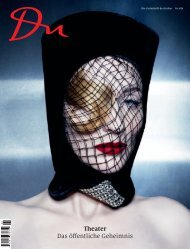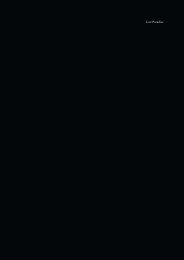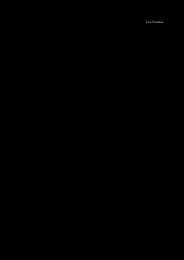Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Spielzeitheft 2010/11 - Armin Kerber
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ich fragen. Jemand anderes starrt auf die leere Bühne,<br />
versucht mich wohl zu überhören, was durchaus<br />
nicht gelingt. – Da spricht und kommentiert unaufhörlich<br />
diese Stimme aus dem Off. Ja, genau!<br />
Das bin ja ich!<br />
Nun tritt ein Schauspieler auf. Er stutzt. Wieso<br />
denn bloss? Hat er seinen Text vergessen? Verschlägt<br />
es ihm schlichtweg die Sprache, weil ich nicht verstumme?<br />
Wer spricht denn hier eigentlich? Der Schauspieler<br />
sieht ins Publikum, so als ob er nicht ratlos<br />
und gänzlich überfordert wäre. Professionell.<br />
Er versucht im Dunkeln den Techniker zu sehen, aber<br />
dieser sitzt mit offenem Mund vor seinem Mischpult,<br />
welches ihm nicht mehr zu gehorchen scheint.<br />
Der Schauspieler geht nach einer Zeit irritiert ab.<br />
Nanu? Ist er nicht gesprächsbereit? Ist er etwa zu<br />
lahm sich dieser Herausforderung zu stellen? Es ist ja<br />
nicht so, dass ich mir gerne selber beim Sprechen<br />
zuhöre, nein, aber da draussen scheint niemand befähigt,<br />
mir tapfer entgegenzutreten.<br />
Ja, schauen Sie mal an, jetzt erhebt sich doch<br />
tatsächlich jemand aus dem Publikum und verlässt<br />
mit strenger Miene den Raum. Schon folgt ihm<br />
ein anderer. Sollte ich betroffen sein? Ein regelrechter<br />
Exodus sitzt ein. Sind Sie denn nicht bereit, etwas<br />
Kunst einzustecken? Das schliesst doch die Unterhaltung<br />
nicht aus. Oder haben Sie sich nur hierher<br />
bemüht, um mir zu zeigen, dass Sie mir nicht zuhören<br />
mögen? Das glaube ich nicht. Dazu ist Ihnen Ihre<br />
Zeit zu wertvoll. – Aber nein! Von einer Publikumsbeschimpfung<br />
kann doch keine Rede sein.<br />
Nach und nach leert sich der Raum. – Nur einer<br />
bleibt. Ja, wer ist es denn? Ach, der Kritiker. Er sieht<br />
verärgert aus. Oh, nein! Das gibt sicherlich einen<br />
satten Verriss! Ich muss ihn hier behalten, zumindest<br />
bis Redaktionsschluss. Der Kritiker muss einmal<br />
darüber schlafen und sein Verriss wird sich in ein Lob<br />
wandeln, zu einem Lob auf meinen Mut, meinen<br />
Mut zum radikalen Experiment. Bitte, schauen Sie<br />
etwas aufgeschlossener, auch wenn Sie glauben schon<br />
alles gesehen zu haben, Sie Abgeklärtheitskonstrukt.<br />
Die Strenge in Ihrem Gesicht steigert nicht Ihre<br />
Intelligenz. Da können Sie sich sicher sein. Nein,<br />
entschuldigen Sie. Despektierlich will ich doch nicht<br />
sein. Aber ich revolutioniere hier das Theater.<br />
Das Off-Sprechtheater, um genau zu sein. Wenn Sie<br />
ehrlich sind, mögen Sie doch meine Visage überhaupt<br />
nicht, seien Sie nur froh, allein meine Stimme ertragen<br />
zu müssen. Bitte, schauen Sie jetzt doch<br />
etwas freundlicher, ja, was ist es denn, was ich hier<br />
abziehe? Eben. Ich darf doch bitten.<br />
Also, bitte schön, es ist nun drei Uhr morgens und<br />
ich brauche ein Glas Wasser und Sie, Sie können<br />
gehen. Ich habe fertig. Ja, dieser Monolog könnte ewig<br />
weiter gehen. Mein Problem ist, ich nehme keine<br />
Erschöpfung an mir wahr. Und dieser Umstand<br />
beginnt mich zu langweilen. Ich scheine eine unerschöpfliche<br />
Stimme zu sein. Aber wissen Sie,<br />
gerade darum kann das Guiness-Buch der Rekorde<br />
keine Herausforderung für mich werden. Ich ziehe<br />
lieber weiter, will aus dem Off der Welt sprechen!<br />
Zu allen Menschen! Zu jeder Zeit! Gott bewahre,<br />
denken Sie. Man wird sehen, ob er dazu im Stande ist!<br />
Mehr ist nicht zu sagen. – Ja, das war’s. – Woher sollte<br />
ich wissen, wer für das hier verantwortlich ist?<br />
Sie schreien hier doch nicht im Ernst eine Stimme aus<br />
dem Off an? Peinlichst. Sie sind ganz allein im Raum.<br />
Bitte, bewahren Sie Haltung. Das ist doch nur ein<br />
Theater, Sie müssen sich doch Ihre Haare nicht gleich<br />
büschelweise ausreissen. – Aber dennoch, nichts<br />
zu danken. Die Bühne gehört jetzt Ihnen, Sie machen<br />
das Stück schon! Brechen Sie aus! – Und ich? Ich<br />
sprach nur, um gesprochen zu haben. Umso schöner<br />
die Stille danach.<br />
Einmal alles, bitte<br />
Wie die Digitalisierung den Zeitbegriff<br />
auf die Probe stellt. Und warum das Theater<br />
auch das Museale wagen sollte.<br />
von Tobi Müller<br />
Der Kulturbetrieb kann nicht mehr scharf zwischen<br />
neu und alt unterscheiden. Ich lese gerade einen<br />
dicken, erfolgreichen Roman über das Ende der DDR<br />
zu Ende, der formal ins späte 19. Jahrhundert<br />
zurückreicht. Dazu höre ich elektronische Popmusik,<br />
welche die Angst der dunklen Achtzigerjahre<br />
beschwört. Und heute Abend werde ich in ein Tanztheater<br />
eines belgischen Choreographen gehen,<br />
der seit zwanzig Jahren die Darstellung von Ausgegrenzten<br />
mit hohem musikalischen Pathos paart.<br />
Uwe Tellkamps Bestseller „Der Turm“ mag man<br />
klassizistisch nennen, die Musik von Zola Jesus und<br />
Fever Ray wird auch mit „Gothic“ angeschrieben –<br />
man denkt an Kutten und mittelalterliche Kirchen.<br />
Und selbst die Inszenierungen von Alain Platel<br />
gehören zur Avantgarde von gestern. Diese guten<br />
und in der Gegenwart gemachten Kunstwerke<br />
werden allesamt in ein Fach gesteckt, auf dem Geschichte<br />
steht.<br />
Weil die kapitalistische Verwertungslogik, besonders<br />
jene der Medien, am Fetisch des Neuen festhalten<br />
muss, sucht man Hilfe bei der Vorsilbe Neo.<br />
Neo-Klassizismus, Neo-Gothic, Neo-Avantgarde.<br />
Selbst die Popmusik, die dem bürgerlichen Kulturbetrieb<br />
am weitesten entfernte Sparte, hat einen<br />
Begriff für die Wiederkehr des Alten gefunden. Im<br />
Pop spricht man von Retro, was die Nähe zu Design<br />
und Mode offenbart. Retro-Look, Retro-Brillen,<br />
Retro-Grafik. Und Retro-Rock. Lustigerweise bedeutet<br />
Retro nicht alt, sondern neu. Neu, das auf alt<br />
macht. Es geht um eine sichtbare Simulation. Wer das<br />
nicht will und an der Aura des Alten festhalten<br />
möchte, kauft sich eine Vintage-Brille. Das ist neudeutsch<br />
für antiquarisch oder antik.<br />
Diese vielen Beschriftungen, die Vergangenes in der<br />
Gegenwart anzeigen, erscheinen vielleicht hilflos.<br />
Doch sie haben auch ihr Gutes. Denn täuscht<br />
der Eindruck, dass mit der Zunahme der Geschichtsverweise<br />
gleichzeitig der plumpe Fortschrittsglaube<br />
abgenommen hat? Wer traut sich noch, einen<br />
Maler progressiv oder eine Einspielung zukunftsweisend<br />
zu nennen? Die Begriffslosigkeit, was Zeit,<br />
Stil und Geschichte betrifft, führt auch zu weniger<br />
Kunst, die sich in Posen des Neuen wirft und<br />
darin genügt. Was sollte das auch sein, das Neo-Neue?<br />
Schuld sind natürlich D & G: Digitalisierung<br />
und Globalisierung. Die Archive wachsen sekündlich.<br />
Wir machen virtuelle Touren durch Städte, Museen,<br />
Bibliotheken. Und niemand wartet mehr wochenlang<br />
auf teure Pakete mit Vinylplatten aus Übersee.<br />
Kein falsches Hohelied auf die Grenzenlosigkeit<br />
des Netzes und den freien Zugang für alle, bitte: Auch<br />
das Netz ist ein Herrschaftsraum, wird es immer<br />
mehr. Aber der Unterschied ist dennoch epochal.<br />
Auch für die Künste. Noch nie konnten so viele Menschen<br />
auf so viele Kunstwerke zugreifen wie heute.<br />
Wenn Lesegeräte wie Kindle oder iPad erschwinglich<br />
und besser werden, wenn die Buchbranche die<br />
Preise für das digitale Produkt endlich senkt, dann<br />
wird die Verbreitung von Büchern enorm zunehmen.<br />
Das wird nicht ohne Folge für die Texte selbst bleiben.<br />
Die Musik hat die ersten zehn Jahre dieses<br />
Wandels bereits hinter sich. Es ist kein grosses Problem,<br />
zum Beispiel über afrikanische Musiken<br />
Bescheid zu wissen. Die digitalen Vertriebskanäle<br />
führten aber auch zu einer erhöhten Präsenz von<br />
Musik in allen Bereichen. Auch privat: Man hat heute<br />
nicht mehr zwanzig oder hundert Alben zu Hause<br />
im Plattenregal, sondern dreitausend auf dem<br />
Rechner. Wenn Sie iTunes benutzen und der Genius-<br />
Funktion Zugriff erlauben, weiss Apple sogar<br />
genau, was Sie „privat“ so hören. Doch selbst das ist<br />
schon Geschichte, weil der Trend zum Streamen geht,<br />
nicht zum Besitzen von Musikdateien. Jedes Mal,<br />
wenn man etwas Bestimmtes hören möchte, greift<br />
man auf das Internet zu. Das heisst am Ende:<br />
Jeder hat die grösste Plattensammlung der Welt.<br />
Einmal alles, bitte.<br />
Am Theater ist die Globalisierung vielleicht nicht<br />
vorbeigezogen – der finanzielle Zwang zu Koprodutionen<br />
und die Austauschbarkeit der Festivals<br />
zeugen deutlich von ihrem Einfluss. Aber die Digitalisierung<br />
musste das Theater bisher nicht interessieren.<br />
Einige Erfolgsstücke, etwa von Patrick Marber<br />
oder Igor Bauersima, hatten zwar ein bisschen<br />
Internet in ihren Themen drin, aber das Wesen von<br />
Theater wurde davon nicht berührt. Man hat viel über<br />
neue Spielweisen geschrieben, auch ging die Rede<br />
von neuen Dramaturgien, neuen Stoffen und neuen<br />
Stücken, aber der Rahmen, auf den sich Theater<br />
bezieht, bleibt relativ stabil.<br />
Denn das Theater kann man weder downloaden<br />
noch speichern, es fehlt an audiovisuellen Archiven.<br />
Man muss eine Karte kaufen, anstehen und im Saal<br />
gleich nochmal warten. Und selbst legendäre Inszenierungen,<br />
noch bis in die Siebzigerjahre, gibt es nicht<br />
als Film- oder Videoaufzeichnungen. Das begrenzt den<br />
theaterhistorischen Horizont eines Theatergängers<br />
in der Regel auf seine eigene Seh-Biografie. So<br />
bleibt der Kanon – was man spielt, wie man es spielt –<br />
einigermassen übersichtlich.<br />
Viele Theaterschaffende haben einen Schimmer in<br />
den Augen, wenn sie sagen, dass die Bühnenkunst<br />
halt aus der Zeit gefallen sei. Man sagt gerne auch: so<br />
wunderbar aus der Zeit gefallen, und meint damit<br />
den scheinbaren Anachronismus des Live-Erlebnisses<br />
sowie die Traditionspflege. Beide Momente gehören<br />
dem Theater aber längst nicht mehr exklusiv.<br />
Lesungen bersten vor Publikum, die Musikbranche<br />
versucht sich mit überteuerten Konzerten zu retten,<br />
Fanmeilen durchziehen die Innenstädte, noch<br />
nicht einmal die Street Parade ist tot. Und den hysterischen<br />
Ruf nach Geschichte hört man auch in<br />
jeder Kunstsparte.<br />
Und doch stimmt es, Theater ist einzigartig.<br />
Nicht weil es live gespielt wird oder auch mit alten<br />
Texten arbeitet, sondern weil es immer wieder neu<br />
beginnen muss. Jedes Stück muss jedes Mal von<br />
Grund auf neu interpretiert werden, keine Inszenierung<br />
kann sich zu sehr auf eine andere, frühere,<br />
beziehen. Genau deswegen ist Theater nicht museal,<br />
auch wenn viele Theaterverächter gerne so urteilen.<br />
Millionen von Menschen sehen sich jedes Jahr<br />
die Bilder von Caravaggio oder von den Impressionisten<br />
an. Aber keiner weiss, wie Shakespeare<br />
wirklich inszeniert hat. Und nur ein paar Spezialisten<br />
haben eine genaue Vorstellung davon, wie Max<br />
Reinhardt mit einer modernen Bühnentechnik das<br />
Schauspiel ins 20. Jahrhundert hineindrehte.<br />
Seit zweieinhalbtausend Jahren herrscht im Theater<br />
eine relative Geschichtslosigkeit.<br />
Peter Stein hat als einer der wenigen die Geister<br />
der Vergangenheit ein paar Mal tatsächlich geweckt.<br />
Zur Eröffnung der Schaubühne 1970 in Berlin<br />
setzte er Brechts „Die Mutter“ auf den Spielplan.<br />
Die Hauptrolle spielte Therese Giehse, die mit Brecht<br />
bereits vor der Machtergreifung der Nazis in<br />
Berlin zusammengearbeitet hatte, dann in Zürich<br />
im Schauspielhaus und für zwei Jahre auch im Ost-<br />
Berlin der frühen DDR. Steins „Mutter“ war eine<br />
Gründungsgeste, eine Verbeugung vor der Geschichte.<br />
Aber noch keine Rekonstruktion wie Tschechows<br />
„Drei Schwestern“: Stein und sein Team studierten<br />
1984 die Regiebücher des Regisseurs Stanislawski und<br />
seiner Uraufführung im Moskauer Künstlertheater<br />
von 1901. Es wurde einer der grössten Erfolge der<br />
Schaubühne (wobei die meisten Zuschauer den musealen<br />
Charakter der Inszenierung nicht bemerkten).<br />
Warum hat das Sprechtheater so grosse Mühe,<br />
einzelne Arbeiten museal auszustellen oder zu rekonstruieren?<br />
Die Oper macht manchmal Ausnahmen,<br />
vor einigen Jahren sah ich im ehemaligen Ost-Berlin