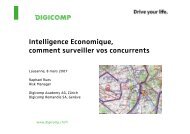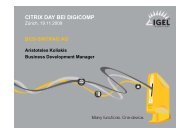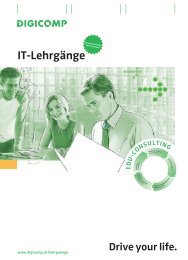Visual Facilitating – Digicomp _1_x
Visual Facilitating – Digicomp _1_x
Visual Facilitating – Digicomp _1_x
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Visual</strong> <strong>Facilitating</strong> <strong>–</strong> Wie wir Komplexität ins Bild setzen können /<br />
Daniel Osterwalder, visualdynamics<br />
<strong>Visual</strong> <strong>Facilitating</strong> verweist auf zwei Dinge: Auf das <strong>Visual</strong>isieren und auf <strong>Facilitating</strong>,<br />
worunter wir das Erleichtern und Ermöglichen verstehen. Zusammengenommen<br />
bedeutet es, dass wir mit Hilfe von Bildern ein vertieftes oder neues Verständnis in<br />
ein komplexes Thema erleichtern oder möglich machen wollen. Mit Bildern können<br />
wir somit komplexe Themen nicht einfach nur mit ästhetischen Mitteln neu und<br />
anders gestalten, mit Bildern und dem visuellen Denken und Tun verdichten und<br />
vereinfachen wir komplexe Themen und eröffnen so einen neuen Zugang zu<br />
unserem Thema. Und schliesslich ist visuelles Denken ein ausgesprochen effektiver<br />
Problemlösungsansatz, denn Bilder können grosse Mengen an Informationen<br />
zusammenfassen und so etwas Neues verdeutlichen.<br />
Eine Gefahr besteht natürlich darin, dass wir in einer Welt leben, in der die Bilder-<br />
und Informationsflut exorbitant wächst. Und nun kommen wir mit <strong>Visual</strong>isieren und<br />
<strong>Visual</strong> <strong>Facilitating</strong> und legen gleich noch ein Brikett in den hochrot glühenden Ofen<br />
und vervielfachen die Bilderflut noch? Das wäre natürlich am Ziel vorbeigeschossen.<br />
Damit wir mit Bildern und <strong>Visual</strong>isierungen also nicht noch mehr Verwirrung stiften<br />
wollen, müssen wir zuerst einmal verstehen, was wir uns unter <strong>Visual</strong>isieren<br />
vorstellen müssen.<br />
„Wer schnellen und bleibenden Eindruck machen will, bedient sich<br />
der Bilder“ (Otto Neurath) <strong>–</strong> ein kleiner historischer Abriss<br />
Otto Neurath, der Wiener Sozialwissenschaftler, der in der ersten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts im bekannten Wiener Kreis mittat, sprach im Zusammenhang mit einer<br />
zu entwickelnden Bildersprache oder Bilderschrift davon, dass diese mit<br />
sprechenden und einfachen Signaturen zu versehen sei, also weniger Konventionen<br />
bedürfen, um verstanden zu werden. Ein Bauer wird demnach mit einer Sichel<br />
dargestellt, ein Bergarbeiter mit einem Hammer. Grösste Bedeutung kommt somit<br />
einer einfachen Darstellung zu. Sinnvolles <strong>Visual</strong>isieren ist damit also Reduktion und<br />
Einfachheit. In den Worten Neuraths: „Der Kopf als Kreisscheibe verlangt einen<br />
1
wesentlich vereinfachten Körper als Fortsetzung. Es kommen überhaupt nur sehr<br />
vereinfachte Bilder in Betracht.“<br />
Mit dem deutschen Grafiker Gerd Arntz entwickelte Neurath ab 1927 aus der „Wiener<br />
Methode der Bildstatistik“ [ die „International Picture Language“ bzw. das<br />
Bildersprachen-System ISOTYPE = International System of Typographic Picture<br />
Education Isotype (siehe Abbildung).<br />
Abbildung 1: Beispiel aus Isotype<br />
Neurath war der Meinung, dass wir mit diesen visuellen Codierungen komplexe<br />
Sachverhalte allen Volksgruppen verständlich machen könnten und dass damit das<br />
Verständnis für komplexe Zusammenhänge zunehmend gefördert werden könnte.<br />
Betrachten wir die einzelnen Elemente, so können wir uns unschwer vorstellen, dass<br />
Isotype auch vielen Programmierern nicht unbekannt war und ist, finden wir doch in<br />
den sogenannten Bibliotheken verschiedener Applikationen recht ähnliche Symbole<br />
und Icons.<br />
Kleiner Spaziergang durch die Geschichte<br />
Viel wichtiger an den Arbeiten Neuraths et al. war aber, dass damit das Bild wieder<br />
Aufnahme fand im öffentlichen Diskurs, auch als Mittel, um vertiefte Erkenntnisse in<br />
komplexe Sachverhalte zu entwickeln. Im 17. bis 19. Jahrhundert war dem nicht so.<br />
Werfen wir deshalb den Blick historisch etwas weiter zurück. Uns allen sind die<br />
figurativen Darstellungen der Ägypter, Azteken und Mayas bekannt, wenn sich diese<br />
auch nicht so einfach erschliessen. en. Mit den Libri Carolingi (895 unserer<br />
Zeitrechnung) begann dann ein eigentlicher Kreuzzug gegen das Bild, heisst es dort<br />
doch, „was den Lesekundigen die Schrift, das bedeutet Idioten das Bild.“ Im Zuge der<br />
Reformation und dem Bildersturm und der Forcierung der Schriftkultur als Werkzeug<br />
der Erkenntnisgewinnung während der Aufklärung (so beispielsweise der Philosoph<br />
I. Kant, der sich vehement gegen Bilder als Mittel zur Verständigung stellte) erfolgte<br />
eine eigentliche Zäsur gegen das Bild. Erst um 1900, im Zusammenhang mit dem<br />
Umbruch der Kommunikationskultur und ersten medientechnischen Innovationen<br />
2
fand und findet das Bild (neben Ton, Foto, Film) wieder vermehrten Einsatz in der<br />
Kommunikation; zuerst im Unterrichtswesen, dann mehr und mehr auch im<br />
Zusammenhang mit wissenschaftlichen und technischen Publikationen. Denn Bilder<br />
(wie auch Fotos, Ton, Film) haben der Schrift und der Sprache eines vorweg: Sie<br />
schaffen eine Direktheit der Erfahrung, was die Sprache und die Schrift nicht<br />
schaffen kann, denn Bilder sprechen die Sinne viel intensiver an als ein Wort.<br />
Deshalb auch Neuraths Diktum: „Vereinfachte Mengenbilder sich merken ist besser<br />
als genaue Zahlen vergessen.“ Für Neurath bedeutete die Arbeit mit Bildern und<br />
seine Entwicklungen mit Isotype auch ein Beitrag zur Demokratisierung von Wissen.<br />
Bilder und Symbole sollen es als neue Denkwerkzeuge für den Alltag allen<br />
ermöglichen, vertiefte Erkenntnisse gewinnen zu können, den „der gewöhnliche<br />
Bürger sollte in der Lage sein, uneingeschränkt Informationen zu erhalten.“<br />
<strong>Visual</strong>isieren ist sehen (hören),<br />
vorstellen, verstehen und<br />
zeigen<br />
Damit ist ein klarer Auftrag ans Bild<br />
und ans <strong>Visual</strong>isieren verbunden.<br />
Nicht einfach zeichnen, sondern Wege<br />
eröffnen zu neuer<br />
Erkenntnisgewinnung. Das bedeutet,<br />
dass wir <strong>Visual</strong>isieren etwas weiter<br />
fassen müssen, nämlich als sehen<br />
(hören), vorstellen, verstehen und<br />
zeigen (oder zeichnen).<br />
Beginnen wir nun mit dem Zeichnen Abbildung 2: Zeichnen - das Pferd falsch aufgezäumt<br />
oder <strong>Visual</strong>isieren, dann beginnen wir<br />
mit dem Zeigen oder Präsentieren, zäumen das Pferd von hinten auf und setzen uns<br />
dementsprechend auch mit dem Rücken zum Wind aufs Pferd, was leider dazu führt,<br />
dass wir nicht sehen, wohin die Reise<br />
geht. Wenn wir uns beim <strong>Visual</strong>isieren<br />
einfach dem Zeigen / Zeichnen widmen,<br />
so macht es letztlich nur einen<br />
ästhetischen Unterschied, ob wir schön<br />
zeichnen oder klassisch eine<br />
Präsentationssoftware wie Powerpoint,<br />
Keynote oder Prezi einsetzen. Um zu<br />
verstehen, wohin die Reise beim<br />
<strong>Visual</strong>isieren gehen soll, lohnt es sich<br />
deshalb, uns einen Moment lang beim<br />
Sehen (Hören), Betrachten, Vorstellen und<br />
Verstehen aufzuhalten.<br />
Was sehen Sie?<br />
Der Psychologe Benesch untersuchte mit<br />
Hilfe dieses Bildes, auf welche Weise sich<br />
das Sehen zwischen Erwachsenen und<br />
Kindern unterscheidet. Die Hypothese:<br />
Sehen und Wahrnehmen ist abhängig<br />
Abbildung 3: Sandro Del Prete - Liebespaar?<br />
3
oder besser: Eingebettet in unseren sozialen Kontext. 90 % der Erwachsenen, denen<br />
das Bild gezeigt wurde, sahen ein Liebespaar. Nur wenige sahen direkt etwas<br />
anderes. Als Die Forschungsgruppe um Benesch das Bild Kindern zwischen vier und<br />
acht Jahren zeigte, entdeckten die Kinder <strong>–</strong> Fische.<br />
Sehen Sie selbst <strong>–</strong> was haben Sie zuerst entdeckt?<br />
Was bedeutet das für das <strong>Visual</strong>isieren? Beim <strong>Visual</strong>isieren geht es im<br />
Zusammenhang mit dem Sehen nicht um die Frage, was wir sehen, sondern wie wir<br />
sehen. Bleiben wir bei der Frage „Was sehen Sie?“, dann verstehen wir sehen als<br />
Abbildung. Stellen wir aber die Frage nach dem Wie, dann verstehen wir Sehen als<br />
Konstruktionsprozess. In diesem Fall wird das <strong>Visual</strong>isieren ein Austauschprozess,<br />
d.h. wer beispielsweise in einem Workshop für eine Gruppe visualisiert, hört zu, um<br />
die Sprache und Sprachbilder der Gruppe zu verstehen, um dann das Gesagte auf<br />
den Kern zu reduzieren und um aus dem Gesagten die entsprechende Bildsprache<br />
abzuleiten. Neurath schrieb dazu: „Wer am geschicktesten weglassen kann, ist der<br />
beste Lehrer. Die Transformation bestimmter Ideen in klare Skizzen auf der<br />
Grundlage des ausgewählten Materials (Kern) ist der zweite schwierige Schritt. Alles<br />
muss auf seinen eigentlichen Kern reduziert werden.“<br />
Instrumente visuellen Denkens<br />
Kehren wir noch einmal zurück zum Zeigen: Setzen wir uns für das Zeigen vor den<br />
Computer und öffnen die entsprechende Zeige-Software (wie Powerpoint, Keynote,<br />
Prezi), so macht sich hier der Unterschied bemerkbar zum Skizzieren und Zeichnen<br />
von Hand. Während mein Blick vor dem Computer bereits beim Sehen in einen<br />
Tunnel gezwängt wird, öffnet sich mir beim Skizzieren und Zeichnen von Hand das<br />
Sehfeld. Dieses ist nicht begrenzt, hat keine Einschränkung und dementsprechend<br />
bleibt Raum für das Sehen und die Vorstellung und schliesslich für die Verbindung<br />
zwischen sehen und zeichnen. Die Basis für das visuelle Denken hat nichts mit dem<br />
Erstellen von Grafiken am Computer zu tun. „Visuelles Denken heisst, mit den Augen<br />
denken zu lernen, und dazu braucht man überhaupt keine fortschrittliche<br />
Technologie.“ (Roam, 33) Die Instrumente visuellen Denkens sind unsere Augen,<br />
unsere Vorstellungskraft, unser Gehör und unsere Hände. Zu <strong>Visual</strong>isieren bedeutet<br />
deshalb Sehen, vorstellen, zuhören / verstehen und zeigen (zeichnen). Wir brauchen<br />
dazu nur das Vertrauen in unsere Instrumente und ein wenig Übung. Roam versteht<br />
visuelles Denken als vierstufigen Prozess:<br />
- sehen und die ganze Vielfalt in den Blick nehmen<br />
- betrachten (verstehen) und eine Auswahl treffen; wir erkennen beispielsweise<br />
Muster, Unterscheidungen und kategorisieren<br />
- vorstellen (wie bestimmte Elemente und Dinge miteinander in Verbindung<br />
stehen); z.B. Analogien und Vergleiche bilden, ein verborgenes System<br />
entdecken, das Gesehene in der Vorstellung manipulieren, auf den Kopf<br />
stellen, von der Seite sehen etc.<br />
- zeigen und präsentieren (oder eben zeichnen); dabei die Bilder und Ideen<br />
nach Prioritäten sortieren, überlegen, was in den Vordergrund gehoben<br />
werden muss und vielleicht auch eine visuelle Pointe finden.<br />
Betrachten: Die Kunst auszuwählen<br />
Auswählen und betrachten bedeutet zu reduzieren. Als Spezialisten eines Themas<br />
neigen wir dazu, sehr viel als wichtig zu erachten, damit man unser Thema versteht.<br />
Viel wichtiger ist es jedoch, aus der Informationsflut eine geeignete Auswahl zu<br />
treffen. Dies bewerkstelligen wir mit einem einfachen Fragenkatalog. Wir erstellen ein<br />
Koordinatensystem mit den Fragen:<br />
4
- wer / was: alle Herausforderungen in Bezug auf Dinge, Menschen und Rollen<br />
o Wer gehört dazu? Wer führt das Projekt? Wo liegt die Verantwortung<br />
etc.?<br />
- wie viel: Fragestellungen im Zusammenhang mit Messen und Zählen<br />
o Haben wir genügend Ressourcen, um damit unser Projekt zu Ende zu<br />
führen?<br />
o Wie viel werden wir davon noch brauchen, um weitermachen zu<br />
können?<br />
- Wo: Richtung und Zugehörigkeit<br />
o Wohin führt das Projekt? Wohin zielen wir? Wie passen die Teile<br />
zusammen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig?<br />
- Wann: Planung und Zeitablauf, Zeitdimension<br />
o Was kommt zuerst, was danach? Wann soll was erledigt sein?<br />
- Wie: Beeinflussungen<br />
o Was passiert, wenn wir hier nachgeben? Können wir Ergebnisse<br />
ändern, wenn wir unser Handeln verändern?<br />
- Warum: Erkennen des „ganzen Elefanten“<br />
o Was tun wir da und warum eigentlich? Wenn es Veränderungen<br />
braucht, welchen Optionen haben wir?<br />
Mit Hilfe dieser Fragen können wir aus der Fülle an Informationen eine Auswahl<br />
treffen. In einem weiteren Auswahlschritt geht es dann darum, wem wir das zeigen<br />
wollen, denn je nach Publikum müssen wir die Auswahl anders treffen. Und damit<br />
gelangen wir zur Vorstellung.<br />
Vorstellung oder was will ich eigentlich vermitteln<br />
Dan Roam hat eine sehr einsichtige Gegenüberstellung entwickelt, wie wir uns das<br />
Thema, das wir vermitteln wollen auch vorstellen können; er tut dies anhand<br />
einfacher Gegensätze:<br />
- Soll es simpel sein (z.B. ein einzelner Baum) oder ausführlich (Wald)?<br />
- Soll es Qualität abbilden oder Quantität?<br />
- Geht es um die Vision oder um die Durchführung und Umsetzung?<br />
- Stehen individuelle Merkmale im Vordergrund oder Vergleiche?<br />
- Geht es beim Thema um Wandel oder um den Status quo?<br />
Mit Hilfe dieser einfachen Gegensätze spielen wir unser Thema in unserer<br />
Vorstellung durch, bevor wir mit Zeichnen beginnen.<br />
Zeichnen: Grammatik und Vokabeln büffeln?<br />
Wir können eine Fremdsprache dadurch lernen <strong>–</strong> und wer kennt das nicht -, dass wir<br />
Vokabeln büffeln, grammatische Strukturen auswendig lernen und haufenweise<br />
Papier vollschreiben mit uns oft nicht sehr verständlichen Sätzen. Dieser Ansatz geht<br />
davon aus, dass wir uns aus dem Anhäufen “toter” Elemente (Vokabeln) schon<br />
irgendwie verständlich machen können. Die Fremdsprache bleibt aber<br />
Fremdsprache. Ein anderer Ansatz zum Erlernen einer uns ungewohnten Sprache ist<br />
die Immersion, d.h. das Eintauchen in die neue Sprache. Dieser Ansatz des<br />
Erlernens einer Sprache baut darauf auf, dass dies deshalb erfolgsversprechender<br />
ist, weil er auf den Prinzipien des Erwerbs der Muttersprache beruht. D.h. wir<br />
verlassen uns beim auf unsere einfachen Zeichnungen, wie sie uns von der Hand<br />
gehen. Keine komplexen Kunstwerke, sondern mit wenigen Strichen, vielleicht<br />
einigen geometrischen Grundformen (Kreis, Dreieck, Quadrat), etwas Farbe und<br />
Schatten visualisieren wir das, was wir mittels Betrachtung und Vorstellung<br />
ausgewählt und reduziert haben. Die Formen, wie wir zeichnen und visualisieren<br />
5
können, sind sehr vielfältig. Wichtig ist dabei nur, dass man für sich ein eigenes<br />
System entwickelt, mit dem man das, was man sich vorstellen kann, auch zeichnen<br />
kann, damit unser Publikum oder unsere internen / externen Kunden dies verstehen<br />
können.<br />
Zur Wahl des Bildes oder des Layouts bietet Roam sechs verschiedene Layouts an:<br />
- Wer Thema -> Porträt oder Landkarte / Map des Themas<br />
- Wie viel -> Tabellen, Kuchen, andere bekannte Symbole und Darstellungen<br />
aus der Statistik<br />
- Wo -> Karte, Landkarte, auf der die räumliche Position gezeigt werden kann.<br />
- Wann -> Zeitstrahl, Ablauf, Weg (von unten links nach rechts oben, 1 Drittel)<br />
- Wie -> Ablaufdiagramm, Pfeile und andere Formen, eine Ablauf zu zeichnen<br />
- Warum -> Schaubild<br />
An dieser Stelle lohnt es sich natürlich, sich zuerst einmal eine Skizze des zu<br />
<strong>Visual</strong>isierenden zu entwickeln. Mit Hilfe weniger Striche können wir eine Karte<br />
zeichnen, ein Porträt des Themas bis hin zum komplexen Schaubild. Wenn wir dann<br />
noch einige Figuren einbauen, erhält die <strong>Visual</strong>isierung rasch Leben.<br />
Abbildung 4: Bildergeschichte für die Einführung einer komplexten Internetapplikation<br />
6
Literatur<br />
Frank Hartmann, Erwin K. Bauer: Bildersprache Otto Neurath. <strong>Visual</strong>isierungen, 2.<br />
erw. Auflage, Wien 2006<br />
Robert E. Horn: <strong>Visual</strong> Language. Global Communication fort he 21 st Century,<br />
Portland 1998<br />
Christian Leborg: <strong>Visual</strong> Grammar, New York 2006<br />
Nancy Margulies: Mapping Inner Space. Learning and Teaching <strong>Visual</strong> Mapping,<br />
Wales 2002<br />
Dan Roam: Auf der Serviette erklärt. Probleme lösen und Ideen verkaufen mit Hilfe<br />
von Bildern, München 2009<br />
David Sibbet: <strong>Visual</strong> Meetings. How Graphics, Sticky Notes & Idea Mapping Can<br />
Transform Group Productivity, New Jersey 2010<br />
7