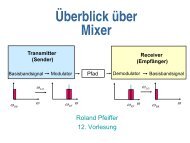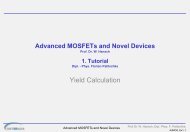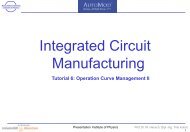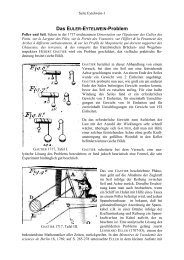Grundzüge der Wirtschaftspolitik
Grundzüge der Wirtschaftspolitik
Grundzüge der Wirtschaftspolitik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Professur für Volkswirtschaftslehre<br />
insbeson<strong>der</strong>e Mikroökonomie und Wettbewerbspolitik<br />
Professurvertreter PD Dr. Karl Morasch<br />
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
Volkswirtschaftslehre<br />
4. Trimester<br />
Skript<br />
(Teil II - zu Kapitel 3)<br />
Herbsttrimester 2002<br />
PD Dr. Karl Morasch
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
3 Zielbildung als Problem <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> 55<br />
3.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Zielbildung 55<br />
3.1.1 Werturteilsproblematik 55<br />
3.1.1.1 Bewertungen als Voraussetzung <strong>der</strong> Wissenschaft 56<br />
3.1.1.2 Bewertungen als Erkenntnisobjekt <strong>der</strong> Wissenschaft 56<br />
3.1.1.3 Bewertungen als Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens 57<br />
3.1.2 Rationale <strong>Wirtschaftspolitik</strong> 58<br />
3.1.2.1 Ziele und Zielbeziehungen 58<br />
3.1.2.2 Analyse und Prognose 58<br />
3.1.2.3 Optimierung des Mitteleinsatzes 59<br />
3.1.2.4 Durchsetzung wirtschaftspolitischer Entscheidungen 59<br />
3.1.3 Formal und Modalziele <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> 60<br />
3.1.3.1 Finalziele 60<br />
3.1.3.2 Modalziele 67<br />
3.1.4 Zielbeziehungen, Klassifikation von Zielen und<br />
Operationalisierbarkeit 68<br />
3.1.4.1 Zielbeziehungen 68<br />
3.1.4.2 Klassifikation von Zielen 69<br />
3.1.4.3 Operationalisierung von Zielen 70<br />
3.2 Kollektive Zielvorstellungen: Pareto-Kriterium vs. Soziale<br />
Wohlfahrtsfunktion 71<br />
3.2.1 Präferenzaggregation – ein Beispiel 71<br />
3.2.2 Lösungskonzepte für kollektive Entscheidungen 74<br />
3.2.2.1 Lexikographische Ordnung 75<br />
3.2.2.2 Pareto-Kriterium 76<br />
3.2.2.3 Umverteilung zur Erfüllung des Pareto-Kriteriums 78<br />
3.2.2.4 Potentielle Pareto-Verbesserung 78<br />
3.2.2.5 Kollektive Zielfunktion – soziale Wohlfahrtsfunktion 79<br />
3.3 Präferenzaggregation und Unmöglichkeitstheorem 83<br />
3.3.1 Präferenzaggregation durch Wahl: Arrow’s-Wahlparadoxon 84<br />
3.3.2 Wahlparadoxon in <strong>der</strong> Praxis: Abstimmung Berlin vs. Bonn 85<br />
3.3.3 Arrow’s Unmöglichkeitstheorem 87<br />
3.3.4 Konsequenzen des Unmöglichkeitstheorems für die<br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong> 88<br />
- ii- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3 Zielbildung als Problem <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
Die Klarheit über Zielvorstellungen auf gesellschaftlicher Ebene ist eine notwendige<br />
Voraussetzung einer adäquaten <strong>Wirtschaftspolitik</strong>. Nach einigen grundsätzlichen Überlegungen<br />
zur Zielbildung beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit unterschiedlichen<br />
Arten von Formulierungen einer wirtschaftspolitischen Zielfunktion (Orientierung am<br />
Pareto-Kriterium vs. Soziale Wohlfahrtsfunktion) und mit dem Problem <strong>der</strong> Aggregation<br />
individueller Präferenzen zu einer kollektiven Präferenzordnung (z.B. durch Wahlen).<br />
3.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Zielbildung<br />
Unsere Überlegungen zur Zielbildung setzen an am Konzept einer <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre<br />
als Schaffung von Entscheidungshilfen für die praktische <strong>Wirtschaftspolitik</strong>. Der<br />
alternative Ansatz, <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre als Analyse <strong>der</strong> tatsächlich ablaufenden und<br />
beobachtbaren wirtschaftspolitischen Prozesse zu betreiben wird in 4.3 behandelt.<br />
Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre in erster Linie Entscheidungshilfe<br />
für Politiker sein soll. Die Betonung liegt hierbei auf <strong>der</strong> Hilfe, d.h. die<br />
Entscheidungen selbst sind von den Politikern zu treffen. Wo kann wissenschaftliches<br />
Nachdenken über <strong>Wirtschaftspolitik</strong> hilfreich sein? Erinnern wir uns an die Klassifikation<br />
<strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> nach Zielen, Mitteln und Trägern. Es wird kaum Uneinigkeit<br />
darüber bestehen, dass <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre Aufgaben bei <strong>der</strong> Analyse von Mitteln<br />
und Trägern zukommt (genaueres dazu in Kapitel 4). Mehr umstritten ist jedoch, ob<br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre auch zu den Zielen etwas sagen kann – dies führt auf die sogenannte<br />
Werturteilsproblematik.<br />
3.1.1 Werturteilsproblematik<br />
Wenn die systematische Beschäftigung mit <strong>Wirtschaftspolitik</strong> <strong>der</strong> Beratung und Entscheidungshilfe<br />
<strong>der</strong> Träge <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> dienen soll, dann ist auch darüber<br />
nachzudenken, welche Rolle Werturteile <strong>der</strong> Beratenden spielen können. Ausgangspunkt<br />
ist die Frage, ob sich wissenschaftliche Ökonomen auf Sachinformationen<br />
beschränken müssen, o<strong>der</strong> ob sie einen Schritt weitergehen und zu wissenschaftlich<br />
begründbaren Bewertungen des wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Geschehens<br />
kommen können. Zunächst zur Unterscheidung zwischen Sach- und Werturteilen:<br />
Sachurteile sind Erkenntnisse, z.B. über Fakten o<strong>der</strong> Kausalzusammenhänge. Werturteile<br />
sind Entscheidungen, die aufgrund von Präferenzen gefällt werden.<br />
- 55- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Bei <strong>der</strong> Diskussion <strong>der</strong> Werturteilsproblematik ist es sinnvoll drei Typen von Werturteilen<br />
zu unterscheiden: angesiedelt ist. Wir unterscheiden zwischen<br />
• Bewertungen als Voraussetzung <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
• Bewertungen als Erkenntnisobjekt <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
• Bewertungen als Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens<br />
Wie wir im weiteren sehen werden, sind die ersten beiden Typen von Werturteilen unverdächtig.<br />
Wenn von einer Werturteilsproblematik gesprochen wird, dann muss sich<br />
dies, damit überhaupt eine Problematik entsteht, auf den dritten Typ einer Bewertung<br />
beziehen. Wirtschaftswissenschaftler stellen durchaus „was-soll-sein?“-Fragen im Sinne<br />
einer normativen Ökonomik. Sie können aber die dabei verwendete Norm nicht wissenschaftlich<br />
begründen. Nun zu den drei Typen von Werturteilen<br />
3.1.1.1 Bewertungen als Voraussetzung <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
Bewertungen als Voraussetzung <strong>der</strong> wissenschaftlichen Arbeit spielen bereits dann eine<br />
Rolle, wenn wir bewusst o<strong>der</strong> unbewusst aufgrund unserer Interessen und Bewertungen<br />
einen Forschungsgegenstand auswählen. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass unsere<br />
individuellen Wertpositionen de facto die Ergebnisse unseres wissenschaftlichen Arbeitens<br />
beeinflussen und dabei auch verfälschen können. Es ist denkbar, dass wir einem<br />
Wunschdenken unterliegen, dass wir lediglich selektive Wahrnehmung besitzen, und<br />
dass wir von <strong>der</strong> Gruppe, innerhalb <strong>der</strong>er wir uns bewegen, beeinflusst werden. Es wäre<br />
deshalb unrealistisch, eine werturteilsfreie Wissenschaft in dem Sinne zu for<strong>der</strong>n, dass<br />
all diese Effekte bereits auf individueller Ebene ausgeschaltet sein müssten. Statt dessen<br />
verlassen wir uns auf empirische Tests als Selektionsmechanismus und darauf, dass<br />
durch die Beteiligung einer Vielzahl von Wissenschaftlern an <strong>der</strong> wissenschaftlichen<br />
Diskussion <strong>der</strong>artige Werturteile neutralisiert o<strong>der</strong> zumindest reduziert werden.<br />
3.1.1.2 Bewertungen als Erkenntnisobjekt <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
Unstrittig ist sicherlich, dass das Prinzip <strong>der</strong> Werturteilsfreiheit nicht die For<strong>der</strong>ung<br />
beinhalten kann, Wissenschaft dürfe sich nicht mit Werten und Bewertungen als Studiengegenstand<br />
befassen. Gerade in <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre sind ja die Ziele <strong>der</strong><br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong> integraler Bestandteil des Versuches, Entscheidungshilfe für die<br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong>er zu leisten. So versuchen wir, Zielbeziehungen zu ermitteln, die<br />
Kosten von Kompromissen zwischen Zielen zu bestimmen und Wege zur Erreichung<br />
von Zielen aufzuzeigen. All dies hat nichts mit dem Werturteilsproblem und mit einer<br />
Bewertung durch die Wissenschaftlerin zu tun, solange klar ist, dass die zur Diskussion<br />
stehende Bewertung durch die Politiker erfolgt.<br />
- 56- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.1.1.3 Bewertungen als Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens<br />
Den eigentlichen Kern <strong>der</strong> Werturteilsproblematik machen somit jene Bewertungen aus,<br />
die sich - scheinbar - als Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens ergeben. Dabei ist zunächst<br />
einmal zu beachten, dass die Herleitung von normativen Aussagen aus positiven<br />
Aussagen, d.h. von Soll-Sätzen aus Seins-Sätzen, unwissenschaftlich, weil logisch unmöglich,<br />
ist. Man spricht hier vom sogenannten naturalistischen Fehlschluss. Logische<br />
Schlussverfahren bestehen aus bestimmten Prämissen und aus Schlussfolgerungen, die<br />
aus den Prämissen durch Deduktion gewonnen werden. Die Konklusionen können niemals<br />
einen größeren Gehalt haben als die Gesamtheit <strong>der</strong> Prämissen, die ihnen zugrunde<br />
liegen. Wollte man also aus einem Satz von Sachprämissen eine wertende Schlussfolgerung<br />
ziehen, so müsste eine zusätzliche, wertende Prämisse gleichzeitig existieren. Bewertende<br />
Konklusionen setzen auch bewertende Prämissen voraus.<br />
Wir sind uns dieses Umstandes aufgrund sprachlicher Unschärfen häufig nicht bewusst.<br />
So wären vermutlich die meisten unter uns bereit, aus <strong>der</strong> Sachaussage „Kartelle führen<br />
zu einer Verknappung <strong>der</strong> Güterproduktion“ den (wertenden) Schluss zu ziehen, „Kartelle<br />
sind schädlich“. Dabei wird jedoch stillschweigend unterstellt, dass eine Verknappung<br />
<strong>der</strong> Güterproduktion als schädlich zu gelten hat. Es liegt hier also eine bereits vorhandene<br />
und nicht logisch hergeleitete Wertaussage vor, die offengelegt werden sollte.<br />
Ein logisch zulässiger Weg zur Herleitung werten<strong>der</strong> Aussagen in <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaft<br />
und in <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre im beson<strong>der</strong>en könnte demnach darin bestehen,<br />
offengelegte Wertprämissen vorauszusetzen und aus diesen im Zusammenhang<br />
mit weiteren Sachprämissen normative Sätze abzuleiten. Dies tut beispielsweise die traditionelle<br />
Wohlfahrtsökonomik, die mit dem sogenannten Pareto-Kriterium ein ganz<br />
bestimmtes, scheinbar unverdächtiges Werturteil voraussetzt.<br />
Wir wollen aus dieser Diskussion zur Werturteilsproblematik das Fazit ziehen, dass die<br />
For<strong>der</strong>ung nach einer wertfreien Wissenschaft keineswegs dazu führt, dass <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre<br />
keinen Beitrag zur Lösung wirtschaftspolitischer Probleme im Sinne von<br />
Beratung und Entscheidungshilfe leisten kann. Sie kann durchaus wertfrei Politikern bei<br />
ihren Bemühungen um eine rationale <strong>Wirtschaftspolitik</strong> unterstützen. Sollen jedoch<br />
innerhalb <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre selbst Bewertungen vorgenommen, d.h. wertende<br />
Aussagen abgeleitet werden, so hat dies in dem Bewusstsein zu geschehen, dass Wertprämissen<br />
vorausgesetzt sind und eine Offenlegung dieser Wertprämissen angebracht<br />
ist.<br />
- 57- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.1.2 Rationale <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
Die Idee einer <strong>Wirtschaftspolitik</strong>lehre als Entscheidungshilfe bei <strong>der</strong> praktischen <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
ist eng verbunden mit dem Konzept einer „rationalen <strong>Wirtschaftspolitik</strong>“.<br />
Die folgende Charakteristik rationaler <strong>Wirtschaftspolitik</strong> gibt eine komprimierte Zusammenfassung<br />
dieses Ansatzes, wobei auf die vier grundlegenden Anfor<strong>der</strong>ungen (i)<br />
Klarheit über Ziele und Zielbeziehungen, (ii) Situationsanalyse und Prognose, (iii) Optimierung<br />
des Mitteleinsatzes und (iv) Durchsetzung wirtschaftspolitischer Entscheidungen<br />
jeweils kurz eingegangen wird.<br />
3.1.2.1 Ziele und Zielbeziehungen<br />
Aus den Beweggründen wirtschaftspolitischen Handelns wurde bereits deutlich, dass es<br />
sich nicht von selbst versteht, mit welchen konkreten Zielsetzungen, also mit welchen<br />
Vorstellungen über den gewollten Zustand <strong>der</strong> Realität (Soll-Zustand), <strong>der</strong> Staat <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
betreibt. Die Auffassung über die Rangfolge <strong>der</strong> Ziele wird dann bedeutsam,<br />
wenn man sie mit den gegebenen Instrumenten nicht gleichzeitig vollständig erreichen<br />
kann. Zum Beispiel verfolgt die Stabilisierungspolitik die Ziele Vollbeschäftigung<br />
und Preisstabilität, zwischen denen in kurzfristiger Sicht ein Zielkonflikt besteht: Unterstellt<br />
man die Gültigkeit <strong>der</strong> Phillips-Kurve, so erreicht man mehr Preisstabilität auf<br />
Kosten des Beschäftigungsstandes.<br />
Die Träger <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> haben zu entscheiden, welcher Zielsetzung Vorrang<br />
einzuräumen ist. Die Auffassung über die Rangfolge ist Ausdruck einer bestimmten<br />
Werthaltung, die wissenschaftlich nicht zwingend begründet werden kann. Überdies<br />
sind diese Werthaltungen auch Wandlungen unterworfen. Wissenschaftlich können allerdings<br />
Aussagen über das Vorliegen von Zielkonflikten getroffen werden. Am Anfang<br />
rationaler <strong>Wirtschaftspolitik</strong> steht daher eine Entscheidung über die zu verfolgenden<br />
Ziele und ihre Rangfolge, so dass <strong>der</strong> Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente durch<br />
sie gelenkt werden kann. Dabei sollten die Zielwerte möglichst in quantifizierter Form<br />
vorliegen.<br />
3.1.2.2 Analyse und Prognose<br />
Die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger müssten vor <strong>der</strong> Entscheidung genaue<br />
Kenntnisse über die Situation und über die Wirkung unterschiedlicher Instrumente in<br />
dieser Situation haben. In <strong>der</strong> Realität muss jedoch davon ausgegangen werden, dass<br />
Unklarheiten über Auswirkungen eines bestimmten Instrumenteneinsatzes bestehen.<br />
Zwar ist es die eigentliche Aufgabe <strong>der</strong> Volkswirtschaftslehre, solche Zusammenhänge<br />
zu ermitteln. Dies gelingt jedoch nur beschränkt: Die in einem bestimmten Kontext<br />
ermittelten Beziehungen gelten häufig nicht allgemein und können meist auch nicht in<br />
- 58- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
mittelten Beziehungen gelten häufig nicht allgemein und können meist auch nicht in <strong>der</strong><br />
erwünschten Weise quantifiziert werden.<br />
Wirtschaftspolitische Instrumente wirken häufig erst nach einer gewissen Dauer. Dies<br />
bedeutet für die <strong>Wirtschaftspolitik</strong> die Notwendigkeit, die künftige Entwicklung <strong>der</strong><br />
Wirtschaft zu prognostizieren, um ihrer Entscheidung nicht eine irrelevante Auffassung<br />
über <strong>der</strong>en künftigen Zustand zugrunde zu legen und dadurch die Ziele zu verfehlen.<br />
Der Träger <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> wäre z.B. schlecht beraten, einen Zusammenschluss<br />
von Unternehmen mit <strong>der</strong> Begründung, dass durch ihn eine marktbeherrschende Stellung<br />
entstünde, zu verbieten, wenn mit dem Auftauchen neuer Anbieter sicher zu rechnen<br />
wäre.<br />
3.1.2.3 Optimierung des Mitteleinsatzes<br />
Das Entscheidungsproblem <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> besteht darin, bei den zu unterstellenden<br />
Wirkungszusammenhängen und Prognosedaten aus den zur Verfügung stehenden<br />
Instrumenten jene Kombination auszuwählen, bei <strong>der</strong> die Ziele möglichst optimal erreicht<br />
werden. Es handelt sich um ein Entscheidungsproblem, das weitgehende Parallelen<br />
zur Nutzenmaximierung des Haushalts bzw. zur Gewinnmaximierung <strong>der</strong> Umverteilung<br />
in <strong>der</strong> mikroökonomischen Theorie aufweist. Diese Probleme werden in 4.1 und<br />
4.2 im Detail analysiert. Generell kann <strong>der</strong> Mitteleinsatz nur dann optimiert werden,<br />
falls Klarheit über Ziele und Zielbeziehungen herrscht sowie eine gute Situationsanalyse<br />
einschließlich zugehöriger Prognose durchgeführt wurde.<br />
3.1.2.4 Durchsetzung wirtschaftspolitischer Entscheidungen<br />
Die entsprechend dem Optimalkalkül gewählten Instrumentwerte müssen dann in die<br />
Realität umgesetzt werden. Wenn das geschehen ist, beeinflussen sie die ökonomischen<br />
Größen in Richtung auf die Zielwerte. Dass die Implementierung wirtschaftspolitischer<br />
Maßnahmen in <strong>der</strong> Praxis durchaus schwierig sein kann, wird in 4.3 im Kontext <strong>der</strong><br />
ökonomischen Theorie <strong>der</strong> Politik noch ausführlich besprochen.<br />
Dieser Grundansatz rationaler <strong>Wirtschaftspolitik</strong> weist im Hinblick auf die Realität unseres<br />
gesellschaftlich-politischen Systems deutlich hypothetische Züge auf.<br />
• Es gibt keine zentrale Instanz, die alle infragekommenden wirtschaftspolitischen<br />
Entscheidungen trifft und die getroffenen Entscheidungen dann durchsetzt. Vielmehr<br />
sind die Kompetenzen zu wirtschaftspolitischem Handeln verschiedenen Trägern zugeordnet,<br />
die wenigstens teilweise unabhängig voneinan<strong>der</strong> handeln (z.B. Regierung<br />
und Bundesbank).<br />
- 59- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
• Auch sind die Informationsanfor<strong>der</strong>ungen für das beschriebene Verfahren allzu hoch.<br />
Dies hat zur Folge, dass die getroffenen Entscheidungen allenfalls im stochastischen<br />
Sinne den Alternativen überlegen sein können. Dies schafft aber im politischen System<br />
Probleme bei <strong>der</strong> Durchsetzbarkeit <strong>der</strong> getroffenen Maßnahmen.<br />
Mit rationaler <strong>Wirtschaftspolitik</strong> im beschriebenen Sinne - sie wurde insbeson<strong>der</strong>e von<br />
Tinbergen propagiert - wurde vor allem in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
experimentiert. Die Probleme bei <strong>der</strong> praktischen Umsetzung sind eine <strong>der</strong><br />
Ursachen dafür, dass in jüngerer Zeit an<strong>der</strong>e Politikansätze wie z.B. Regelbindung eine<br />
größere Bedeutung gewonnen haben - eine sinnvolle (praktische) <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
muss nicht nur die Unvollkommenheiten des Marktes, son<strong>der</strong>n auch diejenigen des politischen<br />
Prozesses berücksichtigen.<br />
3.1.3 Formal und Modalziele <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
Angenommen, wir legten eine Sammlung wirtschaftspolitischer Ziele an. Eine Umfrage<br />
würde vermutlich eine Vielzahl von Zielen zutage för<strong>der</strong>n, die auf unterschiedlichen<br />
Ebenen anzusiedeln sind. Diesem Umstand trägt die Unterteilung <strong>der</strong> Ziele nach einem<br />
Über- und Unterordnungsverhältnis Rechnung. Wir sprechen von Grundwerten o<strong>der</strong><br />
Grundzielen auf <strong>der</strong> einen und Instrumentalzielen auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite. Analog können<br />
wir zwischen sogenannten Finalzielen und Modalzielen unterscheiden.<br />
3.1.3.1 Finalziele<br />
Finalziele <strong>der</strong> Wirtschafts- wie <strong>der</strong> allgemeinen Politik sind Wohlstand, Freiheit, soziale<br />
Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und sozialer Friede. Diese Ziele sind in einer hochentwickelten<br />
Industriegesellschaft offensichtlich von <strong>der</strong> überwiegenden Mehrheit <strong>der</strong><br />
Menschen akzeptiert. Sie besitzen den Rang „letzter“ Ziele, d.h. sie müssen nicht aus<br />
an<strong>der</strong>en Werten abgeleitet werden.<br />
Dies sei an einem Beispiel veranschaulicht: Preisniveaustabilität ist ein allgemein akzeptiertes<br />
Instrumental- o<strong>der</strong> Modalziel. Wir haben jedoch an ihr selbst kein Interesse.<br />
Eigentlich wäre es uns völlig egal, ob die Preise steigen o<strong>der</strong> nicht, wenn damit nicht<br />
negative Begleiterscheinungen z.B. in Bezug auf Wohlstand, Gerechtigkeit o<strong>der</strong> (sozialer)<br />
Friede verbunden wären. Diese „letzten“ Ziele stellen einen Wert in sich selbst dar.<br />
Wir müssen sie nicht auf an<strong>der</strong>e Ziele zurückführen.<br />
- 60- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Festzuhalten ist:<br />
• Derartige Finalziele o<strong>der</strong> Wertvorstellungen können sowohl nach ihrem konkreten<br />
Inhalt als auch nach ihrer relativen Dringlichkeit, d.h. nach ihrer Rangordnung, individuell,<br />
räumlich und zeitlich variieren.<br />
• Zwischen (Final-) Zielen und Mitteln kann nicht immer eindeutig unterschieden<br />
werden. So ist (ökonomische) Freiheit zum einen ein Wert an sich, zum an<strong>der</strong>en aber<br />
in <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> Freiheit des Marktteilnehmers auch ein Instrument, das die<br />
Funktionsfähigkeit <strong>der</strong> Märkte und damit die Leistungskraft <strong>der</strong> Marktwirtschaft<br />
för<strong>der</strong>t.<br />
• Der Katalog <strong>der</strong> Finalziele lässt sich nur durch gesellschaftliche Konvention festlegen.<br />
Der Konsens darüber wird insbeson<strong>der</strong>e im Zeitablauf Verän<strong>der</strong>ungen unterliegen.<br />
Betrachten wir nun kurz einige dieser Finalziele im einzelnen:<br />
(1) Finalziel (ökonomische) Freiheit<br />
Wir können (individuelle) Handlungsfreiheit unter einem formalen und einem materialen<br />
Aspekt betrachten. Die formale Freiheit entspricht unserer Gleichheit vor dem Gesetz<br />
und dem Schutz vor staatlicher Willkür, den wir in unserem Rechtsstaat genießen.<br />
Materiale Freiheit hingegen bezeichnet die Möglichkeit, im Rahmen <strong>der</strong> formalen Freiheit<br />
und <strong>der</strong> durch ethische Normen gezogenen Grenzen selbst gesteckte Ziele zu verwirklichen.<br />
Damit hat materiale Freiheit ganz offensichtlich etwas mit (ökonomischer)<br />
Macht zu tun. Wer (ökonomisch) völlig unvermögend ist, ist letztlich unfrei trotz aller<br />
formaler Freiheit, die ihm gegeben ist. Nur wer auch ein Mindestmaß an (ökonomischer)<br />
Macht besitzt, kann die Chancen nutzen, die ihm die formale Freiheit gewährt.<br />
Freiheit ist jedoch nicht nur aus individueller, son<strong>der</strong>n auch aus gesellschaftlicher Perspektive<br />
von Interesse: Die Ausübung <strong>der</strong> Freiheit durch den einen kann die Freiheit des<br />
an<strong>der</strong>en beschränken. Beanspruchen o<strong>der</strong> besitzen einzelne Individuen völlige individuelle<br />
Handlungsfreiheit, so wird eine Gesellschaft in ihrer Existenz bedroht. Bei <strong>der</strong> deshalb<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Festlegung gesellschaftlicher Grenzen <strong>der</strong> individuellen Handlungsfreiheit<br />
hat die Gesellschaft Interessenkonflikten vorzubeugen bzw. Interessenkonflikte<br />
zu lösen.<br />
Dem Recht kommt dabei die Funktion eines Regelwerks <strong>der</strong> Freiheit zu. Dieses Regelwerk<br />
gewährt die bereits angesprochene formale Freiheit. Dabei gewährt unsere Rechts-<br />
- 61- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Rechtsordnung insbeson<strong>der</strong>e auch wirtschaftliche Freiheit, die wir als Teilnehmer auf<br />
Märkten nutzen können. Zu denken ist beispielsweise an die Konsumenten- und die<br />
Gewerbefreiheit. Wir vertrauen als Gemeinwesen bei <strong>der</strong> Gewährung dieser Freiheiten<br />
- im Grundsatz - auf die Selbstkoordination <strong>der</strong> Wirtschaftssubjekte durch Markttransaktionen<br />
und auf die Selbstkontrolle durch den Druck des Wettbewerbs mit anpassungsund<br />
entwicklungsför<strong>der</strong>nden sowie machtbegrenzenden Folgen.<br />
Eine wichtige Aufgabe des Staates ist es dann, rechtliche Bedingungen für die Selbststeuerung<br />
zu schaffen und zu sichern. Dazu gehört die Gewährleistung <strong>der</strong> Privatautonomie,<br />
d.h. die Anerkennung des Privateigentums, die Einräumung wirtschaftlicher<br />
Freiheitsrechte, sowie die Sicherung ihrer Wahrnehmungsmöglichkeiten mit Hilfe des<br />
Privatrechts. Hinzu kommen jedoch auch rechtliche Vorkehrungen, die den Mißbrauch<br />
<strong>der</strong> Privatautonomie zu Lasten an<strong>der</strong>er vermeiden o<strong>der</strong> ahnden sollen. Zur <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
gehören deshalb auch z.B. die Wettbewerbspolitik mit ihrem Verbot <strong>der</strong> Kartellbildung<br />
und des Missbrauchs von Marktmacht sowie die Regulierung z.B. <strong>der</strong> Sektoren<br />
Energie, Verkehr und Kreditwesen.<br />
Zusätzlich zu diesen Aspekten <strong>der</strong> formalen Freiheit im wirtschaftlichen Bereich wird<br />
die Gesellschaft die tatsächlichen Handlungsspielräume, d.h. die materiale Freiheit, im<br />
Blick haben. Welche Verteilung materialer Freiheiten sie anstrebt, hat etwas mit dem<br />
nächsten Grundziel, <strong>der</strong> Gerechtigkeit, zu tun.<br />
(2) Finalziel Gerechtigkeit<br />
Gerechtigkeit ist wohl das Finalziel, das am häufigsten zur Begründung von Vorschlägen<br />
o<strong>der</strong> Maßnahmen herangezogen wird. Gleichzeitig ist es wohl auch das Ziel, über<br />
dessen inhaltliche Ausgestaltung die weitestgehenden Meinungsverschiedenheiten bestehen.<br />
Zunächst einmal kann festgehalten werden: Gerechtigkeit ist Gleichheit in einem<br />
näher zu bestimmenden Sinn. Damit ist aber noch nicht viel gewonnen, da es über<br />
eben diesen zu bestimmenden Sinn in einer Gesellschaft sehr unterschiedliche Auffassungen<br />
gibt. Eine Fülle von Gerechtigkeitskriterien, die uns anzeigen sollen, woran sich<br />
unser Streben nach Gerechtigkeit als Finalziel orientieren soll, sind denkbar. So lässt<br />
sich Gerechtigkeit definieren<br />
• als Gleichheit <strong>der</strong> formalen Freiheit,<br />
• als Gleichheit <strong>der</strong> Startbedingungen und Chancen,<br />
• als Leistungsgerechtigkeit,<br />
• als Bedarfsgerechtigkeit,<br />
- 62- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
• als Gleichheit <strong>der</strong> materialen Freiheit.<br />
Versteht man unter Gerechtigkeit lediglich eine Gleichheit <strong>der</strong> individuellen Freiheit, so<br />
besteht für zumindest unsere Gesellschaft bei <strong>der</strong> Realisierung des Finalziels kein großes<br />
Problem mehr. Es genügt, allen Bürgern die grundlegenden staatsbürgerlichen<br />
Rechte zu gewähren und Regeln gegen den Missbrauch dieser (Freiheits-) Rechte gegenüber<br />
an<strong>der</strong>en aufzustellen.<br />
Verstehen wir Gerechtigkeit als Gleichheit <strong>der</strong> Startchancen, so kann dies ein Weg sein,<br />
die Bewertung von beobachtbarer Leistung und von nicht beobachtbarer subjektiver<br />
Anstrengung in Einklang zueinan<strong>der</strong> zu bringen. Sind die Startbedingungen gleich, so<br />
spricht vieles dafür, dass gleiche Leistung auch auf gleichen Einsatz zurückzuführen ist.<br />
Der Gedanke <strong>der</strong> Chancengleichheit besitzt im übrigen erhebliche Attraktivität innerhalb<br />
des marktwirtschaftlichen Gedankengebäudes. Aus <strong>der</strong> Kreislaufdarstellung einer<br />
Volkswirtschaft ist bekannt, dass <strong>der</strong> Marktmechanismus in den Faktormärkten Faktorpreise<br />
und zugehörige individuelle Einkommen bestimmt. Gingen die Wirtschaftssubjekte<br />
mit den gleichen Anfangsausstattungen, d.h. Startchancen, in diesen Marktwettbewerb,<br />
so erschiene das Prinzip „Je<strong>der</strong> ist seines Glückes Schmied“ akzeptabel.<br />
Leistungsgerechtigkeit lässt sich verstehen als „gleicher Lohn für gleiche Leistung“, da<br />
wir das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Mühe“ aufgrund von Informationsproblemen<br />
nicht realisieren können. Wie<strong>der</strong>um geht es also darum, eine Näherungsgröße für nicht<br />
beobachtbaren Einsatz zu finden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass wir einen Bewertungsmaßstab<br />
für Leistungen benötigen. Wie vergleichen wir die Leistung eines Vorstandsvorsitzenden,<br />
einer Professorin, eines Krankenpflegers, einer Hausfrau und eines<br />
Fußballstars? Was verstehen wir überhaupt unter Leistung? Ein denkbares und für uns<br />
relevantes Bewertungssystem ist <strong>der</strong> Markt. Er spiegelt, wenn er funktioniert, relative<br />
Knappheit <strong>der</strong> verschiedenen Leistungen wi<strong>der</strong>. Erinnern wir uns noch einmal an die<br />
einfache Kreislaufdarstellung einer Marktwirtschaft. Die Frage, wie viel Güter ein Individuum<br />
erhält, wird auf den Faktormärkten beantwortet. Dort entscheidet sich anhand<br />
<strong>der</strong> relativen Knappheit <strong>der</strong> von diesem Individuum angebotenen Produktionsfaktoren<br />
und des Einsatzes des Individuums sein Einkommen. Es ist jedoch zu bedenken, dass<br />
<strong>der</strong> vom Markt gelieferte Bewertungsmaßstab, d.h. <strong>der</strong> Preis einer Leistung, verzerrt<br />
sein kann. Möglich ist auch <strong>der</strong> Fall, dass kein Preis existiert, weil es für die Leistung<br />
keinen Markt gibt. Eine Verzerrung wird insbeson<strong>der</strong>e dann vorliegen, wenn Marktmacht<br />
auf <strong>der</strong> Angebots- o<strong>der</strong> Nachfrageseite besteht. So wird <strong>der</strong> Markt bei durch<br />
Ausnahmebegabungen geschaffenen Monopolen - Beispiel Startenor, Spitzenathlet -<br />
und bei durch Marketing erzeugten Meinungsmonopolen - Beispiel Popstar - manche<br />
- 63- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Leistungen überaus hoch bewerten, während an<strong>der</strong>e Leistungen - Beispiel brotlose<br />
Künstler - nicht o<strong>der</strong> erst nach dem Ableben des Leistenden gewürdigt werden. Auf die<br />
Querverbindung zur Startgleichheit sei hingewiesen. Selbst wenn <strong>der</strong> Markt als Bewertungssystem<br />
für Leistung funktioniert und akzeptiert ist, bleibt doch zu beachten, dass<br />
eben nicht nur die Bemühung und <strong>der</strong> Einsatz des Individuums über die Verteilung des<br />
arbeitsteilig Erwirtschafteten entscheiden, son<strong>der</strong>n auch natürliche und gesellschaftliche<br />
Zufälligkeiten, die bei <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> Produktionsfaktoren nach Menge und Qualität<br />
auf die verschiedenen Individuen Einfluss ausüben. Insofern erscheint eine Interpretation<br />
des Gerechtigkeitsziels als Leistungsgerechtigkeit ohne gleichzeitige Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Startchancen fragwürdig.<br />
Im klaren Gegensatz zur Leistungsgerechtigkeit steht die Bedarfsgerechtigkeit. Sie for<strong>der</strong>t,<br />
jedem nach seinen Bedürfnissen zu geben. Hier tritt jedoch erneut ein Informationsproblem<br />
für die <strong>Wirtschaftspolitik</strong> auf. Da wir die individuellen Bedürfnisse nicht<br />
messen o<strong>der</strong> beobachten und auch nicht zwischen den Individuen vergleichen können,<br />
ergibt sich für die Praxis allenfalls die For<strong>der</strong>ung, alle Menschen o<strong>der</strong> zumindest die<br />
Mitglie<strong>der</strong> einer homogenen Gruppe gleichzustellen. Damit wird im Extremfall eine<br />
egalitäre Verteilung angestrebt. Bei weniger rigoroser Anwendung würde das Kriterium<br />
auf Gruppen in ähnlichen Situationen - z.B. Erwerbsunfähigkeit o<strong>der</strong> Opfer einer Naturkatastrophe<br />
- bezogen. Die grundsätzlichen Schwierigkeiten des Kriteriums lassen<br />
sich dadurch jedoch nicht beseitigen. Insbeson<strong>der</strong>e ist es dadurch belastet, dass es einen<br />
Anreiz setzt, Bedürfnisse falsch, d.h. übertrieben hoch, anzugeben.<br />
Schließlich kann <strong>der</strong> Gerechtigkeitsbegriff als Gleichheit <strong>der</strong> materialen Freiheit definiert<br />
werden. Damit wäre ein Zustand anzustreben, in dem alle Individuen über die gleiche<br />
ökonomische Macht verfügen. Erneut treten für die Gesellschaft praktisch unlösbare<br />
Beobachtbarkeitsprobleme auf. Insbeson<strong>der</strong>e auch unter Anreizgesichtspunkten<br />
ist sehr fraglich, ob eine <strong>der</strong>art egalitärer Gerechtigkeitsbegriff in einer Gesellschaft<br />
realisiert werden kann, ohne wirtschaftliche Stagnation auszulösen.<br />
Es lässt sich nun die Frage stellen, welcher Gerechtigkeitsbegriff in unserer Gesellschaft<br />
akzeptiert ist und realisiert werden soll. Eine eindeutige Antwort hierauf ist<br />
offensichtlich nicht möglich. Es hat den Anschein, als ob alle genannten Gerechtigkeitskriterien<br />
parallel in <strong>der</strong> Gesellschaft existieren. Eine gewisse Dominanz kommt<br />
offensichtlich dem Kriterium <strong>der</strong> Leistungsgerechtigkeit zu. Nicht zu verkennen ist jedoch,<br />
dass auch Bedarfsgerechtigkeit in bestimmten Bereichen und bei bestimmten gesellschaftlichen<br />
Gruppen - z.B. den Kirchen - eine große Rolle spielt. Das Kriterium <strong>der</strong><br />
Chancengleichheit gewann insbeson<strong>der</strong>e im Verlauf <strong>der</strong> sechziger und siebziger Jahre<br />
- 64- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
an Bedeutung. Schließlich ist zu konstatieren, dass <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne Wohlfahrtsstaat generell<br />
dazu tendiert, die Zahl <strong>der</strong> Anwendungsfälle <strong>der</strong> Bedarfsgerechtigkeit auszudehnen.<br />
Dies birgt jedoch ganz offensichtlich die Gefahr negativer Anreizwirkungen in sich.<br />
(3) Finalziel sozialer Friede<br />
Totaler sozialer Friede im Sinne einer Vermeidung aller interpersonellen Interessenkonflikte<br />
würde erfor<strong>der</strong>n, einen vorausgesetzten Zustand vollkommen zu stabilisieren.<br />
Dies würde jedoch wesentliche Freiheitsnormen, wie z.B. die Gedanken- o<strong>der</strong> die<br />
Handlungsfreiheit, aber auch ökonomische Freiheiten wie insbeson<strong>der</strong>e die Gewerbefreiheit<br />
beschränken. Damit ist vollkommener sozialer Friede im Sinne einer völlig konfliktfreien<br />
Gesellschaftsordnung nicht möglich. Realisierbar ist allenfalls ein Kompromiss,<br />
<strong>der</strong> Interessengegensätze regelt bzw. vermeiden hilft. Giersch (1961) spricht in<br />
diesem Zusammenhang vom Charakter eines Waffenstillstandes. Dies ist insbeson<strong>der</strong>e<br />
deshalb berechtigt, da einer solchen Vereinbarung häufig eine Periode erhöhter Spannung<br />
vorausgeht. So werden, um einen möglichst günstigen Kompromiss zu erzielen<br />
und um scheinbar Zugeständnisse machen zu können, extreme Ausgangspositionen bezogen.<br />
Man denke in diesem Zusammenhang an den Konflikt zwischen Arbeitgebern<br />
und Gewerkschaften im Rahmen von Tarifverhandlungen. Zu bedenken ist, dass Kompromisse<br />
häufig zu Lasten dritter Personen o<strong>der</strong> Gruppen gehen. So kann eine großzügige<br />
Einigung <strong>der</strong> Tarifparteien die Konsumenten allgemein über gestiegene Preise o<strong>der</strong><br />
im Fall des Öffentlichen Dienstes die Bürger über höhere Steuern belasten. Der<br />
gemeinsame Verzicht <strong>der</strong> Partner auf einen Teil ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit<br />
im Rahmen von Kartellen o<strong>der</strong> Interessenverbänden sind weitere Beispiele für <strong>der</strong>artige<br />
Wirkungen eines Kompromisses. Als Reaktion droht ein defensiver Zusammenschluss<br />
<strong>der</strong>er, die nun wie<strong>der</strong>um ihre Interessen bedroht sehen. In letzter Konsequenz<br />
kann eine solche Entwicklung zu einem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem führen,<br />
das Züge einer Zunftordnung, eines Ständestaates o<strong>der</strong> des Korporativismus trägt.<br />
Individuelle Handlungsfreiheit, von <strong>der</strong> wir uns für den Wohlstand und den Fortschritt<br />
positive Wirkungen erwarten, muss dann in extremer Weise gegenüber einem Ausgleich<br />
<strong>der</strong> Gruppeninteressen zurückstehen.<br />
(4) Finalziel soziale Sicherheit<br />
Sicherheit und Frieden sind insoweit komplementär, als zugleich mit dem sozialen Frieden<br />
ein bestimmtes Maß an kollektiver und individueller Sicherheit erreicht wird. Sicherheit<br />
meint jedoch noch mehr. Es geht den Menschen auch um ihre Gesundheit, die<br />
Sicherheit von Einkommen und Vermögen und um einen Schutz vor den Auswirkungen<br />
- 65- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Individualität und Alter. Zweifelsohne besteht ein<br />
Spannungsverhältnis zwischen sozialer Sicherheit und formaler Freiheit, das um so größer<br />
wird, je weiter <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> sozialen Sicherheit gefaßt wird. Als Mindestfor<strong>der</strong>ung<br />
bedeutet soziale Sicherheit die weitgehende Vermeidung jener allgemeinen Vermögens-<br />
und Beschäftigungsrisiken, die mit wirtschaftlichen Schwankungen einher<br />
gehen. Als Maximalfor<strong>der</strong>ung kann soziale Sicherheit bedeuten, daß alle individuellen<br />
Vermögens- und Einkommensrisiken ausgeschaltet werden sollen. Dies würde erneut<br />
eine überaus starre Ordnung erfor<strong>der</strong>n, in <strong>der</strong> Konkurrenz und Markt als Auslesemechanismen<br />
keine Rolle mehr spielen können.<br />
Man beachte, daß die Gesellschaft nicht nur das anzubietende Ausmaß an sozialer Sicherheit<br />
festlegen muß. Sie hat auch zu prüfen, ob es erfor<strong>der</strong>lich ist, alle o<strong>der</strong> bestimmte<br />
Bevölkerungsgruppen dazu zu zwingen, Vorsorge für die Risiken des Lebens zu treffen.<br />
Wir finden dies bei den gesetzlichen Sozialversicherungen. Gründe für einen solchen<br />
Zwang können in mangeln<strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit <strong>der</strong> Menschen, einem Versagen<br />
von Märkten für private Risikovorsorge o<strong>der</strong> in einer angestrebten ausgleichenden<br />
Gerechtigkeit liegen.<br />
(5) Finalziel Wohlstand<br />
Wenn wir von Wohlstand sprechen, meinen wir in <strong>der</strong> Regel die materielle Güterversorgung,<br />
das Sachvermögen und den realen Wert des Geldvermögens einer Person o<strong>der</strong><br />
einer Gruppe. Der Begriff des Wohlstandes ist sicherlich enger als <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong><br />
Wohlfahrt, <strong>der</strong> in theoretischer Hinsicht eine Bewertung von Gütermengen durch Nutzen-<br />
bzw. Wohlfahrtsfunktionen beinhaltet und <strong>der</strong> im allgemeinen Sprachgebrauch<br />
über die materielle Güterversorgung hinaus auch immaterielle Werte umfasst.<br />
Das gesellschaftliche Wohlstandsziel kann am Nettosozialprodukt o<strong>der</strong> an seiner<br />
Wachstumsrate gemessen werden. Dieser Maßstab ist sicherlich dadurch zu verfeinern,<br />
dass die Größe <strong>der</strong> Bevölkerung o<strong>der</strong> die Anzahl <strong>der</strong> geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt<br />
werden. Wir gelangen auf diese Weise zu Größen wie Durchschnittseinkommen<br />
o<strong>der</strong> Produktivität. Die letztgenannte Messgröße, die den zur Erzeugung einer Gütermenge<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Arbeitseinsatz berücksichtigt, erscheint als die sinnvollste.<br />
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass Wohlstand als Finalziel nicht<br />
unumstritten ist. Zunächst gilt es die generelle Kritik am Sozialprodukt als Wohlstandsindikator<br />
zur Kenntnis zu nehmen. Bei weitem nicht alles, was an wirtschaftlicher Leistung<br />
in einem Land erstellt wird, schlägt sich im Sozialprodukt nie<strong>der</strong>. Man denke an<br />
- 66- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
die Arbeit <strong>der</strong> Hausfrauen und -männer o<strong>der</strong> an Leistungen, die in dem in den letzten<br />
Jahrzehnten stark expandierten Do-it-yourself-Bereich erbracht werden. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite werden Leistungen zu hoch bewertet, wenn bestimmte Kosten, die bei ihrer<br />
Erstellung anfallen, keine Berücksichtigung finden. Dies ist insbeson<strong>der</strong>e dann relevant,<br />
wenn die Güterproduktion mit externen Effekten in <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> Umweltverschmutzung<br />
verbunden ist. Die Kosten <strong>der</strong> Umweltbelastung, die einer - aus <strong>der</strong> Sicht des einzelnen<br />
Produzenten - kostenlosen Faktornutzung entspricht, finden keinen Eingang in<br />
die traditionelle Berechnung des Sozialproduktes. Noch schlimmer: Wenn in einer späteren<br />
Periode Maßnahmen zu Behebung <strong>der</strong> angerichteten Umweltschäden ergriffen<br />
werden, dann zählt dies wie<strong>der</strong>um als wirtschaftliche Leistung und erhöht das Sozialprodukt.<br />
Der materielle Wohlstand eine Gesellschaft wird in diesem Fall vom Indikator<br />
Sozialprodukt zu hoch ausgewiesen.<br />
Noch wesentlich grundsätzlicher ist eine Kritik, die Wohlstand generell als Finalziel in<br />
Frage stellt. So erklärt Giersch (1961) Wohlstand zum Unter-, d.h. zum Modalziel, das<br />
seinen Wert von an<strong>der</strong>en Zielsetzungen her empfängt. Hinter dieser Einordnung steht,<br />
dass Wirtschaften, d.h. die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, kein Selbstzweck<br />
ist, son<strong>der</strong>n ein Mittel, um bestimmte individuelle und gesellschaftliche Ziele zu<br />
erreichen. Wohlstand ist in dieser Sicht ein Mittel, um die an<strong>der</strong>en genannten Finalziele<br />
zu för<strong>der</strong>n.<br />
3.1.3.2 Modalziele<br />
Modal- o<strong>der</strong> Instrumentalziele <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> sind erstrebte ökonomische o<strong>der</strong><br />
soziale Sachverhalte, denen im Hinblick auf die Finalziele ein nachgeordneter Rang zuerkannt<br />
wird und bei denen <strong>der</strong> angestrebte Sachverhalt sich unmittelbar auf die Gestaltung<br />
ökonomischer Größen bezieht. Zwei Eigenschaften sind es demnach, die ein Modalziel<br />
<strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> konstituieren:<br />
• Zum einen muss das Modalziel mindestens ein Finalziel för<strong>der</strong>n.<br />
• Zum an<strong>der</strong>en wollen wir nur solche Ziele betrachten, die sich auf ökonomische Größen<br />
beziehen.<br />
Eine nahezu unendliche Anzahl von <strong>der</strong>artigen Instrumentalzielen sind denkbar. Neben<br />
den drei in <strong>der</strong> Veranstaltung wichtigen Zielen allokative Effizienz, internationale Arbeitsteilung<br />
und gerechte Verteilung sollen beispielhaft noch zwei wichtige makroökonomische<br />
Ziele - stetiges Wachstum (Thema in Konjunktur- und Wachstum) und Preisniveaustabilität<br />
(Thema in Geld, Kredit, Währung) – herausgestellt werden. Die<br />
genannten Ziele stehen im übrigen auch im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> praktischen Wirtschaftspo-<br />
- 67- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
nannten Ziele stehen im übrigen auch im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> praktischen <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland und in vielen an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n stehen:<br />
� Allokative Effizienz: Durch allokative Effizienz wird nicht nur das Wohlstandsziel<br />
geför<strong>der</strong>t, son<strong>der</strong>n auch Gerechtigkeit im Sinn <strong>der</strong> Vermeidung von nicht leistungsgerechtem<br />
Einkommen (z.B. Monopolrenten).<br />
� Internationale Arbeitsteilung: Die mit <strong>der</strong> internationalen Arbeitsteilung und Spezialisierung<br />
einher gehenden Wohlstandsgewinne för<strong>der</strong>n materiale Freiheit. Wie in<br />
<strong>der</strong> Binnenwirtschaft auch, gehen mit Arbeitsteilung jedoch mehr Abhängigkeit und<br />
mehr Unsicherheit einher. Das Gerechtigkeitsziel kann insbeson<strong>der</strong>e dadurch betroffen<br />
werden, dass außenwirtschaftliche Entwicklungen einige gesellschaftliche<br />
Gruppen isoliert negativ betreffen, während an<strong>der</strong>e von ihnen profitieren.<br />
� Stetiges Wirtschaftswachstum: Wirtschaftswachstum för<strong>der</strong>t ohne jeden Zweifel das<br />
Wohlstandsziel. Nicht automatisch positiv müssen die Wirkungen im Hinblick auf<br />
die Ziele soziale Sicherheit, sozialer Friede und Gerechtigkeit sein. Hier hängt es davon<br />
ab, wie <strong>der</strong> Zuwachs an materiellem Wohlstand verteilt wird. Die Stetigkeit des<br />
Wachstums stellt auf die Vermeidung von Konjunkturschwankungen ab, die insbeson<strong>der</strong>e<br />
unter dem Blickwinkel soziale Sicherheit ungünstig zu beurteilen sind. Eng<br />
damit verbunden ist auch das Modalziel hoher Beschäftigung bzw. niedriger (unfreiwillige)<br />
Arbeitslosigkeit, das sich positiv auf alle Finalziele auswirkt.<br />
� Preisniveaustabilität: Eine Verfolgung dieses Zieles för<strong>der</strong>t den Wohlstand, da eine<br />
stabile Währung das Funktionieren <strong>der</strong> Märkte erleichtert. Auch sozialer Friede und<br />
Gerechtigkeit stehen in einem positiven Verhältnis zum Ziel <strong>der</strong> Geldwertstabilität.<br />
� Gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen: Offensichtlich sind hier die<br />
Beziehungen zum Finalziel Gerechtigkeit. Man mus auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite jedoch<br />
auch sehen, dass das Anstreben einer bestimmten Verteilung als Instrumentalziel<br />
auch negative Wirkungen für an<strong>der</strong>e Finalziele, so z.B. Freiheit und Wohlstand, haben<br />
kann.<br />
3.1.4 Zielbeziehungen, Klassifikation von Zielen und Operationalisierbarkeit<br />
3.1.4.1 Zielbeziehungen<br />
Generell lassen sich Zielbeziehungen in vertikale und horizontale trennen. Von einer<br />
vertikalen Zielbeziehung sprechen wir dann, wenn Ziele auch Mittelcharakter haben,<br />
- 68- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
also nach an<strong>der</strong>en Zielen hinterfragbar sind. Für horizontale Zielbeziehungen lassen<br />
sich fünf Fälle unterscheiden:<br />
• Identität: Ziele unterscheiden sich bei genauer Analyse inhaltlich nicht.<br />
• Antinomie: Die Verfolgung eines Ziels schließt die Erreichung mindestens eines<br />
an<strong>der</strong>en Zieles völlig aus.<br />
Identität und Antinomie lassen sich als logische Zielbeziehungen auffassen. Voraussetzung<br />
für die Verfolgung mehrerer Ziele ist ihre logische Vereinbarkeit. Ist sie gewährleistet,<br />
so schließt das jedoch nicht aus, dass es Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> gleichzeitigen<br />
Realisierung gibt. Hier spielen die sogenannten technologischen o<strong>der</strong> empirischen Zielbeziehungen<br />
eine Rolle:<br />
• Komplementarität: Die Verfolgung eines Ziels begünstigt zugleich mindestens ein<br />
an<strong>der</strong>es Ziel.<br />
• Neutralität: Die Verfolgung eines Ziels lässt mindestens ein an<strong>der</strong>es Ziel unberührt.<br />
• Konflikt: Die Verfolgung eines Ziels beeinträchtigt mindestens ein an<strong>der</strong>es Ziel.<br />
Völlige Unabhängigkeit von Zielen dürfte sich in nur sehr wenigen Fällen ergeben. Ihr<br />
steht die Interdependenz des ökonomischen Geschehens entgegen. Je größer das Zielbündel<br />
und die Zahl <strong>der</strong> damit verknüpfbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, desto<br />
wahrscheinlicher sind nicht-neutrale Beziehungen zwischen Zielen.<br />
Welche Beziehungen weisen nun die oben ausführlich diskutierten Finalziele auf? Das<br />
weitaus größte Konfliktpotential ist zwischen Freiheit und den an<strong>der</strong>en Zielen zu sehen.<br />
Dies zeigt sich insbeson<strong>der</strong>e auch in <strong>der</strong> politischen Diskussion. Es bestehen aber auch<br />
Beziehungen <strong>der</strong> Komplementarität, so zwischen sozialem Frieden und sozialer Sicherheit.<br />
3.1.4.2 Klassifikation von Zielen<br />
Wirtschaftspolitische Ziele lassen sich unter an<strong>der</strong>em nach dem Aggregationsgrad <strong>der</strong><br />
Zielvariablen klassifizieren. In diesem Fall ist die folgende Unterteilung sinnvoll:<br />
� Gesamtwirtschaftliche o<strong>der</strong> globale Ziele. Hierbei handelt es sich um Zielgrößen,<br />
wie z.B. Preisniveaustabilität, die die gesamte Volkswirtschaft betreffen.<br />
� Teilwirtschaftliche o<strong>der</strong> sektorale Ziele. Hier handelt es sich um Zielsetzungen, wie<br />
z.B. die Stabilisierung <strong>der</strong> Erzeugerpreise in <strong>der</strong> Investitionsgüterindustrie, die nur<br />
einen Ausschnitt <strong>der</strong> Volkswirtschaft betreffen.<br />
- 69- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Außerdem lassen sich Zielvariablen anhand ihres formalen Charakters klassifizieren.<br />
Man unterscheidet dann:<br />
� Niveauziele. Für eine quantifizierbare Zielgröße wird ein Zielwert festgelegt. Man<br />
denke an eine bestimmte Arbeitslosenquote, die wirtschaftspolitisch angestrebt wird.<br />
� Gleichgewichts- o<strong>der</strong> Stabilitätsziele: Man strebt für eine Zielvariable eine Gleichgewichtslage<br />
o<strong>der</strong> ein stabiles Verhalten an. Man denke an das Ziel einer stabilen<br />
Währung o<strong>der</strong> das Ziel eines gleichmäßigen Wirtschaftswachstums.<br />
� Strukturziele: Man strebt eine bestimmte Struktur, z.B. eine bestimmte Verteilung<br />
einer ökonomischen Größe über Wirtschaftssubjekte o<strong>der</strong> Gruppen, an. Zu denken<br />
ist beispielsweise an das Ziel einer gleichmäßigeren Vermögensverteilung.<br />
3.1.4.3 Operationalisierung von Zielen<br />
Im nächsten Schritt unserer Überlegungen über Ziele <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> soll dem<br />
Problem <strong>der</strong> Operationalisierung von Zielen Aufmerksamkeit gewidmet werden. Unabhängig<br />
davon, ob wir wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf identifizieren, wirtschaftspolitische<br />
Maßnahmen ergreifen o<strong>der</strong> eine Erfolgskontrolle durchführen wollen,<br />
wir sind immer auf Bestimmtheit, d.h. Operationalisierbarkeit, unserer Ziele angewiesen.<br />
Operationalisierbarkeit - z.B. des Ziels „Preisniveaustabilität“ - liegt dann vor,<br />
• wenn es gelingt, reale ökonomische Phänomene (z.B. Güterpreise) festzulegen,<br />
die als Definitionsmerkmale eines Zieles gelten und in dieser Eigenschaft den<br />
Zielinhalt angemessen wie<strong>der</strong>geben. Wir nennen dies Konkretisierbarkeit.<br />
• wenn die als Definitionsmerkmale geltenden Phänomene gemessen werden können<br />
(z.B. Güterpreise beobachten und aufzeichnen). Wir nennen dies Meßbarkeit<br />
o<strong>der</strong> die Verfügbarkeit von Maßgrößen.<br />
• wenn bei mehreren Definitionsmerkmalen für ein Ziel eine durchführbare Aggregationsvorschrift<br />
(z.B. Preisindex) festgelegt ist. Wir nennen dies Aggregierbarkeit.<br />
Erst wenn Ziele in diesem Sinne operationalisiert sind, können auch Zielerreichungsgrade,<br />
d.h. Messgrenzen, angegeben werden. Nun erst sind Problemidentifikation, Lösungsversuch<br />
und Erfolgskontrolle möglich.<br />
- 70- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.2 Kollektive Zielvorstellungen:<br />
Pareto-Kriterium vs. Soziale Wohlfahrtsfunktion<br />
Wir haben bislang die Ziele für die <strong>Wirtschaftspolitik</strong> und ihre Beziehungen zueinan<strong>der</strong><br />
diskutiert, uns dabei jedoch keinerlei Gedanken gemacht, wie eine Gesellschaft zu entsprechenden<br />
Zielvorstellungen kommt. In diesem Abschnitt wollen wir zwei teilweise<br />
gegenläufige Ansätze zur „Lösung“ dieses Problems betrachten: Zum einen eine Orientierung<br />
<strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> am Pareto-Kriterium und damit ausschließlich an den<br />
individuellen Nutzen, zum an<strong>der</strong>en das Konzept einer sozialen Wohlfahrtsfunktion, bei<br />
<strong>der</strong> eine gesellschaftliche Gewichtung <strong>der</strong> individuellen Interessen vorgenommen wird.<br />
Welche grundlegenden (und letztlich nicht vollständig lösbaren) Probleme bei <strong>der</strong> Gewinnung<br />
einer kollektiven Zielvorstellung für eine Gruppe von Individuen aus den individuellen<br />
Zielen <strong>der</strong> Gruppenmitglie<strong>der</strong> auftreten kann, wird dann im nächsten Abschnitt<br />
thematisiert.<br />
Die Notwendigkeit einer kollektiven Zielvorstellung liegt auf <strong>der</strong> Hand: Man kann<br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong> nur dann rational betreiben, wenn es eine Zielvorstellung <strong>der</strong> Gruppe<br />
gibt, für die <strong>Wirtschaftspolitik</strong> gemacht wird. Ein natürlicher Ausgangspunkt zur Bestimmung<br />
<strong>der</strong> kollektiven Ziele sind die individuellen Präferenzordnungen. Dies ist<br />
kompatibel mit <strong>der</strong> in unserer Gesellschaftsordnung enthaltenen Position, dass individuelle<br />
Ziele die Ziele einer Gruppe, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Gesellschaft insgesamt, determinieren<br />
sollten und nicht umgekehrt. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme<br />
sollen nun anhand eines denkbar einfachen mikroökonomisch formulierten Beispiels<br />
veranschaulicht werden<br />
3.2.1 Präferenzaggregation – ein Beispiel<br />
Der Staat kann ein Gelände auf eine von zwei Arten nutzen:<br />
• Alternative A: Kraftwerksbau mit <strong>der</strong> Folge niedrigerer Strompreise.<br />
• Alternative B: Anlegen eines Naherholungsgebietes, das zu einem niedrigen Preis<br />
<strong>der</strong> Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird und dadurch den Preis des Gutes Erholung<br />
senkt.<br />
Im üblichen mikroökonomischen Kalkül des Haushalts dreht jede <strong>der</strong> beiden Maßnahmen<br />
die Budgetgerade eines betroffenen Konsumenten nach außen, d.h. jede wirkt nutzenerhöhend.<br />
Die Präferenzen von zwei repräsentativen Haushalten 1 und 2 sind in den<br />
folgenden Indifferenzkurvenschaubil<strong>der</strong>n wie<strong>der</strong>gegeben.<br />
- 71- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Erholung<br />
u 1 B<br />
u 1 A<br />
u 1 0<br />
KWh<br />
Haushalt 1 hat eine relativ starke Präferenz für das Gut Erholung. Beide Projekte erhöhen<br />
seinen Nutzen, jedoch liegt das Nutzenniveau im Fall B über dem des Falls A.<br />
Völlig an<strong>der</strong>s hingegen bei Haushalt 2: Dieser hat eine stärkere Präferenz für das Gut<br />
Strom und präferiert deshalb den Fall A.<br />
Erholung<br />
u 2 0<br />
u 2 B<br />
u 2 A<br />
KWh<br />
Damit stehen wir, wollen wir als <strong>Wirtschaftspolitik</strong>er eine Entscheidung für die aus<br />
diesen beiden Individuen bestehende Gruppe fällen, vor einem Problem: Entscheiden<br />
wir uns für eines <strong>der</strong> beiden Projekte, bevorzugt man einen Haushalt gegenüber dem<br />
an<strong>der</strong>en. Viele Situationen <strong>der</strong> Realität sind im übrigen noch unangenehmer als das Beispiel,<br />
da sie mit einer echten Verschlechterung <strong>der</strong> Position eines Haushalts einher gehen.<br />
- 72- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Im Beispiel deutet sich bereits eine zentrale Eigenschaft einer kollektiven Entscheidungsregel<br />
o<strong>der</strong> sozialen Wohlfahrtsfunktion an: Sie scheint eine Abwägung zwischen<br />
den Interessen <strong>der</strong> Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> zu erfor<strong>der</strong>n.<br />
Wenn wir den Nutzenniveaus <strong>der</strong> beiden Akteure Indexzahlen zuordnen, dann ergibt<br />
sich eine graphische Repräsentation <strong>der</strong> Politikoptionen durch die Punkte 0 (Status<br />
quo), A und B im folgenden Schaubild:<br />
u 1<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
E<br />
C<br />
O<br />
B<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Die Darstellung beruht auf folgen<strong>der</strong> Wahl <strong>der</strong> Indexzahlen:<br />
Alternative 0 A B<br />
Haushalt 1 2,5 3 4<br />
Haushalt 2 3 6 4<br />
Man beachte, dass aufgrund <strong>der</strong> Ordinalität <strong>der</strong> Nutzenfunktionen die Lage von 0, A, B<br />
nicht eindeutig ist. Fest steht jedoch das Muster <strong>der</strong> Anordnung, das sich durch die zugelassenen<br />
streng monoton positiven Transformationen <strong>der</strong> individuellen Nutzenfunktionen<br />
nicht än<strong>der</strong>t.<br />
Welchen <strong>der</strong> drei Punkte 0, A und B unseres Entscheidungsproblems soll eine <strong>Wirtschaftspolitik</strong>erin<br />
wählen? Ein Konflikt tritt auf: Haushalt 1 würde B wählen, 2 präferiert<br />
A. Dies verdeutlicht, dass aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong>erin eine Entscheidung<br />
mit mehrfacher Zielsetzung vorliegt, wenn eine wirtschaftspolitische Entscheidung<br />
für eine Gruppe von Individuen zu treffen ist, und dass zwischen den Einzelzielen<br />
häufig Konflikte bestehen werden.<br />
Angenommen, es stünden statt <strong>der</strong> beiden Projekt A und B stetige, d.h. unendlich viele,<br />
Politikoptionen zur Verfügung. Dies führt auf konkave Nutzenmöglichkeitskurve, die<br />
den maximal möglichen Nutzen für Individuum 1 zu gegebenem Nutzen des Indivi-<br />
A<br />
D<br />
- 73- © K. Morasch, 2002<br />
u 2
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
duums 2 darstellt. Auf dieser Nutzenmöglichkeitskurve sind drei weitere Punkte von<br />
Bedeutung:<br />
• Die Punkte C und D definieren einen Bereich auf <strong>der</strong> Nutzenmöglichkeitskurve, <strong>der</strong><br />
gegenüber dem Status quo 0 pareto-überlegen ist. D.h. in diesem Bereich stellt sich<br />
mindestens einer <strong>der</strong> beiden Haushalte besser als im Ausgangszustand, ohne daß <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>e eine Verschlechterung erfährt. Eine Mindestanfor<strong>der</strong>ung an wirtschaftspolitisches<br />
Handeln scheint zur erfor<strong>der</strong>n, dass nur zwischen Punkte auf dem Kurvenabschnitt<br />
von C bis D gewählt wird.<br />
• Punkt E hingegen verdeutlicht eine Alternative, die nicht mit dem Status quo nicht<br />
unter Verwendung des Pareto-Kriteriums verglichen werden kann. Haushalt 1 verbessert<br />
sich, während sich Haushalt 2 verschlechtert.<br />
Wirtschaftspolitische Entscheidungen im Bereich von C bis D bedürfen zwar einer Abwägung<br />
zwischen den Interessen <strong>der</strong> beiden Haushalte, haben aber den Vorteil, dass<br />
beide Haushalte eine Nutzenerhöhung erfahren. Wäre statt dessen nur zwischen dem<br />
Status quo 0 und dem Punkt E zu wählen, so läge eine noch unangenehmere Entscheidungssituation<br />
vor: Es wäre zu überlegen, ob <strong>der</strong> Nutzenzuwachs beim Haushalt 1 den<br />
Nutzenrückgang beim Haushalt 2 rechtfertigt. In <strong>der</strong> Realität sind Entscheidungssituationen<br />
vom zuletzt beschriebenen Typ durchaus häufig anzutreffen. Man denke an eine<br />
Handelsliberalisierung mit einem Schwellenland, die Preis von bestimmten Importgütern<br />
senkt und dadurch Konsumenten zugute kommt, gleichzeitig aber die in den importkonkurrierenden<br />
Sektoren beschäftigten Produktionsfaktoren negativ berührt. O<strong>der</strong><br />
an eine Maßnahme zur Stabilisierung <strong>der</strong> gesetzlichen Altersversorgung, bei <strong>der</strong> Rentner<br />
Kürzungen auferlegt werden müssen, um Beitragszahler zu entlasten.<br />
Im Ideal würde man sich in unserem Beispiel eine soziale Wohlfahrtsfunktion<br />
1 2<br />
1 2<br />
w = w(<br />
u , u ) <strong>der</strong>art wünschen, dass sich aus ihr mit w = w(<br />
u , u ) = konstant soziale<br />
Indifferenzkurven bilden lassen, die dann eine optimale Entscheidung liefern. In unserem<br />
Schaubild ist dies durch die drei konvexen Kurven angedeutet. Diese sozialen Indifferenzkurven<br />
identifizieren Projekt A als gegenüber Projekt B überlegen. Somit<br />
steckt in <strong>der</strong> dahinter stehenden sozialen Wohlfahrtsfunktion offensichtlich eine Abwägung<br />
zugunsten des Haushalts 2.<br />
3.2.2 Lösungskonzepte für kollektive Entscheidungen<br />
Anhand des Beispiels mit zwei Individuen und zwei Projekten (A: Kraftwerksbau, B:<br />
Naherholungsgebiet) wurde die Thematik kollektiver Entscheidungen, d.h. von Ent-<br />
- 74- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
scheidungen für Gruppen o<strong>der</strong> die Gesellschaft insgesamt, veranschaulicht. Die „Gruppe“<br />
o<strong>der</strong> die „Gesellschaft“ ist dabei geeignet abzugrenzen. Sie umfasst alle jene, die<br />
von einer betrachteten Entscheidung betroffen sind. Dies kann eine Stadt o<strong>der</strong> ein Landkreis<br />
ebenso sein, wie ein ganzes Land o<strong>der</strong> eine Gruppe von Län<strong>der</strong>n. Zu fragen ist<br />
jetzt: Wie ist die Wohlfahrt, wie sind die Präferenzen einer Gruppe o<strong>der</strong> Gesellschaft<br />
und damit die Zielfunktion des kollektiven Handelns bzw. <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> zu<br />
charakterisieren? Während dies zuvor nur angedeutet wurde, soll nun eine zunehmend<br />
systematischere Herangehensweise entwickelt werden. Dazu wird nun eine Reihe von<br />
Entscheidungskriterien im Detail diskutier, die im ökonomischen Denken eine wichtige<br />
Rolle spielen und auch Einfluss auf politische Diskussionen und politisches Handeln<br />
ausüben.<br />
3.2.2.1 Lexikographische Ordnung<br />
Ein beson<strong>der</strong>s einfacher Weg besteht darin, bei mehrfacher Zielsetzung, d.h. insbeson<strong>der</strong>e<br />
auch bei mehreren individuellen Zielsetzungen, eine Hierarchie dieser Einzelziele<br />
zu bilden und dann jene Alternative zu wählen, die das beste Ergebnis beim wichtigsten<br />
Einzelziel liefert. Führt dies zu keiner eindeutigen Handlungsempfehlung, dann wird für<br />
die gleich gut bewerteten Alternativen zusätzlich das zweitwichtigste Einzelziel herangezogen<br />
usw. Der Begriff <strong>der</strong> lexikographischen Ordnung ist für dieses Vorgehen angemessen,<br />
da wie bei <strong>der</strong> alphabetischen Sortierung in einem Lexikon eine Reihung<br />
zuerst nach dem ersten Ziel (Buchstaben), dann nach dem zweiten Ziel (Buchstaben)<br />
usw. erfolgt.<br />
Obgleich dies formal einfach ist, bleibt offen, ob und wann eine solche Vorgehensweise<br />
angebracht ist. Man beachte im beson<strong>der</strong>en, dass im Fall einer durch mehrere betroffene<br />
Individuen gegebene Mehrfachzielsetzung die lexikographische Ordnung einer Rangordnung<br />
<strong>der</strong> Interessen <strong>der</strong> Betroffenen entspricht. Es muss ein Gesellschaftsmitglied<br />
als das wichtigste, eines als das zweitwichtigste usw. festgelegt werden. Dies wird im<br />
allgemeinen nicht akzeptabel sein.<br />
Im Beispiel führt eine lexikographische Ordnung, bei <strong>der</strong> die Interessen von Haushalt 1<br />
vor die des Haushalts 2 gestellt werden, zur Entscheidung für B aus <strong>der</strong> Alternativenmenge<br />
{ 0,<br />
A,<br />
B}<br />
. Nur wenn es eine Alternative gäbe, die für Haushalt 1 denselben Nutzen-Wert<br />
wie B erreicht, müsste zusätzlich geprüft werden, wie diese Alternative bei<br />
<strong>der</strong> Zielfunktion des Haushalts 2 im Vergleich zu B abschneidet.<br />
- 75- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.2.2.2 Pareto-Kriterium<br />
Das grundlegendste Rationalitätsprinzip, nämlich keine Alternative zu wählen, die unter<br />
allen Umständen schlechter als eine an<strong>der</strong>e Alternative ist, lässt sich unmittelbar in den<br />
jetzt relevanten Kontext übertragen. Es trägt hier den Namen Pareto-Kriterium und verlangt,<br />
nur solche Alternativen zu wählen, die bezüglich <strong>der</strong> Einzelziele nicht dominiert<br />
sind. Mit Blick auf mehrere betroffene Individuen heißt dies, nur solche Aktionen<br />
durchzuführen, die mindestens ein Individuum besser stellen, ohne gleichzeitig ein an<strong>der</strong>es<br />
Individuum schlechter zu stellen.<br />
Formal definiert man wie folgt: Es sei S = { s1, …, sN<br />
} die Menge <strong>der</strong> Zustände und I die<br />
Zahl <strong>der</strong> Haushalte mit Index i = 1, …, I. „�i “ und „ ~ �i “ bezeichnet die starke bzw.<br />
schwache Präferenz des Haushalts i. Ein Zustand s1 wird dann gegenüber einem Zustand<br />
s2 Pareto-präferiert, wenn gilt<br />
s1 ~<br />
�is2 für alle i = 1,<br />
…,<br />
I<br />
s � s für mindestens ein i<br />
1 i 2<br />
Dies konstituiert eine kollektive Präferenzordnung „ � P “. Ein Zustand s 1 heißt Pareto-<br />
optimal, wenn es keinen Zustand s2 <strong>der</strong>art gibt, dass s � s .<br />
2 P 1<br />
Man beachte, dass dies ein sehr einsichtiges und allgemeines - da nicht einmal auf Nutzen<br />
rekurrierendes -, aber letztendlich zu schwaches Entscheidungskriterium darstellt.<br />
Zwei Schwächen fallen beson<strong>der</strong>s auf:<br />
• Das Pareto-Kriterium ist vereinbar mit extrem ungleichen Verteilungen. Man veranschauliche<br />
sich dies durch Punkte am linken o<strong>der</strong> rechten Rand <strong>der</strong> Nutzenmöglichkeitsgrenze<br />
des beim Beispiel präsentierten Schaubilds o<strong>der</strong> – speziell im Kontext<br />
des Beispiels – durch die Punkte C und D. Das Kriterium leistet keine Abwägung<br />
zwischen Einzelzielen, d.h. es gewichtet in keiner Weise die Interessen <strong>der</strong> Individuen<br />
und beinhaltet demzufolge auch keinerlei Gerechtigkeitsnorm. Es stellt allein<br />
auf die Erreichung von Effizienz ab. Ineffizient wäre es, wenn durch eine an<strong>der</strong>e<br />
Aktion ein Zustand erreicht werden könnte, <strong>der</strong> eine Pareto-Verbesserung liefert,<br />
d.h. mindestens ein Individuum besser stellt, ohne gleichzeitig ein an<strong>der</strong>es zu schädigen.<br />
Der Verzicht auf ein Abwägen zwischen den Interessen verschiedener Individuen<br />
wurde im Zuge <strong>der</strong> „Neuen Wohlfahrtsökonomik“ seit den 30er Jahren vielfach<br />
als Fortschritt angesehen. Schließlich steht das kollektive Entscheidungskriterium<br />
nun auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> ordinalen Nutzentheorie.<br />
- 76- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
• Zustände, die Pareto-optimal sind, d.h. von denen ausgehend keine Pareto-<br />
Verbesserungen mehr möglich sind, können mit diesem Kriterium nicht verglichen<br />
werden. Sie werden als gleich gut eingeschätzt. Folglich kann auch keine Entscheidung<br />
zwischen den Aktionen getroffen werden, die zu diesen Pareto-optimalen Zuständen<br />
führen. Die kollektive Präferenzordnung ist nicht vollständig, da Zustände,<br />
in denen sich jeweils ein Individuum besser und das an<strong>der</strong>e schlechter stellt, nicht<br />
vergleichbar sind.<br />
Im Beispiel wird 0 sowohl von A als auch von B Pareto-dominiert. Damit steht fest,<br />
dass eines <strong>der</strong> beiden Projekte durchzuführen ist, jedoch ist keine Entscheidung möglich,<br />
welches Projekt dies sein sollte.<br />
Weiterhin kann das Pareto-Kriterium einen Punkt E nicht mit O vergleichen. Derartige<br />
Entscheidungssituationen, bei denen eine wirtschaftspolitische Maßnahme einer gesellschaftlichen<br />
Gruppe nützt und einer an<strong>der</strong>en schadet, treten jedoch häufig auf. Man denke<br />
an die Einführung eines Importzolls, an die EG-Agrarpolitik, an Subventionen für<br />
bedrohte Branchen usw.<br />
Angesichts des Unvermögens des Pareto-Kriteriums, zwischen Zuständen abzuwägen,<br />
die mindestens ein Individuum besser stellen und gleichzeitig ein an<strong>der</strong>es Individuum<br />
schlechter stellen, tritt die Frage auf, wie in solchen Situationen eine Alternative gewählt<br />
werden kann. Ein Vorschlag, <strong>der</strong> nach dem Ökonomen Hicks als Hicks'scher Optimismus<br />
bezeichnet wird, lautet, das Problem <strong>der</strong> Verschlechterung o<strong>der</strong> Benachteiligung<br />
für ein Individuum o<strong>der</strong> eine Gruppe im Vertrauen darauf zu ignorieren, dass spätere<br />
wirtschaftspolitische Entscheidungen die jetzt Benachteiligten ebenso begünstigen<br />
werden, so dass nach mehreren Aktionen alle Individuen besser gestellt sind als im<br />
Ausgangszustand. In dem früheren Schaubild bedeutet dies, dass ein Übergang von 0<br />
nach E durchaus akzeptabel ist, da später eine Bewegung von E nach Nordosten zu erwarten<br />
ist, die auf einen Punkt führt, <strong>der</strong> auch im Nordosten von 0 liegt. In <strong>der</strong> Realität<br />
treffen wir <strong>der</strong>artige Argumentationsmuster beispielsweise dort an, wo ein Abbau von<br />
Systemen <strong>der</strong> sozialen Sicherung mit den, für alle Bürger vorteilhaften zukünftigen<br />
Wachstumseffekten einer dynamischeren Volkswirtschaft schmackhaft gemacht werden<br />
soll. Aus einem eher konzeptionellen Blickwinkel erscheint dieser Vorschlag ähnlich<br />
wie die lexikographische Ordnung jedoch wenig befriedigend und wird darum nicht<br />
weiter verfolgt.<br />
- 77- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.2.2.3 Umverteilung zur Erfüllung des Pareto-Kriteriums<br />
Teilt man diesen Hicks'schen Optimismus nicht, so könnte eine alternative Vorgehensweise<br />
darin bestehen, Verlierer aus den Gewinnen <strong>der</strong> Begünstigten zu kompensieren,<br />
um so eine tatsächliche Pareto-Verbesserung herzustellen. Umverteilung sichert hier eine<br />
Pareto-Verbesserung, wobei immer noch das Ausmaß an Umverteilung festzusetzen<br />
ist.<br />
Im Schaubild des Beispiels führt dies auf den Vorschlag, das hinter Punkt E stehende<br />
Projekt zu realisieren, dabei aber den Verlierer 2 aus den Zuwächsen des Gewinners 1<br />
zu kompensieren, um so die Nutzenverteilung zumindest des Punktes C zu erreichen,<br />
<strong>der</strong> den Ausgangszustand 0 Pareto-dominiert. Die Umverteilungslösung ist ganz offensichtlich<br />
nicht eindeutig. Alle Punkte auf <strong>der</strong> Nutzenmöglichkeitsgrenze zwischen C<br />
und D kämen in Frage.<br />
Argumente dieser Art finden sich z.B. bei den Diskussionen über Handelsliberalisierung.<br />
Dort wird häufig darauf verwiesen, dass die aggregierten Vorteile für das Land<br />
insgesamt groß genug sind, um einen Verlierer – z.B. die Landwirtschaft – aus den Vorteilen<br />
des Gewinners – z.B. die Industrie – zu kompensieren. Realisieren ließe sich dies<br />
über einen Steuer-Transfer-Mechanismus. Sozialversicherungen und progressive Einkommenssteuer<br />
wirken bereits automatisch in diese Richtung. Es darf aber nicht übersehen<br />
werden, dass die Pareto-Verbesserung in diesen Fällen meist eine hypothetische<br />
bleibt, d.h. kaum tatsächlich erzielt werden wird, weil man sich scheut, einen <strong>der</strong>art fallbezogenen<br />
Umverteilungsmechanismus aufzubauen.<br />
3.2.2.4 Potentielle Pareto-Verbesserung<br />
Gesteht man sich ein, dass man eine Umverteilung nicht durchführen kann o<strong>der</strong> will,<br />
obgleich genügend aggregierter Vorteil für eine Kompensation <strong>der</strong> Verlierer zur Erreichung<br />
einer Pareto-Verbesserung vorhanden wäre, dann argumentiert man letztlich nur<br />
noch mit einer potentiellen Pareto-Verbesserung. Es wird dabei lediglich geprüft, ob<br />
die Nutznießer einer Aktion die Verlierer <strong>der</strong>art kompensieren könnten, dass eine Pareto-Verbesserung<br />
gegenüber dem Ausgangszustand stattfindet. Dieses Vorgehen, das nur<br />
auf Effizienz abstellt und dabei sogar Verschlechterungen für Individuen o<strong>der</strong> Gruppen<br />
in Kauf nimmt, steht im Mittelpunkt <strong>der</strong> sog. „Neuen Wohlfahrtstheorie“. Es handelt<br />
sich bei diesem Entscheidungskriterium um eine interessante theoretische Variante, die<br />
beispielsweise in <strong>der</strong> Außenhandelstheorie bei <strong>der</strong> Begründung <strong>der</strong> Vorteilhaftigkeit<br />
von Außenhandel und speziell Freihandel eine große Rolle spielt, aber nicht unbedingt<br />
reale Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> überzeugen wird. In diesem Kriterium kommt beson<strong>der</strong>s<br />
deutlich die Fixierung des konventionellen ökonomischen Denkens auf Fragen <strong>der</strong> Effi-<br />
- 78- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
zienz und die Abstraktion von Fragen <strong>der</strong> Verteilung zum Ausdruck. Eine solche einseitige<br />
Fixierung ist im übrigen nur zulässig, wenn Effizienz und Verteilung, d.h. Allokation<br />
und Distribution, voneinan<strong>der</strong> trennbar sind. Wenn hingegen die Frage <strong>der</strong> Verteilung<br />
des „Kuchens“ einen Einfluss auf die Größe des „Kuchens“ hat, dann kann man<br />
nicht sagen, man solle sich allein mit <strong>der</strong> Maximierung <strong>der</strong> Größe des „Kuchens“ befassen<br />
.<br />
3.2.2.5 Kollektive Zielfunktion – soziale Wohlfahrtsfunktion<br />
Als letztes Entscheidungskriterium sei eine Zielfunktion genannt, die Einzelziele gewichtet<br />
und zu einer übergeordneten Zielfunktion aggregiert. Liegt <strong>der</strong> mehrfachen<br />
Zielsetzung <strong>der</strong> Fall zugrunde, dass mehrere Individuen o<strong>der</strong> Gruppen unterschiedlich<br />
von dem wirtschaftspolitischen Eingreifen betroffen sind, dann wären die zu aggregierenden<br />
Zielfunktionen die individuellen Nutzenfunktionen. Man spricht man in diesem<br />
Zusammenhang von einer sozialen Wohlfahrtsfunktion, die als Funktion <strong>der</strong> individuellen<br />
Nutzenniveaus definiert ist, und wählt die Notation<br />
wobei<br />
1 N<br />
w( u , … , u ) ,<br />
i<br />
u eine individuelle Nutzenfunktion bezeichnet.<br />
Diese Schreibweise einer sozialen Wohlfahrtsfunktion entstammt <strong>der</strong> Tradition des Utilitarismus,<br />
wo seit Bentham (1789) zwei soziale Zustände c1 und c2 dadurch verglichen<br />
wurden, dass man die Summe <strong>der</strong> unter diesen Zuständen erreichten individuellen<br />
Nutzenniveaus vergleicht. Zustand 1 ist demnach mindestens so gut wie Zustand 2,<br />
wenn<br />
N<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
N<br />
∑<br />
i<br />
i<br />
u ( c ) ≥ u ( c ) .<br />
1<br />
i=<br />
1<br />
2<br />
In <strong>der</strong> entscheidend von Bergson (1938) und Samuelson (1947) angeregten Literatur des<br />
20. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurden demgegenüber Funktionen o<strong>der</strong> Präferenzrelationen über soziale<br />
Zustände betrachtet. Dies war insofern konsequent, als parallel in <strong>der</strong> Haushaltstheorie<br />
das Konzept <strong>der</strong> Präferenzrelation die Nutzenfunktion als elementaren Baustein<br />
ablöste. Wenn die soziale Rangfolge nicht auf den individuellen Nutzenniveaus basiert,<br />
dann hat dies den Vorteil, dass auch Nicht-Nutzenkomponenten in <strong>der</strong> gesellschaftlichen<br />
Betrachtung Berücksichtigung finden können. Allerdings ist zuzugestehen, dass<br />
mit einer extrem liberalen Position dieses Vorgehen abzulehnen und statt dessen eine<br />
Fundierung <strong>der</strong> sozialen Rangordnung auf den individuellen Nutzen zu for<strong>der</strong>n wäre,<br />
nach dem Motto, nur was in die individuelle Nutzenfunktion eingeht, ist für die gesellschaftliche<br />
Entscheidung relevant.<br />
- 79- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Mit <strong>der</strong> Einführung einer Zielfunktion ist ein Abwägen zwischen den Einzelzielen verbunden.<br />
Dies bedeutet insbeson<strong>der</strong>e, dass eine soziale Wohlfahrtsfunktion die Interessen<br />
<strong>der</strong> Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> gewichtet. Ist dies geschehen, dann kann mittels <strong>der</strong> sozialen<br />
Wohlfahrtsfunktion unter den Pareto-effizienten, d.h. nicht Pareto-dominierten,<br />
Punkten ein wohlfahrtsmaximieren<strong>der</strong> ausgewählt werden.<br />
Für eine Darstellung einer sozialen Wohlfahrtsfunktion im Schaubild des Beispiels bietet<br />
es sich an, Isowohlfahrtskurven, d.h. Indifferenzkurven von w, zu konstruieren.<br />
1<br />
2<br />
Hierzu hält man w konstant und betrachtet u als Funktion von u . Die in <strong>der</strong> früheren<br />
Abbildung eingezeichneten Isowohlfahrtskurven basieren auf einer Cobb-Douglas-Spe-<br />
1 a 2 b<br />
zifikation von <strong>der</strong> Art w = ( u ) ( u ) . Sie liefern A als wohlfahrtsmaximierendes Projekt.<br />
Betrachten wir kurz gängige Formulierungen sozialer Wohlfahrtsfunktionen, wie sie in<br />
<strong>der</strong>, in diesem Bereich auch sehr stark durch Philosophen beeinflussten, ökonomischen<br />
Literatur zu finden sind. Wir gehen jeweils davon aus, dass zwei Individuen 1 und 2 mit<br />
ihren Nutzenfunktionen 1<br />
u und 2<br />
u eine Zustandsvektor c bewerten, <strong>der</strong> in beliebiger<br />
Allgemeinheit für die Individuen relevante Daten enthält. Unser Interesse gilt <strong>der</strong> sozia-<br />
1 2<br />
1 2<br />
len Wohlfahrtsfunktion w( u , u ) = w[ u ( c),<br />
u ( c)]<br />
.<br />
(1) Bentham’sche bzw. utilitaristische Wohlfahrtsfunktion<br />
Gegeben sei totale Vergleichbarkeit <strong>der</strong> individuellen Nutzen im folgenden Sinn: Die<br />
wirtschaftspolitische Entscheidungsträgerin kann die Nutzenniveaus und die Nutzenän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Individuen vergleichen. Weiterhin seien die individuellen Nutzenfunktionen<br />
kardinal, d.h. bis auf positive lineare Transformationen eindeutig.<br />
Die soziale Wohlfahrt muss dann gegenüber einer auf alle individuellen Nutzen identisch<br />
angewandten positiven linearen Transformation invariant sein. Diese Bedingung<br />
wird von <strong>der</strong> Bentham’schen o<strong>der</strong> utilitaristischen sozialen Wohlfahrtsfunktion erfüllt.<br />
Sie lautet für den einfachsten Fall mit zwei Individuen<br />
1 2 1 2 1 2<br />
w( u , u ) = u ( c ) + u ( c)<br />
= u + u .<br />
1<br />
2<br />
1 2<br />
w( α + βu<br />
, α + βu<br />
) = 2α<br />
+ β ( u + u ) konstituiert dieselbe soziale Rangordnung wie<br />
1 2 1 2<br />
die auf den nicht transformierten Nutzen basierende Funktion w( u , u ) = u + u .<br />
1 2 1 2<br />
Man beachte folgendes: Aufgrund <strong>der</strong> Kardinalität repräsentiert w( u , u ) = u + u die-<br />
1 2 1 1 1 2<br />
selbe soziale Präordnung wie w( u , u ) = u + u . Die zweite Form <strong>der</strong> Wohlfahrts-<br />
2 2<br />
funktion kann interpretiert werden als erwarteter Nutzen eines risikoneutralen Individu-<br />
- 80- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
ums, das in einem Ausgangszustand nicht weiß, ob es später vom Typ 1 o<strong>der</strong> vom Typ<br />
2 sein wird und dem Eintreten bei<strong>der</strong> Zustände gleiche Wahrscheinlichkeit beimisst.<br />
Damit hat dieser Typ <strong>der</strong> sozialen Wohlfahrtsfunktion eine interessante, auf den Nobelpreisträger<br />
Harsanyi zurückgehende, Interpretation: Es ist die soziale Wohlfahrtsfunktion,<br />
auf die sich risikoneutrale Mitglie<strong>der</strong> einer Gesellschaft einigen könnten, wenn sie<br />
in einem Anfangszustand (unter dem sog. „Schleier <strong>der</strong> Ignoranz“, „veil of ignorance“)<br />
noch nicht ihren zukünftigen Status (erfolgreich o<strong>der</strong> erfolglos, reich o<strong>der</strong> arm, gesund<br />
o<strong>der</strong> krank) kennen.<br />
(2) Rawls’ Kriterium<br />
Kardinalität <strong>der</strong> Nutzen ist keine Voraussetzung für die Existenz einer sozialen Wohlfahrtsfunktion.<br />
Man unterstelle ordinale Nutzen, d.h. individuelle Nutzenfunktionen, die<br />
bis auf eine zunehmende Transformation eindeutig sind. Die wirtschaftspolitische Entscheidungsträgerin<br />
sei in <strong>der</strong> Lage, die Nutzenniveaus, nicht jedoch die Nutzenän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Individuen zu vergleichen.<br />
Somit muss die soziale Wohlfahrtsfunktion invariant gegenüber einer auf alle Individuen<br />
identisch angewandten zunehmenden Transformation sein. Dies erfüllt das Kriterium<br />
des Moralphilosophen Rawls:<br />
u u min ) , w(<br />
1 2<br />
= .<br />
i<br />
i u<br />
Wohlfahrtsmaximierung bedeutet dann die Maximierung <strong>der</strong> Position des am schlechte-<br />
1 2<br />
sten gestellten Gesellschaftsmitglieds (Maximin-Kriterium). w(g( u ), g( u )) führt auf<br />
1 2<br />
dieselbe soziale Rangordnung von Zuständen wie w( u , u ) , wenn g(.) eine monoton<br />
steigende Funktion ist.<br />
Analog <strong>der</strong> Harsanyi-Interpretation des utilitaristischen Ansatzes kann man auch hier<br />
von einem Individuum sprechen, das in einem Urzustand („veil of ignorance“) noch<br />
nicht weiß, von welchem Typ es sein wird. Im Gegensatz zuvor handelt es sich nun aber<br />
um ein extrem risikoaverses und nicht um ein risikoneutrales Individuum.<br />
(3) Nash-Kriterium<br />
Gegeben seien kardinale Präferenzen, jedoch keinerlei Vergleichbarkeit <strong>der</strong> individuellen<br />
Nutzen. Die soziale Wohlfahrtsfunktion muss dann invariant gegenüber - zwischen<br />
den Individuen möglicherweise verschiedenen - positiven linearen Transformationen<br />
~ i i i i i<br />
u = α<br />
+ β u , β > 0<br />
- 81- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
i<br />
sein. Dies erfüllt das Nash-Kriterium (mit u c ) als Nutzen von i im Status quo):<br />
( 0<br />
w( 0<br />
0<br />
1 2 1 1 2 2<br />
u , u ) = ( u ( c) − u ( c ))( u ( c)<br />
− u ( c )) .<br />
Durch Einsetzen sieht man ~ 1 ~ 2 1 2 1 2<br />
w( u , u ) = β β w( u , u ) , so dass sich nach den Transformationen<br />
in <strong>der</strong> Tat dieselbe soziale Rangordnung ergibt.<br />
(4) Verallgemeinertes Nash-Kriterium<br />
Gegeben seien kardinale Präferenzen und eine Vergleichbarkeit nur <strong>der</strong> Nutzenän<strong>der</strong>ungen<br />
durch die wirtschaftspolitische Entscheidungsträgerin. Die soziale Wohlfahrtsfunktion<br />
muss dann gegenüber positiven linearen Transformationen von <strong>der</strong> Art<br />
~ i i i<br />
u = α + βu<br />
, β > 0 ,<br />
invariant sein. Dies erfüllt das verallgemeinerte Nash-Kriterium:<br />
1 2 1 1 δ 2 2 1−δ<br />
w( u , u ) = ( u ( c) − u ( c )) ( u ( c)<br />
− u ( c )) , δ ≥ 0 .<br />
0<br />
~ 1 ~ 2<br />
1 2<br />
1 2<br />
w( u , u ) = β w( u , u ) liefert dieselbe soziale Rangordnung wie w( u , u ) . c0 bezeichnet<br />
hier wie<strong>der</strong> den Status quo, <strong>der</strong> dann erhalten bleibt, wenn kein wirtschaftspolitisches<br />
Eingreifen erfolgt.<br />
Veranschaulichung <strong>der</strong> Wohlfahrtsfunktionen<br />
Eine Veranschaulichung <strong>der</strong> Resultate dieser unterschiedlichen Wohlfahrtsfunktionen<br />
lässt sich für den Fall mit zwei Individuen an einem einfachen Schaubild durchführen.<br />
v 1<br />
u<br />
Zur Verdeutlichung <strong>der</strong> eingetragenen Punkte:<br />
O<br />
N<br />
0<br />
U<br />
R<br />
E<br />
45 o<br />
N: Nash<br />
U: Utilitaristisch<br />
R: Rawls<br />
E: Egalitär<br />
v 2<br />
u<br />
- 82- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
• Für die Isowohlfahrtskurven zur utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion kann man<br />
schreiben:<br />
1 2<br />
2<br />
w = u + u ⇒ u = wkonst.<br />
−<br />
u<br />
2<br />
Dies liefert eine Schar von im 45-Grad Winkel fallenden Linien und den Punkt U<br />
als Tangentialpunkt mit <strong>der</strong> bis R verlaufenden Pareto-effizienten Grenze.<br />
• Für die Nash-Wohlfahrtsfunktion kann man schreiben:<br />
1 2<br />
1 2<br />
1<br />
2<br />
Sei u ( 0 ) = u ( 0 ) = 0 ⇒ w = u ⋅u<br />
⇒ u = wkonst.<br />
u<br />
Dies liefert eine Hyperbel-Schar und den Tangentialpunkt N.<br />
• Für die Rawls’sche Wohlfahrtsfunktion ist zu bedenken:<br />
1<br />
max min(u<br />
,u<br />
2<br />
)<br />
2 1<br />
Oberhalb <strong>der</strong> Winkelhalbierenden ist u < u , d.h. 2<br />
u ist das Minimum, das es zu<br />
1<br />
maximieren gilt. Unterhalb <strong>der</strong> Winkelhalbierenden ist u das Minimum. Maximierung<br />
führt jedoch in den an<strong>der</strong>en Bereich (Punkte unterhalb <strong>der</strong> Winkelhalbierenden<br />
sind Pareto-ineffizient). Insgesamt führt dies auf den Punkt R.<br />
Im Schaubild ist von den betrachteten Kriterien das Kriterium von Rawls das egalitärste,<br />
das mit Pareto-Effizienz vereinbar ist. Wie Laffont (1988, S. 95) zeigt, ist diese Aussage<br />
ist von allgemeinerer Gültigkeit .<br />
3.3 Präferenzaggregation und Unmöglichkeitstheorem<br />
Typisch für wirtschaftspolitische Entscheidungen innerhalb einer Demokratie sind Entscheidungen<br />
in Form von Abstimmungen in verschiedenen Gremien (z.B. innerhalb <strong>der</strong><br />
Regierung o<strong>der</strong> im Parlament). Kennzeichnend für solche Abstimmung ist, dass sich ein<br />
Individuum (Mitglied eines Gremiums) für eine bestimmte Option aussprechen kann,<br />
etwa für einen bestimmten Haushaltsplan o<strong>der</strong> die Betrauung einer bestimmten Person<br />
mit einer Aufgabe. Dabei werden die Individuen diejenige Alternative wählen, die ihren<br />
Präferenzen am ehesten entspricht.<br />
Bei einem demokratischen Abstimmungsprozess setzt sich dabei die Option durch, die<br />
die meisten Stimmen in dem entsprechenden Gremium erhält. Man kann sagen, dass<br />
durch eine Abstimmung entsprechend den Geschäftsordnungsregeln aus den individuellen<br />
Präferenzen eine kollektive Präferenzordnung entsteht. Wie im folgenden gezeigt<br />
- 83- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
wird, ist die Bildung einer konsistenten kollektiven Präferenzordnung aus konsistenten<br />
individuellen Präferenzen nicht allgemein sichergestellt.<br />
3.3.1 Präferenzaggregation durch Wahl: Arrow’s-Wahlparadoxon<br />
Das Grundproblem bei <strong>der</strong> Aggregation individueller Präferenzen lässt sich an einem<br />
einfachen Beispiel verdeutlichen. Es gelte folgende individuelle Präferenzordnung für<br />
die Individuen I, II und III:<br />
Individuum I A > B > C<br />
Individuum II C > A > B<br />
Individuum III B > C > A<br />
A, B und C sind Optionen, die zur Abstimmung stehen. Individuum I zieht A B und B C<br />
vor, entsprechend gilt dann auch A > C. Für II und III gelten entsprechend dem Tableau<br />
an<strong>der</strong>e individuelle Präferenzordnungen.<br />
(i) Stehen alle drei Alternativen gleichzeitig zur Wahl, so werden die einzelnen Optionen<br />
je eine Stimme bekommen. Die Abstimmung führt zu keinem Ergebnis, d.h. es entsteht<br />
keine sinnvolle kollektive Präferenzordnung.<br />
(ii) Nimmt man stattdessen an, dass jeweils über zwei Optionen abgestimmt wird, so ergibt<br />
sich z.B. C > A, d.h. C wird gegenüber A präferiert, da I für A und II und III für C<br />
stimmen. Insgesamt resultieren bei paarweiser Abstimmung folgende Ergebnisse:<br />
B > C I, III für B, II für C<br />
A > B I, II für A, III für C<br />
C > A II, III für C, I für A<br />
Dies bedeutet für die gesamte Präferenzordnung des Gremiums<br />
C > A > B > C<br />
Diese Präferenzordnung ist inkonsistent - sie ist nicht transitiv und führt somit zu wi<strong>der</strong>sprüchlichen<br />
Ergebnissen: Im direkten Vergleich wäre in <strong>der</strong> kollektiven Präferenzordnung<br />
C gegenüber A bevorzugt, A jedoch gegenüber B und B wie<strong>der</strong>um gegenüber<br />
C.<br />
Dieser Sachverhalt wird als Arrow-Paradox bezeichnet. Es ist also keineswegs selbstverständlich,<br />
dass Abstimmungen zu einer konsistenten kollektiven Präferenzordnung<br />
führen. Eine weitere Konsequenz liegt darin, dass möglicherweise die Reihenfolge <strong>der</strong><br />
- 84- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Wahlgänge über ein Ergebnis entscheidet: Bei sukzessiver paarweiser Abstimmung<br />
(Verlierer scheidet jeweils aus) kann je nach Wahl <strong>der</strong> Abstimmungspaare jedes Resultat<br />
zustande kommen (falls z.B. mit A gegen C begonnen wird, gewinnt zunächst C und<br />
in <strong>der</strong> zweiten Runde B). Das Ergebnis <strong>der</strong> Abstimmung folgt somit nicht allein aus den<br />
Präferenzen <strong>der</strong> Abstimmenden („dem Mehrheitswillen“), son<strong>der</strong>n wird auch durch die<br />
Regeln <strong>der</strong> Abstimmung beeinflusst. Das dies nicht nur eine theoretische Möglichkeit<br />
ist, zeigt das folgende Praxisbeispiel.<br />
3.3.2 Wahlparadoxon in <strong>der</strong> Praxis: Abstimmung Berlin vs. Bonn<br />
Die jüngere deutsche Geschichte liefert einen Anwendungsfall, mit dem die Problematik<br />
<strong>der</strong> Aggregation individueller Präferenzen in einem realitätsnahen Kontext<br />
verdeutlicht werden kann. Am 20. Juni 1991 fand im Deutschen Bundestag die Abstimmung<br />
darüber statt, wo zukünftig Bundesregierung und Parlament ihren Sitz haben<br />
sollten. Zur Wahl standen die Städte Bonn und Berlin. Wir können diese Wahl als einen<br />
Mechanismus zur Aggregation individueller Präferenzen verstehen, insbeson<strong>der</strong>e deshalb,<br />
da <strong>der</strong> Fraktionszwang aufgehoben war und die Abgeordneten des Deutschen<br />
Bundestages nach ihrem Gewissen und ihren eigenen Interessen abstimmen konnten. Da<br />
überdies drei namentliche Abstimmungen stattfanden, liegt ein ungewöhnlich großes<br />
Maß an Information vor. Überdies kann davon ausgegangen werden, dass die Wahlentscheidungen<br />
<strong>der</strong> Abgeordneten nicht durch strategische Überlegungen verzerrt wurden,<br />
da kein Abgeordneter die Absichten aller an<strong>der</strong>en vor den Abstimmungen kannte<br />
und da es auch keinen erklärten Favoriten gab.<br />
Leininger (1993) untersuchte die Bundestagsabstimmung Berlin vs. Bonn aus <strong>der</strong> Perspektive<br />
<strong>der</strong> Public Choice Theorie (zu Einzelheiten vgl. Leininger (1993), The Fatal<br />
Vote: Berlin versus Bonn, Finanzarchiv, Heft 50, S. 1-20). Er ging dabei in zwei Schritten<br />
vor:<br />
• Aus dem beobachteten Abstimmungsverhalten jedes Abgeordneten in den drei<br />
Wahlgängen wird unter Verwendung von Konsistenzanfor<strong>der</strong>ungen die individuelle<br />
Präferenzordnung des Abgeordneten ermittelt (dieser Aspekt wird hier nicht behandelt<br />
- wer daran interessiert ist kann das bei Leininger im Detail nachlesen).<br />
• Es werden dann zu gegebenen individuellen Präferenzordnungen <strong>der</strong> Abgeordneten<br />
des Deutschen Bundestages die Wahlergebnisse bestimmt, die sich bei unterschiedlichen<br />
Wahlverfahren ergeben hätten.<br />
- 85- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Der zuletzt genannte Punkt ist auch deshalb von Interesse, da im Vorfeld <strong>der</strong> Abstimmung<br />
über die Hauptstadtfrage intensive Diskussionen in <strong>der</strong> Öffentlichkeit und im<br />
Ältestenrat des Deutschen Bundestages über das zur Anwendung kommende Wahlverfahren<br />
stattfanden.<br />
Ein wesentliches Ergebnis <strong>der</strong> Arbeit von Leininger ist, dass das Wahlergebnis - wie<br />
vor dem Hintergrund des Wahlparadoxons nicht überraschend - von <strong>der</strong> Art des<br />
Wahlverfahrens entscheidend mitbestimmt wurde.<br />
Im Kern standen drei Vorschläge zur Auswahl:<br />
• Alternative A (Konsensantrag Berlin/Bonn): Das Parlament zieht nach Berlin, die<br />
Regierung bleibt in Bonn.<br />
• Alternative B (Vollendung <strong>der</strong> Einheit Deutschlands): Parlament und Regierung<br />
ziehen nach Berlin.<br />
• Alternative C (Bundesstaatslösung): Parlament und Regierung verbleiben in Bonn.<br />
Leininger untersuchte eine Reihe von Abstimmungsverfahren, von denen wir beispielhaft<br />
drei herausgreifen:<br />
• Mehrheitswahl mit Stichwahl<br />
• Vergabe von Rangziffern (Bordas Regel): 2 Punkte für die präferierte Alternative, 1<br />
Punkt für die mittlere, kein Punkt für die am schlechtesten bewertete<br />
• Zustimmungswahl: Jede Alternative, die man prinzipiell akzeptieren könnte erhält<br />
ein Stimme (je<strong>der</strong> kann eine, zwei o<strong>der</strong> drei Stimmen vergeben).<br />
Ergebnis:<br />
• Bei Mehrheitswahl (M) gewinnt B (Umzug nach Berlin), weil es in <strong>der</strong> Stichwahl<br />
<strong>der</strong> Alternative C (alles bleibt in Bonn) vorgezogen wird. Ergebnis im Detail: erster<br />
Wahlgang: A:147, B:221, C:290; Stichwahl B-C: 337-320<br />
• Bei Bordas Regel (B) gewinnt C (alles bleibt in Bonn) - A:513, B:708, C:750. In<br />
einem gewissen Sinn haben die Bonn-Befürworter stärkere Präferenzen für Bonn,<br />
während die Berlin-Befürworter eher auch mit dem Kompromiß leben könnten.<br />
• Bei <strong>der</strong> Zustimmungswahl (Z) gewinnt A (Parlament nach Berlin, Regierung bleibt<br />
in Bonn) - konkretes Ergebnis: A:367, B:337, C:320. Die Zustimmungswahl beinhaltet<br />
schon vom Grundkonzept her die Idee des Kompromisses, so daß dieses Ergebnis<br />
an sich nicht verwun<strong>der</strong>lich ist.<br />
- 86- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
3.3.3 Arrow’s Unmöglichkeitstheorem<br />
Das Problem <strong>der</strong> Aggregation individueller Präferenzen zu einer sozialen Zielfunktion<br />
hat in <strong>der</strong> Theorie erhebliches Interesse gefunden. An eine solche soziale Zielfunktion<br />
o<strong>der</strong> kollektive (gesellschaftliche, soziale) Entscheidungsregel zur Bewertung von Zuständen<br />
sind einige auf Arrow zurückgehende und scheinbar naheliegende Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
zu stellen:<br />
• Die Entscheidungsregel sollte vollständig in dem Sinn sein, dass sie für alle Kombinationen<br />
von Zuständen einen Vergleich im Sinne von „mindestens so gut wie“ liefert.<br />
• Die gesellschaftliche Entscheidungsregel sollte monoton bezüglich Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
individuellen Rangordnungen sein. Das bedeutet, wird ein Zustand c 1 gegenüber<br />
einem Zustand c 2 sozial präferiert und än<strong>der</strong>n sich die individuellen Wertschätzungen<br />
dahingehend, dass einige Individuen c 1 nun positiver einschätzen und niemand<br />
1 c negativer einschätzt als zuvor, so wird c 1 auch nach dieser Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
individuellen Einschätzungen sozial präferiert.<br />
• Die soziale Entscheidungsregel sollte unabhängig von irrelevanten Alternativen<br />
sein. D.h. die gesellschaftliche Entscheidung hinsichtlich zweier Zustände c 1 und<br />
c 2 darf nicht dadurch verän<strong>der</strong>t werden, dass den Individuen zusätzlich eine dritte<br />
Alternative c 3 zur Wahl gestellt wird.<br />
• Es sollte Souveränität <strong>der</strong> Individuen gelten. D.h. wir erwarten von unserer sozialen<br />
Entscheidungsregel, dass sie <strong>der</strong> Gesellschaft nicht auferlegt ist in dem Sinn, dass<br />
ein Zustand c 1 gegenüber c 2 für alle beliebigen individuellen Präferenzen gesellschaftlich<br />
präferiert wird.<br />
• Schließlich verlangen wir von unserer sozialen Entscheidungsregel, dass sie nicht<br />
diktatorisch ist. Das bedeutet, es gibt kein Individuum, dessen Präferenzen sich gegen<br />
die Präferenzen aller an<strong>der</strong>en Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> durchsetzen.<br />
Es handelt sich bei <strong>der</strong> Suche nach einem Aggregationsmechanismus für individuelle<br />
Präferenzen um ein Thema, das nicht nur in <strong>der</strong> „social choice“ Theorie <strong>der</strong> Volkswirtschaftslehre<br />
des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts behandelt wurde, son<strong>der</strong>n schon viel früher in <strong>der</strong> mathematischen<br />
Theorie von Wahlmechanismen z.B. von Borda (1781) und Condorcet<br />
(1785) Beachtung fand. Dort wurde auch das oben vorgestellte „Wahlparadoxon“ heraus<br />
gearbeitet, das wir heute als ein Beispiel für die Unmöglichkeit einer kollektiven<br />
Entscheidungsregel interpretieren. Das Ergebnis genauerer Überlegungen lautet, dass<br />
es keine kollektive Entscheidungsregel und damit keine Aggregation individueller Prä-<br />
- 87- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
ferenzen geben kann, die diesen - auf den ersten Blick so einleuchtenden - Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
gerecht wird. Dieses Resultat ist seit Mitte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts unter dem Namen<br />
„Unmöglichkeitstheorem“ von Arrow bekannt. Auch <strong>der</strong> demokratische Abstimmungsmechanismus<br />
unterliegt dieser „Unmöglichkeit“. Er löst nicht das Problem <strong>der</strong> Präferenzaggregation,<br />
wenn man die Anfor<strong>der</strong>ung von Arrow stellt.<br />
3.3.4 Konsequenzen des Unmöglichkeitstheorems für die <strong>Wirtschaftspolitik</strong><br />
Was besagt nun dieses Unmöglichkeitstheorem? Ist es etwa so zu verstehen, daß es keine<br />
soziale Rangordnung von Zuständen, damit auch keine Zielfunktion geben kann,<br />
anhand <strong>der</strong>er bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen rational zwischen Alternativen<br />
gewählt werden kann? Die Möglichkeit einer rationalen <strong>Wirtschaftspolitik</strong> wäre dann<br />
nicht gegeben.<br />
Die Frage ist nur dann zu bejahen, wenn man<br />
• die bei <strong>der</strong> Herleitung des Theorems an den Aggregationsmechanismus gestellten<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen alle akzeptiert und als unverzichtbar erachtet und<br />
• den bei <strong>der</strong> Herleitung des Theorems zugrunde gelegten Informationsstand als zutreffend<br />
akzeptiert.<br />
Dieser Informationsstand ist <strong>der</strong>, <strong>der</strong> sich aus <strong>der</strong> Ablösung <strong>der</strong> utilitaristischen Denktradition<br />
durch die Neue Wohlfahrtstheorie ergab. Im Utilitarismus war interpersoneller<br />
Nutzenvergleich zugelassen und gleichzeitig jegliche Nicht-Nutzeninformation ausgeschlossen.<br />
Man verdeutlicht sich dies am einfachsten durch einen Blick auf die soziale<br />
Wohlfahrtsfunktion des Utilitarismus, die als Summe über individuelle Nutzen definiert<br />
ist. Mit <strong>der</strong> Herleitung des Nutzenkonzepts aus Präferenzordnungen und <strong>der</strong> Entstehung<br />
<strong>der</strong> neuen Wohlfahrtstheorie wurde im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t die Vergleichbarkeit<br />
individueller Nutzen zur fortan unzulässigen Annahme, so dass we<strong>der</strong> interpersonelle<br />
Nutzenvergleiche noch Nicht-Nutzeninformation in die Bildung einer sozialen Wohlfahrtsfunktion<br />
eingehen konnten.<br />
Wie Sen (1995, S. 8) treffend feststellt, ist <strong>der</strong> Versuch, soziale Wohlfahrt abzuwägen,<br />
ohne interpersonelle Nutzenvergleiche anzustellen und ohne Nicht-Nutzeninformation<br />
zu verwenden, keine fruchtbare Übung. Auch kann kaum bestritten werden, dass wir<br />
uns in <strong>der</strong> Realität Gedanken machen über die Verteilung von Gütern, dass wir in bestimmtem<br />
Umfang Armut und Ungleichheit reduzieren wollen. Ein solches Denken<br />
erfor<strong>der</strong>t aber interpersonelle Vergleiche. Sobald diese zugelassen sind, verschwindet<br />
- 88- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
das Unmöglichkeitstheorem. Diese Vergleiche mögen ungenau und immer umstritten<br />
sein, aber sie werden verwendet und sind auch unverzichtbar.<br />
Die Zulassung interpersoneller Nutzenvergleiche „rettet“ die Möglichkeit Zustände kollektiv<br />
zu bewerten und erlaubt damit die Existenz von Entscheidungskriterien für die<br />
<strong>Wirtschaftspolitik</strong>. Sie hilft jedoch nicht bei <strong>der</strong> Auswahl von sozialen Entscheidungsmechanismen,<br />
wie z.B. Wahlverfahren, die auf Äußerungen <strong>der</strong> Individuen über ihre<br />
Präferenzen basieren. Hier hat das Unmöglichkeitstheorem größere Bedeutung. Auswege<br />
sind dadurch zu finden, dass man die Relevanz <strong>der</strong> von Arrow aufgestellten Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
hinterfragt.<br />
Schwächt man die für die vorangegangene Beweisführung zentrale For<strong>der</strong>ung nach einem<br />
universellen Definitionsbereich ab, dann erhält man Entscheidungsmechanismen,<br />
die für große Bereiche individueller Präferenzprofile die restlichen Anfor<strong>der</strong>ungen erfüllen.<br />
Prominentestes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Unterstellung eingipfliger<br />
Präferenzen. Dies mag für viele Entscheidungssituationen, so z.B. über die<br />
Höhe des staatlichen Budgets, durchaus angemessen sein (siehe dazu das Medianwählermodell<br />
in 4.3).<br />
Die an<strong>der</strong>e Anfor<strong>der</strong>ung, auf die sich das Interesse konzentrierte, ist die <strong>der</strong> Unabhängigkeit<br />
von irrelevanten Alternativen. Bekannte und in <strong>der</strong> Praxis viel verwendete Entscheidungsmechanismen,<br />
wie z.B. <strong>der</strong> von Borda (1781) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> von Condorcet (1785)<br />
verletzen diese Bedingung. Im übrigen ist anzumerken, dass die Borda-Regel ein Element<br />
des interpersonellen Nutzenvergleichs enthält: Dadurch, dass Rangziffern aggregiert<br />
werden, unterstellt man beispielsweise, dass <strong>der</strong> Unterschied zwischen <strong>der</strong> ersten<br />
und <strong>der</strong> zweiten Präferenz bei einem Individuum ebenso bedeutend ist wie bei einem<br />
an<strong>der</strong>en.<br />
Wenig sinnvoll erscheint es, das Diktaturverbot aus <strong>der</strong> Liste <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen zu streichen<br />
und statt dessen einen „wohlwollenden Diktator“ für die Zielformulierung anzunehmen.<br />
Zum einen bestehen Zweifel am dauerhaften „Wohlwollen“ von Diktatoren, zu<br />
an<strong>der</strong>en vermag selbst bei gegebenem „Wohlwollen“ ein solcher Diktator die individuellen<br />
Präferenzen <strong>der</strong> Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> nicht prinzipiell besser zu aggregieren als<br />
beispielsweise ein demokratisches Wahlverfahren. Hat man zwischen den zwei „Übeln“<br />
Demokratie – als mit dem Unmöglichkeitstheorem belastetes Verfahren zur Präferenzaggregation<br />
– und Diktatur – als scheinbarer Ausweg aus dem Unmöglichkeitstheorem<br />
– zu wählen, so ist eindeutig die Demokratie die überlegene Option.<br />
- 89- © K. Morasch, 2002
<strong>Grundzüge</strong> <strong>der</strong> <strong>Wirtschaftspolitik</strong> Kapitel 3: Zielbildung<br />
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass aus dem Unmöglichkeitstheorem von Arrow nur dann<br />
die Unmöglichkeit eines sozialen Abwägens zwischen Zuständen folgt, wenn man interpersonelle<br />
Nutzenvergleiche rigoros ablehnt und auf <strong>der</strong> Erfüllung <strong>der</strong> gesamten Liste<br />
<strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen an einen Aggregationsmechanismus beharrt. Aus wirtschaftspolitischer<br />
Perspektive war dies für viele vermutlich ohnehin nie ein großes Problem. Dort kann<br />
man von <strong>der</strong> Existenz einer kollektiven Präferenzordnung eines Entscheidungsträgers<br />
ausgehen, die ganz natürlich die Interessen unterschiedlicher Teile <strong>der</strong> Gesellschaft miteinan<strong>der</strong><br />
vergleicht. <strong>Wirtschaftspolitik</strong> deshalb als irrational zu bezeichnen, weil diese<br />
Präferenzordnung des Entscheidungsträgers sich nicht im Sinne einer Präferenzaggregation<br />
à la Arrow aus individuellen Präferenzen herleiten lässt, drückt nicht<br />
nur ein sehr individualistisches, son<strong>der</strong>n auch ein unrealistisches Weltbild aus.<br />
- 90- © K. Morasch, 2002