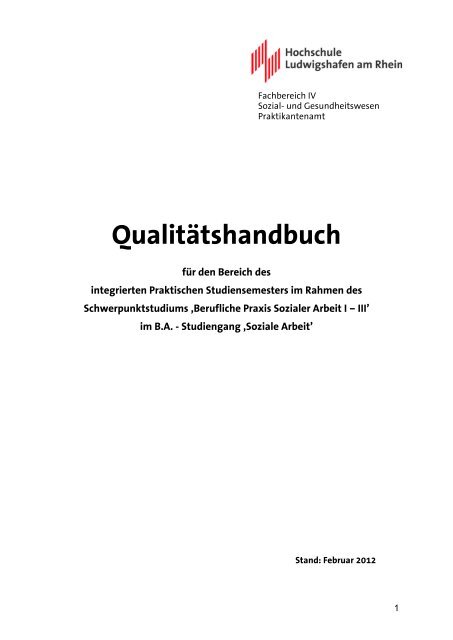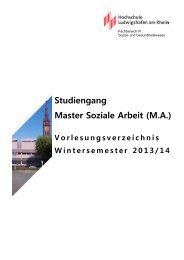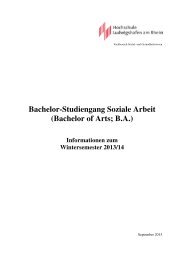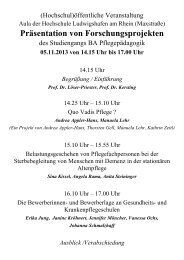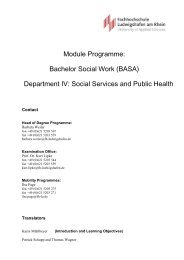Qualitätshandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Qualitätshandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Qualitätshandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
<strong>Qualitätshandbuch</strong><br />
für den Bereich des<br />
integrierten Praktischen Studiensemesters im Rahmen des<br />
Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I – III’<br />
im B.A. - Studiengang ‚Soziale Arbeit’<br />
Stand: Februar 2012<br />
1
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
Fachbereich IV - Sozial- und Gesundheitswesen -<br />
Maxstraße 29<br />
67059 <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Zuständiger Bereich:<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Michael Dillmann, Dipl.-Pädagoge, Dipl.-Sozialarbeiter (FH), Dipl.-Mediator<br />
Tel. (0621) 5 203 – 536<br />
Fax (0621) 5 203 – 579<br />
E-Mail: michael.dillmann@fh-ludwigshafen.de<br />
2
Gliederung<br />
Einleitung<br />
1. Rechtsgrundlagen / grundlegende Bestimmungen<br />
1.1. § 20 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 20. August 2003<br />
1.2. Auszug aus dem Landesgesetz über die staatliche Anerkennung von<br />
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und<br />
Sozialpädagogen (SoAnG) vom 7. November 2000 (GVBl. S. 437) in<br />
Verbindung mit dem 1. Landesgesetz zur Änderung des SoAnG<br />
1.3. Praktikumsordnung (PraktO) der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> -Fachbereich<br />
IV- für den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ vom 16.09.2009<br />
1.4. Auszug aus der Prüfungsordnung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> -<br />
Fachbereich IV- für den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ vom 16.09.2009)<br />
2. Aktueller Stand der Qualitätsentwicklung im Bereich des<br />
Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’ mit<br />
dem integrierten Praktischen Studiensemester<br />
2.1. Die Studienschwerpunktgebiete des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche<br />
Praxis Sozialer Arbeit I - III’ im Rahmen des B.A.-Studiengangs Soziale<br />
Arbeit’ (Stand: Februar 2010)<br />
2.1.1. Soziale Arbeit als Hilfe zur Erziehung<br />
2.1.2. Soziale Arbeit mit suchtgefährdeten / suchtkranken Menschen<br />
2.1.3. Soziale Arbeit mit alten, behinderten und kranken Menschen<br />
2.1.4. Soziale Arbeit mit straffälligen Menschen und ihrem Umfeld<br />
2.1.5. Soziale Arbeit mit psychisch kranken / behinderten Menschen<br />
2.1.6. Soziale Arbeit mit Migrantinnen und Migranten<br />
2.1.7. Soziale Arbeit mit Menschen in finanziell schwierigen Situationen<br />
2.1.8. Soziale Arbeit als Bildung, Betreuung und Erziehung in der Kindheit<br />
2.2. Lernzielkatalog zur Erreichung der Qualifikationsziele des Praktischen<br />
Studiensemesters (§ 3 Absatz 2 PraktO)<br />
2.3. Form des Ausbildungsplans (§ 3 Absatz 3 und § 12 PraktO)<br />
2.4. Qualität der halbtägigen Lehrveranstaltungen in Form von<br />
Praxisberatung / Supervision während des Praktischen Studiensemester<br />
(§ 6 Absatz 3 PraktO)<br />
2.5. Form des Praktikumsberichts (§ 11 PraktO)<br />
3. Anhang<br />
3.1. Musterformularsatz<br />
3.2. Terminübersicht<br />
3.3. Liste anerkannter Praktikumsstellen (nur bei Bedarf)<br />
3
Einleitung<br />
Der modular aufgebaute, siebensemestrige B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ an der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> beinhaltet ein Schwerpunktstudium ‚Berufliche Praxis<br />
Sozialer Arbeit I - III’ (Wahlpflicht), das in besonderem Maße auf die Förderung<br />
berufsfeldspezifischer Kompetenzen zielt und aus den Modulen ‚Berufliche Praxis<br />
Sozialer Arbeit I’ (Modul 10), ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit II (Modul 11) und<br />
‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit III’ (Modul 14) besteht.<br />
Das Modul ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit II’ (Modul 11) erfolgt in der Form eines<br />
Praktischen Studiensemesters. Der Studiengang integriert so ‚Praxis’ als einen<br />
spezifischen Lernort und ein wichtiges Referenzsystem. Bereits während ihres<br />
Studiums erhalten die Studierenden einen exemplarischen Einblick in ein Arbeitsfeld<br />
der Sozialen Arbeit, sie erfahren diese als konkrete berufliche Praxis und sind<br />
gefordert, ihr Wissen, Verstehen und Können gezielt, kontextsensibel und<br />
lösungsorientiert einzusetzen, um vielfältige Problem-, Frage- und Aufgabenstellungen<br />
dieser Praxis angemessen zu bestimmen, mögliche Lösungsstrategien und Methoden<br />
kriteriengeleitet abzuwägen, zu entscheiden und zu vertreten sowie Interventionen zu<br />
planen, umzusetzen, zu reflektieren und zu bewerten.<br />
Der durch die Praktikumsstelle und die <strong>Hochschule</strong> kooperativ angeleitete und<br />
begleitete ‚Lernort Praxis’ zielt in besonderer Weise auf die Vermittlung der Fähigkeit<br />
zu Integration und Transfer sowie zur transdisziplinären Reflexivität. Die Studierenden<br />
erfahren die besondere Bedeutung von ‚Persönlichkeit’ und ‚Haltung’ (Solidarität und<br />
Empathie, Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit, Stabilität und Belastbarkeit, etc.) in<br />
Interaktionsprozessen und erhalten wichtige Impulse für ihr weiteres Studium. Der<br />
Studiengang erhält konstant Rückmeldungen zur ‚Praxistauglichkeit’ seines<br />
Studienprogr<strong>am</strong>ms und wichtige Anregungen zur Weiterentwicklung und Sicherung<br />
einer praxisbezogenen Lehre.<br />
Der Qualität des integrierten praktischen Studiensemesters im Rahmen des<br />
Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’ des B.A.-Studiengangs<br />
‚Soziale Arbeit’ kommt gerade im Rahmen eines Fachhochschulstudiengangs, der in<br />
besonderem Maße der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden bei<br />
hoher Anwendungsorientierung sicherzustellen hat ( § 2 Hochschulgesetzes<br />
(HochSchG) vom 20. August 2003 ), eine herausragende Bedeutung zu.<br />
Die Praktikumsordnung für den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Ludwigshafen</strong> soll diese Qualität sichern. Sie regelt Ziele, Inhalte, Organisation und<br />
Durchführung des integrierten Praktischen Studiensemesters im Rahmen des<br />
Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Soziale Arbeit I - III’.<br />
Für die Qualitätsentwicklung im Bereich des integrierten praktischen<br />
Studiensemesters im Rahmen des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer<br />
Arbeit I - III’ des B.A.- Studiengangs ‚Soziale Arbeit’ ist das Praktikanten<strong>am</strong>t der<br />
<strong>Hochschule</strong> zuständig (§ 7 Absatz 2 Satz 6 Praktikumsordnung). Der aktuelle Stand<br />
dieser Qualitätsentwicklung ist im <strong>Qualitätshandbuch</strong> für den Bereich des integrierten<br />
Praktischen Studiensemesters im Rahmen des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis<br />
Sozialer Arbeit I - III’ dokumentiert. Entscheidungen im Hinblick auf<br />
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung auf organisatorischer Ebene erfolgen im<br />
Rahmen der Entscheidungsstrukturen der <strong>Hochschule</strong>. Das Praktikanten<strong>am</strong>t hat dabei<br />
sicherzustellen, dass in die - diesen Entscheidungen vorausgehenden -<br />
Meinungsbildungsprozesse die unterschiedlichen Qualitätsperspektiven relevanter<br />
4
Qualitätsbetroffener (Studierende, Anstellungsträger, Anleiter/innen, andere<br />
<strong>Hochschule</strong>n, Fachdisziplin Soziale Arbeit etc.) einfließen.<br />
Bezogen auf die Dimensionen der Qualität der Praktischen Studiensemester auf<br />
welche die <strong>Hochschule</strong> nicht unmittelbar Einfluss nehmen kann, hat sie ihrerseits über<br />
das Praktikanten<strong>am</strong>t meinungsbildend tätig zu werden.<br />
Das Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
5
1. Rechtsgrundlagen / grundlegende Bestimmungen<br />
1.1. § 20 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 20. August 2003<br />
Studienpläne<br />
Für jeden Studiengang stellt die <strong>Hochschule</strong> einen Studienplan auf. Er<br />
unterrichtet über die Inhalte, gegebenenfalls einschließlich einer in den<br />
Studiengang eingeordneten beruflichen Praxis, die Schwerpunkte und<br />
Anforderungen, insbesondere die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und in<br />
der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Teilnahme- und Leistungsnachweise<br />
eines Studiums, dessen Aufbau und Umfang seinen Abschluss innerhalb der<br />
Regelstudienzeit ermöglichen müssen. Im Studienplan ist die Gelegenheit zur<br />
selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an<br />
zusätzlichen, insbesondere fachübergreifenden Lehrveranstaltungen nach<br />
eigener Wahl auszuweisen. Er soll orientierende Lehrveranstaltungen für<br />
Eingangssemester, einen Vorschlag für eine sinnvolle Abfolge der<br />
Lehrveranstaltungen, zumindest für das Grundstudium, und eine Empfehlung<br />
vorsehen, in welchen Fällen die Studierenden eine Studienfachberatung in<br />
Anspruch nehmen sollen.<br />
1.2. Auszug aus dem Landesgesetz über die staatliche Anerkennung von<br />
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und<br />
Sozial-pädagogen (SoAnG) vom 7. November 2000 (GVBl. S. 437) in<br />
Verbindung mit dem 1. Landesgesetz zur Änderung des SoAnG<br />
§ 1 Staatliche Anerkennung und Berufsbezeichnung<br />
(1) Die staatliche Anerkennung erhält auf Antrag, wer<br />
1. in den Studiengängen Sozialarbeit oder Sozialpädagogik oder in einem<br />
inhaltlich vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich<br />
anerkannten <strong>Hochschule</strong><br />
a) ein sechssemestriges Studium erfolgreich abgeschlossen und daran<br />
anschließend ein Berufspraktikum gemäß § 6 erfolgreich absolviert hat<br />
(zweiphasige Ausbildung) oder<br />
b) ein Diplomstudium einschließlich zwei von der <strong>Hochschule</strong> begleiteten<br />
Praxissemestern mit Diplom oder ein Bachelorstudium einschließlich einer<br />
Praxisausbildung von mindestens 60 Leistungspunkten mit Bachelor of Arts<br />
erfolgreich abgeschlossen hat (einphasige Ausbildung) und<br />
2. die für die Ausübung des Berufes erforderliche persönliche Zuverlässigkeit<br />
und erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse besitzt.<br />
Das Berufspraktikum, die praktische Studiensemester und die Praxisausbildung<br />
dienen dem Nachweis der Fähigkeit, im Studium erworbene Kenntnisse<br />
sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns in der Praxis des<br />
sozialen Dienstes öffentlicher oder freier Träger anzuwenden.<br />
(2) Die staatliche Anerkennung berechtigt entsprechend dem Studienabschluss<br />
nach Absatz 1 und § 1 a zur Führung der Berufsbezeichnung "Staatlich<br />
anerkannte Sozialarbeiterin" oder "Staatlich anerkannter Sozialarbeiter" oder<br />
6
"Staatlich anerkannte Sozialpädagogin" oder "Staatlich anerkannter<br />
Sozialpädagoge" oder "Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin"<br />
oder "Staatlich anerkannter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge".<br />
(3) Ist gegen die Antragstellerin oder den Antragsteller wegen des Verdachts<br />
einer Straftat, aus der sich Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit ergeben,<br />
ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über den Antrag bis zur<br />
Beendigung des Verfahrens ausgesetzt werden. Die Antragstellerin oder der<br />
Antragsteller ist vorher zu hören.<br />
§ 16 Praxissemester und Praxisausbildung<br />
(1) Im einphasigen Diplomstudiengang treten an die Stelle des<br />
Berufspraktikums zwei in das Studium integrierte Praxissemester. Im Bachelor-<br />
Studiengang erfolgt eine Praxisausbildung von mindestens 60<br />
Leistungspunkten; davon müssen mindestens 30 Leistungspunkte in Form eines<br />
zus<strong>am</strong>menhängenden Praktikums in der Praxis des sozialen Dienstes<br />
öffentlicher oder freier Träger erworben werden, die übrigen Leistungspunkte<br />
können auch im Rahmen einzelner Praxissegmente während des Studiums<br />
erworben werden.<br />
(2) Die Praxissemester und die Praxisausbildung sollen die Studierenden<br />
befähigen, unter Einbezug der bisher im Studium erworbenen<br />
wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden sozialarbeiterischen und<br />
sozialpädagogischen Handelns und studienbegleitender Projektarbeit<br />
selbstständig und eigenverantwortlich im Bereich der Sozialarbeit und der<br />
Sozialpädagogik tätig zu sein und berufspraktische Aufgaben unter<br />
Berücksichtigung der rechtlichen, organisatorischen und finanziellen<br />
Rahmenbedingungen wahrzunehmen.<br />
(3) Die Praxissemester und die Praxisausbildung müssen dem Berufspraktikum<br />
insbesondere hinsichtlich des Abschlusses gleichwertig sein. Über die<br />
Gleichwertigkeit entscheidet die zuständige Behörde.<br />
(4) Die staatliche Anerkennung wird, soweit der Nachweis nach Absatz 3 Satz 1<br />
erbracht ist, im Auftrag der zuständigen Behörde von der zuständigen<br />
<strong>Hochschule</strong> erteilt.<br />
§ 17 Durchführung der Praxissemester und der Praxisausbildung<br />
(1) Über die Anerkennung der Praxisstellen und die Inhalte und die<br />
Durchführung der Praxissemester und der Praxisausbildung entscheiden die<br />
<strong>Hochschule</strong>n. Als Träger von Praxisstellen zur Durchführung der Praxissemester<br />
und der Praxisausbildung können insbesondere die in § 8 Abs. 1 genannten<br />
Ausbildungsstellen anerkannt werden. Weitere anerkannte Praxisstellen sind<br />
der zuständigen Behörde anzuzeigen.<br />
(2) Auf Antrag der <strong>Hochschule</strong> kann die zuständige Behörde festlegen, dass<br />
Aufgaben zur Durchführung des § 16 „Praxissemester und Praxisausbildung“<br />
auf das Landes<strong>am</strong>t für Soziales, Jugend und Versorgung übertragen werden.<br />
Dies gilt auch für die Übertragung auf weitere Stellen.<br />
7
1.3. Praktikumsordnung (PraktO) der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> -Fachbereich IV -<br />
für den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ vom 16.09.2009<br />
Auf Grund des § 20 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 20. August 2003<br />
sowie des Landesgesetzes über die staatliche Anerkennung von<br />
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozialpädagoginnen und<br />
Sozialpädagogen (SoAnG) vom 7. November 2000 (GVBl. S. 437) hat der Rat der<br />
Evangelischen <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> 28. November 2007 die folgende<br />
Ordnung zur Regelung des integrierten Praktischen Studiensemesters im<br />
Rahmen des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’ des<br />
B.A.- Studiengangs ‚Soziale Arbeit’ (Praktikumsordnung) beschlossen. Die<br />
Praktikumsordnung wurde vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend<br />
und Kultur <strong>Rhein</strong>land- Pfalz mit Schreiben vom 14.08.2009 genehmigt.<br />
§ 1 Geltungsbereich<br />
(1) Die Praktikumsordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den B.A.-<br />
Studiengang ‚Soziale Arbeit’ an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> die Ziele, Inhalte,<br />
Organisation und Durchführung des integrierten Praktischen Studiensemesters im<br />
Rahmen des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’ des B.A.-<br />
Studiengangs ‚Soziale Arbeit’ (§ 2 Absatz 2).<br />
§ 2 Art und curriculare Verortung des integrierten Praktischen Studiensemesters<br />
(1) Das Praktische Studiensemester ist ein curricular integrierter, von der <strong>Hochschule</strong><br />
geregelter, inhaltlich bestimmter und betreuter Studienabschnitt im Rahmen des<br />
modularisierten B.A.-Studiengangs ‚Soziale Arbeit’ an der <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Ludwigshafen</strong>, der mit Lehrveranstaltungen vorbereitet, begleitet, reflektiert und<br />
ausgewertet wird.<br />
(2) Im Rahmen des o.g. Studiengangs ist das integrierte Praktische Studiensemester<br />
ein eigenständiges Modul (Modul 11: ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit II’) und<br />
schließt mit einer modulbezogenen Prüfungsleistung ab (Praktikumsbericht; § 13<br />
Absatz 2). Zus<strong>am</strong>men mit Modul 10 (‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I’) und Modul<br />
14 (‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit III’) bildet das integrierte Praktische<br />
Studiensemester das Schwerpunktstudium ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’<br />
(Wahlpflicht) des o.g. Studiengangs.<br />
(3) Für die erfolgreiche Ableistung des integrierten Praktischen Studiensemesters<br />
werden in Anlehnung an das European Credit Transfer System 30 Leistungspunkte<br />
(ECTS; credits) vergeben (§ 5 Absatz 2). Diesen entspricht eine studentische<br />
Arbeitsbelastung von 900 Stunden.<br />
(4) Die Studierenden leisten das Praktische Studiensemester im Rahmen des von ihnen<br />
gewählten Studienschwerpunktgebiets (§ 9 Absatz 1) in der Regel in einer<br />
Einrichtung der Berufspraxis der Sozialen Arbeit ab (Praktikumsstelle; § 10 Absatz<br />
1).<br />
(5) Das Praktische Studiensemester kann auch durch entsprechende Zeiten im Ausland<br />
abgeleistet werden (§ 4 Absatz 2 Prüfungsordnung).<br />
(6) In begründeten Ausnahmefällen kann das Praktische Studiensemester auch in<br />
Form eines angeleiteten und begleiteten sozialwissenschaftlichen<br />
Forschungsprojektes oder eines gleichwertigen Praxisprojektes erfolgen. Die<br />
Entscheidung über die Ableistung des Praktischen Studiensemesters in dieser Form<br />
treffen die StudienschwerpunktleiterInnen im Einvernehmen mit dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t.<br />
8
§ 3 Ziele und Inhalte des integrierten Praktischen Studiensemesters<br />
(1) Das integrierte Praktische Studiensemester vermittelt Einblicke in Arbeitsfelder der<br />
Sozialen Arbeit sowie praktische Kenntnisse und Fähigkeiten in unmittelbarer,<br />
schrittweiser und angeleiteter Wahrnehmung beruflicher Aufgaben der Sozialen<br />
Arbeit. Hierbei üben die Studierenden ihre künftige berufliche Rolle ein und lernen,<br />
sie kritisch zu reflektieren.<br />
(2) Die Qualifikationsziele des Praktischen Studiensemesters im Einzelnen:<br />
Studierende haben exemplarisch einen vertieften Zugang zur Sozialen Arbeit<br />
als berufliche Praxis in sozialadministrativen Bezügen und - bezogen auf ein<br />
Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit - spezifisches Wissen und<br />
Handlungskompetenzen in unmittelbarer, schrittweiser und angeleiteter<br />
selbständiger Wahrnehmung beruflicher Aufgaben erworben.<br />
Sie sind in konkreten Zus<strong>am</strong>menhängen beruflicher Praxis in der Lage, ihr<br />
Wissen, Verstehen und Können gezielt, kontextsensibel und lösungsorientiert<br />
einzusetzen, um vielfältige Problem-, Frage- und Aufgabenstellungen dieser<br />
Praxis angemessen zu bestimmen, mögliche Lösungsstrategien und Methoden<br />
kriteriengeleitet abzuwägen, zu entscheiden und zu vertreten sowie<br />
Interventionen zu planen, umzusetzen, zu reflektieren und zu bewerten.<br />
Studierende wissen um die besondere Bedeutung von ‚Persönlichkeit’ und<br />
‚Haltung’ (Solidarität und Empathie, Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit,<br />
Stabilität und Belastbarkeit, etc.) in Interaktionsprozessen.<br />
Die Methoden ‚Supervision’ und ‚kollegiale Beratung’ (Intervision) sind den<br />
Studierenden bekannt. Sie sind in der Lage, diese Methoden zur Qualifizierung<br />
ihrer Rollen- und Beziehungsgestaltung zu nutzen.<br />
Studierende haben sich kritisch mit ihren biographisch geprägten Werten und<br />
Normen, den eigenen Deutungsmustern und Relevanzhorizonten sowie ihren<br />
persönlichen Verhaltensdispositiven auseinandergesetzt und können deren<br />
Einfluss im Rahmen ihrer Interventionen einschätzen.<br />
Sie sind in ausreichendem Maße in der Lage, ihre Rolle und ihre Beziehungen zu<br />
Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Praktikumsstelle sowie zu<br />
Kooperationspartnern dieser Stelle eigenverantwortlich und rollen- und<br />
aufgabengerecht zu gestalten.<br />
Studierende beginnen d<strong>am</strong>it, sich mit unterschiedlichen Modi der Rollen- und<br />
Beziehungsgestaltung sowie deren institutionalisierte Rahmungen im Sinne<br />
einer kritischen Sozialen Arbeit auseinander zu setzen.<br />
(3) Dem integrierten Praktischen Studiensemester liegt ein Ausbildungsplan (§ 12)<br />
zugrunde.<br />
(4) Erfolgt das integrierte Praktische Studiensemester in Form eines<br />
sozialwissenschaftlichen Forschungsprojektes oder eines gleichwertigen<br />
Praxisprojektes (§ 2 Abs. 6), hat der Ausbildungsplan (§ 3 Abs. 3) angemessene<br />
Qualifikationsziele auszuweisen (zu erwerbende praktische Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten) und darzustellen, wie der / die Studierende diese in einem<br />
angeleiteten und begleiteten Lernprozess schrittweise erwerben kann (Form und<br />
Umfang der Anleitung; zeitlicher und inhaltlicher Ablauf; Tätigkeitsschwerpunkte<br />
des / der Studierenden).<br />
§ 4 Dauer des integrierten Praktischen Studiensemesters<br />
(1) Das integrierte Praktische Studiensemester umfasst einen zus<strong>am</strong>menhängenden<br />
Zeitraum von 20 Wochen. Es erfolgt in Vollzeittätigkeit in einer Praktikumsstelle in<br />
einer Einrichtung der Berufspraxis der Sozialen Arbeit. Ein Urlaubsanspruch besteht<br />
während dieser Zeit nicht.<br />
9
(2) In begründeten Fällen kann das Praktische Studiensemester auf Antrag einer/eines<br />
Studierenden in Teilzeit erbracht werden. Es muss jedoch bis zu Beginn der<br />
Vorlesungen des folgenden Semesters abgeleistet sein. Über den Antrag und die<br />
näheren Bestimmungen der Modalitäten entscheidet das Praktikanten<strong>am</strong>t.<br />
§ 5 Teilnahmevoraussetzungen und Voraussetzungen für die Vergabe von<br />
Leistungspunkten (credits)<br />
(1) Das integrierte Praktische Studiensemester kann nur von Studierenden angetreten<br />
werden, für die eine Rückmeldebescheinigung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> zum<br />
fünften Studiensemester vorliegt, und die - nach dem studiengangsspezifischen<br />
Studienplan - die Module 1 - 10 erfolgreich abgeschlossen haben.<br />
(2) Die Vergabe von Leistungspunkten (credits) für das integrierte Praktische Studiensemester<br />
(Modul 11, ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit II’) erfolgt unter den<br />
folgenden Voraussetzungen:<br />
1. der/die Studierende weist die Teilnahme an den begleitenden<br />
Studientagen sowie an den Supervisionssitzungen nach (§ 6 Abs. 4),<br />
2. die Praktikumsstelle bescheinigt die erfolgreiche Ableistung des<br />
Praktikums,<br />
3. der Praktikumsbericht ist mit mindestens der Note 4,0 benotet.<br />
(3) Das Praktikum ist mit Erfolg abgeleistet, wenn die Leistungen der / des<br />
Studierenden trotz Mängeln mindestens den Anforderungen genügen.<br />
(4) Erfolgt das integrierte Praktische Studiensemester in Form eines<br />
sozialwissenschaftlichen Forschungsprojektes oder eines gleichwertigen<br />
Praxisprojektes (§ 2 Abs. 6) werden die dem Modul zugewiesenen Leistungspunkte<br />
(credits) unter folgenden Voraussetzungen vergeben:<br />
1. der/die Studierende weist die Teilnahme an den begleitenden<br />
Studientagen sowie an den Supervisionssitzungen nach (§ 6 Abs. 4),<br />
2. seitens der Projektleitung (Anleitung) wird die - mit Blick auf die<br />
Qualifikationsziele (§ 3 Abs. 4) - erfolgreiche Teilnahme <strong>am</strong> Projekt<br />
bescheinigt (§ 5 Abs. 3 gilt entsprechend),<br />
3. der von dem / der Studierenden zu erstellende Projektbericht ist mit<br />
mindestens der Note 4,0 benotet.<br />
§ 6 Curriculare Einbindung und fachliche Begleitung des integrierten Praktischen<br />
Studiensemesters<br />
(1) Die fachliche Einbindung des integrierten Praktischen Studiensemesters erfolgt -<br />
studien-schwerpunktgebietspezifisch - im Rahmen von vorbereitenden,<br />
begleitenden und nachbereitenden Lehrveranstaltungen und -<br />
studienschwerpunktgebietübergreifend - im Rahmen von Praxisberatung /<br />
Supervision.<br />
(2) Die - studienschwerpunktgebietspezifisch durchgeführten - vorbereitenden,<br />
begleitenden und nachbereitenden Lehrveranstaltungen werden jeweils von zwei<br />
haupt<strong>am</strong>tlich Lehrenden bzw. einem/einer haupt<strong>am</strong>tlich Lehrenden und<br />
einem/einer Lehrbeauftragten geleitet (Studienschwerpunktleiter/innen). Dabei<br />
soll jeweils ein/e Studienschwerpunktleiter/ -leiterin eine mehrjährige einschlägige<br />
berufliche Praxis in mindestens einem Praxisfeld des Schwerpunktgebietes<br />
vorweisen.<br />
(3) Während des integrierten Praktischen Studiensemesters werden mindestens 5<br />
ganztägige Lehrveranstaltungen im jeweiligen Studienschwerpunktgebiet und -<br />
studienschwerpunkt-gebietsübergreifend - 5 halbtägige Lehrveranstaltungen in<br />
Form von Praxisberatung / Supervision sichergestellt. Die Vor- und Nachbereitung<br />
10
des Praktischen Studiensemesters erfolgt in den studienschwerpunktgebietspezifisch<br />
durchgeführten Lehrveranstaltungen der Module 10 und 14.<br />
(4) Die Teilnahme an den in Absatz 1 genannten Lehrveranstaltungen einschließlich<br />
den Lehrveranstaltungen in Form von Praxisberatung / Supervision ist für die<br />
Studierenden verpflichtend.<br />
(5) Studierende, die ihr Praktikum an einer Praktikumsstelle im Ausland ableisten (§ 2<br />
Absatz 5), haben ein Äquivalent für die begleitenden Lehrveranstaltungen zu<br />
erbringen. Über Form und Umfang eines solchen Äquivalents entscheidet das<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t im Einvernehmen mit der Studienschwerpunktleitung.<br />
§ 7 Aufgaben des Praktikanten<strong>am</strong>ts<br />
(1) Für die Anerkennung der Praktikumsstellen und die organisatorische Abwicklung<br />
des integrierten Praktischen Studiensemesters ist das Praktikanten<strong>am</strong>t zuständig.<br />
Dessen Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs IV der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> bestimmt.<br />
(2) Des Weiteren ist das Praktikanten<strong>am</strong>t Ansprechpartner für die Träger,<br />
Trägerverbände und Einrichtungen Sozialer Arbeit in allen Fragen, welche die<br />
Organisation und Durchführung des Praktischen Studiensemesters betreffen. Es<br />
führt regelmäßig Informationsveranstaltungen für Studierende zu Fragen des<br />
Praktischen Studiensemesters durch. Das Praktikanten<strong>am</strong>t organisiert das<br />
Wahlverfahren im Rahmen des Schwerpunktstudiums (§ 9). Es berät Studierende in<br />
Fragen der Vorbereitung und Durchführung des Praktischen Studiensemesters und<br />
deren Integration in die persönliche Studien- und Berufsplanung. Das<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t führt eine Liste anerkannter Praktikumsstellen. Es ist<br />
verantwortlich für die Qualitätsentwicklung im Bereich des integrierten<br />
Praktischen Studiensemesters.<br />
§ 8 Aufgaben der Studienschwerpunktleiter/-leiterinnen<br />
(1) Die StudienschwerpunktleiterInnen sind für die Studierenden<br />
AnsprechpartnerInnen in allen fachlichen Fragen des Praxisfeldes sowie bei der<br />
Vorbereitung und Durchführung des Praktischen Studiensemesters und deren<br />
Integration in die persönliche Studien- und Berufsplanung. Sie halten Kontakt mit<br />
den Praktikumsstellen.<br />
(2) Die StudienschwerpunktleiterInnen empfehlen den Studierenden bei Bedarf<br />
rechtzeitig Praxisberatung / Supervision in Form von Einzel- oder Gruppenberatung<br />
über die angebotene Praxisberatung / Supervision nach § 6 Absatz 3 hinaus.<br />
(3) Die StudienschwerpunktleiterInnen stellen die fachliche Begleitung (Vorbereitung,<br />
Reflexion, Auswertung / Evaluation, Dokumentation) des integrierten Praktischen<br />
Studiensemesters sicher.<br />
(4) Die StudienschwerpunktleiterInnen beraten die Studierenden bei der Erstellung des<br />
Praktikumsberichts.<br />
(5) Die StudienschwerpunktleiterInnen sind zuständig für die Genehmigung des<br />
Ausbildungsplans und die Überprüfung von dessen Einhaltung.<br />
(6) Die StudienschwerpunktleiterInnen stellen Lernzielkontrollen im Sinne der<br />
allgemeinen Ziele des integrierten Praktischen Studiensemesters sowie der im<br />
Ausbildungsplan aufgeführten besonderen Lernziele sicher.<br />
§ 9 Wahl und Bildung der Studienschwerpunktgebiete<br />
(1) Die Studierenden absolvieren das integrierte Praktische Studiensemester (5.<br />
Semester) sowie dessen Vor- und Nachbereitung (4. Semester bzw. 6. und 7.<br />
Semester) in einem von ihnen zu wählenden Studienschwerpunktgebiet im<br />
Rahmen des Studienschwerpunkts ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I - III’<br />
11
(Wahlpflicht) (§2 Absatz 2). Der Fachbereich IV der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong><br />
bestimmt hierzu sechs Studienschwerpunktgebiete. Er stellt dabei sicher, dass<br />
diese das Spektrum der beruflichen Praxis Sozialer Arbeit abbilden.<br />
(2) Am Ende des zweiten Studiensemesters reichen die<br />
StudienschwerpunktleiterInnen die aktualisierten Darstellungen ihrer<br />
Schwerpunktgebiete beim Praktikanten<strong>am</strong>t ein. Diese werden den Studierenden zu<br />
Beginn des dritten Studiensemesters durch Aushang bekannt gemacht. Danach<br />
führt das Praktikanten<strong>am</strong>t für die Studierenden des dritten Studiensemesters eine<br />
Informationsveranstaltung durch, in der Ziele und Organisation des integrierten<br />
Praktischen Studiensemesters sowie die Rahmenkonzepte, Inhalte und die<br />
LeiterInnen der Studienschwerpunktgebiete vorgestellt werden.<br />
(3) Die Wahl eines Studienschwerpunktgebiets durch die Studierenden muss<br />
schriftlich innerhalb einer Woche nach der Informationsveranstaltung dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t gegenüber erfolgen.<br />
(4) Die Höchst- bzw. Mindestzahl der Studierenden eines Studienschwerpunktgebiets<br />
wird jeweils vom Fachbereichsrat festgelegt.<br />
(5) Das Praktikanten<strong>am</strong>t organisiert das Wahlverfahren im Rahmen des<br />
Schwerpunktstudiums, das die festgelegten Höchst- und Mindestzahlen in den<br />
sechs Studienschwerpunktgebieten sicherstellt.<br />
§ 10 Praktikumsstellen<br />
(1) Praktikumsstellen sind grundsätzlich Einrichtungen und Dienste öffentlicher oder<br />
freier Träger der Sozialen Arbeit.<br />
(2) Die Praktikumsstellen bedürfen der Anerkennung durch das Praktikanten<strong>am</strong>t.<br />
Diese wird nur erteilt, wenn sichergestellt ist, dass<br />
a.) sich die Praktikumsstelle als Lernort versteht, an dem die Studierenden in<br />
einem Handlungsfeld Sozialer Arbeit deren berufstypische<br />
Handlungsvollzüge erlernen und einüben können, und sie erklärt, die<br />
Ausbildung unter Beachtung der Praktikumsordnung und § 16 Absatz 2<br />
SoAnG auf der Grundlage des Ausbildungsplans (§ 12) durchzuführen,<br />
b.) die Praktikumsstelle eine/einen staatlich anerkannte(n) Diplom-<br />
Sozialarbeiter/<br />
-in bzw. Diplom-Sozialpädagogen/-in mit mindestens dreijähriger<br />
Berufserfahrung mit der Anleitung beauftragt,<br />
c.) in der Praktikumsstelle für die Sozialverwaltung typische Vorgänge<br />
regelmäßig zu bearbeiten sind,<br />
d.) die Praktikumsstelle erklärt, im Rahmen der Präsenzzeit des/der<br />
Studierenden (20 Wochen Vollzeit, d.h. 20 x 37,5 Stunden = 750 Stunden)<br />
eine Kontaktzeit mit der Anleiterin, dem Anleiter von mindestens 300<br />
Stunden sicherzustellen,<br />
e.) die Praktikumsstelle den Studierenden - im Rahmen der Präsenzzeit (s. o.)<br />
- die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstaltungen nach § 6<br />
Absatz 3 ermöglicht,<br />
f.) die Praktikumsstelle nach Ableistung des Praktikums bescheinigt, ob<br />
dieses erfolgreich bzw. nicht-erfolgreich abgeleistet wurde (§ 5 Absatz 3),<br />
g.) sich die Praktikumsstelle verpflichtet, Hinweise darauf, dass das<br />
Praktikum nicht mit Erfolg abgeleistet werden kann, unverzüglich dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t der Fachochschule mitzuteilen. Die/der Studierende ist<br />
hiervon in Kenntnis zu setzen.<br />
(3) In besonders begründeten Fällen können für Fachkräfte mit einschlägiger<br />
abgeschlossener Hochschulausbildung, die über eine mehrjährige Berufspraxis in<br />
12
einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit verfügen, Ausnahmen von der Voraussetzung<br />
nach Absatz 2 Ziffer b) zugelassen werden.<br />
(4) Bei Praktikumsstellen im Ausland kann von der Regelung in Absatz 2 Ziffer e.)<br />
Abstand genommen werden.<br />
(5) Kommt die Praktikumsstelle ihrer Verpflichtung nach Absatz 2 Ziffer g.) nicht nach,<br />
verliert sie ihr Recht, den Nicht-Erfolg des Praktikums wirks<strong>am</strong> zu bescheinigen.<br />
§ 11 Wahl der Praktikumsstelle<br />
(1) Die Studierenden wählen ihre Praktikumsstelle aus dem Kreis der vom Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
anerkannten Praktikumsstellen. Die Wahl bedarf der Genehmigung der<br />
jeweiligen StudienschwerpunktleiterInnen. Eine Genehmigung setzt voraus, dass<br />
die Handlungsvollzüge der Praktikumsstelle im gewählten<br />
Studienschwerpunktgebiet angemessen begleitet und reflektiert werden können. §<br />
10 bleibt unberührt.<br />
(2) Die Studierenden haben die von ihnen gewählte Praktikumsstelle dem Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
spätestens acht Wochen vor Beginn des Praktischen Studiensemesters<br />
schriftlich mitzuteilen.<br />
(3) Spätestens zwei Wochen nach Beginn des Praktikums teilen die Studierenden dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t schriftlich mit, dass sie das Praktikum angetreten haben.<br />
§ 12 Ausbildungsplan<br />
(1) Die Praktikumsstelle erstellt zus<strong>am</strong>men mit dem / der Studierenden einen<br />
Ausbildungsplan.<br />
(2) Der Ausbildungsplan beschreibt die Qualifikationsziele, den zeitlichen und inhaltlichen<br />
Ablauf, die Form der Praktikumsanleitung sowie die Tätigkeitsschwerpunkte<br />
des Studierenden im Rahmen des Praktikums.<br />
(3) Der Ausbildungsplan bedarf der Genehmigung durch das Praktikanten<strong>am</strong>t. Dieses<br />
genehmigt den Ausbildungsplan im einvernehmen mit der<br />
Studienschwerpunktleitung.<br />
§ 13 Praktikumsbericht<br />
(1) Die Studierenden schließen das integrierte Praktische Studiensemester mit der<br />
Erstellung eines Praktikumsberichts ab.<br />
(2) Der Praktikumsbericht stellt eine studienbegleitende Modulprüfung im Sinne von §<br />
11 der Prüfungsordnung für den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ dar und fließt als<br />
Prüfungsleistung - in Form einer schriftlichen Prüfung nach § 13 der<br />
Prüfungsordnung - in die Ges<strong>am</strong>tnote der Bachelorprüfung ein (Prüfungsordnung<br />
§ 10 Absatz 3 Satz 1). Der Praktikumsbericht ist von den SchwerpunktleiterInnen zu<br />
bewerten.<br />
§ 14 Wechsel des Studienschwerpunktgebiets<br />
(1) Ein Wechsel des Studienschwerpunktgebiets ist nur einmalig und lediglich bis zum<br />
Ende der sechsten Woche des Praktischen Studiensemesters möglich. Ein Wechsel<br />
setzt die Zustimmung des Praktikanten<strong>am</strong>ts und der betroffenen<br />
Studienschwerpunktleitung voraus.<br />
(2) Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn durch den Wechsel die Mindestzahl<br />
des abgebenden Studienschwerpunktgebiets nicht unter- und die Höchstzahl des<br />
aufnehmenden Studienschwerpunktgebiets nicht überschritten wird.<br />
(3) Der Antrag auf Wechsel des Studienschwerpunktgebiets ist schriftlich beim<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t zu stellen.<br />
13
§ 15 Wechsel der Praktikumsstelle<br />
Während des integrierten Praktischen Studiensemesters kann die Praktikumsstelle nur<br />
in begründeten Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung des Praktikanten<strong>am</strong>ts und<br />
der StudienschwerpunktleiterInnen gewechselt werden.<br />
§ 16 Krankheit während des integrierten Praktischen Studiensemesters<br />
Durch Krankheit, Mutterschutz oder Erziehungsurlaub nicht angetretene Zeiten des<br />
Praktischen Studiensemesters werden bis zu drei Wochen auf die Dauer des<br />
Praktischen Studiensemesters angerechnet. Der Krankheit von Studierenden steht die<br />
Krankheit eines von ihnen allein zu versorgenden Kindes gleich.<br />
§ 17 In Kraft treten<br />
Diese Ordnung tritt <strong>am</strong> 29.09.2009 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ihr Studium an<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> nach dem 01.09.2008 begonnen haben.<br />
<strong>Ludwigshafen</strong>, den 01.10.2009<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Der Präsident<br />
14
1.4 Auszug aus der Prüfungsordnung der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> - Fachbereich IVfür<br />
den B.A.-Studiengang ‚Soziale Arbeit’ vom 16.09.2009<br />
§ 4 Regelstudienzeit und Praktisches Studiensemester<br />
(1) Das Studium umfasst eine Regelstudienzeit von sieben Semestern. Die für den<br />
erfolgreichen Studienabschluss erforderlichen Lehrveranstaltungen (Pflicht- und<br />
Wahlpflichtveranstaltungen) und Prüfungsanforderungen ergeben sich aus dem<br />
Studienplan (s. Anlage 1). Die Regelstudienzeit schließt die Prüfungszeiten -<br />
einschließlich der Bachelorarbeit - ein. Insges<strong>am</strong>t ist dem Studium eine<br />
studentische Arbeitsbelastung entsprechend 210 ECTS-Punkte (European Credit<br />
Transfer System) zugeordnet. Der Studiengang beinhaltet ein Praktisches<br />
Studiensemester (§ 5 Abs. 4).<br />
(2) Das integrierte Praktische Studiensemester (5. Studiensemester) stellt - im Verbund<br />
mit weiteren Modulen, die in besonderem Maße professionsspezifische Methodenund<br />
Handlungskompetenz sowie berufsfeldspezifische Qualifikationen vermitteln -<br />
die Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung sicher. Es kann auch durch<br />
entsprechende Zeiten im Ausland abgeleistet werden.<br />
§ 5 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots, Auslandssemester<br />
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind - auf das Qualifikationsziel des<br />
Studienganges hin bestimmte - funktionale Elemente des Studienganges, die sich<br />
in thematisch zus<strong>am</strong>menhängende Lehrveranstaltungen ausdifferenzieren und mit<br />
einer Modulprüfung (§ 10 Abs. 2 und § 11) abschließen (s. Studienplan, Anlage 1).<br />
(2) Mit bestandener Modulprüfung (§ 11 Abs. 10) werden - unter der Voraussetzung<br />
des Vorliegens aller sonstigen Voraussetzungen für die Vergabe von<br />
Leistungspunkten - für jedes abgeschlossene Modul Leistungspunkte (credits)<br />
vergeben. Die Zuordnung dieser Leistungspunkte zu den Modulen, die Form der<br />
Modulprüfungen und die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten<br />
sind dem Studienplan (s. Anlage 1) zu entnehmen.<br />
(3) Der für ein Modul aufzuwendende studentische Arbeitsaufwand wird durch<br />
Leistungspunkte (credits) beschrieben. Pro Semester werden 30, pro Studienjahr 60<br />
Leistungspunkte vergeben und den Modulen zugeordnet (s. Studienplan, Anlage 1).<br />
Das entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand (work load) von etwa 900<br />
Stunden pro Semester bzw. 1.800 Stunden pro Studienjahr. Berücksichtigt werden<br />
dabei auch die Zeiten für Prüfungsvorbereitungen, integrierte praktische<br />
Studienphasen, Arbeits- und Projektgruppen sowie die Bachelorarbeit. Das Nähere<br />
regelt der Studienplan (s. Anlage 1).<br />
(4) Die Module im Rahmen des Studienganges erstrecken sich im Regelfall über zwei<br />
Semester (d.h. ein Studienjahr). Das Modul des Praktischen Studiensemesters<br />
erstreckt sich über ein Semester und umfasst 20 Wochen; es ist auf Antrag i.S. eines<br />
Teilzeitpraktikums verlängerbar bis Vorlesungsbeginn des anschließenden<br />
Semesters. Über diesen Antrag entscheidet das Praktikanten<strong>am</strong>t (§ 4 Abs. 2<br />
Praktikumsordnung). Die Module oder ihre zugehörigen Lehrveranstaltungen<br />
können blockweise angeboten werden.<br />
15
(5) Generell kann ein Semester an einer <strong>Hochschule</strong> im Ausland abgeleistet werden.<br />
Vor Antritt muss die Genehmigung eines äquivalenten Studienplans beim<br />
Prüfungsausschuss eingeholt werden. Im Ausland erbrachte gleichwertige Studienund<br />
Prüfungsleistungen werden auf Antrag durch den Prüfungsausschuss<br />
angerechnet.<br />
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß<br />
(1) Eine Modulprüfung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet bzw. - im Falle einer<br />
Modulprüfung in Form einer nicht benoteten Studienleistung - als „nicht<br />
bestanden “, wenn Studierende zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe<br />
nicht erscheinen oder wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von<br />
der Prüfung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Modulprüfung<br />
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Wird eine<br />
Wiederholungsprüfung ohne triftigen Grund (nach Absatz 2) versäumt, erlischt der<br />
Prüfungsanspruch.<br />
(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungstermins oder für den Rücktritt nach Beginn<br />
einer Prüfung geltend gemachten Gründe müssen dem vorsitzenden Mitglied des<br />
Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht<br />
werden. Bei Krankheit soll das Attest unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes<br />
Verzögern, spätestens bis zum dritten Tag nach dem Prüfungstermin bei dem<br />
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses vorliegen. Das Attest muss die<br />
Prüfungsunfähigkeit erkennen lassen. Die Vorlage eines <strong>am</strong>tsärztlichen Attestes<br />
kann verlangt werden. Der Krankheit von Studierenden steht die Krankheit eines<br />
von ihnen allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt das vorsitzende Mitglied<br />
des Prüfungsausschusses die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt. Die<br />
bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.<br />
(3) Versuchen Studierende das Ergebnis einer Modulprüfung durch Täuschung oder<br />
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende<br />
Leistung als mit "nicht ausreichend" bewertet bzw. - im Falle einer Modulprüfung in<br />
Form einer nicht benoteten Studienleistung - als „nicht bestanden“ ( ... ).<br />
(4) Eine Modulprüfung - einschließlich der Bachelorarbeit - gilt als endgültig nicht<br />
bestanden, wenn sie ganz oder in wesentlichen Teilen nicht durch den Studenten<br />
oder die Studentin selbst verfasst wurde (Plagiat). Eine Wiederholung der Leistung<br />
bzw. Arbeit ist in diesem Fall ausgeschlossen. Zur Beurteilung, ob ein Plagiat<br />
vorliegt, ist ein weiterer Prüfer oder eine weitere Prüferin hinzu zu ziehen. Der bzw.<br />
die Studierende ist vor der Entscheidung zu hören.<br />
(5) Entscheidungen nach Absatz 3 und 4 sind vom Prüfungsausschuss den<br />
Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer<br />
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.<br />
§ 10 Umfang und Art der Bachelorprüfung<br />
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus<br />
studienbegleitenden Modulprüfungen gemäß §§ 11-16, einschließlich der<br />
Bachelorarbeit gemäß § 18.<br />
(2) Modulprüfungen können sein:<br />
schriftliche Prüfungen gemäß § 13;<br />
mündliche Prüfungen gemäß § 14;<br />
Kombination aus schriftlicher und mündlicher Prüfung oder<br />
sonstige Prüfungsformen gemäß § 15.<br />
16
(3) In die Ges<strong>am</strong>tnote (Bachelorprüfung) fließen die Noten der Modulprüfungen, die<br />
als Prüfungsleistungen erfolgen (§ 11 Abs. 1 Satz 2), ein. Die Noten der<br />
Modulprüfungen, die als Studienleistungen erfolgen (§ 11 Abs. 1 Satz 2), bleiben bei<br />
der Bildung der Ges<strong>am</strong>tnote unberücksichtigt. Anlage 1 weist aus, welche Module<br />
mit einer Prüfungsleistung und welche mit einer Studienleistung abschließen.<br />
§ 11 Zweck, Durchführung und Bestehen von Modulprüfungen<br />
(1) Jedes Modul schließt mit einer - dem Qualifikationsziel des Moduls adäquaten -<br />
Modulprüfung ab. Modulprüfungen erfolgen als Studienleistungen oder als<br />
Prüfungsleistungen. Der Studienplan (s. Anlage 1) weist aus, welche Module mit<br />
einer Studienleistung und welche Module mit einer Prüfungsleistung abschließen.<br />
In einer Modulprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden zentrale<br />
Inhalte und Methoden des Prüfungsmoduls beherrschen und die erworbenen<br />
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbständig anwenden können.<br />
(2) Die Prüfungsanforderungen sind an den Inhalten der Lehrveranstaltungen und an<br />
den Qualifikationen zu orientieren, die aufgrund des studiengangspezifischen<br />
Studienplanes (s. Anlage 1) für das betreffende Modul vorgesehen sind.<br />
(3) Art und Form der Modulprüfungen ergeben sich aus dem Studienplan (s. Anlage 1)<br />
und dem Modulhandbuch.<br />
(4) Die Modulprüfung kann sich in mehrere einzelne Studien- bzw. Prüfungsleistungen<br />
mit gleicher oder unterschiedlicher Prüfungsform nach den §§ 13 bis 15<br />
untergliedern. Der Studienplan (s. Anlage 1) weist aus, bzgl. welcher Module von<br />
dieser Regelung Gebrauch gemacht wird. Gruppenprüfungen sind zulässig.<br />
(5) Klausuren und mündliche Prüfungen sollen innerhalb eines Prüfungszeitraums<br />
stattfinden, der vom Prüfungsausschuss festgesetzt wird. Der Prüfungsausschuss<br />
legt Termine und Dauer der Prüfungen fest und bestimmt, bis zu welcher Frist die<br />
Meldung und ggf. der Antrag auf Zulassung mit den erforderlichen Unterlagen<br />
spätestens vorliegen muss. Der Prüfungstermin und der Termin für den Antrag auf<br />
Zulassung zu den Prüfungen werden den Studierenden - spätestens zwei Wochen<br />
vor der betreffenden Prüfung - durch Aushang bekannt gegeben.<br />
(6) Andere Prüfungsformen werden von den Prüfenden organisiert.<br />
(7) Machen Studierende glaubhaft, dass sie wegen Krankheit oder Behinderung nicht<br />
in der Lage sind, Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form<br />
abzulegen, hat das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses zu gestatten,<br />
diese Leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige<br />
Leistungen in anderer Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines qualifizierten<br />
ärztlichen Attests verlangt werden.<br />
(8) Im Falle von Studierenden mit Behinderungen sind deren Belange zur Wahrung<br />
ihrer Chancengleichheit in Modulprüfungen durch die Gestaltung der<br />
Leistungsbedingungen zu berücksichtigen.<br />
(9) Werden Lehrveranstaltungen in einer Fremdsprache abgehalten, können die entsprechenden<br />
Modulprüfungen auch in der Fremdsprache gefordert werden.<br />
Darüber sind die Studierenden spätestens mit der Veröffentlichung des<br />
Prüfungstermins zu informieren.<br />
(10) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie gemäß § 19 mit mindestens der Note<br />
4,0 (ausreichend) bewertet wurde bzw. - im Falle einer Modulprüfung in Form einer<br />
nicht benoteten Studienleistung -, wenn sie mit bescheinigtem Erfolg erbracht<br />
wurde. Dies ist dann der Fall, wenn die Studienleistung trotz Mängeln mindestens<br />
den Anforderungen genügt.<br />
17
§ 12 Zulassung zu den Modulprüfungen und Fristen<br />
(1) Eine Modulprüfung kann nur ablegen, wer ordnungsgemäß für den<br />
entsprechenden Studiengang an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> eingeschrieben ist.<br />
(2) Die Modulprüfungen werden von Studierenden eines studentischen Jahrgangs<br />
unmittelbar im Anschluss an das jeweilige Modul, das für diesen Jahrgang<br />
angeboten wird, abgelegt. Erfolgt die Modulprüfung in der Form einer sonstigen<br />
Prüfungsform nach § 15, kann diese auch im laufenden Modul erbracht werden.<br />
(3) Über den Antrag auf Zulassung zu Studien- bzw. Prüfungsleistungen gemäß § 11<br />
Abs. 5 entscheidet der Prüfungsausschuss. Der Antrag auf Zulassung ist zus<strong>am</strong>men<br />
mit den gemäß Abs. 6 erforderlichen Unterlagen schriftlich zu dem gemäß § 11<br />
Abs. 5 festgelegten Termin an das Prüfungs<strong>am</strong>t zu richten. Die Zulassung zur<br />
Wiederholung einer Modulprüfung ist spätestens im darauffolgenden Studienjahr<br />
zu beantragen. Andernfalls gilt die Modulprüfung erstmals als nicht bestanden<br />
(4) Hängt die Einhaltung einer für die Meldung oder Ablegung einer Prüfung oder ihrer<br />
Wiederholung vorgeschriebenen Frist von Studienzeiten ab, werden<br />
Verlängerungen und Unterbrechungen nicht berücksichtigt, soweit sie<br />
1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien<br />
einer <strong>Hochschule</strong>, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks,<br />
2. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von den Studierenden nicht zu<br />
vertretende Gründe oder<br />
3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes bedingt waren;<br />
im Falle der Nummer 3 ist mindestens die Inanspruchnahme der Fristen<br />
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend<br />
dem § 4 des Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) über die Elternzeit zu<br />
ermöglichen.<br />
Unberücksichtigt bleibt ferner ein ordnungsgemäßes einschlägiges<br />
Auslandsstudium bis zu zwei Semestern; dies gilt nicht für Auslandsstudienzeiten,<br />
die nach dieser Prüfungsordnung abzuleisten sind.<br />
Die Nachweise obliegen den Studierenden. Die Entscheidung über das Vorliegen<br />
der Gründe nach § 26 Abs. 1 Satz 5 HochSchG trifft der Prüfungsausschuss auf<br />
Antrag der zu prüfenden Person.<br />
(5) Prüfungs- oder Studienleistungen können bereits vor dem Fachsemester abgelegt<br />
werden, in dem die Prüfung gemäß dem Studienplan (s. Anlage 1) vorgesehen ist.<br />
(6) Der Meldung bzw. dem Antrag auf Zulassung haben die Studierenden beizufügen:<br />
1. eine Erklärung der Studierenden, ob sie eine Prüfung in dem eingeschriebenen<br />
Bachelorstudiengang endgültig nicht bestanden haben oder ob sie sich in<br />
einem solchen Studiengang an einer anderen <strong>Hochschule</strong> in einem<br />
Prüfungsverfahren befinden,<br />
2. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wie oft sowie in welchen Modulen oder<br />
Prüfungsgebieten bereits Prüfungsleistungen in demselben Studiengang oder<br />
in anderen Studiengängen an einer <strong>Hochschule</strong> in Deutschland nicht bestanden<br />
wurden,<br />
3. eine Erklärung, ob bei den vorgesehenen mündlichen Prüfungen einer<br />
Zulassung von Zuhörenden widersprochen wird und<br />
4. die Nachweise der fachlichen Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige<br />
Prüfung.<br />
Ist es nicht möglich, die Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise zu erbringen,<br />
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Weise zu führen.<br />
(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn<br />
1. die Studierenden die Prüfung in dem eingeschrieben Studiengang an einer<br />
<strong>Hochschule</strong> in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden<br />
18
haben oder wenn sie sich in einem solchen Studiengang in einem<br />
Prüfungsverfahren befinden,<br />
2. die Wiederholung der Prüfungsleistung nach dieser Prüfungsordnung<br />
unmöglich geworden ist oder<br />
3. der Antrag auf Zulassung oder die Beibringung der erforderlichen Unterlagen<br />
unvoll-ständig oder nicht termingerecht erfolgte.<br />
§ 13 Schriftliche Prüfungen<br />
(1) In schriftlichen Prüfungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in<br />
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln Probleme erkennen und mit<br />
fachspezifischen Methoden Lösungen entwickeln können.<br />
(2) Schriftliche Prüfungen sind: Klausurarbeiten, Seminararbeiten, Hausarbeiten (zu<br />
diesen zählt auch der Praktikumsbericht) und Projektarbeiten. Schriftliche<br />
Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind in der Regel ausgeschlossen.<br />
(3) Schriftliche Prüfungen werden in der Regel von einem Prüfenden bewertet. Führt<br />
das Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung zum Verlust des Prüfungsanspruches,<br />
erfolgt eine Zweitbewertung durch eine vom Vorsitzenden des<br />
Prüfungsausschusses zu bestimmende weitere prüfende Person.<br />
(4) Klaussuren dauern mindestens 90 Minuten.<br />
(5) Die Studierenden haben sich bei Klausuren auf Verlangen der aufsichtführenden<br />
Person mit einem <strong>am</strong>tlichen Ausweis auszuweisen.<br />
(6) Seminararbeiten, Projektarbeiten und Hausarbeiten beinhalten die eigenständige<br />
schriftliche Bearbeitung eines modulbezogenen Themas. Die Bearbeitungszeit<br />
beträgt zwischen 2 und 8 Wochen. Sie beginnt mit der Ausgabe des Themas durch<br />
die Lehrende oder den Lehrenden. Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten können<br />
durch die Studierenden präsentiert werden. Den Studierenden muss dies<br />
gleichzeitig mit der Festlegung der Bearbeitungszeit bekannt gegeben werden (§ 11<br />
Abs. 5 und 6).<br />
(7) Durch Projektarbeiten werden in der Regel die Te<strong>am</strong>fähigkeit und die Fähigkeit zur<br />
Problemanalyse sowie zur Entwicklung und Präsentation von Lösungsansätzen<br />
nachgewiesen. Hierbei sollen die Studierenden zeigen, dass sie an einer größeren<br />
Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte<br />
erarbeiten können. Abs. 6 Satz 2 bis 5 gelten entsprechend.<br />
(8) Seminararbeiten, Hausarbeiten und Projektarbeiten sind Einzelarbeiten oder<br />
Gruppenarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss der als Prüfungsleistung zu<br />
bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden deutlich unterscheidbar und<br />
bewertbar sein.<br />
(9) Die Dauer bzw. die Bearbeitungszeit von Klausuren legt der Prüfungsausschuss fest<br />
(§ 11 Abs. 5).<br />
(10) Die Seminararbeiten, Hausarbeiten und Projektarbeiten sind spätestens <strong>am</strong><br />
Abgabetermin in der geforderten Form bei der Lehrenden oder dem Lehrenden<br />
abzuliefern. Bei der Abgabe haben die Studierenden zu versichern, dass sie die<br />
Arbeit – bei Gruppenarbeiten ihren entsprechend gekennzeichneten Teil -<br />
selbstständig angefertigt haben und keine als die angegebenen und bei Zitaten<br />
kenntlich gemachten Hilfsmittel benutzt haben. Der Abgabezeitpunkt der<br />
schriftlichen Arbeit ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung durch die Post ist der<br />
Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend.<br />
(11) Schriftliche Prüfungen sind in der Regel innerhalb von sechs Wochen, spätestens<br />
jedoch zum Vorlesungsbeginn des nächsten Semesters zu bewerten. Die<br />
Bekanntmachung des Bewertungsergebnisses durch Aushang ist ausreichend.<br />
19
§ 19 Bewertung von benoteten Studienleistungen und Prüfungsleistungen, Bildung<br />
der Ges<strong>am</strong>tnote<br />
(1) Prüfungsleistungen sowie benotete Studienleistungen sind durch Noten<br />
differenziert zu beurteilen. Die einzelnen Noten werden von den jeweiligen<br />
Prüfenden festgesetzt.<br />
(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen und der benoteten Studienleistungen<br />
sind folgende Noten zu verwenden:<br />
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;<br />
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den<br />
durchschnittlichen Anforderungen liegt;<br />
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen<br />
Anforderungen entspricht;<br />
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel<br />
noch den Anforderungen genügt;<br />
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher<br />
Mängel den Anforderungen nicht mehr<br />
genügt.<br />
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder<br />
erhöhte Notenziffern verwendet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind<br />
ausgeschlossen.<br />
(3) Wird eine Prüfungsleistung bzw. eine benotete Studienleistung durch mehrere<br />
Prüfende bewertet, errechnet sich die Note, sofern nicht in dieser Prüfungsordnung<br />
etwas anderes bestimmt ist, aus dem arithmetischen Mittel der Noten der<br />
einzelnen Bewertungen.<br />
(4) Für die Umrechnung der Noten in die ECTS-Bewertungsskala gelten die Regeln der<br />
Kultusministerkonferenz (KMK) in der jeweilig gültigen Fassung.<br />
(5) Die Ges<strong>am</strong>tnote für das Bachelor-Studium wird aus dem Durchschnitt sämtlicher<br />
Prüfungsleistungen und der zweifach gewichteten Note der Bachelorarbeit<br />
gebildet.<br />
§ 21 Freiversuch<br />
(1) Eine Modulprüfung gilt im Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen, wenn<br />
die Prüfung zu dem im Studienplan (s. Anlage 1) vorgesehenen Zeitpunkt oder<br />
früher abgelegt wurde (Freiversuch). Pro Modul ist nur ein Freiversuch möglich.<br />
(2) Für die Bachelorarbeit wird ein Freiversuch nicht gewährt. Studien- und Prüfungsleistungen,<br />
die an anderen <strong>Hochschule</strong>n erbracht und angerechnet wurden, sind<br />
vom Freiversuch ausgeschlossen. Prüfungen, die wegen Täuschungen oder eines<br />
sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestanden erklärt wurden, sind<br />
ebenfalls vom Freiversuch ausgeschlossen.<br />
(3) Eine im Freiversuch bestandene Prüfungsleistung (§10 Abs. 3 Satz 1) kann einmal<br />
zur Notenverbesserung zum jeweils nächsten Prüfungstermin wiederholt werden.<br />
Wird eine Notenverbesserung nicht erzielt, bleibt die im ersten Prüfungsversuch<br />
erzielte Note gültig.<br />
(4) Für die Berechung des Zeitpunktes nach Abs. 1 ist § 12 Abs. 4 entsprechend zu<br />
berücksichtigen.<br />
§ 22 Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen<br />
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können nur einmal wiederholt werden. § 21<br />
Abs. 1 bleibt unberührt. Der Prüfungsausschuss setzt Wiederholungstermine fest.<br />
(2) Nicht bestandene Prüfungen im Studiengang Soziale Arbeit an einer anderen<br />
<strong>Hochschule</strong> in der Bundesrepublik Deutschland sind als Fehlversuche auf die<br />
20
zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche sind<br />
auch nicht bestandene Prüfungsleistungen in Modulen oder Prüfungsgebieten<br />
eines anderen Studiengangs an einer <strong>Hochschule</strong> in der Bundesrepublik<br />
Deutschland anzurechnen, die denen im Studiengang Soziale Arbeit im<br />
Wesentlichen entsprechen, soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere<br />
Anforderungen gestellt wurden.<br />
(3) Sind Teile einer Modulprüfung (§ 11 Abs. 4) nicht bestanden, so müssen nur diese<br />
wiederholt werden.<br />
(4) Die Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden. Eine nicht bestandene<br />
Bachelorarbeit muss innerhalb von zwei Monaten nach Datum des Bescheids über<br />
das Nichtbestehen neu angemeldet werden. Andernfalls gilt sie als nicht<br />
bestanden. Die Möglichkeit einer Fristverlängerung (§ 12 Abs. 4) bleibt davon<br />
unberührt.<br />
(5) Eine mindestens als ausreichend bewertete und d<strong>am</strong>it bestandene Modulprüfung<br />
kann nicht wiederholt werden. § 21 (Freiversuch) bleibt unberührt.<br />
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen<br />
(1) Haben Studierende bei einer Modulprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst<br />
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss<br />
nachträglich die Noten für diejenigen Studien- und oder Prüfungsleistungen, bei<br />
deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend berichtigen und die<br />
Bachelorprüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.<br />
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Modulprüfung nicht erfüllt,<br />
ohne dass die Studierenden hierüber täuschen wollten, und wird diese Tatsache<br />
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das<br />
Bestehen der Prüfung geheilt. Haben Studierende die Zulassung vorsätzlich zu<br />
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes <strong>Rhein</strong>land-Pfalz über die Rechtsfolgen.<br />
Vor der Entscheidung ist den Studierenden Gelegenheit zur Äußerung zu geben.<br />
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen.<br />
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf<br />
Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.<br />
21
2. Aktueller Stand der Qualitätsentwicklung im Bereich des<br />
Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis Sozialer Arbeit I – III’ mit dem<br />
integrierten Praktischen Studiensemester<br />
2.1 Die Studienschwerpunktgebiete des Schwerpunktstudiums ‚Berufliche Praxis<br />
Sozialer Arbeit I - III’ im Rahmen des B.A.-Studiengangs Soziale Arbeit’<br />
(Stand: Januar 2010)<br />
Anforderungen an die Praktikumsstellen für die Praktischen Studiensemester<br />
Das Praktische Studiensemester erfolgt ausschließlich in Praktikumsstellen, die von der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> anerkannt sind.<br />
Die Anerkennung kann nur erteilt werden, wenn die Praktikumsstelle Gewähr dafür<br />
bietet, dass<br />
die Studierenden dort Handlungsvollzüge erlernen und einüben können, die für<br />
die Profession Sozialer Arbeit typisch sind,<br />
die fachliche Anleitung durch staatlich anerkannte Diplom-Sozialarbeiter/innen<br />
bzw. Diplom-Sozialpädagogen/innen erfolgt, die für die Praxisanleitung in<br />
besonderer Weise befähigt sind. Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn der/<br />
die Betreffende eine mindestens dreijährige berufliche Praxis in einem Feld<br />
Sozialer Arbeit nachweisen kann.<br />
In begründeten Fällen können für Fachkräfte mit einschlägiger abgeschlossener<br />
Hochschulausbildung, die über eine mind. dreijährige Berufspraxis in einem<br />
Arbeitsfeld Sozialer Arbeit verfügen (verabschiedet in der Sitzung der<br />
haupt<strong>am</strong>tlich Lehrenden des Fachbereichs Soziale Arbeit <strong>am</strong> 09.01.02),<br />
Ausnahmen von dieser Voraussetzung zugelassen werden, der Ausbildungsplan<br />
im Rahmen des Praktikums seine Umsetzung erfährt,<br />
sie den Studierenden die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstaltungen an<br />
der <strong>Hochschule</strong> ermöglicht,<br />
sie mit der <strong>Hochschule</strong> im Sinne eines gemeins<strong>am</strong>en Ausbildungsanliegens<br />
kooperiert. Insbesondere berichten die Praktikumsstellen in diesem<br />
Zus<strong>am</strong>menhang der <strong>Hochschule</strong> bei Beendigung eines Praktischen<br />
Studiensemesters über die Entwicklung und fachliche Eignung der Studierenden<br />
und stellen fest, ob diese den Anforderungen beruflicher Praxis gewachsen sind.<br />
Zuordnung zu den Schwerpunktgebieten<br />
Das Praktikanten<strong>am</strong>t führt hierzu mit der Fachschaft ein Wahl- und<br />
Ausgleichsverfahren durch. (§9 PraktO)<br />
(1) Die Praktischen Studiensemester werden im Rahmen eines von den<br />
Studierenden zu wählenden Schwerpunktgebietes durchgeführt.<br />
(2) Am Ende des 2. Semesters reichen die Studienschwerpunktleiter/-leiterinnen<br />
die aktuellen Darstellungen ihrer Schwerpunktgebiete dem Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
ein. Diese werden den Studierenden zu Beginn des 3. Semesters durch Aushang<br />
bekannt gemacht. Danach führt das Praktikanten<strong>am</strong>t für die Studierenden des<br />
3. Semesters eine Informationsveranstaltung durch, in der Ziele und<br />
Organisation des jeweiligen Praktischen Studiensemesters sowie die<br />
Rahmenkonzepte, Inhalte und Leiter/innen der Schwerpunktgebiete vorgestellt<br />
werden.<br />
22
(3) Die Wahl eines Schwerpunktgebietes durch die Studierenden muss schriftlich<br />
innerhalb einer Woche nach der Informationsveranstaltung dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t gegenüber erfolgen.<br />
(4) Die Höchst- bzw. Mindestzahl der Studierenden eines Schwerpunktgebietes<br />
wird jeweils vom Fachbereichsrat festgelegt.<br />
(5) Das Praktikanten<strong>am</strong>t organisiert ein Schwerpunktgebiets-Wahlverfahren, das<br />
die festgelegten Höchst- und Mindestzahlen in den Schwerpunktgebieten<br />
sicherstellt.<br />
Der Fachbereich IV – Sozial- und Gesundheitswesen- der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> hat<br />
sich auf die folgende acht Studienschwerpunktgebiete verständigt. Die spezifischen<br />
Zielsetzungen und Inhalte dieser Studienschwerpunktgebiete werden im Folgenden<br />
aktuell beschrieben.<br />
2.1.1 Soziale Arbeit als Hilfe zur Erziehung<br />
Schwerpunktleitung: Dipl. - Sozialarbeiterin, Dipl. - Pädagogin Barbara Weiler / Prof.<br />
Dr. Wolfgang Krieger<br />
Inhalt/Ziel des Schwerpunktgebietes:<br />
Studierenden wird – im Aufgabenbereich „Hilfe(n) zur Erziehung“ – im unmittelbaren,<br />
kooperativen Bezug zur institutionalisierten Praxis Sozialer Arbeit ein exemplarischer<br />
Zugang zur Sozialen Arbeit als konkrete berufliche Praxis vermittelt. Ziel ist dabei –<br />
entsprechend dem Profil des Studiengangs – vorgefundene Praxen Sozialer Arbeit in<br />
Dialog zu stellen mit Ansätzen einer kritisch reflexiven Sozialen Arbeit.<br />
Vor dem Hintergrund des aktuellen sozialstaatlichen Wandels stehen „Hilfe(n) zur<br />
Erziehung“ als sozialpolitisch gerahmte und rechtlich in hohem Maße normierte<br />
Leistung(en) für junge Menschen und ihre F<strong>am</strong>ilien im Rahmen des SGB VIII in<br />
besonderer Weise unter Legitimationsdruck, verschärft durch nicht überwundene und<br />
sich wieder einspielende Konzepte einer Sozialen Arbeit als Normalisierung.<br />
Auf der Grundlage einer Analyse und Kritik bevormundender, ausschließender und<br />
verdinglichender Diskurse und Praktiken im Kontext der Sozialen Arbeit als Hilfe zur<br />
Erziehung geht es darum, Spielräume und Perspektiven auszuloten, um Praxen Sozialer<br />
Arbeit in diesem Handlungsfeld auf die Ermöglichung einer autonomen Lebenspraxis<br />
ihrer Adressatinnen und Adressaten hin zu orientieren.<br />
Im Einzelnen werden den Studierenden die sozialpolitische und rechtliche Rahmung<br />
sowie die Idee, Funktion und institutionelle Ausgestaltung der „Hilfe(n) zur Erziehung“<br />
vermittelt. Sie werden vertraut gemacht mit den verschiedenen Angebotsformen der<br />
Jugendhilfe, ihren Zielsetzungen, Leistungen und Arbeitskonzepten. Sie werden befähigt,<br />
sich kritisch und produktiv mit Institutionalisierungs- und Interventionsformen<br />
der Jugendhilfe auseinanderzusetzen, Konsequenzen des aktuellen sozialstaatlichen<br />
Wandels für diesen Bereich einzuschätzen und Ansatzpunkte für eine reflexive,<br />
kritisch-produktive Soziale Arbeit als Hilfe zur Erziehung auszuloten.<br />
Aktuelle Thematisierungen und Entwicklungen (exemplarisch):<br />
Erziehung statt Strafe? / Strafe statt Erziehung!;<br />
Kooperationen im Bereich „Hilfe(n) zur Erziehung“ und Schule;<br />
Professionalität und Kinderschutz / Politisierung des Kinderschutzes / Neue<br />
Kinderschutzdebatte;<br />
Modellprojekt Heimerziehung als f<strong>am</strong>ilienunterstützende Hilfe;<br />
F<strong>am</strong>ily Group Conferences – F<strong>am</strong>ilienrat als partizipative und sozialraumorientierte<br />
Form der Hilfeplanung in den Hilfen zur Erziehung.<br />
23
Geeignete Praktikumsstellen:<br />
Erziehungsberatungsstellen (gem. § 28 SGB VIII);<br />
Angebote sozialer Gruppenarbeit (gem. § 29 SGB VIII);<br />
Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshilfe (gem. § 30 SGB VIII);<br />
Sozialpädagogische F<strong>am</strong>ilienhilfe (gem. § 31 SGB VIII);<br />
Tagesgruppe (gem. § 32 SGB VIII);<br />
Pflegekinderdienst (gem. § 33 SGB VIII);<br />
Bereich der stationären Jugendhilfe (gem. § 34 SGB VIII);<br />
Angebote intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (gem. § 35 SGB VIII);<br />
innovative Formen der Hilfen zur Erziehung (gem. § 27 SGB VIII);<br />
(Allgemeine) Soziale Dienste.<br />
2.1.2 Soziale Arbeit mit suchtgefährdeten / suchtkranken Menschen<br />
Schwerpunktleitung: Michael Dillmann<br />
Inhalt/Ziel des Schwerpunktgebietes:<br />
Im Mittelpunkt des Schwerpunktgebiets stehen Themen der Prävention von Suchterkrankungen,<br />
Beratung und Behandlung von Klientinnen und Klienten, die sich in<br />
Abhängig-keitsbeziehungen zu Personen und/oder Stoffen befinden, sowie deren<br />
Angehörige. Versorgung von Klienten und Klientinnen, die von Drogen abhängig sind,<br />
aber nicht ent-wöhnt werden können. Des Weiteren: Alkohol-, Drogen- und<br />
Medik<strong>am</strong>enten-Missbraucher, Essgestörte, Spieler, Beziehungsabhängige und deren<br />
Partnerinnen und Partner und Ange-hörige. Personen, denen Abhängigkeit erstmals<br />
oder erneut droht.<br />
Studiensemesterpraxis/Arbeitsfelder:<br />
Mitarbeit in den Einrichtungen der Praxis in Suchtberatungsstellen, Fachkliniken und<br />
Frauenhäusern sowie anderen Stellen, in denen auch Abhängigkeitsprobleme (neben<br />
anderen Problemen) bearbeitet werden (z.B. betriebliche Sozialarbeit, Aidshilfen,<br />
Adaptions-einrichtungen, Substitutions- und Betäubungsmittelvergabestellen,<br />
Schulsozialarbeit).<br />
Besonderheiten des Schwerpunktgebiets:<br />
Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Affinitäten zu den Gegenständen des<br />
Schwerpunktgebiets und Interesse für die sehr unterschiedlichen Tätigkeiten anderer<br />
Studierender im Studienschwerpunkt.<br />
Die Einrichtungen der Praxis verfolgen verschiedenartige Ziele und arbeiten mit unterschiedlichen<br />
Methoden. Auf diese Vielfalt sollten sich Studierende einstellen können.<br />
2.1.3 Soziale Arbeit mit alten, behinderten und kranken Menschen<br />
Schwerpunktleitung: Prof. Dr. Arnd Götzelmann und Lehrbeauftragte<br />
Inhalt/Ziel des Schwerpunktgebietes:<br />
Im Mittelpunkt des Schwerpunktgebietes stehen Theorie und Praxis der<br />
psychosozialen Unterstützung bzw. Gesundheitsförderung in der Arbeit mit alten,<br />
behinderten und kranken Menschen. Ziel ist es, die Studierenden zu befähigen, in<br />
diesen Feldern Sozialer Arbeit theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen<br />
miteinander zu verbinden.<br />
24
Da sich in diesem Schwerpunktgebiet eine große Überschneidung zu pflegerischmedizinischen<br />
Bereichen des Gesundheitswesens ergeben, sind entsprechende<br />
Erfahrungen aus dem Vorpraktikum, dem Zivildienst, dem Erstberuf oder dem Job<br />
neben dem Studium hilfreich, jedoch keine zwingende Voraussetzung. Ein gewisses<br />
Verständnis für andere Berufe und Tätigkeitsbereiche im Gesundheitswesen ist<br />
wünschenswert und soll gefördert werden.<br />
Das Schwerpunktgebiet widmet sich den vielfältigen Aufgaben von<br />
SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen in Einrichtungen<br />
− für alte Menschen (Geriatrie, Gerontopsychiatrie, soziale Gerontologie, Geragogik)<br />
z.B. in Beratungsstellen, Sozialstationen, Tagesstätten und Pflegeheimen, in<br />
Seniorenbüros, -zentren und -genossenschaften, in Diensten und Angeboten der<br />
offenen und halboffenen Hilfen,<br />
− für Menschen mit Behinderungen (medizinische, berufliche, psychosoziale<br />
Rehabilitation, Behindertenpädagogik) z.B. in Beratungsstellen, Tagesstätten bzw.<br />
-kliniken und Wohnheimen, in Schulen, in Werkstätten, in Berufsbildungs- und<br />
Berufsförderungswerken,<br />
− für kranke Menschen (Gesundheits- und Pflegewesen bzw. -wissenschaften) z.B. in<br />
AIDS- und Krebsberatungsstellen, in Sozialstationen und im<br />
Krankenhaussozialdienst.<br />
Es werden Überblick und Vertiefungen sowohl bezüglich der drei Arbeitsfelder bzw.<br />
Hilfebereiche und ihrer Einrichtungstypen, der zugehörigen sozialen<br />
Sicherungssysteme, der Formen von Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten<br />
sowie alte Menschen betreffende Erkrankungen als auch bezüglich der<br />
Organisationsformen und Handlungskonzepte Sozialer Arbeit in diesen Feldern<br />
gegeben und erarbeitet.<br />
Die Bedeutung der Kooperation bzw. Arbeitsteilung mit und Delegation an Angehörige<br />
anderer Berufsgruppen etwa der Medizin, der Pflege, der Psychologie, der<br />
Rehabilitation u.a. soll herausgearbeitet und unter Heraushebung der besonderen<br />
Aufgaben und Kompetenzen Sozialer Arbeit gefördert werden.<br />
Angesichts des demographischen Wandels hin zu einer Gesellschaft mit immer mehr<br />
alten Menschen, eines in Ausbau befindlichen Systems der Behindertenhilfe und der<br />
zunehmenden Bedeutung psychosozialer Aspekte im Bereich des Krankenhaus- und<br />
Gesundheitswesens bietet dieses Schwerpunktgebiet für SozialarbeiterInnen und<br />
SozialpädagogInnen ein Betätigungsfeld mit interessanten Zukunftsaussichten.<br />
2.1.4 Soziale Arbeit mit straffälligen Menschen und ihrem Umfeld<br />
Schwerpunktleitung: Prof. Dr. Christiane Simsa/ Herr Herbold<br />
Inhalt/Ziel des Schwerpunktgebietes:<br />
Im Mittelpunkt des Schwerpunktgebietes steht die Theorie und Praxis der<br />
Straffälligenhilfe. Ziel ist es, die Studierenden zu befähigen, in diesem Arbeitsfeld der<br />
Sozialen Arbeit das theoretisch Erlernbare in der Praxis umzusetzen. Hierzu gehört<br />
zum einen die Vermittlung kriminologischer Erkenntnisse zu Kriminalität und<br />
Straffälligkeit sowie (Re-)Sozialisierung, andererseits das Erarbeiten praxisnahen<br />
Wissens über stationäre und <strong>am</strong>bulante Maßnahmen für Straffällige. Die<br />
Auseinandersetzung mit sozialarbeiterischen Methoden für die Klientel der<br />
25
Straffälligenhilfe bildet selbstverständlich einen Schwerpunkt. Im Laufe der Studiensemester<br />
soll eine professionelle Haltung gegenüber den Ursachen, Erscheinung und<br />
Folgen von Straffälligkeit entwickelt werden. Neben finanziellen und sachlichen Hilfen<br />
betrifft dies die psychosoziale Beratung, die Aktivierung gesellschaftlicher Netzwerke<br />
und die Förderung sozialer Kompetenzen.<br />
Studiensemesterpraxis/Arbeitsfelder:<br />
Straffälligenhilfe findet in verschiedenen Einrichtungen statt:<br />
in der Gerichtshilfe,<br />
in der Bewährungshilfe,<br />
in der Jugendgerichtshilfe,<br />
bei freien Trägern der Straffälligenhilfe,<br />
in Anstalten des Strafvollzuges und des Jugendarrestes und<br />
in anderen Institutionen bzw. Projekten der Sozialen Arbeit.<br />
Inhaltlich umfassen die Arbeitsfelder vielfältige Aufgabenbereiche, wie etwa<br />
beratende Begleitung bei der (Re-)Integration in die Gesellschaft,<br />
Unterstützung bei der Suche und Sicherung von Wohnraum und Arbeitsplatz,<br />
Konfliktmanagement,<br />
Schuldnerberatung.<br />
Besonderheiten des Schwerpunktgebietes:<br />
Straffälligenhilfe arbeitet mit Straffälligen und deren persönlichem Umfeld.<br />
Sie berührt verschiedene Aspekte der Sozialen Arbeit, u.a. Abhängigkeiten und<br />
psychische Erkrankungen. Die Schwerpunktleiterin und der Schwerpunktleiter sind auf<br />
Grund ihrer beruflichen Vorbildung in der Lage, sowohl auf die theoretischen<br />
Anforderungen als auch auf die methodischen Voraussetzungen für die Soziale Arbeit<br />
mit Straffälligen in ihren sozialen Bezügen einzugehen. Dies betrifft auch die Auswahl<br />
der Praxisstellen und die Betreuung während der praktischen Studiensemester. Bei der<br />
Vermittlung von Praxisstellen können auf erfolgreich etablierte Kontakte zu<br />
verschiedenen Personen und Einrichtungen der Straffälligenhilfe zurückgegriffen<br />
werden.<br />
2.1.5 Soziale Arbeit mit psychisch kranken / behinderten Menschen<br />
Schwerpunktleitung: Prof. Dr. Raimund Hassemer / Prof. Dr. Kurt Lipke<br />
Inhalt/ Ziel des Schwerpunktgebietes:<br />
Im Schwerpunktgebiet „Soziale Arbeit mit psychisch kranken/behinderten Menschen“<br />
geht es um den Beitrag, den Soziale Arbeit intra- und extr<strong>am</strong>ural bei der Behandlung<br />
und Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter zu leisten hat. Die Soziale Arbeit<br />
findet hier ein weites - und nach wie vor expandierendes - Betätigungsfeld, das von der<br />
intensiven, stationären Versorgung psychisch kranker Menschen in akuten Phasen<br />
ihrer Erkrankung bis hin zu niedrigschwelligen, <strong>am</strong>bulanten Angeboten für<br />
chronifizierte Klienten reicht und durch eine große Vielfalt unterschiedlichster Dienste<br />
und Einrichtungen gekennzeichnet ist. Aus dieser Bestimmung des Arbeitsfeldes<br />
folgen die inhaltlichen Zielsetzungen des Schwerpunktgebietes: Es geht unter<br />
psychologisch-psychiatrischem Aspekt zum einen um die Erarbeitung eines theoretisch<br />
hinreichend fundierten Wissens über das Phänomen „Psychische Krankheiten“ und die<br />
Erhöhung individueller Kompetenzen im Umgang mit vor allem schizophren<br />
erkrankten Menschen. In rechtlich-administrativer Hinsicht werden auf der anderen<br />
26
Seite insbesondere die möglichen Konsequenzen psychischer Erkrankung für die<br />
Rechtsposition der Betroffenen sowie die Probleme der Finanzierung kurativer und<br />
rehabilitativer Maßnahmen thematisiert.<br />
Studiensemesterpraxis/Arbeitsfelder:<br />
Die Arbeitsfelder Sozialer Arbeit mit psychisch Kranken und Behinderten sind vielfältig.<br />
Sie umfassen sozialarbeiterische Tätigkeiten in Kliniken und Abteilungen von<br />
Allgemeinkrankenhäusern ebenso wie etwa in Rehabilitationseinrichtungen,<br />
Tagesstätten, Wohnheimen oder im Rahmen des betreuten Wohnens sowie<br />
<strong>am</strong>bulanter Beratung und Betreuung.<br />
Das Schwerpunktgebiet arbeitet seit längerem mit vielen Diensten und Einrichtungen<br />
der Region zus<strong>am</strong>men und legt im Interesse einer qualifizierten Anleitung und eines<br />
produktiven Theorie-Praxis-Dialogs grundsätzlichen Wert darauf, diese Kontakte<br />
kontinuierlich zu gestalten.<br />
Besonderheiten des Schwerpunktgebietes:<br />
Das Schwerpunktgebiet arbeitet mit psychisch kranken und behinderten Menschen in<br />
allen Phasen ihrer Erkrankung und mit allen Schweregraden einer eventuellen<br />
Behinderung. Die Studierenden des Schwerpunktgebietes müssen über die<br />
Bereitschaft verfügen, sich auf den Umgang mit „verrückten“ Menschen einzulassen<br />
und ihre Arbeit mit den häufig schwierigen Klientinnen und Klienten stets auf Neue<br />
kritisch zu reflektieren. Vorkenntnisse in der Psycho-Pathologie u.ä. oder Erfahrungen<br />
im Kontakt mit psychisch Kranken und Behinderten werden demgegenüber nicht<br />
vorausgesetzt.<br />
2.1.6 Soziale Arbeit mit Migrantinnen und Migranten<br />
Schwerpunktleitung: Prof. Dr. Anne Lorenz / Prof. Dr. Jörg Reitzig<br />
Zielsetzung und Inhalte:<br />
Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund.<br />
Davon ist ca. die Hälfte „Inländer ohne deutschen Pass“: Kinder und Jugendliche, die<br />
hier geboren sind, und Menschen, die schon seit mehr als zwanzig Jahren hier leben.<br />
Hierzu gehören auch Flüchtlinge – rund 20 Millionen sind es weltweit. Immer weniger<br />
davon finden den Weg nach Europa.<br />
Nur 4,2 Prozent der MigrantInnen auf der Welt leben in Deutschland. Dennoch ist das<br />
Thema Migration ein Querschnittsgebiet der Sozialen Arbeit, dessen Bedeutung stark<br />
zugenommen hat und weiter wächst. Das Schwerpunktgebiet bietet Einblicke in<br />
Praxisfelder und theoretische Hintergründe. Zu letzteren gehören rechtliche<br />
Regelungen ebenso wie soziologische und politische Aspekte. Die Arbeit im<br />
Schwerpunktgebiet zielt auf eine kritische Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse<br />
und auf die Diskussion von sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen<br />
Interventionsmöglichkeiten.<br />
Studiensemesterpraxis/Arbeitsfelder:<br />
Das Praktische Studiensemester wird in Praktikumsstellen, die vorwiegend<br />
Klientinnen und Klienten mit Migrationshintergrund haben, absolviert. Die Stellen<br />
decken daher ein breites Spektrum ab. Zu ihnen gehören Einrichtungen wie Spiel- und<br />
Lernhäuser, Jugendzentren, Beratungsstellen, aber auch Asylbewerberunterkünfte und<br />
Spezialdienste. Die Absolvierung von Praktischen Studiensemesters im Ausland ist<br />
möglich. Entsprechend breit sind auch die Fähigkeiten und Kompetenzen die<br />
vermittelt werden.<br />
27
Die Klienten der Einrichtungen sind meist Kinder und Jugendliche, Flüchtlinge aller<br />
Altersgruppen, aber auch spezifische Zielgruppen (z. B. ausländische Frauen, alte<br />
Menschen etc.).<br />
Besonderheiten des Schwerpunktgebietes:<br />
Das Migrationsprojekt bietet in gewisser Weise einen Querschnitt der Sozialen Arbeit,<br />
weil fast alle Tätigkeitsfelder vorkommen können. Deswegen wird nicht auf eine<br />
spezifische Arbeitsform hin orientiert, sondern reflektiert, wie und ob bestimmte<br />
Angebote bei dieser spezifischen Zielgruppe modifiziert werden müssen oder nicht.<br />
2.1.7 Soziale Arbeit mit Menschen in finanziell schwierigen Situationen<br />
Schwerpunktleitung: Prof. Dr. Hans Ebli/ Prof. Dr. Andreas Rein/<br />
Bernhard Guttenbacher<br />
Zielsetzung und Inhalte:<br />
Ziel dieses Schwerpunktgebietes ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ideen<br />
und Funktionen einer Sozialen Arbeit mit Menschen in finanziell schwierigen<br />
Situationen sowie ihrer Organisations- und Arbeitsweisen zu vermitteln und sie zu<br />
befähigen, sich kritisch und produktiv mit hieraus entstehenden Fragestellungen<br />
auseinanderzusetzen.<br />
Soziale Arbeit hat in nahezu allen ihren Arbeitsfeldern mit Menschen zu tun, die auch<br />
in finanziell schwierigen Situationen leben, also in Armut und Prekarität. Darüber<br />
hinaus haben sich spezifische Arbeitsfelder wie etwa die Arbeitslosenhilfe, die<br />
Wohnungslosenhilfe, die gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit in so genannten<br />
„sozialen Brennpunkten“ und zuletzt die Schuldnerberatung herausgebildet. Auch weil<br />
eine intensive Einarbeitung in alle diese Arbeitsbereiche im Rahmen des Projekts nicht<br />
möglich ist, wird es im Kern exemplarisch um das gesellschaftliche Problem<br />
„Überschuldung“ und die gesellschaftliche Problembearbeitung „Schuldnerberatung“<br />
gehen. Abhängig von den Interessen der Studierenden kann dieses Kernangebot auf<br />
die Soziale Arbeit mit arbeitslosen Menschen, mit wohnungslosen Menschen und<br />
Menschen, die in „sozialen Brennpunkten“ leben, ausgeweitet werden.<br />
Praktisches Studiensemester/Arbeitsfelder:<br />
Demnach können Praktika in verschiedenen Arbeitsbereichen und Einrichtungen<br />
stattfinden, so<br />
• in der Sozial- und Lebensberatung<br />
• in der Schuldner- und Insolvenzberatung<br />
• in Einrichtungen der Arbeitslosenhilfe<br />
• in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe<br />
• in der Gemeinwesenarbeit und im Quartiermanagment<br />
• und in anderen Einrichtungen und Projekten Sozialer Arbeit mit thematischem<br />
Bezug<br />
2.1.8 Soziale Arbeit als Bildung, Betreuung und Erziehung in der Kindheit<br />
Schwerpunktleitung: Peter Rahn<br />
Inhalt/Ziel des Schwerpunktgebietes<br />
Im Mittelpunkt des Schwerpunktgebietes stehen Theorie und Praxis der Sozialen<br />
Arbeit in der Kindheit (bis 14 Jahre) sowie der Bildungsübergänge zwischen F<strong>am</strong>ilie,<br />
Kindertageseinrichtung, Schule sowie Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist es, die<br />
28
Studierenden zu befähigen, in diesem Bereich Sozialer Arbeit theoretische Grundlagen,<br />
aktuelle Forschungsstände sowie eigene Erfahrungen beruflicher Praxis aufeinander<br />
zu beziehen und füreinander nutzbar machen zu können.<br />
Kindheit als eigenständige Lebensphase, als Moratorium zu betrachten fördert einen<br />
Blick, der die Rechte von Kindern, gerade auch das Recht auf Selbst- und<br />
Mitbestimmung ins Zentrum rückt. Andererseits ist diese Lebensphase in besonderer<br />
Weise von Abhängigkeit geprägt. Dieses Spannungsverhältnis im Sinne der Kinder mit<br />
zu gestalten, ist die besondere Herausforderung der fortschreitenden Institutionalisierung<br />
von Kindheit. Über sie wird das gesellschaftliche Interesse <strong>am</strong> Formen von<br />
Kindern in Richtung eines bestimmten Ideals deutlich. Mit der modernen Betonung<br />
von Bildung als Aufgabe der Einrichtungen der frühen Kindheit spitzt sich das<br />
Spannungsverhältnis zu: Steuerungspolitische Perspektiven effizienter Ausbildung<br />
konfligieren mit der Orientierung <strong>am</strong> Moratoriumsgedanken und einer<br />
Subjektorientierung.<br />
Die Arbeit mit Kindern stellt ein gesellschaftlich und fachlich umkämpftes Terrain dar.<br />
Soziale Arbeit kann sich hier verorten, in dem sie die Kompetenzen, Partizipations- und<br />
Selbstbestimmungsrechte der Kinder ernstnimmt sowie unter Beachtung ihrer<br />
unterschiedlichen Lebenslagen professionelle Handlungsalternativen entwickelt,<br />
engagiert vertritt und umsetzt.<br />
Das Schwerpunktgebiet profiliert sich gegenüber anderen Angeboten zur<br />
Qualifizierung für Leitungs-, Bildungs- und Erziehungstätigkeiten in<br />
Tageseinrichtungen für Kinder (z.B. Studiengänge der Elementarpädagogik,<br />
Frühpädagogik, Pädagogik der Kindheit, Erziehung und Bildung in der Kindheit) durch<br />
seine Einbettung in den Studiengang Soziale Arbeit und auf der Grundlage einer<br />
Bestimmung dessen, was kritisch-reflexive Soziale Arbeit als Bildung, Betreuung und<br />
Erziehung in institutionellen Kontexten heißen kann. Entsprechend findet eine<br />
Auseinandersetzung mit feldtypischen Sachverhalten, mit den darin liegenden<br />
Interessen, Positionen und Konflikten statt. Es werden Wissen und Kompetenzen<br />
vermittelt, um dieses Handlungsfeld als reflexive Praxis mit gestalten zu können.<br />
Da sich in diesem Schwerpunktgebiet eine große Überschneidung zu anderen<br />
pädagogischen Arbeitsfeldern ergeben, sind entsprechende Erfahrungen im<br />
Vorpraktikum, einem FSJ, im Erstberuf oder dem Job neben dem Studium hilfreich,<br />
jedoch keine zwingende Teilnahmevoraussetzung. Ein gewisses Verständnis für<br />
pädagogische und andere Berufe und Tätigkeitsbereiche im Bildungswesen ist<br />
wünschenswert und soll gefördert werden.<br />
Arbeitsfelder/Einrichtungen<br />
Der Schwerpunkt widmet sich den vielfältigen Aufgaben von Sozialarbeiterinnen und<br />
Sozialpädagogen in u.a. folgenden Einrichtungen:<br />
Tageseinrichtungen für Kinder: Krippe, Kindergarten, Hort<br />
Frühe Hilfen und Kindesschutz<br />
Ganztagsschulen, außerschulische Bildungsangebote<br />
schulbezogene Kinder- und Jugendhilfe<br />
Offene Kinderarbeit, Sozialraumarbeit<br />
Erziehungs- und F<strong>am</strong>ilienberatungsstelle<br />
29
2.2 Lernzielkatalog zur Erreichung der Qualifikationsziele des Praktischen<br />
Studiensemesters (§ 3 Absatz 2 PraktO)<br />
§ 3 Absatz 2 der Praktikumsordnung benennt die grundsätzlichen Qualifikationsziele<br />
des Praktischen Studiensemesters. Mit Blick auf diese werden die folgenden konkreten<br />
Lernziele als Voraussetzung jeder Lernzielkontrolle benannt.<br />
Förderung der Berufskompetenz. Die Anleitung unterstützt Studierende gezielt dabei:<br />
die komplexe berufliche Praxis in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit bei freien<br />
und öffentlichen sowie privaten Trägern systematisch erfahren zu können,<br />
zentrale sozialarbeiterische und sozialpädagogische Handlungsvollzüge der<br />
jeweiligen Arbeitsfelder erkennen zu können sowie diese in einem angeleiteten<br />
und begleiteten Lernprozess schrittweise einüben, analysieren und reflektieren<br />
zu lernen;<br />
die AdressatInnen der Praktikumsstelle und ihre gesellschaftlichen, kulturellen,<br />
regionalen, lokalen, sozialen, materiellen und persönlichen Ausstattungslagen<br />
kennen und einschätzen zu lernen sowie diese - sachlich und politisch<br />
reflektiert - beschreiben und strategisch fördern zu lernen;<br />
Kenntnis über andere im Berufsfeld tätige Institutionen, Dienste und Personen<br />
zu gewinnen;<br />
gesetzliche und institutionelle Angebote anwenden, ausschöpfen und<br />
verbessern zu lernen;<br />
Mittel und Methoden fachlichen Handelns kennen zu lernen und zu erproben;<br />
sozialwissenschaftliche Theorien in der beruflichen Praxis zu überprüfen.<br />
Ein weiteres Lernziel ist die Entwicklung der Berufsidentität. Dieser Bereich meint die<br />
Ausformung eines spezifischen beruflichen Habitus. Die Anleitung unterstützt<br />
Studierende gezielt dabei:<br />
in der jeweiligen Praktikumsstelle die Organisationsstruktur der Institution<br />
überschauen und Entscheidungsabläufe und Aufgabenverteilung im<br />
Spannungsfeld von Sozialadministration nachvollziehen und in ihrer Bedeutung<br />
für die Soziale Arbeit einschätzen zu können;<br />
sich mit beruflichen Rollenträgerinnen und Rollenträgern identifizieren bzw.<br />
auseinandersetzen zu können und Abgrenzungen zu anderen Berufsrollen<br />
vornehmen zu können;<br />
Standards und berufsethische Prinzipien der Sozialen Arbeit im Vergleich bzw.<br />
in Abgrenzung zu anderen Berufsrollen erkennen und danach handeln zu<br />
können;<br />
das Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Institution, Rolle und Person, das sich<br />
u.a. in widersprüchlichen Erwartungen an die Klienten niederschlägt, sowie den<br />
Widerspruch zwischen institutionalisierten Erwartungen und den Erwartungen<br />
der Klienten analysieren und reflektieren zu lernen, und eigene,<br />
kriteriengeleitete Handlungsmodelle entwickeln zu lernen.<br />
die Praktikumsanleitung konstruktiv nutzen zu lernen, z.B. indem Arbeits- und<br />
Lernprozesse regelmäßig analysiert, reflektiert und ausgewertet werden.<br />
Lernziel ist insbesondere auch die Förderung der Reflexionskompetenz als konstitutiver<br />
Bestandteil der beruflichen Kompetenz. Die Anleitung unterstützt Studierende gezielt<br />
dabei:<br />
ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung weiterentwickeln zu lernen;<br />
30
sich der Einstellungen und Haltungen, Werte und Normen, die dem eigenen<br />
Handeln zu Grunde liegen, bewusster zu werden und deren Bedeutung für die<br />
berufliche Praxis einschätzen zu können;<br />
die Konsequenzen eigenen Handelns in administrativen, kollegialen und<br />
klientbezogenen Bezügen einschätzen zu lernen.<br />
2.3 Form des Ausbildungsplans (§ 3 Absatz 3 und § 12 PraktO)<br />
Die Lernprozesse der Studierenden in der Praktikumsstelle werden über das ges<strong>am</strong>te<br />
Praktikum hinweg fachlich unterstützt und begleitet. Dabei ist die Gestaltung der<br />
Einführungs- und Orientierungsphase, der Erprobungsphase und schließlich der<br />
Konsolidierungs- und Verselbständigungsphase flexibel zu handhaben, weil letztlich<br />
nur bezogen auf ein konkretes Praktikum bestimmt werden kann, wie intensiv die<br />
Einarbeitung - mit Blick auf die Anforderungen der jeweiligen Praktikumsstelle aber<br />
auch auf die unterschiedlichen personalen und fachlichen Voraussetzungen, die der /<br />
die jeweilige Studierende mitbringt, - sein muss und wie weit eigenständiges Arbeiten<br />
gehen kann.<br />
Der Ausbildungsplan hat die Funktion, eine Bestimmung der o.g. Aspekte<br />
vorzunehmen.<br />
Im Ausbildungsplan soll deutlich werden, in welcher Weise die Heranführung des<br />
Studierenden an die allgemeinen professionellen und ethischen Standards der<br />
Praktikumsstelle, an die Qualifikationsziele des integrierten Praktischen<br />
Studiensemesters und an die konkreten Lernziele im Rahmen des Praktikums (s. 2.2<br />
Lernzielkatalog zur Erreichung der Qualifikationsziele des Praktischen<br />
Studiensemesters nach § 3 Absatz 2 PraktO) geplant und angeleitet wird.<br />
Dabei sollen die individuellen Vorstellungen der Studierenden mit denen der<br />
anleitenden Fachkraft vermittelt und mit den jeweiligen Möglichkeiten der<br />
Praktikumsstelle abgestimmt werden. Der Ausbildungsplan wird - im Einvernehmen<br />
mit der <strong>Hochschule</strong> - zwischen Praktikumsstelle, Anleiter / Anleiterin und Student /<br />
Studentin vereinbart und dem zuständigen Praktikanten<strong>am</strong>t zu Beginn des Praktikums<br />
vorgelegt.<br />
Die Lernziele sollten so konkret formuliert werden, dass sie <strong>am</strong> Ende des Praktikums<br />
überprüft werden können.<br />
Strukturierungsempfehlung für den individuellen Ausbildungsplan:<br />
1. Formale Strukturen der Ausbildung.<br />
Bitte benennen Sie:<br />
Ausbildungsstelle (Praktikumsort) und Träger der Ausbildungsstelle<br />
N<strong>am</strong>e und Qualifikation der Praxisanleiterin/ des Praxisanleiters<br />
N<strong>am</strong>e der Praktikantin / des Praktikanten<br />
Dauer des Praktikums von ... bis ...<br />
Arbeitszeiten, z.B. Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit<br />
Praktikumsvergütung<br />
2. Fachliche Ausrichtung der ausbildenden Institution.<br />
Bitte benennen Sie:<br />
gesetzliche Grundlagen, Ziele und Aufgaben der Institution<br />
Adressatengruppen / Adressatinnengruppen<br />
Methoden und Arbeitsformen<br />
31
Sonstige konzeptionellen Bestimmungen der Praxisstelle<br />
3. Inhaltliche Elemente der Ausbildung.<br />
Bitte benennen Sie:<br />
mögliche Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte und Lernfelder der/des Studierenden<br />
konkrete Lernziele, bezogen auf die zeitliche Struktur des Praktikums<br />
Formen des Lernens, z.B. durch Hospitation, Beobachtung, Übernahme von<br />
bestimmten Aufgaben und Tätigkeiten, Teilnahme an Te<strong>am</strong>sitzungen und<br />
Supervision<br />
Anleitungsformen und Anleitungsinhalte<br />
Bitte nicht vergessen: Der Ausbildungsplan wird von dem/der Studierenden und der<br />
anleitenden Fachkraft unterschrieben und der <strong>Hochschule</strong> als Vertragspartnerin<br />
vorgelegt.<br />
2.4 Qualität der halbtägigen Lehrveranstaltungen in Form von Praxisberatung /<br />
Supervision während des Praktischen Studiensemester (§ 6 Absatz 3 PraktO)<br />
Studierende, die mindestens zwei Supervisionsveranstaltungen fernbleiben -<br />
entschuldigt oder unentschuldigt -, haben auf eigene Kosten entsprechend für<br />
Ersatz zu sorgen.<br />
Der / die Studierende hat dem Praktikanten<strong>am</strong>t in diesem Falle einen<br />
Qualifikationsnachweis der Supervisorin / des Supervisors vorzulegen. Die<br />
Supervision erfolgt durch externe DGSV-anerkannte, erfahrene Supervisorinnen<br />
und Supervisoren aus einem Berufsfeld der Sozialen Arbeit.<br />
2.5 Form des Praktikumsberichts (§ 11 PraktO)<br />
Nach § 13 PraktO schließen die Studierenden das integrierte Praktische<br />
Studiensemester mit der Erstellung eines Praktikumsberichts ab. Sie stellen in diesem<br />
Bericht ihre Fähigkeit dar, Praxis theoriegeleitet darstellen, befragen, begründen und<br />
evaluieren und diese - insbesondere auch mit kritischem Blick auf die eigene<br />
Fachlichkeit und unter kritischer Würdigung der eigenen Person - kritisch-konstruktiv<br />
reflektieren und „weiterdenken“ zu können.<br />
Der Praktikumsbericht wird ausschließlich hochschulintern reflektiert, begutachtet<br />
und bewertet.<br />
Struktur und Inhalt eines Praktikumsberichts:<br />
Neben einer Einleitung in Form einer thematischen Einführung mit Bezug auf<br />
Aufgaben und Problemstellungen Sozialer Arbeit im allgemeinen und im Feld der<br />
Praktikumsstelle im besonderen sowie einer kurzen Skizze der Struktur und des Inhalts,<br />
besteht ein Praktikumsbericht aus:<br />
a) einem analytischen Teil:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Organisationsbezug:<br />
Einbindung in Trägerstruktur, Aufgaben, Progr<strong>am</strong>m, Ziele, Leitbild und<br />
Grundwerte, betreuter Klientenkreis, Geschichte, Finanzierung, rechtliche<br />
Grundlagen, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalstruktur,<br />
Räumlichkeiten etc..<br />
Aufgabenbezug:<br />
Beschreibung der eigenen Einbindung in die Interaktionen im Aufgabenfeld,<br />
der eigenen Aufgaben und Tätigkeiten und angewandten Methoden.<br />
Selbstbezug:<br />
Warum habe ich gerade diese Praktikumsstelle gewählt?<br />
32
Mit welchen Erwartungen habe ich mein Praktikum begonnen?<br />
Welche (auch persönlichen) Ziele wollte ich erreichen?<br />
Welche Wünsche und Hoffnungen habe ich mit den zu erwartenden<br />
Aufgaben und Anforderungen verbunden?<br />
Welche Ängste (z.B. bezogen auf die Institution, die Klienten etc.) hatte ich?<br />
b) einem problematisierenden Teil:<br />
Formulierung von erkennbaren Problemstellungen (auch exemplarisch, z.B.<br />
anhand eines Falles)<br />
Einschätzen der institutionellen Ressourcen<br />
Würdigung der eigenen Praxis, Dispositionen und Strategien sowie<br />
Darstellung der wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit<br />
diesen Problemstellungen<br />
Einschätzen der eigenen theoretischen und/oder praktischen Vorkenntnisse<br />
c) einem systematisierenden Teil:<br />
Zuordnung der Erfahrungen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
Welche Sichtweisen können der Praxis auf dem Hintergrund<br />
wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse entstehen?<br />
Schlussfolgerungen hinsichtlich praktisch anzustrebender Verbesserungen<br />
und<br />
ggf. hinsichtlich sozialwissenschaftlich zu klärender Forschungsfragen<br />
d) einem perspektivischen Teil:<br />
Welche Konsequenzen ziehe ich für mein weiteres Studium?<br />
Welche Elemente meiner personalen Kompetenz wären weiter zu<br />
entwickeln?<br />
Welche Impulse können der Lehre gegeben werden?<br />
Könnte ich mir vorstellen, später im Praxisfeld meiner Praktikumsstelle tätig<br />
zu werden?<br />
2.6 Empfehlungen zur Beurteilung von praktischen Ausbildungsphasen<br />
Eine Beurteilung erfolgt in der Regel schriftlich und muss zuvörderst mit der / dem<br />
Studierenden erörtert werden. Hierbei handelt es sich nicht um ein umfassendes<br />
Dienstzeugnis für spätere Bewerbungen, sondern um eine Bescheinigung gegenüber<br />
der <strong>Hochschule</strong>, die dokumentiert, ob das Praktikum erfolgreich absolviert wurde.<br />
Die Beurteilung soll die / den Studierende(n) in ihrem / seinem Lernprozess fördern<br />
und ihm / ihr helfen, sich gezielt weiterzuentwickeln zu können. Deshalb sollen -<br />
neben den vorhandenen Stärken - in konstruktiver Form auch Schwächen benannt<br />
werden, d<strong>am</strong>it an deren Behebung zielgerichtet weitergearbeitet werden kann.<br />
Die Beurteilung durch die anleitende Fachkraft soll sich auf folgende Aspekte beziehen:<br />
Im Hinblick auf Gestaltung und Verlauf des Praktischen Studiensemesters:<br />
auf die Rahmenbedingungen, unter denen dieses absolviert wurde;<br />
auf die im Ausbildungsplan festgelegten organisatorische Strukturen (Arbeitsfeld,<br />
Zeiten, etc.) einschließlich möglicher Veränderungen und Ergänzungen;<br />
33
– auf besondere Aufgabenstellungen und Situationen während des Praktischen<br />
Studiensemesters;<br />
– auf die Formen der Praxisanleitung.<br />
Im Hinblick auf die Studierenden selbst:<br />
– Kenntnisse und Fertigkeiten und deren Umsetzung in praktisches, zielführendes<br />
und den Klienten beteiligendes und stärkendes Handeln;<br />
– auf die Fähigkeit und Bereitschaft zur Aufnahme und Verarbeitung von<br />
Informationen;<br />
– auf die wertschätzende und konstruktive Beziehungsgestaltung zu Adressatinnen<br />
und Adressaten, den Umgang mit Einzelnen und/oder Gruppen;<br />
– auf die Fähigkeit zur Problemerkennung und deren fachlicher Einordnung und<br />
Beurteilung;<br />
– auf den Zugang zu Handlungskonzepten und zur methodischer Strukturierung;<br />
– auf die administrativen Kompetenzen;<br />
– auf die festgestellten Lernfortschritte;<br />
– auf den offenkundigen weiteren Lernbedarf.<br />
Im Hinblick auf eine zus<strong>am</strong>menfassende Bewertung des Verlaufs des Praktischen Studiensemesters:<br />
– Ges<strong>am</strong>teindruck der beruflichen Persönlichkeit;<br />
– Aussage über die derzeitige Einschätzung der beruflichen Eignung im<br />
spezifischen Arbeitsfeld, insbesondere der erkennbaren Fähigkeiten und weiteren<br />
Entwicklungsmöglichkeiten.<br />
3. Anhang<br />
3.1 Musterformularsatz<br />
3.2 Terminübersicht<br />
3.3 Liste anerkannter Praktikumsstellen (nur bei Bedarf)<br />
34
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
A<br />
Fachbereich IV-<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Meldung der Praktikumsstelle<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
Nachn<strong>am</strong>e:<br />
Vorn<strong>am</strong>e:<br />
Straße:<br />
Anschrift<br />
(während des Praktikums)<br />
Matrikel-Nr.:<br />
e-Mail:<br />
Schwerpunktgebiet:<br />
Das Praktische Studiensemester (20 Wochen à 37,5 Stunden) leiste ich bei folgender Einrichtung ab:<br />
...................................................................................................................................................................................<br />
N<strong>am</strong>e der Einrichtung bzw. der Institution<br />
...................................................................................................................................................................................<br />
Abteilung / Arbeitsfeld<br />
...................................................................................................................................................................................<br />
Straße<br />
Postleitzahl, Ort<br />
...................................................................................................................................................................................<br />
Telefon Fax E-Mail<br />
...................................................................................................................................................................................<br />
(N<strong>am</strong>e und Berufsbezeichnung der anleitenden Person / Jahr der staatlichen Anerkennung)<br />
(A) vom 03.09.2012 bis 18.01.2013<br />
(B) vom 10.09.2012 bis 25.01.2013<br />
<br />
Die Tätigkeiten werden in folgender Form erbracht:<br />
(C) anderer Zeitrahmen vom .....................bis .........................(Antrag beifügen)<br />
……………………………………………………………………………………….......…...............................…..<br />
……………………………………………………………………………………………........................................<br />
…………………………………………………………………………..……………...................................….......<br />
.................................................... ...................................................................................<br />
(Datum)<br />
(Unterschrift des/der Studierenden)<br />
...................................................................................<br />
(Unterschrift Schwerpunktleiter/in)<br />
Abgabe beim Praktikanten<strong>am</strong>t bis zum 02. Juli 2012 !<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
(Exemplar für Praktikanten<strong>am</strong>t)<br />
B1<br />
Fachbereich IV-<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
zwischen<br />
Ausbildungsvereinbarung<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Einrichtung, Träger<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
vertreten durch Herrn / Frau<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Straße<br />
Postleitzahl, Ort<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Telefon Fax E-Mail<br />
und<br />
nachfolgend Praktikumsstelle genannt<br />
der/ dem Studierenden der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong>,<br />
Frau/Herr<br />
geboren <strong>am</strong>:<br />
in:<br />
Anschrift:<br />
Telefon:<br />
E-Mail:<br />
Matr.-Nr.:<br />
im folgenden Studierende/ Studierender genannt<br />
wird im Einvernehmen mit der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Maxstr. 29<br />
67059 <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Tel. (0621) 5203 - 0<br />
Fax (0621) 5203 - 559<br />
für die Zeit vom …......…….……...……..……. bis ….............………………….………<br />
20 Wochen à 37,5 Stunden oder .......... Wochen à .......... Stunden<br />
auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils gültigen Fassung folgende Ausbildungsvereinbarung<br />
geschlossen:<br />
Zwei Wochen nach Beginn des Praktischen Studiensemesters.<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
(Exemplar für Praktikumstelle)<br />
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
B2<br />
Fachbereich IV-<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Ausbildungsvereinbarung<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
zwischen<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Einrichtung, Träger<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
vertreten durch Herrn / Frau<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Straße<br />
Postleitzahl, Ort<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Telefon Fax E-Mail<br />
und<br />
nachfolgend Praktikumsstelle genannt<br />
der/ dem Studierenden der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong>,<br />
Frau/Herr<br />
geboren <strong>am</strong>:<br />
in:<br />
Anschrift:<br />
Telefon:<br />
E-Mail:<br />
Matr.-Nr.:<br />
im folgenden Studierende/ Studierender genannt<br />
wird im Einvernehmen mit der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Maxstr. 29<br />
67059 <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Tel. (0621) 5203 - 0<br />
Fax (0621) 5203 - 559<br />
für die Zeit vom …......…….……...……..……. bis ….............………………….………<br />
20 Wochen à 37,5 Stunden oder .......... Wochen à .......... Stunden<br />
auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils gültigen Fassung folgende Ausbildungsvereinbarung<br />
geschlossen:<br />
Zwei Wochen nach Beginn des Praktischen Studiensemesters.<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
(Exemplar für Studierende)<br />
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
B3<br />
Fachbereich IV-<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Ausbildungsvereinbarung<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/2013<br />
zwischen<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Einrichtung, Träger<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
vertreten durch Herrn / Frau<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Straße<br />
Postleitzahl, Ort<br />
....................................................................................................................................................................................<br />
Telefon Fax E-Mail<br />
und<br />
nachfolgend Praktikumsstelle genannt<br />
der/ dem Studierenden der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong>,<br />
Frau/Herr<br />
geboren <strong>am</strong>:<br />
in:<br />
Anschrift:<br />
Telefon:<br />
E-Mail:<br />
Matr.-Nr.:<br />
im folgenden Studierende/ Studierender genannt<br />
wird im Einvernehmen mit der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Maxstr. 29<br />
67059 <strong>Ludwigshafen</strong><br />
Tel. (0621) 5203 - 0<br />
Fax (0621) 5203 - 559<br />
für die Zeit vom …......…….……...……..……. bis ….............………………….………<br />
20 Wochen à 37,5 Stunden oder .......... Wochen à .......... Stunden<br />
auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils gültigen Fassung folgende Ausbildungsvereinbarung<br />
geschlossen:<br />
Zwei Wochen nach Beginn des Praktischen Studiensemesters.<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!<br />
§ 1 Pflichten<br />
(1) Die Praktikumsstelle verpflichtet sich,<br />
1. den/ die Studierende in der zuvor genannten Zeit für das Praktische Studiensemester unter Beachtung der Praxisordnung und des SoAnG fachlich<br />
auszubilden und anzuleiten,<br />
2. eine/n Diplom-Sozialarbeiter/in bzw. Diplom-Sozialpädagogen/in mit mindesten 3-jähriger Berufserfahrung mit der Anleitung zu beauftragen*,<br />
3. mit dem/der Studierenden einen Ausbildungsplan auf der Grundlage der Ordnung für die Praktischen Studienanteile zu erstellen,<br />
4. einen angemessenen Arbeitsplatz und erforderliche Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen,<br />
5. den Studierenden/die Studierende für die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> im Umfang von maximal 5<br />
ganztägigen und 5 halbtägigen Veranstaltungen zu befreien,<br />
6. eine Praxisbeurteilung zu erstellen, aus der hervorgeht, dass das Praktikum erfolgreich bzw. nicht erfolgreich abgeleistet wurde, die Angaben über<br />
etwaige Fehlzeiten enthält und die mit dem/ der Studierenden besprochen wurde,<br />
(2) Der/ die Studierende verpflichtet sich, sich dem Ausbildungszweck entsprechend zu engagieren (37,5 Stunden/Wo. Vollzeit).<br />
Er/sie muss<br />
1. die im Rahmen der Praktischen Studiensemester erteilten Aufgaben sorgfältig erfüllen und den Anweisungen der Praxisanleitung und des Trägers der<br />
Einrichtung/der Institutionsleitung nachkommen,<br />
2. die gesetzlichen Vorschriften und geltenden Ordnungen, insbesondere die Schweigepflicht und den Datenschutz beachten<br />
3. sein/ihr Fernbleiben der Praktikumsstelle unverzüglich anzeigen.<br />
*in begründeten Ausnahmefällen ist ein fachlich äquivalenter Abschluss zulässig<br />
§ 2 Kosten und Vergütung<br />
(1) Diese Vereinbarung begründet für die Praktikumsstelle keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten, die bei der Erfüllung der Vereinbarung entstehen.<br />
Dies gilt nicht, soweit es sich um Schadensfälle handelt, die in die Haftpflichtversicherung der/ des Studierenden fallen.<br />
(2) Der/ die Studierende sollte eine monatliche Praktikumsvergütung von € 300,- im Praktischen Studiensemester erhalten. Ein gesetzlicher Anspruch auf<br />
eine Vergütung durch die Praktikumsstelle besteht nicht.<br />
§ 3 Praxisanleiter/in<br />
Die Praktikumsstelle benennt Frau/ Herrn<br />
………………………………………………………………………………………………..<br />
………………………………………………………………………………………………..<br />
Beruf, Telefon/Fax /E-Mail des/der Anleiters/in, (bitte vollständig ausfüllen)<br />
als Praxisanleiter/in für die Ausbildung des/der Studierenden. Diese/r Praxisanleiter/in ist zugleich Ansprechpartner/in des/der Studierenden und des Fachbereichs<br />
Soziale Arbeit in allen Fragen, die diese Vereinbarung berühren.<br />
§ 4 Urlaub<br />
Der/die Studierende im Praktischen Studiensemester hat keinen Anspruch auf Erholungsurlaub.<br />
§ 5 Versicherungsschutz<br />
(1) Während des Praktischen Studiensemesters bleibt der Status eines/einer Studierenden für den Praktikanten/die Praktikantin bestehen. Er/sie ist daher<br />
kraft Gesetzes gegen Unfall versichert. Im Versicherungsfalle informiert die Praktikumsstelle den Fachbereich Soziale Arbeit über den Unfall.<br />
(2) Sofern das Haftpflichtrisiko des/der Studierenden während der praktischen Tätigkeit nicht durch eine Haftpflichtversicherung der Praktikumsstelle gedeckt<br />
ist, hat diese den/die Studierende/n auf die für ihn/sie geltenden Schadensersatz- und Regressverpflichtungen hinzuweisen. Das gleiche gilt, wenn die<br />
Praktikumsstelle im Innenverhältnis Regressansprüche geltend machen will.<br />
§ 6 Fehlzeiten<br />
(1) Der/die Studierende ist verpflichtet, die durch Krankheit bedingte Verhinderung unverzüglich mitzuteilen. Er/sie hat vom 3. Tag der Krankheit an der<br />
Praktikumsstelle eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen und die <strong>Hochschule</strong> zu verständigen.<br />
(2) Durch Krankheit, Mutterschutz oder Erziehungsurlaub nicht angetretene Zeiten des Praktischen Studiensemesters werden bis zu drei Wochen auf die<br />
Dauer des Praktischen Studiensemesters angerechnet.<br />
§ 7 Kündigung der Vereinbarung<br />
(1) Die Ausbildungsvereinbarung kann von der Praktikumsstelle mit entsprechender arbeitsrechtlich fundierter Begründung in Abstimmung mit dem<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden.<br />
(2) Der/die Studierende kann die Ausbildungsvereinbarung mit arbeitsrechtlich fundierter Begründung im Einvernehmen mit dem Praktikanten<strong>am</strong>t durch<br />
schriftliche Erklärung mit einer Frist von 14 Tagen kündigen.<br />
(3) Das Recht der Praktikumsstelle und der Studierenden, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes analog arbeitsrechtlicher Bestimmungen mit sofortiger<br />
Wirkung zu kündigen, bleibt unberührt.<br />
§ 8 Ausfertigung der Vereinbarung<br />
Diese Vereinbarung wird in drei Ausfertigungen unterzeichnet. Jede/r Vereinbarungspartner/in erhält eine Ausfertigung.<br />
§ 9 Sonstige Vereinbarungen<br />
Sonstige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.<br />
……………………………………...........................................………….........………<br />
Ort/Datum<br />
………………………….................…… ………….............................................. ……............................…………………….<br />
Vertreter/in der Student/in Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Praktikumsstelle<br />
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
C<br />
Fachbereich IV -<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Antrittsbestätigung<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
Datum …………………………………………<br />
Der/die Studierende<br />
(N<strong>am</strong>e, Vorn<strong>am</strong>e)<br />
Matr.-Nr.:<br />
hat in der Praktikumsstelle ......................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................<br />
<strong>am</strong> (A) 03. Sept. 2012<br />
(B) 10. Sept. 2012<br />
(C) .......................<br />
das Praktische Studiensemester angetreten.<br />
......................................................................<br />
Dienststempel<br />
Unterschrift Praxisanleiter/in<br />
Abgabe beim Praktikanten<strong>am</strong>t:<br />
Zwei Wochen nach Beginn des Praktischen Studiensemesters!<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
D<br />
Fachbereich IV –<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Bescheinigung über die Ableistung des<br />
Praktischen Studiensemesters<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
Der/die Studierende Datum: ....……………………….<br />
(N<strong>am</strong>e, Vorn<strong>am</strong>e)<br />
Matr.-Nr.:<br />
hat in der Praktikumsstelle ……………………………………………………….................….<br />
………………………………………………………………………………………..................<br />
in der Zeit vom (A) 03.09.2012 bis 18.01.2013<br />
(B) 10.09.2012 bis 25.01.2013<br />
(C) .................. - ...................<br />
20 Wochen à 37,5 Stunden Vollzeit oder .......... Wochen à .......... Stunden<br />
das Praktische Studiensemester abgeleistet.<br />
Fehlzeiten ……………………………………………………………………………<br />
von – bis / Grund des Fehlens<br />
Das Praktische Studiensemester wurde erfolgreich absolviert. Die im Ausbildungsplan aufgeführten Lernziele wurden<br />
erreicht.<br />
Ja<br />
nein<br />
Bericht über die Entwicklung und fachliche Eignung der/des Studierenden:<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
.....................................................................................................................................................................................<br />
………………………………………..................................….<br />
Stempel/Unterschrift Praxisanleiter/in<br />
Abgabe beim Praktikanten<strong>am</strong>t:<br />
Bei Beendigung des Praktischen Studiensemesters<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
HS <strong>Ludwigshafen</strong> • Ernst-Boehe-Straße 4 • 67059 <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
E<br />
Fachbereich IV –<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Standort: Maxstraße 29<br />
Teilnahmebestätigung Supervision<br />
Praktisches Studiensemester<br />
Wintersemester 2012/ 2013<br />
Datum ………………………………………<br />
Der/die Studierende<br />
(N<strong>am</strong>e, Vorn<strong>am</strong>e)<br />
Matr.-Nr.:<br />
hat an folgenden Supervisionssitzungen teilgenommen:<br />
28. September 2012<br />
........................................................................<br />
(Unterschrift Supervisor/in)<br />
26. Oktober 2012<br />
........................................................................<br />
(Unterschrift Supervisor/in)<br />
23. November 2012<br />
........................................................................<br />
(Unterschrift Supervisor/in)<br />
14. Dezember 2012<br />
........................................................................<br />
(Unterschrift Supervisor/in)<br />
11. Januar 2013<br />
........................................................................<br />
(Unterschrift Supervisor/in)<br />
Abgabe beim Praktikanten<strong>am</strong>t:<br />
Bei Beendigung des Praktischen Studiensemesters<br />
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!
Termine Prakt. Studiensemester BASA<br />
Wintersemester 2012 / 2013<br />
Fachbereich IV<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Meldung der Praktikumsstelle beim Praktikanten<strong>am</strong>t:<br />
bis 02.07.2012<br />
Dauer: 03.09.2012-18.01.2013<br />
oder<br />
10.09.2012-25.01.2013<br />
Antrittsbestätigung und Abgabe des Vertrages:<br />
14 Tage nach Beginn des Prakt. Studiensemesters<br />
beim Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Abgabe Ausbildungsplan:<br />
bis zum1. Begleittag<br />
bei dem/der Schwerpunktleitern/in<br />
Ganztägige Begleittage: Donnerstag, 27.09.2012<br />
Montag, 22.10.2012<br />
Dienstag, 20.11.2012<br />
Mittwoch, 12.12.2012<br />
Donnerstag, 10.01.2013<br />
Supervision (halbtags): Freitag, 28.09.2012<br />
Freitag, 26.10.2012<br />
Freitag, 23.11.2012<br />
Freitag, 14.12.2012<br />
Freitag, 11.01.2013<br />
Beurteilung der Praktikumsstelle: bis 08.02.2013<br />
beim Praktikanten<strong>am</strong>t<br />
Abgabe Praktikumsbericht: bis 08.03.2013<br />
bei dem/der jeweiligen Studienschwerpunktleiter/in<br />
gez. Michael Dillmann<br />
<strong>Ludwigshafen</strong>, 17.01.2012