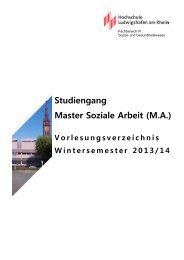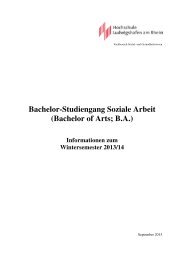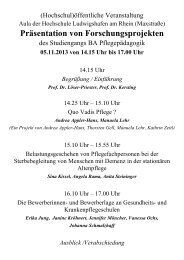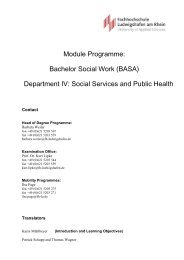Modulhandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Modulhandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Modulhandbuch - Hochschule Ludwigshafen am Rhein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Modulhandbuch</strong><br />
Bachelor-Studiengang<br />
Marketing<br />
Version 1.1<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
Fachbereich II
Titel des Moduls: Propädeutikum<br />
Kennnummer<br />
M100<br />
Workload<br />
180 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Einführungsveranstaltung<br />
b) Buchführung<br />
c) Wissenschaftliches<br />
Arbeiten<br />
Credits<br />
6<br />
Kontaktzeit<br />
Studiensemester<br />
1. Sem.<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Einführungsveranstaltung:<br />
Wissen und Verstehen<br />
Häufigkeit des Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
112,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Studierende lernen die <strong>Hochschule</strong>, den Studienort <strong>Ludwigshafen</strong>, Lehrende und Studierende<br />
aus höheren Semestern des Studiengangs kennen. Sie erlangen dabei Kenntnisse und Zugang<br />
zu Informationen bezüglich des Studiengangs und hochschulspezifische Vorgänge und können<br />
aktiv d<strong>am</strong>it umgehen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden erhalten u.a. eine Einführung in die Funktionsweise der Bibliothek und erlernen<br />
die dort zur Verfügung stehenden Services und Angebote zu nutzen.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden kennen Ansprechpartner und Kontaktwege für die Belange Ihres Studiums.<br />
Buchführung:<br />
Wissen und Verstehen<br />
In Buchführung werden erste betriebswirtschaftliche Grundlagen zum Verstehen der Verarbeitung<br />
von finanzwirtschaftlichen Daten im Unternehmen gelegt.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden sind über die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften des Rechnungswesens<br />
informiert und kennen typische Belege, Buchungsverfahren, Bücher sowie den Kontenrahmen<br />
als organisatorisches Instrument der Buchführung. Sie sind fähig, typische Buchungsvorgänge<br />
in einem Industrie-, Handels- bzw. Dienstleistungsunternehmen einschließlich<br />
der vorbereitenden Jahresabschlussbuchungen zu entwickeln und zu begründen.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden erhalten die Befähigung, Informationen des Jahresabschlusses eines Unternehmens<br />
entscheidungsorientiert auszuwerten und die Ergebnisse zu kommunizieren.<br />
Wissenschaftliches Arbeiten:<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Nach der Teilnahme an der Veranstaltung sind die Studierenden in der Lage:<br />
- den Zweck und die Ziele wissenschaftlichen Arbeitens zu beschreiben.<br />
- wichtige Konzepte der Wissenschaftstheorie zu charakterisieren und die Marketingtheorie<br />
darin einzuordnen.<br />
- den Unterschied zwischen induktiver und deduktiver Forschungslogik zu begründen
- die Grenzen der Objektivität im Forschungsprozess darzustellen<br />
- die Anforderungen an wissenschaftliche Hypothesen zu beschreiben<br />
- den grundsätzlichen Aufbau einer Forschungsarbeit und den Forschungsprozess darzustellen<br />
- die Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit zu erklären<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden zeigen anhand von Aufgaben und in der Diskussion, dass sie ihre theoretischen<br />
Kenntnisse auf spezifische Fragestellungen übertragen, Aussagen strukturiert auf Richtigkeit<br />
überprüfen und logische Fehler entdecken können.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden nehmen Stellung zu Einzelaspekten und diskutieren sie zus<strong>am</strong>men mit ihren<br />
Kommilitoninnen / Kommilitonen und dem Lehrenden.<br />
3 Inhalte<br />
Einführungsveranstaltung:<br />
Studiengangorientierung, Marketingverständnis an der <strong>Hochschule</strong> <strong>Ludwigshafen</strong>, Anerkennungsmöglichkeiten,<br />
Optionen für das Auslandsstudium/Praxissemester, Prüfungsordnung<br />
Buchführung:<br />
Finanzbuchhaltung, Grundlagen Kosten- und Leistungsrechnung, Statistik, Analyse, Planung<br />
Wissenschaftliches Arbeiten:<br />
Im Zentrum des propädeutischen Lehrgebiets 'Wissenschaftliches Arbeiten' steht die Vermittlung<br />
theoretischer Grundlagen für selbständiges wissenschaftliches Arbeiten. In einem ersten<br />
Teil werden wissenschaftstheoretische Grundlagen, Begriffe behandelt sowie besonders der<br />
Bezug der Marketingforschung zu empirischer Sozialwissenschaft verdeutlicht. Darauf aufbauend<br />
wird in einem zweiten Teil konkretes wissenschaftliches Handwerk vermittelt, wie der<br />
grundsätzliche Aufbau und Gliederung einer Forschungsarbeit, Grundlagen des wissenschaftlichen<br />
Informationsmanagements, Umgang mit fremden Gedankengut , Zitiertechnik, Gestaltung<br />
und Einbindung von Abbildungen und Tabellen sowie das Erstellen eines Literaturverzeichnisses<br />
nach wissenschaftlichem Standard. Im dritten Teil wird die Theorie entsprechend<br />
den anfallenden Arbeitsschritten bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit vermittelt:<br />
Formulierung und Präzisierung des Forschungsproblems, der Forschungslücke und Forschungsfrage,<br />
die korrekte Formulierung wissenschaftlicher Hypothesen, Konzeptspezifikation,<br />
Festlegung des Untersuchungsdesigns, des Untersuchungss<strong>am</strong>ples, Datenerhebung bis zur<br />
Datenanalyse und Dokumentation.<br />
4 Lehrformen<br />
Hochschulführung, Stadtführung, Informationsveranstaltung, Gespräche, Vorlesung, Seminaristischer<br />
Unterricht<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: Immatrikulation im Bachelorstudiengang Marketing<br />
Inhaltlich: - keine -<br />
6 Prüfungsformen:<br />
Studienleistung Buchführung, Wissenschaftliches Arbeiten (unbenotete Klausur : bestanden / nicht bestanden),<br />
Bearbeitungszeit max. 120 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen, Erbringen der Studienleistung<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
- Keine -
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Unbenotete Studienleistung geht nicht in die Berechnung der Endnote mit ein<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Klaus Blettner / Prof. Dr. Manfred König, Prof. Dr. Isabella Wünsche<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Buchführung wird anerkannt, wenn Studierende einen entsprechenden Nachweis über Buchführungskenntnisse<br />
im Rahmen der Hochschulreife oder Berufsausbildung erbringen.
Titel des Moduls: Marketingforschung<br />
Kennnummer<br />
M 310<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Grundlagen Marketingforschung<br />
b) Statistik für Marktforschung<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
3. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Grundlagen Marketingforschung:<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden erläutern, welche Problemstellungen in der Marketingdisziplin untersucht und wie Erkenntnisse<br />
in der Marketingforschung gewonnen werden. Sie beurteilen Marktforschungsergebnisse<br />
hinsichtlich der Transparenz, .der Vertrauenswürdigkeit und wissenschaftlich entsprechend der<br />
Gütemaße. Sie lernen den Prozess der Marketingforschung hinsichtlich Desk Research und Fieldwork,<br />
Eigen- und Fremdmarktforschung und der einzelnen Prozessschritte kennen. In jedem Prozessschritt<br />
bestimmen sie ausgehend von den dargestellten Inhalten das Vorgehen und identifizieren die Vorteile<br />
und Gefahren die die konkrete Ausgestaltung der Prozessplanung beeinflussen. Sie können untern<br />
Anleitung systematisch konkrete wissenschaftliche Fragestellungen im Marketing-Kontext bearbeiten. Sie<br />
erkennen die mit den Transformationsschritten verbundenen wissenschaftstheoretischen Implikationen<br />
(z.B. Modellbildung, Methodenwahl), können diese beschreiben, beurteilen und in ihren Folgen für die<br />
wissenschaftliche Arbeit einschätzen. Das bedeutet, die Studierenden sind in der Lage die qualitativen<br />
und quantitativen Marktforschungsinstrumente zu beschreiben, ihre anwendungsbezogenen Vor-und<br />
Nachteile gegenüberzusetzen und das geeignete Instrumentarium in ein Forschungsdesign zu<br />
integrieren. Sie entwerfen konkretes Befragungs- oder Beobachtungsdesign und evaluieren den zu<br />
erwartenden Erfolg vor der Durchführung der geplanten Maßnahme und danach. Die Anwendung der<br />
relevanten statistischen Analyse-Methoden können sie bereits in das Forschungsdesign einordnen. Der<br />
Ergebnisbericht kann angefertigt werden. Inhaltliche Anforderungen und die an das Design eines<br />
Ergebnisberichtes und einer Ergebnispräsentation werden wiedergegeben und umgesetzt.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden zeigen anhand von konkreten Marktforschungsproblemen, dass sie ihre theoretischen<br />
Kennt-nisse systematisch auf die Lösung dieser übertragen können und dabei die inhaltliche und formale<br />
Vorgehensweise wissenschaftlichen Arbeitens anwenden. Sie lernen methodisch ein<br />
Managementproblem in ein Marktforschungsproblem umzuwandeln, Methoden der Informationssuche<br />
und –bewertung und die wissenschaftlich fundierte Erstellung des Forschungsdesigns. Die vorgestellten<br />
Methoden der Sekundär- und Primärforschung und der qualitativen und quantitativen Marketingforschung<br />
können sie für ein konkretes Marketingforschungsproblem anwenden einschließl. der begründeten<br />
Entscheidung über geeignete Analyseverfahren. Aus dem statistischen und<br />
verhaltenswissenschaftlichen Instrumentarium werden Methoden zur sinnvollen Verdichtung erhobener<br />
Daten und ihrer Interpretation vermittelt.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden vertiefen die theoretischen Grundlagen durch eigene Literaturrecherchen und –studien.<br />
In Projekten und Fallstudien wenden sie fachlich klar verständlich die Inhalte der Teilaufgaben darstellen<br />
und mit ihren Kommilitonen und Lehrenden diskutieren können. Neben Vortrags- und<br />
Einzelarbeitsphasen lernen und arbeiten sie gemeins<strong>am</strong> in Gruppen. Grundlage der Te<strong>am</strong>arbeit ist die<br />
weiterführende Kommunikation mit den Mitgliedern. Die Studierenden erwerben Erfahrung in der<br />
Kommunikation als Marktforscher gegenüber Probanden durch Projektarbeit. Die Studierenden<br />
systematisch erwerben Fähigkeiten und sind kompetent, wissenschaftlich und praktisch zu<br />
kommunizieren.
Statistik für Marktforschung:<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Studierende sind in der Lage, statistische Analysen sinnvoll durchzuführen. Aufbauend auf den<br />
Kenntnissen der Grundlagen der Statistik entscheiden sie über die Auswahl geeigneter Verfahren<br />
entsprechend des verfügbaren Datenmaterials aus der Sekundär- und Primärforschung. Sie verstehen<br />
die einzelnen Verfahren hinsichtlich ihrer Aussage, der maßgeblichen Verfahrensschritte und der zu<br />
beachtenden Restriktionen. Sie erstellen eigenständig mit Hilfe statistischer Software (z.B. SPSS)<br />
Auswertungen und diskutieren die Ergebnisse des Outputs. Statistisches Vokabular können die<br />
Studierenden exakt wiedergeben und Experten sowie Laien erklären.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Auf Basis der Methoden der Marketingforschung und der Statistik sind die Studierenden in der Lage,<br />
Datenauswertungen durch Anwendung von deskriptiver Statistik, multivariater und Prognosemethoden<br />
selbständig durchzuführen. Solide Methodenkenntnis ist Voraussetzung für die Anwendung der<br />
statistischen Software. Die effiziente Softwarenutzung setzt die Kenntnis der angebotenen<br />
Auswertungsmethoden mit ihren Teilschritten voraus. Die Verdichtung und Darstellung der Ergebnisse<br />
wird nach den methodischen Vorgaben in den Grundlagen praktisch vorgenommen.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden können in Einzel- und Te<strong>am</strong>arbeit in Form von Projekten und Fallstudien fachlich klar<br />
verständlich die statistischen Sachverhalte und die zu erwartenden Aussagen aus der Datenauswertung<br />
darstellen und mit ihren Kommilitonen und Lehrenden diskutieren. Grundlage der Te<strong>am</strong>arbeit ist die<br />
weiterführende Kommunikation mit den Mitgliedern. Die Studierenden erwerben Fähigkeiten in der<br />
kompetenten wissenschaftlich-praktischen Kommunikation in der Diskussion mit Te<strong>am</strong>mitgliedern und<br />
Lehrenden und als Marktforscher gegenüber künftigen oder tatsächlichen Auftraggebern.<br />
3 Inhalte<br />
Die Aufgaben- und Anwendungsgebiete der Marketingforschung werden erarbeitet. Eigenmarkt- und<br />
Fremdmarktforschung werden mit ihren entscheidungsrelevanten Vor-und Nachteilen vorgestellt. Die<br />
inhaltliche Erklärung des Marktforschungprozesses mit seinen Teilschritten ist die Basis für die<br />
Darstellung der Methoden der Datengewinnung (Sekundär-, Primärforschung). Vermittelte Kenntnisse<br />
über den Ablauf der Sekundärforschung und die Auswahl geeigneter Datenquellen sind Grundlage für<br />
sich anschließende praktische Übungen. Es werden Vor- und Nachteile der Sekundär-, Primärforschung<br />
gegenübergestellt und diskutiert.<br />
Die verfügbaren Methoden der Primärforschung, die qualitativen und die quantitativen Methoden der<br />
Datengewinnung werden einzeln inhaltlich und hinsichtlich ihrer Anwendung erklärt, Know-how für<br />
Befragungs- und Beobachtungsdesign vermittelt und in Fallstudien und Projektarbeit praktisch<br />
umgesetzt. Wissen aus strategischem Marketing zur Marktsegmentierung bildet die Basis für die<br />
Auswahl der Stichprobe nach Struktur und Umfang. Die Eignung unterschiedlicher Stichproben-<br />
Auswahlverfahren für das Marktforschungsproblem bzw. die Zielgruppe wird diskutiert und bewertet.<br />
Die Durchführungsphase wird durch Projektarbeit oder eine Fallstudie praktisch vermittelt und an Hand<br />
der Erfahrungen ausgewertet. Methoden der Datenauswertung beginnen mit der Vermittlung der<br />
Fähigkeiten der Dateneingabe, Codierung und Prüfung der Daten hinsichtlich ihrer Korrektheit.<br />
Die Datenauswertung findet mit Hilfe von Statistiksoftware statt. Es werden Kenntnisse zur Auswahl<br />
geeigneter statistischer Methoden vermittelt und die Interpretation des Output der statistischen<br />
Ergebnisse. Eingeschlossen sind statistische Test- und Prüfverfahren in die Auswertung.<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung, Einzelarbeitsphasen, Gruppenarbeit, Fallstudien, Projektarbeit, Computer<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: Teilnahme an Modul Statistik
6 Prüfungsformen<br />
Klausur oder Fallstudie und Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote<br />
werden jeweils vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur oder Fallstudie und Präsentation<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Gabi Theuner<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Angebotsmanagement<br />
Kennnummer<br />
M 320<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Produktmanagement<br />
Preismanagement<br />
Marken- und Wettbewerbsrecht<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
Studiensemester<br />
3. Sem.<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden können den Gegenstand, die Ziele und Gestaltungselemente des Produktmanagements<br />
und der produktpolitischen Entscheidungsfindung erläutern. Produkt- und Progr<strong>am</strong>manalysen<br />
können sie anhand geeigneter Kennzahlen und Methoden anwenden, die Ergebnisse können sie entscheidungsrelevant<br />
aufbereiten und interpretieren. Zum Verständnis des Begriffs Innovation aus wissenschaftlicher<br />
und praktischer Sicht können sie Stellung nehmen. Das Phasenkonzept des Innovationsmanagements<br />
und das Zus<strong>am</strong>menwirken der Funktionsbereiche können sie erläutern, den Zus<strong>am</strong>menhang<br />
des Neuproduktplanungsprozesses mit der Marketingstrategie können sie begründen. Die Eignung der<br />
Conjoint Analyse für die Produktgestaltung und für das Value Pricing können sie beurteilen und sie sind<br />
in der Lage Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchzuführen. Sie unterscheiden strategische, taktische,<br />
aktive und passive Positionierung und können aufzeigen, wie Analysen zur Produktpositionierung<br />
durchgeführt werden und welche Verfahren dabei Anwendung finden. Die Beziehungen zwischen Produktentwicklung<br />
und Sustainability können sie kritisch darlegen.<br />
Die Studierenden können den Zus<strong>am</strong>menhang von Preispolitik und Preismanagement und die jeweiligen<br />
Entscheidungsfelder und das Zus<strong>am</strong>menspiel von Preis und den anderen Marketinginstrumenten erläutern.<br />
Auf Basis einer Einführung in die statische Preistheorie können sie Berechnungen mit Preisabsatz-,<br />
Kosten- und Gewinnfunktionen durchführen sowie Preiselastizitäten berechnen und interpretieren. Zudem<br />
sollen die Studierenden die Entscheidungstatbestände im Rahmen der dyn<strong>am</strong>ischen Preistheorie<br />
und Spezialprobleme des Preismanagements erläutern. Sie sind in der Lage, die Marketingrelevanz<br />
psychologischer Erklärungsmodelle gegenüber dem preistheoretischen Modell des „homo oeconomicus“<br />
kritisch zu würdigen und sie können erläutern, wie sich die Preisdeterminanten auf die Preiswahrnehmung<br />
auswirken. Den Prozess der Preisbestimmung können sie im Zus<strong>am</strong>menhang mit Methoden der<br />
Preisbestimmung beschreiben, die preispolitischen Strategien können sie voneinander abgrenzen und<br />
kritisch reflektieren.<br />
Die Studierenden können die für das Marketing, insbesondere im Zus<strong>am</strong>menhang mit der Produkt- und<br />
Preispolitik maßgeblichen Rechtsnormen beschreiben und hinsichtlich ihrer Relevanz potentiellen Konfliktfeldern<br />
zuordnen. Sie können die wesentlichen Rechtsnormen im Hinblick auf Konfliktlösung und<br />
Konfliktvermeidung im Marketing einschätzen und sie auf einfache Fälle und Fragen im Bereich des<br />
Marketings, vor allem in den Entscheidungsfeldern der Angebotspolitik selbständig anwenden und sachgerecht<br />
lösen bzw. bearbeiten.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können vorgegebene Problemstellungen des Produkt- und Preismanagements anhand<br />
gegebener Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu einer Lösung führen. Die<br />
vorgestellten Methoden des Produktmanagements sowie der Preisfindung und Preisbildung können sie<br />
bei der Lösung von Aufgaben anwenden. Die erworbenen rechtlichen Kenntnisse können sie in Fallbeispielen<br />
anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen (Haus-)Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu produkt- und preispolitischen<br />
Fragestellungen, stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden
und verteidigen sie argumentativ. Sie können die wesentlichen Rechtsnormen auf einfache Fälle und<br />
Fragen im Bereich des Marketings selbständig anwenden und sachgerecht lösen bzw. bearbeiten und<br />
das Ergebnis in der Diskussion mit den Studierenden und Lehrenden vertreten.<br />
3 Inhalte<br />
Nach einer ausführlichen Begriffsklärung hinsichtlich Produkt, Gegenstand und Ziele des Produktmanagements<br />
werden die Gestaltungselemente produktpolitischer Entscheidungen vorgestellt. Produkt- und<br />
Progr<strong>am</strong>manalysen und die hierzu erforderlichen Analysemethoden und –instrumente sowie Methoden<br />
der Sortimentsplanung bilden einen weiteren Teilbereich der Veranstaltung. Im Besonderen wird auf die<br />
Entwicklung und Einführung neuer Produkte im Kontext der Marketingstrategie und der Produkteplanung<br />
eingegangen. Anhand des Phasenkonzeptes des Innovationsmanagement lernen die Studierenden Methoden<br />
und Entscheidungsfelder sowie die Schnittstellen zu anderen Unternehmensbereichen kennen.<br />
Von besonderer Relevanz ist die kundennutzenorientierte Vorgehensweise bei der Gestaltung von alternativen<br />
Produktkonzepten im Zus<strong>am</strong>menhang mit der Preisfindung mittels Conjoint Analyse sowie die<br />
Produktpositionierung auf Basis multivariater Analysemethoden. Nach einer grundlegenden Einführung in<br />
das Preismanagement und der Einordnung der Preispolitik werden typische Entscheidungsfelder der<br />
Preismanagements diskutiert. Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der strategischen, taktischen und operativen<br />
Dimensionen des Preismanagement sollen erkannt, verstanden und interpretiert werden können.<br />
Ökonomische Theorien und psychologische Ansätze zur Analyse optimaler Preisstrategien werden<br />
dargestellt und auf die Preisgestaltung angewendet, dabei werden anhand von Preisabsatz-, Kosten- und<br />
Gewinnfunktionen gewinnmaximale Preismengenkombinationen bestimmt. Kern des Moduls bilden wegen<br />
ihrer praktischen Relevanz verhaltenswissenschaftliche Erklärungsmodelle hinsichtlich Preiswahrnehmung<br />
und die Preisfindung. Auf Basis dieser Kenntnisse werden Verfahren der Preisbildung diskutiert,<br />
Value Pricing und Methoden der Nutzenorientierten Preisbildung bilden dabei den Schwerpunkt.<br />
Lebenszyklus- und Wettbewerbsbezogene Preisstrategien, Formen der Preisdifferenzierung sowie Preispositionierung<br />
schließen das Modul ab. Betriebswirtschaftliches Handeln findet immer in einem rechtlichen<br />
Rahmen statt. Dies wird in besonderer Weise im Bereich Marketing vor allem im Zus<strong>am</strong>menhang<br />
mit der Produkt- und Preispolitik bedeuts<strong>am</strong>. Die Rechte und Pflichten im Zus<strong>am</strong>menhang mit Marketingleistungen<br />
selbst einzuschätzen, soll erlernt werden. Es sollen rechtliche Zus<strong>am</strong>menhänge und Probleme<br />
in diesem Kompetenzfeld erkannt, gestaltet und gelöst werden. Im Mittelpunkt stehen dabei das UWG<br />
(einschl. Nebengesetze) und GWB, Marken- und sonstige Kennzeichenrechte, Urheber- und Leistungsschutzrechte<br />
und deren praktische Anwendung.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminaristischer Unterricht, Fallstudien, Gruppenarbeiten<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: - keine -<br />
Inhaltlich: - keine -<br />
6 Prüfungsformen:<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Klausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
- Keine -<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8/144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Manfred König / Prof. Dr. Manfred König, Prof. Dr. Dr. Christoph Rohleder<br />
11 Sonstige Informationen<br />
- Keine -
Titel des Moduls: Konzeptionelles Marketing<br />
Kennnummer<br />
M 330<br />
Workload<br />
240 h<br />
Credits<br />
8<br />
Studiensemester<br />
3. Sem.<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Marketingplanung und -<br />
controlling<br />
Einführung Internationales<br />
Marketing<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 45 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
geplante Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden können die Zus<strong>am</strong>menhänge von Kundennutzenorientierung, strategischen Wettbewerbsvorteilen<br />
und Marketingstrategie erläutern und begründen. Die generischen Strategieoptionen,<br />
vorgestellten Strategiekonzepte und die Planungstools können sie hinsichtlich ihrer theoretischen Fundierung<br />
und Praxisrelevanz voneinander abgrenzen und kritisch beurteilen. Sie sind in der Lage, die Grundlagen<br />
des Strategischen Marketings, der strategischen Situationsanalyse sowie der Ziel- und Strategieplanung<br />
auf konkrete Aufgabenstellungen analytisch anzuwenden und daraus Lösungsansätze zu entwickeln.<br />
Hierzu können sie die erforderlichen Marketingkennzahlen berechnen und ihre Bedeutung für<br />
das Marketingcontrolling beurteilen. Die Bedeutung von Marketingkonzepten für strategische Teilpläne,<br />
z.B. Innovationsstrategie, und die Einbindung der strategischen Marketingplanung in die Unternehmensplanung<br />
können sie ebenso wie auch ethische Anforderungen im Kontext von Marketingentscheidungen<br />
beurteilen.<br />
Die Studierenden können die Herausforderungen des internationalen Marketings sowie Theorien und<br />
Strategien der Internationalisierung erläutern. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten der internationalen<br />
Marktbearbeitung zu begründen und globale, internationale, multinationale und transnationale Problemstellungen<br />
im Kontext der unternehmensinternen Organisation abzugrenzen. Basisentscheidungen<br />
zur Marktauswahl, Markteintrittsstrategie, Timing und Formen des Markteintritts, Marktbearbeitung sowie<br />
Interdependenzen zwischen diesen Basisentscheidungen können sie begründet voneinander abgrenzen.<br />
Ethische Implikationen internationaler Marktbearbeitung können sie kritisch würdigen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden beherrschen die grundlegende methodische Vorgehensweise und die Verfahren der<br />
Marketingplanung und des internationalen Marketing. Sie können selbständig Problemstellungen und<br />
Zus<strong>am</strong>menhänge analysieren, strukturieren und systematisch darstellen. Sie erkennen die hierzu erforderlichen<br />
Informationen. Methoden und Modelle zur Problemlösung können sie ableiten und fallstudienbezogen<br />
anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden diskutieren mit den Studierenden Problemstellungen aus Aufgabenstellungen und<br />
Fallstudien und verteidigen argumentativ ihre Lösungen. Im Rahmen der Gruppenarbeiten übernehmen<br />
sie Verantwortung für ihr Te<strong>am</strong>.<br />
3 Inhalte<br />
Die Veranstaltung „Marketingplanung und –controlling“ greift zunächst grundlegende Aufgabenstellungen<br />
und Strategien marktorientierter Unternehmensführung auf und setzt dabei Schwerpunkte auf Nutzenorientierung<br />
und - ausgehend von den Wurzeln des Strategiebegriffs im Marketing bei u.a. Drucker,<br />
Porter, Ansoff - die Schaffung strategischer Wettbewerbsvorteile. Die Studierenden lernen zunächst<br />
generische Strategien, deren theoretische Fundierung und Relevanz für die jeweilige strategische Entscheidungsebene<br />
sowie die Stellung der Marketingplanung im Kontext der Unternehmensplanung ken-
nen. Im Anschluss daran werden dann die Elemente einer Marketingstrategie von der Situationsanalyse<br />
bis zur Strategiedokumentation systematisch behandelt und diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die<br />
Analyse-, Planungsmethoden und Instrumente, ihre theoretische Fundierung und praktische Relevanz.<br />
Die Veranstaltung „Einführung Internationales Marketing“ trägt der absatzseitigen unternehmerischen<br />
Internationalität Rechnung. Behandelt werden Ursachen, Folgen und Motive der Internationalisierung,<br />
ausgewählte Herausforderungen und Ansätze, die einen Erklärungsbeitrag zur Internationalisierung leisten.<br />
Diese werden anhand von Wettbewerbsstrategien international tätiger Unternehmen reflektiert, dabei<br />
stehen die Internationalisierungsstrategien und die jeweiligen Organisationsformen im Fokus. Über die<br />
Betrachtung der Internationalisierung der Wirtschaft und der regionalen Integrationsprozesse hinaus<br />
bilden die Methoden und Instrumente des internationalen Marketings, die Marktauswahl, Markteintrittsstrategien,<br />
das Timing und die Formen des Markteintritts sowie die Marktbearbeitung den Kern der Veranstaltung.<br />
Im Modul geht es im Weiteren um die Identifikation gesellschaftlicher und insbesondere ökologischer<br />
Herausforderungen sowie ethischer Anforderungen an das Marketing im Allgemeinen und an das internationale<br />
Marketing im Besonderen.<br />
4 Lehrformen<br />
Seminaristischer Unterricht, Fallstudien, Gruppenarbeiten<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: - keine -<br />
Inhaltlich: - keine -<br />
6 Prüfungsformen:<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Klausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
- Keine -<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8/144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Manfred König / Prof. Dr. Manfred König<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Kommunikationsmanagement<br />
Kennnummer<br />
M 400<br />
Workload<br />
300 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Grundlagen<br />
b) Mediaplanung<br />
c) Dialogmarketing<br />
Credits<br />
10<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
232,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Die Studierenden können die Integrierte Kommunikation als Basis der Unternehmenskommunikation<br />
beschreiben. Sie sind in der Lage, Ziele, Aufgaben und Merkmale der Integrierten Kommunikation<br />
darzustellen und den Einsatz der Kommunikationsinstrumente im Marketing – Mix zu begründen.<br />
Ausgehend von Kommunikationszielen und –strategien identifizieren die Studierenden problembezogen<br />
Zielgruppen gerechte Kommunikationsinstrumente. Sie legen dar, inwieweit die Instrumente auf neu zu<br />
erschließenden Märkten angepasst werden sollen oder inwieweit eine ähnliche Ausgestaltung wie auf<br />
bereits bearbeiteten Märkten erfolgen soll (Standardisierung/Differenzierung). Sie kennen die<br />
wesentlichen Einflussfaktoren der Standardisierungs-/Differenzierungsentscheidung und können diese<br />
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den optimalen Standardisierung-/Differenzierungsgrad beurteilen.<br />
Die Kommunikation im Unternehmen und die Kommunikation mit dem Umfeld können sie erklären und<br />
Schlüsse ziehen zur Ausgestaltung und Abstimmung der internen mit der externen Kommunikation.<br />
Die Mediaplanung hinsichtlich der einzelnen Planungsschritte lernen die Studierenden anzuwenden und<br />
zu beurteilen. Dabei werden Verbindungen zum strategischen Marketing, zur Marketingforschung und<br />
zum Konsumentenverhalten gezogen. Die Gemeins<strong>am</strong>keiten und Besonderheiten der neuen Medien<br />
gegenüber den klassischen Medien können sie charakterisieren und Schüsse ziehen für die<br />
konzeptionelle und operative (K<strong>am</strong>pagnen) Kommunikation. Die Studierenden erkennen die optimalen<br />
Methoden zur Erfolgsmessung der Kommunikationsmaßnahmen und können sie anhand praktischer<br />
Beispiele demonstrieren.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden analysieren und strukturieren selbständig wesentliche Kommunikationsschwerpunkte<br />
aus Fallstudien, aktuellen Pressemitteilungen bzw. Unternehmensproblemstellungen. Sie tragen die zur<br />
Lösung notwendigen Informationen zus<strong>am</strong>men und entwickeln einen fundierten aufeinander<br />
abgestimmten Instrumenteneinsatz. Methoden der kommunikationsbezogenen Marketingforschung, zum<br />
Konsumentenverhalten und zur Medienplanung können sie bei der Lösung der Aufgaben anwenden.<br />
Durch Laborarbeit mit apparativen Verfahren wird die Methodenkompetenz hinsichtlich der Beurteilung<br />
der Effizienz der Kommunikationsplanung entwickelt.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden sind in der Lage, die Problemstellungen und die Entscheidungsvorbereitung zu<br />
diskutieren, argumentativ ihre Entscheidungsempfehlungen zu verteidigen und auf Anregungen und<br />
Gegenargumente Dritter einzugehen. Im Rahmen der Gruppenarbeiten kommunizieren sie professionell<br />
im Te<strong>am</strong> zur effektiven Erreichung der Zielstellungen.<br />
3 Inhalte<br />
Integriert in dem Modul „Kommunikationsmanagement“ werden die traditionellen<br />
Kommunikationsinstrumente und die neuen Medien im Überblick dargestellt. Determinanten für die<br />
Kommunikationspolitik bilden vor allem kulturellen und sprachlichen Gegebenheiten, Branchenspezifik,<br />
die Art und Verfügbarkeit von Medien und Kooperationen mit Dienstleistern wie Agenturen und<br />
Marktforschungsinstituten. Diese Determinanten werden an Hand von typischen Beispielen erklärt und<br />
Empfehlungen sowie Hinweise auf Gefahren für das Kommunikationsmanagement gegeben.<br />
Auf Basis der Integrierten Kommunikation werden die Kommunikationsinstrumente inhaltlich und in ihrer<br />
Wirkung dargestellt. Es wird zwischen der Kommunikation mit dem Markt und der Öffentlichkeit
unterschieden sowie zwischen interner und externer Kommunikation und hinsichtlich der verfügbaren<br />
Medien zwischen „traditionellen und neuen“ Medien. Die Erläuterung des Kommunikationsprozesses bis<br />
hin zur Mediaplanung in ihren einzelnen Schritten erfolgt detailliert. Die Ziel- und Strategieplanung und<br />
Ist-Analyse leiten sich aus dem Strategischen Marketing und der Marketingforschung ab und werden an<br />
die Anforderungen der Kommunikation angepasst. Die theoretischen und praktischen<br />
Budgetierungsmethoden sind sowohl auf die lang- und mittelfristige Budgetierung bezogen als auch auf<br />
die K<strong>am</strong>pagnenbudgetierung. Die K<strong>am</strong>pagnenbudgetierung wird in Case Studies praktisch durchgeführt.<br />
Die Gestaltung erfährt eine Differenzierung in die unterschiedlichen Medien (z.B. Offline/Online Medien).<br />
Unter Berücksichtigung der Standardisierungs- und Differenzierungserfordernisse der Planung,<br />
Gestaltung und Koordination des Einsatzes der Kommunikationsinstrumente werden Beispiellösungen<br />
vermittelt. Kommunikationskonzepte und –K<strong>am</strong>pagnen werden an Hand wissenschaftlicher und<br />
praxisrelevanter Kriterien nach ihrem Zielerreichungspotenzials beurteilt. Bezogen auf die<br />
unterschiedlichen Kommunikationsinstrumente sind die allgemeinen und Instrument spezifischen<br />
Erfolgsfaktoren ein Schwerpunkt. Die Erfolgskontrolle wird als wesentlicher Schwerpunkt der<br />
Mediaplanung vor, während und nach einer K<strong>am</strong>pagne erklärt und praktiziert. .<br />
Hinsichtlich der Optimierung des Instrumenteneinsatzes spielen die Umfeld-Gegebenheiten, wie<br />
sozioökonomische Faktoren, Homogenitätsgrad der Kundenbedürfnisse und das Käuferverhalten eine<br />
zentrale Rolle.<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung/Seminar, Fallstudien, Einzelarbeitsphasen, Gruppenarbeiten<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: Teilnahme an den Modulen des 1. und 2. Sem. wird empfohlen<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur oder Gruppenarbeit und Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote<br />
werden jeweils vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur oder Gruppenarbeit und Präsentation<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
10 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Gabi Theuner<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Vertriebsmanagement<br />
Kennnummer<br />
M 410<br />
Workload<br />
300 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Vertriebsmanagement<br />
Credits<br />
10<br />
Kontaktzeit<br />
6 SWS / 67,5 h<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
232,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Die Teilnehmer können den Gegenstand, die Ziele und Gestaltungselemente des Vertriebsmanagements<br />
erläutern. Sie lernen, Vertriebsstrategien zu planen, umzusetzen und den Erfolg zu kontrollieren. Die<br />
Teilnehmer können die Konsequenzen vertriebspolitischer Entscheidungen für andere<br />
Funktionsbereiche des Unternehmens abwägen. Sie wissen, Methoden und Techniken des Personal<br />
Selling einzuordnen. Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten im B2C und B2B Vertrieb<br />
abzuschätzen. Die grundlegenden Funktionen von CRM-Systemen können sie erklären.. Dabei erlernen<br />
sie auch, wie der technologische Fortschritt mit dem Schwerpunkt Internet, völlig neue<br />
Vertriebsszenarien stimuliert.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können vorgegebene Problemstellungen des Vertriebsmanagements anhand<br />
gegebener Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu einer Lösung führen. Die<br />
vorgestellten Methoden des Vertriebsmanagements können sie bei der Lösung von Aufgaben anwenden.<br />
Die erworbenen Kenntnisse der verschiedenen Phasen im Vertriebsprozess können sie in Fallbeispielen<br />
anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen (Haus-)Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu vertriebspolitischen<br />
Fragestellungen, stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden<br />
und verteidigen sie argumentativ.<br />
3 Inhalte<br />
Einordnung<br />
o Der Vertrieb im Rahmen von Unternehmensführung und Marketing<br />
o Theorie-Dominanz des Marketing<br />
o Praxis-Bedeutung des Vertriebs<br />
o Begriffsklärungen<br />
o Marketing vs. Vertrieb<br />
Vertriebsstrategie<br />
o Kunden<br />
o B2C vs. B2B<br />
o Produkt vs. Dienstleistung<br />
o Wettbewerbsvorteile<br />
o Kanäle<br />
o Preispolitik<br />
Vertriebsmanagement<br />
o Verkäuferpersönlichkeit<br />
o Vertriebsorganisation<br />
o Vertriebscontrolling<br />
o Personalmanagement<br />
o Kultur<br />
Vertriebsprozess<br />
o Marktplanung<br />
o Kundenplanung
o Geschäftsanbahnung<br />
o Anfragenprüfung<br />
o Angebotserstellung<br />
o Vorklärung<br />
o Verhandlung<br />
o Auftragsmanagement<br />
o After-Sales<br />
o Vertriebscontrolling<br />
Personal Selling<br />
CRM<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung, seminaristischer Unterricht, Gruppenarbeiten.<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: -keine-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur oder Gruppenarbeit und Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote<br />
werden jeweils vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur oder Gruppenarbeit und Präsentation<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
-<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
10 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Klaus Blettner<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Sprache: deutsch, einzelne Abschnitte in Englisch<br />
Literatur:<br />
Hofbauer, G./Hellwig, C.: Professionelles Vertriebsmanagement: Der prozessorientierte Ansatz<br />
aus Anbieter- und Beschaffersicht, aktuelle Aufl., Erlangen<br />
Winkelmann, P.: Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung: Die Instrumente des integrierten<br />
Kundenmanagements (CRM), aktuelle Aufl., München<br />
Homburg, C. /Schäfer, H./ Schneider, J.: Sales Excellence - Vertriebsmanagement mit System,<br />
aktuelle Aufl., Wiesbaden<br />
Johnston, M.W./Marshall, G.W.: Sales Force Management, aktuelle Aufl., New York
Titel des Moduls: Online-Marketing und E-Commerce<br />
Kennnummer<br />
M 420<br />
Workload<br />
300 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Online-Marketing<br />
b) E-Commerce/<br />
E-Entrepreneurship<br />
Credits<br />
10<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
4. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
232,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Die Studierenden können die wesentlichen Aufgabenfelder des Online-Marketings und des E-Commerce<br />
erklären. Dies beinhalte Wissen über die Nutzungsmöglichkeiten des Internets als Werbe- und<br />
Kommunikationsplattform, über die Nutzungsmöglichkeiten des Internets als Vertriebskanal, der<br />
gängigen Geschäftsmodelle im Internet, über die gängigen Preis- bzw. Abrechnungsmodelle für<br />
Onlinewerbung, über die Funktionsweise von „sozialen Medien“ . Studierende verstehen die aktuellen<br />
relevanten Theorien im Bereich des Online-Marketings, können die Mechanismen des Empfehlungs-<br />
Marketings darstellen und rechtliche Hürden bei Online-Handel und Online-Werbung beschreiben. Die<br />
Studierenden sind in der Lage, Strategien im Bereich des Online-Marketings und E-Commerce zu<br />
entwickeln und auf die betriebliche Praxis anzuwenden, Sie sind in der Lage, die aktuell zur Verfügung<br />
stehenden Instrumente im Bereich Online-Marketing und E-Commerce aus betriebswirtschaftlicher<br />
Perspektive einzuschätzen und zielorientiert einzusetzen. Studierende können Online-Marketingbudgets<br />
zielorientiert einsetzen und optimieren, den Erfolg von Online-Maßnahmen im Bereich Werbung und<br />
Handel messen und bewerten, Rückschlüsse aus Ergebnissen von Online-Marketingaktionen ziehen<br />
und entsprechende weiterführende Maßnahmen definieren. Die Studierenden weisen die Kompetenz<br />
auf, einen Businessplan im Umfeld des E-Commerce zu analysieren. Sie kennen die Bereiche Ziele,<br />
Aufbau und Adressaten, Executive Summary, Darstellung von Geschäftsidee/-konzept/-modell, Added<br />
Value, Unique Selling Proposition, Willingness to Pay, Produkt-/Technologie-Beschreibung,<br />
Management(-Te<strong>am</strong>), Organisation, Marketing und Vertriebskonzept, Markt- und Wettbewerbsanalyse,<br />
IT-Projektmanagement und IT-Prozessmanagement und Finanzplan eines Businessplans.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierende analysieren und strukturieren Problemstellungen aus Fallstudien und Praxisbeispielen,<br />
tragen die zur Lösung notwendigen Informationen zus<strong>am</strong>men und entwickeln einen fundierten<br />
aufeinander abgestimmten Instrumenteneinsatz.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden analysieren Fallstudien zu E-Commerce Geschäftsmodellen, stellen ihre Lösungen vor,<br />
diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden und verteidigen sie argumentativ. Sie können<br />
die wesentlichen Methoden des Online-Marketings selbständig anwenden und sachgerecht auswählen<br />
und das Ergebnis in der Diskussion mit den Studierenden und Lehrenden vertreten.<br />
3 Inhalte<br />
Kenzeichnung des Online-Marketings<br />
Verbreitung und Nutzung des Online-Marketings<br />
Konzeption des Online-Marketing-Einsatzes<br />
Instrumente des Online-Marketings (Websites, Online Advertising, Online PR, SEO, E-<br />
Mail-Marketing, Mobile Marketing, Social Media Marketing, Viral Marketing)<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen des Online-Marketing und des E-Commerce<br />
Einführung/Geschichte des Internet und des E-Commerce<br />
E-Infrastruktur<br />
E-Strategy<br />
Geschäfts- und Erlösmodelle im E-Commerce
4 Lehrformen<br />
E-Procurement<br />
E-Shops<br />
E-Marketplaces<br />
Social Networks<br />
E-Environment<br />
Security & Privacy<br />
M-Commerce<br />
E-Commerce: Business Plan Canvas<br />
Aktuelle Trends im E-Gründungsgeschehen<br />
Vorlesung, seminaristischer Unterricht, Gruppenarbeiten.<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: -keine-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur oder Gruppenarbeit und Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote<br />
werden jeweils vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur oder Gruppenarbeit und Präsentation<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
10 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Klaus Blettner<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Sprache: deutsch, einzelne Abschnitte in Englisch<br />
Literatur:<br />
Kreutzer, R.T.: Praxisorientiertes Online-Marketing, aktuelle Auflage, Wiesbaden<br />
Weinberg, T., Pahrmann, C.: Social Media Marketing, aktuelle Aufl., Köln<br />
Chaffey, D.: E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice,<br />
aktuelle Auflage, Harlow<br />
Kollmann, T.: E-Entrepreneurship - Grundlagen der Unternehmensgründung in der Net<br />
Economy, aktuelle Aufl., Wiesbaden
Titel des Moduls: Auslandsstudien- oder Praxissemester<br />
Kennnummer<br />
M 500<br />
Workload<br />
900 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Kolloquium (2 SWS, 2 Credits)<br />
Credits<br />
30<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5<br />
Studiensemester<br />
5. Sem.<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
877,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden können neue Herangehens- und Arbeitsweisen einordnen und bewerten, wie wichtig<br />
kulturelle Vielfalt für ein Unternehmen im globalen Wettbewerb ist bzw. können in praktischer Anwendung<br />
ihre erworbenen oder zu erwerbender Kenntnisse vertiefen oder neue Kenntnisse und Fähigkeiten durch<br />
praktische Mitarbeit in einer Organisation oder Institution erwerben.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden planen ihr Auslandsstudien- / Praxissemester selbst und nutzen hierzu verschiedene<br />
Medien zur Informationsbeschaffung. Sie sind in der Lage, aus ihrem Auslandsstudium / Praxissemester<br />
wichtige Erfahrungen abzuleiten, diese zu strukturieren, wiederzugeben, im Kontext ihres eigenen kulturellen<br />
Hintergrundes zu bewerten.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Durch die Auseinandersetzung mit fremden Lernumgebungen, Geschäftskulturen und kultureller Vielfalt<br />
sollen die Eigeninitiative, Selbstständigkeit, sprachliche, vor allem fremdsprachliche Kompetenz und<br />
Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Im Kolloquium diskutieren die Studierenden ihre Lernerfahrungen,<br />
beziehen Standpunkte und argumentieren sie gegenüber ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen.<br />
3 Inhalte<br />
Das Auslandsstudiensemester in einem anderen gesellschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Umfeld<br />
an einer ausländischen <strong>Hochschule</strong> soll das wissenschaftliche Studium im Inland, möglichst mit Bezug<br />
zum Studiengang Marketing, ergänzen und den Einstieg einer Bachelorabsolventin /eines Bachelorabsolventen<br />
ins Berufsleben in einer zunehmend globalisierten Welt erleichtern.<br />
Im Praxissemester sollen die Studierenden berufspraktische Kenntnisse und Fähigkeiten in möglichst<br />
vielen marketingrelevanten Bereichen eines Wirtschaftsunternehmens oder einer wirtschaftsnahen Institution<br />
im In- oder Ausland erwerben. Es geht um die Vermittlung von Kenntnissen über die wirtschaftlichen<br />
und organisatorischen Zus<strong>am</strong>menhänge des Unternehmens.<br />
Das Auslandsstudien-/Praxissemester wird durch ein Kolloquium ergänzt. Dieses dient als Präsentationsund<br />
Diskussionsforum für die im Auslandsstudium und/oder Unternehmen gemachten Erfahrungen und<br />
erworbenen Erkenntnisse.<br />
4 Lehrformen<br />
Referat / Diskussion<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: Mindestens erfolgreicher Abschluss des 1. Studienjahres (Vorlage eines Notenauszuges).<br />
Inhaltlich: - keine -<br />
6 Prüfungsformen<br />
Kolloquium: Studienleistung regelmäßige Teilnahme und Referat<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Auslandsstudium: Nachweis über die absolvierten Lehrveranstaltungen und anderen Studientätigkeiten;<br />
Referat
Praxissemester: Nachweis über das Praktikum, Praxisbericht, Referat<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
- Keine -<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
Unbenotete Studienleistung geht nicht in die Berechnung der Ges<strong>am</strong>tnote mit ein<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Manfred König / Prof. Dr. Manfred König, Prof. Dr. Gabi Theuner, Prof. Dr. Klaus Blettner, Prof.<br />
Dr. Dr. Christoph Rohleder<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Projekte zu aktuellen Marketingthemen<br />
Kennnummer<br />
M 600<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Projekte zu aktuellen<br />
Marketingthemen<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
6 SWS / 67,5 h<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Neben der Anwendung spezifischen im Studienverlauf erlernten Fachwissens professionalisieren die<br />
Studierenden folgende Kompetenzen:<br />
Selbstständige personelle Zus<strong>am</strong>menstellung des Projektte<strong>am</strong>s<br />
Planung der eigenen Arbeit<br />
Systematisches Erschließen von Fachwissen<br />
Systematische Dokumentation von Arbeitsergebnissen<br />
Verbale und schriftliche Präsentation von Ergebnissen<br />
Durchsetzungsvermögen<br />
Abwicklung fachübergreifender Projekte<br />
Befähigung zur Te<strong>am</strong>arbeit<br />
Prozessorientiertes Denken<br />
Erkennen der Einschätzung der eigenen Person durch Andere<br />
Ergebnisorientiertes Arbeiten mit Zeitvorgabe<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierende analysieren und strukturieren Problemstellungen aus Fallstudien, tragen die zur Lösung<br />
notwendigen Informationen zus<strong>am</strong>men und entwickeln einen fundierten aufeinander abgestimmten<br />
Instrumenteneinsatz.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden diskutieren die Problemstellungen, stellen den Gang der Entscheidungsvorbereitung<br />
dar und verteidigen argumentativ ihre Entscheidungsempfehlungen. Im Rahmen der Gruppenarbeiten<br />
übernehmen sie Verantwortung für ihr Te<strong>am</strong>.<br />
3 Inhalte<br />
Die Praxisprojekte dienen zur fächerbegleitenden, anwendungsorientierten Vertiefung und<br />
Erweiterung der marketingspezifischen Kenntnisse. In Kleingruppen werden eigene<br />
Lösungsansätze zu realen oder realitätsnahen aktuellen Fragestellung des Marketings erarbeitet<br />
Regelmäßige Inhalte sind:<br />
Projektmanagement im Marketing<br />
Systematisches Lösen von Praxisaufgaben<br />
Anwendung von Problemlösungsmethoden<br />
Anwendung von Analyse-Tools und Werkzeugen, z.B. SPSS<br />
Evaluierung von Problemlösungen<br />
Entscheidungsrelevantes Aufbereiten von Daten<br />
Visualisierung und Präsentation<br />
Verteidigen / Argumentieren von Lösungsvorschlägen<br />
Ergebnisbericht und Dokumentation<br />
4 Lehrformen<br />
Gruppenarbeiten in Te<strong>am</strong>s von 3-7 Studierenden
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: -keine-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Projektbericht und Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote werden jeweils<br />
vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Klausur oder Hausarbeit (Projektbericht)<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
-<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Klaus Blettner/ Prof. Dr. habil. Gabi Theuner<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Wahlpflichtmodul Marketing<br />
Kennnummer<br />
M 610<br />
Workload<br />
300 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Wahlpflichtmodul Marketing<br />
Credits<br />
10<br />
Kontaktzeit<br />
6 SWS / 67,5 h<br />
Studiensemester<br />
6. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
232,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
40-45 Studierende<br />
Die Studierenden sollen in der Lage sein, die wichtigsten Elemente der Marketinginstrumente zu<br />
beherrschen sowie für ein Unternehmen eine Marketingkonzeption zu entwickeln Die Studierenden<br />
können den Gegenstand, die Ziele und Gestaltungselemente des Marketings wie auch der einzelnen<br />
Bereiche erläutern. Die 4 P´s im Bereich Marketing können sie anhand geeigneter Konzepte und<br />
Methoden anwenden, die Ergebnisse können sie entscheidungsrelevant aufbereiten und interpretieren.<br />
Zum Verständnis des Begriffs Marketingplanung aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht können sie<br />
Stellung nehmen. Die Aufgabenbereiche des Marketingmanagements und das Zus<strong>am</strong>menwirken der<br />
Funktionsbereiche können sie erläutern, den Zus<strong>am</strong>menhang des operativen Marketings mit der<br />
Marketingstrategie können sie begründen. Die Eignung der Marketingkonzepte für die<br />
Internationalisierung können sie beurteilen und sie sind in der Lage Profitabilitätsberechnungen<br />
durchzuführen. Sie können strategische, taktische Maßnahmen analysieren und aufzeigen, wie diese<br />
geeignet umgesetzt werden und welche Verfahren dabei Anwendung finden. Die Beziehungen zwischen<br />
Marketing und anderen Unternehmensbereichen können sie kritisch darlegen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können vorgegebene Problemstellungen im Bereich Marketing anhand gegebener<br />
Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu einer Lösung führen. Die vorgestellten<br />
Methoden innerhalb des Marketings können sie bei der Lösung von Aufgaben anwenden. Die<br />
erworbenen methodischen Kenntnisse können sie in Fallbeispielen anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu marketingrelevanten Fragestellungen,<br />
stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden und verteidigen sie<br />
argumentativ. Sie können die wesentlichen Marketingkonzepte auf einfache Fälle und Fragen im Bereich<br />
des Marketings selbständig anwenden und sachgerecht lösen bzw. bearbeiten und das Ergebnis in der<br />
Diskussion mit den Studierenden und Lehrenden vertreten.<br />
3 Inhalte<br />
SWOT-Analyse im Marketing<br />
Planung von Marketingstrategien<br />
Planung des Marketingmix<br />
Durchsetzung von Marketingkonzeptionen<br />
Angebotspolitische Entscheidungen<br />
Kommunikationspolitische Entscheidungen<br />
Vertriebspolitische Entscheidungen<br />
Quantitative Methoden des Marketing<br />
Aktuelle Themen des Marketings<br />
Neue Entwicklungen innerhalb des Marketings<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung, Fallstudienbearbeitung<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-
Inhaltlich: -keine-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Seminararbeit, Vortrag, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote werden jeweils vor<br />
Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Prüfungsleistung<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
Das Wahlpflichtmodul Marketing ist ein Angebot des Bachelorstudiengangs Marketing für<br />
andere Studiengänge<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
10 / unterschiedlichen je nach nachfragendem Studiengang<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Dr. Rohleder<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Thesis<br />
Kennnummer<br />
M 620<br />
Workload<br />
360 h<br />
Credits<br />
12<br />
Studiensemester<br />
6. Sem.<br />
Häufigkeit des Angebots<br />
permanent<br />
Dauer<br />
12 Wochen<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Keine<br />
Kontaktzeit<br />
- -<br />
Selbststudium<br />
360 h<br />
geplante Gruppengröße<br />
- -<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Die Studierenden sind in der Lage, auf Grundlage von vertieftem Fachwissen sowie von Fähigkeiten und<br />
Methoden ihres Faches ein anwendungsorientiertes Problem aus dem Bereich Marketing bzw. mit Marketingbezug<br />
in einem Zeitraum von 12 Wochen selbständig und mit wissenschaftlichen Methoden zu<br />
bearbeiten und zu lösen.<br />
3 Inhalte<br />
Die Erstellung der Bachelorarbeit umfasst die Recherche und Erarbeitung des aktuellen Forschungsstandes,<br />
das darauf aufbauende Formulieren von Forschungsfragen und die Entwicklung wissenschaftlich<br />
fundierter Aussagen. Die Bearbeitung der Problemstellung mittels der fachlichen Methoden und<br />
Techniken wird durch das Herausarbeiten eines wissenschaftlich begründeten Urteils abgeschlossen.<br />
4 Lehrformen<br />
entfällt<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: Um zur Abschlussarbeit zugelassen zu werden, müssen die Studierenden mindestens 120<br />
ECTS erworben haben.<br />
Inhaltlich: Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
Keine<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Thesis<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
-<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
12/144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Klaus Blettner / Prof. Dr. Manfred König, Prof. Dr. Gabi Theuner, Prof. Dr. Dr. Christoph<br />
Rohleder und andere Dozentinnen und Dozenten der <strong>Hochschule</strong><br />
11 Sonstige Informationen<br />
Die Abfassung der Bachelorarbeit in englischer Sprache wird begrüßt.
Titel des Moduls: Grundlagen BWL<br />
Kennnummer<br />
M 110<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Allgemeine BWL<br />
b) Marketinggrundlagen<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
1. Sem.<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Allgemeine BWL<br />
Wissen und Verstehen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden sollen in der Lage sein, die wichtigsten Elemente der Betriebswirtschaft zu<br />
beherrschen sowie für ein Unternehmen betriebswirtschaftliche Berechnungen durchzuführen. Die<br />
Studierenden können den Gegenstand der Betriebswirtschaft, die Ziele und Bereiche in einem<br />
Unternehmen erläutern. Die Konzepte und Methoden der Betriebswirtschaftslehre können sie anwenden,<br />
die Ergebnisse können sie entscheidungsrelevant aufbereiten und interpretieren. Zum Verständnis des<br />
Begriffs Betriebswirtschaft können sie aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht Stellung nehmen. Die<br />
Aufgabenbereiche der Betriebswirtschaftslehre und das Zus<strong>am</strong>menwirken der Funktionsbereiche können<br />
sie erläutern. Den Zus<strong>am</strong>menhang der operativen Betriebswirtschaftslehre und strategischen<br />
Betriebswirtschaftslehre können sie begründen. Die Eignung der Konzepte können die Studierenden<br />
auch für die Internationalisierung bzw. im internationalen Kontext beurteilen und sie sind in der Lage<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Sie können strategische, taktische Maßnahmen<br />
analysieren und aufzeigen, wie diese geeignet umgesetzt werden und welche Verfahren dabei<br />
Anwendung finden. Die Beziehungen zwischen Betriebswirtschaft und anderen Wissenschaften können<br />
sie kritisch darlegen. Die Studierenden erlangen die Fähigkeit, die Grundstrukturen der<br />
betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprobleme zu erkennen und thematisch einzuordnen. Sie können<br />
die wirtschaftswissenschaftlichen Grundbegriffe (Fachbegriffe) terminologisch korrekt verwenden. Sie<br />
durchschauen das Wirkungsgeflecht von wirtschaftswissenschaftlichen Modellen und können mit Hilfe<br />
dieser Modelle die ökonomischen Folgen in verschiedenen Handlungsfeldern abschätzen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können vorgegebene Problemstellungen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre<br />
anhand gegebener Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu einer Lösung führen.<br />
Die vorgestellten Methoden innerhalb der Betriebswirtschaftslehre können sie bei der Lösung von<br />
Aufgaben anwenden. Die erworbenen methodischen Kenntnisse können sie in Fallbeispielen anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu betriebsrelevanten Fragestellungen,<br />
stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden und verteidigen sie<br />
argumentativ. Sie können die wesentlichen Konzepte auf einfache Fälle und Fragen im Bereich der<br />
Betriebswirtschaftslehre selbständig anwenden und sachgerecht lösen bzw. bearbeiten und das Ergebnis<br />
in der Diskussion mit den Studierenden und Lehrenden vertreten.<br />
Marketinggrundlagen<br />
Wissen und Verstehen<br />
Die Studierenden sollen in der Lage sein, die wichtigsten Elemente der Marketinginstrumente zu<br />
beherrschen sowie für ein Unternehmen eine Marketingkonzeption zu entwickeln Die Studierenden<br />
können den Gegenstand, die Ziele und Gestaltungselemente des Marketings wie auch der einzelnen<br />
Bereiche erläutern. Die 4 P´s im Bereich Marketing können sie anhand geeigneter Konzepte und<br />
Methoden anwenden, die Ergebnisse können sie entscheidungsrelevant aufbereiten und interpretieren.<br />
Zum Verständnis des Begriffs Marketingplanung aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht können sie<br />
Stellung nehmen. Die Aufgabenbereiche des Marketingmanagements und das Zus<strong>am</strong>menwirken der
Funktionsbereiche können sie erläutern, den Zus<strong>am</strong>menhang des operativen Marketings mit der<br />
Marketingstrategie können sie begründen. Die Eignung der Marketingkonzepte für die<br />
Internationalisierung können sie beurteilen und sie sind in der Lage Profitabilitätsberechnungen<br />
durchzuführen. Sie können strategische, taktische Maßnahmen analysieren und aufzeigen, wie diese<br />
geeignet umgesetzt werden und welche Verfahren dabei Anwendung finden. Die Beziehungen zwischen<br />
Marketing und anderen Unternehmensbereichen können sie kritisch darlegen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können vorgegebene Problemstellungen im Bereich Marketing anhand gegebener<br />
Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu einer Lösung führen. Die vorgestellten<br />
Methoden innerhalb des Marketings können sie bei der Lösung von Aufgaben anwenden. Die<br />
erworbenen methodischen Kenntnisse können sie in Fallbeispielen anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu marketingrelevanten Fragestellungen,<br />
stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit ihren Kommilitonen und dem Lehrenden und verteidigen sie<br />
argumentativ. Sie können die wesentlichen Marketingkonzepte auf einfache Fälle und Fragen im Bereich<br />
des Marketings selbständig anwenden und sachgerecht lösen bzw. bearbeiten und das Ergebnis in der<br />
Diskussion mit den Studierenden und Lehrenden vertreten.<br />
3 Inhalte<br />
Basiswissen über betriebswirtschaftliche Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
Besonderheiten der Ökonomie als Wissenschaft<br />
Organisation<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Marketing & Vertrieb<br />
Beschaffung & Produktion<br />
Personal & Organisation<br />
4 Lehrformen<br />
Bearbeitung von Fallstudien, interaktive Vorlesung und Übungen<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8/144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Dr. Rohleder<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: VWL und Recht<br />
Kennnummer<br />
M 120<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) VWL<br />
b) Recht<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 45 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
Studiensemester<br />
1. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Problemorientiert aus betrieblicher Sicht analysieren und argumentieren können<br />
Theorie und Politik der VWL integriert anwenden<br />
Konsequenzen volkswirtschaftlicher Entwicklungen für betriebliche Entscheidungen erkennen<br />
die Studierenden mit den für ihre zukünftigen Führungsaufgaben in der Wirtschaft notwendigen<br />
juristischen Kenntnissen auszustatten<br />
Methodenkompetenz:<br />
<br />
<br />
<br />
Wirtschaftsphänomene mit Ursachen und Wechselwirkungen auf vier Ebenen (Mikro, Makro,<br />
Umwelt, International) mit dem volkswirtschaftlichen Instrumentarium analysieren und beurteilen<br />
können<br />
Sachverhalte empirisch bearbeiten und bewerten lernen<br />
Die Studierenden sollen lernen, die einschlägigen Rechtsquellen selbstständig zu nutzen,<br />
wirtschaftliche Sachverhalte rechtlich zu beurteilen, wirtschaftlich relevante Verträge zu erstellen<br />
und Rechtsfälle zu lösen<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Information als zentralen Produktionsfaktor unserer Zeit optimal nutzen<br />
Diskussion aktueller Probleme erlernen<br />
Das Studium des Rechts erstreckt sich auf die wichtigsten Rechtsmaterien, wobei die<br />
Lerninhalte praxisbezogen dargestellt werden, d<strong>am</strong>it die Studenten argumentativ juristische<br />
Inhalte vertreten können<br />
3 Inhalte<br />
VWL<br />
0. Einführung: Begriffssystem, Denkweise und Objektbereich, Nutzen des Internet<br />
1. Handlungspar<strong>am</strong>eter für Unternehmen (Mikroökonomik)<br />
Zur Einschätzung der Nachfrage des privaten Haushalts/ Der Zus<strong>am</strong>menhang zwischen Produktion,<br />
Kosten und Angebot/ Die Abhängigkeiten in der Absatzpolitik (Markt und Preisbildung)/ Wettbewerb und<br />
Konzentration/ Konsequenzen von technischem Fortschritt und Strukturwandel/ Die Funktionsweise des<br />
Arbeitsmarktes: Bedeutung für die betriebliche Personalpolitik/ Unternehmensgröße und –verhalten:<br />
KMU und Multis<br />
2. Unternehmen in der Ges<strong>am</strong>twirtschaft (Makroökonomik)<br />
Die Volkswirtschaftlichen Ges<strong>am</strong>trechnungen als Rahmen und Informationsbasis/ Beurteilung der<br />
Wirtschaftslage: Das Keynessche Gütermarktmodell und die Struktur des IS-LM-Modells/ Geld und<br />
Preisniveaustabilität/ Konjunkturanalyse als Frühwarnsystem und Planungsbasis/ Die Relevanz der<br />
Finanzpolitik (einschließlich Subventionsmöglichkeiten)/ Unternehmen und Öffentlichkeit<br />
3. Die Berücksichtigung der Umwelt (Umweltökonomik) und die wirtschaftlichen Beziehungen des<br />
Unternehmens zum Ausland (Internationale Wirtschaft)<br />
Wirtschaftsethik und Handeln der Wirtschaftssubjekte/ Das Verhältnis zwischen Ökonomie und<br />
Umweltschutz/ Umweltökonomische Ges<strong>am</strong>trechnung und Öko-Management/ Umweltpolitik/
Marktwirtschaftliche Instrumente des Umweltschutzes. Probleme des Welthandels und der<br />
Welthandelsordnung/ Erklärung des Welthandels (Markt, Preise und Politik/ Erscheinungsformen, Risiken<br />
und Finanzierung der Außenwirtschaft/ Währung, insbesondere Euro und Europäisches<br />
Währungssystem/ Messung der Außenwirtschaft: Die Zahlungsbilanz<br />
Die Veranstaltung Recht umfasst folgende Gebiete:<br />
Einführung (Privatrecht, öffentliches Recht)<br />
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Allgemeiner Teil<br />
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Schuldrecht<br />
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Sachenrecht<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung, seminaristischer Unterricht, Gruppenarbeiten.<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: -keine-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Werner Krämer<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Baßeler/Heinrich/Utecht: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, Stuttgart 2010<br />
Krugman, P./ Wells, R.: Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 2010.<br />
Mankiw, N. G./ Taylor: Principles of Economics, Fort Worth 2006 (deutsch, Stuttgart, 2008)<br />
Jeweils in der neuesten Auflage:<br />
Wörlen, Rainer, BGB AT<br />
Wörlen, Rainer, Schuldrecht AT<br />
Wörlen, Rainer, Schuldrecht BT<br />
Wörlen, Rainer, Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen<br />
Wörlen, Rainer / Metzler-Müller, Karin: Zivilrecht<br />
Bürgeliches Gesetzbuch, Beck, dtv
Modul: Wirtschaftsmathematik / Statistik<br />
Kennnummer<br />
M 130<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Wirtschaftsmathematik<br />
b) Statistik<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
1. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wirtschaftsmathematik:<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Viele Aufgabenstellungen in der betrieblichen Praxis sind mit Hilfe mathematischer Methoden zu lösen.<br />
Die Studierenden lernen mathematische Denkweisen und wichtige mathematische Inhalte bzw.<br />
Verfahren kennen. Sie sind d<strong>am</strong>it in der Lage, die Inhalte mit den typischen Begrifflichkeiten zu<br />
benennen. Des Weiteren erlangen sie die Fähigkeiten, mathematische Verfahren verstehen und rechnen<br />
zu können und diese auf andere Fragestellungen anzuwenden. Die Ergebnisse (Lösungen) sind zu<br />
interpretieren.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden erhalten Aufgaben, die sie selbstständig und sorgfältig bearbeiten bzw. lösen. Dazu<br />
müssen die Aufgaben analysiert und mit geeigneten Methoden bzw. mathematischen Verfahren<br />
berechnet werden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lernen, Lösungswege verständlich und nachvollziehbar darzustellen und zu erläutern.<br />
Statistik:<br />
Wissen und Verstehen:<br />
In vielen Bereichen eines Unternehmens werden Daten zur Entscheidungsfindung<br />
herangezogen. Die Studierenden erlangen Kenntnisse in der Auswertung, Analyse und<br />
Darstellung von empirischen Daten. Des Weiteren lernen sie, stochastische Methoden bzw.<br />
Verfahren zu verstehen, mit deren Hilfe sie dann Stichproben von Daten analysieren und<br />
auswerten. Diese Verfahren sind anschließend auf typische Fragestellungen zu übertragen und<br />
anzuwenden. Die Auswertungsergebnisse sind zu interpretieren.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden erhalten Aufgaben (Daten), die sie selbstständig bearbeiten bzw. auswerten.<br />
Dazu müssen die Daten analysiert und mit geeigneten mathematisch-stochastischen Verfahren<br />
berechnet werden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lernen, verschiedene Analysemethoden verständlich und nachvollziehbar<br />
darzustellen und zu erläutern.<br />
3 Inhalte<br />
Wirtschaftsmathematik:<br />
<br />
<br />
<br />
Wichtige Funktionen mit einer oder mehreren unabhängigen Variablen<br />
Differentialrechnung reeller Funktionen mit einer oder mehreren unabhängigen Variablen<br />
Anwendung der Differentialrechnung auf ökonomische Probleme
Integralrechnung mit einer unabhängigen Variablen<br />
Einführung in die lineare Algebra<br />
Lösungsverfahren von Gleichungssystemen<br />
Statistik:<br />
Typisierung und Skalierung von Daten, Kennzahlenermittlung<br />
Indexzahlen<br />
Elemente der Kombinatorik<br />
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie<br />
Diskrete und stetige Verteilungen<br />
Stichprobenmethoden<br />
Korrelation und Regressionsanalyse<br />
Einführung in die Schätztheorie und Ermittlung von Konfidenzintervallen<br />
Hypothesentests (ausgewählte Testverfahren)<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung mit Übungseinheiten<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: keine<br />
Inhaltlich: keine<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Klausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
LK Gunda Helmer<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Literaturempfehlungen:<br />
Tietze, Jürgen: Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik, Vieweg-Verlag<br />
Tietze, Jürgen: Einführung in die Finanzmathematik, Vieweg-Verlag<br />
Schwarze, Jochen: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, NWB-Verlag<br />
Puhani, J. : Statistik – Einführung mit praktischen Beispielen, Lexika-Verlag<br />
Puhani, J. : Kleine Formels<strong>am</strong>mlung zur Statistik<br />
Bleymüller, J. , Gehlert, G. , Gülicher, H. : Statistik für Wirtschaftswissenschaftler
Titel des Moduls: Führungskompetenzen<br />
Kennnummer<br />
M 200<br />
Workload<br />
240 h<br />
Studiensemester<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Management (Pflicht)<br />
b) Personalmanagement<br />
(Pflicht)<br />
c) Ein Fach zur Wahl:<br />
Projektmanagement/<br />
Te<strong>am</strong>arbeit<br />
Rhetorik/Präsentationstechnik<br />
Moderation<br />
Konflikttraining<br />
Credits<br />
8<br />
2. Sem.<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden können die institutionellen und funktionalen Grundlagen der Unternehmensführung<br />
beschreiben und erläutern. Sie sind für die Probleme der Führung eines Unternehmens in seiner<br />
Ges<strong>am</strong>theit sensibilisiert und verstehen die wesentlichen modernen Unternehmensführungsansätze..<br />
Grundlagenwissen besteht zu den Unternehmensführungsfunktionen Strategische Planung u. Kontrolle,<br />
Operative Planung, Organisation, Mitarbeiterführung. Studierende erwerben grundlegende Fach- und<br />
Methodenkompetenz in zentralen Gebieten des Personalmanagements und Grundlagen des<br />
notwendigen Führungswissens einer mit Personalverantwortung betrauten Führungskraft.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden können einfache Analyse- und Strukturierungsmethoden aus den Bereichen der<br />
Planung und Mitarbeiterführung anwenden. Lösungsansätze zu einfachen praktischen Fragestellungen<br />
werden erarbeitet und gegenüber den Mit-Studierenden vertreten.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Wesentliche Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung können argumentiert und diskutiert<br />
werden. Die Studierenden lernen Präsentations-, Projektmanagement-, Moderations- und<br />
Konfliktbewältigungstechniken kennen und erarbeiten Präsentationen zu betriebswirtschaftlichen Themen<br />
3 Inhalte<br />
Grundaspekte (Managementprozess, -funktionen, -kompetenzen, -theorie)<br />
Kontext des Managements: Unternehmensziele und Unternehmensverfassung<br />
Strategische Planung und Kontrolle<br />
Operative Planung<br />
Organisation als Gestaltung von Unternehmensstrukturen<br />
Mitarbeiterführung<br />
Personalplanung, -recruiting, -einsatz, -entwicklung, -freisetzung, -politik, Grundlagen<br />
leistungsorientierter Vergütung<br />
4 Lehrformen<br />
Synthese aus Vorlesung, Übung, Seminar – mit etwas größerer Betonung der<br />
Wissensvermittlung vom Dozenten in Richtung Studierende<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen
-<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Präsentation, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote werden jeweils vor<br />
Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestehen der Modulklausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
-<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Wolfgang Anders / Prof. Dr. Wolfgang Anders, Prof. Dr. Matthias H<strong>am</strong>ann<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Basisliteratur:<br />
- Steinmann, H., Schreyögg, G.; Management, 6. Aufl., Wiesbaden 2005<br />
- Schreyögg, G., Koch, J., Grundlagen des Managements, 2. Aufl., Wiesbaden 2010<br />
- Macharzina, K., Wolf, J., Unternehmensführung, 6. Aufl., Wiesbaden 2008<br />
- Hinterhuber, H., Strategische Unternehmensführung, Bd. II, 7. Aufl., Berlin 2004<br />
- Meier, H., Unternehmensführung, 4. Aufl., Herne 2010
Titel des Moduls: Rechnungswesen<br />
Kennnummer<br />
M 210<br />
Workload<br />
300 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Jahresabschluss<br />
b) Steuerlehre<br />
c) Kosten- und<br />
Leistungsrechnung<br />
Credits<br />
10<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
210 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden sollen in der Lage sein, das Zustandekommen nationaler Jahresabschlüsse<br />
nachzuvollziehen. Dabei sind die handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Sachverhalte des extern<br />
geprägten Rechnungswesens von wesentlicher Bedeutung. Im Bereich Steuerlehre werden die<br />
relevanten Steuern und deren Auswirkungen auf die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen aufgezeigt.<br />
Im internen Rechnungswesen mit dem Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung lernen die<br />
Studierenden die Kostenerfassung, -verarbeitung, -kontrolle und Preisermittlung kennen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Studierende können komplexes betriebswirtschaftliches Geschehen anhand der Daten des<br />
Rechnungswesens reflektieren.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden sind in der Lage, eine Bilanz zu lesen, zu interpretieren und die Erkenntnisse<br />
zu kommunizieren.<br />
3 Inhalte<br />
Jahresabschluss:<br />
Ziele und Grundsätze der Rechnungslegung, Bestandteile der Rechnungslegung, Bilanz (Gliederung,<br />
Aktiva, Passiva), Gewinn- und Verlustrechnung (Rechengrößen, Ges<strong>am</strong>t- versus<br />
Umsatzkostenverfahren), ausgewählte zusätzliche Angaben und Informationen (z.B. Anhang),<br />
Grundzüge der Jahresabschlussanalyse.<br />
Steuerlehre:<br />
Grundlagen der Besteuerung, Grundlagen der Einkommenssteuer, Persönliche und sachliche<br />
Steuerpflicht, Veranlagungsformen und Tarif, Gewinneinkünfte, Überschusseinkünfte, Verlustausgleich,<br />
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen, Steuerfestsetzung und Steuererhebung,<br />
Grundlagen der Körperschaftssteuer, persönliche und sachliche Steuerpflicht, Ermittlung des<br />
körperschaftssteuerpflichtigen Einkommens, verdeckte Gewinnausschüttung und verdeckte Einlagen,<br />
Tarif, Steuerfestsetzung und Steuererhebung, Grundlagen der Gewerbesteuer, Sachliche Steuerpflicht,<br />
Ermittlung der Bemessungsgrundlage.<br />
Steuerermittlung, Steuerfestsetzung und Steuererhebung<br />
Kosten- und Leistungsrechnung:<br />
Grundlagen, insbesondere Aufgaben, Kostenrechnungssysteme, Kostenbegriffe und –verläufe),<br />
Einführung in die Kostenarten-, Kostenstellen-, und Kostenträgerrechnung und Rechenbeispiele für<br />
einfache Deckungsbeitragsrechnung, Einführung in die Leistungsrechnung.<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: Teilnahme an den Modulen des 1. Sem. wird empfohlen<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 240 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
beim Bachelorstudiengang IPO<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
10 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Isabella Wünsche, Prof. Dr. Rudolf Mohr<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Konsumenten und Marken<br />
Kennnummer<br />
M 220<br />
Workload<br />
240 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Psychologie<br />
b) Konsumentenverhalten<br />
c) Markenmanagement<br />
Credits<br />
8<br />
Kontaktzeit<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
Studiensemester<br />
2. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
172,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden sollen die psychologischen Teildisziplinen, die für die Arbeits-, Wirtschafts- und<br />
Organisationspsychologie relevant sind, kennen, die theoretischen Grundlagen verstehen und daraus die<br />
Konsequenzen für das Marketing ableiten können. Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten<br />
Elemente des Konsumentenverhaltens zu beherrschen sowie für ein Unternehmen entsprechende<br />
Konzepte zu entwickeln Die Studierenden können den Gegenstand, die Ziele und Gestaltungselemente<br />
des Konsumentenverhaltens wie auch der einzelnen Bereiche erläutern. Die psychischen Determinanten<br />
des Konsumentenverhaltens, die Umweltdeterminanten können sie anhand geeigneter Konzepte und<br />
Methoden anwenden, die Ergebnisse können sie entscheidungsrelevant aufbereiten und interpretieren.<br />
Zum Verständnis des Begriffs Konsumentenverhaltens aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht<br />
können sie Stellung nehmen. Die Aufgabenbereiche der Konsumentenforschung und das<br />
Zus<strong>am</strong>menwirken der Verhaltensdeterminanten können sie erläutern, den Zus<strong>am</strong>menhang der<br />
psychischen und umweltbedingten Determinanten können sie begründen. Die Eignung der Konzepte für<br />
die Umsetzung der Unternehmensziele können sie beurteilen und sie sind in der Lage diese<br />
situationsadäquat zu modifizieren. Sie können strategische, taktische Maßnahmen analysieren und<br />
aufzeigen, wie diese geeignet umgesetzt werden und welche Verfahren dabei Anwendung finden. Die<br />
Beziehungen zwischen Konsumentenverhalten und anderen Marketingbereichen können sie kritisch<br />
darlegen. Den Studierenden werden fundierte Kenntnisse im Bereich des Markenmanagements<br />
vermittelt. Angestrebt wird die Vermittlung einer möglichst ganzheitlichen Sichtweise auf das Phänomen<br />
Marke und die Möglichkeiten der aktiven Markensteuerung. Wissenselementen. Die Studierenden lernen<br />
die Instrumente der Markenführung kennen, und erhalten erste Zugänge zu Methoden und<br />
Messansätzen im Bereich des Markencontrollings.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden haben über Kenntnis über den Gegenstandsbereich der Psychologie, das<br />
wissenschaftsorientierte Herangehen an Probleme der Psychologie im Marketingkontext, sowie über<br />
methodische Grundlagen und grundlegende statistische Verfahren der Psychologie. Die Studierenden<br />
können vorgegebene Problemstellungen im Bereich Konsumentenverhalten und des<br />
Markenmanagements anhand gegebener Informationen selbständig analysieren und strukturieren und zu<br />
einer Lösung führen. Die vorgestellten Methoden können sie bei der Lösung von Aufgaben anwenden.<br />
Die erworbenen methodischen Kenntnisse können sie in Fallbeispielen anwenden.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lösen Aufgaben und bearbeiten Fallstudien zu Fragestellungen des<br />
Konsumentenverhaltens und des Markenmanagements, stellen ihre Lösungen vor, diskutieren sie mit<br />
ihren Kommilitonen und dem Lehrenden und verteidigen sie argumentativ. Sie können die wesentlichen<br />
Konzepte auf einfache Fälle und Fragen im Bereich des Konsumentenverhaltens selbständig anwenden<br />
und sachgerecht lösen bzw. bearbeiten und das Ergebnis in der Diskussion mit den Studierenden und<br />
Lehrenden vertreten. Sie können grundlegende psychologische Erkenntnisse hierbei argumentativ<br />
einfließen lassen.<br />
3 Inhalte<br />
Psychologie:
Behandelt werden die psychologischen Teildisziplinen, die für die Arbeits-, Wirtschafts- und<br />
Organisationspsychologie relevant sind:<br />
- Persönlichkeitspsychologie (Selbstwertgefühl)<br />
- Interaktion und Kommunikation<br />
- Wahrnehmungs- und Einstellungspsychologie<br />
- Gruppenpsychologie<br />
- Motivationspsychologie<br />
Konsumentenverhalten:<br />
Grundlagen des Käuferverhaltens<br />
(Bedeutung des KV für das Marketing, Modelle, Träger und Typen von Kaufentscheidungen)<br />
Intrapersonelle Determinanten des Endverbraucherverhaltens<br />
Interpersonelle Determinanten des Endverbraucherverhaltens<br />
Totalmodelle des Käuferverhaltens<br />
Käuferverhalten von Organisationen<br />
Markenmanagement:<br />
Theoretische Erklärungsansätze der Marke<br />
Markenstruktur und Markenstrukturentscheidungen<br />
Konzeption des Marken-Design<br />
Markenstrategien<br />
Markenpositionierung<br />
Markenartikel-Management<br />
Ermittlung Markenwert<br />
Markenführung im Internet<br />
Internationale Markenführung<br />
Rechtliche Aspekte der Marke<br />
4 Lehrformen<br />
Vorlesung<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: Teilnahme an den Modulen des 1. Sem. wird empfohlen<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur oder Seminararbeit und Vortrag, Umfang und konkrete Gewichtung zur Ges<strong>am</strong>tnote werden<br />
jeweils vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur oder Seminararbeit und Vortrag<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
8 / 144
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Dr. Rohleder, Prof. Dr. Theuner<br />
11 Sonstige Informationen
Titel des Moduls: Business English<br />
Kennnummer<br />
M 230<br />
Workload<br />
120 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Business English<br />
Credits<br />
4<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 45 h<br />
Studiensemester<br />
2. Sem.<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
<br />
<br />
<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
75 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
max. 15-18<br />
Studierende<br />
(35er Gruppe wird<br />
halbiert)<br />
die Studierenden sollen ihre Gr<strong>am</strong>matikfehler analysieren und verstehen, und zur<br />
Selbstkorrektur ermutigt werden, bzw. in Gruppen zus<strong>am</strong>menarbeiten, um eine<br />
gegenseitige Bewertung zu erzielen und das Gelernte umzusetzen.<br />
Sie sollen auch Wirtschaftstexte analysieren, beurteilen, kritisch würdigen können, und<br />
auch einschätzen können, ihre Antworten begründen, und gelernte Begriffe, Wörter etc.<br />
auf andere Sachverhalte übertragen<br />
Briefe/Emails/Berichte gemäß Anleitung des Dozenten gestalten, analysieren, Korrektur<br />
vornehmen, kritisch überprüfen<br />
Methodenkompetenz:<br />
Die Studierenden analysieren und strukturieren (z.B. einen Brief) selbstständig unter<br />
Einbezug der relevanten Methoden eine vorgegebene Problemstellung, tragen die zur<br />
Lösung notwendigen Informationen zus<strong>am</strong>men und formulieren eine fundierte Antwort.<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Inhalte<br />
<br />
<br />
Die Studierenden führen einen für alle Beteiligten (Kommilitonen und Lehrende)<br />
nachvollziehbaren Diskurs über Ihre Problemstellung und argumentieren die Lösung.<br />
Sie arbeiten im Te<strong>am</strong> und übernehmen Verantwortung.<br />
Entwicklung der rezeptiven und produktiven Grundkenntnisse und Fähigkeiten in<br />
Englisch bzw. Business English, (listening, reading, writing and speaking)<br />
Entwicklung fachsprachlicher Inhalte in Anlehnung an die betriebswirtschaftlichen LV,<br />
(Marketing)anhand aktuellen Text- und Multimaterials, auch Geschäftskorrespondenz,
4 Lehrformen<br />
Berichte, Telefonieren, Referate<br />
interaktive Vorlesungen, seminaristischer Unterricht, Partnerarbeit, Gruppenarbeiten, Planspiele,<br />
Übungen<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: - Level B2 -<br />
Inhaltlich:<br />
6 Prüfungsformen<br />
Präsentation in englischer Sprache<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestehen der Präsentation<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
4 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
LK Mary von Fritschen<br />
11 Sonstige Informationen:<br />
Market Leader, specialised title: Marketing, Pearson & Longman,<br />
Empfehlungen:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Zweisprachiges Wörterbuch: Pons / Langenscheidt Großwörterbuch<br />
Einsprachiges Wörterbuch, : Oxford Advanced Learner’s Dictionary<br />
Wirtschaftssprache: Pons Kleines Fachwörterbuch<br />
Referenz-und Übungsgr<strong>am</strong>matik: Murphy, R. English Gr<strong>am</strong>mar in Use, (Intermediate<br />
with answers,<br />
Gr<strong>am</strong>mar no problem/ Business Gr<strong>am</strong>mar no problem, Cornelsen<br />
Business Gr<strong>am</strong>mar & Practice, Oxford, Michael Duckworth<br />
English for Marketing & Advertising, SHORT course, Cornelsen<br />
**(jeweils aktuellste Ausgabe)<br />
Sonst: Arbeitsblätter/Reader vom Dozent
Titel des Moduls: IT & Finance<br />
Kennnummer<br />
M 300<br />
Workload<br />
180 h<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
a) Investition und<br />
Finanzierung<br />
b) Wirtschaftsinformatik /ERP<br />
Credits<br />
6<br />
Kontaktzeit<br />
4 SWS / 45 h<br />
2 SWS / 22,5 h<br />
Studiensemester<br />
3. Semester<br />
2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen<br />
Wissen und Verstehen:<br />
Häufigkeit des<br />
Angebots<br />
jedes SS und WS<br />
Selbststudium<br />
112,5 h<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
geplante<br />
Gruppengröße<br />
35 Studierende<br />
Die Studierenden haben die grundlegenden Finanzierungsprozesse im Unternehmen verstanden und<br />
den Zus<strong>am</strong>menhang des Finanzierungsbereichs zu anderen betrieblichen Funktionen nachvollzogen. Sie<br />
können die wichtigsten IT-Prozesse im Unternehmen charakterisieren und lernen die Anwendung von<br />
ERP-Systemen in ihren Grundzügen kennen.<br />
Methodenkompetenz:<br />
Im Einzelnen sollen folgende Lernziele erreicht werden:<br />
Investition und Finanzierung:<br />
Systematik und Methoden der integrierten Finanzplanung<br />
Gründliche Kenntnis der einzelnen Finanzierungsformen und –anlässe<br />
Professionalisierung im Umgang mit Finanzpartnern durch Kenntnis derer Produkte,<br />
Vorgehensweisen und Interessenslagen<br />
Erwerb von Problemlösungskompetenz bei alternativen betrieblichen Finanzierungsproblemen,<br />
insbesondere durch Aufbau eines problemadäquaten Finanzierungsmixes<br />
Sensibilisierung für Trends und mittelfristige Entwicklung des betrieblichen Finanzierungsumfeldes<br />
Wirtschafsinformatik / ERP:<br />
Konzept und Modellierung von Geschäftsprozessen<br />
Anlegen von St<strong>am</strong>m- und Bewegungsdaten im SAP-System<br />
Durchführung von Geschäftsprozessen, um Kernfunktionen in einem ERP-System<br />
kennenzulernen<br />
SAP-Logistik/Produktions-Fallstudie als Übung <strong>am</strong> ERP-System R/3 erfolgreich umsetzen<br />
Konzeption von ERP-Systemen<br />
Typische Problemstellungen bei der Einführung von ERP-Systemen<br />
Überblick über Architektur und typische Komponenten von ERP Systemen<br />
Kommunikative Kompetenz:<br />
Die Studierenden lernen, Finanzierungsmethoden und Lösungsansätze im Bereich der<br />
Wirtschaftsinformatik verständlich und nachvollziehbar darzustellen und zu erläutern.<br />
3 Inhalte<br />
Investition und Finanzierung:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Grundlagen / Begriffe / Definitionen<br />
Grundzüge der integrierten Finanzplanung<br />
Eigenkapitalfinanzierung<br />
Fremdfinanzierung<br />
Finanzierungssurrogate<br />
Innenfinanzierung<br />
Ausgewählte Finanzierungsarten und Finanzierungsbausteine<br />
Probleme der Mittelstandsfinanzierung/ Fehlerquellen im Finanzierungsbereich
Wirtschafsinformatik / ERP:<br />
Überblick ERP-Systeme<br />
Ziele von ERP-Systemen<br />
Funktionsumfang von ERP-Systemen<br />
Marktüberblick<br />
Architektur von ERP-Systemen<br />
Geschäftsprozesse und deren Modellierung<br />
Individual- und Standardsoftware<br />
Kostenbewertung von ERP-Systemen<br />
Organisationsstrukturen und deren Abbildung in ERP-Systemen<br />
Fallstudien mit Praxislösung im ERP-System SAP R/3 in dem Bereich Logistik oder Produktion<br />
Betriebswirtschaftliche Funktionen im ERP-System<br />
Umsetzung von Geschäftsprozessen in der Betriebswirtschaftlichen Software SAP R/3<br />
Anlegen von St<strong>am</strong>mdaten in den Modulen SD, MM, PP<br />
Stücklistenerstellung<br />
Erzeugung von Bewegungsdaten<br />
Kundenauftrag, Materialbedarfsplanung<br />
Mandant, Buchungskreis, Verkaufsorganisation, Werk<br />
Planauftrag, Fertigungsauftrag, MRP-Lauf, Ergebniskalkulation<br />
Rückmeldungen durchführen<br />
Wareneingänge, Warenausgänge verbuchen<br />
4 Lehrformen<br />
4 +2 SWS seminaristische Vorlesung mit Tafel und Be<strong>am</strong>erprojektion, Softwarevorführungen, Softwareübungen<br />
und weiteren Übungen<br />
5 Teilnahmevoraussetzungen<br />
Formal: -keine-<br />
Inhaltlich: Teilnahme an den Modulen des 1. und 2. Sem. wird empfohlen<br />
6 Prüfungsformen<br />
Klausur, Bearbeitungszeit max. 180 Minuten<br />
7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten<br />
Bestandene Modulklausur<br />
8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen)<br />
9 Stellenwert der Note für die Endnote<br />
6 / 144<br />
10 Modulbeauftragte/r und haupt<strong>am</strong>tlich Lehrende<br />
Prof. Dr. Bernhard Wasmayr<br />
11 Sonstige Informationen<br />
Sprache: deutsch, einzelne Abschnitte in Englisch<br />
Literatur:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Vorlesungsunterlagen /Handouts des Dozenten<br />
SAP-Fallstudienmaterial<br />
Christof Schulte: Logistik - Wege zur Optimierung der Supply Chain, Vahlen, aktuelle Auflage<br />
Peter Stahlknecht, Ulrich Hasenk<strong>am</strong>p: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Springer, aktuelle<br />
Auflage