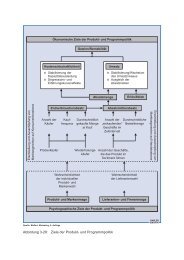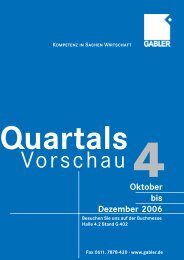Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich
Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich
Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Product<br />
Promotion Price<br />
Place<br />
4 P's des klassischen<br />
Konsumgütermarketing<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Promotion Product<br />
Place Personnel<br />
Price<br />
Physical<br />
Facilities<br />
Process<br />
Management<br />
7 P's des<br />
Dienstleistungsmarketing<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-1: <strong>Erweitertes</strong> <strong>Marketing</strong>-<strong>Mix</strong> <strong>im</strong> <strong>Dienstleistungsbereich</strong><br />
(Quelle: Magrath 1986)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Kosten, Umsatz<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
Kosten KG Kosten DL<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Diff KG<br />
opt<br />
Diff DL<br />
opt<br />
Anzahl der angebotenenProduktbzw.Leistungsvarianten<br />
DL = Dienstleistungen<br />
KG = Konsumgüter<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-2: Opt<strong>im</strong>ale Leistungsdifferenzierung bei Dienstleistungen<br />
und Konsumgütern (idealtypische Darstellung)<br />
13<br />
Umsatz DL<br />
Umsatz KG<br />
Diff = Opt<strong>im</strong>aler Differenzierungsgrad<br />
opt<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Preishöhe<br />
mit Yield-Management<br />
ohne Yield-Management<br />
Risiko aufgrund fehlender<br />
Handlungsflexibilität<br />
Hohe Planungssicherheit,<br />
Kostenvorteile<br />
Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />
Kunde<br />
Anbieter<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-3: Zeitliche Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen<br />
Zeit (t)<br />
Zeitpunkt der<br />
Leistungserstellung<br />
Risiko aufgrund ggf. fehlender<br />
Verfügbarkeit<br />
Vermeidung von Leerkosten<br />
(Beitrag zur Fixkostendeckung)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
1950 1995<br />
1. Klassische Fachgeschäfte<br />
2. Warenhäuser<br />
3. Versandhandel<br />
Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />
1. Klassische Fachgeschäfte<br />
2. Spezialgeschäfte<br />
3. Katalogschauräume<br />
4. SB-Warenhäuser<br />
5. Kaufhäuser<br />
6. Warenhäuser<br />
7. Verbraucher-/Hypermärkte<br />
8. Supermärkte<br />
9. Fachmärkte<br />
10. Factory Outlets<br />
11. Versandhandel<br />
12. Shopping-Center/-Malls<br />
13. City-Center<br />
14. Fachmarkt-Center<br />
15. Discounter<br />
16. Convenience Stores (Tankstellen,<br />
Bahnhöfe, Kiosk etc.)<br />
17. Havariemärkte (Restposten,<br />
Versicherungsschäden)<br />
18. Home-/Teleshopping<br />
19. Second-hand-Märkte<br />
20. Sonstige<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-4: Betriebsformenentwicklung <strong>im</strong> deutschen Einzelhandel<br />
GABLER<br />
GRAFIK
5,5% 5,5%<br />
2,0%<br />
7,2%<br />
11,9%<br />
18,0%<br />
55,4%<br />
14,0%<br />
5,8%<br />
17,5%<br />
21,8%<br />
35,4%<br />
1980 1995<br />
Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />
Versandhandel<br />
Fachmärkte<br />
Warenhäuser<br />
Verbrauchermärkte/<br />
SB-Warenhäuser<br />
Filialisierte<br />
Fachgeschäfte<br />
Kleine und mittlere<br />
Fachgeschäfte<br />
Filialisierende<br />
Betriebsformen<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-5: Entwicklung der Marktanteile der Betriebsformen <strong>im</strong> deutschen<br />
Einzelhandel (1980 bis 1995)<br />
(Quelle: Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />
INSERT 5-1: Lebensmittel Zeitung, 04.10.1996, S. 38
Sort<strong>im</strong>entsstandardisierung<br />
groß<br />
Wachstum<br />
Grundnutzen<br />
groß<br />
gering<br />
Filialbetrieb<br />
gering<br />
gering<br />
gering<br />
gering<br />
hoch<br />
hoch<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Einflußfaktoren der Strategiewahl<br />
Umweltbezogen<br />
Marktvolumen<br />
Markt-Lebenszyklusphase<br />
Kaufverhalten<br />
Lieferantenstärke<br />
Standort-Heterogenität<br />
Unternehmensbezogen<br />
Bindungsform<br />
Filial-Management-Qualität<br />
Filial-Heterogenität<br />
Marktabdeckung<br />
Qualitätsorientierung<br />
Kostenorientierung<br />
Innovationsorientierung<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-6: Zentrale Einflußfaktoren der Sort<strong>im</strong>entsstandardisierung<br />
(Quelle: Lensker 1996, S. 62)<br />
gering<br />
Stagnation<br />
Zusatznutzen<br />
gering<br />
groß<br />
Kooperation<br />
hoch<br />
groß<br />
hoch<br />
hoch<br />
gering<br />
gering<br />
Sort<strong>im</strong>entsdifferenzierung<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Standorttyp Häufig bevorzugt von Bevorzugte Güterarten<br />
Typ 1 In großer räumlicher Nähe<br />
zu den Wohnorten der<br />
Haushalte, die als Kunden<br />
gewonnen werden sollen<br />
Typ 2 In großer räumlicher Nähe<br />
zu Konkurrenzbetrieben<br />
Typ 3 In großer räumlicher Nähe<br />
zu Betrieben mit ergänzendem<br />
Sort<strong>im</strong>ent<br />
Typ 4 In großer räumlicher Nähe<br />
zu Passantenströmen<br />
Nachbarschaftsgeschäften,Lebensmittelfilialbetrieben<br />
Fachgeschäften (zum<br />
Beispiel<br />
Möbelhandlungen,<br />
Autohäuser)<br />
Fachgeschäften,<br />
Shopping-Centern<br />
Relativ kleinen<br />
Geschäften<br />
Typ 5 Verkehrsgünstig gelegen Geschäften mit großem<br />
Flächenbedarf<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-7: Standorttypen <strong>im</strong> Einzelhandel<br />
(in enger Anlehnung an Müller-Hagedorn 1993, S. 111)<br />
Regelmäßig<br />
anfallender Bedarf,<br />
Geplante, routinierte<br />
Einkäufe,<br />
Einkäufe, die zu Fuß<br />
erledigt werden<br />
Güter, deren Beschaffung<br />
eine umfassende<br />
Informationssuche<br />
erfordert<br />
Keine spezifischen<br />
Schwerpunkte<br />
Güter mit hohem<br />
Impulskaufanteil<br />
Güter mit hohem<br />
Flächenbedarf,<br />
Einkäufe, die mit dem<br />
Auto erledigt werden<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Leistungsvorteil Wettbewerbsvorteil<br />
Kostenvorteil<br />
Gesamtmarkt<br />
Factory<br />
Outlet<br />
Center<br />
Einkaufszentren<br />
City-<br />
Center<br />
CentrO/<br />
Oberhausen<br />
SB<br />
Warenhäuser<br />
Warenhäuser<br />
Verbrauchermärkte<br />
Stuck<br />
in the<br />
middle<br />
Marktabdeckung<br />
Supermärkte<br />
Fachdiscounter<br />
Fachhandel<br />
Fachmärkte<br />
Teilmarkt<br />
GABLER<br />
GRAFIK<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-8: Wettbewerbsstrategische Positionierung der Betriebsformen <strong>im</strong> deutschen Einzelhandel<br />
(in Anlehnung an Meffert 1985)
USA Deutschland<br />
ECR-Komponente Einsparpotential<br />
(in %<br />
vom<br />
Umsatz)<br />
Efficient Replenishment<br />
(EDI, automatisierte Disposition)<br />
Effiziente Wiederbefüllung<br />
der Läger und Regale<br />
<strong>im</strong> Handel<br />
Efficient Store Assortments<br />
(Category Management)<br />
bessere Sort<strong>im</strong>entsstruktur<br />
Efficient Promotion<br />
weniger und gezieltere Verkaufsförderungsmaßnahmen<br />
Efficient Product Development<br />
kundenorientierte<br />
Neuproduktentwicklung<br />
ECR-Komponente Einsparpotential<br />
(in %<br />
vom<br />
Umsatz)<br />
4,1 Operative Kooperation<br />
(Warenfluß, Bestandsführung,<br />
Verwaltung)<br />
1,5<br />
4,3<br />
0,9<br />
<strong>Marketing</strong>-Kooperation<br />
(Effiziente Sort<strong>im</strong>ente,<br />
Verkaufsförderungsmaßnahmen<br />
und Produkteinführungen)<br />
Gesamte Einsparung 10,8 Gesamte Einsparung 3,4<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-9: Einsparpotentiale durch Efficient Consumer Response<br />
(Quelle: Biehl 1995)<br />
2,5<br />
0,9<br />
GABLER<br />
GRAFIK
I = Marktstufe<br />
II = Betriebsform<br />
billigpreisig<br />
stilorientiert<br />
avantgardistisch<br />
exklusiv<br />
DIY-/<br />
technikbezogen<br />
auswahlbetont<br />
exklusiv<br />
preisbetont<br />
großflächig<br />
spartanisch<br />
etc.<br />
Textilien<br />
Möbel<br />
Autozubehör<br />
Food<br />
aktions-/<br />
diskontorientiert<br />
mittelflächig<br />
klassisch<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
flaggschiffartig<br />
Non-<br />
Food<br />
„Alles<br />
unter<br />
einem<br />
Dach”<br />
Unterhaltungselektronik<br />
auswahlorientiert<br />
weltstädtisch<br />
Versandhandel<br />
Warenhaus<br />
Verbrauchermarkt<br />
design-/<br />
trendorientiert<br />
Fachmarkt<br />
Möbel<br />
Zustellgroß-<br />
Handel<br />
Großhandel<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-10: Zusammenhang zwischen Betriebsformen und Betriebstypen<br />
(in enger Anlehnung an Heinemann 1989, S. 15)<br />
traditionell<br />
IV<br />
III<br />
II<br />
I<br />
Einzelhandel<br />
exklusiv<br />
Autozubehör<br />
Eigenlieferung<br />
Lebensmittel<br />
DIY-/<br />
technikbezogen<br />
etc.<br />
Fremdlieferung<br />
C & C-<br />
Läger<br />
Lampen<br />
etc.<br />
Fachgeschäft<br />
Lebensmittel<br />
Industriebedarf<br />
etc.<br />
Non-<br />
Food<br />
Privatbedarf<br />
Food<br />
Bekleidung<br />
Elektroartikel<br />
Automobile:<br />
Neuwagen<br />
nachbarschaftsorientiert<br />
gehoben<br />
modisch<br />
konsumstark<br />
serviceorientiert<br />
auswahlorientiert<br />
preisbetont<br />
servicebetont<br />
convenienceorientiert<br />
frischeorientiert<br />
III = Branche<br />
IV = Betriebstyp<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Supermarkt Discounter Verbrauchermarkt Kaufhaus<br />
Personalkosten<br />
8,5%<br />
Mieten 1,5%<br />
Abschreibung 1,5%<br />
Werbung 1,0%<br />
Übrige 1,0%<br />
direkte Kosten<br />
Personalkosten<br />
5,0%<br />
Mieten 2,0%<br />
Abschreibung 1,0%<br />
Werbung 1,0%<br />
Übrige 1,0%<br />
direkte Kosten<br />
Zentral- 8,5%<br />
gemeinkostenZentralgemeinkosten 5,0%<br />
∑ 22,0% 1<br />
Personalkosten<br />
5,0%<br />
Mieten 2,0%<br />
Abschreibung 1,5%<br />
Werbung 1,0%<br />
Übrige<br />
Sachkosten<br />
4,0%<br />
Übrige<br />
Sachkosten<br />
Zentral- 3,0% Zentral- 2,0%<br />
gemeinkostengemeinkosten <strong>Abbildung</strong> 5-11: Kostenstrukturen verschiedener Betriebsformen innerhalb<br />
eines Einzelhandelskonzerns<br />
(in enger Anlehung an Müller-Hagedorn 1993, S. 86)<br />
Personalkosten<br />
12,0%<br />
Mieten 5,0%<br />
Abschreibung 2,0%<br />
Werbung 2,0%<br />
∑ 15,0% 1 ∑ 16,5% 1 ∑ 28,0% 1<br />
1 Rest <strong>im</strong> wesentlichen Wareneinstandskosten. Basis: Gesamtkosten der Betriebsform (= 100%)<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
6,0%<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Autor <strong>Marketing</strong>instrumente<br />
U. Hansen<br />
(1990)<br />
B. Tietz<br />
(1993)<br />
K. Barth<br />
(1996)<br />
L. Berekoven<br />
(1993)<br />
L. Müller-<br />
Hagedorn<br />
(1995)<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
1. Standortpolitik<br />
2. Sort<strong>im</strong>entspolitik<br />
3. Produktpolitik, insbesondere<br />
Eigenmarkenpolitik<br />
4. Verkaufsgestaltung<br />
5. Preispolitik<br />
6. Absatzfinanzierung<br />
1. Waren- und dienstleistungsbezogene<br />
Instrumente (Produktgestaltung,<br />
Sort<strong>im</strong>entsprogramm,<br />
Mengenpolitik)<br />
2. Entgeltbezogene Instrumente<br />
(Preise, leistungsbezogene Konditionen,<br />
finanzielle Konditionen)<br />
3. Nebenleistungsbezogene<br />
Instrumente (Kundendienst)<br />
4. Informations- und kommunikationsbezogene<br />
Instrumente<br />
(Sachwerbung, persönliche Werbung,<br />
Public Relation, Kontaktintensität<br />
und Präsentation,<br />
zeitliche Kontaktbereitschaft)<br />
1. Leistungspolitik (Sort<strong>im</strong>entspolitik,<br />
Quantitätspolitik, Überbrückungspolitik,Sicherungspolitik,Umsatzdurchführungspolitik,Sachgüteraufbereitungsbzw.<br />
Komplettierungspolitik)<br />
1. Sort<strong>im</strong>entspolitik<br />
2. Handelsmarkenpolitik<br />
3. Qualitäts- und Qualitätssicherungspolitik<br />
4. Servicepolitik<br />
5. Preispolitik<br />
1. Ware (Sort<strong>im</strong>ent)<br />
(Sort<strong>im</strong>entsbreite und -tiefe,<br />
Anteil der markierten Ware,<br />
Verfügbarkeit)<br />
2. Personal (Bedienungssystem,<br />
besondere Dienstleistungen,<br />
Beratung, Dienste nach dem<br />
Verkauf)<br />
3. Standort (Art der Geschäftslage)<br />
7. Absatzwerbung<br />
8. Kundenservice<br />
9. Beschwerdepolitik<br />
5. Institutionenorientierte<br />
Instrumente (Handelswege)<br />
6. Warenprozeßinstrumente:<br />
Waren- und dienstleistungsgebundene<br />
Instrumente der<br />
Zeitverfügbarkeit (Lagerhaltung)<br />
und der Raumverfügbarkeit<br />
(Transport), und zwar Liefertermin,<br />
Lieferhäufigkeit,<br />
Bestell- und Liefermenge,<br />
Leistungsbereitschaft und<br />
Leistungsservice<br />
2. Entgeltpolitik (Preispolitik,<br />
Rabattpolitik, Konditionenpolitik)<br />
3. Beeinflussungspolitik<br />
(Präsentationspolitik, Werbepolitik,<br />
Öffentlichkeitspolitik)<br />
6. Werbepolitik<br />
7. Verkaufsförderungspolitik<br />
8. Verkaufsraumgestaltung und<br />
Warenpräsentation<br />
9. Verkaufspersonalpolitik<br />
10. Standortpolitik<br />
4. Werbung (Schaufenster,<br />
Prospekte, Anzeigen)<br />
5. Verkaufsraum (Ladengestaltung,<br />
Größe der Verkaufsfläche)<br />
6. Preise und Konditionen<br />
(Höhe der Kalkulation,<br />
Umtauschmöglichkeiten)<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-12: Die Systematik der <strong>Marketing</strong>instrumente <strong>im</strong> Handel<br />
(in Anlehnung an Müller-Hagedorn 1993, S. 51)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Partialmodelle<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Ansätze zum Verhalten auf<br />
Investitionsgütermärkten<br />
Monoorganisationale<br />
Ansätze<br />
Totalmodelle<br />
Phasenablauf<br />
des Entscheidungsprozesses<br />
Kollektiver Charakter<br />
des Entscheidungsprozesses<br />
Beschreibung<br />
alternativer<br />
Kaufsituationen<br />
Interaktionsansätze<br />
Personale<br />
Interaktionsansätze<br />
Organisationale<br />
Interaktionsansätze<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-13: Forschungsansätze zum Verhalten auf Investitionsgütermärkten<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Makro-Umwelt der Interaktion<br />
Marktstruktur<br />
Marktdynamik<br />
Soziale Umwelt<br />
Internationalisierungsgrad<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Atmosphäre<br />
Nachfrager<br />
Interaktionsprozeß<br />
Anbieter<br />
Organisationen Individuen<br />
Organisationen Individuen<br />
Transaktionsepisoden<br />
■<br />
Ziele<br />
Einstellungen<br />
Erfahrungen<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Struktur<br />
Technologie<br />
Ressourcen<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Langfristige Beziehungen<br />
■<br />
Ziele<br />
Einstellungen<br />
Erfahrungen<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Struktur<br />
Technologie<br />
Ressourcen<br />
■<br />
■<br />
■<br />
GABLER<br />
GRAFIK<br />
Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-14: Das Interaktionsmodell der IMP-Group<br />
(Quelle: Turnbull/Valla 1986, S. 5)
Kaufverbund<br />
mit<br />
ohne<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
OEM-<br />
Geschäft<br />
Anlagengeschäft<br />
Einzelkundenbezogen<br />
(Individual-Transaktion)<br />
Transaktionsform<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-15: Geschäftstypen-Ansatz<br />
(in enger Anlehnung an Backhaus 1999)<br />
Systemgeschäft<br />
Produktgeschäft<br />
Anonymer Markt<br />
(Routine-Transaktion)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Die Eröffnung des neuen Athener Flughafens wurde Foto: AIA<br />
um vier Monate auf den 1.3.2001 vorgezogen.<br />
INSERT 5-2: Handelsblatt 14./15.05.1999, S. 62
Persönlicher Verkauf*<br />
Fachmessen<br />
Herkömmlicher Katalog<br />
Fachzeitschriftenartikel<br />
Hausmessen<br />
Klassische Werbung<br />
Elektronischer Katalog<br />
Mailing<br />
Telefonverkauf<br />
* Mehrfachnennungen möglich<br />
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60% 70% 80 % 90 % 100 %<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-16: Bedeutung einzelner Kommunikationsinstrumente<br />
in der Werkzeugmaschinenindustrie<br />
(Quelle: Belz et al. 1996, S. 79)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Integrationsvorteile<br />
hoch<br />
niedrig<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
3<br />
Globales<br />
<strong>Marketing</strong><br />
1 2<br />
Internationales<br />
<strong>Marketing</strong><br />
niedrig hoch<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-17: Systematisierung der Grundorientierungen<br />
<strong>im</strong> internationalen <strong>Marketing</strong><br />
4<br />
Transnationales<br />
<strong>Marketing</strong><br />
Multinationales<br />
<strong>Marketing</strong><br />
Differenzierungsvorteile<br />
GABLER<br />
GRAFIK
F NL S CH U.K.<br />
Schriftliche Befragung 4 % 33 % 23 % 8 % 9 %<br />
Telefon-Interview 15 % 18 % 44 % 21 % 16 %<br />
Persönliches Interview auf der Straße 52 % 37 % – – –<br />
Persönliches Interview zu Hause – – 8 % 44 % 54 %<br />
Gruppeninterview 13 % – 5 % 6 % 11 %<br />
Tiefeninterview 12 % 12 % 2 % 8 % –<br />
Analyse von Sekundärdaten 4 % – 4 % 8 % –<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-18: Datenerhebungsformen in ausgewählten Ländern<br />
(Quelle: Demby 1990, S. 24)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Zield<strong>im</strong>ensionen<br />
Schnellere Diffusion<br />
neuer Konzepte<br />
Profilierung <strong>im</strong><br />
Wettbewerb<br />
Koordinationsvereinfachung<br />
Erleichterung der länderübergreifenden<br />
Planung<br />
Harmonisierung des<br />
Marktauftritts<br />
Nutzung von<br />
Synergien<br />
Ausschöpfung des<br />
Marktvolumens<br />
Ausschöpfung der<br />
Preisspielräume<br />
Risikostreuung<br />
Erhöhung der<br />
Kommunikationseffizienz<br />
Reduzierung von<br />
Distributionskosten<br />
Reduzierung der<br />
Produktstückkosten<br />
Erhöhung der Kooperationsbereitschaft<br />
des Handels<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
global orientierte Unternehmen<br />
national orientierte Unternehmen<br />
f<strong>Abbildung</strong><br />
5-19: Ziele <strong>im</strong> internationalen <strong>Marketing</strong> europäischer Unternehmen<br />
(Quelle: Meffert/Bolz 1998, S. 104)<br />
wichtig unwichtig<br />
N = 92<br />
***<br />
**<br />
**<br />
**<br />
*<br />
***<br />
**<br />
***<br />
Signifikanzniveau α<br />
<<br />
<<br />
<<br />
0,10<br />
0,05<br />
0,01<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Strategische Marktwahl<br />
(Geschäftsfeldabgrenzung)<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Funktionen<br />
Technologien<br />
Abnehmer<br />
Länder<br />
Internationale Marktwahl<br />
(inter- und intranationale<br />
Marktsegmentierung<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-20: Strategische und internationale Marktwahl <strong>im</strong> Überblick<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Anzahl der bearbeiteten<br />
Auslandsmärkte<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Sprinklerstrategie<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-21: Länderübergreifende T<strong>im</strong>ingstrategien<br />
(Quelle: Ayal/Zif 1979, S. 86)<br />
Wasserfallstrategie<br />
Langfristig<br />
opt<strong>im</strong>ale Anzahl<br />
der bearbeiteten<br />
Auslandsmärkte<br />
Zeit<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Wo<br />
soll das Unternehmen<br />
mit Blick auf<br />
wen<br />
was<br />
wie stark<br />
in<br />
welcher<br />
Wettbewerbssituation<br />
mit<br />
welchen<br />
Wirkungen standardisieren?<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
regional<br />
Absatzmittler<br />
Standardisierungsd<strong>im</strong>ensionen<br />
Strategie<br />
Instrumente<br />
Sonstige<br />
Aufgabenumwelt<br />
Inhalte<br />
1<br />
3<br />
Inhalte<br />
Globale Umwelt<br />
<strong>Marketing</strong>-<br />
Standardisierung<br />
Realisierung von Wettbewerbsvorteilen<br />
intern<br />
extern<br />
Unternehmen<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-22: Paradigma der <strong>Marketing</strong>standardisierung<br />
(Quelle: Bolz 1992, S. 5)<br />
weltweit<br />
Endverbraucher<br />
Prozesse<br />
2<br />
4<br />
Prozesse<br />
Wettbewerb<br />
Effektivität Effizienz<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Markenname<br />
Produkt Differenziert Standardisiert<br />
Differenziert insbesondere Nahrungsmittel,<br />
etwa von Unilever<br />
Standardisiert Snuggle/M<strong>im</strong>osin/Kuschelweich<br />
(Weichspüler);<br />
Silkience/Soyance/Sientel<br />
(Shampoo)<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-23: Vereinheitlichung von physischen Produkten<br />
und der Markenpolitik in der Praxis<br />
Coca-Cola;<br />
Pepsi-Cola;<br />
Camel;<br />
Produkte von<br />
Kraft-Jacobs-Suchard<br />
Kodak-Filme;<br />
Rado-, Seiko-Uhren;<br />
Minolta-, Canon-Kameras<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-3: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.08.1996, S. 14<br />
Grafik:<br />
Felix Brocker
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-3: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.08.1996, S. 14 (Fortsetzung)<br />
Tobias Piller
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-4: Henkel, Internationale Einführungskampagne<br />
für das Produkt Svit, 2000
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-4: Henkel, Internationale Einführungskampagne<br />
für das Produkt Svit, 2000 (Fortsetzung)
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
71,2<br />
12,0<br />
2,7<br />
13,0<br />
43,3 44,0<br />
7,0<br />
5,7<br />
71,6 69,5<br />
22,5<br />
22,9<br />
3,4<br />
2,0 3,2 3,2<br />
Schweiz GB Dänemark Deutschland Frankreich Polen<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-24: Anteile einzelner Medien am nationalen<br />
Werbeaufkommen 1999 (in Prozent)<br />
(Quelle: Horizont, Nr. 4, 2000, S. 12)<br />
Print<br />
TV<br />
Hörfunk<br />
Außenwerbung<br />
42,6<br />
37,0<br />
7,2<br />
12,4<br />
29,1<br />
56,0<br />
7,7 7,1<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-5: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.02.1999, S. 27
Land<br />
PKW<br />
BMW 525i VW Golf CL Renault 19 Fiat Uno 45<br />
D 58.257,– 23.575,– 21.789,– 17.140,–<br />
F 60.653,– 22.997,– 21.890,– 14.159,–<br />
I 63.342,– 22.126,– 22.940,– 13.613,–<br />
B 61.629,– 24.417,– 25.097,– 14.491,–<br />
E 64.263,– 23.970,– 18.690,– 12.851,–<br />
DK 51.489,– 19.016,– 14.429,– 13.304,–<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-25: Verkaufspreise (inklusive 15 Prozent Mehrwertsteuer)<br />
verschiedener PKW-Marken in Europa<br />
(Quelle: ADAC Motorwelt, Nr. 2, 1993, S. 96)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-6: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.1999, S. 22
Integrationsvorteile<br />
hoch<br />
niedrig<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
3<br />
1<br />
Globale<br />
Strategie<br />
Geozentrische<br />
Kultur<br />
Internationale<br />
Strategie<br />
Ethnozentrische<br />
Kultur<br />
niedrig hoch<br />
4<br />
2<br />
Misch-Strategie<br />
(Transnationale Strategie)<br />
Synergetische<br />
Kultur<br />
Multinationale<br />
Strategie<br />
Polyzentrische<br />
Kultur<br />
Differenzierungsvorteile<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-26: Unternehmenskultur und internationale Grundorientierung<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Öffentliche Verwaltungen Öffentliche Unternehmen<br />
Angebotsverhalten Bedarfswirtschaftlich Erwerbs- und<br />
bedarfswirtschaftlich<br />
Bedeutung der<br />
Gewinnerzielung<br />
Einnahmen Steuern, Beiträge,<br />
Gebühren<br />
Beteiligung einer<br />
Gebietskörperschaft<br />
Keine Bedeutung Dominierende bis<br />
sekundäre Bedeutung<br />
Umsatzerlöse und<br />
Subventionen<br />
100 % 51 %–100 %<br />
Etatisierung Brutto Netto<br />
Abgabe der Güter Unentgeltliche Abgabe von<br />
Kollektivgütern<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-27: Unterschiede zwischen öffentlichen Verwaltungen<br />
und Unternehmen<br />
(in enger Anlehnung an Töpfer/Braun 1989, S. 15,<br />
Raffée et al. 1994, S. 21)<br />
Entgeltliche Abgabe von<br />
Individualgütern<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Keine<br />
individuellen<br />
Eigentumsrechte<br />
Individuelle<br />
Eigentumsrechte<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Öffentliches Gut Privates Gut<br />
Kollektivgüter<br />
Nicht-Ausschluß<br />
Nicht-Rivalität<br />
unentgeltliche Abgabe<br />
Angebot durch öffentliche<br />
Verwaltungen<br />
(zum Beispiel Rechtssicherheit)<br />
Öffentliche Individualgüter<br />
(meritorische Güter)<br />
Ausschlußprinzip<br />
nicht kostendeckende,<br />
gegebenenfalls entgeltliche<br />
Abgabe<br />
Angebot durch öffentliche<br />
Unternehmen<br />
(zum Beispiel Bildungsangebote<br />
der Volkshochschulen)<br />
Private Individualgüter<br />
Ausschlußprinzip<br />
entgeltliche Abgabe zu<br />
Marktpreisen<br />
Angebot durch öffentliche<br />
Unternehmen<br />
(zum Beispiel Transportleistungen,<br />
öffentlicher Luftverkehrs-<br />
gesellschaften)<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-28: Systematisierung von Kollektiv- und Individualgütern<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Human Concept of <strong>Marketing</strong><br />
Ökologieorientiertes <strong>Marketing</strong><br />
Kommerzielles <strong>Marketing</strong><br />
<strong>Marketing</strong> öffentlicher Betriebe<br />
Soziale Verantwortung des <strong>Marketing</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />
Vertiefung<br />
(Deepening)<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Generic <strong>Marketing</strong><br />
<strong>Abbildung</strong> 5-29: Deepening und Broadening des kommerziellen <strong>Marketing</strong><br />
(in Anlehnung an Wehrli 1981, S. 51)<br />
Ausweitung<br />
(Broadening)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Produzent<br />
b) Das Produkt <strong>im</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />
Unterstützergruppen<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Konsumartikel<br />
oder Dienstleistungen<br />
Beiträge,<br />
Spenden<br />
Nutzen<br />
Öffentlichkeiten<br />
Akzeptanz<br />
„Gesellschaftliches<br />
Produkt“<br />
Erstellt von sozialer<br />
Organisation<br />
Nutzen<br />
Nutzen<br />
Gesetze,<br />
Rahmenbedingungen<br />
Genehmigung<br />
erteilende<br />
Gruppen<br />
a) Das Produkt in der Wirtschaft<br />
Bezahlung<br />
Existenzberechtigung<br />
Nutzen<br />
Kunde<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-30: Das Produkt in der Wirtschaft und <strong>im</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />
(Quelle: Beilmann 1995, S. 9 f.)<br />
= Produkt<br />
Nutzergruppen<br />
= Produkt<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Aufgabenbereiche<br />
nichtkommerzieller Organisationen<br />
Gesundheitsvorsorge und<br />
Rehabilitation<br />
Entwicklungshilfe und<br />
Nahrungsmittelplanung<br />
Nichtkommerzielle<br />
Organisationen<br />
Stiftungen, Wohlfahrtsorganisationen,<br />
Verbände, Kränkenhäuser und andere<br />
Stiftungen, Wohlfahrtsorganisationen,<br />
Kirchen, Internationale Behörden und andere<br />
Bildungswesen Schulen, Universitäten, Stiftungen,<br />
Wohlfahrtsorganisationen und andere<br />
Kultur Stiftungen, Ministerien, Museen,<br />
Theater und andere<br />
Freizeitgestaltung Kindergärten, Kirchen,<br />
Wohlfahrtsorganisationen und andere<br />
Umweltschutz und Landespflege Behörden, Bürgerinitiativen, Ministerien und<br />
andere<br />
Stadt-, Verkehrs- und Regionalplanung Ministerien, Verbände, Behörden, Polizei und<br />
andere<br />
Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung Ministerien, Behörden, Polizei und andere<br />
Minderheitenschutz Behörden, Bürgerinitiativen, Parteien<br />
und andere<br />
„Humanisierung der Arbeitswelt“ Verbände, Gewerkschaften,<br />
Genossenschaften und andere<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-31: Systematisierung nichtkommerzieller Organisationen<br />
auf der Grundlage von Aufgabenbereichen<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Philosophie<br />
der Organisation<br />
Umweltanalyse<br />
Wirtschaft Politik Technologie Recht Kultur Gesellschaft<br />
Konkurrierende<br />
Organisationen<br />
Marktabgrenzung<br />
und -wahl<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Marktanalyse<br />
Klienten Vermittler<br />
Planung einer Social <strong>Marketing</strong>-Strategie<br />
Marktteilnehmer<br />
Situationsanalyse<br />
Ist-Analyse Prognose<br />
Soziale Aufgaben<br />
und Ziele<br />
<strong>Marketing</strong>budget<br />
Social <strong>Marketing</strong>-Maßnahmen<br />
Produkt Kommunikation Distribution Preis<br />
Koordination von Social <strong>Marketing</strong>-Aktivitäten<br />
Organisation Personal Kontrolle<br />
Social <strong>Marketing</strong>-Ergebnis<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-32: Planungsprozeß des Social <strong>Marketing</strong><br />
Eigene<br />
Organisation<br />
Organisationsstruktur<br />
Instrumentalstrategien<br />
Marktbezogene Ziele Organisationsinterne Ziele<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Zu jeder Zeit. Aber wir können etwas dagegen<br />
tun. Mit Vorsorge bei Ihrem Arzt, mit Fürsorge und mit Geld. Informationen erhalten<br />
Sie bei der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh, unter 0 52 41 / 9 77 00.<br />
Spendenkonto: Deutsche Bank Gütersloh, BLZ 480 700 40, Konto-Nr. 50.<br />
Lähmungs- und/oder Taubheitsgefühl<br />
einer Körperseite, besonders des<br />
Gesichtes oder des Armes.<br />
Plötzlicher Verlust der Sprechfähigkeit<br />
oder Schwierigkeiten, Gesprochenes<br />
zu verstehen<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Plötzlich auftretende sehr starke<br />
Kopfschmerzen.<br />
INSERT 5-7: Plakat der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe<br />
STIFTUNG<br />
DEUTSCHE<br />
SCHLAGANFALL<br />
HILFE<br />
Plötzliche Sehstörungen, besonders<br />
auf einem Auge und/oder Doppelbilder.<br />
Plötzlich eintretender Drehschwindel<br />
und Gangunsicherheit.
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-8: Kampagne der BundesArbeitsGemeinschaft<br />
Kinder- und Jugendtelefon <strong>im</strong> Deutschen Kinderschutzbund e. V.
Ökologie-Pull<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,5<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Metallverarbeitung/Fahrzeugbau<br />
Metallverarbeitung/Fahrzeugbau<br />
Elektrotechnik<br />
Chemie<br />
2,0 3,0 4,0 5,0<br />
Betroffenheitspositionierung 1988<br />
Betroffenheitspositionierung 1994<br />
Elektrotechnik<br />
Holz-/Papierverarbeitung<br />
Nahrungsmittel<br />
Holz-/Papierverarbeitung<br />
Chemie<br />
Nahrungsmittel<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-33: Betroffenheitspositionierung ausgewählter Branchen<br />
<strong>im</strong> Längsschnittvergleich*<br />
Ökologie-<br />
Push<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Kunde<br />
Umweltschutz<br />
als Bedürfnis<br />
und gesellschaftlicher<br />
Anspruch<br />
UMP<br />
UEP<br />
Ökologie<br />
Umweltschutz zur dauerhaften<br />
Sicherung der natürlichen<br />
Umwelt<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-34: Spannungsfeld <strong>im</strong> Öko-<strong>Marketing</strong><br />
(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 24)<br />
Umweltschutz als<br />
wettbewerbsstrategischer<br />
Erfolgsfaktor<br />
UEP = Unique Environmental Proposition UMP = Unique <strong>Marketing</strong> Proposition<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Unternehmung<br />
Wettbewerb/<br />
Handel<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Kosten<br />
Produktbezogene<br />
Umweltvorteile<br />
als ...<br />
Preis und/oder<br />
Opportunitätskosten<br />
geringer bzw. gleich<br />
hoch wie bei<br />
traditionellen<br />
Substitutionsprodukten<br />
Preis und/oder<br />
Opportunitätskosten<br />
höher als bei<br />
traditionellen<br />
Substitutionsprodukten<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Individualnutzen Sozialnutzen<br />
Klassische<br />
Ansatzpunke des<br />
Öko-<strong>Marketing</strong><br />
Sicherung von<br />
Wettbewerbsvorteilen<br />
+ Rationalisierung<br />
+ Differenzierung<br />
Abbau von<br />
Wettbewerbsnachteilen<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-35: Erfolgsvoraussetzungen und Ansatzpunkte<br />
eines ökologieorientierten <strong>Marketing</strong><br />
I<br />
III<br />
+ gesellschaftsorientierte<br />
Profilierung<br />
Herausstellung von<br />
Wettbewerbsvorteilen<br />
<strong>Marketing</strong> für Ökologie<br />
Instrumente der Umweltpolitik<br />
(z. B. Verbote, Steuern,<br />
Abgaben)<br />
Wertewandel und<br />
Verhaltensvorschriften<br />
II<br />
IV<br />
GABLER<br />
GRAFIK
B 1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
B 2.<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
B 3.<br />
3.1<br />
3.2<br />
3.3<br />
3.4<br />
3.5<br />
I 1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
1.4<br />
I 2.<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.5<br />
I 3.<br />
3.1<br />
3.2<br />
Boden 1) (m 2 )<br />
Versiegelt<br />
Grün<br />
Überbaut<br />
Gebäude 1) (m 2 )<br />
Produktion<br />
Lager und Vertrieb<br />
Verwaltung<br />
Anlagen (Stück)<br />
Produktionsmaschinen<br />
Büroausstattung<br />
Büro- und Komm.-Masch.<br />
Fuhrpark<br />
Technische Anlagen<br />
Umlaufgüter (kg)<br />
Rohstoffe<br />
Halb- und Fertigwaren<br />
Hilfsstoffe<br />
Betriebsstoffe<br />
Energie (kWh)<br />
Gas<br />
Strom<br />
Heizöl<br />
Fernwärme<br />
Treibstoff<br />
Wasser (m 3 )<br />
Stadtwasser<br />
Rohwasser<br />
Konzernübersicht Öko-Bilanzen<br />
INPUT<br />
1991<br />
15.771.320<br />
5.311.896<br />
2.655.422<br />
5.954.169<br />
1.849.833<br />
185.039.982<br />
15.749.655<br />
54.809.172<br />
97.754.180<br />
1.615.625<br />
15.111.350<br />
672.110<br />
451.936<br />
220.174<br />
INPUT<br />
INPUT<br />
1992<br />
12.006.223<br />
4.243.238<br />
2.114.895<br />
4.115.455<br />
1.532.635<br />
157.709.097<br />
20.536.032<br />
46.465.919<br />
71.677.150<br />
2.391.466<br />
16.638.530<br />
530.541<br />
338.583<br />
191.958<br />
Zugang<br />
1993<br />
9.281<br />
3.323<br />
523<br />
5.435<br />
3.955<br />
0<br />
3.695<br />
260<br />
1.321<br />
341<br />
470<br />
421<br />
42<br />
47<br />
INPUT<br />
1993<br />
12.421.796<br />
3.821.006<br />
2.637.453<br />
4.345.438<br />
1.617.899<br />
150.682.651<br />
19.892.297<br />
47.878.784<br />
59.416.240<br />
5.595.680<br />
17.899.650<br />
495.043<br />
303.852<br />
191.191<br />
Zugang<br />
1994<br />
12.931<br />
636<br />
938<br />
11.357<br />
17.447<br />
1.210<br />
16.059<br />
178<br />
1.436<br />
530<br />
583<br />
277<br />
25<br />
21<br />
INPUT<br />
1994<br />
11.055.912<br />
3.558.124<br />
2.082.292<br />
3.936.325<br />
1.479.171<br />
118.986.313<br />
16.570.184<br />
33.123.331<br />
47.262.590<br />
5.586.418<br />
16.443.790<br />
428.770<br />
281.275<br />
147.495<br />
Bestand<br />
31.12.1993<br />
649.143<br />
68.606<br />
448.659<br />
131.878<br />
178.473<br />
73.709<br />
87.569<br />
17.205<br />
16.542<br />
6.386<br />
7.020<br />
2.806<br />
164<br />
166<br />
Bestand<br />
31.12.1994<br />
–<br />
697.183<br />
–<br />
–<br />
–<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
497.616<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
I 4. Luft (m 3 ) – – – – entfällt<br />
1) Durch Verbesserungen der Datenerhebung in den KUNERT-Werken Tunesien und Marokko änderten sich die Bestandswerte<br />
der Konten Boden und Gebäude.<br />
Kommentar<br />
Der Vergleich der INPUT- und OUTPUT-Größen über mehrere Jahre zeigt deutlich die Erfolge<br />
des Umwelt-Controllings. Stoff- und Energie-INPUT sowie Abfall-, Abwasser- und Abluftmenge<br />
konnten über die Jahre hinweg nachhaltig reduziert werden. So ging der Energieverbrauch<br />
zwischen 1991 und 1994 um rund 36 %, der Wasser-INPUT um 36 % und der Rohstoffverbrauch<br />
um 33 % zurück. Dem starken Rückgang dieser INPUT-Werte steht eine geringere Abnahme<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-9: Ökobericht der Kunert AG 1994/95, S. 14 f.
Bestand<br />
31.12.1994<br />
646.960<br />
65.750<br />
448.386<br />
132.824<br />
185.369<br />
72.107<br />
96.667<br />
16.415<br />
16.715<br />
5.943<br />
7.436<br />
2.972<br />
182<br />
182<br />
Bestand<br />
31.12.1994<br />
–<br />
2.786.664<br />
–<br />
–<br />
–<br />
36.398<br />
3.910<br />
25.236<br />
6.052<br />
1.200<br />
OUTPUT<br />
1991<br />
9.280.253<br />
5.786.896<br />
175.962<br />
0<br />
3.007.958<br />
3.124.629<br />
26.475<br />
1.963.477<br />
843.697<br />
290.980<br />
Konzernübersicht Öko-Bilanzen<br />
OUTPUT<br />
1992<br />
7.997.075<br />
5.153.663<br />
164.446<br />
0<br />
2.561.693<br />
3.069.063<br />
27.738<br />
2.260.672<br />
577.803<br />
202.850<br />
Abgang<br />
1993<br />
105.414<br />
13.435<br />
54.322<br />
37.657<br />
1.569<br />
1.569<br />
0<br />
0<br />
1.037<br />
554<br />
209<br />
178<br />
56<br />
40<br />
OUTPUT<br />
1993<br />
8.935.247<br />
5.116.411<br />
211.756<br />
989.275<br />
2.617.805<br />
2.519.252<br />
40.399<br />
1.920.624<br />
485.429<br />
72.800<br />
OUTPUT<br />
Abgang<br />
1994<br />
9.602<br />
2.692<br />
340<br />
6.570<br />
17.923<br />
9.347<br />
7.566<br />
1.010<br />
1.263<br />
973<br />
167<br />
111<br />
7<br />
5<br />
OUTPUT<br />
1994<br />
8.492.704<br />
5.199.188<br />
194.911<br />
897.598<br />
2.201.007<br />
2.357.988<br />
62.883<br />
1.816.553<br />
349.652<br />
128.920<br />
B 1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
B 2.<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
B 3.<br />
3.1<br />
3.2<br />
3.3<br />
3.4<br />
3.5<br />
0 1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
1.4<br />
0 2.<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
2.4<br />
Boden 1) (m 2 )<br />
Versiegelt<br />
Grün<br />
Überbaut<br />
Gebäude 1) (m 2 )<br />
Produktion<br />
Lager und Vertrieb<br />
Verwaltung<br />
Anlagen (Stück)<br />
Produktionsmaschinen<br />
Büroausstattung<br />
Büro- und Komm.-Masch.<br />
Fuhrpark<br />
Technische Anlagen<br />
Produkte (kg)<br />
Beinbekleidung<br />
Oberbekleidung<br />
Transportverpackung<br />
Produktverpackung<br />
Abfälle (kg)<br />
Sondermüll<br />
Wertstoffe<br />
Restmüll<br />
Bauschutt<br />
entfällt 185.039.982 157.709.097 150.682.651 118.986.313 0 3. Energieabgabe (kWh)<br />
entfällt 487.770 388.189 376.289 339.277 0 4. Abwässer (m 3 )<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
entfällt<br />
163.521<br />
200.632<br />
59.356.556<br />
–<br />
133.058<br />
167.702<br />
49.605.355<br />
–<br />
138.828<br />
207.872<br />
48.080.685<br />
121.614.000<br />
100.548<br />
170.132<br />
36.109.594<br />
96.895.400<br />
0 5.<br />
5.2.1.<br />
5.2.2.<br />
5.2.3.<br />
5.2.4.<br />
Abluft<br />
NO3 (kg)<br />
SO2 (kg)<br />
CO2 (kg)<br />
Wasserdampf (kg)<br />
des OUTPUT Bein- und Oberbekleidung von knapp 10 % <strong>im</strong> Laufe der vier Jahre gegenüber. Im<br />
gleichen Zeitraum konnten die Abfälle um ein Viertel reduziert werden, wobei das Restmüllaufkommen<br />
um 59 % schrumpfte. Erfreulich auch die CO 2-undNO 3-Emissionen, die um jeweils<br />
39 % zurückgingen. Wermutstropfen ist die Zunahme des Sondermülls. Sie ist zum Teil auf eine<br />
verbesserte Erfassung z. B. von Elektronikschrott zurückzuführen.<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-9: Ökobericht der Kunert AG 1994/95, S. 14 f. (Fortsetzung)
Konsumentenbezogene Faktoren<br />
Umweltbewußtsein<br />
Stellenwert der Umweltverträglichkeit<br />
bei der Idealmarke<br />
Wahrnehmbarkeit des<br />
Umweltnutzens<br />
Bedeutung klassischer<br />
Produkteigenschaften<br />
Wettbewerbsbezogene Faktoren<br />
Umfang von umweltorientierten<br />
Konkurrenzangeboten<br />
Differenzierungsfähigkeit<br />
klassischer Produkteigenschaften<br />
Intensität der Wettbewerbsprofilierung<br />
mit dem Umweltschutz<br />
Produktbezogene Faktoren<br />
Dauerhaftigkeit und Einzigartigkeit<br />
des Umweltnutzens<br />
Erfüllungsgrad ganzheitlicher<br />
Problemlösungen<br />
Diskr<strong>im</strong>inierungsgefahr<br />
bestehender Produkte/Marken<br />
Konflikte zwischen traditionellen<br />
Qualitätskomponenten und der<br />
Umweltverträglichkeit<br />
Umweltkomponenten der Marke<br />
Markenstrategie<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
hoch gering<br />
Umweltverträglichkeit als dominante Positionierungsd<strong>im</strong>ension<br />
Umweltverträglichkeit als flankierende Positionierungsd<strong>im</strong>ension<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-36: Best<strong>im</strong>mungsfaktoren einer dominanten und flankierenden<br />
ökologieorientierten Positionierungsentscheidung<br />
(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 281)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
100%<br />
Gesamtemissionen<br />
<strong>im</strong><br />
Lebenszyklus<br />
Rohstoffgewinnung<br />
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
Produkt B<br />
Produkt C<br />
Produkt A<br />
Herstellung Verwendung Entsorgung<br />
<strong>Abbildung</strong> 5-37: Produktbezogene Differenzierungspotentiale <strong>im</strong> Umweltschutz<br />
(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 223)<br />
GABLER<br />
GRAFIK
Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />
INSERT 5-10: Capital, Nr. 11/1999, S. 82