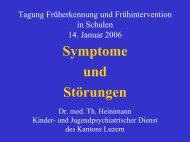Konzept - sitesystem
Konzept - sitesystem
Konzept - sitesystem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«Die Gesundheitsfördernde Schule setzt sich explizit mit Themen der Gesundheitsförderung<br />
auf allen Ebenen des Schulgeschehens (Unterricht, Team, Schulorganisation,<br />
Vernetzung, Curriculum) auseinander und verpflichtet sich zu entsprechenden<br />
Massnahmen. Damit trägt sie zur Verbesserung der Bildungs- und Schulqualität<br />
und zur Entfaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens aller an<br />
der Schule Beteiligten bei<br />
Sie orientiert sich dabei an einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff und richtet ihre<br />
Arbeit nach den Prinzipien der Gesundheitsförderung gemäss Ottawa Charta aus:<br />
Partizipation, Befähigung zum selbst bestimmten Handeln, Ressourcenorientiertheit,<br />
Langfristigkeit und Chancengleichheit bezüglich Geschlecht, sozialer, ethnischer<br />
und religiöser Herkunft.»<br />
Ein Unterstützungssystem für<br />
Kantonale Netzwerke und Schulen<br />
<strong>Konzept</strong> 2008 - 2010<br />
Barbara Zumstein<br />
Nationale Koordinatorin SNGS<br />
www.bildungundgesundheit.ch<br />
www.gesundheitsfoerderung.ch<br />
T:\Alte Struktur\ENGS\<strong>Konzept</strong> 2008-2010\20080218_SNGS-<strong>Konzept</strong> 2008 10.doc<br />
- 1 -
Das SNGS – ein Unterstützungssystem<br />
für Kantonale Netzwerke und Schulen<br />
Seite<br />
1. Ausgangslage 4<br />
2. Erfahrungen der Jahre 1997 – 2004 5<br />
3. Theoretische Herleitung und Begründung des Ansatzes 6<br />
der Gesundheitsfördernden Schule<br />
3.1 Das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen – 7<br />
Das Referenzmodell der WHO<br />
3.2 Die gute Schule – Schulethos – Das Referenzmodell der 8<br />
Schuleffektivität<br />
4. Die Gesundheitsfördernde Schule – Das Referenzmodell 9<br />
des SNGS<br />
4.1 Definition 9<br />
4.2 Handlungsprinzipien 10<br />
4.2.1 Partizipation und Empowerment 10<br />
4.2.2 Gesundheitliche Chancengleichheit – Gender, soziale, religiöse 11<br />
und ethnische Herkunft<br />
4.2.3 Salutogenese – Stärken der Ressourcen 13<br />
5. Hauptstrategie der Neukonzeption 2008 - 2010 13<br />
5.1 Das SNGS – Ein Unterstützungssystem für Schulen und 14<br />
Fachstellen<br />
5.2 Generelle Ziele 15<br />
6. Initiierung und Unterstützung Regionaler Netzwerke 15<br />
6.1 Kriterien für die Anerkennung 15<br />
6.2 Netzwerk der Netzwerke – Fachaustausch und Koordination 17<br />
6.3 Finanziell selbständige Kantonale Netzwerke als Ziel bis 2010 – 17<br />
Ressourcen<br />
7. Netzwerkschulen: Zwei Typen 17<br />
7.1 Programm-Schulen 18<br />
7.2 Alumni-Schulen 19<br />
- 2 -
8. Die Unterstützungsangebote für Fachstellen-Kantonale Netzwerke 19<br />
8.1 Information 19<br />
8.2 Beratung und Unterstützung bei der Initiierung Kantonaler 20<br />
Netzwerke<br />
8.3 Schriftliche Vereinbarungen 20<br />
8.4 Auszeichnung der Kantonalen Netzwerke mit einem Label 20<br />
8.5 Finanzielle Unterstützung 20<br />
8.6 Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Vernetzung 21<br />
8.7 Projektdatenbank/Dokumentation 21<br />
8.8 Impulstagungen 21<br />
8.9 Elektronischer Newsletter 22<br />
9. Die Unterstützungsangebote für Schulen 22<br />
9.1 Information, Beratung und Begleitung 22<br />
9.2 Schriftliche Vereinbarungen 22<br />
9.3 Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Vernetzung 23<br />
9.4 Website/Projektdatenbank 23<br />
9.5 Finanzielle Unterstützung 23<br />
9.5.1 Programmschulen 24<br />
9.5.2 Alumni-Schulen 25<br />
9.6 Auszeichnung der Schulen mit einem Label 25<br />
9.7 Dokumentation 25<br />
9.8 Impulstagungen 26<br />
9.9 Elektronischer Newsletter 26<br />
10. Kooperationen 26<br />
11. Projektorganisation 27<br />
- 3 -
1. Ausgangslage<br />
1992 haben die WHO, der Europarat und die Europäische Kommission gemeinsam<br />
das Projekt «Europäisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen» (ENHPS)<br />
lanciert. Die Schweiz beteiligt sich seit 1993 daran. Das Projekt basiert auf der<br />
konzeptionellen Grundlage der Ottawa-Charta.<br />
Für das Setting Schule wurden die Ziele der 5 Handlungsebenen wie folgt definiert:<br />
Personen<br />
Gruppe<br />
Organisation<br />
Umfeld - Lebenswelt<br />
Gesellschaft<br />
Persönlichkeitsstärkung, lifeskills, Resilienz<br />
Teambildung, Kooperationen<br />
Schulentwicklung Richtung Gesundheitsförderndes Profil<br />
Öffnung der Schule in die Gemeinde, Vernetzung mit<br />
Fachstellen und Experten<br />
Lobbying und Entwicklung einer Policy für das Setting<br />
Schule<br />
Nach dem salutogenetischen Ansatz sollen Schulen unter Mitwirkung aller<br />
Beteiligten ihre Organisation so gestalten, dass die Schule ein Ort ist:<br />
• wo Gesundheit gefördert wird,<br />
• wo persönliche Gesundheitspotenziale aller Beteiligten entwickelt werden,<br />
• wo gemeinschaftliche Problemlösungskapazitäten gefördert werden,<br />
• wo Gesundheitsrisiken thematisiert und eliminiert werden,<br />
• wo sich alle Beteiligten wohl fühlen und damit die besten Voraussetzungen für<br />
eine gute Leistungserbringung haben.<br />
RADIX Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und<br />
Prävention (RADIX) koordiniert und moderiert das Schweizerische Netzwerk<br />
RADIX unterstützt gesundheitsfördernde Aktivitäten in Gemeinden und Schulen und<br />
die Umsetzung nationaler Programme auf lokaler Ebene. Die Verbindung der<br />
verschiedenen Settings und Akteurinnen und Akteure ist die Grundlage des<br />
Arbeitsansatzes von RADIX. In diesem Rahmen beteiligt sich RADIX an<br />
Meinungsbildungsprozessen mit fachlicher Perspektive. RADIX orientiert sich an<br />
den Grundsätzen der Ottawa-Charta und verbessert die Qualität seiner Arbeit<br />
kontinuierlich. (www.radix.ch)<br />
1996 hat das Bundesamt für Gesundheit RADIX mit der Erarbeitung eines neuen<br />
<strong>Konzept</strong>es für das SNGS betraut und 1997 für die Dauer von 4 Jahren mit dessen<br />
Umsetzung beauftragt. 2001 wurde der Auftrag für weitere 4 Jahre verlängert und<br />
als neuer Partner konnte Gesundheitsförderung Schweiz gewonnen werden. Seit<br />
2002 arbeitet das SNGS mit und wurde auf 1.01.2008 mit dessen Koordination<br />
beauftragt. von bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz (www.bildungundgesundheit.ch).<br />
- 4 -
2. Erfahrungen der Jahre 1997 - 2007<br />
Netzwerkschulen<br />
Ende Februar 2008 gehören dem Netzwerk schweizweit 731 Schulen mit insgesamt<br />
156’603 SchülerInnen und 18’190 Lehrpersonen an. Die Schulen arbeiten nach<br />
einer Standortbestimmung, der Aushandlung von Zielen und der Errichtung einer<br />
schulinternen Projektstruktur an einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen<br />
Massnahmenplan. Zwischen Netzwerkmoderation und Schule besteht eine<br />
schriftliche Vereinbarung, in der die gegenseitigen Pflichten und Rechte<br />
festgehalten sind. Auf der Schulseite sind dies: Umsetzung der Massnahmen zur<br />
Erreichung der Ziele, jährliche Berichterstattung, Teilnahme an zwei<br />
Erfahrungsaustauschtreffen pro Jahr und Überprüfen der Zielerreichung nach 3<br />
Jahren. Von Seite der Netzwerkmoderation werden den Schulen folgende Angebote<br />
gemacht: Beratung und Begleitung, strukturierter und bedürfnisorientierter<br />
Erfahrungsaustausch, finanzielle Unterstützung, Ausstattung mit Dokumenten,<br />
vierteljährlicher Newsletter, Zugang zu europäischen Projekten, kostenlose<br />
Teilnahme an den jährlichen, öffentlichen Impulstagungen und Auszeichnung der<br />
Schule mit einem Label.<br />
Programmschwerpunkte der Netzwerkschulen:<br />
Körperliche Gesundheit<br />
Körperliche Gesundheit allgemein<br />
Ernährung<br />
Bewegung<br />
Entspannung<br />
Körperhaltung<br />
Sexualität<br />
Sicherheit<br />
Suchtprävention<br />
Unspezifische Suchtprävention<br />
Tabak<br />
Alkohol<br />
Cannabis<br />
Neue Technologien<br />
Essstörungen<br />
Psychische Gesundheit<br />
Psych. Gesundheit allgemein<br />
Konfliktfähigkeit<br />
Beziehungen/Freundschaft<br />
Selbstwertgefühl/Selbstbestimmung<br />
Stress<br />
Suizid/Selbstverletzung<br />
Verlust/Trauer<br />
Gewalt<br />
Wohlbefinden<br />
Strukturelle/Organisatorische Themen:<br />
Allg. strukturelles / organisat. Thema<br />
Zusammenarbeitsformen<br />
Teamkultur<br />
Arealgestaltung<br />
Leitbild<br />
Curriculum<br />
Soziale Gesundheit<br />
Soziale. Gesundheit allgemein<br />
Kommunikation<br />
Umgang miteinander/Zusammenarbeit<br />
Respekt + Toleranz<br />
Integration<br />
- 5 -
Nebst den Netzwerkschulen profitieren rund weitere 3'000 interessierte Personen<br />
aus dem Gesundheits- und Bildungssektor von den Dienstleistungen des SNGS.<br />
Kantonale Netzwerke<br />
Aufgrund der grossen Anzahl von Netzwerkschulen hat die Trägerschaft im August<br />
2001 als einen der strategischen Schwerpunkte die Kantonalisierung des SNGS<br />
definiert und Kriterien für die Anerkennung Kantonaler Netzwerke als Teile des<br />
SNGS festgelegt. Im Februar 2008 arbeiten nebst den zwei SNGS-sprachregionalen<br />
Netzwerken 9 Kantonale Netzwerke nach dem <strong>Konzept</strong> des SNGS: Stadt Bern,<br />
Kanton Thurgau, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Tessin, das<br />
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, Kanton Zürich, Kanton<br />
Genf, Kanton Luzern. Ingesamt werden im Februar 2008 224 Schulen durch<br />
Kantonale Netzwerkkoordinationen betreut.<br />
Erkenntnisse und Ergebnisse<br />
Die wichtigsten Erfahrungen der letzten 10 Jahre lassen sich wie folgt<br />
zusammenfassen:<br />
1. Im Verlauf der Jahre haben sich die Themen schwerpunktmässig vom<br />
somatischen in den psychosozialen Bereich verschoben.<br />
2. Nach einer ausschliesslichen Orientierung an der Schülergesundheit in den<br />
ersten Jahren haben die Schulen vermehrt auch an Zielen zugunsten der<br />
Lehrergesundheit gearbeitet.<br />
3. Die Gesundheitsförderung hat sich bestens in die Schulentwicklung eingepasst.<br />
Günstig wirkten sich in den meisten Kantonen die Verbindung der<br />
Gesundheitsförderung mit der Erarbeitung von Leitbildern und<br />
Jahresprogrammen aus. Die Gesundheitsförderung wird von den Schulen<br />
zunehmend als Mehrwert und nicht als ein additives Programm wahrgenommen.<br />
4. In 10 Kantonen ist die Kantonalisierung auf fruchtbaren Boden gestossen. Es<br />
konnten Ressourcen für die Kantonalen Netzwerke generiert werden.<br />
5. Das Netzwerk als Unterstützungssystem ist gut bekannt und deckt ein Bedürfnis<br />
bei den Schulen ab.<br />
6. Die Gesundheitsfördernde Schule wird zunehmend bei der Entwicklung von<br />
spezifischen Fragestellungen im Bereich Qualitätsentwicklung durch<br />
Gesundheitsförderung als Referenzmodell beigezogen.<br />
3. Theoretische Herleitung und Begründung des Ansatzes der<br />
Gesundheitsfördernden Schule<br />
Das Schweizerische Netzwerk als Teil des European Network of Health Promoting<br />
Schools (ENHPS) orientierte sich bei Beginn der Aufbauarbeit am <strong>Konzept</strong>ansatz<br />
des Europäischen Referenzmodells der WHO, suchte aber bereits nach drei Jahren<br />
Anknüpfungspunkte an die Schulqualitätsdiskussion, um Gesundheitsförderung mit<br />
- 6 -
Schulentwicklung zu verbinden. Diese Anstrengungen wurden in den letzten Jahren<br />
noch verstärkt. Für die vorliegende <strong>Konzept</strong>ion wurden zentrale Aspekte des<br />
Referenzmodells der WHO mit jenen der Schulentwicklung, der Schulqualität und<br />
der Schuleffektivität verknüpft. Aus der Koppelung von Gesundheitsförderung,<br />
Schulentwicklung und Qualitätsentwicklung ergibt sich ein integrales <strong>Konzept</strong>,<br />
welches eine hohe Anschlussfähigkeit an die aktuellen Fragestellungen des<br />
Bildungssektors hat und den Anforderungen an die gute Schule Rechnung trägt.<br />
Mit dem Anspruch, die Schulqualität positiv zu beeinflussen, begibt sich die<br />
Gesundheitsförderung direkt in den Kernbereich der Schul- und<br />
Unterrichtsentwicklung. Zwischen der durch die Gesundheitsförderung angeregten<br />
Schulentwicklung und der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages einer<br />
Schule ergibt sich eine Schnittstelle, die im Qualitätsmanagement einer Schule<br />
bewusst bearbeitet werden muss. Gesundheitsförderung wird im Idealfall ins<br />
Qualitätsmanagement einer Schule integriert. Gesundheitsfördernde Schulen tragen<br />
zu einer guten Schule bei, indem sie die Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsund<br />
Lernbedingungen nicht nur als Ziel der Gesundheitsförderung ansehen,<br />
sondern als Grundlage für alle Lern- und Lehrprozesse.<br />
Qualitätsdimensionen und -merkmale der schulischen Gesundheitsförderung und<br />
Prävention wurden von Brägger und Posse (2007) im Auftrag von b+g erarbeitet.<br />
Die SNGS-Instrumente wurden dem Stand der Entwicklung angepasst.<br />
3.1 Das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen –<br />
Das Referenzmodell der WHO<br />
Die Schweiz beteiligt sich seit Januar 1993 (Kontrakt vom 17.12.1993) am<br />
Europäischen Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen (ENHPS) und hat sich<br />
verpflichtet, den Ansatz der Gesundheitsfördernden Schule auf der Basis der<br />
länderspezifischen Bedingungen zu implementieren. Nach einer dreijährigen<br />
Pilotphase wurde das <strong>Konzept</strong> der Gesundheitsfördernden Schule 1996 überprüft<br />
und in einen Ansatz überführt, der die Interessen der Gesundheit mit denjenigen der<br />
Bildung verbindet, ohne noch genau benennen zu können, welche wechselseitigen<br />
positiven Effekte zu erwarten sind. Die Zielsetzungen der Gesundheitsfördernden<br />
Schule definiert die WHO wie folgt (vgl. WHO, 1999):<br />
• Klärung der sozialen Zielsetzung der Schule und Betonung ihres<br />
gesundheitsförderlichen Potentials;<br />
• Förderung der Verantwortung für die Gesundheit des Einzelnen, der Familie und<br />
der Gemeinschaft;<br />
• Förderung der Selbstachtung aller SchülerInnen, so dass sie imstande sind, ihr<br />
physisches, psychisches und soziales Potential auszuschöpfen;<br />
• Schaffung guter inner- und ausserschulischer Beziehungen;<br />
• Ausschöpfung des Potentials spezialisierter und anderer ausserschulischer<br />
Angebote, die Gesundheitsförderung und gesundheitsförderliche Massnahmen<br />
beratend und aktiv unterstützen können;<br />
• Planung eines kohärenten gesundheitserzieherischen Schulprogramms;<br />
• ein Angebot realistischer und attraktiver gesundheitlicher Alternativen, die zu<br />
einer gesunden Lebensweise anregen;<br />
- 7 -
• Schaffung einer sicheren und gesunden Umwelt (Ernährungsangebote, Gebäude,<br />
Spielplätze, Freizeiteinrichtungen usw.).<br />
Die Resolution von Thessaloniki<br />
Nebst diesen Zielsetzungen haben die Teilnehmenden der ersten Europakonferenz<br />
des ENHPS in Thessaloniki eine Resolution «Die Gesundheitsfördernde Schule –<br />
eine Investition in Bildung, Gesundheit und Demokratie» verabschiedet, die auf der<br />
Ebene der Prozessqualität Handlungsprinzipien für die Gesundheitsfördernde<br />
Schule definiert (WHO 1999). Für die schweizerische Umsetzung relevant sind:<br />
• Demokratie: Die Gesundheitsfördernde Schule gründet sich auf demokratischen<br />
Prinzipien, die das Lernen, die persönliche und soziale Entwicklung und die<br />
Gesundheit fördern.<br />
• Chancengleichheit: Die Gesundheitsfördernde Schule gewährleistet, dass das<br />
Prinzip der Chancengleichheit in die Lernerfahrung eingebettet ist. Sie bietet<br />
allen einen chancengleichen Zugang zu allen Bildungsmöglichkeiten. Ziel ist die<br />
emotionale und soziale Entwicklung des einzelnen zu fördern und ihm eine<br />
diskriminationsfreie Selbstverwirklichung zu ermöglichen.<br />
• Befähigung zum selbstbestimmten Handeln: Die Gesundheitsfördernde Schule<br />
fördert die Fähigkeiten zu handeln und Veränderungen zu bewirken. Sie bietet<br />
den SchülerInnen einen Rahmen, in dem sie in der Zusammenarbeit mit ihren<br />
LehrerInnen und anderen das Gefühl gewinnen können, etwas geleistet zu<br />
haben. Erreicht wird das durch gute Bildungskonzepte und -methoden mit der<br />
Möglichkeit einer Teilnahme an kritischer Entscheidungsfindung.<br />
• Lehrplan: Der Lehrplan einer gesundheitsfördernden Schule bietet die<br />
Möglichkeit, Wissen und Einsicht zu gewinnen und sich die für das persönliche<br />
Leben wesentlichen Fähigkeiten anzueignen.<br />
• LehrerInnen-Aus- und -Weiterbildung: Die LehrerInnen-Aus- und -Weiterbildung<br />
für die Ziele der Gesundheitsfördernden Schule ist nicht nur eine Investition in<br />
Gesundheit, sondern auch in Bildung.<br />
• Schulisches Umfeld: Die Gesundheitsfördernde Schule sieht im physischen und<br />
sozialen schulischen Umfeld einen wesentlichen Faktor für die Förderung und<br />
Erhaltung von Gesundheit.<br />
• Gemeinschaften: Eltern und Schulgemeinschaft spielen bei der Durchsetzung<br />
des <strong>Konzept</strong>es der schulischen Gesundheitsförderung eine entscheidende Rolle.<br />
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit stellen Schulen, Eltern, nichtstaatliche<br />
Organisationen und die Gemeinschaft vor Ort eine starke, positive<br />
Veränderungen bewirkende Kraft dar.<br />
3.2 Die gute Schule – Schulethos – Das Referenzmodell der<br />
Schuleffektivitätsforschung<br />
In internationalen Fachkreisen besteht ein Konsens über die wichtigsten<br />
Qualitätsmerkmale einer guten Schule (Posch/Altrichter, www.qis.at, BMUK, Wien<br />
1999). Für den Ansatz der Gesundheitsfördernden Schule erachten wir die<br />
folgenden als relevant:<br />
- 8 -
• Orientierung an hohen, allen bekannten fachlichen und überfachlichen<br />
Leistungsstandards: positive Leistungserwartung und intellektuelle<br />
Herausforderung<br />
• Hohe Wertschätzung von Wissen und Kompetenz<br />
• Mitsprache und Verantwortungsübernahme durch SchülerInnen<br />
• Wertschätzende Beziehungen zwischen Leitung, LehrerInnen und SchülerInnen<br />
• Aushandlung und konsequente Handhabung von Regeln: Berechenbarkeit des<br />
Verhaltens<br />
• Reichhaltiges Schulleben und vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten für LehrerInnen<br />
und SchülerInnen<br />
• Eine kooperative, aber deutlich wahrgenommene und zielbewusste Schulleitung<br />
• Zusammenarbeit und Konsens im Kollegium<br />
• Einbezug der Eltern<br />
• Schulinterne Lehrerweiterbildung<br />
Gemeinsam mit der Gesundheitsförderung kommt die Schuleffektivitätsforschung<br />
zum Schluss, dass das Ethos einer Schule – ein Konglomerat von<br />
Prozessmerkmalen, gelebtem Leitbild, Philosophie des Zusammenlebens – mit der<br />
Qualität der Schule in der Regel in engerem Zusammenhang steht als viele Input-<br />
Faktoren. Gesundheitsförderung legt ihren Schwerpunkt deshalb stark auf die<br />
Prozess- und Outcomequalitäten.<br />
4. Die Gesundheitsfördernde Schule – Das Referenzmodell des SNGS<br />
Das SNGS arbeitet mit einem strukturellen Ansatz, der es ermöglicht, dass Schulen<br />
selbstbestimmt Prozesse initiieren und dafür vom SNGS die nötige Unterstützung<br />
bekommen. Für diesen settingbezogenen Ansatz muss die Definition der guten<br />
gesunden Schule von bildung+gesundheit mit weiteren Merkmalen ergänzt werden.<br />
4.1 Definition<br />
Die Gesundheitsförderung bringt ihre Anliegen in die Entwicklung der Schule und<br />
des Unterrichtes ein und beeinflusst so deren Qualität: «Gesundheit macht eine<br />
Differenz, die einen Qualitätssprung bedeutet.» (Peter Paulus, Schulische<br />
Gesundheitsförderung – vom Kopf auf die Füsse gestellt, anschub.de 2003)<br />
Bei der Entwicklung der Schule in Richtung Gesundheitsfördernder Schule müssen<br />
die Qualitätsansprüche des Bildungs- mit denjenigen des Gesundheitssektors<br />
gekoppelt werden. Diese Verbindung liegt nicht (allein) im Interesse des<br />
Gesundheitssektors. Vor allem der Bildungssektor profitiert davon: Wer Leistung<br />
fordert, muss Gesundheit fördern (Peter Paulus, anschub.de 2003).<br />
Eine Reihe von Studien beweisen diese Komplementarität. So zeigt zum Beispiel<br />
Lyndal Bond u.a. in der Gatehouse-Studie, dass das Commitment einer<br />
- 9 -
Schulgemeinschaft zur Problembewältigung nicht lediglich den Cannabiskonsum<br />
senkt, sondern dass darüber hinaus auch bedeutsame Qualitätsbereiche wie<br />
Schulkultur und Ethos positiv beeinflusst werden (Lyndal Bond: Long-term of the<br />
Gatehouse Project on Cannabis Use of 16-Year-Olds in Australia, in Journal of<br />
School Health, 1/04 S. 23 - 29).<br />
Auch Vuille kommt in seiner Evaluation der Gesundheitsteams an den Stadtberner<br />
Schulen zum Ergebnis, dass in Schulen mit gutem Schulklima nicht nur das<br />
gesundheitliche Verhalten der SchülerInnen besser ist sondern auch deren<br />
Lernerfolg (Vuille, J.-C.: Die gesunde Schule im Umbruch, Bern 2004).<br />
Nebst der Verbindung von Gesundheitsförderung mit dem Qualitätsmanagement<br />
einer Schule erachten wir die drei Handlungsprinzipen der Ottawa-Charta –<br />
Partizipation/Empowerment, Chancengleichheit und Orientierung an den<br />
Ressourcen - als bedeutsam für die Umsetzung der Gesundheitsfördernden Schule.<br />
Sie betreffen die Prozess- und Outputqualität.<br />
Durch die Integration des Ansatzes in die Schulentwicklung und das<br />
Qualitätsmanagement, gepaart mit den Handlungsprinzipien der Ottawa-Charta,<br />
bewirkt die Gesundheitsfördernde Schule einen Mehrwert für die einzelne Schule,<br />
aber auch für das Bildungssystem selber.<br />
Die Definition der Gesundheitsfördernden Schule durch das SNGS dient den<br />
Schulen und Fachstellen dabei als Orientierungshilfe für die Profilentwicklung und<br />
die Rechenschaftslegung. Damit garantiert sie auch die Anschlussfähigkeit an die<br />
Qualitätsziele des Bildungsbereiches.<br />
«Die Gesundheitsfördernde Schule setzt sich explizit mit Themen der<br />
Gesundheitsförderung auf allen Ebenen des Schulgeschehens (Unterricht, Team,<br />
Schulorganisation, Vernetzung, Curriculum) auseinander und verpflichtet sich zu<br />
entsprechenden Massnahmen. Damit trägt sie zur Verbesserung der Bildungs- und<br />
Schulqualität und zur Entfaltung und Förderung der Gesundheit und des<br />
Wohlbefindens aller an der Schule Beteiligten bei.<br />
Sie orientiert sich dabei an einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff und richtet ihre<br />
Arbeit nach den Prinzipien der Gesundheitsförderung gemäss Ottawa Charta aus:<br />
Partizipation, Befähigung zum selbst bestimmten Handeln, Ressourcenorientiertheit,<br />
Langfristigkeit und Chancengleichheit bezüglich Geschlecht, sozialer, ethnischer<br />
und religiöser Herkunft.»<br />
4.2 Handlungsprinzipien<br />
Nebst dem Referenzrahmen «Qualität» sind die Handlungsprinzipien der Ottawa-<br />
Charta wichtige Grundsteine für die Arbeit der Schulen wie auch für die Arbeit der<br />
Fachstellen mit den Schulen.<br />
4.2.1 Partizipation und Empowerment<br />
Wie bereits andere Studien zur Wirkung von Partizipation und Empowerment (Vuille,<br />
Althof «just community») belegen, weist auch das Ludwig Boltzmann-Institut für<br />
Medizin- und Gesundheitssoziologie der Universität Wien in seiner Untersuchung<br />
«Partizipative Strukturen in der Schule und die Gesundheit von Jugendlichen im<br />
Alter von 11, 13 und 15 Jahren. Endbericht 2002» eine positive Wirkung von<br />
- 10 -
Partizipation und Empowerment auf die Gesundheit der SchülerInnen nach. Ein<br />
positives Schul- und Klassenklima (Ebene der Schule) sowie die Förderung des<br />
Kohärenzsinns und der Selbstwirksamkeit der SchülerInnen (Ebene der<br />
Persönlichkeit) wirken sich stark auf die Gesundheit der SchülerInnen aus. Der<br />
Einfluss der Schule ist laut dieser Studie im Vergleich mit der Familie, der Peer-<br />
Gruppen und der sozialen Schicht vergleichsweise gross und von diesen<br />
unabhängig. Damit sich dieses Potential im Sinne des Empowerments positiv<br />
auswirken kann, müssen Schulen über eine partizipative Struktur verfügen, die sich<br />
durch folgende Merkmale auszeichnet:<br />
• Die Schulleitung versteht sich als stark führend, aber nicht als autoritär. Sie<br />
nimmt ihre Aufgaben vor allem als «Prozessprovider» auf der Beziehungsebene<br />
wahr.<br />
• Die Lehrpersonen haben als Gruppe weit reichende Gestaltungsmöglichkeiten in<br />
Bezug auf das Unterrichten, identifizieren sich stark mit der Schule und<br />
entwickeln diese mit.<br />
• SchülerInnen tragen Verantwortung für die Angelegenheiten der Klasse oder<br />
auch der ganzen Schule. Sie teilen mit den Lehrpersonen die Verantwortung für<br />
ihren Lernerfolg, nutzen zur Wahrnehmung dieser Verantwortung die Freiräume<br />
sowie die soziale und lerntechnische Unterstützung der Lehrpersonen.<br />
• Die Eltern kennen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und arbeiten in Gruppen an der<br />
Entwicklung der Schule mit.<br />
4.2.2 Gesundheitliche Chancengleichheit – Gender, soziale, religiöse und<br />
ethnische Herkunft<br />
Studien im Bildungs- und Gesundheitsbereich zeigen deutlich einen<br />
Zusammenhang zwischen Geschlecht, sozialer Herkunft, Gesundheitsverhalten und<br />
Schulerfolg. Die Gesundheitsfördernde Schule will die Schule als Lern- und<br />
Arbeitsort so gestalten, dass sich darin alle Beteiligten wohl fühlen und die<br />
bestmöglichen Leistungen erbringen können.<br />
Aus den Forschungsergebnissen wissen wir, dass gesundheitsbezogene<br />
Interventionen – auch im Setting Schule – nur dann erfolgreich sind, wenn sie sich<br />
an spezifischen Zielgruppen ausrichten (Petra Kolip, Geschlechtergerechte<br />
Gesundheitsförderungspraxis, in: Prävention 4/2003 S. 207). Wie wichtig die<br />
Differenzierung nach Geschlecht und sozialer Schicht im Setting Schule ist, zeigen<br />
diverse Studien: Vera (EDK 1992), SMASH (2002), Buddeberg (1996), Gender<br />
Mainstreaming Leonardo Programm (2001), TIMSS (1998), NFP43 «Bildung und<br />
Beschäftigung». Hier einige ausgewählte Ergebnisse:<br />
• Ausserschulische Erfahrungen von Mädchen werden im Unterricht weniger<br />
berücksichtigt als solche von Jungen.<br />
• Lehrprsonen gehen auf innovative Vorschläge von Mädchen weniger ein als auf<br />
solche von Jungen.<br />
• 25% der Mädchen und 7% der Knaben haben ein deutlich gestörtes<br />
Essverhalten.<br />
• Mädchen werden öfters für schlechte Leistungen getadelt, Jungen für schlechtes<br />
Verhalten.<br />
- 11 -
• 40% der Mädchen und 18% der Knaben sind mit ihrem Aussehen und ihrem<br />
Körper unzufrieden und dies unabhängig vom Alter und Ausbildungstyp.<br />
• Vor allem engagierte Lehrer kehren der Schule den Rücken. Der Anteil der<br />
männlichen Lehrpersonen nimmt stetig ab. Es findet eine immer stärkere<br />
Feminisierung der Schule statt.<br />
• Die weiblichen, älteren Schülerinnen rauchen häufiger als ihre Kollegen.<br />
• Je höher die soziale Schicht desto niedriger der Anteil adipöser SchülerInnen.<br />
• Jungen haben tendenziell schlechtere Schulresultate und haben häufiger<br />
Lernschwierigkeiten.<br />
• Bei durchschnittlichen Schulleistungen treten 83% der Schweizer Mädchen, 70%<br />
der Schweizer Jungen, 65% der ausländischen Mädchen und 37% der<br />
ausländischen Jungen an die Sekundarschule über.<br />
• Je grösser die Unterschiede bezüglich Ethnie und Religion im Vergleich zu den<br />
schweizerischen sind, desto höher ist das Risiko der Kinder in die unteren<br />
Schulniveaus eingeteilt zu werden.<br />
• Mädchen weisen zwar bessere Schulleistungen auf, was sich jedoch im späteren<br />
beruflichen Erfolg nicht niederschlägt.<br />
Sowohl die ENHPS-Thessaloniki Resolution von 1997 wie die Ottawa-Charta von<br />
1986 beschreiben als Ziel des gesundheitsfördernden Handelns, bestehende<br />
soziale Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern. Zudem soll die<br />
Gesundheitsförderung dazu beitragen, Möglichkeiten und Voraussetzungen zu<br />
schaffen, damit alle Menschen befähigt werden, ihr grösstmögliches<br />
Gesundheitspotential zu verwirklichen. Dies umfasst sowohl Geborgenheit und<br />
Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen Umwelt, den Zugang zu allen<br />
wesentlichen Informationen und die Entfaltung von praktischen Fertigkeiten als auch<br />
die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug auf die persönliche Gesundheit<br />
treffen zu können. Menschen können ihr Gesundheitspotential nur dann<br />
weitestgehend entfalten, wenn sie auf die Faktoren, die ihre Gesundheit<br />
beeinflussen, auch Einfluss nehmen können.<br />
Schulen sind keine neutralen Organisationen, sondern in den meisten Fällen dem<br />
schweizerischen Mittelmass verpflichtet. Die Schule ist ein Ort, wo soziale und<br />
geschlechtsspezifische Rollen hergestellt und eingeübt werden. Durch die Haltung<br />
der Schulakteure kann diese Rollengestaltung traditionell (z.B. hierarchische<br />
Bewertung der Tätigkeiten von «Mann – Erwerbsarbeit» und «Frau – Hausarbeit»)<br />
oder bewusst im Sinne der Pädagogik der Vielfalt (z.B. durch ausgewogenes<br />
Geschlechterverhältnis auf der Leitungsebene sowie Anstellungen von<br />
Lehrpersonen unterschiedlicher Ethnien) beeinflusst werden. Eine Schule kann<br />
neue Formen des Zusammenlebens durch ein Klima der Offenheit für verschiedene<br />
Lebensentwürfe unterstützen und so stereotypes Verhalten vermindern.<br />
Die Gesundheitsfördernde Schule bemüht sich um eine Pädagogik der Vielfalt:<br />
• Sie anerkennt, dass Chancengleichheit durch Gleichbehandlung allein nicht<br />
erreicht werden kann.<br />
- 12 -
• Sie achtet drauf, dass die Vielfalt der Mitglieder der Schule in der Steuergruppe<br />
und bei der Besetzung von Leitungsfunktionen für die Projekte abgebildet ist.<br />
• Sie prüft ihre Vorhaben und Projekte darauf hin, welche Aspekte der Kategorie<br />
Geschlecht und soziale Herkunft eine Rolle spielen.<br />
• Sie reflektiert die Methoden kritisch darauf hin, ob sie Mädchen/Lehrerinnen oder<br />
Jungen/Lehrer ansprechen.<br />
• Sie überprüft, ob die mit dem Projekt verbundenen Werte und Normen von der<br />
Zielgruppe aufgenommen werden können (soziale Relevanz der Ziele).<br />
• Sie prüft, ob die Projekte geschlechterspezifisch oder gemischt durchgeführt<br />
werden sollen.<br />
• Sie wertet ihre Arbeit unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf beide<br />
Geschlechter und die soziale Herkunft aus.<br />
4.2.3 Salutogenese – Stärken der Ressourcen<br />
Das <strong>Konzept</strong> der Salutogenese (vgl. Antonovskys Gesundheits-<br />
Krankheitskontinuum, 1997) interessiert sich dafür, wie Gesundheit erhalten,<br />
gefördert und gestärkt werden kann, damit sich das Individuum auf dem<br />
Gesundheits-Krankheitskontinuum in Richtung des gesunden Pols bewegt.<br />
Übertragen auf die Schulen bedeutet dies, sich zu fragen, was die Schule<br />
verbessern oder zusätzlich unternehmen muss, damit sich alle Schulbeteiligten auf<br />
diesen Pol hin bewegen können. Es geht um Fragen von Energie, Aktivität,<br />
Lebensfreude, Kreativität, Motivation, Leistung, Zusammenarbeit, Zugehörigkeit,<br />
positive Gefühle, Ausdauer, Sinnhaftigkeit und damit auch um die Frage nach den<br />
vorhandenen Ressourcen sowohl auf individueller wie organisationaler Ebene.<br />
Das Ressourcenmodell definiert Ressourcen als personale Fähigkeiten und<br />
strukturelle Voraussetzungen, die es ermöglichen, Situationen im gewünschten Sinn<br />
zu beeinflussen. Bezogen auf die Gesundheitsfördernde Schule ergeben sich<br />
daraus Kriterien auf 3 Handlungsebenen:<br />
• Ebene der personalen Ressourcen: Kompetenzen, Selbstkonzept, Selbstwert,<br />
Situationskontrolle, Selbstwirksamkeit, Einstellungen, Haltungen, Bewusstsein.<br />
• Ebene der organisationalen Ressourcen: Anforderungsvielfalt, Partizipation,<br />
Handlungsspielräume, Beeinflussungsmöglichkeiten.<br />
• Ebene der sozialen Ressourcen: Unterstützung durch andere Personen oder<br />
Systeme, Zugehörigkeitsgefühl, Eingebundensein.<br />
5. Hauptstrategie 2008 - 2010<br />
Nach 10 Jahren der direkten Arbeit mit den einzelnen Schulen und dem Aufbau<br />
einiger Kantonaler Netzwerke wird der Fokus ab 2008 auf die Implementierung und<br />
Verankerung in den Regionen und Kantonen gelegt. Um eine Breitenwirkung zu<br />
erzielen, sollen möglichst viele Kantonale Netzwerke als Unterstützungssysteme für<br />
- 13 -
Schulen entstehen. Zur Erreichung dieses Zieles richtet RADIX seine Angebote<br />
schwerpunktmässig auf zwei Zielgruppen aus:<br />
a) Fachstellen in den Kantonen – mit dem Ziel, diese für die Schaffung Kantonaler<br />
Netzwerke zu gewinnen.<br />
b) Schulen – in Regionen wo es noch keine Kantonalen Netzwerke gibt.<br />
Über die Gesamtdauer 2008 - 2010 sind die SNGS-Dienstleistungen zu 2/3 für die<br />
Kantone und zu 1/3 für die Schulen konzipiert. Aus heutiger Sicht sollen sich die<br />
Dienstleistungen des SNGS ab 2010 auf die Koordination und Unterstützung<br />
Kantonaler Netzwerke beschränken.<br />
Zielgruppenspezifische Ausrichtung 2008 - 2010<br />
Schulen<br />
Kantonale<br />
Netzwerke<br />
1997 2001 2005 2007 2010<br />
Ziel der Kantonalisierung ist die Gewinnung der Kantone bzw. der Regionen für die<br />
Schaffung eigener Unterstützungssysteme für die Schulen, so dass das SNGS sich<br />
längerfristig aus der direkten Arbeit mit den Schulen zurückziehen und sich auf die<br />
Unterstützung und Koordination der Kantonalen Netzwerke beschränken kann. Bis<br />
2010 sollen 75% aller Kantone mit Kantonalen Netzwerken abgedeckt sein. Für die<br />
Schulen aus den übrigen Kantonen muss auf 2010 hin geprüft werden, ob ein<br />
gemeinsames „Restnetzwerk“ weiter betrieben werden kann.<br />
5.1 Das SNGS – Ein Unterstützungssystem für Schulen und Fachstellen<br />
Netzwerke umfassen Mitglieder aus demselben Setting, mit vergleichbaren<br />
Rahmenbedingungen und vergleichbaren Zielen. Sie haben Zugangskriterien,<br />
Beschreibungen von Rechten und Pflichten und kennen Ausschlusskriterien.<br />
Netzwerke bilden sich, um sich gegenseitig zu motivieren, sich auszutauschen, um<br />
voneinander zu lernen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Damit Netzwerke<br />
funktionieren brauchen sie eine Koordination und Moderation. Die<br />
Netzwerkkoordination unterstützt ihre Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer<br />
Rahmenbedingungen sowie ihres Veränderungsbedarfs und -potenzials.<br />
Das SNGS versteht sich als Dienstleistungserbringerin einerseits für Schulen, die<br />
sich intensiv und mit einer langfristigen Perspektive um ein Gesundheitsförderndes<br />
Profil bemühen und andererseits für Fachstellen bzw. Regionale Netzwerke, die<br />
- 14 -
ihrerseits in ihrem Gebiet ein Unterstützungssystem als Teil des SNGS aufbauen<br />
bzw. unterhalten.<br />
5.2 Generelle Ziele<br />
Mit unseren Angeboten wollen wir folgende generelle Ziele erreichen:<br />
Ebene der Schulen:<br />
• Schulen für ihre Aufgaben in der GF sensibilisieren.<br />
• Schulen zu Gesundheitsförderungs-Aktivitäten anregen.<br />
• Vorhandene Gesundheitsförderungs-Ansätze stärken.<br />
• Schulen dazu anregen, die Gesundheitsförderung mit ihrem<br />
Qualitätsmanagement zu verbinden.<br />
• Bereitschaft, Gesundheitsförderungs-Innovationen zu unterstützen.<br />
• Schulen einen Reflexionsraum für ihre Gesundheitsförderungs-Aktivitäten bieten.<br />
• Schulen für ihre Gesundheitsförderungs-Profilbildung belohnen.<br />
• Vernetzungsplattformen, Austausch und Lernfelder anbieten.<br />
Ebene der Fachstellen bzw. Kantonaler Netzwerke:<br />
• Schlüsselpersonen in der schulischen Gesundheitsförderung und<br />
Schulentwicklung in den Gemeinden, Kantonen und Regionen für die Idee der<br />
«Gesundheitsfördernden Schule» gewinnen.<br />
• Fachstellen bei der Initiierung Kantonaler Netzwerke unterstützen.<br />
• Kantonale Netzwerke mit Beratung, Austauschtreffen und Ressourcen<br />
unterstützen.<br />
6. Initiierung und Unterstützung Kantonaler Netzwerke<br />
In der <strong>Konzept</strong>ion 2001 - 04 hat die Trägerschaft als einen der strategischen<br />
Schwerpunkte das weitere Wachstum des Netzwerkes festgelegt. Gleichzeitig<br />
wurde die Anzahl der Schulen, die direkt durch die beiden sprachregionalen SNGS-<br />
Koordinationsstellen in Luzern und Lausanne betreut werden, auf maximal 200<br />
festgelegt. Damit aber weitere Schulen von einem entsprechenden<br />
Unterstützungsangebot profitieren können, wurde die Projektleitung beauftragt,<br />
Kantonale Netzwerke als Teile des SNGS zu initiieren und so die<br />
«Gesundheitsfördernde Schule» in Regionen und Kantonen zu verankern.<br />
6.1 Kriterien für die Anerkennung<br />
Um zu gewährleisten, dass die Kantonalen Netzwerke nach vergleichbaren<br />
Minimalstandards arbeiten, hat die Trägerschaft am 23.8.01 Kriterien für deren<br />
Arbeitsweise und die Anerkennung als Teil des SNGS erlassen:<br />
- 15 -
Der Kanton bzw. die Gemeinde beauftragt eine Stelle, ein Kantonales Netzwerk<br />
aufzubauen und zu koordinieren. Diese<br />
• richtet ihre Arbeit nach dem <strong>Konzept</strong> der «Gesundheitsfördernden Schule» aus,<br />
wie es im Leitfaden «Wir werden eine Gesundheitsfördernde Schule» (Zumstein,<br />
2001) beschrieben ist.<br />
• führt eine Supportstelle für Schulen: Begleitung, Beratung und<br />
Evaluationsunterstützung.<br />
• geht mit den Netzwerkschulen eine schriftliche Vereinbarung ein: mit mind. zwei<br />
Zielen für die Dauer von 3 Jahren.<br />
• betreibt Qualitätssicherung und legt Prozedere für die Überprüfung der<br />
Zielerreichung und für die Erneuerung der Vereinbarung fest.<br />
• bietet mind. zwei Erfahrungsaustauschtreffen pro Jahr an: Austausch und<br />
Weiterbildung.<br />
• dokumentiert die Arbeit der Netzwerkschulen.<br />
• berichtet jährlich dem Schweizerischen Netzwerk aufgrund eines Rasters.<br />
• unterstützt das nationale Netzwerk durch Synthesen und Beiträge.<br />
• kooperiert bei nationalen Evaluationen.<br />
• strebt langfristig die Äufnung eines Projektfonds für Schulen an.<br />
Im Gegenzug verpflichtet sich das SNGS zu einigen Dienstleistungen zur<br />
Unterstützung der Kantonalen Netzwerke. Das SNGS<br />
• organisiert einen jährlichen Erfahrungsaustausch für die Kantonalen Netzwerke<br />
auf nationaler Ebene.<br />
• tritt einen Anteil des Projektfonds an die Kantonalen Netzwerke ab.<br />
• erstellt auf Antrag der Kantonalen Netzwerkkoordination das Label für die<br />
Schulen «Mitglied im Schweizerischen Netzwerk Gesundheitsfördernder<br />
Schulen».<br />
• öffnet die Erfahrungsaustauschtreffen für die interessierten Schulen aus den<br />
Kantonalen Netzwerken.<br />
• organisiert jährlich eine nationale Impulstagung und bietet diese den Schulen aus<br />
den Kantonalen Netzwerken zu den gleichen Bedingungen an wie den Schulen<br />
aus dem Schweizerischen Netzwerk.<br />
Das Kantonale und das Schweizerische Netzwerk halten die vereinbarte<br />
Zusammenarbeit schriftlich fest und überprüfen sie ein Mal pro Jahr.<br />
Die stärkere Einbindung der Kantone in das SNGS ist wünschenswert. Für diesen<br />
Prozess verstärkt das SNGS die Zusammenarbeit mit den Dossierverantwortlichen<br />
Gesundheitsförderung EDK.<br />
- 16 -
6.2 Netzwerk der Netzwerke – Fachaustausch und Koordination<br />
Jährlich finden zwei Austauschtreffen der Kantonalen Netzwerke statt. Diese Treffen<br />
werden durch das SNGS organisiert und dienen der konzeptionellen,<br />
organisatorischen und qualitativen Weiterentwicklung der Gesundheitsfördernden<br />
Schule sowie der Netzwerkarbeit.<br />
6.3 Finanziell selbständige Kantonale Netzwerke als Ziel bis 2010<br />
Interessierte Kantone werden für die Initiierung eigener Netzwerke im Zeitraum<br />
2008 - 2010 weiterhin mit einer zweijährigen Anschubfinanzierung durch das SNGS<br />
unterstützt. Diese Strategie verfolgt mittelfristig das Ziel der finanziellen<br />
Selbständigkeit der Kantonalen Netzwerke und damit langfristig die Perspektive der<br />
Verankerung der Gesundheitsfördernden Schule in den Kantonen.<br />
Gemäss Stellungnahme der EDK vom August 2004 kann nicht davon ausgegangen<br />
werden, dass die Kantonalen Netzwerke als Unterstützungszentren von den<br />
Kantonen allein getragen werden können. Hier sind also zusätzliche Anstrengungen<br />
nötig. Auch wenn die Kantonalisierung bis 2010 erfolgreich abgeschlossen werden<br />
kann, wird es auf nationaler Ebene weiterhin eine Koordinationsstelle als<br />
Unterstützung für die Kantonalen Netzwerke und für die Sicherstellung der<br />
gemeinsamen Weiterentwicklung des Ansatzes der «Gesundheitsfördernden<br />
Schule» brauchen.<br />
7. Netzwerkschulen: Zwei Typen<br />
Interessierte Schulen können jederzeit dem Netzwerk beitreten, wenn sie die<br />
Voraussetzungen erfüllen. Dies führt dazu, dass im Netzwerk Schulen mit den<br />
unterschiedlichsten Entwicklungsstufen mitarbeiten. Es gibt Netzwerkschulen, die<br />
sich seit mehr als neun Jahre aktiv mit der Gestaltung ihrer Schule als gesundem<br />
Lern- und Arbeitsort auseinandersetzen und sehr viel erreicht und verankert haben.<br />
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schulen nach Unterstützung und Anleitung<br />
machen eine Aufteilung der Schulen im Sinne einer Binnendifferenzierung nötig.<br />
Wegleitend ist dabei folgende Strategie:<br />
• Die Schulen erhalten die ihrem Entwicklungsstand angepassten<br />
Unterstützungsformen.<br />
• Die Erfahrungen der «älteren» Netzwerkschulen sollen für das Netzwerk und<br />
seine Schulen nutzbar gemacht werden.<br />
• Durch eine erweiterte Selbstevaluation durch die «älteren» Netzwerkschulen<br />
sollen Erkenntnisse bezüglich Wirkungsfaktoren gewonnen werden.<br />
• Die Projektförderungsmittel des Netzwerkes sollen möglichst effizient für neue<br />
Schulen eingesetzt werden.<br />
• Durch die Binnendifferenzierung bekommt das SNGS die Möglichkeit, praktisch<br />
unbegrenzt wachsen zu können, was auch Voraussetzung für eine breite<br />
Kantonalisierung ist.<br />
- 17 -
Für die Umsetzung dieser Strategie wurden ab Juli 2005 neu zwei Typen von<br />
Netzwerkschulen definiert: Die Programm-Schulen und die Alumni-Schulen 1 . Beide<br />
Gruppen gehören dem Netzwerk der Gesundheitsfördernden Schulen an und halten<br />
ihre Ziele, Pflichten und Rechte in einer Vereinbarung fest. Als Zeichen der<br />
Netzwerkzugehörigkeit und um das schulhausinterne Commitment zur<br />
Gesundheitsförderung/Schulentwicklung sichtbar zu machen, verfügen alle Schulen<br />
über das Label «Wir sind auf dem Weg zur Gesundheitsfördernden Schule».<br />
Die Kantonalen Netzwerke – mit Ausnahme Volksschulen Zürich – arbeiten zurzeit<br />
nur mit einer Gruppe von Schulen, den «Programm-Schulen». Ob sie analog dem<br />
SNGS die Unterteilung in zwei Typen von Netzwerkschulen machen wollen<br />
(müssen), ist ihr Entscheid und dürfte abhängig sein von der Anzahl zu betreuenden<br />
Netzwerkschulen und ihren Ressourcen.<br />
7.1 Programm-Schulen<br />
Programm-Schulen sind Schulen, die während drei Jahren mit Unterstützung der<br />
SNGS-Angebote an dem auf ihre Schule hin massgeschneiderten Programm<br />
arbeiten. In einer Standortbestimmung mit Hilfe von SNGS-Tools oder anderen<br />
bewährten Instrumenten, erkennen Schulen ihre «blinden Flecken» und<br />
verständigen sich darüber, welche Massnahmen sie zur Verbesserung der<br />
Schulqualität im Sinne der Gesundheitsfördernden Schule treffen wollen. Sie<br />
definieren mindestens zwei Ziele, planen Massnahmen zur Zielerreichung und legen<br />
die Evaluation fest.<br />
Für die Aufnahme ins Netzwerk müssen die Schulen folgende Voraussetzungen<br />
erfüllen:<br />
• Standortbestimmung ist durchgeführt und Entwicklungsbedarf definiert.<br />
• Programm für drei Jahre ist festgelegt, Ziele sind formuliert.<br />
• Mehrheitsentscheid des Kollegiums liegt vor.<br />
• Zustimmung der Schulleitung und der Aufsichtsbehörden liegt vor.<br />
• Steuergruppe ist gewählt und mandatiert.<br />
• Teilnahme an zwei Erfa-Treffen (jeweils ganzer Mittwoch) von mindestens einer<br />
Person ist geregelt.<br />
• Bereitschaft, die Programme und Projekte auf der Homepage www.gesundeschulen.ch<br />
zu dokumentieren und spezielle Zusatzfragen der<br />
Netzwerkkoordination zu beantworten ist vorhanden.<br />
• In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Schule und dem SNGS werden alle<br />
Punkte festgehalten.<br />
Im Gegenzug profitieren die Schulen von:<br />
• Beratung und Unterstützung<br />
• Erfahrungsaustauschtreffen<br />
1<br />
Alumni-Schulen: Alumnus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet «der Zögling», wörtlich «der Genährte» (von alere, «ernähren»). Wir<br />
verwenden den Begriff sinngemäss für Netzwerkschulen, die seit ein paar Jahren Erfahrungen in der Gesundheitsförderung gesammelt und<br />
von den Dienstleistungen des SNGS profitiert haben. Diese «Ehemaligen» erhalten sowohl die Möglichkeit, ihre Kontakte zum Netzwerk zu<br />
pflegen und auszubauen, als auch die Optionen gemeinsam mit anderen Alumni an einer Fragestellung/einem Projekt zu arbeiten.<br />
- 18 -
• Tagungen<br />
• Dokumentation<br />
• Newsletter<br />
• finanzielle Projektunterstützung<br />
• Auszeichnung der Schule mit einem Label<br />
7.2 Alumni-Schulen<br />
Nach drei Jahren Netzwerkmitgliedschaft im Status einer Programmschule und der<br />
Auswertung der Ziele und erreichten Wirkungen, wechseln die Schulen in den<br />
Alumni-Status. Sie arbeiten weiter an ihrem Gesundheitsfördernden Profil, pflegen<br />
den Kontakt zum Netzwerk und den Netzwerkschulen. Das SNGS nutzt ihr<br />
Erfahrungspotential für die Optimierung seiner Angebote und für die<br />
Erfahrungsaustauschtreffen. Alumni-Schulen verpflichten sich, die Projektdatenbank<br />
auf www.gesunde-schulen.ch nachzuführen. Interessengeleitet können sie an den<br />
Erfa-Treffen der Programmschulen teilnehmen. Alumni-Schulen nehmen kostenlos<br />
an der jährlichen Impulstagung teil. In Ausnahmefälle können auch Schulen, die<br />
bisher nicht im Netzwerk mitarbeiteten, direkt Alumni-Schulen werden.<br />
Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Qualität bereits systematisch entwickeln und<br />
Aspekte der Gesundheitsförderung darin integriert haben.<br />
Wenn sich Alumni-Schulen eigenständig vernetzen, um in Gruppen von Netzwerk-<br />
Schulen voneinander zu lernen oder gemeinsame Projekte oder Instrumente zu<br />
erarbeiten, können sie einen finanziellen Beitrag seitens der Netzwerkmoderation<br />
für ihr Vorhaben bekommen. In begründeten Fällen können auch Schulprojekte<br />
finanziell unterstützt werden.<br />
8. Unterstützungsangebote Fachstellen – Kantonale Netzwerke<br />
8.1. Information<br />
Ziel: Alle kantonalen Fachstellen und Schlüsselpersonen für Gesundheitsförderung<br />
sollen kontinuierlich über die Arbeit des SNGS informiert sein und entwickeln<br />
dadurch eine Sensibilität für die Unterstützung der Schulen in ihrem Gebiet.<br />
Vorgehen: Das SNGS informiert die zuständigen Fachstellen und<br />
Schlüsselpersonen über jeden Netzwerkbeitritt einer Schule aus ihrem Gebiet und<br />
holt bei Bedarf auch deren Beratung und Expertise ein. Die Schlüsselperson erhält<br />
eine Kopie der Vereinbarung mit der Schule, weiss so über deren geplante<br />
Aktivitäten Bescheid und kennt die Anzahl der Schulen, die mit Unterstützung des<br />
SNGS an ihrem Profil arbeiten. Alle Gesuche der Netzwerkschulen für eine<br />
Projektfinanzierung werden den Schlüsselpersonen zur Begutachtung vorgelegt, so<br />
dass sie auch hierüber Bescheid wissen bzw. ihr Veto einlegen können. Mit diesen<br />
Massnahmen erreichte das SNGS bisher eine gute, langjährige Kooperation mit den<br />
Schlüsselpersonen. Diese Beziehungen müssen für die Kantonalisierung positiv<br />
genutzt werden.<br />
- 19 -
8.2 Beratung und Unterstützung bei der Initiierung Kantonaler Netzwerke<br />
Ziel: In Regionen mit mehr als 10 Netzwerkschulen sollen die Schlüsselpersonen für<br />
ein eigenes Kantonales Netzwerk gewonnen werden. Das SNGS stellt Beratung und<br />
Begleitung in diesem Prozess zur Verfügung.<br />
Vorgehen: Durch die Zusammenarbeit mit den Schlüsselpersonen kennt das SNGS<br />
die örtlichen, kantonalen Verhältnisse. Gemeinsam kann so die Strategie für das zu<br />
schaffende Kantonale Netzwerk festgelegt werden. In der Regel erarbeitet das<br />
SNGS zusammen mit den Fachstellen ein <strong>Konzept</strong>, welches dann durch die lokalen<br />
Verantwortlichen den zuständigen Stellen eingegeben wird. Das SNGS wirkt nach<br />
der <strong>Konzept</strong>definition nur noch unterstützend und überlässt den Lead den lokalen<br />
Schlüsselpersonen. Um die Autonomie der Kantone zu wahren und sie für die<br />
Rollenübernahme zu gewinnen, beschränkt sich das SNGS auf die Beratung der<br />
Schlüsselpersonen und gelangt nicht von sich aus an die zuständigen<br />
Entscheidungspersonen.<br />
8.3 Schriftliche Vereinbarungen<br />
Ziel: Mit der schriftlichen Vereinbarung zwischen Kanton und SNGS wird die<br />
Unterstützung für die Schulen im Kanton strukturell verankert und erhält eine hohe<br />
Verbindlichkeit.<br />
Vorgehen: Bis zur Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen SNGS und dem<br />
Kanton müssen die Kriterien der Anerkennung geklärt sein. Es muss eine Stelle mit<br />
den Pflichten für die Betreuung des Kantonalen Netzwerkes beauftragt und mit den<br />
nötigen Ressourcen ausgestattet sein. Dieser Prozess muss abgestimmt sein auf<br />
die kantonale Schulentwicklung und muss den Ansatz der «Gesundheitsfördernden<br />
Schule» in diese Eigenheiten integrieren. Die Prüfung, ob alle Kriterien erfüllt sind,<br />
dient als formale Klärungshilfe für Schlüsselpersonen in den Kantonen. Wenn<br />
bestimmte Kriterien noch nicht erfüllt werden, können das SNGS und der Kanton<br />
einen Zeithorizont bis zur Erfüllung vereinbaren. Die Zusammenarbeit wird jährlich<br />
überprüft und wenn nötig neu ausgehandelt.<br />
8.4 Auszeichnung der Kantonalen Netzwerke mit einem Label<br />
Ziel: Durch die Verwendung des Labels erhalten die Kantonalen Netzwerke für ihre<br />
Arbeit eine nationale Abstützung und erfahren so eine Aufwertung der<br />
Wahrnehmung ihrer Arbeit.<br />
Vorgehen: Nach der Anerkennung der Kantonalen Netzwerke erstellt das SNGS für<br />
diese ein Label. Sie können das Label gezielt einsetzen für ihre Öffentlichkeitsarbeit,<br />
das Sichtbarmachen ihrer Beteiligung an einem nationalen Programm und als<br />
Legitimation gegenüber ihren Schulen und Auftraggebern.<br />
8.5 Finanzielle Unterstützung<br />
Ziel: Mit der finanziellen Unterstützung durch das SNGS soll ein Anreiz für die<br />
Kantone zur Schaffung Kantonaler Netzwerke geschaffen werden.<br />
Vorgehen: Das SNGS sieht vor, den Kantonalen Netzwerken eine Pauschale für<br />
ihre Leistungen an die Schulen auszuzahlen. Bei der Verhandlung der Vereinbarung<br />
- 20 -
wird geprüft, für welche Leistungen zusätzliche finanzielle Ressourcen nötig sind.<br />
Dies kann sein für die Durchführung der Erfa-Treffen oder für die<br />
Projektunterstützung der Schulen. In vielen Fällen löst der Pauschalbetrag – in der<br />
Regel Fr. 10'000 pro Jahr – einen Prozess im Kanton aus, der es ermöglicht, eigene<br />
Ressourcen zu generieren.<br />
8.6 Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Vernetzung<br />
Ziel: Die beiden Erfahrungsaustauschtreffen der Kantonalen Netzwerke dienen der<br />
qualitativen Weiterentwicklung des Ansatzes der Gesundheitsfördernden Schule<br />
und der Optimierung der Unterstützung der Schulen.<br />
Vorgehen: Das SNGS organisiert zweimal jährlich ein Erfahrungsaustauschtreffen<br />
und ermöglicht so die Vernetzung zwischen den Kantonalen Netzwerken sowie die<br />
Mitgestaltung auf nationaler Ebene. Gemeinsam mit den KoordinatorInnen der<br />
Kantonalen Netzwerke werden Massnahmen, Angebote und Instrumente für die<br />
Unterstützung der Schulen entwickelt. Das SNGS lädt je nach Bedarf Experten zu<br />
den Treffen ein und plant Fortbildungsmodule ein. Um die Sensibilisierung für den<br />
Bedarf an Kantonalen Netzwerken in den Kantonen zu erhöhen, werden zu den<br />
Treffen auch Schlüsselpersonen aus Kantonen eingeladen, in denen noch kein<br />
Kantonales Netzwerk besteht.<br />
8.7 Projektdatenbank/Dokumentation<br />
Ziel: Auf der website des SNGS werden gute Projekte von Fachstellen und<br />
Kantonen dokumentiert.<br />
Vorgehen: Die website des SNGS ermöglicht einen einfachen Zugang zu den<br />
websites der Kantonalen Netzwerke und dokumentiert auch die Kantonalen<br />
Netzwerke als gute Projekte der Kantone. Darüber hinaus werden die von den<br />
Kantonalen Netzwerken unterstützen Schulprojekte auf www.gesunde-schulen.ch<br />
erfasst.<br />
8.8 Impulstagungen<br />
Ziel: Das SNGS trägt mit seinen jährlichen Impulstagungen zum aktuellen Diskurs<br />
bezüglich spezifischer Fragestellungen im Themenbereich «Gesundheitsfördernde<br />
Schule» bei.<br />
Vorgehen: Das SNGS führt jährlich zwei Impulstagungen durch, eine in der<br />
Romandie und eine in der Deutschschweiz. Das SNGS organisiert die Tagung als<br />
kostenloses Angebot für die Kantonalen Netzwerke und ihre Schulen. Mit diesen<br />
Tagungen wird ein breites Fachpublikum aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor<br />
für die Gesundheitsförderung im Setting Schule sensibilisiert und die Kantonalen<br />
Netzwerke können dieses Angebot für die Bewerbung ihrer Arbeit, als Instrument für<br />
ihre Öffentlichkeitsarbeit und die generelle Sensibilisierung in ihrem Kanton nutzen.<br />
- 21 -
8.9 Elektronischer Newsletter<br />
Ziel: Das SNGS stellt den Kantonalen Netzwerken ein Instrument für die<br />
Verbreitung ihren Anliegen und Projekte zur Verfügung.<br />
Vorgehen: Das SNGS gibt vier Mal jährlich einen nationalen, elektronischen<br />
Newsletter heraus. Die Kantonalen Netzwerke können mit eigenen Beiträgen an<br />
diesem Newsletter partizipieren oder auch Teile daraus in einen eigenen Newsletter<br />
integrieren. Damit können die Kantonalen Netzwerke als Teile des SNGS ihre<br />
Eigenständigkeit zum Ausdruck bringen und ihre Arbeit sichtbar machen.<br />
9. Unterstützungsangebote für Schulen<br />
9.1 Information, Beratung und Begleitung<br />
Ziel: Alle interessierten Schulen sollen für ihre Bedürfnisse eine adäquate<br />
Information, Beratung und Begleitung erhalten, um sich in Richtung<br />
Gesundheitsfördernde Schule zu entwickeln.<br />
Vorgehen: Beratung und Begleitung der Schulen auf dem Weg zur<br />
Gesundheitsfördernden Schule wird durch die Netzwerkkoordination via Telefon,<br />
Mail, Besuche vor Ort oder persönliche Beratung in den Räumen des SNGS<br />
geleistet. Wenn die SNGS-KoordinatorInnen diese Arbeit nicht leisten können,<br />
weisen sie die Anfragenden an externe ExpertInnen weiter. In Kantonen oder<br />
Regionen, in denen zwischen Fachstellen und SNGS eine Zusammenarbeit<br />
vereinbart wurde, informiert das SNGS über seine Aktivitäten wie auch diejenigen<br />
der Schulen.<br />
Bei Schulen, die sich für einen Netzwerkbeitritt interessieren, wird abgeklärt, ob sie<br />
die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Falls nicht, wird eine entsprechende Beratung<br />
eingeleitet, sofern dies die betreffende Schule wünscht.<br />
Darüber hinaus stellt das SNGS seine Auskunfts-, Informationsdienste und<br />
Kurzberatungen auch weiteren interessierten Schulen und Fachstellen kostenlos zur<br />
Verfügung. Pro Jahr machen rund 800 Einzelpersonen (Lehrpersonen,<br />
Schulleitungen, Eltern oder Fachstellenangestellte) von dieser Möglichkeit<br />
Gebrauch.<br />
9.2 Schriftliche Vereinbarungen<br />
Ziel: Mit der schriftlichen Vereinbarung zwischen Schule und SNGS bekommt das<br />
von der Schule definierte Gesundheitsförderungs-Programm intern eine hohe<br />
Verbindlichkeit.<br />
Vorgehen: Die Schulen und das SNGS halten Programm, einzelne<br />
Planungsschritte, Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten in einer Vereinbarung<br />
schriftlich fest. Die Vereinbarung enthält auch das Datum der Zustimmung durch<br />
das Team (Commitment) und muss von der Schulleitung, den Behörden und wo<br />
vorhanden vom Schüler- und Elternrat unterzeichnet sein. Die Beauftragten für<br />
Gesundheitsförderung der kantonalen zuständigen Stellen erhalten Kenntnis von<br />
der Aufnahme der Schule ins Netzwerk. Alle Angaben der Schulen werden in einer<br />
- 22 -
Schul- und Projektdatenbank gesammelt und stehen den Netzwerkschulen zur<br />
eigenen Vernetzung zur Verfügung. Sie ist auf www.gesunde-schulen.ch bzw.<br />
www.ecoles-en-sante.ch verfügbar.<br />
9.3 Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Vernetzung<br />
Ziel: Die Erfahrungsaustauschtreffen sind Lernfelder für die Netzwerkschulen. Sie<br />
profitieren von den Erfahrungen anderer, erhalten in bedeutsamen Bereichen<br />
Fortbildungen und werden angeregt, sich eigenständig mit anderen Schulen zu<br />
vernetzen.<br />
Vorgehen: Das SNGS führt vier Erfahrungsaustausch-Treffen durch, zwei in der<br />
Romandie und zwei in der Deutschschweiz. Die Treffen decken die bei den Schulen<br />
erhobenen Bedürfnisse ab, darüber hinaus beinhalten sie aber auch einen<br />
Fortbildungsteil. Dafür sind externe Moderationen und Inputs vorgesehen. Für die<br />
Förderung der eigenständigen Vernetzung unter den Schulen werden spezielle<br />
Instrumente wie Schullisten, e-mail-Listen, Links auf den homepages und<br />
gegenseitige Besuche organisiert. Die Erfahrungsaustauschtreffen werden<br />
ausgewertet, um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden und um<br />
Verbesserungen vornehmen zu können.<br />
Die Netzwerkschulen werden zur Nutzung von weiteren Fortbildungsangeboten<br />
motiviert.<br />
9.4 Website/Projektdatenbank<br />
Ziel: Die website schafft einen einfachen Zugang zum SNGS und seinen<br />
Dienstleistungen sowie zu allen Netzwerkschulen. Die website ist ein Instrument zur<br />
selbständigen Vernetzung der Schulen.<br />
Vorgehen: Die www.gesunde-schulen.ch bzw. www.ecoles-en-sante.ch ist so<br />
umgebaut, dass folgende Inhalte gefunden werden können:<br />
• generelle Informationen zum SNGS<br />
• News<br />
• Datenbank mit den Netzwerkschulen und ihren Programmen und Projekten<br />
• Tools/Materialen als Downloads<br />
• Veranstaltungen<br />
• Elektronischer Newsletter<br />
• Links<br />
9.5 Finanzielle Unterstützung<br />
Die finanzielle Projektunterstützung wird laufend optimiert. Zurzeit gelten folgende<br />
Standards:<br />
• Durchgehende Nummerierung der Gesuche.<br />
• Fachliche Prüfung durch die Projektförderung.<br />
• Koordination mit anderen Promotionsprojekten (BAG/Kantone/GF CH usw.).<br />
- 23 -
• Bedürfnis/Bedarf auf lokaler Ebene geklärt; regionale/kantonale Zweitmeinung ist<br />
dazu eingeholt.<br />
• Beschlussfassung mit Antragsteller abgesprochen, wenn Unterstützungsbeitrag<br />
von gewünschtem Betrag abweicht.<br />
• Beschlussfassung gemeinsam mit Leitung Plattform Gesunde Schulen RADIX.<br />
• Mitteilung des Beschlusses an GutachterIn und ev. Kantonale Schlüsselperson.<br />
• Auszahlung in zwei Raten.<br />
• Anforderungen an den Schlussbericht sind kommuniziert.<br />
• Jedes Gesuch wird formell abgeschlossen.<br />
• Von jedem Gesuch wird auf www.gesunde-schulen.ch ein Dossier angelegt.<br />
• Zwischen dem Empfang des Gesuches und der Beschlussfassung verstreichen in<br />
der Regel nicht mehr als sechs Arbeitswochen.<br />
Die Zuteilung von finanziellen Beiträgen an Projekte von Schulen kann für kantonale<br />
Schlüsselpersonen (Kantonale Delegierte für GF oder Suchtprävention, LeiterInnen<br />
regionale Fachstellen, Bereichsverantwortliche in Gesundheits- oder<br />
Erziehungsdirektionen) eine sensible Tätigkeit von RADIX sein. RADIX respektiert<br />
die kantonale Hoheit und unterstützt die Aufgaben der kantonalen Stellen. Aus<br />
diesen Gründen führt RADIX eine Liste, die für jeden Kanton festhält, wer für<br />
Zweitmeinungen prioritär anzufragen ist sowie allenfalls weitere Personen und<br />
Stellen, die über die Beschlüsse oder über spezielle Aktivitäten der<br />
Projektförderungen zu informieren sind.<br />
Die Zweitmeinung hat vier Zwecke zu erfüllen:<br />
1. Die kantonale Leitperson über das lokale Projekt und unsere<br />
Unterstützungsabsicht zu informieren.<br />
2. Kantonal eine Chance zur Koordination zu bieten.<br />
3. Lokale Akteure mit den kantonalen Stellen zu vernetzen.<br />
4. Über die Rückmeldung unseres Entscheides, die fachliche und institutionelle<br />
Qualität unserer Unterstützung und somit die Qualität des lokalen Projektes zu<br />
stärken.<br />
Für die Projekte der beiden Typen von Netzwerkschulen bestehen unterschiedliche<br />
Finanzierungsmöglichkeiten.<br />
9.5.1 Finanzielle Unterstützung für Programmschulen<br />
Ziel: Mit einem finanziellen Beitrag an ihr Programm sollen Schulen für ihre<br />
Zielerreichung unterstützt werden. Jede Projektunterstützung ist mit den Partnern in<br />
den Kantonen abgestimmt.<br />
Vorgehen: Programmschulen brauchen für die Umsetzung einzelner Teilprojekte<br />
ihres Programms oft eine externe fachliche Unterstützung. Die Programmschulen<br />
können dafür beim SNGS einen Beitrag von max. Fr. 4'000 für die Gesamtdauer<br />
von 3 Jahren beantragen. Die Unterstützung beträgt maximal 50% der budgetierten<br />
Projektkosten. Die Gesuchstellung erfolgt via Datenbank (mit Login für die Schulen.<br />
Für die Unterstützung müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein: Die Projekte müssen<br />
kompatibel mit den Zielen in der Vereinbarung sein, sie müssen zudem in einen<br />
- 24 -
längerfristigen Prozess eingebettet sein, die gesamte Schule betreffen, die<br />
Chancengleichheit reflektiert haben, partizipativ und auf eine nachhaltige Wirkung<br />
angelegt sein. Nicht unterstützt werden Investitionen oder erwirtschaftete Defizite.<br />
Auch bei Erfüllung aller Kriterien besteht kein Anspruch auf Unterstützung.<br />
9.5.2 Finanzielle Unterstützung für Alumni-Schulen<br />
Ziel: Mit einem finanziellen Beitrag an die Alumni-Schulen sollen diese in ihrer<br />
Weiterentwicklung punktuell unterstützt und die Vernetzung der Schulen<br />
untereinander über gemeinsame Arbeitsschwerpunkte gefördert werden.<br />
Vorgehen: Wenn sich Alumni-Schulen eigenständig vernetzen, um in Gruppen<br />
voneinander zu lernen oder gemeinsame Projekte oder Instrumente zu erarbeiten,<br />
können sie ein Unterstützungsgesuch an die Netzwerkkoordination stellen.<br />
Für diese Gesuchsabwicklung gelten die gleichen Standards wie für die Gesuche<br />
der Programmschulen.<br />
9.6 Auszeichnung der Schulen mit einem Label<br />
Ziel: Die Arbeit der Netzwerkschulen wird gegen aussen sichtbar gemacht.<br />
Vorgehen: Jede Netzwerkschule erhält als Anerkennung für ihre Arbeit und ihre<br />
Bemühungen, ihre Schule als gesunden und guten Arbeits- und Lernort zu gestalten<br />
ein Label in der Form einer Tafel. Diese Auszeichnung dient der Sichtbarmachung<br />
des Netzwerkes gegen aussen, eignet sich für die Schulen bestens für eine<br />
wirksame Öffentlichkeitsarbeit und dient gleichzeitig als sichtbares Zeichen des<br />
Commitments der Schulbeteiligten, sich auf dem Weg zur Gesundheitsfördernden<br />
Schule vorwärts zu bewegen. Austretende Schulen müssen das Label zurückgeben,<br />
erhalten aber eine Urkunde auf der die Verweildauer im Netzwerk und die erreichten<br />
Ziele vermerkt sind. Dieses Instrument kann von den Schulen für ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit wirkungsvoll eingesetzt werden.<br />
9.7 Dokumentation<br />
Ziel: Das Netzwerk dokumentiert best-practice Projekte und Erfahrungen der<br />
Netzwerkschulen und stellt diese Interessierten zur Verfügung.<br />
Vorgehen: Das SNGS kooperiert mit der Info-doc von RADIX. Die Dienstleistungen<br />
der Info-doc wurden im Jahr 2007 rund verdreifacht und von Personen aus dem<br />
Schulbereich beansprucht.<br />
Darüber hinaus führt das SNGS eine sprachspezifische Handbibliothek mit der<br />
wichtigsten, auch «grauen» Literatur zur Gesundheitsfördernden Schule.<br />
Auf www.gesunde-schulen.ch bzw. www.ecoles-en-sante.ch erhält jede<br />
Netzwerkschule ihren virtuellen Raum. Hier fügen die Schulen ihre Daten,<br />
Projektberichte und Erfahrungen direkt in die Datenbank ein.<br />
Das SNGS legt von jeder Netzwerkschule ein Dossier an und ist so in der Lage,<br />
Interessierten die nötigen Auskünfte geben zu können und mittels<br />
Dokumentenanalyse eine Übersicht über die Aktivitäten der Themen zu erstellen.<br />
- 25 -
9.8 Impulstagungen<br />
Ziel: Das SNGS organisiert seine jährlichen Impulstagungen zu aktuellen<br />
Fragestellungen der Schulen im Themenbereich «Gesundheitsfördernde Schule».<br />
Vorgehen: Das SNGS führt jährlich zwei Impulstagungen durch, eine in der<br />
Romandie und eine in der Deutschschweiz. Zur Sensibilisierung der Schulen für<br />
bestimmte Fragestellungen sowie der Fachwelt für den Ansatz der<br />
Gesundheitsfördernden Schule werden jeweils themenspezifisch Kooperationen<br />
gesucht. In der Deutschschweiz findet die Impulstagung jeweils im<br />
November/Dezember in Luzern statt, in der Romandie im September. Beide<br />
Tagungen können von allen Netzwerkschulen kostenlos besucht werden.<br />
9.9 Elektronischer Newsletter<br />
Ziel: Das Netzwerk informiert vier Mal pro Jahr mittels elektronischem Newsletter<br />
über neue Projekte, Studien, Veranstaltungen und Angebote.<br />
Vorgehen: Seit 2005 wurde der gut eingeführte Rundbrief des SNGS in Printform<br />
aus Kostengründen durch einen elektronischen Newsletter ersetzt. Der Rundbrief<br />
wird seitdem in veränderter Form von bildung+gesundheit als Netzbrief<br />
herausgegeben. Der elektronische SNGS-Newsletter erscheint viermal pro Jahr in<br />
einer gemischten Ausgabe (deutsch und französisch). Er wird grafisch gestaltet und<br />
redaktionell kurz gehalten. Kurzinfos werden mit Links für weitergehende Infos<br />
versehen. Auf Wunsch der Schulen wird der Newsletter als pdf auf der website mit<br />
Archiv installiert.<br />
10. Kooperationen<br />
Fachstellen der Kantone und Gemeinden<br />
RADIX orientiert sich bei der Konzipierung der Angebote an den Bedürfnissen der<br />
Kundinnen und Kunden und am fachlichen Bedarf. Die Angebote ergänzen und<br />
unterstützen die Arbeit der regionalen Fachstellen. So arbeitet auch das SNGS<br />
wenn und wo immer möglich mit Fachstellen zusammen und geht definierte<br />
Kooperationen ein, sei dies zur Beratung und Begleitung einzelner Schulen oder<br />
direkt für die Initiierung Kantonaler Netzwerke.<br />
bildung + gesundheit<br />
Die Netzwerkschulen arbeiten an einem breiten Themenspektrum. Dieses Spektrum<br />
kann und will das SNGS nicht allein aufarbeiten und sucht deshalb für diese<br />
thematischen Fragestellungen die Kooperation mit den entsprechenden Fachstellen<br />
oder den Mitgliedern von b+g. Diese Kooperationen haben sich bereits in den<br />
letzten Jahren sehr gut eingespielt und sollen so auch weiterhin gepflegt werden.<br />
Sie zeigen sich in der Aufarbeitung einzelner Fragestellungen, dem gemeinsamen<br />
Organisieren von Tagungen sowie der gemeinsamen Herausgabe des Netzbriefes<br />
b+g.<br />
- 26 -
BAG und Gesundheitsförderung Schweiz<br />
Wichtige Kooperationen betreffen auch Projekte und Programme von b+g sowie der<br />
beiden Trägerorganisationen: BAG und Gesundheitsförderung Schweiz. Das SNGS<br />
ist hier in den letzten Jahren verschiedentlich erfolgreiche Kooperationen<br />
eingegangen und wird dies auch in Zukunft tun.<br />
Kantone, Pädagogische Hochschulen<br />
Für die langfristige Verankerung der Gesundheitsfördernden Schulen durch<br />
Kantonale Netzwerke sind Kooperationen mit den Kantonen von zentraler<br />
Bedeutung. Wie bisher schon wird das SNGS in jedem Kanton den Kontakt zu den<br />
Dossierverantwortlichen Gesundheitsförderung EDK und die Zusammenarbeit mit<br />
ihnen (Netzwerkbeitritt, finanzielle Projektunterstützung, Tagungen) pflegen. Das<br />
SNGS bemüht sich laufend um Kooperationen dieser Art. Die Zusammenarbeit mit<br />
den Lehrerweiterbildungsinstitutionen für die Ausbildungslehrgänge<br />
«Kontaktlehrpersonen Gesundheitsförderung», der Konzipierung von CAS/MAS<br />
sowie weiteren LWB-Angeboten, der Einbezug der kantonalen Fachpersonen in die<br />
jährliche Impulstagung und in den Entscheid über die finanzielle<br />
Projektunterstützung, sowie die Information an sie über jede neue Netzwerkschule<br />
sollen weiterhin bestehen und wenn möglich noch intensiviert werden. Diese<br />
Kooperationen schaffen die Voraussetzungen für Kantonale Netzwerke und haben<br />
deshalb eine hohe Priorität.<br />
International<br />
Im internationalen Kontext sind die Kooperationen mit dem ENHPS, dem<br />
transnationalen Netzwerk der deutschsprachigen Länder sowie dem Netzwerk der<br />
frankophonen Länder von grosser Bedeutung.<br />
11. Projektorganisation<br />
Die Organisationsstruktur zeigt die Vernetzung auf mehreren Ebenen: auf der<br />
normativen (ENHPS/WHO, Auftraggeber), der strategischen (RADIX und Netzwerk<br />
der Kantonalen Netzwerke) sowie auf der operativen Ebene (Zielgruppen und<br />
indirekte Zielgruppen).<br />
- 27 -
Organisationsstruktur SNGS<br />
bildung + gesundheit und Gesundheitsförderung Schweiz sind gemeinsam<br />
Auftraggeber des SNGS. Sie beauftragen RADIX mit der Entwicklung der Strategie<br />
und der <strong>Konzept</strong>umsetzung. Sie definieren das Controlling durch den<br />
Leistungsvertrag und die Meilensteine. Die Auftraggeber sind vertreten durch:<br />
b+g, BAG:<br />
Dagmar Costantini<br />
Gesundheitsförderung Schweiz: Bettina Schulte-Abel<br />
RADIX:<br />
Barbara Zumstein<br />
Auftraggeber und Auftragnehmer treffen sich zur Besprechung der Meilensteine<br />
sowie bei Sonderfällen.<br />
___________________________________________________________________<br />
Barbara Zumstein. lic. phil.<br />
Nationale Koordinatorin SNGS<br />
RADIX Schweizer Kompetenzzentrum für<br />
Gesundheitsförderung und Prävention<br />
15. Februar 2008<br />
- 28 -