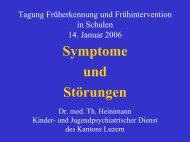Zertifikatsarbeit 13.10.06 - sitesystem
Zertifikatsarbeit 13.10.06 - sitesystem
Zertifikatsarbeit 13.10.06 - sitesystem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Thomas Aeschimann, Affolternstrasse, 3462 Weier im Emmental<br />
Die Schlüsselrolle der Schulleitung<br />
im Qualitätsmanagement<br />
einer gesundheitsfördernden Schule<br />
PH Bern, Institut für Weiterbildung<br />
<strong>Zertifikatsarbeit</strong> zur Schulleitungsausbildung<br />
Oktober 2006
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Abstract<br />
Welche Rolle spielt die Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden<br />
Schule? Von dieser Fragestellung ausgehend werden in der vorliegenden Arbeit die Erfahrungen<br />
von zehn Jahren Schulentwicklung an der Schule Affoltern im Emmental reflektiert.<br />
Was mit einem Suchtpräventionskonzept angefangen, ein erstes Leitbild der Schule ermöglicht<br />
und schliesslich zum Beitritt zum Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen der Schweiz geführt<br />
hat, zeigt, wie mit Gesundheitsförderung die Schulqualität verbessert werden kann. Ein sinnvolles<br />
Qualitätsmanagement schafft Transparenz und ermöglicht zielgerichtetes Planen, Umsetzen,<br />
Auswerten und Dokumentieren. Diese Entwicklungsschritte wurden an der Schule Affoltern<br />
dank Coaching und Beratung durch Fachstellen und Fachpersonen erleichtert.<br />
Gesundheitsförderung ist Schulentwicklung. Sie bündelt die Kräfte und richtet diese aus, ist ein<br />
Weg mit definiertem Ziel, macht das Ethos der Schule bewusst und prägt das (Selbst-) Verständnis<br />
von Schule.<br />
An gesundheitsfördernden Schulen wird Qualität – wie in allen neueren Konzepten des Qualitätsmanagements<br />
– heute ganzheitlich verstanden. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass es<br />
keine gute gesunde Schule ohne gute Schulleitung gibt. Zielführendes Handeln ist Ausgangspunkt<br />
des Qualitätsmanagements.<br />
Die Schulleitung hat in der Qualitätsentwicklung einer gesundheitsfördernden Schule die<br />
Schlüsselrolle inne. Die Schlüsselaufgabe ist das Wahrnehmen und Ausfüllen der unterschiedlichsten<br />
Schnittstellen, mit allen Beteiligten und im ganzen Spannungsfeld rund um die Schule.<br />
Auf verschiedenen Ebenen stellen Menschen Ansprüche an die Gestaltung, Erscheinung und<br />
Qualität. Diese Ansprüche sind in hohem Masse konfliktträchtig und verlangen die hohen Kompetenzen<br />
für die verschiedenen Führungsaufgaben.<br />
In dieser Rolle ist die Schulleitung change agent, die sich mit ständig wechselnden Bedürfnissen<br />
oder Voraussetzungen auseinandersetzt und die Ressourcen zu Gunsten einer guten, gesunden<br />
Schulentwicklung lenkt. Das birgt für die Schulleitung auch die Gefahr der<br />
Überforderung für die Beteiligten. In schwierigen Situationen wird auch die Gefahr der Machtballung<br />
deutlich.<br />
Gesundheitsförderung kann demnach nur gelingen, wenn die Schulleitung ihre Schlüsselrolle<br />
wahrnehmen kann und wenn Unterstützungsangebote für Schulleitungen das Qualitätsmanagement<br />
an den Schulen erleichtern helfen. Zertifikatslehrgänge und die Ausbildung von Verantwortlichen<br />
für die Gesundheitsförderung müssen zuerst einmal den Beweis erbringen, dass sie<br />
für die Schulleitungen hilfreich sind.<br />
Soll Gesundheitsförderung an Schulen nachhaltig sein, braucht es die Schulleitung in dieser<br />
Schlüsselrolle. Sie garantiert Kontinuität, funktionierende Schnittstellen und eine längerfristig<br />
aufgelegte Ausrichtung.<br />
Wer "Gesundheit fördern" fordert, muss die Schulleitung fördern.<br />
- 2 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung ....................................................................................................................5<br />
1.1 Ausgangslage...............................................................................................................5<br />
Schule Affoltern - Struktur und Grösse ......................................................................5<br />
Schulanlage - Alles unter einem Dach.......................................................................5<br />
Schulleitung - Organisation und Aufteilung................................................................5<br />
1.2 Fragestellung................................................................................................................6<br />
1.3 Zielsetzungen ...............................................................................................................6<br />
2. Was ist eine gesundheitsfördernde Schule?............................................................7<br />
2.1 Wandel der Gesundheitsförderung seit 1960................................................................7<br />
2.2 Der Begriff "Gesundheitsfördernde Schule" ..................................................................8<br />
2.3 Die Bedeutung der "gesundheitsfördernden Schule" in der Diskussion der Fachleute<br />
und Fachstellen ............................................................................................................9<br />
Mit Gesundheitsförderung die Schulqualität verbessern............................................9<br />
Mit Gesundheitsförderung gute Schule machen ........................................................9<br />
Mit Gesundheitsförderung der Schule Profil geben....................................................9<br />
Zusammenfassung..................................................................................................10<br />
2.4 Erfahrungen an der eigenen Schule - der Weg von der Normalschule zur<br />
Netzwerkschule ..........................................................................................................11<br />
Suchtpräventionskonzept ........................................................................................11<br />
Leitbild.....................................................................................................................12<br />
Beitritt Netzwerk ......................................................................................................13<br />
Gesundheitsförderung als Dach ..............................................................................13<br />
2.5 Reflexion ....................................................................................................................13<br />
3. Woran erkennt man das Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden<br />
Schule? .....................................................................................................................15<br />
3.1 Qualität ist, was den Anforderungen entspricht...........................................................16<br />
3.2 Qualitätsmanagement in der Diskussion der Fachleute und Fachstellen ....................17<br />
Gesundheitsförderung heisst Qualitätsmanagement ...............................................17<br />
Gesundheitsförderung und Schulqualität.................................................................18<br />
3.3 Erfahrungen an der eigenen Schule – Qualität managen............................................18<br />
z.B. Projekt "Dranbleiben" .......................................................................................18<br />
- 3 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
3.4 Reflexion ....................................................................................................................19<br />
4. Welche Rolle hat die Schulleitung im Qualitätsmanagement einer<br />
gesundheitsfördernden Schule? .............................................................................20<br />
4.1 Schulleitungsverständnisse ........................................................................................20<br />
4.2 Die Schulleitung in der globalisierten Welt - eine Agentin des Wandels? ..................21<br />
4.3 Die Gesundheitsförderung ist Aufgabe der Schulleitung .............................................23<br />
Schulleitung als Verantwortliche für gesundheitsfördernde Prozesse......................23<br />
Schulleitung als soziale Architektin..........................................................................24<br />
Schulleitung als Hüterin von "High Performance – Low Burnout" ............................24<br />
4.4 Zusammenfassung .....................................................................................................25<br />
4.5 Erfahrungen an der eigenen Schule – die Rolle der Schulleitung................................25<br />
Struktur- Qualität durch Verankerung: .....................................................................25<br />
Prozess-Qualität durch Partizipation........................................................................26<br />
Beziehungs-Qualität durch Schlüsselpersonen .......................................................26<br />
4.6 Reflexion ....................................................................................................................27<br />
Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung.........................................27<br />
Die Schlüsselrolle liegt bei der Schulleitung ............................................................28<br />
Erfahrungen mit der Schlüsselrolle der Schulleitung................................................28<br />
Masshalten und Machtbewusstsein in der Schlüsselrolle ........................................31<br />
Unterstützungsbedarf für die Schulleitung an einer gesundheitsfördernden Schule.31<br />
Ohne Unterstützung der Schulleitungen keine erfolgreiche Gesundheitsförderung .32<br />
5. Schluss......................................................................................................................33<br />
6. Literatur und Quellen................................................................................................35<br />
6.1 Quellen im Internet .....................................................................................................35<br />
6.2 Gedruckte Literatur.....................................................................................................36<br />
- 4 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
1. Einleitung<br />
1.1 Ausgangslage<br />
Schulen entwickeln sich - auch die Schule Affoltern. Während früher die Persönlichkeiten einzelner<br />
Lehrerinnen und Lehrer das Gesicht und das Wachstum der Schule geprägt haben, wird<br />
seit der Einführung des Lehrplans 95 im Kanton Bern Schulentwicklung bewusst gesteuert und<br />
umgesetzt. Im Rückblick auf diese Zeit ist die Zäsur von Schule halten zu Schule leiten deutlich.<br />
Viel Engagement und viel Kraft stecken in dieser Dekade auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden<br />
Schule. Um diesen Weg nachvollziehen zu können, sind einige Angaben zur Schule<br />
nötig:<br />
Schule Affoltern - Struktur und Grösse<br />
Die Schule Affoltern ist eine kleinere ländliche Schule im höchst gelegenen Dorf des Emmentals.<br />
Sie beherbergt im Schuljahr 2005/2006 einen Kindergarten, eine Basisstufenklasse, vier<br />
Primarklassen und eine Realklasse. Im zentral gelegenen Schulhaus werden rund 120 Kinder<br />
von 5 bis 15 Jahren aus der ganzen politischen Gemeinde von 7 Klassenlehrpersonen und 7<br />
Teilpensen- oder Fachlehrpersonen unterrichtet. Ungefähr 55% der Schülerinnen und Schüler<br />
treten Ende der 6. Klasse in die Sekundarschule der Nachbargemeinde Sumiswald ein. Seit<br />
dem Schuljahr 2005/2006 nimmt die Basisstufenklasse am "Entwicklungsprojekt zur Flexibilisierung<br />
des Schuleintrittsalters" teil.<br />
Die Kinder kommen weitgehend aus intakten, traditionellen Familien. Der berufliche Hintergrund<br />
der Eltern ist durchmischt, max. 20% der Familien sind noch in der Landwirtschaft tätig. Weniger<br />
als 3% sind Kinder von Menschen aus dem Ausland. Die Schule Affoltern kämpft mit einem<br />
starken Rückgang der Schülerzahlen.<br />
Die Lehrpersonen, die im Schuljahr 2005/2006 arbeiten, sind altersmässig durchmischt. Drei<br />
Personen unterrichten seit 20 oder mehr Jahren an der Schule Affoltern, fünf Personen zwischen<br />
13 und 20 Jahren. Acht Lehrpersonen sind seit max. 5 Jahren an unserer Schule angestellt.<br />
Die zwei Männer sind anzahlmässig den 12 Frauen deutlich unterlegen.<br />
Schulanlage - Alles unter einem Dach<br />
Von 1973 bis 1996 prägen zwei Schulhäuser die Geschichte der Schule Affoltern: Im "Neuen<br />
Schulhaus" – gebaut in der Hochkonjunktur der Siebzigerjahre – werden die erste vier Schuljahre<br />
mehrheitlich von Lehrerinnen unterrichtet. Im "Alten Schulhaus" mit Jahrgang 1899 gehen<br />
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse bei Lehrern zur Schule. In dieser Zeit schwankt<br />
die Zahl der Klassen zwischen acht und sechs.<br />
1995 beziehen die Schülerinnen und Schüler mit den 14 Lehrpersonen das "Blaue Huus", das<br />
so umgetaufte sanierte und grosszügig erweiterte "Neue Schulhaus. Nach einer mühsamen<br />
Standortsuche zieht 2001 auch der Kindergarten im Schulhaus ein. Seither sind alle Klassen<br />
der Schule Affoltern unter einem Dach.<br />
Schulleitung - Organisation und Aufteilung<br />
Die Schule Affoltern versteht sich als geleitete Schule. Im Pflichtenheft sind die Arbeit und<br />
Kompetenzen der Schulleitung geregelt. Die verschiedenen Schulleitungsaufgaben sind auf<br />
eine Frau und einen Mann aufgeteilt. Für die Bereiche Finanzen, Konferenzen, Terminplanung,<br />
Dokumentationen, Weiterbildung ist Rosette Graf zuständig. Als "Verantwortlicher Schulleitung"<br />
- 5 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
bin ich zuständig für die Bereiche Kommunikation und Kontakte zu Behörden und Institutionen,<br />
Administration der Pensen und Lektionen, Erfassung der Schülerinnen und Schüler.<br />
Die wichtigsten Aufgaben werden gemeinsam geplant, durchgeführt und ausgewertet: Die Planung<br />
von Schulentwicklung, die Mitarbeitergespräche, die Pädagogischen Konferenzen und<br />
andere Absprachen, die Anstellungsfragen und die Personalplanung. Für diese Schulleitungsaufgaben<br />
stehen der Schule knapp 30 Anstellungsprozente zur Verfügung. Diese sind intern<br />
aufgeteilt auf 10% für die Schulleiterin und 20% für mich als Schulleiter.<br />
1.2 Fragestellung<br />
Die Erfahrungen von zehn Jahren Schulentwicklung und das Bemühen, auf dem Weg zu einer<br />
gesundheitsfördernden Schule voranzukommen, führen ohne Umwege zu Fragen der Qualität<br />
und dem Qualitätsmanagement. Die vorliegende Arbeit untersucht demnach die Bedeutung der<br />
Schulleitung in diesem Bereich:<br />
Welche Rolle spielt die Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden<br />
Schule?<br />
Diese Fragestellung verlangt Klärung im Bezug auf<br />
o den Begriff der "gesundheitsfördernden Schule"<br />
o den Begriff des "Qualitätsmanagements"<br />
o den Begriff der "Rolle der Schulleitung"<br />
1.3 Zielsetzungen<br />
Ziel dieser Arbeit ist es,<br />
o die Merkmale der gesundheitsfördernden Schule aufzuzeigen und den Weg der Schule Affoltern<br />
zu einer gesundheitsfördernden Schule zu beschreiben<br />
o das Qualitätsmanagement im Rahmen von Schulentwicklung der eigenen Schule mit Qualitätsmodellen<br />
aus der (ausgewählten) Fachliteratur zu vergleichen<br />
o die Rolle der Schulleitung im sich wandelnden Umfeld "Schule" darzustellen und anhand der<br />
Schulentwicklung an der Schule Affoltern zu reflektieren<br />
o den Unterstützungsbedarf aufzuzeigen und einzelne Angebote zu beurteilen.<br />
- 6 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
2. Was ist eine gesundheitsfördernde Schule?<br />
In diesem Kapitel werfe ich einen kurzen Blick auf die Geschichte der Gesundheitsförderung<br />
seit 1960. Ich kläre die Begriffe der guten gesunden Schule und der gesundheitsfördernden<br />
Schule und stelle mit geeigneten Definitionen den Unterschied dar. Die Begriffsklärung ermöglicht,<br />
dass von einem gemeinsamen Basiswissen für die weitere Lektüre ausgegangen wird.<br />
Schliesslich versuche ich die Bedeutung der gesundheitsfördernden Schule für die Profilbildung<br />
und Entwicklung der Schule herauszuarbeiten und diese mit der Erfahrung an der Schule Affoltern<br />
zu beleuchten.<br />
2.1 Wandel der Gesundheitsförderung seit 1960<br />
Seit 1960 hat die Gesundheitsförderung auch in der Bildungslandschaft eine weite Verbreitung<br />
und gute Akzeptanz gefunden. In dieser Zeitspanne hat sich das Verständnis von Gesundheitsförderung<br />
stark verändert.<br />
Gesundheitserziehung in<br />
der Schule<br />
(seit 60er/70er)<br />
Gesundheitsförderung<br />
in und mit der Schule<br />
(seit Mitte 80er)<br />
Gesundheitsfördernde<br />
Schule<br />
(seit Anfang 90er)<br />
Risikofaktoren<br />
Verhaltensprävention<br />
somatisch<br />
Risiko- und Schutzfaktoren<br />
Verhaltens- und<br />
Verhältnisprävention<br />
psychosomatisch, sozial<br />
und ökologisch<br />
Ressourcen<br />
Lebensstile<br />
... und strukturell bzw.<br />
systemisch<br />
SchülerInnen<br />
SchülerInnen<br />
LehrerInnen<br />
Betroffene werden<br />
Beteiligte<br />
Aufklärung durch<br />
Fachunterricht<br />
Entwicklung durch<br />
Medizinische und psychologische<br />
Erkenntnisse<br />
Fächerübergreifende<br />
Projekte<br />
Entwicklung durch<br />
fachlich-pädagogische<br />
Interessen<br />
Fächerüberwindene<br />
Profilbildung:<br />
Schule als Projekt<br />
Entwicklung durch<br />
(schul-)politische<br />
Möglichkeiten<br />
Abbildung 1: Von der Gesundheitserziehung zur Gesundheitsfördernden Schule (Seeger, 2004, S. 8)<br />
Diese Entwicklung von der Gesundheitserziehung zur gesundheitsfördernden Schule lässt sich<br />
nach Seeger (2004, S. 6) wie folgt zusammenfassen:<br />
o ·<br />
o ·<br />
o ·<br />
o ·<br />
o ·<br />
o ·<br />
Von der Pathogenese zur Salutogenese<br />
Von Defiziten zu Ressourcen<br />
Vom Leid zum Glück<br />
Von der Aufklärung zur Partizipation<br />
Von der Anpassung zur Emanzipation<br />
Von der Askese zum Hedonismus<br />
- 7 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
2.2 Der Begriff "Gesundheitsfördernde Schule"<br />
Die vergangenen 40 Jahre mit "Gesundheitsförderung" haben nicht nur in der Bildungslandschaft<br />
die Anzahl von Begriffen, Fachausdrücken, Modellen und Definitionen explodieren lassen.<br />
Oft liegen die Unterschiede für Laien im Bereich von Nuancen und können kaum<br />
differenziert werden. Das gilt speziell auch für den Begriff der "gesundheitsfördernden Schule".<br />
In der Fachliteratur tauchen verschiedene Begriffe auf, die in ihrer Bedeutung zu unterscheiden<br />
sind:<br />
o Die gute Schule:<br />
Konsens internationaler Fachkreise zu den<br />
wichtigsten Qualitätsmerkmalen 1<br />
o Die gute gesunde Schule:<br />
Referenzmodell von "bildung+gesundheit" auf der<br />
Grundlage der Sigriswiler-Definition 2<br />
o Die gesundheitsfördernde Schule: Struktureller Ansatz des Schweizerischen<br />
Netzwerks gesundheitsfördernder Schulen (SNGS) 3 ,<br />
bei dem im Vordergrund steht, dass die Schulen als<br />
Lebenswelten gesundheitsfördernde Prozesse<br />
selber initiieren (Setting-Ansatz 4 ) und so<br />
Schulentwicklung ermöglichen.<br />
Im Folgenden verwende ich den Begriff "gesundheitsfördernde Schule" im Sinne des Schweizerischen<br />
Netzwerks Gesundheitsfördernder Schulen (SNGS). Er beinhaltet gleichzeitig aber auch<br />
das Verständnis einer "guten gesunden Schule", welches seinerseits die Qualitätsmerkmale der<br />
"guten Schule" aufweist.<br />
1 Qualitätsmerkmale: Mit folgenden Qualitätsmerkmalen beschreibt Herbert Altrichter (Altrichter 1999, o.S.) eine "gute Schule":<br />
"Positive Leistungserwartung und intellektuelle Herausforderung; transparentes, stimmiges und 'berechenbares' Regelsystem;<br />
positives Schulklima mit Engagement für SchülerInnen; Mitsprache und Verantwortungsübernahme durch SchülerInnen;<br />
Zusammenarbeit und pädagogischer Konsens im Lehrkörper; wenig Fluktuation von LehrerInnen und SchülerInnen; zielbewusste,<br />
kommunikations- und konsensorientierte Schulleitung; reichhaltiges Schulleben; schulinterne Lehrerfortbildung; Einbeziehung der<br />
Eltern; Unterstützung durch die Schulbehörde" (Altrichter, 1999, o.S.).<br />
2 Sigriswiler-Definition: Fachleute haben sich im Juni 2003 in Sigriswil auf eine Definition von "guten gesunden Schulen" geeinigt:<br />
"Die gute gesunde Schule ist eine Schule, die bei der Verwirklichung ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages gezielt<br />
gesundheitswissenschaftlich fundierte Interventionen entwickelt und durchführt. Ziel ist die nachhaltig wirksame Steigerung der<br />
Schul- und Bildungsqualität im Rahmen von Schulentwicklung. Dabei ist die Gesundheitsqualität von prinzipieller Bedeutung"<br />
(Zumstein, 2005, S. 9).<br />
3 Schweizerisches Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (SNGS): 1993 haben die WHO, der Europarat und die Europäische<br />
Kommission gemeinsam das «Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen» (ENHPS) lanciert, an dem sich die Schweiz<br />
neben 42 anderen Ländern beteiligt. Der konzeptuelle Ansatz basiert auf der Ottawa-Charta: Schulen als Organisationseinheit<br />
verständigen sich auf gesundheitsfördernde Ziele und deren Umsetzung, stellen ihre Erfahrungen anderen Schulen zur Verfügung<br />
und profitieren so ihrerseits von den anderen Netzwerkschulen. Partizipation und Empowerment sind die leitenden<br />
Handlungsgrundsätze. Im August 2005 sind 356 Schulen Mitglied des Netzwerkes. Das SNGS arbeitet als Kompetenzzentrum von<br />
bildung+gesundheit.<br />
4 Setting: „Gesundheitsförderung in Schulen bezieht sich auf die Schule als ein soziales System, welches bestimmte Umwelt- und<br />
Lebensbedingungen für die Menschen schafft, die in der Schule arbeiten oder dort ausgebildet werden. Die persönlichen<br />
Verhaltens- und Handlungsweisen dieser Menschen stehen in einer wechselseitigen Beziehung zu den Verhältnissen an einer<br />
Schule. Gesundheitsförderung in Schulen richtet sich an die folgenden Bevölkerungsgruppen:<br />
- Schülerinnen und Schüler<br />
- Lehrerinnen und Lehrer<br />
- Personal (administratives Personal, Abwarte, Bibliothekarinnen, Angestellte der Mensa etc.)<br />
- Eltern<br />
- Behörden, Politikerinnen und Politiker<br />
- Gemeindebewohnerinnen und – bewohner“ (Ackermann, 2004, S. 23).<br />
- 8 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
2.3 Die Bedeutung der "gesundheitsfördernden Schule" in der Diskussion der<br />
Fachleute und Fachstellen<br />
Mit Gesundheitsförderung die Schulqualität verbessern<br />
Bei der Durchsicht von Literatur aus Fachkreisen fällt die Nähe der "Gesundheitsförderung" zu<br />
Schulentwicklung und Schulqualität auf. Nach Zumstein (2005, S.10) bringt die Gesundheitsförderung<br />
im Konzept des Schweizerischen Netzwerks gesundheitsfördernder Schulen (SNGS)<br />
"ihre Anliegen in die Entwicklung der Schule und des Unterrichtes ein und beeinflusst so deren<br />
Qualität". Zumstein zitiert an gleicher Stelle Peter Paulus: "Gesundheit macht eine Differenz, die<br />
einen Qualitätssprung bedeutet". Bei der Entwicklung der Schule in Richtung Gesundheitsfördernder<br />
Schule müssten die Qualitätsansprüche des Bildungs- mit denjenigen des Gesundheitssektors<br />
gekoppelt werden. Diese Verbindung liege nicht (allein) im Interesse des<br />
Gesundheitssektors. Vor allem der Bildungssektor profitiere davon: Wer Leistung fordere, müsse<br />
Gesundheit fördern.<br />
Die Definition der Gesundheitsfördernden Schulen durch das SNGS lautet demnach: "Die<br />
Gesundheitsfördernde Schule setzt sich explizit mit Themen der Gesundheitsförderung auf<br />
allen Ebenen des Schulgeschehens (Unterricht, Team, Schulorganisation, Vernetzung,<br />
Curriculum) auseinander und verpflichtet sich zu entsprechenden Massnahmen. Damit trägt sie<br />
zur Verbesserung der Bildungs- und Schulqualität und zur Entfaltung und Förderung der<br />
Gesundheit und des Wohlbefindens aller an der Schule Beteiligten bei. Sie orientiert sich dabei<br />
an einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff und richtet ihre Arbeit nach den Prinzipien der<br />
Gesundheitsförderung gemäss Ottawa Charta aus: Partizipation, Befähigung zum selbst<br />
bestimmten Handeln, Ressourcenorientiertheit, Langfristigkeit und Pädagogik der Vielfalt<br />
(Chancengleichheit bezüglich Geschlecht, sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft)"<br />
(Zumstein, 2005, S.11).<br />
Mit Gesundheitsförderung gute Schule machen<br />
Paulus (zitiert nach Seeger, 2004, S. 6) bringt die Bedeutung von Schulentwicklung durch Gesundheitsförderung<br />
auf den Punkt: „Die Gesundheitsfördernde Schule ist eine Schule, die ‘Gesundheit‘<br />
zum Thema ihrer Schule macht. Sie hat einen Schulentwicklungsprozess mit dem Ziel<br />
eingeleitet, ein gesundheitsförderndes Setting Schule zu schaffen, das die Gesundheit der LehrerInnen,<br />
der SchülerInnen und die Gesundheit des nicht-unterrichtenden Personals am Arbeits-<br />
und Lernplatz Schule fördert".<br />
Paulus (2003, S.1) unterstreicht den Qualitätsaspekt der gesundheitsfördernden Schule: "Die<br />
gute gesunde Schule ist eine Schule, die sich in ihrer Entwicklung klar den Qualitätsdimensionen<br />
der guten Schule verpflichtet hat und die bei der Verwirklichung ihres sich daraus ergebenden<br />
Bildungs- und Erziehungsauftrages gezielt Gesundheitsinterventionen einsetzt. Ziel ist die<br />
nachhaltig wirksame Steigerung der Bildungs- und Erziehungsqualität der Schule".<br />
Mit Gesundheitsförderung der Schule Profil geben<br />
Nach Seeger (2004, S. 9) muss die gesundheitsfördernde Schule "einen eindeutig identifizierbaren<br />
konzeptionellen Kern aufweisen, der sich von anderen Schulprofilen deutlich unterscheidet.<br />
Gleichzeitig nutzt eine gesundheitsfördernde Schule vergleichbare bzw. identische<br />
'Entwicklungshilfen' für ihre Profilbildung". Die Profilbildung der gesundheitsfördernden Schule<br />
wird durch die Merkmale der guten Schule ermöglicht:<br />
"Eine Gesundheitsfördernde Schule...<br />
o nutzt bewährte Verfahrenswege zur effektiven Problemlösung,<br />
o nutzt curriculare, finanzielle und personelle Freiräume zur individuellen Profilbildung,<br />
o nutzt eine mutige Kommunikation zur Gestaltung von Beziehungen,<br />
- 9 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
o nutzt eine Methodenvielfalt zum gemeinsamen Entdecken neuer Lernformen,<br />
o nutzt und fördert Entscheidungskompetenzen und Mitverantwortung, indem sie Betroffene<br />
zu Beteiligten werden lässt,<br />
o nutzt immer wieder folgenreiche Impulse (Studientage, Projekte usw.) als Inspirations- und<br />
Kraftquelle,<br />
o nutzt die individuelle Arbeitszufriedenheit als sensiblen Indikator zur (Selbst-) Reflexion,<br />
o nutzt Partnerschaften und Netzwerke, um vielfältige Ressourcen konstruktiv zu bündeln,<br />
usw." (Seeger, 2004, S. 11).<br />
Seeger unterstreicht damit den Setting-Ansatz, der in den untenstehenden Grafiken verdeutlicht<br />
wird:<br />
Abbildung 2: Von der Prävention zum Gesundheitsmanagement auf Grund des Setting-Ansatzes<br />
(Seeger 2005b, o.S.)<br />
Zusammenfassung<br />
In der Sicht der Fachpersonen muss die Gesundheit im Dienst der Schulqualitätsentwicklung<br />
stehen nach dem Motto “Mit Gesundheit gute Schule machen“ (Paulus, 2003, S.1). Alle drei<br />
oben zitierten Fachpersonen machen deutlich, dass Gesundheitsförderung die Schulentwicklung<br />
massgeblich und grundlegend beeinflusst, initiiert, Sinn stiftet, umfassend wirkt und – so ist<br />
Seeger (2004, S. 22) überzeugt – als Teil eines Ganzen gar zum "Trendsetter einer partizipativen<br />
Gesundheits- und Bildungspolitik" wird. Zwar ist Schulentwicklung ohne Gesundheitsförderung<br />
möglich und erfüllt sogar die Kriterien der guten Schule – kann sie aber alle Betroffenen<br />
erreichen und "mitnehmen"? Gesundheitsförderung an der Schule bietet die Chance - basierend<br />
auf dem Verständnis der Salutogenese 5 und des Setting-Ansatzes - das pädagogische<br />
Profil, die Unterrichtsqualität, das Schulklima, die Zusammenarbeit und Identifikation aller Beteiligten<br />
zu fördern.<br />
5 Salutogenese: Im Salutogenese-Konzept von Aaron Antonovsky wird die Gesundheit als Ressource für die Lebensgestaltung<br />
betrachtet. Das Konzept zielt auf die Entwicklung von personen- und systemgebundenen gesunden Potenzialen in Lebenswelten<br />
(Settings). Eines dieser Setting ist beispielsweise die Schule.<br />
- 10 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
2.4 Erfahrungen an der eigenen Schule - der Weg von der Normalschule zur<br />
Netzwerkschule<br />
Als im Kanton Bern 1995 der neue Lehrplan erschien und das neue Volksschulgesetz in Kraft<br />
trat, wurden die Kollegien beauftragt, interne Absprachen im Sinn von Schulentwicklung zu<br />
machen. Dazu konnten die Schulen je insgesamt 16 Tage (!) einsetzen. Vier Tage wurden für<br />
die Erarbeitung des Konzepts verwendet, die restlichen Tage standen bis Ende 1997/1998 für<br />
die Umsetzung zur Verfügung. Deshalb wurde in unserem Kollegium 1996 darüber diskutiert, in<br />
welche Richtung die ersten Schritte von Schulentwicklung führen sollen.<br />
Suchtpräventionskonzept 6<br />
Die persönliche Betroffenheit eines Lehrers mit dem Suchtproblem seines Kindes war das<br />
Schlüsselerlebnis und im Jahr 1996 die Initialzündung für den Weg zu einer gesundheitsfördernden<br />
Schule. Die schwierige Situation führte uns vor Augen, wie zentral und zukunftsträchtig<br />
das Thema "Suchtprävention" ist. Wir beschlossen zu handeln, bevor wir handeln mussten.<br />
Um die Ideen in die Tat und ein Projekt umzusetzen, fehlte den Lehrpersonen und der neu zusammengesetzten<br />
Schulleitung aber das nötige know-how. Das Kollegium entschied, die Fachstelle<br />
Berner Gesundheit – vormals Plus-Fachstelle – um Unterstützung anzufragen. Berner<br />
Gesundheit ermöglichte der Schule Affoltern über längere Zeit ein Coaching der Lehrpersonen<br />
durch eine Fachfrau– notabene ohne administrative oder finanzielle Hindernisse.<br />
Das Ziel des Projekts war, ein Suchtpräventionskonzept mit folgenden Handlungsebenen zu<br />
erstellen:<br />
6 Das Suchtpräventionskonzept der Schule Affoltern von 1997 beinhaltete Zielsetzungen und Massnahmen zu Schulklima,<br />
Unterrichtspraxis, Früherkennung, Normen und Werte, Fortbildung für Lehrpersonen (Grundlagen zur Suchtprävention,<br />
Früherkennung, Schulprojekte, Kommunikation) und Elternarbeit.<br />
- 11 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
o Primärprävention:<br />
Wie können Suchtentwicklungen<br />
bei<br />
Menschen verhindert<br />
werden?<br />
Verhältnisprävention:<br />
Verhaltensprävention:<br />
Die Verhältnisprävention in der Schule<br />
befasst sich mit der gesunden Schule.<br />
Ziel ist es, die Lebensverhältnisse im<br />
System Schule so zu gestalten, dass<br />
sich die Menschen darin zu ihrem Wohl<br />
und zum Wohl der Gesamtheit entfalten<br />
können.<br />
Sie beinhaltet das Vermitteln von Wissen,<br />
Werten und Entscheidungshilfen für<br />
suchtpräventives Verhalten und das<br />
Verbessern der individuellen Lebenskompetenzen<br />
(Selbstkompetenz, Sozialkompetenz,<br />
Sachkompetenz).<br />
o Sekundärprävention (Früherkennung)<br />
o Weiterbildung für Lehrpersonen<br />
o Elternarbeit:<br />
Den Eltern sollen die Ziele der Schule bezüglich der Suchprävention<br />
transparent gemacht werden.<br />
Leitbild<br />
Nach der Erstellung des Konzeptes wurde der Schulleitung bewusst, dass – für die längerfristig<br />
ausgelegte Umsetzung – die Grundlage, bzw. die Legitimation für die Gesundheitsförderung im<br />
Blick auf die Fluktuation im Kollegium fehlte. Für zukünftige Anstellungen wollte die Schulleitung<br />
über ein Instrument verfügen, das Lehrpersonen zu Gesundheitsförderung verpflichtet, aber<br />
auch legitimiert.<br />
1999 beschloss das Kollegium in einem nächsten Schritt, ein Leitbild für die Schule zu erstellen,<br />
o das grundlegende Erkenntnisse aus der Suchtpräventionsarbeit beinhaltet<br />
o das Erfahrungen aus der Teamentwicklung beschreibt<br />
o das Verständnis von Partizipation und Empowerment (damals: "Stärken stärken") aufzeigt<br />
o das Hinweise auf die Elternarbeit enthält<br />
o das die Zusammenarbeit mit der Schulaufsichtsbehörde (Schulkommission) beleuchtet<br />
o das die Position der Schule im Umfeld der Gemeinde klärt<br />
o das die Handlungsfelder der Schulentwicklung definiert<br />
Gleichzeitig mit dem Verfassen des Leitbildtextes plante die Schulleitung zusammen mit dem<br />
Kollegium auch den ersten Umsetzungsschritt zum Thema "Zusammenarbeit mit der Schulkommission".<br />
Die Entstehung des Leitbildes bildete den eigentlichen Abschluss des ersten Teils der Schulentwicklung<br />
mit Gesundheitsförderung während fünf Jahren.<br />
- 12 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Beitritt Netzwerk<br />
"Die Schule Affoltern ist eine gesundheitsfördernde Schule und steht auf einer guten Basis".<br />
Dieser erste Satz in der Präambel des Leitbilds vom August 2000 hat eine starke Ausstrahlung<br />
und ist Fixpunkt in der weiteren Schulentwicklung.<br />
Zu Beginn des zweiten Teils von Gesundheitsförderung stellte sich der Schulleitung und dem<br />
Kollegium die Frage "Wo erhalten wir Unterstützung für die Umsetzung des Leitbildes und des<br />
Grundsatzes in der 'Präambel'?". Der Schritt zum Beitritt zum Netzwerk der gesundheitsfördernden<br />
Schulen der Schweiz (SNGS) war deshalb logisch und nötig. Die Motivation für den<br />
Beitritt waren nicht in erster Linie die Finanzen, sondern viel mehr das Fachwissen, der Austausch<br />
und die Weiterbildungsmöglichkeiten, die angeboten wurden. Ebenfalls reizte der Gedanke,<br />
dass Kontakte für spätere Projekte gewinnbringend geknüpft werden können. Die<br />
Zugehörigkeit zum Netzwerk ist aber auch eine Auszeichnung und ein Ausdruck der Verbindlichkeit<br />
in einer sich schnell wandelnden Bildungslandschaft. Die Plakette ziert deshalb den<br />
Eingangsbereich der Schulanlage und ist auch auf der Startseite des Internetauftritts der Schule<br />
sichtbar.<br />
Gesundheitsförderung als Dach<br />
Aus den Erfahrungen beim Erstellen und Umsetzen des Suchtpräventionskonzeptes und der<br />
Erarbeitung des Leitbildes war klar: Wir sind eine gesundheitsfördernde Schule. Die folgende<br />
Darstellung zeigt (von unten nach oben) den Weg der Schule Affoltern zur gesundheitsfördernden<br />
(Netzwerk-) Schule auf.<br />
Abbildung 3: Grundlagen der Gesundheitsförderung an der Schule Affoltern (eigene Grafik)<br />
2.5 Reflexion<br />
Glück fördert die Gesundheit. Im doppelten Sinn. Glück stand mir als unerfahrenem Schulleiter<br />
bei, als es darum ging, die Umsetzung des Lehrplans 95 mit dem aus zwei Kollegien<br />
zusammengewürfelten Team zu planen. Im Nachhinein erwies sich der Entscheid des<br />
- 13 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Kollegiums, Gesundheitsförderung – damals in Form von "Suchtprävention" - als ersten Schritt<br />
im Schulentwicklungsprozess anzugehen, als Glücksfall. Das Schlüsselerlebnis für den Start<br />
zur Gesundheitsförderung war das erwähnte coming out des Kollegen, dessen Sohn mit<br />
Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Die emotionale Betroffenheit aller Lehrpersonen schaffte<br />
eine vorher unbekannte Solidarität und Anteilnahme, wirkte dort verbindend, wo vorher im neu<br />
zusammengestellten Kollegium die Unterschiede betont worden waren.<br />
Das Überzeugende am Projekt "Suchtprävention" war, dass...<br />
o eine Ergriffenheit des Kollegiums den Ausgangspunkt bildete (Emotion)<br />
o alle die Wichtigkeit des Themas erkannten (Relevanz)<br />
o das Thema für alle neu war (Vorkenntnisse)<br />
o alte und junge Lehrpersonen eingebunden wurden (Erfahrung)<br />
o das Anliegen Stufen übergreifend war (Schulstufen)<br />
o das Thema Fächer übergreifend durchgeführt werden konnte (Schulfächer)<br />
o es den Touch von etwas Neuem, Spannendem hatte (Akzeptanz)<br />
o es vielseitig und kreativ angegangen werden konnte (Kreativität)<br />
o verschiedene Zugänge möglich schienen (Zugänge)<br />
Die hohen Anforderungen machten klar, dass – als zweiter Glücksfall – die Lehrpersonen und<br />
die Schulleitung nicht fähig waren, das Projekt selber anzupacken und auf Unterstützung angewiesen<br />
waren. Aufmerksam geworden durch einen Flyer von Berner Gesundheit knüpfte ich<br />
Kontakt mit der Fachstelle und stiess auf offene Ohren. Mein Entscheid, eine Fachstelle und<br />
nicht einen Drogenberater mit eigenen Drogenerfahrungen als Ansprechpartner zu wählen, erwies<br />
sich bald als richtig und weise. Das professionelle Coaching durch eine Fachfrau von Berner<br />
Gesundheit entlastete die Schulleitung und das Kollegium sehr. Es lieferte die Grundlagen<br />
und Informationen, zeigte die weltumspannenden Zusammenhänge auf, bot wichtige Inputs und<br />
klärte die Verantwortung für den Prozess. Dank dieser Unterstützung wurde - parallel und ergänzend<br />
zur Konzeptarbeit - auch ein entscheidender Teamentwicklungsprozess eingeleitet,<br />
der das Kollegium formte und verband. Schliesslich war – als dritter Glücksfall – das ganze Coaching<br />
von ca. 60 Stunden für die Schule kostenlos. Als Schulleiter war ich in dieser Phase –<br />
Ansprechpartner für die Fachperson – zugleich Motivator, Kommunikator und Organisator. Hier<br />
wurden mir als Schulleiter das Potential und die Chancen von Gesundheitsförderung für die<br />
Schulentwicklung bewusst:<br />
Gesundheitsförderung<br />
o bündelt die Kräfte und richtet diese aus (Fokus)<br />
o ist Weg mit definiertem Ziel (Prozess)<br />
o macht das Ethos der Schule bewusst (Ethos)<br />
o prägt das (Selbst-) Verständnis von Schule (Profil)<br />
- 14 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Abbildung 4: Bedeutung von Gesundheitsförderung für die Schulentwicklung und Ethos einer Schule<br />
(eigene Grafik)<br />
Seeger (2003, S. 47) beschreibt treffend die Erfahrungen der Schule Affoltern: "Projekte der<br />
Gesundheitsförderung/Prävention wirken vor allem indirekt über eine Verbesserung des Schulklimas.<br />
(= Verbesserung der Struktur- und Prozessqualitäten schulischen Arbeitens und Lernens).<br />
Je besser Gesundheitsförderung in Schulentwicklung integriert ist, desto wirksamer ist<br />
sie".<br />
Rückblickend stelle ich fest, dass vor allem auch das Erleben des gemeinsamen Prozesses als<br />
gleichberechtigte Beteiligte den Erfolg des ersten Schritts auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden<br />
Schule ermöglichte.<br />
“Gesundheit ist ein Weg,<br />
der sich bildet,<br />
wenn man ihn geht<br />
und gangbar macht.”<br />
Heinrich Schipperges<br />
(zitiert nach Seeger, 2005a, S. 28)<br />
3. Woran erkennt man das Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden<br />
Schule?<br />
Im folgenden Kapitel umschreibe ich die Bedeutung von Qualität und setze sie in den Bezug zur<br />
gesundheitsfördernden Schule. Ich zeige mit ausgewählten Zitaten die Bedeutung von Gesundheitsförderung<br />
im Qualitätsmanagement auf und erläutere die Abläufe, die an unserer Schule<br />
mithelfen, Qualität zu entwickeln. Schliesslich reflektiere ich meine Rolle im Qualitätsentwicklungsprozess.<br />
- 15 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
3.1 Qualität ist, was den Anforderungen entspricht 7<br />
Der Begriff "Qualitätsmanagement" 8 stammt aus der Wirtschaft. Er ist abhängig von andern<br />
Begriffen wie Qualität, Qualitätsentwicklung, Qualitätskriterien, Qualitätsorientierung,<br />
Qualitätsgrundsätzen etc. Die Dokumentation der Ausbildung für Schulleitungen (AFS) vom<br />
Februar 1999 erläutert den Qualitätsbegriff:<br />
"Der Begriff ist weder scharf umrissen noch von einer allgemein anerkannten Lehrmeinung<br />
festgelegt. Eine verbreitete Auffassung lautet so: Qualität ist nicht einfach das Beste, sondern<br />
das der Situation Angemessene, das den Erwartungen Entsprechende. 'Qualität ist die Gesamtheit<br />
von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte<br />
Erfordernisse zu erfüllen' (gemäss ISO 8402)" (AFS Unterlagen GKL 15). Anders ausgedrückt:<br />
"Qualität heisst tun, was man verspricht" (Keller, 2003, S. 1).<br />
Qualitätsmanagement heisst demnach, durch geeignete Massnahmen diese Qualität zu erhalten<br />
oder zu verbessern. Mit Qualitätsentwicklung können die Kompetenzen oder die Zufriedenheit<br />
der Beteiligten mit den Anforderungen in Einklang gebracht werden kann und<br />
Veränderungen begegnet werden.<br />
Qualitätsentwicklung basiert auf der Qualitätsorientierung jeder und jedes Einzelnen, aber auch<br />
auf den Vereinbarungen der Schule. Die Qualitätsorientierung der Gesundheitsförderung bedeutet<br />
die Ausrichtung aller auf die Anliegen der Gesundheitsförderung. Qualitätsentwicklung ist<br />
nach Ansicht der AFS – vor allem auf der strategischen Ebene – eine Aufgabe der Schulleitung.<br />
Abbildung 5: Qualitätsentwicklung als Regelkreis (AFS, 1999, o.S.)<br />
7 Definition nach ISO. Gefunden in den Kursunterlagen zum Workshop von Beat Peverelli, Chaute Märit 2000 in Langnau<br />
8 Wie schwierig "Qualitätsmanagement" (QM) in der Schule zu beschreiben ist, zeigt die Definition von QM in www.wikipedia.de:<br />
Adaptiert auf die Schule könnte die Definition so lauten: "Der Begriff Qualitätsmanagement (QM) bezeichnet einen Teilbereich der<br />
Schulleitungsaufgabe. Ziel ist die Optimierung von Zusammenarbeit unter der Berücksichtigung der Ressourcen sowie der<br />
Qualitätserhalt von Unterricht und Schulleistungen (Output) und deren Weiterentwicklung. Hierbei von Belang sind etwa die<br />
Optimierung von Kommunikation, Entscheidungsfindungen, Lösungsstrategien, die Erhaltung oder Steigerung der Zufriedenheit von<br />
Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und andern Beteiligten, sowie der Motivation der Mitarbeiter. Ebenfalls zu QM<br />
gehören die Klärung bestimmter Handlungs- und Arbeitsprozesse, Standards für Produkte oder Leistungen, Dokumentationen,<br />
Berufliche Weiterbildung, Ausstattung und Gestaltung der Schulanlage und Arbeitsräumen" (Wikipedia, 2006).<br />
- 16 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
3.2 Qualitätsmanagement in der Diskussion der Fachleute und Fachstellen<br />
Gesundheitsförderung heisst Qualitätsmanagement<br />
Seeger unterscheidet drei Qualitäten und Strategien an der gesundheitsfördernden Schule, die<br />
gemanagt werden müssen. Auffallend ist die gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussung der<br />
Qualitätsmerkmale. Wichtige Akteure sind nebst der Schulleitung die Koordinatorinnen und<br />
Koordinatoren für Gesundheitsförderung (KGF) 9 und die Mitglieder der Gesundheitsteams (z.B.<br />
Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung). Nutzniessende – aber nicht direkte Akteure – sind die<br />
Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler und andere an der Schule Beteiligte. Nicht<br />
erwähnt bleibt die Schullaufsicht (Behörde).<br />
Abbildung 6: Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schulen (Seeger, 2005b, o.S)<br />
Damit zeigt Seeger auf, welches Potential die Gesundheitsförderung für die Schul- bzw. Qualitätsentwicklung<br />
hat. Das dynamische Modell fragt die Akteure: "Tun wir noch, was wir versprochen<br />
haben?" (Keller, 2003, S.2). Der von Seeger (2004, S. 9) als "eindeutig identifizierbarer<br />
konzeptioneller Kern" ermöglicht es der Schule aus gegebenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen<br />
(Input) mit Hilfe von Qualitätsmanagement zu bedeutenden Outputs zu gelangen:<br />
9 KGF: Im Kanton Bern wird die Ausbildung zur Gesundheitskoordinatorin/zum Gesundheitskoordinator seit 2006 als<br />
Zertifikatslehrgang an der Pädagogischen Hochschule Bern angeboten.<br />
- 17 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Abbildung 7: Qualitätsmanagement an der gesundheitsfördernden Schule ist Schulentwicklung (Seeger,<br />
2005b, o.S.)<br />
Gesundheitsförderung und Schulqualität<br />
Für Rolff (2004) "[...] betrifft Gesundheitsförderung die ganze Breite des Qualitätsbegriffs und<br />
gehört deshalb auch in jedes qualitätsbewusste Schulprogramm. Gesundheitsförderung darf<br />
nicht nur ein toleriertes Hobby einzelner Lehrkräfte sein. Es gehört zum Kern des schulischen<br />
Qualitätsmanagements. Qualität wird in allen neueren Konzepten des Qualitätsmanagements<br />
ganzheitlich verstanden".<br />
Rolff (2004) hebt – stärker als Seeger – die Rolle der Schulleitung hervor: "[...] Hinzu kommt die<br />
Dimension "Schulmanagement", die ihre Bedeutung aus dem Forschungsergebnis zieht, dass<br />
es keine gute Schule ohne gute Schulleitung gibt. [...] Zielführendes Handeln ist [...] der Ausgangspunkt<br />
des Qualitätsmanagements. Auch Zielvereinbarungen, z. B. zwischen Behörde und<br />
Schulleitung oder Schulleitung und Fachgruppen, gehören zum zielführenden Handeln. Die<br />
Zielsetzungen sollten aus dem Leitbild bzw. den darauf bezogenen Entwicklungsschwerpunkten<br />
hergeleitet werden".<br />
3.3 Erfahrungen an der eigenen Schule – Qualität managen<br />
Noch bevor die Qualitätsdiskussion in der Bildungslandschaft des Kantons Bern richtig losging<br />
und einzelne Schulen unterschiedliche Qualitätssysteme kennen lernten, machte die Schule<br />
Affoltern ihrerseits ersten Erfahrungen mit Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement. Angeleitet<br />
durch das Coaching von Berner Gesundheit wurde das Kollegium mit dem Regelkreis<br />
bekannt gemacht und erste Projekte wurden konzipiert. Einzelne Massnahmen aus dem Suchtpräventionskonzept<br />
wurden in den Schritten "Planung – Durchführung – Auswertung – Dokumentation"<br />
umgesetzt. Um Verbindlichkeit der Schule punkto Gesundheitsförderung zu<br />
unterstreichen, wurde auf das Schuljahr 2003/2004 an der Schule eine "Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung"<br />
gebildet, einerseits um die Kontaktperson für Gesundheitsförderung (Kontaktperson<br />
zum Netzwerk) zu entlasten, andererseits um die Verantwortung für die<br />
Gesundheitsförderung auf mehrere Schultern zu verteilen.<br />
z.B. Projekt "Dranbleiben"<br />
Aus dieser Arbeitsgruppe heraus wurde das jüngste Projekt "Dranbleiben" (April 2005 bis März<br />
2006) lanciert.<br />
- 18 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Meine Aufgabe als Schulleiter im Projekt "Dranbleiben" bestand darin, die Qualitätsgrundsätze<br />
zu klären und in den Zusammenhang der Schulkultur und -geschichte zu stellen. Dadurch<br />
profitierten die Berufseinsteigenden und jungen Lehrpersonen. Da es sich um ein Projekt der<br />
ganzen Schule handelte (Kindergarten bis 9. Klasse), unterstützte ich die Arbeitsgruppe und<br />
das Kollegium, indem ich die inhaltlichen, zeitlichen und qualitativen Ansprüche an das<br />
Vorhaben klären half. Eine weitere Aufgabe lag darin, ein griffiges Motto zu finden, das die<br />
Umsetzung der verschiedenen Aktivitäten unterstützte und mithalf, das Anliegen nach aussen<br />
zu tragen. Als Schulleiter war ich auch Berater bei organisatorischen Fragen und Ideengeber.<br />
Das Projekt zeigt gut, wie Qualitätsmanagement an der Schule Affoltern funktioniert:<br />
Qualitätsgrundsätze<br />
- klassenübergreifender Anlass<br />
- längerfristig angelegtes Projekt<br />
- Bezug zu Schulklima (Verhältnisprävention)<br />
- Elternfortbildung<br />
- Partizipation von Kindern<br />
Q- Dokumentation<br />
- Zeitungsbericht mit Foto<br />
- Bericht der Evaluation<br />
Q- Planung<br />
- Analyse und Beobachtungen<br />
- Motto und Themenwahl<br />
- Zielsetzung<br />
- Konzeption und Bezug zu GF<br />
- Etappierung<br />
- Evaluation<br />
Qualitätsmanagement<br />
Projekt "Dranbleiben"<br />
Q- Evaluation<br />
- Interview mit Schülerinnen/ Schülern<br />
- Umfrage bei Lehrpersonen<br />
- Resultate und Schlussfolgerungen<br />
Q- Steuerung<br />
- Durchführen von Projekttagen<br />
"Dranbleiben"<br />
- Elternabend zum Thema<br />
"Dranbleiben"<br />
- Reflexion des Projekts in der<br />
AG und im Kollegium<br />
- Inputs für Schülerinnen und<br />
Schüler<br />
(Bewegungsaktivitäten,<br />
Wettbewerb)<br />
- Abschlussveranstaltung mit<br />
Wettbewerbauflösung<br />
Abbildung 8: QM des Projektes "Dranbleiben" (eigene Grafik)<br />
3.4 Reflexion<br />
Wie viel Qualitätsmanagement braucht die Schule? Diese Frage stellt sich immer dann, wenn<br />
ein Projekt von den Aktivitäten lebt und unterrichtsnah ausgelegt ist. Wenn die Begeisterung<br />
des Kollegiums, das Know-how in Unterrichtsfragen, die sprudelnden Ideen und die grosse<br />
Kreativität einander beflügeln, kann Qualitätsmanagement zu einer Art "Bedrohung" oder<br />
"Belastung" werden. Im Kollegium heisst es dann: "Auch das noch!" oder "Ziele sind schon gut,<br />
- 19 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
lastung" werden. Im Kollegium heisst es dann: "Auch das noch!" oder "Ziele sind schon gut,<br />
Hauptsache ist aber doch, dass es fägt!" oder "Evaluation wozu? Wir hatten doch Erfolg".<br />
Während die Verantwortung für Qualitätsmanagement in den ersten Jahren von Schulentwicklung<br />
ganz bei der Schulleitung lag, half die Bildung von verschiedenen Arbeitsgruppen mit, die<br />
Herausforderung auf mehrere Personen zu verteilen. Eine Checkliste für die Arbeit der Arbeitsgruppe<br />
erwies sich als hilfreich: Sie gab Hinweise zu den Zielen, definierte die Rahmenbedingungen<br />
und hielt den Auftrag für die Arbeitsgruppe fest.<br />
Meine Aufgabe als Schulleiter bestand nun vor allem darin, die Zusammenhänge und Hintergründe<br />
(Ottawa Charta) aufzuzeigen, neue Erkenntnisse aus der Gesundheitsförderung einzubringen,<br />
Akzente zu setzen und Vorhaben darin zu fördern, dass sie der Profilbildung der<br />
Schule dienten.<br />
Im Rückblick wird klar, dass - dank der sorgfältigen und professionellen Hinführung durch Berner<br />
Gesundheit – das Qualitätsmanagement an der Schule Affoltern rasch zur Selbstverständlichkeit<br />
und als wesentlich erkannt wurde. Diese Grundhaltung erleichtert bis heute die<br />
Gesundheitsförderung. Als Schulleiter bleibt es meine Aufgabe, die Balance zwischen systematisch<br />
und nützlich/schlank zu finden, damit Qualitätsmanagement nicht erschlagend oder beliebig<br />
wird. Schliesslich habe ich darüber zu wachen, dass Qualitätsmanagement nicht zum Inhalt<br />
wird. Alle haben Qualitätsverantwortung – sie liegt nicht alleine bei der Schulleitung. So kann es<br />
der Schule Affoltern gelingen, das zu tun, was versprochen wurde.<br />
4. Welche Rolle hat die Schulleitung im Qualitätsmanagement einer<br />
gesundheitsfördernden Schule?<br />
In diesem Kapitel zeige ich die verschiedenen (Rollen-) Verständnisse von Schulleitung auf,<br />
beleuchte die Auswirkung von Globalisierung und Autonomiebestrebung für die Schulleitenden<br />
und zeige ihre Position im stetigen Wandel auf. Schliesslich wird die Schlüsselrolle der Schulleitung<br />
im Qualitätsmanagement beschrieben und begründet und anhand der eigenen Erfahrung<br />
erläutert.<br />
4.1 Schulleitungsverständnisse<br />
Schulleitung ist nicht gleich Schulleitung. Das Verständnis von Schulleitung variiert in der<br />
Schweiz von Kanton zu Kanton, aber auch innerhalb der Verbände. Für das Verständnis der<br />
Schulleitungsrolle kann es hilfreich sein, die unterschiedlichen Ansätze zu vergleichen.<br />
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hält ihr Verständnis von Schulleitung im<br />
Schulleitungsdossier 10 vom 15.10.2001 fest. Darin überträgt sie der Schulleitung Verantwortung<br />
10 Schulleitungsdossier: Vorlage für ein Pflichtenheft für Schulleitungen. In der kommentierten Fassung beschreiben folgende<br />
Schwerpunkte die Aufgabe der Schulleitung: (siehe unten)<br />
1. Schulleitung ist eine Führungsaufgabe, die im Schulganzen gegenüber dem Lehrerkollegium und den einzelnen Lehrkräften<br />
durch dafür geeignete, ausgebildete, und von der Schulkommission gewählte Personen bewältigt wird.<br />
2. Die Position der Schulleitungsperson innerhalb des Kollegiums beinhaltet sowohl Gleichgestellt- wie auch Vorgesetztsein.<br />
Sicher ist sie aber nicht die Position der "prima inter pares". Schulleitungspersonen sind von Gesetzes wegen zur Übernahme<br />
von Führung verpflichtet.<br />
3. Schulleitung heisst Steuerung schulischer Qualitätsentwicklung<br />
4. Schulleitung heisst Organisations- und Teamentwicklung<br />
5. Schulleitung heisst Personalführung<br />
6. Schulleitung heisst Kommunikation nach aussen<br />
7. Schulleitung heisst Zusammenarbeit mit Schulkommission und Inspektorat<br />
(ERZ, 2001, S. 2).<br />
- 20 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
für die Bereiche Führung, Steuerung und Qualitätsentwicklung, Organisation und<br />
Teamentwicklung, Personalführung, Kommunikation nach aussen und Zusammenarbeit mit<br />
Schulkommission und Inspektorat. Die Stellung der Schulleitung gegenüber dem Kollegium<br />
beschreibt das Schulleitungsdossier: "Solange Schulleitungspersonen in ihrer Schule Unterricht<br />
erteilen (was innerhalb gewisser Grenzen wünschbar ist), sind sie gleichzeitig Kolleginnen resp.<br />
Kollegen der anderen Lehrkräfte. In der Schulleitungsfunktion sind sie aber Führende und<br />
Vorgesetzte. Die zukünftigen Schulleiterinnen und Schulleiter müssen die Entwicklung vom<br />
reinen Lehrerberuf zum Schulleiterberuf mit Lehrverpflichtung vollziehen" (ERZ, 2001, S. 2).<br />
Der Verband Schulleiterinnen Schulleiter Schweiz (VSL CH) seinerseits unterstreicht im<br />
Positionspapier 11 vom 15.11.2005 den Führungsanspruch und die Kompetenzen der<br />
Schulleitung in den Bereichen Pädagogik, Qualität, Personelles, Finanzen, Infrastruktur,<br />
Organisation, Kommunikation und Rechtliches. Das Konzept ist angelehnt an Aussagen zu<br />
Führung und Qualitätsmanagement aus der Wirtschaft. Konzept und Rechenschaft sind<br />
zentrale Begriffe.<br />
Der Verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz betont im Positionspapier Schulleitungen 12 vom<br />
5.12.2005, dass Schulleitung verfasst und ausgehandelt werden müsse. Es gehe in einem hoch<br />
komplexen System mit hoch qualifiziertem Personal nicht an, Schulen nach sich ständig wandelnden<br />
Management-Moden zu leiten. Das Aushandeln von Regeln, Kompetenzen und Zuständigkeiten<br />
bilde die Grundlage für die Schulleitungen, die Partizipation ernst nehmen und im<br />
Hinblick auf die Ressourcen weise handeln. Die Schulleitung und das Kollegium seien der organischen<br />
und verlässlichen Schulentwicklung verpflichtet. "Der LCH sieht die Rolle der Schulleitung<br />
in der Unterrichts- und Schulentwicklung als kluge Mischung von Herausforderung,<br />
Planungshilfe, Insistieren auf Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit, Vermittlung von internen und<br />
externen Ressourcen und Schutz vor Überforderung durch überbordende innere oder äussere<br />
Impulse. Die Schulleitung sorgt insbesondere für eine mittel- bis langfristige Planung (Entwicklungsprogramm),<br />
welche Synergien zwischen den Entwicklungsvorhaben, Berechenbarkeit und<br />
Machbarkeit gewährleistet" (LCH, 2005, S.26).<br />
4.2 Die Schulleitung in der globalisierten Welt - eine Agentin des Wandels?<br />
Die Globalisierung beeinflusst auch das Schulwesen. Zu dieser Einsicht kommt Schratz:<br />
Einerseits seien die Schulen autonomer geworden, eigenmächtiger – gleichzeitig aber auch<br />
11 Positionspapier zur Schulleitung: Der Verband Schulleiterinnen Schulleiter Schweiz (VSL CH) hält in Grundsätzen die Aufgaben<br />
der Schulleitung fest. Es wird versucht, die Rollen von Behörde, Schulleitung und Lehrpersonen zu klären und zu unterscheiden.<br />
Zur Rolle der Schulleitung werden folgende Aussagen gemacht (Ausschnitt):<br />
- Die Schulleitung führt die Schule im pädagogischen Bereich.<br />
- Die Schulleitung erarbeitet mit dem Schulteam ein umfassendes Qualitätsentwicklungs- und Evaluationskonzept und sorgt für<br />
deren Umsetzung. Sie legt der Behörde Rechenschaft ab.<br />
- Die Schulleitung führt das Personal der Schule.<br />
- Die Schulleitung erstellt das Jahresbudget, verfügt über die gesprochenen finanziellen Mittel und legt darüber Rechenschaft<br />
ab.<br />
- Die Schulleitung sorgt für die Planung der Infrastruktur und deren Umsetzung.<br />
- Die Schulleitung führt die schulinterne Organisation.<br />
- Die Schulleitung sorgt für ein Kommunikationskonzept und ist für Vernetzung, Koordination und Information der Schule nach<br />
innen und aussen verantwortlich.<br />
- Die Schulleitung sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen, der Weisungen sowie der<br />
Teambeschlüsse. Sie verfügt über Sanktionskompetenz. (VSL CH, 2005, S.3).<br />
12 Positionspapier Schulleitungen des Verbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH): Die Publikation macht Aussagen zu<br />
folgenden Punkten:<br />
- Schulen brauchen eine verfasste Leitung<br />
- Dem Bildungsauftrag und einem guten Arbeitsklima verpflichtet<br />
- Der organischen und verlässlichen Schulentwicklung verpflichtet<br />
- Vorschriften hüten und zwischen Interessen vermitteln<br />
- In geklärten Zuständigkeiten balancierte Macht wahrnehmen<br />
- Kompetent und entlastend dank ausreichender Ressourcen (LCH, 2005, S.26-28)<br />
- 21 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
ohnmächtiger und in der Ungewissheit orientierungsloser. Die Globalisierungsvorgänge<br />
brächten eine Neuverteilung von Macht durch den "diskontinuierlichen Umbau von Institutionen,<br />
der flexiblen Spezialisierung der Produktion und der Konzentration der Macht ohne<br />
Zentralisierung". Schratz (1999, S. 2) beschreibt die Diskrepanz von Autonomie und Kontrolle:<br />
"Während sich einerseits für die Schulen [...] neue Chancen der Selbstentwicklung eröffnen,<br />
laufen die Bedingungen, unter denen die Akteure dazu 'ermächtigt' (empowered) werden sollen,<br />
eher in die Gegenrichtung: In einigen Fällen werden die Anforderungen an die Lehrerschaft<br />
verstärkt (höhere Stundenverpflichtung, grössere Schülerzahl pro Klasse, längere<br />
Anwesenheitspflicht an der Schule u.a.m.), in anderen die Rahmenbedingungen erschwert<br />
(Einschränkung von finanziellen Spielräumen, Abbau von Stellen, Umschichtung von Budgets<br />
u.a.m.), vielfach neue Aufgaben formuliert, die eine systematische, langfristige Arbeit<br />
erschweren. Das einzig Beständige ist der Wandel [...]". Die Autonomisierung habe dazu<br />
geführt, "dass es zu einer Neubestimmung zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen<br />
Selbststeuerung und Kontrolle gekommen ist [...]" (Schratz, 1999, S. 6). Die erweiterten<br />
Entscheidungsspielräume und entstandene Vielfalt könnten nicht im herkömmlichen Sinn<br />
kontrolliert werden. Während diese zentrale Kontrolle – z.B. durch die Schulaufsicht<br />
(Schulkommission) – abgenommen habe, wachse die Kontrolle durch die Globalisierung mittels<br />
Qualifizierungsmassnahmen oder Qualitätssicherung. Die Schnittstelle zwischen<br />
Autonomisierung und Globalisierung ist ein "[...] Spannungsfeld zwischen Profilierung der<br />
Einzelschule [...] und der staatlichen Kontrolle des Schulsystems" (Schratz, 1998, S. 172) und<br />
deshalb in hohem Grad konfliktträchtig, wie die Grafik darstellt.<br />
weniger Kontrolle durch Autonomisierung<br />
STANDORT<br />
SCHULE<br />
BILDUNG<br />
SYSTEM<br />
stärkere Kontrolle durch Globalisierung<br />
Abbildung 9: Schnittstellenkonflikt zwischen Autonomisierung und Globalisierung (Schratz, 1999, S. 7)<br />
Daher plädiert Schratz (1999, S. 14) für ein "systemisches Beziehungsgefüge zwischen kontextueller<br />
Steuerung (Aufsichtssystem) und operativer Steuerung (Schule) [...]". Zwischen beiden<br />
Systemen spiele die Beziehungspflege der Schnittstelle eine zentrale Rolle. Durch die Kooperation<br />
und geklärte Formen der Zusammenarbeit entstehe Qualität, vorausgesetzt, dass "die<br />
Steuerung sich auf den Prozess des Aushandelns und Verstehens von Qualität einlässt"<br />
(Schratz, 1999, S. 17).<br />
- 22 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
kontextuelle Steuerung<br />
Die Schulaufsicht...<br />
operative Steuerung<br />
Die Schule...<br />
... leistet Designarbeit im System ... versteht sich als lernende Schule<br />
... stellt Erfolgspotentiale bereit ... definiert Erfolgskriterien<br />
... bemüht sich, Qualität (an Schule) zu verstehen ... setzt eigene Qualitätsstandards<br />
... betreibt Super-Vision ... schöpft Gestaltungsräume aus<br />
... betreibt Meta-Evaluation ... evaluiert ihre eigene Arbeit<br />
Abbildung 10: Dezentrales Steuerungsmodell im systemischen Bezug (Schratz, 1999, S. 14)<br />
An dieser Schnittstelle zwischen System und Umwelt steht die Schulleitung. Sie hat nach<br />
Schratz (1998, S. 173) die Aufgabe, "den Umgang der Schule mit den Irritationen an den<br />
Schnittstellen [...] so zu steuern, dass diese als Anregung und Chance für die Entwicklung gesehen<br />
werde [...]. Da der bewusste Umgang mit den Schnittstellen innerhalb und ausserhalb<br />
des Systems ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Lernenden Schule darstellt, benötigt sie diesbezüglich<br />
eine operationale Geschlossenheit, d.h. einen vereinbarten und von allen getragenen<br />
Gemein-Sinn. Je klarer die Nahtstellen der möglichen Interaktionen definiert sind, umso besser<br />
können sich die Betroffenen orientieren und damit interagieren [...]. Dieses Denken aus den<br />
Nahtstellen des Systems schafft Klarheit und setzt dadurch Energie frei für die Inhalte, die<br />
kommuniziert werden".<br />
4.3 Die Gesundheitsförderung ist Aufgabe der Schulleitung<br />
Die Schulleitung hat in der Qualitätsentwicklung einer gesundheitsfördernden Schule die<br />
Schlüsselrolle inne. Verschiedene Fachstellen und Fachleute unterstreichen diese These und<br />
beschreiben die Aufgabe der Schulleitung mit umfassenden Anforderungen. Es fällt auf, dass<br />
neben Qualitätsmanagementwissen, Übersicht über die Bildungstendenzen, Schulentwicklungserfahrungen<br />
und eigenen Unterrichtskompetenzen vor allem soziale Kompetenzen verlangt<br />
sind, um die Lehrerinnen und Lehrer in den "windigen" Zeiten sicher zu leiten und zu<br />
führen.<br />
Schulleitung als Verantwortliche für gesundheitsfördernde Prozesse<br />
In geleiteten Schulen liegt gemäss SNGS die Planung, Umsetzung und Evaluation der gesundheitsfördernden<br />
Prozesse in der Verantwortung der Schulleitung. Das Netzwerk will diese<br />
Prozesse in Schulen unterstützen. Die Entwicklung der Schule in Richtung Gesundheitsfördernde<br />
Schule setzt eine gemeinsame Strategie aller Beteiligten voraus, die sowohl den Bereich<br />
Bildung wie Gesundheit betrifft. Deshalb konzentriert sich seine Beratung und Begleitung<br />
auf die Strukturbildung in der Organisation Schule. Die Gesundheitsförderung bringt ihre Anliegen<br />
in die Entwicklung der Schule und des Unterrichtes ein und beeinflusst so deren Qualität.<br />
Dieses Commitment 13 muss in der Schule hergestellt werden.<br />
13 Commitment: In der Organisationspsychologie ist der Begriff "Commitment" von zentraler Bedeutung. Aus dem englischen<br />
übersetzt heisst Commitment "Selbstverpflichtung" oder "freiwillige Bindung". Der Begriff skizziert das Ausmass, mit dem sich<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Unternehmen verpflichtet fühlen oder in der Arbeit aufgehen.<br />
- 23 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Schulleitung als soziale Architektin<br />
Alle Beteiligten in die Gesundheitsförderung einzubinden, ist eine der Herausforderungen der<br />
Schulleitung. Deshalb sieht Seeger in der Schulleitung eine soziale Architektin, die auf der Beziehungs-<br />
und Kontaktebene besonders gefordert ist und eine (Schulklima-) Wettermacherin ist.<br />
Ihre Qualitätsarbeit hat nach Seeger (2003, S. 52) drei Bereiche:<br />
Klarheit schaffen<br />
o Ziele klären und Mandate erteilen<br />
o Erfolge und Misserfolge reflektieren<br />
Kontexte herstellen<br />
o Innovationen im Schulprofil bzw. -programm abbilden<br />
o Schulprofil in den Zusammenhang zur gesellschaftlich Entwicklungen stellen<br />
Sichtbarkeit erzeugen<br />
o Kultur der Wertschätzung entwickeln und pflegen<br />
o mit Schulprofil profilieren<br />
Schulleitung als Hüterin von "High Performance – Low Burnout" 14<br />
Gerade die Pflege der Beziehungen und die Verantwortung für die "soziale Architektur" der (gesundheitsfördernden)<br />
Schule bergen für die Schulleitung grosse Burnout-Fallen. Was auf der<br />
Beziehungsebene gut oder schlecht läuft, nährt oder beansprucht die Ressourcen der Schulleitungsverantwortlichen<br />
stärker als organisatorische Fragen. Hohe Ansprüche an die Qualität von<br />
Schulentwicklung (Stichwort "Gute Schule") verbunden mit Widerständen gegen (Gesundheitsförderungs-)<br />
Projekte werden zum Gesundheitsrisiko von Schulleitungen. Strittmatter (2002. S.<br />
8) fordert deshalb, dass Schulentwicklung die wichtigsten Erkenntnisse über Merkmale wirksamer<br />
Schulen und gesunderhaltender Arbeitsplatzbedingungen in eine Synthese zu bringen habe.<br />
Im Marbacher Handlungsmodell 15 zeigt er auf, dass eine nachhaltige Wirkung im Sinne der<br />
Leistungssteigerung und gleichzeitiger Burnout-Prophylaxe durch ein stimmiges Zusammenspiel<br />
aller oder der meisten Systemelemente erreicht wird. Der Kernbereich Schulleitung lässt<br />
sich nach Strittmatter (2002, S. 10) durch die folgenden Prinzipien beschreiben:<br />
o Eine Schulleitung arbeitet ergebnisorientiert und sorgt für verbindliche, gemeinsam ausgehandelte<br />
Zielschwerpunkte, deren Umsetzung und Evaluation.<br />
o Eine Schulleitung fördert das Verstehen und Lernen und kann dank dem Steuerungswissen<br />
mit Erfolgen und Misserfolgen umgehen.<br />
o Eine Schulleitung fördert die Kooperation und stärkt die Mitverantwortung mit partizipaktivem<br />
Führungsstil und dem partizipativen Aushandeln von Entscheiden.<br />
o Eine Schulleitung beschafft sich unterstützende Ressourcen, sei es materiell oder durch<br />
externe Hilfe, damit die Lehrerinnen und Lehrern den gebotenen Support als Wertschätzung<br />
erleben.<br />
Strittmatters zentrales Anliegen, dass wichtige Entscheide auf dem Weg zu einer gesunden<br />
14 High Performance – Low Burnout: Leitidee aus dem Artikel zum Marbacher Handlungsmodell von A. Strittmatter (Strittmatter,<br />
2002. S. 8). Siehe folgende Fussnote.<br />
15 Marbacher Handlungsmodell: Das Modell ist in drei Dimensionen gegliedert: Günstige Rahmenbedingungen, vier hauptsächliche<br />
schulische Entwicklungsfelder, Kernbereich Schulleitung. Der Entwicklungsprozess kann grundsätzlich an beliebigen Stellen des<br />
Handlungsfeldes ansetzen. Empfehlenswert ist jedoch der Ansatzpunkt «Definition von Leitideen / Kernzielen» zusammen mit<br />
«Entwicklung der Schulleitung" (Strittmatter, 2002. S. 9).<br />
- 24 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Schule "verhandelbar" und "aushandelbar" sein müssen, findet im Positionspapier<br />
Schulleitungen des Verbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz seinen Niederschlag (siehe<br />
Fussnote 12). Strittmatter kennt die Schwierigkeiten der (vor allem mittleren bis grossen)<br />
Lehrkollegien. In seinem Konzept spürt man auch das Widerstandspotential von Kolleginnen<br />
und Kollegen, die in einer geleiteten Schule um ihre Autonomie fürchten. Hier liegt eine der<br />
Gefahren von Burnout bei Schulleitungen.<br />
4.4 Zusammenfassung<br />
Schulleitungen an gesundheitsfördernden Schulen sind auf allen Ebenen gefordert: Einerseits<br />
befinden sie sich je nach Schulumfeld (Kantone) in einem luftleeren Raum, was ihre gesetzlichen<br />
Grundlagen und Kompetenzen anbelangt. Die widersprüchlichen, auf unterschiedlichen<br />
Weltanschauungen basierenden (gewerkschaftlichen) Rahmenbedingungen erschweren die<br />
Arbeit in einer (Schul-) Welt, die nach Autonomie und Eigenverantwortung schreit. Andererseits<br />
ist die Schulleitung den Gegenströmungen von Harmonisierung, Leistungsorientierung, autoritären<br />
Ansprüchen u.v.m. ausgesetzt. Ständige Reformen - wenig durchdacht und in der Umsetzung<br />
kaum finanzierbar - begleiten die Schulleitungen nicht nur im Kanton Bern seit Jahren.<br />
Schliesslich ist die Schule mit der Öffnung und Profilbildung öffentlicher geworden. Auf verschiedenen<br />
Ebenen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulbehörden, Gemeinden, Kanton)<br />
stellen Menschen Ansprüche an die Gestaltung, Erscheinung und Qualität der Schule. Das<br />
Kerngeschäft Unterricht ist zu einem Bereich neben andern geworden. All diese Ansprüche sind<br />
in hohem Masse konfliktträchtig und verlangen hohe Kompetenzen in all den verschiedenen<br />
Führungsaufgaben. Die gesundheitsfördernde Schule entwickelt sich deshalb nur nachhaltig,<br />
wenn die Schulleitung ihre Schlüsselrolle im Qualitätsmanagement wahrnehmen kann und in<br />
dieser höchst anspruchsvollen Aufgabe die entsprechende Unterstützung erhält.<br />
4.5 Erfahrungen an der eigenen Schule – die Rolle der Schulleitung<br />
An der Schule Affoltern erlebten wir auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Schule viele<br />
der Herausforderungen, wie sie oben beschrieben sind. Das Qualitätsmanagement entstand<br />
nach und nach auf Grund der Erfahrungen mit gesundheitsfördernden Themen und Projekten.<br />
In Anlehnung an das Modell "QM einer gesundheitsfördernden Schule" von Seeger (siehe<br />
Abbildung Seite 17) spielten folgende Punkte eine zentrale Rolle:<br />
<br />
Struktur- Qualität durch Verankerung:<br />
Die Gesundheitsförderung<br />
ist im Schulleitbild verankert<br />
Der erste Satz in der Präambel des Leitbildes "Die Schule<br />
Affoltern ist eine gesundheitsfördernde Schule und steht auf<br />
einer guten Basis" legt fest, dass an der Schule Affoltern Gesundheitsförderung<br />
die Grundlage der gemeinsamen Schulentwicklung<br />
bildet.<br />
Das Leitbild erweist sich als tragfähige Grundlage für ein zielgerichtetes<br />
Handeln. Alle Schulentwicklung basiert bisher auf<br />
den Aussagen des Leitbildes.<br />
Für das Qualitätsmanagement der gesundheitsfördernden<br />
Schule bildet es die Richtschnur und Legitimation.<br />
Eine Dreijahresplanung<br />
schafft Transparenz und<br />
Zielorientierung<br />
Die Dreijahresplanung ermöglicht, die grossen Linien und die<br />
benötigten Ressourcen frühzeitig zu erkennen. Für die<br />
Lehrpersonen kann Verbindlichkeit geschaffen werden. Sie<br />
können sich auf die geplanten Schwerpunkte verlassen. Für<br />
Neueinsteigende ist der Weg der Schulentwicklung und<br />
- 25 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Umsetzungen nachvollziehbar und garantiert Kontinuität.<br />
Dank der Aufteilung in die drei Dimensionen<br />
o Unterricht / Eltern und Schüler<br />
o Ressourcen und ideelle Werte<br />
o Persönlichkeit und Team<br />
wird sichergestellt, dass die Qualität der Schule in allen Bereichen,<br />
die an die Lehrpersonen gestellt werden, entwickelt<br />
wird.<br />
Qualifizierte und mandatierte<br />
Verantwortliche für<br />
Gesundheitsförderung<br />
Zeit-, Geld- und Personalressourcen<br />
Seit ca. 5 Jahren übernimmt eine vom Kollegium gewählte<br />
Kontaktperson die Verbindung zum Netzwerk. Sie ist zugleich<br />
verantwortlich für gesundheitsfördernde Aktivitäten an der<br />
Schule und für die Dokumentation. Aus dem Schulpool sind<br />
für dieses Amt zwei Anstellungsprozente reserviert. Damit wir<br />
die Bedeutung dieser wichtigen Aufgabe unterstrichen.<br />
Fixe Zeitgefässe für spezielle gesundheitsfördernde Anlässe<br />
sind ebenso festgelegt wie die Möglichkeit, Themen an der<br />
Pädagogischen Konferenz zu besprechen. Ein weiteres Zeitgefäss<br />
sind die reservierten Sperrstunden. Dank grosszügigem<br />
Budget für die internen Anlässe und Projekte waren<br />
auch aufwändige Vorhaben nicht gefährdet.<br />
<br />
Prozess-Qualität durch Partizipation<br />
Transparente und partizipative<br />
Prozessabläufe<br />
Die Arbeitsgruppe oder die Kontaktperson klären die Bedürfnisse<br />
der Schule ab, planen die Projekte, legen sie dem Kollegium<br />
offen und nehmen Anregungen entgegen, führen das<br />
Projekt zusammen mit dem ganzen Kollegium durch, reflektieren<br />
diese gemeinsam und dokumentieren das Vorhaben.<br />
Positive Erfahrungen und ernstgenommene Kritik verbessern<br />
die Ausgangslage für die nächsten Projekte.<br />
<br />
Beziehungs-Qualität durch Schlüsselpersonen<br />
Kontaktperson für Gesundheitsförderung<br />
als<br />
interner Moderator und<br />
externe Brücke<br />
Die Kontaktperson für Gesundheitsförderung ist in Anlehnung<br />
an Seeger (2003. S. 54)<br />
o die Koordinatorin von Projekten<br />
o die Verbindungsperson zum Netzwerk<br />
o die Person mit dem Hauptanliegen "Gesundheitsförderung"<br />
und damit zugleich Schatzsucherin und -finderin.<br />
o der Navigator um Brücken zu bauen und Netzwerke knüpfen<br />
zu helfen<br />
o der Seismograf, um persönliche und institutionelle<br />
- 26 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Ressourcen und Stärken nicht zu strapazieren<br />
Externe Beratung durch<br />
'Kritische Freunde'<br />
An die Schule Affoltern werden seit zehn Jahren regelmässig<br />
Beraterinnen und Berater geholt, um das ganze Kollegium in<br />
zentralen Anliegen der Gesundheitsförderung zu unterstützen<br />
(z.B. Schülerinnen- / Schüler-Partizipation).<br />
Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung<br />
als Brutstätte<br />
sozialer Erfindungen<br />
Personen aus dem Umfeld "Schule" sowie Eltern, Fachpersonen<br />
und Interessierte unterstützen in dieser Funktion die<br />
Schule, übernehmen Verantwortung und tragen die Anliegen<br />
nach aussen.<br />
Eine hohe Bedeutung kommt dem Kontakt mit dem Schweizerischen<br />
Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen zu. Die<br />
Netzwerk- und Impulstagungen mit den Workshops lieferten<br />
wertvolle Anregungen.<br />
Die Arbeitsgruppe "Gesundheitsförderung" bereitet Projekte<br />
vor, arbeitet diese aus und begleitet längerfristige Vorhaben<br />
beratend (z.B. Pausenkiosk).<br />
4.6 Reflexion<br />
An einer Impulstagung des SNGS in Luzern begegnete ich einer frustrierten Netzwerk-<br />
Kontaktperson aus einer andern Schule. Sie erzählte mir, dass all ihre Bemühungen für die<br />
Verbesserung der Gesundheit an ihrer Schule im Sande verliefen. Sie sei enttäuscht und fühle<br />
sich im Stich gelassen. Ich fragte nach, wie denn die Schulleitung und das Kollegium hinter ihrer<br />
Aufgaben stünden. Ihr Antwort war für mich ein Schlüsselerlebnis: Das Kollegium ermuntere<br />
sie, Projekte anzureissen, sie spüre da und dort Gleichgesinnte und finde auch lobende Worte.<br />
Alle wären dafür, etwas Gesundheitsförderndes zu machen, falls die Zeit und die Kraft reichen.<br />
Die Schulleitung hingegen habe so viel zu tun, dass sie gar keine Zeit finde oder kein Interesse<br />
zeige für diese Aufgabe.<br />
Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung<br />
Mir wurde deutlich bewusst, welche entscheidende Bedeutung die Schulleitung für das Gelingen<br />
von Gesundheitsförderung hat:<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit Schulentwicklung praktiziert<br />
wird.<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit Unterrichtsentwicklung<br />
initiiert wird.<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit Personalentwicklung<br />
gemacht wird.<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit Schulkultur gepflegt wird<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit am Profil der Schule<br />
gearbeitet wird.<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit Werte generiert werden.<br />
- 27 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit massgebend das<br />
Schulklima gestaltet wird.<br />
o Gesundheitsförderung ist Kernaufgabe der Schulleitung, weil damit wichtige Kontakte geknüpft<br />
werden.<br />
Die Schlüsselrolle liegt bei der Schulleitung<br />
Was macht nun eigentlich die Schlüsselrolle aus? Warum kann diese Kernaufgabe nicht einfach<br />
delegiert werden? Die Antwort liegt im Begriff "Schnittstelle".<br />
Die Schlüssel-Aufgabe der Schulleitung ist das Wahrnehmen und Ausfüllen der unterschiedlichsten<br />
Schnittstellen auf allen Ebenen, mit allen Beteiligten und im ganzen<br />
Spannungsfeld im Umfeld der Schule.<br />
Diese Aufgabe ist untrennbar mit der Schulleitung verbunden. In meinen Erfahrungen sind es<br />
o die Schnittstelle mit der Schulbehörde<br />
o die Schnittstelle mit der Standortgemeinde<br />
o die Schnittstelle mit schulnahen Institutionen<br />
o die Schnittstelle mit externen Beratungspersonen<br />
o die Schnittstelle mit der Schulaufsicht (Schulkommission)<br />
o die Schnittstelle mit den Lehrerinnen und Lehrern (Kollegium)<br />
o die Schnittstelle mit den Eltern<br />
o die Schnittstelle mit den Schülerinnen und Schülern<br />
Bei allen Schnittstellen nehmen Menschen ihre Interessen wahr. Deshalb ist die Pflege der Beziehung<br />
zu den einzelnen Personen wichtigste Aufgabe der Schulleitung. Da sich die Interessen<br />
einiger Schnittstellen überlagern oder u.U. im Widerspruch zueinander stehen, muss die Schulleitung<br />
für eine funktionierende Gesundheitsförderung Missverständnisse klären bzw. Interessenskollisionen<br />
aufzeigen.<br />
Erfahrungen mit der Schlüsselrolle der Schulleitung<br />
Die eigenen Erfahrungen auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Schule bestätigen die<br />
Bedeutung der Rolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement.<br />
Erster Wegabschnitt "Suchtpräventionskonzept":<br />
o Als Schulleiter motivierte ich das Kollegium<br />
für das Projekt "Suchtprävention", fand die<br />
passende externe Beraterin für das Vorhaben<br />
und unterstützte die Analyse des Ist-<br />
Zustandes an der Schule.<br />
o Als Schulleiter unterstützte ich die Beraterin<br />
bei der Planung und Etappierung des<br />
Projekts und garantierte eine gute Kommunikation<br />
mit allen Beteiligten.<br />
o Als Schulleiter informierte ich die<br />
Schulaufsicht (Schulkommission) und<br />
Kernaufgabe<br />
Schulentwicklung<br />
Kontakte<br />
Kontakte<br />
Schulkultur<br />
Profilbildung<br />
Kontakte<br />
Schnittstelle<br />
Kollegium<br />
externe Beratungspersonen<br />
Kollegium<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
- 28 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
zeigte die Relevanz für die Schule auf.<br />
o Als Schulleiter ermöglichte ich den<br />
Einbezug der Eltern und unterstützte die<br />
Durchführung von Elternanlässen.<br />
o Als Schulleiter war ich verantwortlich für<br />
die Finanzierung der unterschiedlichen<br />
Projekte und Anlässe.<br />
o Als Schulleiter war ich verantwortlich für<br />
die Umsetzung der Massnahmen im<br />
Suchtpräventionskonzepts.<br />
o Als Schulleiter garantierte ich die<br />
Verbindlichkeit des Massnahmenkatalogs<br />
und ermöglichte Neueinsteigenden den<br />
Zugang zum Projekt.<br />
o Als Schulleiter war ich besorgt um<br />
Kontinuität und die ausgewogene<br />
Aufgabenverteilung<br />
o Als Schulleiter zeigte ich mich<br />
verantwortlich für die Auswertung von<br />
Rückmeldungen.<br />
o Als Schulleiter legte ich der Schulbehörde<br />
offen, was die Schule Affoltern punkto<br />
Schulentwicklung gemacht hat.<br />
o Als Schulleiter thematisierte ich die<br />
Ausrichtung auf die Gesundheitsförderung<br />
gemäss Leitbild bei Neuanstellungen<br />
Werte<br />
Kontakte<br />
Profilbildung<br />
Werte<br />
Unterrichtsentwicklun<br />
g<br />
Schulkultur<br />
Werte<br />
Werte<br />
Schulkultur<br />
Schulentwicklung<br />
Werte<br />
Profilbildung<br />
Schulentwicklung<br />
Personalentwicklung<br />
Eltern<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Kollegium<br />
Kollegium<br />
Kollegium<br />
Kollegium<br />
Kantonale<br />
Schulbehörde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Zweiter Wegabschnitt "Leitbild"<br />
Als Schulleiter zeigte ich die Bedeutung eines<br />
Leitbildes für die Schulentwicklung auf und<br />
motivierte das Kollegium für eine pragmatische<br />
Lösung<br />
Als Schulleiter unterstützte ich die Beraterin<br />
bei der Organisation und der Moderation.<br />
Als Schulleiter moderierte ich die Redaktion<br />
des Leitbildtextes.<br />
Als Schulleiter plante ich die Drucklegung und<br />
Finanzierung des Leitbildes<br />
Als Schulleiter unterbreitete ich das Ergebnis<br />
der Schulaufsicht (Schulkommission), ging<br />
behutsam mit den Widerständen um und klärte<br />
Kernaufgabe<br />
Schulentwicklung<br />
Schulkultur<br />
Profilbildung<br />
Werte<br />
Schulentwicklung<br />
Schulentwicklung<br />
Schulentwicklung<br />
Profilbildung<br />
Kontakte<br />
Schnittstelle<br />
Kollegium<br />
externe<br />
Beratungspersonen<br />
Kollegium<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
- 29 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
die Missverständnisse.<br />
Als Schulleiter unterstützte ich die Präsentation<br />
des Leitbildes für Eltern und Schulbehörden<br />
und organisierte die Medienberichterstattung.<br />
Als Schulleiter legte ich dem Kollegium in<br />
einem Dreijahresplan die Umsetzung des<br />
Leitbildes fest und plante die nötigen<br />
Zeitgefässe ein.<br />
Kontakte<br />
Profilbildung<br />
Schulkultur<br />
Werte<br />
Schulkultur<br />
Werte<br />
Profilbildung<br />
Eltern<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Kollegium<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Dritter Wegabschnitt "Schulkultur"<br />
Als Schulleiter schuf ich zur Förderung der<br />
Identität ein Logo und einen Namen für die<br />
Schule.<br />
Kernaufgabe<br />
Profilbildung<br />
Schnittstelle<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Kollegium<br />
Eltern<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Als Schulleiter zeichne ich mich<br />
verantwortlich für das regelmässige<br />
Erscheinen der Schulhauszeitung und die<br />
termingerechte Information der Eltern.<br />
Als Schulleiter veranlasse ich geeignete<br />
Pressemitteilung und organisiere die Bilder.<br />
Als Schulleiter initiiere und betreue ich den<br />
Internetauftritt<br />
Als Schulleiter achte ich auf klare<br />
Rahmenbedingungen für die Arbeit in den<br />
Arbeitsgruppen, unterstütze diese bei der<br />
Planung und Durchführung der<br />
verschiedenen Anlässe<br />
Als Schulleiter achte ich auf die<br />
Wertschätzung aller Beteiligten beim<br />
Abschluss eines Projekts<br />
Schulkultur<br />
Profibildung<br />
Schulklima<br />
Profilbildung<br />
Schulklima<br />
Schulkultur<br />
Profilbildung<br />
Schulklima<br />
Werte<br />
Schulklima<br />
Unterrichtsentwicklung<br />
Schulklima<br />
Werte<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Eltern<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Eltern<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Kollegium<br />
Eltern<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Kollegium<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Kollegium<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
- 30 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Als Schulleiter nehme ich Bedenken ernst<br />
und achte auf die Ressourcen des Kollegiums<br />
Schulentwicklung<br />
Werte<br />
Schulkultur<br />
Personalentwicklung<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Kollegium<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Als Schulleiter lege ich Wert auf<br />
Verbindlichkeit und schaffe Transparenz<br />
durch klare Abläufe<br />
Schulentwicklung<br />
Unterrichtsentwicklung<br />
Schulklima<br />
Schulkultur<br />
Standortgemeinde<br />
Schulaufsicht<br />
(Schulkommission)<br />
Eltern<br />
Kollegium<br />
Schülerinnen und<br />
Schülern<br />
Masshalten und Machtbewusstsein in der Schlüsselrolle<br />
Das Anliegen high performance – low burnout ist auch an unserer Schule ein zentrales Thema,<br />
dem die Schulleitung immer wieder und immer mehr Beachtung schenken muss. In den<br />
vergangenen zehn Jahren hat das Kollegium so viele Bereiche der Schulentwicklung<br />
angepackt, dass die Gefahr zum Ausbrennen latent vorhanden ist.<br />
Die Schlüsselrolle im Qualitätsmanagement birgt für die Schulleitung die Gefahr der<br />
Überforderung aller Beteiligten. In schwierigen Situationen wird auch die Gefahr der<br />
Machtballung deutlich, die die Schlüsselrolle u. U. in sich trägt. Bei häufigen Wechseln im<br />
Kollegium wird es immer schwieriger, den knowhow-Verlust bei Abgängen aufzufangen. So<br />
bleiben die Erfahrungen bei der Schulleitung gespeichert, die sich zur Kontinuität verpflichtet<br />
hat, und führt so zu einer (ungewollten) Machtkonzentration.<br />
Darum sind flache Hierarchien, die Aufteilung von Verantwortung auf viele verschiedene<br />
Schultern wichtig. An unserer Schule hat sich z.B. die Bildung der Arbeitsgruppen für die<br />
verschiedenen Anlässe als sehr hilfreich und entlastend erwiesen.<br />
Unterstützungsbedarf für die Schulleitung an einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Wie ich oben aufzeigte, liegt eine hohe Verantwortung bei der Schulleitung. Diese<br />
Verantwortung kann zugleich beflügelnd wie auch belastend sein. Für das Gelingen von<br />
Gesundheitsförderung ist die professionelle Unterstützung der Schulleitung auf allen Ebenen<br />
zentral. Dabei geht es um pragmatische, situationsgerechte, kostengünstige und effektive Hilfe.<br />
Wir haben an unserer Schule erfahren, wie wichtig externe Beratungspersonen, die<br />
Weiterbildung, Netzwerke und schulnahe Institutionen sind.<br />
o Beratung: Die Schule Affoltern wurde seit 1995 immer wieder von professionellen Coachs<br />
beraten, angeleitet und hinterfragt. Themen der Beratungen waren Teambildung und<br />
Teamentwicklung, Gesprächsführung, Beurteilung, Suchtprävention und das Erarbeiten<br />
eines Leitbildes. Allein für die Grundlagen der Gesundheitsförderung und das<br />
Suchtpräventionskonzept konnte die Schule während rund zwei Jahren auf die Beratung<br />
durch die Berner Gesundheit zählen. Dank dem unentgeltlichen Dienst der Stiftung Berner<br />
Gesundheit und dem grosszügigen Finanzierungsmodell der (ehemaligen) Zentralstelle für<br />
Lehrerinnen und Lehrerfortbildung des Kantons Bern entstanden für die Schule keine<br />
Kosten.<br />
Da die Beraterinnen und Berater nicht nur ihre fachlichen Kompetenzen einbrachten,<br />
sondern auch die anspruchsvollen Moderationen übernahmen, wurde die Schulleitung vor<br />
Rollen- und Zielkonflikten bewahrt. Zudem gaben die Rückmeldungen der Fachleute<br />
Informationen über das Schulklima und Teamkultur. Diese Erfahrungen waren für unsere<br />
Schule von grösster Bedeutung.<br />
- 31 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
Eigeninitiative neue Kontakte zu knüpfen und eigene Ressourcen zu generieren. Dabei geht<br />
vergessen, dass kleine und mittlere Schulen nicht über genügend Mittel verfügen, weder<br />
personell, noch finanziell, geschweige denn strukturell (Schulleitungsanstellung).<br />
Ob Zertifikatslehrgänge zur Gesundheitsförderung 18 , wie sie im Kanton Bern seit Herbst 2006 an<br />
der Pädagogischen Hochschule angeboten werden, für die Schulleitungen tatsächlich hilfreich<br />
sein werden, wird sich erst noch zeigen müssen.<br />
Soll Gesundheitsförderung an allen Schulen nachhaltig sein, braucht es die Schulleitungen als<br />
Schlüsselpersonen und Verantwortliche. Sie ermöglichen Kontinuität, funktionierende<br />
Schnittstellen und eine längerfristig angelegte Schulentwicklung. Aus meiner Sicht wird es<br />
darum die Aufgabe von bildung+gesundheit und ihrer Organisationen, aber auch von den<br />
Pädagogischen Hochschulen sein, die Schulleitungen zu mobilisieren, motivieren und<br />
schliesslich tatkräftig zu unterstützen, damit Gesundheitsförderung nicht zu einer Disziplin unter<br />
vielen andern verkommt, sondern sich zur besten und gesündesten Form von Schulentwicklung<br />
etabliert. Wer "Gesundheit fördern" fordert, muss Schulleitungen fördern.<br />
5. Schluss<br />
Die Schulleitung spielt die zentrale Rolle im Qualitätsmanagement von gesundheitsfördernden<br />
Schulen. Sie steht einerseits im Spannungsfeld von Autonomie/Globalisierung und<br />
Harmonisierungstendenz/Standards und hält diesen gegensätzlichen Strömungen stand. Sie<br />
wirkt ausgleichend, setzt die Kräfte ressourcenorientiert ein, setzt Prioritäten und kommuniziert<br />
die Lage der Bildungspolitik, damit die Schule nicht durch "Winde" hin und her geschüttelt wird.<br />
Das ist ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit der Lehrpersonen.<br />
In dieser Rolle ist die Schulleitung change agent, die sich mit ständig wechselnden<br />
Bedürfnissen oder Voraussetzungen auseinandersetzt und die Ressourcen zu Gunsten einer<br />
guten, passenden und stimmigen Schulentwicklung lenkt.<br />
Die Schulleitung schafft die Verbindung und den Informationsfluss zwischen den verschiedenen<br />
Ebenen einer Schullandschaft (Behörden, Schulaufsicht, Eltern, Lehrpersonen und Umwelt).<br />
Schley (1998, S. 37) hat treffend die vielseitigen Anforderungen des change management<br />
beschrieben. Sie gelten m.E. auch für Schulleitungen: "[...]<br />
o Visionen entwickeln und herausfordernde Ziele finden<br />
o Energien wecken und Kräfte entfalten<br />
o in Bewegung kommen, auflockern<br />
o gewohnte Wege verlassen, der Intuition folgen<br />
o das Tempo verändern, bewusst verlangsamen und beschleunigen<br />
o bildhaftes Darstellen und Visualisieren<br />
o mit Metaphern und Analogien arbeiten<br />
18 Im Lehrgang werden Lehrpersonen im Auftrage der Schulleitung und des Kollegiums zu Koordinatorinnen und Koordinatoren für<br />
Gesundheitsförderung (KGF) ausgebildet. Die Teilnehmenden des Lehrgangs vertiefen und ergänzen ihr Wissen im Bereich<br />
Gesundheit und Gesunderhaltung. Als Lehrperson erwerben sie einen breiten fachlichen und didaktischen Hintergrund zum<br />
Themenbereich gute, gesunde Schule. Sie werden auf ihre vielfältigen Aufgaben vorbereitet, wie fachliche Unterstützung der<br />
Lehrkräfte, Koordination von schulischen Aktivitäten, Initiierung von Projekten, internen Weiterbildungen oder Leitideen zur<br />
Früherfassung, Mitarbeit an der Schul- und Qualitätsentwicklung.<br />
- 33 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
o Bühnen bauen für gute Inszenierungen und Präsentationen<br />
o Netzwerke knüpfen, Kommunikation aufbauen<br />
o Überforderung spüren, Erschöpfung erkennen, Kraft schöpfen<br />
o Rhythmen, Zyklen, Kreisläufe herstellen<br />
o ganzheitliches Datengewinnen und leibliche Wahrnehmung<br />
o fehlende Qualitäten erfassen und als Gegenqualitäten einsetzen und unerschrocken und<br />
beherzt mit Abweichungen umgehen".<br />
Die Schlüsselrolle der Schulleitung ist nicht in erster Linie eine sachliche, fachliche sondern<br />
eine Beziehungsaufgabe, weil in allen Schnittstellen Menschen mit unterschiedlichen<br />
Bedürfnissen, Erkenntnissen, Sichtweisen und Erfahrungen ihre Aufgaben wahrnehmen. So ist<br />
die Schulleitung ein "sozialer Architekt" und ermöglicht ein gutes Schulklima. Gelingendes<br />
Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule zeigt sich nach Seeger (siehe<br />
Abbildung Seite 17) in Form von "Ergebnis-Qualität" durch "starke" Schüler und Schülerinnen<br />
und vergnügte Lehrpersonen, eine gesundheitsfördernde Schul-Organisation, (z.B.<br />
Unterricht/Projekte, Profil/Programm, Schulklima /-kultur) und wirksame Kooperationen (z.B.<br />
Team, Partner/Eltern, Netzwerke).<br />
"Das Schulklima ist einer der wichtigsten Faktoren [...]. Die Qualität des Schulklimas ist<br />
abhängig von der Qualität der Schulleitung und vom Engagement des Lehrkörpers für eine<br />
aktive gesamtschulische Gesundheitsförderung. Die Entwicklung dieser Qualitäten ist eine<br />
zentrale Aufgabe der Schulentwicklung – daher sind Schulentwicklung und<br />
Gesundheitsförderung nicht voneinander zu trennen[...]", fasst Vuille (2004, o.S.) die<br />
Ergebnisse seiner Untersuchung 19 zusammen. Sie bestätigt und unterstreicht die Schlüsselrolle<br />
der Schulleitung deutlich.<br />
Die Schule Affoltern ist auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Schule. Hinter uns liegen<br />
zehn lehrreiche, dynamische Jahre. Im Rückblick stelle ich dankbar fest, dass sich der erste<br />
Satz des Leitbildes "Die Schule Affoltern ist eine gesundheitsfördernde Schule und steht auf<br />
einer guten Basis" als klarer Wegweiser und zuverlässiger Kompass erwiesen hat.<br />
Es bleibt ein Geheimnis, warum im Kollegium – trotz häufiger Wechsel bei den jungen<br />
Lehrpersonen – zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen an diesen wichtigen Themen<br />
gearbeitet werden konnte.<br />
19 Untersuchungsergebnisse von Jean-Claude Vuille sind publiziert in „Die gesunde Schule im Umbruch“. Wie eine Stadt versucht<br />
eine Idee umzusetzen und was die Menschen davon spüren. Verlag Rüegger, Zürich, 2004.<br />
- 34 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
6. Literatur und Quellen<br />
6.1 Quellen im Internet<br />
Altrichter, H. (1999). Was ist eine 'gute Schule' und wie entwickelt sie sich?<br />
http://www.wipnet.at/db.asp?file=61&folder=/Paedagogik/Schule&back=inhalt (12.09.2003)<br />
Erziehungsdirektion des Kantons Bern (ERZ) (2001). Schulleitungsdossier.<br />
http://www.erz.be.ch/site/index/fachportal-bildung/fb-kindergartenvolksschule-index/fbvolksschule-schulleitungen/fb-volksschule-schulleitungen-schulleitungsdossier.htm<br />
(30.07.2006<br />
16:48)<br />
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) (2005). Schulleitung: Ein notwendiges Positionspapier.<br />
Bildung Schweiz 2/2005 S.26 – 28.<br />
http://www.lch.ch/bildungschweiz/pdfs/2006/artikel/02/ausdemlch_26_28.pdf (07.12.2006 21:46)<br />
Paulus, P. (2003). Mit Gesundheit gute Schule machen. Eine nationale Allianz für nachhaltige<br />
Schulgesundheit und Bildung.<br />
http://www.anschub.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F0A-F53BFCE5/anschub/Anschub.demit_Gesundheit_gute_Schule_machen1.pdf<br />
(27.07.2006 13:54)<br />
Rolff, H.-G. (2004). Gesundheitsförderung und Schulqualität. Vortrag am Kongress Gute und<br />
gesunde Schule. Dortmund (14./15.11.2004).<br />
http://80.86.187.227:8080/gugs_full/v_rolff.htm (20.04.2006 19:21)<br />
Seeger, S. (2003). Auf das Klima kommt es an! Lebensraum Schule. Bestimmbare oder<br />
beeinflussbare Klimazone? Folien zum Referat. Muttenz, 23. Oktober 2003.<br />
http://www.bl.ch/docs/ekd/inspekt/jg/reise/schulklima-ppt.pdf (21.04.2006 09:17)<br />
Seeger, S. (2004). Starke Schüler und vergnügte Lehrer. Wege zu gesundheitsfördernden<br />
Schulen. Skizze eines doppelten Paradigmawechsels.<br />
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/gesundids/medio/opus/Fortbildung/management_<br />
der_gesundheit.pdf (19.04.2006 14:13)<br />
Seeger, S. (2005a). Erste Schritte auf dem Weg zur Gesundheitsfördernden Schule.<br />
Orientierungshilfen für eine gesundheitsbezogene Schulentwicklung. Folien zu einem Vortrag<br />
vom 12.5.2005 (vom Verfasser zu Verfügung gestellt). Schlüchtern.<br />
Verband Schulleiterinnen Schulleiter Schweiz (VSL CH) (2005). Schulleitung. Positionspapier<br />
des VSL CH. 15.11.2005.<br />
http://www.vslch.ch/Positionspapier_VSLCH_051115_DV.pdf (21.04.2006 16:41)<br />
Vuille, J.-C. (2004). Schulklima und Gesundheit. Vortrag am Kongress Gute und gesunde<br />
Schule. Dortmund (14./15.11.2004).<br />
http://80.86.187.227:8080/gugs_full/f01-3.htm (15.02.2006 15:36)<br />
WHO (1998).Ottawa-Charta.<br />
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/de/hp/notion/default.asp#setting (18.04.2006 19:16)<br />
Wikipedia (2006). Suchbegriff: Qualitätsmanagement<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagement (20.04.2006 16:26)<br />
Zumstein, B. (2005). Ein Unterstützungssystem für Fachstellen-Regionale Netzwerke und<br />
Schulen. Konzept 2005 – 2007.<br />
http://www.gesunde-schulen.ch/data/data_157.pdf (18.04.2006 18:54)<br />
- 35 -
Die Schlüsselrolle der Schulleitung im Qualitätsmanagement einer gesundheitsfördernden Schule<br />
6.2 Gedruckte Literatur<br />
Ackermann, E., Blösch M., Gassmann B., Strub Ch. (Hrsg.). (2004). Gesunde Schule konkret.<br />
Eine Struktur für Gesundheitsfördernde Schulen – Erfahrungsbericht. Zürich: Pestalozzianum<br />
AFS (1999). Was heisst eigentlich Qualität. AFS Unterlagen zum Grundlagenkurs 15. Aus- und<br />
Fortbildung für Schulleiterinnen und Schulleiter. o.O. 1999<br />
Keller, H. (2003). Was ist Qualität. Handout zum Referat an der Fachtagung 'Q-Schule' des VSL<br />
CH. Hergiswil 19.11.2003<br />
Schley, W. (1998). Change Management. Schule als lernende Organisation. In: H. Altrichter, W.<br />
Schley, M. Schratz (Hrgs). Handbuch zur Schulentwicklung. Innsbruck: Studienverlag 1998, S.<br />
13-53<br />
Schratz, M. (1999). Bildungsmanagement und Steuerung. Globalisierung als Herausforderung<br />
für das Schulwesen. In: Rösner, E. (Hrsg.). Schulentwicklung durch Schulqualität. Dortmund:<br />
Institut für Schulentwicklungsforschung 1999, S. 219-241<br />
Schratz, M. (1998). Schulleitung als change agent. Vom Verwalten zum Gestalten der Schule.<br />
In: H. Altrichter, W. Schley, M. Schratz (Hrgs). Handbuch zur Schulentwicklung. Innsbruck:<br />
Studienverlag 1998, S. 160-189<br />
Seeger, S. (2005b). Bericht 2. Netzwerk-Treffen vom 1. Juni 2005. Folien zu einem Vortrag.<br />
Netzwerk Gesundheitsteams Stadtberner Schulen. Bern: Gesundheitsdienst Stadt Bern.<br />
Strittmatter, A. (2002). Leistungsfähige Schulen jenseits von Burnout. In: SNGS Rundbrief<br />
19/2002. Schweizerisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen. Luzern<br />
- 36 -