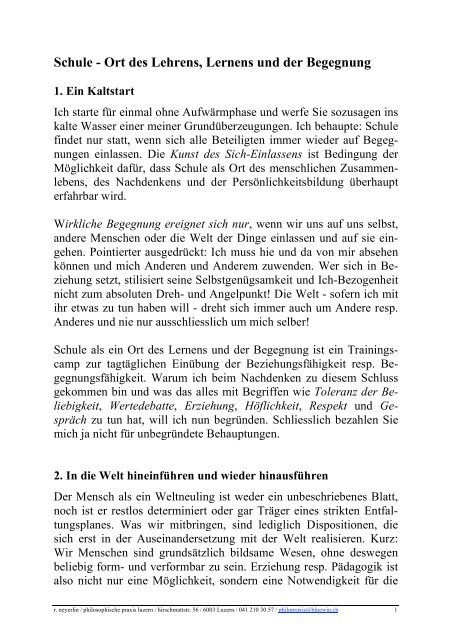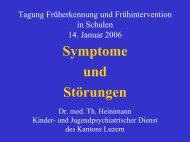Schule - Ort des Lehrens, Lernens und der ... - Gesunde Schulen
Schule - Ort des Lehrens, Lernens und der ... - Gesunde Schulen
Schule - Ort des Lehrens, Lernens und der ... - Gesunde Schulen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schule</strong> - <strong>Ort</strong> <strong>des</strong> <strong>Lehrens</strong>, <strong>Lernens</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> Begegnung<br />
1. Ein Kaltstart<br />
Ich starte für einmal ohne Aufwärmphase <strong>und</strong> werfe Sie sozusagen ins<br />
kalte Wasser einer meiner Gr<strong>und</strong>überzeugungen. Ich behaupte: <strong>Schule</strong><br />
findet nur statt, wenn sich alle Beteiligten immer wie<strong>der</strong> auf Begegnungen<br />
einlassen. Die Kunst <strong>des</strong> Sich-Einlassens ist Bedingung <strong>der</strong><br />
Möglichkeit dafür, dass <strong>Schule</strong> als <strong>Ort</strong> <strong>des</strong> menschlichen Zusammenlebens,<br />
<strong>des</strong> Nachdenkens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Persönlichkeitsbildung überhaupt<br />
erfahrbar wird.<br />
Wirkliche Begegnung ereignet sich nur, wenn wir uns auf uns selbst,<br />
an<strong>der</strong>e Menschen o<strong>der</strong> die Welt <strong>der</strong> Dinge einlassen <strong>und</strong> auf sie eingehen.<br />
Pointierter ausgedrückt: Ich muss hie <strong>und</strong> da von mir absehen<br />
können <strong>und</strong> mich An<strong>der</strong>en <strong>und</strong> An<strong>der</strong>em zuwenden. Wer sich in Beziehung<br />
setzt, stilisiert seine Selbstgenügsamkeit <strong>und</strong> Ich-Bezogenheit<br />
nicht zum absoluten Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt! Die Welt - sofern ich mit<br />
ihr etwas zu tun haben will - dreht sich immer auch um An<strong>der</strong>e resp.<br />
An<strong>der</strong>es <strong>und</strong> nie nur ausschliesslich um mich selber!<br />
<strong>Schule</strong> als ein <strong>Ort</strong> <strong>des</strong> <strong>Lernens</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> Begegnung ist ein Trainingscamp<br />
zur tagtäglichen Einübung <strong>der</strong> Beziehungsfähigkeit resp. Begegnungsfähigkeit.<br />
Warum ich beim Nachdenken zu diesem Schluss<br />
gekommen bin <strong>und</strong> was das alles mit Begriffen wie Toleranz <strong>der</strong> Beliebigkeit,<br />
Wertedebatte, Erziehung, Höflichkeit, Respekt <strong>und</strong> Gespräch<br />
zu tun hat, will ich nun begründen. Schliesslich bezahlen Sie<br />
mich ja nicht für unbegründete Behauptungen.<br />
2. In die Welt hineinführen <strong>und</strong> wie<strong>der</strong> hinausführen<br />
Der Mensch als ein Weltneuling ist we<strong>der</strong> ein unbeschriebenes Blatt,<br />
noch ist er restlos determiniert o<strong>der</strong> gar Träger eines strikten Entfaltungsplanes.<br />
Was wir mitbringen, sind lediglich Dispositionen, die<br />
sich erst in <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Welt realisieren. Kurz:<br />
Wir Menschen sind gr<strong>und</strong>sätzlich bildsame Wesen, ohne <strong>des</strong>wegen<br />
beliebig form- <strong>und</strong> verformbar zu sein. Erziehung resp. Pädagogik ist<br />
also nicht nur eine Möglichkeit, son<strong>der</strong>n eine Notwendigkeit für die<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 1
Menschwerdung <strong>des</strong> Menschen. Der Mensch, so formuliert es Immanuel<br />
Kant in seiner Pädagogikschrift, wird nur durch Erziehung zum<br />
Menschen. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. 1<br />
Wären wir Menschen bildungsunfähig, wir könnten getrost auf alle<br />
pädagogischen Bemühungen verzichten. Erziehung ist Bildung, Menschenbildung.<br />
Die Menschwerdung <strong>des</strong> Menschen ist ein Erziehungs<strong>und</strong><br />
Bildungsauftrag. Wir Erwachsene haben den Auftrag <strong>und</strong> die<br />
Pflicht, die Heranwachsenden in die Welt hineinzuführen. Daran führt<br />
kein Weg vorbei - ausser wir machen Erziehung zur Karikatur. Eine<br />
Karikatur notabene, die nach Ansicht <strong>der</strong> Philosophin Hannah Arendt,<br />
die Autorität von Erwachsenen abschafft <strong>und</strong> damit auch <strong>der</strong>en Verantwortlichkeit<br />
für die Welt, in welche sie ihre Kin<strong>der</strong> hineingeboren<br />
haben, leugnet <strong>und</strong> die Verpflichtung ablehnt, sie in diese Welt hineinzugeleiten.<br />
2<br />
Erziehung ist <strong>des</strong>halb immer auch Unterweisung! Der Philosoph <strong>und</strong><br />
Talmudgelehrte Emanuel Lévinas, sagt: „Die Unterweisung ist eine<br />
Rede, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Meister dem Schüler beibringen kann, was <strong>der</strong> Schüler<br />
noch nicht weiss. Die Unterweisung […] setzt fortwährend in mich<br />
die Idee <strong>des</strong> Unendlichen. Die Idee <strong>des</strong> Unendlichen setzt eine Seele<br />
voraus, die mehr zu erhalten vermag, als sie aus sich selbst ziehen<br />
kann.“ 3<br />
Noch einmal: Wir haben die Pflicht, Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche in die<br />
Welt hineinzuführen. Dabei haben wir Standpunkte zu vertreten <strong>und</strong><br />
Haltungen einzunehmen. Haltungen wurzeln in Menschen- <strong>und</strong> Weltbil<strong>der</strong>n,<br />
Wertvorstellungen, Normengefügen <strong>und</strong> Überzeugungen <strong>und</strong><br />
bestimmen die Art <strong>und</strong> Weise wie ich mich zu mir selbst, gegenüber<br />
den Mitmenschen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Welt verhalte. Sie geben mir Halt, weil sie<br />
mir als Orientierungshilfen ermöglichen, mein Leben zu gestalten <strong>und</strong><br />
zu verantworten. Erziehende müssen vor allem gute Orientierungsgüter<br />
bereitstellen <strong>und</strong> überzeugend für sie eintreten.<br />
1 vgl. Kant, Immanuel; Über Pädagogik, in: Immanuel Kant; Werke in 12 Bänden (Hrsg. Weischedel, Wilhelm), Frankfurt a.<br />
M. 1968, Bd. 7, S. 699.<br />
2 vgl. Arendt, Hannah, Reflections on Little Rock, in: Dissent, 1959.<br />
3 Lévinas, Emanuel; Totalität <strong>und</strong> Unendlichkeit, 262.<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 2
Jede Erziehung ist per definitionem zielgerichtet <strong>und</strong> vollzieht sich als<br />
erzieherisches Verhältnis. Ziellose Erziehung ist ein Wi<strong>der</strong>spruch in<br />
sich selbst. Ziellose Erziehung führt zu Verwahrlosung, die durch<br />
Richtungs-, Sinn- <strong>und</strong> Wesenlosigkeit gekennzeichnet ist. Ein wichtiger<br />
Beziehungspunkt resp. Bezugspunkt sind wir Erziehenden selbst -<br />
egal, ob wir es wollen o<strong>der</strong> nicht! Wir alle sind massgebend, konkretes<br />
Modell <strong>und</strong> Beispiel dafür, was Liebe, Güte, Gerechtigkeit, Respekt<br />
u.a.m. sein könnte. Auf uns kommt es an, ob sich Heranwachsende<br />
bejaht <strong>und</strong> angenommen fühlen <strong>und</strong> damit eine Basis für ihr<br />
Seelenwachstum geschaffen wird.<br />
All dies wi<strong>der</strong>spricht nicht gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>der</strong> Einsicht, dass ein Kind<br />
letztlich nicht nach einem an<strong>der</strong>en gezogen werden kann, als ihm<br />
selbst. Wir Menschen sind nicht beliebig form- <strong>und</strong> verformbar. Wir<br />
sind zwar massgeben<strong>der</strong> Beziehungspunkt, aber nicht absoluter Massstab.<br />
Weltneulinge nach seinem eigenen Bilde zu erziehen, käme einer<br />
Anmassung gleich. Die An<strong>der</strong>en sind niemals genau gleich wie ich<br />
<strong>und</strong> das ist gut so! Die An<strong>der</strong>en sind kein Duplikat von mir - wir Menschen<br />
wi<strong>der</strong>sprechen einan<strong>der</strong>!<br />
Ziel je<strong>der</strong> Erziehung muss es <strong>des</strong>halb sein, die Heranwachsenden wie<strong>der</strong><br />
aus <strong>der</strong> Erwachsenenwelt hinauszuführen. Wir sollen Menschen<br />
heranbilden, die an sich selber arbeiten lernen, <strong>und</strong> sich in eigenständiger<br />
Weise in eine menschliche Gesellschaft einordnen können. Wir<br />
können an Erziehungszielen wie Autonomie, Urteils- <strong>und</strong> Kritikfähigkeit,<br />
Selbständigkeit usw. festhalten, auch ohne dass wir Erziehung für<br />
einen moralisch an sich unstatthaften Versuch <strong>der</strong> Fremdbestimmung,<br />
für Manipulation <strong>und</strong> Indoktrination halten.<br />
Erziehung ist letztlich Befreiungsarbeit <strong>und</strong> heisst hindurchgehen statt<br />
ausweichen. Erziehung verfehlt ihr Ziel, wenn es nicht gelingt, Kin<strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> Jugendliche zunehmend in grössere Freiheiten einzuführen <strong>und</strong> zu<br />
einem eigenständigen Leben zu befähigen. Erziehung beför<strong>der</strong>t, wie<br />
Platon nie müde wurde zu betonen, die Umwandlung o<strong>der</strong> Umwendung<br />
<strong>der</strong> Seele hin zum Guten, <strong>der</strong> Wahrheit, dem Schönen <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Freiheit – auch <strong>der</strong> Freiheit gegen sich selbst. 4 Erziehung hat den<br />
mündigen Menschen im Blick.<br />
4 ebd. S. 151f.<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 3
3. Ein Set guter Orientierungsgüter<br />
Nun, stellen wir die Frage ganz konkret: Was kann uns helfen, mündige<br />
Menschen zu werden <strong>und</strong> unser Leben eigenständig zu gestalten<br />
<strong>und</strong> zu verantworten? Die Antworten ergeben sich aus <strong>der</strong> Analyse<br />
<strong>des</strong> Zeit-Designs.<br />
Betrachten wir die gegenwärtige kulturelle Landschaft, wird vor allem<br />
eines deutlich: Wir leben in einer hoch komplexen, individualisierten,<br />
fragmentierten <strong>und</strong> radikal pluralistischen Welt. Wir leben mit <strong>und</strong> in<br />
dynamischen Verän<strong>der</strong>ungsprozessen <strong>und</strong> lauter Provisorien. Die<br />
Vielfalt <strong>der</strong> Lebenswege, <strong>der</strong> Lebensweisen, <strong>der</strong> sozialen Umwelten,<br />
<strong>der</strong> Glaubens-, Sinn-, Wissens- <strong>und</strong> Orientierungssysteme, <strong>der</strong> Berufsrollen<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> gewachsenen Identitäts- <strong>und</strong> Beziehungsmuster ist e-<br />
norm.<br />
Wir bewegen uns in unsicherem Gelände: Identitätsfindung erweist<br />
sich als etwas Prekäres <strong>und</strong> <strong>der</strong> Orientierungsmangel ist notorisch.<br />
Wir Menschen von heute sind unaufhörlich auf <strong>der</strong> Suche nach uns<br />
selbst <strong>und</strong> nach Orientierung. Beinahe alles erweist sich als offen, unbestimmt<br />
<strong>und</strong> entscheidungsabhängig. Wir müssen ständig entscheiden<br />
<strong>und</strong> unser Leben neu <strong>des</strong>ignen. Doch so gut wie nichts von dem,<br />
was wir tun müssen <strong>und</strong> machen können, gründet noch in unbefragbar<br />
gewissen Überlieferungen, Routinen, Überzeugungen o<strong>der</strong> Zwängen.<br />
Unser Leben wird immer weniger von vorgegebenen Geboten, Werten,<br />
Normen <strong>und</strong> Direktiven geprägt. Am Ende aller Beratungen sind<br />
wir auf das angewiesen, was uns selbst überzeugt.<br />
Wie anspruchsvoll das alles ist, zeigt <strong>der</strong> schwierige Umgang mit<br />
Wertepluralismus <strong>und</strong> –relativismus. Gerade in einer Welt, in <strong>der</strong> radikale<br />
Pluralität in allen Lebensbereichen zur Alltagserfahrung geworden<br />
ist, wird die Allgemeingültigkeit sittlicher Massstäbe andauernd<br />
in Frage gestellt bzw. relativiert. Die unterschiedlichsten Wertesysteme,<br />
Sichtweisen <strong>und</strong> Handlungsmuster bestehen gleichzeitig nebeneinan<strong>der</strong>,<br />
konkurrenzieren sich o<strong>der</strong> kollidieren gar miteinan<strong>der</strong>.<br />
Die Frage „Was gilt eigentlich?“ wird zum Dauerbrenner. Wir Menschen<br />
von heute ringen ständig um Leitblanken, Massstäbe <strong>und</strong> Richtlinien.<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 4
Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich bei <strong>der</strong> Realisierung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung<br />
nach Anerkennung von unterschiedlichen Werthaltungen <strong>und</strong><br />
Normengefügen. Die Unterschiedlichkeit erweist sich häufig als konflikthaft<br />
<strong>und</strong> manche Konflikte scheinen unlösbar, das gegenseitige<br />
Verstehen unmöglich zu sein.<br />
Wie also angemessen mit Pluralität umgehen? Gefragt wären Pluralitätskompetenz<br />
<strong>und</strong> Differenzverträglichkeit. Sie erst würden ein<br />
grösstmögliches Mass an Freiheit <strong>und</strong> Handlungsstrategien eröffnen.<br />
Denn in einer plural verfassten Gesellschaft sind nur diejenigen handlungsfähig,<br />
die mit dieser Vielfalt umzugehen, auf sie einzugehen <strong>und</strong><br />
mit ihr zu handeln vermögen, die an<strong>der</strong>en leiden an Dauerüberfor<strong>der</strong>ung.<br />
Wer in Zukunft bestehen will, muss beziehungs- resp. begenungsfähig<br />
<strong>und</strong> dialogfähig sein. Wir brauchen eine Kultur <strong>des</strong> Dialogs,<br />
<strong>des</strong> Wi<strong>der</strong>streits <strong>und</strong> Wi<strong>der</strong>spruchs, <strong>des</strong> Zuhörens, <strong>des</strong> Sowohlals-Auch<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> argumentativen Relativismus. Wir können nicht<br />
mehr auf absolut <strong>und</strong> universell Gültiges <strong>und</strong> Verbindliches zurückgreifen,<br />
son<strong>der</strong>n wir haben in beschwerlichen demokratischen Suchprozessen<br />
<strong>und</strong> konflikthaften Auseinan<strong>der</strong>setzungen immer wie<strong>der</strong><br />
Regeln, Wertehierarchien <strong>und</strong> Handlungsziele aushandeln. Ich plädiere<br />
<strong>des</strong>halb für Auseinan<strong>der</strong>setzung versus Beliebigkeit, gegenseitigen<br />
Respekt <strong>und</strong> Dialog bzw. eine Ethik <strong>des</strong> mitmenschlichen Kontaktes,<br />
<strong>der</strong>en wichtigster Bestandteil das Zuhören ist.<br />
Das alles zusammen ergibt eine stattliche Sammlung brauchbarer Orientierungsgüter.<br />
Ich zähle die wichtigsten auf: Sie heissen Auseinan<strong>der</strong>setzung,<br />
Respekt, Zuhören-Können.<br />
3.1 Auseinan<strong>der</strong>setzung o<strong>der</strong> vom Wert <strong>der</strong> Wertedebatte<br />
Zwei Haltungen prägen unseren Umgang mit Wertepluralismus nachhaltig:<br />
Die Toleranz <strong>der</strong> Gleichgültigkeit resp. Beliebigkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
F<strong>und</strong>amentalismus. Beide gebärden sich als Begegnungsvermeidungsstrategien.<br />
In beiden Fällen findet keine wirkliche Begegnung zwischen<br />
mir <strong>und</strong> An<strong>der</strong>en <strong>und</strong> An<strong>der</strong>em statt.<br />
Der F<strong>und</strong>amentalismus rebelliert gegen eine Welt, die keine absolute<br />
Wahrheit mehr kennt <strong>und</strong> alles als relativ betrachtet. An Stelle <strong>des</strong><br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 5
Zweifels <strong>und</strong> <strong>der</strong> generellen Ungewissheit <strong>und</strong> Unsicherheit setzt er<br />
sein absolutes Wissen. Er kennt die Antworten <strong>und</strong> sie sind immer<br />
schon vor den Fragen da. Was gilt, kann hergebetet werden.<br />
F<strong>und</strong>amentalistisches Denken <strong>und</strong> Verhalten zeigt sich immer in <strong>der</strong><br />
Art <strong>und</strong> Weise <strong>der</strong> Kommunikation resp. in <strong>der</strong> Unfähigkeit, mit An<strong>der</strong>en<br />
<strong>und</strong> An<strong>der</strong>em auf gewaltlose Art umzugehen. Er ist eine Begegnungsvermeidungsstrategie.<br />
Das Weltbild von F<strong>und</strong>amentalisten duldet<br />
keine Wi<strong>der</strong>sprüche <strong>und</strong> verbietet jede dialogische Begegnung.<br />
Die Pseudo-Toleranz <strong>der</strong> Gleichgültigkeit dagegen umgeht die ernsthafte<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung aus Gründen <strong>der</strong> Bequemlichkeit. Alles<br />
wird als gleichwertig o<strong>der</strong> gleicherweise bedeutungslos <strong>und</strong> belanglos<br />
nebeneinan<strong>der</strong> gestellt. Vielheit wird hier in Form von Bequemlichkeit<br />
<strong>und</strong> zu Entlastungszwecken in Anspruch genommen. Dies zeigt<br />
sich etwa am Verhalten <strong>der</strong>er, die allem, was sie sagen ein “ich meine”,<br />
“aus meiner Sicht”, “ich vertrete die Auffassung” vorschalten<br />
<strong>und</strong> dadurch einer eingehenden, wahrhaftigen Argumentation <strong>und</strong><br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung ausweichen.<br />
Der Slogan “anything goes!” beschreibt exakt diese Haltung erkenntnistheoretischer<br />
Beliebigkeit <strong>und</strong> völliger Indifferenz. Er ist eine Mogelpackung,<br />
denn in Wahrheit verhält es sich nicht so, dass alles ginge,<br />
son<strong>der</strong>n nur einiges geht im Sinne <strong>des</strong> Gelingens, während an<strong>der</strong>es<br />
bloss ein Stück weit geht <strong>und</strong> wie<strong>der</strong> an<strong>der</strong>es schlicht daneben geht<br />
o<strong>der</strong> zugr<strong>und</strong>e geht.<br />
Toleranz <strong>der</strong> Gleichgültigkeit <strong>und</strong> F<strong>und</strong>amentalismus sind für mich<br />
keine angemessenen Umgangsformen mit Pluralismus im Allgemeinen<br />
<strong>und</strong> Wertepluralismus im Beson<strong>der</strong>en. Meine Vision ist eine an<strong>der</strong>e:<br />
Ich plädiere für die Ermöglichung von Dialogfähigkeit, Pluralitätskompetenz<br />
<strong>und</strong> Differenzverträglichkeit. Wir müssen lernen, uns<br />
ernsthaft mit Wertepluralismus auseinan<strong>der</strong>zusetzen <strong>und</strong> in redlicher<br />
Anstrengung die Frage prüfen „Was gilt denn überhaupt?“ Der Wert<br />
<strong>der</strong> Wertedebatte besteht darin, dass wir lernen, immer wie<strong>der</strong> Regeln,<br />
Wertehierarchien <strong>und</strong> Handlungsziele auszuhandeln <strong>und</strong> Basiswerte<br />
hervorzubringen, die anerkannt <strong>und</strong> auch durchgesetzt werden können.<br />
Denn ohne diese gemeinsame Suche nach Verbindlichem gibt es<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 6
kein Leben in Gemeinschaften. Wir dürfen uns nicht mit dem unverbindlichen<br />
Nebeneinan<strong>der</strong> <strong>des</strong> Vielen begnügen – auch in unseren<br />
<strong>Schule</strong>n nicht. Streiten wir also leidenschaftlich <strong>und</strong> in gegenseitiger<br />
Anerkennung um die besten Argumente <strong>und</strong> Lösungen.<br />
3.2 Zwei Tugenden – Respekt <strong>und</strong> Zuhören<br />
Gut <strong>und</strong> tugendhaft, sagt Aristoteles, werde <strong>der</strong> Mensch durch drei<br />
Dinge: durch Anlage, Gewohnheit resp. Erziehung <strong>und</strong> Einsicht. 5 Erziehung<br />
leistet demnach einen veritablen Beitrag zur Tugendhaftigkeit.<br />
Unter dem Begriff Tugend - was sich von Tauglichkeit, also von Vermögen<br />
herleitet – verstehen wir gemeinhin die erworbene Disposition<br />
o<strong>der</strong> Fähigkeit das Gute zu tun. Tugend ist nichts an<strong>der</strong>es als das Bemühen,<br />
die menschliche Kraft o<strong>der</strong> die Fähigkeit, sich gut zu verhalten.<br />
Tugendhaftigkeit ist unsere Art <strong>und</strong> Weise, menschlich zu sein<br />
<strong>und</strong> zu handeln. Ich zitiere dazu den französischen Philosophen Comte-Sponville:<br />
“Tugend im allgemeinen Sinn ist Kraft, <strong>und</strong> im beson<strong>der</strong>en<br />
Sinne: menschliche Kraft o<strong>der</strong> Menschlichkeitskraft. Man nennt<br />
dies auch die moralischen Tugenden, die bewirken, dass ein Mensch<br />
menschlicher o<strong>der</strong> […] vortrefflicher erscheint als ein an<strong>der</strong>er, <strong>und</strong><br />
ohne die wir […] mit Recht als Unmenschen bezeichnet würden. Das<br />
setzt einen Wunsch nach Menschlichkeit voraus (<strong>der</strong> natürlich historisch<br />
ist, denn eine natürliche Tugend gibt es nicht), ohne den jede<br />
Moral unmöglich wäre.” 6<br />
Tugenden gehören zu den Wertgefühlen. Sie sind nicht an die blosse<br />
Natur geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> nicht Teil eines genetischen Co<strong>des</strong>. Sie gehören<br />
nicht zur Natur - auch nicht zur menschlichen. Sie sind erworbene<br />
Qualitäten einer von Menschen errichteten Welt. Tugendhaft muss <strong>der</strong><br />
Mensch erst werden.<br />
5 Rüegg, Walter (Hrsg.); Antike Geisteswelt Bd. II, Hanau 1986, S. 164.<br />
6 Comte-Sponville, André; Ermutigung zum unzeitgemässen Leben, Hamburg 1996, S. 15.<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 7
Doch wie trägt Erziehung zu unserer Tugendhaftigkeit bei? Die Antwort<br />
ist ziemlich simpel: durch das Erlernen <strong>der</strong> Höflichkeit! Ich will<br />
das kurz ausführen.<br />
Am Anfang aller Tugendhaftigkeit steht die Höflichkeit, die selber<br />
keine Tugend ist. Tugendhaftigkeit beginnt mit <strong>der</strong> Verinnerlichung<br />
o<strong>der</strong> wenn Sie lieber wollen <strong>der</strong> Anerziehung anständiger Umgangsformen.<br />
D.h., die Höflichkeit resp. Wohlerzogenheit geht allen an<strong>der</strong>en<br />
guten Charaktereigenschaften voraus <strong>und</strong> macht sie erst möglich.<br />
Sie steht sozusagen an vor<strong>der</strong>ster Stelle.<br />
Warum ist die Höflichkeit selbst keine Tugend? Die Antwort lautet:<br />
Weil sie bloss so tut als ob sie eine Tugend wäre. Sie ist das Zur-<br />
Schau-Tragen von Tugend, aus dem die Tugendhaftigkeit überhaupt<br />
erst entstehen kann. Nur durch die Höflichkeit, die tugendhaftes Benehmen<br />
nachahmt, haben wir die Chance, vielleicht einmal tugendhaft<br />
zu werden.<br />
Ich will Ihnen diesen Zusammenhang an einem konkreten Beispiel<br />
verdeutlichen. Wenn ich ohne jede Absicht jemanden anremple <strong>und</strong><br />
mich danach dafür entschuldige, ist das eine Art künstliche, gespielte<br />
Tugendhaftigkeit. Mein Verhalten bleibt rein äusserlich. Es erfolgt reflexartig,<br />
weil ich gewisse Umgangsregeln verinnerlicht habe. Und<br />
doch demonstriere ich damit dem An<strong>der</strong>en gegenüber ein Minimum<br />
an Respekt. Ohne meine Entschuldigung - selbst wenn sie ein wenig<br />
verlogen gemeint war - könnte sich die Tugend <strong>des</strong> Respekts als Anerkennung<br />
<strong>der</strong> An<strong>der</strong>en nie entwickeln.<br />
Respekt ist die Kunst <strong>der</strong> Anerkennung An<strong>der</strong>er, weil sie an<strong>der</strong>s sind.<br />
Respekt ist eine Tugend <strong>und</strong> für das Erleben <strong>und</strong> Gestalten sozialer<br />
Beziehungen von grosser Bedeutung. Verstanden als bewusst bezeugte<br />
Handlung <strong>und</strong> Haltung, bestimmt er unser Verhältnis zu uns selbst,<br />
zu An<strong>der</strong>en <strong>und</strong> An<strong>der</strong>em. Wir sind auf gegenseitigen Respekt angewiesen.<br />
Doch wir behandeln an<strong>der</strong>e Menschen, uns selbst <strong>und</strong> die<br />
Welt <strong>der</strong> Dinge nicht von Natur aus respektvoll. Der Akt <strong>des</strong> Respektierens<br />
geschieht nicht einfach von selbst <strong>und</strong> er lässt sich nicht befehlen.<br />
Wir Menschen können immer auch an<strong>der</strong>s! Gegenseitige Aner-<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 8
kennung muss gelehrt, gelernt <strong>und</strong> andauernd eingeübt werden – <strong>und</strong><br />
dies ganz ohne Erfolgsgarantie.<br />
Dass Tugendhaftigkeit bei <strong>der</strong> Erziehung beginnt o<strong>der</strong>, um ein unschönes<br />
Wort zu gebrauchen, bei <strong>der</strong> Dressur, lässt sich auch am Beispiel<br />
<strong>des</strong> Zuhören-Könnens illustrieren. Wer seine Kin<strong>der</strong> mit Überzeugung<br />
erzieht <strong>und</strong> von ihnen tausendmal dieselben Dinge abverlangen<br />
muss, weiss um diesen Zusammenhang. Bis zum Überdruss habe<br />
ich als Kind von Erwachsenen - Grosseltern, Eltern, Lehrerinnen, Polizisten,<br />
Fussballtrainern usw. – den Satz “Wenn öpper mit eim redet,<br />
lohst me zue!” eingetrichtert bekommen. Ob ich <strong>des</strong>halb ein wirklich<br />
tugendhafter Mensch geworden bin, darüber befragen Sie besser meine<br />
Mitmenschen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so wichtig!?<br />
Vielleicht ist wichtiger, dass es Menschen gibt, die uns Tugendhaftigkeit<br />
zumuten <strong>und</strong> uns über Erziehung tugendtauglich machen. Damit<br />
keine Missverständnisse aufkommen: Nicht jede Erzieherin, nicht je<strong>der</strong><br />
Erzieher ist an Tugendhaftigkeit interessiert. Wer auf Macht, Gehorsam<br />
<strong>und</strong> Abhängigkeit aus ist, hat kein Interesse an tugendhaften<br />
Menschen, denn diese haben gelernt, sich selber zu erziehen!<br />
Doch warum bezeichne ich das Zuhören-Können als eine Tugend? Im<br />
Akt <strong>des</strong> Zuhörens vollzieht sich die bewusste Hinwendung zu An<strong>der</strong>en<br />
<strong>und</strong> An<strong>der</strong>em. Als eine bewusste Haltung <strong>der</strong> Ansprechbarkeit <strong>und</strong><br />
Aufnahmebereitschaft ist das Zuhören-Können eine <strong>der</strong> wichtigsten<br />
Bedingungen dafür, dass überhaupt sinnvoll unterrichtet <strong>und</strong> wirklich<br />
gelernt werden kann. Wer nie gelernt hat genau hinzuhören, wer sich<br />
stetig je<strong>der</strong> ernsthaften Auseinan<strong>der</strong>setzung entzieht <strong>und</strong> sich auf<br />
nichts leidenschaftlich einlassen kann, <strong>der</strong> bringt sich um die lustvolle<br />
Erfahrung, dass Bildung die Seele erzittern lässt <strong>und</strong> den Hunger nach<br />
mehr weckt. Menschen, die zuhören können, sind wissbegieriger <strong>und</strong><br />
lernfähiger - sie können getrost unterrichtet werden. So betrachtet gehört<br />
Höflichkeit durchaus zum Kerngeschäft <strong>der</strong> <strong>Schule</strong>.<br />
Noch einmal: Das Zuhören ist ein Akt, <strong>der</strong> mein Interesse an An<strong>der</strong>en<br />
<strong>und</strong> An<strong>der</strong>em zum Ausdruck bringt. Erst das Zuhören, verstanden als<br />
offene Haltung zur Welt <strong>und</strong> zu den an<strong>der</strong>en Menschen, ermöglicht<br />
wirkliche Begegnung. Will etwa die <strong>Schule</strong> nicht zu einem <strong>Ort</strong> <strong>des</strong><br />
Nicht-Interesses, <strong>der</strong> Langeweile, <strong>der</strong> Lernverweigerung, <strong>der</strong> Tristesse<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch 9
verkommen, dann muss sie Menschen ausbilden, die sich aufs Zuhören<br />
verstehen.<br />
4. Ermutigung<br />
Ich komme zum Schluss. Wer An<strong>der</strong>en <strong>und</strong> An<strong>der</strong>em nicht zuhören<br />
<strong>und</strong> nicht antworten will, kann nicht wirklich lernen <strong>und</strong> verstehen.<br />
Menschen <strong>und</strong> Dinge haben uns etwas anzugehen – an<strong>der</strong>s ist <strong>Schule</strong><br />
nicht sinnvoll zu veranstalten! <strong>Schule</strong> findet nur statt, wenn sich alle<br />
Beteiligten immer wie<strong>der</strong> auf Begegnungen einlassen. Die wichtigste<br />
Frage <strong>der</strong> Lehrpersonen an die SchülerInnen lautet <strong>des</strong>halb: Könnt ihr<br />
lernen, mich lehren zu lassen? Die wichtigste <strong>der</strong> SchülerInnen: Könnt<br />
ihr mich lehren, wie man lernt?<br />
Die <strong>Schule</strong> als <strong>Ort</strong> <strong>der</strong> Beziehungspflege, <strong>der</strong> Begegnung, <strong>der</strong> Persönlichkeitsbildung,<br />
<strong>des</strong> <strong>Lehrens</strong> <strong>und</strong> <strong>Lernens</strong> bietet ideale Experimentierfel<strong>der</strong><br />
zur Einübung einer Beziehungs- <strong>und</strong> Begegnungskultur, die<br />
die gegenseitige Verstehensfähigkeit för<strong>der</strong>t. Wenden Sie sich freudig<br />
An<strong>der</strong>en <strong>und</strong> An<strong>der</strong>em zu, lassen Sie sich ein. Begegnung gelingt,<br />
wenn ich An<strong>der</strong>e <strong>und</strong> An<strong>der</strong>es zu Wort kommen lasse <strong>und</strong> im Zuhören-Können<br />
ebenso souverän bin wie im Antworten. Entfalten Sie in<br />
Ihren alltäglichen kleinen Welten zusammen mit Ihren SchülerInnen<br />
die Fähigkeit für das Gespräch, die herrliche Genauigkeit <strong>des</strong> Zuhörens<br />
<strong>und</strong> die ständige Bereitschaft, Rede <strong>und</strong> Antwort zu stehen. Es<br />
macht uns menschlicher <strong>und</strong> auch lernfähiger.<br />
Höl<strong>der</strong>lin sagt von uns Menschen: „Wir sind ein Gespräch“ Wir können<br />
auch sagen: „Die <strong>Schule</strong> ist ein Gespräch“ Verwickeln Sie einan<strong>der</strong><br />
getrost in Gespräche <strong>und</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzungen <strong>und</strong> tun Sie es mit<br />
Leidenschaft, Neugier, Wohlwollen <strong>und</strong> in gegenseitigem Respekt.<br />
Vielleicht erspüren <strong>und</strong> verstehen Sie dann, warum <strong>der</strong> grosse alte Jude<br />
Martin Buber sagen konnte „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“<br />
7<br />
Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören.<br />
7 Buber, Martin; Ich <strong>und</strong> Du, Darmstadt 1983, S. 18.<br />
r. neyerlin / philosophische praxis luzern / hirschmattstr. 56 / 6003 Luzern / 041 210 30 57 / philopraxis@bluewin.ch<br />
10