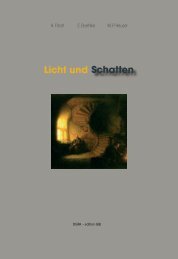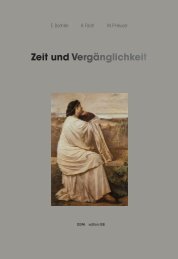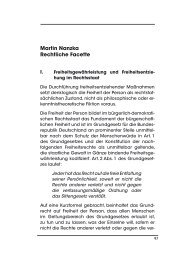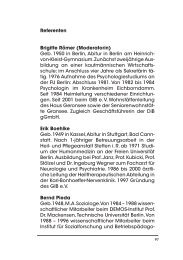Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten der ... - GIB e.V.
Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten der ... - GIB e.V.
Psychopharmakotherapie in Integrationsprojekten der ... - GIB e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
<strong>Psychopharmakotherapie</strong> <strong>in</strong> <strong>Integrationsprojekten</strong><br />
<strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe –<br />
zwischen Ablehnung, Nutzen und Missbrauch<br />
Pädagogische Facette<br />
Mart<strong>in</strong> Th. Hahn<br />
Lieber Herr Boehlke,<br />
sehr geehrte Teilnehmer<strong>in</strong>nen und Teilnehmer dieses Symposiums!<br />
Für die freundliche Begrüßung und die E<strong>in</strong>ladung zu dieser Veranstaltung möchte ich mich<br />
herzlich bedanken. Gerne b<strong>in</strong> ich ihr gefolgt, zumal ich mich auch im Ruhestand als „Berl<strong>in</strong>er“<br />
fühle und ich mich an die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Universität und<br />
Karl-Bonhoeffer-Kl<strong>in</strong>ik - resp. zwischen Psychiatrie und Pädagogik/Andragogik (z. B. im<br />
DAHLEMER FORUM) - er<strong>in</strong>nere, die sich vorwiegend an <strong>der</strong> Person von Herrn Boehlke<br />
festmachte.<br />
Das für dieses Symposium formulierte Thema verweist auf umfangreich beschreibbare,<br />
pädagogisch bedeutsame Sachverhalte, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> vorgegebenen Zeit nur angedeutet werden<br />
können.<br />
Zunächst machen wir uns das geme<strong>in</strong>same Handlungsfeld von Psychiatrie und Pädagogik -<br />
resp. Andragogik - bewusst, ehe wir Variablen benennen, die auf dieses Feld e<strong>in</strong>wirken.<br />
Anschließend befassen wir uns mit anthropologischen Grundvoraussetzungen, die das<br />
pädagogisch-andragogische Denken und Handeln bestimmen. Es geht um e<strong>in</strong> Menschenbild,<br />
das auf Geme<strong>in</strong>samkeiten aller Menschen gründet. Ohne dieses kann das Zusammenwirken<br />
von Pädagogik und Mediz<strong>in</strong> nicht verständlich dargestellt werden. Im Schlussteil soll das<br />
„Integrationsprojekt <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe“ als geme<strong>in</strong>sames Verantwortungs- und<br />
Handlungsfeld für Pädagogik, Andragogik und Psychiatrie gekennzeichnet werden.<br />
Der Begriff Psychopharmaka wird nicht spezifisch gebraucht. Psychopharmaka werden ganz<br />
allgeme<strong>in</strong> als Heilmittel – resp. Arzneimittel - verstanden, die auf das Zentralnervensystem<br />
e<strong>in</strong>wirken und das Verhalten von Menschen verän<strong>der</strong>n können. Indikationen bei Menschen mit<br />
geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung können psychiatrische Erkrankungen, Entwicklungsstörungen,<br />
Verhaltensstörungen und emotionale Störungen sowie psychosomatische Erkrankungen se<strong>in</strong>.
2<br />
1. Menschliches Verhalten als geme<strong>in</strong>same Aufgabe von Pädagogik,<br />
Andragogik und Mediz<strong>in</strong><br />
Unter <strong>Integrationsprojekten</strong> <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe s<strong>in</strong>d – vermutlich im S<strong>in</strong>ne des Veranstalters<br />
dieses Symposiums – auch o<strong>der</strong> vorwiegend Wohne<strong>in</strong>richtungen für erwachsene Menschen mit<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen zu verstehen. Deshalb sei zunächst e<strong>in</strong>e Anmerkung zu dem vielleicht wenig<br />
bekannten Begriff <strong>der</strong> Andragogik erlaubt: Während sich die Pädagogik mit ihren Zielsetzungen<br />
auf das K<strong>in</strong>des- und Jugendalter bezieht, gilt die Andragogik im hier gebrauchten Verständnis<br />
dem erwachsenen Menschen: nicht nur im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Erwachsenenbildung, son<strong>der</strong>n umfassend,<br />
auf den ganzen Menschen und se<strong>in</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den bezogen. Der Begriff enthält semantisch<br />
Inhalte, die wir u.a. auch mit Betreuung, Assistenz, För<strong>der</strong>ung, Begleitung, Pflege und<br />
Unterstützung verb<strong>in</strong>den. Der Verweigerung des Erwachsense<strong>in</strong>s durch falsch verstandene<br />
Pädagogisierung, die vornehmlich die familiären und <strong>in</strong>stitutionellen Wohnsituationen<br />
betreffen, wirkt <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Andragogik entgegen, <strong>in</strong>dem er das Erwachsense<strong>in</strong> bewusst<br />
macht.<br />
Pädagogik, Andragogik und Pflege haben die Aufgabe, durch E<strong>in</strong>wirkung auf das Individuum<br />
dieses zu befähigen,<br />
- Zustände des Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong> sozialer Integration selbst und mit an<strong>der</strong>en zusammen <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Gegenwart herzustellen<br />
- und das Individuum zu befähigen, Zustände des Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong> sozialer Integration <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Zukunft selbst und mit an<strong>der</strong>en zusammen herbeizuführen.<br />
Mit ihrer E<strong>in</strong>wirkung auf das Verhalten des Individuums ergeben sich für Pädagogik und<br />
Andragogik Schnittmengen mit <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>, die zum Beispiel über Psychopharmaka ebenfalls<br />
auf menschliches Verhalten e<strong>in</strong>wirken kann. Dort wo Verhalten auffällig ist, pathologische Züge<br />
annimmt und im Zusammenleben zum Problem wird, s<strong>in</strong>d Überlappungen <strong>der</strong> Aufgabenfel<strong>der</strong><br />
von Pädagogik, Andragogik und Mediz<strong>in</strong> angezeigt. In <strong>Integrationsprojekten</strong> <strong>der</strong><br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe kann dies z. B. <strong>der</strong> Fall se<strong>in</strong>.
3<br />
Mediz<strong>in</strong>,<br />
Psychiatrie<br />
Auffälliges<br />
Verhalten<br />
Pädagogik,<br />
Andragogik<br />
Abbildung 1: Schnittmenge <strong>der</strong> Aufgabenfel<strong>der</strong><br />
Mediz<strong>in</strong>, Pädagogik und Andragogik begegnen sich so als sich <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är ergänzende<br />
Rehabilitationswissenschaften.<br />
In diesem S<strong>in</strong>ne verstehen wir Habilitation als die Befähigung zur selbstbestimmten Herstellung<br />
von Zuständen des eigenen Wohlbef<strong>in</strong>dens <strong>in</strong> sozialer Integration. Rehabilitation ist danach die<br />
Wie<strong>der</strong>herstellung und <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Habilitation bei ihrer Schädigung, Bee<strong>in</strong>trächtigung,<br />
Verh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> Gefährdung.<br />
Psychiatrie und Pädagogik/Andragogik unterstützen sich nicht nur bei <strong>der</strong> Verfolgung<br />
geme<strong>in</strong>samer Zielsetzungen, sie benötigen sich auch gegenseitig als Korrektiv dabei.<br />
2. Variablen, die auf das geme<strong>in</strong>same Handlungsfeld e<strong>in</strong>wirken<br />
Zur historischen Variable<br />
- E<strong>in</strong>e psychische Erkrankung wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bevölkerung immer noch nicht als e<strong>in</strong>e „normale“<br />
Erkrankung angesehen.<br />
- H<strong>in</strong>ter dem Arzneimittel „Psychopharmakon“ verbirgt sich - auch bei ambulanter<br />
Verabreichung – e<strong>in</strong>e gewisse Nähe zur Institution <strong>der</strong> Psychiatrischen Kl<strong>in</strong>ik, die gefürchtet<br />
wird.<br />
- Es gibt e<strong>in</strong> altes Konkurrenzdenken, das Pädagogik und Psychiatrie <strong>in</strong> die Wiege gelegt<br />
ist, das sich nicht an Sach- son<strong>der</strong>n an Machtfragen orientiert.<br />
- Es gibt bei den Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnern von <strong>Integrationsprojekten</strong> Personen, die<br />
e<strong>in</strong>en Teil ihres Lebens <strong>in</strong> <strong>der</strong> Psychiatrie verbracht haben. Sie und ihre Angehörigen<br />
fürchten e<strong>in</strong>e erneute E<strong>in</strong>weisung.<br />
- Erfahrungen <strong>der</strong> Vergangenheit, z. B. im Dritten Reich, führten dazu, dass sich die<br />
Psychiatrie e<strong>in</strong>em Rechtfertigungsdruck ausgesetzt fühlt, Menschse<strong>in</strong> nicht zu manipulieren.<br />
Wir könnten noch an<strong>der</strong>e Beispiele heranziehen und kämen zusammenfassend zum Schluss,<br />
dass es vorwiegend die Institution <strong>der</strong> Psychiatrischen Kl<strong>in</strong>ik ist, die sich heutzutage noch im
4<br />
negativen S<strong>in</strong>n auf das Image <strong>der</strong> Psychiatrie allgeme<strong>in</strong> und die <strong>Psychopharmakotherapie</strong><br />
auswirkt.<br />
Zur Fortschrittsvariable<br />
Im Zusammenhang unserer Gedankenführung seien ausgewählte Fortschritte angesprochen:<br />
Erstens: Geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung wird heute als vorkommende Form des Menschse<strong>in</strong>s gesehen,<br />
nicht als Krankheit. Wer e<strong>in</strong>e geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung hat, kann zusätzlich krank werden, auch<br />
psychisch krank.<br />
Zweitens: Wir wissen, dass sich im Problemverhalten e<strong>in</strong>es Menschen mit schwerer geistiger<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung e<strong>in</strong>e normale und <strong>in</strong> Teilbereichen oft verzögerte Entwicklung spiegelt, auf <strong>der</strong><br />
sich e<strong>in</strong> Verhalten aufbaut, das als Arrangement des Individuums mit dieser beson<strong>der</strong>en<br />
Entwicklung zu verstehen ist. H<strong>in</strong>zu können kommen: mögliche Störungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Entwicklungsbereichen, Hospitalismusphänomene, Reaktionen auf ausgebliebene<br />
Kommunikation und Bedürfnisbefriedigungen, Auswirkungen von richtiger o<strong>der</strong> falscher o<strong>der</strong><br />
unterlassener Erziehung, För<strong>der</strong>ung und Therapie. Kommt e<strong>in</strong>e psychische Erkrankung h<strong>in</strong>zu, ist<br />
das Phänomen „Problemverhalten“ bei diesem ätiologischen Konglomerat nur schwer auf se<strong>in</strong>e<br />
eigentliche Ursache zurückzuführen. Die hier notwendige „Differentialdiagnose“ wird stets<br />
weiterentwickelt und ist nicht mehr vergleichbar mit <strong>der</strong> so genannten „Doppeldiagnose“<br />
früherer Jahre. Sie muss auch auf pädagogisch-andragogische Zusammenhänge rekurrieren.<br />
Drittens: Wir haben es mit e<strong>in</strong>em pädagogisch-andragogischen Erkenntnisfortschritt zu tun, <strong>der</strong><br />
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Paradigmenwechsel ausdrückt und den Menschen – nicht o<strong>der</strong> nicht nur se<strong>in</strong>e<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung – als Ausgangspunkt des Denkens und Handelns hat.<br />
Viertens: Wir haben es mit e<strong>in</strong>em Fortschritt mediz<strong>in</strong>isch-therapeutischer Erkenntnisse zu tun,<br />
<strong>der</strong> sich auf die immer bessere Erforschung <strong>der</strong> Psychopharmaka bezieht, z. B. auf ihre Wirkung<br />
bei bestimmten Zustandsbil<strong>der</strong>n und Altersgruppen.<br />
Fünftens: Die Notwendigkeit des <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Zusammenwirkens ist erkannt.<br />
Sechstens: Die Unsicherheiten im Umgang mit psychischen Erkrankungen von Menschen mit<br />
geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung haben sich verr<strong>in</strong>gert. Neben <strong>der</strong> <strong>Psychopharmakotherapie</strong> kommen<br />
auch an<strong>der</strong>e Therapien zur Anwendung.<br />
Zur Normalisierungsvariable<br />
Integrationsprojekte <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe s<strong>in</strong>d Teil e<strong>in</strong>er weltweiten Entwicklung, welche die<br />
Normalisierung <strong>der</strong> Wohn- und Lebensbed<strong>in</strong>gungen für Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
nach dem Normalisierungspr<strong>in</strong>zip zum Ziel hat (u.a. EISENBERGER et al. 1998, EISENBERGER et al.<br />
1999, FISCHER et al. 1994, FISCHER et al. 1996, FISCHER et al. 1998, HAHN et al. 2003, HAHN et al.<br />
2004, NEUMANN 1999, NIRJE 1994). Stichworte dazu: Enthospitalisierung,<br />
De<strong>in</strong>stitutionalisierung, Community Liv<strong>in</strong>g, Community Care, Geme<strong>in</strong>wesen<strong>in</strong>tegration.<br />
Zur Qualifikationsvariable<br />
Die Anwendung <strong>der</strong> <strong>Psychopharmakotherapie</strong> <strong>in</strong> <strong>Integrationsprojekten</strong> <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe ist<br />
auf speziell qualifiziertes Personal angewiesen. Wenn Psychopharmaka als bequeme<br />
Diszipl<strong>in</strong>ierungsmaßnahme, z. B. zur Ruhigstellung, e<strong>in</strong>gesetzt werden, spricht dies nicht<br />
grundsätzlich gegen sie, son<strong>der</strong>n für die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Verbesserung <strong>der</strong> Qualifikation<br />
des Personals e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>richtung, das mit Psychopharmaka verantwortlich umzugehen hat (vgl.<br />
LEOPOLD 2002).<br />
Zur Rahmenvariable
5<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen des Zusammenlebens <strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrativen Projekten können das Auftreten von<br />
Problemverhalten begünstigen, abschwächen o<strong>der</strong> verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n (vgl. HAHN et al.2003, HAHN et al.<br />
2004).<br />
Zusammenfassung<br />
Es lässt sich erkennen, dass angesichts <strong>der</strong> Existenz und des Zusammenwirkens <strong>der</strong> erwähnten<br />
Variablen auch heutzutage alles möglich ist, was das Thema uns vorgegeben hat: Ablehnung,<br />
Missbrauch und Nutzen <strong>der</strong> <strong>Psychopharmakotherapie</strong>. Diese Aussage ließe sich mit<br />
E<strong>in</strong>zelbeispielen belegen. Ihr steht aber e<strong>in</strong> deutliches Übergewicht des Nutzens gegenüber,<br />
was als Trend e<strong>in</strong>er weiterführenden Entwicklung bezeichnet werden darf.<br />
3. Problemverhalten als bedürfnisorientiertes Verhalten 1<br />
Obwohl <strong>Psychopharmakotherapie</strong> als Bee<strong>in</strong>flussungsmöglichkeit menschlichen Verhaltens bei<br />
oberflächlicher Betrachtung als Alternative zu Pädagogik und Andragogik ersche<strong>in</strong>t, handelt es<br />
sich bei ihr – auf Verhaltensbee<strong>in</strong>flussung bezogen – um e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Wechselwirkung zu ihr<br />
stehende Ergänzung. Die richtige Anwendung von Psychopharmaka ist deshalb nicht denkbar<br />
ohne Beachtung ihrer Korrespondenz mit grundlegenden pädagogisch-andragogischen<br />
Zusammenhängen, <strong>in</strong> denen sich das Individuum bef<strong>in</strong>det. Dies gilt für Ätiologie und Genese<br />
des Verhaltens, ganz beson<strong>der</strong>s für die Diagnose, die Zeiten <strong>der</strong> Anwendung und Absetzung<br />
von Psychopharmaka sowie die Zeit danach und auch für präventive Maßnahmen. Die<br />
folgenden anthropologisch orientierten Ausführungen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> fragmentarischer Umriss e<strong>in</strong>es<br />
Menschenbildes, das auf Geme<strong>in</strong>samkeiten gründet und relativistischen Begründungen des<br />
Menschse<strong>in</strong>s e<strong>in</strong>e Absage erteilt. Menschen mit schwerer Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung und Problemverhalten<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>bezogen. Es wird auf Entstehungszusammenhänge von Problemverhalten aufmerksam<br />
gemacht, die primär nichts mit e<strong>in</strong>er psychischen Erkrankung zu tun haben, wohl aber mit <strong>der</strong><br />
Missachtung von Bedürfnissen und Kommunikation im Zusammenleben. E<strong>in</strong>e sorgfältige<br />
„Differentialdiagnose“ des Psychiaters muss diese Zusammenhänge eruieren, analysieren und<br />
bei <strong>der</strong> möglichen Indikation „Psychopharmaka“ berücksichtigen.<br />
3.1 Menschliches Wohlbef<strong>in</strong>den und Selbstbestimmung<br />
Die umfassendste, alle Menschen verb<strong>in</strong>dende Geme<strong>in</strong>samkeit ist die Fähigkeit, zu Zuständen<br />
des Wohlbef<strong>in</strong>dens im Zusammenleben zu gelangen. Menschen mit schwerer und mehrfacher<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung können sich wohl fühlen. Wenn wir dies noch nicht o<strong>der</strong> nur selten beobachtet<br />
haben, liegt es nicht daran, dass sie diese Fähigkeit nicht hätten, son<strong>der</strong>n vielleicht an ihren<br />
Lebensumständen, die Wohlbef<strong>in</strong>den nicht ermöglichen - o<strong>der</strong> an unserer unzureichenden<br />
Beobachtung.<br />
Menschenleben ist wesenhaft gekennzeichnet durch permanente selbstbestimmte<br />
E<strong>in</strong>flussnahme auf das eigene Wohlbef<strong>in</strong>den. Mit <strong>der</strong> Realisierung se<strong>in</strong>es Autonomiepotenzials<br />
verwirklicht <strong>der</strong> Mensch se<strong>in</strong>e Existenz.<br />
1<br />
In Anlehnung an vorausgegangene Veröffentlichungen und Vorträge, u. a. HAHN 1999
6<br />
Dies gilt für alle Menschen gleich. Menschen mit sehr schweren Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen und<br />
Problemverhalten machen ke<strong>in</strong>e Ausnahme.<br />
3.2 Menschliches Wohlbef<strong>in</strong>den und Bedürfnisse<br />
Menschlichem Wohlbef<strong>in</strong>den liegt die Befriedigung von Bedürfnissen zu Grunde. Unter<br />
Bedürfnis sei e<strong>in</strong>e Alternative zu e<strong>in</strong>er aktuellen Ausgangslage verstanden, die mehr<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den verspricht als die Ausgangslage.<br />
Problemverhalten kann im Zusammenleben hervorgerufen werden, wenn Bedürfnisse nicht<br />
erkannt, wenn sie missachtet o<strong>der</strong> ihrer Realitätsferne wegen nicht erfüllt werden können, wenn<br />
das Protestverhalten bei unerfüllten Bedürfnissen nicht richtig <strong>in</strong>terpretiert werden kann, wenn<br />
e<strong>in</strong>e jahrelang unverän<strong>der</strong>te d<strong>in</strong>gliche und soziale Umwelt – etwa bei Bettlägerigkeit o<strong>der</strong><br />
isolierenden Wohne<strong>in</strong>richtungen - ke<strong>in</strong>e Alternativen zu Ausgangslagen anbietet und e<strong>in</strong>e<br />
apathische Bedürfnislosigkeit entsteht o<strong>der</strong> wenn auf Kommunikation weitgehend verzichtet<br />
wird.<br />
3.3 Zwei Möglichkeiten <strong>der</strong> selbstbestimmten Bedürfnisbefriedigung<br />
Will <strong>der</strong> Mensch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Leben Zustände des Wohlbef<strong>in</strong>dens erreichen, muss er<br />
selbstbestimmt Bedürfnisse befriedigen können. Zur selbstbestimmten Befriedigung von<br />
Bedürfnissen stehen dem Menschen zwei Möglichkeiten offen – und dies ist bei Menschen mit<br />
schwerer geistiger und mehrfacher Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung mit Problemverhalten gleich.<br />
Möglichkeit e<strong>in</strong>s (o<strong>der</strong> Modell A)<br />
Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbstbestimmt, unabhängig: Auf <strong>der</strong> grafischen Darstellung<br />
sieht man l<strong>in</strong>ks das Individuum und ganz rechts die von ihm angestrebte Alternative zu se<strong>in</strong>er<br />
Ausgangslage: das Bedürfnis, dessen Realisierung es anstrebt. Die im Laufe se<strong>in</strong>er Entwicklung<br />
ausgeformten Fähigkeiten ermöglichen ihm, se<strong>in</strong> Bedürfnis selbständig alle<strong>in</strong> zu realisieren.<br />
Der Pfeil symbolisiert den Akt <strong>der</strong> Bedürfnisbefriedigung.<br />
Möglichkeit zwei (o<strong>der</strong> Modell B)<br />
Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbstbestimmt, abhängig: Das Bedürfnis kann nicht alle<strong>in</strong><br />
befriedigt werden. Soll es selbstbestimmt befriedigt werden, benötigt <strong>der</strong> Mensch Assistenz:<br />
E<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> mehrere Personen realisieren das Bedürfnis o<strong>der</strong> geben Unterstützung bei se<strong>in</strong>er<br />
Realisierung, nachdem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Akt <strong>der</strong> Kommunikation Verständigung darüber erreicht wurde,<br />
welches Handlungsziel angestrebt werden soll, <strong>in</strong> welcher Weise und unter welchen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen dies geschehen soll bzw. geschehen kann.
7<br />
1. Selbstbestimmt unabhängig<br />
Individuum<br />
2. Selbstbestimmt abhängig<br />
Individuum<br />
Bedürfnisbefriedigung<br />
Bedürfnisbefriedigung<br />
Kommunikation<br />
Aktion<br />
Assistent<br />
Abbildung 2: Möglichkeiten <strong>der</strong> selbstbestimmten Bedürfnisbefriedigung<br />
Assistenz<br />
Der Assistenz ausübenden Person wird mittels Kommunikation die Kompetenz des Assistierens<br />
vermittelt. Umgekehrt steht die assistenzbedürftige Person, durch Kommunikationsakte bewirkt,<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ständigen Empowermentprozess, <strong>der</strong> die Assistenz und das Zusammenleben mit<br />
an<strong>der</strong>en Menschen permanent verbessert. Die Assistenz darf als dialogischer Akt verstanden<br />
werden, <strong>in</strong> dem verbal und nonverbal (Wahrnehmung, Handeln, Sprache) kommuniziert wird.<br />
Menschen mit schwerer Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung s<strong>in</strong>d bei <strong>der</strong> selbstbestimmten Befriedigung ihrer<br />
Bedürfnisse - d. h. bei <strong>der</strong> Herstellung von Zuständen des Wohlbef<strong>in</strong>dens - <strong>in</strong> extremer Weise<br />
auf ihre soziale Umwelt, auf Assistenz, angewiesen. Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung stellt sich für die Betroffenen<br />
dar als e<strong>in</strong> „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ (HAHN 1981).<br />
3.4 Die Rolle <strong>der</strong> Kommunikation<br />
Assistenz ist ohne Kommunikation nicht möglich. Menschen mit schwerer und mehrfacher<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung haben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel zusätzlich zu ihrem „Mehr an sozialer Abhängigkeit“ extreme<br />
Kommunikationsdefizite: durch ihre eigene bee<strong>in</strong>trächtigte Kommunikation und durch<br />
Kommunikationse<strong>in</strong>schränkungen o<strong>der</strong> –verweigerungen ihrer sozialen Umwelt, z. B. verursacht<br />
durch Personalmangel.<br />
Wir fragen: Wie sollen Menschen, die <strong>in</strong> extremer Weise bei <strong>der</strong> Befriedigung von Bedürfnissen<br />
auf Assistenz angewiesen s<strong>in</strong>d, - wie sollen diese Menschen zu Wohlbef<strong>in</strong>den gelangen, wenn<br />
ihnen die Voraussetzung für Assistenz - Kommunikation - verweigert wird? Durch den Ausfall<br />
von Kommunikation wird Assistenz verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t und Problemverhalten evoziert.<br />
An die Stelle von Assistenz tritt Fremdbestimmung. Fremdbestimmung stellt grundsätzlich e<strong>in</strong>e<br />
potenzielle und reale Gefahr für Selbstbestimmung dar, gefährdet damit das Wohlbef<strong>in</strong>den, die
8<br />
Gew<strong>in</strong>nung von Identität und – bei Andauern – die erlebbare S<strong>in</strong>nhaftigkeit <strong>der</strong> eigenen<br />
Existenz. Das Spezifikum des Menschlichen, die selbstbestimmte E<strong>in</strong>flussnahme auf das eigene<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den, wird missachtet. Der Mensch wird zum Objekt. .<br />
3.5 Subjektive S<strong>in</strong>nhaftigkeit von <strong>in</strong> Freiheit praktiziertem Verhalten<br />
Zustände des Wohlbef<strong>in</strong>dens kommen auf Grund subjektiver Interpretationen <strong>der</strong> erfahrbaren<br />
Welt des Individuums zustande. Sie s<strong>in</strong>d deshalb nicht zw<strong>in</strong>gend an objektivierbare äußere<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen gebunden.<br />
Mit an<strong>der</strong>en Worten: Menschen mit schwerer - geistiger – Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung können sich glücklich<br />
fühlen – auch wenn Außenstehende, z. B. Vertreter/-<strong>in</strong>nen des Präferenzutilitarismus ihren<br />
Zustand gleich Leid setzen.<br />
In Freiheit realisiertes Verhalten ist gleichzusetzen mit selbstbestimmtem Verhalten. Es ist<br />
subjektiv s<strong>in</strong>nvoll, weil es <strong>in</strong> <strong>der</strong> aktuellen Situation <strong>der</strong> Herstellung von Wohlbef<strong>in</strong>den dient.<br />
Diese Erkenntnis verhilft uns z. B. zu e<strong>in</strong>em beson<strong>der</strong>en Zugang zum Verständnis und zur<br />
Verän<strong>der</strong>ung des selbstverletzenden Verhaltens und an<strong>der</strong>er Formen möglichen<br />
Problemverhaltens: Indem wir den subjektiven S<strong>in</strong>n respektieren und nach ihm forschen,<br />
erschließen sich uns zuvor nicht vorhandene Möglichkeiten <strong>der</strong> Bee<strong>in</strong>flussung des Verhaltens.<br />
3.6 Möglichkeiten <strong>der</strong> Verhaltensbee<strong>in</strong>flussung<br />
Auf dem angedeuteten Menschenbild fußen Möglichkeiten <strong>der</strong> Verhaltensbee<strong>in</strong>flussung durch<br />
Pädagogik und Andragogik. E<strong>in</strong>e Auswahl:<br />
- Es müssen Verhaltensmöglichkeiten angeboten werden, die mehr Wohlbef<strong>in</strong>den<br />
versprechen. Sie können selbstbestimmt als Alternative zum Problemverhalten ergriffen<br />
werden.<br />
- Es muss sichergestellt se<strong>in</strong>, dass kommuniziert wird und Bedürfnisse <strong>in</strong> Erfahrung gebracht<br />
werden.<br />
- Bezugspersonen müssen sich um den Erwerb von Empathie bemühen.<br />
- Das soziale Umfeld muss Bedürfnisse kennen und respektieren lernen.<br />
- Das soziale Umfeld muss <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage se<strong>in</strong>, bei <strong>der</strong> Befriedigung von Bedürfnissen zu<br />
assistieren.<br />
- Über fe<strong>in</strong>fühlige Bedürfnisbefriedigung muss e<strong>in</strong> Beziehungsaufbau angestrebt werden.<br />
- Grenzen sollen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel nicht e<strong>in</strong>fach gesetzt und ihre Beachtung auch nicht repressiv<br />
erzwungen werden, son<strong>der</strong>n über bedürfnisorientierte Lernprozesse, durch Teilhabe am<br />
Zusammenleben und durch Aushandeln vermittelt werden.<br />
- Es müssen Freiheitsräume für selbstbestimmtes Handeln durch Wahrnehmung und<br />
Kompetenzvermittlung erschlossen werden, die erstrebenswerte Alternativen zum<br />
Problemverhalten darstellen.<br />
- E<strong>in</strong> anregungsreiches soziales und d<strong>in</strong>gliches Umfeld muss Bedürfnissen entgegenkommen<br />
und erkennbar Möglichkeiten ihrer selbstbestimmten Befriedigung anbieten (z. B.<br />
Bewegungsbedürfnis, Umgang mit Tieren).
9<br />
4 Integrationsprojekte als geme<strong>in</strong>sames Handlungsfeld von<br />
Pädagogik, Andragogik und Psychiatrie<br />
Wir fragen: Was kennzeichnet Integrationsprojekte <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenhilfe unter dem Aspekt <strong>der</strong><br />
<strong>Psychopharmakotherapie</strong> als geme<strong>in</strong>sames Handlungsfeld von Pädagogik/Andragogik und<br />
Psychiatrie?<br />
4.1 Merkmale des Handlungsfeldes<br />
Wir greifen e<strong>in</strong>ige Merkmale auf, die <strong>in</strong> unserem Zusammenhang von Bedeutung s<strong>in</strong>d (vgl.<br />
HAHN et al. 2003, 2004).<br />
Konfrontation mit <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
Das Leben <strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrativen Wohnsituationen wird von <strong>der</strong> Öffentlichkeit eher wahrgenommen als<br />
das Leben <strong>in</strong> Großheimen. Dies bedeutet zweierlei: Die Beobachtung durch die Öffentlichkeit<br />
stellte e<strong>in</strong> gewisses Korrektiv für die Verantwortlichen dar, das es im Großheim nicht gibt.<br />
Gleichzeitig kommt es beim Personal zu e<strong>in</strong>em an sich selbst gestellten Erwartungsdruck: Es<br />
möchte mit den Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnern so unauffällig wie möglich <strong>in</strong> <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
auftreten. Dies führt dazu, dass Personen mit Problemverhalten bei Unternehmungen gerne zu<br />
Hause gelassen werden. Der Wunsch, dieses Problemverhalten zu verän<strong>der</strong>n – ggf. auch mit<br />
Psychopharmaka – kommt <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong>tegrativen Situation schneller auf, liegt näher als im<br />
Großheim, wo man dieses Verhalten kennt und toleriert. Die <strong>in</strong>tegrative Situation führt auch<br />
dazu, dass bei e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>kauf o<strong>der</strong> Bummel, bei <strong>der</strong> Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, <strong>der</strong><br />
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, stets wechselnden, fremden Personenkreisen<br />
begegnet wird. Dies s<strong>in</strong>d oft Überfor<strong>der</strong>ungssituationen für Bewohner/-<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter/-<br />
<strong>in</strong>nen, was bei Menschen mit Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen zu Problemverhalten und bei dem begleitenden<br />
Personal zu starkem Stress führen kann.<br />
Bei unserem Forschungsprojekt WISTA haben wir aber e<strong>in</strong>e nicht vermutete, erstaunliche<br />
Lernfähigkeit des Wohnumfeldes im Tolerieren von Problemverhalten feststellen können.<br />
Freiheitsräume für selbstbestimmtes Handeln<br />
Mit wenigen Ausnahmen konnten wir <strong>in</strong> unseren Forschungsprojekten WISTA und USTA<br />
feststellen, dass <strong>in</strong>tegratives Wohnen mehr Freiheitsräume für selbstbestimmte<br />
Bedürfnisbefriedigung bietet, mehr Kontaktmöglichkeiten bestehen und mehr Anregungen<br />
vorhanden s<strong>in</strong>d, die zu Wohlbef<strong>in</strong>den beitragen und dem Auftreten von Verhaltensproblemen<br />
entgegenwirken. Bei e<strong>in</strong>zelnen Bewohner<strong>in</strong>nen und Bewohnern gab es trotz unbefriedigen<strong>der</strong><br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen unerwartete positive Entwicklungen. Auch Eltern stellten dies fest.<br />
Dokumentierte Beispiele belegen es.<br />
Beson<strong>der</strong>e Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
Es gibt Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, die dem Auftreten von Problemverhalten entgegenwirken und<br />
solche, die es begünstigen und dann beim Personal den Wunsch nach E<strong>in</strong>satz von<br />
Psychopharmaka entstehen lassen. Denken wir an Personalmangel, <strong>der</strong> ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelzuwendung<br />
im S<strong>in</strong>ne von Kommunikation erlaubt, an die Organisation des Alltags mit stresserzeugenden<br />
Engpässen, an Nichtbeschäftigung, an fehlende Bewegungsmöglichkeiten usw. Die Ergebnisse<br />
unseres Projektes WISTA lassen den Schluss zu, dass e<strong>in</strong>e nach Schweregrad <strong>der</strong> Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung
10<br />
heterogen zusammengesetzte Wohngruppe für Menschen mit schwerer Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung und<br />
Problemverhalten besser ist als e<strong>in</strong>e homogen zusammengesetzte Gruppe, wo<br />
Problemverhalten kumuliert und sich unter den Gruppenmitglie<strong>der</strong>n eskalierend ausdehnen<br />
kann. Unterschiedlich stark beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te Personen geben mehr Anregungen zur selbstbestimmten<br />
Befriedigung von Bedürfnissen und zur Erschließung von Freiheitsräumen, die mehr<br />
Wohlbef<strong>in</strong>den versprechen als mögliches Problemverhalten.<br />
4.2 Merkmale des Zusammenwirkens von Pädagogik/Andragogik und<br />
Psychiatrie<br />
Der zeitliche Rahmen und die an<strong>der</strong>en Ortes schon geschehene Erwähnung rechtfertigt e<strong>in</strong>e<br />
knappe Auflistung <strong>in</strong> Stichworten:<br />
Verantwortungsvolle <strong>Psychopharmakotherapie</strong> bei Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
erfor<strong>der</strong>t speziell dafür qualifiziertes Personal.<br />
Dem E<strong>in</strong>satz von Psychopharmaka muss e<strong>in</strong> Menschenbild zu Grunde liegen, das<br />
Menschenwürde sicherstellt und den Menschen nicht zum Gegenstand, zu e<strong>in</strong>em Objekt<br />
werden lässt. E<strong>in</strong> relativ leicht überprüfbares Kriterium dafür ist die Eruierung, Respektierung<br />
und Befriedigung von Bedürfnissen.<br />
E<strong>in</strong> M<strong>in</strong>destmaß an Kommunikation muss überprüfbar <strong>in</strong>stitutionell abgesichert vorhanden se<strong>in</strong>,<br />
um <strong>der</strong> Entstehung von Problemverhalten entgegenzuwirken.<br />
- Die Inanspruchnahme des Psychiaters muss <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Netzwerk mediz<strong>in</strong>isch orientierter<br />
Dienstleistungen, die vorwiegend ambulant se<strong>in</strong> sollten, e<strong>in</strong>schließlich Krisen<strong>in</strong>tervention,<br />
e<strong>in</strong>gebettet se<strong>in</strong>.<br />
- Anamnese, Diagnose, Behandlungsplan, langsame Rücknahme <strong>der</strong> Dosierung: alle<br />
mediz<strong>in</strong>ischen Maßnahmen sollten <strong>in</strong> enger Absprache mit dem Personal erfolgen und<br />
umgekehrt die <strong>in</strong> Wechselwirkung dazu stehenden pädagogisch-andragogischen Aktivitäten<br />
mit dem Arzt besprochen werden.<br />
- Personal und Arzt sollten sich um vertrauensvolle Zusammenarbeit bemühen, ihre<br />
möglichst präzisen Beobachtungsergebnisse und Feststellungen austauschen und sich<br />
gegen Machtmissbrauch sensibilisieren.<br />
4.3 Gefahren <strong>der</strong> <strong>Psychopharmakotherapie</strong> im pädagogisch-andragogischen<br />
Handlungsfeld<br />
Leichtfertiger E<strong>in</strong>satz von Psychopharmaka<br />
Nicht qualifiziertes Personal, das se<strong>in</strong>em Handeln nicht das Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>der</strong> ihm anvertrauten<br />
Menschen zugrunde legt, sieht den S<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>er Arbeit im Dienst nach Vorschrift o<strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
erkennbaren Erfolgen, z. B. im Abbau von Problemverhalten. Gel<strong>in</strong>gt dies über längere Zeit<br />
h<strong>in</strong>weg nicht – i. d. Regel, weil Rahmenbed<strong>in</strong>gungen es nicht ermöglichen o<strong>der</strong> beim Fehlen<br />
e<strong>in</strong>es entsprechenden Menschenbildes ke<strong>in</strong>e befriedigende Kommunikation und ke<strong>in</strong><br />
Beziehungsaufbau zustande kommt -droht e<strong>in</strong> S<strong>in</strong>nverlust <strong>der</strong> Arbeit. Mitarbeiter/-<strong>in</strong>nen <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>richtungen brennen dann aus und leiden darunter. In e<strong>in</strong>er solchen Situation neigen sie<br />
dazu, die Notbremse zu ziehen: Sie for<strong>der</strong>n Psychopharmaka und erhalten sie. In solchen<br />
Situationen werden Psychopharmaka nicht als Heil- o<strong>der</strong> Arzneimittel für den Betroffenen<br />
e<strong>in</strong>gesetzt, son<strong>der</strong>n zur Korrektur e<strong>in</strong>es Sett<strong>in</strong>gs, das an<strong>der</strong>s nicht mehr haltbar sche<strong>in</strong>t. Oft s<strong>in</strong>d
11<br />
es die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, meist aber die fehlende Qualifikation <strong>der</strong> Verantwortungsträger/-<br />
<strong>in</strong>nen o<strong>der</strong> Mitarbeiter/-<strong>in</strong>nen „vor Ort“ e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>richtung, die e<strong>in</strong>e solche Situation verursachen.<br />
Man hört dann Äußerungen über Bewohner/-<strong>in</strong>nen, wie „Der ist fehl am Platz, <strong>der</strong> gehört <strong>in</strong> die<br />
Psychiatrie“ – für die Angehörigen e<strong>in</strong>e Horrorvorstellung.<br />
Nicht selten übernehmen an<strong>der</strong>e Mitarbeiter/-<strong>in</strong>nen später e<strong>in</strong>en solchen Arbeitsplatz, und es<br />
gel<strong>in</strong>gt ihnen, <strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit beson<strong>der</strong>en pädagogischen Maßnahmen e<strong>in</strong>e hohe<br />
Dosierung herunterzufahren o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Mittel ganz abzusetzen (vgl. LEOPOLD 2002). Sehr schnell<br />
wird die Schuld dann beim verschreibenden Arzt gesucht. In Wirklichkeit war es aber die<br />
Pädagogik/Andragogik und die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, die angesichts e<strong>in</strong>es Problemverhaltens<br />
versagt hatten. Die Mediz<strong>in</strong> wurde als Feuerwehr missbraucht, <strong>der</strong> betroffene Bewohner als<br />
Objekt <strong>in</strong>strumentalisiert. Psychopharmaka s<strong>in</strong>d bei e<strong>in</strong>er solchen Anwendung ke<strong>in</strong> Heilmittel,<br />
son<strong>der</strong>n Ausdruck von Hilflosigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er pädagogisch-andragogischen Situation, die durch<br />
Überfor<strong>der</strong>ung gekennzeichnet ist.<br />
Wir erkennen aber auch e<strong>in</strong>e Gefahr bei <strong>der</strong> Psychiatrie: Sie sollte sich für die missbräuchliche<br />
Anwendung von Psychopharmaka sensibilisieren, sie nicht leichtfertig e<strong>in</strong>setzen und klaren<br />
Kriterien für die Indikation folgen. Das heißt, sie muss die Möglichkeiten von Pädagogik und<br />
Andragogik kennen und überprüfen, ob sie ausgelotet s<strong>in</strong>d, ihre Wirkungen erkennen, um zu<br />
e<strong>in</strong>er gezielten Diagnose zu gelangen, die Abgrenzungen zulässt.<br />
FINZEN, e<strong>in</strong> Baseler Psychiater warnt (1991): „Es geht nicht um die Frage, Neuroleptika ja o<strong>der</strong><br />
ne<strong>in</strong>, son<strong>der</strong>n um die Frage, Neuroleptika bei welchen Patienten, <strong>in</strong> welcher Dosierung und wie<br />
lange? . . . Neuroleptika gehören zu den häufigsten missbräuchlich e<strong>in</strong>gesetzten Substanzen . .<br />
. Der Missbrauch von Neuroleptika als Dauermedikation bei geistig Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten ist e<strong>in</strong> weiteres.<br />
In jedem psychiatrischen Lehrbuch steht, dass <strong>der</strong> Neuroleptikagebrauch bei ihnen außer <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
akuten Erregung nicht <strong>in</strong>diziert ist; trotzdem werden Tausende von geistig Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten ohne<br />
vernünftige Gründe nach wie vor unter Neuroleptika gesetzt . . . Die Schlussfolgerung ist nicht,<br />
Neuroleptika zu verbieten, son<strong>der</strong>n sie überlegt und zurückhaltend e<strong>in</strong>zusetzen und jenen<br />
kräftig auf die F<strong>in</strong>ger zu klopfen, die dies nicht tun“ (zit. nach LEOPOLD 2002, 126/127).<br />
Nichtbeachtung <strong>der</strong> Variablen Kommunikation und Bedürfnisbefriedigung<br />
Verhaltensdokumentationen, mediz<strong>in</strong>isch-pädagogische Gutachten und an<strong>der</strong>e schriftliche<br />
Zeugnisse im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Beschäftigung mit Problemverhalten lassen selten<br />
erkennen, dass man die Rolle von Bedürfnissen und Kommunikation beachtet.<br />
Nebenwirkungen werden zu wenig beachtet<br />
Es ist bekannt und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur beschrieben, dass Nebenwirkungen von verabreichten<br />
Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung häufiger auftreten. Sie werden von<br />
den Betroffenen nicht spezifisch geäußert, weil es Kommunikationsprobleme gibt, und deshalb<br />
oft erst spät erkannt. Die verschreibenden Ärzte und das Personal <strong>in</strong> Wohne<strong>in</strong>richtungen sollten<br />
dies bedenken und auf mögliche Nebenwirkungen achten.<br />
4.4 Ausblick und Denkanstöße für notwendige Weiterentwicklungen<br />
Die Dezentralisierung von Wohne<strong>in</strong>richtungen für Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung wird<br />
zunehmen. Forschungsergebnisse zur Anwendung <strong>der</strong> <strong>Psychopharmakotherapie</strong> werden zu<br />
e<strong>in</strong>er differenzierteren und wirksameren Anwendungspraxis beitragen. Die Ambulantisierung<br />
mediz<strong>in</strong>ischer Dienstleistungen für Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung wird weiter
12<br />
fortschreiten und dazu beitragen, dass Vorurteile gegenüber Psychopharmaka abgebaut<br />
werden. Die psychiatrische Kl<strong>in</strong>ik wird als Schreckgespenst an Wirkung e<strong>in</strong>büßen.<br />
Krisen<strong>in</strong>terventionsmöglichkeiten und spezielle kl<strong>in</strong>ische Behandlungsmöglichkeiten werden<br />
weiter ausgebaut werden. Die Interdiszipl<strong>in</strong>arität wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong><br />
<strong>Psychopharmakotherapie</strong> mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit werden. Dazu tragen auch<br />
die Fortschritte <strong>in</strong> Pädagogik und Andragogik bei. E<strong>in</strong> Paradigma, das den Menschen mit<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ungen vor dem H<strong>in</strong>tergrund se<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>samkeiten mit allen an<strong>der</strong>en Menschen zum<br />
Bezugspunkt hat, wird dazu beitragen, dass Kommunikationsdefizite und mangelnde<br />
Bedürfnisbefriedigung abnehmende Größen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ätiologie von Problemverhalten se<strong>in</strong> werden.<br />
Schließlich sei noch an e<strong>in</strong>en Verbesserungsbedarf bei <strong>der</strong> durch Ausbildung vermittelten<br />
Qualifikation für Fachkräfte gedacht . . .<br />
Schöne Vorstellungen von Weiterentwicklungen, die sich angesichts leerer Sozialkassen als<br />
Täuschung herausstellen könnten. Die Antizipation e<strong>in</strong>es künftigen Zustandes ist aber die Basis<br />
für Verän<strong>der</strong>ungen. Deshalb ist es wichtig, sie uns bewusst zu machen.<br />
Literatur<br />
BRADL, C.: Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten – e<strong>in</strong> Schlüsselproblem. In: Geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung 33 (1994),<br />
117-124<br />
DREHER, W., HOFMANN, Th., BRADL, Chr. (Hrsg.): Geistigbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te zwischen Pädagogik und Psychiatrie. Bonn 1987<br />
EISENBERGER, J., HAHN, M. Th., HALL, C., KOEPP, A., KRÜGER, C., POCH-LISSER, B.(Hrsg.): Menschen mit geistiger<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung auf dem Weg <strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>de. Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zu<br />
Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 5) Reutl<strong>in</strong>gen 1998<br />
EISENBERGER, J., HAHN, M. Th., HALL, C., KOEPP, A., KRÜGER, C. (Hrsg.): Das Normalisierungspr<strong>in</strong>zip – vier Jahrzehnte<br />
danach. Verän<strong>der</strong>ungsprozesse stationärer E<strong>in</strong>richtungen für Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. (Berl<strong>in</strong>er<br />
Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 7) Reutl<strong>in</strong>gen 1998<br />
FISCHER, U., HAHN, M. Th., KLINGMÜLLER, B., SEIFERT, M. (Hrsg.): WISTA-Experten- Hear<strong>in</strong>g 1993. Wohnen im Stadtteil<br />
für Erwachsene mit schwerer geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von<br />
Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 1) Reutl<strong>in</strong>gen 1994<br />
FISCHER, U., HAHN, M. Th., KLINGMÜLLER, B., SEIFERT, M. (Hrsg.): Urbanes Wohnen für Erwachsene mit schwerer<br />
geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. Herausfor<strong>der</strong>ung – Realität – Perspektiven. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und<br />
Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 2) Reutl<strong>in</strong>gen 1996<br />
FISCHER, U., HAHN, M. Th., LINDMEIER, Chr., REIMANN, B., RICHARDT, M. (Hrsg.): Wohlbef<strong>in</strong>den und Wohnen von<br />
Menschen mit schwerer geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. Tagungsbericht des Projektes WISTA. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur<br />
Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 6) Reutl<strong>in</strong>gen 1998<br />
GAEDT, Chr.: Die vermeidbare Entwicklung von Schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenzentren. E<strong>in</strong> Plädoyer für Große<strong>in</strong>richtungen im<br />
System <strong>der</strong> Wohnangebote für geistig Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>te. In: Geistige Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung 31 (1992), 94-106<br />
HAHN, M. Th.: Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung als soziale Abhängigkeit. Zur Situation schwerbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen. München 1981<br />
HAHN, M. Th.: Zum Verhältnis von Geistigbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>tenpädagogik und Psychiatrie. In: DREHER, W., HOFMANN, Th.,<br />
BRADL, Chr. (Hrsg): Geistigbeh<strong>in</strong><strong>der</strong>te zwischen Pädagogik und Psychiatrie. Bonn 1987, 50-73<br />
Hahn, M. Th.: Anthropologische Aspekte <strong>der</strong> Selbstbestimmung. In: WILKEN, E., VAHSEN, F. (Hrsg.): Son<strong>der</strong>pädagogik<br />
und Soziale Arbeit. Rehabilitation und soziale Integration als geme<strong>in</strong>same Aufgabe. Neuwied 1999, 14-30<br />
HAHN, M. Th.: Die langsame Entdeckung <strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>samkeit. In: KLAUß, Th., LAMERS, W. (Hrsg.): Alle K<strong>in</strong><strong>der</strong> alles<br />
lehren . . . Grundlagen <strong>der</strong> Pädagogik für Menschen mit schwerer und mehrfacher Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. Heidelberg<br />
2003, 29-50<br />
HAHN, M. Th., EISENBERGER, J., HALL, C., KOEPP, A., KRÜGER, C.: Die Leute s<strong>in</strong>d ja draußen aufgeblüht . . .<br />
Zusammenfassende Gesamtdarstellung des Projektes USTA (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von<br />
Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 10) Reutl<strong>in</strong>gen 2003<br />
HAHN, M. Th., FISCHER, U., KLINGMÜLLER, B., LINDMEIER, Chr., REIMANN, B., RICHARDT, M., Seifert, M. (Hrsg.): Warum<br />
sollen sie nicht mit uns leben? Stadtteil<strong>in</strong>tegriertes Wohnen von Erwachsenen mit schwerer geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung<br />
und ihre Situation <strong>in</strong> Wohnheimen. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 11) Reutl<strong>in</strong>gen 2004
13<br />
HENNICKE, K.: Therapeutische Zugänge zu geistig beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ten Menschen mit psychischen Störungen. In: Geistige<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung 33 (1994), 95-110<br />
LEOPOLD, D.: Wirkungen und Nebenwirkungen von Neuroleptika unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung des E<strong>in</strong>satzes<br />
bei Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. In: D. LUDWIG SCHLAICH STIFTUNG (Hrsg.): Spektrum Heilerziehungspflege.<br />
(Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 9) Reutl<strong>in</strong>gen<br />
2002, 109-128<br />
MENZEL, M.: <strong>Psychopharmakotherapie</strong> bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen mit Intelligenzm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. Unveröffentlichter<br />
Vortrag (Symposium Psychische Störungen bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen mit Intelligenzm<strong>in</strong><strong>der</strong>ung,<br />
Gammert<strong>in</strong>gen-Mariaberg, 13.11.2004)<br />
NEUMANN, J.: Von <strong>der</strong> Variabilität e<strong>in</strong>es Begriffs – 40 Jahre Normalisierungsbegriff. In: Eisenberger, J. et al.(Hrsg.):<br />
Das Normalisierungspr<strong>in</strong>zip – vier Jahrzehnte danach. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von<br />
Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 7) Reutl<strong>in</strong>gen 1999, 9-36<br />
NIRJE, B.: Zur Geschichte des Normalisierungspr<strong>in</strong>zips. In: FISCHER, U. et al. (Hrsg.): WISTA Experten-Hear<strong>in</strong>g 1993.<br />
( Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 1) Reutl<strong>in</strong>gen<br />
1994, 141-174<br />
NIRJE, B.: Das Normalisierungspr<strong>in</strong>zip. In: FISCHER, U. et al. (Hrsg.): WISTA Experten-Hear<strong>in</strong>g 1993. (Berl<strong>in</strong>er<br />
Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 1) Reutl<strong>in</strong>gen 1994, 175-<br />
202<br />
NIRJE, B., PERRIN, B.: Das Normalisierungspr<strong>in</strong>zip und se<strong>in</strong>e Missverständnisse. In: FISCHER, U. et al. (Hrsg.): WISTA<br />
Experten-Hear<strong>in</strong>g 1993. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 1) Reutl<strong>in</strong>gen 1994, 203-207<br />
SEIDEL, M.: <strong>Psychopharmakotherapie</strong> bei selbstverletzendem Verhalten geistig beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ter Menschen –<br />
Möglichkeiten und Grenzen. In: SEIDEL, M., HENNICKE, K. (Hrsg.): Gewalt im Leben von Menschen mit geistiger<br />
Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 8)<br />
Reutl<strong>in</strong>gen 1999, 309-330<br />
SEIDEL, M., HENNICKE, K. (Hrsg.): Gewalt im Leben von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. (Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur<br />
Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 8) Reutl<strong>in</strong>gen 1999<br />
SEIFERT, M.: Lebensqualität und Wohnen bei schwerer geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. Theorie und Praxis. (Berl<strong>in</strong>er<br />
Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen<br />
mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 3) Reutl<strong>in</strong>gen 1996<br />
SEIFERT, M.: Wohnalltag von Erwachsenen mit schwerer geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung. E<strong>in</strong>e Studie Zur Lebensqualität.<br />
(Berl<strong>in</strong>er Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Beh<strong>in</strong><strong>der</strong>ung, Bd. 4) Reutl<strong>in</strong>gen<br />
1996<br />
SEIFERT, M.: Verhaltensauffälligkeiten – e<strong>in</strong>e Zumutung für die Nachbarschaft? Probleme <strong>der</strong> Akzeptanz beim<br />
geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>tegrierten Wohnen. In: THEUNISSEN, G. (Hrsg.): Auffälliges Verhalten – Ausdruck von Selbstbestimmung?<br />
Bad Heilbrunn 2000, 125-152