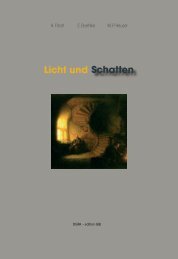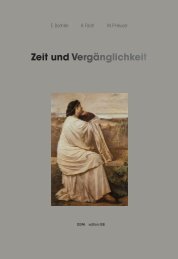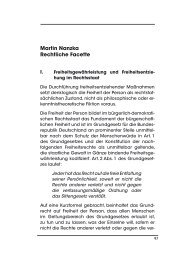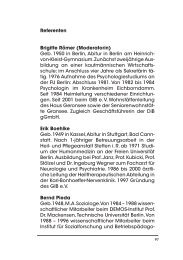Bernd Pieda Arbeitspolitische Facette Nehmen wir den ... - GIB e.V.
Bernd Pieda Arbeitspolitische Facette Nehmen wir den ... - GIB e.V.
Bernd Pieda Arbeitspolitische Facette Nehmen wir den ... - GIB e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Bernd</strong> <strong>Pieda</strong><br />
<strong>Arbeitspolitische</strong> <strong>Facette</strong><br />
<strong>Nehmen</strong> <strong>wir</strong> <strong>den</strong> Begriff Kaleidoskop als Metapher<br />
zur Beschreibung der Arbeit als Teil des Lebens<br />
von Menschen mit Intelligenzminderung ernst, so<br />
lassen sich mindestens zwei Aspekte hervorheben.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich,<br />
dass die folgen<strong>den</strong> Ausführungen nicht<br />
beanspruchen, eine abschließende Analyse<br />
des Arbeitsbegriffs zu leisten, sie sind selber nur<br />
<strong>Facette</strong>n des Begriffs.<br />
Zum einen kann Arbeit, wie die verschie<strong>den</strong>en<br />
Bilder eines Kaleidoskops, die unterschiedlichsten<br />
Formen annehmen – u. a. Berufstätigkeit,<br />
Lohnarbeit, Gartenarbeit, Hobby. Zum anderen<br />
brauchen diese Bilder einen Halt wiederum<br />
analog zu dem Halt, <strong>den</strong> das Kartonrohr eines<br />
Kaleidoskops <strong>den</strong> bunten Kristallen gibt.<br />
Arbeitspolitisch betrachtet ist dieser Rahmen<br />
unsere konkrete Gesellschaft, die das<br />
Spektrum oder das Drehpotential unseres<br />
Arbeitskaleidoskops bestimmt oder begrenzt.<br />
Meines Erachtens lassen sich auch hier zwei<br />
unterscheidbare Grenzbereiche ausmachen.<br />
Der eine Grenzbereich <strong>wir</strong>d durch die Form<br />
der Arbeit gekennzeichnet, die in unserer<br />
Gesellschaft vorherrscht. Das ist die kapitalistische<br />
Produktionsweise, die in unserer Gesellschaft<br />
mittlerweile so allumfassend ist, dass es kaum eine<br />
Nische gibt, in der sie nicht zur Wirkung kommt.<br />
Denken Sie in diesem Zusammenhang z. B.<br />
18
an die Landkommunenbewegung der Hippie-<br />
Ära in <strong>den</strong> USA, aber auch an Nachklänge der<br />
Stu<strong>den</strong>tenbewegung: Wer träumte seinerzeit<br />
nicht von einer Landparzelle in der Lüneburger<br />
Heide. Inhalt dieser Träume war in der Regel<br />
der Wunsch nach einer autarken Lebensform<br />
bis hin zur selbst produzierten Kleidung (z. B.<br />
die stricken<strong>den</strong> Männer auf Tagungen der<br />
Umweltbewegung). Wie sehr die damalige<br />
gesellschaftspolitische Situation arbeitspolitisch<br />
<strong>wir</strong>ksam war, kann auch für <strong>den</strong> Bereich der<br />
Behindertenhilfe aufgezeigt wer<strong>den</strong>. Beispielhaft<br />
in diesem Zusammenhang ist die Diskussion<br />
in <strong>den</strong> 1970er Jahren über adäquate Lebensund<br />
Wohnformen von und für Menschen<br />
mit Behinderungen. Dort kamen vor allem<br />
die traditionellen Großeinrichtungen „unter<br />
Beschuss“, wie Anstalten und Landeskliniken.<br />
Es war die Zeit der Adaption des<br />
Normalisierungsprinzips der Behindertenhilfe<br />
in Deutschland. Es gab aber auch engagierte<br />
Vertreter, die in <strong>den</strong> Lebensformen ihrer<br />
Großeinrichtung durchaus die Chance einer<br />
gesellschaftlichen Nische erblickten - und<br />
nicht nur für behinderte Menschen. Hier konnte<br />
ein Stück Utopie gelebt wer<strong>den</strong> im Vorgriff auf<br />
eine bessere Welt. In diesem Zusammenhang<br />
können beispielhaft die Neuerkeroder<br />
Diskussionstage angeführt wer<strong>den</strong>. Heute<br />
– 20 bis 30 Jahre später – haben sich unsere<br />
Produktionsverhältnisse so differenziert und<br />
verfestigt, begleitet vom Prozess der Globalisierung,<br />
dass Nischenutopien kaum mehr gedacht wer<strong>den</strong>.<br />
Das heißt in unserer Gesellschaft sind der Erwerb<br />
19
Aber letztlich bleibt es dabei: Wir gewinnen unsere<br />
gesellschaftliche Anerkennung durch „bezahlte“<br />
Arbeit und nicht durch Hobby, Bastelei etc. In<br />
der Deutzer Erklärung auf dem 3. Alternativen<br />
Werkstättentag in Köln im November 2006 wurde<br />
ganz aktuell gefordert: „Deshalb fordern <strong>wir</strong>, dass<br />
alle Menschen mit Behinderung, die in einer<br />
Werkstatt arbeiten, einen Lohn erhalten, mit dem<br />
sie ein selbstständiges Leben finanzieren können,<br />
ohne auf Sozialhilfe oder andere Zuwendungen<br />
angewiesen zu sein.“<br />
Neben dem Aspekt, dass das Kaleidoskop „Arbeit“<br />
einen Rahmen, eine Begrenzung braucht, muss es<br />
auch gehalten wer<strong>den</strong>, d. h., wenn das Kaleidoskop<br />
Arbeit als Teil des Lebens von Menschen mit<br />
Intelligenzminderung angesehen wer<strong>den</strong> soll,<br />
dann brauchen <strong>wir</strong> als diejenigen, die Menschen<br />
bei der Ver<strong>wir</strong>klichung dieses Anspruchs<br />
unterstützen wollen, eine grundsätzliche<br />
Orientierung. In diesem Zusammenhang ist<br />
meines Erachtens das Normalisierungsprinzip<br />
das Paradigma der Wahl. August Rüggeberg<br />
hat dies einmal als das fortschrittlichste<br />
Paradigma der professionellen Behindertenhilfe<br />
bezeichnet. Nach dem schwedischen Arzt und<br />
Normalisierungstheoretiker Karl Grunewald ist die<br />
Integration das Mittel der Wahl zur Umsetzung des<br />
Normalisierungsprinzips. Er unterscheidet 3 Arten<br />
der Integration, die physische, die funktionale<br />
und die soziale Integration.<br />
Im jetzt für die Behindertenhilfe relevanten<br />
Sozialgesetzbuch XII ist der Begriff Integration<br />
überwiegend durch <strong>den</strong> Begriff Teilhabe ersetzt.<br />
21
Mit Karl Grunewald können <strong>wir</strong> aber formulieren:<br />
Es ist normal, teilzuhaben.<br />
Betrachten <strong>wir</strong> aus dieser Perspektive<br />
durchschnittliche Wege der beruflichen<br />
Rehabilitation, so fällt sofort auf, dass nicht<br />
Normalisierung, sondern Institutionalisierung,<br />
und zwar in der Regel in Sonderinstitutionen, der<br />
Fall ist.<br />
Es ist also ersichtlich, dass für <strong>den</strong> Bereich der<br />
beruflichen Rehabilitation von Menschen mit<br />
Intelligenzminderung das Normalisierungsprinzip<br />
noch nicht umfassend umgesetzt ist. Ein Aspekt<br />
ist meines Erachtens hier allerdings wichtig: Der<br />
Bereich der beruflichen Rehabilitation wiederholt<br />
augenscheinlich, was der Bereich der sozialen<br />
Rehabilitation und dort das Wohnen behinderter<br />
Menschen vor ca. 20 bis 30 Jahren durchlaufen<br />
hat. Zunehmend entstehen hoffnungsvolle<br />
Initiativen und Modelle im Feld einer ambulanten<br />
beruflichen Rehabilitation. In ihnen entwickeln die<br />
betroffenen Menschen persönliche Kompetenzen<br />
und machen Fortschritte, die bislang vom<br />
professionellen Umfeld nicht erwartet wur<strong>den</strong>.<br />
Ähnliches berichtet Karl Grunewald von der<br />
konsequenten Deinstitutionalisierung im Bereich<br />
des Wohnens in Schwe<strong>den</strong>.<br />
Diese Fortschritte ermutigen und unterstützen<br />
die Forderung, Menschen mit Behinderung die<br />
Chance umfassend zu geben, sich selbst zu<br />
strukturieren und das in einer gesellschaftlich<br />
anerkannten Weise.<br />
22