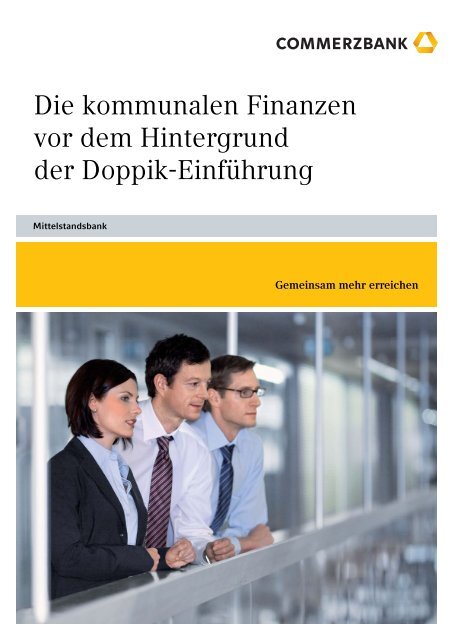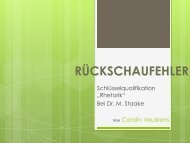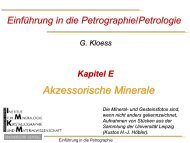Studie - Universität Leipzig
Studie - Universität Leipzig
Studie - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die kommunalen Finanzen<br />
vor dem Hintergrund<br />
der Doppik-Einführung<br />
Mittelstandsbank<br />
Gemeinsam mehr erreichen
02 I Vorwort
Vorwort I 03<br />
Liebe Leser,<br />
die Umsetzung des Beschlusses aus dem Jahre 2003 zur Umstellung<br />
von der Kameralistik zur doppischen und erweiterten kameralen Haushaltsführung<br />
durch die ständige Konferenz der Innenminister stellt besondere<br />
Herausforderungen an die Kommunen. Die künftige Steuerung<br />
von Gemeinden, Städten und Kreisen erfolgt nach einem Ressourcenverbrauchskonzept<br />
und das Ende der Kameralistik ist daher wohl absehbar.<br />
Mit dem Anspruch Deutschlands „Beste Mittelstandsbank“ zu werden,<br />
sehen wir uns auch im Öffentlichen Sektor, und im Besonderen bei<br />
der Doppik-Umstellung, als kompetenten Ansprechpartner und Berater.<br />
Unsere Aufgabe ist es, Kommunen Instrumente und Dienstleistungen<br />
zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen und<br />
ihre Aufgaben im Interesse der Menschen effizient erfüllen können.<br />
Ganz oben auf der Agenda steht daher die Erhöhung der Handlungsspielräume.<br />
Dies bedeutet für uns nicht nur, bei der Analyse der einzelnen<br />
Rechnungselemente zu unterstützen, sondern auch neue Zusammenhänge<br />
darzustellen und zu interpretieren. Obwohl Unterschiede bei<br />
den länderspezifischen Regularien zur Doppik bestehen, lehnen sich<br />
doch viele Kriterien stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs<br />
an. Es existiert somit eine recht hohe Übereinstimmung zwischen der<br />
kaufmännischen Buchführung und der kommunalen Doppik. Genau an<br />
dieser Stelle bringen wir unser spezielles Wissen zur Bilanzanalyse und<br />
zum Bilanzstrukturmanagement mit ein.<br />
Martin Blessing<br />
Unsere Schwerpunktbetreuer Öffentlicher Sektor kennen die Anforderungen<br />
an die Kommunen und erarbeiten Hand in Hand mit hoch<br />
spezialisierten Kommunalkundenbetreuern effiziente Lösungen. Auf<br />
Basis dieser individuell erarbeiteten Optimierungsstrategien werden<br />
Handlungsempfehlungen entwickelt und die Auswirkungen kalkulierbar.<br />
Das ist der Ansatzpunkt der Commerzbank bei der Doppik:<br />
„Analysieren – beraten – Zukunft gestalten“.<br />
Ihr<br />
Vorsitzender des Vorstands<br />
Commerzbank AG
04 I Vorwort<br />
Vorwort<br />
Prof. Dr. Thomas Lenk<br />
Die divergierenden gesetzlichen Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund<br />
der Umstellung auf doppische Rechnungslegungsgrundsätze in<br />
den einzelnen Bundesländern sowie deren unterschiedlich weit fortgeschrittene<br />
Umsetzung führen zu einem äußerst heterogenen Bild, in<br />
dem die verschiedenen Mischformen aus Kameralistik und kaufmännischer<br />
Buchführung nebeneinander stehen. Prinzipiell unterliegt die<br />
kommunale Finanzverwaltung bereits mit der Umstellung des öffentlichen<br />
Haushalts- und Rechnungswesens von kameralistischen auf<br />
doppische Grundsätze einer gesteigerten Transparenz. Sobald die ersten<br />
Jahresabschlüsse einer größeren Anzahl von Kommunen vorliegen, dürfte<br />
sich darüber hinaus die Frage nach deren Vergleichbarkeit und ihrer<br />
Eignung zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und der Bonität ergeben.<br />
Neben externen Ratings durch die bekannten Agenturen, welche<br />
aus Kostengründen für die meisten Kommunen zunächst nicht infrage<br />
kommen dürften, ist eine Bonitätseinschätzung durch Banken in deren<br />
Rolle als Kreditgeber die wahrscheinlichere Variante. Da die meisten<br />
deutschen Banken dem „interne Rating-Ansatz“ (IRB) des Basel-II-Abkommens<br />
folgen, dürfte ein Vorliegen ausreichend kalibrierter interner<br />
Rating-Systeme lediglich eine Frage der Zeit sein. Ferner gewinnen<br />
bisher nicht oder nur rudimentär genutzte Finanzierungsinstrumente,<br />
wie beispielsweise Derivate, mehr und mehr an Bedeutung im kommunalen<br />
Kreditgeschäft.<br />
Dr. Oliver Rottmann<br />
Nicht zuletzt generiert die Herstellung einer Kompatibilität mit dem<br />
kaufmännischen Rechnungswesen für Kommunen transparentere Beurteilungsmöglichkeiten<br />
hinsichtlich Public-Private-Partnership-Projekten.<br />
Nach kameralistischen Kriterien bildet der Liquiditätszufluss nicht selten<br />
das wesentliche Beurteilungselement derartiger Projekte. Eine Beurteilung<br />
desselben Projekts unter den Gesichtspunkten einer erweiterten,<br />
ressourcenverbrauchsorientierten Sichtweise muss dabei nicht zwangsläufig<br />
zum gleichen Ergebnis führen, da der reinen Liquiditätsbetrachtung<br />
noch weitere Kriterien, wie Ertragsorientierung (Vermeidung von<br />
Verlusten), Kapitalbindung und Auswirkungen auf die Bilanzstruktur,<br />
hinzugestellt werden.
Vorwort I 05<br />
Da die Bedeutung der Kreditwirtschaft in den letzten Jahren angesichts<br />
der (bis einschließlich 2006) gewachsenen Verschuldung deutlich<br />
zugenommen hat, dürften Banken eine wichtige Rolle im Prozess der<br />
Neuordnung und Strukturierung der doppischen Haushalte einnehmen.<br />
Insofern könnte sich das in der Kreditwirtschaft vorhandene umfangreiche<br />
Know-how zu Fragen der Bilanzanalyse und des Bilanzstruktur-,<br />
Anlage- und Risikomanagements als äußerst hilfreich erweisen. Die<br />
Möglichkeiten der Bonitätsermittlung durch externe und interne Ratings<br />
dürfte das Kommunalkreditgeschäft beeinflussen, wobei auch die Einführung<br />
neuer Kapitalmarktprodukte zu erwarten ist, z. B. im Rahmen<br />
des direkten Kapitalmarktzugangs der Kommunen.<br />
Die folgende Untersuchung soll zunächst den aktuellen Status quo im<br />
Rahmen der Umstellung auf die Doppik umreißen und ferner perspektivisch<br />
den Umgang mit den neu geschaffenen kommunalen Bilanzen und<br />
die dafür zweckmäßigen Instrumente untersuchen. Dabei konzentriert<br />
sich das Kapitel Schuldenmanagement zunächst auf die Passivseite; der<br />
Umgang mit den erstmals wertmäßig erfassten Aktiva wird in den Kapiteln<br />
Bilanzstrukturmanagement sowie Cash Management diskutiert. Darüber<br />
hinaus befassen sich die Kapitel Rating und Bilanzanalyse mit der<br />
Problematik der Bonitätsermittlung kommunaler Gebietskörperschaften.<br />
<strong>Leipzig</strong>, im August 2007<br />
Prof. Dr. Thomas Lenk<br />
Dr. Oliver Rottmann
06 I Inhalt
Inhalt I 07<br />
Inhalt<br />
1. Einführung<br />
1.1 Vorbemerkung<br />
1.2 Defizite der Kameralistik<br />
1.3 Die Doppik als Grundlage<br />
des neuen Rechnungswesens<br />
1.4 Status quo und Perspektiven<br />
der Doppik-Einführung in Deutschland<br />
1.5 Exkurs: Internationale Anwendung der IPSAS<br />
08<br />
08<br />
09<br />
10<br />
12<br />
2. Untersuchungsergebnisse:<br />
Das kommunale Finanzwesen vor dem<br />
Hintergrund der Doppik-Einführung<br />
2.1 Einführung<br />
2.2 Schuldenmanagement<br />
2.3 Bilanzstrukturmanagement<br />
2.4 Cash Management<br />
2.5 Rating<br />
2.6 Bilanzanalyse<br />
13<br />
14<br />
18<br />
26<br />
27<br />
29<br />
3. Fazit<br />
33
08 I Einführung<br />
1. Einführung<br />
1 <br />
Vgl. Hufnagel/Jürgens (2003),<br />
S. 138<br />
2<br />
Vgl. Leupold (1942), S. 1 f<br />
3<br />
Vgl. Lüder (2001), S. 7<br />
1.1 Vorbemerkung<br />
Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen<br />
in Deutschland befindet sich im Umbruch.<br />
Die seit den 1990er-Jahren voranschreitende<br />
Verwaltungsmodernisierung unterliegt mehr<br />
und mehr Transparenz- und Effizienzpostulaten.<br />
Die sich unter den Bezeichnungen „Neues<br />
Kommunales Finanzmanagement“ (NKF),<br />
„Neues Steuerungsmodell“ (NSM) oder „New<br />
Public Management“ (NPM) vollziehende<br />
Umgestaltung sieht u. a. die Bündelung von<br />
Fach- und Ressourcenverantwortung sowie<br />
Dezentralisierung und Serviceorientierung<br />
bei der Erstellung von Verwaltungsleistungen<br />
vor. 1 Besonders das System der Rechnungslegung<br />
spielt im Rahmen der Reformziele<br />
eine bedeutende Rolle. Im Zuge der Reformen<br />
wird intendiert, von der Methode der Kameralistik<br />
zur doppelten Buchführung überzugehen.<br />
Die sogenannte Doppik (doppelte Buchführung<br />
in Kontenform) stellt dabei das Kernstück des<br />
NKF dar. Die intendierte Zielsetzung impliziert<br />
hierbei, Kosten und Erlöse, Aufwendungen und<br />
Erträge separat zu verbuchen, um somit ein<br />
aussagekräftigeres Bild über die kommunale<br />
Finanzsituation erhalten zu können, als es die<br />
Kameralistik ermöglicht.<br />
1.2 Defizite der Kameralistik<br />
Die originäre Verwaltungsbuchführung als<br />
ursprünglich intendierte Erfolgsermittlung<br />
wurde im Laufe der Zeit in den meisten<br />
Ländern und Gemeinden mehr und mehr<br />
dem Haushaltsgedanken unterworfen. Damit<br />
wich die Funktion der Buchführung, die<br />
Erfolge zu ermitteln, der Erbringung des<br />
Nach weises, inwiefern der Haushaltsplan<br />
eingehalten wurde. 2 Die Verwaltungsbuchführung<br />
erhielt den Charakter einer reinen<br />
Kassen rechnung. Bei der Kameralistik handelt<br />
es sich um ein Verfahren der einfachen<br />
Buchführung, bei dem jeder Geschäftsvorfall<br />
ausschließlich auf einem Konto verbucht wird.<br />
Es erfolgen allerdings in der Regel auf einem<br />
Konto zwei Buchungen je Geschäftsvorfall:<br />
die Soll-Stellung bei Fälligkeit der Zahlung und<br />
die Ist-Buchung bei Zahlungseingang bzw.<br />
-ausgang. Besteht ein Rechnungssystem aus<br />
mehreren Hauptrechnungen, ist die Zahlung<br />
zweckmäßiger im Verbund zu führen, wofür<br />
allerdings die doppelte Buchführung besser<br />
geeignet ist. 3 Kameralistisches Rechnungswesen<br />
findet Eignung, um Zahlungsvorgänge<br />
aufzuzeigen. Mittelherkunft und -verwendung<br />
werden verdeutlicht. Seit den 1990er-Jahren<br />
verbreitete sich allerdings die Ansicht, dass<br />
eine singuläre Betrachtung von Zahlungsvorgängen<br />
nicht ausreicht, da Ressourcenverbräuche<br />
nicht sichtbar werden. In der Verwaltungskameralistik<br />
findet bspw. keine Abschreibung<br />
bei Wertminderung des Anlagevermögens<br />
statt. Damit fehlen Informationen, die eine<br />
Beurteilung der Effizienz von Verwaltungshandeln<br />
unterstützen. Der Versuch einer<br />
Beseitigung dieser evidenten Schwächen<br />
führte zu Erweiterungen der Kameralistik, was<br />
allerdings eine Reihe von Neben- und Ergänzungsrechnungen<br />
notwendig machte. Daraus<br />
resultierte wiederum ein Verlust an Übersichtlichkeit.<br />
Eine weitere Schwäche des Systems<br />
liegt in deren geringer Verbreitung. Die<br />
Kameralistik findet international als Buchungssystem<br />
keine Anerkennung. Das Rechnungswesen<br />
der privaten Wirtschaftseinheiten<br />
basiert fast ausschließlich auf dem System<br />
der doppelten Buchführung. Im Öffentlichen<br />
Sektor steigt seit geraumer Zeit die Tendenz,<br />
Einrichtungen auszugliedern und in diesen die<br />
doppelte Buchführung zu implementieren.<br />
Eine Koexistenz in der Anwendung zweier
Einführung I 09<br />
nicht kompatibler Rechensysteme konterkariert<br />
allerdings eine zielführende Beurteilung<br />
der wirtschaftlichen Lage des „Konzerns<br />
Stadt“. 4 Der aufgrund der evidenten Schwächen<br />
der Kameralistik entstandene Reformprozess<br />
versuchte, als Alternativmodell ein<br />
doppisches Buchungssystem im öffentlichen<br />
Rechnungswesen durchzusetzen. Der folgende<br />
Abschnitt analysiert den Status quo der Reformbestrebungen,<br />
den Stand der Umsetzung<br />
sowie perspektivische Umsetzungsschritte in<br />
den einzelnen deutschen Bundesländern.<br />
1.3 Die Doppik als Grundlage des neuen<br />
Rechnungswesens<br />
1.3.1 Ausgestaltung einer integrierten<br />
Verbundrechnung (Doppik)<br />
Die Doppik bildet die Grundlage eines Systems<br />
der Mehrkomponentenrechnung. In dieser integrierten<br />
Verbundrechnung (IVR) werden die<br />
Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung<br />
sowie die Kosten- und Leistungsrechnung<br />
als Unterelement miteinander verbunden.<br />
Die Finanzrechnung bildet Einnahmen und<br />
Ausgaben sowie am Ende des Haushaltsjahres<br />
die Veränderungen im Bestand liquider Mittel<br />
ab. Sie stellte vormals das Kernelement der<br />
Kameralistik dar. Durch Einbeziehung der<br />
Investitionen in die Finanzrechnung kann dem<br />
Informationsanspruch gegenüber der Öffentlichkeit<br />
in höherem Maße Rechnung getragen<br />
werden. 5 Die Ergebnisrechnung als zweite<br />
Säule der integrierten Verbundrechnung ist<br />
mit der Gewinn- und Verlustrechnung des<br />
kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar.<br />
Aufwendungen und Erträge werden in ihr<br />
erfasst; am Ende des Haushaltsjahres weist sie<br />
das Jahresergebnis aus. Unter Einbeziehung<br />
einer Kosten- und Leistungsrechnung und in<br />
Verbindung mit der Finanzrechnung wird von<br />
der „erweiterten Kameralistik“ gesprochen.<br />
Das neue Element innerhalb dieses Drei-<br />
Komponenten-Systems auf kommunaler Ebene<br />
stellt die Vermögensrechnung dar. 6 Diese<br />
kommunale Bilanz bildet das Vermögen sowie<br />
das Kapital und die Schulden der Kommune<br />
ab. Das Jahresergebnis als Abschluss der Vermögensrechnung<br />
dient der Beurteilung des finanziellen<br />
Handelns. 7 Zusammenfassend kann<br />
als Vorteil angesehen werden, dass zukünftige<br />
Verpflichtungen, wie bspw. Pensionszahlungen,<br />
in Form von Rückstellungen berücksichtigt<br />
werden. Aber auch Abschreibungen<br />
und Forderungen werden genauer dokumentiert.<br />
Diesem reformierten Rechnungswesen<br />
wird ein reformiertes Haushaltswesen zur<br />
Seite gestellt, welches den Finanz- und den<br />
Ergebnishaushalt beinhaltet. 8 Die integrierte<br />
Verbundrechnung wird in der folgenden Grafik<br />
dargestellt.<br />
1. Integrierte Verbundrechnung<br />
Finanzrechnung<br />
Einnahmen<br />
Finanzhaushalt<br />
(geplante Finanzrechnung)<br />
Aktiva<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
(Zahlungswirksame Erträge/<br />
Aufwendungen; weitere Zahlungen<br />
– (Des-)/Inves titionen; Aufnahme/<br />
Tilgung von Krediten ...)<br />
Planvermögensrechnung<br />
Quelle: in Anlehnung an Lüder (2001), hier zitiert nach Hilgers (2007), S. 189<br />
4<br />
Vgl. Lüder (2001), S. 11<br />
5<br />
Vgl. Schwarting (2001), S. 283<br />
6<br />
Vgl. Lüder (1999), S. 8<br />
7<br />
Vgl. Schwarting (2001), S. 283<br />
8<br />
Vgl. Hilgers (2007), S. 189<br />
reformiertes<br />
Rechnungswesen<br />
Passiva<br />
Ergebnisrechnung<br />
Vermögensrechnung<br />
Aufwendungen<br />
Erträge<br />
Kosten- und<br />
Leistungsrechnung<br />
Kosten Leistungen<br />
Ergebnishaushalt<br />
(geplante Aufw./<br />
Erträge)<br />
gepl. Aufw.<br />
reformiertes<br />
Haushaltswesen<br />
gepl. Ertrag
10 I Einführung<br />
2. Zusammenhang IPSAS und GoB<br />
Koordinierung/Abgleich<br />
unternehmerisch – öffentlich<br />
IPSAS<br />
Koordinierung/Abgleich<br />
national – international<br />
1.3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Die privatwirtschaftliche Rechnungslegung<br />
hat den Anforderungen des HGB, zunehmend<br />
jedoch den International Accounting Standards<br />
(IAS) sowie den International Financial Reporting<br />
Standards (IFRS) zu entsprechen. Auf<br />
dieser Basis sind Regeln erarbeitet worden, die<br />
als Grundlage der Rechnungslegung im Öffentlichen<br />
Sektor dienen sollen: Die International<br />
Public Sector Accounting Standards (IPSAS).<br />
In Verbindung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger<br />
Buchführung (GoB – privatwirtschaftlich)<br />
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger<br />
öffentlicher Buchführung (GoöB – Öffentlicher<br />
Sektor) ergibt sich folgender Zusammenhang:<br />
IAS/IFRS<br />
GoöB<br />
Koordinierung/Abgleich<br />
national – international<br />
GoB<br />
Koordinierung/Abgleich<br />
unternehmerisch – öffentlich<br />
Bundesland 11 ist noch keine Entscheidung über<br />
die zukünftige Buchungsweise getroffen worden.<br />
Grundsätzliche Unterschiede bestehen<br />
darüber hinaus im Zeitpunkt des Erlasses und<br />
Inkrafttretens der Gesetzesvorlagen. Tabelle 3<br />
bietet einen zeitlichen Überblick über den<br />
Stand der Doppik-Umsetzung in Deutschland.<br />
Darüber hinaus sind Unterschiede im Umfang<br />
der Berichterstattung, den Bewertungsgrundsätzen<br />
des Sach- und Beteiligungsvermögens<br />
sowie bei Pensionsrückstellungen festzustellen.<br />
12<br />
In Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und<br />
dem Saarland wird neben der Eröffnungsbilanz<br />
auch Anhang und Lagebericht zur Berichterstattung<br />
herangezogen. In Rheinland-Pfalz<br />
werden nur der Anhang und die Übersichten<br />
zur Eröffnungsbilanz (neben dieser selbst) ausgewertet.<br />
Die übrigen Bundesländer, welche<br />
bereits mit dem Umstellungsprozess begonnen<br />
haben (Hessen und Niedersachsen), weisen<br />
diesbezüglich keine Angaben aus.<br />
Das Sachanlagevermögen unterliegt landesspezifischen<br />
Bewertungsansätzen, vor allem<br />
in Bezug auf die Hilfswerte. Grundsätzlich<br />
gilt nach Beschluss der Innenministerkonferenz<br />
vom 21. November 2003:<br />
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bölsenkötter (2007), S. 15<br />
9<br />
NW, NI, RP, ST, SL, HH, BW,<br />
BB, HB, MV und SN<br />
10<br />
HE, BY, TH und SH<br />
11<br />
BE<br />
12<br />
Die Angaben beziehen sich<br />
auf einen Unternehmensvortrag<br />
der PricewaterhouseCoopers<br />
AG auf dem<br />
NKF-Bundeskongress am<br />
7. November 2006.<br />
13<br />
Institut der Wirtschaftsprüfer<br />
1.4 Status quo und Perspektiven der<br />
Doppik-Einführung in Deutschland<br />
Der Status quo der Reformbestrebungen auf<br />
Länderebene verläuft in Deutschland sehr heterogen.<br />
Elf der 16 deutschen Bundesländer<br />
streben einen Übergang zur Doppik an 9 , in<br />
vier Bundesländern besteht ein Wahlrecht zwischen<br />
Kameralistik und Doppik 10 und in einem<br />
„Bei der Eröffnungsbilanz ist neben der<br />
Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungsaufwand<br />
auch eine Bewertung nach<br />
vorsichtig geschätzten Zeitwerten möglich,<br />
wobei bei beiden Modellen Sonderregelungen<br />
für Bewertungserleichterungen vorgesehen<br />
werden. Die Festlegung des maßgebenden<br />
Bewertungsverfahrens für die Eröffnungsbilanz<br />
erfolgt durch die Länder, wobei diese die zu<br />
erwartende Stellungnahme des IDW 13 in ihre<br />
Entscheidungsfindung einbeziehen.“
Einführung I 11<br />
3. Stand der Doppik-Umsetzung in Deutschland (2007)<br />
Kommunalebene<br />
Landesebene<br />
Umstellungsbeginn ab ... Vollendung der Umstellung ...<br />
Baden-Württemberg 2009 2013 Erweiterte Kameralistik<br />
Brandenburg<br />
Modellprojekte bis<br />
30.09.2007<br />
2011 Kameralistik<br />
Bremen Doppik; Vollendung 2008<br />
Hamburg Doppik seit 2006 eingeführt; Doppisches Haushaltswesen ab 2008<br />
Doppik<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
2008 2012 Kameralistik<br />
Nordrhein-Westfalen 2005 2008 Einführung der IVR 14<br />
Niedersachsen 2006 2011 Kameralistik<br />
Rheinland-Pfalz Mitte 2006 2008 Kameralistik<br />
Saarland Mitte 2007 2008 Kameralistik<br />
Sachsen 2008 2013 Optimierte Kameralistik<br />
Sachsen-Anhalt 2006 2010 Kameralistik<br />
Bayern Kameralistik/Doppikoption 2007 Kameralistik<br />
Wahlrecht<br />
Hessen Erweiterte Kameralistik/Doppik bis 2011 Ab 2008<br />
Doppisches Rechnungsund<br />
Haushaltswesen<br />
Schleswig-Holstein Erweiterte Kameralistik/Doppik ab 2009 Optimierte Kameralistik<br />
Thüringen Traditionelle Kameralistik/Doppik ab 2009 Kameralistik<br />
Berlin<br />
Erweiterte Kameralistik<br />
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hilgers (2007), S. 191<br />
Eine weitere Grundlage bildet die Stellungnahme<br />
des IDW zur Rechnungslegung der öffentlichen<br />
Verwaltung nach den Grundsätzen der<br />
doppelten Buchführung. Darin ist Folgendes<br />
festgeschrieben (Tz 19):<br />
„Für die Eröffnungsbilanz der öffentlichen Verwaltung<br />
gelten die Grundsätze für die Gliederung<br />
der Bilanz (Tz. 68 ff.) entsprechend. Bei<br />
der erstmaligen Bewertung sind die Vermögensgegenstände<br />
zu Zeitwerten anzusetzen.<br />
Damit wird die Anschaffung bzw. Herstellung<br />
des Vermögensgegenstandes zu dem Zeitpunkt<br />
fingiert, zu dem erstmals die Grundsätze der<br />
doppelten Buchführung angewendet werden.<br />
Die häufig problematische Ermittlung der<br />
(fortgeführten) Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten<br />
für weit vor dem Stichtag der<br />
Eröffnungsbilanz erworbene oder hergestellte<br />
Vermögensgegenstände wird dadurch ver-<br />
14<br />
Integrierte Verbundrechnung
12 I Einführung<br />
15 <br />
HE, NI, RP, ST, SL, BW, BB,<br />
HB, MV und SN<br />
16<br />
Kann der Anschaffungs- oder<br />
Herstellungswert eines<br />
Vermögensgegenstandes bei<br />
der Aufstellung der ersten<br />
Eröffnungsbilanz nicht<br />
mit vertretbarem Aufwand<br />
ermittelt werden, so gilt der<br />
auf den Anschaffungs- oder<br />
Herstellungszeitpunkt rückindizierte<br />
Zeitwert am Stichtag<br />
der ersten Eröffnungsbilanz<br />
als Anschaffungs- oder<br />
Herstellungswert.<br />
17<br />
NW und BB<br />
18<br />
HE und HH<br />
19<br />
NI, RP, ST und BW<br />
20<br />
Vgl. Hilgers (2007), S. 191.<br />
21<br />
Bundesrechnungshof (2006),<br />
S. 12<br />
mieden. Erhaltene Investitionszuschüsse u. Ä.<br />
sind nicht von dem geförderten Aktivposten<br />
abzusetzen (vgl. Tz. 39).“<br />
Lediglich Nordrhein-Westfalen und Hamburg<br />
nutzen Zeitwerte für die Bestimmung der<br />
Werte von Sachanlagevermögen. Die übrigen<br />
analysierten Bundesländer 15 setzen die Anschaffungs-<br />
bzw. Herstellungskosten abzüglich<br />
der Abschreibungen als Werte an. Hilfswerte<br />
stellen aktuelle Wiederbeschaffungszeitwerte,<br />
Ertrags- und Vergleichswerte sowie rückindizierte<br />
Werte 16 dar.<br />
Ähnlich ist die Wertbestimmung des Beteiligungsvermögens.<br />
Nordrhein-Westfalen und<br />
Hamburg benutzen die aktuellen Zeitwerte,<br />
wohingegen die o. g. Bundesländer das<br />
anteilige Eigenkapital zur Wertbestimmung<br />
heranziehen. Auch hier werden unter Umständen<br />
Hilfswerte genutzt. Dies sind bspw.<br />
Anschaffungs- und Herstellungskosten oder<br />
Börsen- bzw. Marktpreise.<br />
Der Ansatz der Pensionsrückstellungen ist<br />
ebenso unterschiedlich. Werden sie in einigen<br />
Bundesländern mit 5 % 17 oder 6 % 18 bewertet,<br />
ist in anderen das EStG maßgebend 19 .<br />
Auf Bundesebene ist das kameralistische System<br />
der Geldverbrauch-Erfassung weiter vorherrschend.<br />
Der Bundesrechnungshof empfahl<br />
2006 dem Bund, an den positiven Erfahrungen<br />
der Doppik auf Landesebene anzuknüpfen<br />
bzw. die Reformen auf Bundes ebene voranzubringen.<br />
Wird dem nicht nachgegangen,<br />
können sich unterschiedliche Systeme entwickeln,<br />
die die Vergleichbarkeit zwischen den<br />
föderalen Ebenen erschweren. 20<br />
Diese kurzen Erläuterungen verdeutlichen das<br />
teils heterogene Vorgehen bei der Einführung<br />
der Doppik in den Bundesländern. Anpassungs-<br />
und Veränderungsnotwendigkeiten<br />
werden sich im Praxiseinsatz herausstellen.<br />
1.5 Exkurs: Internationale Anwendung der<br />
IPSAS<br />
Die Anwendung der IPSAS im internationalen<br />
Vergleich ist sehr unterschiedlich. OECD und<br />
NATO wenden bereits derartige Vorschriften<br />
an, die Europäische Kommission plant deren<br />
Einführung. Die Einführung der IPSAS-<br />
Regelungen wurde 2006 vo n den Vereinten<br />
Nationen beschlossen und soll zum 1. Januar<br />
2010 angewandt werden. 21<br />
Neben diesen Institutionen wenden bereits<br />
zahlreiche Staaten die IPSAS an. In Europa<br />
waren es im März 2006 die Länder Albanien,<br />
Frankreich, Ungarn, die Niederlande, Norwegen,<br />
die Slowakei und die Schweiz. Dar aus<br />
wird ersichtlich, dass ein Großteil Europas keine<br />
oder nur geringe Erfahrungen mit diesem<br />
Bereich des öffentlichen Rechnungswesens<br />
besitzt. Noch deutlicher wird der Anspruch<br />
an eine Einführung der IPSAS, wenn man die<br />
internationale Entwicklung betrachtet. Neben<br />
China, Südafrika, Indien oder Israel haben<br />
auch kleine Nationen wie beispielsweise Osttimor,<br />
Laos oder die Malediven die Anwendung<br />
zumindest beschlossen oder gar umgesetzt.<br />
Eigene, mit den IPSAS jedoch weitestgehend<br />
übereinstimmende Standards wenden Australien,<br />
Kanada, Neuseeland, Großbritannien sowie<br />
die Vereinigten Staaten an.<br />
Es wird evident, dass der internationale Konvergenzprozess<br />
der kommunalen Rechnungslegungsstandards<br />
bereits weit fortgeschritten<br />
und Europa diesbezüglich eher die Rolle eines<br />
Nachzüglers beschieden ist.
Untersuchungsergebnisse I 13<br />
2. Untersuchungsergebnisse<br />
Das kommunale Finanzwesen vor dem Hintergrund<br />
der Doppik-Einführung<br />
2.1 Einführung<br />
Die divergierenden gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
in den einzelnen Bundesländern<br />
sowie deren unterschiedlich weit fortgeschrittene<br />
Umsetzung führen in der Gesamtperspektive<br />
zu einem äußerst heterogenen Bild,<br />
in dem die verschiedenen Mischformen aus<br />
Kameralistik und kaufmännischer Buchführung<br />
nebeneinander stehen. Eine weitere<br />
Problematik zeigt sich in der Frage, ob sich<br />
die öffentlichen Haushalte an den teilweise<br />
als reformbedürftig geltenden Regelungen<br />
des HGB orientieren oder eine Einführung<br />
der internationalen, auf den IFRS basierenden<br />
IPSAS erwägen sollten. 22 Letztere sind deutlich<br />
komplexer in der Handhabung, hätten jedoch<br />
gegenüber den HGB-Regelungen einige nicht<br />
unbedeutende Vorteile 23 , so etwa die realitätsnahe<br />
Bewertung von Gegenständen des Anlagevermögens<br />
(keine stillen Reserven) und die<br />
in der HGB-Praxis als schwebende Geschäfte 24<br />
generell nicht enthaltene bilanzielle Abbildung<br />
von Derivaten, welche sich besonders im kommunalen<br />
Schuldenmanagement wachsender<br />
Beliebtheit erfreuen. Auch hier haben sich bereits<br />
Mischformen herausgebildet, die internationale<br />
Regelungen teilweise berücksichtigen<br />
(z. B. Eröffnungsbilanz per 01.01.2006 der<br />
Stadt Hamburg).<br />
Darüber hinaus dürfte sich, sobald die ersten<br />
Jahresabschlüsse einer größeren Anzahl von<br />
Kommunen vorliegen, zweifellos die Frage<br />
nach deren Vergleichbarkeit und ihrer Eignung<br />
zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage<br />
und der Bonität ergeben. Neben externen Ratings<br />
durch die bekannten Agenturen, welche<br />
aus Kostengründen für die meisten Kommunen<br />
nicht infrage kommen dürften, ist eine Bonitätseinschätzung<br />
durch Banken in deren Rolle<br />
als Kreditgeber die wahrscheinlichere Vari-<br />
ante. Da die meisten deutschen Banken dem<br />
„interne Rating-Ansatz“ (IRB) des Basel-II-<br />
Abkommens folgen, dürfte ein Vorliegen ausreichend<br />
kalibrierter interner Ratingsysteme<br />
lediglich eine Frage der Zeit sein. Hierauf wird<br />
vertiefend im Abschnitt 2.5 eingegangen.<br />
Die Herstellung einer Kompatibilität mit dem<br />
kaufmännischen Rechnungswesen eröffnet<br />
den Kommunen darüber hinaus transparentere<br />
Beurteilungsmöglichkeiten hinsichtlich Public-<br />
Private-Partnership-Projekten 25 . Nach kameralistischen<br />
Kriterien bildet der Liquiditätszufluss<br />
das wesentliche Beurteilungselement derartiger<br />
Projekte. Eine Beurteilung desselben<br />
Projekts unter den Gesichtspunkten einer<br />
erweiterten, ressourcenverbrauchsorientierten<br />
Sichtweise muss dabei nicht zwangsläufig<br />
zum gleichen Ergebnis führen, da der reinen<br />
Liquiditätsbetrachtung noch weitere Kriterien,<br />
wie Ertragsorientierung (Vermeidung von<br />
Verlusten), Kapitalbindung und Auswirkungen<br />
auf die Bilanzstruktur ( vgl. Abschnitt 2.6),<br />
hinzugestellt werden.<br />
Eine in ihren künftigen Auswirkungen noch<br />
nicht hinreichend beurteilbare Funktion eines<br />
Jahresabschlusses bzw. Geschäftsberichtes<br />
besteht des Weiteren in der zu erwartenden<br />
höheren Öffentlichkeitswirksamkeit aufgrund<br />
seiner im Vergleich zu kameralistischen<br />
Rechenwerken einfacheren Zugänglichkeit gegenüber<br />
einem breiteren Publikum; ein Effekt,<br />
der insbesondere bei den vergleichsweise<br />
bürgernahen kommunalen Haushalten, deren<br />
„Shareholder“ ihre Einwohner darstellen, eine<br />
gewisse Sensibilität besitzen dürfte. Die durch<br />
die Publikation von Jahresabschlussberichten<br />
steigende Transparenz und Verständlichkeit<br />
könnte in vielen Fällen einen nicht unerheblichen<br />
Druck der Öffentlichkeit über Medien,<br />
22<br />
Vgl. Bräunig (2007), S. 83<br />
23<br />
Vgl. Bolsenkötter (2007),<br />
S. 23<br />
24<br />
Als sogenanntes „schwebendes<br />
Geschäft“ wird im<br />
deutschen Handelsrecht ein<br />
Schuldverhältnis (Vertrag)<br />
bezeichnet, dessen Erfolg<br />
noch nicht realisiert wurde.<br />
Infolgedessen finden in der<br />
dem Realisationsprinzip<br />
verpflichteten deutschen<br />
Handelsbilanz mit Ausnahme<br />
etwaiger Drohverlustrückstellungen<br />
derartige Geschäfte<br />
keinen Niederschlag. Die<br />
IFRS enthalten dagegen mit<br />
IAS 39 einen sehr umfangreichen<br />
Standard, welcher<br />
sich ausschließlich mit der<br />
Bewertung, Erfolgswirksamkeit<br />
und Bilanzierung derivativer<br />
Finanzinstrumente<br />
beschäftigt.<br />
25<br />
Public Private Partnership<br />
(PPP) stellt eine Kooperation<br />
bzw. einen Leistungsaustausch<br />
zwischen der Öffentlichen<br />
Hand und privaten<br />
Unternehmen dar. An einer<br />
PPP sind mindestens ein<br />
öffentlicher und ein privater<br />
Partner beteiligt. Die Ziele<br />
beider Partner müssen dabei<br />
kompatibel sein, sie weisen<br />
häufig einen komplementären<br />
Charakter auf (Budäus<br />
2004, S. 12). Nicht selten<br />
stellt die private Seite im<br />
Zuge einer Teilprivatisierung<br />
auch den Betreiber<br />
oder ist an den Einnahmen<br />
beteiligt. Als bedeutendes<br />
Beispiel ist das deutsche<br />
Lkw-Autobahnmautsystem<br />
aufzuführen, dessen Entwicklung,<br />
Umsetzung und<br />
Betrieb im Wesentlichen von<br />
einem privaten Konsortium<br />
getragen wurde, welches für<br />
den Bund die Autobahnmaut<br />
einzieht, an der es im Gegenzug<br />
beteiligt ist.
14 I Untersuchungsergebnisse<br />
26 <br />
Hier insbesondere als sogenannte<br />
progressive Bilanzpolitik<br />
zu verstehen, welche<br />
den Einsatz von Bewertungsspielräumen,<br />
sachverhaltsgestaltenden<br />
Maßnahmen<br />
und Ermessensspielräumen<br />
zugunsten einer positiveren<br />
Darstellung der eigenen<br />
bilanziellen Verhältnisse<br />
beinhaltet. Einem „Schlechterrechnen“<br />
durch den<br />
jeweiligen politischen Gegner<br />
dürfte mangels erforderlicher<br />
Zusatzinformationen aus der<br />
Verwaltung ggf. Grenzen<br />
gesetzt sein.<br />
Verbände u. Ä. auf die Administration der<br />
Kommunen ausüben, deren Leistungen künftig<br />
auch am Umgang mit dem kommunalen Vermögen<br />
gemessen werden. Es ist nicht<br />
auszuschließen, dass insofern ein politisch<br />
motivierter Gestaltungswille die Bilanzierungspraxis<br />
beeinflussen könnte. Bilanzpolitik 26<br />
ist auch in der Privatwirtschaft ein mitunter genutztes<br />
Mittel zur Herstellung einer positiveren<br />
Außenwirkung.<br />
Da die Bedeutung der Kreditwirtschaft als<br />
Stakeholder der Kommunen in den letzten<br />
Jahren angesichts der (bis einschließlich 2006)<br />
gewachsenen Verschuldung deutlich zugenommen<br />
hat, dürften die Banken eine wichtige<br />
Rolle im Prozess der Neuordnung und Strukturierung<br />
der doppischen Haushalte einnehmen.<br />
Insofern könnte sich das in der Kreditwirtschaft<br />
vorhandene umfangreiche Know-how<br />
zu Fragen der Bilanzanalyse und des Bilanzstruktur-,<br />
Anlage- und Risikomanagements als<br />
äußerst hilfreich erweisen.<br />
Die Möglichkeiten der Bonitätsermittlung<br />
durch externe und interne Ratings dürfte das<br />
Kommunalkreditgeschäft beeinflussen, wobei<br />
auch die Einführung neuer Kapitalmarktprodukte<br />
neben dem klassischen Pfandbrief zu<br />
erwarten ist, etwa ein direkter Kapitalmarktzugang<br />
der Kommunen.<br />
Von der Modernisierung der Verwaltung<br />
erwartete Effizienzsteigerungen, etwa durch<br />
die Etablierung von Cash Management- oder<br />
Ressourcen- und Beschaffungsmanagementsystemen<br />
innerhalb des Konzerns Kommune,<br />
attestieren Banken ebenfalls eine bedeutende<br />
Rolle als Abwickler des Zahlungsverkehrs der<br />
Kommunen und ihrer Tochtergesellschaften.<br />
Die Interaktionen zwischen Kommunen und<br />
Banken in diesen einzelnen Bereichen sollen<br />
im Folgenden näher betrachtet werden.<br />
2.2 Schuldenmanagement<br />
2.2.1 Vorbemerkung<br />
Eine Bewertung der Vermögensseite findet<br />
im kommunalen Rechnungswesen im Rahmen<br />
kameralistischer Grundsätze nicht statt, der<br />
Umgang mit der Verschuldung und deren<br />
Kosten wird bisher überwiegend passiv vollzogen.<br />
Angesichts wachsender Verschuldung<br />
(bis 2006) und allmählich steigender Zinssätze<br />
für das steigende Kassenkreditvolumen<br />
(Abbildung 4; 12,5 Mrd. davon allein in NRW)<br />
wird der bestehende Handlungsbedarf jedoch<br />
von einer zunehmenden Zahl von Kommunen<br />
wahrgenommen. Dabei wird sich im Wesentlichen<br />
auf das Schuldenmanagement konzentriert.<br />
Eine <strong>Studie</strong> der <strong>Universität</strong> Potsdam auf der<br />
Basis des Jahres 2003 zeigte, dass Kommunen<br />
mit höherer Verschuldung Vorreiter bei<br />
der Implementierung von Strukturen zum<br />
aktiven Umgang mit Schulden und zu den<br />
daraus resultierenden Lasten sind. Das Handlungstempo<br />
in der Praxis ist insofern davon<br />
abhängig, wie prekär die Haushaltslage bereits<br />
ausfällt.
Untersuchungsergebnisse I 15<br />
4. Verschuldung der Gemeinden<br />
Lang- und kurzfristige Verschuldung der Gemeinden<br />
in Mrd. Euro<br />
90<br />
88,3<br />
88<br />
86<br />
28<br />
25<br />
20<br />
87,5 87,1 87,1<br />
88,9<br />
89,3 88,75 88,13<br />
27,6<br />
23,95<br />
20,2<br />
15<br />
16,3<br />
10<br />
6,0<br />
6,9<br />
9,0<br />
10,7<br />
5<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*<br />
langfristige Schulden<br />
kurzfristige Schulden „Kassenkredite“<br />
* Stand: 3. Quartal 2006 (ohne Stadtstaaten);<br />
langfristige Schulden: Kreditmarktschulden<br />
i. w. S. sowie Schulden der öffentlichen Haushalte<br />
Grafik: Deutscher Städte- und Gemeindebund, www.dstgb.de<br />
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes<br />
2.2.2 Kreditmanagement<br />
Eine aktive Marktbearbeitung sowie ein Vergleich<br />
von Finanzierungsalternativen finden<br />
in vielen Kommunen noch nicht in ausreichendem<br />
Maße statt. So stellt z.B. Birkholz<br />
(2006) fest, dass knapp die Hälfte (46,2%) der<br />
befragten Kommunen nicht mehr als sieben<br />
Darlehensangebote am Markt einholt. 27 In der<br />
Regel wird dazu ein standardisiertes Verfahren<br />
(auf Basis eines Vordrucks) genutzt. Ausschreibungen<br />
auf der Grundlage der europäischen<br />
Dienstleistungsrichtlinie werden nur in Ausnahmefällen<br />
vorgenommen – was jedoch angesichts<br />
des im europäischen Vergleich zunehmend<br />
konvergierenden Zinsniveaus auch keine<br />
wesentlich günstigeren Angebote erwarten lassen<br />
dürfte. Die isolierte Betrachtung einzelner<br />
Investitionsprojekte und deren Finanzierung<br />
wird erst allmählich durch eine Sichtweise der<br />
Gesamtverschuldung als Portfolio abgelöst.<br />
Dadurch werden hohe Zinsbindungsquoten<br />
und inflexible Verschuldungsstrukturen in<br />
den Darlehensportfolios der Kernhaushalte<br />
sichtbar. In den (meist privatwirtschaftlich<br />
organisierten) Eigengesellschaften ist der<br />
Anteil kurz- und mittelfristiger Verschuldung<br />
dagegen höher. 28 Angesichts der Anstrengung<br />
zur Reduzierung der Zinsbelastung rückt die<br />
Problematik des steigenden Kassenkreditvolumens<br />
(vgl. Abbildung 4) zunehmend in den<br />
27<br />
Vgl. Birkholz (2006), S. 15<br />
28<br />
Vgl. Birkholz (2006), S. 17
16 I Untersuchungsergebnisse<br />
29<br />
Vgl. Lenk (2007)<br />
30<br />
Vgl. Birkholz (2006), S. 19<br />
31<br />
Vgl. Landkreistag Rheinland-<br />
Pfalz (2006)<br />
32<br />
Vgl. Birkholz (2006), S. 23<br />
33<br />
Zu Swapgeschäften vgl. u.a.<br />
Hull (2006), S. 194f.<br />
Fokus. Ein nicht geringer Teil dieser inzwischen<br />
dauerhaft beanspruchten Kredite wird<br />
als Überziehungskredit geführt und variabel<br />
verzinst. Dies wirkt sich gerade auf die kurzfristige<br />
Zinslast negativ aus, 29 insbesondere<br />
seit der durch die EZB eingeleiteten Zinswende.<br />
Die entstandenen quasi-permanenten,<br />
variablen verzinsten Sockelbestände an Kassenkrediten<br />
sind insofern aus einem langfristig<br />
orientierten Blickwinkel zu betrachten, der<br />
auch das resultierende Zinsänderungsrisiko in<br />
Betracht zieht.<br />
Die Möglichkeiten des direkten Kapitalmarktzugangs<br />
oder günstigerer Kreditkonditionen,<br />
die sich aus kommunalen Kooperationen zur<br />
Bündelung des gemeinsamen Kreditbedarfs<br />
ergeben, werden trotz einiger erfolgreicher<br />
Beispiele von den weitaus meisten Kommunen<br />
als nicht praktikabel abgelehnt. 30<br />
Als Hauptgrund wird ein hoher Koordinationsaufwand<br />
genannt; die zu erwartenden<br />
Vorteile werden als gering eingeschätzt. Auch<br />
hier dürfte den Kommunen ein zu stark einzelprojektorientiertes<br />
Planungswesen im Weg<br />
stehen. Als sinnvoll könnte sich hier die Schaffung<br />
einer Plattform erweisen, auf welcher<br />
Kommunen ohne größeren Aufwand andere<br />
Gebietskörperschaften finden können, welche<br />
ähnliche Finanzierungsbedarfe aufweisen.<br />
Dieser Weg interkommunaler Kooperation wird<br />
in der Schweiz bereits beschritten; es existiert<br />
mit der Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden<br />
(ESG) eine zentrale Institution.<br />
In Deutschland nutzen bisher nur einige Landkreise<br />
in Rheinland-Pfalz seit 2005 die Möglichkeit<br />
einer Darlehensgemeinschaft, wobei<br />
sich die durch die Bündelung erzielte Verhandlungsmacht<br />
in den Kreditkonditionen insofern<br />
deutlich positiv bemerkbar machte, dass das<br />
Niveau des Bundeslandes erreicht wurde. 31<br />
2.2.3 Risikomanagement und<br />
Derivateeinsatz<br />
Neben den aufgeführten Maßnahmen zur<br />
Verminderung von Lasten aus der hohen Verschuldung<br />
besteht die Möglichkeit der Identifikation<br />
von Zins- und Prolongationsrisiken<br />
in den Schuldenportfolios der Gemeinden. Im<br />
Vordergrund steht dabei das die Kommunen<br />
betreffende Zinsänderungsrisiko bei den oft<br />
abgeschlossenen langfristigen Festzinsvereinbarungen.<br />
Die daraus resultierende hohe Zinsbindungsquote<br />
birgt das Risiko, bei fallendem<br />
Marktzins zu hohe Zinsen zu zahlen. Das<br />
Prolongationsrisiko besteht in zeitlich nicht<br />
hinreichend diversifizierten Festzinsvereinbarungen.<br />
Laufen zahlreiche Vereinbarungen an<br />
eng beieinander liegenden Terminen ab, so<br />
besteht im Falle zwischenzeitlich gestiegener<br />
Zinsen das Risiko einer sprunghaften Verteuerung<br />
des Schuldenportfolios. Während sich<br />
dem Prolongationsrisiko recht einfach durch<br />
eine stärkere Streuung der Auslauftermine für<br />
Festzinsvereinbarungen oder mit sogenannten<br />
„forward rate agreements“ (FRA), bei denen<br />
bereits zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt ein<br />
Festzins für ein zukünftiges Darlehen vereinbart<br />
wird, begegnen lässt, erfreut sich im Umgang<br />
mit dem Zinsänderungsrisiko der Einsatz<br />
von Swaps und Zinsderivaten zunehmender<br />
Beliebtheit. „Forward rate agreements“ werden<br />
bislang (noch) eher selten genutzt, da sie<br />
in vielen Fällen gegen die Gemeindehaushaltsordnungen<br />
verstoßen, welche den Kauf eines<br />
derivativen Instruments ohne zugehöriges<br />
Grundgeschäft untersagen (sog. Konnexitätsprinzip)<br />
32 . Das zugehörige Grundgeschäft<br />
liegt beim FRA in der Zukunft. Bei einem Zinsswapgeschäft<br />
33 handelt es sich im Allgemei-
Untersuchungsergebnisse I 17<br />
nen um einen Austausch der Fälligkeiten von<br />
Zinssatzvereinbarungen. So kann die Kommune<br />
beispielsweise das Zinsänderungsrisiko für<br />
eine variable Zinsposition begrenzen, indem<br />
sie selbige mithilfe eines Swaps für einen<br />
gewissen Zeitraum in eine Quasi-Festzinsposition<br />
umwandelt. Denkbar ist jedoch auch der<br />
umgekehrte Fall, in dem – in Erwartung eines<br />
fallenden Zins niveaus – eine eher hochverzinsliche<br />
Festzinsvereinbarung gegen eine variable<br />
Position getauscht wird.<br />
5. Swapgeschäft<br />
Kommune<br />
Kreditpartner<br />
Variabler Zins,<br />
zzgl. Kreditmarge<br />
Variabler Zins (z. B.<br />
3-Monats-Euribor)<br />
Festzins<br />
Swappartner<br />
Die Gestaltungsfreiheit der Finanzmarktakteure<br />
hinsichtlich der Ausgestaltung<br />
derivativer Finanzinstrumente lässt jedoch<br />
zahlreiche weitere Konstruktionen zu, von<br />
denen die Sicherung einer Zinsober- oder<br />
-untergrenze (cap/floor/collar) nur beispielhaft<br />
genannt seien. Insbesondere für den Umgang<br />
mit Derivaten ist es unerlässlich, für den<br />
Ausbau hinreichender eigener Kompetenzen<br />
zu sorgen. Während ein reines Sicherungsgeschäft<br />
zur Absicherung eines variablen Zinses<br />
unproblematisch ist, öffnen eher spekulative<br />
Kontrakte, 34 die zur Senkung der Zinslast<br />
abgeschlossen werden, oft erhebliche Risikopositionen.<br />
35 Die Versuchung, zugunsten der<br />
Reduzierung laufender Zinsausgaben erhebliche<br />
Risiken in der Zukunft aufzubauen, mag<br />
dabei unter anderem auch der aus kameralistischer<br />
Erfahrung entstammenden mangel n -<br />
den Zukunftsbetrachtung und Unterscheidungsfähigkeit<br />
zwischen Ausgaben und<br />
Aufwendungen zuzuschreiben sein. Als exemplarisch<br />
gelten mögen die bekannt gewordenen<br />
Fälle der Städte Hagen, Neuss, Solingen,<br />
Würzburg oder Pforzheim, die offenbar<br />
beim Kauf von hochkomplexen Derivaten (sog.<br />
CMS-Spread-Ladder-Swaps) ohne hinreichende<br />
eigene Chance/Risiko-Abwägungen<br />
oder Zinsmeinungen agierten. Da Derivate<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 108<br />
in der Regel so konstruiert sind, dass sie auf<br />
gegensätzlichen Zukunftserwartungen der<br />
Geschäftspartner beruhen, könnte angenommen<br />
werden, dass die Beziehung der Kommune<br />
zum Anbieter des Derivats im Prinzip dem<br />
partnerschaftlichen Status widerspricht. Dies<br />
ist jedoch nicht der Fall, da weder der Finanzdienstleister<br />
noch der Zinsmarkt sich gegen<br />
die Kommune stellt. Vielmehr wird das Interesse<br />
von Marktteilnehmern nach der Umsetzung<br />
der eigenen Portfoliostrategie zusammengeführt.<br />
Der Finanzdienstleister übernimmt hierbei<br />
die Funktion eines Vermittlers und sichert<br />
seinerseits Überhänge der nicht vermittelbaren<br />
Transaktion am Zinsmarkt ab.<br />
Die bisherige Vorgehensweise der Gebietskörperschaften<br />
orientiert sich offenbar im<br />
Wesentlichen am Ziel einer kurz- bis mittelfristigen<br />
Ausgabenvermeidung; ein Ansatz,<br />
der bereits in einigen Fällen zu erheblichen<br />
Problemen geführt hat. Für ein erfolgreiches<br />
Schulden- und Risikomanagement ist zunächst<br />
der Aufbau geeigneter Strukturen, Prozesse<br />
und Kompetenzen nötig. 36 Ohne eine<br />
vorherige Identifikation von Risiken und<br />
34<br />
Der spekulative Aspekt<br />
besteht hierbei in der<br />
Zinserwartung zum Zeitpunkt<br />
des Abschlusses. Die Aufgabe<br />
einer Festzinsposition<br />
zugunsten einer variablen<br />
Konstruktion impliziert aus<br />
Schuldnersicht eine „Wette“<br />
auf einen fallenden bzw.<br />
zumindest gleichbleibend<br />
niedrigen Marktzins während<br />
der Laufzeit des Kontraktes.<br />
35<br />
Vgl. Lenk (2007)<br />
36<br />
Vgl. Lenk (2007)
18 I Untersuchungsergebnisse<br />
37<br />
Vgl. Frischmuth (2006),<br />
S. 122ff.<br />
38<br />
Vgl. Birkholz (2006), S. 25f<br />
Chancen und der fundierten Bildung einer<br />
Marktmeinung bleibt der Einsatz von Instrumenten<br />
zur Portfoliosteuerung nur Stückwerk.<br />
Als Orientierung für den Aufbau adäquater<br />
Strukturen in den Kommunen könnten hierbei<br />
die 2005 in Kraft getretenen Mindestanforderungen<br />
an das Risikomanagement (MaRisk)<br />
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
(BaFin) dienen, deren Regelungen<br />
auch vom Deutschen Städtetag in einer<br />
Musterdienstanweisung für die Aufnahme von<br />
Krediten 37 aufgegriffen werden. Als wesentliche<br />
Bestandteile einer adäquaten Organisationsstruktur<br />
nach den MaRisk sind folgende<br />
Punkte aufzuführen:<br />
• aufbauorganisatorische Strukturen (funktionale<br />
und organisatorische Trennung,<br />
„4-Augen-Prinzip“),<br />
• ablauforganisatorische Maßnahmen (Richtlinien<br />
zum Derivateeinsatz, Modellierung<br />
von Prozessen),<br />
• Sicherstellung einer hinreichenden Qualifikation<br />
der Mitarbeiter sowie<br />
• Schaffung einer geeigneten IT-Umgebung<br />
(Darlehensbuchhaltungssoftware, Risikomanagementtools).<br />
Es ist darüber hinaus festzuhalten, dass eine<br />
vollständige Geschäftsbesorgung des Risikomanagements<br />
durch externe Dritte nicht<br />
zielführend ist, da zu einer konsequenten<br />
Risikostrategie ebenfalls die Identifikation<br />
und das Handling einer daraus resultierenden<br />
Prinzipal-Agent-Konstellation mit entsprechend<br />
vorhandenen Informationsasymmetrien<br />
gehören, sodass der o. g. Aufbau eigener<br />
Kompetenzen unerlässlich ist. In der oben<br />
angeführten <strong>Studie</strong> der <strong>Universität</strong> Potsdam<br />
wird nahezu allen betrachteten Kommunen<br />
diesbezüglich erheblicher Nachholbedarf<br />
attestiert. Vor allem die notwendigen personellen<br />
Kapazitäten werden offenbar nicht<br />
oder unzureichend bereitgestellt. 38 Es wird<br />
ersichtlich, dass insbesondere eine intendierte<br />
Orientierung des kommunalen Schulden- und<br />
Risikomanagements an den MaRisk für den<br />
Finanzsektor eine Zusammenarbeit zwischen<br />
Banken und Kommunen nahe legt, welche<br />
über die reine Geschäftsbeziehung (Kreditverhältnis,<br />
Derivategeschäft) hinausgeht.<br />
2.3 Bilanzstrukturmanagement<br />
2.3.1 Vorbemerkung<br />
Die tief greifendste Umstellung innerhalb<br />
der Neuordnung der kommunalen Finanzplanung<br />
und -berichterstattung dürfte in der<br />
Identifikation und Bewertung kommunalen<br />
Vermögens liegen. Die Schaffung einer bilanziellen<br />
Aktivseite stellt einen Prozess dar,<br />
der den weitaus größten Teil der bundesdeutschen<br />
Gebietskörperschaften noch beschäftigt.<br />
Bis zum jetzigen Zeitpunkt (August 2007)<br />
haben fast alle Gebietskörperschaften in den<br />
umgestellten Bundesländern, darunter die<br />
Stadt Salzgitter und der Stadtstaat Hamburg,<br />
eine Eröffnungsbilanz vorgelegt; der erste vollständige<br />
Jahresabschluss für Hamburg wurde<br />
am 14.08.2007 der Öffentlichkeit im Rahmen<br />
einer Bilanzpressekonferenz vorgelegt. Es<br />
ist insofern noch verfrüht, die Auswirkungen<br />
dieser Vervollständigung der kommunalen<br />
Vermögensrechnung konkret antizipieren<br />
zu können, nichtsdestotrotz lassen sich einige<br />
Grundtendenzen darlegen. Die Aktivierung und<br />
Bewertung öffentlichen Vermögens ist mit den
Untersuchungsergebnisse I 19<br />
Instrumenten der kaufmännischen Rechnungslegung<br />
nicht vollständig darstellbar. Selbst die<br />
über die Richtlinien des HGB weit hinausgehenden<br />
und zum Teil sehr detaillierten Regelungen<br />
der IFRS sind beispielsweise für die<br />
Bewertung von Infrastruktureinheiten wie Straßen<br />
oder Abwasserleitungen sowie öffentlicher<br />
Güter wie Denkmäler, Wasser- oder Grünflächen<br />
ungeeignet. Adäquate Konzepte (auf<br />
HGB-Basis) werden zurzeit z. B. an den<br />
Landesrechnungshöfen erarbeitet. Auch die<br />
internationalen, für die öffentliche Verwaltung<br />
entwickelten, auf den IFRS basierenden IPSAS<br />
enthalten bereits entsprechende Regelungen<br />
(IPSAS 17 Property, Plant and Equipment,<br />
IPSAS 21 Impairment of Noncash-generating<br />
Assets). Die bereits angedeutete heterogene<br />
Gesetzgebung in den Bundesländern lässt hier<br />
zunächst wenig Hoffnung auf eine einheitliche<br />
Handhabung in den Kommunen. Abbildung 6<br />
veranschaulicht den überschneidenden bzw.<br />
offenen Regelungsbedarf der verschiedenen<br />
Bilanzierungsstandards. Es ist allerdings<br />
davon auszugehen, dass sich die kommunalen<br />
Bilanzstrukturen in absehbarer Zeit von ihrer<br />
„Urform“, der Eröffnungsbilanz, entfernen<br />
werden. Die Gründe dafür liegen zum einen in<br />
dem Anpassungsdruck, der von dem Bemühen<br />
um ein gutes Rating erzeugt wird. Zum anderen<br />
legt das Ziel von Effizienzsteigerungen<br />
oder Kosten-Nutzen-Erwägungen die Veränderung<br />
von Vermögens- und Beteiligungsverhältnissen<br />
nahe. 39 Ebenso sind hier ordnungspolitische<br />
Richtungserwägungen (Effizienzpostulat<br />
versus Daseinsvorsorge) 40 von Relevanz.<br />
Darüber hinaus gewinnt im Bemühen um die<br />
Erreichung einer höheren Generationengerechtigkeit<br />
auch das Ziel der Fristenkongruenz<br />
6. Regelungsbereiche der IFRS und der IPSAS<br />
Gegenstandsbereich<br />
der Empfehlungen<br />
Δ 3<br />
Δ 1<br />
Δ 2<br />
IPSAS<br />
Δ 1<br />
= IAS/IFRS-Vorgaben, die inhaltlich in die IPSAS zu übernehmen sind<br />
Δ 2<br />
= Sachverhalte, die im Grunde in den IAS/IFRS geregelt sind, aber für den öffentlichen<br />
Bereich einer abweichenden Regelung bedürfen<br />
Δ 3<br />
= Für den öffentlichen Sektor irrelevante Sachverhalte<br />
Δ 4<br />
= Sachverhalte, die nicht in den IAS/IFRS geregelt sind, aber für den öffentlichen<br />
Bereich einer Regelung bedürfen<br />
Quelle: Bolsenkötter (2007), S. 16<br />
der Bilanzaktiva und -passiva an Bedeutung.<br />
Künftig wird sich folglich den Städten und<br />
Gemeinden die Frage nach der Privatisierung,<br />
der Veräußerung von Randaktivitäten, aber<br />
auch der Investition in zukunftsträchtige kommunale<br />
Handlungsfelder weitaus stärker<br />
als bisher stellen, wobei anhand der Informationen<br />
der neuen doppischen Rechnungslegung<br />
eine objektivere Entscheidungsfindung möglich<br />
sein wird. Neben den klassischen Finanzierungs-<br />
und Beratungsaktivitäten dürften<br />
Makler- und Vermittlergeschäfte bei der<br />
Optimierung kommunaler Immobilienportfolios<br />
den Finanzsektor ebenfalls beschäftigen.<br />
IAS/IFRS<br />
Δ 4<br />
39<br />
Grunwald spricht hier vom<br />
Übergang von der Dienstleistungs-<br />
zur Gewährleistungsverwaltung:<br />
„Hierzu<br />
gehört auch die Abkehr vom<br />
Prinzip ‚Wenn es gut sein<br />
soll, muss es die Stadt in<br />
städtischem Eigentum bzw.<br />
mit eigener Infrastruktur<br />
selber machen’!“, Grunwald<br />
u. a. (2006), S. 6<br />
40<br />
Vgl. hierzu u. a. Lenk/Rottmann<br />
(2007), S. 2
20 I Untersuchungsergebnisse<br />
41<br />
Als „off-balance“ werden<br />
Investitionsprojekte (z.B.<br />
Immobilien) bezeichnet, die<br />
aufgrund ihrer rechtlichen<br />
Konstruktion nicht in der<br />
Bilanz auftauchen. Sie<br />
werden zur Optimierung der<br />
Bilanzstruktur angewandt<br />
und stellen insofern auch ein<br />
Mittel der Bilanzpolitik dar.<br />
2.3.2 Leasing<br />
Es ist zu erwarten, dass die Kommunen<br />
unter dem Eindruck der aktuellen Schuldenlast<br />
und im Interesse einer hohen Bonitätseinstufung<br />
eine möglichst hohe Eigenkapitalquote<br />
und eine weitgehend fristenkongruente<br />
Bilanzstruktur anstreben. Die Stellschrauben<br />
hierzu finden sich im Wesentlichen im<br />
kommunalen Anlagevermögen. Abgesehen von<br />
Bewertungsspielräumen, deren Ausnutzung<br />
vom jeweils gegebenen Regelwerk abhängt,<br />
sind es klassische Off-Balance-Instrumente 41<br />
der Investitionsfinanzierung, die die Bilanzen<br />
der Kommunen in den nächsten Jahren strukturell<br />
stark verändern dürften und die Entwicklung<br />
aus Bankensicht interessant gestalten. In<br />
der Privatwirtschaft seit langem angewendete,<br />
IFRS-sichere Leasingmodelle bedürfen keiner<br />
großen Anpassungen, um den Bedürfnissen<br />
kommunaler Nachfrager gerecht zu werden.<br />
Grundsätzlich existieren zwei Ausprägungen<br />
des Leasing, welche über die Art der Bilanzierung<br />
des Leasinggegenstands entscheiden<br />
können. So weist das Operate-Leasing eher<br />
den Charakter eines Mietverhältnisses auf, in<br />
dem z. B. das Investitionsrisiko beim Leasinggeber<br />
liegt, sodass eine Bilanzierung des<br />
Investitionsgegenstands beim Leasinggeber<br />
vorzunehmen ist und die Leasingrate in voller<br />
Höhe als Miet- bzw. Leasingaufwand erfolgswirksam<br />
wird.<br />
7. Leasing inkl. PPP-Model<br />
Kommune<br />
nutzt<br />
ggf. Bürgschaft<br />
Leistungen<br />
Leasingobjekt<br />
plant u.<br />
erstellt<br />
Leasinggeber<br />
gibt<br />
Kaufpreis<br />
Hersteller<br />
Kredit/Forderungskauf<br />
ggf. Abtretung der Leasingraten<br />
Kreditinstitut<br />
z z z<br />
Fondzeichner = Antragseigener<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 172
Untersuchungsergebnisse I 21<br />
8. Finance-Leasing<br />
Kommune<br />
nutzt<br />
Leistungen<br />
Leasingobjekt<br />
Leasinggeber<br />
gibt<br />
Kaufpreis<br />
Verkäufer<br />
Kredit/Forderungskauf<br />
ggf. Abtretung der Leasingraten<br />
Kreditinstitut<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 173<br />
Demgegenüber steht das Finance-Leasing,<br />
welches sich insbesondere auf Spezialinvestitionen<br />
bezieht, dessen wirtschaftliche Nutzung<br />
durch Dritte nicht ohne Weiteres möglich<br />
ist. Das Investitionsrisiko und das wirtschaftliche<br />
Eigentum liegen in der Regel beim<br />
Leasingnehmer, das Leasingverhältnis trägt<br />
insofern weit stärker den Charakter einer Kreditfinanzierung.<br />
Die Bilanzierung von Leasingverhältnissen ist<br />
stark abhängig von der jeweiligen Vertragsgestaltung,<br />
die sich sehr flexibel auf jedem<br />
Punkt zwischen reinem Operate- oder reinem<br />
Finance-Leasing befinden kann. Sowohl das<br />
HGB (insbesondere ergänzt durch steuerrechtliche<br />
Vorgaben) als auch die internationalen<br />
Rechnungslegungsvorschriften definieren gewisse<br />
Kriterien, nach denen eine Entscheidung<br />
über die Bilanzierung des Leasinggegenstands<br />
zu fällen ist.<br />
Während sich das deutsche Recht stärker an<br />
formalen Kriterien ausrichtet, an denen sich<br />
spezielle, auf außerbilanzielle Behandlung<br />
ausgerichtete Konstruktionen orientieren<br />
können, richten sich die IFRS am „Substanceover-form“-Prinzip<br />
aus, was besagt, dass<br />
die praktische Handhabung des Leasingverhältnisses<br />
über die bilanzielle Zurechnung<br />
entscheidet. Handelt es sich beispielsweise um<br />
eine Investition, die nicht durch Dritte nutzbar<br />
ist, so kann von einer Bilanzierung beim Leasingnehmer<br />
ausgegangen werden. Im Rahmen<br />
von Konzernabschlüssen werden auch eigens<br />
gegründete Zweckgesellschaften in diese<br />
Betrachtungen einbezogen. Zur Beschleunigung<br />
der Optimierung von Bilanzstrukturen<br />
und zur Verringerung der Kapitalbindung ist<br />
Leasing auch für Bestandsobjekte ein adäquater<br />
Weg im Rahmen von sogenannten<br />
„Sale-and-Lease-Back“-Modellen. Dabei wird<br />
ein Bestandsobjekt an eine Zweckgesellschaft
22 I Untersuchungsergebnisse<br />
verkauft und von dieser zurückgemietet. Der dabei entstehende Liquiditätsgewinn<br />
kann ggf. zur Schuldentilgung eingesetzt werden, wobei<br />
zu beachten ist, dass die meist benötigte Finanzierung der Zweckgesellschaft<br />
aus Konzernsicht zu einer Schuldenneutralität führt.<br />
9. Sale-and-Lease-Back<br />
verkauft Objekt<br />
Kommune<br />
nutzt<br />
Leistungen<br />
Leasingobjekt<br />
Leasinggeber<br />
gibt<br />
erhält Kaufpreis<br />
z z z<br />
soweit ein Fonds eingeschaltet wird:<br />
Fondszeichner = Antragseigener<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 174<br />
2.3.3 Factoring<br />
Beim Factoring handelt es sich um den Verkauf von Forderungen,<br />
beispielsweise aus Lieferungen und Leistungen an einen sogenannten<br />
Factor (Spezialbank). Der Kaufpreis errechnet sich aus dem Nennwert<br />
der Forderungen, abzüglich eines Diskonts für die Vorfinanzierung der<br />
Forderung, einer Gebühr für den Verwaltungsaufwand und, im Falle<br />
des echten Factoring, um einen Risikobeitrag. Bei letzterem geht mit<br />
der Übertragung der Forderung auch das Delkredere-Risiko, folglich<br />
das eines Ausfalls der Forderung, auf den Factor über. Die Gebühr des<br />
Factors ist dabei in der Regel niedriger als ein Kontokorrentzinssatz.<br />
Dabei entsteht ein Liquiditätsgewinn vom Zeitpunkt des Verkaufs bis zur<br />
Fälligkeit der Forderung. Insbesondere die im Kapitel 2.2.1 erwähnte angespannte<br />
Kassenkreditlage macht diese Finanzierungsform tenden ziell
Untersuchungsergebnisse I 23<br />
interessant. Allerdings ist ein Einsatz dieses<br />
Instruments im kommunalen Bereich stark<br />
von gesetzlichen Restriktionen abhängig. So<br />
ist beispielsweise der Verkauf von Steuerforderungen<br />
per Factoring unmöglich; bezüglich<br />
gewisser Gebühren und Entgelte und zahlreicher<br />
Forderungspositionen kommunaler<br />
Eigenbetriebe und Gesellschaften ist er jedoch<br />
zumindest denkbar. Darüber hinaus ergibt sich<br />
eine Problematik aufgrund der Rechtsnatur<br />
des Forderungsschuldners. Nur Forderungen<br />
der Kommune an Unternehmen eignen sich für<br />
Factoring. Bei Forderungen an Privatpersonen<br />
müssten diese schriftlich zustimmen, sodass<br />
dies nur bei Verrechnungsstellen für Ärzte<br />
vorkommt. Für die Dienstleistung der Forderungsverwaltung<br />
(Debitorenmanagement) der<br />
Factoringgesellschaft ist die Rechtsform jedoch<br />
unerheblich, was eine Lösung für die Kommune<br />
darstellt. Hier besteht unter Umständen<br />
für Kommunen die Möglichkeit, die Debitorenbuchhaltung,<br />
das Mahnwesen und Inkasso<br />
abzugeben. Eine Anwendung des (weniger<br />
gebräuchlichen) unechten Factorings, bei<br />
dem die Forderungsbestände nicht verkauft,<br />
sondern nur gegen deren Vorfinanzierung<br />
sicherungshalber abgetreten werden, könnte<br />
zudem mit haushaltsrechtlichen Vorschriften<br />
wie Kreditsicherungsverboten in Konflikt<br />
geraten. Entscheidungen darüber liegen im<br />
Ermessensspielraum der Kommunalaufsichtsbehörden.<br />
42 Im Falle der Erfüllung öffentlicher<br />
Aufgaben durch private Unternehmen oder<br />
privatrechtlich organisierte Eigengesellschaften<br />
(Tochter unternehmen des Konzerns<br />
Kommune) kann der Verkauf von Forderungen<br />
(auch als kom munale Forfaitierung bezeichnet)<br />
im Rahmen von PPP-Projekten als sinnvolle<br />
Finanzierungsalternative genutzt werden.<br />
Tritt ein Unternehmen Forderungen, die<br />
an die Kommune (aus abgeschlossenen<br />
Leistungs verträgen) bestehen, an ein Kreditinstitut<br />
ab, so dürfte das Factoringentgelt<br />
aufgrund der hohen Bonität der Forderungen<br />
unterhalb der Finanzierungskosten für gewöhnliche<br />
Kontokorrentkredite liegen, woran<br />
dann durch verbesserte Konditionen des<br />
Unternehmens auch die Kommune teilhaben<br />
kann. Für hinreichend große Forderungsportfolios<br />
kommunaler Tochtergesellschaften (oder<br />
bei Kooperationen) ist gegebenenfalls perspektivisch<br />
die Ausgabe von Asset-Backed Securities<br />
(ABS) möglich. Dabei wird ein Bündel von<br />
länger laufenden Forderungen, welche einen<br />
stetigen Mittelzufluss (Cashflow) erzeugen, an<br />
eine Zweckgesellschaft verkauft, die den Kauf<br />
mit der Ausgabe von Wertpapieren refinanziert,<br />
welche wiederum durch die originären<br />
Forderungen besichert sind.<br />
10. Factoring inkl. PPP<br />
Kommune<br />
Forderungsabtretung<br />
Leistungsvertrag<br />
Priv.<br />
Unternehmer<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 166<br />
Einredefreiheit<br />
Abtretungsgenehmigung<br />
der Kommune<br />
Leistungsentgelt<br />
Kreditinsitut<br />
Verkaufspreis =<br />
Barwert der Forderungen<br />
42<br />
Vgl. Schwarting (2007),<br />
S. 122.
24 I Untersuchungsergebnisse<br />
2.3.4. Pensionsrückstellungen<br />
Einen weiteren, allerdings sehr komplexen Themenbereich stellt die künftige Behandlung der<br />
kommunalen Pensionsverpflichtungen dar. Diese werden im kameralistischen System aus den<br />
laufenden Haushaltsmitteln realisiert, wobei eine liquiditätsorientierte Sichtweise überwiegt.<br />
Gleichzeitig steigt die Belastung aufgrund der wachsenden Zahl der Versorgungsberechtigten<br />
und der steigenden Lebenserwartung ständig an.<br />
Da sich die kameralistische Praxis in der Vergangenheit nicht an einer Kapitalwertermittlung der<br />
während der Anstellung anfallenden Versorgungsansprüche orientierte, wurden nicht oder nur<br />
im geringen Umfang Rücklagen gebildet. Die Umstellung auf eine kaufmännische Buchführung<br />
mit ihrer Vorschrift, ungewisse zukünftige Verbindlichkeiten zu bilanzieren, führt nun zu einer<br />
11. Kommunale Pensionsverpflichtungen<br />
Entwicklung Versorgungsempfänger und -ausgaben<br />
in Mrd. Euro<br />
170<br />
150<br />
166<br />
8<br />
7<br />
130<br />
110<br />
107 122<br />
6,2<br />
6<br />
5<br />
90<br />
4<br />
70<br />
3,6<br />
3<br />
50<br />
2,9<br />
2005 2015 2035<br />
2<br />
Anzahl kommunaler Versorgungsempfänger in Tausend<br />
kommunale Versorgungsausgaben in Mrd. EUR (Anpassung 1,5%)<br />
Quelle: Dritter Versorgungsbericht der Bundesregierung, Berlin, 25.05.2005, S. 61ff)
Untersuchungsergebnisse I 25<br />
verstärkten Auseinandersetzung mit dieser<br />
Problematik. Die Abwicklung der Pensionsansprüche<br />
über Versorgungsverbände oder<br />
ähnliche Konstruktionen stellt dabei lediglich<br />
organisatorische Maßnahmen dar, die die<br />
Kommune letztendlich nicht von der eigentlichen<br />
Versorgungspflicht befreien.<br />
Die Bewertung und Bilanzierung der Pensionsverpflichtungen<br />
und ihrer jährlichen<br />
Zuführungen, welche sich auch in der neuen<br />
ressourcenverbrauchsorientierten Gewinn und<br />
Verlustrechnung bemerkbar machen werden,<br />
stellen dabei noch keine über die laufenden<br />
Zahlungsverpflichtungen hinausgehende<br />
liquide Belastung dar. Sie helfen allerdings,<br />
die bis dato teilweise recht unklaren Prognosen<br />
zu zukünftigen Haushaltsbelastungen<br />
durch Versorgungsansprüche in der Zukunft<br />
zu beziffern.<br />
Darüber hinaus wird jedoch bereits die<br />
Möglichkeit der Kapitaldeckung von Pensionsrückstellungen<br />
diskutiert, die über den<br />
systematischen Aufbau eines Kapitalstockes<br />
in verschiedenen Geldanlagen zu einer<br />
Finanzierung der Ansprüche in der Zukunft<br />
beitragen soll. Insbesondere bei einem sich<br />
fortsetzenden mehrjährigen Aufbau kann<br />
dabei die Wirkung eines Zinseszinseffekts zu<br />
einer beachtlichen Kostenreduzierung führen.<br />
Auch unter Ratingaspekten führt eine fristengerechte<br />
Bilanzstruktur 43 zu einer besseren<br />
Bewertung (Anlagendeckungsgrad, siehe auch<br />
Kapitel Rating/Bilanzanalyse).<br />
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die<br />
Voraussetzung für den Einstieg in eine Kapitaldeckung<br />
von Pensionsverpflichtungen in der<br />
nachhaltigen Erwirtschaftung liquider Überschüsse<br />
liegt, da eine Dotierung des Kapitalstocks<br />
ansonsten nur zu Lasten weiterer Verschuldung<br />
möglich wäre. Der Spread zwischen<br />
Soll- und Habenzinsen dürfte in der Folge auch<br />
die durch den angesprochenen Zinseszinseffekt<br />
erwarteten Einsparungen negieren. Es<br />
wird deutlich, dass aus diesen Erwägungen<br />
heraus vor einen Aufbau kapitalgedeckter<br />
Versorgungsansprüche zunächst eine zumindest<br />
liquiditätsseitige Haushaltskonsolidierung<br />
gesetzt ist.<br />
Zudem ist anzumerken, dass eine vollständige<br />
Kapitaldeckung der Pensionsansprüche auch<br />
in der Privatwirtschaft (Betriebsrenten) in<br />
vielen Fällen nicht erreicht wird. So stellte eine<br />
Untersuchung der Unternehmensberatung<br />
Rauser Towers Perrin bezogen auf das Jahr<br />
2005 eine Lücke zwischen Anwartschaften und<br />
reserviertem Vermögen bei den DAX-30-Konzernen<br />
in Höhe von 108 Mrd. Euro bei einem<br />
Gesamtvolumen der Pensionsansprüche von<br />
247 Mrd. Euro fest. 44<br />
Ein alternativer Weg zur Schaffung eines Kapitalstockes<br />
könnte in der Bildung kommunaler<br />
Sondervermögen aus dem Verkauf oder der<br />
Umwidmung anderweitig nicht mehr benötigter<br />
Aktiva resultieren; die Möglichkeiten dazu<br />
dürften jedoch interkommunal stark divergieren<br />
und sind abhängig von der individuellen<br />
Vermögensausstattung und den jeweiligen<br />
politischen Machtverhältnissen.<br />
43<br />
Langfristigen Pensionsverbindlichkeiten<br />
steht langfristig<br />
orientiertes Finanzanlagevermögen<br />
gegenüber.<br />
44<br />
Spiegel-Online (2007)
26 I Untersuchungsergebnisse<br />
45<br />
Bei einer Clearingstelle handelt<br />
es sich um eine zentrale<br />
Stelle, in welcher konzerninterne<br />
Zahlungsverpflichtungen<br />
erfasst und durch<br />
Verrechnung zum Ausgleich<br />
gebracht werden.<br />
46<br />
Vgl. § 30 GmbHG<br />
2.4 Cash Management<br />
Die Verwaltung kommunaler Liquiditäts- und<br />
Vorratsbestände birgt hohes Rationalisierungspotenzial,<br />
welches sich aus dem bisher noch<br />
nicht besonders deutlich ausgeprägten Selbstverständnis<br />
der Kommunen als Konzern ergibt.<br />
Zwar wird im Bereich der Kernhaushalte bereits<br />
über eine gegenseitige Deckungsfähigkeit<br />
einzelner Titel ein aktives Cash Management<br />
betrieben, eine Einbeziehung kommunaler Eigengesellschaften<br />
in ein zu etablierendes „konzernweites“<br />
System des Liquiditätsmanagements<br />
steht jedoch noch aus. Es ist freilich zu<br />
beachten, dass streng an Verwendungszwecke<br />
gebundene Gelder, wie Fördermittel, ggf. (teilweise)<br />
aus diesem System herausgehalten<br />
werden müssen. Die üblichen Instrumente<br />
des konzerninternen Netting und Pooling<br />
sowie des von den Banken angebotenen<br />
Zerobalancing dürften recht schnell allgemeine<br />
Verbreitung finden. Beim sogenannten<br />
konzerninternen Netting handelt es sich um<br />
eine Verrechnungsvereinbarung zwischen der<br />
Kommune und ihren Eigenbetrieben, Tochterund<br />
Beteiligungsunternehmen. Gegenseitige<br />
Forderungen und Verbindlichkeiten werden<br />
grundsätzlich gegeneinander verrechnet, um<br />
Finanzierungs- und Transaktionskosten (Bankgebühren)<br />
zu sparen. Bei hinreichend umfangreichen<br />
Strukturen (Einbindung zahlreicher<br />
Töchter) einer konsequenten Umsetzung, die<br />
eine entsprechende IT-Umgebung und eine<br />
konzerninterne Clearingstelle 45 erfordert,<br />
bestehen insbesondere für größere Kommunen<br />
erhebliche Potenziale, um gerade die Inanspruchnahme<br />
der vergleichsweise teuren Kassenkredite<br />
zu reduzieren. Wird darüber hinaus<br />
noch ein Pooling (auch Cash-Pooling) etabliert,<br />
werden auch die konzerninternen Liquiditätsbestände<br />
einbezogen. Bestehende Guthaben<br />
werden als vorübergehende konzerninterne<br />
Darlehen an Stellen mit Liquiditätsbedarf verschoben,<br />
um externe Kreditaufnahmen zu vermeiden.<br />
Es ist dabei allerdings auf die bereits<br />
angesprochene Berücksichtigung zweckgebundener<br />
Mittel zu achten. Darüber hinaus besteht<br />
die Notwendigkeit, dass das Pooling nicht zur<br />
Deckung dauerhafter Liquiditätsdefizite<br />
missbraucht wird. Insbesondere bei Einbezug<br />
privatrechtlicher, in Form von Kapitalgesellschaften<br />
organisierter Einheiten kann es<br />
ansonsten zur Aushöhlung des Grundsatzes<br />
der Kapitalerhaltung 46 kommen und zu Verstößen<br />
gegen diesen Grundsatz. Für kleinere<br />
Kommunen, die den mit konzerninternen<br />
Verrechnungsstellen verbundenen Verwaltungsaufwand<br />
scheuen bzw. für die eine<br />
Anwendung von Netting- oder Pooling-Systemen<br />
schlicht unrentabel wäre, bietet sich die<br />
vorher erwähnte Lösung des Zerobalancing<br />
an. Hierbei übernimmt eine Bank (i.d.R. die<br />
Hausbank), bei der alle wesentlichen zahlungsverkehrsrelevanten<br />
Konten geführt werden,<br />
das Clearing, indem sie entweder täglich oder<br />
zu bestimmten Stichtagen einen weitgehenden<br />
Ausgleich aller Kontosalden vornimmt. Dies<br />
kann entweder über einen Kontenverbund<br />
geschehen, in dem die Salden lediglich gegenein<br />
ander aufgerechnet werden, um für die<br />
ver bleibende Spitze die Kredit- oder Guthabenzinsen<br />
zu ermitteln, oder auch durch einen tatsächlichen<br />
Kontenausgleich per Überweisung.<br />
Auch hier lässt sich eine optimale Nutzung der<br />
im Konzern Kommune vorhandenen Liquidität<br />
erreichen, mit dem Vorteil, dass eigene personelle<br />
Ressourcen geschont werden können.
Untersuchungsergebnisse I 27<br />
2.5 Rating<br />
Unter Basel II werden die Regeln des Baseler<br />
Bankenausschusses zur Eigenkapitalunterlegung<br />
von Krediten subsumiert, welche in<br />
Europa seit dem 1. Januar 2007 verpflichtend<br />
sind. Der vorherige Standard, in welchem alle<br />
Kredite pauschal zu acht Prozent mit Eigenkapital<br />
der Bank zu unterlegen waren, ist einer<br />
komplexen Regelung gewichen, in welcher die<br />
letztendliche Eigenkapitalunterlegung von der<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit und der Höhe des<br />
zu erwartenden Kreditausfalls (exposure at<br />
default) abhängt. Während letzterer vergleichsweise<br />
einfach aus der Forderung selbst und<br />
dem Wert ihrer Besicherung ermittelt werden<br />
kann, werden zur Bestimmung des Ausfallrisikos<br />
Ratingverfahren herangezogen. Die externen<br />
Ratings der Agenturen Standard & Poor‘s,<br />
Moody‘s oder Fitch werden dabei zur Risikogewichtung<br />
im sogenannten Standardansatz herangezogen.<br />
Bei diesem werden die ermittelten<br />
Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten an<br />
extern geratete Schuldner (Staaten, internationale<br />
Institutionen, Großunternehmen und ggf.<br />
auch Kommunen) bzw. von Wertpapieren von<br />
extern gerateten Schuldnern mit bestimmten<br />
vorgegebenen Risikogewichtungsfaktoren<br />
verknüpft.<br />
12. Ratingklassen von Standard & Poor‘s<br />
Rating* Ausfallwahrscheinlichkeit** Einstufung*** Kredit***<br />
AAA 0,00% Beste Bonität<br />
AA+ 0,00% Sehr gute Bonität<br />
AA 0,00%<br />
AA- 0,02%<br />
A* 0,05% Gute Bonität<br />
A 0,04%<br />
A- 0,04%<br />
BBB+ 0,22% Zufriedenstellende Bonität<br />
BBB 0,28%<br />
BBB- 0,39%<br />
BB+ 0,56% Befriedigende bis<br />
BB 0,95%<br />
ausreichende Bonität,<br />
höheres Insolvenzrisiko<br />
BB- 1,76%<br />
B+ 3,01% Ausreichende Bonität,<br />
B 8,34%<br />
hohes Insolvenzrisiko<br />
B- 12,18%<br />
CCC 28,83% Kaum ausreichende Bonität,<br />
CC<br />
sehr hohes Insolvens-<br />
risiko<br />
C<br />
Kreditvergabe (sehr)<br />
wahrscheinlich<br />
Kreditvergabe fraglich<br />
bis sehr fraglich<br />
* Nach der Klassifikation von Standard & Poor‘s ** Nach S&P Annual Default Study 2005 *** Nach Deutsche Bank<br />
Quelle: Schwarting (2007), S. 125
28 I Untersuchungsergebnisse<br />
47<br />
Vgl. Schwarting (2007),<br />
S. 123<br />
48<br />
Bundesverfassungsgericht,<br />
Urteil vom 19. Oktober 2006<br />
– 2 BvF 3/03<br />
49<br />
Deutsche Bundesbank<br />
(2005), S. 23<br />
Die deutschen Kommunen (und Bundesländer)<br />
profitieren hinsichtlich externer Ratings<br />
bislang von einer von den Ratingagenturen<br />
unisono unterstellten Beistandsbereitschaft der<br />
Länder bzw. des Bundes. Obwohl die Länder<br />
eine rechtliche Garantenstellung für kommunale<br />
Schulden bisher stets vermieden haben, 47<br />
und auch der Bund in seiner ablehnenden<br />
Haltung bezüglich einer Einstandspflicht für<br />
Schulden der Länder durch das Verfassungsgerichtsurteil<br />
im Falle Berlins 48 gestärkt wurde,<br />
gehen die Kapitalmärkte nach wie vor davon<br />
aus, dass Deutschland im Zweifelsfall die Zahlungsunfähigkeit<br />
einer Gebietskörperschaft<br />
– nicht zuletzt aus Imagegründen – verhindern<br />
wird. Die im Standardansatz gegebene Möglichkeit,<br />
gewisse, weitgehend risikolose Kreditbestände<br />
ungeratet zu lassen (sog. partial<br />
use), stand bundesweit zur Diskussion. Entschieden<br />
wurde, dass kommunale Schulden<br />
künftig weiter unter diesem Ausnahmebestand<br />
klassifiziert werden. Es ist festzuhalten, dass<br />
nach den QIS<strong>Studie</strong>n (qualitative impact<br />
studies) der Bundesbank zur Umsetzung von<br />
Basel II in der deutschen Kreditwirtschaft (vor<br />
allem im Bereich der Unternehmenskredite)<br />
bei insgesamt rückläufigen Anforderungen an<br />
die Eigenkapitalunterlegung die Staatenportfolios<br />
einen gegenläufigen Trend aufweisen. 49<br />
Der IRB-Ansatz (internal ratings based) legt<br />
dagegen aus institutseigenen Ratings ermittelte<br />
Ausfallwahrscheinlichkeiten zugrunde,<br />
wobei sich die Ratingklassen aus der bankinternen<br />
Datenhistorie ergeben. Obwohl der<br />
IRB-Ansatz mit erheblichem statistischem<br />
Aufwand verbunden ist, wird er aufgrund der<br />
tendenziell geringeren Eigenkapitalunterlegung<br />
von den Kreditinstituten bevorzugt. Für<br />
Schuldner ohne externes Rating bildet er zudem<br />
die einzige Möglichkeit zur Ermittlung<br />
der Ausfallwahrscheinlichkeiten. Die bankinternen<br />
Ratingverfahren basieren in der Regel<br />
auf zwei Säulen, einem quantitativen und<br />
einem qualitativen Ansatz. Ersterer beinhaltet<br />
vergleichsweise „harte Kriterien“, wie<br />
Kennzahlen aus der Bilanz und Gewinn- und<br />
Verlustrechnung. Darüber hinaus werden<br />
gelegentlich auch Planrechnungen und Prognosen<br />
herangezogen. Da in der Regel die<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit für einen einjährigen<br />
Betrachtungshorizont bestimmt wird, spielen<br />
auch liquiditätsbezogene Kennzahlen eine<br />
bedeutende Rolle. Unter qualitativen Faktoren<br />
werden im Wesentlichen nichtnummerische<br />
Informationen verstanden, die oft auf der<br />
Beurteilung der zu ratenden Entität durch das<br />
Kreditinstitut beruhen. So werden auch hier<br />
neben objektiven Fakten, wie Rechtsform,<br />
Branchenzugehörigkeit und ggf. Informationen<br />
zu bilanzpolitischen Maßnahmen, „weiche Kriterien“,<br />
wie die Beurteilung der Organisation,<br />
Produktqualität, Managementfähigkeiten,<br />
des Controlling und zahlreicher weiterer Faktoren,<br />
meist auf Punkteskalen vorgenommen,<br />
die dann in die Ermittlung der Ratingnote<br />
einfließen. Bei der sogenannten Kalibrierung<br />
spielt die Gewichtung der qualitativen gegenüber<br />
den quantitativen Faktoren eine bedeutende<br />
Rolle. Unter Kalibrierung wird eine Feineinstellung<br />
des jeweiligen Ratingsystems auf<br />
den zu ratenden Kundenbestand verstanden,<br />
welche in den meisten Kreditinstituten in einer<br />
mehrjährigen Pilotphase erfolgte, um einen<br />
hinreichenden Datenbestand (Ratinghistorie)<br />
zu erhalten und institutspezifische Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
für die zu definierenden<br />
Ratingklassen zu bestimmen. Eine „Umrechnung“<br />
der internen Ratingklassen in<br />
die Einstufungen der Ratingagenturen, ein<br />
sogenanntes Mapping, ist möglich, muss<br />
jedoch regelmäßig auf eventuelle Änderungen
Untersuchungsergebnisse I 29<br />
überprüft werden. Basel II bestimmt überdies<br />
zwei Insolvenzklassen; zum Ersten, dass der<br />
Kreditnehmer seine Zahlungsverpflichtungen<br />
seit mehr als 90 Tagen nicht mehr erfüllen<br />
kann (Illiquidität), zum anderen, dass der Kreditnehmer<br />
seinen Kreditverpflichtungen nicht<br />
mehr nachkommt. 50 Kreditnehmer mit diesen<br />
Merkmalen werden ungeachtet anderer Ergebnisse<br />
als Ausfall geratet. Somit würde eine<br />
Kommune bei Zahlungsverzug von >90 Tagen<br />
von Zinszahlungen bei einem Kassenkredit<br />
oder Kommunaldarlehen nach Basel II als<br />
ausgefallen eingestuft.<br />
2.6 Bilanzanalyse<br />
Wie im vorangegangenen Abschnitt angedeutet,<br />
könnten aus dem doppischen Jahresabschluss<br />
gewonnene Kennzahlen als<br />
quantitative Ratingfaktoren ein wesentliches<br />
Fundament der Bonitätseinschätzung bilden.<br />
Während die bisherigen kameralistischen Rechenwerke<br />
von Kreditgebern nur in Einzelfällen<br />
herangezogen wurden und für Aussagen,<br />
die über eine bloße Liquiditätseinschätzung<br />
hinausgehen, auch nicht genügend Informationen<br />
enthalten, wird sich auf die künftigen<br />
Jahresabschlüsse das vorhandene Instrumentarium<br />
der Bilanzanalyse und -kritik anwenden<br />
lassen. Hinsichtlich dieser Systematik wird<br />
grundsätzlich zwischen finanzwirtschaftlicher,<br />
erfolgswirtschaftlicher und strategischer Analyse<br />
unterschieden. Die finanzwirtschaftliche<br />
Analyse bezieht sich dabei auf bilanzielle und<br />
liquiditätsorientierte Größen, die erfolgsorientierte<br />
basiert auf der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
und bemisst die Rentabilität, während<br />
die strategische Analyse zukunftsgerichtete<br />
Elemente einbezieht. Untrennbar verbunden<br />
mit der Bilanzanalyse ist die Bilanzkritik, in der<br />
die Kennzahlen der Analyse einer mehr oder<br />
weniger umfangreichen verbalen Würdigung<br />
13. Mapping S&P zum Commerzbank (CB)-<br />
Rating zu Skala Initiative Finanzstandort<br />
Deutschland (IFD)<br />
S&P CB-Rating IFD-Skala<br />
AAA bis BBB 1,0 – 2,4 I<br />
BBB- 2,6 – 2,8 II<br />
BB+ bis BB 3,0 – 3,2 III<br />
BB- bis B+ 3,4 – 3,8 IV<br />
B+ bis B 4,0 – 4,6 V<br />
B 4,8 – 5,8 VI<br />
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Commerzbank (2006)<br />
unterzogen werden. Besonders wichtig ist<br />
hierbei die dynamische Bilanzkritik, welche<br />
über einen Mehrjahresvergleich Entwicklungstendenzen<br />
aufzeigen kann, die bei einer<br />
statischen Betrachtung (nur ein Bilanzstichtag)<br />
nicht evident sind. Weiteres wichtiges Element<br />
der Bilanzkritik ist der Vergleich der gewonnenen<br />
Zahlen mit Branchenkennzahlen und<br />
Planzahlen. Nicht selten werden die ermittelten<br />
Kennzahlen und deren Würdigung<br />
den Kreditnehmern im Rahmen einer Unternehmensanalyse<br />
entgeltlich zur Verfügung<br />
gestellt. Bezüglich der Ausweitung der Bilanzanalyseverfahren<br />
auf kommunale Kreditnehmer<br />
stellt sich vor allem die Frage nach der<br />
Anwendbarkeit ertragsorientierter Kennzahlen,<br />
da das Zielsystem einer Kommune nicht<br />
primär in der Gewinnmaximierung, sondern<br />
in der Aufgabenerfüllung besteht. Nichtsdestotrotz<br />
lässt sich im Sinne der Erwägung<br />
„Bürger=Shareholder“ ein gewisses Interesse<br />
an einer Vermögenserhaltung oder, im günstigen<br />
Falle, -mehrung begründen.<br />
50<br />
Vgl. Bank für Internationalen<br />
Zahlungsausgleich (2004),<br />
S. 97
30 I Untersuchungsergebnisse<br />
51<br />
Grunwald u.a. (2006), S. 5<br />
Zur Abwandlung bestehender Kennzahlensysteme<br />
existiert bereits ein Vorstoß der Stadt<br />
Salzgitter, welcher auf erste Erfahrungen<br />
mit deren Eröffnungsbilanz zurückgeht und<br />
daher auch als „Salzgitteraner Analysezahlen“<br />
bezeichnet wurde. Diese beinhalten neben der<br />
reinen Kennzahlengewinnung ebenso bereits<br />
Überlegungen zur Definition qualitativer Faktoren<br />
für ein eventuelles kommunales Rating.<br />
Sie sollen nach Angabe der Autoren „der<br />
Startschuss einer kommunalen Kennzahlendiskussion<br />
sein“. 51 Aus Sicht der Verfasser ist zu<br />
kritisieren, dass die Initiative zur Bewertung<br />
der kommunalen Bilanzen nicht von deren<br />
Adressaten, sondern von den Kommunen<br />
selbst ausgeht. Dies deutet zum einen hin auf<br />
einen gewissen Willen zur Beeinflussung der<br />
Meinung von Rechnungshöfen, Kreditinstituten<br />
und Öffentlichkeit bezüglich der Interpretation<br />
der kommunalen Jahresabschlüsse und zum<br />
anderen auf gewisse Tendenzen, eine Neuausrichtung<br />
der Bilanzanalyse aufgrund von<br />
Besonderheiten kommunaler Jahresabschlüsse<br />
vorzunehmen. Nachvollziehbar ist die Selbstbeschäftigung<br />
der Kommunen allerdings vor<br />
dem Hintergrund einer Optimierung der Bilanz<br />
angesichts etwaiger Ratingverfahren durch<br />
die Kreditgeber. In der folgenden Übersicht<br />
sind die seitens der Stadt Salzgitter ermittelten<br />
Kennzahlen dargestellt, wobei die speziell für<br />
den kommunalen Bereich entwickelten Kennzahlen<br />
farbig markiert sind:<br />
14. Salzgitteraner Analysezahlen<br />
I Vermögens- und Kapitalstruktur<br />
Anlageintensität<br />
Investitionsquote<br />
Anlageabnutzungsgrad<br />
Abschreibungsquote<br />
Verschuldungsgrad<br />
Eigenkapitalquote<br />
Fremdkapitalquote<br />
Anteil Pensionsrückstellungen<br />
Anlagevermögen<br />
Gesamtvermögen<br />
Nettoinvestitionen<br />
Sachvermögen zu hist. AHK<br />
kumulierte Abschreibungen<br />
Sachvermögen zu hist. AHK<br />
Jahresabschreibung<br />
Sachanlagevermögen<br />
Fremdkapital<br />
Basis-Reinvermögen<br />
Basis-Reinvermögen<br />
Bilanzsumme<br />
Fremkapital<br />
Gesamtkapital<br />
Pensionsrückstellungen<br />
Gesamtkapital
Untersuchungsergebnisse I 31<br />
II Finanzstruktur<br />
Deckungsgrad A<br />
Deckungsgrad B<br />
Liquidität ersten Grades<br />
Liquidität dritten Grades<br />
Dynamischer Verschuldungsgrad/<br />
Entschuldungsfähigkeit<br />
Cashflow-Marge<br />
Investitionsdeckung<br />
(umgekehrte) Investitionsdeckung<br />
Innenfinanzierungsgrad<br />
Eigenkapital<br />
Anlagevermögen<br />
EK + langfr. FK<br />
Anlagevermögen<br />
Liquide Mittel<br />
Kurzfr. FK<br />
Liquidierbares Umlaufvermögen<br />
Kurzfr. FK<br />
Nettoverschuldung<br />
Cashflow<br />
Cashflow<br />
ordentliche Erträge<br />
Jahresabschreibung SV<br />
Auszahlungen für Investitionen<br />
100 - Auszahlungen für Investitionen<br />
Jahresabschreibung auf Sachanlagen<br />
Cashflow<br />
Nettoinvestitionen<br />
III Ertrags- und Steuerstruktur<br />
Zinssteuerquote<br />
Zinsdeckungsquote<br />
Zinslastquote<br />
Transferaufwandsquote<br />
Durchschnittliche Personalkosten pro<br />
Mitarbeiter<br />
Personalaufwandsquote<br />
Abschreibungsintensität<br />
Anteil Straßenbauunterhaltung<br />
Anteil Gebäudeinstandhaltung<br />
Zinsaufwand<br />
Steuererträge<br />
Zinsaufwand<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zinsaufwand<br />
Gesamtaufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Gesamtaufwendungen<br />
Personalaufwand<br />
Anzahl Beschäftigte<br />
Personalaufwand<br />
Gesamtaufwendungen<br />
Jahresabschreibungen Sachanlagen<br />
Ordentliche Erträge<br />
Instandhaltungsaufwand Straßenbau<br />
Buchwert Straßenvermögen<br />
Instandhaltungsaufwand Hochbau<br />
Buchwert des Gebäudevermögens<br />
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Grunwald u. a. (2006)
32 I Untersuchungsergebnisse<br />
Es ist evident, dass die Abweichung des Kennzahlenbestands gegenüber<br />
den in der Privatwirtschaft üblichen Schemata eher gering ausfällt.<br />
Lediglich die speziellen Kennzahlen Zinssteuerquote, Transferaufwandsquote,<br />
Straßenbauaufwandsquote und Gebäudeinstandhaltungsquote<br />
sind für die Einschätzung kommunaler Besonderheiten hinzugestellt<br />
worden. Die Frage nach einer besonderen Rolle der Kommunen bezüglich<br />
deren Würdigung dürfte daher vielmehr im Rahmen der weniger<br />
formalisierten Bilanzkritik behandelt werden. Es ist davon auszugehen,<br />
dass bestehende betriebswirtschaftliche Kennzahlensysteme ohne größeren<br />
Anpassungsaufwand verwendet werden können.
Fazit I 33<br />
3. Fazit<br />
Die Untersuchung verdeutlicht, dass sich die deutschen öffentlichen<br />
Haushalte in einem mehrdimensionalen Umbruchprozess befinden.<br />
Während sich zum einen internationale Richtlinien und nationale<br />
Gesetzesgrundlagen ändern, besteht nicht selten auch interner, zumeist<br />
aus der Verschuldungssituation resultierender Reformdruck. Es<br />
wurde dargestellt, welche Ansätze bestehen, dieser Situation mit neuen<br />
Steuerungsinstrumenten, wie der integrierten Verbundrechnung und<br />
dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, beizukommen. Auch eine<br />
weitgehende Implementierung internationaler Standards, wie in der<br />
Untersuchung dargestellt, erscheint angebracht, um weitere Reformerfordernisse<br />
nach erfolgter Etablierung nationaler Standards zumindest<br />
im Umfang zu reduzieren. Der evidente Nachholbedarf im internationalen<br />
Vergleich berührt dabei mit dem Ziel einer innovativen, modernen<br />
Verwaltung auch Kriterien des internationalen Standortwettbewerbs.<br />
Ein besonderer Fokus im Rahmen der Einführung der doppischen Rechnungslegung<br />
liegt dabei auf den Banken als wesentlichen Gläubigern<br />
der kommunalen Haushalte. Insbesondere im Schuldenmanagement<br />
werden bereits jetzt Produkte und Beratungsleistungen in Anspruch<br />
genommen, wobei den Kommunen oft noch das zum Aufbau geeigneter<br />
Strukturen erforderliche Know-How fehlt. Insbesondere beim Einsatz<br />
von Zinsderivaten besteht hierbei noch Handlungsbedarf.<br />
Die erstmalige Aktivierung kommunalen Anlage- und Umlaufvermögens<br />
wird zahlreiche Veränderungen im Verhältnis Bank-Kommune herbeiführen,<br />
sowohl durch die dann möglichen Bonitätseinschätzungen<br />
(Rating und Bilanzanalyse), als auch im Bilanzstruktur-, Anlagen- und<br />
Cash-Management. Bei letzteren wird der Ausbau bestehender und<br />
die Einführung alternativer Finanzierungsformen und neuer Modelle<br />
öffentlich-privater Partnerschaften Lösungen für den absehbaren<br />
vielfältigen Konsolidierungsbedarf in den kommunalen Bilanzen bieten.<br />
Aus Sicht der Verfasser ist absehbar, dass dieser Betätigungssektor für<br />
die Kreditbranche sowie die entsprechenden Stellen der öffentlichen<br />
Verwaltung im Zuge der anstehenden Veränderungen einen erheblichen<br />
Bedeutungszuwachs erfahren wird.
34 I Literatur<br />
Literaturverzeichnis<br />
Adam, Berit (2004), Internationale Rechnungslegungsstandards für die öffentliche Verwaltung (IPSAS),<br />
Eine kritische Analyse unter besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit in Deutschland, Frankfurt<br />
am Main.<br />
Birkholz, Kai (2006)¸ Kommunales Debt Management in Deutschland, in: Nierhaus, Michael (Hrsg.),<br />
KWI-Arbeitshefte 12, Potsdam.<br />
Bolsenkötter, Heinz (2007), Die Zukunft des öffentlichen Rechnungswesens, Einführung, in Bolsenkötter,<br />
Heinz (Hrsg.), Die Zukunft des öffentlichen Rechnungswesens, Reformtendenzen und internationale<br />
Entwicklung, Baden-Baden, S. 13-25.<br />
Bräunig, Dietmar (2007), Rechnungslegung nach IAS/IFRS und IPSAS aus bilanztheoretischer Sicht am<br />
Beispiel öffentlicher Unternehmen und Verwaltungen, in: Bolsenkötter, Heinz (Hrsg.), Die Zukunft des öffentlichen<br />
Rechnungswesens, Reformtendenzen und internationale Entwicklung, Baden-Baden, S. 69-87.<br />
Budäus, Dietrich (2004), Public Private Partnership – Ansätze, Funktionen, Gestaltungsbedarfe, in:<br />
Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft (Hrsg.), Public Private Partnership, Berlin, S. 9-22.<br />
Bundesrechnungshof, Bericht nach §99 Bundeshaushaltsordnung über die Modernisierung des staatlichen<br />
Haushalts- und Rechnungswesens, Bonn, 17.08.2006.<br />
Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 96/2006 vom 19. Oktober 2006 zum Urteil vom<br />
19.Oktober 2006 – 2 BvF 3/03.<br />
Commerzbank (2006), Einblick gewinnen, Chancen erkennen – Ratingorientierte Beratung, Broschüre<br />
VKS02015.<br />
Deutsche Bundesbank (2005), Ergebnisse der vierten Auswirkungsstudie zu Basel II, Frankfurt am Main.<br />
Förschle, Gerhart u. a. (2001), Internationale Rechnungslegung: US-GAAP, HGB und IAS, Heidelberg.<br />
Frischmuth, Birgit (2006), Musterdienstanweisung: in Sachsenlandkurier, Jg. 17 (2006), S. 122ff.<br />
Grunwald, Ekkehard u. a. (2006), Die Analyse der kommunalen Bilanz, in: KGSt Info, Sonderdruck aus<br />
Beiträgen der Bände 22/2005 und 08/2006.<br />
Hilgers, Dennis (2007), Neue Wege im Umgang mit öffentlichen Ressourcen und öffentlicher Verschuldung<br />
– Erkenntnisse aus der 2. Hamburger Fachtagung zur Reform des staatlichen Rechnungswesens<br />
am 9. und 10. November 2006, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen,<br />
30. Jg., Heft 2, S. 188-195.
Literatur I 35<br />
Hufnagel, Wolfgang und Andreas Jürgens (2003), Projekt NKF – Die Organisation des betrieblichen<br />
Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, in: Der Gemeindehaushalt, 104 (2003),<br />
Heft 6, S. 138-140.<br />
Hull, John C. (2006), Optionen, Futures und andere Derivate, München.<br />
Landkreistag Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2006), Sonderrundschreiben S 84/2006.<br />
Lenk, Thomas (2007), Wissenschaftlich-statistische Auswertung – Welche allgemeinen Erkenntnisse<br />
kann man aus den Durchschnittskennzahlen ableiten?, Abschlussvortrag der Tagung Erster bundesweiter<br />
interkommunaler Finanzierungsvergleich am 8.5.2007 in Berlin.<br />
Lenk, Thomas und Oliver Rottmann (2007), Öffentliche Unternehmen vor dem Hintergrund der Interdependenz<br />
von Wettbewerb und Daseinsvorsorge am Beispiel einer Teilveräußerung der Stadtwerke<br />
<strong>Leipzig</strong>, Arbeitspapier Nr. 36 des Instituts für Finanzen, <strong>Leipzig</strong>.<br />
Lüder, Klaus (2001), Neues öffentliches Haushalts- und Rechnungswesen, Anforderungen, Konzept,<br />
Perspektiven, Berlin.<br />
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (Hrsg.) (2004), Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung<br />
und der Eigenkapitalanforderungen, Basel.<br />
Schwarting, Gunnar (2007), Kommunales Kreditwesen, Haushaltsrechtliche Grundlagen – Schuldenmanagement<br />
– öffentlich-private Partnerschaften, Berlin.<br />
spiegel-online (2007), Die 100-Milliarden-Euro-Lücke,<br />
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,druck-429423,00.html, 19.09.2007.
VKS01083<br />
Herausgeber:<br />
Commerzbank AG<br />
Mittelstandsbank<br />
Frankfurt am Main<br />
www.commerzbank.de/firmenkunden<br />
Stand: Oktober 2010