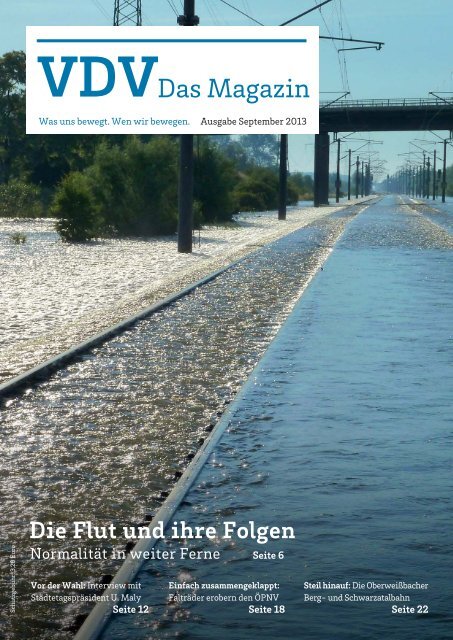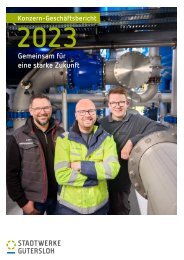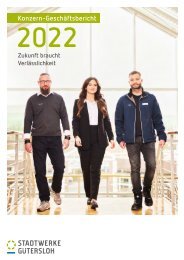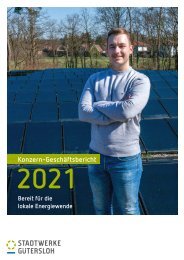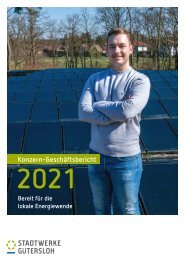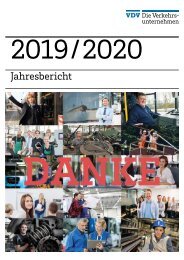VDV - Das Magazin
Ausgabe 3 - September 2013
Ausgabe 3 - September 2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>VDV</strong><br />
<strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong><br />
Was uns bewegt. Wen wir bewegen. Ausgabe September 2013<br />
Schutzgebühr: 3,20 Euro<br />
Die Flut und ihre Folgen<br />
Normalität in weiter Ferne Seite 6<br />
Vor der Wahl: Interview mit<br />
Städtetagspräsident U. Maly<br />
Seite 12<br />
Einfach zusammengeklappt:<br />
Falträder erobern den ÖPNV<br />
Seite 18<br />
Steil hinauf: Die Oberweißbacher<br />
Berg- und Schwarzatalbahn<br />
Seite 22
Inhalt<br />
18 <strong>Das</strong> klappt: Falträder ermöglichen<br />
neue Wegeketten mit dem ÖPNV.<br />
6 Nach der Flut: Nur Notbetrieb auf<br />
Magdeburger Betriebshof<br />
30 Werbebotschafter: VRS fährt gut<br />
mit Schauspieler Ralf Richter.<br />
22 Technikdenkmal: Im Thüringer<br />
Wald geht es steil bergauf.<br />
28 Wiener Linien: Im Nahverkehr<br />
sozial verträglich unterwegs<br />
3 Editorial<br />
Solidarität in der Katastrophe<br />
4 <strong>VDV</strong> im Bild<br />
Millionenschäden und Umleitungen<br />
6 Titelstory<br />
Normalität in weiter Ferne<br />
Seite 8: Drei Fragen an Schleswig-<br />
Holsteins Verkehrsminister<br />
Reinhard Meyer<br />
Seite 9: Hochwasserfolgen treffen<br />
den Fernverkehr hart.<br />
10 Aktuell<br />
Was der <strong>VDV</strong> von der neuen<br />
Bundesregierung erwartet<br />
11 Standpunkt<br />
<strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />
Oliver Wolff fordert auch<br />
von Wahlkämpfern Realismus.<br />
2 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Editorial<br />
In der<br />
Katastrophe<br />
zusammengestanden<br />
Auch wenn das Juni-Hochwasser bei vielen schon<br />
wieder in Vergessenheit geraten ist – für die Mitarbeiter<br />
und Fahrgäste der betroffenen Verkehrsunternehmen<br />
bestimmt es immer noch den Alltag.<br />
Und das wird noch eine Weile so bleiben. Welche<br />
Schäden das Wasser beispielsweise auf der ICE-<br />
Strecke bei Stendal angerichtet hat und wann die<br />
Folgen behoben sein können, werden wir frühestens<br />
in den kommenden Wochen erfahren.<br />
Klar ist aber: Ohne die Einsatz- und Hilfsbereitschaft<br />
unzähliger freiwilliger und professioneller Helfer und<br />
ohne die Flexibilität und das besondere Engagement<br />
vieler Mitarbeiter in den Verkehrsunternehmen<br />
wären die Schäden an Infrastruktur und Fahrzeugen<br />
vielleicht noch größer ausgefallen. Und auch jetzt versuchen<br />
die Mitarbeiter jeden Tag, die Unannehmlichkeiten<br />
für unsere Kunden so gering wie möglich zu<br />
halten. Dafür möchte ich allen meinen herzlichen<br />
Dank aussprechen.<br />
Besonderen Dank möchte ich noch einmal an die<br />
Besucher unserer Jahrestagung richten, die im Juni<br />
für die damals akut betroffene Region um Magdeburg<br />
gespendet haben. Die Solidarität ging über die Geldspenden<br />
hinaus und war ganz handfest: Busfahrer<br />
aus Hamburg setzten sich in Magdeburg ans Steuer,<br />
andere Verbandsunternehmen stellten Fahrzeuge<br />
und Material. Wenn es etwas Gutes in der Katastrophe<br />
gibt, dann, dass sie die Menschen ein Stück zusammengeschweißt<br />
hat.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Jürgen Fenske<br />
12 Blick von außen<br />
Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly<br />
zur Verkehrsinfrastruktur<br />
14 Aus dem Verband<br />
Vielseitig und unterschätzt: Die<br />
Ausbildung in der Verkehrsbranche<br />
18 Reportage<br />
Immer mehr klappen<br />
einfach zusammen.<br />
21 Aktuell<br />
UNESCO-Kommission startet<br />
Wettbewerb „Mobiler Alltag 2023“.<br />
22 Unterwegs im Netz<br />
Hochprozentig bergauf, bergab<br />
– und das oben ohne<br />
26 U20<br />
Discobusse: Feiern und<br />
sicher fahren<br />
28 Grenzenlos<br />
Sozial und nachhaltig: Wiener Linien<br />
bieten viel Bim für kleines Geld.<br />
30 Abgefahren<br />
Autofreak wirbt für intelligenten<br />
Verkehrsmix.<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ finden Sie<br />
auch im Internet als E-Paper unter<br />
www.vdv.de/das-magazin<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 3
4 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
<strong>VDV</strong> im Bild<br />
Millionenschäden und monatelange Umleitungen<br />
Bahndämme über- und unterspült, Brücken zerstört, Betriebshöfe vollgelaufen<br />
– wie hier am 10. Juni in Magdeburg: Kaum ein Verkehrsunternehmen<br />
im Süden und Osten der Republik entkam im Juni den beiden<br />
Tiefs Frederik und Günther. Sie sorgten mit Unmengen von Niederschlägen<br />
in den Alpen sowie den Mittelgebirgen Ostdeutschlands und<br />
Tschechiens für ein Jahrhunderthochwasser, das in sieben Bundesländern<br />
Milliardenschäden anrichtete. Der Rückversicherer Munich Re<br />
bezifferte den ökonomischen Gesamtschaden auf mehr als zwölf Milliarden<br />
und den versicherten Schaden auf mehr als drei Milliarden Euro.<br />
Während der Betriebshof der Magdeburger Verkehrsbetriebe Ende<br />
August seine Arbeit stark eingeschränkt wieder aufnehmen konnte,<br />
werden die Folgen bei der Deutschen Bahn noch monatelang zu spüren<br />
sein. Noch immer ist ein Teilstück der ICE-Strecke Berlin-Hannover<br />
östlich von Stendal gesperrt, das die Elbfluten zwei Wochen lang komplett<br />
überspült hatten.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 5
Bis in den August hinein stellten die MVB ihre<br />
Fahrzeuge auf einem Teilstück des Netzes ab und<br />
erledigten dort notdürftige Reparaturen.<br />
Normalität in<br />
weiter Ferne<br />
<strong>Das</strong> Wasser ist seit Wochen wieder weg. Aber für die Menschen in den Hochwassergebieten<br />
Ost- und Süddeutschlands hat die Katastrophe noch lange kein Ende. Von den <strong>VDV</strong>-Unternehmen<br />
traf es die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) besonders schwer.<br />
Die Idylle trügt: Schwalben fliegen zu ihren Nestern,<br />
Gräser wiegen sich im Sommerwind. Ruhe und Naturerlebnisse<br />
sind auf einem Straßenbahnbetriebshof<br />
jedoch fehl am Platz. Vor dem Elbehochwasser<br />
warteten hier 35 Mitarbeiter fast rund um die Uhr<br />
die Züge der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Nun<br />
setzen die Schienen Rost an, wuchert das Grün zwischen<br />
den Abstellgleisen, und von den Nachbargrundstücken<br />
weht ein süßlich-fauliger Geruch<br />
über das Gelände. Keine Pfützen, keine Schlammreste,<br />
nur etwas Sickerwasser in den Montagegruben<br />
der Werkstatt: Mitarbeiter der MVB und<br />
Freiwillige haben hier ganze Reinigungsarbeit geleistet.<br />
Oberflächlich betrachtet erinnert nichts<br />
mehr daran, dass der Betriebshof fast einen halben<br />
Meter unter Wasser stand. Erst auf den zweiten<br />
Blick lässt sich erahnen, was die mittlerweile wieder<br />
kilometerweit entfernte Elbe und das Grundwasser<br />
angerichtet haben könnten. Oberleitungsmasten<br />
stehen schief, Schienen sind unterspült oder liegen<br />
auf lockerem Schotter. Auch zwei Monate nach dem<br />
Pegelhöchststand kann niemand die endgültigen<br />
Schäden beziffern, sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe<br />
noch weit von der Normalität entfernt.<br />
Ende August startete ein Notbetrieb auf dem Betriebshof<br />
Nord. Ob dieser aber jemals wieder wie<br />
vor der Flut arbeiten wird, ist ungewiss.<br />
Zumindest die Fahrzeuge blieben unversehrt. Kurz<br />
bevor das Hochwasser den Betriebshof vom Netz<br />
6 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Titelstory<br />
Kommunikation beinahe in Echtzeit<br />
Die Elbeflut stellte die Magdeburger Verkehrsbetriebe nicht nur vor eine große<br />
betriebliche, sondern auch vor eine kommunikative Herausforderung. Schließlich<br />
galt es, die Fahrgäste möglichst schnell über die aktuellen Änderungen in<br />
den Linien- und Fahrplänen sowie beim Schienenersatzverkehr zu informieren.<br />
„Dabei hat uns Social Media sehr geholfen“, erläutert Pressesprecherin<br />
Juliane Kirste. Kurzfristige Einschränkungen kommunizierten die MVB über<br />
ihren Twitter-Störungsmelder, ihre Facebook-Seite sowie über einen Hochwasser-Bereich<br />
auf ihrer Webseite. Zusätzlich war eine gebührenfreie Hotline<br />
täglich von 5:30 bis 20:30 Uhr besetzt.<br />
Twitter-Störungsmelder: Über das Internet<br />
gab es aktuelle Fahrplan- und Linieninfos.<br />
www.mvbnet.de<br />
https://twitter.com/stoerungsmelder<br />
Auf der Hebebühne war eine nicht-fahrfähige Bahn in Sicherheit (Foto, l.). Bis dato ist eine vollständige Wiederinbetriebnahme des<br />
Betriebshofes nicht in Sicht. Auch ein Drittel des Straßenbahnnetzes war gesperrt.<br />
abschnitt, brachten MVB-Mitarbeiter in einer<br />
nächtlichen Hauruck-Aktion 70 Züge in Sicherheit.<br />
„Eine Stunde später hätten wir die Bahnen nicht<br />
mehr retten können“, verdeutlicht MVB-Pressesprecherin<br />
Juliane Kirste den Wettlauf gegen die<br />
Zeit. Entlang des West- und Südrings wurden die<br />
Trams im Stadtgebiet aufgereiht. Die außergewöhnliche<br />
Abstellfläche entwickelte sich zum mobilen<br />
Interimsbetriebshof, auf dem auch einfache Reparaturen<br />
erledigt wurden. Der kleinere Betriebshof im<br />
südlichen Stadtteil Westerhüsen war ebenfalls<br />
durch das Hochwasser abgeschnitten. Ohne intakten,<br />
festen Betriebshof hielten die Magdeburger<br />
Verkehrsbetriebe auch auf dem Scheitelpunkt des<br />
Hochwassers einen relativ stabilen ÖPNV aufrecht.<br />
Und das, obwohl ein Drittel des Straßenbahnnetzes<br />
gesperrt und ein Teil der Buslinien geändert oder<br />
komplett eingestellt war. Zudem forderte der Katastrophenstab<br />
regelmäßig kurzfristig Busse an, um<br />
Menschen zu evakuieren und Helfer an ihre Einsatzorte<br />
zu bringen. „<strong>Das</strong> alles war nur dank der großen<br />
Bereitschaft unserer Mitarbeiter, weit über das normale<br />
Maß hinaus zu arbeiten, möglich“, erläutert<br />
Betriebsleiter Andreas Busch. Was unter normalen<br />
Umständen drei Monate Planungszeit benötigt,<br />
musste innerhalb kurzer Zeit geschehen: Während<br />
des Hochwassers strickten die MVB-Mitarbeiter acht<br />
Mal ihr Liniennetz und ihre Fahrpläne um, teilweise<br />
mehrmals am Tag. Über das Internet wurden die<br />
Fahrgäste auf dem Laufenden gehalten (s. Infokasten).<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 7
Titelstory<br />
2,7<br />
Milliarden Euro<br />
So hoch sind ersten Schätzungen<br />
zufolge die Hochwasserschäden<br />
allein in Sachsen-Anhalt.<br />
Mit dem Kleinbus der Dessauer Verkehrs GmbH konnten die<br />
MVB die für Trams gesperrte Elbbrücke befahren.<br />
In der Katastrophe standen die MVB nicht alleine<br />
da: Handfeste Unterstützung kam von der Feuerwehr,<br />
von Helfern und Unternehmen aus der Region<br />
sowie von anderen Verkehrsbetrieben. Acht Busfahrer<br />
der Hamburger Hochbahn verstärkten eine<br />
Woche lang den Schienenersatzverkehr und entschärften<br />
damit zum Teil die angespannte Situation<br />
aufgrund der verstärkten Busleistungen. Weitere<br />
Hilfe leistete die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG).<br />
Deren Kleinbus ermöglichte es, den auf einer Elbinsel<br />
liegenden Ortsteil Werder anzusteuern, als<br />
die Brücke dorthin für Straßenbahnen gesperrt<br />
war. Obwohl selber von der Flut betroffen, halfen<br />
die Dresdner Verkehrsbetriebe mit einer Pumpe aus,<br />
die auf dem vollgelaufenen Betriebshof zum Einsatz<br />
kam. Die Bogestra aus Bochum hielt für die Magdeburger<br />
Kapazitäten zur Soforthilfe bereit. „Bei allen<br />
Helfern bedanken wir uns ganz, ganz herzlich“, sagt<br />
MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel:<br />
„Über die große Solidarität und Unterstützung haben<br />
wir uns sehr gefreut.“ Unter anderem waren auf<br />
der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung in Mainz bei einer Tombola<br />
10.000 Euro für die Hochwassergeschädigten<br />
zusammengekommen, 7.500 davon gingen nach<br />
Magdeburg. Mit diesem Geld wollen die MVB nun<br />
eine Kita, einen Sportverein, den Träger eines<br />
Sportplatzes sowie eine Gemeinschaftsunterkunft<br />
unterstützen.<br />
Spendenkonto der Stadt Magdeburg:<br />
Konto-Nr.: 641017855, BLZ: 81053272<br />
Stadtsparkasse Magdeburg<br />
Verwendungszweck: Hochwasserhilfe 2013<br />
Im Eiltempo hat der Bundesrat über den Fluthilfefonds und die Entflechtungsmittel entschieden.<br />
Dazu drei Fragen an den Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz Reinhard Meyer (SPD) –<br />
in Schleswig-Holstein Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie.<br />
» Herr Meyer, welche vorläufige<br />
Schadensbilanz ziehen Sie<br />
für die Flutgebiete in Schleswig-Holstein?<br />
Im Vergleich zu manch anderen<br />
Bundesländern ist Schleswig-Holstein<br />
von dem<br />
Elbhochwasser 2013 recht<br />
glimpflich betroffen worden.<br />
<strong>Das</strong> macht den Schaden für die<br />
einzelnen Betroffenen im Kreis<br />
Herzogtum Lauenburg allerdings<br />
nicht einfacher. Insgesamt<br />
gehen wir in Schleswig-Holstein nach derzeitigem Wissensstand<br />
von einem Schaden in einer Größenordnung von rund 25 Millionen<br />
Euro aus. Davon dürften vier Millionen auf direkte Schäden<br />
von gewerblichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe<br />
entfallen. Die Soforthilfe für die betroffenen Unternehmen und Selbstständigen<br />
ist bereits Anfang Juli angelaufen – mit einer 50-prozentigen<br />
Förderung. Mit dem Bund laufen derzeit noch die Verhandlungen<br />
über die anschließende Aufbauhilfe, durch die bis zu 80 Prozent<br />
des Schadens aufgefangen werden können – unter Anrechnung der<br />
gewährten Soforthilfe. Über die direkten Schäden durch das Hochwasser<br />
hinaus sind viele Unternehmen durch die erzwungenen<br />
Betriebsunterbrechungen und präventive Maßnahmen betroffen.<br />
Diese indirekten Schäden können nach den mit dem Bund verhandelten<br />
Regularien leider nicht bezuschusst werden.<br />
» Zusammen mit dem Fluthilfefonds hat der Bundesrat über die Entflechtungsmittel<br />
entschieden. Einerseits bestand die akute Notsituation,<br />
andererseits wurde ein langer Streit beigelegt. Könnte die schnelle Freigabe<br />
auch künftig als Muster für Infrastrukturfinanzierung dienen?<br />
8 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Hochwasserfolgen treffen Fernverkehr hart: Ein<br />
Viertel der ICE-Fahrgäste immer noch betroffen<br />
Dr. Volker Kefer, Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn,<br />
konnte Ende Juli die Gesamtschäden durch das Hochwasser<br />
noch nicht umfassend eingrenzen. Er setzte sie zwischen 200<br />
und 500 Millionen Euro an. Umleitungen und Verspätungen<br />
kosteten allein im Juni 30 Millionen. „Es gibt ein beträchtliches<br />
Maß an Unsicherheit bezüglich des Untergrunds”, sagt Kefer<br />
über den Bahndamm des immer noch gesperrten Teilstücks der<br />
ICE-Strecke Berlin-Hannover östlich von Stendal. Es war etwa<br />
zwei Wochen komplett überspült, nachdem die Elbefluten<br />
einen maroden Deich bei Fischbeck durchbrachen.<br />
Einen Zeitpunkt für die Freigabe will die DB frühestens Ende<br />
September nennen. Die Umleitungen trafen vor allem Pendler<br />
nach Wolfsburg, um das ICE-Züge wochenlang einen Bogen<br />
machten. Auf den Verbindungen in den Südwesten und in<br />
das Ruhrgebiet dauert die Fahrt von und nach Berlin derzeit<br />
20 bis 60 Minuten länger. Es trifft, so Personenverkehrsvorstand<br />
Ulrich Homburg, bis zu 25 Prozent der Fahrgäste<br />
im Fernverkehr.<br />
Anfang Juni hatte die Katastrophe zunächst Bayern heimgesucht.<br />
Mehrere Hauptstrecken wurden über- und unterspült<br />
und mussten tagelang gesperrt werden. Eine Brücke bei<br />
Übersee am Chiemsee konnte bislang nur provisorisch wiederhergestellt<br />
werden. Dann traf es den Osten: In Sachsen<br />
und Sachsen-Anhalt überspülte das Wasser Bahnsteige und<br />
Kombinierter Verkehr: TX Logistik konnte wegen des Hochwassers<br />
50 Güterzüge nicht Richtung Italien fahren.<br />
Unterführungen. Auch Güterzüge stauten sich wegen Hochwasserschäden<br />
oder umgeleiteter Personenzüge. DB Schenker<br />
Rail-Chef Alexander Hedderich sagte, der Stau-Abbau dauerte<br />
in der schlimmsten Phase mehrere Tage. Die Situation<br />
wurde durch das geringere Güteraufkommen aufgrund des<br />
aktuellen Konjunkturproblems etwas abgemildert.<br />
Eine genauere Hochwasserbilanz konnte TX Logistik ziehen.<br />
<strong>Das</strong> europaweit tätige Eisenbahnlogistikunternehmen beziffert<br />
seinen Schaden durch ausgefallene Züge auf mehr als<br />
400.000 Euro. Drei Viertel davon verteilen sich auf Fixkosten<br />
für Personal, Lokomotiven, Waggons und Trassen in Italien.<br />
50 Güterzüge – größtenteils Kombinierter Verkehr mit Lkw-<br />
Trailern – konnten wegen des Hochwassers nicht Richtung<br />
Brenner fahren. „Umleiten war aufgrund der Profilhöhe nicht<br />
möglich“, erläutert Thorsten Lüttig, Leiter des Geschäftsbereichs<br />
Projektmanagement. Innerhalb von drei Wochen habe<br />
sich der Betrieb aber wieder normalisiert.<br />
Bisweilen kommt es bei Gesetzgebungsverfahren zu sogenannten<br />
Paketlösungen, das heißt, es werden Maßnahmebündel zusammengeschnürt,<br />
die auf den ersten Blick vielleicht wenig miteinander zu tun<br />
haben, in der aktuellen Situation aber zu einer politischen Lösung beitragen.<br />
So war es auch in diesem Fall: Seit einigen Jahren verhandeln<br />
die Länder mit dem Bund die gesetzlich festgelegte Revision der Entflechtungsmittel,<br />
bis zur Elbeflut 2013 ohne einvernehmliches Ergebnis.<br />
Mit dem jetzt gefundenen Ergebnis konnten sich die Länder<br />
einverstanden erklären. Eine Katastrophensituation sollte aber sicher<br />
nicht als „Muster“ dienen, um die notwendige Finanzierung der Infrastruktur<br />
auf den Weg zu bringen.<br />
» Wie kann aus Ihrer Sicht sichergestellt werden, dass die Entflechtungsmittel<br />
zweckgemäß eingesetzt und nicht anderweitig in den<br />
Haushalten verbucht werden?<br />
Mit Wirkung zum 1. Januar 2007 hat Schleswig-Holstein als erstes<br />
Bundesland eine landesgesetzliche Regelung für den Tatbestand<br />
„Gemeindeverkehrsfinanzierung“ des Entflechtungsgesetzes geschaffen,<br />
um die Vergabe von Leistungen beziehungsweise Zuwendungen<br />
an Kommunen und die Träger des ÖPNV aus den Kompensationsmitteln<br />
des Bundes bis 2019 in voller Höhe für GVFG-<br />
Vorhaben zu gewährleisten. Damit wird sichergestellt, dass die zum<br />
Teil hoch verschuldeten Kommunen bei ihren wichtigen Infrastrukturmaßnahmen<br />
bis 2019 unterstützt werden. Somit wurde den Kommunen<br />
und den Trägern des ÖPNV landesseitig bereits frühzeitig ein<br />
deutliches Signal für eine Fortsetzung der Unterstützung im Bereich<br />
der Infrastrukturmaßnahmen gegeben, und sie erhalten die für diese<br />
Maßnahmen erforderliche Planungssicherheit. Ohne Zuwendungen<br />
aus Kompensationsmitteln würde die Investitionstätigkeit der<br />
Gemeinden in erheblichem und unvertretbarem Umfange beeinträchtigt<br />
werden. Eine gruppenspezifische Zweckbindung ist somit<br />
im GVFG-SH verankert.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 9
Aktuell<br />
Der barrierefreie Ausbau im Sinne des<br />
Personenbeförderungsgesetzes kostet<br />
die Branche Milliarden.<br />
Noch in 2013<br />
Finanzierungsfragen<br />
verlässlich lösen<br />
Der 22. September 2013, der Tag der Bundestagswahl,<br />
ist für die Verkehrsunternehmen ein entscheidendes<br />
Datum: Der in den vergangenen Jahren entstandene<br />
Aufgabenstau muss zeitnah von der neu gewählten<br />
Bundesregierung und den Ländern abgebaut werden.<br />
In der nahen Zukunft stehen der ÖPNV und der Schienenverkehr<br />
vor milliardenschweren Vorhaben. Nach Ansicht des <strong>VDV</strong> muss<br />
die neue Bundesregierung daher vor allem bei den offenen Finanzierungsfragen<br />
noch in diesem Jahr verlässliche Lösungen finden.<br />
„Wir brauchen weiterhin eine auskömmliche Mitfinanzierung<br />
durch den Bund, vor allem bei der Sanierung und Instandsetzung<br />
unserer Infrastruktur“, so <strong>VDV</strong>-Präsident Jürgen Fenske. Beispielsweise<br />
soll der ÖPNV laut Personenbeförderungsgesetz<br />
(PBefG) bis 2022 komplett barrierefrei ausgebaut werden. Allein<br />
das kostet mehrere Milliarden Euro. „<strong>Das</strong> geht nicht ohne ausreichende<br />
und langfristig gesicherte Bundesmittel“, erklärt Fenske.<br />
Zudem müsse sich die neue Regierung dringend in Europa für den<br />
uneingeschränkten Erhalt der EU-Verordnung 1370 über öffentliche<br />
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße einsetzen.<br />
Noch unklar ist die Zukunft des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes<br />
(GVFG), das Ende 2019 ausläuft. Auch hier ist aus<br />
Sicht des <strong>VDV</strong> eine Anschlussregelung noch in diesem Jahr erforderlich.<br />
Es gibt bereits einen einstimmigen Vorschlag des Bundesrates,<br />
das GVFG-Bundesprogramm mit jährlich 330 Millionen<br />
Euro bis 2025 zu verlängern. „Dem müssen Bundestag und Bun-<br />
desregierung zeitnah zustimmen, dann haben wir zumindest bei<br />
diesem wichtigen Finanzierungsinstrument endlich Gewissheit“,<br />
sagt Fenske.<br />
Auch bei der künftigen Infrastrukturfinanzierung sieht der <strong>VDV</strong><br />
die Bundesregierung in der Verantwortung. Die heutigen Mittel<br />
reichen bei Weitem nicht, um den angefallenen Sanierungsbedarf<br />
deutschlandweit zu decken. Die Daehre-Kommission hatte in<br />
ihrem Bericht zusätzliche Mittel von jährlich 7,2 Milliarden Euro<br />
über die nächsten 15 Jahre veranschlagt, nur für Instandsetzung<br />
und Sanierung der Verkehrswege. Zwei Milliarden davon benötigen<br />
das deutsche Schienennetz und der kommunale ÖPNV zusätzlich.<br />
Mit Spannung erwartet der <strong>VDV</strong> daher die Ergebnisse<br />
der Kommission um den ehemaligen Bundesverkehrsminister<br />
Kurt Bodewig, die als Nachfolgein der Daehre-Kommission bis<br />
Ende September konkrete Vorschläge zur Infrastrukturfinanzierung<br />
vorlegen wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere<br />
Punkte, die die neue Bundesregierung angehen muss:<br />
· die Revision der Regionalisierungsmittel im Jahr 2014,<br />
· eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit<br />
der Deutschen Bahn,<br />
· das Eisenbahnregulierungsgesetz.<br />
Wahlprüfsteine auf der<br />
<strong>VDV</strong>-Homepage<br />
Der <strong>VDV</strong> hat alle Parteien angeschrieben und um ihre<br />
Positionen zur Verkehrspolitik gebeten. Ab Anfang<br />
September können Sie sich darüber auf der Homepage<br />
des Verbands informieren.<br />
www.vdv.de<br />
10 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Standpunkt<br />
„Wahlkampfgetöse“<br />
Der Wahlkampf kurz vor der Bundestagswahl<br />
motiviert einige Politiker zu absurden Parolen.<br />
Den unsinnigen Forderungen scheinen keine<br />
Grenzen gesetzt zu sein, sagt <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />
Oliver Wolff (Foto) und sieht<br />
darin eine Gefahr, dass die eigentlichen Themen<br />
rund um den Öffentlichen Verkehr in den<br />
Hintergrund geraten:<br />
„Statt sich mit Sinn und<br />
Verstand, und vor allem in<br />
Kenntnis der Sachlage, mit<br />
den zentralen verkehrspolitischen<br />
Fragen zu beschäftigen,<br />
widmen sich einige Politiker<br />
lieber dem absurden Wahlkampfgetöse.<br />
Der <strong>VDV</strong> lehnt<br />
solche populistischen Parolen<br />
wie die Abschaffung der<br />
1. Klasse bei der Bahn oder<br />
die Diskussionen um kostenlosen<br />
ÖPNV und die Herabstufung von Schwarzfahren<br />
zu einer Ordnungswidrigkeit ab. Stattdessen brauchen<br />
wir realistische Lösungen für die wichtigen Themen<br />
und Probleme unserer Branche.<br />
Wer einerseits Wettbewerb und Privatisierung auf der<br />
Schiene vertritt, kann andererseits nicht allen Ernstes<br />
den Produktkatalog eines Unternehmens politisch vorgeben<br />
wollen und dabei die Abschaffung der 1. Klasse<br />
fordern. Die Eisenbahnunternehmen sollen also möglichst<br />
privatwirtschaftlich organisiert sein, was der<br />
Bundestag mit der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn<br />
auch seinerzeit umgesetzt hat. Gleichzeitig<br />
will man ihnen aber verbieten, mit Angeboten Geld zu<br />
verdienen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse<br />
ihrer Fahrgäste einzugehen. <strong>Das</strong> verträgt sich nicht.<br />
Ebenso populistisch wie unsinnig ist die Debatte um<br />
die mildere Bestrafung von Schwarzfahrern. Nach der<br />
ohnehin nur sehr mäßig beschlossenen Heraufsetzung<br />
des Erhöhten Beförderungsentgeltes hört man im Wahlkampf<br />
nun eine Forderung, das Schwarzfahren zu einer<br />
Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Schwarzfahren ist<br />
und bleibt eine Straftat, durch die den Verkehrsunternehmen<br />
circa 250 Millionen Euro jährlich an Einnahmen<br />
fehlen. Wer soll eigentlich geschützt werden, wenn<br />
Schwarzfahrer nicht ordentlich zur Kasse gebeten werden<br />
und mit keiner empfindlichen Strafe zu rechnen<br />
haben? Der ehrliche Fahrgast, der sein Ticket kauft,<br />
oder die notorischen Schwarzfahrer, die vorsätzlich<br />
die Zeche prellen? Die Wahlkämpfer haben hier einmal<br />
mehr übersehen, dass ihre Forderung die ehrlichen<br />
Bürger belastet, statt sie zu entlasten. Man fragt sich,<br />
welche absurden Forderungen wir im Wahlkampf noch<br />
erwarten dürfen. Vielleicht die Abschaffung der Business-Class<br />
im Luftverkehr? Oder die kalendarische<br />
Festlegung des Tages, an dem Fleischgerichte im<br />
ICE-Speisewagen nicht mehr verzehrt werden dürfen?“<br />
Positionen und Parolen: Die eigentlich wichtigen Themen drohen auf der Stecke zu bleiben – etwa in der Verkehrspolitik.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 11
Blick von außen<br />
„Zweckbindung<br />
der Mittel<br />
erforderlich“<br />
Verkehrsinfrastruktur: Dr. Ulrich Maly (Foto),<br />
neuer Präsident des Deutschen Städtetags,<br />
fordert eine schnelle Weichenstellung bei der<br />
Finanzierung.<br />
» Herr Dr. Maly, wie beurteilen Sie aus Sicht des<br />
Deutschen Städtetags die Einigung von Bund und<br />
Ländern zur Fortführung der Entflechtungsmittel?<br />
Die Entflechtungsmittel sind unverzichtbar für<br />
den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie sichern<br />
insbesondere Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur<br />
der Städte und Mittel für die soziale<br />
Wohnraumförderung. Allerdings brauchen wir<br />
weiterhin eine Zweckbindung der Mittel. Die<br />
Länder sollten den guten Beispielen von Nordrhein-<br />
Westfalen und Brandenburg folgen und die Entflechtungsmittel<br />
im bisherigen Umfang für diese<br />
beiden Aufgaben bereitstellen. Mit dem Auslaufen<br />
der Finanzhilfen 2019 sehe ich allerdings dunkle<br />
Wolken am Horizont. Es ist daher dringend geboten,<br />
in der nächsten Legislaturperiode so bald wie möglich<br />
die Weichen für die zukünftige Finanzierung<br />
zu stellen, damit Städte und Gemeinden Planungssicherheit<br />
erhalten.<br />
» Wo werden die vom Bund zugesagten Entflechtungsmittel<br />
in den Kommunen am dringendsten<br />
benötigt?<br />
Im Verkehrsbereich fehlt heute nicht mehr nur das<br />
Geld für Neubau und Modernisierung. Beides müssen<br />
wir engagiert weiter betreiben, etwa dort, wo im<br />
Nahverkehr gerade in den Großstädten die Fahrgastzahlen<br />
weiter wachsen. Darüber hinaus aber ist nicht<br />
zu übersehen: Die kommunale Verkehrsinfrastruktur<br />
konnte vielerorts seit Jahren nicht instand gesetzt<br />
werden. Die Mittel fehlen also ganz wesentlich auch<br />
bei den Erhaltungsinvestitionen, gerade bei großen<br />
Brücken und Tunneln in kommunaler Baulast. Auch<br />
dafür sollten die Entflechtungsmittel geöffnet<br />
werden.<br />
Die Bundesmittel für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur<br />
in den Städten und Gemeinden<br />
sind allerdings derzeit auf 1,33 Milliarden Euro jährlich<br />
und damit auf den Stand von 2007 eingefroren.<br />
Gemessen an dem tatsächlichen Bedarf, den wir in<br />
einem gemeinsamen Gutachten mit dem <strong>VDV</strong> und<br />
13 Bundesländern für den Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung<br />
in einer Höhe von 1,96 Milliarden<br />
Euro jährlich ermittelt haben, ist dies objektiv<br />
und allgemein anerkannt zu wenig.<br />
12 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
» Wo sieht der Deutsche Städtetag darüber hinaus<br />
dringenden Handlungsbedarf bei der Infrastrukturfinanzierung?<br />
Ein großer Kraftakt wird die Umsetzung der Barrierefreiheit<br />
bis 2022 nach den neuen Bestimmungen<br />
des Personenbeförderungsgesetzes. Diese Regelung<br />
ist sinnvoll, denn sie hilft nicht nur den Menschen<br />
mit Behinderungen und sensorischen Einschränkungen,<br />
sondern auch dem immer größer werdenden<br />
Anteil an älteren Menschen oder den Familien<br />
mit Kindern. Es erfolgt bereits ein schrittweiser<br />
Umbau von Haltestellen und Fahrzeugen in den<br />
Städten. Übrig bleibt aber ein erheblicher Nachrüstungsbedarf<br />
an bestehenden Anlagen, der nur durch<br />
Förderprogramme zügig beseitigt werden kann.<br />
Nach der Liberalisierung des Fernbusverkehrs, das<br />
ist ein weiteres Thema, wenden sich die Busanbieter<br />
hilfesuchend an die Städte, ihnen Haltepunkte an<br />
Busterminals bereitzustellen. Die Kommunen sind<br />
allerdings für den Fernverkehrsausbau nicht verantwortlich.<br />
Die finanzielle Beteiligung der Busunternehmen<br />
an dieser Haltestelleninfrastruktur<br />
ist noch völlig unklar.<br />
InnoTrans 2014<br />
23. – 26. SEPTEMBER · BERLIN<br />
Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik<br />
Innovative Komponenten · Fahrzeuge · Systeme<br />
innotrans.de<br />
THE FUTURE<br />
OF<br />
MOBILITY<br />
Investitionsbedarf besteht auch, um Lärmschutz-<br />
Einrichtungen zu unterhalten. Investitionen zur<br />
Lärmsanierung entlang der Hauptverkehrsstraßen<br />
werden von Bund und Ländern gefördert, der<br />
anschließende Unterhalt und damit zusätzliche<br />
Kosten kommen aber auf die Haushalte der<br />
Kommunen zu.<br />
Mehr als 50 Milliarden Euro sind bis 2030 notwendig, um eine<br />
barrierefreie Infrastruktur zu schaffen.<br />
www.damit-deutschland-vorne-bleibt.de/verstehen/Artikel/<br />
Die-Deutschen-werden-immer-aelter/03746
Aus dem Verband<br />
Vielseitig und unterschätzt:<br />
Die Ausbildung in der<br />
Verkehrsbranche<br />
Fahrer, Techniker, Planer oder Marketingexperte:<br />
Die Berufswelt der öffentlichen<br />
Verkehrsbetriebe ist vielfältig. Doch wenn<br />
im Herbst die Bewerbungsrunde für die neu<br />
zu vergebenden Ausbildungsplätze in 2014<br />
startet, blicken Personaler mit Sorge in die<br />
Zukunft. Die Zahl der Bewerber sinkt, der<br />
Fachkräftemangel droht. Dabei spricht vieles<br />
für einen Job im ÖPNV und bei der Eisenbahn.<br />
Aus Sicht von Michael Weber-Wernz, Fachbereichsleiter<br />
Bildung im <strong>VDV</strong> und Geschäftsführer der <strong>VDV</strong>-<br />
Akademie, können die Verkehrsunternehmen mit<br />
großen Vorteilen aufwarten: „<strong>Das</strong> eine ist die Stabilität,<br />
und zwar in zweierlei Hinsicht“, erklärt er: „Die<br />
Unternehmen haben eine lange Tradition – und es<br />
wird sie noch lange geben. Sie sind moderne und<br />
wichtige Mobilitätsdienstleister in unseren Städten<br />
und Regionen.“ <strong>Das</strong> andere sei die Standortstabilität:<br />
Ein ÖPNV-Betrieb sei kein Unternehmen, das mal<br />
eben seine Produktion auslagere. „Die Arbeitsplätze<br />
bleiben in der Region.“ Hinzu kommen geregelte<br />
Arbeitszeiten und eine Reihe weiterer Pluspunkte:<br />
in der Regel unbefristete Verträge sowie gute Aufstiegs-<br />
und Weiterbildungsmöglichkeiten.<br />
Trotzdem: Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen<br />
liegt unter dem Bedarf. Gerade im gewerblich-technischen<br />
Bereich gehen die Absolventenzahlen seit 2008<br />
zurück oder stagnieren – ein Vorbote des allgemeinen<br />
Trends, dass es weniger Schulabgänger geben wird.<br />
Mit den doppelten Abschlussjahrgängen wurde jetzt<br />
ein absoluter Höchststand erreicht: 917.000 Jugendliche<br />
haben in diesem Sommer die Schule verlassen.<br />
Zum Vergleich: Für 2025 rechne man noch mit<br />
725.000, sagt der <strong>VDV</strong>-Experte. „Darauf muss sich<br />
die Wirtschaft erst einmal einstellen.“<br />
Konzentriert: Der angehende Industriemechaniker Oliver Franz<br />
arbeitet im BVG-Ausbildungszentrum an einer Mini-Lok.<br />
Für die Verkehrsunternehmen sei es deswegen wichtig,<br />
ihr Image aufzupolieren und sich als attraktiver<br />
Arbeitgeber zu positionieren. Dazu gehört zum einen<br />
das breite Aufgabenspektrum, das ausbildungsseitig<br />
immerhin mehr als 40 Berufe umfasst – von Fach-<br />
14 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Aus dem Verband<br />
kräften im Fahrbetrieb, Kfz-Mechatronikern über<br />
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung<br />
bis hin zu Fachinformatikern. Vielen Jugendlichen sei<br />
diese Vielfalt nicht bewusst.<br />
Darüber hinaus spielen andere wichtige Aspekte eine<br />
Rolle. „Verkehrsbetriebe bieten eine durchweg hochwertige<br />
Ausbildung“, sagt Michael Weber-Wernz.<br />
Und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />
sei ein Thema, dem sich immer mehr Unternehmen<br />
widmeten – und mit dem sie auch bei der Suche nach<br />
Nachwuchsfachkräften punkten könnten. Er regt<br />
deswegen Teilzeitmodelle auch für Azubis an.<br />
Doch diese Vorteile müssen vermittelt werden. Wie<br />
können sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber<br />
vermarkten und Jugendliche für eine Ausbildung<br />
begeistern? „<strong>Das</strong> sind teilweise ganz einfache<br />
Dinge“, erläutert Michael Weber-Wernz. „Praktika,<br />
Werbung an Bussen und Bahnen, Auftritte bei Facebook,<br />
die Teilnahme an Bildungs- und Ausbildungs-<br />
messen – einfach die Türen ganz weit öffnen und<br />
zeigen, was man hat.“ Auszubildende, die bereits im<br />
Unternehmen arbeiten, können als Werbeträger auftreten<br />
und interessierten Schülern ihre Sicht der<br />
Dinge vermitteln. <strong>Das</strong> duale Studium, also Berufsausbildung<br />
und Studium parallel zu absolvieren,<br />
ziehe wiederum konkret Abiturienten an, stecke in<br />
der Branche indes noch in den Kinderschuhen. „Aber<br />
es ist eine klasse Sache, so kann man die Attraktivität<br />
steigern“, urteilt der <strong>VDV</strong>-Experte.<br />
Apropos Studium: Mit Blick auf den künftigen Fachkräftemangel<br />
sprechen die Unternehmen des Verkehrssektors<br />
immer gezielter Studenten an – im<br />
Oktober etwa über die siebte Personal- und Unternehmensbörse<br />
des <strong>VDV</strong>. An der TU München können<br />
sich Betriebe und Studierende kennenlernen und<br />
austauschen. Hier werden Studien- und Examensarbeiten<br />
ebenso vermittelt wie interessante Jobs.<br />
www.vdv-karriere.de<br />
Adam Urbancsok liebt große Fahrzeuge – und erlernt<br />
bei den DVB seinen Traumberuf<br />
Busse haben Adam Urbancsok schon in seiner Heimat Ungarn fasziniert. Mittlerweile<br />
lebt der junge Mann seit fünf Jahren in Deutschland und hat sich hier<br />
für seinen Traumjob entschieden. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB)<br />
wird er Fachkraft im Fahrbetrieb.<br />
„Die großen Fahrzeuge zu führen, das fand ich immer interessant.<br />
Davon habe ich schon als Kind geträumt“, schwärmt der 20-Jährige.<br />
Als er eine Ausbildungsstelle suchte, habe er es deswegen<br />
bei den Dresdner Verkehrsbetrieben probiert, und es hat<br />
geklappt. Am 1. September startet er ins zweite Ausbildungsjahr.<br />
War das erste Jahr überwiegend theoretisch, beginnt nun<br />
die Fahrschule. Adam Urbancsok hat sich natürlich für den<br />
Schwerpunkt Bus entschieden. Nach dem Abschluss seiner<br />
Ausbildung will er jedoch nicht unbedingt hinterm Steuer bleiben.<br />
„Ich könnte mir vorstellen, eine Weile Bus zu fahren und mich<br />
dann weiterzubilden. Der Beruf ist dafür gut geeignet“, erklärt er.<br />
Ihm schwebt eine Stelle als sogenannter Dispatcher vor – als Mitarbeiter<br />
im Stördienst. „Ich wäre immer draußen unterwegs, erlebe viel<br />
und kriege einiges mit“, sagt Adam Urbancsok. „Und ich kann den anderen<br />
Fahrern bei Problemen helfen.“ Diese Serviceorientierung liegt ihm. Schließlich<br />
gehört auch die Arbeit in der Kundeninformation zu dem, was ihm am meisten Spaß<br />
macht.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 15
Aus dem Verband<br />
Mareen Winguth lebt bei der BVG ihre Technikbegeisterung aus<br />
Eigentlich stand Mareen Winguth schon voll im Berufsleben. Doch der Job<br />
als Verkäuferin hat der technikbegeisterten 26-Jährigen nicht gereicht.<br />
Vor zwei Jahren wagte sie deswegen etwas Neues – und begann ihre<br />
Ausbildung zur Industriemechanikerin bei den Berliner Verkehrsbetrieben<br />
(BVG).<br />
„Ich wollte schon immer wissen, wie Technik funktioniert und<br />
was dahinter steckt“, erklärt Mareen Winguth. „Ich bastle gerne<br />
an etwas herum. Man zerbricht sich seinen Kopf und findet am<br />
Ende dann doch eine Lösung.“<br />
Jetzt gehört das Drehen, Fräsen, Bohren und Meißeln zu ihrem<br />
Berufsalltag im gewerblich-technischen Bereich. Industriemechaniker<br />
bei der BVG fertigen einen Großteil aller benötigten<br />
Teile selbst, etwa Räder oder verschiedene Kleinteile für die<br />
U-Bahnen in der Hauptstadt. Mareen Winguth: „<strong>Das</strong> sind alles Sachen,<br />
von denen jeder eigentlich annimmt, dass sie woanders gefertigt und geliefert<br />
werden.“ Der Beruf ist sehr vielseitig, findet die 26-Jährige außerdem.<br />
Die Ausbildung bei der BVG ist dual organisiert: Auf zwei Wochen Praxis folgt eine Woche Berufsschule.<br />
Wie es nachher für die BVG-Azubis weitergeht, ist auch schon klar: Sie werden für mindestens<br />
ein Jahr und einen Tag übernommen.<br />
SWM-Auszubildender Alexander Haggenmiller<br />
wird Fachkraft im Fahrbetrieb<br />
Die Berufswahl war bei Alexander Haggenmiller eine Entscheidung aus Leidenschaft.<br />
Bei den Stadtwerken München (SWM) lässt sich der 20-Jährige zur Fachkraft im<br />
Fahrbetrieb ausbilden.<br />
„Die U-Bahn war schon immer meins“, sagt der Münchner und gerät ins Schwärmen.<br />
„Wie funktioniert der Betrieb, wie das Verkehrssystem? Diese großen<br />
Fahrzeuge haben so unendlich viel Technik und tausende PS.“ Als vor einigen<br />
Jahren dann die Berufswahl anstand, hatte er sich deswegen gleich<br />
entsprechend orientiert und bei den SWM beworben. Im September<br />
startet Alexander Haggenmiller nun in sein drittes Ausbildungsjahr.<br />
<strong>Das</strong> heißt: Er beginnt mit dem U-Bahn-Führerschein.<br />
Diese Richtung ist bei Ausbildungsbeginn jedoch nicht vorgegeben:<br />
Die angehenden Fachkräfte können sich im ersten Teil ihrer Ausbildung<br />
auch für die Schwerpunkte Bus oder Tram entscheiden.<br />
Während der drei Jahre durchlaufen sie dann verschiedene sogenannte<br />
Versetzungsstellen: Sie schnuppern in die Arbeit der Leitstelle<br />
hinein, lernen Disposition und Verwaltung kennen, erstellen<br />
Dienst- und Umlaufpläne. Dabei müssen die Auszubildenden natürlich<br />
auch die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer beachten. „<strong>Das</strong> war echt<br />
eine Herausforderung“, lacht Alexander Haggenmiller, „da raucht einem<br />
hinterher der Kopf.“<br />
16 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
4,9<br />
Milliarden<br />
Fahrgäste waren im<br />
ersten Halbjahr 2013 mit<br />
dem ÖPNV unterwegs.<br />
Aus dem Verband<br />
Experten treffen sich erstmals zum<br />
Fachsymposium Multimodalität<br />
ÖPNV bleibt auf Wachstumskurs:<br />
Fahrgastzahlen erneut gestiegen<br />
Die Marke von zehn Milliarden Fahrgästen könnte dieses<br />
Jahr erstmals überschritten werden: Bereits in den ersten<br />
sechs Monaten nutzten mehr als 4,9 Milliarden Kunden den<br />
ÖPNV – 0,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die<br />
Personenkilometer, also die erbrachte Verkehrsleistung<br />
von Bussen und Bahnen, blieben dagegen unverändert bei<br />
45,9 Milliarden Kilometern. Vor allem die Fahrten mit<br />
U-, Stadt- und Straßenbahnen legten deutlich zu – plus<br />
ein Prozent. Über 1,9 Milliarden Fahrgäste nutzten diese<br />
Angebote der <strong>VDV</strong>-Mitgliedsunternehmen. Auch im<br />
Schienenpersonennahverkehr stiegen die Fahrgastzahlen<br />
mit 0,8 Prozent im ersten Halbjahr deutlich gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung beim Bus, der in absoluten<br />
Zahlen noch immer das am häufigsten genutzte<br />
ÖPNV-Verkehrsmittel ist, blieb mit 2,284 Milliarden<br />
Fahrgästen konstant.<br />
www.vdv.de/pressemitteilungen.aspx<br />
Personalbedarf bis 2025: Gutachten<br />
wird in Hannover vorgestellt<br />
Arbeit, Bildung, Personal 2020: Vom 25. bis 27. September werden<br />
die Trends und Chancen auf dem <strong>VDV</strong>-Personalkongress<br />
in Hannover diskutiert. Im Mittelpunkt steht, wie die Zukunft<br />
der Arbeits- und Bildungswelten aussieht, wie der demografische<br />
Wandel bewältigt werden kann und wie Unternehmen<br />
ihre Attraktivität steigern und Personal gewinnen können.<br />
Vorgestellt wird auch das neue Gutachten, das die Personalbedarfe<br />
in den Mitgliedsunternehmen des <strong>VDV</strong> für die kommenden<br />
sieben bis zwölf Jahre ermittelt hat. Dazu wurden bei<br />
einer Erhebung in den Monaten Juni und Juli 350 Unternehmen<br />
des Personennah- und Fernverkehrs, die Verkehrsverbünde<br />
und 200 Unternehmen des Schienengüterverkehrs befragt.<br />
Außerdem werden auf dem Personalkongress die besten<br />
Auszubildenden und dualen Studierenden der Jahre 2012/2013<br />
ausgezeichnet.<br />
Kurz ins Netz gehen und auf ein Auto, Fahrrad oder<br />
eine Mitfahrgelegenheit zugreifen: Mit Smartphones<br />
und Tablets ist das nahezu von überall aus möglich.<br />
Welche Veränderungen das fast allgegenwärtige Internet<br />
oder die Herausforderungen der Energiewende für<br />
den Mobilitätsmarkt mit sich bringen, ist unter anderem<br />
Thema des <strong>VDV</strong>-Fachsymposiums Multimodalität.<br />
Diese Veranstaltung wird von der <strong>VDV</strong>-Akademie<br />
erstmalig ausgerichtet. Namhafte Vertreter aus Verkehrsunternehmen,<br />
Herstellerfirmen und der Verwaltung<br />
diskutieren am 17. und 18. Oktober in Berlin über<br />
ein wesentliches Zukunftsthema der Branche. Welche<br />
Geschäftsmodelle tragen sich? In welchen Segmenten<br />
sind Kooperationen mit Internet- und Automobilkonzernen<br />
denkbar? Um weiterhin Rückgrat und<br />
Motor der multimodalen Mobilität zu sein, müssen die<br />
Verkehrsunternehmen ihre Entwicklung zu Mobilitätsdienstleistern<br />
und zum Mobilitätsverbund weiter<br />
fortsetzen.<br />
Anmeldungen sind per Post, E-Mail oder Fax<br />
an die <strong>VDV</strong>-Akademie in Köln sowie unter<br />
www.vdv-akademie.de möglich. Anmeldeschluss<br />
ist der 20. September 2013.<br />
www.vdv-akademie.de/bildung/tagungen-undseminare/6-vdv-personalkongress<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 17
Reportage<br />
Falt and Ride:<br />
Immer mehr klappen<br />
einfach zusammen<br />
Sich in den Sattel schwingen, ein paar Kilometer zur nächsten Haltestelle<br />
radeln, mit dem ÖPNV weiterkommen und wieder aufs Rad steigen: Mit<br />
der neuen Generation von Falträdern lassen sich öffentliche Verkehrsmittel<br />
und Fahrradfahren bequem verbinden.<br />
Jeder Handgriff sitzt: Kerstin Glöckner<br />
fährt die Sattelstütze herunter, legt die<br />
Pedale an, entriegelt den Klappmechanismus<br />
in der Rahmenmitte und dockt<br />
mit einer fließenden Bewegung das Vorderrad<br />
ans Hinterrad an. Zuletzt legt sie<br />
die Lenkerstange um und sichert sie mit<br />
einer Gummilasche am Rahmen. Auf dem<br />
belebten Jungfernstieg hat die Hamburgerin<br />
in knapp zehn Sekunden ihr flottes<br />
weißes Faltrad auf die Größe eines Koffers<br />
zusammengelegt. Nun steigt sie in<br />
den Lift der U- und S-Bahn-Station und<br />
setzt ihren Nachhauseweg mit der U 1<br />
ins malerische Klein Borstel fort.<br />
Seit Mai legt Kerstin Glöckner<br />
den Weg zwischen ihrem<br />
Wohnort und ihrem Arbeitsplatz<br />
in der City<br />
mit dem Faltrad und der<br />
U-Bahn zurück. Auf den<br />
Teilstücken, die sie radelt,<br />
spart sie jetzt viel<br />
Zeit. Für die gesamte<br />
Strecke benötigt sie statt<br />
50 nur noch 35 Minuten.<br />
„Außerdem tue ich etwas für<br />
meine Fitness“, schmunzelt Kerstin<br />
Glöckner: „Und wenn ich nach der Arbeit<br />
noch etwas in der Stadt unternehmen<br />
will, bin ich sehr mobil.“ <strong>Das</strong> ist sie zudem<br />
in den öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
zu jeder Tageszeit. Und das auch noch<br />
äußerst platzsparend: Da Falträder als<br />
Gepäckstücke gelten, dürfen sie anders<br />
als ihre Pendants mit starrem Rahmen<br />
auch in den Stoßzeiten mitgenommen<br />
werden – ohne zusätzlichen Fahrschein.<br />
<strong>Das</strong>s in immer mehr Großstädten trendige<br />
Klappräder in Bussen und Bahnen<br />
zu sehen sind, ist auch das Ergebnis einer<br />
Kooperation zwischen Verkehrsverbünden<br />
und -betrieben, dem Allgemeinen<br />
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sowie<br />
einem Fahrradgroßhändler und -importeur.<br />
In mittlerweile fünf Städten –<br />
Hamburg, München, Karlsruhe,<br />
Stuttgart und seit Kurzem<br />
Münster – wurden schon<br />
etwa 1.000 Räder über den<br />
Fachhandel verkauft, allein<br />
in Hamburg mehr als<br />
300. In der Hansestadt<br />
kostet das Rad vergünstigte<br />
549 Euro, die Stadtwerke<br />
Münster bieten<br />
dagegen eine Mietvariante<br />
für 9,99 Euro<br />
im Monat an. „Mit dem<br />
Faltrad vereinfachen wir die Verknüpfung<br />
von ÖPNV und Radverkehr<br />
weiter“, sagt Rainer Vohl, Pressesprecher<br />
des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV):<br />
„Gerade in der Hauptverkehrszeit lassen<br />
18 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Reportage<br />
Umweltfreundlich durch die City:<br />
Kerstin Glöckner legt die Stecke von<br />
ihrem Arbeitsplatz zur U-Bahn-Station<br />
Jungfernstieg per Faltrad zurück.<br />
1.000<br />
Falträder<br />
wurden bundesweit im<br />
Rahmen der Kooperation<br />
zwischen den<br />
Verkehrsverbünden und<br />
dem ADFC verkauft.<br />
Zusammengeklappt auf die Größe<br />
eines Koffers fährt das Faltrad<br />
platzsparend in der U-Bahn mit ...<br />
… und lässt sich mit seinem Gewicht<br />
von 13 Kilogramm mühelos auch<br />
Treppen hinuntertragen, …<br />
… bevor Kerstin Glöckner es mit<br />
wenigen Handgriffen startklar für<br />
die nächste Etappe macht ...<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 19
Reportage<br />
sich jetzt Wegeketten bilden, die bisher<br />
nicht möglich schienen.“ <strong>Das</strong> soll ab September<br />
auch in Bremen möglich sein.<br />
Hamburg gilt als Geburtsort des Erfolgsmodells<br />
und Rainer Vohl als sein geistiger<br />
Vater. Um Pendlern und Radfahrern entgegenzukommen,<br />
suchte der HVV eine Alternative<br />
zu den Fahrrad-Sperrzeiten während<br />
des Berufsverkehrs. Eine Abschaffung kam<br />
aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht infrage.<br />
Rainer Vohl, der in seiner Freizeit leidenschaftlich<br />
gern Rennrad fährt, hatte die Idee, auf<br />
Klappräder zu setzen, und testete zahlreiche Modelle<br />
– schließlich sollte das Faltrad technisch ausgereift,<br />
preiswert und nicht zuletzt im strengen Sinne der<br />
Straßenverkehrsordnung sicher sein. Vohls Aufbauarbeit<br />
kam aber zuerst dem Münchner Verkehrsund<br />
Tarifverbund zugute, der dieses Mobilitätsmodell<br />
als Pilotprojekt schon im Jahr 2012 anbot.<br />
Zusätzlich hatten die Münchner die Idee, mit einem<br />
unabhängigen und nicht kommerziell interessierten<br />
Partner – dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-<br />
Club – zu kooperieren. „Auf diese Weise haben wir<br />
abwechselnd voneinander profitiert“, erläutert Vohl.<br />
Nach Stuttgart stieg Hamburg schließlich als dritte<br />
deutsche Stadt im Februar dieses Jahres in das<br />
Modell „Mobilität zum Mitnehmen“ ein. Uwe Hahslbauer<br />
vom Fahrrad-Importeur Hartje KG betrachtet<br />
die Angebote als „Mosaiksteine, um die Situation<br />
von Pendlern mit Fahrrädern zu entlasten“. Als<br />
ideale Lösung für Berufspendler, die so die letzten<br />
Kilometer zwischen Wohnung, Haltestelle und<br />
… und entspannt die letzten Kilometer<br />
nach Hause radelt.<br />
Arbeitsplatz leicht und schnell überbrücken können,<br />
sieht auch der ADFC Hamburg das Angebot. „Unser<br />
Ziel bleibt allerdings weiterhin die Aufhebung der<br />
Sperrzeiten für Fahrräder im HVV“, sagt Merja<br />
Spott, ADFC-Referentin für Verkehr.<br />
Faltrad-Pendlerin Kerstin Glöckner hat unterdessen<br />
nach einer 20-minütigen U-Bahn-Fahrt die Station<br />
Klein Borstel erreicht. Mit wenigen Handgriffen<br />
faltet sie ihr Rad – klack, klack, klack – wieder auseinander<br />
und radelt in der Nachmittagssonne die<br />
letzten Kilometer nach Hause. Kerstin Glöckner:<br />
„Solche Genussmomente habe ich jetzt viel öfter.“<br />
metropolradruhr: Deutschlands größtes öffentliches Leihfahrradsystem ist jetzt komplett<br />
Leihfahrräder sind in vielen Städten schwer im Kommen. Sie ermöglichen<br />
es, sich einfach und umweltfreundlich mit dem Nahverkehr zu vernetzen.<br />
<strong>Das</strong> größte Fahrradverleihsystem Deutschlands gibt es im Ruhrgebiet.<br />
„metropolradruhr“ ist ein Angebot von zehn Städten und des Verkehrsverbunds<br />
Rhein-Ruhr (VRR) unter Federführung des Regionalverbandes<br />
Ruhr. Seit Ende Juni ist der Aufbau des Systems abgeschlossen. Nun sind<br />
rund 300 Verleihstationen, überwiegend an ÖPNV-Haltestellen, in Betrieb.<br />
Dort stehen rund um die Uhr 2.700 Räder zur Verfügung. Betreiber<br />
ist das Unternehmen nextbike, Leipzig. Da die Räder an jeder beliebigen<br />
Station zurückgegeben werden können, sind nicht nur Rundtouren, sondern<br />
auch Fahrten in einfacher Richtung möglich. Schon 52.000 Fahrten<br />
wurden von Januar bis Juli unternommen – und damit mehr als im gesamten<br />
Vorjahr. Abokunden des VRR und der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-<br />
Lippe (VRL) radeln mit dem RadCard-Tarif besonders günstig: Für<br />
monatlich 1,50 Euro sind die ersten 30 Minuten jeder Fahrt kostenlos.<br />
www.metropolradruhr.de<br />
20 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Aktuell<br />
Pfiffige Mobilitätsideen<br />
vor der Kamera umsetzen<br />
Nachhaltiger Verkehr der Zukunft:<br />
Die deutsche UNESCO-Kommission<br />
hat Videowettbewerb gestartet.<br />
Wie wird Verkehr umweltfreundlicher?<br />
Wie lassen sich Bus und Bahn, Fahrrad<br />
und Auto besser vernetzen? Und wollen<br />
wir überhaupt immer in Bewegung sein?<br />
Antworten sucht die Deutsche UNESCO-<br />
Kommission. Im Rahmen der UN-Dekade<br />
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />
läuft seit August der Kreativ-Wettbewerb<br />
„Mobiler Alltag 2023“. In Filmen<br />
oder kommentierten Bilderserien im<br />
Videoformat sollen die Teilnehmer zeigen,<br />
wie sie sich ihren mobilen Alltag im<br />
Jahr 2023 vorstellen und warum der<br />
nachhaltiger ist als heute. Aber wie kann<br />
der Einzelne dazu beitragen, dass Mobilität<br />
nachhaltiger wird? Egal, ob Anfänger<br />
oder Kameraprofi: Jeder ist eingeladen,<br />
sich Gedanken zu machen, aktiv zu werden<br />
und mit einer guten Idee vielleicht<br />
die Zukunft aller mitzugestalten. Eingereichte<br />
Videos werden im Internet unter<br />
www.mobileralltag2023.de veröffentlicht.<br />
Der Wettbewerb wird in Kooperation mit<br />
dem Bundesministerium für Bildung<br />
und Forschung, der Deutschen Bahn,<br />
der Volkswagen AG, dem Allgemeinen<br />
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und<br />
dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen<br />
(<strong>VDV</strong>) sowie mit Förderung<br />
des Stifterverbandes für die Deutsche<br />
Wissenschaft durchgeführt. Zu gewinnen<br />
gibt es Geld- und Sachpreise.<br />
Doch was heißt nachhaltig? Nachhaltigkeit<br />
bedeutet, so zu handeln, dass Menschen<br />
hierzulande und woanders auf der<br />
Welt sowie zukünftige Generationen gut<br />
leben können. Mobilität ist nachhaltig,<br />
wenn sie allen das Mobilsein ermöglicht,<br />
ohne der Umwelt zu schaden. Doch noch<br />
verursacht sie Probleme und wird immer<br />
teurer. Zudem verändert die zunehmende<br />
Mobilisierung die Menschen: Sie<br />
erledigen immer mehr in kürzerer Zeit,<br />
wechseln häufiger ihren Arbeitsplatz<br />
oder den Wohnort. Oft entstehen dadurch<br />
Stress und das Gefühl, dass die<br />
Zeit immer knapper wird.<br />
Die Teilnahmebedingungen und weitere<br />
Infos stehen im Internet. Einsendeschluss<br />
ist der 4. November 2013.<br />
www.mobileralltag2023.de<br />
Die starke Allianz<br />
für eine gute CO2-Bilanz<br />
www.carsharing.de
Unterwegs im Netz<br />
25<br />
Prozent<br />
Mit dieser Steigung überwindet<br />
die Oberweißbacher Bergbahn<br />
einen Höhenunterschied<br />
von 323 Metern.<br />
Die Bergstation Lichtenhain nutzen viele Wanderer als Ausgangspunkt für Touren durch die Weiten des Thüringer Waldes.<br />
bergauf, bergab<br />
– und das oben ohne<br />
Hochprozentig<br />
22 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Rollendes Denkmal mit<br />
Aufgaben im Nahverkehr<br />
Die OBS ist als Tochter der DB ein kleines mittelständisches<br />
Unternehmen mit gerade einmal 30 Mitarbeitern.<br />
Auf der Schwarzatalbahn, 25 Kilometer zwischen Rottenbach<br />
und Katzhütte mit Anschluss von und nach Saalfeld<br />
und Erfurt, pendeln zwei moderne Dieseltriebzüge der<br />
Baureihe VT 641 ganzjährig im Stundentakt. Auf der<br />
Bergbahn gibt es alle halbe Stunde eine Abfahrt in beide<br />
Richtungen und ab Lichtenhain Anschlussverkehr auf der<br />
2,6 Kilometer langen Flachstrecke im Oberland. Täglich<br />
fahren rund 150 Züge. Schon zu DDR-Zeiten wurde die<br />
Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Doch erst nach der<br />
Wende wurde die komplette OBS 2001 und 2002 für<br />
rund 15 Millionen Euro umfassend für einen modernen<br />
Betrieb saniert, barrierefrei ausgebaut und mit Verkaufsstellen<br />
und Gastronomie ausgestattet – im<br />
bewussten Kompromiss zwischen erhaltenswerter<br />
alter Technik und modernen Kundenbedürfnissen. So<br />
ist die OBS nicht nur ein lebendiges, rollendes technisches<br />
Denkmal, sondern zugleich ein Bahnangebot des<br />
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), den das Land<br />
Thüringen per Verkehrsvertrag für 20 Jahre bestellt<br />
hat.<br />
Sie ist Touristenmagnet, technisches Denkmal und „ganz normaler“ Schienenpersonennahverkehr:<br />
die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS). <strong>Das</strong> kleinste<br />
Regio-Netz der Deutschen Bahn betreibt Europas steilste Standseilbahn zum Transport<br />
normalspuriger Eisenbahnwaggons.<br />
Höchstgeschwindigkeit gemächliche sechs Stundenkilometer,<br />
Spurweite sensationell breite 1.800<br />
Millimeter, Steigung atemberaubende 25 Prozent:<br />
<strong>Das</strong> Abenteuer Bergbahn beginnt im romantischen<br />
Schwarzatal im östlichen Thüringer Wald, am Haltepunkt<br />
Obstfelderschmiede. Dorthin kommen die<br />
modernen Dieseltriebwagen der Schwarzatalbahn<br />
jede Stunde im festen Takt. Ein bisschen sind sie<br />
schon Verheißung, denn in schön geschwungener<br />
Schrift steht an der DB-roten Außenhaut zu lesen:<br />
„Mit uns geht es zur Bergbahn“. Diese lockt Jahr<br />
für Jahr gut und gerne 170.000 Besucher – und ist<br />
damit neben der Wartburg eine der großen Touristenattraktionen<br />
Thüringens.<br />
Bergbahn-Feeling gleich in der Talstation. Der<br />
Bahnsteig schwingt sich wie eine Treppe mit breiten<br />
Stufen dem steilen Hang entgegen. Auch die Sitze<br />
im Waggon sind, wie bei solchen Transportmitteln<br />
üblich, gleichsam einer großen Treppe angeordnet.<br />
Ein Klingelzeichen, dann ein leichter Ruck, und es<br />
geht los. Aufwärts, gemächlich. Vor dem Wagen<br />
vibriert das Stahlseil, das ihn über mitdrehende Rollen<br />
mitten im breiten Gleis nach oben führt. Stolze<br />
40 Millimeter ist die Lebensader der Bergbahn dick.<br />
„Als ich das auf einer Schweizer Bergbahn-Messe<br />
Begegnung auf halber<br />
Strecke: In der Ausweiche<br />
treffen sich bei jeder Fahrt<br />
die beiden Fahrzeuge der<br />
Bergbahn.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 23
Unterwegs im Netz<br />
„40 Millimeter Stahlseil<br />
machten mich auf einer<br />
Schweizer Bergbahn-<br />
Messe zum interessanten<br />
Gesprächspartner.“<br />
Günter Kretzschmar (OBS)<br />
Für kalte Tage: Statt des Cabrios (Foto, oben) wird auch ein anderer Waggon auf der Güterbühne bergauf, bergab transportiert.<br />
OBS-Infrastruktur- und Technikchef Günter Kretzschmar (Foto, r.) zeigt stolz das runderneuerte Maschinenhaus.<br />
mal erzählt habe, war ich für die dortige Industrie<br />
plötzlich ein interessanter Gesprächspartner“, erinnert<br />
sich Günter Kretzschmar schmunzelnd. An der<br />
Dicke des Seils, so erläutert der Leiter Infrastruktur<br />
und Technik der OBS, erkannten die Fachleute im<br />
Alpenland, dass das, was da im fernen Thüringen<br />
bergauf, bergab rollt, eine „richtige“ Bergbahn ist.<br />
Eine hochmoderne zudem: Vor zehn Jahren wurde sie<br />
als rollendes Denkmal mit Millionenaufwand von der<br />
DB und dem Land Thüringen saniert und modernisiert.<br />
Von der Geschichte und der Technik der Bergbahn<br />
erzählen die Mitarbeiter während der Fahrt per<br />
Mikrofon. Sie sind Mädchen (und Jungen) für alles:<br />
kontrollieren die Fahrkarten, sind freundliche Fremdenführer.<br />
Sie haben das Lokführerpatent in der<br />
Tasche – und sie sind Bergbahn-Maschinisten: Während<br />
die Fahrten der OBS in früheren Tagen von einem<br />
Maschinisten in der Bergstation gesteuert wurden,<br />
machen das heute die Bergbahnbediener aus dem<br />
Wagen heraus – dank moderner Computer-Technik.<br />
Wie jede Standseilbahn hat sie einen zweiten<br />
Wagen, der seine Fahrt „oben“ startet, wenn der andere<br />
„unten“ beginnt. In der Mitte der nur 1,4 Kilometer<br />
langen Strecke liegt die Ausweichstelle mitten<br />
im Thüringer Tann. <strong>Das</strong> erste, was der bergwärts<br />
fahrende Reisende von der Talfahrt ausmachen<br />
kann, ist ein zitronengelber Punkt. Wenn der näher<br />
kommt, traut mancher seinen Augen nicht: ein<br />
Sonnenschirm? Richtig, ein Sonnenschirm. <strong>Das</strong><br />
zweite Fahrzeug der OBS, das zumindest an schönen<br />
Sommertagen eingesetzt wird, fährt oben ohne: ein<br />
Cabriowagen. Es sind sogar zwei Sonnenschirme<br />
auf einem offenen, mit Sitzbänken bestuhlten<br />
Güterwagen, jeweils am Arbeitsplatz des Lokführer-<br />
Maschinisten-Zugbegleiters. Der aufgesetzte<br />
Wagen ist auf einem für die schräge Berg- und Talbahn<br />
konzipierten fahrbaren Untersatz fest verankert<br />
– auf einer knallrot lackierten „Güterbühne“.<br />
Dieses Vehikel ist der eigentliche Sinnstifter dieser<br />
Bergbahn. Sie wurde in den 20er-Jahren des vorigen<br />
24 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Unterwegs im Netz<br />
Talstation Obstfelderschmiede: Hier treffen sich Oberweißbacher Bergbahn<br />
und Schwarzatalbahn.<br />
Maschinist, Lok- und Fremdenführer: Zugbegleiter Karsten<br />
Schellhardt erklärt Technik und Attraktionen der OBS.<br />
Blickfang Bergbahn-<br />
Technik: Die ausgemusterten<br />
Seilwinden<br />
der ersten Generation<br />
stehen an der Station<br />
Lichtenhain.<br />
Jahrhunderts konzipiert und gebaut, um die karge<br />
Hochebene rund um Oberweißbach an das Schienennetz<br />
anzuschließen. Bis dahin gab es nur steile<br />
Bergwege die gut 300 Höhenmeter hinauf, dort aber<br />
wohnten einmal einige tausend Menschen, die Lebensmittel<br />
ebenso brauchten wie etwa Kohle. Und<br />
es gab eine prosperierende Glasindustrie, die nach<br />
Rohstoffen und Verbindungen in die Absatzmärkte<br />
verlangte. In der Talstation wurden die Güterwagen<br />
von der Schwarzatalbahn übernommen und über<br />
eine Drehscheibe auf die Güterbühne der Bergbahn<br />
bugsiert. Oben, an der Bergstation Lichtenhain, dasselbe<br />
Manöver wieder. So landeten die Güterwagen<br />
auf der Flachstrecke, die die Hochebene weiter erschließt.<br />
Erst 1966 wurde der Güterverkehr eingestellt. Die<br />
obere Strecke ist noch in Betrieb – für den Nah- und<br />
Ausflugsverkehr. Zwei bejahrte Triebwagen, zu<br />
DDR-Zeiten aus Bauteilen für die Berliner S-Bahn<br />
modernisiert, zuckeln im gemächlichen Tempo bis<br />
nach Cursdorf. Wer weiter will, muss wandern.<br />
Und das tun viele. Sascha Schwarze, Hotelmanager<br />
im Hotel Waldfrieden direkt am Haltepunkt Meuselbach-Schwarzmühle<br />
an der Schwarzatalbahn,<br />
weiß um den Segen der Schienenanbindung für die<br />
touristische Region. „Mit der Bahn raus ins Grüne,<br />
das ist unsere Attraktion, die unser Haus seit seiner<br />
Gründung 1908 pflegt.“ Nachzulesen in Meyer's<br />
Reiseführer vom Thüringer Wald aus jenem Jahr.<br />
Und heute ist die Berg- und Talbahn Highlight in<br />
den Pauschalpaketen einiger Hotels: Jeder Gast bekommt<br />
kostenlos eine Tageskarte für die OBS.<br />
Weitere Infos unter<br />
www.oberweissbacher-bergbahn.com<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 25
U20<br />
Feiern – und<br />
sicher fahren<br />
Abends in der Stadt ein Bier trinken und<br />
dann nach Hause – gerade im ländlichen<br />
Raum ist das nicht einfach. Eine Alternative<br />
zum eigenen Auto: Nachtbusse. Doch die<br />
müssen nicht nur den demografischen<br />
Wandel im Blick behalten. Auch das sich<br />
ändernde Freizeitverhalten spielt für die<br />
Auslastung eine wichtige Rolle – etwa im<br />
Münsterland. Eine Nacht unterwegs mit der<br />
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM).<br />
An der Haltestelle am Hauptbahnhof Münster wartet<br />
bereits ein Dutzend Nachtschwärmer, als ein Bus der<br />
Linie N4 um die Ecke biegt. Es ist eine laue Freitagnacht<br />
Ende Juli, die große Uhr an der Haltestelle zeigt<br />
1:06 Uhr. Einige der Fahrgäste unterhalten sich leise<br />
im Bus, andere dösen ein. Es sind gerade Ferien, da ist<br />
in den RVM-Nachtlinien immer etwas weniger los. Im<br />
vorderen Teil des Gelenkbusses sitzt Andreas Dahse.<br />
Der 48-Jährige aus dem kleinen Ottmarsbocholt ist<br />
auf dem Rückweg nach einem Kneipenabend in der<br />
Stadt. „Ich finde das sehr gut, gerade, wenn man vom<br />
Dorf kommt“, urteilt er: „Ohne den Bus wäre man ans<br />
Auto gefesselt.“<br />
Seit einigen Jahren sinken jedoch die Fahrgastzahlen<br />
in den Nachtbussen der RVM, sagt Pressesprecher<br />
Markus Kleymann. Nach 152.000 Fahrgästen in 2010<br />
nutzten 2012 noch 139.000 die elf Nachtlinien des<br />
Verkehrsunternehmens. <strong>Das</strong> liege zum einen am<br />
demografischen Wandel – gerade die Zahl der Jugendlichen<br />
nehme ab. Hinzu kommt aber auch das veränderte<br />
Freizeitverhalten. Waren vor einigen Jahren<br />
Großraumdiscos angesagt, die mehr als 1.000 Leute<br />
anzogen, geht der Trend in Städten wie Münster heute<br />
zu kleinen Clubs und Privatpartys. <strong>Das</strong> zerfasert die<br />
Nachfrage, gerade auf dem Land.<br />
Glück haben die Unternehmen, in deren Einzugsgebiet<br />
keine Kneipen- oder Clubszene mit den großen Dis-<br />
Pünktlich um 1:06 Uhr<br />
am Hauptbahnhof<br />
Münster: Die N4 ist die<br />
beliebteste Nachtbuslinie<br />
der RVM.<br />
26 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
U20<br />
Die Nacht durchtanzen<br />
– und noch fahren?<br />
Wer darauf keine Lust<br />
hat, kann in vielen<br />
Städten auf das Nachtbusangebot<br />
zurückgreifen.<br />
kotheken konkurriert. Die Friedberger Demmelmair<br />
Omnibusbetrieb GmbH & Co. KG zum Beispiel betreibt<br />
einen Shuttlebus zwischen der Stadt Augsburg und<br />
einer Großraumdisco im nahen Untermeitingen, der<br />
„sehr, sehr gut angenommen“ werde, sagt Inhaber<br />
Gerhard Bestele. Ähnlich ist die Situation bei der<br />
Kemptener Berchtold‘s Autoreisen und Reisebüro<br />
GmbH & Co. KG, die im benachbarten<br />
Obergünzburg eine Disco bedient.<br />
Im Münsterland sucht die RVM nun<br />
neue und kreative Wege, um den<br />
Herausforderungen zu begegnen. Sie<br />
will verstärkt die ältere Zielgruppe<br />
ansprechen – etwa durch Kombi-<br />
Tickets. Ein Beispiel: die Kooperation<br />
mit dem GOP-Varieté in Münster.<br />
Die Eintrittskarte ist gleichzeitig<br />
das Ticket für den Nachtbus. Und wer einmal den<br />
Nachtbus genutzt hat, der nehme das Angebot<br />
vielleicht auch künftig eher wahr, so der Gedanke.<br />
Zudem lässt sich die RVM regelmäßig neue Marketingaktionen<br />
einfallen – zu besonderen Anlässen<br />
treten etwa Bands, Comedians oder Zauberer in<br />
den Bussen auf.<br />
Die Kosten für die Nachtlinien im Münsterland<br />
werden dabei gedrittelt: Städte und Gemeinden<br />
tragen einen Teil, der Rest kommt über den Fahrpreis<br />
139<br />
Tausend<br />
Fahrgäste nutzten 2012<br />
das Nachtbusangebot<br />
der RVM.<br />
sowie die Westfälische Provinzial-Versicherung –<br />
Letztere ist Sponsoring-Partner der RVM und ihrer<br />
übergeordneten Geschäftsführungsgesellschaft, der<br />
Westfälischen Verkehrsgesellschaft (WVG). Die<br />
existierenden Linien stehen indes nicht zur Diskussion<br />
– auch in Zeiten klammer öffentlicher Kassen<br />
und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.<br />
„Die Akzeptanz ist ganz stark,<br />
auch in der Politik“, so Markus Kleymann:<br />
„Die Kommunalpolitiker haben<br />
ja schließlich ebenfalls Kinder, die<br />
mitfahren.“ Denn die Motivation hinter<br />
den Nachtbussen war seinerzeit<br />
nicht nur der Mobilitätsgedanke.<br />
Party- und Kneipengänger sollten<br />
davon abgehalten werden, sich angetrunken<br />
hinters Steuer zu setzen.<br />
<strong>Das</strong> soll auch künftig so bleiben. Bei großen Veranstaltungen<br />
reagiert die RVM deswegen auch mit<br />
zusätzlichen Bussen. Zuletzt etwa Mitte August bei<br />
einem Doppelkonzert von Unheilig am Freitag und<br />
Rapper Cro am Samstag. Die RVM war mit sieben<br />
Extra-Fahrzeugen im Einsatz, um die Musikfans<br />
nach Hause zu bringen. Markus Kleymann: „Wir<br />
wollen ja schließlich niemanden an der Haltestelle<br />
stehen lassen.“<br />
www.rvm-online.de<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 27
Grenzenlos<br />
4,5<br />
Mal<br />
umrunden die Öffis in Wien<br />
jeden Tag die Erde – legen also<br />
180.000 Kilometer zurück.<br />
Sozial und nachhaltig:<br />
Viel Bim für kleines Geld<br />
Was gibt es für 2,10 Euro? Fast drei Kugeln Eis, manchmal schon eine Portion<br />
Pommes rot-weiß und etwa eineinhalb Liter Superbenzin. 2,10 Euro reichen aber<br />
auch, um mit Bus, Tram oder U-Bahn quer durch die Stadt zu fahren. Und in Wien<br />
geht das sogar besonders sozial verträglich und ökologisch nachhaltig.<br />
28 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Grenzenlos<br />
907 Millionen Passagiere pro Jahr, 118 Linien: Die Fahrzeuge der Wiener Linien sind rund um die Uhr im Einsatz.<br />
Die soziale Nachhaltigkeit ist einer der zentralen Pfeiler<br />
der Wiener Linien GmbH & Co. KG. <strong>Das</strong> österreichische<br />
Verkehrsunternehmen bietet nicht nur<br />
Einzeltickets günstig an – Jahreskarten gibt es bereits<br />
für 365 Euro. Zum Vergleich: In Berlin zahlen Kunden<br />
etwa 700 Euro, in London 1.200 Pfund. Für Schüler,<br />
Auszubildende, Studenten, Senioren und sozial Bedürftige<br />
gelten reduzierte Preise. „<strong>Das</strong> liegt sicher<br />
auch an einer höheren Bereitschaft der Stadtverwaltung,<br />
öffentlichen Verkehr anteilig aus Steuermitteln<br />
zu finanzieren“, erklärt Günter Steinbauer, Geschäftsführer<br />
der Wiener Linien. Die Verbilligung der Jahreskarte<br />
sei zudem ein politischer Auftrag durch die<br />
rot-grüne Stadtregierung. Als 100-prozentige Tochter<br />
der Wiener Stadtwerke Holding AG befinden sich<br />
die Wiener Linien mittelbar in öffentlichem Eigentum.<br />
Dabei gelingt dem Unternehmen etwas, woran andere<br />
noch arbeiten: der schwierige Dreiklang aus sozialer<br />
Verantwortung und ökologischer Nachhaltigkeit einerseits<br />
sowie wirtschaftlichem Erfolg andererseits.<br />
Die Fahrgastzahlen in Wien steigen jährlich, der Streckenausbau<br />
läuft problemlos, die Einnahmen stimmen.<br />
Waren es 2008 noch 803 Millionen Fahrgäste in<br />
Bus, U-Bahn und Bim, wie die Einheimischen ihre<br />
Tram nennen, stiegen die Zahlen 2012 auf satte 907<br />
Millionen. <strong>Das</strong> Straßenbahnnetz ist das sechstgrößte<br />
der Welt, der öffentliche Nahverkehr hat das Auto als<br />
beliebtestes Fortbewegungsmittel längst verdrängt. Er<br />
erreicht einen Marktanteil von 39 Prozent – der Pkw<br />
nur 27 Prozent. „<strong>Das</strong> ist ein langfristiger Prozess, der<br />
viele Jahre dauert und mit vielen Faktoren zu tun hat“,<br />
urteilt Unternehmenssprecher Dominik Gries, „mit<br />
dem Netzausbau, mit Stadtentwicklung, mit der Entwicklung<br />
eines städtischen Lifestyles, der kein Auto<br />
mehr braucht, und mit Intervallen, die so kurz sind,<br />
dass man gar nicht mehr auf den Fahrplan zu schauen<br />
braucht.“<br />
Die hohe Akzeptanz der „Öffis“ – der öffentlichen<br />
Verkehrsmittel – spiegelt sich auch in Umfragen<br />
wider, denen zufolge 90 Prozent der Einwohner mit<br />
der Leistung der Wiener Linien zufrieden sind. Insgesamt<br />
nutzen neun von zehn Wienern den öffentlichen<br />
Verkehr. Damit tun sie auch der Umwelt etwas Gutes.<br />
Bim und U-Bahn fahren mit elektrischem Antrieb,<br />
Bremsenergie wird in Strom umgewandelt und zurück<br />
ins Netz gespeist. Der Effekt lässt sich laut Wiener<br />
Linien in Zahlen belegen: Jeder Fahrgast, der auf den<br />
ÖPNV umsteigt, spare bis zu 1.500 Kilogramm CO2<br />
pro Jahr ein.<br />
www.wienerlinien.at<br />
In den Farben des Regenbogens<br />
Diese Straßenbahnen fallen ins Auge: Bunt designt führten zwei<br />
Bim der Wiener Linien auch 2013 die Regenbogenparade an –<br />
den Höhepunkt der „Vienna Pride“. <strong>Das</strong> Unternehmen unterstützt<br />
bereits seit mehreren Jahren die Veranstaltung der österreichischen<br />
Homosexuellen- und Transgenderbewegung.<br />
Fuhren die Bim vor der Parade aber zunächst „nur“ mit Regenbogenfahnen<br />
durch die Hauptstadt, wurden 2012 erstmals zwei<br />
Schienen-Sonderfahrzeuge entsprechend gestaltet. Die Parade<br />
stehe für Toleranz und Respekt, und damit wolle sich das Unternehmen<br />
solidarisch zeigen, erklären die Wiener Linien.<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 29
Abgefahren<br />
Autofreak wirbt für<br />
intelligenten Verkehrsmix<br />
In seinen Rollen gibt er oft robuste Burschen<br />
mit derbem Charme, denen komplexe<br />
Zusammenhänge eher weniger<br />
liegen. Deshalb erregt Ralf Richter derzeit<br />
umso mehr Aufmerksamkeit mit der<br />
Kampagne, in der der Verkehrsverbund<br />
Rhein-Sieg (VRS) und der ADAC Nordrhein<br />
für die intelligente Nutzung verschiedener<br />
Verkehrsmittel werben. Der<br />
Schauspieler hat in PS-starken Streifen<br />
wie „Manta – Der Film“ oder „Superstau“<br />
mitgewirkt und ist auch im richtigen<br />
Leben bekennender Fan auffälliger Fahrzeuge:<br />
Ein goldenes Benzcoupé, wie er es<br />
als Ganove Kalle Grabowski durch „Bang<br />
Boom Bang“ steuerte, besaß Richter eine<br />
Zeitlang selbst. Männliche Autofahrer<br />
zwischen 30 und 50 Jahren sind folglich<br />
die Kernzielgruppe der Anzeigen und<br />
Radiospots. <strong>Das</strong> Konzept mit dem harten<br />
Jungen als Werbeträger scheint zu funktionieren:<br />
Für die 1.500 Testtickets –<br />
kostenlose Tagesfahrscheine für zwei<br />
Personen – gab es doppelt so viele Anfragen,<br />
und auch mit den Klickzahlen der<br />
Kampagnenwebseite zeigt sich der VRS<br />
sehr zufrieden. Der in Köln lebende Richter<br />
steht auch privat zu der Botschaft,<br />
dass es die Mischung macht. In der Domstadt<br />
verlässt er sich deshalb nicht nur<br />
auf das Auto. „Ich fahre hier gut mit den<br />
Öffentlichen“, so der Schauspieler: „Und<br />
das sag‘ ich als Autofreak, der ja gerne<br />
mal selber am Steuer sitzt.“<br />
www.verkehrsmix.de<br />
Termine<br />
25. bis 27. September 2013<br />
6. <strong>VDV</strong>-Personalkongress<br />
in Hannover<br />
Arbeit, Bildung, Personal<br />
2020: Trends und Chancen<br />
stehen im Mittelpunkt.<br />
19. bis 20. November 2013<br />
UITP-Konferenz<br />
in Straßburg<br />
Thema ist die Öffnung<br />
der europäischen Märkte im<br />
Schienenpersonenverkehr.<br />
Die nächste<br />
Ausgabe von<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“<br />
erscheint Ende<br />
Oktober 2013.<br />
www.vdv.de/termine.aspx<br />
http://strasbourg2013.uitp-events-expo.org<br />
Impressum<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong><br />
Herausgeber:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (<strong>VDV</strong>),<br />
Kamekestraße 37-39, 50672 Köln,<br />
Tel. 02 21/5 79 79-0<br />
E-Mail: info@vdv.de,<br />
Internet: www.vdv.de<br />
Redaktion <strong>VDV</strong>:<br />
Lars Wagner (V.i.S.d.P.),<br />
Pressesprecher und Leiter Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Realisierung, Text und Redaktion:<br />
AD HOC PR, Gütersloh: Stefan Temme (Lt.), Elena Grawe,<br />
Christian Horn, Tobias Thiele<br />
Mitarbeit:<br />
Eberhard Krummheuer, Thomas Rietig, Friedhelm Bihn<br />
Gesamtleitung und Anzeigen:<br />
Christian Horn (AD HOC PR)<br />
Tel. 0 52 41/90 39-33<br />
horn@adhocpr.de<br />
Grafik-Design:<br />
Volker Kespohl (Volker.Kespohl ı Werbung Münster)<br />
Bildnachweise:<br />
Titelmotiv: Deutsche Bahn/Frank Barby<br />
Deutscher Städtetag/Stadt Nürnberg (12); dpa/Matthias<br />
Balk (11); Dresdner Verkehrsbetriebe (15); Fotolia (26, 27,<br />
30); Elena Grawe (26); Hauke Hass (2, 18, 19, 20); Kay Herschelmann<br />
(14, 16); Infra Dialog Deutschland (13); Eberhard<br />
Krummheuer (24, 25); Magdeburger Verkehrsbetriebe (2,<br />
4, 5, 6, 7, 8), Metropolradruhr/D2B/Sebastian Pretzsch (20);<br />
Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (23)/Mario<br />
Ehrlich (2, 24)/Günter Kretzschmar (22)/Thomas Albrecht<br />
(23); Ocean/Corbis (17, 22); Dieter Schneider (8); Stadtwerke<br />
München (16); TX Logistik/Knut Ragnar Holme (9); <strong>VDV</strong><br />
(3, 10, 11), <strong>VDV</strong>-Akademie (17); VRS (2, 30); Wiener Linien/<br />
Novotny (2, 28)/Johannes Zinner (29)/Thomas Jantzen (29).<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (<strong>VDV</strong>),<br />
Redaktion „<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“,<br />
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin,<br />
magazin@vdv.de<br />
Produktion und Druck:<br />
Druckhaus Rihn, Blomberg<br />
Anzeigenpreise:<br />
Laut Mediadaten 2013<br />
Für Anregungen, Themenvorschläge, Lob und Kritik erreichen Sie uns unter magazin@vdv.de<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ erscheint alle zwei Monate (sechsmal<br />
im Jahr). Alle im <strong>Magazin</strong> erscheinenden Beiträge und<br />
Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Außerhalb der<br />
Grenzen des Urheberrechts ist die Verwertung ohne die<br />
Zustimmung des Herausgebers nicht zulässig. <strong>Das</strong> gilt vor<br />
allem für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie die<br />
elektronische Speicherung und Verarbeitung.<br />
30 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>
Abgefahren<br />
Autofreak wirbt für<br />
intelligenten Verkehrsmix<br />
In seinen Rollen gibt er oft robuste Burschen<br />
mit derbem Charme, denen komplexe<br />
Zusammenhänge eher weniger<br />
liegen. Deshalb erregt Ralf Richter derzeit<br />
umso mehr Aufmerksamkeit mit der<br />
Kampagne, in der der Verkehrsverbund<br />
Rhein-Sieg (VRS) und der ADAC Nordrhein<br />
für die intelligente Nutzung verschiedener<br />
Verkehrsmittel werben. Der<br />
Schauspieler hat in PS-starken Streifen<br />
wie „Manta – Der Film“ oder „Superstau“<br />
mitgewirkt und ist auch im richtigen<br />
Leben bekennender Fan auffälliger Fahrzeuge:<br />
Ein goldenes Benzcoupé, wie er es<br />
als Ganove Kalle Grabowski durch „Bang<br />
Boom Bang“ steuerte, besaß Richter eine<br />
Zeitlang selbst. Männliche Autofahrer<br />
zwischen 30 und 50 Jahren sind folglich<br />
die Kernzielgruppe der Anzeigen und<br />
Radiospots. <strong>Das</strong> Konzept mit dem harten<br />
Jungen als Werbeträger scheint zu funktionieren:<br />
Für die 1.500 Testtickets –<br />
kostenlose Tagesfahrscheine für zwei<br />
Personen – gab es doppelt so viele Anfragen,<br />
und auch mit den Klickzahlen der<br />
Kampagnenwebseite zeigt sich der VRS<br />
sehr zufrieden. Der in Köln lebende Richter<br />
steht auch privat zu der Botschaft,<br />
dass es die Mischung macht. In der Domstadt<br />
verlässt er sich deshalb nicht nur<br />
auf das Auto. „Ich fahre hier gut mit den<br />
Öffentlichen“, so der Schauspieler: „Und<br />
das sag‘ ich als Autofreak, der ja gerne<br />
mal selber am Steuer sitzt.“<br />
www.verkehrsmix.de<br />
Termine<br />
25. bis 27. September 2013<br />
6. <strong>VDV</strong>-Personalkongress<br />
in Hannover<br />
Arbeit, Bildung, Personal<br />
2020: Trends und Chancen<br />
stehen im Mittelpunkt.<br />
19. bis 20. November 2013<br />
UITP-Konferenz<br />
in Straßburg<br />
Thema ist die Öffnung<br />
der europäischen Märkte im<br />
Schienenpersonenverkehr.<br />
Die nächste<br />
Ausgabe von<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“<br />
erscheint Ende<br />
Oktober 2013.<br />
www.vdv.de/termine.aspx<br />
http://strasbourg2013.uitp-events-expo.org<br />
Impressum<br />
<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong><br />
Herausgeber:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (<strong>VDV</strong>),<br />
Kamekestraße 37-39, 50672 Köln,<br />
Tel. 02 21/5 79 79-0<br />
E-Mail: info@vdv.de,<br />
Internet: www.vdv.de<br />
Redaktion <strong>VDV</strong>:<br />
Lars Wagner (V.i.S.d.P.),<br />
Pressesprecher und Leiter Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Realisierung, Text und Redaktion:<br />
AD HOC PR, Gütersloh: Stefan Temme (Lt.), Elena Grawe,<br />
Christian Horn, Tobias Thiele<br />
Mitarbeit:<br />
Eberhard Krummheuer, Thomas Rietig, Friedhelm Bihn<br />
Gesamtleitung und Anzeigen:<br />
Christian Horn (AD HOC PR)<br />
Tel. 0 52 41/90 39-33<br />
horn@adhocpr.de<br />
Grafik-Design:<br />
Volker Kespohl (Volker.Kespohl ı Werbung Münster)<br />
Bildnachweise:<br />
Titelmotiv: Deutsche Bahn/Frank Barby<br />
Deutscher Städtetag/Stadt Nürnberg (12); dpa/Matthias<br />
Balk (11); Dresdner Verkehrsbetriebe (15); Fotolia (26, 27,<br />
30); Elena Grawe (26); Hauke Hass (2, 18, 19, 20); Kay Herschelmann<br />
(14, 16); Infra Dialog Deutschland (13); Eberhard<br />
Krummheuer (24, 25); Magdeburger Verkehrsbetriebe (2,<br />
4, 5, 6, 7, 8), Metropolradruhr/D2B/Sebastian Pretzsch (20);<br />
Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (23)/Mario<br />
Ehrlich (2, 24)/Günter Kretzschmar (22)/Thomas Albrecht<br />
(23); Ocean/Corbis (17, 22); Dieter Schneider (8); Stadtwerke<br />
München (16); TX Logistik/Knut Ragnar Holme (9); <strong>VDV</strong><br />
(3, 10, 11), <strong>VDV</strong>-Akademie (17); VRS (2, 30); Wiener Linien/<br />
Novotny (2, 28)/Johannes Zinner (29)/Thomas Jantzen (29).<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (<strong>VDV</strong>),<br />
Redaktion „<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“,<br />
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin,<br />
magazin@vdv.de<br />
Produktion und Druck:<br />
Druckhaus Rihn, Blomberg<br />
Anzeigenpreise:<br />
Laut Mediadaten 2013<br />
Für Anregungen, Themenvorschläge, Lob und Kritik erreichen Sie uns unter magazin@vdv.de<br />
„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ erscheint alle zwei Monate (sechsmal<br />
im Jahr). Alle im <strong>Magazin</strong> erscheinenden Beiträge und<br />
Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Außerhalb der<br />
Grenzen des Urheberrechts ist die Verwertung ohne die<br />
Zustimmung des Herausgebers nicht zulässig. <strong>Das</strong> gilt vor<br />
allem für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie die<br />
elektronische Speicherung und Verarbeitung.<br />
30 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>