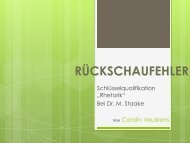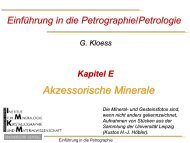Prof. Dr. Roger Gläser - Universität Leipzig
Prof. Dr. Roger Gläser - Universität Leipzig
Prof. Dr. Roger Gläser - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
UI stellt vor: <strong>Prof</strong>essor <strong>Dr</strong>. <strong>Roger</strong> <strong>Gläser</strong><br />
<strong>Roger</strong> <strong>Gläser</strong> studierte Chemie an der<br />
<strong>Universität</strong> Stuttgart und promovierte 1997 am<br />
dortigen Institut für Technische Chemie mit<br />
einer Arbeit zur Aromatenalkylierung an<br />
mikroporösen Molekularsiebkatalysatoren in<br />
überkritischer Reaktionsphase. Nach einem<br />
Forschungsaufenthalt als DFG-Stipendiat in<br />
der Arbeitsgruppe von <strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. C.A. Eckert<br />
am Georgia Institute of Technology, Atlanta,<br />
Georgia, USA, kehrte er 1999 wieder an das<br />
Institut für Technische Chemie der <strong>Universität</strong><br />
Stuttgart zurück, wo er im Januar 2007 seine<br />
Habilitation abschloss. Seit 01.08.2007 ist er<br />
<strong>Prof</strong>essor für Technische Chemie an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>. Er leitet als Direktor das<br />
Institut für Technische Chemie sowie das<br />
Institut für Nichtklassische Chemie e.V. an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>.<br />
Wie wird man <strong>Prof</strong>essor?<br />
Bei mir war nicht von vornherein klar, dass ich <strong>Prof</strong>essor werde. Ich wusste<br />
schon ziemlich früh, dass ich Chemie studieren würde. Das kam durch einen<br />
Chemiebaukasten den ich mit dreizehn geschenkt bekommen habe und das hat<br />
mich total fasziniert. Eigentlich ging es sogar schon früher los, nämlich als<br />
mein Onkel Physiklehrer wurde und mich einmal mit in ein Fotolabor nahm.<br />
Als ich mit diesen Säftchen hantierte und Fotos entwickelte, da ging es, glaub<br />
ich, los. Und bevor ich Chemie in der Schule hatte, war schon klar, dass mich<br />
das interessieren würde. Es hat sich aber arg gewandelt, als ich im Abi-Alter<br />
war. Damals interessierte ich mich vor allem für die organische Chemie. Als<br />
ich dann an die Uni ging, hat mich das gar nicht mehr so sehr interessiert. Da<br />
sind dann ganz viele Entwicklungen abgelaufen. Auf einmal haben mich die<br />
Naturstoffe gar nicht mehr interessiert, dafür habe ich viel Freude an<br />
Physikalischer Chemie gefunden - und dann kam die Technische Chemie.<br />
Früher ging Physik bei mir gar nicht. Ich habe es auch im Abi abgewählt. Im<br />
dritten Semester hätte ich das Studium auch beinahe wegen der Physikalischen<br />
Chemie geschmissen. Aber dann kam das Physik-Vordiplom, da musste ich zwei<br />
Monate lang mal richtig ran und dann hat es ein paar Mal Klick gemacht.<br />
Dann hab ich Physik und PC richtig verstanden und es hat Spaß gemacht. Nach<br />
dem Vordiplom wurde mir dann klar dass es mit dem Studium doch hinhauen<br />
wird… Ich begann mich zunehmend für TC zu interessieren, da mich die<br />
Praktika, besonders das in OC, doch ziemlich gequält haben. Zunehmend
wurde für mich Forschung nach dem Studium eine Berufsalternative, trotzdem<br />
war es alles andere als klar dass ich <strong>Prof</strong>essor werden würde. Nachdem ich mit<br />
meiner Doktorarbeit in TC fertig war konnte, ich mich immer noch nicht<br />
entscheiden: ich wusste zwar, ich will in die Forschung, das hat mir richtig<br />
Spaß gemacht, aber mir war noch nicht klar, ob ich in die Industrieforschung<br />
oder in die Hochschulforschung will. Ich hab mir dann gesagt, dass ich noch<br />
etwas Zeit brauche und bin erst einmal ins Ausland gegangen. Während meiner<br />
Postdoc-Phase in Atlanta (School of Chemical Engineering, Georgia Institute<br />
of Technology) wusste ich, ich will Forschung machen. Irgendwie hab ich mich<br />
dann während meiner Postdoc-Zeit dazu entschieden, dass ich´s mal an einer<br />
Hochschule probieren will. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch, dass ich bei<br />
der Forschung an einer Hochschule auch Lehre anbieten kann. Ich habe schon<br />
immer gerne Lehre gemacht, nicht nur während der Habilitationsphase<br />
sondern auch schon während des Studiums in Seminaren oder in Lernkreisen<br />
mit meinen Kommilitonen. Lehre macht mir Spaßdeswegen wollte ich dann<br />
auch an eine Hochschule, was sich aber erst spät herauskristallisierte. Währen<br />
der Habilitationsphase in Stuttgart habe ich gemerkt, dass Lehre und<br />
Forschung für mich zusammen gehören.<br />
Die Entscheidung, für meine Habilitation von den USA zurück nach Stuttgart<br />
zu gehen war alles andere als selbstverständlich. Um ein Haar wäre ich in den<br />
USA geblieben. Doch dann lag mir doch einiges an Deutschland und, nicht<br />
zuletzt auch wegen meiner Frau, habe ich mich entschieden zurück zu kommen.<br />
Wir waren damals schon verheiratet und meine Frau hatte nicht viel Lust, in<br />
die Staaten zu ziehen. Direkt nach der Habilitation wurde ich dann hier in<br />
<strong>Leipzig</strong> zum <strong>Prof</strong>essur und Institutsleiter der Technischen Chemie und dem<br />
Institut für Nichtklassische Chemie e.V. berufen.<br />
Und wie sind Sie auf <strong>Leipzig</strong> gekommen? Was sind die Vorteile von<br />
<strong>Leipzig</strong>?<br />
Hier ist die Antwort, die ich auch der Berufungskomission gegeben habe. Die<br />
fragen ja auch: wieso wollen Sie nach <strong>Leipzig</strong>?<br />
<strong>Leipzig</strong> bietet viele tolle Gelegenheiten. <strong>Leipzig</strong> hat, was die Fakultät angeht,<br />
sehr gute Kooperationsmöglichkeiten. <strong>Leipzig</strong> hat auch gute <strong>Prof</strong>essoren - in<br />
den verschiedensten Fachgebieten. Die Fakultät für Chemie und Mineralogie<br />
ist, auch deutschlandweit, relativ gut bekannt. Auch die Physik in <strong>Leipzig</strong> hat<br />
einen guten Ruf. Ich finde auch gut, dass die Fakultät nicht zu groß ist.<br />
Außerdem glaube ich auch, dass man so ganz gut Kontakt zu den Studierenden<br />
halten kann. Die <strong>Prof</strong>essur für TC, gerade in der heterogenen Katalyse, hat<br />
auch einen guten Ruf gehabt. Herr <strong>Prof</strong>essor Papp ist sehr bekannt. Das ist<br />
auch ein konkretes Argument gewesen, hierherzugehen. Wieder ein anderes<br />
gutes Argument ist, dass die Leitung des Instituts für Nichtklassische Chemie<br />
mit der <strong>Prof</strong>essur verbunden ist, die in meinem konkreten Fall ganz gut<br />
zusammenpassen. Am INC beschäftigt man sich mit Dingen, mit denen ich<br />
mich auch schon lange beschäftigt habe, etwa alternative Lösungsmittel und<br />
ähnliches.
Dann die Stadt <strong>Leipzig</strong> selbst natürlich. Ich kenn Herrn <strong>Prof</strong>essor Kärger<br />
schon relativ lange und wir hatten über Stuttgart schon öfter mal eine<br />
Kooperation. Und deswegen kannte ich <strong>Leipzig</strong> als Stadt schon ein bisschen<br />
und es hat mir immer schon gut hier gefallen. Die Stadt lebt, da ist Dynamik,<br />
gerade jetzt bewegt sich viel, das gefällt mir gut. Was nicht ganz so toll ist, ist<br />
dass es an der Uni <strong>Leipzig</strong> keine Ingenieurwissenschaften gibt. Als<br />
Technischer Chemiker muss man da halt externe Kooperationen suchen. Aber<br />
ich kenn auch einige Leute in <strong>Dr</strong>esden und Chemnitz, insofern ist das nicht<br />
ganz so schlimm.<br />
Wie wirbt man <strong>Dr</strong>ittmittel ein und wie werden diese verwendet?<br />
Da gibt es im wesentlichen zwei Wege: das eine ist die Industrie und das<br />
andere sind öffentliche Fördermittel. Im ersten Fall können Sie sich mit ihrer<br />
Idee an die Industrie wenden. Oder es läuft auch andersherum ab und die<br />
Industrie tritt an Sie heran und sagt, wir haben ein Problem, können Sie das<br />
lösen? Aber das ist eher selten. Häufiger ist es so, dass man sich einen Ruf<br />
aufgebaut hat und dann kommt die Industrie und sagt, wir haben gehört, Sie<br />
können dies oder das ganz gut und wir könnten Ihr Know-How gut gebrauchen.<br />
Manchmal läuft es auch so, dass wir eine Idee haben und wir dann mit der<br />
Industrie oder man mit anderen Kollegen, die auch Katalyse machen, z.B. beim<br />
Treffen auf Tagungen, darüber sprechen. Wenn man dann der Meinung ist<br />
„Mensch, das müsste man mal wirklich untersuchen.“, schreibt man einen<br />
Antrag und wenn alles gut läuft, bekommt man auch Geld.<br />
Von den Industriemitteln kommt relativ viel an. Die Uni <strong>Leipzig</strong> behält ca. 12%,<br />
den Rest kriegen wir als Institut. Die Uni ist hier auch so eine Art „Bank“, die<br />
das Geld verwaltet mit allem was dazu gehört. Und dafür zahlen wir als<br />
<strong>Dr</strong>ittmittelempfänger einen gewissen Verwaltungsbeitrag. Typischerweise ist<br />
der <strong>Dr</strong>ittmittelanteil hoch und er wird auch weiter steigen. Für uns als<br />
Technische Chemiker ist das nicht so sehr problematisch. Wir wählen unsere<br />
Forschungsgebiete oft auch so, dass wir Dinge treiben, die für die Industrie<br />
von Interesse sind. Es wird aber immer schwieriger, <strong>Dr</strong>ittmittel von der<br />
Industrie einzuwerben. Der Konkurrenzkampf zwischen den Unis und den<br />
Arbeitsgruppen die heterogene Katalyse machen wird noch weiter zunehmen.<br />
Was halten Sie von der Idee „Lehrprofessor“?<br />
Das finde ich gut, ich find das absolut okay. Ich würde aber andersherum<br />
fragen: Gibt es dann auch einen „Forschungsprofessor“? Die Idee, dass man<br />
besser differenziert zwischen denen, die ganz auf Forschung gehen und denen,<br />
die den Schwerpunkt etwas mehr in der Lehre haben, finde ich persönlich<br />
richtig. Für mich aber wäre eine Lehrprofessur nichts, denn ich kann mir für<br />
mich Lehre ohne Forschung nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, inwieweit<br />
das Vorhandensein von Lehrprofessuren die <strong>Universität</strong>(en) verändern wird.<br />
Aber für mich persönlich wäre so eine <strong>Prof</strong>essur weniger geeignet.
Was halten Sie allgemein von Studiengebühren?<br />
Ehrlich gesagt, ich finde das völlig korrekt. Wenn man eine ordentliche<br />
Leistung haben will, dann muss man das auch entsprechend entlohnen. Ich<br />
finde aber, dass Studiengebühren nur eingeführt werden sollten, wenn man<br />
vernünftige Möglichkeiten hat wirklich jedem Studierenden, aus allen<br />
gesellschaftlichen Hintergründen, ein Studium zu ermöglichen. Es muss<br />
Finanzierungsmöglichkeiten geben, mit denen das geht. Der Rechtsanspruch<br />
auf Bildung und gerade auch auf universitäre Bildung muss erhalten bleiben.<br />
Und es darf nicht so sein, dass den <strong>Universität</strong>en dann das Budget von den<br />
Ministerien zusammengestrichen wird.<br />
In dem Fall bin ich selbst ein gebranntes Kind. Ich habe kein Bafög bekommen,<br />
mein Vater hat ein paar Mark zu viel verdient. Ich komme aus einer<br />
kinderreichen Familie und ich hätte es wirklich gut gebrauchen können. In den<br />
Semesterferien hab ich am Band gestanden und habe das Geld für mein<br />
Studium verdient. Aber das ist okay. Ich hätte gerne 500 Mark gezahlt, wenn<br />
ich dafür eine bessere Leistung, z.B. bessere Betreuung oder Ausstattung in den<br />
Praktika,geboten bekommen hätte.<br />
Wo sehen Sie Unterschiede zwischen <strong>Universität</strong>en in den USA und in<br />
Deutschland?<br />
Grundsätzlich ist das Comitment der Studierenden in den USA viel höher, u.a.<br />
weil sie eben auch viel mehr für ihr Studium bezahlen müssen. Die Betreuung<br />
der Studierenden durch die <strong>Prof</strong>essoren ist viel besser, unter anderem weil man<br />
an den US-Unis mehr Geld hat. Der Kontakt zwischen <strong>Prof</strong>essor und<br />
Studierenden ist viel enger, vor allem dann auch in den Arbeitsgruppen. Ich<br />
glaube aber, dass in Deutschland die Ausbildung insgesamt breiter ist. Wir<br />
haben keine so starke Fokussierung auf bestimmte Spezialdisziplinen und<br />
versuchen sogar, noch mehr in die Breite zu gehen. Ich denke, dass auch die<br />
Art zu lehren in den USA ein bisschen anders ist als hier, v.a. dadurch, dass der<br />
Kontakt <strong>Prof</strong>essor/Studierende enger ist. Vielleicht ist man in den USA auch<br />
etwas offener gegenüber neuen (Lehr)Methoden.<br />
In der Forschung gibt es auch einige Unterschiede: wie das ganze angelegt und<br />
organisiert ist und wie man arbeitet. Zum Beispiel würden Sie jetzt nach ihrer<br />
Bachelor-Phase schon in die Arbeitskreise gehen. Sie hätten zwar weiterhin<br />
Vorlesungen, aber man arbeitet schon in den Gruppen. Das macht man bei uns<br />
ja eigentlich erst so richtig zur Masterarbeit. Man kann in den USA auch die<br />
Masterarbeit überspringen und praktisch die Arbeit, die man nach dem<br />
Bachelor in den Arbeitskreisen angefangen hat, bis in die Doktorarbeit hinein<br />
verlängern. Die Vorlesungen, Prüfungen und Scheine müssen natürlich<br />
trotzdem alle gemacht werden. Und dann gibt es da noch den sogenannten<br />
„PhD-Qualifier“, der ziemlich anspruchsvoll ist.<br />
Außerdem wählen die <strong>Universität</strong>en in den USA ihre Studenten viel früher aus.<br />
An einigen Orten werden Studienanwärter auf Kosten der Unis zu<br />
Wochenenden eingeladen, um Studierende für die Uni anzuwerben. An den<br />
Wochenenden wird den Interessenten die Stadt von anderen Studierenden, die
schon an der Uni sind, gezeigt wird. Man geht mit ihnen abends aus, die<br />
<strong>Universität</strong> stellt sich vor. Wenn man sich dann dort anmeldet, wird man, mit<br />
einem bisschen Glück, ausgewählt und zu einem Interview eingeladen. Man<br />
muss Essays schreiben, wieso man an diese Uni möchte und alle möglichen<br />
Fragen beantworten. Viele Bewerber werden dann auch abgelehnt.<br />
Was machen Sie in Ihrem Arbeitskreis?<br />
Das ist eine Frage, für die ich die nächsten zwei Tage für eine Antwort<br />
bräuchte. Kurz gefasst: heterogene Katalyse. Wir beschäftigen uns mit solchen<br />
Feststoffen als Katalysatoren, die eine definierte Porosität haben. Bei fast allen<br />
Materialien, die wir uns ansehen, geht es darum, dass die Poren eine bestimmte<br />
Größe oder Struktur haben. Das ist das einende Element. Dann beschäftigen<br />
wir uns Redoxkatalysatoren, also Katalysatoren, die entweder Oxidation oder<br />
Reduktion katalysieren. Die aktiven Zentren sitzen entweder in dem<br />
Feststoffgerüst auf einer definierten Position oder sie sind Nanopartikel, z.B.<br />
von Metallen oder das ganze poröse System besteht aus dem redoxaktiven<br />
Material . Ein weiteres Gebiet, das wir bearbeiten, könnten man nachhaltige<br />
Chemie oder „Green Chemistry“ beschreiben. Nicht Umweltschutz, das<br />
machen wir zwar auch, aber eher im Sinne von Vermeidungsstrategien. Wir<br />
stellen uns sozusagen die Frage „Wie kann man durch Katalyse von Anfang an<br />
die Entstehung von Umweltproblemen vermeiden?“. Ein wichtiger Teil unserer<br />
Aktivitäten richtet sich auf neue Lösungsmittel, im allgemeinsten Sinne. Dazu<br />
gehören z.B. überkritisches CO2 und Wasser Auch ionische Flüssigkeiten<br />
könnten wir demnächst dazu nehmen. Im Wesentlichen sind das die drei Felder:<br />
erstens Katalysatoren, also Materialien mit definierter Porosität und<br />
Nanostrukturierung, zweitens Nachhaltigkeit und Umweltschutz und drittens<br />
neuartigen Lösungsmittel, das wir gerne als „Solvent Engineering“<br />
bezeichnen. Durch die neue Stelle hier in <strong>Leipzig</strong> kommt jetzt natürlich immer<br />
wieder etwas Neues dazu. Am Institut für Nichtklassische Chemie zum Beispiel<br />
wird sehr viel Adsorption gemacht, z.B. in den Bereichen Abluftreinigung oder<br />
Biomethan. Wir haben auch angefangen mit Kollegen aus der Bauchemie<br />
gemeinsame Projekte zu diskutieren. Ein interessanter Ansatz ist unseres<br />
Erachtens, dass man Wände mit einer „Farbe“ anstreichen oder mit einem<br />
Putz versehen könnte, in der bzw. in dem ein Katalysator drin ist, der die Luft<br />
in der Umgebung reinigt. Die Umweltgifte oder unangenehm riechenden<br />
Substanzen werden durch den Einfluss des Tageslichts an dem Katalysator<br />
zersetzt. In Großstädten wäre das sicherlich sehr nützlich.<br />
Sie hatten Ihre Frau erwähnt. Haben Sie Familie? Sind sie schon hier oder<br />
noch in Stuttgart?<br />
Wie schon gesagt, ich bin verheiratet. Wir haben keine Kinder, aber nicht, dass<br />
wir das nicht wollten, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Das ist jetzt<br />
kein generelles Statement gegen Kinder, aber so, wie wir momentan beide<br />
unseren Job betreiben, wäre das sicherlich schwierig. Sie sollen aber nicht den<br />
Eindruck bekommen, dass Familie nicht vereinbar wäre mit dem
Chemiestudium oder gar mit einer beruflichen Tätigkeit als Chemiker oder als<br />
Forscher ganz allgemein. Da muss man sich halt gut organisieren. Meine Frau<br />
ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie hat gerade habilitiert, und vertritt derzeit<br />
eine <strong>Prof</strong>essur in Freiburg. Wir sind also die Woche über sehr weit<br />
auseinander. Deswegen versucht meine Frau momentan, auch eine Stelle hier<br />
in der Nähe zu bekommen. Im Moment aber pendleich an den Wochenenden<br />
nach Stuttgart, entweder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Aber da plagt<br />
einen auch ein wenig das schlechte CO 2 -Gewissen.<br />
Herzlichen Dank für dieses Interview! Mario Ficker