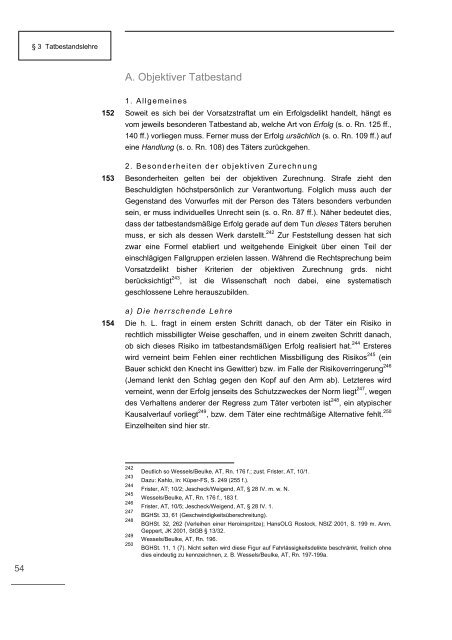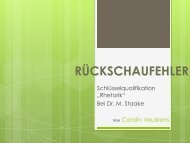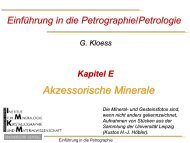A. Objektiver Tatbestand
A. Objektiver Tatbestand
A. Objektiver Tatbestand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
A. <strong>Objektiver</strong> <strong>Tatbestand</strong><br />
1. Allgemeines<br />
152<br />
Soweit es sich bei der Vorsatzstraftat um ein Erfolgsdelikt handelt, hängt es<br />
vom jeweils besonderen <strong>Tatbestand</strong> ab, welche Art von Erfolg (s. o. Rn. 125 ff.,<br />
140 ff.) vorliegen muss. Ferner muss der Erfolg ursächlich (s. o. Rn. 109 ff.) auf<br />
eine Handlung (s. o. Rn. 108) des Täters zurückgehen.<br />
2. Besonderheiten der objektiven Zurechnung<br />
153<br />
Besonderheiten gelten bei der objektiven Zurechnung. Strafe zieht den<br />
Beschuldigten höchstpersönlich zur Verantwortung. Folglich muss auch der<br />
Gegenstand des Vorwurfes mit der Person des Täters besonders verbunden<br />
sein, er muss individuelles Unrecht sein (s. o. Rn. 87 ff.). Näher bedeutet dies,<br />
dass der tatbestandsmäßige Erfolg gerade auf dem Tun dieses Täters beruhen<br />
muss, er sich als dessen Werk darstellt. 242 Zur Feststellung dessen hat sich<br />
zwar eine Formel etabliert und weitgehende Einigkeit über einen Teil der<br />
einschlägigen Fallgruppen erzielen lassen. Während die Rechtsprechung beim<br />
Vorsatzdelikt bisher Kriterien der objektiven Zurechnung grds. nicht<br />
berücksichtigt 243 , ist die Wissenschaft noch dabei, eine systematisch<br />
geschlossene Lehre herauszubilden.<br />
a) Die herrschende Lehre<br />
154<br />
Die h. L. fragt in einem ersten Schritt danach, ob der Täter ein Risiko in<br />
rechtlich missbilligter Weise geschaffen, und in einem zweiten Schritt danach,<br />
ob sich dieses Risiko im tatbestandsmäßigen Erfolg realisiert hat. 244 Ersteres<br />
wird verneint beim Fehlen einer rechtlichen Missbilligung des Risikos 245 (ein<br />
Bauer schickt den Knecht ins Gewitter) bzw. im Falle der Risikoverringerung 246<br />
(Jemand lenkt den Schlag gegen den Kopf auf den Arm ab). Letzteres wird<br />
verneint, wenn der Erfolg jenseits des Schutzzweckes der Norm liegt 247 , wegen<br />
des Verhaltens anderer der Regress zum Täter verboten ist 248 , ein atypischer<br />
Kausalverlauf vorliegt 249 , bzw. dem Täter eine rechtmäßige Alternative fehlt. 250<br />
Einzelheiten sind hier str.<br />
242<br />
243<br />
244<br />
245<br />
246<br />
247<br />
248<br />
249<br />
250<br />
Deutlich so Wessels/Beulke, AT, Rn. 176 f.; zust. Frister, AT, 10/1.<br />
Dazu: Kahlo, in: Küper-FS, S. 249 (255 f.).<br />
Frister, AT; 10/2; Jescheck/Weigend, AT, § 28 IV. m. w. N.<br />
Wessels/Beulke, AT, Rn. 176 f., 183 f.<br />
Frister, AT, 10/5; Jescheck/Weigend, AT, § 28 IV. 1.<br />
BGHSt. 33, 61 (Geschwindigkeitsüberschreitung).<br />
BGHSt. 32, 262 (Verleihen einer Heroinspritze); HansOLG Rostock, NStZ 2001, S. 199 m. Anm.<br />
Geppert, JK 2001, StGB § 13/32.<br />
Wessels/Beulke, AT, Rn. 196.<br />
BGHSt. 11, 1 (7). Nicht selten wird diese Figur auf Fahrlässigkeitsdelikte beschränkt, freilich ohne<br />
dies eindeutig zu kennzeichnen, z. B. Wessels/Beulke, AT, Rn. 197-199a.<br />
54
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
Für die h. L. spricht zwar, dass sie über die Pflichtwidrigkeit des<br />
erfolgsursächlichen Verhaltens hinaus nach einem spezifischen Zusammenhang<br />
zwischen Handlung und Erfolg sucht. Ihr gelingt es aber nicht, diesen<br />
Zusammenhang positiv zu definieren 251 und verliert sich daher in einer offenen<br />
Kasuistik von Ausschlussgründen. Letztlich bleibt es dann aber dabei, dass<br />
jedes gegen ein abstraktes Gefährdungsverbot verstoßende Setzen einer<br />
notwendigen Bedingung für den Erfolg als <strong>Tatbestand</strong>sverwirklichung<br />
angesehen wird, soweit nicht eine der eben genannten Fallgruppen vorliegt.<br />
155<br />
b) Kritische Stimmen<br />
Gegen die h. L. wird eingewandt, die Lehre von der objektiven Zurechnung sei<br />
beim Vorsatzdelikt überflüssig. Es handele sich einesteils um Fragen der<br />
<strong>Tatbestand</strong>sauslegung (nicht missbilligte Risiken), der Rechtfertigung (Risikoverringerung)<br />
oder des vorsatzausschließenden Irrtums (alle übrigen Fallgruppen).<br />
252<br />
Zutreffend an diesem Ansatz ist das Bemühen, die Fallgruppen der herrschenden<br />
Kasuistik durch systematische Dogmatik nach geordneten Prinzipien<br />
zu entscheiden. Hinsichtlich der ersten beiden Fallgruppen überzeugt<br />
die Lösung auch. Demgegenüber fällt der Befund im Übrigen zu undifferenziert<br />
aus. Schon die §§ 25-27 StGB zeigen an, dass nicht alle diese Konstellationen<br />
als Vorsatzprobleme angemessen gelöst werden können.<br />
156<br />
157<br />
c) Eigene Auffassung<br />
Eine systematisch geschlossene Lösung lässt sich erreichen, wenn man den<br />
Ansatz der h. L. umkehrt. Statt zunächst jedes auch noch so entfernt<br />
erfolgsursächliche Verhalten daraufhin zu untersuchen, ob es gegen<br />
irgendeine rechtliche Verhaltensanweisung verstößt, ist dasjenige Verhalten<br />
des Täters zum Ausgangspunkt zu nehmen, das unmittelbar zur<br />
<strong>Tatbestand</strong>sverwirklichung führt. Daraus ergibt sich:<br />
aa) Verwirklicht jemand alle Merkmale des objektiven <strong>Tatbestand</strong>es unabhängig<br />
vom Verhalten anderer in eigener Person, ist es nach seinem äußeren Erscheinungsbild<br />
ausschließlich individuelles Werk des Täters. Führt das Handeln<br />
des Täters ohne weitere Zwischenakte (d. h. unmittelbar) zur Verwirklichung<br />
des <strong>Tatbestand</strong>es (der Messerstich führt zum Verbluten), dann ist die<br />
objektive Zurechnung ohne weiteres zu bejahen. 253<br />
158<br />
159<br />
251<br />
252<br />
253<br />
So Renzikowski, GA 2007, S. 560 (573).<br />
Armin Kaufmann, Jescheck-FS, 1985, S. 251 ff.; vgl. w. Kühl, AT, § 4 Rn. 42; Maiwald, in:<br />
Miyazawa-FS, S. 465 (478 ff.).<br />
Genauso Frister, AT 10/3.<br />
55
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
160<br />
161<br />
162<br />
163<br />
164<br />
bb) Geht der Eintritt des Erfolges dagegen unmittelbar auf das Verhalten des<br />
Opfers bzw. das Dritter zurück, bedarf die objektive Zurechnung besonderer<br />
Begründung. Hier kann ein Regressverbot eingreifen.<br />
(1) Liegt ein Fall freiverantwortlicher Selbstgefährdung vor, ist der Erfolg grds.<br />
alleiniges Werk des Opfers. 254 Diese Fallgruppe ist auch in der Rspr. anerkannt.<br />
255<br />
(2) Gleiches gilt, wenn der Eintritt des Erfolges unmittelbar auf einem eigenverantwortlichen<br />
Dazwischentreten eines Dritten beruht. 256<br />
Ein Teil der Literatur verneint die objektive Zurechnung darüber hinaus auch<br />
beim Vorsatzdelikt, wenn der Täter auf das rechtmäßige Verhalten anderer<br />
hätte vertrauen dürfen. 257 Auch diese Problematik lässt sich ebenfalls am besten<br />
im Rahmen der Prüfung des Vorsatzes behandeln. Geht der Täter nämlich<br />
ernsthaft davon aus, dass sein Handeln möglicherweise erst zusammen mit<br />
dem (fahrlässigen) Handeln eines Dritten zum Erfolg führt, kann er sich auf<br />
Vertrauen nicht berufen. 258<br />
(3) Eine Ausnahme zum Regressverbot greift dagegen, wenn der Täter von<br />
Rechts wegen dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt. Dies ist zum<br />
einen dann der Fall, wenn der Täter die Selbstgefährdung des Opfers seinerseits<br />
veranlasst hat und das Recht das Opfer gerade auch vor solchen Veranlassungen<br />
schützen will. 259 Zum anderen gestatten die § 25 I 2. Alt. u. II, §§ 26<br />
f. StGB in differenzierter Weise die Zurechnung fremden Unrechttuns. Dies ist<br />
Bestandteil der Beteiligungslehre (s. u. Rn. 516 ff.).<br />
(4) Wird der Erfolg unmittelbar erst durch ein (fahrlässiges) Handeln des Täters<br />
bewirkt, das seinem vorausgegangenen (vorsätzlichen) Handeln unvorhergesehen<br />
nachfolgt, dann ist der Erfolg grundsätzlich nicht durch das zeitlich erste<br />
Handeln ins Werk gesetzt worden. Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn<br />
das zeitlich erste Handeln das ihm nachfolgende Handeln provoziert. 260<br />
254<br />
255<br />
256<br />
257<br />
258<br />
259<br />
260<br />
LPK-StGB/Kindhäuser, § 13 Rn. 118 f. m. w. N.; vgl. w. Frister, AT, 10/15 f.; Wessels/Beulke, AT,<br />
Rn. 187 ff. m. w. N.<br />
BGHSt. 32, 262 (265) (Heroinspritze); BGH, NStZ 1985, S. 25 (26); 2001, S. 205.<br />
BGH MDR 1956, S. 526; BGH, NJW 1966, S. 1823; näher: Köhler, AT, S. 145 f.; Roxin, AT I § 24<br />
Rn. 28 ff. m. w. N.; krit. Frister, AT 10/13.<br />
Näher Jakobs, AT, Rn. 7/51 ff.<br />
Im Ergebnis zutreffend: BGHSt. 2, 20 (24); 7, 118 (122); 30, 228 (232) m. w. N.; vgl. w. Köhler, AT,<br />
S. 148; krit. auch Frister, AT, 10/11 f.; 10/26.<br />
Vgl. BGHSt. 37, 179 (Heroinverkauf) m. zust. Anm. Beulke/Schröder, NStZ 1991, S. 393; Otto, Jura<br />
1991, S. 443; Rudolphi, JZ 1991, S. 972; abl. Anm. Hohmann, MDR 1991, S. 1117; zust. Frister,<br />
AT, 10/17; krit. Roxin, AT I § 11 Rn. 115 ff. m. w. N.; vgl. w. BGHSt. 39, 322 (Brandretter) m. zust.<br />
Anm. Amelung, NStZ 1994, S. 338; Sowada, JZ 1994, S. 663; krit. Anm. Alwart, NStZ 1994, S. 84;<br />
Bernsmann/Zieschang, JuS 1995, 775; K. Günther, StV 1995, S. 78;zust. auch Frister, AT, 10/18;<br />
10/28.<br />
Vgl. den Jauchegrubenfall: BGHSt. 14, 193, wo die Frage freilich als Vorsatzproblem aufgeworfen<br />
wird, dagegen treffend Frister, AT; 11/52-54.<br />
56
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
cc) Zum Dritten folgt aus dem Vorstehenden die Irrelevanz hypothetischer Ersatzursachen<br />
(Fallgruppe überholender und überholter Kausalität, s. o. Rn.<br />
112). Zwar behauptet eine Mindermeinung das Gegenteil. Wenn das Gut verloren<br />
sei, fehle der Erfolgszurechnung der hinreichende Grund. 261 Doch wird<br />
dem heute zu Recht entgegen gehalten, ein Rechtsgut verliere seine rechttliche<br />
Garantie nicht dadurch, dass es dem Untergang geweiht sei. Niemand darf<br />
dem Verhungernden vergiftete Speisen vorsetzen. 262 M. a. W.: Dass auch andere<br />
dem Opfer nach dem Leben trachten, hindert es nicht, denjenigen als<br />
Täter anzusehen, der es wirklich getötet hat. Der Tod bleibt auch dann allein<br />
sein Werk. Wegen der hypothetischen Ersatzursache ist freilich der Bestand<br />
des Rechtsguts hinfällig. Das nähert das Unrecht hier dem (untauglichen) Versuch<br />
an. Daher ist bei der Strafrahmenwahl die analoge Anwendung der §§ 23<br />
I, 49 I StGB zu erwägen. 263<br />
dd) Schließlich sind die Fälle der Risikokonkurrenz zu entscheiden. 264 Hier<br />
kehren die Fallgruppen der kumulativen und der alternativen Kausalität (s. o.<br />
Rn. 111, 113 ff.) wieder.<br />
Zum Teil wird hier vertreten, bei kumulativer Kausalität sei bei beiden Tätern,<br />
soweit sie ohne Wissen vom Verhalten des anderen handelten, die objektive<br />
Zurechnung des Erfolges zu verneinen, während sie bei alternativer Kausalität<br />
zu bejahen sei. 265 Das ist inkonsequent: Da bei alternativer Kausalität beide<br />
Ursachen sich objektiv ex post teils gegenseitig hemmen, so auf nur notwendige<br />
Beziehungen reduzieren, teils als solche den Erfolg aber bedingen, handelt<br />
es sich bei ihnen dem wirklichen Verlauf nach ebenfalls lediglich um kumulative<br />
Kausalität. 266<br />
Richtig ist daher: Sowohl bei kumulativer als auch bei alternativer Kausalität<br />
entscheidet sich die Frage der objektiven Zurechnung nach dem Handlungszeitpunkt.<br />
Derjenige, der zuletzt handelt, dessen Handeln setzt wegen der bereits<br />
zuvor gesetzten anderen Bedingung nicht nur eine notwendige, sondern<br />
auch eine hinreichende Bedingung für die Realisierung der geschaffenen Gefahr<br />
im Erfolg. So hängt es objektiv allein von ihm ab, ob der Erfolg eintritt. Bei<br />
ihm ist daher die objektive Zurechnung in beiden Fällen zu bejahen, wie sie bei<br />
dem Ersthandelnden beide Male grundsätzlich zu verneinen ist. 267 Denn dieser<br />
führt den Erfolgseintritt gerade nicht unmittelbar herbei. Handeln schließlich<br />
beide gleichzeitig und gefährdet das Handeln von jedem je für sich unmittelbar<br />
165<br />
166<br />
167<br />
168<br />
261<br />
262<br />
263<br />
264<br />
265<br />
266<br />
267<br />
Grundlegend Arthur Kaufmann, in: Eb. Schmidt-FS, 1961, S. 200 (229).<br />
Jakobs, AT, Rn. 7/92, 97.<br />
Jakobs, AT, Rn. 7/74 f. m. w. N.<br />
Näher dazu: Jakobs, AT, Rn. 7/72 ff.; Köhler, AT, S. 145 f.<br />
So etwa Murmann, S. 183.<br />
Zutreffend insoweit: Arthur Kaufmann, in: Eb. Schmidt FS, 1961, S. 200 ff.<br />
So Köhler, AT, S. 145 f. Offen bleibt beim Ersthandelnden die Zurechnung über die §§ 25 I, 2. Alt.,<br />
II, 26 f. StGB.<br />
57
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
169<br />
170<br />
171<br />
172<br />
den durch den Straftatbestand geschützten Rechtsgutsträger, dann ist der<br />
Erfolg beiden objektiv zurechenbar.<br />
Ausnahmsweise ist die objektive Zurechnung zum Ersthandelnden dennoch zu<br />
bejahen, wenn er das Handeln des Letzthandelnden veranlasst hat und das<br />
Recht das Opfer gerade auch vor solchen Veranlassungen schützen will (s. o.<br />
Rn. 163).<br />
ee) Zwar ist der Erfolg auch dann nicht alleiniges Werk des Täters, wenn es<br />
Werk der Natur ist. Dementsprechend verneint ein Teil der Literatur (schon) die<br />
objektive Zurechnung, wenn der schädigende Kausalverlauf zum Zeitpunkt des<br />
Handelns (objektiv ex ante) nach allgemeiner Lebenserfahrung höchst unwahrscheinlich<br />
gewesen ist (atypischer Kausalverlauf). 268 Doch handelt es sich hier<br />
recht besehen um ein Vorsatzproblem.<br />
Für die Einordnung als Fallgruppe objektiver Zurechnung spricht zwar, dass<br />
das Bewirken von etwas Unvorhersehbarem bei niemandem als dessen Werk<br />
angesehen wird. Gleichwohl ist dieser Maßstab zu unpräzise. Als bloß quantitative<br />
Größe kann er zur qualitativen Scheidung von Recht und Unrecht keine<br />
Gewissheit beitragen. In der Praxis sind zudem die Fälle selten, in denen etwas<br />
ex post Erkennbares ex ante als unerkennbar anzusehen ist. Handhabbar<br />
wäre der Maßstab nur, wenn man ihn auf Fälle beschränkt mit bisher unerkannten<br />
Mängeln oder Dispositionen (z. B. eine bisher nicht bekannte Häufung<br />
von Nierenkrankheiten beim Opfer). Doch hängt der Umstand, ob etwas bisher<br />
unerkannt geblieben ist, davon ab, ob auch der Täter selbst es bisher nicht<br />
erkannt hat. Folglich geht es darum, ein etwaiges Sonderwissen des Täters<br />
über das Tatgeschehen zu berücksichtigen. 269 Diese Frage beantwortet sich<br />
am rationellsten im Rahmen der Prüfung des Vorsatzes.<br />
ff) Von Rechts wegen scheint sich der Eintritt eines Erfolges zwar auch dann<br />
nicht dem Täter zurechnen zu lassen, wenn dieser keine rechtmäßige Alternative<br />
hatte. Diese Figur findet bei Vorsatzdelikten jedoch ihre angemessene<br />
Berücksichtigung in der Prüfung des subjektiven <strong>Tatbestand</strong>es. Nimmt der<br />
Täter hin, dass auf seine Wahl der riskanteren Alternative (Unterschreiten des<br />
zulässigen Seitenabstandes) der Erfolg eintreten kann, dann ist am Vorsatz<br />
nicht zu zweifeln. Weiß er dagegen nicht, dass die Wahl der riskanteren Alternative<br />
die Wahrscheinlichkeit des Erfolgsverwirklichung erhöht, liegt ein Tatumstandsirrtum<br />
vor, § 16 I 1 StGB. Geht er zutreffend von einer Alternative<br />
gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit aus, ist dies ein Fall der Pflichtenkollision.<br />
Ein Teil der Lehre beschränkt daher diese Figur zu Recht auf Fahrlässigkeitsdelikte.<br />
268<br />
269<br />
So Köhler, AT, S. 144 f.<br />
Vgl. die Kritik von Struensee, JZ 1989, S. 53 (59 f.); zust. Frister, AT 10/34 f.<br />
58
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
gg) Ähnlich liegt es bei der Frage nach dem Schutzzweck der Norm. Wird diese<br />
Figur eng gefasst 270 , geht es darum, bestimmte abstrakte Gefährdungsverbote<br />
(z. B. der StVO) auf Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Rechtsgutsverletzungen<br />
zuzuschneiden. 271 Diese Überlegungen haben nur im Rahmen von<br />
Fahrlässigkeitsdelikten einen Sinn. 272 Fährt dagegen jemand gerade zu dem<br />
Zweck zu schnell, um zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einen<br />
Unfall zu verursachen, dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass er den<br />
<strong>Tatbestand</strong> des Vorsatzdeliktes erfüllt. Wird diese Figur dagegen weit verstanden<br />
273 , bezieht man Fälle mit ein, die hier im Rahmen des Regressverbotes<br />
erörtert worden sind.<br />
hh) Nach einem Teil der Literatur ist in den Fällen der Risikoverringerung, in<br />
denen der Täter eine bereits bestehende Gefahr in ihrer Wirkung abmildert (z.<br />
B. einen Schlag auf den Kopf an die Schulter ablenkt), ebenfalls die objektive<br />
Zurechnung zu verneinen. 274 Dies ist fraglich. Die verbleibende Wirkung ist<br />
Werk des Zuletzthandelnden. Die Lösung ist auf anderer Ebene zu suchen: bei<br />
der (tatbestandsausschließenden) Einwilligung oder der Rechtfertigung aufgrund<br />
von mutmaßlicher Einwilligung oder rechtfertigenden Notstandes. 275<br />
173<br />
174<br />
d) Fallsammlung zur objektiven Zurechnung<br />
Fall 1<br />
A traf im April 1983 den H, mit dem er befreundet war. H sagte dem A, er habe<br />
Heroin, das man zusammen „drücken“ könne. Daraufhin entschloss sich der A,<br />
die nötigen Spritzen zu besorgen. Zwei Spritzen übergab er dem H, der sie mit<br />
einer aufgekochten Heroinlösung füllte. A und H setzten sich die Spritzen und<br />
fielen beide in Ohnmacht. Als A wieder aufwachte, war der H bereits an Atemstillstand<br />
und Herzkreislaufversagen verstorben (BGHSt. 32, 262-<br />
Heroinspritze).<br />
Lösungshinweis: siehe Rn. 161<br />
Fall 2<br />
A hatte an den O Heroin verkauft. Dieser hatte sich das Rauschgift gespritzt<br />
und war daran verstorben (BGHSt. 37, 179-Heroinverkauf).<br />
Lösungshinweis: siehe Rn. 163.<br />
270<br />
271<br />
272<br />
273<br />
274<br />
275<br />
Wessels/Beulke, AT, Rn. 182.<br />
Vgl. RGSt. 63, 392; BGHSt. 33, 61.<br />
Vgl. Jescheck/Weigend, AT, § 28 IV. 4. a. E.<br />
Jescheck/Weigend, AT, § 28 IV. 4. a. E.<br />
Dazu: Wessels/Beulke, AT, Rn. 193 ff.<br />
So Köhler, AT, S. 147 f.;zust. Kahlo, in: Küper-FS, S. 249 (269 Fn. 91).<br />
59
§ 3 <strong>Tatbestand</strong>slehre<br />
Fall 3<br />
Der T betrieb ein Bordell. Der Bäcker B lieferte dem T Brötchen für das Buffet<br />
der Gäste. Dem B war bekannt, dass der T die Backwaren für die Bordellbewirtung<br />
brauchte (RGSt. 39, 44).<br />
Lösungshinweis: vgl. Rn. 162.<br />
Fall 4<br />
Wie 3, nur war der B ein Spirituosenhändler, der den T mit alkoholischen Getränken<br />
belieferte.<br />
Lösungshinweis: vgl. Rn. 162 f.<br />
Fall 5<br />
Die Bäuerin B geriet mit ihrer Nachbarin N in Streit. Um die N zu ersticken,<br />
stopfte die B der N eine Handvoll Sand in den Mund. Darauf ging die N bewusstlos<br />
zu Boden. Die B ging davon aus, dass die N tot sei. In Wahrheit lebte<br />
sie aber noch. Um die vermeintliche Leiche zu verstecken, warf die B die N in<br />
eine Jauchegrube. Dort ertrank die N (BGHSt. 14, 193-Jauchegrube).<br />
Lösungshinweis: eingehende Lösung siehe Rn. 183. Vgl. ferner Rn. 164, 180.<br />
B. Subjektiver <strong>Tatbestand</strong> (Vorsatz)<br />
175<br />
176<br />
1. Allgemeines<br />
Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, ist nur vorsätzliches Handeln (s. u.<br />
Rn. 176) tatbestandsmäßig. Fehlt es daran, ist ein objektiv tatbestandsmäßiges<br />
Verhalten allenfalls dann strafbar, wenn es fahrlässig ins Werk gesetzt wurde<br />
und das Gesetz die Strafbarkeit ausdrücklich anordnet, § 15 StGB. Umgekehrt<br />
erweitert das Gesetz in vielen Vorschriften den subjektiven <strong>Tatbestand</strong> über die<br />
Kenntnis der Tatumstände hinaus auf weitere subjektive <strong>Tatbestand</strong>smerkmale<br />
(z. B. in §§ 242 I, 267 I StGB). Ihr Vorliegen ist der Sache nach genauso zu<br />
prüfen wie der Vorsatz beim Versuch (s. u. Rn. 467 ff.).<br />
a) Vorsatzbegriff<br />
Wie dargelegt, bedarf es schließlich der intellektuellen Herrschaft des Täters<br />
über das objektiv tatbestandsmäßige Geschehen, damit dies Ausdruck der<br />
Geltungsanmaßung ist, dass das angegriffene Rechtsgut nach dem Willen des<br />
Täters nicht mehr sein soll. Hierzu muss der Täter von der Möglichkeit der <strong>Tatbestand</strong>sverwirklichung<br />
gewusst haben und dieses Wissen sich in seinem Willen<br />
zu Eigen gemacht haben. Eingebürgert hat sich die (Faust-) Formel vom<br />
60