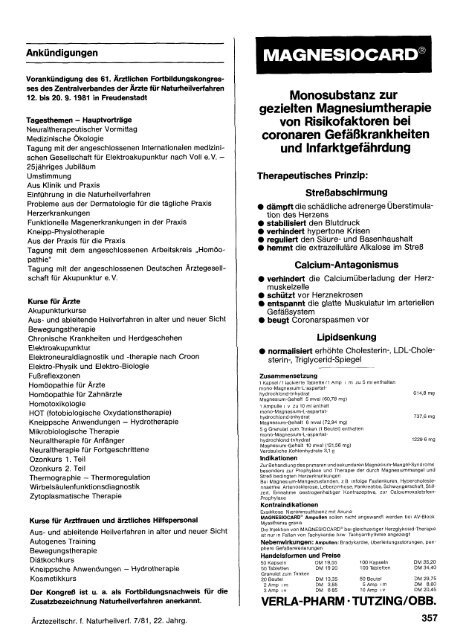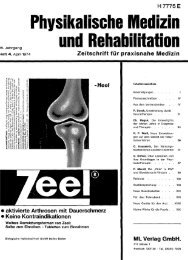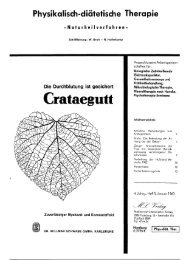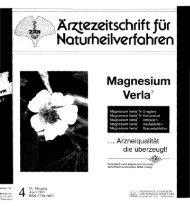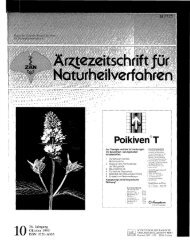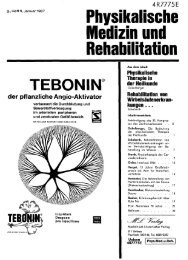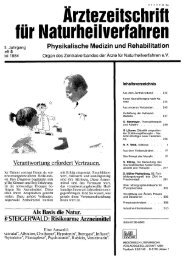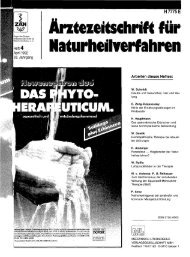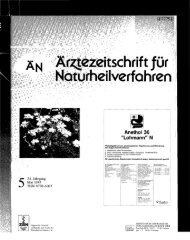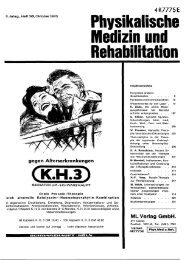Gesamte Ausgabe runterladen - Zentralverband der Ärzte für ...
Gesamte Ausgabe runterladen - Zentralverband der Ärzte für ...
Gesamte Ausgabe runterladen - Zentralverband der Ärzte für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ankündigungen<br />
MAGNESIOCARD<br />
Vorankündigung des 61. Ärztlichen Fortbildungskongresses<br />
des <strong>Zentralverband</strong>es <strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren<br />
12. bis 20. 9. 1981 in Freudenstadt<br />
Tagesthemen - Hauptvorträge<br />
Neuraltherapeutischer Vormittag<br />
Medizinische Ökologie<br />
Tagung mit <strong>der</strong> angeschlossenen Internationalen medizinischen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Elektroakupunktur nach Voll e.V. -<br />
25jähriges Jubiläum<br />
Umstimmung<br />
Aus Klinik und Praxis<br />
Einführung in die Naturheilverfahren<br />
Probleme aus <strong>der</strong> Dermatologie <strong>für</strong> die tägliche Praxis<br />
Herzerkrankungen<br />
Funktionelle Magenerkrankungen in <strong>der</strong> Praxis<br />
Kneipp-Physiotherapie<br />
Aus <strong>der</strong> Praxis <strong>für</strong> die Praxis<br />
Tagung mit dem angeschlossenen Arbeitskreis „Homöopathie"<br />
Tagung mit <strong>der</strong> angeschlossenen Deutschen <strong>Ärzte</strong>gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Akupunktur e.V.<br />
Kurse <strong>für</strong> <strong>Ärzte</strong><br />
Akupunkturkurse<br />
Aus- und ableitende Heilverfahren in alter und neuer Sicht<br />
Bewegungstherapie<br />
Chronische Krankheiten und Herdgeschehen<br />
Elektroakupunktur<br />
Elektroneuraldiagnostik und -therapie nach Croon<br />
Elektro-Physik und Elektro-Biologie<br />
Fußreflexzonen<br />
Homöopathie <strong>für</strong> <strong>Ärzte</strong><br />
Homöopathie <strong>für</strong> Zahnärzte<br />
Homotoxikologie<br />
HOT (fotobiologische Oxydationstherapie)<br />
Kneippsche Anwendungen - Hydrotherapie<br />
Mikrobiologische Therapie<br />
Neuraltherapie <strong>für</strong> Anfänger<br />
Neuraltherapie <strong>für</strong> Fortgeschrittene<br />
Ozonkurs 1. Teil<br />
Ozonkurs 2. Teil<br />
Thermographie - Thermoregulation<br />
Wirbelsäulenfunktionsdiagnostik<br />
Zytoplasmatische Therapie<br />
Kurse <strong>für</strong> Arztfrauen und ärztliches Hilfspersonal<br />
Aus- und ableitende Heilverfahren in alter und neuer Sicht<br />
Autogenes Training<br />
Bewegungstherapie<br />
Diätkochkurs<br />
Kneippsche Anwendungen - Hydrotherapie<br />
Kosmetikkurs<br />
Der Kongreß ist u. a. als Fortbildungsnachweis <strong>für</strong> die<br />
Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren anerkannt.<br />
Monosubstanz zur<br />
gezielten Magnesiumtherapie<br />
von Risikofaktoren bei<br />
coronaren Gefäßkrankheiten<br />
und Infarktgefährdung<br />
Therapeutisches Prinzip:<br />
Streßabschirmung<br />
• dämpft die schädliche adrenerge Überstimulation<br />
des Herzens<br />
• stabilisiert den Blutdruck<br />
• verhin<strong>der</strong>t hypertone Krisen<br />
• reguliert den Säure- und Basenhaushalt<br />
• hemmt die extrazelluläre Alkalose im Streß<br />
Calcium-Antagonismus<br />
• verhin<strong>der</strong>t die Calciumüberladung <strong>der</strong> Herzmuskelzelle<br />
• schützt vor Herznekrosen<br />
• entspannt die glatte Muskulatur im arteriellen<br />
Gefäßsystem<br />
• beugt Coronarspasmen vor<br />
Lipidsenkung<br />
• normalisiert erhöhte Cholesterin-, LDL-Cholesterin-,<br />
Triglycerid-Spiegel<br />
Zusammensetzung<br />
1 Kapsel/1 lackierte Tablette /1 Amp i m zu 5 ml enthalten<br />
mono-Magnesium-L-aspartathydrochlond-tnhydrat<br />
614,8 mg<br />
Magnesium-Gehalt 5 mval (60,78 mg)<br />
1 Ampulle i v zu 10 ml enthalt<br />
mono-Magnesium-L-aspartathydrochlond-tnhydrat<br />
737,6 mg<br />
Magnesium-Gehalt 6 mval (72,94 mg)<br />
5 g Granulat zum Trinken (1 Beutel) enthalten<br />
mono-Magnesiurn-L-aspartathydrochlond-tnhydrat<br />
1229 6 mg<br />
Magnesium-Gehalt 10 mval (121,56 mg)<br />
Verdauliche Kohlenhydrate 3,1 g<br />
Indikationen<br />
Zur Behandlung des primären und sekundären Magnesium-Mangel-Syndroms<br />
beson<strong>der</strong>s zur Prophylaxe und Therapie <strong>der</strong> durch Magnesiummangel und<br />
Streß bedingten Herzerkrankungen<br />
Bei Magnesium-Mangelzustanden, zB infolge Fastenkuren, Hypercholestennaemie<br />
Artenosklerose, Leberzirrhose, Pankreatitis, Schwangerschaft, Stillzeit,<br />
Einnahme oestrogenhaltiger Kontrazeptiva, zur Calciumoxalatstein-<br />
Prophylaxe<br />
Kontraindikationen<br />
Exsikkose Niereninsuffizienz mit Anune<br />
MAGNESIOCARD" Ampullen sollen nicht angewandt werden bei AV-Block<br />
Myasthenia gravis<br />
Die Injektion von MAGNESIOCARD" bei gleichzeitiger Herzglykosid-Therapie<br />
ist nur in Fallen von Tachykardie bzw Tachyarrhythmie angezeigt<br />
Nebenwirkungen: Ampullen: Bradykardie, Uberleitungsstorungen, periphere<br />
Gefaßerweiterungen<br />
Handelsformen und Preise<br />
50 Kapseln<br />
50 Tabletten<br />
Granulat zum Trinken<br />
20 Beutel<br />
2 Amp i m<br />
3 Amp i v<br />
DM 19,55<br />
DM 19 20<br />
DM 13,35<br />
DM 3,85<br />
DM 6 85<br />
100 Kapseln<br />
100 Tabletten<br />
50 Beutel<br />
5 Amp i m<br />
10 Amp iv<br />
DM 35,20<br />
DM 34,40<br />
DM 29,75<br />
DM 8,60<br />
DM 20,45<br />
VERLA-PHARM • TUTZING/OBB.<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg. 357
Anfragen wegen des 61. Ärztlichen Fortbildungskurses richten<br />
Sie bitte an:<br />
<strong>Zentralverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren e.V.<br />
- Geschäftsstelle -<br />
Eichelbachstraße 61, 7290 Freudenstadt - Kniebis,<br />
Telefon (07442) 2111.<br />
Internationaler Kongreß über Akupunktur in Praxis und<br />
Forschung zum 30jährigen Bestehen <strong>der</strong> Deutschen <strong>Ärzte</strong>gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Akupunktur e.V.<br />
Ort: Kur<strong>für</strong>stliches Schloß Mainz<br />
30.9. bis 3.10.1981<br />
Praktische Akupunkturkurse im Anschluß an den Kongreß<br />
3. und 4.10.1981<br />
Veranstalter: Deutsche <strong>Ärzte</strong>gesellschaft <strong>für</strong> Akupunktur e.V.<br />
Mitveranstalter: Institut <strong>für</strong> Anästhesiologie <strong>der</strong> Johannes-<br />
Gutenberg-Universität Mainz (Prof. Dr. Frey)<br />
Kongreßsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch (Simultanübersetzung)<br />
Hauptthemen:<br />
A. Zur Wirkungsweise <strong>der</strong> Akupunktur<br />
B. Grundlagenforschungen zur Akupunktur<br />
C. Therapeutische Anwendung <strong>der</strong> Akupunktur<br />
D. Traditionelle chinesische Medizin<br />
Anmeldung:<br />
1. Kongreßsekretariat c/o Prof. Dr. med. R. Frey, Institut <strong>für</strong><br />
Anästhesiologie <strong>der</strong> Universität, Langenbeckstraße 1,<br />
D-6500 Mainz, Tel. 061 31/19-21 68<br />
2. Deutsche <strong>Ärzte</strong>gesellschaft <strong>für</strong> Akupunktur e.V., Silberbachstraße<br />
10, D-7800 Freiburg, Tel. 0761/7 7940<br />
Fortbildungsarbeit <strong>der</strong> Gesellschaft <strong>für</strong> Neurotherapie in<br />
Frankfurt <strong>für</strong> 1981:<br />
24. 10./25. 10. 1981:<br />
Therapeutische Lokalanästhesie <strong>für</strong> Fortgeschrittene (Anästhesie<br />
<strong>der</strong> Ganglien im Kopf-, Hals-, Brust-, Bauch- und<br />
Leinsaat-<br />
Honig-<br />
Granulat<br />
zum Einnehmen<br />
Indikationen: Zur Vorbeugung<br />
gegen Eiweißmangel,<br />
Mangel an hochungesättigten<br />
Fettsäuren,<br />
zur Funktionspflege von<br />
Leber, Galle sowie Magen<br />
und Darm. Zur Vorbeugung<br />
gegen Obstipation (Stuhlverstopfung).<br />
Kontraindikationen:<br />
Nicht anzuwenden bei Heus<br />
(Darmverschluß). Diabetiker<br />
beachten bitte die auf <strong>der</strong><br />
Packung angegebenen<br />
BE.<br />
Zusammensetzung:<br />
In 100 g Granulat sind enthalten:<br />
67 g Leinsamen,<br />
DAB 7, gequetscht, 13,5 g<br />
fettfreies Milchpulver mit<br />
hohem Anteil an wertvollem<br />
Eiweiß und Milchzucker,<br />
Bienenhonig q. s.<br />
Dosierung: Falls vom<br />
Arzt nicht an<strong>der</strong>s verordnet,<br />
nehmen Erwachsene<br />
3 x täglich bis zu 3 Eßlöffeln<br />
in Obstsaft, Milch,<br />
Wasser o<strong>der</strong> zusammen<br />
mit den Mahlzeiten. Kin<strong>der</strong><br />
über 10 Jahre nehmen<br />
die Hälfte.<br />
Handelsformen u. Preis:<br />
Stand Juli 1979,<br />
OP zu 250 g DM 4,65<br />
Erhältlich in Apotheken -<br />
rezeptfrei<br />
Hersteller<br />
FLUGGE-DIAT • Nagoldstr. 57<br />
7000 Stuttgart 50 Munster<br />
Beckenbereich, Periduralanästhesie, Kaudalanästhesie).<br />
Ort: (abweichend von den an<strong>der</strong>en Seminaren)<br />
Maingau-Krankenhaus, Frankfurt/Main<br />
(begrenzte Teilnehmerzahl)<br />
28. 11./29. 11. 1981:<br />
Neurotherapie chronischer Schmerzzustände (Akupunktur,<br />
Chirotherapie, therapeutische Lokalanästhesie, physikalische<br />
Therapie, medikamentöse Therapie, Psychotherapie).<br />
Ort (<strong>für</strong> alle Seminare):<br />
Euro-Crest-Hotel, Frankfurt/Main, Isenburger Schneise 40,<br />
6000 Frankfurt 71<br />
Anmeldung und nähere Information durch:<br />
Sekretariat Dr. D. Gross, Gesellschaft <strong>für</strong> Neurotherapie,<br />
Nie<strong>der</strong>rä<strong>der</strong> Landstr. 58, 6000 Frankfurt/Main 71; Telefon<br />
(0611) 67 7244<br />
Preisausschreiben<br />
Preis des „Deutschen Verbandes langlaufen<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> e.V."<br />
Der „Deutsche Verband langlaufen<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> e.V." verleiht<br />
jährlich <strong>für</strong> eine hervorragende sportmedizinische Arbeit<br />
auf dem Gebiet des Langstreckenlaufes den „van Aaken-<br />
Preis".<br />
Ziel dieses Preises ist die För<strong>der</strong>ung langstreckenlaufbezogener<br />
wissenschaftlicher Arbeiten.<br />
Die Höhe des Preises, <strong>der</strong> nur ausnahmsweise teilbar ist,<br />
beträgt 2000,- DM. Jede in deutscher Sprache eingereichte<br />
Arbeit, die möglichst einen Umfang von 25 Schreibmaschinenseiten<br />
nicht überschreiten soll, kann vom „Deutschen<br />
Verband langlaufen<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> e. V." veröffentlicht werden.<br />
Die Bewerber werden gebeten, ihre Arbeiten bis zum 31.<br />
3. 1982 in sechsfacher Ausfertigung bei Herrn Rechtsanwalt<br />
Benning, Prinzregentenstraße 1, D-8900 Augsburg,<br />
einzureichen, Tel.: 0821/33525. Anfragen, die den Preis<br />
betreffen, sind ebenfalls an diese Adresse zu richten. Die<br />
Arbeiten und ein kurzes beigefügtes Autoreferat sollen ohne<br />
Namensvermerk o<strong>der</strong> Hinweis auf den Autor sein. Name<br />
und Anschrift des Bewerbers sollen in einem verschlossenen<br />
Umschlag dem Manuskript beigefügt werden.<br />
Die Preisträger werden in einer Veranstaltung des „Deutschen<br />
Verbandes langlaufen<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> e.V." geehrt.<br />
Preis <strong>der</strong> Deutschen Therapiewoche 1981<br />
Das Kuratorium <strong>der</strong> Deutschen Therapiewoche, die Stadt<br />
Karlsruhe und die Karlsruher pharmazeutischen Firmen<br />
Dr. Willmar Schwabe und Pfizer GmbH stiften zum 33. Therapiekongreß<br />
wie<strong>der</strong>um einen<br />
„Preis <strong>der</strong> Deutschen Therapiewoche".<br />
Ziel des Preises ist die För<strong>der</strong>ung therapiebezogener wissenschaftlicher<br />
Arbeiten. Aus ihnen soll die erfolgreiche<br />
Umsetzung von wissenschaftlichen Grundlagen, Erkenntnissen<br />
o<strong>der</strong> originellen Beobachtungen in - nach dem<br />
Stand <strong>der</strong> Wissenschaft - rationell begründete und methodisch<br />
einwandfreie therapeutische Maßnahmen (insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> medikamentösen Therapie) hervorgehen.<br />
358 <strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.
Prämiert werden können nur Arbeiten, die bis zum Termin<br />
<strong>der</strong> Preisverleihung noch bei keinem an<strong>der</strong>en Preisausschreiben<br />
teilgenommen haben, die we<strong>der</strong> publiziert noch<br />
bei einem Verlag zur Publikation vorgelegt worden sind.<br />
Die Arbeiten sollen in deutscher Sprache eingereicht werden<br />
und möglichst einen Umfang von 30 Schreibmaschinenseiten<br />
nicht überschreiten.<br />
Die Höhe des Preises, <strong>der</strong> nur ausnahmsweise teilbar ist,<br />
beträ9t<br />
DM15.000,-.<br />
Die Beurteilung und Auswahl <strong>der</strong> Arbeiten erfolgt durch<br />
ein vom Kuratorium <strong>der</strong> Deutschen Therapiewoche berufenes<br />
Prüfungskollegium.<br />
Die Veröffentlichung <strong>der</strong> prämierten Arbeit erfolgt in <strong>der</strong><br />
Zeitschrift THERAPIEWOCHE, dem offiziellen Organ <strong>der</strong><br />
Deutschen Therapiewoche, gegebenenfalls in gekürzter<br />
Fassung.<br />
Die Bewerber werden gebeten, ihre Arbeiten bis zum 15.<br />
Mai 1981 beim Ärztlichen Geschäftsführer <strong>der</strong> Deutschen<br />
Therapiewoche, Dr. med. P. Hoffmann, Kaiserallee 30,<br />
7500 Karlsruhe 1, einzureichen; Tel.: (0721) 843021.<br />
Anfragen, die den Preis betreffen, sind ebenfalls an diese<br />
Adresse zu richten.<br />
Die Arbeiten und ein kurzes beigefügtes Autorreferat sollen<br />
ohne Namensvermerk o<strong>der</strong> Hinweise auf den Autor sein.<br />
Name und Anschrift des Bewerbers bitten wir in einem<br />
verschlossenen Umschlag dem Manuskript beizufügen.<br />
Die Verleihung des Preises erfolgt bei <strong>der</strong> Eröffnungsfeier<br />
des 33. Deutschen Therapiekongresses, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Zeit<br />
vom 29. August bis 4. September 1981 in Karlsruhe stattfindet.<br />
mastodynon<br />
mastodynori<br />
mastodynon<br />
mastodynon<br />
bei MASTODYNE<br />
und fibrozystischer<br />
MASTOPATHE<br />
Kurorte und Heilbä<strong>der</strong> berichten<br />
Wilhelm-Raabe-Gesellschaft tagt in Bad Berleburg<br />
Bad Berleburg hat bisher nicht allein als Kneipp-Heilbad<br />
von sich reden gemacht. Auch als Tagungsort im kleinen<br />
Rahmen mausert sich <strong>der</strong> Kurort im Wittgensteiner Waldund<br />
Bergland. Neben <strong>Ärzte</strong>vereinigungen, Sozialversicherungsträgern,<br />
Behörden und natürlich verschiedenen<br />
Kneipp-Organisationen hat auch in diesem Jahr die Wilhelm-Raabe-Gesellschaft<br />
ihre Vorliebe <strong>für</strong> einen ruhigen<br />
und erholsamen aber reizvollen Kurort zum Tagen entdeckt.<br />
Die Jahrestagung 1980 <strong>der</strong> Raabe-Gesellschaft findet vom<br />
29.-30. November im Berleburger Kurhaus statt. 80 Tagungsgäste<br />
werden erwartet.<br />
Nach Bad Berleburg ziehen sie nicht nur die vorweihnachtlichen<br />
Reize des Kurstädtchens, son<strong>der</strong>n auch die gewichtigen<br />
Beiträge <strong>der</strong> alten Toleranzfreistatt <strong>der</strong> Wittgensteinischen<br />
Grafschaften <strong>für</strong> die deutsche Geistesgeschichte.<br />
In seiner Novelle „Gedelöcke", die mit Dogmatismus und<br />
Intoleranz ins Gericht geht, erwähnt Wilhelm Raabe unter<br />
an<strong>der</strong>em die Berleburger Bibel.<br />
Im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungsabends steht ein<br />
Referat des Vizepräsidenten <strong>der</strong> Gesellschaft mit <strong>der</strong> Überschrift:<br />
Berleburgs Beitrag zur Geschichte <strong>der</strong> religiösen und literarischen<br />
Toleranz in Deutschland.<br />
Auskünfte: Kurverwaltung Bad Berleburg,Tel. (02751) 821<br />
Indikationen: Mastodynie, fibrozystische Mastopathie,. prämenstruelles<br />
Syndrom, Corpus luteum-insuffizienzbedingte<br />
Zyklusanomalien, zyklisch bedingte Migräne.<br />
Kontraindikationen sind bisher nicht bekannt.<br />
Nebenwirkungen wurden bisher nicht beobachtet.<br />
Zusammensetzung: 100 g enthalten: Agnus castus D 1 20 g,<br />
Caulophyllum thalictroides D 4 10 g. Cyclamen D 4 10 g,<br />
Ignatia D 6 10 g, Iris D 2 20 g, Lilium tigrinum D 3 10 g,<br />
LupuUnum D 8 10 g, Tinc\uva Condufango 10 g. (Ab O A<br />
wird mit 15%igem Ethanol potenziert).<br />
Dosierung: 2mal täglich 30 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.<br />
Handelsformen: OP mit 50 ml DM 11,55, OP mit 100 ml<br />
DM 17,80; Großpackungen mit 500 ml und 1000 ml.<br />
Bionorica KG, Apotheker Popp, 8500 Nürnberg 1<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg. 359
22. Jahrgang<br />
Heft 7, Juli 1981<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Naturheilverfahren<br />
Physikalische Medizin und Rehabilitation<br />
Organ des <strong>Zentralverband</strong>es <strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren e.V.<br />
o<br />
Redaktionssekretariat „Arztezeitschnft":<br />
von-Scheffel-Straße 3, 8210 Pnen/Chiemsee.<br />
Schnftleitung •<br />
K H Caspers, Bad Fussmg; H. Haferkamp, Mainz, K. Schimmel,<br />
Pnen und R F. Weiß, Marstetten-Aitrach<br />
Wissenschaftlicher Beirat:<br />
M v Ardenne (Dresden) -A Becker (Hannover) - H Bialonski (BadGodesberg)<br />
- J Brand (Kernigstem) - F Brantner (Villach) - N Breidenbach<br />
(Salem-Beuren) - P Dosch (Grunwald b München) - H Fleisohhacker<br />
(Wien) - K Franke (Bad Lauterberg) - P Frick (Mainz) - W Gawhck (Bad<br />
Tolz)-H Giesenbauer(Bremen-Lesum)-H Harmsen (Hamburg)-E Höllischer<br />
(Baden-Baden)-H Huneke (Dusseldorf) -W H Kahlert (Bad Salzuflen)<br />
- J Kaiser (Bad Wörishofen) - G Kellner (Wien) - K Kotschau<br />
(Schloßberg)-H Kolb (Wetzlar)-H Krauß (Berlin)-R v Leitner (Berlin) -<br />
H Mensen (Bad Rothenfelde) - W v Nathusius (Ortenberg) -HD Neumann<br />
(Buhl) - H Paul (Bad Godesberg) - A Pischinger (Wien) - A Rost<br />
(Tubingen) - H Seyfarth (Leipzig) - W Schauwecker (Bensheim) - R G<br />
Schenck (Aachen) - H Schlüter (Berieburg) - O Schumacher-Wan<strong>der</strong>sieb<br />
(Bad Munstereifel) - R Voll(Plochingen)-H L Walb(Homberg,Kr Alsfeld)<br />
- H Winterberg (Mannheim) - W Zimmermann (München)<br />
Aus <strong>der</strong> Klinik <strong>für</strong> Anästhesiologie <strong>der</strong> Städtischen Kliniken Fulda (Chefarzt: Prof. Dr. R. Dölp)<br />
R. Döip Notfallmedizin als Grundlage <strong>der</strong> Katastrophenmedizin<br />
O<br />
Zusammenfassung<br />
Katastrophen- und Notfallmedizin unterscheiden<br />
sich „nur" durch die Anzahl <strong>der</strong> in kurzer Zeit zu<br />
versorgenden Patienten. Dadurch wird vom Arzt, <strong>der</strong><br />
in einer Katastrophensituation tätig wird, zwar mehr<br />
als nur ärztliches Können verlangt; er muß neben<br />
<strong>der</strong> Lösung medizinischer Probleme eine Reihe von<br />
Aufgaben erfüllen, die organisatorischer und taktischer<br />
Art sind; auch muß er verstehen lernen, daß<br />
<strong>für</strong> den einzelnen Patienten nicht mehr alles Notwendige<br />
im Sinne einer optimalen Medizin getan werden<br />
kann.<br />
Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite wird <strong>der</strong> Arzt <strong>für</strong> die Bewältigung<br />
einer Katastrophe am besten gerüstet sein,<br />
<strong>der</strong> notfallmedizinische Kenntnisse und Fähigkeiten<br />
erworben hat. Deshalb stellt die Weiterbildung in <strong>der</strong><br />
Notfallmedizin eine Basis <strong>für</strong> die Sicherstellung <strong>der</strong><br />
ärztlichen Versorgung im Katastrophenfall dar.<br />
Summary<br />
Catastrophe and emergency medicine differ „only"<br />
in the number of patients to be treated in a Short<br />
time. Thus the demands on a doctor who works in<br />
a catastrophe Situation require more than medical<br />
knowledge; in addition to solving medical problems<br />
he must fulfill a number of tasks, which are of the<br />
organisational and tactical type; he must: also learn<br />
that not everything can be done for the individual<br />
patient in the sense of optimum medical care.<br />
By comparison the doctor best equipped for mastering<br />
a catastrophe is someone who has received<br />
emergency medical knowledge and capabilities. For<br />
this reason additional training in emergency medicine<br />
is a basis for ensuring medical care in catastrophic<br />
situations.<br />
Die Begriffe Katastrophenmedizin, Zivilschutz u. a. waren<br />
nach dem letzten Weltkrieg über lange Zeit mit einem Tabu<br />
belegt. Erst in <strong>der</strong> jüngsten Vergangenheit versuchten sowohl<br />
<strong>der</strong> Gesetzgeber als auch die ärztlichen Organisationen<br />
und Rettungsdienste dem Beispiel an<strong>der</strong>er Län<strong>der</strong><br />
(z. B. Schweiz) zu folgen und den Katastrophenfall als eine<br />
mögliche Variante medizinischer Versorgungsnotwendigkeit<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung zur Kenntnis zu nehmen. Es häuften<br />
sich daher in letzter Zeit Diskussionen zu diesem Thema<br />
und Publikationen über Organisationsformen zur Bewältigung<br />
einer Katastrophensituation, wobei jedoch häufig Negativdarstellungen<br />
mit Schlagworten wie: „Das Chaos ist<br />
vorprogrammiert" u. ä. gewählt wurden. Sie dürften <strong>der</strong><br />
Problemstellung nicht dienlich sein.<br />
Mit Sicherheit kann man aber davon ausgehen, daß Resolutionen<br />
und auch Gesetze nur Papier füllen, und daß Ein-<br />
Arztezeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg. 361
Dölp, Katastrophenmedizin<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr, f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
lagerungen von Medikamenten und Geräten nicht weiterführen,<br />
solange gezielte Fortbildungsmaßnahmen, sowohl<br />
bereits an den Universitäten als auch in regionalen Bereichen<br />
<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong>schaft nicht durchgeführt werden.<br />
Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Katastrophenmedizin<br />
Im Juli 1980 wurde die Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Katastrophenmedizin<br />
in München gegründet. Aus diesem Ereignis<br />
läßt sich ablesen, welche Bedeutung den ärztlichen<br />
Maßnahmen unter Katastrophenbedingungen heute beigemessen<br />
wird. Ein wesentliches Ziel dieser Gesellschaft<br />
besteht - neben <strong>der</strong> Kooperation mit in- und ausländischen<br />
medizinischen Fachgesellschaften sowie staatlichen und<br />
privaten Einrichtungen, die sich mit Katastrophenmedizin<br />
befassen - genau darin, was sich <strong>der</strong> <strong>Zentralverband</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren anläßlich <strong>der</strong> diesjährigen Tagung<br />
vorgenommen hat, eine Aus- und Fortbildung <strong>der</strong><br />
<strong>Ärzte</strong>schaft, die mit katastrophenmedizinischen Problemen<br />
bisher nicht o<strong>der</strong> nur wenig vertraut ist, durchzuführen.<br />
Überdenken wir noch einmal den Begriff „Katastrophe",<br />
dann verstehen wir darunter ein Schadensereignis, dessen<br />
Folgen durch lokal vorhandene Mittel nicht beherrscht werden<br />
können. Organisation und Improvisation werden primär<br />
die beherrschende Rolle spielen. Je besser die Organisation,<br />
desto weniger notwendig wird Improvisation sein.<br />
Immer wird es sich um die ärztliche Behandlung von Notfallpatienten<br />
in Ausnahmesituationen handeln, die wie folgt<br />
zu definieren sind: zum Notfallpatienten wird <strong>der</strong>jenige,<br />
dessen vitale Funktionen - Atmung, Herz-Kreislauf - infolge<br />
eines Traumas o<strong>der</strong> einer lebensbedrohlichen akuten Erkrankung<br />
gestört sind. Hinzuzurechnen sind auch solche<br />
Patienten, bei denen mit einer lebensbedrohlichen Störung<br />
als Folge eines akuten Ereignisses zu rechnen ist.<br />
Die Tätigkeit des Arztes in einer Katastrophensituation erfor<strong>der</strong>t<br />
ein Umdenken (Graul, 1977). Die durch die ärztliche<br />
Ausbildung vorgeschriebene Alternative, <strong>für</strong> jeden einzelnen<br />
alles menschlich und technisch Erfor<strong>der</strong>liche zu tun<br />
im Sinne einer optimalen Medizin, muß in Konkurrenz<br />
treten zu dem in einer Katastrophe notwendigen Aufgaben<br />
<strong>der</strong> auf den einzelnen Patienten ausgerichteten Hilfeleistung.<br />
In einer solchen Situation gilt keine Dienstanweisung, <strong>der</strong><br />
Arzt ist zwangsläufig nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet,<br />
und er hat neben ärztlichen Problemen eine Reihe<br />
von Aufgaben zu erfüllen, die taktischer Art sind und <strong>der</strong>en<br />
Lösung erst die rein ärztliche Versorgung erlaubt (Peter<br />
Bamm, 1957). Die For<strong>der</strong>ung, die an den Arzt gestellt wird,<br />
hat Contzen (1978) so beschrieben: das Bestmögliche <strong>für</strong><br />
die größte Anzahl von Verletzten zur rechten Zeit zu tun.<br />
Phasen <strong>der</strong> Katastrophenhilfe<br />
Will man sich einen Überblick über die Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Katastrophenhilfe verschaffen, so ist es nützlich, diese in<br />
drei Phasen aufzuteilen (Veigel, 1979).<br />
Die erste Phase - Lanz (1979) nennt sie die Isolationsphase<br />
- besteht darin, daß das Schadensereignis unvorhergesehen<br />
und innerhalb kurzer Zeit über einen nicht vorbereiteten<br />
Bevölkerungsteil o<strong>der</strong> einen ungenügend geschützten<br />
Bevölkerungsteil hereinbricht. Spontane Selbst- und Nächstenhilfe<br />
durch Laien gehören zu den ersten Maßnahmen<br />
und entscheiden über das Überleben. Wie bereits gesagt,<br />
ist zu for<strong>der</strong>n, daß wenigstens Grundkenntnisse bei <strong>der</strong><br />
Gesamtbevölkerung in Deutschland vorhanden sind, wie<br />
sie inzwischen z. B. bei Absolvierung eines Kurzlehrganges<br />
zur Führerscheinprüfung verlangt werden. Auch die freiwillige<br />
Ausbildung z. B. als Schwesterhelferin o<strong>der</strong> als<br />
Hilfskrankenpfleger bei den Hilfsorganisationen wie DRK,<br />
ASB, Johanniter- und Malteserhilfsdienst ist zu for<strong>der</strong>n.<br />
In <strong>der</strong> zweiten Phase - <strong>der</strong> Rettungsphase - kommt es<br />
bereits zu einer organisierten Hilfe. Ärztliche Aufgabe dabei<br />
ist, eine Sichtung - Triage - vorzunehmen, die grundsätzlich<br />
zunächst einen Filterungsvorgang beinhaltet, um die<br />
ärztlichen Maßnahmen dem Verletzungs-o<strong>der</strong> Erkrankungsgrad<br />
jeweils anpassen zu können. Diese Sichtung bedarf<br />
nicht nur einer erheblichen fachlichen Qualifikation, son<strong>der</strong>n<br />
auch <strong>der</strong> Kenntnisse über Transportkapazität sowie<br />
Aufnahmekapazität und Leistungsfähigkeit rückwärtiger<br />
Einrichtungen. Ausdrücklich sei in diesem Zusammenhang<br />
darauf hingewiesen, daß kein Verletzter o<strong>der</strong> Kranker vom<br />
Orte des Geschehens abtransportiert werden darf, ehe<br />
nicht seine Transportfähigkeit festgestellt worden ist.<br />
Als Vorgehen empfiehlt sich zunächst, die Leichtverwundeten<br />
festzulegen und hier zu entscheiden, ob durch schnelle<br />
beson<strong>der</strong>s nichtärztliche Maßnahmen geholfen werden<br />
kann. Indem man sich so rasch durch organisatorische und<br />
an<strong>der</strong>e Hilfsmaßnahmen <strong>der</strong> Leichtverwundeten entledigt,<br />
können sich die <strong>Ärzte</strong> mit beson<strong>der</strong>er Sorge den Schwerverletzten<br />
zuwenden. Hier kann man mit einer ganz begrenzten<br />
Anzahl von Medikamenten und Infusionslösungen,<br />
auf die ich noch eingehen werde, nahezu alle Aufgaben<br />
erfüllen. Es sollte allerdings eine weitgehende Übereinstimmung<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Ausstattung von Notarztkoffern<br />
erzielt werden, um insbeson<strong>der</strong>e noch durch zusätzliche<br />
Färb- und Symbolkodierung zu garantieren, daß je<strong>der</strong> Arzt<br />
mit jedem Notarztkoffer je<strong>der</strong>zeit arbeiten kann.<br />
Neben <strong>der</strong> Erhaltung o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong> bereits<br />
genannten Vitalfunktionen ist zu entscheiden, in welcher<br />
weiteren Sanitätseinrichtung die Weiterbehandlung erfolgt<br />
und mit welchen Transportmitteln die Verlegung durchgeführt<br />
werden kann. In einer Katastrophensituation werden<br />
uns - natürlich in Abhängigkeit von Zeitpunkt und Wetterlage<br />
- auch Rettungshubschrauber zur Verfügung stehen,<br />
die - wie die Erfahrungen gezeigt haben - gerade <strong>für</strong> den<br />
Transport von Schwerstverletzten in Spezialeinrichtungen,<br />
also über längere Distanzen, von beson<strong>der</strong>em Vorteil sind.<br />
In <strong>der</strong> dritten Phase schließlich - <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>herstellungsphase<br />
- wird <strong>der</strong> Einsatz von Spezialisten notwendig, die<br />
über Tage o<strong>der</strong> Wochen durch gezielte Behandlungstechniken<br />
eine Genesung und Rehabilitierung des Patienten<br />
betreiben.<br />
362
Dölp, Katastrophenmedizin<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr, f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Dringlichkeitsstufen<br />
Beschränken wir unsere Betrachtungen zunächst und im<br />
wesentlichen auf die zweite Phase <strong>der</strong> Versorgung, dann<br />
ergeben sich aus <strong>der</strong> vorgenommenen Sichtung unterschiedliche<br />
Dringlichkeitsstufen <strong>für</strong> die Behandlung und<br />
den Abtransport <strong>der</strong> einzelnen Verwundeten (Tscherne,<br />
1979).<br />
Als Grundsatz gilt: Notfallpatienten, d. h. im allgemeinen<br />
Schwerverwundete o<strong>der</strong> Schwererkrankte, werden zuerst<br />
behandelt<br />
Die ersfe Behandlungsstufe, d. h. die <strong>der</strong> Notfallpatienten<br />
mit Behandlungspriorität, umfaßt solche mit Asphyxie, mechanischem<br />
Verschluß <strong>der</strong> Atemwege, Gesichts- und Kieferverletzungen<br />
größeren Ausmaßes, offenem Pneumothorax<br />
sowie Notfallpatienten mit Schockzuständen infolge<br />
Volumenmangels bedingt durch intraabdominelle o<strong>der</strong><br />
intrathorakale Blutungen und umfaßt auch alle Notfallpatienten<br />
mit Mehrfachverletzungen; Verbrennungen mit mehr<br />
als 20% <strong>der</strong> Körperoberfläche fallen ebenfalls unter diese<br />
Gruppe. Bauchverletzungen mit Eingeweidevorfällen, die<br />
dringlicher chirurgischer Behandlung bedürfen, sind hier<br />
hinzuzurechnen.<br />
Die zweite Dringlichkeitsstufe betrifft Patienten, bei denen<br />
eine ärztliche o<strong>der</strong> chirurgische Versorgung zeitweise aufgeschoben<br />
werden kann. Hierbei handelt es sich um Abdominalverletzungen<br />
ohne große Schockereignisse einschließlich<br />
perforieren<strong>der</strong> Wunden im Magen-Darm-Kanal,<br />
Verletzungen des Urogenitalsystems sowie Thoraxverletzungen<br />
ohne Asphyxie. Auch Gefäßverletzungen, bei denen<br />
eine Blutstillung erreicht ist, die jedoch späterer Restitution<br />
zugeführt werden müssen, gehören zu dieser Gruppe.<br />
Ebenso die gedeckten Hirnverletzungen mitzunehmendem<br />
Bewußtseinsverlust sowie Brandverietzte mit weniger als<br />
20% verbrannter Körperoberfläche sind hier hinzuzurechnen.<br />
Allen diesen Patienten wird Priorität beim Abtransport<br />
in Sanitätseinrichtungen außerhalb <strong>der</strong> Katastrophenzone<br />
eingeräumt.<br />
Die dritte Dringlichkeitsstufe enthält Verwundete mit Hirnund<br />
Rückenmarksverletzungen, die eine Entlastung erfor<strong>der</strong>n,<br />
mit leichteren Muskelverletzungen, bei denen ein<br />
Debridement erfor<strong>der</strong>lich ist, mit geschlossenen Frakturen<br />
und Luxationen kleinerer Knochen und Gelenke sowie mit<br />
Augen-, Gesichts- und Kieferverletzungen ohne Atembehin<strong>der</strong>ung.<br />
Hieraus ergibt sich eine aufgeschobene Transportpriorität.<br />
In die vierte Dringlichkeitsstufe gehören vor allem die<br />
Leichtverletzten.<br />
Es wird immer eine kleine Gruppe von polytraumatisierten<br />
Patienten mit schweren Schädel-Hirn-Verletzungen, schwersten<br />
Verbrennungen usw. geben, die hier in eine fünfte<br />
Gruppe einzuordnen wären und bei <strong>der</strong> eine Therapie „ut<br />
aliquid fiat" durchzuführen ist. Sie sind sogenannte Wartefälle<br />
mit infauster Prognose, bei denen Schmerztherapie<br />
und psychischer Beistand wohl an erster Stelle stehen.<br />
364<br />
Es wird nicht verkannt, daß gerade die Sichtung beim<br />
Massenanfall von Erkrankten o<strong>der</strong> Verletzten immer mit<br />
den stärksten moralischen Bedenken verbunden sein wird.<br />
Je mehr jedoch Rettungssanitäter eine Ausbildung erfahren<br />
haben, qualifizierte lebensrettende Maßnahmen durchzuführen,<br />
desto mehr kann <strong>der</strong> ärztliche Bereich entlastet<br />
werden und sich auf wesentliche ärztliche Maßnahmen bei<br />
<strong>der</strong> lebensrettenden Sofortbehandlung <strong>der</strong> Dringlichkeitsstufe<br />
I beschränken und sich vermehrt <strong>der</strong> Dringlichkeitsstufe<br />
V zuwenden.<br />
Für den medizinischen Bereich sollte als primäres Ziel<br />
gelten, das Chaos auf den Katastrophenraum zu begrenzen<br />
und nicht auf die Umgebung übergreifen zu lassen.<br />
Notfallmedizinische Erstmaßnahmen<br />
Nach Sichtung und Überprüfung <strong>der</strong> Diagnose wird in den<br />
meisten Fällen noch am Orte des Geschehens eine primäre<br />
Schocktherapie durchzuführen sein, die im wesentlichen<br />
gleichen Grundsätzen folgt, wie sie unter Normalverhältnissen<br />
bei <strong>der</strong> Individualtherapie anzuwenden ist. Dazu<br />
stehen uns heute künstliche kolloidale Volumenersatzmittel<br />
zur Verfügung in Form von Dextran-Gelatine- o<strong>der</strong> auch<br />
Hydroxyäthylstärkepräparaten. Ohne auf die eigentliche<br />
Schocktherapie hier eingehen zu wollen, möchte ich doch<br />
darauf hinweisen, daß bei allen erwachsenen Patienten, die<br />
eine typische Schocksymptomatik aufweisen und einen<br />
sogenannten Schockindex (Puls/systolischer Blutdruck)<br />
von über 1,0 zeigen, ein intravasales Volumendefizit über<br />
1 I besteht, so daß diese Menge eines kolloidalen Volumenersatzmittels<br />
bei Schocksymptomatik in raschester Tropfenfolge<br />
intravenös appliziert werden muß.<br />
Neben <strong>der</strong> Schockbehandlung mit künstlichen kolloidalen<br />
Volumenersatzmitteln kommt <strong>der</strong> Schmerzbehandlung, insbeson<strong>der</strong>e<br />
beim Transport von Notfallpatienten eine beson<strong>der</strong>e<br />
Bedeutung zu. Grundsätzlich unterteilen wir Schmerzpatienten<br />
in drei Gruppen:<br />
I. Verletzte mit stärksten Schmerzen<br />
II. Verletzte mit mäßiggradigen Schmerzen<br />
III. Verletzte ohne Schmerzen mit starker Unruhe und Erregung.<br />
Während <strong>für</strong> die letztgenannte Gruppe die Gabe von Sedativa<br />
z. B. Atosil® o<strong>der</strong> Valium® ausreichend erscheint, haben<br />
sich bei Verletzten mit mäßiggradigen Schmerzen<br />
einfache, nichtmorphinhaltige Analgetika bewährt, die auch<br />
im Sinne einer Selbstmedikation zum Einsatz kommen<br />
können.<br />
Opiate - dem BTM-Gesetz unterworfen - zählen zwar zu<br />
den potentesten Analgetika, haben aber den Nachteil zahlreicher<br />
Nebenwirkungen, wie Atem- und Kreislaufdepression,<br />
Brechreiz mit Erbrechen, die sämtlich unter Katastrophensituationen<br />
nicht zu vernachlässigen sind, weshalb<br />
diese Medikamente ausschließlich durch einen Arzt appliziert<br />
werden sollten. Als geeignete Kombination von Sedativa<br />
und Analgetika erscheint mir die Gabe z. B. von Va-
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Dölp, Katastrophenmedizin<br />
o<br />
lium® und Fortral® o<strong>der</strong> auch von Atosil® und Dolantin®<br />
empfehlenswert. Auch Dipidolor® und Temgesic® gelten<br />
als nebenwirkungsarme Substanzen mit guter analgetischer<br />
Wirkung.<br />
Stellt man Maximalfor<strong>der</strong>ungen an Analgetika und Sedativa<br />
unter Katastrophenbedingungen, dann sollten sie im Idealfall<br />
folgende Vorzüge haben:<br />
große therapeutische Breite<br />
schneller Wirkungseintritt<br />
ausreichende Wirkungsintensität<br />
gute Steuerbarkeit bei langer Wirkungsdauer<br />
keine negative Beeinflussung <strong>der</strong> Vitalfunktionen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Schutzreflexe<br />
geringer Überwachungsaufwand<br />
gute Lagerungsfähigkeit<br />
gute Transportierbarkeit.<br />
Als Applikationsweg <strong>der</strong> Analgetika und Sedativa kommt<br />
bei Schwerverwundeten mit Kreislaufumstellung im Sinne<br />
einer Zentralisierung nur die intravenöse Injektion in Betracht.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die ärztliche Versorgung<br />
in Katastrophenfällen die Sicherung ganz bestimmter,<br />
inzwischen genannter Voraussetzungen erfor<strong>der</strong>t.<br />
Selbstverständlich ist die reine ärztliche Tätigkeit nur als<br />
Teilbereich in <strong>der</strong> Gesamtplanung <strong>für</strong> Katastrophenfälle<br />
anzusehen, dennoch kann sie nicht isoliert betrachtet werden,<br />
da sie in das Gesamtsystem <strong>der</strong> Katastrophenmedizin<br />
integriert werden muß.<br />
Von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung ist aber neben einer einheitlich,<br />
zumindest auf <strong>der</strong> Ebene eines Bundeslandes<br />
durchgeführten Katastrophenplanung, immer wie<strong>der</strong> die<br />
Aktualisierung in Form von Übungen und wie<strong>der</strong>kehrenden<br />
Diskussionen über die beabsichtigte o<strong>der</strong> auch zu adaptierende<br />
Koordination. Sehr wesentlich ist auch, daß die<br />
personelle Situation den Ansprüchen gerecht wird, d. h.<br />
daß eine entsprechende Aus-, Weiter- und Fortbildung<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, und daß Wie<strong>der</strong>holungen<br />
diese Kenntnisse und Fähigkeiten sichern. Die Basis<br />
<strong>für</strong> die Katastrophenmedizin muß die Notfallmedizin darstellen,<br />
d. h. jede Aktivität zur Verbesserung <strong>der</strong> Notfallmedizin<br />
muß zwangsläufig zu einer Verbesserung <strong>der</strong> Vorbereitung<br />
auf eine Katastrophensituation führen.<br />
Literatur<br />
Bamm, P.: Chirurgie und Taktik im Rußlandfeldzug. Vierteljahreszeitschrift<strong>für</strong><br />
Schweizerische Sanitätsoffiziere 34, 70 (1957).<br />
Contzen, H.: Vorbereitungen im Krankenhaus <strong>für</strong> den Massenanfall<br />
von Verletzten. In: DRK-Schriftenreihe 55, 155 (1978).<br />
Graul, E. H.: Katastrophenmedizin. Int. Congress on Disaster,<br />
Mainz, 30. Sept. bis 3. Okt. 1977.<br />
Lanz, R.: Vortrag zum Thema: Der Arzt im Katastrophenfall. 96.<br />
Kongreß <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Chirurgie, München,<br />
15. bis 28. April 1979.<br />
Tscherne, H.: Vortrag zum Thema: Der Arzt im Katastrophenfall.<br />
96. Kongreß <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Chirurgie, München,<br />
25. bis 28. April 1979.<br />
Veigel, J. G.: Stiefkind Katastrophenmedizin. Deutsches <strong>Ärzte</strong>blatt<br />
Heft 27, 1799 (1979).<br />
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. R. Dölp, Klinik <strong>für</strong> Anaesthesiologie,<br />
Städtische Kliniken Fulda, Pacelliallee 4, D-6400 Fulda.<br />
o<br />
Aus <strong>der</strong> Klinik <strong>für</strong> Anästhesiologie <strong>der</strong> Städtischen Kliniken Fulda (Chefarzt: Prof. Dr. med. R. Dölp)<br />
H. Kiingebiei Sofortdiagnostik und -therapie respiratorischer Störungen<br />
Zusammenfassung<br />
Die sofortdiagnostischen und -therapeutischen Maßnahmen<br />
im Rahmen respiratorischer Notfälle müssen<br />
sich in erster Linie auf die Aufrechterhaltung<br />
des Sauerstoffangebots <strong>für</strong> den Gesamtorganismus<br />
erstrecken. Es werden die Symptomatik und die<br />
entsprechende Therapie beschrieben unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Partialfunktion Atmung im Verbundsystem<br />
<strong>der</strong> Vitalfunktionen. Notfalltherapie heißt<br />
prospektives Denken und Handeln, Vermin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Schäden schon im Ansatz. Durch konsequentes,<br />
frühzeitiges Eingreifen kann <strong>der</strong> Krankheitsverlauf<br />
wesentlich gelin<strong>der</strong>t und verkürzt werden.<br />
Summary<br />
The immediate diagnostic and therapeutic steps for<br />
respiratory emergencies must initially concentrate<br />
on maintaining the oxygen supply to the complete<br />
organism. The Symptoms and the appropriatetherapy<br />
are described taking into account the partial breathing<br />
function in conjunction with the vital functions.<br />
Emergency therapy means prospective thinking and<br />
action, reducing the damage from the outset. Proper,<br />
early action can consi<strong>der</strong>ably ease and shorten the<br />
course of the illness.<br />
Bei den sofortdiagnostischen Möglichkeiten, die zur primären<br />
Analyse des Geschehens am Notfallort und im weiteren<br />
Ablauf <strong>der</strong> Soforttherapie zur Verfügung stehen, müssen<br />
von vornherein die Zusammenhänge des Verbundsystems<br />
<strong>der</strong> Vitalfunktionen bzw. die gegenseitigen Einflüsse von<br />
Atmung, Herz-Kreislauf-System, Wasser-Elektrolyt-Haushalt<br />
und Stoffwechselfunktion, beachtet werden. In Abhän-<br />
367
Klingebiel, Respiratorische Störungen<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
gigkeit von <strong>der</strong> Schwere des Ereignisses führen diese zu<br />
Kompensationsmechanismen o<strong>der</strong> zu einer oft nicht o<strong>der</strong><br />
viel zu spät bemerkten Dekompensation.<br />
Die Sofort- o<strong>der</strong> Elementardiagnostik des respiratorischen<br />
Notfalls stützt sich auf Zeichen einer gestörten Atemtätigkeit<br />
und auf die entsprechenden, daraus resultierenden<br />
Zeichen einer Ateminsuffizienz. Als Notfallpatient ist <strong>der</strong>jenige<br />
zu deklarieren, bei dem eine Störung vitaler Funktionen<br />
vorliegt, zu be<strong>für</strong>chten ist o<strong>der</strong> nicht sicher ausgeschlossen<br />
werden kann. Jede Störung <strong>der</strong> Atemmechanik kann je<strong>der</strong>zeit<br />
(muß aber nicht) zu einer Ateminsuffizienz führen. Mit<br />
den Mitteln am Orte des Geschehens ist nur eine grobe<br />
Abschätzung darüber möglich, ob die nachgewiesene Störung<br />
bereits eine Insuffizienz bewirkt hat. In schweren Fällen<br />
ist die Entscheidung darüber leicht, wenn z. B. ein kompletter<br />
Atemstillstand eingetreten ist o<strong>der</strong> eine deutliche<br />
Zyanose besteht. Die tägliche Praxis zeigt jedoch, daß die<br />
klinische Symptomatik nicht ausreicht, um eine Ateminsuffizienz<br />
ohne Zuhilfenahme z. B. einer Blutgasanalyse zu<br />
definieren. Traumatisierte Patienten, bei denen sofort nach<br />
Eintreffen in <strong>der</strong> Klinik eine Blutgasanalyse durchgeführt<br />
wurde, zeigten infolge von Thoraxtraumen o<strong>der</strong> allein aufgrund<br />
von Blutverlusten mit Schocksymptomatik bereits<br />
eine ausgeprägte Ventilationsstörung.<br />
Respiratorische Insuffizienz<br />
Die am meisten ge<strong>für</strong>chtete Form <strong>der</strong> respiratorischen Insuffizienz,<br />
das sogenannte ARDS (Acute Respiratory Distress<br />
Syndrome) o<strong>der</strong> häufig auch Schocklunge genannt,<br />
kann sich noch Tage nach dem Unfall ausbilden. Es ist<br />
sehr schwer, wenn nicht unmöglich, den progredienten<br />
Verlauf nach Eintritt eindeutiger Symptome mit heute zur<br />
Verfügung stehenden Mitteln dann noch zu unterbrechen.<br />
Das ARDS führt letztlich zu einer schweren Lungenfibrose<br />
mit Alveolar- und Kapillarverlust, die in <strong>der</strong> überwiegenden<br />
Zahl <strong>der</strong> Fälle mit dem Leben nicht vereinbar ist.<br />
Da es am Notfallort keine aufwendige Labordiagnostik gibt,<br />
muß <strong>der</strong> Notarzt sozusagen prospektiv denken und therapieren.<br />
Eine allgemeine Dekompensation kann nur verhin<strong>der</strong>t<br />
werden, wenn von Anfang an versucht wird, die Atemfunktion,<br />
d. h. die Sauerstoffversorgung des Körpers zu<br />
verbessern. Die Therapie muß beginnende, am Notfallort<br />
noch nicht in jedem Falle sichtbare Verän<strong>der</strong>ungen beheben<br />
o<strong>der</strong> sogar zu verhin<strong>der</strong>n suchen. Der Krankheitsverlauf<br />
kann entscheidend verkürzt werden, wenn durch gezielte<br />
Maßnahmen Schäden verhin<strong>der</strong>t werden.<br />
Wenn am Notfallort eine Störung <strong>der</strong> Atmung entdeckt<br />
wird, sollte man Sofortmaßnahmen ergreifen. In 80% <strong>der</strong><br />
Fälle ist die Ursache einer Atemstörung allein die zurückfallende<br />
Zunge, die die Atemwege blockiert. Durch einfaches<br />
Überstrecken des Kopfes zusammen mit dem Esmarchschen<br />
Handgriff kann ein Freimachen und Freihalten <strong>der</strong><br />
Atemwege erreicht werden. Das Freihalten <strong>der</strong> Atemwege<br />
kann mittels eines Oropharyngealtubus nach Guedel o<strong>der</strong><br />
eines Nasenpharyngealtubus nach Wendl unterstützt werden.<br />
Der Kopf muß dabei überstreckt bleiben. In nur 20%<br />
<strong>der</strong> Fälle müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden.<br />
Die nächste Frage ist die nach dem Bewußtsein. Einen<br />
bewußtlosen Patienten legt man in jedem Falle in stabile<br />
Seitenlage unter Überstreckung des Kopfes. Dadurch wird<br />
einer Aspiration von Blut o<strong>der</strong> auch von Erbrochenem vorgebeugt,<br />
im Falle daß <strong>der</strong> Patient Verletzungen im Bereich<br />
<strong>der</strong> Mundhöhle hat o<strong>der</strong> erbricht.<br />
Atemstillstand<br />
Als Zeichen eines Atemstillstandes sind einmal die fehlenden<br />
Exkursionen von Thorax und/o<strong>der</strong> Oberbauch zu werten,<br />
außerdem das Fehlen von hör- und spürbarem Luftstrom.<br />
Spiegel-, Fe<strong>der</strong>- o<strong>der</strong> Watteproben gehören heute<br />
nicht mehr zur Feststellung eines Atemstillstandes. Es<br />
kommt auch gar nicht darauf an, ob noch eine Restfunktion<br />
besteht, son<strong>der</strong>n ob die vorhandene Funktion vital ausreicht.<br />
Die Beatmung eines Patienten als erste Maßnahme ist immer<br />
dann absolut indiziert, wenn <strong>der</strong> Patient keine Spontanatmung<br />
o<strong>der</strong> eine finale Schnappatmung hat. Man kann<br />
die Atemspende ohne Hilfsmittel als Mund-zu-Mund- o<strong>der</strong><br />
Mund-zu-Nase-Beatmung durchführen. Die Position des<br />
Kopfes ist dabei wie<strong>der</strong> die Überstreckung im Genick und<br />
das Anheben des Unterkiefers, <strong>der</strong> Mund wird mit dem<br />
Daumen verschlossen und über die Nase wird vom Helfer<br />
ein Volumen von ca. 500 ml insuffliert. Dabei ist auf Thoraxexkursionen<br />
zu achten. Die Gefahr <strong>der</strong> Atemspende liegt<br />
in <strong>der</strong> Insufflation von Luft in den Magen (Überschreiten<br />
des Ösophagusverschlußdrucks ab + 15 cm H 2 O). Diese<br />
Gefahr besteht auch bei <strong>der</strong> Atemspende mit Maske und<br />
Beatmungsbeutel. Bei effizienter Beatmung müssen Exkursionen<br />
am Thorax o<strong>der</strong> am Oberbauch sichtbar sein. Ein<br />
weiteres Zeichen <strong>der</strong> suffizienten Atemspende ist das Verschwinden<br />
<strong>der</strong> zentralen Zyanose und die wie<strong>der</strong> eintretende<br />
Pupillenverengung.<br />
Eine normale Atemfrequenz des Erwachsenen liegt zwischen<br />
12 und 16/min. Störungen <strong>der</strong> Atemfrequenz drükken<br />
sich häufig als alveoläre Hypoventilation aus. Diese<br />
kann als Ursache sowohl Tachypnoe als auch eine Bradypnoe<br />
haben.<br />
Eine Bradypnoe bei unverän<strong>der</strong>ter Atemtiefe ist als zentral<br />
aufgelöste Atemdepression zu deuten, aber auch die abgeflachte<br />
Atmung in Verbindung mit einer Bradypnoe muß als<br />
Folge einer zentralen Atemdepression aufgefaßt werden.<br />
Eine pathologische Steigerung <strong>der</strong> Atemfrequenz weist auf<br />
periphere Störungen hin, die an <strong>der</strong> Atemmuskulatur, am<br />
Lungenparenchym und am Lungenkreislauf liegen können.<br />
Steigerungen <strong>der</strong> Atemfrequenz sind als Versuch einer<br />
kompensatorischen Hyperventilation zu verstehen. Eine<br />
Tachypnoe bedeutet aber in den meisten Fällen gleichzeitig<br />
eine alveoläre Hypoventilation durch Verkleinerung<br />
des Atemzugvolumens und damit eine relative Vergrößerung<br />
<strong>der</strong> Ventilation des anatomischen Totraums (2 ml/<br />
kg KG).<br />
368
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Klingebiel, Respiratorische Störungen<br />
r\<br />
Eine flache Atmung verbunden mit einer Tachypnoe entspricht<br />
ebenfalls einer peripheren neuromuskulären Atemstörung.<br />
Die flache, schnelle Atmung ist aber auch bei<br />
Thoraxtraumen anzutreffen, falls Schmerzen vorhanden<br />
sind o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Atemstörungen, die die Atemtechnik<br />
beeinträchtigen.<br />
Eine forcierte Atmung entsteht, wenn <strong>der</strong> Patient gegen ein<br />
mechanisches Hin<strong>der</strong>nis in den oberen Atemwegen anatmen<br />
muß o<strong>der</strong> wenn eine schwere Bronchialobstruktion<br />
besteht. Bei <strong>der</strong> Verlegung im Bereich des Einröhrensystems,<br />
also in den proximalen Abschnitten des Tracheobronchialbaums,<br />
kommt es zu inspiratorischen Atemschwierigkeiten,<br />
während eine Bronchialobstruktion, also<br />
eine distale Stenose, zu exspiratorischen Atembeschwerden<br />
führt.<br />
Bei <strong>der</strong> angestrengten Atmung wird nicht nur die Atemmuskulatur,<br />
son<strong>der</strong>n auch die Atemhilfsmuskulatur beansprucht.<br />
Wir sprechen von einer Orthopnoe. Der Patient<br />
richtet zur Verbesserung seiner Atemfunktion den Oberkörper<br />
auf und stützt beide Hände nach hinten, um so den<br />
größtmöglichen Effekt <strong>der</strong> Atemhilfsmuskulatur zu erreichen.<br />
Eine Orthopnoe kann drei Ursachen haben:<br />
1. eine Lungenstauung, eventuell ein Lungenödem (Asthma<br />
cardiale)<br />
2. eine schwere Bronchialobstruktion (Asthma bronchiale)<br />
3. in seltenen Fällen auch Thoraxtraumen.<br />
Beim Lungenödem dient die Hochlagerung <strong>der</strong> Umverteilung<br />
<strong>der</strong> Durchblutung in die kaudalen Lungenabschnitte,<br />
um damit eine Verbesserung <strong>der</strong> Ventilation in den kranialen<br />
Partien zu erreichen. Bei <strong>der</strong> Bronchialobstruktion kann<br />
bei aufgerichtetem Oberkörper und abgestützten Armen<br />
<strong>der</strong> Schultergürtel besser fixiert und die Atemhilfsmuskulatur<br />
wirkungsvoller eingesetzt werden. Auch Patienten mit<br />
Thoraxtraumen verspüren in halbsitzen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> sitzen<strong>der</strong><br />
Stellung nicht nur durch Ausnutzung <strong>der</strong> Atemhilfsmuskulatur,<br />
son<strong>der</strong>n auch durch muskuläre Stabilisierung einer<br />
knöchernen Verletzung eine Erleichterung <strong>der</strong> Atemtätigkeit.<br />
Eine paradoxe Atmung entsteht nach schweren Thoraxtraumen<br />
mit Rippenserienstückbrüchen. Die Thoraxwand<br />
verliert ihre Stabilität - man spricht von einem instabilen<br />
Thorax. Die Thoraxwand kann im Bereich <strong>der</strong> Fraktur den<br />
normalen Aufwärtsbewegungen <strong>der</strong> Brustwand in <strong>der</strong> Inspiration<br />
nicht folgen, man erkennt vielmehr im Bereich <strong>der</strong><br />
betroffenen Partie während <strong>der</strong> Inspiration eine paradoxe<br />
Einziehung <strong>der</strong> Brustwand, während sich bei <strong>der</strong> Exspiration<br />
das betreffende Stück nach außen vorwölbt. Dieser Effekt<br />
verstärkt sich durch Hinzukommen von Schmerzen, schlechten<br />
Ventilationsbedingungen (d. h. alveolärer Hypoventilation)<br />
und Verschlechterung <strong>der</strong> Atemtechnik.<br />
Atemtypen<br />
Notfallmedizinische Leitsymptome <strong>für</strong> verschiedene Störungen<br />
<strong>der</strong> Atemregulation auf <strong>der</strong> Basis zerebraler Schäden<br />
sind bestimmte Atemtypen. Die normale Atmung besteht<br />
aus einem koordinierten Wechsel von Inspiration und<br />
Exspiration, wobei die Atemtiefe im wesentlichen unverän<strong>der</strong>t<br />
ist, bestenfalls durch Seufzeratemzüge unterbrochen<br />
wird. Jede Atemrhythmusstörung ist zentraler Genese, entwe<strong>der</strong><br />
primär durch Verletzung o<strong>der</strong> Erkrankung des Gehirns<br />
o<strong>der</strong> sekundär durch metabolische Störungen (Hyperkapnie,<br />
Hypoxie, Azidose).<br />
Im Rahmen einer metabolischen Azidose (z. B. beim Coma<br />
diabeticum, Coma uraemicum usw.) versucht <strong>der</strong> Organismus<br />
durch eine zentrale Steigerung <strong>der</strong> Atemtiefe bei leicht<br />
angehobener Atemfrequenz, flüchtige Säure - insbeson<strong>der</strong>e<br />
Kohlensäure - über die Lungen in verstärktem Maße<br />
zu eliminieren, um so saure Valenzen abzugeben. Die große<br />
o<strong>der</strong> Kussmaulsche Atmung ist gekennzeichnet durch leicht<br />
erhöhte, konstant vertiefte Atemzüge. Sie ist in einem gewissen<br />
Bereich pathognomisch <strong>für</strong> vital bedrohliche, metabolische<br />
Störungen des Organismus. Im Rahmen zerebraler<br />
Regulationsstörungen, z. B. bei <strong>der</strong> Apoplexie, bei Hirntumoren<br />
o<strong>der</strong> Vergiftungen, ist nicht selten die periodische<br />
o<strong>der</strong> Cfteyne-Sfo/cessche Atmung zu beobachten. Bei diesem<br />
Atemtyp nimmt die Atemtiefe sukzessive ab, um von<br />
einem Minimum mit nur geringen Atembewegungen aus<br />
wie<strong>der</strong> auf übernormale Werte anzusteigen. Dieser Zustand<br />
wie<strong>der</strong>holt sich ständig. Bei Zeichen von erhöhtem Hirndruck<br />
tritt schließlich häufig die sogenannte ß/'ofsche Atmung<br />
auf. Eine Reihe normaler Atemzüge wird plötzlich<br />
durch eine längere Pause unterbrochen, in <strong>der</strong>en Gefolge<br />
die Atmung wie<strong>der</strong> in üblicher Weise einsetzt. Bei <strong>der</strong> Biotschen<br />
Atmung können aber auch Atemfrequenz, Zugvolumen<br />
und Atempausen völlig regellos abwechseln. Bei <strong>der</strong><br />
finalen Schnappatmung handelt es sich schließlich um<br />
maximal tiefe, nie<strong>der</strong>frequente Atemzüge, die <strong>für</strong> den Gasaustausch<br />
absolut ungenügend sind. Funktionen liegt hier<br />
also schon ein Atemstillstand vor.<br />
Atemnebengeräusche weisen einmal auf eine Obstruktion<br />
<strong>der</strong> Luftwege o<strong>der</strong> aber auch auf Verän<strong>der</strong>ungen des Lungenparenchyms<br />
hin. Schnarchende Atemgeräusche verursachen<br />
z. B. Obstruktionen im Bereich des Hypopharynx,<br />
etwa durch Zurücksinken <strong>der</strong> Zunge. Stridoröses Atmen<br />
tritt bei Atemwegshin<strong>der</strong>nissen im Bereich von Larynx und<br />
Trachea auf, Pfeiffen, Giemen und Brummen entstehen<br />
während <strong>der</strong> Exspiration durch bronchiale Obstruktionen<br />
und zähen Schleim in den Atemwegen. Grobes Rasseln und<br />
Gurgeln spricht <strong>für</strong> die Aspiration von Fremdsekreten o<strong>der</strong><br />
Sekretverhaltungen in <strong>der</strong> Trachea und den Hauptbronchien.<br />
Feines Rasseln ist dagegen beim Lungenödem und<br />
auch bei Pneumonien feststellbar.<br />
Von großer Wichtigkeit ist, daß beim Abchecken <strong>der</strong> hier<br />
dargestellten und im einzelnen charakterisierten Symptomatik<br />
gleichzeitig festgestellt wird, ob im Einzelfall Verletzungen<br />
o<strong>der</strong> Erkrankungen vorliegen, die sich direkt o<strong>der</strong><br />
indirekt negativ auf die Atemfunktion auswirken können.<br />
Dazu gehören Verletzungen <strong>der</strong> Mundhöhle, Kieferfrakturen,<br />
Traumen des Halses mit Schädigung, Teileinriß o<strong>der</strong> gar<br />
Abriß <strong>der</strong> Trachea, Schädigung <strong>der</strong> Atemwege durch Verbrennungen<br />
usw. In diesem Zusammenhang sind auch das<br />
371
Klingebiel, Respiratorische Störungen<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
allergische Ödem und Insektenstichverletzungen zu nennen.<br />
Auf Prellmarken o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Anhaltspunkte <strong>für</strong> eine<br />
Thoraxverletzung ist zu achten. Insbeson<strong>der</strong>e muß immer<br />
wie<strong>der</strong> auch an die Möglichkeit eines Pneumothorax gedacht<br />
werden, <strong>der</strong> häufig verkannt wird. Kommt es unter<br />
einer effektiven Beatmung nicht schnell zur Besserung <strong>der</strong><br />
Symptomatik, son<strong>der</strong>n ergibt sich eine zunehmende Zyanose<br />
und Erschwerung <strong>der</strong> Atmung o<strong>der</strong> Beatmung mit<br />
gleichzeitiger Verschlechterung <strong>der</strong> Kreislaufsituation,<br />
dann muß als erstes an einen Pneumothorax gedacht<br />
werden.<br />
Auch Verletzungen <strong>der</strong> Halswirbelsäule mit Schädigung des<br />
Rückenmarks können durch Ausfall <strong>der</strong> Atemmuskulatur<br />
schnell zu einer bedrohlichen Ateminsuffizienz führen.<br />
Schwere abdominelle Traumen, bei denen eventuel) eine<br />
Mitverletzung des Zwerchfells eingetreten ist, erfor<strong>der</strong>n<br />
ebenfalls unsere Aufmerksamkeit. Schließlich ist in diesem<br />
Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt des engen Verbundsystems<br />
<strong>der</strong> Vitalfunktionen <strong>der</strong> Schock zu nennen.<br />
Durch Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Transportkapazität <strong>für</strong> Sauerstoff,<br />
durch eine schockbedingte Störung <strong>der</strong> Lungenzirkulation<br />
entsteht ein mehr o<strong>der</strong> weniger ausgeprägter, häufig nicht<br />
erkennbarer Sauerstoffmangel, <strong>der</strong> sich natürlich schnell<br />
auf die übrigen vitalen Funktionen auswirkt und zu respiratorisch<br />
ausgelösten, aber z. B. kardiozirkulatorisch in Erscheinung<br />
tretenden Verän<strong>der</strong>ungen führt. Klinische Zeichen<br />
einer Ateminsuffizienz sind meist unspezifisch durch<br />
Hypoxie und Hyperkapnie ausgelöst. Praktisch bedeutungsvoll<br />
sind Unruhe, Verwirrtheit, Tachykardie und Hypertension,<br />
in schweren Fällen Bradykardie, Arrhythmie und Hypotension.<br />
Bei anämischen Patienten kann trotz ausgeprägter<br />
Hypoxie eine Zyanose fehlen.<br />
le Residualkapazität nimmt bei Lungenbeeinträchtigungen<br />
meist ab. Durch PEEP-Beatmung wird sie vergrößert, dadurch<br />
wird gleichzeitig die nach Exspiration in <strong>der</strong> Lunge<br />
verbleibende Luftmenge vergrößert. So kann sowohl die<br />
Sauerstoffversorgung des Organismus gebessert als auch<br />
die Hämodynamik des Lungenkreislaufs unterstützt werden.<br />
Eine PEEP-Beatmung kann natürlich auch mit Maske und<br />
Beatmungsbeutel durchgeführt werden.<br />
Wenn das Sauerstoffdefizit des Patienten gebessert ist,<br />
ist <strong>der</strong> funktionell wichtigste Teil <strong>der</strong> Therapie bestritten.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sedierung des unruhigen<br />
Patienten und die Schmerzbekämpfung. Innere Unruhe und<br />
Schmerzen können allein eine starke Stimulation des sympathischen<br />
Nervensystems mit seinen in dieser Situation<br />
nachteiligen Wirkungen auf Herz und Kreislauf im Sinne<br />
einer Verstärkung <strong>der</strong> Schockreaktion bewirken. Man<br />
spricht von <strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>der</strong> psychovegetativen Entkopplung.<br />
Lokalanästhesien sind am Notfallort nicht praktikabel.<br />
Eine intravenöse Schmerztherapie ist da am sichersten<br />
und wirkungsvollsten. Es sollten in <strong>der</strong> Regel Opiat-<br />
Analgetika gegeben werden. Die notwendigen hohen Dosen<br />
liegen alle in einem Bereich, in dem auch eine deutliche<br />
Atemdepression eintritt. Darum ist eine gute Analgesie meist<br />
mit <strong>der</strong> Indikation zur Intubation verbunden.<br />
Die gravierendste Erkrankung von Thorax und Lungen ist<br />
das Asthma bronchiale. Das zentrale Symptom ist die Bronchialobstruktion<br />
mit Mukoziliarinsuffizienz und Dyskrinie.<br />
Sämtliche Atemwegssyndrome bewegen sich von Anfang<br />
an zielstrebig und - wenn unbehandelt - unausweichlich<br />
dem Endpunkt mit Parenchym-, Alveolar- und Kapillarverlust<br />
und Fibröse entgegen. Je fortgeschrittener das Krankheitsbild<br />
ist, desto ernster ist <strong>der</strong> Zustand des Patienten<br />
und desto lebensgefährlicher sind akut einsetzende Ereignisse.<br />
Therapie <strong>der</strong> respiratorischen Insuffizienz<br />
Die Therapie <strong>der</strong> respiratorischen Insuffizienz muß nun die<br />
möglich werdende Dekompensation im Auge haben. Bei<br />
Erkrankungen o<strong>der</strong> Verletzungen von Thorax und Lungen<br />
muß in jedem Falle eine Leistungsmin<strong>der</strong>ung angenommen<br />
werden.<br />
Der wichtigste Aspekt ist die Oxygenierung des Patienten.<br />
Bei Gefahr einer Lungenverletzung o<strong>der</strong> -erkrankung muß<br />
generell Sauerstoff appliziert werden. Bessert sich darunter<br />
<strong>der</strong> Zustand des Patienten nicht entscheidend, bleibt z. B.<br />
eine Zyanose bestehen, muß <strong>der</strong> Patient künstlich beatmet<br />
werden. Am sichersten ist das mittels endotrachealer Intubation<br />
<strong>der</strong> Fall. Die Intubation sollte immer mit einer kontrollierten<br />
Beatmung unter Zugabe von Sauerstoff kombiniert<br />
sein. Optimal ist in den meisten Fällen weiterhin die<br />
Verwendung eines PEEP-Ventils. Beatmung mit PEEP bedeutet<br />
Beatmung mit einem positiven endexspiratorischen<br />
Druck. Dadurch, daß am Ende <strong>der</strong> Exspiration <strong>der</strong> Atemwegsdruck<br />
erhöht bleibt, resultiert eine vergrößerte funktionelle<br />
Residualkapazität (Kombination von Residualvolumen<br />
und endexspiratorischem Reservevolumen). Diefunktionel-<br />
Therapie des Status asthmaticus<br />
Eine Steigerung des Krankheitsbildes besteht im sogenannten<br />
Status asthmaticus. Die schwere Dyspnoe ist jedoch<br />
nicht allein Ausdruck <strong>der</strong> respiratorischen Insuffizienz, son<strong>der</strong>n<br />
vor allem <strong>der</strong> erhöhten Atemarbeit, die ihrerseits durch<br />
eine enorme Erhöhung des Atemwegswi<strong>der</strong>standes bewirkt<br />
wird. Die Säulen <strong>der</strong> Therapie des Asthma bronchiale sind:<br />
1. Kortikoide (250-500 mg Prednisolon)<br />
2. Broncholytika (z. B. Theophyllin-Abkömmlinge,/?2-Stimulator<br />
als Aerosol, Orciprenalin iv.) Mukolytika (Bromhexin)<br />
3. Sauerstoffgabe<br />
4. Sedativa (z. B. 5-10 mg Diazepam)<br />
5. Herz- und Kreislauftherapie.<br />
Therapie am Notfallort ist nicht die Interpretation von Daten<br />
<strong>der</strong> apparativen Diagnostik, son<strong>der</strong>n Einordnen von Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
die wir mit unseren Sinnen, bestenfalls noch mit<br />
einfachen Hilfsmitteln (Stethoskop, RR-Meßgerät, EKG-<br />
Monitor) wahrnehmen. Die Wahrnehmungen, zusammen mit<br />
372
Arztezeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Klingebiet, Respiratorische Störungen<br />
Befragung des Patienten und Umgebungsanamnese reichen<br />
völlig aus, um eine Elementargefahrdung zu erkennen<br />
und zu definieren. Eine Dekompensation kann nur verhin<strong>der</strong>t<br />
werden, wenn von Anfang an versucht wird, Atmung<br />
und Herz-Kreislauf-System zu optimieren. Je besser die<br />
Leistungsbedingungen sind, dadurch, daß man die Lungenfunktion<br />
künstlich z. B. durch Beatmungsmaßnahmen unterstutzt,<br />
desto eher verhin<strong>der</strong>t man, daß die an<strong>der</strong>en Vitalfunktionen<br />
konsekutiv durch Sauerstoffmangel geschädigt<br />
o<strong>der</strong> in ihren Kompensationsmöglichkeiten entscheidend<br />
eingeschränkt werden. Durch Aufrechterhaltung eines suffizienten<br />
Kreislaufs wie<strong>der</strong>um stellt man eine weitere Voraussetzung<br />
zur Überwindung eines Lungenschadens her<br />
Notfalltherapie bedeutet also, Beurteilen des Gesamtzustandes<br />
des Patienten unter Berücksichtigung aller Vitalfunktionen<br />
und Bedenken des therapeutischen Effekts in<br />
bezug auf den Gesamtorganismus Der Vitalfunktion Atmung<br />
kommt dabei die erste Stelle zu, da sie es ist, die<br />
die Sauerstoffversorgung des Korpers sichern muß. So ist<br />
z. B. auch ein kunstlicher Kreislauf ohne adäquate Zufuhr<br />
von Atemgas als nutzlose Übung anzusehen Notfalltherapie<br />
berücksichtigt immer das Überleben des Gesamtorganismus<br />
und ist nicht in erster Linie Organtherapie. Die bleibt<br />
<strong>der</strong> klinischen Versorgung vorbehalten<br />
Anschrift <strong>der</strong> Verfasserin Frau Dr H Khngebiel, Klinik <strong>für</strong> Anaesthesiologie<br />
<strong>der</strong> Stadtischen Kliniken, Pacelhallee 4, D-6400 Fulda<br />
o<br />
Aus dem Zentrum <strong>für</strong> Anasthesiologie<br />
(Leiter- Prof Dr F. W Ahnefeld, Prof Dr W Dick, Prof Dr Dr A Grunert)<br />
<strong>der</strong> Universität Ulm<br />
j. schäffer Sofortdiagnostik und -therapie bei kardiozirkulatorischen Notfällen<br />
O<br />
Zusammenfassung<br />
Bei <strong>der</strong> Behandlung von Notfallpatienten haben kardiozirkulatorische<br />
Notfälle einen sehr großen Anteil.<br />
Brustschmerz, Rhythmusstörungen, Bewußtlosigkeit,<br />
Herzinsuffizienz und Kreislaufstillstand sind Leitsymptome<br />
kardialer Funktionsstörungen und können<br />
zum Versagen einer suffizienten Zirkulation führen.<br />
Mit notfallmedizinischen Maßnahmen wie Lagerung,<br />
Sauerstoffgabe, Beatmung und dem Einsatz von<br />
Notfallmedikamenten wird versucht, die Vitalfunktionen<br />
wie<strong>der</strong>herzustellen und so das Überleben des<br />
Patienten zu sichern.<br />
Summary<br />
Cardio circulatory emergencies are one of the major<br />
sections of treatment required by emergency patients.<br />
Chest pain, rythmic disturbances, unconsciousness,<br />
heart insuff iciency and circulation standstill<br />
are the guiding Symptoms of cardiac functional<br />
disturbances and can lead to the failure of adequate<br />
circulation. Emergency medical treatment, such as<br />
bedding, the giving of oxygen, artificial respiration<br />
and the application of emergency medication are<br />
used to try to reobtain the vital funetions and thus<br />
ensure that the patient survives.<br />
Die Auswertung von Einsatzprotokollen verschiedener Notarztdienste<br />
hat gezeigt, daß internistische Notfalle einen<br />
immer größeren Anteil bei <strong>der</strong> Behandlung von Notfallpatienten<br />
haben. Dabei haben kardiozirkulatonsche Notfalle<br />
den größten Anteil Im folgenden soll daher die Diagnostik<br />
und Therapie <strong>der</strong> wichtigsten kardialen Störungen dargestellt<br />
werden, die zu einer Einschränkung <strong>der</strong> Zirkulation<br />
fuhren. Die wichtigsten Leitsymptome kardialer Funktionsstörungen<br />
sind <strong>der</strong> Brustschmerz, Rhythmusstorungen,<br />
Herzinsuffizienzzeichen, die kardiale Synkope und im extremsten<br />
Fall <strong>der</strong> Kreislaufstillstand (Tab. I)<br />
Tab I Leitsymptome kardialer Funktionsstörungen<br />
Brustschmerz<br />
Rhythmusstorungen<br />
Synkope<br />
Insuffizienzzeichen - Lungenodem<br />
- Schock<br />
Kreislaufstillstand<br />
1. Brustschmerz - Angina-pectoris-Anfall<br />
Eines <strong>der</strong> häufigsten Symptome, mit denen <strong>der</strong> Arzt beim<br />
kardialen Notfallpatienten konfrontiert ist, ist <strong>der</strong> Brustschmerz<br />
Er ist Ausdruck einer vorübergehenden o<strong>der</strong> per-<br />
373
Schaffen Kardiozirkulatorische Notfälle<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
manenten Ischämie am Myokard, sei es, daß es sich um<br />
einen Angina-pectoris-Anfall o<strong>der</strong> um die Manifestierung<br />
eines Herzinfarktes handelt. Bei durch Arteriosklerose verengten<br />
Koronargefäßen können körperliche o<strong>der</strong> seelische<br />
Belastung über eine Herzfrequenzerhöhung und einen<br />
Blutdruckanstieg zu einem Angina-pectoris-Anfall führen.<br />
Vorübergehen<strong>der</strong> Sauerstoffmangel des Herzmuskels verursacht<br />
ein starkes Schmerzereignis.<br />
Im Brustkorb entsteht ein retrosternales Engegefühl und<br />
ein stechen<strong>der</strong> Schmerz, <strong>der</strong> vor allem in den linken Arm<br />
ausstrahlt. Häufig sind damit Übelkeit und Erbrechen verbunden.<br />
Der Anfall dauert weniger als zehn bis zwanzig<br />
Minuten. Differentialdiagnostisch läßt sich <strong>der</strong> Angina-pectoris-Anfall<br />
vom Herzinfarkt durch die Gabe von Nitropräparaten<br />
unterscheiden: Hält <strong>der</strong> Brustschmerz auch nach<br />
Applikation dieser Medikamente weiter an, so ist <strong>der</strong> dringende<br />
Verdacht auf einen Herzinfarkt zu stellen.<br />
Der Patient mit dem Angina-pectoris-Anfall wird zunächst<br />
mit erhöhtem Oberkörper gelagert. Die diagnostische Gabe<br />
von Nitroglyzerin (Nitrolingual®) ist hier gleichzeitig die<br />
Therapie. In beson<strong>der</strong>s schweren Fällen kann Sauerstoff<br />
zur besseren Oxygenierung des Myokards gegeben werden.<br />
Gegebenenfalls ist eine Sedierung etwa mit Diazepam<br />
notwendig.<br />
2. Brustschmerz - Herzinfarkt<br />
Ist <strong>der</strong> Brustschmerz mit Nitropräparaten nicht zu unterdrücken,<br />
so besteht <strong>der</strong> dringende Verdacht auf einen<br />
Herzinfarkt. Arteriosklerose, Thrombose o<strong>der</strong> Embolie führen<br />
zum Verschluß einer Koronararterie und damit zum<br />
permanenten Sauerstoffmangel am Herzmuskel. Der Herzinfarkt<br />
mit Untergang von Herzmuskelgewebe ist die Folge.<br />
Rhythmusstörungen, kardiogener Schock o<strong>der</strong> ein kardiales<br />
Lungenödem können als Komplikationen auftreten.<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Symptomatik stehen die Todesangst<br />
des Patienten und die Schmerzen, die vor allem in den<br />
linken Arm ausstrahlen. Atypisch ist die Ausstrahlung in<br />
den rechten Arm, den Rücken o<strong>der</strong> das Abdomen, was als<br />
akutes Abdomen mit starken Koliken imponieren kann.<br />
Der Anfall dauert in <strong>der</strong> Regel immer länger als zwanzig<br />
Minuten.<br />
Der Patient wird zunächst mit erhöhtem Oberkörper gelagert,<br />
um den venösen Rückfluß zum Herzen zu vermin<strong>der</strong>n<br />
und dadurch eine Verbesserung <strong>der</strong> Myokardperfusion zu<br />
erreichen. Zur Vermeidung je<strong>der</strong> körperlichen Anstrengung<br />
wird <strong>der</strong> Patient immobilisiert. Zur Verbesserung <strong>der</strong> Oxygenierung<br />
des Myokards wird Sauerstoff insuffliert und die<br />
Vorlast des Herzens durch die Gabe von Nitroglyzerin gesenkt.<br />
Im gleichen Sinne wirkt Furosemid (Lasix®) in einer<br />
Dosierung von 20 mg. Jede weitere Belastung des Herzens<br />
soll durch eine gute Analgesie und Sedierung vermieden<br />
werden. Dazu eignet sich zum einen beson<strong>der</strong>s Morphin<br />
in einer Dosierung von 3 bis 5 mg i.V., da es zudem den<br />
Druck im kleinen Kreislauf senkt und zum an<strong>der</strong>en Diazepam<br />
5 mg i.v. Kontraindiziert sind in dieser Situation Pentazocin<br />
(Fortral®), da es den Wi<strong>der</strong>stand im Pulmonalkreislauf<br />
erhöht und damit eine Belastung des Herzens verursacht,<br />
und Digitalispräparate, da sie den Sauerstoffverbrauch<br />
im Myokard erhöhen und dadurch eine Ausdehnung<br />
<strong>der</strong> Infarktzone verursachen. Aus dem gleichen Grunde<br />
sollen Sympathikomimetika, wie Orciprenalin (Alupent®)<br />
und Adrenalin (Suprarenin®) nach Möglichkeit vermieden<br />
werden. Zu dieser allgemeinen Therapie des Myokardinfarktes<br />
kommt weiter die spezielle Therapie <strong>der</strong> Komplikationen<br />
wie Rhythmusstörungen, Lungenödem und kardiogener<br />
Schock. Wegen <strong>der</strong> akuten Lebensbedrohung dieser<br />
Patienten durch eventuell auftretende Rhythmusstörungen<br />
wird <strong>der</strong> Transport in die Klinik nach Möglichkeit immer in<br />
ärztlicher Begleitung und unter ständiger EKG-Überwachung<br />
durchgeführt.<br />
3. Komplikationen des Herzinfarktes - Rhythmusstörungen<br />
Von den Patienten, die innerhalb <strong>der</strong> ersten 24 Stunden an<br />
den Folgen eines Myokardinfarktes versterben, kommen<br />
50% innerhalb <strong>der</strong> ersten fünfzehn Minuten und weitere<br />
30% im weiteren Verlauf <strong>der</strong> ersten Stunde nach dem Infarktereignis<br />
zu Tode. Sie versterben an den Folgen lebensbedrohlicher<br />
Rhythmusstörungen. Ungefährlich sind die<br />
supraventrikulären Extrasystolen, sie sind nur zu therapieren,<br />
wenn sie in tachykar<strong>der</strong> Form vorliegen o<strong>der</strong> zu einer<br />
Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Auswurfleistung des Herzens und damit<br />
zum Blutdruckabfall führen. In diesem Falle werden 2,5 bis<br />
5 mg Verapramil (Isoptin®) intravenös injiziert.<br />
Eine schwere Gefährdung des Patienten stellen dagegen<br />
ventrikuläre Extrasystolen dar, da sie, vor allem, wenn sie<br />
polytopen Ursprung haben, zum Kammerflimmern führen<br />
können. Eine Therapie ist immer angezeigt, wenn mehr als<br />
zehn ventrikuläre Extrasystolen pro Minute auftreten. Die<br />
Injektion von 50 bis 100 mg Lidocain (Xylocain ) als Bolus<br />
ist hier angezeigt. Die antiarrhythmische Therapie wird mit<br />
einer Lidocain-Dauertropfinfusion aufrechterhalten.<br />
Der kardiale Notfallpatient ist auch durch eine totale Blokkierung<br />
<strong>der</strong> Reizleitung im Atrioventrikularknoten, also einem<br />
AV-Block III. Grades, vital bedroht. Mit einer gewissen<br />
Latenzzeit nach Beginn <strong>der</strong> Blockierung setzt ein Kammerersatzrhythmus<br />
in <strong>der</strong> Form ventrikulärer Extrasystolen mit<br />
einer Frequenz von 30 bis 40 pro Minute ein.<br />
Sklerose <strong>der</strong> Koronargefäße, Störungen des Elektrolythaushaltes<br />
und des Säuren-Basen-Haushaltes können die<br />
Ursache solcher Überleitungsstörungen sein. Infolge vermin<strong>der</strong>ter<br />
Auswurfleistung kommt es zum Sauerstoffmangel<br />
im Gehirn und damit zur Bewußtlosigkeit, die mit Krämpfen<br />
einhergehen kann. Man spricht von /Wam-Sfo/ces-Anfall<br />
o<strong>der</strong> von <strong>der</strong> kardialen Synkope. Ursachen können vor<br />
allem bradykarde, aber auch asystolische und tachykarde<br />
Rhythmusstörungen sein.<br />
Bleibt <strong>der</strong> Patient weiterhin bewußtlos, so ist er in stabile<br />
Seitenlage zu bringen. Gegegebenenfalls ist die Atem-<br />
374
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Schäffer, Kardiozirkulatorische Notfälle<br />
D<br />
spende durchzuführen. Bei weiterbestehendem Kreislauf-<br />
Stillstand ist mit <strong>der</strong> Herz-Lungen-Wie<strong>der</strong>belebung zu beginnen.<br />
Besteht lediglich eine Bradykardie, so wird zur<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Myokardoxygenierung Sauerstoff insuffliert.<br />
Zunächst werden 0,5 bis 1,0 mg Atropin gespritzt,<br />
um damit eine vagale Innervationslage zu unterdrücken.<br />
Eine Dosis von 2 mg Atropin soll nicht überschritten werden,<br />
da bei dieser Dosierung eine vollständige Vagusblockierung<br />
sicher erreicht ist. Läßt sich <strong>der</strong> Kreislauf so nicht<br />
stabilisieren, wird Orciprenalin (Alupent®) 0,1 mg weise<br />
eingesetzt. Zur weiteren sympathischen Stimulation können<br />
5 mg Orciprenalin als Infusionszusatz gegeben werden.<br />
Zur Dauertherapie ist in diesen Fällen fast immer die Implantation<br />
eines elektrischen Schrittmachers angezeigt.<br />
4. Komplikation des Herzinfarktes - Kreislaufstillstand<br />
Die schwerste Komplikation des Herzinfarktes o<strong>der</strong> zuvor<br />
bestehen<strong>der</strong> Rhythmusstörungen ist das Auftreten eines<br />
Kreislaufstillstandes. Dabei ist <strong>der</strong> klinische Tod, bei dem<br />
sich die zusammengebrochenen Organfunktionen durch<br />
rechtzeitiges Eingreifen möglicherweise vollkommen wie<strong>der</strong>herstellen<br />
lassen, von dem definitiven biologischen Tod<br />
zu unterscheiden, bei dem eine irreversible Schädigung <strong>der</strong><br />
Gewebe eingetreten ist. Sofort einsetzende Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> kardiopulmonalen Reanimation können einen Minimal-<br />
~~ kreislauf aufrechterhalten und damit eine Minimalperfusion<br />
des Gehirns, des Herzens und <strong>der</strong> Lunge sicherstellen.<br />
An erster Stelle steht daher die sichere Diagnostik des<br />
Kreislaufstillstandes anhand von Bewußtlosigkeit, völliger<br />
Muskelerschlaffung, weiten, lichtstarren Pupillen und eventuell<br />
bestehen<strong>der</strong> Zyanose bei gleichzeitiger Pulslosigkeit<br />
an den zentralen Arterien wie <strong>der</strong> Arteria carotis.<br />
Bei dieser Symptomatik haben sofort die Maßnahmen <strong>der</strong><br />
kardiopulmonalen Reanimation zu beginnen. Ist nur ein<br />
~\ Helfer am Notfallort, so beginnt er mit drei bis fünf Mundzu-Nase-<br />
beziehungsweise Mund-zu-Mund-Beatmungen,<br />
gefolgt von 15 Kompressionen <strong>der</strong> extrathorakalen Herzmassage,<br />
die weiter im Wechsel mit <strong>der</strong> Beatmung im Verhältnis<br />
2:15 durchgeführt wird.<br />
Günstiger ist es, wenn die Herz-Lungen-Wie<strong>der</strong>belebung<br />
von zwei Helfern durchgeführt werden kann. Dabei beginnt<br />
auch hier <strong>der</strong> eine mit drei bis fünf Beatmungen, an die<br />
sich eine permanente Herzmassage mit einer Frequenz<br />
von 60 pro Minute anschließen soll. Zur Beatmung nach<br />
je<strong>der</strong> fünften Kompression wird die Massage nicht unterbrochen,<br />
es wird also interponierend beatmet. Daraus ergibt<br />
sich ein Verhältnis von fünf Kompressionen zu einer Beatmung.<br />
Neben diesen Grundmaßnahmen <strong>der</strong> kardiopulmonalen<br />
Reanimation wird nun mit <strong>der</strong> erweiterten Therapie begonnen.<br />
Zunächst wird die Beatmung dadurch optimiert, daß<br />
die inspiratorische Sauerstoffkonzentration durch Einsatz<br />
eines Beatmungsbeutels auf 40 Vol% erhöht werden kann.<br />
Durch endotracheale Intubation besteht die Möglichkeit,<br />
die Atemfrequenz zu steigern und damit <strong>der</strong> metabolischen<br />
Tab. II: Therapie des Kreislaufstillstandes.<br />
Allgemein: Beatmung<br />
Herzmassage<br />
Sauerstoff<br />
Puffertherapie<br />
Asystolie: Orciprenalin -Adrenalin<br />
Kalzium<br />
Schrittmacher<br />
Kammerflimmerrv. Defibrillation<br />
Orciprenalin - Adrenalin<br />
Lidocain<br />
Hypostolie: Kalzium<br />
Orciprenalin - Adrenalin<br />
Azidose durch eine respiratorische Alkalose entgegenzuwirken.<br />
Als nächstes wird ein peripher- o<strong>der</strong> zentralvenöser Zugang<br />
geschaffen, über dem Natriumbikarbonat zum Ausgleich<br />
<strong>der</strong> metabolischen Azidose infundiert wird. Initial ist eine<br />
Dosierung von 1 mval Natriumbikarbonat pro kg Körpergewicht<br />
indiziert, erst nach zehn Minuten ist die Hälfte <strong>der</strong><br />
Initialdosis zu wie<strong>der</strong>holen.<br />
Erst nach diesen allgemeinen Maßnahmen, die bei je<strong>der</strong><br />
Form des Kreislaufstillstandes gleich durchgeführt werden,<br />
wird nun durch Ableiten des EKGs die Form des Kreislaufstillstandes<br />
differenziert. Wir unterscheiden die Asystolie,<br />
das Kammerflimmern und die Hyposystolie bzw. elektromechanische<br />
Entkopplung (Tab. II).<br />
Bei <strong>der</strong> Asystolie fehlt jede elektrische und mechanische<br />
Aktivität des Herzens, es liegt also ein echter Herzstillstand<br />
vor. Neben <strong>der</strong> Puffertherapie wird durch die hochdosierte<br />
Gabe von Sympathikomimetika - zuerst Orciprenalin (Alupent®)<br />
dann gegebenenfalls Adrenalin (Suprarenin®) -<br />
versucht, die Herzaktivität wie<strong>der</strong> herzustellen. Weiterhin<br />
wird Kalzium injiziert, da es die Sinuserregbarkeit erhöht<br />
und zudem die elektromechanische Kopplung vermittelt.<br />
Beim Kammerflimmern handelt es sich um einen Zustand<br />
unkoordinierter, gegeneinan<strong>der</strong>laufen<strong>der</strong> Erregungen des<br />
Myokards, man spricht auch von einer kreisenden Erregung.<br />
Dieser Zustand des Herzens ist hämodynamisch uneffektiv,<br />
ein Kreislaufstilistand liegt auch hier vor. Die Therapie <strong>der</strong><br />
Wahl ist die elektrische Defibrillation. Im allgemeinen wird<br />
ein initialer Stromstoß von 200 bis 300 Joules empfohlen,<br />
<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> nächsten Defibrillation auf 400 Joules gesteigert<br />
wird. Sehr häufig wird auch hier <strong>der</strong> Einsatz von Sympathikomimetika<br />
notwendig, einmal um die Reizschwelle<br />
des Myokards herabzusetzen, zum an<strong>der</strong>en, um nach erfolgreicher<br />
Defibrillation bei nun sehr häufig bestehen<strong>der</strong><br />
Asystolie einen Sinusrhythmus zu induzieren. Steht kein<br />
Defibrillator zur Verfügung, so ist auch <strong>der</strong> Versuch einer<br />
medikamentösen Defibrillation mit Lidocain (Xylocain®)<br />
möglich. Dazu werden mindestens 100 mg als Bolus injiziert.<br />
Der Einsatz von Lidocain ist auch angezeigt, wenn<br />
ein Kammerflimmern elektrisch nicht zu durchbrechen ist<br />
und zur Prophylaxe ventrikulärer Rhythmusstörungen nach<br />
erfolgreicher Defibrillation.<br />
375
Schäffer, Kardiozirkulatorische Notfälle<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Bei <strong>der</strong> Hyposystolie sehen wir auf dem EKG-Monitor bradykarde,<br />
träge und deformierte Kammerkomplexe, ohne<br />
daß eine Auswurfleistung des Herzens vorliegt. Auch bei<br />
diesen Patienten imponiert die klinische Symptomatik des<br />
Kreislaufstillstandes. Grund ist die elektromechanische<br />
Entkopplung von Reizleitungssystem und kontraktilen<br />
Filamenten <strong>der</strong> Muskulaltur. Diese Kopplung wird durch<br />
Kalzium vermittelt, weswegen hier die Injektion von 5 bis<br />
10 mg Kalziumglukonat indiziert ist. Als zusätzliche Therapie<br />
wird häufig <strong>der</strong> Einsatz von Sympathikomimetika notwendig,<br />
um die Reizbildung, Reizleitung und Kontraktionskraft<br />
des Herzens zu verbessern.<br />
Der Erfolg <strong>der</strong> Reanimation wird anhand <strong>der</strong> gleichen Zeichen<br />
überprüft wie <strong>der</strong> Kreislaufstillstand.<br />
4. Komplikationen des Herzinfarktes - Pumpversagen des<br />
Myokards<br />
Infolge <strong>der</strong> Herzmuskelschädigung beim Myokardinfarkt<br />
kann es zum akuten Pumpversagen des Herzens kommen.<br />
Es äußert sich zum einen als kardiales Lungenödem, zum<br />
an<strong>der</strong>en als kardiogener Schock. Infolge <strong>der</strong> Blutstauung<br />
in <strong>der</strong> Lunge im Rahmen des Linksherzversagens tritt Serum<br />
aus den Kapillaren in die Alveolen aus. Die Vergrößerung<br />
<strong>der</strong> Diffusionsstrecke stört den Gasaustausch in <strong>der</strong> Lunge.<br />
Hypoxie und Hyperkapnie sind die Folge. Durch Einreißen<br />
<strong>der</strong> Alveolarwände entsteht <strong>der</strong> klassisch beschriebene<br />
fleischwasserfarbene Schaum.<br />
Die Patienten sind dyspnoeisch und zyanotisch, die grobblasigen<br />
Rasselgeräusche sind meist schon ohne Stethoskop<br />
zu hören. Bei einer Rechtsherz-Beteiligung fällt eventuell<br />
die vermehrte Venenfüllung auf. Nur in schwersten<br />
Fällen tritt Schaum aus dem Mund.<br />
Der Patient wird zunächst halbsitzend gelagert, zur Vermeidung<br />
<strong>der</strong> Hypoxie wird Sauerstoff insuffliert. Der Pulmonalarteriendruck<br />
und damit die Vorlast des Herzens wird<br />
durch die Gabe von Furosemid und Nitroglyzerin gesenkt.<br />
Den gleichen Effekt hat eine Sedierung mit 3 bis 5 mg<br />
Morphin. Eventuell wird die Herzkraft durch Digitalspräparate<br />
gesteigert. In schwersten Fällen müssen die Patienten<br />
intubiert und mit positiv endexspiratorischem Druck (PEEP)<br />
beatment werden.<br />
Ausdruck des muskulären Pumpversagens auf <strong>der</strong> arteriellen<br />
Seite ist <strong>der</strong> kardiogene Schock. Über den Abfall des<br />
Herz-Minuten-Volumens kommt es zu einer Engstellung<br />
<strong>der</strong> peripheren Gefäße. Diese als Zentralisation bezeichnete<br />
Notfallreaktion führt zu einem Sauerstoffmangel im Gewebe<br />
und damit zu einer schweren metabolischen Gewebsazidose.<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> klinischen Symptomatik stehen <strong>der</strong><br />
Blutdruckabfall und die kompensatorische Tachykardie als<br />
Ausdruck des vermin<strong>der</strong>ten Stromzeitvolumens. Beim kardiogenen<br />
Schock können jedoch auch bradykarde Rhythmusstörungen<br />
zu <strong>der</strong> beschriebenen Zirkulationsstörung<br />
führen, weswegen <strong>der</strong> von Algöwer und Burri entwickelte<br />
Schock-Index hier nicht immer gültig ist. Die gestörte Mikrozirkulation<br />
läßt sich an <strong>der</strong> kalten, blassen Haut, an <strong>der</strong><br />
Zyanose und <strong>der</strong> vermin<strong>der</strong>ten Füliungszeit des Nagelbettes<br />
erkennen. Eventuell besteht gleichzeitig im großen und/<br />
o<strong>der</strong> kleinen Kreislauf eine venöse Stauung, prall gefüllte<br />
Venen und die Manifestierung eines Lungenödems sind<br />
dann das klinische Korrelat. Diese Patienten werden im<br />
Gegensatz zu allen an<strong>der</strong>en Schockpatienten mit erhöhtem<br />
Oberkörper gelagert. Sie werden sediert und zur Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Hypoxämie mit Sauerstoff behandelt. Erst dann<br />
erfolgt die ursächliche Therapie <strong>der</strong> Rhythmusstörungen<br />
beziehungsweise des Lungenödems. Läßt sich dadurch<br />
<strong>der</strong> Kreislauf nicht stabilisieren, so ist Dopamin als Dauertropfinfusion<br />
indiziert. In sehr seltenen Fällen kann auch<br />
eine leichte Volumensubstitution notwendig werden, eine<br />
genaue Beobachtung <strong>der</strong> Stauungszeichen ist jedoch notwendig.<br />
Bei manifester Stauungsinsuffizienz sind Volumenersatzmittel<br />
streng kontraindiziert.<br />
In einer kurzen Übersicht sollten die kardialen Ursachen<br />
zirkulatorischer Notfälle in Sofortdiagnostik und -therapie<br />
dargestellt werden. Myokardinfarkt, Rhythmusstörungen<br />
und kardiales Pumpversagen mit Lungenödem und kardiogenem<br />
Schock sind lebensbedrohliche Störungen <strong>der</strong><br />
Vitalfunktionen, die einen gezielten ärztlichen Einsatz erfor<strong>der</strong>n.<br />
Anschrift des Verfassers: Dr. med. J. Schäffer, Zentrum <strong>für</strong> Anästhesie<br />
<strong>der</strong> Universität, Prittwitzstraße 43, D-7900 Ulm.<br />
1921-1981<br />
60 Jahre<br />
SANATO-RHEV<br />
Gelenkrheuma, Lumbago, Ischias, Gicht, Muskelschmerzen<br />
und Prellungen aller Art, rheumatische und neuralgische<br />
Beschwerden — alterprobtes Einreibemittel — Die gestauten<br />
u. schmerzh. Stellen morgens u. abends gut einmassieren.<br />
Arztemuster auf Wunsch DM 8,90 u. DM 20,20<br />
Zus.: 10 ml enth. Camph. 400 mg, Chlorof. 480 mg, Ol. Tereb.<br />
rect. 480 mg, Ol. pin. silv. 480 mg, Methyl, salicyl. 80 mg,<br />
Liqu. Ammonii caust. 80 mg. Rhus. tox. D 4 80 mg, Sulf. D 4<br />
80 mg, Ol. Arach. et Emuig, qs. — 100-ml- u. 250-ml-Packg. —<br />
| Bitte beachten:^ Dr. Hotz Kin<strong>der</strong>- und Vollbad zur Haut- und Körperpflege<br />
_ Dr. W. Hotz & Co. Nachf., 7053 Kernen im Remstal b. Stuttgart.<br />
®<br />
NiNo-Fluid<br />
vielseitig belebend<br />
und schmerzstillend<br />
— äußerlich und<br />
Innerlich anzuwenden —<br />
1 ml enth.:<br />
Ol. menth. pip. 300 mg<br />
Menth. Christ. 30 mg<br />
Spir. ad —<br />
10- u. 30-ml-Packg.<br />
376
Aus dem Zentrum <strong>für</strong> Anasthesiologie (Leiter Prof Dr F W Ahnefeld, Prof Dr W Dick, Prof Dr Dr A Grunert)<br />
<strong>der</strong> Universität Ulm<br />
H. H. Mehrkens Notfallmedizin als Grundlage <strong>der</strong> Katastrophenmedizin: Notfallkasuistiken<br />
Zusammenfassung<br />
Verschiedene Umwelteinflüsse können zu lebensbedrohlichen<br />
Störungen <strong>der</strong> Wärmeregulation des<br />
menschlichen Organismus führen. An zwei Fallbeispielen<br />
werden die protrahierte akzidentelle Unterkühlung<br />
und die Hitzeerschöpfung dargestellt. Es<br />
werden insbeson<strong>der</strong>e die diagnostischen und therapeutischen<br />
Erstmaßnahmen bei<strong>der</strong> Krankheitsbil<strong>der</strong><br />
besprochen, die gerade auch unter katastrophenmedizinischen<br />
Gesichtspunkten relevant werden<br />
können.<br />
Summary<br />
Diverse ambient conditions can cause life endangering<br />
disturbances to the heat regulating mechanism<br />
in the human organism. Two examples are used<br />
to demonstrate this: protracted accidental un<strong>der</strong>cooling<br />
and heat exhaustion. Particular emphasis is<br />
given to the first diagnostic and therapeutic steps<br />
for both types of illness, which can be particularly<br />
relevant from catastrophe medical aspects.<br />
Eine ungestörte Wärmeregulation stellt eine wesentliche<br />
Grundvoraussetzung <strong>für</strong> die Existenz des menschlichen<br />
Organismus dar Dieser als „thermische Homöostase" bezeichnete<br />
Zustand wird durch einen geregelten Gleichgewichtszustand<br />
zwischen Wärmeabgabe (durch Strahlung,<br />
Konduktion, Konvektion und Perspiratio) und Warmebelastung<br />
(durch Umwelt und endogen-metabolische Warmeproduktion)<br />
aufrechterhalten Außer individuellen Faktoren,<br />
wie Zustandsbild und Leistungsbreite des Herz-Kreislaufsystems,<br />
des Wasser-Elektrolythaushaltes und <strong>der</strong> Schweißdrusenfunktion<br />
kommt <strong>für</strong> Störungen dieses Gleichgewichtszustandes<br />
darüber hinaus auch Umweltfaktoren wie<br />
Luftbewegung und Luftfeuchtigkeit eine unter Umstanden<br />
entscheidende Bedeutung zu Diese Möglichkeit kann nicht<br />
zuletzt gerade unter den Bedingungen einer Katastrophensituation<br />
zum Tragen kommen<br />
Erstes Fallbeispiel<br />
Notfallmeldung<br />
In den frühen Morgenstunden eines Dezembertages Anruf<br />
beim Hausarzt, ein junger Mann sei bewußtlos und pulslos<br />
im Schnee aufgefunden worden Beim Transport ms Haus<br />
sei noch Stöhnen vernommen worden<br />
Erstbefund<br />
Zirka eine halbe Stunde spater trifft <strong>der</strong> Hausarzt beim<br />
Patienten ein Dieser ist tief bewußtlos mit weiten, lichtstarren<br />
Pupillen, Pulse sind nicht tastbar, eine Atmung ist<br />
nicht festzustellen, <strong>der</strong> gesamte Korper fühlt sich eiskalt an<br />
Verdachtsdiagnose<br />
Schwere Unterkühlung<br />
Soforttherapie<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> Angehörigen wird <strong>der</strong> Unterkühlte in eine Zinkwanne<br />
mit heißem Wasser gelegt Der Hausarzt fuhrt zirka<br />
eineinhalb Stunden lang die kardiopulmonale Reanimation<br />
ohne sichtbaren Effekt allein durch<br />
Weiterfuhrende Maßnahmen<br />
Nach zirka an<strong>der</strong>thalb Stunden trifft <strong>der</strong> Notarztwagen mit<br />
Notarzt und zwei Rettungssanitätern ein Sie fuhren gemeinsam<br />
die kardiopulmonale Reanimation fort Im EKG zeigt<br />
sich eine fragliche Null-Linie Alupent intrakardial injiziert<br />
hat keinen Effekt Einige Minuten nach Defibnllation kommt<br />
es unter Fortfuhrung <strong>der</strong> kardiopulmonalen Reanimation<br />
jedoch zu Herzaktionen und Wie<strong>der</strong>einsetzen <strong>der</strong> Spontanatmung<br />
Intravenös wird 1 g Urbason injiziert, außerdem<br />
werden 500 ml einer angewärmten Glukoselosung infundiert<br />
Etwa zweieinhalb Stunden nach Beginn <strong>der</strong> Reanimationsmaßnahmen<br />
(zirka dreieinhalb bis vier Stunden<br />
nach Auffinden des Patienten) sind Atmung und Kreislauf<br />
stabilisiert, und es erfolgt <strong>der</strong> Transport in die Klinik<br />
Aufnahmebefund in <strong>der</strong> Klinik<br />
a) Der Patient ist weiterhin bewußtlos, atmet spontan, Puls<br />
120/mm, Blutdruck 140/100 Es besteht eine geringe<br />
üppenzyanose, es liegen keine Erfnerungs- o<strong>der</strong> sonstigen<br />
Verletzungszeichen vor Die Rektaltemperatur betragt<br />
32°C, die Pupillen sind mittelweit, zeigen keine<br />
Lichtreaktionen und keine Kornealreflexe<br />
b) Im EKG Smustachykardie, sonst o B Im Rontgen-Thorax<br />
sind beide Lungen belüftet Es ist eine Transparentsmin<strong>der</strong>ung<br />
im rechten Oberfeld zu erkennen<br />
c) Laborbefunde<br />
Hk 49%, Na+ 126 mmol/i, K 4 5,8 mmol/l, BZ 28 mg%,<br />
Blutgasanalyse<br />
pH 7,0, pCO 2 46, pO 2 110, BE -20<br />
Diagnose<br />
Schwere protrahierte akzidentelle Unterkühlung<br />
Verlauf<br />
Innerhalb von fünf Stunden wird <strong>der</strong> Patient mittels Warmeapplikation<br />
im Stammbereich durch einen Lichtbogen<br />
sowie die intravenöse Zufuhr angewärmter Glukoselosungen<br />
auf normale Korpertemperatur erwärmt Zusätzlich wird<br />
Glukose intravenös verabfolgt, außerdem wird die Azidose<br />
mit Natriumbikarbonat ausgeglichen Weiterhin werden<br />
gegeben 10 000 Einheiten Liquemin pro 24 Stunden, Dopamm<br />
in niedriger Dosierung, 100 mg Fortecortin zur Hirnodemprophylaxe<br />
sowie Binotal als antibiotische Abschirmung<br />
Am Folgetag ist <strong>der</strong> Patient erweckbar und wird zunehmend<br />
ansprechbar Es kommt allerdings zu einem kontinuierli-<br />
377
Mehrkens, Katastrophenmedizin<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
chen Anstieg <strong>der</strong> harnpflichtigen Substanzen und des<br />
Serumkaliums, die eine Dialyse erfor<strong>der</strong>lich machen, obwohl<br />
noch eine ausreichende Urinausscheidung vorliegt. Ferner<br />
kommt es zu einem erheblichen Anstieg <strong>der</strong> Transaminasen.<br />
Nach fortschreiten<strong>der</strong> Besserung des Allgemeinzustandes<br />
ereignet sich in <strong>der</strong> siebenten Nacht nach dem ursächlichen<br />
Geschehen eine unerklärbare Aspiration, die zum<br />
Kreislaufstillstand führt. Die Reanimation ist zwar primär<br />
erfolgreich, <strong>der</strong> Patient verstirbt jedoch drei Tage später<br />
an den Folgen <strong>der</strong> Aspiration.<br />
Zusammenfassung<br />
Der junge Mann war in alkoholisiertem Zustand auf dem<br />
nächtlichen Nachhausewege vor Erschöpfung und Übermüdung<br />
im Schnee eingeschlafen. Geför<strong>der</strong>t durch den<br />
Alkoholeinfluß kam es bedingt durch den Schnee und Frost<br />
zum Abfall <strong>der</strong> Körpertemperatur in einen Bereich, <strong>der</strong><br />
sicher weit unterhalb von 30° Celsius gelegen haben muß.<br />
In diesem Zustand des „Scheintodes" wurde er von seinen<br />
Angehörigen gefunden.<br />
Bei einer Unterkühlung ist auch in diesem extremen Stadium<br />
noch eine vollständige Restitution möglich. Vor einer<br />
Wie<strong>der</strong>erwärmung im heißen Wannenganzkörperbad wird<br />
heute jedoch allgemein gewarnt wegen <strong>der</strong> Gefahr des<br />
sogenannten „Wie<strong>der</strong>erwärmungsschocks", wenn nämlich<br />
durch die plötzliche periphere Gefäßweitstellung massiv<br />
kaltes Schalenblut in die zentralen Körperregionen eingeschwemmt<br />
wird. Empfohlen wird dagegen insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong><br />
die Notfalltherapie das Auflegen von Wärmepackungen<br />
nach Hibler auf den Thorax mit anschließendem Einhüllen<br />
des gesamten Körpers in warme Decken. Gewarnt wird<br />
auch vor <strong>der</strong> Anwendung von Lichtbogen, da die Gefahr<br />
von Verbrennungen bei unterkühlten Patienten beson<strong>der</strong>s<br />
groß ist.<br />
Im genannten Fall waren die mehrstündigen Reanimationsbemühungen<br />
und die Wie<strong>der</strong>erwärmung im Ganzkörperbad<br />
primär erfolgreich. Auffallen<strong>der</strong>weise war <strong>der</strong> Patient jedoch<br />
bei <strong>der</strong> Aufnahme in <strong>der</strong> Klinik trotz seiner Kerntemperatur<br />
von über 30°C weiterhin bewußtlos. Als Ursachen dieser<br />
Bewußtlosigkeit kommen neben <strong>der</strong> Hypoglykämie auch<br />
ein bereits eingetretenes Hirnödem und die schwere metabolische<br />
Entgleisung in Frage. Die Hypoglykämie ist ein<br />
wesentliches Kennzeichen <strong>der</strong> protrahierten akzidentellen<br />
Unterkühlung und Ausdruck <strong>der</strong> maximalen Inanspruchnahme<br />
sämtlicher Energiereserven. Charakteristisch sind<br />
ferner Hyponatriämie, Hyperkaliämie sowie eine Hämokonzentration<br />
bei relativem Volumenmangel.<br />
Trotz ausreichen<strong>der</strong> Flüssigkeitssubstitution und Diurese<br />
kam es zu einem Nierenversagen (wahrscheinlich bedingt<br />
durch eine Myoglobinurie), das zu einer Dialysebehandlung<br />
zwang. Die trotz <strong>der</strong> fortschreitenden Besserung des Allgemeinzustandes<br />
in <strong>der</strong> siebten Nacht aufgetretene Aspiration,<br />
die schließlich den deletären Ausgang zur Folge hatte, ist<br />
letztlich nicht eindeutig zu erklären. Zu diskutieren sind<br />
mögliche Spätkomplikationen in Form schwerwiegen<strong>der</strong><br />
Herzrhythmusstörungen o<strong>der</strong> auch ein Krampfanfall, die in<br />
<strong>der</strong> Literatur als Spätfolgen beschrieben werden.<br />
Zweites Fallbeispiel<br />
Notfallmeldung<br />
Im Hochsommer wird <strong>der</strong> Hausarzt nachmittags von einem<br />
aufgeregten Ehemann angerufen, seiner Frau gehe es<br />
schlecht, sie sei so schläfrig, außerdem klage sie über<br />
Übelkeit. Dabei sei es ihr den ganzen Tag über gut gegangen.<br />
Erstbefund<br />
Der Hausarzt trifft zirka eine Stunde später bei <strong>der</strong> etwa<br />
dreißigjährigen Patientin ein. Sie liegt apathisch, aber ansprechbar<br />
im Bett. Das Hautkolorit ist blaß. Der Blutdruck<br />
beträgt 90/40 mg Hg, die Herzfrequenz 100/min. Der Ehemann<br />
berichtet, seine Frau sei sonst immer gesund gewesen.<br />
Erst am Nachmittag habe sie sich plötzlich nicht mehr<br />
wohlgefühlt. Die rektale Temperatur beträgt 37,5°C. Bei <strong>der</strong><br />
neurologischen Untersuchung und <strong>der</strong> Auskultation stellt<br />
<strong>der</strong> Hausarzt keine pathologischen Befunde fest. Ihm fällt<br />
nur die ausgetrocknete Zunge <strong>der</strong> Patientin auf.<br />
Verdachtsdiagnose<br />
Hitzeerschöpfung.<br />
Soforttherapie<br />
Der Hausarzt läßt die Beine <strong>der</strong> Patientin hochlegen und<br />
die Bettdecke entfernen. Er gibt <strong>der</strong> Patientin ein Glas Wasser<br />
zu trinken. Um eine an<strong>der</strong>e Ursache <strong>der</strong> plötzlichen<br />
Erkrankung auszuschließen, weist er die Patientin in die<br />
innere Abteilung des Kreiskrankenhauses ein und beauftragt<br />
den Ehemann, bis zum Eintreffen des Krankenwagens<br />
kalte Wadenwickel zu machen.<br />
Aufnahmebefund in <strong>der</strong> Klinik<br />
a) Bei <strong>der</strong> stationären Aufnahme ist die Patientin noch leicht<br />
schläfrig, <strong>der</strong> Blutdruck beträgt 100/55 mg Hg, die Herzfrequenz<br />
110/min.<br />
b) EKG und Röntgen-Thoraxbefund sind o. B.<br />
c) Laborbefunde:<br />
Hk 58%, Na+ 134 mmol/l, K+ 4,3 mmol/l, Harnstoff 12<br />
mmol/l, Kreatinin 163/umol/l, geringe Urinauscheidung,<br />
hochkonzentriert, mit einem spezifischen Gewicht von<br />
1030.<br />
Diagnose<br />
Hitzeerschöpfung.<br />
Verlauf<br />
Während <strong>der</strong> Nacht wird <strong>der</strong> Patientin reichlich zu trinken<br />
angeboten. Nachdem sie zwei Liter einer Elektrolytlimonade<br />
zu sich genommen hat, ist <strong>der</strong> Befund so weit gebessert,<br />
daß sie am nächsten Morgen nach Hause entlassen<br />
werden kann.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Patientin hatte sich den ganzen Tag über beim Sonnen<br />
bei hochsommerlichen Temperaturen im Garten <strong>der</strong> prallen<br />
Sonne ausgesetzt. Durch starkes Schwitzen kam es zu<br />
378
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Mehrkens, Katastrophenmedizin<br />
o<br />
einer isotonen Dehydratation, die am Nachmittag mit beginnen<strong>der</strong><br />
Schocksymptomatik und Bewußtseinstrübung<br />
die typischen Symptome einer Hitzeerschöpfung auslöste.<br />
Im Gegensatz zum Hitzschlag, <strong>der</strong> bei länger anhalten<strong>der</strong><br />
Hitzeexposition aus <strong>der</strong> Hitzeerschöpfung hervorgeht,<br />
kommt es hier noch nicht zum signifikanten Anstieg <strong>der</strong><br />
Körperkerntemperatur. Der Anstieg des Hämatokrit bestätigt<br />
den Flüssigkeitsverlust aus dem Extrazellulärraum und<br />
speziell aus dem Intravasalraum im Sinne einer „Eindikkung".<br />
Da beim Schwitzen Elektrolyte mit verlorengehen,<br />
sind diese im Serum nicht o<strong>der</strong> nur unwesentlich verän<strong>der</strong>t.<br />
Durch die vermin<strong>der</strong>te Urinausscheidung steigen Serumharnstoff<br />
und -kreatinin in den oberen Normbereich, gleichzeitig<br />
steigt auch das spezifische Gewicht des Urins an.<br />
Das Krankheitsbild wurde vom behandelnden Arzt richtig<br />
erkannt. Es wurde eine Schocklagerung durchgeführt und<br />
die physikalische Kühlung angeordnet. Außerdem wurde<br />
mit einer oralen Flüssigkeitssubstitution begonnen. Da<strong>für</strong><br />
ist am besten eine Elektrolytlimonade geeignet, wie sie in<br />
<strong>der</strong> Klinik gegeben wurde. Damit werden außer <strong>der</strong> Flüssigkeit<br />
insbeson<strong>der</strong>e auch die notwendigen Elektrolyte und<br />
Kalorien zugeführt. Bei bewußtlosen Patienten und bei Patienten<br />
mit ausgeprägter Schocksymptomatik ist die orale<br />
Flüssigkeitssubstitution kontraindiziert; in diesen Fällen ist<br />
die rasche intravenöse Zufuhr von mindestens 1000 ml<br />
Ringerlaktatlösung vordringlich.<br />
Unter katastrophenmedizinischen Aspekten sind zur Vermeidung<br />
von Hitzeschäden außer <strong>der</strong> individuellen körperlichen<br />
Konstitution und Leistungsbreite insbeson<strong>der</strong>e prophylaktische<br />
Maßnahmen von Bedeutung:<br />
1. Alle gefährdeten Personen (insbeson<strong>der</strong>e Säuglinge,<br />
Kleinkin<strong>der</strong>, alte Menschen und generell diejenigen mit<br />
eingeschränkter kardiozirkulatorischer Leistungsbreite)<br />
sind soweit wie möglich vor Hitzebelastungen zu schützen.<br />
2. Eingetretene Verluste (zum Beispiel durch vermehrte<br />
Schweißproduktion o<strong>der</strong> auch durch bestimmte Erkrankungen,<br />
die mit Erbrechen o<strong>der</strong> Durchfällen einhergehen)<br />
müssen rechtzeitig und adäquat ersetzt werden. Gerade<br />
auch Herzkreislaufkranke müssen unter den Bedingungen<br />
äußerer Hitzeeinwirkung ausreichende Flüssigkeitsmengen<br />
zu sich nehmen. Eine Flüssigkeitsrestriktion <strong>für</strong><br />
diese Patienten in <strong>der</strong>artigen Situationen ist absolut<br />
falsch.<br />
3. Übliche Getränke wie Tee und Kaffee o<strong>der</strong> auch Mineralwasser<br />
sind wegen ihres mangelnden Gehaltes an<br />
Elektrolyten und Kalorien <strong>für</strong> eine adäquate Substitution<br />
nicht ausreichend. Besser geeignet sind Fruchtsäfte<br />
o<strong>der</strong> im Handel erhältliche Elektrolytkonzentrate, die<br />
individuell mit Wasser zubereitet werden können.<br />
Literatur<br />
1. Ahnefeld, F. W., H. Klingebiel, H.-H. Mehrkens: Pathophysiologie<br />
und Therapie von Kälteschäden. Med. Klin. 74, 1833 (1979).<br />
2. Mehrkens, H.-H., F. W. Ahnefeld, W. Seeling: Notfalltherapie be<br />
Hiteeschäden. Notfallmed. 6, 683 (1980).<br />
3. Neureuther, G., G. Flora: Kälteschäden. Notfallmed. 4, 103<br />
(1978).<br />
4. Nobbe, F.: Schäden durch Kälte und Unterkühlung. Wehrmed.<br />
Mschr. 6, 183 (1978).<br />
Anschrift des Verfassers: PD Dr. med. H.-H. Mehrkens, Zentrum<br />
<strong>für</strong> Anästhesie <strong>der</strong> Universität, Prittwitzstraße 43, D-7900 Ulm.<br />
o<br />
H. Krauß Naturheilverfahren in <strong>der</strong> heutigen Medizin - Erfahrungen und Perspektiven<br />
Zusammenfassung<br />
Seit <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>twende in Deutschland gesammelte<br />
Erfahrungen mit dem Naturheilverfahren bzw.<br />
<strong>der</strong> Physiotherapie werden ausgewertet. Dabei wurden<br />
insbeson<strong>der</strong>e Fragen <strong>der</strong> Lehre und Lernbarkeit<br />
sowie <strong>der</strong> Integrationsmöglichkeiten im Hochschulbereich<br />
erörtert. Es werden erfolgreiche Beispiele<br />
des Dialogs mit <strong>der</strong> Gesamtmedizin geschil<strong>der</strong>t und<br />
das Modell einer zentralen Abteilung <strong>für</strong> Physiotherapie<br />
als Rehabilitationsstätte <strong>für</strong> alle Disziplinen innerhalb<br />
des Allgemeinen Krankenhauses dargestellt.<br />
Summary<br />
Experience gained in Germany since the turn of the<br />
Century with naturopathic and physiotherapy treatment<br />
is evaluated. Particular attention is given to<br />
the questions concerning training and trainability as<br />
well as the possibilities of integration into the university<br />
sector. Successful examples of the dialogue<br />
with the medical sector are described, and the model<br />
of a central physiotherapy department as a rehabilitation<br />
centre for all disciplines in a general hospital,<br />
are described.<br />
Vor wenigen Monaten gedachten wir mit einem wissenschaftlichen<br />
Symposion des 75jährigen Bestehens des<br />
ersten Lehrstuhls <strong>für</strong> unser Fachgebiet in Deutschland.<br />
Wenn oft gemahnt wird, wir sollten mehr aus <strong>der</strong> Geschichte<br />
lernen, so kann dies, wie ich meine, auch <strong>für</strong> die Medizingeschichte<br />
gelten.<br />
379
Krauß, Naturheilverfahren<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Der erste deutsche Lehrstuhl unseres Fachgebietes wurde<br />
1905 in Berlin gegründet und mit Ludwig Brieger besetzt.<br />
Brieger war durch die internistische Schule <strong>der</strong> Charite<br />
gegangen und in späteren Jahren einer <strong>der</strong> produktivsten<br />
und engen Mitarbeiter Robert Kochs. Die Institutsgrundlage<br />
seines Lehrstuhls war die Hydrotherapeutsiche Universitätsanstalt.<br />
Zur Vorbereitung <strong>für</strong> seine neue Aufgabe hospitierte Brieger<br />
bei Winternitz in Wien, dem ersten wissenschaftlichen Interpreten<br />
<strong>der</strong> von dem genialen Bauern Vinzenz Prießnitz<br />
entwickelten Wasserbehandlung.<br />
So spannte sich <strong>der</strong> Bogen von dem damals wichtigsten<br />
Zweig <strong>der</strong> Naturheilkunde zur Hochschulmedizin. Der Lehrauftrag<br />
Briegers lautete: „Allgemeine Therapie".<br />
Brieger wurde entsprechend seinem Ausbildungsgang von<br />
<strong>der</strong> Hochschulmedizin akzeptiert.<br />
Dies gilt dagegen nicht <strong>für</strong> seinen Nachfolger Franz Schönenberger.<br />
Zuerst Pädagoge, dann praktischer Arzt, jahrzehntelang<br />
Herausgeber <strong>der</strong> verdienstvollen und weit verbreiteten<br />
Zeitschrift „Der Naturarzf", wurde er auf Anordnung<br />
des preußischen Kultusministeriums als Lehrstuhlinhaber<br />
eingesetzt.<br />
Die in seiner Amtszeit formulierte Klinikbezeichnung „Universitätsklinik<br />
<strong>für</strong> natürliche Heil- und Lebensweise" deutete<br />
den erweiterten Anspruch des Lehrstuhls an. Diese<br />
Bezeichnung betont zugleich die Verantwortlichkeit <strong>für</strong> die<br />
präventivmedizinische Aufgabe, in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> deutschen<br />
Klinik ein geradezu revolutionieren<strong>der</strong> Sachverhalt.<br />
Mit Beginn <strong>der</strong> zwanziger Jahre verfügte die Berliner Universität<br />
somit über die Einrichtungen, die zu einer wirksamen<br />
Vertretung <strong>der</strong> natürlichen Heil- und Lebensweisen<br />
erfor<strong>der</strong>lich sind: Lehrstuhl - klinische Betten - Poliklinik<br />
und eine große Behandlungsabteilung. Dieser Einrichtungsstatus<br />
und die erweiterte Aufgabenstellung sind <strong>der</strong> Initiative<br />
breiter Kreise <strong>der</strong> Bevölkerung zu verdanken, namentlich<br />
dem Deutschen Bund <strong>für</strong> naturgemäße Lebens- und<br />
Heilweise (Prießnitzbund), einer damals mehr als 100000<br />
Mitglie<strong>der</strong> zählenden Massenorganisation.<br />
Die Reaktion <strong>der</strong> Hochschulmedizin war vergleichbar mit<br />
dem, was sie während <strong>der</strong> letzten zwei Jahre in Westberlin<br />
und in einigen Kreisen <strong>der</strong> Bundesrepublik erlebt haben:<br />
eine schroffe Ablehnung. In den kritischen Jahren von 1933<br />
bis 1945 bestanden neben Schwierigkeiten <strong>der</strong> personellen<br />
Vertretung die <strong>der</strong> baulichen Zerstörung <strong>der</strong> meisten Einrichtungen<br />
des Lehrstuhls.<br />
Ein entscheiden<strong>der</strong> Schritt in <strong>der</strong> Entwicklung des Fachgebietes<br />
und damit des Lehrstuhls erfolgte 1956/57. Damals<br />
wurde in <strong>der</strong> DDR die Fachrichtung Physikalischdiätetische<br />
Medizin eingeführt. Diese wurde eine Disziplin<br />
wie alle übrigen Fachrichtungen in <strong>der</strong> Medizin mit einer<br />
vierjährigen Ausbildung nach <strong>der</strong> ärztlichen Approbation<br />
und einer abschließenden Facharztprüfung.<br />
Mit dieser Neuregelung erweiterten sich auch die Aufgaben<br />
des Lehrstuhls. Neben dem studentischen Unterricht traten<br />
in verstärktem Maße Verpflichtungen <strong>für</strong> die Facharztausbildung<br />
und die postgraduelle Weiterbildung vieler an<strong>der</strong>er<br />
Fachdisziplinen.<br />
Zugleich än<strong>der</strong>te sich die Stellung <strong>der</strong> Fachrichtung in <strong>der</strong><br />
Gesamtmedizin. Mit <strong>der</strong> vielseitigen und gründlichen Ausbildung<br />
entwickelte sich zwanglos eine Kompetenz unserer<br />
<strong>Ärzte</strong> auf Teilgebieten, in denen die an<strong>der</strong>en Disziplinen<br />
kaum konkurrieren konnten. Für die Gesamtmedizin ergab<br />
sich oft <strong>der</strong> Erfolg, daß manche Bereiche <strong>der</strong> Therapie,<br />
die bisher nicht o<strong>der</strong> abhängig vom Zufall eines persönlichen<br />
Interesses betreut wurden, jetzt sachverständig vertreten<br />
werden konnten. Dieser Sachverhalt hat sich nicht<br />
zuletzt auch positiv auf das interdisziplinäre Verständnis<br />
<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> ausgewirkt.<br />
Ein Wort zur Namensgebung dessen, was in meinem Thema<br />
als Naturheilverfahren bezeichnet wurde. Es ist eine scheinbar<br />
zweitrangige Frage, doch zeigten gerade die schroffen<br />
Haltungen mancher <strong>Ärzte</strong>kreise in neuer Zeit, daß die eine<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Formulierung <strong>für</strong> sie offenbar wie ein Reizwort<br />
wirkt.<br />
Die großen kommunalen und Universitätskliniken, von<br />
denen hier berichtet wird, führten folgende Namen: „Klinik<br />
<strong>für</strong> Naturheilkunde", später war es eine „Klinik <strong>für</strong> natürliche<br />
Heil- und Lebensweise", dann <strong>für</strong> „Physikalisch-diätetische<br />
Therapie", schließlich <strong>für</strong> „Physiotherapie". Unter so<br />
unterschiedlicher Firmierung läßt sich also offenbar Gleiches<br />
tun.<br />
Wenn wir 1956 die Bezeichnung „Physikalisch-diätetische<br />
Therapie" <strong>für</strong> das Fachgebiet wählten, so geschah dies in<br />
bewußter Anknüpfung an eine deutsche Tradition, die um<br />
die Jahrhun<strong>der</strong>twende begann. Die <strong>Ärzte</strong> unserer Richtung<br />
schlössen sich damals in den Gesellschaften <strong>für</strong> Physikalisch-diätetische<br />
Therapie zusammen. Es handelte sich von<br />
<strong>der</strong> Aufgabenstellung her um die Vorläufer des <strong>Zentralverband</strong>es<br />
<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren. Die wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift war damals das 20 Jahre von Ziegelroth<br />
herausgegebene „Archiv <strong>für</strong> Physikalisch diätetische<br />
Therapie".<br />
Wenn in <strong>der</strong> DDR seit etwa 20 Jahren die Bezeichnung<br />
„Physiotherapie" eingeführt wurde, so geschah dies in <strong>der</strong><br />
Erwartung, daß unter dieser Bezeichnung eine internationale<br />
Verständigung erfolgen könne. In <strong>der</strong> Tat ist dies heute<br />
von Südamerika bis Kanada und zur Sowjetunion möglich<br />
geworden.<br />
Es erscheint jedoch wichtig, die genannten Begriffe näher<br />
zu erläutern. Wenn wir die in <strong>der</strong> Bundesrepublik vorwiegend<br />
verbreitete Bezeichnung „Naturheilverfahren" hinzunehmen,<br />
ist es deutlich, daß eine Differenzierung <strong>der</strong> Bezeichnungen<br />
vom sprachlichen Ursprung her nicht möglich<br />
ist, sie drücken vielmehr ganz o<strong>der</strong> annähernd Gleiches<br />
aus.<br />
Eine Definition des Begriffes „Physiotherapie" sei - vorwiegend<br />
pragmatisch - mit zwei Thesen versucht.<br />
1. Der Physiotherapeut greift zunächst zu den naturnäheren<br />
Mitteln, bevor er an<strong>der</strong>e anwendet. Als „naturnahe"<br />
gelten vor allem die Umweltreize, denen <strong>der</strong> Mensch<br />
sich in seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung angepaßt<br />
hat, die seinen Reaktionsvermögen adäquat sind:<br />
Kälte, Wärme, Licht, mechanische Einwirkungen ver-<br />
380 Fortsetzung auf Seite 389
Editorial<br />
o<br />
Wir leben in einer unruhigen Zeit. Das betrifft auch die<br />
Medizin. Die verschiedensten Probleme beschäftigen die<br />
<strong>Ärzte</strong>schaft lebhaft, von <strong>der</strong> „Kostendämpfung" im Krankenhaus<br />
bis zu Auseinan<strong>der</strong>setzungen wissenschaftlicher<br />
Art, die bis weit in allgemein humane und ethische Folgerungen<br />
reichen.<br />
Nachdem in den vorigen Jahren die Blutdruckkrankheit<br />
und die rheumatischen Krankheitszustände in den Vor<strong>der</strong>grund<br />
<strong>der</strong> Erörterungen gerückt waren, macht uns jetzt<br />
das Krebsprobkm ernstlich zu schaffen, weil wir letztlich<br />
trotz vieler Anstrengungen und <strong>der</strong> Neugründung von<br />
immer zahlreicheren Krebsforschungsinstituten sowie <strong>der</strong><br />
Bereitstellung erheblicher staatlicher Mittel und solchen<br />
aus privaten Stiftungen nicht viel weiter gekommen sind.<br />
Die Begriffe Heilung und Remission in <strong>der</strong> Onkologie<br />
Manche Berichte, die sehr schnell auch Eingang in die<br />
Massenmedien gefunden haben, sprechen von neuen Errungenschaften,<br />
die sogar eine Heilung des Krebsleidens<br />
möglich machen sollen o<strong>der</strong> wenigstens in Aussicht stellen.<br />
Das betrifft jedoch nur einige wenige <strong>der</strong> malignen<br />
Krankheiten, vor allem die Leukämie <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, und<br />
auch hierbei überwiegend nur die akute lymphoblastische<br />
Form. Notwendig ist dazu allerdings eine sehr intensive<br />
Therapie, die mit unvermeidbaren Nebenwirkungen verbunden<br />
ist und <strong>der</strong>en Durchführung beson<strong>der</strong>e Erfahrung<br />
in onkologischen Zentren voraussetzt. Mit einer<br />
solchen, geradezu aggressiven Therapie ist es möglich, die<br />
Zahl <strong>der</strong> Leukämiezellen im Organismus weitgehend zu<br />
vernichten. Aber ein geringer Rest bleibt in <strong>der</strong> Regel<br />
doch noch erhalten, und von diesem können Rezidive<br />
ausgehen.<br />
Um auch die im Zentralnervensystem, beson<strong>der</strong>s in den<br />
Hirnhäuten, zurückbleibenden Leukämiezellen vollständig<br />
zu zerstören, muß zu <strong>der</strong> Chemotherapie noch eine<br />
Röntgenbestrahlung des Schädels hinzugefügt werden,<br />
die dann allerdings auch neue Probleme mit sich bringt.<br />
Es kommt entscheidend darauf an, die unvermeidbaren<br />
Nebenwirkungen zu begrenzen und zu beherrschen, vor<br />
allem durch eine intensive Pflege mit einem speziell geschulten<br />
Personal.<br />
Während <strong>der</strong> Intensivtherapie leidet <strong>der</strong> Allgemeinzustand<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> meist erheblich. Nach erreichter Remission<br />
fühlen sie sich besser, aber man sieht sich hier neuen<br />
Schädigungsmöglichkeiten gegenüber. Die durch eine intensive<br />
Chemotherapie und Strahlenbehandlung geheilten<br />
Kin<strong>der</strong> stellen eine neuartige Risikogruppe dar. Sie<br />
o<br />
Der Vorstand des <strong>Zentralverband</strong>es <strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren e. V. lädt hiermit<br />
seine Mitglie<strong>der</strong> zu einer Mitglie<strong>der</strong>versammlung ein. Sie findet am Mittwoch, dem<br />
16. 9. 1981, 18.00 Uhr, in Freudenstadt, Kurhaus - Kleiner Kursaal, statt.<br />
Tagesordnungspunkte:<br />
1. Bericht des Vorsitzenden<br />
2. Kassenbericht<br />
3. Verschiedenes.<br />
Dr. med. K. Schimmel<br />
— Vorsitzen<strong>der</strong> —<br />
Der Vorstand <strong>der</strong> Internationalen medizinischen Gesellschaft <strong>für</strong> Neuraltherapie nach<br />
Huneke e. V. lädt hiermit seine Mitglie<strong>der</strong> zu einer Mitglie<strong>der</strong>versammlung ein.<br />
Sie findet am Freitag, dem 11.9.1981, 12.30 Uhr, in Freudenstadt, Kurhaus -Kleiner<br />
Kursaal, statt.<br />
Tagesordnungspunkte:<br />
1. Wahl des Vorstandes<br />
2. Bericht des Vorsitzenden<br />
3. Satzungsän<strong>der</strong>ung<br />
4. Kassenbericht<br />
5. Verschiedenes<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.
neigen zu Infekten, weil die Immunabwehr vermin<strong>der</strong>t ist.<br />
Es kommt zu häufig rezidivierenden katarrhalischen Infektionen<br />
<strong>der</strong> Luftwege mit Sinusitis und Otitis. Eine<br />
beson<strong>der</strong>s ge<strong>für</strong>chtete Komplikation sind die Varizellen<br />
(Windpocken). Diese sonst harmlose Infektion kann unter<br />
immunsuppressiver Therapie zu schweren Verläufen mit<br />
Pneumonie, Hepatitis, Enzephalitis und tödlichem Ausgang<br />
führen. Daher ist ein Kontakt mit einem an Windpocken<br />
Erkrankten, z. B. in Schule und Kin<strong>der</strong>garten,<br />
schnellstens dem Behandlungszentrum zu melden, das<br />
dann sofort Varizellen-Hyperimmunglobulin geben wird.<br />
Zu den heute besser beherrschbaren Karzinomen gehört<br />
auch dasjenige <strong>der</strong> Prostata bei den Männern und das<br />
Ovarialkarzinom <strong>der</strong> Frauen. Über neue Behandlungsmöglichkeiten<br />
des Ovarialkarzinoms berichtet <strong>der</strong> Onkologe<br />
A. Goldhirsch mit drei Mitarbeitern vom Ludwig-<br />
Institut <strong>für</strong> Krebsforschung <strong>der</strong> Universität Bern (Schweiz,<br />
med. Wschr. 110: 1597-1605. Nr. 44.1980). Er ist sehr<br />
optimistisch und meint, „daß Ovarialkarzinome heute<br />
auch in fortgeschrittenen Stadien bei optimaler interdisziplinärer<br />
Therapieplanung in den Bereich <strong>der</strong> Heilbarkeit<br />
gerückt sind." Allerdings gilt auch dies nur mit Einschränkungen<br />
und bei Auswahl geeigneter Fälle. Daher<br />
werden, auf Veranlassung <strong>der</strong> Schriftleitung, diese optimistischen<br />
Äußerungen von einem an<strong>der</strong>en Onkologen<br />
kritisch betrachtet (Priv. Doz. Dr. F. Cavalli, Onkolog.<br />
Dienst des Hospitals San Giovanni in Bellinzona, ebenda.<br />
1594-1596). Er stellt dabei vor allem die Begriffe Heilung<br />
und Remission in <strong>der</strong> Onkologie zur Diskussion.<br />
Die mo<strong>der</strong>ne medizinische Onkologie hat in den letzten<br />
zwei Jahrzehnten eine umfassende Methodologie entwikkelt,<br />
die von vielen Onkologen auch als kritische Empirie<br />
bezeichnet wird. Damit soll gesagt sein, daß wir trotz<br />
aller klinisch-chemotherapeutischen Forschung um die<br />
Beobachtung und Erfahrung am kranken Menschen nicht<br />
herumkommen. Da es sich in den meisten Berichten<br />
überdies nur um eine mäßige Verbesserung <strong>der</strong> Remissionsrate<br />
in <strong>der</strong> Behandlung irgendeiner Tumorart handelt,<br />
sollte die Veröffentlichung nicht unbedingt in einer<br />
allgemeinen medizinischen Zeitschrift geschehen, denn<br />
sie könnte dann mehr verwirren als weiterbringen. Sie gehörte<br />
in eine onkologische Fachzeitschrift hinein, wenigstens<br />
solange, bis weitere und gesicherte Erfahrungen vorliegen.<br />
Der Krebs gilt gefühlsmäßig als unheilbar, nicht nur unter<br />
Laien. Die allzu häufig angekündigten und nachträglich<br />
wi<strong>der</strong>legten Berichte über sensationelle Durchbrüche in<br />
<strong>der</strong> Krebsbehandlung haben ein Mißtrauen hervorgerufen.<br />
Der Begriff <strong>der</strong> Heilung ist gerade in <strong>der</strong> Onkologie keineswegs<br />
eindeutig zu definieren. Zunächst wird man<br />
darunter zu verstehen haben, daß bei dem Kranken über<br />
lange Zeit jede nachweisbare Spur des Tumors verschwunden<br />
ist. Aber gerade in dieser Zeitspanne liegt die<br />
Unsicherheit. Es gibt nach neuen Beobachtungen Langzeitüberlebende<br />
(„long-term survivors"), bei denen eine<br />
echte Heilung erst dann angenommen werden kann, wenn<br />
die Überlebenskurve eines Kollektivs von Tumorkranken<br />
<strong>der</strong>jenigen eines altersentsprechenden Kollektivs ohne<br />
Tumorkrankheit gleich wird. Beim primär operablen Mammakarzinom<br />
kann eine solche Zeitspanne rund 20 Jahre<br />
betragen. Dann ist jedoch immer noch ein Spätrezidiv<br />
möglich; ebenso beim kl einzelligen Bronchuskarzinom.<br />
Dabei hat sich ein neues Problem gezeigt. Es wird immer<br />
klarer, daß mit <strong>der</strong> zunehmenden Aggressivität <strong>der</strong> Chemotherapie<br />
und vor allem mit einer Kombination von<br />
intensiver Chemo- und Radiotherapie die Inzidenz von<br />
Zweittumoren deutlich zunimmt. Gerade das Ovarialkarzinom<br />
ist in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel. Meist<br />
handelt es sich dabei um akute myeloische Leukämien,<br />
die etwa vier Jahre nach Therapiebeginn auftreten. An<strong>der</strong>e<br />
Spätschäden sind die Strahlenperikarditis, die vermin<strong>der</strong>te<br />
Infektionsabwehr und die Zytostatika-Lunge.<br />
Zwar braucht man deshalb noch nicht in einen therapeutischen<br />
Nihilismus zu verfallen, aber das Prinzip <strong>der</strong><br />
Verhältnismäßigkeit erfor<strong>der</strong>t doch sorgfältige Beachtung.<br />
Eine weitere Frage ist es, ob wir den allermeisten Patienten<br />
eine als potentiell kurativ empfohlene Therapie vorenthalten<br />
dürfen, bis sich die anfänglichen Resultate<br />
durch eine genügend lange Beobachtungszeit als wirklich<br />
definitive Heilung herausgestellt haben. Die apodiktische<br />
Antwort des Onkologen darauf ist: nein. Aber sie erfor<strong>der</strong>t<br />
doch einige Einschränkungen. Die Fehlerquellen<br />
einer allgemein anerkannten Methode werden häufig<br />
unterschätzt. Eine positive Selektion des Krankengutes<br />
und vieles mehr kann leicht zu statistisch gesicherten,<br />
aber biologisch wenig bedeutsamen „spektakulären" Frühresultaten<br />
Anlaß geben. Daher ist zwar jede Verbesserung<br />
unserer Methodik prinzipiell zu begrüßen, aber sie muß<br />
auch sehr kritisch betrachtet werden. Abschließend meint<br />
dazu <strong>der</strong> Autor: „Diese Feststellungen bekräftigen meines<br />
Erachtens den Standpunkt, <strong>der</strong> eine völlige Trennung<br />
zwischen optimaler tagtäglicher Behandlung und klinischer<br />
Krebsforschung als ein Ding <strong>der</strong> Unmöglichkeit<br />
ansieht."<br />
Aufklärung über die Gefährlichkeit diagnostischer Eingriffe<br />
Ein rechtsmedizinisches Problem beschäftigt die <strong>Ärzte</strong> in<br />
zunehmendem Maße. Nach <strong>der</strong> Rechtssprechung stellt<br />
auch <strong>der</strong> kunstgerecht und mit Erfolg durchgeführte ärztliche<br />
Heileingriff eine Körperverletzung im Sinne <strong>der</strong><br />
§§ 223, 230 StGB, § 823 DGB sowie eine Verletzung <strong>der</strong><br />
körperlichen Integrität nach Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes<br />
dar, wenn er nicht durch eine rechtswirksame Einwilligung<br />
des Patienten o<strong>der</strong> seines gesetzlichen Vertreters<br />
gedeckt ist. Das gilt nicht nur <strong>für</strong> chirurgische Eingriffe,<br />
son<strong>der</strong>n auch <strong>für</strong> diagnostische Methoden. Auch bei diesen<br />
muß <strong>der</strong> Arzt den Patienten über Art, Dringlichkeit,<br />
Tragweite und Risiko sowie über mögliche Alternativen<br />
unterrichten, so daß dieser selbst das Für und Wi<strong>der</strong><br />
abwägen kann. Das bringt den Arzt oft in eine schwierige<br />
Situation. Wie weit darf er mit <strong>der</strong> Aufklärung gehen, um<br />
den Patienten nicht so sehr zu verunsichern, daß selbst<br />
ein wichtiger und notwendiger diagnostischer Eingriff in<br />
Frage gestellt wird und unterbleibt? Die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Rechtsprechung wurden dabei in letzter Zeit immer<br />
mehr in die Höhe geschraubt. So muß <strong>der</strong> Arzt etwa bei<br />
einer unbedeutsamen kosmetischen Operation ein Auf-<br />
II<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.
klärungsinteresse des Patienten auch dann voraussetzen,<br />
wenn die Häufigkeit tödlicher Zwischenfälle nur 1:1000<br />
beträgt; ja sogar auf extrem seltene Zwischenfälle von<br />
1:2000 müsse er aufmerksam machen. Selbst über typische,<br />
dem Patienten nicht erkennbare Risiken ist er auch dann<br />
aufzuklären, wenn sie sehr selten sind, z. B. bei einer<br />
Nierenbiopsie, bei welcher <strong>der</strong> Verlust einer Niere in etwa<br />
0,1% <strong>der</strong> Fälle vorkommen kann.<br />
An<strong>der</strong>erseits sollte die rücksichtslose Aufklärung ihre<br />
Grenzen haben, wie Rechtsanwalt Dr. H.-J. Rieger (7500<br />
Karlsruhe 41, Ostpreußenstr. 13, Deutsche med. Wschr.<br />
105: 1490-1491. Nr. 43. 1980) ausführt. Es muß auch<br />
auf den psychischen Zustand des Kranken Rücksicht<br />
genommen werden, <strong>der</strong> durch die Schil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schwierigkeiten<br />
und Gefahren sowie möglicher Schädigungen in<br />
einen Erregungs- o<strong>der</strong> Depressionszus tand geführt werden<br />
könnte. Deshalb sollte <strong>der</strong> Arzt berechtigt sein, von einer<br />
Aufklärung überall dort Abstand zu nehmen, wo die<br />
Gefahr einer schwerwiegenden psychischen Beeinträchtigung<br />
des Patienten besteht. Übrigens kann die Aufklärung<br />
nach <strong>der</strong> Rechtsprechung auch durch einen an<strong>der</strong>en<br />
Arzt vorgenommen werden, z. B. den Stationsarzt o<strong>der</strong><br />
den Hausarzt. Dann aber muß sich <strong>der</strong> durchführende<br />
Kollege vergewissern, daß dies auch wirklich geschehen<br />
ist.<br />
Sehr energisch kritisierte Prof. Dr. Kurt Spohn, Präsident<br />
des 98. Kongresses <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Chirurgie,<br />
in seiner Eröffnungsansprache den Bundesgerichtshof.<br />
Die von ihm gefor<strong>der</strong>te Risikoaufklärung bis zu<br />
einem Seltenheitswert von 1:2000 sei inhuman und praktisch<br />
nicht durchführbar. Die <strong>Ärzte</strong> sollten sich gegen<br />
eine <strong>der</strong>art überzogene Rechtsprechung wehren und sich<br />
nicht ihr anpassen. Der Arzt sehe die Aufklärung als<br />
eine hohe ethische Aufgabe an und nicht nur als eine<br />
juristische Pflicht. Der Begriff <strong>der</strong> Wahrheit sei im ärztlichen<br />
Bereich schwer defmierbar. Eine rigorose Aufklärung<br />
könne dem Patienten durchaus schaden, denn kein<br />
Mensch könne ohne Hoffnung leben.<br />
Industrie Schritte unternommen, um den <strong>für</strong> die Bildung<br />
<strong>der</strong> Transparenzkommission gewählten Organisationsakt<br />
als verfassungsmäßig unzulässig zu erklären. Es hätte <strong>für</strong><br />
die Einsetzung <strong>der</strong> Kommission eines formellen Gesetzes<br />
bedurft.<br />
Auch mit an<strong>der</strong>en Listen zur Begrenzung <strong>der</strong> Arzneimittelkosten<br />
hat man wenig Glück gehabt. Allem Anschein<br />
nach ist dies nicht <strong>der</strong> richtige Weg. Man sollte<br />
die Verordnungsfreiheit des Arztes so wenig wie möglich<br />
einschränken. Besser als durch bürokratische Vorschriften<br />
wird dies durch eine zuverlässige laufende Information<br />
<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> erfolgen, wie sie auch die Fortbildungskongresse<br />
bieten.<br />
Wir sollten also auch auf dem Gebiet <strong>der</strong> Rechtsmedizin<br />
wie<strong>der</strong> dahin zurückfinden, wo <strong>der</strong> Arzt in <strong>der</strong> Praxis mit<br />
beiden Füßen auf dem Boden <strong>der</strong> Wirklichkeit des praktischen<br />
Lebens steht und stehen muß, wenn er seiner<br />
Aufgabe gerecht werden will. Es geht nicht an und muß<br />
letztlich den Kranken selbst am meisten schaden, daß<br />
man seine Tätigkeit durch übersteigerte Bestimmungen<br />
einengen und noch schwerer machen wollte, wie sie es<br />
sowieso schon ist.<br />
Im Grunde bedeutet dies, daß man wie<strong>der</strong> mehr Vertrauen<br />
zur Tätigkeit und zum Ethos des Arztes haben<br />
müsse — wie es glücklicherweise bei <strong>der</strong> weit überwiegenden<br />
Zahl <strong>der</strong> Kranken und <strong>der</strong> gesamten Bevölkerung<br />
auch heute noch besteht.<br />
R. F. Weiß<br />
Kein Glück mit Transparenzlisten<br />
Die vieldiskutierten Transparenzlisten mögen eine gute<br />
theoretische Begründung haben, praktisch sind sie jedoch<br />
undurchführbar. Das hat sich bald herausgestellt, als eine<br />
Firma Klage erhob, da sich in <strong>der</strong> Transparenzliste ein<br />
Werturteil über die Wirksamkeit eines Präparates fand.<br />
Gegen diese Praxis <strong>der</strong> Transparenzkommission rief ein<br />
Arzneimittelhersteller das Verwaltungsgericht und das<br />
Oberverwaltungsgericht in Berlin an. Dieses hat durch<br />
eine einstweilige Anordnung vom 22. April 1980 <strong>der</strong><br />
Transparenzkommission untersagt, in einer Transparenzliste<br />
<strong>für</strong> das Indikationsgebiet „Angina pectoris" Qualitätskennzeichen<br />
zu veröffentlichen, ohne daß <strong>der</strong> Transparenzkommission<br />
nachprüfbare wissenschaftliche Erkenntnisse<br />
vorliegen, die dies rechtfertigen. Demgemäß<br />
will die Transparenzkommission zunächst generell auf<br />
Qualitätskennzeichen verzichten. Sie strebt eine grundsätzliche<br />
gerichtliche Klärung <strong>der</strong> Sachlage an. Demgegenüber<br />
hat <strong>der</strong> Bundesverband <strong>der</strong> Pharmazeutischen<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
ARZNEIEN<br />
Sedovent<br />
MAGENTROPFEN<br />
Subazidität, Dyspepsie, Völlegefühl,<br />
Meteorismus. Auch bei Kin<strong>der</strong>n.<br />
Zusammensetzung In 100g Acid citnc 0,5g,85,5g<br />
aethanol -wassrig Auszug aus 0,1 g Cort Chmae,<br />
1 g Cort Cinnamomi, 2 g Pencarp Aurantn immat, 3 g<br />
Herba Millefoln, 4 g Rhiz Calami, 7 g Rad Gentianae<br />
Kontraindikation Hyperaziditat<br />
20 ml 50 ml<br />
ERNST SCHWORER PHARMAZ FABRIK { 6901 WIESENBACH
Aus dem Verbandsleben<br />
3<br />
t-><br />
u<br />
N<br />
ä<br />
Q<br />
Laudatio<br />
Am 19.6.1981 wurde Dr. Emil Höllischer 75 Jahre alt.<br />
Geboren in Hochstadt/Pfalz besuchte er die Elementarschule<br />
und das Humanistische Gymnasium in Karlsruhe.<br />
Nach seinem Studium in Heidelberg, Berlin und München<br />
legte er am 30. November 1935 das Medizinische<br />
Staatsexamen ab. Im Jahr darauf erfolgte die Promotion.<br />
d =3 o 6<br />
'S '.0<br />
d "S 3<br />
a<br />
j> ö o a<br />
II *-|<br />
ü -S ü -S<br />
60
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Krauß, Naturheilverfahren<br />
o<br />
o<br />
Fortsetzung von Seite 380<br />
schiedener Art, bestimmte Formen <strong>der</strong> Elektrizität, gerichtete<br />
Ernährung. Diätetik jedoch auch in dem ursprünglichen<br />
hippokratischen Sinne als Lebensordnung<br />
schlechthin.<br />
Zu seinen Mitteln gehört auch das Übungsprinzip, wenn<br />
<strong>der</strong> Ablauf biologisch wichtiger Funktionen gestört ist<br />
(z. B. Atmung, Bewegung, Wärmehaushalt, Kreislaufregulation).<br />
2. Die Therapieverfahren werden „kata physin", gemäß <strong>der</strong><br />
Natur, im Sinne <strong>der</strong> Natur angewendet.<br />
Aus dieser zweiten For<strong>der</strong>ung ergibt sich ein beson<strong>der</strong>es<br />
Verhältnis <strong>der</strong> Physiotherapie zum Krankheitssymptom: Ist<br />
dieses Ausdruck einer Abwehrleistung o<strong>der</strong> des Funktionsversagens?<br />
Daher im ersteren Falle auch die Zurückhaltung gegenüber<br />
einer vorbehaltslosen „Antitherapie" wie antipyretischeantiphlogistische<br />
Behandlung. Der Leitgedanke ist vielmehr:<br />
Wie können wir das in den vorliegenden Symptomen<br />
zum Ausdruck kommende Heilungsgeschehen, sei es durch<br />
vorwiegend örtlich wirkende Maßnahmen o<strong>der</strong> durch Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Kondition, gleichsam durch Unterstützung<br />
<strong>der</strong> heilenden Potenzen auflösen?<br />
Diese Bedeutungsanalyse <strong>der</strong> Krankheitssymptome ist eine<br />
ständige Aufgabe in unserer therapeutischen Praxis, sicher<br />
aber auch ein nie endendes Konzept <strong>für</strong> die klinisch-pathologische<br />
Grundlagenforschung.<br />
Es ist bemerkenswert, wie überschüssig ablehnend Mediziner<br />
oft gegenüber einer betont bionomen Einstellung<br />
reagiert haben. Dies gilt selbst gegenüber Angehörigen -<br />
einer im übrigen gewiß unverdächtigen - Disziplin, wie <strong>der</strong><br />
Chirurgie. So kenne ich keinen deutschen Hochschullehrer<br />
unseres Jahrhun<strong>der</strong>ts, <strong>der</strong> sich trotz aller Anfeindungen<br />
energischer und folgerichtiger <strong>für</strong> bionomes Denken in <strong>der</strong><br />
Medizin einsetzte als den Chirurgen August Bier. Diese<br />
Gedanken waren ihm zugleich Richtschnur <strong>für</strong> seine klinisch-experimentellen<br />
Forschungen wie <strong>für</strong> seinen einzigartigen<br />
ökologischen Großversuch, dürftigen märkischen<br />
Kiefernwald in fruchtbaren Mischwald zu verwandeln, diesen<br />
- wie er selbst sagte - „gesunden" zu lassen.<br />
Lehre und Lernbarkeit <strong>der</strong> Physiotherapie<br />
Wenn wir einmal unter den <strong>Ärzte</strong>n <strong>für</strong> Physiotherapie recherchieren,<br />
wie sie zu dieser Richtung in <strong>der</strong> Medizin gekommen<br />
sind, so treffen wir die Gruppe <strong>der</strong>er, die aus einem<br />
früh gewonnenen, betont lebensgesetzlich orientierten<br />
Standort diese Richtung in <strong>der</strong> Medizin wählten. Dann haben<br />
wir die Gruppe <strong>der</strong>er, die von ihrer bisherigen ärztlichen<br />
Tätigkeit unbefriedigt waren und deshalb nach an<strong>der</strong>en<br />
Wegen suchten, an<strong>der</strong>e vielleicht, weil sie sich hier eine<br />
ökonomische Chance errechneten. Sodann gibt es - vorwiegend<br />
in Län<strong>der</strong>n mit an<strong>der</strong>en Organisationsstrukturen -<br />
<strong>Ärzte</strong>, die durch Zufall, d. h. von einer Verwaltungsstelle<br />
gelenkt zur Physiotherapie kamen.<br />
Wenn wir die Physiotherapie von ihrem wichtigsten Gehalt<br />
als physikalisch-diätetische und funktionsordnende Therapie<br />
begreifen, so wird klar, daß das bloße Sympathisieren<br />
mit diesem Weg nicht ausreicht, diese Therapie mit ihren<br />
Möglichkeiten und Grenzen zu erlernen.<br />
Es gibt <strong>für</strong> den Ausbildungsgang auch zeitliche Gesichtspunkte.<br />
Der werdende Arzt sollte mit <strong>der</strong> Physiotherapie in<br />
Berührung kommen, während sich bei ihm Vorstellungsbil<strong>der</strong><br />
von <strong>der</strong> Therapie und dem ärztlichen Tätigsein überhaupt<br />
entwickeln, also möglichst während des klinischen<br />
Studiums.<br />
Das Erlernen <strong>der</strong> Physiotherapie wird erleichtert durch ein<br />
allgemeinpathologisch orientiertes Konzept, eine Lehre, die<br />
bionome Leitlinien anbietet.<br />
Zur Ausbildung in <strong>der</strong> Physiotherapie gehören aber vor<br />
allem die Wirkungsphysiologie physikalisch-diätetischer<br />
Verfahren, viel methodische Technik und schließlich Erfahrung<br />
in <strong>der</strong> angewandten Physiotherapie. In diesem letztgenannten<br />
Abschnitt sollte neben <strong>der</strong> allgemeinen Indikationslehre<br />
die Anpassung des Behandlungsprogramms an<br />
die Erfor<strong>der</strong>nisse des Einzelfalls vermittelt werden.<br />
Die Physiotherapie kann wohl <strong>für</strong> sich in Anspruch nehmen,<br />
die Lehre Gustav von Bergmanns, des Begrün<strong>der</strong>s <strong>der</strong> funktionellen<br />
Pathologie, nach <strong>der</strong> therapeutischen Seite ergänzt<br />
bzw. ausgebaut zu haben.<br />
A. Brauchte betonte die Unterscheidung von Krankheit und<br />
Leiden (Nosos und Pathos) als Leitlinie <strong>für</strong> die Bewertung<br />
<strong>der</strong> Krankheitssymptome entwe<strong>der</strong> als Ausdruck <strong>der</strong> Abwehrleistung<br />
o<strong>der</strong> als Zeichen eines Funktionsversagens.<br />
P. Vogler gab mit <strong>der</strong> Lehre von den Grundfunktionen praktikable<br />
Leitlinien <strong>für</strong> die Präventivmedizin und die Funktion<br />
<strong>der</strong> Physiotherapie als Basistherapie innerhalb des Gesamttherapieplans.<br />
Wir legten im akademischen Unterricht beson<strong>der</strong>en Wert<br />
auf die Wirkungsphysiologie <strong>der</strong> physiotherapeutischen<br />
Methoden, weil wir meinen, daß sich auf diesem Wege am<br />
besten ein Zugang zum Verständnis <strong>der</strong> Methoden, zur<br />
Abgrenzung gegenüber <strong>der</strong> Pharmakotherapie bzw. einer<br />
Koordination mit ihr gewinnen läßt. Dabei hat es sich didaktisch<br />
bewährt, Behandlungsprogramme nach drei Gesichtspunkten<br />
zu ordnen:<br />
- Entlastung überfor<strong>der</strong>ter Funktionskreise bzw. Organe.<br />
Z. B.: Herz-Kreislauf-Verdauungsapparat-Energiehaushalt.<br />
- Gezieltes und dosiertes Training versagen<strong>der</strong> Funktionskreise.<br />
Z. B.: Atmung, Wärmehaushalt, Bewegungsfunktionen.<br />
- „Entstörung" neuralgestörter Organfunktionen. Z. B.: vertebragene<br />
Reizsyndrome<br />
- Herzrhythmusstörungen - Schlafstörungen.<br />
Das Erlernen: Wirkungsphysiologie läßt sich - wie Pharmakologie<br />
- weitgehend aus Büchern studieren. Dies gilt<br />
nicht <strong>für</strong> Feinheiten <strong>der</strong> Methodik. Ebensowenig kann die<br />
angewandte Physiotherapie, d. h. also die Indikationslehre<br />
389
Krauß, Naturheilverfahren<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
und die so wichtige individuelle Anpassung <strong>der</strong> Verfahren<br />
an die Erfor<strong>der</strong>nisse des Einzelfalles theoretisch erarbeitet<br />
werden. Gleiches gilt auch <strong>für</strong> die so wichtige Fähigkeit,<br />
die Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Physiotherapie real einschätzen<br />
zu können.<br />
Trotz mehrerer Phasen <strong>der</strong> Studienreform meinen wir, daß<br />
die über Jahrzehnte geübte Dreiteilung <strong>der</strong> Vorlesung sich<br />
am besten bewährt hat:<br />
1. Klinische Patientenvorstellung mit Dialog zwischen Dozent<br />
und dem praktizierenden Studenten, aber auch<br />
zwischen Arzt und Patient. Möglichst Wie<strong>der</strong>vorstellung<br />
des Patienten nach Abschluß <strong>der</strong> klinischen Behandlung.<br />
2. Wirkungsphysiologie <strong>der</strong> wichtigsten Therapieverfahren.<br />
3. Methodische Praxis in Form von Vorweisungen und praktischen<br />
Kursen.<br />
Es erfolgt so zwar nicht ein Wissensangebot in Kompendienform<br />
und nicht <strong>für</strong> komputergerechte Fragebögen zubereitet,<br />
aber es werden lebendige Vorstellungen vermittelt<br />
und zugleich kontrollierbar dargeboten. In dieser Form hat<br />
<strong>der</strong> Unterricht Erlebniswert und befähigt dazu, mit dem<br />
Gelehrten etwas anfangen zu können, doch wo haben wir<br />
an unseren Hochschulen die Voraussetzungen, Physiotherapie<br />
mit diesen Ansprüchen zu lehren?. Wo können wir<br />
noch die Leistungsfähigkeit eines rein physiotherapeutischen<br />
Programms am klinischen Patienten studieren und<br />
dem Lernenden vorweisen?<br />
Der Dialog mit <strong>der</strong> Gesamtmedizin<br />
Der Dialog ist notwendig und kann fruchtbar verlaufen <strong>für</strong><br />
beide Seiten. Kurz vor dem letzten Krieg schrieb G. von<br />
Bergmann: das Konzept von Krankheit und Leiden, auf<br />
dem Brauchle seine Lehre aufbaute, könnte die Basis <strong>für</strong><br />
solchen Dialog <strong>der</strong> Richtungen sein. Die Weltereignisse<br />
verhin<strong>der</strong>ten, daß es dazu kam.<br />
Meine eigenen Erfahrungen gehen dahin, daß das unmißverständlichste<br />
und <strong>für</strong> beide Teile ergiebigste Gespräch<br />
nur vor Ort stattfinden kann, soll heißen bei <strong>der</strong> gemeinsamen<br />
Visite am Patientenbett bzw. ante portas patientis.<br />
Ich habe es immer wie<strong>der</strong> erlebt, daß sich hier primär vorhandene<br />
Gegensätzlichkeiten rasch auflösen ließen.<br />
Es gab in Deutschland eine großangelegte Begegnung,<br />
die - ganz unberechtigt - in die Schatten <strong>der</strong> politischen<br />
Entwicklung geriet. Es war das mit Abstand Beste, was an<br />
Dialogen zwischen Gesamtmedizin und natürlichen Heilweisen<br />
organisiert worden ist. Ich meine das Johannstädter<br />
Krankenhaus in Dresden, in dem 1934 bis zum Anfang des<br />
Krieges Innere Medizin, Naturheilkunde, klassische Hydrotherapie<br />
und an<strong>der</strong>e klinische Disziplinen nebeneinan<strong>der</strong><br />
arbeiteten und ihre Auffassungen untereinan<strong>der</strong> austrugen.<br />
Die Brennpunkte des Dialogs waren:<br />
- Eine Gemeinschaftsstation, die therapeutisch von <strong>der</strong><br />
Naturheilkunde geführt und von einem Internisten diagnostisch<br />
beraten wurde. Hier fand bei gemeinsamer Visite<br />
<strong>der</strong> Chefs das aktuelle Gespräch statt.<br />
- Dreiwöchige <strong>Ärzte</strong>kurse mit ausgewogener Verteilung von<br />
Theorie, Klinik und Methodik.<br />
- Gemeinsame Veröffentlichungen <strong>der</strong> beteiligten Kliniken.<br />
Das Ergebnis solcher Begegnungen war ein Gewinn an<br />
gegenseitigem Verstehen und das plastische Erleben <strong>der</strong><br />
Möglichkeiten und Grenzen bei<strong>der</strong> Richtungen. Diese kritische<br />
Kooperation zwang zugleich zu diszipliniertem Handeln<br />
in Diagnostik und Therapie. Wichtig scheint außerdem<br />
<strong>der</strong> Gewinn speziell <strong>für</strong> die präventive Orientierung <strong>der</strong><br />
Medizin.<br />
Die Geschichte <strong>der</strong> Physiotherapie zeigt <strong>der</strong>en frühzeitiges<br />
Eintreten <strong>für</strong> gesunde Lebensformen. Individuelle Prophylaxe,<br />
primäre und sekundäre Prävention sind die Gebiete,<br />
auf denen die Physiotherapeuten mit ihrem Reichtum an<br />
Methoden und Erfahrungen <strong>der</strong> Medizin Wesentliches geben<br />
können.<br />
Erfahrungen mit Organisationsformen <strong>der</strong> Physiotherapie<br />
Das unmittelbare Arzt-Patienten-Verhältnis, wie es vor allem<br />
in <strong>der</strong> Tätigkeit des Arztes <strong>für</strong> Allgemeinmedizin verwirklicht<br />
ist, dürfte auch <strong>für</strong> den physiotherapeutisch orientierten<br />
Arzt <strong>der</strong> gegebene Rahmen sein. Neben <strong>der</strong> Krankenhausbehandlung<br />
wäre er beson<strong>der</strong>s dazu berufen, „Sprechstunden<br />
<strong>für</strong> Gesunde" abzuhalten. Hier könnte er als Berater<br />
<strong>für</strong> Menschen wirken, die noch nicht krank sind, aber<br />
Zweifel haben, ob sie richtig leben und die von kompetenter<br />
Seite <strong>für</strong> ihre Lebensordnung beraten sein möchten.<br />
Sehr oft wird sich dabei die Frage stellen, wie sich die so<br />
weitreichenden Möglichkeiten <strong>der</strong> physikalisch-diätetischen<br />
Therapie methodisch exakt, zur richtigen Zeit und quantitativ<br />
ausreichend in die Praxis umsetzen lassen. In Stichworten<br />
die hier verfolgten Wege:<br />
Lehrunterweisung in physiotherapeutischen Instituten auf<br />
Kassenschein - schriftliche Anleitung über „Physiotherapie<br />
zu Hause" - eigenes physiotherapeutisches Institut mit<br />
technischer Abteilung, die auf methodische Unterrichtung<br />
eingestellt ist.<br />
Wir haben uns kürzlich mit einem Modellentwurf zum Ausbau<br />
<strong>der</strong> Rehabilitation im Allgemeinkrankenhaus befaßt.<br />
Im Mittelpunkt dieses Plans steht die Zentrale Abteilung<br />
<strong>für</strong> Physiotherapie und Rehabilitation. Unter <strong>der</strong> Anleitung<br />
eines Facharztes <strong>für</strong> Physiotherapie obliegt dieser die physiotherapeutische<br />
Behandlung im stationären und ambulanten<br />
Sektor des Krankenhauses.<br />
Um dem weltweiten Mangel an Pflegekräften und den immer<br />
mehr steigenden Krankenhauskosten zu begegnen, werden<br />
nicht mehr pflegebedürftige Patienten zur Durchführung<br />
einer systematisch aufgebauten Rehabilitation hotelähnlich,<br />
in einem interdisziplinär belegten Bettenhaus („Hostel")<br />
untergebracht.<br />
Es erfolgt somit eine Verlagerung des Arbeitskräfteeinsatzes<br />
vom Pflege- zum Physiotherapiebereich.<br />
390
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Krauß, Naturheilverfahren<br />
o<br />
Bei einer Analyse von 6400 repräsentativen Krankengeschichten<br />
aus 11 Kliniken wurden 15,6% <strong>der</strong> Patienten von<br />
den jeweiligen Fachvertretern <strong>für</strong> solche „Hostelbehandlung"<br />
geeignet erklärt. Von prinzipieller Bedeutung bei<br />
dieser Studie ist, daß in enger Zusammenarbeit mit 12 maßgeblichen<br />
Vertretern von neun verschiedenen Fachdisziplinen<br />
das im folgenden wie<strong>der</strong>gegebene Leistungsangebot<br />
<strong>der</strong> physiotherapeutischen Abteilung akzeptiert wurde.<br />
Hiermit würde sich ein Brennpunkt physiotherapeutischen<br />
Wirkens im öffentlichen Gesundheitswesen abzeichnen.<br />
Leistungsangebot <strong>der</strong> Zentralen Abteilung <strong>für</strong> Physiotherapie<br />
und Rehabilitation im Allgemeinkrankenhaus<br />
- Bewegungstherapie<br />
Spezieile Krankengymnastik {Einzelbehandlung) - Gehschule<br />
Gruppenbehandlung: Hockergymnastik - Sporttherapie-<br />
Adipositasgymnastik - Wirbelsäulengymnastik a) <strong>für</strong> Bewegungbeschränkte,<br />
b) <strong>für</strong> Hypermobile - Kraftsport -<br />
Knie- und Fußgymnastik - <strong>für</strong> psychiatrische Patienten<br />
Mobilisationsbehandlung von Extremitäten- und Wirbelgelenken<br />
Therapieschwimmen<br />
Intervalltraining - Ausdauertraining<br />
- Atemtherapie<br />
- Funktionelle Entspannung (Gruppenbehandlung)<br />
-Autogenes Training (Gruppenbehandlung)<br />
- Manuelle Therapie<br />
- Hydrotherapie: alle wichtigen Former kleiner-mittlerergroßer<br />
Hydrotherapie - Unterwasserbewegungstherapie<br />
- Sauna<br />
- Schlammpackungen<br />
- Kryotherapie<br />
- Massage: Klassisch - Bindegewebsmassage-Segmentmassage<br />
- Periostbehandlung - Kolonbehandlung<br />
- Extensionsbehandlung: Unterwasser - Perl - Glisson<br />
- Ernährungsberatung (Gruppe und individuell)<br />
- Methodische Unterweisung in häuslicher Physiotherapie<br />
- Elektrotherapie - hydroelektrische Behandlung<br />
- Ultraschallbehandlung<br />
-Lichtbehandlung: UV-Ganzbestrahlung - UV-Feldbestrahlung<br />
- Infrarot<br />
- Inhalation: Aerosol (lungengängig) - Raum-Einzelinhalation<br />
- Spray (obere Luftwege)<br />
- Kopfdampf<br />
-Arbeitstherapie - funktionserhaltend - funktionswie<strong>der</strong>herstellend.<br />
Die sozialen und politischen Bedingungen unter denen sich<br />
das Naturheilverfahren während des letzten % Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
zu behaupten hatte, waren sehr unterschiedlich. Dies spiegelt<br />
sich in den Nahzielen wie<strong>der</strong>, die sich seine Organisationsformen<br />
jeweils stecken konnten.<br />
Wir sollten darüber das Wesentliche unseres Auftrages<br />
nicht vergessen, nämlich daß wir <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren<br />
uns stets als Anwälte einer bionomen Orientierung<br />
aller Entwicklungen in unserer Zeit fühlen müssen.<br />
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. H. Krauß, Reuterstr. 7,<br />
DDR-1297 Zepernick.<br />
o<br />
Schönwetterfeld mit Klimaleuchten<br />
i__ o<strong>der</strong> einen<br />
"~~ Bio-Raum<br />
Ionisator<br />
T 180 Super<br />
- positiv und negativ —<br />
<strong>für</strong> biologisch gesundes Wohnklima, Erhaltung<br />
<strong>der</strong> Leistungsfähigkeit und <strong>der</strong><br />
Vitalität. Eine Hilfe gegen die „Hauskrankheiten".<br />
Der Klimafaktor „Luftelektrizität"<br />
bestimmt unser Wohlbefinden.<br />
Hersteller<br />
Alfred Hornig<br />
Bio-Med-Elektronic<br />
Raumluft-Technik<br />
Am Konigsbuhl 25<br />
D-8991 Achberg Lindau (Bodensee)<br />
Tel (0 83 80)5 58<br />
Rheuma-Kur<br />
Hilfe durch Naturheilkunde<br />
Biolog. Kurklinik <strong>für</strong> Rheuma, Wirbelsäulen- und Stoffwechselleiden<br />
• MAYR- und Regenerations-Kuren • Wellenbad •<br />
Warmschwimmbecken • Naturheilverfahren • Alle Zimmer<br />
mit Bad und Balkon (Rheinseite) • Ärztl. Leitung • BEI-<br />
HILFEFÄHIG • Geför<strong>der</strong>t vom Rheuma-Hilfswerk Deutschland.<br />
Prospekte gegen DM 1.- Rückporto<br />
RHEUMATORIUM HUMBOLOTHÖHE<br />
5414 Vallendar/Rhein, Tel. (0261) 6 40 31<br />
Wir sind Partner des naturheilkundlichen Arztes, <strong>der</strong> <strong>für</strong><br />
Problempatienten eine stationäre Intensivbehandlung<br />
wünscht Patienten-Information gratis.<br />
391
Aus dem Institut <strong>für</strong> Atempflege und Massage, Freudenstadt<br />
v. Glaser Atem und Vegetativum*<br />
Zusammenfassung<br />
Die vegetative Dystonie - mo<strong>der</strong>ner ausgedrückt -<br />
„das psycho-vegetative Syndrom", ist Ausdruck eines<br />
in seiner „Emotionalität gestörten Befindens".<br />
Unbewußte Regungen vegetativer Funktionen werden<br />
so auch im motorischen Verhalten offenbar.<br />
Der Verfasser zeigt Möglichkeiten auf, neben medikamentöser<br />
Therapie auch über eine individuelle<br />
Atemtherapie Eutonie anzustreben.<br />
Summary<br />
Vegetative dystonia - or giving it its mo<strong>der</strong>n term<br />
„psycho-vegetative syndrome", is an expression of<br />
„emotionally disturbed health".<br />
Unconscious Stimulation of vegetative f unctions thus<br />
become apparent in the motoric behaviour.<br />
In addition to medication therapy, the author indicates<br />
possibilities of obtaining euthymy with individual<br />
breathing therapy.<br />
Die vegetative Fehlsteuerung ist in unserer Zeit so gravierend<br />
geworden, daß zu ihrer Ausbalancierung die therapeutische<br />
Palette auch nichtmedikamentöse Behandlungsmaßnahmen<br />
einbeziehen sollte. Hierbei spielt die Atmung<br />
wohl den bedeutendsten Zugangsweg zur natürlichen Regulierung.<br />
Die Methoden, die hierbei zur Anwendung gebracht werden<br />
können, sind durchweg aus <strong>der</strong> Erfahrung gewachsen,<br />
wobei gewiß gerade diese sich oft als die wirkungsvollsten<br />
erweisen, bei denen das Wort „Atem" gar nicht anklingt<br />
und die den Patienten möglichst nicht auf die Beachtung<br />
des eigenen Atemablaufes orientieren. Man spricht von<br />
Entspannung, Lösung, Dehnung, Eutonie, Ruhe und Gelassenheit<br />
o<strong>der</strong> auch von Frei-Lassen, Zu-Lassen, Kreativ-<br />
Werden und Freier Expression. Auch dann, wenn Tanzen,<br />
Singen, Spielen, Kämpfen anempfohlen wird und natürlich<br />
auch Meditationen und transzendente Erfahrungen wichtig<br />
erscheinen: Es ist immer das Atemsystem, das hierbei primär<br />
angesprochen und verän<strong>der</strong>t wird.<br />
Gerade diese Vielfältigkeit macht aber die Atemtherapie<br />
dem wissenschaftlich orientierten Therapeuten so suspekt,<br />
vor allem deswegen, weil die Wirkmechanismen und Regelungsvorgänge<br />
ihm noch nicht genügend durchschaubar<br />
erscheinen.<br />
Immerhin hat die Neurophysiologie und Streßforschung in<br />
dem letzten Jahrzehnt so viele Fakten beigebracht, daß<br />
sich das Problem Atem und Vegetativum auch von <strong>der</strong><br />
erkenntnistheoretischen Seite her interpretieren läßt (fe<strong>der</strong>führend<br />
ist hier im deutschen Raum v. Eiff).<br />
An sich bietet sich das Atmungssystem schon deswegen<br />
als Zugangstor zum Vegetativum an, weil es einerseits,<br />
* Nach einem Vortrag, gehalten auf dem Kongreß des <strong>Zentralverband</strong>es<br />
<strong>der</strong> <strong>Ärzte</strong> <strong>für</strong> Naturheilverfahren am 16. September 1980<br />
in Freudenstadt.<br />
autonom geregelt, durch den Gasaustausch an <strong>der</strong> Homöostase<br />
des inneren Milieus beteiligt ist, an<strong>der</strong>erseits<br />
aber dadurch, daß <strong>der</strong> Luftwechsel durch die quergestreifte<br />
Skelettmuskulatur getätigt wird, auch <strong>der</strong> willkürlichen Beeinflußung<br />
untersteht.<br />
Es ist verständlich und naheliegend, auf <strong>der</strong> Basis dieses<br />
Dualismus <strong>der</strong> Regelungsformen eine Therapie aufzubauen,<br />
also die bewußte willkürliche Atemführung zur Harmonisierung<br />
des Vegetativums einzusetzen. In zunehmendem Maße<br />
setzt sich aber die Erkenntnis durch, daß gerade die bewußte<br />
Eigendirektive <strong>der</strong> Bewegungsabläufe, <strong>der</strong> Haltung<br />
und des Atems eher als Störungsmoment des Vegetativums<br />
fungiert und ein weiterer, diesen Dualismus überbrücken<strong>der</strong><br />
Regelungsmechanismus stärkere Beachtung finden<br />
muß.<br />
Schon <strong>der</strong> Trend, statt vegetativer Dystonie vom Psychovegetativen<br />
Syndrom (Definition bei Brandlmeier) zu sprechen,<br />
gründet in <strong>der</strong> Einsicht, daß das „Befinden" in all<br />
seiner Emotionalität die maßgeblichen Kriterien <strong>für</strong> die<br />
„vegetativen" Störungen abgibt. Die unbewußten Regungen<br />
<strong>der</strong> vegetativen Funktionen werden dadurch im motorischen<br />
Verhalten, in Mimik, Gestik, Phonik und - <strong>für</strong> den, <strong>der</strong> es<br />
zu sehen vermag - differenziert im Atemablauf offenbar.<br />
Dieses „Verhalten" ist aber eine Angelegenheit des extrapyramidalen<br />
Systems, des sogenannten 2 Weges <strong>der</strong> motorischen<br />
Regelung. Er verläuft über die dünnfaserigen<br />
Nerven des Gamma-Systems (GNS) zu den Muskelspindeln<br />
und innerviert dort efferent die tonischen Muskelfasern<br />
(quergestreift aber wie glatte Muskulatur reagierend), um<br />
durch sie indirekt die gesamte Skelettmuskualtur tonisch<br />
und phasisch zu regulieren. Das GNS ist damit verantwortlich<br />
<strong>für</strong> <strong>der</strong>en Koordination, Anpassung, Elastizität und<br />
Ökonomie.<br />
Erst wenn man sich diesen dreifachen Regelmechanismus<br />
<strong>der</strong> Atembewegungen vor Augen führt, wird die Rolle <strong>der</strong><br />
Atmung als Vermittlungsinstanz zwischen Innen und Außen,<br />
zwischen Organismus und Umwelt, zwischen unbewußter<br />
vegetativer Funktion und bewußten Verhaltensmotiven verständlich<br />
und therapeutisch sinnvoll verwertbar.<br />
Aus <strong>der</strong> unendlichen Vielfalt <strong>der</strong> Verschaltungsmöglichkeiten<br />
zwischen diesen Teilglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Motorik lassen sich<br />
doch einige wesentliche Verbindungszüge herauskristallisieren,<br />
durch die <strong>der</strong> natürliche Ablauf, die Störungsmöglichkeiten<br />
und therapeutischen Richtlinien deutlicher werden<br />
können (s. Tab. I).<br />
A. Die Abfuhr <strong>der</strong> vegetativen Antriebe<br />
1. Im Schlaf, da <strong>der</strong> Mensch ganz <strong>der</strong> Erholung seines<br />
Organismus anheim gegeben ist, dominiert das parasympathische<br />
Vagus-System. Hier regelt sich die Atmung autonom<br />
nach dem Blutmechanismus. Die Kohlensäurespannung<br />
aktiviert über die Chemorezeptoren rhythmische<br />
Neurone <strong>der</strong> Formatio reticularis zur Einatmung. Die Ausatmung<br />
erfolgt dann passiv aufgrund <strong>der</strong> mechanischen<br />
392
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Glaser, Atem und Vegetativum<br />
o<br />
o<br />
Tab. I: Die drei Regelungsmechanismen des Atemsystems.<br />
Systeme<br />
Erfolgsorgan<br />
Initiatoren<br />
Atemform<br />
Kybernetische<br />
Aufgabe<br />
Psychische<br />
Korrelation<br />
Elastizität des Atemapparates. Nach einer Pause beginnt<br />
<strong>der</strong> neue Atemzug durch neuen CO 2 -Reiz. Die Ruheatmung<br />
zeigt also den allgemein bekannten Dreier-Atemrhythmus:<br />
Aktiv ein - passiv aus - Atempause (Abb. 1 oben).<br />
Ist <strong>der</strong> Körper genügend erholt, so daß er auf Sinnenreize<br />
reagieren kann, dann schwingt <strong>der</strong> Organismus weiterhin<br />
autonom in eine sympathikotone Phase über. Der Mensch<br />
ermuntert sich, wird umweltbezogen. Dieses vorerst unspezifische<br />
„Sympathikus Syndrom" (Ehrhardt) wird in <strong>der</strong><br />
Formatio reticularis verschaltet. Mit <strong>der</strong> Erweckung <strong>der</strong><br />
höheren nervalen Instanzen zur Munterkeit und Bewußtseinshelligkeit<br />
vollzieht sich auch eine Anregung <strong>der</strong> Peripherie.<br />
Regelungsbereiche<br />
Verhaltens-<br />
Phänomene<br />
Vegetativum<br />
VNS<br />
glatte Muskeln<br />
Ausbalancierung<br />
Desintegration<br />
Chemorezeptoren<br />
<strong>für</strong> CO 2<br />
u. O2<br />
periodische<br />
Einatemimpulse,<br />
Ein-Aus-Pause<br />
Biologisches<br />
Milieu<br />
Anregung<br />
(Triggern ng)<br />
unbewußt<br />
Drang, Trieb,<br />
Affekte<br />
Instinkte<br />
Aktivität =<br />
Passivität<br />
Antrieb<br />
Egoismen<br />
Spontaneität<br />
Impulse<br />
Potenz<br />
Gesundheit<br />
(biologische<br />
Homöostase)<br />
Extrapyramidales<br />
System GNS<br />
Tonusmuskeln<br />
(in Spindeln)<br />
Muskelspindeln<br />
(Gamma-Ioop)<br />
unspezifische<br />
Tonusanhebung,<br />
Sinusrhythmus<br />
emotionales<br />
Befinden<br />
Regelung<br />
(Feedback-control)<br />
unterbewußt<br />
(marginal-bewußt)<br />
koinästhetische<br />
Gefühle<br />
Bedürfnisse,<br />
Neigung<br />
Lust = Unlust<br />
Empathie<br />
Kontakt<br />
Koordination<br />
Adaptation<br />
Wohlbefinden<br />
(Eutonie)<br />
Motiviertes<br />
Verhalten<br />
Pyramidales<br />
System ANS<br />
Skelettmuskeln<br />
Hirnrinde<br />
(Alpha-<br />
System)<br />
spezifische<br />
Atemvariationen,<br />
Abbruche<br />
rationales<br />
Verhalten<br />
Steuerung<br />
(Steering)<br />
vollbewußt,<br />
reflektierbar<br />
Handlungsthematik<br />
Einsichten<br />
Ja = Nein<br />
Dirigismus<br />
Distanzierung<br />
Definition<br />
Analyse<br />
Gelassenheit<br />
(soziale Integration)<br />
vegetative muskuläre Dystonie: Stressoren:<br />
Entgleisung:<br />
Hypotonie<br />
Hypertonie<br />
Dystonie<br />
Verspannung =<br />
Erschlaffung,<br />
Unbehagen<br />
Kontaktverlust<br />
eigene und<br />
fremde Überu.<br />
Unterfor<strong>der</strong>ungen,<br />
r, , ... Kaschierungen<br />
rsycnovegetatives ,, . ..<br />
Syndrom<br />
Verhaltensstörung<br />
§<br />
Abb.1<br />
Zeit<br />
— —— —<br />
A<br />
Mi<br />
s<br />
Ruheatmung:<br />
Vegetative Impulse<br />
Schema<br />
Pneumogramm<br />
Atmung bei psychischer<br />
Aufgeschlossenheit:<br />
Gamma-Regelung<br />
2. Mit dem sympathikotonen Arousal wird zu gleicher Zeit<br />
das 2. Regulierungssystem zugeschaltet. Das vegetative<br />
System hat also nur den Antrieb dazu gegeben. Über diese<br />
Stimulierung wird mit <strong>der</strong> Munterkeit über das GNS eine<br />
unspezifische, den ganzen Körper global erfassende Anhebung<br />
des Muskeltonus veranlaßt.<br />
Beim kleinen Kinde, das seine Glie<strong>der</strong> noch nicht in Zucht<br />
hat, heben sich dann in charakteristischer Weise die Ärmchen<br />
und Beinchen zum vergnüglichen aber noch ungeordneten<br />
Spiel. Das ganze Atemsystem verschiebt sich auf<br />
eine höhere Einatmungslage, um die herum es dann pausenlos<br />
mit entsprechend aktiven Ausatemimpulsen im Sinusrhythmus<br />
schwingt (Abb. 1 unten).<br />
In diesem unspezifischen Bereitschaftszustand, in dem alle<br />
motorischen Möglichkeiten parat stehen, erwachsen - abhängig<br />
vom allgemeinen Spannungsgrad - die unspezifischen<br />
Allgemeingefühle. Nach Berlyne wirkt starke Anregung mit<br />
Spannungserhöhung aversiv, bringt Unlust, mäßige Anregung<br />
wirkt bekräftigend. Sie schafft im günstigen Falle<br />
Wohlbehagen, das mit Kontaktvorgängen einhergeht. Es<br />
steigt die Freude des in-<strong>der</strong>-Welt-Seins auf.<br />
3. Die Grundtonisierung wird dann weiterhin zur Auswahl<br />
und zum Vollzug spezifischer Ansprüche, Motive o<strong>der</strong> Tendenzen<br />
durch das steuernde Alpha-System über die Pyramidenbahn<br />
moduliert. Dieser Einfluß vollzieht sich primär<br />
durch „Hemmung", also Min<strong>der</strong>ung des Tonuszustandes<br />
in den Körpergebieten, die beim Bewegungsablauf nachzugeben<br />
haben, die also in Dehnung und Lösung übergehen.<br />
Sie bilden dadurch Leitlinien des Bewegens, während<br />
<strong>der</strong> Bewegungsvollzug selbst durch das tonische<br />
Übergewicht <strong>der</strong> Antagonisten getätigt wird. Da <strong>der</strong> aerobe<br />
Stoffwechsel in den Lösungsgebieten stets mit erhöhten<br />
Wärmeprozessen einhergeht, werden diese Dehnungslinien<br />
393
Glaser, Atem und Vegetativum<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
auch als stärker belebt empfunden. Der Atemablauf - <strong>der</strong><br />
bereits unspezifisch aktiviert wurde - erfährt ebenfalls eine<br />
spezifische Verän<strong>der</strong>ung. Dadurch entsteht <strong>der</strong> Eindruck,<br />
als werde die Bewegung durch den Atemimpuls angeregt<br />
und dieser fließe durch die Glie<strong>der</strong> weiter, ihnen, wie bei<br />
allen freien Ausdrucksbewegungen, die natürliche Anmut,<br />
Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit vermittelnd (gute<br />
Ausführungen dazu geben Dore Jacobs und Buytendijk).<br />
Welche Bewegungsgestaltung und Atemverän<strong>der</strong>ung sich<br />
dann ergibt, wenn eindeutige Motivationen auch mit definierten<br />
Bewegungsleitlinien verknüpft sind, ist aus Abb. 2<br />
mit den Figurinen zu entnehmen. Sie bilden kardinale<br />
Grundformen <strong>der</strong> Bewegungsentwicklung (GFE) (Glaser).<br />
Ihre Ausdruckgestaltung zielt darauf ab, die Welt nach<br />
persönlichen Tendenzen zu verän<strong>der</strong>n, also innere Antriebe<br />
im Äußeren zu befriedigen. (Erstaunlicherweise deckt sich<br />
<strong>der</strong> Verlauf dieser Bewegungsleitlinien mit dem <strong>der</strong> chinesischen<br />
Meridiane. Das legt die Vermutung nahe, daß diese<br />
Meridiane ebenfalls von <strong>der</strong> Regelung des Vitaltonus abhängig<br />
zu sein scheinen und nur in diesen Zuständen<br />
funktionelle Realität aufweisen.)<br />
B. Die Abschirmung des Vegetativums<br />
Mensch dann aktiv und passiv an die Strukturen und Bewegungsmöglichkeiten<br />
seines Umfeldes an; er vollzieht sie<br />
gleichsam zusätzlich zu seinen Selbstbewegungen mit<br />
wie <strong>der</strong> Reiter die seines Fferdes, wie <strong>der</strong> Tennisspieler<br />
die seines Gegners.<br />
Diese Art <strong>der</strong> Anpassung ist ebenfalls eine Angelegenheit<br />
<strong>der</strong> extrapyramidalen Gamma-Regelung. Je spielfähiger sie<br />
wird, um so besser funktioniert dieses System auch als<br />
Abfangs- und Abfe<strong>der</strong>ungsmechanismus <strong>für</strong> alle Einwirkungen,<br />
die die „Einstellung" und damit das „Befinden"<br />
beeinträchtigen könnten. Das gilt sowohl <strong>für</strong> mechanische<br />
wie auch <strong>für</strong> psychische Belastungen, weil dieser Gamma-<br />
Regelungsmechanismus eo ipso nur dann funktionstüchtig<br />
ist, wenn <strong>der</strong> Mensch gefühlsmäßig auf Umweltkontakt<br />
schaltet, also psychologisch über sich hinaus spürt, „Transsensus"<br />
(Glaser) verwirklicht.<br />
Auch das Atemsystem ist an dieser Tonusregulation signifikant<br />
beteiligt. Die eutone Elastizitätsschaltung macht den<br />
Brustkorb und die Bauchdecken so abfe<strong>der</strong>ungsfähig, daß<br />
z. B. Stöße o<strong>der</strong> Haltungsän<strong>der</strong>ungen ohne Beeinträchtigung<br />
<strong>der</strong> Atembewegungen abgefangen und ausgeglichen<br />
werden können. Der Atemrhythmus behält unirritierbar<br />
seine schwingende Charakteristik, die einer ausbalancierten<br />
vegetativen Homöostase entspricht, bei.<br />
Wir haben geschil<strong>der</strong>t, wie sich vegetative Entwicklungstendenzen<br />
den Weg zur Befriedigung ihres Dranges in Atem,<br />
Haltung und Bewegung frei zum Ausdruck bringen. Einen<br />
solchen ungehemmten Verlauf wird man vielleicht nur beim<br />
Kleinkind finden, das sich vertrauensvoll in <strong>der</strong> Berücksichtigung<br />
seiner Umweit sicher fühlen darf. Doch schon<br />
bald wird <strong>der</strong> junge Mensch mit dem Feedback <strong>der</strong> Umwelt<br />
konfrontiert. Dieses wandelt zwangsläufig seine primäre<br />
Einstellung ab, ermöglicht ihm aber doch zugleich - und<br />
zwar vorwiegend durch Frustrationen - motorische Lernprozesse<br />
<strong>für</strong> den Umgang mit <strong>der</strong> Welt aufzubauen. Durch<br />
dieses Repertoir <strong>der</strong> Bewegungsmuster paßt sich <strong>der</strong><br />
C. Die Irritierung des Vegetativums<br />
Beim psychovegetativen Syndrom liegt die Fehlfunktion nie<br />
primär im Vegetativum selbst, son<strong>der</strong>n darin, daß dessen<br />
Konstellation nicht <strong>für</strong> das Verhalten <strong>der</strong> Gesamtperson<br />
maßgebend sein kann. Zumeist vermögen sich die biologischen<br />
Antriebe nur deswegen nicht durchzusetzen, weil<br />
die Willensdirektive, die eigentlich nur <strong>der</strong> Steuerung dienen<br />
sollte, die gesamte Regelungsform und oft sogar die<br />
Antriebe an sich zu reißen versucht.<br />
Hingabe Kraftquell Ausgleich Wandlung Überfluß Zielsetzung<br />
Abb. 2: Psychomotorik <strong>der</strong> Atembewegungen<br />
(Grundformen <strong>der</strong> Bewegungsentwicklung nach Glaser).<br />
394
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Glaser, Atem und Vegetativum<br />
o<br />
o<br />
Da will dann <strong>der</strong> Mensch im Leistungswillen mehr aus sich<br />
herausholen, als <strong>der</strong> Körper bereit ist zu geben. Es wird<br />
das Erholungsbedürfnis ignoriert, <strong>der</strong> Schlaf verkürzt,<br />
Raubbau an <strong>der</strong> Gesundheit getrieben, und künstliche<br />
Reize verfälschen echte Bedürfnisse. Dann wie<strong>der</strong> führen<br />
falsche Leitbil<strong>der</strong> zur Selbstbeschränkung. Zorn, Wut und<br />
Aggressionen werden aus Nützlichkeitserwägungen unterdrückt;<br />
Sinnenfreude darf nicht aufkommen, <strong>der</strong> Schmerz<br />
nicht geäußert, Liebe und Zuneigung nicht geoffenbart<br />
werden. Der Mensch orientiert sich nicht mehr an den Wirkungen,<br />
die er auf seine Mitwelt zeitigt; er wird rückbezüglich,<br />
narzistisch o<strong>der</strong> selbstkritisch und unsicher o<strong>der</strong> überheblich.<br />
Durch Selbstdressate wird er unecht und im Wesen<br />
gespalten. Bei <strong>der</strong> Rückwendung und Einschränkung <strong>der</strong><br />
gefühlsmäßigen Kommunikation mit dem Trend zur Intellektualisierung<br />
und Versachlichung blockiert er sein<br />
Gamma-Regelungs-System. Er wird hart und verspannt in<br />
den verschiedensten Leibregionen. Sein Atem wird flach,<br />
arrythmisch und thorakal verlagert, beim Leistungszwang<br />
oft sogar angestrengt hyperventilierend.<br />
Somit verliert das Atem- und Muskelsystem seine Eigenschaft<br />
als Abpufferungsmechanismus gegenüber dem<br />
Vegetativum. Belastungen von außen, die als For<strong>der</strong>ungen,<br />
Vorwürfe und Sticheleien ihn treffen, können nicht mehr<br />
im elastischen Muskelspiel gelassen und heiter abgefangen<br />
werden, son<strong>der</strong>n sie schlagen direkt auf das Vegetativum<br />
durch.<br />
Da die vegetativen Reaktionen in <strong>der</strong> Anfangsphase unbewußt<br />
verlaufen, treten sie erst dann ins Bewußtsein, wenn<br />
die Einwirkung abgeklungen ist, so daß die Welle im aufgewühlten<br />
Vegetativum erst dann wie<strong>der</strong> in die Sphäre des<br />
Befindens zurückschwappen kann. So gehört zur vegetativen<br />
Dysregulation stets eine Retardierung <strong>der</strong> unangenehmen<br />
Symptome: Schlaflosigkeit nach Aufregungen, Herz-<br />
Kreislaufstörungen nach gut durchgestandenen Stressituationen,<br />
Magenbeschwerden nach tapfer geschluckter Beleidigung<br />
usw.<br />
D. Die Diagnostik <strong>der</strong> Regulationsstörungen<br />
Sie ist gar nicht so leicht, wie man erwarten sollte. Vermutlich<br />
liegt es daran, daß das „Befinden" ja gerade an<br />
die Funktion des Regelungs-Systems gebunden ist. Doch<br />
das Befinden ist bei dystoner Regulation oft subjektiv gespalten,<br />
unsicher in <strong>der</strong> Bewertung o<strong>der</strong> wird gar willkürlich<br />
kaschiert. Man kann zwar die gestörte Verhaltensweise<br />
empathisch miterleben o<strong>der</strong> an Begleitsymptomen wie<br />
Sprache, Haltung und Bewegung ablesen, aber die Diagnostik<br />
des Atemablaufes wird weitgehend durch die Kleidung<br />
behin<strong>der</strong>t.<br />
Als Arzt kann man allerdings relativ leicht die Funktion des<br />
Abfangsystems <strong>der</strong> Atmung taktil austesten. Man lege dazu<br />
den Patienten bäuchlings auf die Untersuchungsbank und<br />
gebe ohne beson<strong>der</strong>e Erklärung am entblößten Lendengebiet<br />
mit <strong>der</strong> flachen Hand über den Wirbeln einen stetig<br />
zunehmenden Druck. Auf diese Belastung wird <strong>der</strong> Patient<br />
nach seiner üblichen Gepflogenheit gegenüber Belastungssituationen<br />
unmittelbar reagieren, so daß man aus <strong>der</strong> Art<br />
des Verhaltens Schlüsse ziehen kann.<br />
Bei vagotoner Reaktionslage würde sich <strong>der</strong> Patient unter<br />
<strong>der</strong> Hand in den Ausatem drücken lassen, als wolle er<br />
sich zurückziehen. Bei sympathikotoner Reaktionslage würde<br />
er sich aber einatmend zur Abwehr dagegen spannen.<br />
Eine dystone Reaktionslage würde man diagnostizieren<br />
können, wenn <strong>der</strong> Patient seinen Atem „verhält", also anscheinend<br />
keine Atemreaktion zeigt, statt dessen aber unter<br />
<strong>der</strong> Hand zu transpirieren beginnt und einen roten Kopf<br />
bekommt. Wenn er dann noch sagt, <strong>der</strong> Druck habe ihm<br />
nichts ausgemacht, kann damit gerechnet werden, daß,<br />
eventuell nach Stunden, Kopfschmerzen, Herzsensationen,<br />
Schlaflosigkeit o<strong>der</strong> sonstige vegetativ-dystonen Symptome<br />
auftreten können. Also Vorsicht ist geboten; man darf<br />
sich durch Beherrschungsfähigkeit nicht täuschen lassen.<br />
Bei eutoner Reaktionslage würde die berührte Gegend sich<br />
weich und elastisch <strong>der</strong> Hand entgegenschmiegen. Selbst<br />
ein stärkerer Druck veranlaßt keine Abwehrreaktion o<strong>der</strong><br />
Flucht. Der Atemablauf vertieft sich allenfalls, scheint aber<br />
nicht irritiert. Der Patient hat den Therapeuten „angenommen",<br />
sich auf ihn „eingestellt", fühlt sich „nicht behelligt".<br />
E. Therapeutische Folgerungen<br />
Die bisherigen Darlegungen eröffnen nun die Möglichkeiten,<br />
die methodischen Zugangswege zur Harmonisierung <strong>der</strong><br />
Regelungsformen und <strong>der</strong>en unterschiedliche Ansatzpunkte<br />
und Wertigkeitsstufen zu beleuchten.<br />
1. Das Naheliegenste ist, von allen Umwelteinwirkungen<br />
und von <strong>der</strong> willkürlichen Bevormundung des Vegetativums<br />
Abstand zu nehmen, sich <strong>der</strong> Ruhe hinzugeben, den<br />
vagotonen Erholungsvorgang anzusteuern und den Atem<br />
kommen zu lassen, wie er mag, etwa nach <strong>der</strong> Vorsatzbildung<br />
des Autogenen Trainings nach J. H. Schultz: „Atmung<br />
vollkommen ruhig; es atmet mich".<br />
2. Auch das apparative Biofeedback <strong>der</strong> Atembewegungen<br />
mit <strong>der</strong> Einstellung <strong>der</strong> Rhythmik, des Ruheatems, Ein-Aus-<br />
Pause, hat sich hier als wertvoll zur Entspannung erwiesen.<br />
Der Begriff <strong>der</strong> Entspannung o<strong>der</strong> Relaxation ist hier wirklich<br />
angebracht, denn das tonusregulierende GNS wird<br />
hierbei tatsächlich abgeschaltet. Es ist also keineswegs<br />
gesichert, ob im nachhinein eine gute Tonisierung sich<br />
von selbst aufbaut. Darum sind solche autogenen „Entspannungs"-Methoden<br />
vornehmlich <strong>für</strong> sympathikoton und<br />
damit hyperton reagierende Menschen geeignet, die „gekonnt"<br />
in die persönliche Überfor<strong>der</strong>ung gehen, also <strong>für</strong><br />
die sogenannten aktiven Manager und Leistungsbeflissenen.<br />
3. In ähnliche Richtung tendieren jene Lösungs- und Atemtherapien,<br />
die anempfehlen, daß <strong>der</strong> Mensch den muskulären<br />
Spannungen innerhalb seines Leibes bewußt nachspüren<br />
solle. Aus <strong>der</strong> Fülle <strong>der</strong> Schulen seien nur einige<br />
395
Glaser, Atem und Vegetativum<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
inklinierende genannt: „Funktionelle Entspannung" nach<br />
Fuchs; die G/nd/er-Praxis, auch in <strong>der</strong> Modifikation nach<br />
G. Alexan<strong>der</strong>; die „Progressive Relaxation" nach Jacobson;<br />
<strong>der</strong> „erfahrbare Atem" nach Middendorf; das „Erspüren <strong>der</strong><br />
Innenräume" bei Schaarschuch; die „konzentrative Bewegungstherapie"<br />
nach Stolze.<br />
Bei diesen Methoden wird beson<strong>der</strong>s intensiv die vagotone<br />
Erholungsphase angepeilt und bereits <strong>der</strong> Keim <strong>für</strong> einen<br />
bündigen Übergang in die sympathikotone Aktivierungsphase<br />
gelegt. Diese wird aber thematisch nicht mit angesprochen,<br />
son<strong>der</strong>n hat sich aus sich selbst heraus zu entfalten.<br />
4. Der unmittelbare Aufruf des Tonisierungs-Systems bedarf<br />
stets <strong>der</strong> gefühlsmäßigen Hinwendung auf das Draussen,<br />
den Transsensus, also Raumgefühl und Kontaktaufnahme,<br />
Umgang mit Dingen und mit Lebendem, das ein<br />
eigenständiges Feedback geben kann. Am wirkungsvollsten<br />
<strong>für</strong> die regelrechte Ionisierung ist dabei die Kommunikation<br />
in <strong>der</strong> Mitmenschlichkeit. Hier in <strong>der</strong> Bezugnahme<br />
zu einem adäquaten motorischen System, im empathischen<br />
Miteinan<strong>der</strong>sein, in <strong>der</strong> stetigen Wechselwirkung, entfaltet<br />
sich mit den Reifungsvorgängen nicht nur <strong>der</strong> Atemapparat,<br />
son<strong>der</strong>n es wird auch <strong>der</strong> vegetative Untergrund in <strong>der</strong><br />
ihm gemäßen Periodizität aufgerufen und trainiert.<br />
Welche Prinzipien dabei als Entwicklungstendenzen angesprochen<br />
werden sollten, um zu einer abgerundeten Persönlichkeit<br />
zu gelangen, lassen sich aus den Grundformen<br />
<strong>der</strong> Bewegungsentwicklung entnehmen.<br />
In je<strong>der</strong> einzelnen Bewegungsgestaltung sind alle drei Regelungsarten<br />
integriert: Der Antrieb aus innerem Entwicklungsdrang,<br />
<strong>der</strong> Transsensus zum Aufbau des Kontaktfeldes<br />
als unspezifische Tonusregulation und die Motivierung<br />
zur Steuerung <strong>der</strong> spezifischen Ausdrucksgestaltung<br />
und Wirkungsabsicht (nähere Ausführungen bei Glaser:<br />
Eutonie, Lehrbuch <strong>für</strong> Psychotonik).<br />
Aus den sechs Grundformen ergibt sich eine hierarchische<br />
Ordnung <strong>der</strong> Entwicklungstendenzen, in denen wie<strong>der</strong>um<br />
die einzelnen Regulierungsformen bevorzugt geför<strong>der</strong>t werden.<br />
a) Die beiden linken Formen auf <strong>der</strong> Abbildung haben Affinität<br />
zum vegetativen Antrieb. Sie sind im Kleinkindesalter dominant.<br />
Stoßen, Strampeln, Greifen und Klammern sind in<br />
dieser Lebensphase als animale Triebfunktionen ebenso<br />
zugehörig wie die des Aufnehmens, Lockens und Empfangens.<br />
Kommen sie hier beim Kind noch ungehemmt ganzkörperlich<br />
zum Ausdruck, so kann ihr Fehlen o<strong>der</strong> ihre<br />
Unterdrückung im späteren Leben die Grundlage zur vegetativen<br />
Entgleisung abgeben.<br />
So ist es verständlich, daß sich heutigen Tages in zunehmendem<br />
Maße solche Therapieformen in den Vor<strong>der</strong>grund<br />
spielen, die den animalen Untergrund wie<strong>der</strong> tragfähig<br />
machen wollen. Reich, nunmehr vertreten durch Löwen,<br />
baute die „Bioenergetik" fast ausschließlich auf diesen<br />
beiden Bewegungsformen auf. „Aggressions-Übungen"<br />
gehören <strong>der</strong>zeit zum Repertoire <strong>der</strong> Selbsterfahrungsgruppen,<br />
die wie<strong>der</strong> ursprüngliche Regungen zu äußern<br />
396<br />
wagen. Extrem expressiv entladen sich diese Wesenszüge<br />
in <strong>der</strong> „Urschrei-Therapie" nach Janov.<br />
b) Das Regelungs- und Koordinierungssystem selbst wird<br />
durch die Prinzipien <strong>der</strong> mittleren Gruppe beson<strong>der</strong>s geför<strong>der</strong>t,<br />
kommt doch im Atemkreuz <strong>der</strong> verbindende Ausgleich<br />
und im Schwinger die gleitende Anpassung, das<br />
verbindende aber unverbindliche Miteinan<strong>der</strong>-Umgehen,<br />
zum Ausdruck. Diese Wesenszüge sind in <strong>der</strong> Jugendlichkeit<br />
dominant. Hier bahnt sich die Sublimierung <strong>der</strong> Triebe,<br />
die gefühlsmäßige Ausrichtung auf das Miteinan<strong>der</strong>sein und<br />
das Miteinan<strong>der</strong>-Umgehen an. Hier vollziehen sich die Lernvorgänge<br />
<strong>der</strong> sozialen Kommunikation. Hier entfaltet sich<br />
<strong>der</strong> Ausgleich zwischen Innen und Außen, integriert sich<br />
das Vegetativum zu den Lebensaufgaben.<br />
Der Atem wird schwingend, reaktionsfähig und elastisch<br />
in <strong>der</strong> Rumpfmuskulatur.<br />
So wird in vielen Atemschulen des Atemkreuz bevorzugt<br />
eingebaut (Wolf; „Organgymnastik" bei Medau-Schmitt).<br />
Daneben gehören methodisch in diese Richtung alle bewegungsmäßig<br />
orientierten Leibtherapien, wie sie heute auch<br />
in <strong>der</strong> Infarkt-Prophylaxe und -Rehabilitation eingesetzt<br />
werden. Hierbei stehen Partnerspiele obenan.<br />
c) Die beiden rechten Figuren drücken die höchste Re/festufe<br />
<strong>der</strong> menschlichen Entwicklung aus: DasSich-zur-Verfügung-Stellen<br />
aus <strong>der</strong> Fülle <strong>der</strong> gewonnenen Erfahrung heraus<br />
und die Berechtigung, aus höherer Einsicht, Überschau<br />
und Erkenntnis richtungsweisend sein zu können. Für eine<br />
solche Gestaltung ist es unabdingbare Voraussetzung, daß<br />
die vorangehenden Entwicklungsstufen durchlebt worden<br />
sind, so daß <strong>der</strong> vitale Unterbau und die echte Kommunikationsfähigkeit<br />
noch erkennbar und wirkend sind. Haben<br />
diese sich nicht ausreichend entfaltet und wurde <strong>der</strong> Oberbau<br />
auf schwachen Füßen dominant, dann treten die geschil<strong>der</strong>ten<br />
Schwierigkeiten <strong>der</strong> Zerebralisierung auf, die<br />
wir als ausgesprochene Störfaktoren des Vegetativums<br />
erkannten.<br />
Bei rechtem Einsatz kann jedoch diese, nur den Menschen<br />
auszeichnende Fähigkeit <strong>der</strong> verständigen Einsicht in übergeordnete<br />
Zusammenhänge und <strong>der</strong> Verantwortlichkeit zur<br />
Sefbstgestaltung segensreich zur Harmonisierung auch<br />
des vitalen Untergrundes sein.<br />
Methodisch beinhaltet dies dann aber, nicht erst im Falle<br />
<strong>der</strong> vegetativen Störungen, son<strong>der</strong>n auch sonst in <strong>der</strong><br />
Lebensgestaltung, die eigenen Intentionen auf eine gefühlsgetragene<br />
soziale Integrierung auszurichten. Auf dem therapeutischen<br />
Sektor würde dies bedeuten, sich nicht auf<br />
sachliche, nüchterne Anweisungen in bezug auf den Atem<br />
o<strong>der</strong> die Verhaltensweise des Patienten zu beschränken,<br />
son<strong>der</strong>n die eigene Anteilnahme deutlich werden zu lassen,<br />
kommunikativ animierend zu sprechen und vor einem taktilen<br />
Einsatz nicht zurückzuschrecken.<br />
Eutonie, die den ganzen Menschen psychosomatisch erfassen<br />
soll, realisiert sich letztendlich nur in einem liebenden<br />
Miteinan<strong>der</strong>sein, wie es Binswanger herausstellt.
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Glaser, Atem und Vegetativum<br />
o<br />
Literatur<br />
Alexan<strong>der</strong>, G.: Die Lehre von <strong>der</strong> Entspannung und Eutonie. In:<br />
Eutonie. Karl. F. Haug Verlag, Ulm 1964.<br />
Alexan<strong>der</strong>, G.: Eutonie, ein Weg <strong>der</strong> körperlichen Selbsterfahrung.<br />
Kösel Verlag, München 1976.<br />
Berlyne, D. E.: Arousal and reinforment. Nebraska Symp. Motivation.<br />
Nebraska 1967 (zit. nach Ehrhardt).<br />
Binswanger, L: Grundformen und Erkenntnisse menschlichen<br />
Daseins. 3. Aufl. E. Reinhardt Verlag, München 1962.<br />
Brandlmeier, P.: Psychovegetative Störungen im Krankengut <strong>der</strong><br />
Allgemeinpraxis. Forum d. Prakt. u. Allgemein-Arztes 19 (1980) 8.<br />
Buytendijk, F. J. J.: Allgemeine Theorie <strong>der</strong> menschlichen Haltung<br />
und Bewegung. Springer Verlag, Berlin 1956.<br />
Buytendijk, F. J. J.: Prolegomena einer anthropologischen Physiologie.<br />
O. Müller Verlag, Salzburg 1967.<br />
Ehrhardt, K. J.: Neuropsychologie motivierten Verhaltens. Enke<br />
Verlag, Stuttgart 1975.<br />
Eiff, A. W. von: Seelische und körperliche Störungen durch Streß.<br />
Fischer, Stuttgart 1976.<br />
Eiff, A. W. von: Therapiewoche 1/1978, 32/1979, 31/1981.<br />
Fuchs, M. und E. Wiesenhütter: Funktionelle Entspannung. Hippokrates<br />
Verlag, Stuttgart 1975.<br />
Gindler, £., Ch. Selber und Ch. Brooks: Irr. H. Pätzold: Psychotherapie<br />
und Körperdynamik. Junfermann Verlag, Pa<strong>der</strong>born 1974.<br />
Glaser, V.: Das Gamma-Nervenfaser-System (GNS) als psychosomatisches<br />
Bindeglied. In: Heyer: Atemschulung als Element<br />
<strong>der</strong> Psychotherapie. Wissenschaftl. Buchges., Darmstadt 1970.<br />
Glaser, V.: Eutonie, das Verhaltensmuster des menschlichen<br />
Wohlbefindens. Haug Verlag, Heidelberg 1980.<br />
Jacobs, D.: Die menschliche Bewegung. Henn. Verlag, Ratingen<br />
1962.<br />
Jacobson, £.; Progressive Relaxation. Amer. J. Psycholo. 36<br />
(1925) 73.<br />
Janov, A.: Der Urschrei. Fischer Verlag, Frankfurt 1973.<br />
Löwen, A.: Bioenergetik. Scherz Verlag, Bern und München 1976.<br />
Medau, H.: Mo<strong>der</strong>ne Gymnastik, Lehrweise Medau. Pohl Verlag,<br />
Celle 1967.<br />
Middendorf, I.: Atmungstherapie in Prävention und Rehabilitation.<br />
Atem 3 (1969),<br />
Reich, W.: Die Funktion des Orgasmus. 5. Aufl. Kiepenheuer Verlag,<br />
Köln 1971.<br />
Schaarschuch, A: Lösungs- und Atemtherapie bei Schlafstörungen.<br />
Turm Verlag, Bietigheim 1962.<br />
Schmitt, J. L: Atemheilkunst. 4. Aufl. H. G. Müller Verlag, München<br />
1960.<br />
Schultz, J. H.: Das Autogene Training. 14. Aufl. Thieme Verlag,<br />
Stuttgart 1975.<br />
Stolze, H.: Konzentrative Bewegungstherapie nach Stolze, in:<br />
Stokvis und Wiesenhütter: Der Mensch in <strong>der</strong> Entspannung.<br />
Hippokrates Verlag, Stuttgart, 3. Aufl. 1976.<br />
Wolf, K.: Integrale Atemschulung, Humata Verlag, Bern.<br />
.Anschrift des Verfassers: Dr. med. V. Glaser, Institut <strong>für</strong> Atempflege<br />
und Massage, Straßburger Str. 25, D-7290 Freudenstadt.<br />
Aus dem Institut <strong>für</strong> Kernenergetik (Abt. Strahlenbiologie) <strong>der</strong> Universität Stuttgart<br />
K. E. Lotz Die Krankheit auch ein Standortproblem ?<br />
Neue baubiologische Forschungsergebnisse<br />
O<br />
Zusammenfassung<br />
Die nach dem Zweiten Weltkrieg rasch zunehmende<br />
Bautätigkeit in <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland hatte<br />
zum Ziel, möglichst schnell und viel Wohnraum zu<br />
beschaffen. Man hatte nur die Nutzanwendung im<br />
Auge, ohne dabei auf die biologische Seite des Wohnens<br />
zu achten.<br />
Gewisse alarmierende Feststellungen namhafter <strong>Ärzte</strong><br />
haben indessen in letzter Zeit die Aufmerksamkeit<br />
auf sogenannte ,Haus'-Krankheiten gelegt, und es<br />
wurde <strong>der</strong> dringende Ruf laut, die baubiologische<br />
Seite zu erforschen. Inzwischen ist ein Anfang dazu<br />
gemacht; die Baubiologie wird allmählich ein Teil <strong>der</strong><br />
Forschungs- und Lehraufgaben <strong>der</strong> Fachhochschulen.<br />
Aus dieser Tätigkeit wird vom Vortragenden berichtet,<br />
über den Einfluß auf die Gesundheit von Bauplatz,<br />
Baustoffen, Bauweisen, <strong>der</strong> Haustechnik, hier<br />
vor allem von Heizung und Elektroinstallation und von<br />
<strong>der</strong> Umwelt als dem Standort im engeren und weiteren<br />
Sinne des Menschen.<br />
Summary<br />
The quickening building activity in the Fe<strong>der</strong>al Republic<br />
of Germany after the Second Word War was<br />
aimed at obtaining a great deal of living accommodation<br />
as quickly as possible. Only the use was consi<strong>der</strong>ed,<br />
without taking into account the biological<br />
side of living.<br />
Certain alarming f indings of well-known doctors have<br />
recently drawn attention to so-called „House" illnesses,<br />
and the urgent call has been expressed, to<br />
conduct research into the biological construction<br />
aspect. In the meantime a Start has been made;<br />
constructional biology is slowly becoming a part of<br />
the research and teaching tasks of the technical<br />
Colleges. The lecturer reports on this activty, on<br />
the effects on health from the building site, building<br />
materials, construction methods, house technology,<br />
with particular emphasis on heating and electrical<br />
Installation and from the environment, as the site,<br />
in the closer and wi<strong>der</strong> senses of man.<br />
397
Lotz, Krankheit ein Standortproblem?<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Baubiologische Aspekte<br />
Der gesunde Bauplatz<br />
Natürliches Strahlungsfeld<br />
Unser Lebensraum ist in das Strahlungsfeid eingebettet,<br />
das aus <strong>der</strong> Einstrahlung aus dem Kosmos und <strong>der</strong> Ausund<br />
Rückstrahlung aus <strong>der</strong> Erde gebildet wird. Das Leben<br />
hat sich in langen Zeiten damit ins biologische Gleichgewicht<br />
gesetzt. Dieses Strahlungsfeld besteht nun nicht nur,<br />
wie man vielleicht bei grober Betrachtungsweise annehmen<br />
könnte, aus <strong>der</strong> Strahlung <strong>der</strong> Sonne und davon abhängig<br />
aus <strong>der</strong>jenigen des Mondes in Form von Licht und Infraroto<strong>der</strong><br />
Wärmestrahlen. Es reicht darüber hinaus zu einer<br />
elektromagnetischen Strahlung mit größeren Wellenlängen<br />
im Zentimeter- und Dezimeterbereich. Diese Mikrowellenstrahlung<br />
hat ihren Ursprung außerhalb unseres Milchstraßensystems<br />
(sogenannte extragalaktische Hintergrundstrahlung).<br />
Es handelt sich hier um ein Strahlungsgebiet,<br />
das in den letzten Jahren das Interesse <strong>der</strong> Forschung<br />
gefunden hat. Jedoch zeichnet sich bereits ab, daß es von<br />
größtem Einfluß auf das Leben ist.<br />
Außer <strong>der</strong> Einstrahlung aus dem Kosmos herrscht eine<br />
Neutronenstrahlung, die in radioaktiven Zerfallsvorgängen<br />
in <strong>der</strong> Erdkruste ihren Ursprung hat und teilweise schon<br />
im Boden in Mikrowellenstrahlung umgewandelt wird, aus<br />
dem sie als solche austritt. Wirken die vorher erwähnten<br />
Wellenstrahlungen zusammen, so wird das natürliche<br />
Strahlungsfeld unseres Lebensraumes gebildet, und dieses<br />
Strahlungsfeld durchdringt im größeren o<strong>der</strong> kleineren Ausmaß<br />
jegliche Materie, einschließlich <strong>der</strong> Zellen von Pflanzen<br />
Tieren und Menschen.<br />
Soll nun ein Bauplatz als gesund bezeichnet werden, so<br />
heißt dies, daß er mit den natürlichen Lebensbedingungen<br />
im Einklang steht, in unserem Zusammenhang: daß das<br />
natürliche Strahlungsfeld ohne Störung auf den Menschen<br />
einwirken kann. Dies ist beim größten Teil des Erdbodens<br />
<strong>der</strong> Fall. In früheren Zeiten hat man, bevor man ein Haus<br />
baute, den vorhergesehenen Platz daraufhin untersuchen<br />
lassen, ob das natürliche Strahlungsfeld unverän<strong>der</strong>t war.<br />
Nur dann erstellte man dort sein Haus.<br />
Auch die in <strong>der</strong> freien Natur lebenden Tiere haben ein<br />
Gespür <strong>für</strong> etwaige Störungen <strong>der</strong> Strahlungsverhältnisse<br />
über dem Boden und weichen diesen meist aus. Die Pflanzen<br />
hingegen können dies nicht, sie sind schicksalhaft an<br />
den Standort gebunden. Und so läßt sich an gestörten<br />
Plätzen, beispielsweise bei Bäumen, ein unnatürliches Emporschießen<br />
ihrer Äste beobachten - ein Kirschbaum kann<br />
in <strong>der</strong> Form fast wie eine Pappel aussehen - auch Zwieselbildung,<br />
Drehwuchs und Maserknollen treten auf. Pflanzen<br />
gedeihen an <strong>der</strong>artigen Stellen trotz aller Bemühungen<br />
nicht richtig bzw. sie verkümmern und gehen ein.<br />
Störung durch Grundwasserläufe<br />
Strömt Wasser im Boden, in Spalten o<strong>der</strong> in den Poren von<br />
Sand und Kies eines <strong>für</strong> die Bebauung vorgesehenen Landes,<br />
so ist das dort herrschende Strahlungsfeld nicht mehr<br />
ungestört, son<strong>der</strong>n die Strahlung verän<strong>der</strong>t sich in ihrer<br />
Intensität und Frequenz. Da Organismen zum Ausgleich<br />
<strong>der</strong>artiger Störungen des natürlichen Strahlungsfeldes<br />
kaum in <strong>der</strong> Lage sind, so ist eine <strong>der</strong>artige Situation als<br />
ungesund anzusehen.<br />
Dies kann beispielsweise durch Hautwi<strong>der</strong>standsmessungen<br />
über fließendem Wasser und über neutralen Bodenstellen<br />
verdeutlicht werden. Testet man den Boden auf<br />
seine biophysikalische Wirkungen, so stellt man fest, daß<br />
bei geringen Verän<strong>der</strong>ungen des Standorts teilweise erhebliche<br />
Än<strong>der</strong>ungen im Hautwi<strong>der</strong>stand auftreten. Diese werden<br />
durch Wasserläufe, geologische Brüche, Verwerfungen<br />
und Spalten hervorgerufen. So findet man Plätze mit einem<br />
physiologischen Verhalten, die man als .neutral' ansprechen<br />
kann und an<strong>der</strong>e, an denen die Hautwi<strong>der</strong>stände<br />
schlagartig o<strong>der</strong> nach kurzer Zeit signifikant erhöht werden.<br />
Aus <strong>der</strong>artigen Untersuchungen und aus sehr vielen an<strong>der</strong>en<br />
läßt sich sehr deutlich ersehen, daß es <strong>für</strong> den Menschen<br />
nicht gleichgültig ist, an welchem Platz mit welcher<br />
beson<strong>der</strong>en Ausbildung des örtlichen Strahlungsfeldes er<br />
sich befindet. Der Organismus wird an den verschiedenen<br />
Standorten in eine an<strong>der</strong>e Reaktionslage, das unbewußte<br />
Nervensystem in einen an<strong>der</strong>en Erregungszustand gebracht.<br />
Es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen,<br />
daß <strong>der</strong> Zustand des Organismus bei einem Aufenthalt<br />
über fließendem Wasser auf die Dauer als Stress wirkt<br />
und Steuerungskräfte verbraucht.<br />
Derartige Befunde sind nun sehr zu bedenken, wenn ein<br />
Haus auf einem Platz erbaut würde, <strong>der</strong> von Grundwasser<br />
unterströmt wird.<br />
Die Erkenntnis, daß vom Boden Einflüsse ausgehen, die auf<br />
Menschen, Tiere und Pflanzen einwirken können, ist uralte<br />
Volksweisheit. Bereits <strong>der</strong> chinesische Kaiser Kuang Yü<br />
soll um 2000 v. Chr. einen Erlaß herausgegeben haben, <strong>der</strong><br />
vorschrieb, den Baugrund von Häusern auf unterirdische<br />
Wasserläufe untersuchen zu lassen, um gesundheitsschädliche<br />
Bodeneinflüsse auszuschalten.<br />
Untersuchungen älterer Siedlungen ergaben, daß diese oft<br />
unter Vermeidung von gesundheitsbeeinträchtigenden Bodenzonen<br />
angelegt wurden. Das Wissen um die Bedeutung<br />
einer sorgfältigen Wahl des Bauplatzes <strong>für</strong> das gesundheitliche<br />
Wohlbefinden geht demnach bis ins Altertum<br />
zurück.<br />
Störungen durch Verwerfungen und geologische Brüche<br />
In ähnlicher Weise wie bei vorhandenen Grundwasserströmen<br />
wird das natürliche Strahlungsfeld bei dem ins Auge<br />
gefaßten Bauland gestört, wenn sich dort im Untergrund<br />
Verwerfungen und geologische Brüche befinden.<br />
Während <strong>der</strong> gebirgsbildenden Vorgänge treten beson<strong>der</strong>s<br />
drei Arten von Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> normalen Lagerung eines<br />
Gesteins bzw. Unterbrechungen seines ursprünglichen<br />
Zusammenhangs auf: Brüche, Verschiebungen und Faltungen.<br />
Da Verwerfungen Brüche sind, stellen sie Flächen dar, die<br />
manchmal annähernd eben sein können. Die Gesteine auf<br />
<strong>der</strong> einen Seite <strong>der</strong> Verwerfung sind an denen auf <strong>der</strong><br />
398
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Lotz, Krankheit ein Standortproblem?<br />
an<strong>der</strong>en Seite entlanggeglitten. - Derartige Verwerfungen<br />
stellen somit in <strong>der</strong> Erdkruste Störungszonen dar, da an<br />
den Verschiebungsstellen eine stärkere Grundstrahlung<br />
austritt, die bei <strong>der</strong> Bebauung sich gesundheitsschädigend<br />
auswirken kann.<br />
Baubiologische Empfehlung<br />
Man wähle einen Bauplatz, <strong>der</strong> nicht durch unterirdische<br />
Wasserläufe gestört ist und möglichst keine geologischen<br />
Brüche, Spalten und Verwerfungen aufweist. Um dies zu<br />
klären, ist es unerläßlich, das vorgesehene Bauland mittels<br />
geophysikalischer o<strong>der</strong> biophysikalischer Meßmethoden<br />
vor dem Erstellen des Hauses zu untersuchen. Unterläßt<br />
man diese Untersuchungen und liegen, wenn das Haus<br />
gebaut ist, die Wohn- und Schlafräume in geobiologischer<br />
Sicht ungünstig, d. h. über unterirdischen Wasserläufen,<br />
geologischen Brüchen o<strong>der</strong> Verwerfungen, so muß bei den<br />
Bewohnern früher o<strong>der</strong> später mit Erkrankungen gerechnet<br />
werden. Daher ist es zweckmäßig, aufgrund <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
geo- o<strong>der</strong> biophysikalischer Meßmethoden etwa festgestellte<br />
Bodenstörzonen <strong>der</strong> oben angeführten Arten beim<br />
Hausbau zu meiden.<br />
Der gesunde Hausbau<br />
Raumklima<br />
Von Wohnungsmedizinern wird immer wie<strong>der</strong> gefor<strong>der</strong>t, ein<br />
möglichst gutes Raumklima zu schaffen. Offenbar reicht es<br />
dazu nicht aus, bautechnisch unerläßliche Eigenschaften<br />
wie Wärmespeicherung, Wärmedämmung, Luftfeuchtigkeit,<br />
Schalldämmung usw. zu berücksichtigen. Dies ist nur erst<br />
die rein physikalische Seite <strong>der</strong> Aufgabenstellung.<br />
Legt man eine biologisch-dynamische, d. h. auch die Lebensvorgänge<br />
mit einbegreifende Betrachtungsweise zugrunde,<br />
so sollte <strong>der</strong> Wohnbereich imstande sein, an allen<br />
Lebensfunktionen biologisch teilzunehmen. Die Raumhüllenelemente,<br />
und somit letztlich die Baustoffe, sollten biologische<br />
Vorgänge, beispielsweise den biochemischen<br />
Abbau von Schadstoffen im Raum usw. mit einschließen<br />
und aufrechterhalten.<br />
Bei biophysikalischen Erwägungen zum Raumklima sollten<br />
bei Planung und Bau eines gesun<strong>der</strong>haltenden Gebäudes<br />
weitere, wesentliche gesundheitsbestimmende Faktoren<br />
nicht außer acht gelassen werden, die bisher nicht ins allgemeine<br />
Bewußtsein gelangt sind. Es sollte das biologische<br />
Strahlungsfeld mit erfaßt werden.<br />
Jahrelange Forschungsarbeiten führten nämlich zu dem<br />
Ergebnis, daß das Strahlungsfeld unserer Umgebung im<br />
Mikrowellenbereich - bestehend aus <strong>der</strong> Einstrahlung aus<br />
dem Kosmos und <strong>der</strong> Ausstrahlung aus dem Boden -<br />
bestimmen<strong>der</strong> Faktor <strong>für</strong> die Lebensvorgänge ist. Dieses<br />
Feld kann durch die massive Umbauung des Raumes in<br />
unbiologischer Weise, d. h. den Lebensvorgängen nicht<br />
entsprechend, verzerrt werden, wenn bei <strong>der</strong> Auswahl und<br />
Anordnung <strong>der</strong> Bauelemente dieser Gesichtspunkt nicht<br />
mitberücksichtigt wird.<br />
Mit einer entsprechenden Baustoff-Auswahl hat man schon<br />
an den <strong>für</strong> den Bau vorgesehenen Bauelementen zu beginnen,<br />
wobei <strong>für</strong> ein positives Ergebnis nötig ist, daß die<br />
natürliche Umgebungsstrahlung durch solche Baustoffkombinationen<br />
möglichst wenig gestört o<strong>der</strong> abgeschwächt<br />
wird. Als Maßstab dient dabei die Überlegung, daß die<br />
unverän<strong>der</strong>te Umgebungsstrahlung die wünschenswert<br />
beste Voraussetzung <strong>für</strong> die Entwicklung und Erhaltung<br />
von Organismen darstellt, da sich ja das Leben in langen<br />
Zeiten unter diesen natürlichen Strahlungsverhältnissen<br />
gebildet bzw. damit ins biologische Gleichgewicht gesetzt<br />
hat. Es ist weiter zu bedenken, daß mit einer organischen<br />
Anpassung an an<strong>der</strong>e Strahlungsverhältnisse nicht in kürzeren<br />
Zeitabschnitten, also Jahrzehnten o<strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>ten,<br />
zu rechnen ist. Im Gegenteil: Jede erzwungene Reaktion<br />
leben<strong>der</strong> Organismen, die sich in kürzester Frist anpassen<br />
müssen, vermin<strong>der</strong>t <strong>der</strong>en Lebensqualität.<br />
Bauweisen<br />
Ein die Lebensvorgänge betreffen<strong>der</strong> grundsätzlicher<br />
Nachteil, <strong>der</strong> dem umbauten Raum anhaftet, ist, daß die<br />
biologisch wichtige Strahlung <strong>der</strong> natürlichen Umgebung<br />
gemin<strong>der</strong>t wird. Dadurch entstehen zusammen mit kosmisch-atmosphärischen<br />
und biometeorologischen Effekten<br />
Gefahren <strong>für</strong> die Gesundheit <strong>der</strong> Bewohner.<br />
Das Ziel einer jeden biophysikalisch ausgerichteten Bautechnik<br />
muß es also sein, natürliche Umgebungsstrahlung<br />
so wenig wie möglich zu vermin<strong>der</strong>n.<br />
Die Mikrowellenbestrahlung als elektromagnetische Strahlung<br />
weist im Prinzip die gleichen Gesetze <strong>der</strong> Strahlenoptik<br />
auf, wie sie <strong>für</strong> das sichtbare Licht gelten. Daher<br />
lassen sich auch Baustoffe nach <strong>der</strong> Reflexion, Absorption<br />
und Durchlässigkeit dieser Strahlung einordnen.<br />
Aus eingehen<strong>der</strong> einschlägiger Forschung ließ sich nachweisen,<br />
daß die verschiedenen Baustoffe unterschiedlich<br />
biologische Mikrowellenstrahlung abhalten. Dazu kommt<br />
<strong>der</strong> Unterschied in <strong>der</strong> Molekularstruktur <strong>der</strong> Baustoffe,<br />
woraus <strong>der</strong>en spektroskopische Beurteilung erfor<strong>der</strong>lich<br />
wird, d. h. eine Beurteilung entsprechend <strong>der</strong> Strahlungsintensität<br />
bei unterschiedlichen Frequenzen. Diese ergibt<br />
manchmal unerwartet erhebliche Unterschiede in <strong>der</strong> baubiologisch<br />
positiven und negativen Richtung.<br />
Baustoffe lassen sich also mittels Mikrowellenspektren<br />
nach Frequenz und relativer Intensität hinsichtlich ihrer<br />
Durchstrahlbarkeit kennzeichnen. Durch den Spektrenvergleich<br />
läßt sich eine Klassifizierung <strong>der</strong> Baustoffe <strong>für</strong> diesen<br />
Parameter einführen. Durch die Wahl <strong>der</strong> Baustoffe und<br />
<strong>der</strong>en richtige Zusammenstellung zu Bauelementen wird<br />
man das gesun<strong>der</strong>haltende Bauen för<strong>der</strong>n können, sobald<br />
das Denken hinsichtlich des Mikroklimas zum Allgemeingut<br />
geworden ist.<br />
Die gesunde Haustechnik<br />
Heizungseinrichtungen<br />
Im wohngesunden Haus sollte die Heizung auf Strahlungssystemen<br />
aufgebaut sein, <strong>der</strong>en Heiztechnik weit besser<br />
401
Lotz, Krankheit ein Standortproblem?<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
ist, wenn vertikale Heizflächen hauptsächlich horizontal<br />
abstrahlen. Die Raumluft bleibt dann relativ kühl, und Temperaturschichten<br />
sind kaum wahrzunehmen. Die Lufttemperaturen<br />
unter <strong>der</strong> Decke liegen maximal 2°C über <strong>der</strong>jenigen<br />
<strong>der</strong> Bodengrenzschicht. Ein typischer Vertreter eines<br />
guten Strahlungsklimas ist <strong>der</strong> echte Kachelofen. Unter den<br />
Zentralheizungen sind bisher nur Heizleisten imstande,<br />
ein künstliches Raumklima in vergleichbarerweise hervorzubringen.<br />
Der diesen Heizflächen entweichende Warmluftschleier,<br />
<strong>der</strong> die kalte Außenwand erwärmt, bringt mit dieser<br />
einen Temperaturausgleich zustande. Unter <strong>der</strong> Zimmerdecke<br />
entsteht keine Schichtung warmer Luft.<br />
Diese indirekte Strahlungsheizung weist einen geringen<br />
Energieverbrauch auf, was <strong>der</strong> nachstehenden Reihenfolge<br />
<strong>der</strong> Auswirkung vom Luftheizeffekt auf den Energieverbrauch<br />
<strong>für</strong> die bekannten Heiztechniken entnommen werden<br />
kann:<br />
Luftheizungen <strong>der</strong> Hafner (Mehrraumheizungen); Einzelöfen,<br />
gas-, öl- o<strong>der</strong> kohlebefeuert; Nachtstromspeicheröfen<br />
(luftbewegende Bauarten); Konvektorensysteme; Radiatoren,<br />
Röhrenheizkörper; Plattenheizkörper; Deckenheizungen;<br />
Fußbodenheizungen; Heizleistensysteme; Kachelöfen<br />
(ohne Luftdurchzug).<br />
Hier ist von Stufe zu Stufe mit 3 bis 5% Zu- bzw. Abschlag<br />
bei <strong>der</strong> installierten Leistung und beim Verbrauch zu rechnen.<br />
Es sind also nicht nur <strong>der</strong> Energieaufwand, son<strong>der</strong>n<br />
auch die installierte Leistung systemabhängig. Darausfolgt,<br />
daß nicht etwa bautechnische Bemühungen wie verbesserte<br />
Dämmung des Mauerwerks, Isolierglasfenster usw.<br />
weitaus bessere Möglichkeiten bringen, son<strong>der</strong>n daß diese<br />
bei <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Heiztechnik zu suchen sind, ohne daß ein<br />
finanzieller Aufwand erfor<strong>der</strong>lich wird.<br />
Neben den bisher üblicherweise verwendeten Energieträgern<br />
(Wasserkraft, Kohle, Erdgas, Erdöl, Uran) scheint<br />
durch das immer größer werdende Umweltbewußtsein die<br />
Zeit jetzt reif, daß man <strong>für</strong> die humane Heiztechnik, gerade<br />
auch im Wohnhaus, unsere unerschöpflich zur Verfügung<br />
stehende Energiequelle heranzuziehen sucht: die Sonne.<br />
Elektroeinrichtungen<br />
Betrachtet man das mo<strong>der</strong>ne Haus mit den <strong>der</strong>zeit üblicherweise<br />
verwendeten Elektroinstallationen und -geraten, so<br />
muß man feststellen, daß hier zum Teil erhebliche biologische<br />
Störfaktoren vorliegen. Diese können unter an<strong>der</strong>em<br />
mittels biophysikalischer Meßmethoden, wie etwa durch<br />
Körperwi<strong>der</strong>standsmessungen, nachgewiesen werden.<br />
Bei <strong>der</strong>artigen sogenannten „Elektrostörungen" handelt es<br />
sich um technisch erzeugte elektromagnetische Fel<strong>der</strong>.<br />
Ihre Ursprünge können sein:<br />
1. Kunststoffoberflächen, die sich durch Reibung elektrisch<br />
aufladen;<br />
2. Elektrische Energieversorgungsnetze;<br />
3. Rundfunk-, Fernseh- und kommerzielle Nachrichtensen<strong>der</strong>.<br />
Der Einfluß solcher elektromagnetischen Fel<strong>der</strong> im Hause<br />
kann bei Menschen zu Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden<br />
usw. führen.<br />
Abhilfemaßnahmen<br />
Das wohngesunde Haus sollte sich möglichst in größerem<br />
Abstand von Trafostationen, Hochspannungsleitungen und<br />
<strong>der</strong>gleichen befinden, um von dort ausgehende Gesundheitsstörungen<br />
<strong>für</strong> den Menschen zu verhüten.<br />
Innerhalb des Hauses geht es darum, von Kunststoffoberflächen<br />
sich ergebende elektrische Fel<strong>der</strong> dadurch zu vermeiden,<br />
daß man Materialien mit <strong>der</strong>artigen Eigenschaften<br />
nicht verwendet und da<strong>für</strong> an<strong>der</strong>e einsetzt, die elektrische<br />
Halbleiter darstelien. Solche Stoffe liegen insbeson<strong>der</strong>e in<br />
Form von Naturprodukten vor.<br />
Weiter geht es darum, die von <strong>der</strong> Elektroinstallation verursachten<br />
Fel<strong>der</strong> abzuschirmen bzw. zu vermin<strong>der</strong>n. Die<br />
Maßnahmen hierzu beginnen bereits bei <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong><br />
elektrischen Energie in das Haus. Anstelle von Dachstän<strong>der</strong>n<br />
sind bei <strong>der</strong> Hausanschlußleitung Erdkabel geeigneter,<br />
da diese sich besser mit einer magnetischen Abschirmung<br />
versehen lassen.<br />
Weitere Hinweise<br />
Außer dem vorher Geschil<strong>der</strong>ten sind <strong>für</strong> das wohngesunde<br />
Haus auch gesun<strong>der</strong>haltende Anstriche und Raumausstattungen<br />
vorzusehen, was hier nur angedeutet sei.<br />
Die gesunde Umwelt des Hauses<br />
Der Übergang vom Haus zum Garten, dem „grünen Zimmer"<br />
des Hauses, sollte fließend erfolgen. Dessen Bedeutung<br />
möge noch umrissen werden:<br />
Die Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Lebensumwelt wird in beson<strong>der</strong>er Weise<br />
im Raum <strong>der</strong> großen Menschenballungen sichtbar. Das mit<br />
zunehmen<strong>der</strong> Bebauung entstehende ungünstige Stadtklima<br />
wird von den Stadtplanern oft nur am Rande berücksichtigt.<br />
Gegenüber dem Klima auf dem Lande ist das<br />
Stadtklima entsprechend <strong>der</strong> Stadtgröße mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
denaturiert. Die Än<strong>der</strong>ungen treten vor allem in <strong>der</strong><br />
abgewandelten Luftzusammensetzung, Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Luftfeuchtigkeit, Erhöhung <strong>der</strong> Temperatur, Verringerung<br />
<strong>der</strong> Windgeschwindigkeit und Än<strong>der</strong>ung des Windsystems<br />
in Erscheinung.<br />
In einer gasförmigen Grundsubstanz enthält die Stadtluft<br />
feste, flüssige und gasförmige Spurenstoffe. An die festen<br />
Verunreinigungen lagern sich bevorzugt giftige Gase an:<br />
Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, Schwefeldioxid.<br />
Bei einem täglichen Atemvolumen von 12 cbm Luft<br />
verbleiben ca. 20 Milligramm dieser Schadstoffe in <strong>der</strong><br />
Lunge, ein Wert, <strong>der</strong> sich bei schwerer Arbeit verzehnfachen<br />
kann.<br />
Der durch die Luftverunreinigung gebildete Stadtdunst kann<br />
bis zu 20 Prozent <strong>der</strong> Sonneneinstrahlung zurückhalten<br />
und beson<strong>der</strong>s den gesundheitlich so wesentlichen Ultraviolett-Anteil<br />
<strong>der</strong> Strahlung abschwächen o<strong>der</strong> sogar aufheben.<br />
Vergleicht man die Temperatur <strong>der</strong> Städte mit dem sie<br />
umgebenden Land, so sind die Städte um 0,5 bis 1,5° C<br />
402
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.<br />
Lotz, Krankheit ein Standortproblem?<br />
wärmer. Sie liegen also gewissermaßen 100 bis 300 Meter<br />
tiefer und haben ein entsprechend schlafferes Klima, da<br />
einem Temperaturunterschied von 1° C eine Höhendifferenz<br />
von 200 Metern entspricht. Absolut können die Temperaturen<br />
zwischen Stadtmitte- und -rand sich um mehr<br />
als 10 Grad unterscheiden. Je größer die Stadtfläche, je<br />
höher und dichter die Bebauung, desto mehr steigen die<br />
Temperaturen an. Baumlose, breite Straßen erhitzen sich<br />
beson<strong>der</strong>s stark.<br />
Infolge <strong>der</strong> erhöhten Temperaturen vermin<strong>der</strong>t sich die relative<br />
Luftfeuchtigkeit in den Städten, was Erkrankungen des<br />
Nasen- und Rachenraumes begünstigt. Zudem lassen die<br />
Baumassen nur eine verringerte Luftbewegung zu; dies<br />
führt zur Ausbildung eines ihre Durchlüftung behin<strong>der</strong>nden<br />
Luftkissens. Der an windstillen Tagen aufkommende ,Flurwind'<br />
bringt verstärkt Luftverunreinigungen in das Stadtinnere.<br />
Aus all dem ergibt sich die Aufgabe, die Natur in die Wohn-<br />
Siedlungen und Städte hineinzuholen. Das beginnt mit <strong>der</strong><br />
Erhaltung möglichst jeden Baumes, setzt sich über die<br />
Pflanzung neuer Bäume bis zur Einrichtung geeignet liegen<strong>der</strong><br />
und richtig aufgebauter Grünflächen fort. So läßt sich<br />
das gestörte Stadtklima auf Normalwerte zurückführen.<br />
Gerade an windstillen Tagen überwinden Grünflächen den<br />
Luftstillstand durch die Bildung vieler Luftkreisläufe und tragen<br />
entscheidend zur Durchlüftung und dabei zur Friscriluftversorgung<br />
bei:<br />
Nur durch großflächige Grünanlagen kann die Überwärmung<br />
<strong>der</strong> Stadtluft gemin<strong>der</strong>t werden. Als höchste Temperaturerniedrigung<br />
wurden bei einer nur 50 bis 100 Meter<br />
breiten Grünfläche 3,5 Grad gemessen (nach A. Bernatzky).<br />
Wie sehr Einzelbäume an <strong>der</strong> Temperatursenkung und an<br />
an<strong>der</strong>en Grünflächenwirkungen beteiligt sind, zeigen die<br />
folgenden Beispiele (nach A. Bernatzky): Eine hun<strong>der</strong>tjährige<br />
Buche, die mit ihrer Krone eine Fläche von 160 qm<br />
überdeckte, besaß eine äußere Blattfläche von 1600 qm,<br />
während <strong>für</strong> ihre .innere' Blattfläche (Summe <strong>der</strong> Interzellularwände<br />
des Blattinneren) 160000 qm = 16 ha festgestellt<br />
wurden. Erst daraus ergibt sich das Ausmaß ihrer<br />
Funktion. Bei einer Höhe von 25 Metern und einem Kronendurchmesser<br />
von 15 Metern beträgt die Arbeitsleistung<br />
<strong>der</strong> 100jährigen frei stehenden Buche je Stunde (im ausgewachsenen<br />
Zustand an einem Sonnentag) 2352 g Kohlendioxid<br />
(gesamtes Kohlendioxid aus 4 800 cbm Luft),<br />
960 g Wasseraufnahme, 1 712 g Sauerstoffabgabe, 1 600 g<br />
Traubenzucker-Produktion, 6075 Kalorien Energieverbrauch.<br />
Nach den angegebenen Maßen beträgt <strong>der</strong> Rauminhalt<br />
dieses Baumes samt Wurzeln und Ästen rund 15 cbm,<br />
sein Gewicht rund 12000 kg. Die Hälfte davon ist reiner<br />
Kohlenstoff. Da in jedem Kubikmeter Luft 0,15 g Kohlenstoff<br />
o<strong>der</strong> 0,5 g Kohlendioxid enthalten sind, stammt <strong>der</strong><br />
im Baum während 100 Jahre festgelegte Kohlenstoff von<br />
dem Kohlendioxid aus 40 Millionen cbm Luft, d. h. aus<br />
dem Inhalt von 80000 Einfamilienhäusern mit je 500 cbm<br />
umbautem Raum. In den 100 Jahren hat er demnach mindestens<br />
20000 kg Sauerstoff zur Verfügung gestellt. Um<br />
diesen Baum mit seinem Kronenvolumen von 2 700 cbm in<br />
seiner Leistung zu ersetzen, müßten 2 700 junge Bäume<br />
mit einem Kronenvolumen von je 1 cbm gepflanzt werden.<br />
Der tägliche Sauerstoffbedarf eines Menschen, er atmet<br />
26000mal täglich, wird durch 25 qm grüne Blattfläche<br />
erzeugt. Da aber die Vegetation im Winter ruht, rechnet<br />
man mit 150 qm Blattfläche, um den Jahresbedarf pro<br />
Kopf zu decken. Durch einen Hektar Grün- o<strong>der</strong> Gartenfläche<br />
mit Rasen, Sträuchern und Bäumen werden <strong>der</strong> Luft<br />
in 12 Stunden im Sommer 900 kg Kohlendioxid entzogen<br />
und an sie gleichzeitig 600 kg Sauerstoff abgegeben (alle<br />
Grundzahlen aus pflanzenphysiologischen Arbeiten von<br />
Straßburger, H. Walter u. a.).<br />
Man sieht also aus dem Vorstehenden, daß dem Menschen<br />
als Naturwesen das ,Grüne Zimmer' auf den Leib geschnei<strong>der</strong>t<br />
ist, so daß es zu je<strong>der</strong> Wohnung gehören sollte. Grünflächen<br />
und Bäume reinigen und kühlen also die verschmutzte<br />
und sich stärker erwärmende Stadtluft; es geht<br />
daher um die Erhaltung eines jeden Baumes!<br />
Lärmschutz<br />
Hat man nicht das Glück, daß das Grundstück von stärker<br />
befahrenen Straßen entfernt liegt, so sollte man Schutzmaßnahmen<br />
vorsehen. Hecken und Buschwerk, die in geschickter<br />
Weise gestaffelt und mit Bäumen versetzt angelegt<br />
werden, brechen die Schallwellen und wirken stark<br />
lärmlin<strong>der</strong>nd.<br />
Abfälle<br />
Im Garten zum wohngesunden Haus gilt <strong>der</strong> Grundgedanke<br />
des biologischen Gartenbaus: Leben schafft Leben.<br />
Kunstdünger sollte möglichst nicht angewendet werden,<br />
da er z. B. im Falle des Superphosphats schwefelsaure<br />
Salze als Nebenprodukt enthält. Die Pflanzen aber verbrauchen<br />
den Schwefel nicht, und die Natur setzt Bakterien<br />
ein, um den Schwefel abzubauen. Dies wirkt sich<br />
zum Nachteil des übrigen Bodenlebens aus. Außerdem ist<br />
bewiesen, daß Pflanzen, die mit Kunstdünger aufwachsen,<br />
die Vermehrung <strong>der</strong> Insekten und Krankheitserreger för<strong>der</strong>n,<br />
weil sie von diesen bevorzugt werden.<br />
Deshalb sollte man an die natürliche Humuserzeugung<br />
denken. Diese ist leicht durchzuführen, indem man in entsprechenden<br />
Komposteinrichtungen die Küchenabfälle,<br />
Blätter, Gemüseabfälle usw. sowie alles an<strong>der</strong>e geeignete<br />
organische Material aus Haus und Garten zu Kompost<br />
verarbeitet und es in einem ,Recycling-Verfahren' dem Garten<br />
wie<strong>der</strong> zuführt.<br />
Die Austrocknung, Kälte und Verschlammung des Bodens<br />
wird durch Mulchen vermieden, indem man diesen mit<br />
dünnen Schichten aus kleingehackten Gartenabfällen, Gras<br />
und dgl. bedeckt. Durch das Mulchen wird gleichzeitig das<br />
Bodenleben ernährt. Zur Versorgung mit weiteren Mineralstoffen<br />
dient Urgesteinsmehl. Das gleiche Verfahren kann<br />
man bei den Obstbäumen anwenden, indem man um diese<br />
kreisrunde, „Baumscheiben" hackt und dann auch durch<br />
Mulchen abdeckt. Dadurch kommen die Bäume ins biologische<br />
Gleichgewicht, und <strong>der</strong> Schädlingsbefall wird mit<br />
405
Lotz, Krankheit ein Standortproblem'?<br />
Arztezeitschr f Naturheilverf 7/81, 22 Jahrg<br />
<strong>der</strong> Zeit immer seltener Folge Die Anwendung hochgiftiger<br />
Spritzmittel ist nicht erfor<strong>der</strong>lich Werden eventuell<br />
doch einmal Spritzungen, vor allem in <strong>der</strong> Anfangszeit,<br />
notwendig, so bedient man sich biologischer Präparate<br />
Lagerung von Chemikalien<br />
Naturvolker, die sich noch ihren natürlichen Instinkt bewahrt<br />
haben, legen ihre Vorratsraume <strong>für</strong> Lebensmittel,<br />
Salze und dgl in größerem Abstand vom eigentlichen Aufenthalts-<br />
und Wohnbereich an Sie nehmen offenbar durch<br />
ihre noch vorhandene Empfindsamkeit wahr, daß von diesen<br />
Vorraten gewisse störende Einflüsse ausgehen können<br />
Dieses natürliche Empfinden ist uns heute vielfach verloren<br />
gegangen, und so lagern wir in unmittelbarer Nahe von<br />
Wohn- und Schlafplatzen oft erhebliche Mengen von Waschmitteln,<br />
Salzen, Arzneimitteln, Sprays, und dies ganz ohne<br />
jegliche Bedenken<br />
Schro<strong>der</strong>-Speck wies auf solche „Chemikalienstorungen"<br />
mehrfach eindringlich hm Wenn er zu in ihrem Wohnkhma<br />
gestörten Bewohnern gerufen wurde, untersuchte er die<br />
Hauser nicht nur nach den „aus dem Boden" kommenden<br />
Störungen, nach Baustoff- und Elektrostörungen, son<strong>der</strong>n<br />
stets auch nach Störungen in dieser Hinsicht So stellte er<br />
vielfach fest, daß, wenn beispielsweise Wohn- und Schlafraume<br />
im Süden von Chemikalien sich befanden, durch<br />
<strong>der</strong>en Auswirkungen Schlafstörungen und an<strong>der</strong>e Belästigungen<br />
auftraten So waren einmal ein Sack mit Salz o<strong>der</strong><br />
Rattengift in einer Abstellkammer, ein an<strong>der</strong>mal Rohrchen<br />
mit Schlafmitteln und Arzneien in Nachtschränkchen, dann<br />
wie<strong>der</strong> Metalldosen mit Sprays erhebliche gesundheitliche<br />
Storursachen Sogar die Batterien (mit ihrer Schwefelsaure<br />
und Bleiplatten) von Autos, die in Garagen unter Schlafraumen<br />
abgestellt waren, konnten in darüber befindlichen<br />
Räumen enorme Gesundheitsstörungen bis zu Krebs hervorrufen<br />
Streffer wies neuerdings auf den Synergismus hin, <strong>der</strong> bei<br />
<strong>der</strong> kanzerogenen Wirkung ionisieren<strong>der</strong> Strahlen in Kombination<br />
mit Schadstoffen, vor allem Bleiverbindungen, auftritt<br />
Vorschlage zur Sanierung<br />
Nach den Darlegungen über die große biologische Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Grünflächen sollte man diese auf jeden Fall in <strong>der</strong><br />
Umgebung des wohngesunden Hauses schaffen und in<br />
Hof und Garten „grüne Lungen" in verschiedenster Ausfuhrung<br />
anlegen, sei es als Topfpflanzen, Balkonkasten, Rasen,<br />
Busche, Hecken, Baume usw Man kann ja selbst seine<br />
Phantasie spielen lassen, um das Optimale zu erreichen<br />
Ähnliches gilt auch <strong>für</strong> den Lärmschutz Aufgestellte spezielle<br />
Holzzaune können hier eine min<strong>der</strong>nde Abhilfe<br />
bringen<br />
Organische Abfalle, die kompostierfahig sind, gehören nicht<br />
in die Mulltonne, son<strong>der</strong>n in erprobte Schnellkompostierbehalter,<br />
die sich vom wohngesunden Haus entfernt im<br />
Garten befinden<br />
Chemikalien aller Art bewahrt man zweckmäßig in einem<br />
entsprechend gelegenen Raum auf, <strong>der</strong> sich nicht gerade<br />
im Norden von Schlaf- und Wohnräumen befindet Auch<br />
Gluhbirnenvorrate gehören dorthin, da sie auch stören können<br />
Waschmittelpakete stellt man in Plastikbeutel, die man<br />
zubindet Bei Spraydosen erweisen sich solche aus Metall<br />
in ihren Storwirkungen als ungunstiger als solche aus<br />
Kunststoff Auch sie sind im größeren Abstand vom bewohnenden<br />
Menschen aufzubewahren Autogaragen mit<br />
eingestellten Kraftwagen sollten sich nicht unter Wohn- und<br />
Schlafraumen befinden, wie wir bereits darlegten<br />
Wie neue Erkenntnisse ergaben, erweisen sich in dieser<br />
Weise eingestellte Autos noch aus einer an<strong>der</strong>en Sicht als<br />
gesundheitsgefahrdend ein nach dem Abstellen noch<br />
heißer Benzinmotor enthalt im Vergaser noch ca 100 cm 3<br />
Benzin mit hochgiftigen fluchtigen organischen Bleiverbindungen<br />
(Bleitetraathyl) als Antiklopfmittel In <strong>der</strong> Garage<br />
verdampft dieses Benzin mitsamt diesen Bleiverbindungen,<br />
dringt in die Baustoffe des umbauten Raumes und somit<br />
auch in die Garagendecke und allmählich in die darüber<br />
befindlichen Räume ein Eine Abhilfe gegen diesen Effekt<br />
ist möglich, wenn man den Wagen zunächst außerhalb <strong>der</strong><br />
Garage ca 30 Minuten abkühlen laßt und dann erst einfahrt<br />
Spraydosen mit den <strong>der</strong>zeitig verwendeten Treibgasen auf<br />
Fluorchlorathylen-Basis sind aus ökologischer Sicht ganz<br />
zu meiden, da von ihrer Verwendung auf <strong>der</strong> Erde diese<br />
Treibgase gemäß kurzhchen Mitteilungen bis in <strong>der</strong> Ozonschicht<br />
nachgewiesen werden konnten und zu <strong>der</strong>en Zerstörung<br />
beitragen Dies muß verheerende Folgen nach sich<br />
ziehen, indem die durch die Ozonschicht abgefilterte Ultraviolett-Strahlung<br />
dann ungehin<strong>der</strong>t auf die Erde gelangen<br />
kann<br />
Literatur<br />
1 Czerski, P und Sf Szmigielski Microwave Bioeffects Current<br />
Status and Concepts Proceedings 5th European Microwave<br />
Conference, Hamburg, 348-357, Sept 1975<br />
2 Grand, E H, R J Sheppard und G P South The Importance<br />
of Bound Water Studies in the Determination of Energy Absorption<br />
by Biological Tissue Proc 5th Eur Microwave Conf,<br />
Hamburg, 366-370, Sept 1975<br />
3 Spalla, M, C Tamburello, C Zanfortin A Method to Measure<br />
the Charactenstics of Biological Materials at Millimeter Waves<br />
Proc 6th Eur Microwave Conf, Rom 122-125, Sept 1976<br />
4 Robinson, J E, D McCulloch, A C Chenng, E A Edelsack<br />
Microwave Heatmg of Mahgnant Mouse Tumors encapsulated<br />
in a dielectnc Medium Proc 6th Eur Microwave Conf, Rom,<br />
132-136, Sept 1976<br />
5 Berteand, A J und M Dardalhon Biological Effects by Microwaves<br />
Proc 7th Eur Micro Conf, Copenhagen, 581-589,<br />
Sept 1977<br />
6 Ednch, J und C J Smyth Millimeter Wave Thermograph as<br />
Subcutaneous Indicator of Joint Inflammation Proc 7th Eur<br />
Micro Conf, Copenhagen, 713-717, Sept 1977<br />
7 Myers, P C,N L Sadowsky, A H Barrett Clmical Application<br />
of Microwave Thermography at three Frequencies Proc 8th<br />
Eur Micro Conf, Paris, 558, Sept 1978<br />
8 Ednch, J Microwave Techniques in the Diagnosis and Treatment<br />
of Cancer Proc 9th Eur Micro Conf, Brighton, 25-33,<br />
Sept 1979<br />
9 Streffer, C (Herausgeber) Cancer Therapy by Hyperthermia<br />
and Radiation Urban & Schwarzenberg, Baltimore/München<br />
1978<br />
406
Arztezeitschr f Naturheilverf 7/81,22 Jahrg<br />
Lotz, Krankheit ein Standortproblem?<br />
10 Hahn, G M Interaction of Drugs and Hyperthermia in Vitro<br />
and in Vivo In Cancer Therapy by Hyperthermia and Radiation,<br />
Herausg C Streffer, Urban & Schwarzenberg, p 72, 1977<br />
11 Nimtz, G Mikrowellen - Einfuhrung in Theorie und Anwendung<br />
Hanser-Verlag, München/Wien, 1980<br />
12 Konig, H L Unsichtbare Umwelt Eigenverlag, München, 2<br />
Aufl 1977<br />
13 Ingram, D J E Hochfrequenz-und Mikrowellen-Spektroskopie<br />
Burtherworth & Comp , London, 1976<br />
14 Bengtsson, N E und T Ohlsson Microwave Heating in the<br />
Food Industry Proc IEEE 62 (1974) 44<br />
15 Guy, A W, J F Lehmann und J 8 Sfonebndge Therapeut«;<br />
Applications of Electromagnetic Power Proc IEEE 62 (1974) 55<br />
16 Proc IEEE 68 (1980) Nr 1 Special Issue on Biological Etfects<br />
and Medical Applications of Electromagnetic Energy<br />
17 Johnson, C C und A W Guy Nonionizing electromagnetic<br />
WaveEffects in biological Materials and Systems Proc IEEE 60<br />
(1972)692<br />
18 Myers, P C, A H Barrett und N L Sadowsky Microwave<br />
Thermography of normal and cancerous BreastTissue Annais<br />
of the New York Academy of Sciences (1979)<br />
19 Barrett, A H, P C Myers und L Sadowsky Detection of<br />
Breast Cancer by Microwave Radiometry Radio Science 12<br />
(1977) 167<br />
20 Tagungsbericht <strong>der</strong> UdSSR Akademie <strong>der</strong> Wissenschaften<br />
(17-18 Jan 1973) über nichtthermische Mikrowellen-Strahlungseffekte<br />
auf biologische Systeme Sov Physics - Usp 16<br />
(1974) 568<br />
21 Grundler, W, F Keilmann und H Fröhlich Resonant Grooth<br />
Rate Response of Yeast Cells irradiated by Weak Microwaves<br />
Physics Letters 62 A (1977) 463<br />
22 Fröhlich, H Organisation and Long Range Selective Interaction<br />
in Biological and other pumped Systems Synergetics, Herausg<br />
H Haken, Verlag G G Teubner, Stuttgart (1973) S 241<br />
23 Lofz, K £ Willst du gesund wohnen'? Paffrath-Vertag, Remscheid<br />
(1978)<br />
24 Endros, R und K E Lotz Die Strahlung <strong>der</strong> Erde und ihre<br />
Wirkung auf das Leben Paffrath-Verlag (1978)<br />
25 Endros, R und K £ Lotz Standorteinflusse auf den Lebensprozess<br />
<strong>der</strong> Organismen Paffrath-Verlag (1978)<br />
26 Lotz, K E Strahlenphysikalische, strahlenchemische und<br />
strahlenbiologische Aspekte am und im Haus Paffrath-Verlag<br />
(1978)<br />
27 Endros, R und K E Lotz Ungeklärte schwerste Autounfälle<br />
durch Frontalzusammenstoß und ihre Erklärung durch geophysikalische<br />
und biophysikahsche Storeffekte Paffrath-Verlag<br />
(1978)<br />
28 Endros, R und K E Lotz Zur Frage <strong>der</strong> Mikrowellendurchlassigkeit<br />
von Bauelementen, Mikrowellendurchlassigkert spezieller<br />
Bauelemente Zum Elektroklima in Gebäuden Paffrath-<br />
Verlag (1978)<br />
29 Popp, F A und V E Strauß So konnte Krebs entstehen<br />
Fischer, Hamburg (1979)<br />
30 Diehl, J C und S W Tromp Probleme <strong>der</strong> geographischen<br />
und geologischen Häufigkeitsverteilung <strong>der</strong> Krebssterblichkeit<br />
Haug-Verlag, Ulm (1955)<br />
31 Vester, F und G Henschel Krebs ist an<strong>der</strong>s Kindler, München<br />
(1973)<br />
32 Kreitz, H 40% weniger Kranke Herold-Verlag Dr Wetzel,<br />
München (1979)<br />
33 Freiherr von Pohl, G Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger<br />
Fortschritt <strong>für</strong> alle-Verlag, Feucht (1978)<br />
34 Hartmann, E Krankheit als Standortproblem Heidelberg<br />
(1976)<br />
35 Bachler, K Erfahrungen einer Rutengangenn Ventas-Verlag,<br />
Linz-Wien-Passau (1979)<br />
36 Budwig, J Der Tod des Tumors Band II Die Dokumentation<br />
Eigenverlag Dr Budwig, Freudenstadt (1977)<br />
37 Streffer, C Untersuchungen zur kanzerogenen Wirkung ionisieren<strong>der</strong><br />
Strahlen in Kombination mit Schadstoffen Vortrag<br />
im IKE-Colloquium, Univ Stuttgart (7 12 1979)<br />
38 Hartmann, E Über Kernstrahlungsmessungen zur Objektivierung<br />
des Globalnetzgitters Wetter-Boden-Mensch, Heft 7,<br />
W Krauth, Eberbach (1980)<br />
39 Lotz, K E Zivilisationskrankheiten <strong>der</strong> Architektur Paffrath-<br />
Verlag, Remscheid (1978)<br />
40 Lofz, K £ Strahlenbiochemische Pnmärprozesse unter beson<strong>der</strong>er<br />
Berücksichtigung des Sauerstoffeffektes - im Hinblick<br />
auf die Tumor-Strahlentherapie Paffrath, Remscheid<br />
(1980)<br />
41 Lotz, K E Gesundes Bauen - Gesundes Wohnen Paffrath,<br />
Remscheid (1978)<br />
42 Lotz, K E und M Schro<strong>der</strong>-Speck Bautechnische Gesundheitsmaßnahmen<br />
und Praxisbeispiele Paffrath, Remscheid<br />
(1978)<br />
43 Lotz, K E Einfluß von Außenwanden auf das Raumklima<br />
Paffrath, Remscheid (1978)<br />
44 Lotz, K E Über die Problematik einer exakt-baubiologischen<br />
Beurteilung von Baustoffen aufgrund des <strong>der</strong>zeitigen wissenschaftlichen<br />
Kenntnisstandes Paffrath, Remscheid (1978)<br />
45 Kopp, J Gesundheitsschädliche und bautenschadliche Einflüsse<br />
von Bodenreizen Zürich (1965)<br />
46 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Herausg E A Boedefeld<br />
Bestandsaufnahme Krebsforschung in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
Deutschland 1979 Band I-Ill, Harald Boldt, Boppard (1980)<br />
Anschrift des Verfassers Prof Dr K E Lotz, Fachhochschule<br />
<strong>für</strong> Bauwesen, Postfach 651, 7950 Biberach<br />
LEUKONA<br />
Rheuma-Bad<br />
Zusammensetzung:<br />
100 g enthalten:<br />
ÖL Pini 1,5 g, Campher 3,0 g, Ol. Thymi 4,0 g,<br />
Ol. TerebintU. reotrt.10,0 g, MethylsalicyL 15,0 g.<br />
Indikationen:Subakutes rheumatisches Fieber,<br />
Infektarthritis, primär chronische Polyarthritis,<br />
Lumbai- und Zervikalsyndrom.<br />
Kontraindikationen: Fieberhafte Erkrankungen,<br />
Tuberkulose, schwere Herz- und Kreislaufinsuffizienz,<br />
Hypertonie.<br />
200 ml (7 Vollbä<strong>der</strong>) DM 11,45 mit MwSt.<br />
1000 ml DM 33,- mit MwSt.<br />
Hersteller:<br />
Dr. Atzinger & Co. KG,<br />
8390 Passau<br />
Depositeur <strong>für</strong> Österreich:<br />
Mag. Doskar, 1010 Wien 1<br />
Schweizer Vertreter:<br />
Medinca S.A., 6300 Zug<br />
407
Neue Pharmazeutika<br />
Neurapas®<br />
Zusammensetzung<br />
1 Tablette enthält:<br />
Extr. Herb. Hyperici (aquos. sicc. 6:1) 80,0 mg, Extr. Rad.<br />
Valerianae (spri. sicc. 4:1) 40,0 mg Extr. Herb. Passiflorae<br />
(spir. sicc. 6:1) 40,0 mg, Rhiz. Corydalidis cavae 40,0 mg,<br />
Herb. Eschscholtziae californ. 40,0 mg, Cicuta virosa D2<br />
0,1 mg.<br />
Indikation<br />
Reaktive, agitierte und larvierte Depressionen, Melancholie,<br />
Neurasthenie, Neuropathie, Organneurosen.<br />
Kontraindikationen<br />
keine<br />
Dosierung<br />
1 bis 3mal täglich zwei Tabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit<br />
schlucken.<br />
Verkaufspreis<br />
Röhrchen mit 80 überzogenen Tabletten DM 6,55<br />
Hersteller<br />
PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger<br />
Weg 55, 6300 Lahn-Gießen.<br />
NEYPARADENT-Mundtherapeutikum<br />
zur biologischen Vorbeugung und Behandlung von Mundund<br />
Zahnerkrankungen.<br />
Zusammensetzung<br />
Mischung makromolekularer Organlysate (Crista dent. foet.<br />
Placenta, Diencephalon) und Arzneigrundstoffen, inkorporiert<br />
in organspezifischen Liposomen und suspendiert in<br />
Meerwasser mit Zusätzen von Phytotherapeutika (Chamomillae,<br />
Arnicae, Myrrhae). Die quantitative Zusammensetzung<br />
ist auf <strong>der</strong> Verpackung angegeben.<br />
Eigenschaften<br />
NEYPARADENT®-Mundtherapeutikum enthält organzytoplasmatische<br />
Wirksubstanzen in <strong>für</strong> Mundschleimhaut und<br />
Zahnleiste organotropen Liposomen. Liposome sind feinste<br />
Fett-Tröpfchen, in denen die Organwirkstoffe inkorporiert<br />
sind. Der Organo-Tropismus beruht auf dem Einbau von<br />
Organfaktoren in die Lipidmembranen (DBP 2650 502.2).<br />
Die biologischen Makromoleküle wirken regenerativ auf<br />
geschädigte Gewebe, indem sie die Selbstheilungsvorgänge<br />
anregen und Zellfunktionen normalisieren. Die Liposome<br />
sind in einer optimalen Mischung von phytotherapeutischen<br />
Extrakten emulgiert, die einen speziell entzündungshemmenden,<br />
die Wundheilung för<strong>der</strong>nden Effekt ausüben.<br />
Darüber hinaus enthält NEYPARADENT®-Mundtherapeutikum<br />
Meerwasser mit essentiellen Spurenelementen. Hierdurch<br />
kommt auf natürliche Weise eine adstringierende Wirkung<br />
zustande.<br />
Anwendungsgebiete<br />
Parodontopathien, Entzündungen <strong>der</strong> Mundschleimhaut<br />
und des Zahnfleisches, Aphthen, Herpes labialis.<br />
Dosierung und Anwendungshinweise<br />
Falls vom Arzt nicht an<strong>der</strong>s verordnet, 10 Tropfen und mehr<br />
auf ein Likörglas lauwarmes Wasser geben und mehrmals<br />
täglich spülen. Die Wirkstoffe sollten möglichst lange auf<br />
das Zahnfleisch und die Schleimhäute einwirken. Bei akuten<br />
Entzündungsprozessen kann NEYPARADENT -Mundtherapeutikum<br />
auch unverdünnt zum lokalen Betupfen<br />
angewandt werden.<br />
Unverträglichkeit und Risiken<br />
Bei vorgeschriebener Anwendung keine.<br />
Darreichungsform und Packungsgröße<br />
15 ml Tropfflasche<br />
Hersteller<br />
vitOrgan Arzneimittel GmbH, 7302 Ostfildem 1<br />
Cefaktivon® „novum"<br />
RES-Stimulans, Zellaktivator<br />
Zusammensetzung<br />
1 Ampulle (1 ml) enthält:<br />
Cer(lll)-chlorid<br />
Extr. Sanguinis deprot. sicc. (30:1) v. Kalb<br />
Extr. aquos. (1:5) aus Rad. Echinaceae<br />
Herb. Hyperici<br />
Fol. Trifolii fibr.<br />
Flor. Calendulae<br />
0,1 mg<br />
20 mg<br />
20 mg<br />
20 mg<br />
20 mg<br />
20 mg<br />
Anwendungsgebiete<br />
Vorzeitige Aufbrauchs- und altersbedingte Abnutzungserscheinungen,<br />
periphere und zerebrale Durchblutungsstörungen,<br />
neurovegetative Störungen, Wundheilungsstörungen,<br />
leichtere Verbrennungen, RES-Stimulans, Adjuvans<br />
bei <strong>der</strong> Krebstherapie.<br />
Eigenschaften und Wirkungsweise<br />
Cefaktivon „novum" unterstützt das Heilbestreben des Körpers<br />
bei mangeln<strong>der</strong> Abwehrkraft gegen Bakterien, Viren -<br />
aber auch entartete Zellen - und kann daher mit Vorteil bei<br />
<strong>der</strong> Kanzerose und Präkanzerose, unbeschadet des Vorranges<br />
chirurgischer, radiologischer, chemotherapeutischer<br />
und hormoneller Maßnahmen verordnet werden. Durch<br />
Cefaktivon „novum" wird das Allgemeinbefinden Krebskranker<br />
gehoben und die Angriffsfreudigkeit des RES angestachelt.<br />
Oft wird auch eine Appetitsteigerung nach<br />
Cefaktivon „novum"-Gabe beobachtet.<br />
Die Steigerung <strong>der</strong> Sauerstoffaufnahme mit <strong>der</strong> daraus<br />
resultierenden Verbesserung <strong>der</strong> zellulären Energiebereitstellung<br />
erklärt die günstige Wirkung bei mangeln<strong>der</strong> Heilungstendenz<br />
von Unterschenkelgeschwüren, trophischen<br />
Hautstörungen, Durchblutungsstörungen, Verbrennungen<br />
und chronischen Ekzemen.<br />
Cefaktivon „novum" ist darüber hinaus eine wichtige Hilfe<br />
zur Behandlung <strong>der</strong> Beschwerden des alternden Menschen.<br />
Es ist indiziert bei alters- und zivilisationsbedingten Ver-<br />
408 <strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.
auchs- und Abnutzungserscheinungen, insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
frühzeitigem Verfall nach schwereren Krankheiten, allgemein<br />
bei Schwächezuständen nach Operationen und zehrenden<br />
inneren Erkrankungen, bei klimakterischen Beschwerden<br />
<strong>der</strong> Frau und nachlassen<strong>der</strong> Aktivität des<br />
Mannes, bei neurovegetativer Dystonie sowie bei depressiven<br />
Verstimmungen, beson<strong>der</strong>s des älteren Patienten.<br />
Dosierung<br />
Täglich 1 -2 ml zur iv., im. o<strong>der</strong> sc. Injektion.<br />
Nach ca. 20 Injektionen ist eine Applikationspause von<br />
1-2 Wochen zu empfehlen, dann kann die Kur wie<strong>der</strong>holt<br />
werden. Erhaltungsdosen (von je 1 ml) sind bei erreichtem<br />
Wohlbefinden in 1-2wöchigen Abständen durchaus sinnvoll.<br />
Wenn aus irgendwelchen Gründen eine parenterale<br />
Applikation nicht möglich ist, kann <strong>der</strong> Inhalt von Cefaktivon<br />
„novum"-Ampullen auch sublingual eingenommen<br />
werden (1-2 mal täglich 1 ml).<br />
Handelsformen und Preise<br />
Packung mit 10 Ampullen zu 1 ml DM 17,97<br />
50 Ampullen zu 1 ml DM 58,17<br />
100 Ampullen zu 1 ml DM 97,28<br />
(Preisän<strong>der</strong>ungen vorbehalten)<br />
Hersteller<br />
CEFAK Chem.-pharm. Fabrik, 8960 Kempten/Allgäu.<br />
Pasirheuman®<br />
Zusammensetzung<br />
Eine Tablette enthält 100 mg Phenylbutazon und 100 mg<br />
Ascorbinsäure (Vitamin C)<br />
Indikation<br />
Pasirheuman wird zur Behandlung rheumatischer und rheumatoi<strong>der</strong><br />
Erkrankungen eingesetzt, z. B.: Primär chronische<br />
Polyarthritis; Ischialgie; Gichtanfall; extraartikuläre Affektionen<br />
wie Periarthritis humeroscapularis, Bursitis, Tendinitis,<br />
Tendovaginitis, Muskelrheumatismus, Wurzelneuralgien;<br />
Lumbago (Hexenschuß); Spondylarthritis ankylopoetica<br />
(Morbus Bechterew); Reiter-Syndrom; Arthrosen und<br />
Spondylosen.<br />
Pasirheuman ist ebenso zur Prophylaxe und Therapie von<br />
Entzündungen und Schwellungen nach chirurgischen Maßnahmen<br />
und bei Thrombophlebitis geeignet.<br />
Kontraindikationen<br />
Bei manifesten Magen- und Darmgeschwüren, Leukopenien,<br />
hämorrhagischen Diathesen (Thrombopenie, Koagulopathie),<br />
kardialer, renaler und hepatischer Insuffizienz soll<br />
Pasirheuman nicht eingesetzt werden.<br />
Wegen möglicher Rezidive sollen auch anamnestisch weiter<br />
zurückliegende Magen- und Darmulzera berücksichtigt<br />
werden. Bei länger andauern<strong>der</strong> Therapie empfiehlt es sich,<br />
von Zeit zu Zeit das Blutbild zu kontrollieren.<br />
Dosierung<br />
Im akuten Fall wird viermal eine Tablette pro Tag eingenommen<br />
(drei bis vier Tage), bei längerer Behandlung<br />
genügen ein bis zwei Tabletten täglich.<br />
Verkaufspreis<br />
Packung mit 20 Tabletten 6,20 DM mit MwSt.<br />
Packung mit 50 Tabletten 13,05 DM mit Mwst.<br />
Packung mit 100 Tabletten 24,35 DM mit MwSt.<br />
Hersteller<br />
Delalande Arzneimittel GmbH Köln<br />
Cinaebosan© wird abgelöst durch das homöopatische<br />
Komplexmittel Cinaebosan®-G-, welches sich seit vielen<br />
Jahren unter <strong>der</strong> bisherigen Bezeichnung Grippoplex in <strong>der</strong><br />
Praxis bewährt hat.<br />
Die Zusammensetzung von Cinaebosan®-G-:<br />
20 g enthalten:<br />
Ephedra vulg. D1, Malva silv. D 2, Eupator. perf. D 2 aa 0,2 g;<br />
Ipecac. D 4 0,5 g; Sulf. jod. D 5 0,6 g; Cetrar. isl. D 2,<br />
China D 2 aa 1g; Bryon. D 3, Nux vom. D 4 aa 2 g; Merc.<br />
cyan. D 4 2,3 g; Bellad. D 4, Aconit. D 4 aa 5 g.<br />
Anwendungsgebiete<br />
Grippe, grippöse Infekte, Erkältungskrankheiten.<br />
Dosierungsanleitung<br />
Soweit nicht an<strong>der</strong>s verordnet, stündl. 10 o<strong>der</strong> 3mal tägl.<br />
20 Tropfen Vz Std. vor dem Essen in etw. Wasser einnehmen<br />
(z. Stoßtherapie bis zu 50 Tropfen).<br />
Handelsform und Preis<br />
20 ml Tropfflasche DM 6,85<br />
Hersteller<br />
Walter Bock, Pharmazeutische Präparate, 4650 Gelsenkirchen<br />
Prostata-Adenom<br />
mit Harnverhaltung,<br />
Kongestionen,<br />
Miktionsstörungen,<br />
Blasenhalssklerose,<br />
Prostatitis chronica,<br />
Resturin, Reizblase,<br />
Zustand nach TUR<br />
PROSTAMED<br />
Nebenwirkungsfreie Langzeittherapie prostatischer<br />
Erkrankungen, Besserung <strong>der</strong> Kongestionsprostatitis und<br />
<strong>der</strong> Miktionsbeschwerden Steigerung des Uroflow,<br />
Reduzierung des Resturins,<br />
Behandlung vor und nach Operationen<br />
Zusammensetzung: Kurbisglobuhn 0,1 g, Kurbismehl<br />
0,2 g, Extr fl Solidago 0,04 g, Extr fl Pop trem 0,06 g,<br />
Kakao 0,05 g, Sacch lact ad 0,5 g<br />
Dosierung: 3mal täglich 2 - 4 Tabletten einnehmen<br />
Handelsform und Preise (incl. MwSt.):<br />
60 Tabl DM8,45,120 Tabl DM 14,48, 360 Tabl DM34,78<br />
Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,<br />
7615 Ze/1-Harmersbach/Schwarzwald<br />
410 <strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.
Jsoskleran<br />
Reg -Nr J 261<br />
Apothekenpflichtig<br />
Prophylaktisch und therapeutisch bei Arteriosklerose.<br />
Bestandteile: Armca spag D 30, Acomtum,<br />
Avena, Echinacea, Populus, Solidago, Vincetoxicum<br />
spag D12 aa ad 0,1 g<br />
Dosierung: Falls nicht an<strong>der</strong>s verordnet, 3mal<br />
täglich 1-2 Tabletten<br />
Packung mit 150 Tabletten DM 7,50<br />
Großpackung mit 2000 Tabletten DM 57,60<br />
JSO-Werk<br />
Postfach 74<br />
84 Regensburg 1<br />
Aus <strong>der</strong> pharmazeutischen Industrie<br />
100 Jahre Merckle Arzneimittel Blaubeuren<br />
Als Wegbereiter von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes<br />
mellitus und Hyperlipidämie för<strong>der</strong>t Fettsucht die Entstehung<br />
kardiovaskulärer Erkrankungen - die gefährlichsten<br />
Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. Daß die Firma<br />
Merckle - ausgerechnet im Jubiläumsjahr ihres 100. Geburtstages<br />
- mit Duolip® ein Medikament gegen schwere<br />
Hyperlipidämien, die we<strong>der</strong> durch Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ernährung<br />
noch durch an<strong>der</strong>e Verhaltensän<strong>der</strong>ungen beeinflußt werden<br />
können, auf den Markt brachte, ist ein doppelter Anlaß<br />
zum Feiern.<br />
Vor genau 100 Jahren wurde von Adolf Merckle eine<br />
Chemikaliengroßhandlung in Aussig an <strong>der</strong> Elbe gegründet,<br />
<strong>der</strong> Vorläufer des heutigen mittelständischen pharmazeutischen<br />
Unternehmens in Blaubeuren. Vor <strong>der</strong> Entwicklung,<br />
<strong>der</strong> Produktion und dem Vertrieb von Arzneispezialitäten<br />
befaßte er sich mit Körperpflegemitteln und Verbandsmaterial;<br />
doch bereits 1920 hatte Adolf Merckle zwei<br />
Zweigbetriebe und Nie<strong>der</strong>lassungen in mehreren Städten.<br />
1938 hatte sich die Firma Merckle in Böhmen wirtschaftlich<br />
einen beachtlichen Platz erkämpft.<br />
Das Ende des zweiten Weltkrieges brachte auch das Ende<br />
<strong>der</strong> Firma Merckle in <strong>der</strong> Tschechoslowakei mit sich. In <strong>der</strong><br />
Heimat seiner Frau, in Blaubeuren, begann 1945 <strong>der</strong> Sohn<br />
des Grün<strong>der</strong>s, Ludwig Merckle, einen neuen Versuch mit<br />
aus Böhmen mitgebrachten Präparaten (Toximer® und<br />
Mirfulan®). 1958 gründete er eine Nie<strong>der</strong>lassung in Österreich.<br />
Schon bald wurde die Forschung „fündig", wurden neue<br />
Arznei-Spezialitäten entwickelt, die auf dem pharmazeutischen<br />
Markt erfolgreich waren. Adolf Merckle in <strong>der</strong> dritten<br />
Generation führt seit 1967 die Firma weiter. 1974 gründete<br />
er die 100prozentige Tochter „ratiopharm", die gezielt<br />
Generics auf den deutschen Markt bringt. Sie erzielte 1980<br />
rund 60 Mill. DM Umsatz. 1971 begann die Zusammenarbeit<br />
mit einer Schweizer Pharmafirma.<br />
Die Unternehmensgruppe Merckle, die mit 10 Mill. DM Umsatz<br />
in die 70er Jahre ging, erzielte im Jahre 1980 einen<br />
Umsatz von 125 Mill. DM - mit 500 Mitarbeitern und einem<br />
beachtlichen Platz unter den erfolgreichen pharmazeutischen<br />
Unternehmen <strong>der</strong> Bundesrepublik.<br />
Wegen <strong>der</strong> bei hohen Dosen reiner Aristolochiasäure im<br />
Tierversuch festgestellten kanzerogenen Wirkung empfiehlt<br />
das BGA, auch die Präparate aus dem Handel zu nehmen,<br />
die Aristolochia-Vollauszüge enthalten. Hiervon sind unsere<br />
Erzeugnisse<br />
Rephamen<br />
Rephaprossan und das<br />
Repha-Akne-Mittel (Tropfen und Paste)<br />
betroffen. Wir sind daher lei<strong>der</strong> gezwungen, diese Präparate<br />
ab sofort aus dem Verkehr zu ziehen und die Produktion<br />
bis zur effektiven Klärung ruhen zu lassen.<br />
HYPERFORAT<br />
vegetativ stabilisierend, frei von Nebenwirkungen.<br />
®<br />
psychische<br />
und nervöse<br />
Störungen<br />
Zusammensetzung:Tropfen 100genthalten Extr fl Herb<br />
Hypenci perf. 100 g stand, auf 2 mg Hypencin pro ml.<br />
Kontraindikationen: Photosensibihsierung.<br />
Dosierung: Tropfen. 2—3 x taglich 20—30 Tropfen vor<br />
dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen<br />
Handelsformen und Preise incl. MWST.: Tropfen- Flasche<br />
mit 30 ml DM 8,68, 50 ml DM 13,46,100 ml DM 22,72<br />
Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,<br />
7615 Zell-Harmersbach/Schwarzwald<br />
<strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg. 411
Wir werden uns bemühen, die homöopathischen Präparate<br />
Rephamen und Rephaprossan in geän<strong>der</strong>ter Zusammensetzung<br />
bei gleichem bzw. ähnlichem Arzneibild in<br />
einem beschleunigten Zulassungsverfahren wie<strong>der</strong> in den<br />
Verkehr zu bringen.<br />
REPHA, Chemisch-pharmaz. Fabrik,<br />
Postfach 1180, 3012 Langenhagen<br />
Versierter Pharmaberater<br />
mit langjähriger Außendiensterfahrung, in Fachärzteund<br />
Allgemeinmedizinerkreisen des Bezirkes Hannover<br />
Stadt und Land - Braunschweig - Hildesheim - Harz -<br />
Göttingen gut eingeführt, möchte sich zum 1. Januar<br />
1982 verän<strong>der</strong>n, z. Z. in angekündigter Stellung. Zuschriften<br />
erbeten unter Chiffre 136/81 an den Verlag.<br />
Jura KG in neuen Kontroll- und Produktionsräumen<br />
Die in Konstanz am Bodensee ansässige JURA KG, Produzent<br />
von Arzneimitteln aus Frischpflanzen, Drogen und<br />
Enzymen und Präparaten zur Regeneration <strong>der</strong> Darmflora,<br />
hat ihre im vergangenen Jahr errichteten Produktions- und<br />
Kontrollräume bezogen. Nach neuen, mo<strong>der</strong>nen Richtlinien<br />
werden hier Medikamente <strong>für</strong> die Humanmedizin auf einer<br />
Fläche von etwa 500 m 2 hergestellt. Das Konstanzer Architekturbüro<br />
Fischer & Loessöomg verstand es vortrefflich<br />
einen kleineren pharmazeutischen Betrieb einem älteren<br />
Gebäude mit etwa 1000 m 2 anzuglie<strong>der</strong>n, <strong>der</strong> Verwaltung,<br />
Werkstatt, Lagerräume und Konfektion beherbergt, ohne<br />
daß <strong>der</strong> Produktionsfluß beeinträchtigt wurde.<br />
Auch die Mitarbeiter <strong>der</strong> JURA KG setzen gerne in einem<br />
„Betrieb <strong>der</strong> kurzen Wege" ihre zum Teil über Jahrzehnte<br />
ausgeübte Tätigkeit fort.<br />
Die JURA KG wurde 1925 in Nürnberg von Nikolaus Gollwitzer<br />
gegründet und nach <strong>der</strong> totalen Zerstörung im 2.<br />
Weltkrieg, 1949 nach Konstanz verlegt. Nach seinem Tode<br />
im Jahre 1974 übernahm <strong>der</strong> Sohn, Dipl. Biol. Wolfgang<br />
Gollwitzer die Leitung. Es bleibt <strong>der</strong> JURA KG zu wünschen,<br />
daß die Familientradition eines Tages vom Enkel des Firmengrün<strong>der</strong>s,<br />
Jürgen Gollwitzer, fortgeführt werden möge,<br />
<strong>der</strong> sich zur Zeit auf dem Weg zur Ausbildung als Apotheker<br />
befindet.<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Zentralverband</strong> <strong>der</strong> Arzte <strong>für</strong> Naturheilverfahren e V , sowie die dem <strong>Zentralverband</strong><br />
angeschlossenen Gesellschaften und Arbeitsgemeinschaften<br />
Internationale Gesellschaft <strong>für</strong> Elektroakupunktur nach Dr Voll e V ,<br />
Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Elektroneuraldiagnostik und -therapie nach Croon e V ,<br />
Deutsche Arztegesellschaft <strong>für</strong> Akupunktur e V ,<br />
Internationale Ärztliche Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> HOT (fotobiologische Oxydationstherapie)<br />
e V,<br />
InternationaleGesellschaftfurHomotoxikologie und antihomotoxischeTherapiee V ,<br />
Internationale medizinische Gesellschaft <strong>für</strong> Neuraltherapie nach Huneke e V ,<br />
Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Thermographie e V ,<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Symbioselenkung,<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Gesundheitsvorsorge,<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Phytotherapie,<br />
Arbeitskreis <strong>für</strong> Homöopathie,<br />
Arztegesellschaft <strong>für</strong> Naturheilverfahren (Physiotherapie) e V Berlin<br />
Schriftleitung<br />
Dr med K H Caspers, Hochrainstraße 50, 8399 Bad Fussing 1,<br />
Dr med H Haferkamp, Am Eselsweg 81, 6500 Mainz 22,<br />
Dr med K Schimmel, von-Scheffel-Str 3, 8210 Pnen/Chiemsee,<br />
Dr med R F Weiß, Vogelherd 1, 7971 Aitrach/Wurttemberg<br />
Mitteilung <strong>der</strong> Schriftleitung:<br />
Zuschriften mit Origmahen (wissenschaftlichen Beitragen), Referate redaktionelle<br />
Nachrichten und Verbandsangelegenheiten werden an das Redakt'onssekretanat<br />
<strong>der</strong> Arztezeitschnft <strong>für</strong> Naturheilverfahren, von-Scheffel-Straße 3,8210 Pnen/Chiemsee,<br />
erbeten<br />
Origmahen und Beitrage, die zur Veröffentlichung kommen, werden honoriert Die<br />
Schriftleitung behalt sich jedoch den Zeitpunkt <strong>der</strong> Veröffentlichung vor<br />
Grundsatzlich werden nur Erstveröffentlichungen angenommen<br />
Alle Manuskripte sind direkt an die Schriftleitung zu richten Grundsatzlich werden<br />
nur solche Arbeiten angenommen, die vorher we<strong>der</strong> im Inland noch im Ausland veröffentlicht<br />
worden sind Die Manuskripte dürfen auch nicht gleichzeitig an<strong>der</strong>en<br />
Blattern zum Abdruck angeboten werden — Mit <strong>der</strong> Annahme des Manuskriptes<br />
erwirbt <strong>der</strong> Verlag <strong>für</strong> die Dauer <strong>der</strong> gesetzlichen Schutzfrist die ausschließliche<br />
Befugnis zur Wahrnehmung <strong>der</strong> Verwertungsrechte im Sinne des § 15 f des Urheberrechfsgesetzes<br />
— Übersetzung, Nachdruck — auch von Abbildungen —, Vervielfältigung<br />
auf fotomechanischem o<strong>der</strong> ahnlichem Wege o<strong>der</strong> in Magnetton-Verfahren,<br />
Vortrag, Funk- und Fernsehsendung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen<br />
- auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages<br />
gestattet — Für den persönlichen Gebrauch dürfen von Beiträgen o<strong>der</strong> Teilen von<br />
diesen einzelne Kopien hergestellt werden — Jede im Bereich eines gewerblichen<br />
Unternehmens hergestellte Kopie dient im Sinne von § 54, Abs 2 UrhG gewerblichen<br />
Zwecken und ist gebührenpflichtig Die Gebuhr betragt DM -,40 je vervielfältigte<br />
Seite Sie wird entrichtet entwe<strong>der</strong> durch Anbringen einer entsprechenden<br />
Wertmarke o<strong>der</strong> durch Bezahlung an die VG WORT, Abteilung Wissenschaft, Goethestraße<br />
49, 8000 München, von <strong>der</strong> weitere Einzelheiten zu erfragen sind<br />
Die Beiträge dürfen daher nicht in gleichem o<strong>der</strong> ähnlichem Wortlaut an an<strong>der</strong>er<br />
Stelle veröffentlicht werden<br />
- Jede Arbeit soll eine Zusammenfassung enthalten, die beim Abdruck dem Text<br />
vorgeschaltet wird Diese wäre von Ihnen selbst zu verfassen Sie sollte aber<br />
10 Druckzeilen nicht überschreiten Die Schriftleitung wird ohne Kosten eine<br />
englische Übersetzung veranlassen, sofern Sie es nicht vorziehen, diese selbst<br />
zu verfassen<br />
- Die Arbeit sollte von den Charaktenstika des mundlichen Vortrages befreit und<br />
noch vom Autor so bearbeitet werden, daß sie druckreif vorliegt<br />
- In <strong>der</strong> Regel gilt als maximale Lange <strong>für</strong> jede Arbeit 8-10 Schreibmaschinenseiten<br />
(1 1 /2-zeilig, 70 Anschlage pro Zeile)<br />
- Pro Arbeit sollten maximal 2 Abbildungen zur Publikation vorgelegt werden<br />
Arbeiten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen wir Ihnen lei<strong>der</strong> als<br />
unvollständig zurückreichen<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung übernommen,<br />
Rucksendung erfolgt nur, wenn Ruckporto beigefugt ist Arbeiten unter <strong>der</strong> Rubrik<br />
„Erfahrungen aus <strong>der</strong> Praxis" stellen nicht unbedingt die Meinung <strong>der</strong> Schriftleitung<br />
dar<br />
Editoriais drucken die personliche Meinung des Autors, jedoch nicht unbedingt<br />
die von Herausgeber o<strong>der</strong> Schriftleitung aus<br />
Alle Manuskripte werden von <strong>der</strong> Schriftleitung nach medizinisch-wissenschaftlichen<br />
und vom Lektor des Verlages nach stilistisch-sprachlichen Gesichtspunkten<br />
redigiert<br />
Die Nennung von Markenbezeichnungen läßt keinerlei Rückschlüsse zu, ob es<br />
sich um geschützte Zeichen handelt<br />
Bei Leserzuschriften behalten wir uns die Veröffentlichung o<strong>der</strong> Kürzung aus redaktionellen<br />
Gründen vor<br />
Son<strong>der</strong>drucke:<br />
Von Ongmalbeitragen erhalten die Verfasser auf Verlangen 30 Son<strong>der</strong>drucke kostenlos<br />
Dies muß jedoch mit dem Einreichen des Manuskriptes ausdrucklich vermerkt<br />
werden Wird eine höhere Stuckzahl gewünscht, so erfolgt <strong>für</strong> diese eine Berechnung<br />
Nachdruck:<br />
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, <strong>der</strong> fotomechanischen<br />
Wie<strong>der</strong>gabe und <strong>der</strong> Übersetzung bleiben dem Verlag nach Maßgabe <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Bestimmungen vorbehalten Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit<br />
genauer Quellenangabe gestattet und bedarf bei Ongmalbeitragen <strong>der</strong> schriftlichen<br />
Genehmigung des Verlages Für innerbetriebliche totomechanische Vervielfältigung<br />
gilt das Rahmenabkommen des Borsenvereins des Deutschen Buchhandels mit<br />
dem BDI vom 14 6 1958 (10-Pf-Wertmarke pro Seite)<br />
Verlag:<br />
Medizinisch Literarische Verlagsgesellschaft mbH<br />
Postfach 120/140, D-3110 Uelzen 1<br />
Anzeigenverwaltung: Marlis Jess, Postfach 120/140, D-3110 Uelzen 1<br />
Anzeigenpreisliste: Zur Zeit gilt die Liste Nr 18<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand Uelzen<br />
Erscheinungsweise: Einmal im Monat<br />
Bezugsbedingungen:<br />
Der Bezugspreis betragt jährlich 60,- DM einschl UST , zuzuglich Versandkosten<br />
Einzelhefte werden zum Preis von je 8,- DM abgegeben Abonnementsgebuhren<br />
sind nach Rechnungserhalt fällig o<strong>der</strong> zahlbar netto Kasse<br />
Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Ersatz o<strong>der</strong><br />
Ruckerstattung eingezahlter Bezugsgebuhren<br />
Die Kündigung des Jahresabonnements kann nur schriftlich mit einer Frist von<br />
6 Wochen zum Jahresende beim Verlag erfolgen<br />
Im Falle höherer Gewalt o<strong>der</strong> bei Störung des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch<br />
auf Kürzung bzw Ruckzahlung des Bezugsgeldes<br />
Haftung:<br />
Sämtliche Angaben in diesem Heft sind nach bestem wissenschaftlichen Können <strong>der</strong><br />
einzelnen Autoren gemacht Eine Gewahr übernimmt <strong>der</strong> Verlag <strong>für</strong> diese Beitrage<br />
nicht Im Einzelfall bleibt es dem Leser überlassen, diese Aussagen einer eigenen<br />
Prüfung zu unterziehen Die Arzneimittel- und Geratehersteller haften selbst <strong>für</strong> ihre<br />
in den Anzeigen gemachten Angaben Ebenfalls übernimmt <strong>der</strong> Verlag keine Haftung<br />
<strong>für</strong> Schaden, die durch fehlerhafte o<strong>der</strong> unterbliebene Ausfuhrung im Text o<strong>der</strong> in<br />
den Anzeigen entstehen<br />
Zahlungen:<br />
Auf das Postscheckkonto Hamburg 2 392 16-201, Kreissparkasse Uelzen 5405<br />
BLZ 258 501 10<br />
Gerichtsstand Uelzen<br />
Druck: C Beckers Buchdruckerei GmbH & Co KG , Groß Lie<strong>der</strong>ner Straße 45,<br />
3110 Uelzen<br />
Diese <strong>Ausgabe</strong> umfaßt 60 Seiten und Umschlag<br />
412 <strong>Ärzte</strong>zeitschr. f. Naturheilverf. 7/81, 22. Jahrg.