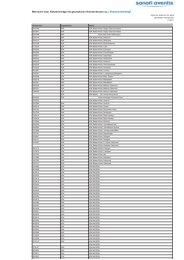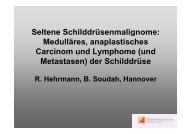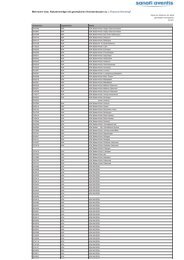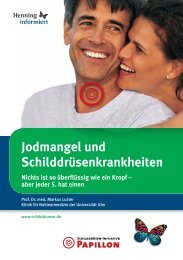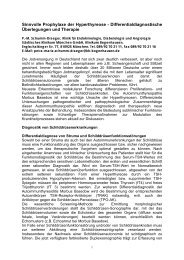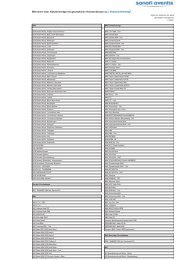Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...
Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...
Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
3 PUNKTE<br />
für Apotheker/PTAs<br />
Von der<br />
Apothekerkammer<br />
zertifiziert<br />
Schilddrüsenerkrankungen zählen zu den häufigsten endokrinologischen Erkrankungen<br />
in Deutschland und entstehen in den meisten Fällen aufgrund eines Jodmangels. In<br />
der vorliegenden Fortbildung liegt der Fokus auf der Therapie einer Unterfunktion und<br />
einer Vergrößerung der Schilddrüse durch eine Substitution mit Schilddrüsenhormonen.<br />
Da diese eine geringe therapeutische Breite aufweisen ist eine sorgfältige und individuelle<br />
Einstellung des Patienten wichtig. Abweichungen oder Schwankungen der Hormonspiegel<br />
können zu Problemen führen, weshalb ein Präparatewechsel nicht unbedenklich<br />
ist und immer kritisch hinterfragt werden sollte. Um <strong>bei</strong> der Arzneimittelabgabe und<br />
Beratung der Patienten eine Hilfe zu liefern, ist die vorliegende Fortbildung in drei Module<br />
gegliedert:<br />
Modul 1: Die Indikationen<br />
In Modul 1 wird zunächst die Anatomie und Physiologie der Schilddrüse beschrieben,<br />
um anschließend auf die häufigsten Funktionsstörungen der Schilddrüse einzugehen.<br />
Modul 2: Die Therapie<br />
Modul 2 beschäftigt sich mit den Therapiemöglichkeiten der verschiedenen Schilddrüsenerkrankungen,<br />
wo<strong>bei</strong> die Behandlung von Hypothyreose und Struma mit Schilddrüsenhormonen<br />
im Vordergrund steht.<br />
Modul 3: Arzneimittelabgabe in der Apotheke<br />
Aufgrund von zahlreichen Rabattverträgen kann eine Substitution des verordneten<br />
Arzneimittels angezeigt sein, die <strong>bei</strong> Schilddrüsenhormonen jedoch nicht unbedenklich<br />
ist. Modul 3 erläutert daher die möglichen Schwierigkeiten und gibt Hilfestellungen<br />
und Tipps <strong>bei</strong> der Abgabe der Schilddrüsenhormone und der Beratung in der Apotheke.<br />
1
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Modul 1: Die Indikationen<br />
Die Schilddrüse ist eine endokrine Drüse, die für die Bildung und Speicherung der<br />
Schilddrüsenhormone Thyroxin und Trijodthyronin verantwortlich ist. Erkrankungen dieses<br />
Organs treten insbesondere in Jodmangelgebieten, zu denen auch Deutschland<br />
zählt, häufig auf. Zum besseren Verständnis der Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen<br />
wird zunächst die Anatomie der Schilddrüse dargestellt, um anschließend<br />
näher auf die Funktion im menschlichen Stoffwechsel und die Folgen von Störungen<br />
dieser Funktion einzugehen.<br />
1.1 Anatomie und Physiologie der Schilddrüse 1,2<br />
Umgeben wird die Schilddrüse von einer bindegewebigen Organkapsel (Capsula fibrosa)<br />
und besteht in der Regel aus zwei Lappen (Lobus dexter und Lobus sinister), von denen<br />
der rechte in den meisten Fällen stärker ausgeprägt ist als der linke. Verbunden sind<br />
diese Lappen über einen schmalen Streifen, den sogenannten Isthmus. Von der Organkapsel<br />
ausgehende Bindegewebsscheiden teilen die<br />
Schilddrüse zusätzlich in verschieden große Läppchenbezirke.<br />
Nebenschilddrüsen<br />
Luftröhre<br />
Schildknorpel<br />
Abb. 1: Anatomische Lage<br />
der Schilddrüse<br />
Abb. 2: Aufbau des<br />
Schilddrüsengewebes<br />
Schilddrüse<br />
Epithelzellen<br />
Schilddrüsenfollikel<br />
C-Zellen<br />
Das Drüsengewebe der Schilddrüse setzt sich aus unregelmäßig<br />
gestalteten, mikroskopisch kleinen Bläschen<br />
zusammen, die als Follikel bezeichnet werden<br />
und die funktionelle Einheit der Schilddrüse darstellen.<br />
Die Follikel bestehen aus einem einschichtig angeordneten<br />
Epithel, welches das Lumen des Follikels<br />
umschließt. In diesen auch als Thyreozyten bezeichneten<br />
Follikelepithelzellen wird neben den Schilddrüsenhormonen<br />
auch das für deren Speicherung notwendige<br />
Kolloid synthetisiert. Die Form der Thyreozyten<br />
ist abhängig vom Funktionszustand der Schilddrüse:<br />
Ruhende Zellen sind flach, während aktive eine kubische<br />
und zum Teil auch zylindrisch erhobene Form<br />
haben.<br />
Das Kolloid ist eine homogene Masse und enthält<br />
das Protein Thyreoglobulin bzw. die Schilddrüsenhormone<br />
und ihre Vorstufen. Im Bedarfsfall wird das<br />
Kolloid verflüssigt, d. h. die Hormone werden von den<br />
Epithelzellen aufgenommen und an die benachbarten<br />
Blutkapillaren ausgeschüttet. Somit sind Epithelzellen<br />
und das Kolloid der Follikel an Hormonbildung und<br />
-speicherung beteiligt.<br />
Das Schilddrüsengewebe<br />
besteht aus<br />
zahlreichen kleinen<br />
Follikeln, die die funktionelle<br />
Einheit der<br />
Schilddrüse darstellen.<br />
Im Kolloid der Follikel<br />
werden die Schilddrüsenhormone<br />
gebildet<br />
und gespeichert.<br />
2
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Zwischen den Follikeln befinden sich im Bindegewebe der Schilddrüse die C-Zellen,<br />
die aufgrund ihrer Lage auch als parafollikuläre Zellen bezeichnet werden. Die Hauptaufgabe<br />
der C-Zellen ist die Bildung des Hormons Calcitonin, welches in den Calcium-<br />
Phosphat-Stoffwechsel eingreift und da<strong>bei</strong> den Blutcalciumspiegel senkt. Auf Calcitonin<br />
wird in dieser Fortbildung nicht näher eingegangen.<br />
1.2 Synthese der Schilddrüsenhormone 1,2<br />
Die Biosynthese der Schilddrüsenhormone erfolgt in den Schilddrüsenfollikeln aus dem<br />
Halogen Jod und der Aminosäure L-Tyrosin. Über einen Natriumjodidsymporter (NIS)<br />
wird Jodid gegen ein Konzentrationsgefälle aus dem Blut in die Thyreozyten transportiert<br />
(im Blutplasma ist die Jodid-Konzentration 25- bis 30-fach niedriger als in den<br />
Follikelepithelzellen). Die Stimulierung dieses Transporters erfolgt mittels des in der<br />
Adenohypophyse gebildeten Thyreotropins (thyreoideastimulierendes Hormon, TSH),<br />
welches die Aufnahme von Jod in die Thyreozyten induziert.<br />
Unter dem Einfluss von Thyreotropin wird in den Thyreozyten das dimere Glykoprotein<br />
Thyreoglobulin (TG) gebildet, das Protein der Schilddrüse, an dem die Schilddrüsenhormonsynthese<br />
von Thyroxin und Trijodthyronin stattfindet. Um das mit der Nahrung<br />
aufgenommene anorganische Jodid in Thyreoglobulin einbauen zu können, muss es<br />
zunächst in einer wasserstoffperoxidabhängigen Reaktion zum elementaren Jod oxidiert<br />
werden.<br />
HO<br />
I<br />
MJT<br />
CH 2<br />
CHCOOH<br />
NH 2<br />
HO<br />
HO<br />
I<br />
I<br />
CH 2<br />
CHCOOH<br />
NH 2<br />
Tyrosin<br />
I 2<br />
2 I 2<br />
HO<br />
CH 2<br />
CHCOOH<br />
Abb. 3: Bildung von MJT und DJT durch Jodierung der Tyrosylreste des<br />
Thyreoglobulins sowie Bildung von T 4<br />
durch Kondensation zweier DJT.<br />
I<br />
I<br />
DJT<br />
NH 2<br />
O<br />
+<br />
HO<br />
HO<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
Thyroxin (T 4<br />
)<br />
CH 2<br />
CHCOOH<br />
CH 2<br />
CH COOH<br />
Die Thyreoperoxidase (TPO)<br />
katalysiert nun die Jodierung<br />
von an Thyreoglobulin<br />
gebundenen Tyrosylresten<br />
an Position C-3 und C-5,<br />
oder nur an C-3, wodurch<br />
die Vorstufen der Schilddrüsenhormone,<br />
3,5-Dijodtyrosin<br />
(DJT) und 3-Monojodtyrosin<br />
(MJT), entstehen.<br />
Anschließend kommt<br />
es zur Kondensation, d. h.<br />
zur Kopplung zweier Tyrosinmoleküle<br />
über einer<br />
Etherbrücke unter Abspaltung<br />
eines Alaninrestes.<br />
Bei der Kopplung zweier<br />
DJT wird 3‘,5‘,3,5-Tetra-<br />
jodthyronin (=Thyroxin, T 4<br />
) gebildet, aus jeweils einem Molekül MJT und DJT entsteht<br />
3‘,3,5-Trijodthyronin (T 3<br />
). 80 % der in der Schilddrüse gebildeten Hormone ist T 4<br />
, während<br />
die T 3<br />
-Bildung lediglich 20 % ausmacht. 3<br />
DJT<br />
NH 2<br />
NH 2<br />
Jodid wird gegen ein<br />
Konzentrationsgefälle<br />
in die Thyreozyten<br />
transportiert.<br />
Durch Jodierung von<br />
Tyrosylresten des<br />
Thyreoglobulins entstehen<br />
die Vorstufen<br />
der Schilddrüsenhormone.<br />
3
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
T 3<br />
entsteht somit zum größten Teil nicht in der Schilddrüse, sondern primär in den<br />
Zielzellen (hauptsächlich Leber und Niere) durch enzymatische Dejodierung (mittels<br />
Dejodase) an C-5´ des auch als Prohormon bezeichneten T 4<br />
(Konversion). Erfolgt die<br />
Abspaltung des Jods an C-5 (also am inneren Ring), so entsteht reverses T 3<br />
(rT 3<br />
), welches<br />
biologisch inaktiv ist.<br />
I I<br />
Das durch die Kondensation<br />
zweier Tyrosinmolekü-<br />
NH 2<br />
HO<br />
O HO<br />
CH 2<br />
CH COOH<br />
le entstandene T 3<br />
und T 4<br />
ist noch kovalent an Thyreoglobulin<br />
gebunden und<br />
Thyroxin (T 4<br />
I I<br />
)<br />
daher biologisch inaktiv.<br />
In dieser Form werden die<br />
I I<br />
I I<br />
Hormone in den Schild-<br />
NH 2<br />
NH 2<br />
drüsenfollikeln gespeichert<br />
HO<br />
O<br />
CH 2<br />
CH COOH HO<br />
O<br />
CH 2<br />
CH COOH<br />
und können <strong>bei</strong> Bedarf<br />
I<br />
I<br />
durch proteolytische Spal-<br />
Trijodthyronin (T 3<br />
)<br />
Abb. 4: Bildung von T 3<br />
und rT 3<br />
aus T 4<br />
.<br />
Reverses T 3<br />
(rT 3<br />
) tung freigesetzt werden.<br />
Dies erfolgt, indem mittels<br />
Pinozytose das Thyreoglobulin<br />
des Kolloids wieder<br />
in die Zelle aufgenommen wird und die da<strong>bei</strong> entstehenden Vesikel mit Lysosomen<br />
verschmelzen. Lysosomale Enzyme spalten das Thyreoglobulin ab und die freien Schilddrüsenhormone<br />
werden, vermutlich über spezifische Transporter, via Interstitium ins Blut<br />
abgegeben. Gleichzeitig werden auch DJT und MJT frei, von denen Jodid mittels Dehalogenase<br />
abgespalten wird und zur erneuten Synthese zur Verfügung steht.<br />
HO<br />
I<br />
I<br />
O<br />
HO<br />
I<br />
I<br />
Thyroxin (T 4<br />
)<br />
CH 2<br />
CH COOH<br />
HO<br />
I<br />
NH 2<br />
O<br />
I<br />
I<br />
NH 2<br />
Trijodthyronin (T 3<br />
)<br />
Abb. 5: Chemische Formel der <strong>bei</strong>den Schilddrüsenhormone<br />
Trijodthyronin (T 3<br />
) und Thyroxin (T 4<br />
).<br />
CH 2<br />
CH COOH<br />
Schilddrüsenhormone sind<br />
nicht wasserlöslich und<br />
daher im Blut zum größten<br />
Teil an drei verschiedene<br />
Transportproteine gebunden:<br />
An thyroxinbindendes<br />
Globulin (TBG), thyroxinbindendes<br />
Präalbumin (TBPA)<br />
und Serumalbumin. T 4<br />
hat<br />
eine höhere Bindungsaffinität<br />
zu den Transportproteinen<br />
als T 3<br />
, wodurch<br />
die T 4<br />
-Wirkung später einsetzt<br />
und länger anhält<br />
als die von T 3<br />
.<br />
T 3<br />
entsteht<br />
hauptsächlich in den<br />
Zielzellen durch<br />
Dejodierung von T 4<br />
.<br />
T 3<br />
und T 4<br />
werden <strong>bei</strong><br />
Bedarf freigesetzt.<br />
Schilddrüsenhormone<br />
sind im Blut<br />
an Transportproteine<br />
gebunden.<br />
4
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Das Verhältnis der Freisetzung von T 4<br />
zu T 3<br />
wird in Abhängigkeit des Jodierungsgrades<br />
von Thyreoglobulin reguliert, d. h. <strong>bei</strong> einem Jodmangel setzt die Schilddrüse aufgrund<br />
des geringeren Jodierungsgrades von Thyreoglobulin das stoffwechselaktivere und<br />
jodärmere T 3<br />
vermehrt frei (kompensatorische T 3<br />
-Mehrsekretion). 4 Der Speicher an<br />
Schilddrüsenhormonen würde,<br />
Kolloid<br />
Thyreozyt<br />
TSH<br />
Protein-<br />
Synthese<br />
Exozytose<br />
Thyreoglobulin<br />
TSA-<br />
Rezeptor<br />
Tyrosin<br />
Peroxidase<br />
Abb. 6: Ablauf und Lokalisation der Synthese<br />
der Schilddrüsenhormone<br />
J<br />
NIS<br />
Dejodase<br />
Thyreoglobulin<br />
T 3<br />
T 4<br />
MJT<br />
DJT<br />
Lysosom<br />
T 3<br />
T 3<br />
T 4<br />
Pinozytose<br />
T 4<br />
Proteolyse<br />
Thyreoglobulin<br />
sofern keine weitere Jodidverwertung<br />
erfolgt, für bis zu 3 Monate<br />
ausreichen. Der Normbereich für<br />
die T 3<br />
-Konzentration im Blut ist<br />
mit 2,0–4,5 pg/ml definiert, der<br />
von T 4<br />
mit 0,8–1,8 ng/dl.<br />
1.2.1 Steuerung der Synthese<br />
und Freisetzung der Schilddrüsenhormone<br />
3<br />
Die Konzentration der Schilddrüsenhormone<br />
wird durch einen<br />
thyreotropen Regelkreis kontrolliert<br />
und gesteuert. Aus dem<br />
Hypothalamus wird Thyreoliberin<br />
(Thyreotropin-Releasinghormon,<br />
TRH, Protirelin) freigesetzt, das<br />
die Adenohypophyse anregt, Thyreotropin<br />
(thyroideastimulierendes<br />
Hormon, TSH) auszuschütten.<br />
TSH ist das Steuerungshormon<br />
der Schilddrüse und fördert die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse sowie die Ausschüttung<br />
von T 4<br />
und T 3<br />
. Über die Blutbahn gelangen die Schilddrüsenhormone an<br />
ihren Zielort, wo sie ihre Wirkung entfalten können.<br />
Die Schilddrüsenhormone erreichen über die Blutbahn auch Hypothalamus und Hypophyse,<br />
wo sich spezielle Rezeptoren befinden, die die Konzentration von T 3<br />
und T 4<br />
wahrnehmen können. Stimmt der Ist-Wert im Blut mit dem Soll-Wert nicht überein, so<br />
wird über Ausschüttung oder Hemmung von TRH und TSH die Schilddrüsensekretion<br />
beeinflusst.<br />
Bei sinkender Konzentration an Schilddrüsenhormonen im Blut wird vermehrt TRH<br />
und TSH ausgeschüttet, was die Freisetzung von T 3<br />
und T 4<br />
stimuliert. Die Produktion<br />
und Ausschüttung von TRH und TSH wird gehemmt, wenn die Konzentration der Schilddrüsenhormone<br />
zu sehr ansteigt. Das zirkulierende T 3<br />
verringert zudem die Zahl der<br />
TRH-Rezeptoren in der Hypophyse, was die TSH-Ausschüttung und darüber die Freisetzung<br />
von T 3<br />
und T 4<br />
reduziert.<br />
Bei Jodmangel<br />
wird vermehrt das<br />
stoffwechselaktivere<br />
und jodärmere T 3<br />
freigesetzt.<br />
TSH und TRH steuern<br />
Produktion und Freisetzung<br />
von T 3<br />
und T 4<br />
.<br />
Bei niedriger Konzentration<br />
der Schilddrüsenhormone<br />
im Blut<br />
wird vermehrt TRH<br />
und TSH ausgeschüttet,<br />
<strong>bei</strong> hoher Konzentration<br />
wird diese<br />
gehemmt.<br />
5
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Hypothalamus<br />
–<br />
Auch äußere Faktoren haben einen<br />
Einfluss auf die Regulation der Schilddrüsenhormone.<br />
Zum Beispiel sorgen<br />
Stress und Kälte für eine Erhöhung<br />
des Soll-Wertes, während dieser durch<br />
Ruhe oder Wärmereize gesenkt wird.<br />
1.3 Funktion der Schilddrüsenhormone<br />
1,2<br />
Die Hormone der Schilddrüse üben vielfältige<br />
Wirkungen aus, ein spezifisches<br />
Zielorgan lässt sich daher nicht ausmachen.<br />
T 3<br />
und T 4<br />
vermitteln ihre Wirkung,<br />
ähnlich wie die Steroidhormone,<br />
über die Bindung an einen spezifischen<br />
Rezeptor, den Schilddrüsenhormonrezeptor<br />
(Thyroidhormonrezeptor, TR).<br />
Dieser ist im Zellkern lokalisiert und<br />
strukturell mit den Steroidrezeptoren verwandt, d. h. er besitzt eine DNA-bindende und<br />
eine hormonbindende Domäne.<br />
Die Schilddrüsenhormone T 3<br />
und T 4<br />
gelangen vermutlich über spezifische Transportsysteme<br />
zunächst in die Zelle. T 4<br />
wird dann in der Zelle durch Dejodierung in das<br />
stoffwechselaktive T 3<br />
umgewandelt, welches nun in den Zellkern transportiert wird.<br />
Dort kann T 3<br />
an den TR binden, der daraufhin seine Konformation ändert und an spezifische<br />
Elemente der DNA (hormonresponsive Elemente, HRE) bindet. Durch diese<br />
Bindung wird die Transkription verschiedener Gene inhibiert oder stimuliert. Transkribierte<br />
Gene werden anschließend mittels Translation in Proteine umgewandelt. So<br />
kann <strong>bei</strong>spielsweise die Aktivität bestimmter Enzyme durch die Schilddrüsenhormone<br />
reguliert werden.<br />
Nukleus<br />
TRH<br />
+<br />
TSH<br />
+<br />
RXR<br />
Hypophyse<br />
Schilddrüse<br />
Abb. 7: Darstellung des thyreotropen Regelkreises<br />
TRE<br />
Gen<br />
Genexpression<br />
Abb. 8: Beeinflussung der Genexpression<br />
durch die Schilddrüsenhormone<br />
TR<br />
T 3<br />
T 3<br />
–<br />
Schilddrüsenhormone<br />
entfalten<br />
ihre Wirkung über die<br />
Bindung an Schilddrüsenrezeptoren.<br />
Schilddrüsenfollikel<br />
T 3<br />
T 4<br />
Zytoplasma<br />
Die Wirkungen der Schilddrüsenhormone<br />
sind vielfältig, so sind diese z. B. an der<br />
Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen<br />
Energiebilanz beteiligt, indem sie<br />
die oxidativen Stoffwechselprozesse beschleunigen<br />
und so den Energieumsatz<br />
des Körpers steigern. Die verschiedenen<br />
Wirkungen der Schilddrüsenhormone<br />
sind in Tabelle 1 dargestellt.<br />
6
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Allgemein<br />
Kardiovaskulär<br />
Erythropoese<br />
Gastrointestinal<br />
Fettstoffwechsel<br />
Kohlenhydratstoffwechsel<br />
Wirkung der Schilddrüsenhormone<br />
Tab. 1: Wirkung der Schilddrüsenhormone im menschlichen Körper<br />
Erhöhung des Grundumsatzes, des Sauerstoffverbrauchs<br />
und der Wärmeproduktion<br />
Stimulation der ß-Adrenorezeptoren, Sensibilisierung<br />
der Zielorgane für Catecholamine, Steigerung der<br />
Herzkraft und der Herzfrequenz<br />
Stimulation der Erythropoese<br />
Stimulation der Darmmotilität<br />
Stimulation der Lipolyse und des Abbaus von VLDL<br />
und LDL<br />
Stimulation der Glykogenolyse, der Glukoneogenese<br />
und der Glykolyse, Anstieg der Blutglukosekonzentration<br />
Knochenstoffwechsel Erhöhung des Knochenumsatzes<br />
Neuromuskuläre Erregbarkeit Steigerung der neuromuskulären Erregbarkeit<br />
Beim Kind<br />
Fördern körperliche und geistige Entwicklung<br />
1.4 Pathophysiologie der Schilddrüse 1,2<br />
Erkrankungen der Schilddrüse können vielfältige Ursachen haben, da sie durch Fehlfunktionen<br />
oder Mutationen aller Einzelkomponenten des Biosynthesewegs der Schilddrüsenhormone<br />
hervorgerufen werden können. Da die Bildung der Schilddrüsenhormone<br />
von einer ausreichenden Jodzufuhr abhängig ist, kommen Schilddrüsenerkrankungen<br />
in Jodmangelgebieten besonders häufig vor. Generell unterscheidet man <strong>bei</strong> Schilddrüsenerkrankungen<br />
zwischen einer Unter- und einer Überfunktion. Unabhängig von<br />
der Stoffwechsellage kann es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse kommen, einem<br />
sogenannten Struma oder Kropf.<br />
1.4.1 Hypothyreose<br />
Eine Hypothyreose wird auch als Unterfunktion der Schilddrüse bezeichnet, die zu einem<br />
Mangel an den Schilddrüsenhormonen T 3<br />
und T 4<br />
führt. Bei einer TSH-Konzentration<br />
> 3 µU/ml bzw. einer T 4<br />
-Konzentration von < 10 pg/ml spricht man von einer Hypothyreose.<br />
Ursachen hierfür gibt es viele, weshalb diese auch in eine kongenitale und eine<br />
erworbene Hypothyreose differenziert wird. 5<br />
1.4.1.1 Formen der Hypothyreose<br />
Die kongenitale Hypothyreose wird bereits intrauterin, also in der Gebärmutter, erworben.<br />
Die Prävalenz der kongenitalen Hypothyreose lag im Jahr 2010, bezogen auf das Erstscreening,<br />
<strong>bei</strong> 1:3277. 5 Ursache kann eine fehlende oder nicht vollständig ausgebildete Schilddrüse<br />
sein, aber auch eine nicht ausreichende Synthese oder Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen,<br />
eine Hormonresistenz oder Störungen im thyreoidalen Jodumsatz. 4<br />
Bei der Hypothyreose<br />
handelt es sich um<br />
eine Unterfunktion<br />
der Schilddrüse.<br />
7
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Bei einer voll ausgebildeten und unbehandelten angeborenen Hypothyreose spricht man<br />
auch von Kretinismus.<br />
Die erworbene Hypothyreose lässt sich noch einmal in drei Formen unterscheiden:<br />
Bei der primären Hypothyreose ist die Schilddrüse selbst ursächlich für die Erkrankung.<br />
Die verminderte Funktion der Schilddrüse kann nach einer Schilddrüsenoperation<br />
oder einer Radiojodtherapie auftreten, aber auch durch Thyreostatika, Jodmangel<br />
oder eine atrophische Thyreoditis, wie z. B. die Hashimoto-Thyreoditis, hervorgerufen<br />
werden. Letzteres ist eine Autoimmunerkrankung, <strong>bei</strong> der es zu einer Zerstörung des<br />
Schilddrüsengewebes kommt. Zu Beginn der Erkrankung kann sich eine Hashimoto-<br />
Thyreoditis in einer Schilddrüsenüberfunktion äußern, langfristig wird sich diese aber<br />
in eine Unterfunktion ändern.<br />
Die sekundäre Hypothyreose ist relativ selten und wird durch einen Mangel an TSH<br />
ausgelöst, welcher zu einer Störung des Regelkreises der Schilddrüse führt.<br />
Die tertiäre Hypothyreose ist äußerst selten und entsteht durch einen Mangel an TRH<br />
oder durch eine Unterbrechung des Portalgefäßsystems zwischen Hypothalamus und<br />
Hypophyse.<br />
1.4.1.2 Symptome einer Hypothyreose<br />
Die Schweregrade einer Hypothyreose können sehr unterschiedlich ausfallen. Im latenten<br />
bzw. kompensierten Stadium sind die Spiegel der Schilddrüsenhormone normal,<br />
die TSH-Werte allerdings erhöht. Bei erniedrigten Konzentrationen der Schilddrüsenhormone<br />
spricht man, sofern keine Symptome vorliegen, von einem subklinischen<br />
Stadium. Äußern sich Symptome, so spricht man von einem manifesten Stadium. Im<br />
schlimmsten Fall kann es bis zu einem lebensgefährlichen Mangel an Schilddrüsenhormonen<br />
kommen.<br />
Die kongenitale Hypothyreose äußert sich meist in den ersten Lebenswochen durch<br />
Trinkschwäche und Bewegungsarmut des Säuglings, aber auch durch Obstipation und<br />
eine übergroße Zunge. Unbehandelt führt eine angeborene Unterfunktion der Schilddrüse<br />
zu Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung des Kindes.<br />
Bei der erworbenen Hypothyreose sind zu Beginn meistens noch keine Symptome<br />
sichtbar, da sich diese erst mit der Zeit ausprägen. In Tabelle 2 sind mögliche Symptome<br />
einer Hypothyreose dargestellt.<br />
1.4.2 Hyperthyreose<br />
Bei der Hyperthyreose handelt es sich um eine Überfunktion der Schilddrüse, die mit<br />
einer vermehrten Abgabe von T 3<br />
und T 4<br />
ins Blut einhergeht, wodurch die Sekretion von<br />
TSH in der Adenohypophyse gehemmt wird.<br />
Eine kongenitale<br />
Hypothyreose entwickelt<br />
sich bereits<br />
im Mutterleib, eine<br />
erworbene erst im<br />
Laufe des Lebens.<br />
Bei der Hyperthyreose<br />
handelt es sich um<br />
eine Überfunktion<br />
der Schilddrüse.<br />
8
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
1.4.2.1 Ursachen einer Hyperthyreose<br />
Zu den möglichen Ursachen einer Hyperthyreose zählen Morbus Basedow, Schilddrüsenautonomie,<br />
Entzündungen oder Tumore der Schilddrüse oder eine zu hohe Zufuhr<br />
von Schilddrüsenhormonen oder Jod.<br />
Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, <strong>bei</strong> der Autoantikörper<br />
gebildet werden, die an den TSH-Rezeptor binden können und dadurch die Follikelepithelzellen<br />
stimulieren. Diese lagern daraufhin vermehrt Jod ein und erhöhen die<br />
Produktion der Schilddrüsenhormone T 3<br />
und T 4<br />
.<br />
Bei einer Schilddrüsenautonomie ist der thyreotrope Regelkreis betroffen, so dass<br />
die Bildung der Schilddrüsenhormone nicht mehr bedarfsgerecht erfolgt. Dies ist<br />
häufig die Folge eines chronischen Jodmangels, durch den bedingt es zu einer<br />
pathologischen Vermehrung autonomer Zellen kommt. Diese autonomen Adenome<br />
ar<strong>bei</strong>ten unabhängig von der TSH-Stimulation und bewirken eine unkontrollierte<br />
Produktion der Schilddrüsenhormone. Man spricht auch von sogenannten „heißen<br />
Knoten“. Knoten, die keine oder wenig Schilddrüsenhormone produzieren, werden<br />
auch als „kalte Knoten“ bezeichnet.<br />
Auch Tumore oder Entzündungen der Schilddrüse können eine Überfunktion der Schilddrüse<br />
verursachen.<br />
1.4.2.2 Symptome einer Hyperthyreose<br />
Genau wie <strong>bei</strong> einer Hypothyreose können auch <strong>bei</strong> einer Hyperthyreose die Symptome<br />
unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Auch hier unterscheidet man zwischen<br />
latentem Stadium, in dem die Spiegel der Schilddrüsenhormone normal sind, aber der<br />
TSH-Wert erniedrigt, sowie dem subklinischen Stadium, indem keine Symptome sichtbar<br />
sind, die Konzentration der Schilddrüsenhormone aber erhöht ist. Im manifesten<br />
Stadium geht die erhöhte Schilddrüsenkonzentration bereits mit Symptomen einher,<br />
während in der thyreotoxischen Krise die Überproduktion der Schilddrüsenhormone<br />
sogar lebensgefährlich ist.<br />
Weitere Symptome einer Hyperthyreose sind in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Eine Hyperthyreose<br />
kann aufgrund eines<br />
Morbus Basedow,<br />
einer Schilddrüsenautonomie,<br />
einer Entzündung<br />
oder eines<br />
Tumors der Schilddrüse<br />
entstehen.<br />
9
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Allgemein<br />
Kardiovaskulär<br />
Erythropoese<br />
Gastrointestinal<br />
Renal<br />
Hepar<br />
Fettstoffwechsel<br />
Kohlenhydratstoffwechsel<br />
Knochenstoffwechsel<br />
Neuromuskuläre Erregbarkeit<br />
Beim Kind<br />
Hypothyreose<br />
Tab. 2: Symptome einer Hypo- und Hyperthyreose<br />
Erniedrigte Körpertemperatur,<br />
Überempfindlichkeit<br />
gegenüber Kälte,<br />
Gewichtszunahme, Appetitlosigkeit<br />
Bradykardie, Reduzierung<br />
des Herzzeitvolumens<br />
Reduzierte Erythropoese<br />
Obstipation, Refluxösophagitis<br />
Reduktion der renalen<br />
Durchblutung und der<br />
glomerulären Filtration,<br />
Salz- und Wasserretention<br />
Reduktion der Proteinsynthese<br />
und der Eliminierung<br />
von Pharmaka<br />
Erhöhtes Serumcholesterol<br />
und VLDL (Hypercholesterolämie),<br />
Atherosklerose<br />
Hypoglykämie<br />
Beeinträchtige Gehirnentwicklung,<br />
Sensibilitätsstörungen,<br />
Hyporeflexie,<br />
Antriebslosigkeit, Depressionen,<br />
Bewusstseinsstörungen,<br />
Koma<br />
Verzögerung von Längenwachstum<br />
und Schluss<br />
der Wachstumsfugen,<br />
Kleinwuchs, Kretinismus<br />
Hyperthyreose<br />
Erhöhung der Körpertemperatur<br />
(Hyperthermie),<br />
Überempfindlichkeit<br />
gegenüber Wärme,<br />
Gewichtsabnahme<br />
Erhöhung der Herzfrequenz<br />
und des Herzzeitvolumens,<br />
Vorhofflimmern<br />
Erhöhung der Erythropoese<br />
Diarrhö<br />
Erhöhung der glomerulären<br />
Filtration, des renalen<br />
Plasmaflusses sowie der<br />
Natriumresorption<br />
Abbau von Steroiden<br />
und Pharmaka<br />
Reduziertes Serumcholesterol<br />
und VLDL<br />
Hyperglykämie, Störung<br />
der Glucosetoleranz, Risiko<br />
eines Diabetes mellitus<br />
Osteoporose, Hyperkalzämie,<br />
Hyperkalzurie<br />
Hyperreflexie, Zittern,<br />
Schlaflosigkeit, Muskelschwäche<br />
Beschleunigung des<br />
Wachstums<br />
10
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Die Symptome des Morbus Basedow sind vielfältig: Die ständige Stimulation der<br />
Schilddrüse durch die Autoantikörper führt meistens zu einer Überfunktion (Hyperthyreose)<br />
und Vergrößerung (Struma) der Schilddrüse. Mit einem Morbus Basedow geht<br />
häufig auch eine endokrine Orbitobatie, ein als Exopthalmus bezeichnetes Hervortreten<br />
der Augäpfel („Glotzauge“) einher.<br />
1.4.3 Struma<br />
Bei einer Struma (oder auch Kropf) handelt es sich um eine krankhafte Vergrößerung<br />
der Schilddrüse, die tastbar, sichtbar oder messbar ist. Diese Veränderung der Schilddrüse<br />
ist allerdings nur die Spitze des Eisberges.<br />
1.4.3.1 Ursachen einer Struma<br />
Die häufigste Ursache für eine Vergrößerung der Schilddrüse ist ein Jodmangel. Die<br />
Schilddrüse ist in der Lage, eine unzureichende Zufuhr von Jod über die Nahrung mit<br />
Hilfe verschiedener Mechanismen auszugleichen (Kompensationsmechanismen).<br />
Dies umfasst eine vermehrte Jodaufnahme aus dem Blut in die Schilddrüse (Jodclearance),<br />
eine erhöhte Jodanreicherung in der Schilddrüse (Jodakkumulation), sowie eine<br />
vermehrte Rückresorption von Jod aus den Verdauungssekreten (Reutilisationsrate).<br />
Zusätzlich wird vermehrt T 3<br />
gebildet, welches weniger Jod enthält, aber auch eine höhere<br />
Aktivität aufweist.<br />
Steht trotz dieser Maßnahmen nicht genug Jod für die ausreichende Bildung an<br />
Schilddrüsenhormonen zur Verfügung, werden in der Schilddrüse vermehrt Wachstumsfaktoren<br />
ausgeschüttet, die eine Vermehrung der Thyreozyten (Hyperplasie) bewirken.<br />
Durch die gesteigerte Bildung von TSH werden die Thyreozyten zusätzlich zum<br />
Wachstum (Hypertrophie) angeregt. Hyperplasie und Hypertrophie verursachen eine<br />
Volumenzunahme der Schilddrüse, wodurch die Synthese von T 3<br />
und T 4<br />
gesteigert<br />
und so deren Konzentration im Blut normalisiert werden kann (euthyreote Struma).<br />
Ist die Schilddrüse trotz dieser Vergrößerung nicht in der Lage, genügend T 3<br />
und T 4<br />
zu bilden, um deren Blutkonzentration zu normalisieren, bildet sich eine hypothyreote<br />
Struma. Wird unabhängig von TSH zu viel T 3<br />
und T 4<br />
gebildet, spricht man von einer<br />
hyperthyreoten Struma.<br />
Auch Schilddrüsenanomalien, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen der Schilddrüse<br />
können zu deren Vergrößerung <strong>bei</strong>tragen. Generell ist eine Struma unabhängig<br />
von der Stoffwechsellage, d. h. es kann <strong>bei</strong> einer Unterfunktion, Überfunktion, aber<br />
auch <strong>bei</strong> normaler Schilddrüsenfunktion auftreten.<br />
1.4.3.2 Einteilung der Struma<br />
Die Einteilung einer Struma kann nach Ausprägung, Funktion oder anatomischer Lage<br />
erfolgen.<br />
Morphologisch wird eine Struma unterschieden in gleichmäßig vergrößert (Struma diffusa)<br />
oder mit bereits vorhandenen Knoten (Struma nodosa).<br />
Jodmangel ist die<br />
häufigste Ursache<br />
für die Struma-<br />
Entstehung.<br />
11
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Die funktionelle Unterteilung richtet sich nach der zugrunde liegenden Stoffwechselleistung<br />
der Schilddrüse, so dass man von euthyreoter Struma (normale Funktion der<br />
Schilddrüse), hypothyreoter Struma (Unterfunktion der Schilddrüse) und hyperthyreoter<br />
Struma (Überfunktion der Schilddrüse) spricht.<br />
Die anatomische Abgrenzung der Struma erfolgt in eutope Struma, die sich in der normalen<br />
anatomischen Lage befinden, und dystope Struma, die im Brustkrob, unter der<br />
Zunge oder hinter der Luftröhre zu finden sind.<br />
Strumen werden üblicherweise in folgende Schweregrade eingeteilt:<br />
Grad 0<br />
Grad 1a<br />
Grad 1b<br />
Grad 2<br />
Grad 3<br />
keine Struma<br />
Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes nicht sichtbar<br />
Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes sichtbar<br />
Struma <strong>bei</strong> normaler Kopfhaltung sichtbar, erhöhtes Hypothyreoserisiko<br />
sehr große Struma, lokale Komplikationen durch Behinderung<br />
der Blutzirkulation und Atmung<br />
Strumen können morphologisch,<br />
funktionell<br />
oder anatomisch<br />
eingeteilt werden.<br />
1.5 Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen 1,2,6<br />
Schilddrüsenerkrankungen können mit Hilfe zahlreicher Untersuchungsmethoden festgestellt<br />
werden. Die am häufigsten angewandten sind im Folgenden kurz erläutert.<br />
Palpation:<br />
Durch Abtasten kann <strong>bei</strong>m Menschen die Schilddrüse ertastet und möglicherweise<br />
eine Struma erkannt werden.<br />
Sonographie:<br />
Die Untersuchung der Schilddrüse mittels Ultraschall kann viele strukturelle Veränderungen<br />
des Organs erfassen, wie zum Beispiel eine Vergrößerung der Schilddrüse<br />
(Struma). Abweichungen des sonografischen Grundmusters können auch <strong>bei</strong> Morbus<br />
Basedow oder Hashimoto-Thyreoditis beobachtet werden.<br />
Szintigraphie:<br />
Besteht aufgrund der palpatorischen, biochemischen oder sonographischen Untersuchung<br />
ein Verdacht auf eine Störung der Schilddrüsenfunktion, kann diese mit Hilfe der<br />
Szintigraphie beurteilt werden. Der Patient bekommt vor der Untersuchung ein Radionuklid,<br />
das dem Jod in seinen chemischen Eigenschaften ähnelt, intravenös appliziert.<br />
Dieses lagert sich nach ca. 10–20 min in der Schilddrüse ein und sendet Strahlen aus,<br />
die mit speziellen Geräten erfasst werden können. Dadurch können Funktionsstörungen<br />
der Schilddrüse, wie <strong>bei</strong>spielsweise kalte und heiße Knoten, erfasst werden.<br />
Röntgen:<br />
Durch die Gabe von Kontrastmitteln und anschließendem Röntgen kann eine Einengung<br />
und Verdrängung von Luft- und/oder Speiseröhre festgestellt werden.<br />
12
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Biochemische Bestimmungsmethoden:<br />
TSH wird in den meisten Fällen als Parameter zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion<br />
herangezogen. Dieser Test wird auch <strong>bei</strong>m Neugeborenen-Screening durchgeführt, um<br />
eine mögliche Hypothyreose frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Da<strong>bei</strong> gilt für<br />
TSH ein Normbereich von 0,3–3,0 mU/l. 7<br />
T 3<br />
und T 4<br />
können ebenfalls zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion herangezogen<br />
werden. Erhöhte Konzentrationen von T 3<br />
und/oder T 4<br />
im Blut weisen auf eine Schilddrüsenüberfunktion<br />
hin, erniedrigte auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Bei einem<br />
Jodmangel kann meist ein erhöhter T 3<br />
und erniedrigter T 4<br />
Spiegel festgestellt werden.<br />
Die Bestimmung von Autoantikörpern kann auf eine Autoimmunerkrankung hinweisen.<br />
Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor weisen auf einen Morbus Basedow hin, gegen<br />
die Thyreoperoxidase auf eine Hashimoto-Thyreoditis. Ein negativer Test schließt diese<br />
Erkrankungen allerdings nicht aus.<br />
Modul 2: <strong>Hormontherapie</strong> und optimale Jodversorgung<br />
Schilddrüsenerkrankungen sind in Deutschland keine Seltenheit: Durchschnittlich 33 %<br />
der Deutschen weisen pathologische Befunde der Schilddrüse auf (Struma und/oder<br />
Knoten). 8 In den meisten Fällen liegt diesen Erkrankungen ein chronischer Jodmangel<br />
zugrunde. Im Folgenden steht die Therapie der Struma und der Hypothyreose im Fokus.<br />
2.1 Therapie der Hypothyreose<br />
Eine kongenitale Hypothyreose entwickelt sich bereits im Mutterleib. Im Rahmen des<br />
Neugeborenen-Screenings erfolgt daher auch ein Test auf eine Schilddrüsenunterfunktion,<br />
wodurch die Diagnose in den meisten Fällen frühzeitig erfolgt. Dies ist für die Betroffenen<br />
von entscheidender Bedeutung, da eine kongenitale Hypothyreose unbehandelt zu<br />
Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung führen kann. Eine Substitution<br />
mit Schilddrüsenhormonen ist unumgänglich und muss in der Regel lebenslang erfolgen.<br />
Auch die erworbene Hypothyreose muss in der Regel mit der lebenslangen Gabe von<br />
Schilddrüsenhormonen behandelt werden.<br />
Am häufigsten wird zur Therapie einer Hypothyreose das seit 1956 zur Verfügung stehende<br />
Natriumsalz von Thyroxin (Levothyroxin-Natrium) verwendet. 3 Dieses wird oral<br />
aufgenommen und im Jejunum und Ileum zu etwa 80 % resorbiert. Die Halbwertszeit<br />
von Levothyroxin beträgt ungefähr 7 Tage, wo<strong>bei</strong> die Bioverfügbarkeit von verschiedenen<br />
Levothyroxinpräparaten deutliche Unterschiede aufweisen kann. So sind Schwankungen<br />
zwischen 80 und 125 % bezogen auf die Vergleichssubstanzen noch erlaubt,<br />
wodurch im Extremfall Abweichungen in der Bioverfügbarkeit von 55 % zwischen zwei<br />
Präparaten entstehen können. 9<br />
Eine Hypothyreose<br />
wird in den meisten<br />
Fällen durch lebenslange<br />
Substitution<br />
mit Schilddrüsenhormonen<br />
behandelt.<br />
Die Bioverfügbarkeit<br />
kann zwischen zwei<br />
Levothyroxin-Präparaten<br />
im Extremfall<br />
um 55 % abweichen.<br />
13
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Um für den Patienten die geeignete Dosis zu finden, ist eine langsame Auftitrierung<br />
mit engmaschiger Kontrolle notwendig, d. h. zu Beginn wird eine niedrige Dosis der<br />
Schilddrüsenhormone gegeben, die mit der Zeit gesteigert wird. Diese Vorgehensweise<br />
nimmt zwar einige Zeit in Anspruch bis die geeignete Dosis gefunden ist, hat sich aber<br />
im Hinblick auf eventuelle Nebenwirkungen bewährt.<br />
Um die individuell geeignete Dosis zu finden, müssen die TSH-Spiegel im Blut regelmäßig<br />
kontrolliert werden. Bei einer guten Einstellung liegen diese zwischen 0,5 und<br />
2,0 mU/l, die in den meisten Fällen mit 50 bis 150 µg T 4<br />
pro Tag erreicht wird. 7 Regelmäßige<br />
Kontrollen der TSH-Spiegel sind, insbesondere <strong>bei</strong> Kindern, auch weiterhin<br />
notwendig, um eine adäquate Zufuhr an Schilddrüsenhormonen zu gewährleisten.<br />
Denn auf nicht optimal eingestellte oder schwankende Hormonspiegel reagieren einige<br />
Patientengruppen sehr empfindlich, dazu gehören Kinder, Schwangere, Patienten mit<br />
Hypo- oder Hyperthyreose oder mit Schilddrüsenkarzinom, sowie Patienten mit instabiler<br />
koronarer Herzkrankheit.<br />
Wechselwirkungen von L-Thyroxin mit anderen Arzneimitteln 7<br />
Die Therapie mit Schilddrüsenhormonen ist sehr störanfällig, da deren Bioverfügbarkeit<br />
durch verschiedene Faktoren, wie z. B. die Nahrungsaufnahme oder die Einnahme<br />
bestimmter Arzneimittel, beeinflusst werden kann. Eine verminderte Wirkung von<br />
L-Thyroxin wurde z. B. <strong>bei</strong> der gleichzeitigen Einnahme von Colestyramin, Rifampicin,<br />
Aluminium, Eisen und Calciumcarbonathaltigen Produkten beobachtet.<br />
Aber auch L-Thyroxin ist in der Lage, die Wirkung verschiedener Arzneimittel zu beeinflussen.<br />
So wurde durch L-Thyroxin eine verstärkte Wirkung von Cumarin beobachtet,<br />
während die blutzuckersenkende Wirkung von Antidiabetika vermindert war.<br />
Um solche Wechselwirkungen zu vermeiden, sollte L-Thyroxin, je nach Arzneimittel, 1–5<br />
Stunden vorher eingenommen werden bzw. es können Dosisanpassungen der Begleitmedikation<br />
nötig werden.<br />
Zu Therapiebeginn<br />
sollte die individuell<br />
geeignete Dosis durch<br />
langsame Steigerung<br />
und regelmäßige TSH-<br />
Kontrollen festgestellt<br />
werden.<br />
Die Einnahme von<br />
L-Thyroxin kann zu<br />
Wechselwirkungen<br />
mit anderen Arzneimitteln<br />
führen.<br />
2.2 Therapie der Hyperthyreose 11<br />
Die Therapie der Hyperthyreose ist abhängig von der Ursache der Erkrankung und wird<br />
in medikamentöse, operative und Radiojodtherapie unterschieden.<br />
2.2.1 Medikamentöse Therapie<br />
Bei einer Überfunktion der Schilddrüse werden häufig sogenannte Thyreostatika (z. B. Carbimazol®)<br />
eingesetzt, die die Bildung der Schildrüsenhormone hemmen. Die Behandlung<br />
wird solange fortgesetzt, bis eine normale Stoffwechsellage der Schilddrüse gegeben<br />
ist (Euthyreose).<br />
14
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
2.2.2 Operative Therapie<br />
Je nach Ursache der Hyperthyreose kann es notwendig sein, die Schilddrüse ganz oder<br />
teilweise zu entfernen. Eine komplette Resektion der Schilddrüse wird <strong>bei</strong>spielsweise<br />
<strong>bei</strong> einem Karzinom durchgeführt. Hier wird im Anschluss an die Operation eine<br />
Hormonsubstitution notwendig, um das Auftreten einer Hypothyreose zu verhindern.<br />
2.2.3 Radiojodtherapie<br />
Bei der Radiojodtherapie wird ein radioaktives Jod-Isotop, 131 Jod, oral eingenommen.<br />
Dieses wird im Intestinaltrakt resorbiert und gelangt so ins Blut, von wo es durch<br />
den Natriumjodidsymporter in die Schilddrüse transportiert und dort gespeichert wird.<br />
Beim Zerfall des radioaktiven Jods entstehen Betastrahlen, die zu Schäden an der<br />
DNA führen und darüber den programmierten Zelltod (Apoptose) induzieren. Da Jod<br />
fast ausschließlich in der Schilddrüse gespeichert wird, kann eine hohe Strahlendosis<br />
im Zielgewebe erreicht werden, ohne dass andere Gewebe übermäßig belastet werden.<br />
Die Radiojodtherapie gilt daher als nebenwirkungsarm.<br />
Eine Hyperthyreose<br />
kann medikamentös,<br />
operativ oder mittels<br />
Radiojodtherapie<br />
behandelt werden.<br />
2.3 Jodprophylaxe<br />
Auch <strong>bei</strong> Schilddrüsenerkrankungen gilt das Motto: Vorbeugen ist besser als heilen. Da<br />
Jodmangel die häufigste Ursache für die Entstehung einer Struma ist, hat die Jodprophylaxe<br />
<strong>bei</strong> dieser Krankheitsentstehung<br />
Nahrungsjod<br />
einen hohen Stellenwert. Daher wird,<br />
Dünndarm Blutkreislauf<br />
bevor die Möglichkeiten der therapeutischen<br />
Behandlung einer Struma erläutert<br />
werden, zunächst auf die Prävention<br />
durch eine optimale Jodversorgung<br />
eingegangen.<br />
T 3<br />
T 4<br />
Jodid<br />
(J - )<br />
Schilddrüse Jodid<br />
(J - Niere<br />
)<br />
• Jodid<br />
Leber<br />
T 3 • Jodid<br />
• SD-Hormon-<br />
T 4 Stoffwechselprodukte<br />
Periphere<br />
Körperzellen<br />
Stuhl<br />
Urin<br />
Abb. 9: Schematische Darstellung des Jodstoffwechsels<br />
im menschlichen Körper<br />
2.3.1 Empfehlungen für die Jodzufuhr<br />
Jod wird über die Nahrung aufgenommen<br />
und gelangt so in den Verdauungstrakt.<br />
Im Dünndarm wird es<br />
als anorganisches Jodid nahezu vollständig<br />
resorbiert. Der Jodbestand<br />
eines Erwachsenen beträgt schätzungsweise<br />
10–20 mg, wovon etwa<br />
70–80 % in der Schilddrüse lokalisiert<br />
sind. 12<br />
15
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Jod – empfohlene Zufuhr<br />
Alter<br />
Jod<br />
Deutschland<br />
Österreich<br />
Säuglinge<br />
0 bis unter 4 Monate 2<br />
4 bis unter 12 Monate<br />
Kinder<br />
1 bis unter 4 Jahre<br />
4 bis unter 7 Jahre<br />
7 bis unter 10 Jahre<br />
10 bis unter 13 Jahre<br />
13 bis unter 15 Jahre<br />
µg/Tag µg/MJ 1<br />
(Nährstoffdichte)<br />
40<br />
80<br />
100<br />
120<br />
140<br />
180<br />
200<br />
m<br />
20<br />
27<br />
21<br />
19<br />
18<br />
19<br />
18<br />
w<br />
21<br />
28<br />
23<br />
21<br />
20<br />
21<br />
21<br />
Jod<br />
WHO<br />
Schweiz<br />
µg/Tag µg/MJ 1<br />
(Nährstoffdichte)<br />
50<br />
50<br />
90<br />
90<br />
120<br />
120<br />
150<br />
m<br />
25<br />
17<br />
19<br />
14<br />
15<br />
13<br />
13<br />
w<br />
26<br />
17<br />
20<br />
16<br />
17<br />
14<br />
16<br />
Der Jodbedarf ändert sich im<br />
Laufe des Lebens und ist u. a.<br />
abhängig vom Alter, daher sind<br />
die Empfehlungen der Deutschen<br />
Gesellschaft für Ernährung<br />
(DGE) für die tägliche Jodzufuhr<br />
an das Alter angepasst.<br />
Für einen Erwachsenen beträgt<br />
der Jodbedarf etwa 200 µg pro<br />
Tag. 13<br />
Die Jodausscheidung wird als<br />
Maß für die Bestimmung der<br />
Jodversorgung eines Menschen<br />
genutzt, da diese eng mit der<br />
Aufnahme von Jod korreliert.<br />
Die empfohlene Jodzufuhr<br />
beträgt für<br />
einen Erwachsenen<br />
200 µg pro Tag.<br />
Jugendliche und Erwachsene<br />
15 bis unter 19 Jahre<br />
19 bis unter 25 Jahre<br />
25 bis unter 51 Jahre<br />
51 bis unter 65 Jahre<br />
65 Jahre und älter<br />
200<br />
200<br />
200<br />
180<br />
180<br />
19<br />
19<br />
20<br />
20<br />
22<br />
24<br />
25<br />
26<br />
24<br />
26<br />
150<br />
150<br />
150<br />
150<br />
150<br />
14<br />
14<br />
15<br />
16<br />
18<br />
18<br />
19<br />
19<br />
20<br />
22<br />
Schwangere<br />
230<br />
–<br />
25<br />
200<br />
–<br />
22<br />
Stillende<br />
260<br />
–<br />
24<br />
200<br />
–<br />
19<br />
Tab. 3: Empfohlene Zufuhr von Jod pro Tag. 13<br />
WHO-Kriterien zur Beurteilung des Jodstatus anhand von Urinjoduntersuchungen 14<br />
Überdurchschnittlich gute Jodversorgung: 200–300 µg/l<br />
Optimale Jodversorgung:<br />
100–200 µg/l<br />
Leichter/Milder Jodmangel (Grad I): 50–99 µg/l<br />
Mäßiger Jodmangel (Grad II):<br />
20–49 µg/l<br />
Schwerer Jodmangel (Grad III):<br />
< 20 µg/l<br />
Aber auch Umweltbelastungen und der Konsum verschiedener Lebensmittel haben<br />
Einfluss auf den Jodbedarf des Menschen. So enthalten einige Kohlsorten Senfölglykoside,<br />
aus denen Thiocyanate, die die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse hemmen,<br />
enzymatisch freigesetzt werden. Allerdings kann es dadurch bedingt erst <strong>bei</strong> übermäßigem<br />
Verzehr zur Entstehung einer Struma kommen. Die Hauptquellen für die Jodzufuhr<br />
sind mittlerweile, bedingt durch die breite Verwendung von jodiertem Tierfutter, Milchund<br />
Milchprodukte (37 %), Fleisch- und Fleischwaren (21 %), sowie Brot und Getreideprodukte<br />
(19 %). 15 Natürlich jodreich sind hauptsächlich Meerestiere und Seefisch,<br />
wohingegen sich Süßwasserfische nicht durch hohe Jodgehalte auszeichnen. 16<br />
Ein Jodmangel kann<br />
anhand von Jodausscheidungen<br />
im Urin<br />
festgestellt werden.<br />
16
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
2.3.2 Jodversorgung in Deutschland<br />
Die Zufuhr von Jod geschieht in der Regel über jodhaltige Lebensmittel. Deutschland<br />
gehört allerdings aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den Jodmangelgebieten,<br />
denn Wasser und Böden enthalten durch Auswaschungen in der Eiszeit nur<br />
geringe Mengen an Jod. Dies führt dazu, dass Lebensmittel wie Obst und Gemüse<br />
relativ wenig Jod enthalten, so dass auch <strong>bei</strong> frischer und vielseitiger Ernährung der<br />
Jodbedarf über die Nahrung nicht ausreichend gedeckt werden kann.<br />
Bereits 1975 sprachen sich Habermann et al. für eine gesetzliche Jodprophylaxe aus.<br />
Denn sie hatten in einer bundesweiten Studie die Jodausscheidung im Urin von Schulkindern<br />
und Erwachsenen bestimmt und kamen zu dem Ergebnis, dass Schulkinder im<br />
Alter von 13 bis 15 Jahren eine mittlere Jodausscheidung von 25,1 µg pro g Kreatinin<br />
aufwiesen, Erwachsene im Mittel zwischen 25 und 35 µg pro Kreatinin. Nach der Definition<br />
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprach dies einem Jodmangel Grad<br />
II. Zusätzlich ergaben ihre Berechnungen, dass in der Bundesrepublik die alimentäre<br />
Jodaufnahme zwischen 30 und 70 µg pro Tag lag und somit weit unter den von der<br />
WHO empfohlenen 150 bis 200 µg pro Tag. Damals wurde in der Bundesrepublik<br />
Deutschland auch ein signifikantes Nord-Süd-Gefälle festgestellt, d. h. dass Menschen<br />
im Süden Deutschlands häufiger sowohl einen Jodmangel als auch eine Struma aufwiesen.<br />
17<br />
Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo bis heute die Jodprophylaxe auf freiwilliger Basis<br />
erfolgt, wurde in der ehemaligen DDR im Jahr 1983 eine generelle Jodprophylaxe eingeführt.<br />
Diese umfasste die Verwendung von Jodsalz sowie seit 1986 auch die Fütterung<br />
von jodhaltigen Mineralstoffmischungen an Nutztiere. Daraufhin hat sich zwar die<br />
Jodversorgung deutlich gebessert, allerdings konnte der Jodmangel auch durch diese<br />
Maßnahme nicht vollständig beseitigt werden. Nach der Wiedervereinigung ging dieser<br />
Effekt verloren. 18<br />
Generell hat sich die Jodversorgung in Deutschland in den letzten Jahren deutlich<br />
verbessert. Dies liegt zum einen darin begründet, dass Jodsalz in privaten Haushalten<br />
eine breite Verwendung findet, und zum anderen darin, dass jodiertes Speisesalz seit<br />
1989 in der Lebensmittelproduktion und -verar<strong>bei</strong>tung sowie in der Gemeinschaftsverpflegung<br />
und Gastronomie verwendet werden darf. Dies wiederum bewirkt auch eine<br />
Erhöhung des Jodgehaltes in ursprünglich jodarmen Lebensmitteln, wie z. B. Fleisch<br />
und Milchprodukte.<br />
Zusätzlich zur breiten Verwendung von jodiertem Speisesalz hat auch die intensive Aufklärung<br />
zum Thema Jodmangel und deren Zusammenhang zu Schilddrüsenerkrankungen<br />
zu einer deutlichen Verbesserung der Jodversorgung in den letzten Jahren geführt.<br />
Dennoch hat sich der Jodmangel noch nicht vollständig ausgeglichen und durch das<br />
Freiwilligkeitsprinzip der Jodprophylaxe sind kontinuierliche Maßnahmen und ständige<br />
Verbraucheraufklärung auch weiterhin notwendig. 19<br />
Aufgrund der breiten<br />
Verwendung von<br />
Jodsalz und der intensiven<br />
Aufklärung hat<br />
sich die Jodversorgung<br />
in Deutschland<br />
verbessert.<br />
17
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
2.3.3 Verwendung von Jodsalz<br />
In Privathaushalten wird zu 80 % jodiertes Speisesalz verwendet, in Metzgereien und<br />
Bäckereien etwa 70–75 %, in der Nahrungsmittelindustrie etwa 40 %. In Großgebinden,<br />
die <strong>bei</strong>spielsweise von Krankenhäusern oder Seniorenheimen eingekauft werden,<br />
ist der Einsatz von Jodsalz rückläufig: 2004 betrug der Anteil von Jodsalz noch 35 %,<br />
2007 lediglich 29,1 %. 16<br />
Die breite Akzeptanz von Jodsalz hat zwar zu einer Verbesserung der Jodversorgung<br />
<strong>bei</strong>getragen, reicht allerdings alleine nicht aus, um den Jodbedarf zu decken.<br />
Auch <strong>bei</strong> Erkrankungen der Schilddrüse wie <strong>bei</strong>spielsweise autonomen Adenomen,<br />
Morbus Basedow oder Autoimmunthyreoditis gilt die Verwendung von Jodsalz als sicher,<br />
so dass Jodsalz auch in diesen Fällen nicht gemieden werden muss. Eine Hoch- oder<br />
Überdosierung kann durch Verwendung von Jodsalz nicht erreicht werden.<br />
Immer wieder wird auch die Vermutung aufgestellt, dass der Verzehr von Jod allergische<br />
Reaktionen auslösen könnte. Dies ist allerdings aufgrund der geringen Molekülgröße<br />
von Jod nicht möglich. Lediglich im Rahmen einer Radiojodtherapie können allergische<br />
Reaktionen z. B. in Form eines Hautausschlages auftreten. 15<br />
Die Einnahme von<br />
Jodsalz ist auch <strong>bei</strong><br />
Hyperthyreose unbedenklich,<br />
eine Hochoder<br />
Überdosierung<br />
kann über Jodsalz<br />
nicht erfolgen.<br />
2.4 Therapie der Struma diffusa/Struma nodosa<br />
Die Therapiemöglichkeiten einer Struma umfassen ebenfalls eine medikamentöse, eine<br />
operative und eine Radiojodbehandlung.<br />
2.4.1 Medikamentöse Therapie<br />
Die medikamentöse Behandlung der vergrößerten Schilddrüse (mit oder ohne (nicht<br />
autonome) Knoten) besteht, genau wie <strong>bei</strong> einer Hypothyreose, in der Substitution<br />
der Schilddrüsenhormone. Dass zur Behandlung einer Struma eine Kombination aus<br />
Thyroxin und Jod am effektivsten ist, war bereits Mitte der 1990er Jahre bekannt.<br />
Aufgrund der verbesserten Jodversorgung kam allerdings die Frage auf, ob eine<br />
zusätzliche Jodzufuhr <strong>bei</strong> der Behandlung von Knoten oder einer Struma noch notwendig,<br />
wenn nicht sogar kontraindiziert ist. Denn die Beziehung zwischen Jodaufnahme<br />
und dem Risiko von Schilddrüsenerkrankungen weist einen U-förmigen Verlauf auf,<br />
d. h. dass sowohl eine zu niedrige (< 50 µg/Tag) als auch eine zu hohe Jod-Aufnahme<br />
(> 500 µg/Tag) ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenerkrankungen mit sich bringt. 19<br />
Daher wurde die Notwendigkeit einer Jodsubstitution zusätzlich zur Gabe von Schilddrüsenhormonen<br />
in Frage gestellt.<br />
Um dies zu evaluieren wurde die weltweit größte Untersuchung zur Behandlung von<br />
Knoten mit oder ohne Struma durchgeführt: Die LISA-Studie (Levothyroxin und Iodid in<br />
der Strumatherapie als Mono- oder Kombinationstherapie) untersuchte die Effektivität<br />
der Knoten-/Struma-Behandlung mit T 4<br />
, Jod und einer Kombination aus T 4<br />
und Jod<br />
gegenüber Placebo. 20<br />
Die Beziehung<br />
zwischen Jodaufnahme<br />
und dem<br />
Risiko für Schilddrüsenerkrankungen<br />
weist einen U-förmigen<br />
Verlauf auf.<br />
18
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Die Ausgangsdosis von Levothyroxin (T 4<br />
) betrug in dieser Studie 75 µg/Tag (Korrektur<br />
der Dosierung nach oben oder unten, bis die TSH-Serumspiegel in einem Zielbereich<br />
von 0,2–0,8 mU/l lagen). Die verwendete Jodkonzentration betrug sowohl <strong>bei</strong> der Monotherapie<br />
als auch <strong>bei</strong> der Kombinationstherapie 150 µg/Tag. Bestimmt wurden das<br />
Gesamtvolumen aller Knoten sowie das Schilddrüsenvolumen. Nach einem Jahr hatten<br />
sich <strong>bei</strong>de gemessenen Parameter unter der Fixkombination aus Levothyroxin und Jod,<br />
im Gegensatz zu Placebo und den jeweiligen Monotherapien, signifikant verbessert. 20<br />
Die LISA-Studie lieferte somit Belege, dass auch trotz der verbesserten Jodversorgung<br />
in Deutschland <strong>bei</strong> der Behandlung von Knoten oder Struma die zusätzliche Gabe von<br />
Jod zu den Schilddrüsenhormonen sinnvoll ist. Bei Bedenken gegenüber der Fixkombinatin<br />
von L-Thyroxin und Jod mit einem Jodgehalt von 150 µg (z. B. Thyronajod®Henning)<br />
kann als Alternative auch eine Fixkombinatin mit einem geringeren Jodgehalt (75 µg)<br />
eingesetzt werden (z. B. L-Thyroxin Henning® plus).<br />
2.4.2 Operative Entfernung<br />
Wenn die Struma eine Größe erreicht hat, <strong>bei</strong> der sie die Funktion der benachbarten<br />
Luft- oder Speiseröhre beeinträchtigt, ist eine teilweise oder komplette operative Entfernung<br />
der Schilddrüse in Erwägung zu ziehen. Indiziert ist eine operative Entfernung der<br />
Schilddrüse ebenfalls <strong>bei</strong> Vorliegen eines Karzinoms. Bei Resektion der Schilddrüse<br />
wird in den meisten Fällen eine lebenslange Substitution von L-Thyroxin und Jod notwendig.<br />
2.4.3 Radiojodtherapie<br />
Zur Behandlung einer Struma kann ebenfalls die Radiojodtherapie verwendet werden.<br />
Beschrieben ist diese in Kapitel 2.3.2.<br />
Die Fixkombination<br />
aus L-Thyroxin und<br />
Jod war der jeweiligen<br />
Monotherapie in der<br />
Strumabehandlung<br />
signifikant überlegen.<br />
2.5 Gefährdete Patientengruppen<br />
2.5.1 Schwangere Frauen<br />
Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen der Schilddrüse,<br />
wie Hypothyreose und Struma. Denn Hormon- und Stoffwechselveränderungen in der<br />
Schwangerschaft beeinflussen diese in ihrer Funktion. 5 In der Schwangerschaft wird<br />
der Grundumsatz gesteigert sowie der Verteilungsraumes von Jod vergrößert.<br />
Außerdem wird während der Schwangerschaft durch eine erhöhte Estrogenkonzentration<br />
die Produktion des thyroxinbindenden Globulins (TBG) angeregt, wodurch die<br />
Bindungskapazität für Schilddrüsenhormone im Serum erhöht ist, d. h. dass weniger<br />
freies T 3<br />
und T 4<br />
im Blut zirkuliert. Die verringerten Hormonspiegel verursachen eine<br />
vermehrte Ausschüttung von TSH, welches die Synthese von Schilddrüsenhormonen<br />
ankurbelt, um deren Konzentration im Blut konstant zu halten. Dadurch bedingt kann<br />
sich die Syntheseleistung der Schilddrüse um 30–100 % steigern und so das Risiko<br />
der Entstehung einer Struma erhöhen. 21<br />
Die erhöhte<br />
Estrogenkonzentration<br />
in der Schwangerschaft<br />
fördert die<br />
Bildung von TBG.<br />
19
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Während der Schwangerschaft wird in der Plazenta humanes Choriongonadotropin<br />
(HCG) gebildet, ein Schwangerschaftshormon, das auf die Schilddrüse stimulierend<br />
wirkt. Zusätzlich verhindert HCG den Anstieg von TSH, so dass die Bestimmung dieses<br />
Parameters im Serum als Zeichen für einen Jod- und Schilddrüsenhormonmangel in<br />
der Schwangerschaft nicht aussagekräftig ist. 5,16<br />
Bei schwangeren Frauen ist zusätzlich die Nierenfunktion gesteigert, was zu einem<br />
erhöhten Jodverlust über den Urin führt und somit auch die Jodkonzentration im Serum<br />
sowie die Bildung der Schilddrüsenhormone verringert. 5<br />
Da aber der Bedarf an Schilddrüsenhormonen in der Schwangerschaft um ca. 50 %<br />
erhöht ist, sollte unbedingt auf eine ausreichende Jodzufuhr geachtet werden. Denn<br />
Jodmangel in der Schwangerschaft kann zur Bildung einer Schwangerschaftsstruma<br />
führen, wo<strong>bei</strong> ein schwerer Jodmangel auch die Entwicklung einer Struma <strong>bei</strong>m Ungeborenen<br />
fördern kann. 5 Und nicht nur das, eine Unterfunktion der Schilddrüse erhöht<br />
sogar das Risiko einer Früh- oder Fehlgeburt.<br />
Ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel ist der Fetus in der Lage, selbst Schilddrüsenhormone<br />
zu bilden, und benötigt dafür täglich etwa 50 µg Jod. Die Synthese der Schilddrüsenhormone<br />
des Ungeborenen ist aber stark abhängig von der Jodversorgung der<br />
Mutter. Für Schwangere und Stillende empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung<br />
eine tägliche Jodzufuhr von 230 µg, um eine ausreichende Versorgung von Mutter<br />
und Kind zu gewährleisten. Diese Mengen sind allerdings über die Nahrung nur schwer<br />
zu erreichen, lediglich über eine zusätzliche Zufuhr von Jodtabletten kann eine optimale<br />
Jodversorgung gesichert werden. Da aber eine Verordnung von Jodtabletten als Prophylaxe<br />
in der Schwangerschaft nicht mehr möglich ist, müssen die Betroffenen diese<br />
Kosten nun selbst tragen. 5,15,22<br />
2.5.2 Neugeborene/Säuglinge<br />
Zwar ist die Zahl der Neugeborenen-Struma in den letzten Jahren zurückgegangen,<br />
dennoch kommen nach wie vor etwa 10 % der Kinder mit einem latenten Jodmangel<br />
zur Welt. 21<br />
Nach der Geburt wird <strong>bei</strong> nicht gestillten Säuglingen die optimale Jodzufuhr durch Zusätze<br />
in der Säuglingsanfangsnahrung gedeckt.<br />
Gestillte Säuglinge hingegen erhalten nur genügend Jod, wenn auch die Mutter ausreichend<br />
versorgt ist. Denn wenn die Mutter bereits einen Jodmangel hat, gelangt auch<br />
weniger Jod in die Muttermilch. 14 Insbesondere <strong>bei</strong> Neugeborenen und Säuglingen ist<br />
allerdings eine optimale Versorgung mit Jod unerlässlich, da im Falle eines Mangels<br />
Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung auftreten können, die irreversibel<br />
sind. Stillenden Müttern sollte daher geraten werden, über die Einnahme von<br />
Jodtabletten die erhöhte Zufuhr zu gewährleisten.<br />
Das Schwangerschaftshormon<br />
HCG<br />
verhindert den<br />
Anstieg von TSH.<br />
In der Schwangerschaft<br />
ist der Bedarf<br />
an Schilddrüsenhormonen<br />
um etwa<br />
50 % erhöht.<br />
Jodmangel in der<br />
Schwangerschaft<br />
kann Folgen für Mutter<br />
und das ungeborene<br />
Kind haben.<br />
Die ausreichende<br />
Jodversorgung der<br />
Mutter ist für gestillte<br />
Säuglinge besonders<br />
wichtig.<br />
20
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
2.5.3 Frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen<br />
oder während einer Hormonersatztherapie<br />
Die Einnahme oraler Kontrazeptiva („Pille“) oder der Ersatzhormone in der postmenopausalen<br />
Phase führt zu einem Anstieg der Estrogenkonzentration im Blut, der einen<br />
Anstieg der TBG-Konzentration im Blut verursacht. Dadurch nimmt die Konzentration<br />
der Schilddrüsenhormone im Blut zunächst ab, durch vermehrte Ausschüttung von<br />
TSH wird allerdings eine vermehrte Synthese angeregt und die Schilddrüsenhormonspiegel<br />
können wieder ansteigen. Bei einer Substitutionstherapie mit L-Thyroxin kann<br />
der Bedarf erhöht sein.<br />
2.5.4 Raucher<br />
Auch Raucher haben ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen der Schilddrüse. Dies liegt<br />
darin begründet, dass Zigarettenrauch Thiocyanat enthält, welches den Jodidtransport<br />
in die Schilddrüse hemmt. Dadurch bedingt haben Raucher einen indirekt erhöhten<br />
Jodbedarf und sind anfälliger für die Entstehung von Strumen. 21<br />
2.5.5 Veganer<br />
Veganer haben zwar keinen erhöhten Jodbedarf, können aber aufgrund der eingeschränkten<br />
Speisenauswahl die erforderliche Menge an Jod nur schwer über die Nahrung<br />
erreichen. Denn jodhaltige Speisen, wie z. B. Seefisch oder Milchprodukte, stehen<br />
<strong>bei</strong> Veganern nicht auf dem Speiseplan.<br />
2.5.6 Patienten mit Autoimmunerkrankungen<br />
Untersuchungen haben gezeigt, dass Autoimmunerkrankungen, zu denen <strong>bei</strong>spielsweise<br />
ein Diabetes mellitus Typ 1 sowie einige rheumatische Erkrankungen zählen, häufig<br />
zusammen auftreten. So entwickelt etwa jeder fünfte Typ-1-Diabetiker im Zeitraum von<br />
zwei bis zwölf Jahren zusätzlich eine autoimmunbedingte Schilddrüsenerkrankung<br />
(Hashimoto-Thyreoditis oder Morbus Basedow). 23<br />
Ähnliches gilt <strong>bei</strong> Autoimmunerkrankungen des rheumatischen Formkreises. Hier wurde<br />
außerdem gezeigt, dass das gleichzeitige Auftreten einer Hypothyreose und einer rheumatoiden<br />
Arthritis die Schmerzsymptomatik verschlechtern können. Eine Behandlung<br />
der Hypothyreose durch Substitution mit Schildrüsenhormonen kann auch die Beschwerden<br />
einer rheumatischen Erkrankung bessern. 24<br />
Eine Autoimmunerkrankung<br />
kann das<br />
Risiko für die Entstehung<br />
einer weiteren<br />
Autoimmunerkrankung<br />
begünstigen.<br />
21
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Modul 3: Arzneimittelabgabe in der Apotheke<br />
Wenn ein Patient mit einer Verordnung über Schilddrüsenhormone in die Apotheke<br />
kommt, muss zunächst überprüft werden, ob für das verordnete Präparat ein Rabattvertrag<br />
vorliegt oder ob eine Substitution angezeigt ist.<br />
3.1 Abgabe <strong>bei</strong> Rabattverträgen<br />
Rabattierte Präparate haben <strong>bei</strong> der Abgabe grundsätzlich Vorrang.<br />
Am konkreten Beispiel der Schilddrüsenhormone bedeutet dies, dass z. B. <strong>bei</strong> einer<br />
Verordnung des Alt-Originals L-Thyroxin Henning®, wenn für die betreffende Krankenkasse<br />
(L-Thyroxin Henning® ist derzeit (Stand August 2012) für über 14 Mio. Versicherte<br />
rabattiert) ein Rabattvertrag besteht, dieses auch abgegeben werden muss und nicht<br />
gegen ein wirkstoffgleiches, nicht rabattiertes Präparat ausgetauscht werden darf.<br />
Besteht mit dem verordneten Alt-Original kein Rabattvertrag, hingegen aber mit einem<br />
wirkstoffgleichen Arzneimittel, so wird eine Substitution angezeigt. Bei kritischen Arzneimittelgruppen<br />
wie den Schilddrüsenhormonen sollte aber nach Möglichkeit nicht ausgetauscht<br />
werden, da hier ein Präparatewechsel zu Therapieproblemen führen kann.<br />
Durch Anmelden „Pharmazeutischer Bedenken“ kann zum Beispiel der Austausch des<br />
verordneten Präparates durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel verhindert werden.<br />
Austausch <strong>bei</strong><br />
L-Thyroxin ist kritisch.<br />
Abb. 10: Beispielhafte Anzeige der Rabattverträge von L-Thyroxin 50 in der Lauer-Taxe online<br />
(ausgewählte Krankenkasse: Techniker Krankenkasse IK 0177504)<br />
Bestehen Rabattverträge sowohl für das Alt-Original als auch für ein Generikum, so darf<br />
der Apotheker gemäß Rahmenvertrag frei wählen, welches Präparat er abgibt. Hier ist<br />
es dann einfach, aus Gründen der Therapiesicherheit auf den Austausch zu verzichten.<br />
Auszug aus dem Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz<br />
2 SGB V:<br />
Ȥ 4 Absatz 2, Satz 5:<br />
„Treffen die Voraussetzungen nach Satz 1 <strong>bei</strong> einer Krankenkasse für mehrere<br />
rabattbegünstigte Arzneimittel zu, kann die Apotheke unter diesen frei wählen.“<br />
22
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Preisunterschiede, die die VK-Preise der Tax-Ansicht darstellen, brauchen da<strong>bei</strong> nicht<br />
berücksichtigt zu werden, da der Apotheker keine Informationen darüber erhält, welchen<br />
Preis die Krankenkasse für die Rabattartikel ausgehandelt hat. Hier empfiehlt<br />
es sich, den Patienten zu befragen, welches Präparat er zuvor erhalten hat, um einen<br />
Präparatewechsel zu verhindern.<br />
3.2 Packungsgrößen und Darreichungsformen von L-Thyroxin<br />
Wenn ein Austausch des verordneten Präparates angezeigt ist, muss überprüft werden,<br />
ob <strong>bei</strong>de Arzneimittel in den gleichen Normbereich fallen und ob die Darreichungsform<br />
übereinstimmt oder als austauschbar gilt. L-Thyroxin gehört zur Arzneimittelgruppe der<br />
Schilddrüsentherapeutika und wird laut Packungsgrößenverordnung wie folgt eingeordnet:<br />
Abb. 11: Einteilung der Packungsgrößen von<br />
L-Thyroxin, dargestellt im AMNOG-Packungsgrößen-Check<br />
des DeutschenApothekenPortals<br />
(Stand August 2012)<br />
Bei einem Blick in die Lauer-Taxe online fällt<br />
auf, dass derzeit zu keinem L-Thyroxin-Präparat<br />
eine N1-Packung im Handel ist. Dies<br />
könnte darin begründet sein, dass <strong>bei</strong> der<br />
Behandlung von Hypothyreose oder Struma<br />
in den meisten Fällen eine lebenslange<br />
Therapie erforderlich ist, die Einnahme der<br />
Präparate also nicht auf einen Zeitraum begrenzt<br />
ist und daher eine geringe Tablettenanzahl<br />
nicht notwendig ist.<br />
Die N2 enthält 50 Tabletten, was mit dem<br />
neuen N2-Bereich von 45–55 Stück übereinstimmt.<br />
Die N3 ist mit 100 Stück im Handel,<br />
welche ebenfalls nach neuer Packungsgrößen-<br />
verordnung in den N3-Bereich mit 95–100 Stück fällt. Als N3 ist auch noch eine<br />
Kalenderpackung mit 98 Stück auf dem Markt, welche auch im aktuellen N3-Bereich<br />
liegt. Diese ist als TKA ausgezeichnet, während die Packung mit 100 Stück als<br />
TAB gekennzeichnet ist. Laut Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA) gelten TAB und<br />
TKA <strong>bei</strong> Schilddrüsentherapeutika als nicht austauschbar.<br />
Bestehen zu<br />
mehreren Präparaten<br />
Rabattverträge, so<br />
darf der Apotheker<br />
zwischen diesen frei<br />
wählen.<br />
TKA und TAB gelten<br />
<strong>bei</strong> Schilddrüsentherapeutika<br />
laut<br />
G-BA als nicht<br />
austauschbar.<br />
Abb. 12: Beispielhafte Anzeige der N3 von L-Thyroxin 50 als TAB und TKA in Awinta Prokas<br />
23
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Für die Abgabe in der Apotheke bedeutet dies, dass Tabletten in einer Kalenderpackung<br />
zwar ebenso als N3 eingeordnet werden wie die „normalen“ Tabletten, ein Austausch<br />
aber dennoch nicht möglich ist, da es sich nicht um eine austauschbare Darreichungsform<br />
handelt. Ist also eine Kalenderpackung verordnet, so müssen auch Tabletten in<br />
einer Kalenderpackung beliefert werden. Bei Verordnung der normalen Tabletten dürfen<br />
nur normale Tabletten abgegeben werden.<br />
3.3 Schilddrüsenhormone als kritische Arzneimittelgruppe<br />
Der Austausch eines verordneten Arzneimittels gegen ein wirkstoffgleiches Generikum<br />
kann nicht nur zu Verunsicherung <strong>bei</strong>m Patienten führen, da dieser dann möglicherweise<br />
nicht sein gewohntes Medikament bekommt. Vielmehr sollten pharmakologische<br />
Aspekte berücksichtigt werden, wenn über eine Substitution nachgedacht wird, denn<br />
verschiedene Levothyroxin-Präparate weisen zum Teil große Unterschiede in der relativen<br />
Bioverfügbarkeit auf (Abweichungen um 20 % nach unten und 25 % nach oben<br />
sind erlaubt, siehe Modul 2, Punkt 2.1). Die therapeutische Breite der Schilddrüsenhormone<br />
ist gering, d. h. der wirksame Konzentrationsbereich ist eng, weshalb die<br />
Patienten individuell eingestellt werden müssen, um das Therapieziel – eine gleichmäßige<br />
Einstellung des Schilddrüsenhormonkreislaufes – zuverlässig zu erreichen. Die Substitution<br />
von Schilddrüsenhormonen sollte daher immer kritisch betrachtet und im Zweifelsfall<br />
durch Anmelden „Pharmazeutischer Bedenken“ verhindert werden.<br />
3.3.1 Die Probleme <strong>bei</strong>m Austausch von Schilddrüsenhormonen<br />
Aufgrund der unterschiedlichen Bioverfügbarkeit der verschiedenen L-Thyroxin-Präparate<br />
muss der Austausch als kritisch angesehen werden. Falls eine Substitution des<br />
verordneten Arzneimittels nicht verhindert werden kann, wird empfohlen, die TSH-Konzentration<br />
im Blut zu überprüfen und zu Beginn der Umstellung regelmäßige Kontrollen<br />
durchzuführen, um die optimale Dosis der Schilddrüsenhormone zu gewährleisten.<br />
Denn schon <strong>bei</strong> geringfügigen Schwankungen der Hormonspiegel, sowohl nach oben<br />
als auch nach unten, können für den Patienten erhebliche Nebenwirkungen auftreten.<br />
Bei einem zu hohen TSH-Spiegel (Hypothyreose) kann es u. a. zu Gewichtszunahme,<br />
Bradykardie oder Erhöhung des Serumcholesterols kommen, <strong>bei</strong> zu niedrigen TSH-<br />
Konzentrationen (Hyperthyreose) u. a. zu Gewichtsabnahme, Vorhofflimmern oder Hyperglykämie.<br />
Für den Patienten bedeuten die erneuten regelmäßigen Kontrollen der TSH-Spiegel einen<br />
erheblichen Zeitaufwand. Für die Krankenkasse entstehen hierdurch deutliche Mehrkosten,<br />
die i. d. R. die Ersparnisse der Rabattverträge übersteigen. Die Substitution<br />
eines verordneten Schilddrüsenhormons ist somit in vielen Fällen nicht wirtschaftlich<br />
und birgt für den Patienten auch noch ein zusätzliches Risiko: Da die Substitution<br />
eines verordneten Medikaments in der Apotheke erfolgt, erhält der Arzt diese Information<br />
häufig nicht und die Therapie des Patienten kann durch abweichende Wirkspiegel<br />
gefährdet sein.<br />
Verschiedene Levothyroxin-Präparate<br />
weisen unterschiedliche<br />
Bioverfügbarkeiten<br />
auf und sollten<br />
deshalb nicht<br />
substituiert werden.<br />
Präparatewechsel<br />
können durch zu<br />
hohe oder zu niedrige<br />
Hormonspiegel<br />
Nebenwirkungen mit<br />
sich bringen.<br />
Ist ein Präparatewechsel<br />
nicht zu<br />
vermeiden sollten die<br />
TSH-Spiegel regelmäßig<br />
überprüft<br />
werden.<br />
24
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Die Therapie wird aber nicht nur durch die unterschiedliche Bioverfügbarkeit der Präparate<br />
gefährdet. Eine Studie der IMS Health hat gezeigt, dass insbesondere Patienten<br />
mit einer Dauermedikation durch einen Wechsel der Arzneimittel verunsichert werden.<br />
Die Zahl der Therapieabbrüche ist <strong>bei</strong> Patienten mit Präparateumstellungen deutlich<br />
höher als <strong>bei</strong> jenen, die ihr gewohntes Medikament auch weiterhin erhalten.<br />
3.3.2 Höhere Therapiekosten durch Austausch<br />
Infolge der nicht eingehaltenen Therapie entstehen weitere Kosten, etwa durch vermehrte<br />
Krankenhauseinweisungen, Arzt- und Facharztbesuche. Auch volkswirtschaftlich<br />
betrachtet können durch Präparateumstellungen Kosten entstehen: Die schlechtere<br />
Wirksamkeit der Therapie kann durch eine geringere Produktivität oder gar einen<br />
Ar<strong>bei</strong>tsausfall der Patienten zusätzliche Kosten verursachen. 25<br />
Bei Präparatewechsel<br />
werden Therapien<br />
häufiger abgebrochen.<br />
3.4 Verordnung mit „Aut-idem-Kreuz“<br />
Liegt eine Verordnung über das Alt-Original mit „Aut-idem-Kreuz“ vor, so ist dieses,<br />
unabhängig von Rabattverträgen, auch abzugeben, da der Arzt mit Setzen des „Autidem-Kreuzes“<br />
den Austausch auf wirkstoffgleiche Präparate (Generika) unterbindet.<br />
So kann schon durch den Arzt sichergestellt werden, dass der Patient auf jeden Fall das<br />
gewünschte Präparat erhält und nicht durch einen Präparatewechsel die Therapie gefährdet<br />
wird. Hat der Arzt den Austausch gegen ein wirkstoffgleiches Arzneimittel durch<br />
Setzen des „Aut-idem-Kreuzes“ nicht verhindert, so hat der Apotheker die Möglichkeit<br />
„Pharmazeutische Bedenken“ anzumelden, wenn aus seiner Sicht ein Austausch der<br />
Präparate die Therapie gefährden könnte.<br />
Das „Aut-idem-Kreuz“<br />
verhindert den<br />
Austausch des verordneten<br />
Präparates<br />
durch ein anderes<br />
rabattbegünstigtes<br />
Generikum.<br />
3.5 Anwendung der „Pharmazeutischen Bedenken“<br />
<strong>bei</strong> Schilddrüsenhormonen<br />
Bei Präparaten mit geringer therapeutischer Breite ist der Austausch des verordneten<br />
Präparates möglichst zu vermeiden. Bestehen Zweifel, ob dem Patienten ein anderes<br />
Arzneimittel zuzumuten ist, kann die Substitution des verordneten durch ein rabattbegünstigtes<br />
Arzneimittel durch Anmelden „Pharmazeutischer Bedenken“ verhindert<br />
werden. Bei korrekter Dokumentation der „Pharmazeutischen Bedenken“, wie am<br />
folgenden Beispiel aufgeführt, sind keine Retaxationen zu befürchten.<br />
Dokumentation Pharmazeutischer Bedenken auf der Verordnung:<br />
1. In die 1. Verordnungszeile wird die Sonder-PZN 2567024 eingetragen.<br />
2. Eine handschriftliche Begründung der Pharmazeutischen Bedenken wird auf<br />
dem Rezept vermerkt, z. B. „Gefährdung des Therapieerfolgs wegen geringer<br />
therapeutischer Breites von L-Thyroxin“.<br />
3. Handschriftlichen Vermerk mit Datum und Unterschrift abzeichnen.<br />
25
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Zusätzlich sollte beachtet werden, ob Folgendes auf dem Rezept aufgedruckt ist:<br />
4. Im Feld „Faktor“ muss eine dreistellige<br />
Kennziffer eingetragen sein. Beispiel:<br />
Nur 1 Verordnung, Nichtabgabe eines<br />
rabattbegünstigten Arzneimittels aufgrund<br />
Pharmazeutischer Bedenken = 611.<br />
5. In dem Feld „Taxe“ muss<br />
eine „0“ stehen.<br />
6. In der 2. Verordnungszeile<br />
soll die PZN des abgegebenen<br />
Präparates sowie dessen Preis sein.<br />
3.6 Kombinationstherapie mit Thyroxin und Jod<br />
Wie bereits in Modul 2 besprochen, ist für die optimale Behandlung von Vergrößerungen<br />
der Schilddrüse die gleichzeitige Gabe von Jod sinnvoll. Dies kann allerdings dazu<br />
führen, dass der Patient täglich mehrere Tabletten, z. B. L-Thyroxin und Jod, einnehmen<br />
muss, was die Therapietreue des Patienten gefährden könnte.<br />
Um den Patienten die Therapie zu erleichtern und die täglich einzunehmende Zahl der<br />
Tabletten zu senken, bieten einige Hersteller Levothyroxin in einer Fixkombination mit<br />
Jod an.<br />
L-Thyroxin und Jod<br />
sind auch als Fixkombination<br />
erhältlich.<br />
3.7 Beratung in der Apotheke<br />
3.7.1 Einnahmehinweise<br />
Die Bioverfügbarkeit von Levothyroxin ist von vielen Faktoren abhängig. So sind vielseitige<br />
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bzw. Mineralstoffen bekannt.<br />
Beispielsweise behindern Eisen- bzw. Calciumpräparate, magensäurebindende Mittel<br />
auf Basis von Aluminiumverbindungen oder auch Medikamente mit Colestyramin oder<br />
Colestipol die L-Thyroxinaufnahme. Auch Sojaprodukte können die Aufnahme des Wirkstoffes<br />
behindern. Hier sollte ein großer zeitlicher Abstand (mindestens 2 Stunden,<br />
<strong>bei</strong> Colestyramin bzw. Colestipol sogar mindestens 5 Stunden) zwischen der Einnahme<br />
eingehalten werden.<br />
Im Einzelfall sollte überprüft werden, ob der Patient zusätzlich zu seinem Schilddrüsenpräparat<br />
noch weitere Medikamente einnimmt, die die Wirksamkeit von L-Thyroxin beeinflussen.<br />
Empfohlen wird, die gesamte Tagesdosis von L-Thyroxin morgens nüchtern mindestens<br />
eine halbe Stunde vor dem Frühstück unzerkaut einzunehmen. So wird der Wirkstoff<br />
am zuverlässigsten vom Körper aufgenommen und Wechselwirkungen mit Nahrungsbestandteilen<br />
können vermieden werden.<br />
26
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
3.7.2 Jodversorgung<br />
Häufigste Ursache für die Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen ist ein alimentärer<br />
Jodmangel, daher ist eine ausreichende Versorgung mit Jod <strong>bei</strong> der Behandlung von<br />
Schilddrüsenerkrankungen besonders wichtig. Um die tägliche alimentäre Jodaufnahme<br />
besser einschätzen zu können, sind nachfolgend die Jodidgehalte einiger ausgewählter<br />
Lebensmittel dargestellt.<br />
Lebensmittel<br />
µg/100g<br />
essbarer Anteil<br />
Rindfleisch, reines Muskelfleisch 5,4<br />
Schweinefleisch, reines Muskelfleisch 4,5<br />
Kabeljau (Dorsch) 170<br />
Scholle 53<br />
Forelle (Bachforelle, Regenbogenforelle) 3,4<br />
Miesmuschel 105<br />
Hühnerei 5,7<br />
Kuhmilch, Vollmilch, 3,5 % Fett 2,7<br />
Camembert, 45 % Fett i. Tr. 3,5<br />
Edamer Käse, 40 % Fett i. Tr. 5,0<br />
Gouda Käse, 45 % Fett i. Tr. 3,6<br />
Haferflocken 4,5<br />
Roggenbrot 8,5<br />
Weissbrot 5,8<br />
Möhre 1,6<br />
Sellerie 2,5<br />
Grünkohl 4,5<br />
Paprikaschote 1,0<br />
Tomate 1,1<br />
Aprikose 0,5<br />
Pfirsich 2,9<br />
Banane 2,0<br />
Pflaume 1,4<br />
Tab. 4: Jodidgehalte ausgewählter Lebensmittel<br />
(in µg/100 g essbarer Anteil) 26<br />
3.7.3 Weitere Hinweise<br />
Patienten nehmen Schilddrüsenhormone<br />
in der Regel<br />
als Dauermedikation<br />
ein. Dennoch sollte in jedem<br />
Beratungsgespräch<br />
noch einmal darauf hingewiesen<br />
werden, wie wichtig<br />
die regelmäßige Einnahme<br />
des Arzneimittels ist. Nur<br />
so wird gewährleistet, dass<br />
der empfindliche Kreislauf<br />
der Schilddrüsenhormone<br />
gleichmäßig eingestellt ist<br />
und dass keine Symptome<br />
einer Über- bzw. Unterfunktion<br />
die Lebensqualität beeinflussen.<br />
Auch regelmäßige Arztbesuche<br />
sind unverzichtbar,<br />
um die Entwicklung der Blutspiegel<br />
zu überwachen und<br />
mögliche Veränderungen<br />
der Schilddrüse mittels<br />
Ultraschalluntersuchung<br />
überprüfen zu lassen. Am<br />
Tag der Blutuntersuchung<br />
dürfen keine Schilddrüsenhormone<br />
eingenommen<br />
werden, damit die Ergebnisse<br />
der Untersuchung<br />
nicht verfälscht werden.<br />
27
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Exemplarisches Beratungsgespräch: ( A = Apotheker / P = Patient)<br />
A<br />
P<br />
A<br />
P<br />
A<br />
P<br />
A<br />
P<br />
A<br />
P<br />
A<br />
P<br />
A<br />
Guten Tag, was kann ich für Sie tun?<br />
Guten Tag, ich möchte gerne dieses Rezept <strong>bei</strong> Ihnen einlösen.<br />
Sie bekommen dieses Präparat, es heißt L-Thyroxin, für Ihre Schilddrüse.<br />
Nehmen Sie es zum ersten Mal ein?<br />
Ja, ich bekomme die Tabletten zum ersten Mal.<br />
Hat der Arzt Ihnen die Dosierung genannt?<br />
Er hat gesagt, ich solle die Tabletten einmal täglich morgens einnehmen, das<br />
werde ich dann immer direkt vor dem Frühstück tun, dann denke ich auf jeden<br />
Fall daran.<br />
Die morgendliche Einnahme ist gut, da das Präparat auf nüchternen Magen am<br />
besten vom Körper aufgenommen wird. Allerdings sollten Sie es mindestens eine<br />
halbe Stunde vor dem Frühstück einnehmen, damit die Aufnahme des Wirkstoffes<br />
nicht durch Nahrungsmittel beeinflusst wird. Zum Beispiel behindert Sojamilch die<br />
Aufnahme von L-Thyroxin. Nehmen Sie denn noch andere Medikamente ein?<br />
Nein, dies ist das einzige Arzneimittel, das ich jetzt nehmen muss.<br />
Wichtig ist auch, dass Sie die Tabletten regelmäßig einnehmen, dann haben Sie<br />
Ihre Erkrankung zukünftig zuverlässig im Griff. Haben Sie auch schon Folgetermine<br />
für weitere Blutuntersuchungen bekommen? Dies ist gerade zu Beginn der Therapie<br />
in kürzeren Abständen erforderlich, nach und nach werden die Zeitabstände aber<br />
größer, wenn Sie gut eingestellt sind.<br />
Ja, ich habe die entsprechenden Termine schon notiert, so kann ich sie nicht<br />
vergessen.<br />
Noch ein Hinweis: Am Tag der Blutuntersuchung dürfen Sie das Arzneimittel nicht<br />
einnehmen, das verfälscht ansonsten das Ergebnis.<br />
Oh, das ist ein guter Hinweis. Danke für Ihre umfassende Beratung.<br />
Gern geschehen, auf Wiedersehen!<br />
28
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Glossar<br />
3,5-Dijodtyrosin<br />
3-Monojodtyrosin<br />
3´,5´,3,5-Tetrajodthyronin<br />
3´,3,5-Trijodthyronin<br />
Adenohypophyse<br />
Capsula fibrosa<br />
Cartilago thyroidea<br />
C-Zellen<br />
Dehalogenase<br />
Exocytose<br />
Follikel<br />
Glandula thyroidea<br />
Hypothalamus<br />
Hyperthyreose<br />
Hypothyreose<br />
Jod<br />
Jodakkumulation<br />
Jodclearance<br />
Interstitium<br />
Isthmus<br />
Kolloid<br />
Larynx<br />
Lobulus dexter<br />
Lobulus sinister<br />
Morbus Basedow<br />
Natriumjodidsymporter<br />
Palpation<br />
DJT; Vorstufe der Schilddrüsenhormone<br />
MJT; Vorstufe der Schilddrüsenhormone<br />
T 4<br />
; Thyroxin<br />
T 3<br />
; Trijodthyronin<br />
größerer Teil der Hirnanhangsdrüse;<br />
Syntheseort für TSH<br />
Organkapsel<br />
Schildknorpel<br />
Zellen in der Schilddrüse, die das Hormon<br />
Calcitonin bilden<br />
Enzym, das Jodid von MJT und DJT abspaltet<br />
Verschmelzung von Vesikeln mit der Plasmamembran<br />
der Follikelepithelzellen<br />
Speichert die gebildeten Schilddrüsenhormone<br />
bzw. das Kolloid<br />
Schilddrüse<br />
Abschnitt des Zwischenhirns, das TRH bildet<br />
Überfunktion der Schilddrüse<br />
Unterfunktion der Schilddrüse<br />
Halogen, das für die Bildung der Schilddrüsenhormone<br />
notwendig ist<br />
Vermehrte Jodanreicherung in der Schilddrüse<br />
Vermehrte Aufnahme von Jod in die Schilddrüse<br />
Zwischengewebe von Organen, indem auch<br />
Blutgefäße und Nerven des Organs verlaufen<br />
Schmaler Streifen, der die <strong>bei</strong>den Lappen der<br />
Schilddrüse verbindet<br />
Speichert die gebildeten, noch an Thyreoglobulin<br />
gebundenen Schilddrüsenhormone<br />
Kehlkopf<br />
Lappen der Schilddrüse<br />
Lappen der Schilddrüse<br />
Autoimmunerkrankung<br />
Transportiert Jod gegen ein Konzentrationsgefälle<br />
aus dem Blut in die Schilddrüse<br />
Befund durch Abtasten<br />
29
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Parafollikuläre Zellen<br />
s. C-Zellen<br />
Radiojodtherapie<br />
Gabe von radioaktivem Jod, u.a. zur Behandlung<br />
von Struma<br />
Reutilisationsrate<br />
Vermehrte Rückresorption von Jod aus den<br />
Verdauungssekreten<br />
Schilddrüsenautonomie<br />
Funktionsstörung des thyreotropen Regelkreises,<br />
die in nicht bedarfsgerechter Bildung der Schilddrüsenhormone<br />
resultiert<br />
Serumalbumin<br />
Transportprotein, an das Schilddrüsenhormone<br />
im Serum gebunden sind<br />
Sonographie<br />
Ultraschall, wird auch zur Untersuchung der<br />
Schilddrüse angewendet<br />
Szintigraphie<br />
Methode zur Untersuchung der Schilddrüse<br />
Struma<br />
Kropf; Vergrößerung der Schilddrüse,<br />
die sichtbar, messbar oder tastbar ist<br />
Thyreozyten<br />
Follikelepithelzellen<br />
Thyreoglobulin<br />
Dimeres Glykoprotein, das in den Thyreozyten<br />
der Schilddrüse gebildet wird und an der<br />
Synthese und Speicherung der Schilddrüsenhormone<br />
beteiligt ist<br />
Thyreoliberin<br />
Thyreotropinreleasing Hormon, s. TRH<br />
Thyreoperoxidase<br />
Enzym, dass die Jodierung von Tyrosylresten<br />
des Thyreoglobulins katalysiert<br />
Thyreostatika Substanzen, die zur Behandlung einer Schild -<br />
drüsenüberfunktion eingesetzt werden<br />
Thyreotropin<br />
Thyreoideastimulierendes Hormon, s. TSH<br />
Thyroxin<br />
T 4<br />
; Schilddrüsenhormon<br />
Thyroxinbindendes Globulin TBG<br />
Thyroxinbindendes Präalbumin TBPA<br />
Transkription<br />
Umschreibung der genetischen Information von<br />
DNA in RNA<br />
Translation<br />
Synthese von Proteinen anhand einer transkribierten<br />
RNA<br />
Trijodthyronin<br />
T 3<br />
; Schilddrüsenhormon<br />
Tyrosin<br />
Nicht essentielle Aminosäure, die für die Bildung<br />
von Schilddrüsenhormonen benötigt wird<br />
Tyrosylrest<br />
Aminosäurerest der Aminosäure Tyrosin<br />
Trachea<br />
Luftröhre<br />
TSH<br />
Thyreotropin; Schilddrüsenhormon, das die<br />
Bildung von T 3<br />
und T 4<br />
induziert<br />
30
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Literatur<br />
1 Silbernagl S, Lang F. Taschenatlas der Pathophysiologie. Thieme Verlag. 2. Auflage.<br />
2 Thews G, Mutschler E, Vaupel P. Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen.<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.<br />
3 Köhrle J, Brabant G. Synthese, Stoffwechsel und Diagnostik der Schilddrüsenhormone.<br />
Internist 2010. 5:559–567.<br />
4 Gärtner R, Reincke M. Substitution of thyroid hormones. Internist 2008 49(5):538, 540–544.<br />
5 Bohnet HG. Jodmangel und Jodversorgung in der Schwangerschaft und Stillzeit.<br />
Präv Gesundheitsf 2007. 2:175–178.<br />
6 Nationaler Screeningreport 2010, Deutsche Gesellschaft für Neugeborenen-Screening.<br />
7 Hartmann L. Schilddrüsenerkrankungen. Mit Infos und Service Stammkunden gewinnen.<br />
Apotheke + Marketing 07.2012.<br />
8 Schumm-Dräger PM, Feldkamp J. Schilddrüsenerkrankungen in Deutschland.<br />
Präv Gesundheitsf 007. 2:153–158.<br />
9 Reiners C. DAZ 2008. 148(14):65–68.<br />
10 TSH-Referenzbereich. Wo beginnt die subklinische Hypothyreose? Endokrinologie & Stoffwechsel.<br />
Universum Innere Medizin 04/07. 32–34.<br />
11 Kharlip J, Cooper DS. Endokrinologen empfehlen Therapie auch <strong>bei</strong> leichtem Verlauf – Überfunktion<br />
im Alter verkürzt Lebensdauer deutlich. Presseinformation der DGE. 30.07.09.<br />
12 Gärtner R. Wichtige Spurenelemente für die Schilddrüse. Präv Gesundheitsf 2007. 2:185–190.<br />
13 D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Umschau/Braus. 1. Auflage.<br />
14 Remer T. Jodversorgung <strong>bei</strong> Kindern und Jugendlichen. Präv Gesundheitsf 2007. 2:167–173.<br />
15 Jahreis G, Leiterer M, Fechner A. Jodmangelprophylaxe durch richtige Ernährung.<br />
Präv Gesundheitsf 2007. 2:179–183.<br />
16 Scriba PC, Heseker H, Fischer A. Jodmangel und Jodversorgung in Deutschland.<br />
Präv Gesundheitsf 2007. 2:143–148.<br />
17 Habermann J, Heinze HG, Horn K, Kanthlehner R, Marschner I, Neumann J, Scriba PC.<br />
Alimentärer Jodmangel in der Bundesrepublik Deutschland. Dtsch med Wschr 1975. 39:1937–1945.<br />
18 Meng W und Scriba PC. Jodversorgung in Deutschland. Deutsches Ärtzeblatt 2002. Heft 39.<br />
19 Großklaus R. Nutzen und Risiko der Jodprophylaxe. Präv Gesundheitsf 2007. 2:159–166.<br />
20 Grussendorf M, Reiners C, Paschke R, Wegscheider K. Reduction of Thyroid Nodule Volume by<br />
Levothyroxine and Iodine Alone and in Combination: A Randomized, Placebo-Controlled Trial.<br />
J Clin Endocrinol Metab 2011. 96(9): 2786–2795.<br />
21 Großklaus R. Jod, Folsäure und Schwangerschaft – Ratschläge für Ärzte. Bundesinstitut für<br />
Risikobewertung. Februar 2006.<br />
22 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.<br />
23 Mevissen G. Autoimmunerkrankungen mit Domino-Effekt. Pharmazeutische Zeitung.<br />
Ausgabe 12/2000.<br />
24 Weiss M. Autoimmunerkrankungen kommen oft im Doppelpack. MMW-Fortschr. Med. Nr. 8/2008.<br />
25 Arzneimittelrabattverträge schaden der Gesundheit und kosten statt zu sparen.<br />
Pressemitteilung Bundesverband der Arzneimittelhersteller e. V. 14. Juli 2010.<br />
26 Fröleke H. Kleine Nährwerttabelle der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.<br />
Umschau. 42. Auflage.<br />
Hier können Sie die Fachinfo L-Thyroxin® Henning und Thyronajod® Henning herunterladen.<br />
31
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
Bitte alle Antwortbogen faxen an: 0221 – 222 8 33 22<br />
q Herr q Frau<br />
Vorname:<br />
Nachname:<br />
q Apotheker q PTA q Sonstige<br />
Bitte vollständige Anschrift der Apotheke (in Druckbuchstaben)<br />
Name der Apotheke:<br />
Straße:<br />
PLZ:<br />
Ort:<br />
Fax:<br />
E-Mail-Adresse:<br />
q Ich möchte auch weiterhin über aktuelle Themen informiert werden.<br />
Kontrollfragen<br />
Modul 1: Die Indikationen<br />
3 PUNKTE<br />
für Apotheker/PTAs<br />
Von der<br />
Apothekerkammer<br />
zertifiziert<br />
1. Wie lautet der lateinische Name der Schilddrüse?<br />
m Cartilago thyroidea m Capsula fibrosa m Glandula thyroidea<br />
2. Ist die Jodkonzentration im Blut oder in der Schilddrüse höher?<br />
m Im Blut m In der Schilddrüse m In Blut und Schilddrüse gleich hoch<br />
3. Welche Aminosäure wird für die Synthese der Schilddrüsenhormone benötigt?<br />
m Threonin m Tryptophan m Tyrosin<br />
4. An welcher Position ist Monojodtyrosin jodiert?<br />
m C-3 m C-4 m C-5<br />
5. Wie lautet die chemische Bezeichnung von Thyroxin?<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
6. Was geschieht <strong>bei</strong> sinkender Konzentration der Schilddrüsenhormone im Blut?<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
7. Welche Wirkung haben Schilddrüsenhormone auf den menschlichen Körper?<br />
m Erhöhung des Grundumsatzes und des Sauerstoffverbrauchs<br />
m Erhöhung des Grundumsatzes und Reduktion des Sauerstoffverbrauchs<br />
m Verringerung des Grundumsatzes und des Sauerstoffverbrauchs<br />
8. Wann entwickelt sich eine kongenitale Hypothyreose?<br />
m Im Laufe des Lebens m Im Säuglingsalter m Im Mutterleib<br />
9. Wann spricht man von einem manifesten Stadium der Hypothyreose?<br />
m Wenn die Spiegel der Schilddrüsenhormone normal sind, die TSH-Werte aber erhöht<br />
m Wenn die Spiegel der Schilddrüsenhormone reduziert sind, sich aber keine Symptome äußern<br />
m Wenn die Spiegel der Schilddrüsenhormone reduziert sind und sich Symptome äußern<br />
m Wenn ein lebensgefährlicher Mangel an Schilddrüsenhormonen vorliegt<br />
10. Welches der folgenden Symptome kann <strong>bei</strong> einer Hyperthyreose auftreten? (Mehrfachnennung möglich)<br />
m Erniedrigte Körpertemperatur<br />
m Obstipation<br />
m Überempfindlichkeit gegenüber Wärme<br />
m Hypoglykämie<br />
m Osteoporose<br />
m Verzögerung von Längenwachstum<br />
11. Wann spricht man von einem Struma Grad 1b?<br />
m Wenn ein Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes aber nicht sichtbar ist<br />
m Wenn ein Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes auch sichtbar ist<br />
m Wenn ein Struma <strong>bei</strong> normaler Kopfhaltung sichtbar ist<br />
m Wenn das Struma so groß ist, dass lokale Komplikationen durch Behinderung der Blutzirkulation<br />
und Atmung entstehen<br />
Modul 2: <strong>Hormontherapie</strong> und optimale Jodversorgung<br />
12. Welche Aussage trifft zu<br />
m Eine Hypothyreose muss in den meisten Fällen durch lebenslange Substitution von Schilddrüsenhormonen<br />
behandelt werden<br />
m Eine Hypothyreose muss so lange mit Schilddrüsenhormonen behandelt werden, bis der Patient<br />
keine Symptome mehr hat<br />
m Eine Hypothyreose muss so lange mit Schilddrüsenhormonen behandelt werden, bis der Patient<br />
ausgewachsen ist<br />
13. Um wie viel % kann die Bioverfügbarkeit zwischen zwei Levothyroxin-Präparaten im Extremfall schwanken?<br />
m 5 % m 25 %<br />
m 55 % m 75 %<br />
14. In welchem Bereich sollten die TSH-Spiegel <strong>bei</strong> guter Einstellung liegen?<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
2
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
15. Welche der folgenden Behandlungsmöglichkeiten werden <strong>bei</strong> der Hyperthyreose angewandt?<br />
(Mehrfachnennung möglich)<br />
m Gabe von Thyroxin<br />
m Gabe von Thyreostatika<br />
m Operative Entfernung eines m Radiojodtherapie<br />
Teils oder der ganzen Schilddrüse<br />
16. Wieviel Jod sollte ein Erwachsener laut DGE täglich aufnehmen?<br />
m 40 µg m 100 µg m 200 µg<br />
17. Über welche Lebensmittel wird Jod hauptsächlich aufgenommen? (Mehrfachnennung möglich)<br />
m Süßwasserfisch<br />
m Milch- und Milchprodukte<br />
m Fleisch- und Fleischprodukte m Obst und Gemüse<br />
18. Was deutet auf einen mäßigen Jodmangel (Grad II) hin?<br />
Jodausscheidungen im Urin von<br />
m 100–200 µg/l<br />
m 50–90 µg/l<br />
m 20–49 µg/l<br />
m
ZertifiZierte fortbildung<br />
<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />
Schilddrüsenerkrankungen<br />
24. Wie lautet der N2-Bereich von Schilddrüsentherapeutika?<br />
m 16–24 Stück m 45–55 Stück m 95–100 Stück<br />
25. Welche Aussage zu L-Thyroxin ist richtig?<br />
m Die Kalenderpackung (TKA) mit 98 Stück ist gegen eine Packung mit 100 Stück (TAB) austauschbar,<br />
da <strong>bei</strong>de in den N3-Bereich fallen<br />
m Die Kalenderpackung (TKA) mit 98 Stück darf gegen die Packung mit 100 Stück (TAB) nicht<br />
substituiert werden, da die Darreichungsformen laut G-BA nicht austauschbar sind<br />
26. Warum sollte <strong>bei</strong> Schilddrüsenhormonen ein Präparatewechsel kritisch betrachtet werden?<br />
(Mehrfachnennung möglich)<br />
m Schilddrüsenhormone haben eine geringe therapeutische Breite<br />
m Die Dosis der Schilddrüsenhormone muss individuell eingestellt werden<br />
m Schilddrüsenhormone haben eine problematische Applikationsform<br />
27. Wodurch kann der Austausch eines verordneten Arzneimittels durch ein rabattbegünstigtes Präparat<br />
verhindert werden?<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
28. Was muss <strong>bei</strong> Pharmazeutischen Bedenken auf dem Rezept aufgedruckt sein, damit keine<br />
Retaxationen zu erwarten sind? (Mehrfachnennung möglich)<br />
m Die Sonder-PZN 2567024<br />
m Eine handschriftliche Begründung der Pharmazeutischen Bedenken<br />
m Unterschrift und Datum zum Abzeichnen des handschriftlichen Vermerks<br />
m Hinweise zur richtigen Einnahme des Arzneimittels<br />
29. Wodurch kann die Therapietreue des Patienten gesichert werden?<br />
m Austausch des bewährten Präparats<br />
m Abgabe des gewohnten Arzneimittels<br />
m Einnahme verschiedener Tabletten mehrmals täglich<br />
30. Mit welchem Element ist Thyroxin in einer Fixkombination erhältlich?<br />
m Eisen m Jod m Folsäure<br />
31. Wodurch kann die Bioverfügbarkeit von Levothyroxin beeinflusst werden? Nennen Sie drei Beispiele.<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
32. Welches der folgenden Lebensmittel enthält am meisten Jodid pro 100 g?<br />
m Forelle m Edamer Käse m Tomate<br />
4