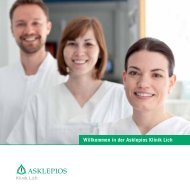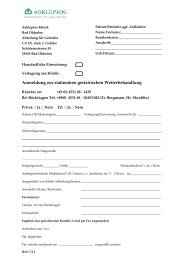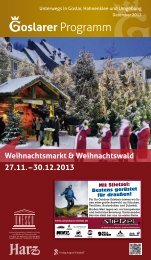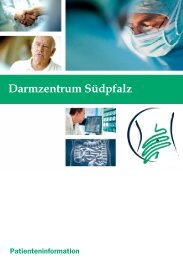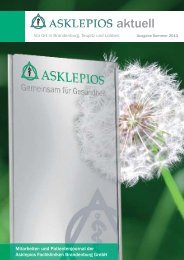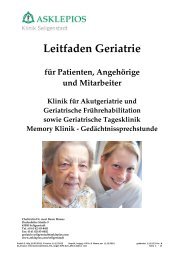aktuell - SciVal
aktuell - SciVal
aktuell - SciVal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Allgemeinpsychiatrie<br />
Sucht und ihre Behandlung<br />
Wir orientieren uns hierbei auch an der Therapiezielhierarchie<br />
nach SCHWOON (1992), die die Grundlage sowohl<br />
für die Indikationsstellung als auch für die Behandlungsplanung<br />
und -durchführung bildet:<br />
• Sicherung des Überlebens<br />
• Verminderung von schweren körperlichen<br />
Folgeschäden<br />
• Sicherung der sozialen Umgebung gegen<br />
Beeinträchtigungen<br />
• Verhinderung sozialer Desintegration<br />
• Ermöglichung längerer Abstinenzphasen<br />
• Einsicht in die Grunderkrankung<br />
• Akzeptanz des eigenen Behandlungs- bzw.<br />
Hilfebedarfs<br />
• Akzeptanz des Abstinenzzieles<br />
• konstruktive Bearbeitung von Rückfällen<br />
• individuelle therapeutische Grenzziehung<br />
(„Selbsthilfe“).<br />
Parallel wird nach einer klaren Therapiezielhierarchie gearbeitet<br />
(geordnet nach Priorität):<br />
• Selbst- und fremdgefährdendes Verhalten<br />
• Therapieschädliches Verhalten<br />
• Aufbau alltagsrelevanter Fertigkeiten<br />
• andere Ziele der Patienten<br />
Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der multiprofessionellen<br />
Teamarbeit geschenkt mit dem Ziel, möglichst<br />
alltags- und realitätsbezogene Behandlungsziele und -ergebnisse<br />
gemeinsam mit den Patienten zu erarbeiten. Zu<br />
diesem Zweck werden der individuelle Therapieauftrag<br />
des Patienten und die Struktur der Therapieangebote gemeinsam<br />
miteinander verglichen, präzisiert und ein gemeinsamer<br />
Therapieplan erstellt, in dessen Rahmen sowohl<br />
die Behandlungsvereinbarung als auch (falls im Einzelfall<br />
erforderlich) ein individueller Therapievertrag die Rahmenbedingungen<br />
festlegen.<br />
Die Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“<br />
werden oft synonym gebraucht; in der Praxis<br />
hat sich der Begriff der „Sucht“ oder „Suchterkrankung“<br />
fest etabliert und scheint für den<br />
Praxisgebrauch weiterhin anwendbar, obwohl<br />
die geltenden Klassifikationssysteme „Abhängigkeit“<br />
bzw. „Abhängigkeitssyndrom“ zur Beschreibung<br />
bevorzugen. Wir nutzen bewusst<br />
den in der täglichen Anwendung griffigeren<br />
Begriff „Sucht“ in Anerkenntnis der Tatsache,<br />
dass die Gesamtheit des Phänomens sich<br />
nicht vollständig in ihm widerspiegelt.<br />
Oberarzt Dr. Eberhard Böhme, Oberarzt Dr. Knud Pieper<br />
Wir bieten stationäre<br />
Suchtbehandlung störungsspezifisch<br />
vorrangig im<br />
Gruppensetting an. Das<br />
Gruppentherapieprogramm<br />
wird ergänzt von je nach Indikation<br />
festzulegenden einzelpsychotherapeutischen<br />
Angeboten. Suchtpatienten<br />
erhalten ein störungsspezifisches<br />
Therapieangebot entsprechend<br />
ihrer Symptomatik<br />
und entsprechend ihres<br />
Behandlungsauftrages. Die<br />
Überprüfung der Indikation<br />
zur stationären Behandlung<br />
erfolgt bei Erfordernis für<br />
alkoholabhängige Patienten<br />
verschiedener Rating-Skalen.<br />
Grundsätzlich beinhaltet die Behandlung die sorgfältige<br />
ärztliche Indikationsprüfung betreffs der Option medikamentöser<br />
Behandlung. Oft kann erst über eine gezielte<br />
Medikation die Basis für ein erfolgreiches psychotherapeutisches<br />
Arbeiten geschaffen werden. Ein hausinterner Leitfaden<br />
zur Führung der medikamentösen Behandlung bildet<br />
dabei die leitliniengestützte Basis.<br />
Da die Suchterkrankung häufig mit komorbiden somatischen<br />
und psychischen Erkrankungen verbunden ist, wird<br />
leitlinienorientiert die Medikation ausgewählt, die für die<br />
individuelle Befundlage des Patienten Entlastung ermöglichen<br />
kann (z.B. adäquate schmerztherapeutische Einstellung,<br />
antidepressive oder antipsychotische Behandlungsstrategien,<br />
Stimmungsstabilisierer, Medikation komorbider<br />
organischer Erkrankungen).<br />
Ergotherapie: Der Schwerpunkt liegt hier auf der Förderung<br />
von Aktivitätsaufbau, Entwicklung von Kreativität<br />
und Freude am Gestalten, Entdecken eigener Fähigkeiten<br />
sowie Förderung des Kompetenzerlebens. Gleichzeitig in<br />
diesem Rahmen Bearbeitung wichtiger Themen mit ergotherapeutischen<br />
Mitteln (Gruppen- und Einzelarbeit, angeleitet<br />
durch Ergotherapeutin).<br />
Sozialdienst: Die Sozialarbeiterin der Suchtstation ist zuständig<br />
für die Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen<br />
in Form von Unterstützung bei der Lösung von realen<br />
Alltagsproblemen mit direktem Bezug auf bearbeitete<br />
Therapieziele und Förderung der zunehmenden Selbständigkeit<br />
bei der Durchführung von Lösungsschritten (durch<br />
Sozialarbeiterin).<br />
Lesen Sie bitte auf Seite 13 weiter.<br />
Sucht und ihre Behandlung<br />
Weiter von Seite 12.<br />
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Sabine Fitzek<br />
Migräne ist eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Bis<br />
zu 15% der Frauen und bis zu 7% der Männer sollen daran<br />
leiden. Die Ursache dieser, den Menschen meist lebenslang<br />
begleitenden Kopfschmerzattacken, die in der Regel einseitig<br />
Allgemeinpsychiatrie<br />
Suchtspezifische Psychotherapie: In dieser Therapiegruppe<br />
wird das Einbeziehen interaktioneller Prozesse als<br />
zusätzlicher Wirkfaktor in den therapeutischen Prozess<br />
gefördert. Die Gruppenteilnehmer gestalten rasch ebensolche<br />
Interaktionsstile wie in den Realsituationen und gehen<br />
demzufolge ähnlich strukturierte Beziehungen ein, so dass<br />
diese im Therapieprozess sichtbar und damit auch behandelbar<br />
werden. Durch diesen prozessorientierten Ansatz<br />
ist diese Therapiegruppe prinzipiell problem- und zieloffen.<br />
Im Unterschied zu anderen verhaltenstherapeutischen<br />
Standardprogrammen ermöglicht diese Behandlungsform<br />
eine störungsinhomogene Gruppenzusammensetzung, bezogen<br />
auf die oft sehr unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen<br />
und Lebenssituationen der einzelnen Patienten.<br />
Entsprechend der Konzeption der Therapiegruppe zielt<br />
die psychotherapeutische Arbeit nicht nur auf Informationsvermittlung<br />
zur Suchterkrankung, sondern bezieht unterschiedliche<br />
Problemlösungsmöglichkeiten hinsichtlich<br />
der Bewältigung des individuellen Alltags unter spezieller<br />
Berücksichtigung der bestehenden Suchtproblematik ein.<br />
Unter Nutzung der Techniken des „motivational Interviewing“<br />
(vgl. Miller & Rollnick 2005) bestimmen die vier<br />
grundlegenden Prinzipien des MI:<br />
• Empathie durch Perspektivwechsel,<br />
• Fördern des Selbstwirksamkeitserlebens durch<br />
Unterstützen von Veränderungsimpulsen,<br />
• flexibler Umgang mit „Widerstand“ als Ansatz<br />
zum Finden eigener Lösungswege<br />
• Diskrepanz erzeugen, um Veränderungsbereitschaft<br />
zu fördern<br />
die Kommunikation in der Gruppe.<br />
Die Therapie wird in Form einer offenen Gruppe durchgeführt.<br />
Grundsätzlich sollen der Kontakt zu den weiterführenden<br />
gruppentherapeutischen Angeboten der Institutsambulanz<br />
bereits während der stationären Behandlung<br />
gebahnt werden.<br />
Botox bei Migräne?<br />
auftreten, oft, aber nicht immer klopfenden Charakter haben<br />
und fast immer mit vegetativen Begleiterscheinungen wie<br />
Übelkeit und Brechreiz oder mit Lichtempfindlichkeit und Ruhebedürfnis<br />
einhergehen, ist nach wie vor ungeklärt.<br />
Vieles spricht dafür, dass die Erkrankung ihren Ursprung<br />
im Hirnstamm hat. Das erklärt möglicherweise auch, warum<br />
nicht wenige Patienten an rezidivierendem Schwindel<br />
als Symptom der Migräne leiden. Manchmal stehen solche<br />
Schwindelattacken sogar ganz im Vordergrund, während<br />
die Migräne an sich längst „im Griff“ ist. Vor allem bei Kindern<br />
von Eltern mit Migränekopfschmerz, die immer wieder<br />
über Schwindel klagen, muss man an Migräne denken.<br />
Die Zeiten, wo der Mensch mit Migräne tagelang ohne<br />
sich zu rühren oder gar Nahrung zu sich nehmen zu können<br />
im abgedunkelten Zimmer auf Besserung wartete, sind<br />
zum Glück vorbei. Heute haben wir eine Vielzahl sehr guter<br />
Migränetherapeutika und die meisten Menschen können<br />
mit ihrer Migräne gut leben. Stellen sich die Attacken mehrfach<br />
im Monat ein, sollte eine medikamentöse Prophylaxe<br />
eingenommen werden. Dabei nimmt man ein Präparat täglich<br />
ein, um die Attackenfrequenz zu verringern. Auch für<br />
die Prophylaxe stehen uns heute mehrere Medikamente zur<br />
Auswahl zur Verfügung, so dass sich in der Regel für den<br />
individuellen Patienten eine gute Wahl treffen lässt.<br />
Eine kleine Gruppe von Patienten entwickelt aber eine<br />
chronische Migräne. Diese Menschen haben dann kaum<br />
noch migränefreie Tage. Oft werden auch zu viele Migränemedikamente<br />
genommen. Das ist verständlich, man will<br />
schnell wieder „fit“ werden, führt aber nicht selten in einen<br />
Teufelskreis. Denn zu viele dieser Attacken – Medikamente<br />
führen unter Umständen in eine andere Kopfschmerzkategorie,<br />
in den Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch.<br />
Dann verursacht das Kopfschmerzmedikament<br />
selbst Kopfschmerzen! Da hilft dann oft nur noch ein stationärer<br />
Medikamentenentzug.<br />
Für die chronische Migräne mit mindestens 15 Tagen<br />
Migräne-Kopfschmerz pro Monat über mehr als 3 Monate,<br />
gibt es aber eine neue Behandlungsoption. In einer großen,<br />
doppelblinden, plazebokontrollierten Studie konnte die<br />
Wirksamkeit von Botoxinjektionen überzeugend nachgewiesen<br />
werden. Dabei wird das Medikament an mehr<br />
als 30 Stellen an Kopf und Nacken injeziert. Nicht jeder Patient<br />
profitiert von der Therapie, bei vielen konnte aber ein<br />
deutlicher Rückgang der Attackenfrequenz nachgewiesen<br />
werden.<br />
Wenn die Voraussetzungen stimmen und alle anderen<br />
Behandlungstrategien versagt haben, wird die Behandlung<br />
in aller Regel von der Kasse übernommen.<br />
Chronische Migräne führt zu einer erheblichen<br />
Einbuße an Lebensqualität.<br />
Mit dieser neuen Behandlungsstrategie<br />
können wir einem Teil der Patienten<br />
ein Stück Lebensqualität<br />
zurückgeben.<br />
Termine für ein Beratungsgespräch<br />
können über das Sekretariat der Neurologie<br />
in Brandenburg vereinbart<br />
werden.<br />
12 <strong>aktuell</strong> Winter 2013/14<br />
<strong>aktuell</strong> Winter 2013/14 13<br />
Fachkliniken Brandenburg GmbH<br />
Fachkliniken Brandenburg GmbH