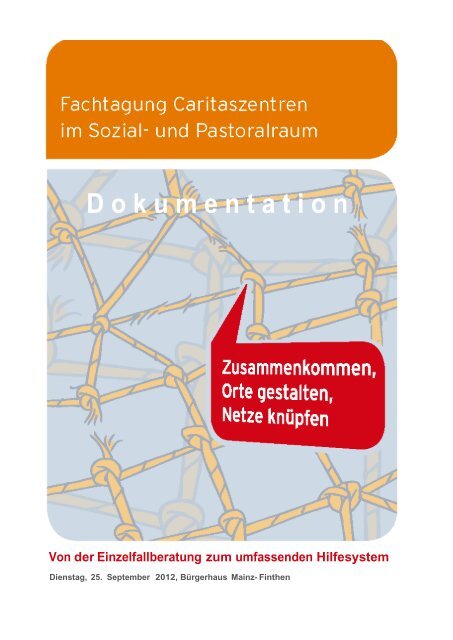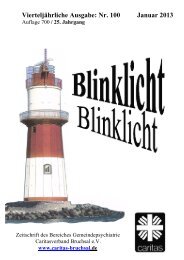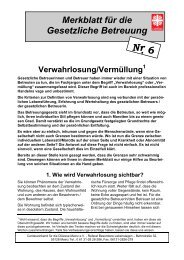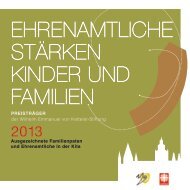Datei herunterladen - Caritasverband für die Diözese Mainz
Datei herunterladen - Caritasverband für die Diözese Mainz
Datei herunterladen - Caritasverband für die Diözese Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der zum Hilfesystem<br />
Dienstag, 25. September Bürgerhaus <strong>Mainz</strong>-
Inhalt:<br />
Seite:<br />
Begrüßung: 3<br />
Diözesancaritasdirektor Thomas Domnick, Vorstand DiCV <strong>Mainz</strong><br />
Weil der Mensch unteilbar ist … 5<br />
Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen <strong>Caritasverband</strong>es, Freiburg<br />
Sozialraumorientierung als zentrales Fachkonzept Sozialer Arbeit 10<br />
Prof. Dr. Stefan Bestmann, Katholische Hochschule <strong>für</strong> Sozialwesen, Berlin<br />
Steuerung komplexer Prozesse in einem Team hoch spezialisierter Musiker<br />
Reinmar Neuner, Dirigent und langjähriger Violinist im Gürzenichorchester –<br />
Kölner Philharmonie<br />
Cornelia Harloff, Musikerin, systemischer Coach und Trainerin<br />
20<br />
Workshops<br />
Sozialraumorientierung als zentrales Fachkonzept Sozialer Arbeit<br />
Prof. Dr. Stefan Bestmann, Kath. Hochschule <strong>für</strong> Sozialwesen, Berlin<br />
Moderation: Ute Strunck, DiCV <strong>Mainz</strong><br />
Caritaszentren als soziale Systeme verstehen und steuern<br />
Reinmar Neuner, Dirigent / Cornelia Harloff, Musikerin<br />
Moderation: Karl Mayer, Caritaszentrum Rüsselsheim<br />
28<br />
29<br />
Caritas und Seelsorge als Mitgestalter des sozialen Gemeinwesens<br />
Frank Mach, Caritashaus St. Josef, Offenbach<br />
Moderation: Winfried Reininger, DiCV <strong>Mainz</strong><br />
Veränderung und Chancen in der verbandlichen Beratungsarbeit<br />
Siglinde Bohrke-Petrovic, Hochschule der BA, Mannheim<br />
Moderation: Helga Feld-Finkenauer, DiCV <strong>Mainz</strong><br />
Blicke über den Tellerrand<br />
Maria Hanisch/Monika Kuntze, <strong>Caritasverband</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> Stadt Köln e.V.<br />
Hartmut Fritz, <strong>Caritasverband</strong> Frankfurt e.V.<br />
Moderation: Eva Trost-Kolodziejski, Caritaszentrum Delbrêl, <strong>Mainz</strong><br />
30<br />
31<br />
Evaluation 37<br />
TN-Liste 38<br />
Hinweis:<br />
Der Film „Caritaszentrum Delbrêl – Haus der Begegnung“ kann auf der<br />
Homepage des <strong>Caritasverband</strong>es <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Diözese</strong> <strong>Mainz</strong> - in der rechten<br />
Spalte unter „Video Caritaszentrum Delbrêl - angesehen werden.<br />
Die Internetadresse lautet: http://www.dicvmainz.caritas.de/<br />
2
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ganz herzlich möchte ich Sie zu unserer Fachtagung „Caritaszentren im Sozial- und Pastoralraum<br />
zum Thema „Von der Einzelfallberatung zum umfassenden Hilfesystem begrüßen“.<br />
Ich freue mich, über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Caritaszentren und<br />
den Caritasverbänden vor Ort, aber auch aus den Caritasverbänden anderen <strong>Diözese</strong>n, aus<br />
dem Bereich der Seelsorge und der öffentlichen Verwaltung. Seien Sie uns herzlich willkommen.<br />
Ziel unserer Fachtagung ist es <strong>die</strong> Entwicklung der Caritaszentren zu reflektieren, besonders<br />
aber Anregungen und Impulse „von außen“ aufzugreifen und in unsere Praxis einfließen zu<br />
lassen.<br />
Nicht von Außen, aber mit einem bundesweiten Fokus wird uns heute Morgen der Präsident<br />
des Deutschen <strong>Caritasverband</strong>es einen Impuls geben. Ein herzliches Willkommen, Herrn<br />
Prälat Dr. Peter Neher, wir freuen uns, dass du hier bist.<br />
Ein ebenso herzliches Willkommen Herrn Prof. Dr. Stefan Bestmann, der uns <strong>die</strong> Sozialraumorientierung<br />
als Fachkonzept sozialer Arbeit erläutern wird.<br />
Was sind Kriterien <strong>für</strong> ein erfolgreiches Team? Wie arbeiten Spezialisten erfolgreich zusammen?<br />
Eine Frage, <strong>die</strong> uns auch mit Blick auf <strong>die</strong> CziSP beschäftigt. Bewusst haben wir daher<br />
aus einem ganz anderen Feld, aus dem Bereich der Musik, zwei Referenten eingeladen:<br />
Frau Cornelia Harloff, sie berät als Coach Musiker und ist selbst Musikerin und Herrn Reimar<br />
Neuner, der als Dirigent ein Orchester leitet. Ein herzliches Willkommen.<br />
Zum Einstieg freue ich mich Ihnen heute, als Premiere einen Film über <strong>die</strong> Caritaszentren –<br />
genauer über ein Caritaszentrum in <strong>Mainz</strong> vorstellen zu dürfen:<br />
Film „Caritaszentrum Delbrêl – Haus der Begegnung“ (s. Hinweis auf Seite 2, Anm. Redaktion)<br />
In dem Film werden vier Orientierungen deutlich, <strong>die</strong> uns bei der Entwicklung unserer Projekte<br />
besonders wichtig sind:<br />
Sozialraumorientierung: Von den Menschen her denken, <strong>die</strong> in <strong>die</strong>sem Sozialraum leben,<br />
in welchen Bezügen stehen sie? Welche Hoffnungen und Erwartungen setzen sie auf Kirche<br />
und Caritas?<br />
Die Problemlagen der Menschen werden komplexer – d.h. wir können darauf nicht mehr nur<br />
mit der Einzelfallberatung reagieren, sondern wir müssen umfassende Hilfesysteme aufbauen,<br />
<strong>die</strong> der Lebenssituation der Menschen gerecht werden. Gleichzeitig liegt darin aber auch<br />
<strong>die</strong> Chance, dass wir <strong>die</strong> Menschen nicht defizitorientiert, von ihren Problemlagen her wahrnehmen,<br />
sondern im Netzwerk ihrer Beziehungen auch als Handelnde mit ihren Fähigkeiten<br />
und Stärken kennen lernen. Wenn es uns gelingt, <strong>die</strong>ses Wahrzunehmen und in unsere Arbeit<br />
einfließen lassen, dann sind Caritaszentren nicht reine Beratungszentren, sondern Foren<br />
im Sozialraum, in denen Begegnung stattfindet und von denen Impulse <strong>für</strong> den Ort oder den<br />
Stadtteil aus gehen – wie <strong>die</strong>s im Film deutlich wurde, über 20 Gruppen treffen sich dort.<br />
Ein weiterer Aspekt ist <strong>die</strong> Pastoralraumorientierung, und auch <strong>die</strong>se kam im Film deutlich<br />
zum Ausdruck – Partnerschaft mit den Pfarrgemeinden. Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern<br />
aus der Seelsorge und der Caritas um voneinander zu lernen, <strong>die</strong> jeweiligen Blickwinkel<br />
einzunehmen und gemeinsam den Pastoralraum, als Teil des Sozialraums weiter zu entwickeln<br />
und gemeinsam mit den Menschen zu gestalten.<br />
3
Als dritten Aspekt unserer Arbeit haben wir <strong>die</strong> Teilhabeorientierung beschrieben, nicht <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Menschen, sondern mit den Menschen deren soziales Umfeld gestalten ist unser Ziel. Im<br />
CZ Delbrel (Film) organisieren Menschen <strong>für</strong> sich selbst ihren Stadtteil, Mittagessen, Theatergruppe,<br />
Begegnung werden möglich. Gleichzeitig muss ich einräumen, dass wir an <strong>die</strong>sem<br />
Aspekt noch arbeiten müssen. Während uns <strong>die</strong> Erhebung von Wünschen und Bedürfnissen<br />
bei den Kitas als Familienzentren durch Elternbefragungen gut gelungen ist, müssen<br />
wir in den Caritaszentren noch entsprechende Instrumentarien entwickeln.<br />
Die vierte Orientierung ist <strong>die</strong> Einbeziehung von Ehrenamt. Ehrenamtliche aus Pfarrgemeinde<br />
und Caritaszentrum bereichern und unterstützen <strong>die</strong> Arbeit im Zentrum, Sie ersetzen<br />
nicht hauptamtliche Tätigkeiten, bieten aber ein mehr an Hilfe und Beziehung. Ehrenamt ist<br />
jedoch kein Sparmodell, ehrenamtliche müssen gut qualifiziert und begleitet werden, auch<br />
<strong>die</strong>s benötigt Ressourcen.<br />
Um unsere Caritaszentren in <strong>die</strong>ser Weise weiter zu entwickeln müssen wir<br />
- auf <strong>die</strong> Menschen schauen<br />
- auf den Sozialraum schauen<br />
- als Team von Spezialisten auf <strong>die</strong> Menschen zugehen.<br />
So gestaltet sich auch unser Vormittag und wir beginnen mit einem Blick auf <strong>die</strong> Menschen:<br />
„Weil der Mensch unteilbar ist …“, Dr. Peter Neher.<br />
4
Prälat Dr. Peter Neher:<br />
„Weil der Mensch unteilbar ist …“<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
gerne habe ich Ihre Einladung angenommen, an der heutigen Fachtagung „Von der Einzelfallberatung<br />
zum umfassenden Hilfesystem“ teilzunehmen. Trifft doch Ihr Thema eine Fragestellung,<br />
<strong>die</strong> mir seit langem besonders am Herzen liegt: Wie können <strong>die</strong> Einrichtungen und<br />
Dienste und hier gerade auch <strong>die</strong> Beratungs<strong>die</strong>nste der Kirche und ihrer Caritas Menschen<br />
in ihrer unterschiedlichen Bedürftigkeit gerecht werden? Und das mit hoher Kompetenz im<br />
Fachlichen und gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass der Mensch ein Ganzes ist – eben<br />
unteilbar!<br />
Meine Überlegungen möchte ich in folgenden Schritten entfalten:<br />
1. Bedeutung der fachlichen Spezialisierung<br />
2. Herausforderung der Vernetzung<br />
3. Theologische Überlegungen<br />
4. Zukunftsfähigkeit von Kirche und ihrer Caritas<br />
1. Bedeutung der fachlichen Spezialisierung<br />
Vernetzung ist das Gebot der Stunde – erlauben Sie mir trotzdem, dass ich zu Beginn<br />
schlaglichtartig auf <strong>die</strong> historische und bleibende Bedeutung von fachlicher Spezialisierung<br />
eingehe.<br />
Die Soziale Arbeit, wie wir sie heute kennen, verdankt sich unter vielem anderen auch einem<br />
Emanzipationsprozess. Im Zuge der Emanzipation der Sozialen Arbeit aus der Dominanz der<br />
Kirchen hat sich in den letzten 100 bis 150 Jahren das entwickelt, was wir heute unter Professionalität<br />
verstehen. Heraus aus dem Odium bloßer Nächstenliebe und Wohltätigkeit trat<br />
im Zuge der Professionalisierung und Spezialisierung eine Soziale Arbeit zutage, <strong>die</strong> sich im<br />
Feld der Human- und Sozialwissenschaften etablierte und <strong>die</strong> eine anthropologische Wende<br />
vollzogen hat: Das Wissen und <strong>die</strong> Wissenschaften vom Menschen mit all seinen unterschiedlichen<br />
Dimensionen und Zugängen steht seitdem im Vordergrund. Bereits bei Lorenz<br />
Werthmann war bei der Gründung des Deutschen <strong>Caritasverband</strong>es das Stu<strong>die</strong>ren, das<br />
heißt qualifiziert und reflektiert ausgebildet zu sein, neben dem Organisieren und Publizieren<br />
eine zentrale Aufgabe der verbandlichen Caritas. Die Fortbildungs-Akademie des Deutschen<br />
<strong>Caritasverband</strong>es in Freiburg und alle Fortbildungsangebote der Diözesan-Caritasverbände<br />
haben ihren Ursprung genau darin, dass man in den sozialen Arbeitsfeldern gut ausgebildete<br />
Menschen benötigt – in einer hochdifferenzierten und hochspezialisierten Welt umso mehr.<br />
So kennen wir Aus- und Weiterbildung, Supervision, Zusatzausbildungen und Fachtagungen.<br />
Die Notwendigkeit von „Fachlichkeit“ wird also nicht kleiner werden!<br />
Die Vielfalt der Problemlagen von Menschen erfordert deshalb ein differenziertes Angebot<br />
auf einem hohen fachlichen Niveau. Die gegenseitige Abhängigkeit von Problemlagen, <strong>die</strong><br />
häufig in einer Person oder auch in der ganzen Familie kumulieren, braucht jedoch mittlerweile<br />
eine Fall- und Feldkompetenz, <strong>die</strong> den Menschen und sein Umfeld als Ganzes wahrnimmt.<br />
Ein qualifiziertes Angebot unterstützt <strong>die</strong> Ratsuchenden bei der Bewältigung von wirtschaftlichen,<br />
sozialen und individuellen Problemen und persönlichen Lebenskrisen und unterstützt<br />
sie in ihrer Fähigkeit, ihre Lebensumstände zu bewerten oder zu ordnen.<br />
Grundsätzliches Ziel der Beratung ist es, dass jeder Mensch genau <strong>die</strong> Unterstützung bekommt,<br />
<strong>die</strong> er in seiner aktuellen Situation braucht, ganz gleich bei welcher Beratungsstelle<br />
er anfragt. Hier genau bedarf es der Vernetzung der Beratungs<strong>die</strong>nste, weil der ratsuchende<br />
Mensch eben oft nicht nur eine Not mit seinen Schulden oder seiner Alkoholsucht hat, in der<br />
Erziehung der Kinder oder seiner Partnerschaft – im Einzelnen kommt man oft nur weiter,<br />
wenn man es im Ganzen des betroffenen Menschen betrachtet.<br />
2. Herausforderung der Vernetzung<br />
Wie gerade benannt, haben <strong>die</strong> Problemlagen der meisten Ratsuchenden unterschiedliche<br />
Dimensionen. Zudem entstehen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen neue<br />
Bedarfe, welche <strong>die</strong> Leistungsfähigkeit einzelner, spezialisierter Beratungs<strong>die</strong>nste überfor-<br />
5
dern. Diesen neuen Bedürfnissen wird man in Zukunft nicht mehr einfach mit neuen Spezialangeboten<br />
begegnen können. Qualitative Verbesserungen werden künftig in hohem Maße<br />
damit verbunden sein, Ressourcen zu bündeln. Die Zukunft gehört daher einem flexiblen,<br />
multiprofessionell arbeitenden Hilfesystem, in dem <strong>die</strong> Beratungsstellen eine zentrale Rolle<br />
spielen.<br />
Das Projekt des Deutschen <strong>Caritasverband</strong>es "Vernetzung und Integration von Beratungs<strong>die</strong>nsten<br />
und -leistungen der Caritas" hat gezeigt, dass alle Beratungsbereiche der Caritas in<br />
vielfältigen Kooperationen stehen. Allerdings ist <strong>die</strong>se Zusammenarbeit häufig personenbezogen<br />
und konzeptionell wenig verankert. Daher werden Kooperationen und <strong>die</strong><br />
Arbeit in Netzwerken künftig durch Vereinbarungen und Konzepte besser abgesichert werden<br />
müssen.<br />
Dies lässt sich am Beispiel der "Frühen Hilfen" verdeutlichen. Sie sollen Familien bereits vor<br />
und dann nach der Geburt eines Kindes unterstützen. Dazu werden örtliche Netzwerke mit<br />
einer Vielzahl von Akteuren geknüpft: Schwangerschaftsberatungsstellen, Entbindungsstationen<br />
der Krankenhäuser, Hebammen und Kinderärzt(inn)e(n), familienunterstützende Dienste<br />
sowie Einrichtungen der Tagesbetreuung. Aber auch <strong>die</strong> Allgemeine Sozialberatung sowie<br />
Sucht- oder Schuldnerberatungsstellen können sinnvoll daran beteiligt sein.<br />
Aus <strong>die</strong>ser ziel- und lösungsorientierten Perspektive stellt sich dann <strong>die</strong> Frage, welchen Beitrag<br />
eine kirchliche Einrichtung oder ein Beratungs<strong>die</strong>nst leisten kann. Mit einem solchen<br />
Zugang könnte es möglicherweise besser gelingen, <strong>die</strong> fachlichen Systemgrenzen zu überwinden.<br />
Voraussetzung hier<strong>für</strong> ist, dass <strong>die</strong> Dienste und Einrichtungen eine klare Vorstellung<br />
von ihren Kernkompetenzen haben, sie auch vermitteln können und im Miteinander eine<br />
neue Fachlichkeit in der Vernetzung gewinnen. Diese Arbeit in Netzwerken muss aber von<br />
den Trägern gewollt und mit Ressourcen unterstützt werden, um zu einer verstärkten Kooperation<br />
aller Beratungs<strong>die</strong>nste der Kirche und ihrer Caritas zu kommen.<br />
Wenn ich an den Caritas-Sozial<strong>die</strong>nst der Caritas im Erzbistum Freiburg denke, an entsprechende<br />
Aktivitäten der Caritas Münster oder auch an <strong>die</strong> Caritaszentren in Duisburg ist hier<br />
bundesweit viel geschehen – das gilt es zu würdigen, weil es ermutigende Beispiele <strong>für</strong> alle<br />
sind, <strong>die</strong> daran arbeiten.<br />
3. Theologische Überlegungen<br />
3.1. Der Mensch ist unteilbar<br />
So wie sich <strong>die</strong> Soziale Arbeit professionalisiert und spezialisiert hat, so sind im Zuge dessen<br />
auch <strong>die</strong> Theologie und <strong>die</strong> Seelsorge in einen Sog der Spezialisierung geraten. Auch im<br />
Feld der Seelsorge gibt es Fachfrauen und Fachmänner <strong>für</strong> unterschiedliche „Seelsorgebedarfe“.<br />
Hier <strong>die</strong> Krankenhausseelsorge, dort <strong>die</strong> Seelsorge <strong>für</strong> Familien, wieder woanders <strong>die</strong><br />
Seelsorge <strong>für</strong> hörgeschädigte Menschen und <strong>die</strong> <strong>für</strong> Menschen mit psychischer Erkrankung<br />
und Behinderung. Auch <strong>die</strong> Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge haben Aus- und Weiterbildungen<br />
<strong>für</strong> einen speziellen Bereich oft im Sozial- und Gesundheitswesen absolviert.<br />
Die Zuständigkeiten sind klar, aber ist damit wirklich immer und in jedem Fall einem Menschen<br />
geholfen?<br />
Soziale Arbeit und Seelsorge sind im Zuge einer sich ausdifferenzierenden und sich spezialisierenden<br />
Gesellschaft in der Gefahr, das Ganze des Menschen aus dem Blick zu verlieren.<br />
Die spirituelle Dimension eines Menschen und seine <strong>die</strong>sbezüglichen Bedarfe können jedoch<br />
in den Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens nicht einfach in einem weiteren<br />
spezialisierten Dienst aufgegriffen werden – so als könnte man über spirituelle und geistliche<br />
Übungen dann <strong>die</strong> vermisste Ganzheitlichkeit herstellen.<br />
Vielmehr hat Ganzheitlichkeit selbst eine spirituelle Dimension. Diese Dimension hat überall<br />
dort Geltung, wo der Mensch in einer entsprechenden sozialprofessionellen Handlungssequenz<br />
im Gesamt seiner körperlichen, psychischen, sozialen und geistlichen Bedürftigkeit<br />
wahr- und ernstgenommen wird – selbst wenn überhaupt kein religiöses Wort fällt. Mit anderen<br />
Worten: Geistlich wird ein Prozess nicht erst dort, wenn religiöse Worte fallen.<br />
6
3.2 Jesu Wirken im Lebensraum der Menschen<br />
Die biblischen Texte berichten darüber, dass Jesus an vielen öffentlichen Plätzen handelt. Er<br />
heilt Kranke, predigt und spricht mit Menschen dort, wo sie leben und arbeiten. Sein Leben<br />
und Wirken ist also nicht von Rückzug geprägt und seine Botschaft gilt nicht <strong>für</strong> eine geschlossene<br />
Gesellschaft. Deshalb ruft Jesus <strong>die</strong> Menschen zur Nachfolge in der Gottes- und<br />
Nächstenliebe. In den Kranken- und Heilungsgeschichten Jesu wird deutlich, dass Heilung<br />
auch <strong>die</strong> soziale Integration einschließt. Kranke gehen geheilt in ihr Dorf zurück. Menschen<br />
helfen einem Kranken, Jesus zu erreichen, um geheilt zu werden. Gleichzeitig erregen seine<br />
Taten aber auch <strong>die</strong> Gemüter derer <strong>die</strong> zuschauen und nicht zuletzt <strong>die</strong> Autoritäten.<br />
Die Botschaft vom Reich Gottes zielt nicht allein auf den Glauben des Einzelnen, sondern<br />
will auch Gerechtigkeit <strong>für</strong> <strong>die</strong> Schwachen und Gedemütigten herstellen. Sie setzt also an<br />
der Veränderung des Zusammenlebens und der Verhältnisse an. Das frühe Christentum hat<br />
viele Menschen auch deshalb fasziniert, weil es alle Menschen als gleich betrachtete und<br />
keinen Unterschied zwischen ihnen machte (vgl. Gal 3,28ff.). Die frühen Gemeinden entwickelten<br />
ihr diakonisches Handeln und verstanden <strong>die</strong>s als eine Grundfunktion der Gemeinde.<br />
Diese Berufung zur Caritas prägt das kirchliche Selbstverständnis bis heute. Papst Benedikt<br />
XVI. schrieb <strong>die</strong>sbezüglich in seiner ersten Enzyklika „Deus caritas est“: „Die Kirche kann<br />
den Liebes<strong>die</strong>nst so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort.“ Nur mit der auch damit<br />
verbundenen Öffnung hin zu den Lebenssituationen der Menschen - letztlich einer diakonischen<br />
Orientierung – kann <strong>die</strong> Kirche ihre Kraft und <strong>die</strong> Aufgabe, Sauerteig in der Welt zu<br />
sein (vgl. 1 Kor 5,6 ff), erfüllen.<br />
3.3 Sozialraumorientierung von Kirche und ihrer Caritas als theologische Notwendigkeit<br />
Die Öffnung hin zu den Lebenssituationen bedeutet <strong>für</strong> <strong>die</strong> Kirche <strong>die</strong> Aufgabe und Herausforderung,<br />
sich auch in den Sozial- und damit Lebensräumen der Menschen zu engagieren<br />
und <strong>die</strong>se mitzugestalten. Denn ihre Berufung zur Caritas erstreckt sich nie nur auf <strong>die</strong> eigenen<br />
Gemeindemitglieder, sondern auf alle Menschen, <strong>die</strong> in einem Sozialraum zusammenleben.<br />
Die Reich-Gottes-Botschaft bedeutet deshalb gerade, sich auch <strong>für</strong> <strong>die</strong> benachteiligten<br />
Menschen im Lebensumfeld einzusetzen, Solidarität zu stiften und <strong>für</strong> gerechte Verhältnisse<br />
einzutreten. Die Aufgabe betrifft alle kirchlichen Akteure – vom einzelnen Gemeindemitglied<br />
über <strong>die</strong> gemeindlichen Gruppen, <strong>die</strong> kirchliche Schule und <strong>die</strong> caritativen Einrichtungen und<br />
Dienste.<br />
Vor <strong>die</strong>sem Hintergrund ist das sogenannte Community Organizing ein bemerkenswerter<br />
Ansatz. Denn hier bringen sich Kirchengemeinden oder auch Einrichtungen und Dienste der<br />
Caritas im Stadtteil zusammen mit zahlreichen anderen Akteuren ein, um miteinander an<br />
konkreten Problemfeldern, <strong>die</strong> es vor Ort gibt, zu arbeiten und Lösungen zu entwickeln.<br />
Der Deutsche <strong>Caritasverband</strong> hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, <strong>die</strong> sozialräumliche Ausrichtung<br />
seiner Arbeit zu stärken und auszubauen. Sozialraum meint hier sowohl den lebensweltlichen<br />
Bezug der Menschen als auch den geografischen Ort, an dem sie wohnen.<br />
Sozialraumorientierung umfasst eine weitreichende Veränderung der fachlichen Ausrichtung,<br />
<strong>die</strong> mit den Begriffen des Raumprinzips, der Regionalisierung, der "Geh-Struktur" (also der<br />
aufsuchenden Beratung), der Ressourcenorientierung und der Kooperation zwischen beruflichen<br />
und zivilgesellschaftlichen Kräften nur angedeutet werden kann. Sozialraumorientierung<br />
fordert auf, Ratsuchende nicht als isolierten Fall, sondern immer in ihren sozialen Bezügen<br />
zu sehen und Ressourcen <strong>für</strong> Veränderung zu aktivieren.<br />
In den Diözesan- und Ortscaritasverbänden sind in den letzten Jahren zahlreiche Ansätze<br />
der Sozialraumorientierung entwickelt und erprobt worden. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe,<br />
sie zu einem strukturgebenden Merkmal unserer Arbeit zusammenzuführen.<br />
Im Rahmen der Sozialraumorientierung stellt <strong>die</strong> Ausgestaltung der pastoralen Räume eine<br />
besondere Herausforderung, aber auch Chance dar. So setzen sich in den aktuellen Umbruchprozessen<br />
Gemeinden tatsächlich wieder stärker mit ihrem diakonischen Grundauftrag<br />
auseinander. Und <strong>die</strong> verbandliche Caritas hat <strong>die</strong> Möglichkeit, sich in der pastoralen Arbeit<br />
als kompetenter Partner zu profilieren. Gerade auch im Rahmen des Gesprächsprozesses<br />
der Deutschen Bischofskonferenz war <strong>die</strong>ses notwendige Zusammenwirken von gemeindlicher<br />
und verbandlicher Caritas beim kürzlich veranstalteten Forum in Hannover ein immer<br />
wieder genannter Punkt.<br />
7
In <strong>die</strong>sen Prozess bringen sich viele Caritasverbände und ihre Einrichtungen und Dienste ein<br />
– und doch bleibt da noch viel zu tun. Auf der Basis von Sozialraumanalysen können sie<br />
gemeinsam mit den dort lebenden Menschen <strong>die</strong> notwendigen Hilfen entwickeln. So können<br />
Netzwerke entstehen, wo Caritas<strong>die</strong>nste und Gemeinden mit ihren sozial-diakonischen Aufgaben<br />
und Zielen ineinandergreifen.<br />
4. Zukunftsfähigkeit von Kirche und ihrer Caritas<br />
4.1 Caritaszentren im Sozial- und Pastoralraum<br />
„Man muss sich vor Ort gut auskennen, um helfen zu können“, so heißt ein früher Leitsatz <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Caritaszentren im Sozial- und Pastoralraum wie sie hier im Diözesancaritasverband<br />
<strong>Mainz</strong> seit 2007 konzipiert werden. Die Caritaszentren stellen sich der Aufgabe, soziale<br />
Probleme benachteiligter, von Armut und Ausgrenzung bedrohter Menschen aktiv mit zu lösen.<br />
Sie analysieren und definieren <strong>die</strong> sozialen Problemstellungen, entwickeln konzeptionelle<br />
Lösungen und bringen <strong>die</strong>se in <strong>die</strong> gesellschaftliche und politische Diskussion<br />
sowie <strong>die</strong> darauf folgenden Entscheidungsprozesse ein. Gemeinsam gilt es, <strong>die</strong>se dann mit<br />
anderen umzusetzen. Caritaszenten im Sozial- und Pastoralraum arbeiten mit den Akteuren<br />
der Selbsthilfe, mit freiwillig sozial Engagierten und mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und<br />
Hauptamtlichen. Sie verwirklichen Geh- und Kommstrukturen, arbeiten interdisziplinär, nutzen<br />
<strong>die</strong> Methodenvielfalt problem-, ressourcen- und lösungsangemessen.<br />
Damit greifen <strong>die</strong> Caritaszentren viele Motive der Sozialraumorientierung auf: Denn <strong>die</strong>se<br />
kommt ohne <strong>die</strong> Zusammenarbeit von beruflichen und ehrenamtlich Engagierten nicht aus.<br />
Die Anforderung nach einer engen Kooperation und einer konzeptionellen Verankerung der<br />
Arbeit mit Ehrenamtlichen – und dazu zählt auch <strong>die</strong> Selbsthilfe – löst häufig noch immer<br />
Ängste aus.<br />
Die Erfahrung zeigt aber, dass <strong>die</strong> Verbindung und Integration von beruflicher und ehrenamtlicher<br />
Arbeit eine neue Qualität schafft. Denn Teilhabe realisiert sich erst in den alltäglichen<br />
Lebensbezügen der Menschen. Daher sind Ehrenamtliche keine Konkurrenz <strong>für</strong> das berufliche<br />
Hilfesystem. Vielmehr trägt <strong>die</strong> Einbindung in soziale Netzwerke durch Ehrenamtliche<br />
dazu bei, <strong>die</strong> in der beruflichen Beratung und Behandlung erreichten Veränderungen nachhaltig<br />
zu sichern.<br />
4.2 Zum Zusammenspiel von Pastoral- und Sozialraum<br />
Bislang habe ich weitgehend vom Sozialraum gesprochen, zunehmend gewinnt im kirchlichen<br />
Umfeld jedoch auch der Begriff des Pastoralraums an Bedeutung.<br />
Die Gründe <strong>für</strong> <strong>die</strong> Neuordnung und Schaffung von pastoralen Räumen in den <strong>Diözese</strong>n sind<br />
vielfältig. Sie reichen vom wachsenden Priestermangel, dem Rückgang der Zahl von Kirchenmitgliedern<br />
bis hin zu finanziellen Ursachen. Die Strukturbildung ist in den <strong>Diözese</strong>n<br />
zum Teil in <strong>die</strong> Entwicklung neuer Pastoralkonzeptionen bzw. Leitlinien auf Bistumsebene<br />
eingebunden. Die verbandliche Caritas ist nur teilweise an der Entwicklung <strong>die</strong>ser Pastoralkonzeptionen<br />
beteiligt.<br />
Die Schaffung eines neuen pastoralen Raums bedeutet <strong>für</strong> <strong>die</strong> Beteiligten und Betroffenen<br />
eine Umbruchsituation. Und es zeigt sich dabei, dass das diakonische Engagement der Pfarreien<br />
und der verbandlich organisierte caritative Dienst unterschiedlich stark ausgeprägt<br />
sind. Umgekehrt ist aber auch in der verbandlichen Caritas mancherorts bisher nur ein geringes<br />
Bewusstsein <strong>für</strong> <strong>die</strong> Herausforderungen und Chancen festzustellen, <strong>die</strong> sich durch <strong>die</strong><br />
pastoralen Räume ergeben. Ausgangspunkt der Gestaltung der neuen pastoralen Räume<br />
aber muss <strong>die</strong> Frage sein, wie <strong>die</strong> Kirche und ihre Caritas den Menschen nahe sein und<br />
Zeugnis von der Liebe Gottes geben kann.<br />
Bischof Franz Josef Bode hat in einem Beitrag der neuen Caritas (nc 03/2012) folgendes<br />
formuliert: „Den ersten Satz [der Pastoralkonstitution Gaudium et spes] kennt fast jeder:<br />
‚Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen<br />
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger<br />
Christi.‘ Den zweiten Satz halte ich <strong>für</strong> nicht weniger gewichtig: ‚Es gibt nichts wahrhaft<br />
Menschliches, das nicht in ihren Herzen (in den Herzen der Christen) seinen Widerhall fände.‘<br />
Wir sollen nicht nur den Resonanzboden bei den anderen suchen, dass unsere Botschaft<br />
dort Widerhall finde. Die Not der Menschen, ihre Fragen und ihre Sehnsüchte sollen<br />
8
Resonanz bei uns finden, in unseren Herzen. Das ist ein Perspektivwechsel […] Wenn <strong>die</strong><br />
Kirche sich finden will, muss sie zu den Menschen finden. Wenn <strong>die</strong> Kirche bei sich sein will,<br />
muss sie bei den Menschen sein. Deshalb ist es notwendig, dass wir insgesamt eine gemeinsame<br />
Perspektive <strong>für</strong> Pastoral und Caritas gewinnen.“<br />
Die neuen pastoralen Räume müssen als Netzwerke mit vielen Knotenpunkten verstanden<br />
werden. Solche Verdichtungspunkte sind heute nicht allein mehr <strong>die</strong> Kirchtürme, sondern<br />
Schulen, Kindertagesstätten, Bildungshäuser, Beratungsstellen und vieles mehr, wo Menschen<br />
zusammenkommen oder Hilfestellung erfahren. Zum Prinzip des großen und weiten<br />
Pastoralraums muss das Prinzip der Nähe und des konkreten Handelns kommen: Es geht<br />
um Nähe vor Ort oder wie es bei den Caritaszentren hieß: „Man muss sich vor Ort gut auskennen,<br />
um gut helfen zu können!“<br />
Auf der Basis der Erkenntnis, dass nicht der Kirchturm allein den Raum christlich macht,<br />
möchte ich noch auf einen Aspekt hinweisen. Auch hier zitiere ich noch einmal Bischof Franz<br />
Josef Bode, wenn er sagt: Eine „verengte Gemeindetheologie muss sich in <strong>die</strong>sem Sinn weiten<br />
im Zusammenspiel von Priestern und Laien, oder besser gesagt, im Zusammenspiel von<br />
Getauften, Gefirmten, Beauftragten, Gesendeten und Geweihten. So wird schneller deutlich,<br />
dass es eine ganze Fülle von Weisen gibt, am Auftrag der Kirche mitzuwirken. Und <strong>die</strong>ses<br />
gelingende Miteinander von Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Freiwilligen, von Männern<br />
und Frauen, von Einzelprofilierung und Kooperation, von Profession und Lebenskompetenz,<br />
von Vielheit und Einheit führt fast von selbst zum Lebensraum und zum Sozialraum der<br />
Menschen. Lebensraum meint mehr den persönlichen Kontext der Menschen, ihre Herkunft,<br />
Umgebung, ihren Horizont, das persönliche Milieu. Daran müssen wir pastoral wie karitativ<br />
interessiert sein. Sozialraum meint das größere Bezugssystem, das Netzwerk, in dem Menschen<br />
in einem größeren Zusammenhang stehen und zu dem der pastorale Raum immer<br />
eine Nähe und Verbindung hat.“<br />
Vor <strong>die</strong>sem Hintergrund will ich noch kurz das ökumenische Projekt „Kirche findet Stadt“ ansprechen.<br />
Dieses Projekt lotet bundesweit Möglichkeiten neuer Ansätze der Zusammenarbeit<br />
von katholischer und evangelischer Kirche und deren Caritas und Diakonie in themenund<br />
sektorübergreifenden lokalen Entwicklungspartnerschaften aus. Denn eine integrierte<br />
Stadtentwicklung bezieht alle relevanten Akteure, Handlungsebenen und -felder ein. Die innovative<br />
Herausforderung <strong>die</strong>ses Projekts liegt darin, dass unterschiedliche Akteure, <strong>die</strong> bereits<br />
vor Ort aktiv sind, Partnerschaften entwickeln. Bundesweit wurden über einen Aufruf<br />
Standorte identifiziert, an denen kirchliche Initiativen, Kirchengemeinden, kirchliche Träger<br />
sowie Caritas und Diakonie ihre Potenziale da<strong>für</strong> einbringen, dass sich lokale Partnerschaften<br />
in innovativer Weise an der Entwicklung ihrer Städte beteiligen. Es geht darum, nicht<br />
mehr nur einzelne Menschen oder Gruppen in den Fokus kirchlich-diakonischen Handelns<br />
zu stellen, sondern <strong>die</strong> Zukunftsfähigkeit ganzer Quartiere oder Städte zu betrachten. Die<br />
Vielfalt der Beispiele und deren Einbettung in Bundes- und Landesprogramme, aber auch in<br />
regionale und sozio-kulturelle Kontexte wie z.B. in den Bistums- und Landeskirchenstrukturen<br />
soll angemessene Berücksichtigung finden.<br />
Ich denke auch <strong>die</strong> Erfahrungen der Caritaszentren lassen sich in <strong>die</strong>sem Kontext identifizieren<br />
als Beitrag dazu, dass „Kirche Stadt findet“ und <strong>für</strong> Menschen in ihrem jeweiligen Lebensraum<br />
erlebbar wird.<br />
In <strong>die</strong>sem Sinne wünsche ich der Weiterentwicklung der Caritaszentren hier in der <strong>Diözese</strong><br />
<strong>Mainz</strong> ein gutes Gelingen: Zusammenkommen, Orte gestalten und Netze knüpfen – darin<br />
liegt <strong>die</strong> Zukunft von Kirche und ihrer Caritas und <strong>die</strong> aktuelle professionelle Herausforderung<br />
hochspezialisierter Dienste und unterschiedlicher Akteure, um ihrer zentralen Aufgabe<br />
gerecht zu werden: dem bedürftigen und in seiner Not unteilbaren Menschen.<br />
9
Prof. Dr. Stefan Bestmann: Sozialraumorientierung als zentrales Fachkonzept Sozialer<br />
Arbeit<br />
10
Cornelia Harloff: „Steuerung komplexer Prozesse in einem Team hoch spezialisierter<br />
Musiker – Ineinandergreifen von Einzel- und Gesamtleistung bei der<br />
Probenarbeit eines Orchesters“<br />
1. Präludium<br />
Ausbildung der Musiker:<br />
• Die Ausbildung beginnt in der Kindheit. Bei Streichern mit 5-7 Jahren, bei Bläsern etwas<br />
später.<br />
• Frühe Musiziererfahrung im Zusammenspiel (Kammermusik, Orchester in Musikschule<br />
oder Schule).<br />
• Teilnahme bei „Jugend Musiziert“, im Landes-und Bundesjugendorchester, Kammermusikkurse,<br />
Instrumentalkurse.<br />
• Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule, möglicherweise schon als Jungstudent (parallel<br />
zur Schule) oder im Precollege der Musikhochschulen (<strong>für</strong> Hochbegabte ab 9-10<br />
Jahre).<br />
• Die Fähigkeiten zu Beginn der Ausbildung/Studium sind bereits enorm hoch.<br />
• 10.000 Stunden geübt bis zum 16. Lebensjahr, spätestens Stu<strong>die</strong>nbeginn (vielfach Abi).<br />
‣ Bevor man Musiker wird, ist man schon Musiker!<br />
Recruiting:<br />
• Das Studium dauert ca. 5-7 Jahre. Die Stu<strong>die</strong>renden haben während des Studiums vielfache<br />
Möglichkeiten Ensemble-Erfahrung zu sammeln (Hochschulorchester, Kammermusik,<br />
Orchesterpraktikum).<br />
• Eine Orchesterstelle bekommt man durch erfolgreiches Bestehen eines Probespiels. Das<br />
gleicht einem Wettbewerb. Bei einer Tutti-Stelle (vergleichbare Position: Mitarbeiter) wird<br />
<strong>die</strong>/der Beste von u. U. 100 und mehr Bewerbern genommen.<br />
Solostellen (Führungspositionen) werden mit den Besten der Besten besetzt.<br />
• Probespiele werden vor dem gesamten Orchester, Chefdirigent, Orchesterdirektor veranstaltet.<br />
Alle Orchestermusiker haben Stimmrecht, ebenso bei Probedirigieren eines neuen<br />
Dirigenten.<br />
Die Berufsanfänger bringen über <strong>die</strong> eigene Fachkompetenz hinausgehend ein enormes<br />
Wissen und Erfahrung mit bezüglich Spielpraxis:<br />
• Auf einander hören, führen, folgen.<br />
• Klangvorstellungen und Aufführungspraxis. Hierüber muss im Grundsatz nicht<br />
mehr verhandelt werden. Bei der Probenarbeit wird nur noch an Feinheiten gefeilt.<br />
2. Das Orchester als Unternehmen<br />
Administration<br />
‣ Intendant/Orchesterdirektor<br />
‣ Verwaltung<br />
Planung, Verträge, Organisation, Finanzen,<br />
PR, Marketing etc.<br />
‣ Dramaturgie etc.<br />
Musiker/Künstler<br />
‣ Dirigent<br />
künstlerische Leitung/Chefdirigent<br />
Gast-Dirigenten, Solisten<br />
‣ Musiker<br />
Führungskräfte: Konzertmeister, Solobläser,<br />
Pauke, Vorspieler<br />
‣ Tutti: Streicher, Bläser<br />
Orchestervorstand: Interessenvertretung der<br />
Musiker gegenüber der Direktion/Intendanz<br />
3. Sitzordnung und Positionen<br />
• Streicher sitzen hintereinander zu zweit am Pult, alle spielen <strong>die</strong> gleiche Stimme/Noten.<br />
• Kleinstes Team ist das 2er-Pult, es entgeht dem Pultnachbar nichts (spieltechnisch, persönlich).<br />
20
• Nächst größere Teamgruppe ist <strong>die</strong> Stimmgruppe: 1. Violinen, 2. Violinen, Bratschen,<br />
Celli, Bässe.<br />
• Führungskräfte der Streicher sitzen am 1. Pult: Sie haben <strong>die</strong> Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
Gruppe und übernehmen Soloaufgaben in Orchesterwerken.<br />
• Junge Topleute sitzen als Führungskräfte ab dem 1. Tag an vorderster Front.<br />
‣Verantwortung durch Befähigung: D. h. <strong>die</strong> Position und <strong>die</strong> damit verbundene Aufgabe<br />
und Verantwortung haben sie durch Befähigung erlangt und nicht durch Länge der<br />
Zugehörigkeit.<br />
• Im Tutti gilt das Rotationsprinzip: Die Sitzordnung rotiert, d.h. <strong>die</strong> Musiker haben immer<br />
wiederandere Pultnachbarn. Das fördert Flexibilität und fordert <strong>die</strong> Bereitschaft, sich immer<br />
wieder einzulassen auf andere Kollegen und deren Herangehensweise und Körpersprache.<br />
• Die Bläser sitzen nebeneinander. Die Stimme ist i. d. Regel einzeln besetzt. Jeder Bläser<br />
hat daher sein eigenes Pult. Bei sehr großer Orchesterbesetzung werden Bläserstimmen<br />
verdoppelt.<br />
• Führungskräfte sind, wie bei den Streichern, top ausgebildete hochmotivierte Spitzenkräfte,<br />
Individualitäten, <strong>für</strong> <strong>die</strong> es eine Herausforderung bedeutet, in einem Orchester und<br />
dann noch unter einem Dirigent zu spielen.<br />
• Die Aufgabenbereiche der Musiker sind strikt voneinander abgegrenzt: der Posaunist<br />
kann nicht den Trompetenpart, <strong>die</strong> Solo-Oboe nicht <strong>die</strong> Piccoloflöte oder der Bratscher<br />
mal eben <strong>die</strong> 2. Geige übernehmen.<br />
• Jeder Musiker, ob Solo oder Tutti, ist <strong>für</strong> seinen Part, und das Beherrschen seiner Noten<br />
selbst verantwortlich.<br />
• Über eine Diensteinteilung ist organisiert, wer bei welchem Projekt/ Konzert/Oper spielt.<br />
Es besteht je nach Programm und Besetzung <strong>die</strong> Möglichkeit, Wünsche bez. der Einteilung<br />
zu äußern.<br />
‣ Position nach Leistung, nicht nach Zugehörigkeit!<br />
‣ Strikt voneinander abgegrenzte Aufgabenbereiche ‣Hochspezialistentum.<br />
‣ Jeder ist <strong>für</strong> seine Leistung selbst verantwortlich.<br />
‣ Rotationprinzip erfordert und trainiert Flexibilität.<br />
‣ Der Dienstplan regelt, wer wann und mit wem spielt - Wünsche sind bedingt<br />
möglich.<br />
4. Arbeitssituation<br />
• Es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Milieus in den Instrumentengruppen: Z. B. Streicher-Blechbläser<br />
• In den Orchestern trifft eine Vielfalt an Personen und unterschiedlichen Nationalitäten<br />
zusammen.<br />
• Viele Menschen (bis zu 100 und mehr) arbeiten auf engstem Raum zusammen besonders<br />
in kleinen Opernhäusern. Die permanente Nähe bedingt, dass man ständig auf dem Präsentierteller<br />
ist. Persönliche Unpässlichkeiten lassen sich kaum verbergen.<br />
• Die Säulen gemeinsamen Musizierens sind Blickkontakt und aufeinander Hören. Das bedeutet<br />
gleichzeitig, es entgeht den Kollegen nichts. Auch zwischenmenschliche Themen<br />
liegen schnell offen.<br />
• Es gibt keinen Raum zum ausleben persönlicher Bedürfnisse und Vorlieben, kein Rückzug<br />
an den eigenen Schreibtisch oder gar ins eigene Büro: Alles wird im Kollektiv erlebt<br />
und „erlitten“.<br />
• Die Folge ist: Man respektiert sich, spielt gut miteinander, auch wenn man gelegentlich<br />
nicht viel miteinander zu tun hat und sich persönlich vielleicht nicht einmal besonders<br />
sympathisch ist. ‣Gerade dann gibt man sich ungern eine Blöße und versucht erst recht<br />
gut zu spielen.<br />
21
• Freiheit besteht außerhalb des Orchesters: Individuelle Vernetzung und Zusammenschluss<br />
findet in kleineren Kammermusikformationen statt, in denen man sich dann künstlerisch<br />
selbstbestimmt verwirklichen kann.<br />
‣ Ausgeprägtes Selbstverständnis der einzelnen Instrumentengruppen, klare Abgrenzung<br />
gegenüber anderen Instrumentengruppen.<br />
‣ Einheit aus Vielfalt: Gegensätze hindern ein 100-Personen (und mehr) Orchester<br />
nicht<br />
‣ daran, das Konzert im gemeinsamen Geiste zu bestreiten.<br />
‣ Alle Musiker/Projektbeteiligten sind zu gleicher Zeit am gleichen Ort<br />
‣ und erarbeiten zeitgleich <strong>die</strong> Musik.<br />
‣ Orchesterspiel ist eine kontinuierliche gruppendynamische Herausforderung.<br />
‣ Respekt geht vor Sympathie.<br />
‣ „Sinfonische Kontinuität bleibt trotz aller natürlichen Divergenzen gewahrt –<br />
‣ das übergeordnete Ergebnis ist Endzweck.<br />
‣ „Selbstverwirklichung“ auf Basis von Eigeninitiative außerhalb der Orchesterarbeit.<br />
5. Probenarbeit<br />
• 2-3 Werke stehen i. d. Regel auf dem Programm eines Sinfoniekonzertes.<br />
• Meistens sind 4 (max. 5, eher selten) Proben a 3 Stunden angesetzt, um das Konzertprogramm<br />
zu erarbeiten. Die erste Probe ist 4-5 Tage vor dem Konzert. Die Generalprobe ist<br />
i. d. Regel am Vortag oder noch am Vormittag des Konzerttages. Bei Opern ist <strong>die</strong> Einstu<strong>die</strong>rungsphase<br />
länger.<br />
• Alle müssen jede Konzertprobe machen, Beurlaubungen <strong>für</strong> eine Probe sind nicht möglich.<br />
Wenn jemand krank wird, wird eine Aushilfe engagiert.<br />
• Die Musiker bereiten sich individuell vor und üben schwierige Passagen.<br />
‣ Kurze Projektlaufzeiten erfordern hoch konzentriertes Arbeiten, keiner kann<br />
fehlen.<br />
‣ Musiker kommen vorbereitet, jeder kennt/beherrscht seinen Part/Noten.<br />
Arbeits-und Abstimmungsprozesse:<br />
• Schreibarbeit (Noten einrichten), sich abstimmen, koordinieren der musikalischen Abläufe<br />
innerhalb der Instrumentengruppe und von Gruppe zu Gruppe im gesamten Orchester.<br />
• Das Einrichten der „Striche“ bei den Streichern ist Aufgabe der Führungskraft (Abteilungsleiter).<br />
• Bei der technisch- instrumentalen Umsetzung wird Balance hergestellt zwischen kreativer<br />
Innovationsfähigkeit junger Spitzenkräfte und der Erfahrung älterer KollegInnen. D. h. bei<br />
besonderen musikalischen Anforderungen wird das bestmöglichste Klangergebnis gesucht<br />
unter Einbeziehung kreativer Ansätze der jungen Spitzenkräfte und Erfahrungswerten<br />
älterer Kollegen. Das Ergebnis wird jeweils durch direktes klangliches Feedback sofort<br />
hörbar und so lange optimiert, bis der Dirigent zufrieden ist.<br />
• Ändern der Umsetzungsstrategie (Spieltechnik, andere Striche etc.) bei den Führungskräften<br />
bedeutet nicht gleichzeitig Autoritätsverlust.<br />
• Die einzelnen Tutti- Musiker haben innerhalb ihres sehr klar umrissenen und abgegrenzten<br />
Aufgabenfeldes wenig individuelle Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten. Es besteht<br />
jedoch höchster Anspruch an ihre abgelieferte Leistung und <strong>die</strong> Präzision.<br />
• Jede Anweisung, Äußerung, Kritik oder jeder Verbesserungsvorschlag des Dirigenten<br />
(verbal und nonverbal) findet vor dem gesamten Orchester statt.<br />
‣Direkteres Feedback als in Probenarbeit gibt es nicht!<br />
‣ Vielschichtige Abstimmungsprozesse während der Probenarbeit.<br />
‣ Synchrone Exaktheit in den Stimmgruppen und zwischen allen Musikern (mechanische<br />
Uhr).<br />
22
‣ Umsetzungstechniken sind nicht Kompromisse auf kleinstem gemeinsamen<br />
Nenner, sondern<br />
‣ <strong>die</strong> Balance zwischen erstklassiger individueller Lösung und Übertragbarkeit<br />
auf das gesamte Team.<br />
‣ Autorität bleibt erhalten auch bei Strategiewechsel der Führungskraft.<br />
‣ Der einzelne Musiker hat ein sehr abgegrenztes Aufgabenfeld. Innerhalb dessen<br />
besteht wenig Freiheit aber höchster Anspruch an Top Leistung und Präzision.<br />
‣ Feedback ist <strong>für</strong> alle hörbar und transparent.<br />
Abteilungsübergreifende Lösungen:<br />
• Ein musikalisch homogenes Konzept zu bauen, erfordert von jedem ein enormes Maß an<br />
Flexibilität.<br />
• Tempi und Striche, von den „Abteilungsleitern“ ausgetüftelt, müssen auch <strong>für</strong> andere Abteilungen/Instrumentengruppen<br />
(z. B. Geigen- Celli) passen.<br />
• Musikalische Themen und Motive wandern durch <strong>die</strong> einzelnen Stimmen. Das bedeutet,<br />
<strong>die</strong> Musiker müssen über den eigenen Tellerrand gucken. Eine ideale Umsetzung <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />
eine Instrumentengruppe heißt noch nicht, dass es auch <strong>für</strong> alle anderen funktioniert. Es<br />
kann u.U. <strong>für</strong> eine andere Gruppe kaum realisierbar sein. Daher müssen Lösungen gefunden<br />
werden, <strong>die</strong> <strong>für</strong> alle machbar sind.<br />
‣ Die Basis der Orchester-Arbeit ist permanentes sich abstimmen der Führungskräfte<br />
untereinander (letztlich aller Beteiligten). Das funktioniert über Blickkontakt<br />
und hören.<br />
‣ Abteilungsübergreifendes Bewusstsein aller Beteiligten: Aufeinander hören<br />
miteinander handeln.<br />
‣ Lösungsstrategien sind nur dann erfolgreich, wenn sie im Hinblick auf das gemeinsame<br />
Endprodukt abteilungsübergreifend kompatibel sind.<br />
‣ Tragfähige Lösungen entstehen auf Grund permanenter kollektiver Interaktion<br />
über alle Interessen hinweg (Musiker haben <strong>die</strong>se Haltung fast unbewusst verinnerlicht).<br />
Leistung versus Konsens & Mitspracherecht:<br />
• Üblicherweise muss der Dirigent in 4 Proben a 3 Stunden und Generalprobe sein künstlerisches<br />
Konzept erarbeiten. Es gibt keine Zeit <strong>für</strong> debattieren des „Für und Wider“. Die<br />
motivierten Topleute würden bei langwierigen Proben-und Abstimmungsprozessen weglaufen.<br />
Mitsprache muss Grenzen haben.<br />
• Die Idee des Dirigenten ist verbindlich <strong>für</strong> alle, es gibt keine Diskussion über andere Interpretationsansätze,<br />
Tempi etc.<br />
‣ Die Vision des Dirigenten ist verbindlich <strong>für</strong> alle, er hat wenig Zeit um Zielvorstellung<br />
zu verwirklichen daher muss er Leistung einfordern.<br />
‣ Das „orchestrale Modell“: Einheit durch Zulassen von Vielfalt und nicht auf<br />
Grund eines statisch festgelegten Konsensmodells.<br />
Teamarbeit als Wechselspiel der Kräfte:<br />
• Es gibt Soli der Spitzenkräfte, <strong>die</strong> den gesamten orchestralen Klangkörper dominieren<br />
und den Rest des Orchesters in den Hintergrund und zur Begleitung zwingen. Das bedeutet<br />
aber nicht Abwertung derjenigen Musiker, <strong>die</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> Zeit des Solos zurücktreten müssen,<br />
oder weil <strong>die</strong> Partitur <strong>für</strong> ihr Instrument/ Stimme gerade eine Pause vorsieht.<br />
Bsp.: Die Pauke hat Pause. Pause heißt nicht abschalten oder „Pause machen“, oder gar<br />
sich unnütz fühlen, weil „keine Aufgabe“ da ist im Sinne „ich werde ja nicht gebraucht“. Es<br />
bedeutet vielmehr aktiv zuhören um dann, wenn der Einsatz kommt, ganz in der Musik zu<br />
sein, den Einsatz im Geiste der sich gerade klanglich vollziehenden Musik zu bringen.<br />
• Die Basis des gemeinsamen Musizierens ist ein kontinuierliches Aufeinander Hören und<br />
Reagieren, ohne welches ein funktionierendes Zusammenspiel undenkbar ist:<br />
‣ Ein Zustand der Offenheit und Durchlässigkeit!<br />
23
‣ Ein, über das eigene Tun hinausgehendes Wach-Sein (bei Musikern fast ein Automatismus),<br />
der dem Musiker signalisiert, auf welcher Position, in welcher Rolle er sich im<br />
orchestralen Gewebe gerade befindet (wer spielt gerade mit wem, wer hat ein Solo,<br />
wer übernimmt es etc.).<br />
• Führungskräfte haben nicht nur Verantwortung, sie prägen den Stil und Klang eines Orchesters.<br />
• Durch spontane künstlerische Äußerungen gerät <strong>die</strong> erarbeitete Struktur u.U. ein wenig<br />
aus der Balance. Aufgrund eines „wachen Miteinanders“ reagieren Dirigent und Musiker<br />
sofort auf kleinste Veränderungen und greifen <strong>die</strong>se unmittelbar auf.<br />
• Basis <strong>für</strong> <strong>die</strong>ses wache Miteinander ist ein ständiges Aufnehmen und Reagieren auf auditive<br />
und körpersprachliche Impulse<br />
‣ Dominanz durch Kompetenz, dem Solisten Raum geben.<br />
‣ Vom Ich zum Wir – Gefühl - Solo und Pausen eingebettet in <strong>die</strong> symphonische<br />
Ganzheit.<br />
‣ Orchestrales Bewusstsein: Bei Musikern stehen alle Sensoren gleichzeitig auf<br />
empfangen und senden.<br />
‣ Alles ist Interaktion, erst dadurch wird das Wechselspiel der Kräfte möglich.<br />
Was macht der Dirigent?<br />
• Der Dirigent hat <strong>die</strong> Führung/ Macht. Die Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Umsetzung liegt beim einzelnen<br />
Musiker<br />
Bsp. Einsatz: Wenn der Dirigent vergisst den Einsatz zu geben, fällt es nicht weiter auf.<br />
Wenn der Musiker den Einsatz verpasst ist es sofort hörbar.<br />
• Unterschiedliche Führungsstile bei den Dirigenten. Die Musiker müssen sich jedes Mal<br />
neu einlassen.<br />
(Z. B. Claudio Abado: Er „dirigiert“ nicht, sondern erwartet von den Musikern, dass sie ihn<br />
inspirieren.)<br />
• Bei der Vorbereitung, dringt der Dirigent tief ein in <strong>die</strong> Partitur, in <strong>die</strong> Gedanken- und Emotionswelten<br />
des Komponisten.<br />
• Der Dirigent gibt <strong>die</strong> große Linie vor. Seine Vision/Interpretation, steht nicht in den Noten.<br />
(„Das wichtigste der Musik steht überhaupt nicht in den Noten.“)<br />
• Er hat als Einziger das Gesamte als Partitur vorliegen und im Blick. Er hat <strong>die</strong> gesamte<br />
Musik im seinem Kopf. Die Musiker haben nur mehr oder weniger Teilperspektiven.<br />
• Der Dirigent sieht/weiß wie <strong>die</strong> einzelnen Instrumenten-Gruppen/Stimmen ineinander greifen<br />
sollen.<br />
• Er ist <strong>die</strong> ordnende Hand, <strong>die</strong> <strong>die</strong> orchestrale Balance herstellt, harmonisiert und den Gesamtklang<br />
gemäß seiner Klangvision mischt.<br />
Z. B.: Das Blech kann <strong>die</strong> Streicher bis zur Unhörbarkeit übertönen. Der Zuhörer würde<br />
hilflose Streicher erleben, <strong>die</strong> versuchen, gegen <strong>die</strong> alles niederschmetternden Blechbläserkollegen<br />
anzuspielen.<br />
• Der Dirigent ist bemüht, jeden Musiker <strong>für</strong> seine Sache zu gewinnen, seine Vision des<br />
Werkes zu vermitteln. Z. B.: Wie würde eine Beethovensymphonie klingen, wenn jeder<br />
Musiker seine eigene Vision des Stückes umsetzen würde? Ein Gewirr von unterschiedlichen<br />
Interpretationen, Stilen, Techniken, Klangfarben ohne erkennbare innere Struktur<br />
und äußere Architektur würde entstehen.<br />
(Mona Lisa von 100 verschiedenen Malern gemalt.)<br />
• Die innere Struktur macht eine übergeordnete Vision erst erlebbar. (Das gleichzeitige Nebeneinander<br />
unterschiedlichster Konzepte überfordert das menschliche Wahrnehmungsvermögen.)<br />
• Der Dirigent motiviert, fördert und fordert, er vertraut den Musikern, hat an sich selbst den<br />
Anspruch, das Beste aus dem Orchester rauszuholen.<br />
• Er lässt Freiheiten zu, <strong>die</strong> im Geiste der Musik sind, gibt Freiräume <strong>für</strong> <strong>die</strong> Solostimmen<br />
im Orchester. Auf <strong>die</strong> Solostimmen muss der Dirigent eingehen sonst verlieren <strong>die</strong>se Musiker<br />
ihre Motivation.<br />
• Er lässt <strong>die</strong> Musiker „kommen“. Das bedeutet, es gibt Momente, in denen er nicht dirigiert,<br />
um im entscheidenden Moment wieder einzugreifen. Er ist offen <strong>für</strong> Anregungen seiner<br />
24
„Mitarbeiter“ (musikalische Impulse), greift <strong>die</strong>se auf und reagiert/integriert sie in sein musikalisches<br />
Konzept.<br />
‣ Der Dirigent hat <strong>die</strong> Macht. Die Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Umsetzung liegt beim<br />
einzelnen Musiker.<br />
‣ Der Anspruch sich künstlerisch zu offenbaren bildet das Fundament der Arbeit<br />
des Dirigenten.<br />
‣ Er richtet das komplexe Wechselspiel aller Kräfte auf ein gemeinsames Ziel<br />
aus.<br />
Die Voraussetzung da<strong>für</strong> ist: Der Dirigent vermittelt seine klare Vision. Sie<br />
muss sich deutlich offenbaren, motivieren und begeistern, Emotionen wecken.Der<br />
Dirigent muss den Solostimmen ihren nötigen Freiraum geben, sonst<br />
gibt es Frustration bei ihnen.<br />
‣ Der Dirigent integriert <strong>die</strong> Ressourcen und Möglichkeiten der Musiker (Mitarbeiter).<br />
6. Konzert<br />
• Die Musiker möchten ihr Bestes geben, streben intrinsisch ihr höchstes Ideal an.<br />
Das heißt, jeder fühlt sich <strong>für</strong> das Gelingen des Gesamten verantwortlich.<br />
• Im Konzert entsteht kreative Spannung durch Unvorhersehbares. Es gibt eine künstlerische<br />
Freiheit des Dirigenten jenseits getroffener Absprachen bei den Proben.<br />
• Kleine Tempoverschiebungen beim Dirigent und Freiheiten der Solostimmen geben dem<br />
Konzert das Originäre, Einmalige. Voraussetzung da<strong>für</strong> ist: Flexibilität, auf einander hören<br />
und schnelles Reagieren.<br />
• Es gibt nur eine einzige Chance, nichts kann nachträglich korrigiert werden. Die da<strong>für</strong><br />
erforderliche Schlüsselqualifikation bei den Musiker ist: Im entscheidenden Moment<br />
höchstes Leistungspotenzial abrufen zu können.<br />
• Der Dirigent muss sich auf <strong>die</strong> Solostimmen verlassen können, dass sie sein Konzept<br />
nicht unterlaufen. Im Konzert kann er letztlich nichts dagegen tun, wenn <strong>die</strong> Solostimme<br />
plötzlich ein anderes Tempo nimmt, als in der Probe abgesprochen war.<br />
• Alle reagieren in Bruchteilen von Sekunden aufeinander durch zuhören und Blickkontakt.<br />
• Das Life Erlebnis, ein gelungenes Konzert ist <strong>die</strong> Durchdringung, Bündelung und Steigerung<br />
aller Kräfte.<br />
‣Das Konzerterlebnis ist mehr als ein Einzelner schaffen kann.<br />
(Die Energie und Ordnung, <strong>die</strong> sich durch Interaktion von einzelnen Teilen in komplexen<br />
Systemen einstellt, ist größer als <strong>die</strong> Summe ihrer Teile: Energie wird freigesetzt statt verbraucht.)<br />
• Musiker haben durchschnittlich mehr Glückserlebnisse als andere Menschen<br />
‣ Vollkommenheit ist das Ziel!<br />
‣ Die Identifikation jedes Einzelnen mit dem Ganzen ist extrem hoch.<br />
‣ Überraschungen und unvorhergesehene Entwicklungen machen das Konzert<br />
spannend, lebendig und einmalig.<br />
‣ Allein das Konzert zählt: Das Orchester als schonungslose Leistungsgesellschaft.<br />
‣ Interdependenz: Dirigent und Musiker sind aufeinander angewiesen.<br />
‣ Interaktion und schnelles Reaktionsvermögen ist <strong>die</strong> Voraussetzung <strong>für</strong> das<br />
Gelingen.<br />
‣ Gelungene Konzerte/Aufführungen setzen Glücksgefühle und Flow-Erlebnisse<br />
frei.<br />
Voraussetzungen:<br />
• Nur <strong>die</strong> permanente Bereitschaft zur Veränderung schafft Kontinuität: Akustische Parameter<br />
(Saal unbesetzt bei Anspielprobe, besetzt im Konzert) Pultnachbarn, Dirigent, abwechselnde<br />
Solisten bei Solokonzerten. Immer neue Umstände verlangen neue Strategien<br />
der künstlerischen und klanglichen Umsetzung.<br />
• Harmonie und Einheit durch Zulassen von Vielfalt: Viele Stimmen (Menschen) ein Ziel.<br />
• Orchestrales Musizieren ist permanente Interaktion, das ergibt <strong>die</strong> sinfonische Kontinuität.<br />
25
• Basis des gemeinsamen Musizierens ist unentwegtes auf einander hören.<br />
• Die Musiker stellen sich in den Dienst einer übergeordneten Sache. Diese <strong>die</strong>nt auch ihrem<br />
individuellen Erfolg.<br />
• Die künstlerische Freiheit des einzelnen Musikers ist kein Selbstzweck. Eine einzelne<br />
Solostimme bringt ihre persönliche Note immer im Kontext einer stetigen Entwicklung ein,<br />
<strong>die</strong> vorher begonnen hat und danach weitergeht.<br />
• Individuelle Leistung gilt als ein Baustein im Gefüge des gesamten Werkes, auf der Basis<br />
gegenseitigen Vertrauens zwischen Musiker und Dirigent.<br />
• Ein vielschichtiges Gefüge aus unterschiedlichen Qualitäten, <strong>die</strong> miteinander in Beziehung<br />
treten, bildet aus vielen Stimmen einen Gesamtklang, in den sich alle Beteiligten<br />
entsprechend einbringen und darin wieder finden.<br />
‣ Change ist Alltagskultur: Kontinuität durch Wandel.<br />
‣ Freie Entfaltung kann nur im Bewusstsein <strong>für</strong> das Ganze gesehen werden.<br />
‣ Alle treten mit jedem und gleichzeitig in Kommunikation und Interaktion.<br />
‣ Individuelle Leistung auf der Basis gegenseitigen Vertrauens<br />
‣ Einheit aufgrund individueller Vielfalt<br />
Zusammenfassung des Vortrages unter den folgenden Aspekten:<br />
Möglichkeiten der individuellen Steuerung<br />
• Abgegrenztes Aufgabenfeld innerhalb dessen wenig Freiheit, aber höchster Anspruch an<br />
Top Leistung und Präzision (Chirurg Herz- OP).<br />
• Grundlage <strong>für</strong> Umsetzungstechniken ist <strong>die</strong> Balance zwischen erstklassiger individueller<br />
Lösung und einer, <strong>die</strong> auch übertragbar ist auf das gesamte Team<br />
• Musiker und Dirigent sind aufeinander angewiesen<br />
• Dirigent Integriert Ressourcen und Möglichkeiten seiner „Mitarbeiter“<br />
• Auf der Basis gegenseitigen Vertrauens zwischen Musiker und Dirigent ist <strong>die</strong> Individuelle<br />
Leistung ein Baustein im Gefüge des gesamten Werkes<br />
• Change ist Alltagskultur. Überraschungen und unvorhergesehene Entwicklungen machen<br />
das Konzert spannend, lebendig und einmalig<br />
• Freie Entfaltung (Solist) kann nur im Bewusstsein <strong>für</strong> das Ganze geschehen. Eine einzelne<br />
Solostimme bringt ihre persönliche Note immer im Kontext einer stetigen Entwicklung<br />
ein, <strong>die</strong> vorher begonnen hat und nach ihm weitergeht<br />
Vernetzung und wechselseitige Einflussnahme<br />
• Individuelles Musizieren in frei gewählter Formation außerhalb der Orchesterarbeit und<br />
des Arbeitsvertrages.<br />
• Ausgeprägtes Selbstverständnis einzelner Instrumentengruppen, klare Abgrenzung gegenüber<br />
anderen Instrumentengruppen.<br />
• Abteilungsübergreifendes Bewusstsein aller Beteiligten: aufeinander hören miteinander<br />
handeln.<br />
• Das Bewusstsein: Lösungsstrategien sind nur dann erfolgreich, wenn sie im Hinblick auf<br />
ein gemeinsames Endprodukt abteilungsübergreifend kompatibel sind.<br />
• Tragfähige Lösungen entstehen auf Grund permanenter kollektiver Interaktion über alle<br />
Interessen hinweg - Musiker haben <strong>die</strong>se Haltung fast unbewusst verinnerlicht.<br />
• Das „orchestrale Modell“: Einheit aufgrund individueller Vielfalt!<br />
Kooperation und Kommunikation<br />
• Gegensätze hindern nicht daran, das Konzert im gemeinsamen Geist zu bestreiten.<br />
• Respekt vor Sympathie „Sinfonische Kontinuität bleibt trotz aller natürlichen Divergenzen<br />
gewahrt - Das übergeordnete Ergebnis ist Endzweck.<br />
• Kurze Projektlaufzeiten erfordern hoch konzentriertes Arbeiten, keine Zeit <strong>für</strong> langwierige<br />
Abstimmungsprozesse und Konsensfindung.<br />
• Alle Musiker sind zu gleicher Zeit am gleichen Ort und treten zur gleichen Zeit miteinander<br />
in Kommunikation.<br />
26
• Die Basis der Orchesterarbeit: Ein ständiges sich abstimmen der Führungskräfte/Vorspieler<br />
(aller Beteiligten) untereinander.<br />
• Alle Kommunikations- und vielschichtigen Abstimmungsprozesse liegen offen.<br />
• Feedback ist unmittelbar, direkt und „coram publicum“.<br />
• „Orchestrales Bewusstsein“: Alle Sensoren stehen gleichzeitig auf Empfang und Senden.<br />
• Alles ist Interaktion, dadurch erst wird das Wechselspiel der Kräfte möglich.<br />
Führung, Verantwortung , Motivation<br />
• Der Dirigent hat <strong>die</strong> Macht – <strong>die</strong> Verantwortung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Umsetzung liegt beim einzelnen<br />
Musiker.<br />
• Der Dirigent vermittelt seine Vision. Sie muss sich deutlich und klar offenbaren, motivieren<br />
und begeistern, Emotionen wecken.<br />
• Der Dirigent bündelt und richtet das komplexe Wechselspiel aller Kräfte auf ein gemeinsames<br />
Ziel aus. Er fordert primär Leistung.<br />
• (Führungs-) Position nach Leistung, nicht nach Zugehörigkeit.<br />
• Jeder ist <strong>für</strong> seine Leistung selbst verantwortlich und kommt vorbereitet in <strong>die</strong> Probe,<br />
kennt/beherrscht seinen Part.<br />
• Die Musiker stellen sich in den Dienst einer übergeordneten Sache, <strong>die</strong> auch ihrem individuellen<br />
Erfolg <strong>die</strong>nt.<br />
• Allein das Konzert zählt: Das Orchester als schonungslose Leistungsgesellschaft<br />
• Vollkommenheit ist das Ziel.<br />
• Das Konzerterlebnis ist mehr als ein Einzelner schaffen kann, ist größer als <strong>die</strong> Summe<br />
seiner Teile (Musiker. Das setzt Energie frei, motiviert.<br />
• Gelungene Aufführungen vermitteln Glücksgefühle/ Flow-Erlebnisse.<br />
27
Erkenntnisse aus den Workshops<br />
Workshop 1: Sozialraumorientierung als zentrales Fachkonzept Sozialer Arbeit<br />
Ausgehend von den am Vormittag gehörten Inhalten, insbesondere Bezug nehmen auf den<br />
Beitrag von Prof. Bestmann „Sozialraumorientierung als zentrales Fachkonzept sozialer Arbeit“,<br />
entwickelte sich ein lebendiger fachlicher Erfahrungsaustausch. Diskutiert wurde dabei<br />
besonders <strong>die</strong> Bedeutung <strong>für</strong> <strong>die</strong> eigene tägliche Arbeit, <strong>die</strong> Möglichkeiten und Heraus- forderungen<br />
in der Umsetzung:<br />
Zentrale Aussagen der Diskussion waren:<br />
o Die Auftragsklärung (mit den Kostenträgern/Auftraggebern) zu Beginn des Projektes ist<br />
sehr wichtig, weil hier <strong>die</strong> Grundlagen vereinbart werden. Im Dialog können <strong>die</strong> Prinzipien<br />
der Sozialraumorientierung dargestellt und vermittelt werden.<br />
o Sozialraumorientierung bringt einen Paradigmenwechsel auf der Handlungsebene mit<br />
sich.<br />
o Die Pflege der Vernetzungsstrukturen braucht Zeit – Beziehungsarbeit ist Teil professioneller<br />
Sozialarbeit.<br />
o Entsäulung der einzelnen Fach<strong>die</strong>nste und stärkere Vernetzung bedeutet nicht Entfachlichung,<br />
sondern das Vernetzen von spezialisiertem Fachwissen und <strong>die</strong> Organisation von<br />
Schnittstellen.<br />
o Welcher Begriff beschreibt <strong>die</strong> Menschen, <strong>die</strong> in <strong>die</strong> Caritaszentren kommen, <strong>die</strong> in der<br />
Sozialraumorientierung „Nutzer“ sind? (Nutzer, Klienten, Bewohner….) Begriffe drücken<br />
immer auch <strong>die</strong> Haltung zu den Menschen, <strong>die</strong> zu uns kommen, aus.<br />
o Das Erstellen von Qualitätsbeschreibungen sozialräumlicher Arbeit entfaltet Wirkung:<br />
- nach außen<br />
- nach innen (Vergewisserung des sozialarbeiterischen Selbstbild)<br />
o Die Adressaten haben Elemente der Lösung in sich.<br />
o Caritas braucht den Mut, gute Ideen zu erklären, z. B. gegenüber der Kommune.<br />
o Sozialraumorientierung stellt den Mensch in den Mittelpunkt.<br />
Als Stolpersteine wurden benannt:<br />
o Mitarbeiter/innen erleben einen aufreibenden Spagat zwischen dem Konzept der Sozialraumorientierung<br />
und den Förderungs-/Finanzierungsverträgen<br />
o Die Ausbildungsorganisation ist bisher nicht auf das Konzept der Sozialraumorientierung<br />
ausgerichtet.<br />
o Die „Vision des Dirigenten“ macht den Unterschied.<br />
o „Verbetriebswirtschaftlichung“ sozialer Arbeit macht konzeptionelles Arbeiten schwierig,<br />
Zeiten <strong>für</strong> fallübergreifendes Arbeiten sind in den Finanzierungen meist nicht vorgesehen.<br />
o Wer erschließt eigentlich den Sozialraum? (Konkurrenzen)<br />
o Verschiebebahnhof bei der Einzelberatung<br />
o Konkurrenzkampf: Wer ist wichtiger?<br />
o Wie kann <strong>die</strong> Qualität der Sozialraumorientierung beschrieben werden? Welche Instrumentarien<br />
stehen zur Verfügung?<br />
o Unterschiedliche Kulturen der unterschiedlichen Akteure z. B. CV und Gemeinden<br />
In der Arbeit des Workshops wurde deutlich, dass es insgesamt in der sozialen Arbeit Nachholbedarf<br />
der Selbstreflektion gibt, <strong>die</strong> gerade in der Auseinandersetzung mit Konzepten wie<br />
der Sozialraumorientierung deutlich werden.<br />
Wir müssen lernen mit Unsicherheit zu leben! Unsicherheit prägt viele Bereiche unserer<br />
Lebenswelt - und das ist in der sozialen Arbeit nicht anders.<br />
28
Workshop 2: Caritaszentren als soziale Systeme verstehen und steuern<br />
Die Referenten demonstrieren <strong>die</strong> Funktionsweise eines Orchesters und <strong>die</strong> Rollen von Dirigent,<br />
Stimmführer und Musikern indem sie mit den Teilnehmern eine kleine Performance mit<br />
rhythmischen Instrumenten einüben. Sobald <strong>die</strong> Teilnehmer <strong>die</strong> Handhabung und ihre Aufgaben<br />
erlernt haben, werden einerseits Rhythmusänderungen vorgenommen und andererseits<br />
übernehmen <strong>die</strong> Teilnehmer andere Rollen, z.B. auch <strong>die</strong> Dirigentenrolle. Dabei werden<br />
Kommunikationselemente und auch Wechselwirkungen zwischen den einzelnen „Instrumentengruppen“<br />
und Dirigenten erfahrbar.<br />
Hier einige Teilnehmer-Rückmeldungen:<br />
• Der Workshop war eine erfrischende Form der Auseinandersetzung mit Systemen, der <strong>die</strong><br />
Komplexität des Zusammenspiels einer Leitungsperson/Dirigent, Fachbereichsleitung/1.Stimme<br />
und den einzelnen weiteren Akteuren/Mitarbeitern spielerisch erfahrbar<br />
gemacht hat. Der Vortrag der beiden Musiker hat zusammen mit dem Workshop zum<br />
Nach- und Weiterdenken angeregt und eine neue Perspektive mit erweitertem Blickwinkel<br />
auf CaritasZentren und Teams eröffnet. Auch mir hat <strong>die</strong> Möglichkeit des Perspektivwechsels<br />
zwischen Musiker- und Dirigentenrolle mit all den Erwartungen des Orchesters<br />
eine besondere Erfahrung gegeben.<br />
• Heute Orchester zu spielen, zu erleben war ein spaßiges und leichtes Modell tiefe Erkenntnisse<br />
über unsere berufliche Organisation + unser Miteinander + Zusammenspiel zu<br />
erfahren.<br />
• Wir sollten in unserer Arbeit öfter über den Tellerrand hinausschauen. Methoden aus anderen<br />
Bereichen, z.B. <strong>die</strong> Arbeitsweisen eines Orchesters lassen sich wunderbar auf unsere<br />
Arbeit übertragen.<br />
• Der Workshop war eindrücklich und hat gezeigt, wie wichtig es ist aufeinander zu hören<br />
und als Gruppe etwas Großes zu erschaffen. Danke <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Erfahrung!<br />
• Leitung braucht Visionen, dann kann das Zusammenspiel von Fach<strong>die</strong>nsten gut funktionieren<br />
– und inspiriert und macht Spaß.<br />
• Der Musik-Workshop war sehr befreiend. Eine unbekannte „Orchesterzusammensetzung“<br />
hat in kurzer Zeit mit gutem Konzept und Führung Erstaunliches geleistet.<br />
• Es war ein lebendiger Prozess, an dem viele Aspekte der Zusammenarbeit innerhalb eines<br />
Systems sehr konkret erfahrbar wurden, unter anderem:<br />
- Jeder einzelne trägt zum Gelingen bei und erfährt sich selbst (auch in kleinen Rollen)<br />
als wichtig (oder kann es auch vermasseln).<br />
- Die Begeisterung/Beseeltheit (des Dirigenten = er hat eine Vision) springt über auf<br />
<strong>die</strong> Gruppe.<br />
- Führung und Kooperation sind notwendig, ergänzen sich gegenseitig.<br />
- Eine gute Atmosphäre macht lernen möglich.<br />
- Gemeinsames Lernen und Entwickeln macht Spaß.<br />
- Erfolg macht Spaß.<br />
• Tatsächlich fände ich es interessant einen solchen Workshop, bzw. <strong>die</strong>se Erfahrung des<br />
gemeinsamen „Musizierens“ im CZ Rüsselsheim mit allen Kolleginnen und Kollegen zu<br />
wiederholen.<br />
Offene Fragen:<br />
Wie entsteht <strong>die</strong>ser Wille bei allen Beteiligten zum Gelingen des Ganzen?<br />
Wie entsteht <strong>die</strong> wohlwollende Atmosphäre in der Gruppe?<br />
29
Workshop 4: Veränderungen und Chancen der verbandlichen Beratungsarbeit<br />
Frau Bohrke-Petrovic führte in das Thema: Veränderungen und Chancen in der verbandlichen<br />
Beratungsarbeit mit einem Impulsvortrag ein. Sie griff dabei Inhalte und Anregungen<br />
der Vorträge und Diskussionen vom Vormittag auf und vertiefte <strong>die</strong>se. Ausgehend vom Arbeitsalltag<br />
der Teilnehmer und der Frage, wie sozialräumliches Arbeiten konkret umsetzbar<br />
sein kann, wurde in dem sich anschließenden Gespräch ein hoher Diskussions- und Austauschbedarf<br />
der Teilnehmer deutlich.<br />
Folgende Fragstellungen prägten <strong>die</strong> Runde:<br />
• Was verändert sich in der Beratung beim sozialräumlichen Arbeiten?<br />
• Vom Fall zum Feld - was bedeutet <strong>die</strong>s konkret?<br />
• Was bedeutet Experte – wie viel muss sein und wo beginnt unerwünschtes Expertentum?<br />
• Wie geht man als Berater mit unterschiedlichen Ansprüchen um (z. B. Kostenträger<br />
erwartet Qualifizierung und Spezialisierung - Einrichtungsträger will eine Umsetzung<br />
des sozialräumlichen Handlungsansatzes)<br />
• Was bedeutet <strong>die</strong>s <strong>für</strong> <strong>die</strong> ganzheitliche Betrachtung und ganzheitliche Arbeit mit<br />
Menschen?<br />
• Wo kommen <strong>die</strong> Ressourcen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Netzwerkarbeit her?<br />
• Wie maßgeblich sind noch Fallzahlen?<br />
• Wie kann man Prozesse gestalten und wer macht das?<br />
Folgende Blitzlichter spiegeln <strong>die</strong> sich daraus ergebenden Diskussionen und Antworten wider:<br />
• Beratung als solches verändert sich von ihrem Verständnis her nicht sondern wird<br />
angereichert durch <strong>die</strong> Betrachtung der Person in ihrem individuellen Umfeld.<br />
• Der Berater als Experte verändert sich dahin, dass er sein Spektrum erweitert.<br />
• Ressourcen müssen im Netzwerk gefunden bzw. erschlossen werden.<br />
• Spannung entsteht oft dadurch, dass Entscheider kurzfristige Erfolge erreichen wollen?<br />
• Netzwerkarbeit erfordert Investitionen an Stellen, an denen man nicht direkter Nutznießer<br />
der Investition ist.<br />
• Der ganzheitliche Ansatz kann weitergeführt werden. Da wo das nicht ausreicht muss<br />
man Anliegen in der Gesellschaft skandalisieren.<br />
• Institutionelle Vorgaben (z. B. der Kostenträger)bremsen aus! Dem kann man durch<br />
Netzwerkarbeit begegnen - da ist Netzwerkarbeit besonders erforderlich<br />
• Netzwerke dürfen nicht (nur) auf personaler Ebene geschaffen werden, sondern sie<br />
müssen auf institutioneller Ebene (z. B. über Träger von Einrichtungen) vereinbart<br />
werden. Vertrag-liche Regelungen müssen über personale Bezüge hinausgehen.<br />
• Leitung/Führung muss Widersprüche klären und klare Unterstützung gewähren, wenn<br />
sozialraumorientiert gearbeitet werden soll.<br />
30
Workshop 5: Blicke über den Tellerrand<br />
31
Informationen zum „Lebenshaus“, hier auszugsweise entnommen der Festrede von Caritasdirektor<br />
Hartmut Fritz zur Einweihung des Caritaszentrums<br />
„DAS CARITAS-ZENTRUM: PRÄSENTATION DER EINZELNEN ELEMENTE<br />
a) Das Lebenshaus<br />
Mit dem Lebenshaus St. Leonhard, meine Damen und Herren, realisiert der <strong>Caritasverband</strong><br />
Frankfurt mitten in der Innenstadt ein neues Wohn- und Versorgungskonzept in der<br />
Altenpflege, das Integration und Teilhabe am öffentlichen Leben <strong>für</strong> alte Menschen ermöglicht<br />
und freiwilliges soziales Engagement in sein Konzept einbezieht.<br />
Gleichzeitig verwirklicht der Verband hier einen zukunftweisenden Ansatz von generationenverbindendem,<br />
sozial durchmischtem Wohnen. Dies zeigt sich auch in der Verzahnung<br />
des Lebenshauses mit der Kindertagesstätte an der Karmelitergasse. Wer hier einzieht, ist<br />
mitten im Leben und legt Wert auf Gemeinschaft.<br />
Neben 25 Wohnungen sowie 36 Pflegeplätzen bietet das Lebenshaus Begegnungsmöglichkeiten<br />
<strong>für</strong> <strong>die</strong> Hausbewohner, <strong>für</strong> Gäste und Nachbarn aus dem Quartier. Im Parterre<br />
sind verschiedene öffentliche Räume entstanden, wo künftig nachbarschaftliche Begegnungen,<br />
kulturelle Angebote, aber auch Familienfeiern möglich sind.<br />
Die von der Augsburger Künstlerin Anne Hitzker-Lubin gestaltete Kapelle ist der spirituelle<br />
Mittelpunkt nicht nur des Lebenshauses, sondern des gesamten Zentrums. Sie ist offen ist<br />
<strong>für</strong> Bewohner, Mitarbeiter und Gäste.<br />
Das Lebenshaus versteht sich darüber hinaus als neuer Mittelpunkt im Quartier. Die Mieter<br />
haben sich bewusst <strong>für</strong> ein Konzept gemeinsamen Wohnens und Lebens entschieden und<br />
engagieren sich je nach ihren individuellen Möglichkeiten <strong>für</strong> <strong>die</strong> Hausgemeinschaft, in <strong>die</strong><br />
auch <strong>die</strong> pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner ein- bezogen sind.<br />
Das Pflegeheim ist bisher trotz hoher Nachfrage erst zur Hälfte belegt. Bei einem sukzessiven<br />
Aufbau von geeignetem Personal - das nicht immer ganz einfach zu finden ist - gehe<br />
ich von einer vollen Belegung der 36 Pflegeplätze bis Ende des Jahres aus. Es gelingt<br />
bereits jetzt sehr gut, <strong>die</strong> Brücke zu schlagen zwischen den Bewohnerlnnen des Pflegeheimes<br />
und den Mietern. Vorlesen, musizieren, backen und kochen, gemeinsam in der<br />
Kleinmarkthalle einkaufen, auch mal das Essen rei- chen - all das ist ein Mehr an sozialem<br />
Kontakt und ein mehr an Menschlichkeit hier im Lebenshaus, <strong>für</strong> alle Beteiligten.<br />
Eine wichtige Voraussetzung da<strong>für</strong> ist <strong>die</strong> professionelle Begleitung der Bewohner des Lebenshauses.<br />
Diese Aufgabe hat der "Quartiersmanager", der <strong>die</strong> Kontakte der Bewohnerinnen<br />
und Bewohner im Lebenshaus unterstützt, aber auch Angebote <strong>für</strong> <strong>die</strong> Menschen im<br />
Stadtteil arrangiert und so aus dem Caritas-Lebenshaus einen le- bendigen Treffpunkt <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Bewohnerinnen und Bewohner der westlichen Altstadt macht.<br />
Kontaktstelle Engagementförderung<br />
In das nachbarschaftliche Konzept ist auch <strong>die</strong> "Kontaktstelle Engagementförderung" einbezogen,<br />
<strong>die</strong> sich im Erdgeschoss zur Buchgasse hin präsentiert. Hier wird ein Informationsund<br />
Aktionszentrum eingerichtet, wo Menschen willkommen sind, <strong>die</strong> sich zum einen über<br />
Caritas-Themen informieren wollen, <strong>die</strong> aber auch auf der Suche sind nach Möglichkeiten<br />
sinnstiftenden ehrenamtlichen Engagements. Herzlich willkommen sind hier besonders Jugendliche,<br />
<strong>die</strong> sich engagieren wollen, und junge Menschen in der Berufsfindungsphase.<br />
Für sie wird es spezielle Angebote geben. Kurz: Hier wird ein Treffpunkt entstehen <strong>für</strong><br />
Menschen, <strong>die</strong> sich sozial enga- gieren und gesellschaftspolitisch einmischen wollen.<br />
Des Weiteren sind in den Gewerberäumen an der Buchgasse <strong>die</strong> Praxis einer Heilpraktikerin<br />
und das Reisebüro der Seniorenerholung des <strong>Caritasverband</strong>s angesiedelt.“<br />
(Die Gesamtfassung der Festrede ist auf der Homepage des CV Frankfurt unter „Neues Caritas-<br />
Zentrum eröffnet – Investition in <strong>die</strong> Zukunft“ veröffentlicht: http://www.caritas-frankfurt.de<br />
36
42 Evaluationsbögen wurden ausgefüllt abgegeben. Die einzelnen Stimmen verteilten sich in<br />
der Summe wie folgt auf <strong>die</strong> verschiedenen Fragestellungen:<br />
Veranstaltungsbeurteilung<br />
Titel der Veranstaltung<br />
Von der Einzelfallberatung zum umfassenden Hilfesystem<br />
stimme voll zu<br />
stimme eher zu<br />
lehne eher ab<br />
lehne voll ab<br />
<br />
stimme zu<br />
Bewertung<br />
<br />
lehne ab<br />
1. Mit dem organisatorischen Ablauf und den Rahmenbedingungen<br />
war ich zufrieden<br />
<br />
30 11 1<br />
2. Die Themen / Inhalte entsprachen den Erwartungen, mit denen<br />
ich zur Veranstaltung gekommen bin<br />
<br />
13 27 1<br />
3. Die Themen / Inhalte wurden anschaulich und verständlich<br />
vermittelt<br />
<br />
16 26<br />
4. Die Anteile von Plenums- und Gruppenarbeit waren dem<br />
Thema und der Gruppe angemessen<br />
<br />
13 23 5 1<br />
5. Die Arbeitsatmosphäre war motivierend und erleichterte <strong>die</strong><br />
Auseinandersetzung mit dem Thema<br />
<br />
13 25 4<br />
6. Ich hatte ausreichend Möglichkeiten, eigene Fragestellungen,<br />
Probleme und Wünsche einzubringen<br />
<br />
8 16 15<br />
7. Die Veranstaltung brachte mir neue Anregungen, Erkenntnisse<br />
und Vorsätze <strong>für</strong> meine Arbeit<br />
<br />
12 21 8 1<br />
8. Die behandelten Themen sind <strong>für</strong> meine tägliche Arbeit wichtig<br />
<br />
14 17 11<br />
9. Diese Veranstaltung würde ich anderen weiterempfehlen<br />
<br />
11 27 2 1<br />
Zu den Fragen 10 – 13 gab es sehr viele Einzelrückmeldungen, <strong>die</strong> intern <strong>für</strong> künftige, vergleichbare<br />
Veranstaltungen noch ausgewertet werden. Insgesamt zeigte sich, dass sowohl<br />
<strong>die</strong> Referate als auch <strong>die</strong> meisten Workshops als sehr interessant bewertet wurden, allerdings<br />
<strong>die</strong> Beteiligungsmöglichkeiten zum Teil als zu gering erachtet wurden.<br />
37
Teilnehmer/innen<br />
Name Vorname Einrichtung<br />
1 Adick Nicola DiCV <strong>Mainz</strong><br />
2 Arnold Stephanie SkF <strong>Mainz</strong><br />
3 Bacher Anette CV Offenbach<br />
4 Berger Mathias Kaplan <strong>Mainz</strong>-Finthen<br />
5 Berlinger Brigitte St. Bartholomäus / Biblis<br />
6 Besslich-Bechtold Anke CZ Haus St. Josef, Offenbach<br />
7 Bickel Claudia CV Saarbrücken<br />
8 Bieg Richilde CZ Saarpfalz<br />
9 Blaß Christine CZ Saarpfalz<br />
10 Bleines Bernd Caritasdirektor, CV Offenbach<br />
11 Bock Claudia CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
12 Bruckmeir Georg CV Worms<br />
13 Ciavarella Adriana DiCV <strong>Mainz</strong><br />
14 Conrads-Mathar Resi DiCV Aachen<br />
15 Dall´Omo Elena CZ Erbach<br />
16 Diederich Georg Caritasdirektor, CV Worms<br />
17 Drenkard-Heim Birgit CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
18 Dmytruk Jerzy Dekanat Alsfeld<br />
19 Dürsch Dorothea CZ Bingen<br />
20 Ebermann Jörg CZ Rüsselsheim<br />
21 Eckert Hildegard SkF <strong>Mainz</strong><br />
22 Eich Christina CZ Rüsselsheim<br />
23 Feld-Finkenauer Helga DiCV <strong>Mainz</strong><br />
24 Feldhege Thea CZ St. Elisabeth Bingen<br />
25 Fett Peter CZ Rüsselsheim<br />
26 Fey Mirjam CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong>, Netzwerk Weisenau<br />
27 Fraune Martin CZ Heppenheim<br />
28 Fried Annette CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
29 Gabel Michaele SkF <strong>Mainz</strong><br />
30 Glaser Klaus Fa. Ergon+Partner<br />
31 Glöckner Karin CV <strong>für</strong> den Main-Kinzig-Kreis<br />
32 Goeb Hartmut CV Gießen<br />
33 Hahn Ulrike CV <strong>Mainz</strong>, bap-servicecenter<br />
34 Hauf Thomas Stadt <strong>Mainz</strong><br />
35 Hebermehl Birgit CZ St. Elisabeth Bingen<br />
36 Heck-Klassen Veronika DiCV <strong>Mainz</strong><br />
37 Heil Hartmut SkF <strong>Mainz</strong><br />
38 Hempel Christina CV Offenbach<br />
39 Hiebing Sonja Dekanat Alsfeld<br />
40 Hille Ursula CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
41 Hoche-Schüler Martina SkF <strong>Mainz</strong><br />
42 Holländer Alfons Kaplan Köln Blumenberg<br />
43 Hufen Gabriele SkF <strong>Mainz</strong><br />
44 Jäger Thomas CZ Worms<br />
45 Jumperz Teresa SkF <strong>Mainz</strong><br />
46 Jung-Wirth Ilona SkF <strong>Mainz</strong><br />
47 Kammler Matthias CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
48 Karst Monika CZ Rüsselsheim<br />
49 Kelm Stefan CZ Friedberg<br />
38
50 Kennel Angelika DiCV Limburg<br />
51 Kern-Müller Ute CV Offenbach<br />
52 Kiefer Franz-Josef Caritasdirektor, CV Darmstadt<br />
53 Kieslich Monika CZ Friedberg<br />
54 Kinader Christof CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
55 Klemm Ursula CZ Erbach<br />
56 Kluth Hedwig Dekanat Alsfeld<br />
57 Knobloch Barbara CZ Rüsselsheim<br />
58 Kohl Johannes Kath. Bildungswerk <strong>Mainz</strong><br />
59 Kolbe Maria CV Offenbach<br />
60 Krafft Peter DiCV <strong>Mainz</strong><br />
61 Kronwald-Najafian Eleonore CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
62 Krüger Marcus Sozialbüro Main - Taunus<br />
63 Krum Martina CZ Friedberg<br />
64 Kunz Friedhelm Heilpäd. Einrichtung, Kreuznacher Diakonie<br />
65 Lehnard Hannelore CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
66 Lich Gisela CZ Vogelsberg<br />
67 Lugert Anne St. Bartholomäus / Biblis<br />
68 Malina Nicole St. Martin / <strong>Mainz</strong><br />
69 Mann Sabine CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
70 Maus Friedrich DiCV <strong>Mainz</strong><br />
71 Mayer Karl CZ Rüsselsheim<br />
72 Meiborg Adelheid St. Bartholomäus, Saulheim<br />
73 Metz Inge SkF <strong>Mainz</strong><br />
74 Meuser Waltraud SkF <strong>Mainz</strong><br />
75 Molitor Ulrike CZ Saarpfalz<br />
76 Morschhäuser Kathrin SkF <strong>Mainz</strong><br />
77 Müller Christine CZ Rüsselsheim<br />
78 Muth Volker CZ Friedberg<br />
79 Noppenberger Josef DiCV Bamberg<br />
80 Oberbeck Ricarda CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
81 Offergeld Bettina DiCV Aachen<br />
82 Ohler Hermann DiCV <strong>Mainz</strong><br />
83 Paul-Bilge Martina SkF <strong>Mainz</strong><br />
84 Poßmann Karin CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
85 Rehibi Elisabeth <strong>Mainz</strong>-Bretzenheim<br />
86 Reifenberg Andreas Dekanat Dieburg<br />
87 Reinel Margarete DWHN<br />
88 Reiniger Kirstin CZ Heppenheim<br />
89 Reininger Winfried DiCV <strong>Mainz</strong><br />
90 Reiser Silke Pflegestützpunkt Worms<br />
91 Reitze Wilfried CZ Friedberg<br />
92 Renker Elena CZ Vogelsberg<br />
93 Ries Elke CV <strong>Mainz</strong><br />
94 Rohschürmann Martin CV <strong>Mainz</strong><br />
95 Roos Tamara SkF <strong>Mainz</strong><br />
96 Rößmann Sr.Theresia Celine <strong>Mainz</strong>-Finthen<br />
97 Sänger Claudia St. Elisabeth Bensheim<br />
98 Schäddel Karin CZ Vogelsberg<br />
99 Schäfer Elisabeth St. Bartholomäus, Saulheim<br />
100 Schaper Peter CZ Rüsselheim<br />
39
101 Scherer Gernot CZ St. Elisabeth Bingen<br />
102 Schilling Inge SkF <strong>Mainz</strong><br />
103 Schimpf Lukas CZ Rüsselsheim<br />
104 Schmitz Theodor SkF <strong>Mainz</strong><br />
105 Schollmayer Claudia SkF <strong>Mainz</strong><br />
106 Schrenk Monika <strong>Mainz</strong><br />
107 Schwarzbauer Gertraude CV Offenbach<br />
108 Schywalski Beate DiCV <strong>Mainz</strong><br />
109 Seikel Peter Caritas Seligenstadt<br />
110 Senft Holger Offenbach<br />
111 Spieß Dorothee CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
112 Steinbrede Petra CV Worms<br />
113 Streich-Karas Christine CZ Vogelsberg<br />
114 Strittmatter Ruth Grünberg<br />
115 Strunck Ute DiCV <strong>Mainz</strong><br />
116 Tianis Petra CV Gießen<br />
117 Tigges-Schwering Cornelia CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
118 Topcic Suzana CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
119 Dr. Veith Werner Caritasdirektor, CV Darmstadt<br />
120 Verhaelen-Peters Hildegard SkF <strong>Mainz</strong><br />
121 Volkmar Juliana DiCV <strong>Mainz</strong><br />
122 Wagner-Erlekam Michael DiCV <strong>Mainz</strong><br />
123 Wagner-Görnert Beate Grünberg<br />
124 Wahhusen Sabine DiCV <strong>Mainz</strong><br />
125 Weber-Karyotaki Katerina<br />
126 Weires-Strauch Agnes CZ Alzey<br />
127 Weitzel Karina CZ Vogelsberg<br />
128 Weyer-Speiger Anna Lisa SkF <strong>Mainz</strong><br />
129 Wilke-Hanf Annette CZ Franziskushaus, Bensheim<br />
130 Wittmann Brigitte CZ Erbach<br />
131 Wörsdörfer Georg CZ St. Elisabeth Bingen<br />
Mitwirkende<br />
1 Abenhausen Karin Hessischer Rundfunk<br />
2 Prof. Dr. Bestmann Stefan Katholische Hochschule, Berlin<br />
3 Bohrke-Petrovic Siglinde Mannheim<br />
4 Domnick Thomas Diözesancaritasdirektor, DiCV <strong>Mainz</strong><br />
5 Fritz Hartmut Caritasdirektor, CV Frankfurt<br />
6 Hanisch Maria CV Köln<br />
7 Harloff Cornelia Köln<br />
8 Kuntze Monika CV Köln<br />
9 Mach Frank CZ Rüsselsheim<br />
10 Merkator Kurt Sozialdezernent <strong>Mainz</strong><br />
11 Prälat Dr. Neher Peter DCV Freiburg<br />
12 Neuner Reinmar Köln<br />
13 Trost-Kolodziejski Eva CZ Delbrêl <strong>Mainz</strong><br />
40