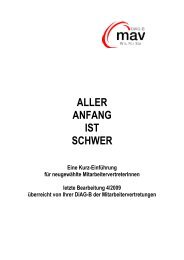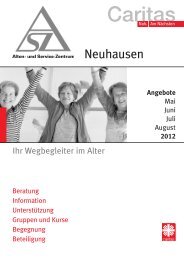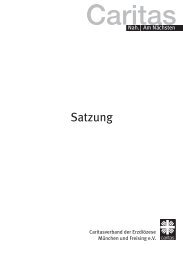Dr. Hanna Permien, Deutsches Jugendinstitut
Dr. Hanna Permien, Deutsches Jugendinstitut
Dr. Hanna Permien, Deutsches Jugendinstitut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Dr</strong>. <strong>Hanna</strong> <strong>Permien</strong>, <strong>Deutsches</strong> <strong>Jugendinstitut</strong><br />
Vortrag zum 25. Bestehen des Mädchenheims Gauting, 19.4.2007<br />
„Ich habe die Geschlossene gebraucht“:<br />
Indikationen und Wirkungsweisen von freiheitsentziehenden Maßnahmen<br />
1. Die Zielgruppe und der Auftrag von freiheitsentziehenden Maßnahmen<br />
Mädchen und Jungen, die – oft nach längeren Abweichungs- und Hilfe“karrieren“ – in teilgeschlos-<br />
senen Gruppen der Jugendhilfe untergebracht werden, haben gemeinsam, dass ihre bisher entwi-<br />
ckelten Bewältigungsstrategien nicht zu einer „normalen“, „normgerechten“ Bewältigung ihrer Ent-<br />
wicklungsaufgaben ausreichten: Sie gehen nicht zur Schule, sind noch nachts unterwegs, haben die<br />
„falschen“ Freunde, begehen Straftaten, konsumieren zuviel Suchtmittel etc. Ihr soziales Umfeld<br />
sowie Jugendhilfe, (Förder-)Schule und ggf. Psychiatrie konnten diese Strategien und die damit<br />
verbundene Selbst- und Fremdgefährdung nicht hinreichend zum Positiven beeinflussen. Wenn<br />
zudem die Jugendlichen keine Einsicht in ihren Hilfebedarf zeigen, sehen Eltern und die Verantwort-<br />
lichen in der Jugendhilfe oft keine andere Möglichkeit mehr, als ihrem Schutzauftrag durch Zwang<br />
und Freiheitsentzug nachzukommen (Hoops/<strong>Permien</strong> 2006, Kap. 3). Dabei gibt es zwar gewisse<br />
Kriterien, die für eine FM sprechen, aber keine eindeutige Indikation für freiheitsentziehende Maß-<br />
nahmen (FM). Wenn also FM als ultima ratio seitens Eltern und Jugendhilfe in Erwägung gezogen<br />
werden, müsste sich die Jugendhilfe selbstkritisch fragen:<br />
- Was können wir lernen aus dem bisherigen Scheitern von Hilfen, um ggf. ähnliche Fehler<br />
künftig zu vermeiden?<br />
- Können wir aktuell noch eine geeignete offene Hilfe finden oder auch „maßschneidern“, die<br />
weniger in die Freiheitsrechte der Jugendlichen eingreift?<br />
- Scheint die FM als Hilfe nicht nur erforderlich (im Sinne von: die Jugendhilfe hat nichts an-<br />
deres ehr zu bieten) sondern scheint sie auch pädagogisch geeignet und verhältnismäßig –<br />
d.h. ist der zu erwartende Erziehungserfolg höher einzuschätzen als die Nachteile, die durch<br />
den Freiheitsentzug und dadurch mögliche Schädigungen entstehen?<br />
2. Freiheitsentziehende Maßnahmen als „verkehrte Welt“ der Jugendhilfe<br />
Teilgeschlossene Unterbringung hat – wie alle anderen Jugendhilfeangebote – nach § 1 SGB VIII<br />
generell die Aufgabe, die Erziehung zu einer „eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen<br />
Persönlichkeit“ zu fördern und dabei u.a. „Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“ und<br />
Kinder und Jugendliche „vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen“ (§ 3 SGB VIII).<br />
Nun haben FM aber einige Besonderheiten, die sie von anderen Jugendhilfeangeboten unterschei-<br />
den – FM sind sozusagen die „verkehrte Welt“ der Jugendhilfe. Denn dort geschieht – zumindest<br />
zunächst - z.T. genau das Gegenteil von dem, was anerkannte und bewährte Prinzipien der moder-<br />
nen Jugendhilfe fordern. Das hängt mit dem Grundparadox von FM zusammen, das da lautet:<br />
Durch Freiheitsentzug zur Freiheit erziehen wollen.<br />
1
3. Die „Wirkungsstudie“ des DJI-Projekts „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ 1<br />
Die zentralen Forschungsfragen der „Wirkungsstudie“ des DJI-Projekts greifen diese Eigenheiten<br />
der FM auf.<br />
Untersuchungsgruppe und Erhebungsinstrumente<br />
Erhebungsform <br />
Leitfaden-<br />
orientierte<br />
Interviews<br />
Fragebogen-<br />
erhebung<br />
jeweils kurz vor der Entlassung der Jugendlichen<br />
aus FM<br />
Erstinterview (7-2005 – 2-2007)<br />
mit 36 Jugendlichen (13 m, 23 w) aus insge-<br />
samt 6 Heimen in 3 Bundesländern sowie mit<br />
ihren Betreuern<br />
Akteneinsicht zu Vorgeschichte und Zielen<br />
des Hilfeplans<br />
- mit 47 Jugendlichen<br />
- mit 53 Betreuern<br />
insgesamt erfasst sind 59 Jugendliche<br />
(darunter 41 „Paare“),<br />
davon 28 Jungen, 31 Mädchen<br />
aus 8 Heimen in 4 Bundesländern<br />
jeweils 10-14 Monate später<br />
Zweitinterview<br />
in 28 Fällen (10 m, 18 w)<br />
- mit 26 Jugendlichen<br />
- mit 22 aktuellen Bezugspersonen<br />
(16 Betreuer und 6 Mütter)<br />
Die Studie ist „multiperspektivisch“ angelegt, insofern, als nicht nur 36 Jugendliche kurz vor ihrer<br />
Entlassung befragt wurden, sondern auch ihre Betreuerinnen und Betreuer. Und sie stellt eine<br />
Follow-up-Studie dar: Wir konnten etwa ein Jahr später nochmals 26 Jugendliche und 22 ihrer<br />
dann aktuellen Bezugspersonen befragen, sodass wir in 28 Fällen mindestens ein Interview führen<br />
konnten.<br />
Zudem haben wir die interviewten Jugendlichen und ihre Betreuer gebeten, jeweils einen Fragebo-<br />
gen auszufüllen. Solche Fragebogen haben wir auch an die Einrichtungen mit teilgeschlossenen<br />
Gruppen verteilt und darum gebeten, dass auch Jugendliche und ihren Betreuer, die wir nicht in-<br />
terviewen konnten, diese Fragebogen kurz vor der Entlassung ausfüllen. Dabei sind Daten zu 59<br />
Fällen zusammengekommen, in 41 Fällen konnten wir sowohl den Jugendlichen- als auch der Be-<br />
treuer-Fragebogen auswerten (sog. Paare), in den anderen Fällen lagen nur der Betreuer- oder nur<br />
der Jugendlichen-Fragebogen vor.<br />
1 Das Projekt »Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen von Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz« wird von<br />
2003–2007 vom DJI durchgeführt und mit Mitteln des Bundes, des DJI und aus neun Bundesländern finanziert.<br />
Die wissenschaftliche Bearbeitung liegt bei Sabrina Hoops und <strong>Dr</strong>. <strong>Hanna</strong> <strong>Permien</strong> unter zeitweiser Mitarbeit von<br />
Martina Steger. Forschungsschwerpunkte sind v.a. die Klärung der Indikationen für Freiheitsentzug in Jugendhilfe<br />
und Jugendpsychiatrie, die rechtlichen Vorgaben und deren Umsetzung, sowie eine Follow-up-Erhebung mit<br />
unter Freiheitsentzug betreuten Jugendlichen und deren Bezugspersonen. Ein erster Projektbericht kann kostenlos<br />
bezogen werden über permien@dji.de. Weitere Informationen unter: www.dji.de/freiheitsentzug<br />
2
Anhand der so gewonnenen Ergebnisse soll im Folgenden dargestellt werden, wie die Jugendlichen<br />
� die „verkehrte Welt“ des FM-Setting erleben und bewerten – hier geht es also zunächst um<br />
die Akzeptanz des FM-Settings und seiner verschiedenen Faktoren,<br />
� welchen Nutzen oder auch Schaden sie ihm für ihre weitere Entwicklung zuschreiben, bzw.<br />
wieweit sie sich am Ende ihres FM-Aufenthalts besser befähigt fühlten, ein ihren eigenen<br />
Zielen und Werten entsprechendes Leben zu realisieren – hier geht es also um die Wir-<br />
kung der FM,<br />
� wie sie den Übergang von der FM in ihr Anschluss-Setting bewältigt haben,<br />
� und wo sie nach einem Jahr stehen und wie sie ihre aktuelle Situation bewerten.<br />
Um die Ergebnisdarstellung etwas farbiger zu gestalten, werde ich im folgenden die Fälle von drei<br />
Mädchen aufgreifen, die geschlossen untergebracht waren: Die Interviews, die wir mit Jasmin,<br />
Solaya, Susi und ihren Bezugspersonen führen konnten, zeigen: Alle drei erleben und gestalten<br />
ihre Zeit in der FM und ihr Leben danach ganz unterschiedlich. Sie stehen quasi Modell dafür, wie<br />
verschieden sich die Interaktion zwischen den Bewältigungsstrategien und den Zielen und Wert-<br />
orientierungen der Jugendlichen einerseits und den pädagogisch-therapeutischen Strukturen und<br />
Strategien von FM andererseits entwickeln kann.<br />
Denn auch, wenn das FM-Setting recht starr erscheint – jedes Mädchen erlebt und konstruiert sich<br />
ein „anderes Gauting“, eine andere teilgeschlossene Gruppe und zieht andere Schlüsse für ihr wei-<br />
teres Leben daraus. Und jedes Mädchen tritt in Interaktion mit den Betreuenden und wird von ih-<br />
nen anders gesehen und vermutlich auch ein bisschen anders behandelt.<br />
Bevor ich die Ergebnisse darstelle, die auch eine Reihe kritischer Aspekte beinhalten, möchte ich<br />
vorausschicken, dass ich große Hochachtung vor der Arbeit derjenigen habe, die tagtäglich mit<br />
hochbelasteten Mädchen arbeiten und ihnen noch eine Chance geben wollen, die sie sonst vielleicht<br />
nicht hätten! Dabei machen es die Mädchen den Betreuenden oft nicht leicht – allerdings erleben<br />
die Mädchen das umgekehrt genauso.<br />
Vorausschicken möchte ich auch, dass ich hier nur einige Punkte unserer Auswertung herausgreifen<br />
kann, diese dürfen aber nicht als einzelne verabsolutiert werden. Vielmehr ist es immer das Ge-<br />
samtgefüge der FM mit seinen Struktur- und Beziehungsaspekten, das mit der Persönlichkeit der<br />
einzelnen Jugendlichen in Interaktion tritt und wirkt.<br />
4. Darstellung wichtiger Ergebnisse<br />
4.1 Konfrontation und Zwang statt Kooperation und Partizipation –<br />
v.a. bei der Heimeinweisung und zu Beginn der Unterbringung<br />
Schauen wir zunächst, wie unsere drei Mädchen die Heimeinweisung erlebten:<br />
Jasmin ging mit 13 Jahren nicht mehr zur Schule, nahm <strong>Dr</strong>ogen, trank, blieb nachts weg und ließ<br />
sich auch in Straftaten hineinziehen. Ihre Mutter war machtlos gegen ihr Verhalten und wandte sich<br />
ans Jugendamt. Doch Jasmin wollte keinerlei Hilfe annehmen. Die Mutter stellte schließlich einen<br />
Antrag auf Freiheitsentzug beim Familiengericht. In einer ersten Anhörung gab der Richter Jasmin<br />
einige Monate Zeit, ihr Verhalten zu ändern, sonst würde er die Genehmigung für ein „geschlosse-<br />
3
nes Heim“ erteilen. Jasmin kümmerte sich nicht darum, sie glaubte nicht, dass ihre Mutter und der<br />
Familienrichter ihre <strong>Dr</strong>ohung wahr machen würden. Als es doch soweit kam, fügte sie sich aber der<br />
Einweisung. So kommt sie mit 14 Jahren „freiwillig“, begleitet nur von ihrer Mutter, ins Heim. Ob-<br />
wohl sie sonst „gerne ihre Meinung sagt“, passt sie sich dort - nach ein, zwei Zusammenstößen mit<br />
den Betreuenden - den Regeln fast perfekt an. Motiv dafür ist, wie sie später sagt, „einfach Angst“<br />
vor den sonst drohenden Ausgangssperren, dem Zimmerarrest oder gar dem Isolationsraum. Sie<br />
meint, sie hätte die Anfangsphase viel besser überstanden, weniger geweint und weniger herum-<br />
geschrieen, wenn sie wenigstens ihre Mutter hätte anrufen dürfen.<br />
Solaya hatte sich schon in einigen Einrichtungen als „untragbar“ erwiesen, weil sie dort tat, was<br />
sie wollte und sehr aggressiv wurde, wenn etwas nicht nach ihrem Willen ging. Sie ist 15, als sie<br />
erstmals in eine teilgeschlossene Clearingstelle gebracht werden soll, ohne vorher darüber infor-<br />
miert worden zu sein. Als sie von der Polizei dort hintransportiert wird, wehrt sie sich so heftig,<br />
dass sie sich eine Anzeige einhandelt. Von der Clearingstelle wechselt sie nach einigen Monaten in<br />
die teilgeschlossene Gruppe eines Mädchenheims. Zwar verläuft dieser Transport ohne Zwischen-<br />
fälle, doch im Heim hat sie sich, wie sie sagt, anfangs „zu sehr gewehrt“ und ist so aggressiv, dass<br />
sie öfter in ihrem Zimmer oder dem sogenannten Time-out-Raum isoliert wird. Schließlich habe sie<br />
die Regeln, wie sie meint, „akzeptiert“, was ihre Betreuerin allerdings nicht bestätigen kann.<br />
Susi kommt mit 15 Jahren in die FM. Sie lässt sich von ihrem Jugendamt zu einem „Vorstellungs-<br />
gespräch“ in einer teilgeschlossenen Einrichtung überreden, muss dann aber gleich dort bleiben.<br />
Sie fühlt sich betrogen und ist auch total sauer auf ihre Mutter, die die Unterbringung „hinter ih-<br />
rem Rücken“ beantragt habe. Sie gibt aber auch zu, dass sie freiwillig nie in dies Heim gekommen<br />
wäre. Sie sagt von ihrer Anfangszeit:<br />
„Ich hab mich gewehrt, ich hab gedroht, weil ich gehofft habe, dass sie mich wieder rauswerfen<br />
und sagen, mit der kann man nicht zusammenarbeiten. <strong>Dr</strong>ei Monate hab ich das gehofft!“ 2<br />
Wegen ihres „Ausrastens“ und ihrer <strong>Dr</strong>ohungen, sich selbst oder den Betreuenden etwas anzutun,<br />
wird sie oft auf ihr Zimmer geschickt und einmal sogar in den Isolationsraum gebracht.<br />
Wie die Interviews und die Fragebogenauswertung zeigen, reagieren die meisten Jugendlichen so<br />
oder ähnlich auf die Heimeinweisung: Sie können das, was von Eltern und Jugendhilfe als „letzte<br />
Chance“ für sie gedacht ist, anfangs meist nur als Strafe wahrnehmen – also als genau das, was<br />
es nach Aussagen der einweisenden Ämter keinesfalls sein soll! Viele beschreiben in den Erstinter-<br />
views die Anfangsphase als die „schlimmste Zeit“ (vgl. <strong>Permien</strong> 2006).<br />
Nun ist eine Unterbringung in einem Heim vermutlich für kein Mädchen und keinen Jungen leicht<br />
wegzustecken. Doch in der FM als der „verkehrten Welt“ der Jugendhilfe kommt erschwerend für<br />
die Jugendlichen hinzu, dass – wie an den Beispielen schon deutlich wurde – bei Hilfeplanung und<br />
Heimeinweisung im Gegensatz zu zentralen Prinzipien der Jugendhilfe verfahren wird bzw. verfah-<br />
ren werden muss:<br />
� Statt durch Partizipation der Jugendlichen ist oft schon die Hilfeplanung durch Unfreiwil-<br />
ligkeit und Zwang oder auch Nichteinbeziehen oder „Hintergehen“ der Jugendlichen<br />
2 Die Zitate aus den Interviews sind der leichteren Lesbarkeit wegen hier z.T. sprachlich leicht<br />
geglättet und gekürzt.<br />
4
gekennzeichnet. Allerdings gibt es auch einzelne Jugendliche, die unter dem <strong>Dr</strong>uck ihrer<br />
Probleme „freiwillig“ in die FM gehen.<br />
� Weiter fühlen die Jugendlichen oft nur mangelhaft oder gar nicht auf das Heim und die<br />
Geschlossenheit vorbereitet, denn – im Gegensatz zu anderen Fremdunterbringungen –<br />
können die Jugendlichen sich das Heim nicht aussuchen, sie können nicht „Probewohnen“,<br />
und sie können sich nach eigenen Aussagen oft auch dann, wenn es tatsächlich zu einem<br />
Vorstellungsgespräch in der FM gekommen ist, nicht vorstellen, was „Geschlossenheit“ im<br />
Alltag bedeutet.<br />
� Auch die Prinzipien der „Lebensweltorientierung“, der Wohnortnähe und der engen Ein-<br />
beziehung der Eltern als „Koproduzenten“ der Jugendhilfe haben bei FM kaum Geltung.<br />
Stattdessen müssen die Jugendlichen den Schock der abrupten Trennung und, dank an-<br />
fänglicher Ausgangs- und Kontaktssperre, die Abschottung von allen bisher vertrauten –<br />
wenn auch noch so fragwürdigen – Lebensbezügen verkraften. Dies kann in manchen Ju-<br />
gendlichen böse Erinnerungen an früheres Eingesperrtsein wecken.<br />
� Statt der Einhaltung des Prinzips Freiwilligkeit, das vielen Fachleuten als Basis einer „Er-<br />
ziehung zur Freiheit“ unabdingbar scheint, wird massiv in die in die Freiheitsrechte der<br />
Jugendlichen eingegriffen, besonders zu Beginn, wo die Jugendlichen sich plötzlich in<br />
einem „total geschlossenen System“ wiederfinden, und sich Ausgänge erst mühsam „erar-<br />
beiten“ müssen. Das bedeutet nicht nur die unfreiwillige, aber „unausweichliche“ Konfron-<br />
tation mit der neuen Umwelt und neuen Betreuenden, sondern auch mit der Heimgruppe.<br />
Die Erstinterviews machen deutlich, dass die anderen Jugendlichen gerade den „Neuen“<br />
nicht selten erst mal kräftig zusetzen, Diese müssen sich also möglichst bald einen mög-<br />
lichst guten Platz in der Gruppe erobern. Solaya und v.a. Jasmin gelingt das von Anfang an<br />
ganz gut, Susi aber hat damit erhebliche Probleme, sie bleibt bis zum Schluss „Außensei-<br />
ter“ und ist häufig auch „Sündenbock“ der Gruppe, so die übereinstimmende Wahrneh-<br />
mung von Susi und ihrer Betreuerin.<br />
FM setzen also, so scheint es mir als Außenstehender, zunächst voll auf Konfrontation statt auf<br />
Kooperation mit den Jugendlichen: Und die erleben, wie sie selber sagen, die Hilfe zumindest<br />
zunächst als Strafe und nicht als Chance!! Diese Konfrontation ist sicher v.a. aus der Not geboren,<br />
dass die Jugendlichen offenbar dringend Hilfe brauchen, sich aber freiwillig nicht helfen lassen wol-<br />
len. Doch verbindet sich mit dieser Konfrontation auch die Hoffnung, dass den Jugendlichen sehr<br />
schnell klar wird, dass ihre bisherigen selbst- und fremdgefährdenden Verhaltensmuster in diesem<br />
Setting keine Chance haben und dass sie sich, abgeschnitten von allen ihren bisherigen Ressour-<br />
cen, leichter für die nötig erscheinenden Veränderungen öffnen.<br />
Doch dieses Vorgehen erschwert – zumindest zunächst – die Kooperation mit den meisten Jugend-<br />
lichen erheblich. Und sie führt nach Aussagen der Mehrzahl der Jugendlichen – zumindest zunächst<br />
– zu erhöhten Belastungen, zu erheblichem Misstrauen gegenüber den Betreuenden und, wie bei<br />
Solaya und Susi, oft zu Reaktionen, die zumindest zunächst genau die Probleme verschärfen, die<br />
eigentlich gelöst werden sollen.<br />
Dies alles spricht m. E. dafür, auch im Falle von Freiheitsentzug bei Hilfeplanung und Heimeinwei-<br />
sung die genannten Prinzipien der Jugendhilfe soweit wie möglich einzuhalten – z.B. zu überprüfen,<br />
ob und wie lange das Verbot von Telefonkontakt zu den Eltern im Einzelfall aufrechterhalten wer-<br />
den muss.<br />
5
4. 2. Gute Angebote, aber (zu) starre Regeln und (zu) harte Konsequenzen?<br />
Die meisten Jugendlichen schätzen die im Rahmen der FM angebotenen und in jeder Einrichtung<br />
etwas unterschiedlichen Freizeit- und Lernangebote sehr und sind stolz auf Erfolge bei sportlichen<br />
Aktivitäten. So liebte z.B. Susi das Trampolinspringen und Solaya das Klettern. Viele Jugendliche<br />
bezeichnen Ausflüge, Heimfeste und Ferienfreizeiten sogar als ihre beste Erfahrung in FM. Auch die<br />
heiminterne Schule erfährt oft hohe Wertschätzung. Selbst Jugendlichen, die schon Jahre nicht<br />
mehr in der Schule waren, macht hier das Lernen nicht selten wieder Spaß und sie ziehen einiges<br />
an Selbstbewusstsein aus ihren Leistungen.<br />
Andererseits sehen sich die Jugendlichen auch nach der – unterschiedlich langen – Eingewöhnung<br />
in das FM-Setting mit einem strengen und starren Regelwerk konfrontiert. Auch dieses Regel-<br />
werk ist m. E. als ein Paradox zu sehen: Im Bemühen der Einrichtung, „Struktur“ und „Basics“ des<br />
üblichen Sozialverhaltens zu vermitteln, müssen Jugendliche zwischen 12-17 Jahren, die sich oft<br />
weit über ihr Alter hinausgehende Freiheiten genommen haben, sich nun plötzlich an Regeln hal-<br />
ten, die ihre Freiräume und damit auch ihre Selbstverantwortung drastisch auf das Niveau von<br />
höchstens 10-, eher 8jährigen absenken.<br />
Wie kommen nun die Jugendlichen mit diesen Strukturen klar?<br />
Einerseits zeigen die Ergebnisse aus Interviews und Fragebogenerhebung, dass viele Jugendlichen<br />
dem engen Rahmen und den strengen Regeln und Konsequenzen positive Bedeutung beimessen:<br />
Nach ihrer Meinung wurde ihnen dadurch nachdrücklich deutlich gemacht, dass es auch für sie<br />
Grenzen gibt, dass sie nicht „einfach tun können, was sie wollen“ und dass ihr Handeln nicht fol-<br />
genlos bleibt. Insofern bieten die Regeln und Konsequenzen zusammen mit dem festen Tagesab-<br />
lauf einerseits Orientierung und Verlässlichkeit (die manche Jugendlichen noch nie erlebt<br />
haben) und fördern andererseits durch ihr Abschreckungs- und Strafpotential zumindest Selbstbe-<br />
herrschung, nach Meinung der meisten Jugendlichen und der Betreuenden aber auch die Fähigkeit,<br />
sich an Regeln zu halten – auch wenn die Jugendlichen sie nicht immer als sinnvoll oder für sich<br />
passend akzeptieren.<br />
Dies wird besonders in den Interviews mit Jasmin und Susi deutlich:<br />
Jasmin hat, wie schon erwähnt – nach außen hin – keine große Mühe, die Regeln einzuhalten, und<br />
ihre Betreuerin bestätigt: „Sie kam glatt durch“. Jasmin berichtet allerdings im Erstinterview von<br />
inneren Auseinandersetzungen, von Wut und Verzweiflung, wenn sie freitags abends im Heim fest-<br />
saß und sich vorstellte, wie alle ihrer Freunde zuhause jetzt in die Disco oder auf eine Party gingen.<br />
Nach einiger Zeit aber habe sie aber erkannt, dass sie das gar nicht brauche. Und im Zweitinter-<br />
view sagt sie, dass sie zwar auch vor der Unterbringung schon gewusst habe, dass „der Blödsinn,<br />
den ich damals gemacht hab, falsch“ war. Aber wichtig für sie waren:<br />
„das Eingesperrtsein und die strengen Regeln, um zu kapieren, dass es so wirklich nicht weiter<br />
geht … Das ist so ein Ding, das ich wissen musste. Das hält mich jetzt zurück, noch mal so einen<br />
Scheiß zu machen“.<br />
Susi dagegen wehrte sich immer wieder gegen die Regeln und v.a. gegen jegliche Kritik an ihrem<br />
Verhalten, denn die konnte sie zunächst nur als Abwertung ihrer ganzen Person begreifen. Sie be-<br />
6
kam dementsprechend harte Konsequenzen zu spüren, z.B. wenn sie mal wieder ausflippte, drohte<br />
oder weggelaufen war. Sie sagt im Zweitinterview, viele der Regeln, die sie in der FM weder akzep-<br />
tieren noch einhalten konnte, gebe es gar nicht in der WG, in der sie jetzt lebt. Aber sie meint, „ich<br />
musste unter Zwang lernen, mich an Regeln zu halten“ – woanders hätte sie das nie gelernt.<br />
Auch die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass sowohl die Jugendlichen wie die Betreu-<br />
enden meinen, dass die meisten Jugendlichen Fortschritte in der Regeleinhaltung gemacht hätten.<br />
Regeln und Konsequenzen und ein geregelter Tagesablauf sollen und können den Jugendlichen<br />
also neue Lernmöglichkeiten eröffnen, z.B., dass man Konflikte austragen kann, ohne das Ge-<br />
genüber zu verletzen, oder dass man sich entschuldigen und einen Schaden auch wieder gutma-<br />
chen kann und muss. Diese Konsequenzen werden zwar von den Jugendlichen auch nicht immer<br />
sofort und gerne akzeptiert, aber sie sind vermutlich eine wichtige Basis für die Lernfortschritte<br />
der Jugendlichen im sozialen Bereich.<br />
Es gibt aber auch Konsequenzen, die, das zeigen sowohl die Ergebnisse der Interviews wie der<br />
Fragebogenerhebung von vielen Jugendlichen abgelehnt werden. Das sind v.a. längere Isolie-<br />
rung im Time-out-Raum, längerer Zimmerarrest und längere Ausgangssperren. Diese<br />
werden von den Jugendlichen vor allem als Strafe und z.T. als Demütigung erlebt.<br />
So hält Jasmin, die sich v.a. aus Angst vor Konsequenzen wie Zimmerarrest und Ausgangssperre<br />
weitgehend an die Regeln hielt und deshalb nie isoliert wurde, nicht viel von „Zimmerarrest“:<br />
„Also bei den meisten Mädchen, wenn die nach 2,3 Tagen da aus ihren Zimmern rausgekommen<br />
sind, war es noch viel schlimmer, als bevor sie da reingekommen sind. Die waren dann so was von<br />
aggressiv und voll Hass auf die Betreuer. … Dadurch, dass sie in diesem kleinen Zimmer eingesperrt<br />
sind, niemand sie versteht, nicht verstehen kann, was wirklich los war und was jetzt in ihnen<br />
vorgeht. … Und die Betreuer konnten dann gar nicht mehr auf sie eingehen … Also ich fand es<br />
keine gute Idee, dieses Einsperren. … Ich denke, bei den meisten Mädchen hätte einfach nur reden<br />
geholfen.“<br />
Bei Susi hat sich die Ablehnung von Isolation und Zimmerarrest nach einem Jahr sogar noch<br />
verstärkt. Sie meint im Zweitinterview:<br />
„Und im Heim hat man Zimmer gekriegt, drei Tage lang … durftest du da schmoren wie ne Bescheuerte,<br />
durftest gar nichts machen, und hinterher wurde gar nicht groß darüber gesprochen.<br />
Also man ist zwar bestraft worden, aber direkt auf die Situation bezogen wurde da kaum was gemacht.“<br />
Ganz ähnlich äußert sich Solaya, die empört berichtet, sie habe drei Wochen Zimmerarrest be-<br />
kommen, weil sie ein Handy eingeschmuggelt hatte:<br />
„Das ist, das ist echt schlimmer als Knast. ... Also das kann ich nicht vergessen.“<br />
Als Strafen und „Verhinderungspädagogik“ scheinen längere Isolation und längere Ausgangssper-<br />
ren also v.a. für das FM-Setting funktional, denn sie stoppen zunächst weiteres Fehlverhalten und<br />
verhindern Konflikteskalationen. Doch scheinen sie die Jugendlichen vor allem auf Gehorsam zu<br />
konditionieren, auch wenn sie zum „Nachdenken“ anregen sollen. Solche und andere als „zu hart“<br />
erlebten Konsequenzen können also statt oder neben Lerneffekten auch durch Angst bedingte<br />
Überanpassung, „innere Emigration“ und Verstellung (wie bei Jasmin) oder Rebellion und<br />
verstärkte Aggressivität (wie bei Susi) oder gar einen „Kampf gegen das System“ provozie-<br />
7
en wie bei Solaya. Auch Traumatisierungen oder Retraumatisierungen sind möglich. Denn Iso-<br />
lation bedeutet Ausschluss – und den dürften die meisten Jugendlichen in ihrem Leben bereits zur<br />
Genüge erlebt haben, genauso dürften viele bereits schlimme Erfahrungen mit „Ausschluss durch<br />
Einschluss“ gemacht haben.<br />
Zudem erscheinen diese Konsequenzen eher „inkonsequent“, da sie nach Meinung der meisten<br />
Jugendlichen weder genügend neue Einsichten fördern, noch zum Erwerb und Training der er-<br />
wünschten neuen Kompetenzen führen und damit auch die Erfahrung von Selbstverantwor-<br />
tung und Selbstwirksamkeit verhindern. Durch diese Art von Konsequenzen scheint also viel<br />
wichtige Zeit zum Lernen und zur Neuorientierung verloren zu gehen: So berichten die Ju-<br />
gendlichen nicht nur von tagelangem Zimmerarrest, sondern auch von langen bzw. wiederholten<br />
Ausgangssperren. Solaya gibt z.B. an, dass sie nach 3 Monaten erstmals für 10 Minuten in den<br />
offenen Hof durfte.<br />
Als Fazit zu diesem Abschnitt – einige Fragen:<br />
� Wird bei der Wahl der Konsequenzen genügend darauf geachtet, dass (Re-) Traumatisie-<br />
rungen der Jugendlichen so weit wie möglich vermieden werden?<br />
� Wären auch in FM weniger „inkonsequente“ und noch mehr „konsequente“ Konsequenzen<br />
möglich, nämlich solche, die konsequent Einsicht und neue soziale Kompetenzen fördern?<br />
� Wäre mehr Mitbestimmung und mehr Individualisierung der Regeln und Konsequenzen<br />
und der Lernziele möglich oder wäre das „ungerecht“ oder eine Überforderung der Betreu-<br />
enden und der anderen Jugendlichen?<br />
� Ist die Diskrepanz zwischen Rahmen und Regeln im Heim und dem Leben danach vielleicht<br />
zu groß, um den nötigen „Transfer“ zu gewährleisten?<br />
4.3 Beziehungen im FM-Setting:<br />
Strukturell belastet – aber auch belastbar und von zentraler Bedeutung!<br />
Nicht nur die Betreuten, sondern auch die Betreuenden müssen sich also immer wieder mit Sinn<br />
und Widersinn der geltenden Regeln und Konsequenzen auseinandersetzen. Zudem reichen sie<br />
allein keinesfalls aus, um die Jugendlichen zu (dauerhaften) Verhaltensänderungen zu motivieren.<br />
Vielmehr ist es das „Gesamtkunstwerk der FM“, die Mischung aus Rahmen, Regeln, Konsequenzen,<br />
Angeboten, Gruppenleben und der intensiven Betreuung, die zu Veränderungen führen.<br />
Die Herstellung einer pädagogischen Beziehung mit den Jugendlichen wird in der Jugendhilfe all-<br />
gemein – aber auch von Betreuenden in FM und den dort betreuten Jugendlichen selber – als zent-<br />
rales Element des pädagogisch-therapeutischen Settings angesehen. Aber der Aufbau und die Wir-<br />
kung von Beziehungen in FM unterliegen strukturellen Belastungen:<br />
� Anders als in offenen Einrichtungen leiten in FM die Betreuenden ihre Autorität und ihren<br />
Machtüberhang gegenüber den Betreuten nicht nur aus ihrer Rolle als Erwachsene und als<br />
Pädagogen ab, sondern auch aus ihrer strukturell vorgegebenen Rolle als „Bewacher“, die<br />
nicht nur die Macht haben, die Jugendlichen zu bestrafen, sondern auch festzuhalten und<br />
einzusperren. Heißt das auch, dass unter diesen Bedingungen gar keine „echte“ pädagogi-<br />
sche Beziehung entstehen kann, wie Kritiker der FM immer wieder vermuten? Denn in FM<br />
8
werde gegen ein weiteres wichtiges Prinzip der Jugendhilfe verstoßen, nämlich, dass eine<br />
pädagogisch wirksame Beziehung Freiwilligkeit seitens der Betreuten erfordert.<br />
� Verstoßen wird in FM zudem gegen ein weiteres Prinzip, nämlich gerade diesen Jugendli-<br />
chen, die in ihrem sozialen Umfeld meist schon viele Beziehungsabbrüche erlebt haben, in<br />
der stationären Jugendhilfe die größtmögliche Beziehungskontinuität zu sichern. In FM<br />
ist dagegen der das Ende der pädagogischen Beziehung oft schon dadurch vorprogram-<br />
miert, dass der Freiheitsentzug laut Gesetz so schnell wie möglich wieder beendet werden<br />
muss und dass die Jugendlichen ihre Beschlüsse kennen, in denen die Familiengerichte die<br />
Dauer der FM in der Regel auf 6-12 Monate festlegen. Möglicherweise wird der FM-<br />
Aufenthalt – oft gegen den Willen der Jugendlichen - aber auch noch einmal verlängert: Die<br />
pädagogische Beziehung ist also eine „Beziehung auf Abruf“.<br />
� Die dritte wesentliche strukturelle Belastung für den Aufbau von Beziehungen stellt die Tat-<br />
sache dar, dass in der FM Jugendliche konzentriert sind, die vielfach unter erheblichen Be-<br />
ziehungsstörungen leiden und meist schon viele negative Beziehungserfahrungen ge-<br />
macht haben – die durch das „Eingesperrtwerden“ noch verstärkt werden.<br />
Diese strukturellen Belastungen stellen also wahrlich nicht die günstigsten Voraussetzungen für<br />
einen Beziehungsaufbau dar. Trotzdem, so zeigen sowohl die Interviews wie die Fragebogenerhe-<br />
bung, schätzen viele, wenn auch nicht alle Jugendliche zumindest zum Schluss ihrer FM die intensi-<br />
ve Betreuung und die Erfahrung von Wertschätzung, Unterstützung, Fairness, Verständnis, Verläss-<br />
lichkeit, Vertrauen seitens der Betreuenden als positiv und wichtig für ihre eigene Entwicklung ein.<br />
Die große Mehrheit der Jugendlichen meint auch, dass sie durch die Beziehungen vor allem zu den<br />
Bezugsbetreuern, aber auch zu den anderen Betreuenden und den Jugendlichen viel oder doch<br />
zumindest einiges für den Umgang mit anderen Menschen gelernt hätten.<br />
Auch viele Betreuende sind überzeugt, dass sie zu vielen Jugendlichen „tragfähige“ und „vertrau-<br />
ensvolle“ Beziehungen aufbauen konnten und dass manche Jugendlichen in FM erstmals Verläss-<br />
lichkeit und gegenseitiges Vertrauen in Beziehungen zu Erwachsenen erlebt und für ihre Entwick-<br />
lung genutzt haben. Denn erst auf dieser Basis sei es gelungen, Sozialverhalten und Selbstreflexion<br />
der Jugendlichen positiv zu beeinflussen.<br />
Andererseits verhalten sich die Betreuenden in den Augen der Jugendlichen nicht immer perfekt.<br />
Die durchaus auch deutlich geäußerte Kritik der Jugendlichen lautet:<br />
� manche Betreuenden würden „gleich eine Strafe geben, statt zuzuhören“,<br />
� sie seien auch „manchmal ganz schön ungerecht“,<br />
� „manche machen nur ihren Job“,<br />
� und es wird auch Angst vor möglicher Willkür geäußert: „die können mit uns machen, was<br />
sie wollen“.<br />
Diese Sicht der Betreuten auf ihre Betreuer mag in FM nicht viel anders sein als in offenen Einrich-<br />
tungen. Doch fällt auf, dass viele der in FM betreuten Jugendlichen in den Interviews davon spre-<br />
chen, dass sie sehr lange gebraucht haben, bis sie erkannten, dass die Betreuenden ihnen nicht<br />
gleichgültig oder böswillig gegenüberstehen, und bis sie ihr Misstrauen überwunden hatten. Manche<br />
berichten auch, dass sie gar kein Vertrauen aufbauen konnten. Diese Probleme dürften nicht nur<br />
den negativen Vorerfahrungen der Jugendlichen zuzuschreiben sein, sondern auch der zwangswei-<br />
9
sen Unterbringung und der Doppelrolle der Betreuenden – wobei wir die jeweiligen Anteile natürlich<br />
nicht genau ermitteln können.<br />
Die geschilderte Bandbreite der Beziehungen findet sich auch bei Jasmin, Susi und Solaya:<br />
Jasmin ist anfangs sehr misstrauisch gegen die Betreuenden und hält Kontakt zunächst v.a. zu den<br />
anderen Mädchen, meint aber im Erstinterview:<br />
„Man bekommt einen sehr guten <strong>Dr</strong>aht zu den Betreuern mit der Zeit! … Ich brauche einfach auch<br />
Erwachsene zum Reden und habe gemerkt, dass sie nicht so mit mir reden wie z.B. mein Jugendamt,<br />
sondern dass sie einfach mit mir reden als Mensch. Dass sie mich verstehen können.“<br />
Zudem hilft es ihr sehr, dass die Betreuerin auch dann ruhig bleibt, wenn es Konflikte gibt, und<br />
Jasmin, die sich mit ihrer Mutter oft nur noch angebrüllt hat, wird selber ruhiger.<br />
Jasmin gewinnt zudem, so wird im Zweitinterview deutlich, durch ihre soziale Kompetenz eine be-<br />
sondere Nähe zu zwei Pädagoginnen, die den Regeln und Konsequenzen selber kritisch gegenüber-<br />
stehen. Dieses Verhältnis erleichtert es ihr, mit deren Doppelrolle umzugehen und deren pädagogi-<br />
sche Kompetenz für ihre Entwicklung zu nutzen und im System der FM gut zu überleben.<br />
Solaya dagegen kann in ihrer zweiten FM wenig von der intensiven Betreuung profitieren. Der<br />
organisatorisch bedingte Wechsel aus der Clearingstelle in ein noch strengeres FM-Setting und der<br />
Betreuerwechsel stellen für sie ein großes Problem dar, auf das sie sehr aggressiv reagiert und eine<br />
Betreuerin sogar körperlich verletzt. Solaya selbst sagt, „ich mag es nicht, wenn man mich ein-<br />
sperrt“. Sie habe sich „immer von den Betreuern abgegrenzt. Ich zeig nicht so gern mein Inneres“.<br />
Auch ihre Betreuerin meint zwar, dass sie einen guten Kontakt zu Solaya herstellen konnte, aber<br />
„keine tragfähige Beziehung“: Solaya sei „höchstens oberflächlich zur Mitarbeit bereit“ gewesen.<br />
Susis Rückblick auf ihre Zeit in FM ist im Zweitinterview deutlich negativer als im Erstinterview. Sie<br />
konnte die Diskrepanz zwischen dem – begrenzten – Vertrauen, das sie zu den Betreuenden in der<br />
FM nach langem Widerstand mühsam aufgebaut hatte, und deren Macht, sie gegen ihren Willen<br />
einzusperren, für sich nicht klären:<br />
„Direkt klar gekriegt habe ich das nicht, aber man musste sich irgendwo auf die Betreuer einlassen.<br />
Hätte ich das nicht getan, wäre ich wahrscheinlich immer noch in der Geschlossenen. Egal, ob<br />
man´s will oder nicht, man muss halt machen, was die wollen, und fertig, auch wenn man keinen<br />
Sinn darin sieht.“<br />
Susis FM-Betreuerin berichtete, dass Susi lange Zeit brauchte, bis sie in den Betreuenden weniger<br />
Gegner als vielmehr Helfer sah, die es gut mit ihr meinen. Dazu kam, dass Susi große Ambivalen-<br />
zen gegenüber einer engeren Beziehung hatte, also Nähe suchte und sie dann wieder nicht ertrug,<br />
und dass sie sich auf für sie belastende Themen wie das Verhältnis zu ihren Eltern nur sehr ungern<br />
einließ. Es sei aber in der FM trotz allem gelungen ihr zu vermitteln, dass sie als Mensch gemocht<br />
werde, auch wenn ihr Verhalten oft kritisiert werden musste.<br />
„Also wenn früher ein Konflikt oder ein Abschied oder so was war, ist sie immer abgehauen. Das<br />
kann sie jetzt hier nicht. Das ist halt der „Vorteil“ von einer geschlossenen. Sie muss das jetzt hier<br />
aushalten mit uns und wir halten sie aus. Und dann merkt sie aber, es geht!“<br />
Gegen Ende der Betreuung habe Susi allerdings von sich aus durch verstärktes Fehlverhalten die<br />
Beziehungen zerstören wollen, um sich dem Abschiedsschmerz zu entziehen.<br />
10
Schon in diesen drei Fällen wird deutlich, wie unterschiedlich die Jugendlichen ihre Beziehungen in<br />
FM gestalten können und dass es dabei durchaus Höhen und Tiefen gibt. Zudem unterliegt die<br />
Sicht der Jugendlichen auf ihre Beziehungen in den FM gewissen Schwankungen, je nachdem,<br />
unter welchem Aspekt sie gerade betrachtet werden.<br />
Festzuhalten ist also: Unsere Ergebnisse weisen insgesamt deutlich darauf hin, dass die Intensi-<br />
tät und die Qualität der Betreuung in FM, die von vielen Jugendlichen lobend hervorgehoben wird,<br />
den genannten strukturellen Belastungen für den Beziehungsaufbau offenbar entgegenwirken,<br />
wenn auch ein gewisser Teil der Jugendlichen sich nicht oder (zu) wenig auf das Beziehungsange-<br />
bot einlassen. Beziehungen sind also – sowohl aus Sicht der Betreuenden wie der Betreuten kei-<br />
neswegs unmöglich, sondern vielmehr quasi das „Herzstück“ der FM.<br />
4.3 Gesamtbewertung der Zeit in FM: „Es war hart, aber ich habe viel gelernt“<br />
Hier noch ein kurzer Blick auf die Gesamtbewertung der Zeit und ihrer Erfolge in FM? Trotz aller<br />
Härten der FM, die die Jugendlichen zum Ende ihrer Unterbringung benennen, antworteten 85%<br />
der Jugendlichen in der Fragebogenerhebung, die Zeit in der FM habe ihnen „viel“ gebracht und<br />
83% meinen, sie hätten „viel“ gelernt, und zwar v.a. bezüglich des Umgangs mit anderen Men-<br />
schen und mit ihren Eltern, zudem würden sie weniger „ausrasten“, hätten weniger Straftaten be-<br />
gangen und könnten mit Alkohol und <strong>Dr</strong>ogen besser umgehen. Vermutlich ist diese sehr positive<br />
Bilanz der Jugendlichen auch dadurch mitbedingt, dass sie selbst stolz darauf sind, dass nun zu-<br />
mindest Teilziele des Hilfeplans erreicht sind, so dass sie entlassen werden können, und dass sie<br />
diese Zeit ihres Lebens nicht (nur) als „verlorene Jugendzeit“ verbuchen wollen. So sagt z.B. Susi,<br />
die sehr stolz ist auf ihren guten Hauptschulabschluss: „Ich hab’ die Geschlossene gebraucht, aber<br />
wünschen tu ich’s keinem!“<br />
Die Betreuenden schätzen die Fortschritte der Jugendlichen deutlich „vorsichtiger“ und entspre-<br />
chend niedriger ein, sind aber ganz überwiegend der Meinung, dass der Freiheitsentzug die geeig-<br />
nete Maßnahme für die beurteilten Jugendlichen war.<br />
4.4. Übergänge: Entlassung und Neubeginn als Krise und Chance<br />
Doch was ist aus den Jugendlichen nach einem Jahr geworden? Unsere Wiederholungsbefragung<br />
kann erste Antworten liefern auf die generellen Fragen:<br />
� Ob und wie weit gelingen „im wahren Leben nach der FM“ der Transfer und die Weiter-<br />
entwicklung des Gelernten im Sinne eigener Ziele der Jugendlichen ?<br />
� Was also passiert, wenn der <strong>Dr</strong>uck und der Zwang der FM nachlassen?<br />
11
Dazu zunächst eine Übersicht:<br />
Verbleib der Jugendlichen nach der FM insgesamt/<br />
Anschlussmaßnahme nach FM<br />
stationäre Erziehungshilfen<br />
Mutter/Eltern<br />
aktueller Aufenthalt nach 10-14 Monaten:<br />
stationäre Erziehungshilfen<br />
Mutter/Vater/Oma<br />
kein fester Wohnsitz<br />
Haft oder U-Haft<br />
Freundin<br />
unklar<br />
Mädchen<br />
23<br />
22<br />
1<br />
Jungen<br />
13<br />
12<br />
1<br />
Jugendliche ins-<br />
ges. 36<br />
Von den 36 Jugendlichen in FM war für 34 eine weitere stationäre Erziehungshilfe geplant, die<br />
auch von allen Jugendlichen begonnen wurde. Der Aufenthalt von 2 Mädchen ist uns nach Ab-<br />
bruch ihrer Erziehungshilfe nicht bekannt.<br />
Nach ca einem Jahr befinden sich nur noch – oder immerhin noch - 17 Jugendliche in den an FM<br />
11<br />
anschließenden Erziehungshilfen oder auch – z.T. nach Unterbrechungen – in anderen Maßnahmen.<br />
Ein Junge ist – nach Aufenthalt bei seinen Eltern und im Gefängnis – sogar wieder geschlossen<br />
untergebracht. 2 Mädchen konnten von einer Wohngruppe in eine Verselbständigungsgruppe bzw.<br />
ins Betreute Einzelwohnen überwechseln.<br />
13 dieser Jugendlichen gehen zur Schule, 4 machen eine Ausbildung oder ein soziales Jahr. Diese<br />
Jugendlichen konnten also – mit mehr oder weniger Problemen - das „Moratorium“ oder die „Puf-<br />
ferzone“ nutzen, die die Jugendhilfe klugerweise zwischen die FM, die den Jugendlichen vergleichs-<br />
weise wenig Selbstständigkeit abverlangt, und der von den Jugendlichen ihrem Alter gemäß erwar-<br />
teten Verselbständigung nutzen.<br />
9 Jugendliche leben derzeit wieder bei ihren Müttern, ein Mädchen lebt derzeit bei ihrem Vater,<br />
eine bei ihrer Oma. Ein Junge lebt bei seiner Freundin und deren Mutter. Die – doch recht häu-<br />
fige – Rückkehr zur Familie bzw. die Einquartierung bei der Freundin waren meist Folge – oder<br />
auch bewusstes Ziel – von Abbrüchen der Anschlussmaßnahmen sowie der damit verbundenen<br />
Schul- und Ausbildungsarrangements. Die frühesten Abbrüche erfolgten bereits nach wenigen Ta-<br />
gen, der späteste erst nach knapp einem Jahr und kurz vor der regulären Beendigung der Maß-<br />
nahme.<br />
D.h.: ein Teil der Abbrüche erfolgte von Seiten der Einrichtungen, weil die Jugendlichen mit der<br />
größeren Freiheit nicht umgehen konnten und wesentliche Regeln verletzten oder wieder straffällig<br />
wurden. Ein Teil der Abbrüche wurde aber auch von den Jugendlichen selbst veranlasst: So man-<br />
cher dieser Jugendlichen war „jugendhilfemüde“ und wollte „einfach endlich nachhause“ und wieder<br />
7<br />
3<br />
2<br />
--<br />
--<br />
6<br />
4<br />
--<br />
2<br />
1<br />
34<br />
2<br />
17<br />
11<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
12
nach eigenem Gusto und ohne strenge Regeln leben: Sie waren also eher „rückkehr- und rück-<br />
zugsorientiert“ als zukunftsorientiert. Manche auch haben den Wechsel von der FM in die Folge-<br />
maßnahme nicht verkraftet. Dies hängt vermutlich auch damit zusammen, dass sie mit den<br />
Betreuenden in den Folgemaßnahmen nicht klar kamen. Sie bescheinigen ihren BetreuerInnen in<br />
der FM nicht selten die besseren Qualitäten: In der FM hätten sie mehr Verständnis, Wertschät-<br />
zung, Vertrauen und auch Schutz erfahren haben als in den Folgeeinrichtungen (so meinte ein<br />
Junge: „In der Geschlossenen haben die besser auf uns aufgepasst“).<br />
Die Gründe hierfür können in der gerade erwähnten Qualität und Intensität der Betreuung (die<br />
offene Einrichtungen wegen der geringeren Personaldichte gar nicht leisten können) liegen, aber<br />
auch darin, dass gerade diese Jugendlichen den mehr oder weniger erzwungenen Betreuer-Wechsel<br />
bei Beendigung der FM nicht gut verkraften, dass also die „Beziehung auf Abruf“ so, wie sie in FM<br />
gegeben ist, doch ein bleibendes strukturelles Problem darstellt. Die Gestaltung der „neuen“ Bezie-<br />
hungen hängt aber auch sehr stark von Art und Konzept der Folgeeinrichtung und den dort arbei-<br />
tenden Personen sowie der individuellen „Passung“ zwischen Pädagogen und Jugendlichen und<br />
deren Zufriedenheit mit ihren aktuellen Lebensumständen ab.<br />
3 Mädchen konnten nach Abbruch ihrer Folgemaßnahmen nicht nachhause zurückkehren, sondern<br />
sind (wieder) auf der Straße bzw. ohne festen Wohnsitz, eine davon lebt in einer Jugendpension,<br />
2 Jungen sind in Haft, einer davon war vorher ebenfalls obdachlos, einer hatte vorher, ebenfalls<br />
nach Abbruch seiner Anschlussmaßnahme, bei seiner Mutter gewohnt.<br />
Bei den Jugendlichen, die eine Maßnahme abgebrochen haben, ist die Zahl derer, die noch oder<br />
wieder eine Schule besuchen, wesentlich geringer und liegt bei 3, ein Junge hat darüber hinaus<br />
eine Arbeit, 2 Jugendliche haben derzeit einen Gelegenheitsjob, eine Ausbildung macht keiner.<br />
Insgesamt ist diese Bilanz aber als eine Momentaufnahme zu betrachten: Das Leben vieler Ju-<br />
gendlicher ist noch stark in Bewegung: So manche haben noch keinen erfolgversprechenden Le-<br />
bensort gefunden, für viele steht ein erneuter Wechsel mit weiteren Anforderungen an ihre Selb-<br />
ständigkeit an, wenn die derzeitige Erziehungshilfe ausläuft, manche sind akut von einem (weite-<br />
ren) Absturz bedroht (z.B., falls ihre Mütter in den Interviews gelegentlich geäußerte <strong>Dr</strong>ohungen<br />
wahr machen und sie hinauswerfen, oder falls in noch anstehenden Gerichtsverfahren noch Haft-<br />
strafen über sie verhängt werden), manche sind aber auch auf einem aufsteigenden Ast und haben<br />
z.B. eine Wohnung oder eine Ausbildung in Aussicht.<br />
Und zum Abschluss wollen wir noch einen kurzen Blick auf das weitere Leben von Jasmin, Solaya<br />
und Susi werfen, wobei es einerseits darum geht, welche Funktionen FM für diese Mädchen erfüllen<br />
konnte, andererseits darum, was die Mädchen an Eigenheiten und Eigen-Sinn mitbringen und was<br />
in Verbindung mit den Erfahrungen in FM ihr weiteres Leben mitbestimmt.<br />
Dabei kann FM – soweit die Jugendlichen sich nicht völlig widersetzen oder der FM entziehen –<br />
verschiedene Funktionen haben, die sie für die einzelnen Jugendlichen in unterschiedlichem Maße<br />
erfüllt:<br />
� Eine Schutz- und Verhinderungsfunktion (bzgl. <strong>Dr</strong>ogen, Straftaten, Gewalt, Prostituti-<br />
on) durch die Teilgeschlossenheit,<br />
13
� Eine (quasi automatische)Förderfunktion bezüglich Schule, Regeleinhaltung, Sozial-<br />
verhalten etc., denn die Jugendlichen können sich den Lernangeboten nicht entziehen.<br />
� Die Funktion der Motivierung und Befähigung für ein sozial verträgliches, eigenständi-<br />
ges und den eigenen Wertvorstellungen entsprechendes Leben.<br />
� eine potentielle Belastungsfunktion der FM, falls es zu schädigenden Nebenwirkungen<br />
der FM gekommen ist.<br />
Jasmin bleibt ein knappes Jahr in der FM und schließt in der Heimschule erfolgreich ihre Haupt-<br />
schule ab. Sie soll anschließend noch in eine WG gehen und von dort aus eine weiterführende<br />
Schule besuchen. Dem stimmt Jasmin zwar oberflächlich zu, nutzt dann aber ihre wiedergewonne-<br />
ne Freiheit sehr bald zu einer Flucht aus der WG und setzt ihre Mutter unter <strong>Dr</strong>uck, sie wieder auf-<br />
zunehmen: Nach der einjährigen Über-Anpassung an die FM ist ihr die Anforderung, sich in eine<br />
neue Maßnahme einzugewöhnen und sich wieder anpassen zu müssen, „einfach zuviel“. Da sie nun<br />
niemand mehr zwingen kann, geht sie auch nicht in die neue Schule: Statt sich eine eigenständige<br />
Zukunftsperspektive aufzubauen, kehrt sie zu ihren alten Lebensstil zurück und verbringt die Näch-<br />
te mit ihren Freunden. Dies alles tut sie gegen den Willen der Mutter, die sich aber ebenso wenig<br />
wie früher gegen Jasmin durchsetzen kann. Jasmin verzichtet nun allerdings auf <strong>Dr</strong>ogen und auf<br />
Delinquenz und ist weniger aggressiv ihrer Mutter gegenüber. Eine Zeitlang besucht sie ein Berufs-<br />
vorbereitungsjahr, wo es ihr ganz gut gefällt, doch dieser Schulversuch endet mit einem Unfall.<br />
Wieder einigermaßen gesund, macht sie zwar bereitwillig Pläne für mögliche Ausbildungen oder<br />
zumindest Gelegenheitsjobs. Sie setzt aber keinen dieser Pläne um, sondern findet immer sofort<br />
Gründe dafür, passiv zu bleiben. So sagt sie z.B., sie sei „ein Mensch, der nicht gerne was alleine<br />
angeht“ – doch die angebotene Hilfe seitens ihrer Mutter und des Jugendamts nimmt sie nicht<br />
wahr, denn „ich weiß ja noch gar nicht, was ich wirklich machen will“. Es fehlt Jasmin also nicht nur<br />
an Kraft und Entschlossenheit, ihre Passivität zu überwinden, sondern ihr fehlt offenbar auch ein<br />
Ziel. Dies wiederum verstärkt ihre Passivität, zumal sie bald weder von ihren Freunden noch von<br />
der Jugendhilfe weitere Unterstützung erhält. Von der von ihr selbst gewünschten Verselbständi-<br />
gung und damit von einem Leben nach ihren Vorstellungen ist Jasmin nach eigenen Worten weit<br />
entfernt, es sei denn, man würde ihr unterstellen, sie wolle trotz gegenteiliger Behauptungen nichts<br />
anderes als jeder Anforderung aus dem Weg gehen und von ihrer Mutter versorgt werden.<br />
War nun die FM für Jasmin sinnlos?? Darüber lässt sich streiten, immerhin hat die FM einige Funk-<br />
tionen für Jasmin erfüllt:<br />
� Schutz- und Verhinderungsfunktion: Hier hatte die FM eindeutig positive Wirkung für<br />
Jasmin: Sie verzichtet zwar während ihrer Heimfahrten nicht ganz auf <strong>Dr</strong>ogen und Alkohol,<br />
lernt aber, sie zu reduzieren.<br />
� (automatische) Förderfunktion: Hier sieht Jasmin die positive Wirkung der FM v.a. in<br />
dem erreichten Hauptschulabschluss und meint, „draußen“ hätte sie es niemals geschafft,<br />
wieder in eine Schule zu gehen.<br />
� Motivierung und Befähigung für ein eigenständiges Leben: Hier betont Jasmin die nach-<br />
haltige Reduzierung ihres Suchtmittelkonsums und ihrer aggressiven Ausfälle sowie ihre<br />
Deliktfreiheit. Kein Transfer fand allerdings bezüglich Jasmins Erfolgserfahrung in der Schu-<br />
le statt: Sie ist zwar immer noch stolz auf ihren guten Abschluss, nutzt ihn aber bisher<br />
nicht für den von ihr „eigentlich“ angestrebten Weg in die Selbstständigkeit.<br />
14
� Potentielle Belastung durch die FM: Es scheint es im Nachhinein so, als ob die FM in<br />
bestimmter Hinsicht geradezu „Gift“ für Jasmin war, weil ihre Passivität und die offenbar<br />
dahinter liegenden Ängste sowie ihre mangelnde Motivation durch ihre soziale Kompetenz<br />
einerseits und die Zwangsstruktur des Heimalltags andererseits nur überdeckt, aber nicht<br />
angegangen wurden: Sie wurde quasi von außen bewegt, statt zu lernen, selbst etwas zu<br />
bewegen und Selbstverantwortung zu übernehmen.<br />
Solaya: Nach 4 Monaten wird die zweite FM abgebrochen mit der Begründung, Solaya habe sich<br />
nur gewehrt und die FM tue ihr nicht gut. Sie wechselt in eine Intensivgruppe derselben Einrich-<br />
tung. Die Betreuenden hoffen, Solaya würde es in diesem offenen Rahmen besser gehen und sie<br />
könne dort die nötigen Strukturierungshilfen besser annehmen. Wieweit Solaya an der Planung<br />
dieser Anschlussmaßnahme beteiligt wurde, bleibt unklar.<br />
Doch auch dieser Schritt scheitert nach kurzer Zeit, da Solaya sofort, als der durch die FM erzeugte<br />
<strong>Dr</strong>uck wegfällt, wieder ihre Vorstellung von Freiheit umsetzt, nämlich zu tun und zu lassen, was sie<br />
will. Dass die Jugendhilfe sie nun ihrerseits aus der offenen Gruppe entlässt, führt Solaya zu dem<br />
Schluss: „Die wollen mich alle nicht“ – und dies gilt nicht nur bezüglich Jugendhilfe und Jugendpsy-<br />
chiatrie, sondern genauso für ihre Mutter, zu der Solaya nach Scheitern der Anschlussmaßnahme<br />
zunächst zurückkehrt. Dort sieht sie sich aber bald durch ihre Schwester verdrängt, weshalb sie zu<br />
ihrer Oma zieht. Statt, wie von ihr geplant, ihren Realschulabschluss anzustreben, folgt ein bald<br />
abgebrochener Versuch in einem BVJ und ein kurzer Gelegenheitsjob. Sie äußert einige wider-<br />
sprüchliche Zukunftspläne, die aber alle sehr „luftig“ klingen. Relativ klar wird, dass sie und ihre<br />
derzeit „beste Freundin“ viel Zeit mit zweifelhaften Kontakten zu Männern via Internet verbringen.<br />
Solaya bewertet ihre derzeitige Situation zwar als schlecht, sieht sich aber überfordert mit dem,<br />
was sie alles regeln müsste, um festen Boden unter die Füße zu bekommen. Sie sucht oder findet<br />
keine Unterstützung in ihrem Umfeld und kann auch gar nicht formulieren, wie diese Hilfe aussehen<br />
könnte, will sich aber auf keinen Fall ans Jugendamt wenden: „Nee, die stecken mich ja sowieso<br />
nur wieder in irgendeine Unterbringung“. Für ihr derzeitiges unstetes Leben findet sie bisher offen-<br />
bar immer wieder Begleiter, die aber ebenso unstet sind.<br />
Schauen wir uns auch bei Solaya wieder an, was sie in und durch FM gewonnen und wo sie viel-<br />
leicht auch Schaden genommen hat:<br />
� Der Schutzauftrag der FM konnte Solaya zwar nach ihren Worten zeitweilig vor weiterem<br />
„Absturz“ bewahren, ist aber in der zweiten Einrichtung an Solayas aggressiver Abwehr der<br />
Geschlossenheit nach kurzer Zeit gescheitert.<br />
� Solaya meint, sie habe auch eine gewisse Förderung erfahren, in der Schule etwas er-<br />
reicht und gelernt, ihre Aggressionen besser zu kontrollieren.<br />
� Eine Motivation und Befähigung zu einem Leben nach eigenen Werten fand, darauf<br />
lässt das Zweitinterview schließen, kaum statt, ein Transfer des Gelernten ist kaum zu er-<br />
kennen, eher eine Ambivalenz zwischen dem sozialkonformen eigenständigen Leben, das<br />
sie anstreben „sollte“ und ihrem derzeitigen unsteten Leben mit zweifelhaften Begleitern.<br />
� Belastetend wirkte die FM insofern, als sie Solaya nur wenig helfen konnte, so dass sie<br />
für Solaya eher als „verlorene“ denn als gewinnbringende Zeit anzusehen ist. Zudem hat<br />
Solaya ihr (sehr begrenztes) Vertrauen in die Jugendhilfe nun offenbar endgültig verloren.<br />
Zu hinterfragen ist auch, ob der organisatorisch bedingte Wechsel von der Clearingstelle in<br />
15
eine FM-Einrichtung und der damit verbundene Beziehungsabbruch sowie der beklagte<br />
langwierige Zimmerarrest schädliche Auswirkungen hatten.<br />
Susi nutzt – nach 2 Jahren in der FM und bei der Entlassung fast 18 Jahre alt – ihre wieder-<br />
gewonnene Freiheit vor allem dazu, in der neuen Einrichtung ihre Ausbildung zu machen und Kon-<br />
takte nach „draußen“ aufzubauen. Sie hat mit den neuen Betreuenden und auch mit der der Grup-<br />
pe anfangs dieselben Probleme und Konflikte wie in der FM. Die Übergangsprobleme waren so<br />
stark, dass sie sogar zeitweise zurück in die teilgeschlossene Gruppe wollte. Der Transfer des<br />
Gelernten ist also gering, aber ihre Auflehnung hält sich doch soweit in Grenzen, dass sie einen<br />
Abbruch der Maßnahme vermeiden kann. Sie ist auch besser als früher in der Lage, die Konse-<br />
quenzen ihres Handelns zu bedenken, und verhält sich so, dass sie ihre Ausbildung, sehr wichtig<br />
ist, fortsetzen kann. In der Ausbildung hat sie erstaunlich wenig Probleme, fühlt sich dort allgemein<br />
anerkannt und von einer Anleiterin besonders gut unterstützt. Auch ihre Betreuerin berichtet, dass<br />
die Ausbilder mit Susi sehr zufrieden seien. Es scheint also, dass Susi sehr viel Selbstvertrauen<br />
daraus zieht, dass sie in der neuen Umwelt die von ihr selbst angestrebte Zukunftsperspektive<br />
aktiv und erfolgreich umsetzen und dadurch schließlich selbständig und unabhängig werden kann.<br />
Da ihre Zukunftspläne mit denen der Jugendhilfe und ihrer Eltern weitgehend konform gehen,<br />
erfährt sie auch von dieser Seite inzwischen viel Anerkennung. In ihrem Zweitinterview stellt sie ihr<br />
aktuelles Leben in der Folgemaßnahme als weitgehend problemlos dar. Dem widerspricht ihre<br />
Betreuerin: „Susi will unbedingt perfekt dastehen, deshalb fällt es ihr umso schwerer, sich mit ih-<br />
ren Fehlern auseinanderzusetzen“. Jedenfalls scheint Susi insgesamt auf einem guten Weg in ihre<br />
Zukunft. Sie steuert derzeit schon den „Aufstieg“ in die Verselbständigungsgruppe als weiteren<br />
wichtigen Schritt an: „Und irgendwann ist man dann ganz auf sich allein gestellt und dann ist man<br />
an dem Punkt – dann hab ich es letztendlich geschafft“<br />
� Auch Susi hat nach eigenen Worten die Schutzfunktion der FM gebraucht: „Sonst wäre<br />
ich jetzt endgültig auf der Straße“.<br />
� Susi hat von der Förderung vor allem im schulischen und – trotz aller Widerstände und<br />
Rückfälle – auch im sozialen Bereich erheblich profitiert und gelernt, ohne Alkohol und<br />
Straftaten auszukommen.<br />
� Bei Susi scheint die Motivation und Befähigung zu einem Leben nach eigenen Wer-<br />
ten von allen drei Mädchen am besten gelungen, wobei Susi die für sie relevanten Werte<br />
erst einmal für sich entwickeln musste: Anders als Jasmin nutzt sie ihren guten Haupt-<br />
schulabschluss als Sprungbrett in eine Ausbildung, in der sie gut vorankommt. Dafür nimmt<br />
sich auch die weiter bestehenden, wenn auch inzwischen reduzierten Probleme in der WG<br />
auf sich.<br />
� Auch bei Susi stellt sich die Frage nach schädigenden Wirkungen der FM, und hier liegt<br />
es nahe, an eine Traumatisierung durch die für sie demütigende häufigere und längere Iso-<br />
lierung zu denken.<br />
Fazit: Die Jugendlichen stehen nach einem Jahr keineswegs alle in den Startlöchern zu einem in<br />
ihren Augen gelingenden Leben, aber immerhin die Hälfte kann jetzt wieder offene Einrichtungen<br />
für sich nutzen – was vor der FM nicht mehr der Fall war. Auch von denen, die sich inzwischen „ins<br />
Privatleben“ zurückgezogen haben, entwickeln einige ganz hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven<br />
16
und verbuchen zumindest Teilerfolge der FM, z.B. bezüglich geringerer Aggressivität, Straffälligkeit<br />
und <strong>Dr</strong>ogennutzung. Zudem sieht die Mehrzahl der Jugendlichen den Erfolg, dass sie ohne FM<br />
längst völlig „abgestürzt“ wären, sie würdigen also zumindest die Schutzfunktion von FM. Nur in<br />
wenigen Fällen meinen die Betreuenden oder die Jugendlichen selber, FM habe gar nichts gebracht<br />
oder sei sogar nachteilig gewesen, und nur selten scheint ihre Situation ein Jahr nach der Entlas-<br />
sung aus der FM genauso schlimm oder noch schlimmer als vor der FM! Und das lässt, trotz aller<br />
mit Freiheitsentzug verbundenen Probleme und Fragen doch eine vorsichtig positive Bilanz zu!<br />
Literatur:<br />
Hoops, Sabrina / <strong>Permien</strong>, <strong>Hanna</strong>: „Mildere Maßnahmen sind nicht möglich!“<br />
Freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 1631 b BGB in Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie.<br />
DJI München.<br />
Kostenlos zu bestellen bei: permien@dji.de<br />
Oder download: www.dji.de/freiheitsentzug<br />
<strong>Permien</strong>, <strong>Hanna</strong>: „Es war Schocktherapie!“ Wirkungen und Nebenwirkungen freiheitsentziehender<br />
Maßnahmen aus der Sicht von Jugendlichen. EREV-Schriftenreihe 4/2006, S. 8-30<br />
17