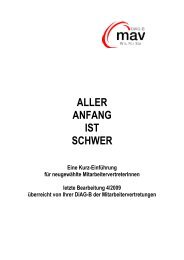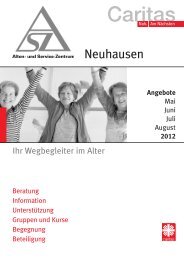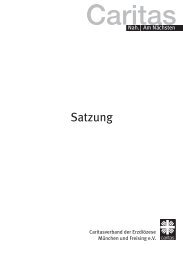2 4 - Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.v.
2 4 - Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.v.
2 4 - Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.v.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Neue Armut <strong>und</strong> ihre Folgen<br />
Jahresbericht 2004/05<br />
<strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Erzdiözese</strong> <strong>München</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Freising</strong> e.V.
Inhalt <strong>und</strong> Impressum<br />
Inhalt<br />
Vorwort des Vorstands Seite 3<br />
Neue Armut <strong>und</strong> ihre Folgen. Caritas tut Not.<br />
Dr. Elke Hümmeler Seite 4<br />
Wandlungsprozesse <strong>und</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ungen gestalten<br />
Hans Lindenberger Seite 6<br />
Bleibt die soziale Gerechtigkeit auf <strong>der</strong> Strecke?<br />
Wilhelm Dräxler Seite 9<br />
Mit Strategie gegen die Not<br />
Johanna Schilling Seite 11<br />
Nur die schnelle Vermittlung hilft weiter<br />
Wolfgang Obermair Seite 14<br />
Aufgaben vor Ort verän<strong>der</strong>n sich<br />
Zahlen - Daten - Fakten 2004 Seite 17<br />
Hohe Qualität sorgt für Anerkennung<br />
Ludwig Mittermeier Seite 22<br />
Meine Wohnung kam mir fast wie<br />
ein Gefängnis vor...<br />
Norbert Huber / Willibald Strobel-Wintergerst Seite 24<br />
Kin<strong>der</strong>reich <strong>und</strong> ohne Arbeit in <strong>München</strong><br />
Axel Hannemann Seite 27<br />
Vom Managersessel in die Schuldnerfalle<br />
Susanne Liebmann / Michael Geiben Seite 30<br />
Arbeitssuche auf vier Rä<strong>der</strong>n<br />
Angelika Schmidbauer Seite 32<br />
Armut ist erblich<br />
Hubertus Janas Seite 36<br />
Wohin mit all‘ dem Geld?<br />
Dr. Thomas Steinforth Seite 39<br />
„Wert-volle“ Angebote<br />
Viola Treudler Seite 42<br />
Frauen für Führung motivieren <strong>und</strong> för<strong>der</strong>n<br />
Ab sofort finden Sie unseren aktuellen Jahresbericht 2004/05<br />
Kontakt<br />
Allgemeine Informationen<br />
Antonie Mousavi<br />
Telefon: (089) 5 51 69-260<br />
Spenden <strong>und</strong> Mitglie<strong>der</strong><br />
Spen<strong>der</strong>betreuung:<br />
Monika Huber<br />
Telefon: (089) 5 51 69-222<br />
Mitglie<strong>der</strong>betreuung:<br />
Angela Pechel<br />
Telefon: (089) 5 51 69-465<br />
Hilfsprojekte im Ausland:<br />
Hubertus Janas<br />
Telefon: (089) 5 51 69-291<br />
Mobil: o1 70-561 40 75<br />
Spendenkonten:<br />
Liga-Bank <strong>München</strong><br />
Kto. 229 77 79<br />
BLZ 750 903 00<br />
Bank für Sozialwirtschaft<br />
Kto. 181 78 01<br />
BLZ 700 205 00<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong><br />
<strong>München</strong> <strong>und</strong> <strong>Freising</strong> e.V.<br />
Hirtenstraße 4, 80335 <strong>München</strong>,<br />
Abteilung Kommunikation <strong>und</strong><br />
Sozialmarketing, Leitung: Elmar Pabst<br />
Telefon: (089) 5 51 69-0<br />
Telefax: (089) 5 50 42 03<br />
eMail: info@caritasmuenchen.de<br />
Konzept <strong>und</strong> Redaktion:<br />
Ulrike Heidecke<br />
Referat für Öffentlichkeitsarbeit<br />
Fotos:<br />
Bildarchiv <strong>der</strong> Caritas<br />
Gestaltung:<br />
www.ideeeins.de, Augsburg<br />
Druck:<br />
www.senser-druck.de, Augsburg<br />
Juli 2005<br />
auch im Internet zum Nachlesen <strong>und</strong> Downloaden: www.caritasmuenchen.de
Neue Armut <strong>und</strong> ihre Folgen. Caritas tut Not.<br />
Hans Lindenberger Wolfgang Obermair<br />
Vorstand des Diözesan-<strong>Caritasverband</strong>s<br />
Vorwort des Vorstands<br />
Noch während dieser Jahresbericht entstand, hat sich die politische Landschaft in Deutschland verän<strong>der</strong>t.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> geplanten Neuwahlen im Herbst des Jahres werden Korrekturen bzw. Nachbesserungen an <strong>der</strong><br />
Arbeitsmarktreform Hartz IV vorgenommen. So sollen nach <strong>der</strong>zeitigem Stand ältere Erwerbslose künftig<br />
länger das vom Einkommen abhängige Arbeitslosengeld I beziehen, bevor sie auf das einheitliche Arbeits-<br />
losengeld II zurückgestuft werden.<br />
Abgesehen davon, dass in <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Situation niemand voraussehen kann, welche Regelungen wie<br />
in die Praxis umgesetzt werden, wenn die B<strong>und</strong>esbürger neu gewählt haben, ist die Verlängerung von Über-<br />
gangsfristen allein sicher keine Lösung für Menschen, die vor allem eins wollen: Arbeit. Wichtiger wären<br />
langfristige Reformkonzepte, die Erwerbsfähige je<strong>der</strong> Qualifizierung <strong>und</strong> jeden Alters Beschäftigung bieten.<br />
Das wichtigste Prinzip bei einem wie auch immer vorangetriebenen Umbau sozialer Strukturen muss sein,<br />
Menschen nicht zu Almosenempfängern zu machen <strong>und</strong> unseren Sozialstaat zum reinen Fürsorgestaat.<br />
Menschen haben soziale Rechte, <strong>und</strong> dazu gehört vor allem das Recht auf Arbeit <strong>und</strong> infolge dessen das<br />
Recht auf Bildung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit z. B., denn wer keine Arbeit hat, hat in <strong>der</strong> Regel auch keinen Zugang zu<br />
einer Vielzahl von Angeboten <strong>und</strong> Möglichkeiten, die besser Gestellten zur Verfügung stehen.<br />
Soziale Ausgrenzung droht aber nicht nur denjenigen, die ihre Arbeit verlieren, son<strong>der</strong>n auch jenen, die<br />
noch keine haben o<strong>der</strong> keine mehr brauchen - Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> alte Menschen - o<strong>der</strong> solchen, die von vornherein<br />
zu den Benachteiligten gehören - Flüchtlinge <strong>und</strong> ausländische Mitbürger z.B. Quer durch alle gesellschaft-<br />
lichen Schichten <strong>und</strong> Generationen macht sich eine neue Form von Armut breit, die wir nicht mehr in den<br />
Griff bekommen werden, wenn wir sie nicht zügig <strong>und</strong> nachhaltig bekämpfen.<br />
Die alte Gerechtigkeitsformel „Jedem das Seine“ darf nicht zur leeren Formel verkommen, <strong>und</strong> Solidarität<br />
passt heute mehr denn je in die Zeit. Solidarität for<strong>der</strong>t von einer Gesellschaft, dass die Starken für die<br />
Schwachen einstehen <strong>und</strong> dass die Benachteiligten eine Form <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung erfahren, die sie in die Lage<br />
versetzt, ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. För<strong>der</strong>n <strong>und</strong> For<strong>der</strong>n müssen stets Hand<br />
in Hand gehen. Menschen Arbeit zu geben, bedeutet, sie ein Stück weit aus <strong>der</strong> Armutsfalle herauszuholen<br />
- als Caritas för<strong>der</strong>n wir deshalb Befähigungs- <strong>und</strong> Beschäftigungsinitiativen, die Menschen darin unter-<br />
stützen, ihre Lebenschancen zu ergreifen. Als Vorsorge vor dem Notfall <strong>und</strong> als Hilfe in <strong>der</strong> Not.<br />
Hans Lindenberger<br />
Wolfgang Obermair<br />
3
Dr. Elke Hümmeler<br />
Ordinariatsrätin<br />
<strong>und</strong> Vorsitzende<br />
des Caritasrats<br />
4<br />
Dr. Elke Hümmeler<br />
Wandlungsprozesse <strong>und</strong> Verän<strong>der</strong>ungen gestalten<br />
Mit dem Weggang von Vorstand Dr. Albert Hauser <strong>und</strong> dem Ausscheiden von Vorstand Joachim Wiedemann<br />
ging das Jahr 2004 für den Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> mit einem regelrechten „Silvesterknall“ zu Ende:<br />
Während Joachim Wiedemann sich nach elfjährigem erfolgreichen Wirken in den wohlverdienten Ruhe-<br />
stand verabschiedete, war Dr. Albert Hauser von <strong>der</strong> Sächsischen Landesregierung zum Staatssekretär im<br />
Dresdener Sozialministerium ernannt worden. Damit stand nach dem Amtswechsel an <strong>der</strong> Verbandsspitze<br />
im Jahr zuvor ein Revirement gleich auf zwei Vorstandspositionen an.<br />
Das gleichzeitige Ausscheiden von zwei Vorstandsmitglie<strong>der</strong>n stellte die Caritas in <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> zwar vor<br />
eine Umbruchsituation, die jedoch durch die Bestellung von Wolfgang Obermair (48) zum neuen Vorstands-<br />
mitglied ab 1. Januar 2005 schnell aufgefangen werden konnte. Gemeinsam mit Caritasdirektor Monsignore<br />
Lindenberger führt er den Verband als verantwortlicher Vorstand für die Trägereinrichtungen <strong>und</strong> Beteili-<br />
gungen sowie kommissarisch das Wirtschaftsressort bis zur Bestellung eines neuen dritten Vorstands.<br />
Wolfgang Obermair, bis dahin verantwortlicher Geschäftsführer des Caritas-Instituts für Bildung <strong>und</strong> Ent-<br />
wicklung, gehört <strong>der</strong> Caritas seit fast 25 Jahren an. Ursprünglich aus <strong>der</strong> Altenpflege kommend, ist er ein<br />
praxiserfahrener Mann <strong>der</strong> Tat, <strong>der</strong> sich als innovativer Gestalter notwendiger Verän<strong>der</strong>ungsprozesse einen<br />
Namen gemacht hat. Als Verantwortlicher für Personal- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung hat er wesentlich an<br />
<strong>der</strong> Neuorganisation des Diözesan-<strong>Caritasverband</strong>s in den Jahren 1991 <strong>und</strong> 1997 mitgewirkt.<br />
In einer Zeit, in <strong>der</strong> unser Sozialstaat vor einschneidenden Verän<strong>der</strong>ungen steht, braucht die Caritas eine<br />
Führung, die Verän<strong>der</strong>ungen, Wandlungsprozesse <strong>und</strong> Umbau verträglich gestalten kann. Kardinal Wetter<br />
hat in seiner programmatischen sozialpolitischen Silvesterpredigt zum Jahreswechsel 2004/05 gesagt:<br />
„Humanität ist keine starre Größe, ..., sie muss immer neu lebendig gehalten werden.“ Die Lebendigkeit<br />
<strong>der</strong> Caritas in <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> kündet von diesem notwendigen, ständigen Anpassungsprozess. Insbeson-<br />
<strong>der</strong>e ihr Engagement in Bereichen, die von Staat <strong>und</strong> Kommunen nicht ausreichend finanziert werden - z. B.<br />
Sozialstationen - o<strong>der</strong> auch gar nicht finanziert werden - z. B. die gemeindeorientierte Sozialarbeit - beweist,<br />
dass die Caritas nah am Nächsten ist.<br />
Die humane Ausrichtung des Verbands zeigt sich nach außen durch die Hinwendung zum hilfebedürftigen<br />
Menschen, nach innen durch ein partnerschaftliches Miteinan<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen,<br />
die hochengagiert <strong>und</strong> professionell tätig sind. Unter <strong>der</strong> Führung des ehemaligen Vorstandsgremiums mit<br />
Caritasdirektor Prälat Neuhauser, Dr. Albert Hauser <strong>und</strong> Joachim Wiedemann ist die Caritas zu einer großen<br />
Non-Profit-Organisation geworden, die ihre Aufgaben inhaltlich, aber auch finanziell verantwortlich, in<br />
hervorragen<strong>der</strong> Weise ausgeführt hat. Die <strong>Erzdiözese</strong> ist stolz auf ihren <strong>Caritasverband</strong>. Er steht gut da,<br />
<strong>und</strong> er nimmt seinen Auftrag, Lebensäußerung <strong>der</strong> Kirche zu sein, ernst. Er ist in unseren Pfarreien verwur-<br />
zelt <strong>und</strong> wird von ihnen getragen. Das beste Zeichen dafür ist das große Engagement, mit dem Pfarreien,<br />
Dekanate <strong>und</strong> auch <strong>der</strong> Diözesanrat <strong>der</strong> Katholiken die Aktivitäten des DiCV begleiten. In Zeiten knapperer<br />
Gel<strong>der</strong> erfahren die Menschen, dass Caritas Kirche <strong>und</strong> Kirche Caritas ist.
�<br />
��<br />
Angeschlossene Fachverbände<br />
IN VIA Kath. Mädchensozialarbeit e.V.<br />
Diözesanverband <strong>München</strong> u. <strong>Freising</strong><br />
Goethestraße 9, 80336 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 28 28 24<br />
Telefax: (089) 28 84 13<br />
invia.muenchen@t-online.de<br />
Katholische Jugendfürsorge <strong>der</strong><br />
<strong>Erzdiözese</strong> <strong>München</strong> u. <strong>Freising</strong> e.V.<br />
Adlzreiterstraße 22, 80337 <strong>München</strong><br />
agke@kjf-muenchen.de<br />
Telefon: (089) 74 64 7-0<br />
Telefax: (089) 74 64 7-278<br />
Katholischer Männerfürsorgeverein<br />
<strong>München</strong> e.V.<br />
Lindwurmstraße 75 (Rgb.),<br />
80337 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 5 14 18-0<br />
Telefax: (089) 5 14 18-36<br />
christa.slama@kmfv.de<br />
www.obdachlosenhilfe.de<br />
Organigramm / angeschlossene Fachverbände<br />
Katholisches Jugendsozialwerk<br />
<strong>München</strong> e.V.<br />
Forstenrie<strong>der</strong> Allee 107<br />
81476 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 74 51 53-0<br />
Telefax: (089) 74 51 53-19<br />
gst@kyw.de<br />
Kreuzb<strong>und</strong> e.V.<br />
Dachauer Straße 5/IV<br />
80335 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 59 08 37 77<br />
info@kreuzb<strong>und</strong>-muenchen.de<br />
Malteser Hilfsdienst e.V.<br />
Streitfeldstraße 1<br />
81673 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 4 36 08-0<br />
Telefax: (089) 43 68 02 09<br />
werner.sonntag@maltanet.de<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
Sozialdienst katholischer<br />
Frauen e.V., <strong>München</strong><br />
Marsstraße 5<br />
80335 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 5 59 81-0<br />
Telefax: (089) 5 59 81-266<br />
info@skf-muenchen.de<br />
www.skf-muenchen.de<br />
St.-Elisabethen-Verein (KdöR)<br />
Allgäuer Straße 34<br />
81475 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 7 45 09 0-0<br />
Telefax: (089) 7 59 63 65<br />
St.-Vinzentinus-Zentralverein<br />
(KdöR)<br />
Oettingenstraße 16<br />
80538 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 21 66 6-0<br />
Telefax: (089) 21 66 6-55 70<br />
5
Hans Lindenberger<br />
Caritasdirektor<br />
Vorstand Ressort I<br />
Spitzenverband <strong>und</strong><br />
Fachqualität<br />
6<br />
Hans Lindenberger<br />
Bleibt die soziale Gerechtigkeit auf <strong>der</strong> Strecke?<br />
Chancengleichheit ist nach wie vor eine For<strong>der</strong>ung an den Staat<br />
Immer mehr Menschen haben inzwischen keine Arbeit mehr, viele seit vielen Jahren - sie sind Langzeitar-<br />
beitslose. Parallel zum permanenten Anstieg <strong>der</strong> Arbeitslosenquote in Deutschland haben sich das Ver-<br />
ständnis von Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> das Bild <strong>der</strong> Arbeitslosen in den vergangenen zehn Jahren gewandelt.<br />
Während früher viele noch weggeschaut <strong>und</strong> sich gedacht o<strong>der</strong> gar gesagt haben „selbst schuld“, ist spä-<br />
testens seit <strong>der</strong> Krise in <strong>der</strong> Bau- <strong>und</strong> <strong>der</strong> IT-Branche klar: r<strong>und</strong> 5 Millionen Menschen können nicht „einfach<br />
nur faul“ sein. Auch die Annahme, dass man sich nur ausreichend um Arbeit bemühen müsse, um welche<br />
zu erhalten, hat sich längst als brüchig erwiesen. Wenn in einer Branche o<strong>der</strong> einer Region zu wenig Stellen<br />
angeboten werden, haben viele eben keine Chance.<br />
Arbeitslosigkeit ist mehr als die Einbuße des Ein-<br />
kommens, die nur eine unter mehreren Folgeer-<br />
scheinungen ist - wenn auch die zentrale. Mit dem<br />
Verlust seiner Arbeit wird ein Mensch aus seiner<br />
gewohnten sozialen Ordnung herauskatapultiert.<br />
Im Extremfall führt das zur vollständigen Zerstö-<br />
rung seiner bisherigen sozialen Strukturen: keine<br />
Alltagsroutine mit geregelten Abläufen mehr, kein<br />
Eingeb<strong>und</strong>ensein in die Gemeinschaft von Arbeits-<br />
teams, keine Teilhabe an sinnerfüllten Verwirkli-<br />
chungschancen, keine Teilnahme am gesellschaft-<br />
lichen Leben.<br />
Eine Reduzierung des Lebens auf das reine Dasein<br />
aber verursacht bei den Betroffenen im schlimms-<br />
ten Fall verheerende innere Verwüstungen. Arbeit<br />
zu haben <strong>und</strong> damit Geld, um die eigene Existenz<br />
selbständig finanzieren zu können, ist eines <strong>der</strong><br />
zentralen Elemente im Leben des Einzelnen. Fällt<br />
es weg, verliert <strong>der</strong> Mensch ein Stück seines Selbst-<br />
verständnisses <strong>und</strong> Selbstvertrauens. Der Verlust<br />
von Arbeit ist deshalb auch ein Verlust von Würde.<br />
Hinzu kommt, dass Armut unter bestimmten Um-<br />
ständen „erblich“ werden kann, d.h. wenn den<br />
Eltern dauerhaft nicht genügend Geld zum Leben<br />
bleibt, setzt sich diese Tendenz in <strong>der</strong> nächsten<br />
Generation fort.<br />
In einer Zeit, in <strong>der</strong> Politiker, Sozialwissenschaftler<br />
<strong>und</strong> Philosophen beinah weltweit nach Wegen,<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Methoden suchen, um wie<strong>der</strong><br />
mehr Menschen „in Lohn <strong>und</strong> Brot“ zu bringen,<br />
muss dieser persönliche, psychisch-emotionale<br />
Hintergr<strong>und</strong> in die Überlegungen einfließen, denn<br />
nur dann kann man beurteilen, welche reformeri-<br />
schen Ansätze o<strong>der</strong> Umsetzungen ein Schritt in die<br />
richtige Richtung sind o<strong>der</strong> sein könnten.<br />
Die Lage ist ernst, <strong>und</strong> die Zeit drängt<br />
Die hohe Arbeitslosigkeit bringt steigende Ausga-<br />
ben <strong>und</strong> fehlende Einnahmen <strong>der</strong> Sozialversiche-<br />
rungen mit sich. Die Vorstellung, dieses Problem<br />
mit <strong>der</strong> Kürzung von Höhe <strong>und</strong> Dauer <strong>der</strong> Arbeits-<br />
losenunterstützung beheben zu können, erfüllt sich<br />
bisher nicht, weil nicht genügend offene Stellen<br />
vorhanden sind. So werden diejenigen, die ihre<br />
Arbeit verloren haben, doppelt bestraft, in dem sie<br />
nun auch noch weniger Geld für die Sicherung ih-<br />
rer Lebensverhältnisse bekommen.<br />
Das wirft die Frage nach dem rechten Verständnis<br />
von Sozialpolitik auf: Ist sie ein Instrument <strong>der</strong> Le-<br />
bensstandardsicherung, eine gesellschaftliche Ver-<br />
pflichtung gegenüber den Benachteiligten, ein Ge-<br />
bot <strong>der</strong> Nächstenliebe? O<strong>der</strong> dient sie <strong>der</strong> ökono-<br />
mischen Optimierung? Mo<strong>der</strong>ne Sozialpolitik ist<br />
viel mehr als das: sie gibt den Menschen Gr<strong>und</strong>si-<br />
cherung <strong>und</strong> -sicherheit im demokratischen Sinn<br />
<strong>und</strong> sorgt für gleiche Lebenschancen. Diese Gr<strong>und</strong>-<br />
sicherheit ist in Artikel 22 <strong>der</strong> Allgemeinen Erklä-<br />
rung <strong>der</strong> Menschenrechte fest geschrieben. In die-<br />
sem Sinne gehören Demokratie <strong>und</strong> Sozialstaat<br />
untrennbar zusammen, <strong>und</strong> die Qualität des mo-<br />
<strong>der</strong>nen Sozialstaats zeigt sich darin, wie demo-<br />
kratisch die Reformen sind, die von <strong>der</strong> Politik be-<br />
schlossen werden.
Wer heute den Sozialstaat „umbaut“, muss sich<br />
an dem Anspruch messen lassen, ob es gelingt,<br />
alle Kräfte <strong>der</strong> Gesellschaft gleichermaßen an den<br />
Mo<strong>der</strong>nisierungsprozessen zu beteiligen <strong>und</strong> die<br />
Lasten solidarisch auf alle zu verteilen. Und er<br />
muss glaubwürdig sein - in seinen Begründungen<br />
für die Notwendigkeit ebenso wie in seinen Ver-<br />
sprechungen des Erfolgs. Wie glaubwürdig ist aber,<br />
wer trotz aller verän<strong>der</strong>ten Bedingungen in einer<br />
globalisierten <strong>und</strong> digitalisierten Welt behauptet,<br />
dass es eigentlich genügend Arbeitsplätze gebe<br />
<strong>und</strong> es nur eine Frage <strong>der</strong> Zeit sei, bis diese gefun-<br />
den werden?<br />
Ludolf von Wartenberg, Hauptgeschäftsführer vom<br />
B<strong>und</strong>esverband <strong>der</strong> Deutschen Industrie, bringt es<br />
auf den Punkt, wenn er davon spricht, dass unsere<br />
Politiker zu viele unrealistische Versprechungen<br />
machen. Er sagt: „Es wäre vernünftiger zu sagen:<br />
Wir haben Probleme, wir können sie meistern,<br />
aber dafür brauchen wir Zeit.“ (DIE ZEIT Nr.23 vom<br />
2. Juni 2005).<br />
An<strong>der</strong>erseits haben wir in <strong>der</strong> bedrängenden Situ-<br />
ation, in <strong>der</strong> sich unsere Gesellschaft befindet,<br />
keine Zeit mehr zu verlieren. Denn während je<strong>der</strong><br />
darauf wartet, dass <strong>der</strong> beabsichtigte Effekt <strong>der</strong><br />
Reformen endlich eintritt, bleibt aus, was wirklich<br />
getan werden müsste - nämlich darüber nachzu-<br />
denken, wie eine neue Arbeitsgesellschaft ausse-<br />
hen könnte, die jenseits von Kapital <strong>und</strong> Markt<br />
Arbeit als Arbeit für die Gemeinschaft definiert.<br />
Reformen müssen ihren Zweck erfüllen, um<br />
gerechtfertigt zu sein<br />
Wohlverstanden: es geht nicht darum, Einschrän-<br />
kungen o<strong>der</strong> Kürzungen von Sozialleistungen von<br />
vornherein zu verdammen. Es ist nicht automatisch<br />
ungerecht, „soziale Opfer“ zu bringen, denn ohne<br />
Opfer wird sich die Tür in eine bessere Zukunft<br />
nicht öffnen lassen.<br />
Der Vorsitzende <strong>der</strong> Deutschen Bischofskonferenz,<br />
Kardinal Lehmann, hat soziale Gerechtigkeit als die<br />
„Eigenschaft des Gemeinwesens“ definiert, „dem<br />
Einzelnen zu helfen“. Weil sie an die Leistungsbe-<br />
reitschaft des Einzelnen geb<strong>und</strong>en sei, könne sie<br />
nicht statisch sein, d.h. was „sozial gerecht“ sei,<br />
müsse situationsbedingt immer wie<strong>der</strong> neu formu-<br />
liert werden.<br />
Insofern sind, unter bestimmten Umständen, auch<br />
Reformen gerechtfertigt, die mit Einschränkungen<br />
<strong>und</strong> Zumutungen einher gehen. Fraglich ist jedoch,<br />
ob die aktuellen Reformen ihren Zweck erfüllen.<br />
Die Zusammenführung von Sozialhilfe <strong>und</strong> Arbeits-<br />
losengeld, von <strong>der</strong> Caritas seit Jahren gefor<strong>der</strong>t, ist<br />
zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Alles<br />
an<strong>der</strong>e muss sich erst noch erweisen.<br />
Wer angesichts <strong>der</strong> Auswirkungen weltweiter Glo-<br />
balisierung soziale Gerechtigkeit erhalten will,<br />
muss sich über einen Abbau sozialer Rechte <strong>und</strong><br />
Leistungen hinaus innovative Gesamtkonzepte ein-<br />
fallen lassen - Konzepte, die auch Ungewöhnliches<br />
zu denken wagen <strong>und</strong> in denen die Frage nach <strong>der</strong><br />
Sozialpflichtigkeit des Eigentums nicht rhetorisch<br />
gestellt wird, son<strong>der</strong>n wie<strong>der</strong> ernst gemeint ist.<br />
An erster Stelle steht hier die seit Jahren anhalten-<br />
de Steuersenkungsdiskussion. Während die Sozi-<br />
alabgabenquote in Deutschland sehr hoch ist, ist<br />
die Steuerquote seit 1965 nicht mehr gestiegen.<br />
Beschäftigungspolitisch notwendig, sagen Exper-<br />
ten, wäre eine radikale Senkung <strong>der</strong> Sozialbeiträ-<br />
ge, die jedoch nicht durch Kürzungen bei den So-<br />
zialleistungen zu erreichen sei, son<strong>der</strong>n durch eine<br />
Verlagerung <strong>der</strong> Finanzierungslast vor allem auf die<br />
Einkommensteuer. Stattdessen erleben wir seit<br />
Jahren eine fortgesetzte Debatte über die Senkung<br />
von Unternehmenssteuern.<br />
„Vorfahrt für Arbeit“, wie sie B<strong>und</strong>espräsident<br />
Köhler for<strong>der</strong>t, funktioniert aber nur, wenn zum<br />
Beispiel ein Steuersystem geschaffen würde, das<br />
Unternehmensgewinne, die in Arbeitsplätze rein-<br />
vestiert werden, niedriger besteuert als solche, die<br />
ausschließlich <strong>der</strong> Gewinnmaximierung dienen.<br />
Damit auch wir uns unsere Sozialstandards in Zu-<br />
kunft leisten können, müssen wir weitere Antwor-<br />
ten finden. Dazu gehört, uns mit dem Gedanken<br />
vertraut zu machen, dass die Umbrüche, die unsere<br />
Gesellschaft <strong>der</strong>zeit erlebt, kein vorübergehen<strong>der</strong><br />
Zustand sind, son<strong>der</strong>n ein Strukturwandel, <strong>der</strong> uns<br />
dauerhaft begleiten wird.<br />
7
8<br />
Globalisierung, Digitalisierung, Wandel von <strong>der</strong><br />
Produktions- zur Wissensgesellschaft, Alterung <strong>der</strong><br />
Bevölkerung sind hier die wesentlichen Stichwor-<br />
te, die das Hintergr<strong>und</strong>szenario abgeben, vor dem<br />
sich <strong>der</strong> Streit über die richtige Wachstumspolitik<br />
in Deutschland abspielt.<br />
Wer über die Bedeutung technologischer Innova-<br />
tionen für das Wirtschaftswachstum diskutiert,<br />
muss im Blick behalten, dass Wachstum nachhaltig<br />
mehr Beschäftigung schafft, <strong>und</strong> es sich Deutsch-<br />
land deshalb nicht leisten kann, den Anschluss in<br />
diese Richtung zu verpassen.<br />
Armut hat neue Gesichter<br />
Trotz aller wirtschaftlichen Engpässe <strong>und</strong> individu-<br />
ellen Verarmungstendenzen wird niemand ernst-<br />
haft behaupten wollen, dass Deutschland ein ar-<br />
mes Land sei. Im Gegenteil – es gibt auch einen<br />
immensen Reichtum <strong>und</strong> ein hohes Aufkommen an<br />
privatem Vermögen in unserem Land. Aber es gibt<br />
eben auch immer mehr Armut, <strong>und</strong> zwar eine Form<br />
von Armut, die ihr Gesicht verän<strong>der</strong>t. (Lesen Sie<br />
dazu die verschiedenen Beiträge in diesem Heft).<br />
Im Gegensatz zu den klassischen Formen von Ar-<br />
mut in Dritte-Welt-Län<strong>der</strong>n z.B. hat Armut bei uns<br />
eine Qualität, die sich hinter scheinbarer Normali-<br />
tät versteckt: <strong>der</strong> arbeitslose Akademiker, <strong>der</strong> Ju-<br />
gendliche, <strong>der</strong> trotz intensiven Bemühens keinen<br />
Ausbildungsplatz findet, die allein Erziehende, die<br />
mit ihrem Halbtagsjob nicht über die R<strong>und</strong>en<br />
kommt, <strong>der</strong> behin<strong>der</strong>te Mensch, <strong>der</strong> von jedem<br />
Arbeitgeber abgelehnt wird, Familien, die sich die<br />
teuren Mieten nicht leisten können usw.<br />
Die Diskrepanz zwischen denen, die viel haben,<br />
<strong>und</strong> denen, die wenig bis gar nichts haben, wird<br />
immer größer. Das leistet nicht nur dem Neidfak-<br />
tor Vorschub, son<strong>der</strong>n ist auch in dem Moment<br />
zutiefst ungerecht, in dem die Politik Maßnahmen<br />
beschließt, die vor allem die „kleinen Leute“ be-<br />
lasten. Caritas-Mitarbeiter in den Einrichtungen vor<br />
Ort berichten über eine erhebliche Zunahme von<br />
Ratsuchenden, die nicht nur frustriert sind, weil sie<br />
mit den neuen Hartz IV-Regelungen nicht zurecht-<br />
kommen, son<strong>der</strong>n auch verzweifelt <strong>und</strong> mutlos an-<br />
gesichts <strong>der</strong> Ungewissheit ihrer Zukunft <strong>und</strong> des<br />
Mangels an Perspektive.<br />
Soziale Gerechtigkeit durch Innovation<br />
Reformen sind nötig, um die Schräglage <strong>der</strong> Gesell-<br />
schaft zu korrigieren. Das schließt Einschnitte ein.<br />
Aber keine Einschränkung, keine Reform darf so<br />
weit gehen, dass sie einseitig die Schwächsten ei-<br />
ner Gesellschaft belastet, diejenigen, die ohnehin<br />
schon die Leidtragenden sind. Wenn Reformen zu<br />
einer Kampfansage an die Arbeitslosen, Kranken<br />
<strong>und</strong> Armen werden, wenn Familien, die zu allererst<br />
die Lasten des sozialen Systems tragen, dafür nur<br />
Nachteile ernten <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong> zum Armutsrisiko<br />
werden, dann droht Reformen die Ausweitung zu<br />
einem Skandal. Hier müssen so bald wie möglich<br />
Korrekturen erfolgen.<br />
Parallel zur zügigen Fort- <strong>und</strong> Durchsetzung von<br />
Hartz IV in allen geplanten Komponenten, dem<br />
För<strong>der</strong>n wie dem For<strong>der</strong>n, muss eine Wirtschafts-<br />
reform die Schaffung neuer Arbeitsplätze forcieren.<br />
Soziale Gerechtigkeit ist nicht durch den Abbau<br />
des Sozialstaats zu erreichen, son<strong>der</strong>n durch in-<br />
novative Reformen, bei denen alle an <strong>der</strong> Finanzie-<br />
rung <strong>und</strong> an den Leistungen <strong>der</strong> Sozialversiche-<br />
rungen beteiligt werden.<br />
Quellenangaben<br />
„Wie sozial bleibt die Demokratie“. Vortrag von<br />
Bischof Kamphaus auf dem ökumenischen<br />
Betriebsräteempfang in Frankfurt am 18.11.2004<br />
Soziale Gerechtigkeit Spielball aktueller Sozialpolitik,<br />
Friedhelm Hengsbach SJ.,<br />
Frankfurt am Main, 12.01.2005<br />
„Erklärung zur Reform des Sozialstaats“ von<br />
Kardinal Lehmann, Zeitung <strong>der</strong> Katholischen<br />
Akademie in Berlin Nr. 4/2004<br />
„10 verbreitete Unwahrheiten im Umgang mit dem<br />
Skandal Arbeitslosigkeit, <strong>und</strong> wie Sie ihnen wi<strong>der</strong>stehen<br />
können“ http://rs.betriebsseelsorge.de/<br />
engpass/arbeitslosigkeit.html<br />
„Kein schöner Land. Die Zerstörung <strong>der</strong><br />
sozialen Gerechtigkeit“ von Heribert Prantl,<br />
Droemer Verlag, 2005
Mit Strategie gegen die Not<br />
Aus <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Projektgruppe „Skandal Arbeitslosigkeit“<br />
Wilhelm Dräxler<br />
Dass Millionen Menschen keinen dauerhaften Arbeitsplatz finden, <strong>der</strong> sie <strong>und</strong> ihre Familie ernährt, stand<br />
auch im Mittelpunkt <strong>der</strong> Silvesterpredigt 2004 von Erzbischof Friedrich Kardinal Wetter, <strong>der</strong> die hohe Ar-<br />
beitslosigkeit in Deutschland als den zentralen Skandal unserer Gesellschaft bezeichnete <strong>und</strong> einfor<strong>der</strong>te,<br />
dass man sich nicht damit abfinden dürfe. In diesem Sinne wurde im <strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> Mün-<br />
chen <strong>und</strong> <strong>Freising</strong> eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die aktiv gegen die stagnierende <strong>und</strong> depressive<br />
Situation auf dem Arbeitsmarkt vorgehen will. Dem Appell des Kardinals folgend erhielt das Projekt den<br />
Namen „Skandal Arbeitslosigkeit“.<br />
In <strong>der</strong> Tat ist es nicht hinnehmbar, dass Millionen<br />
Menschen in Deutschland vom Zugang zur Erwerbs-<br />
arbeit ausgeschlossen sind. Noch schlimmer ist,<br />
dass nach <strong>der</strong>zeitigem Stand die Hartz IV-Reform<br />
ihre Ziele grandios zu verfehlen droht, zum Beispiel<br />
dadurch, dass die Zahl erwerbsfähiger Hartz-IV-<br />
Empfänger mittlerweile um fast eine Million höher<br />
ist als geplant <strong>und</strong> damit <strong>der</strong> Höhepunkt offenbar<br />
noch nicht erreicht ist. Experten erwarten, dass die<br />
Ziffer <strong>der</strong> Langzeitarbeitslosen um weitere 5 Pro-<br />
zent steigen wird, wenn auch die Anträge durch<br />
sind, die zeitverzögert bearbeitet wurden.<br />
Für Personen mit Vermittlungshin<strong>der</strong>nissen (z.B.<br />
Alter, keine geeignete Ausbildung, keine berufs-<br />
spezifische Qualifikation, ohne Schulabschluss,<br />
Behin<strong>der</strong>ung, Migrationshintergr<strong>und</strong> etc.) ist es<br />
beson<strong>der</strong>s schwierig, wie<strong>der</strong> in den Arbeitsmarkt<br />
hineinzufinden, wenn sie einmal aus dem Prozess<br />
herausgefallen sind. Und beson<strong>der</strong>s erschreckend<br />
ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Jungen Men-<br />
schen, die keinen Schulabschluss haben o<strong>der</strong> die<br />
mit an<strong>der</strong>en Problematiken (Suchtprobleme, sozi-<br />
ale Defizite, Sprachprobleme etc.) zu kämpfen ha-<br />
ben, ist <strong>der</strong> Zugang zum Arbeitsmarkt in <strong>der</strong> Regel<br />
von vorneherein verschlossen. (Lesen Sie dazu<br />
auch den Beitrag von Angelika Schmidbauer ab<br />
Seite 32).<br />
Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit als<br />
breite Querschnittsaufgabe<br />
Hauptziel <strong>der</strong> Projektgruppe, in <strong>der</strong> Caritasdirektor<br />
Hans Lindenberger persönlich mitwirkt, ist die Ent-<br />
wicklung einer strategisch geplanten <strong>und</strong> vernetz-<br />
ten Vorgehensweise innerhalb des Diözesanver-<br />
bands, um den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit<br />
zu einer breiten Querschnittsaufgabe zu machen.<br />
Deshalb arbeiten Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbei-<br />
ter aus verschiedenen Bereichen <strong>der</strong> Caritas in <strong>der</strong><br />
Projektgruppe mit.<br />
Zeichen setzen für beson<strong>der</strong>s<br />
Benachteiligte<br />
Mit <strong>der</strong> Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten<br />
sieht sich <strong>der</strong> <strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> mit<br />
seinen angeschlossenen Einrichtungen vor die Auf-<br />
gabe gestellt, für beson<strong>der</strong>s Benachteiligte, die<br />
von Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt bedroht<br />
sind, ein Zeichen zu setzen. Der <strong>Caritasverband</strong><br />
bietet deshalb Arbeitslosen, die nach <strong>der</strong> neuen<br />
Gesetzgebung ab 2005 Arbeitslosengeld II bezie-<br />
hen, Arbeitsmöglichkeiten im sozialen Bereich an.<br />
Er will auf diese Weise daran mitwirken, dass die<br />
Wilhelm Dräxler<br />
Referent Soziale Arbeit<br />
<strong>und</strong> Projektleiter<br />
„Skandal Arbeitslosigkeit“<br />
9
10<br />
Betroffenen durch eine Tätigkeit, die sinnvoll ist,<br />
ihren Fähigkeiten entspricht <strong>und</strong> ihr Selbstbe-<br />
wusstsein stärkt, einen besseren Zugang zum Ar-<br />
beitsmarkt finden.<br />
Der <strong>Caritasverband</strong> sieht in den Betroffenen enga-<br />
gierte Menschen, die arbeiten wollen. Eine wesent-<br />
liche Bedingung für die Bereitstellung von Arbeits-<br />
gelegenheiten ist deshalb, dass die eingesetzten<br />
Personen neben einer Beschäftigung auch eine<br />
Qualifizierung erhalten.<br />
Einige <strong>der</strong> Zielsetzungen im einzelnen: � Aufbau eines standardisierten Informa-<br />
tions- <strong>und</strong> Austauschsystems, um alle<br />
Einrichtungen über aktuelle Entwicklun-<br />
gen zu informieren <strong>und</strong> einen breiten<br />
Wissens- <strong>und</strong> Ideentransfer innerhalb<br />
des Verbands zu ermöglichen.<br />
� Einbindung <strong>der</strong> Caritas in die lokalen<br />
Strukturen, um als kompetenter Partner<br />
bei <strong>der</strong> Integration von Arbeitslosen in<br />
den Arbeitsmarkt mitwirken zu können.<br />
� Verbreitung erworbener interner Kom-<br />
petenzen, z.B. mit Arbeitsprojekten wie<br />
„Rentabel“ (s. Bericht auf Seite 22)<br />
<strong>und</strong> Know-how-Transfer.<br />
� Übernahme <strong>der</strong> Anwaltschaft <strong>der</strong> von<br />
Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen<br />
(„Sprachrohr sein“)<br />
� Einrichtung, Akquisition <strong>und</strong> Betreuung<br />
von Angeboten <strong>der</strong> Arbeitsgelegenheiten<br />
(1-Euro-Jobs); insbeson<strong>der</strong>e die Koordi-<br />
nierung innerhalb des katholischen<br />
Bereichs - u.a.m.
Nur die schnelle Vermittlung hilft weiter<br />
Auswirkungen von Hartz IV auf Beschäftigungsträger<br />
Johanna Schilling<br />
Der Erfolg <strong>und</strong> die Akzeptanz <strong>der</strong> Hartz IV-Reform hängen wesentlich von zwei Faktoren ab: <strong>der</strong> Schaffung<br />
von Arbeitsplätzen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Vermittlung <strong>der</strong> vorhandenen Arbeit. Während die Caritas den ersten Faktor nur<br />
einfor<strong>der</strong>n kann, kann sie den zweiten ganz konkret mit beeinflussen. Deshalb hat sich <strong>der</strong> Münchner<br />
<strong>Caritasverband</strong> sehr früh entschlossen, sein Know-how aktiv in die Umsetzung von Hartz IV einzubringen<br />
<strong>und</strong> gemeinsam mit seiner Tochter, <strong>der</strong> Weißer Rabe GmbH, einem großen <strong>und</strong> qualifizierten Beschäfti-<br />
gungsbetrieb auf dem zweiten Arbeitsmarkt, eine zentrale Vermittlungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsstelle für<br />
Arbeitsgelegenheiten nach §16 (3) SGB II im dezentralen Verb<strong>und</strong>system des <strong>Caritasverband</strong>s <strong>der</strong> Erzdiö-<br />
zese <strong>München</strong> <strong>und</strong> <strong>Freising</strong> gegründet.<br />
Nur, wenn je<strong>der</strong> Arbeitslosengeld-II-Empfänger,<br />
<strong>der</strong> drei St<strong>und</strong>en am Tag arbeiten kann, auch die<br />
Gelegenheit dazu erhält, kann Hartz IV überhaupt<br />
greifen. Deshalb müssen zunächst genügend 1-Euro-<br />
Jobs zur Verfügung gestellt werden. Allein in Mün-<br />
chen rechnet die Kommune mit siebzigtausend Ein-<br />
zelpersonen, die in 1-Euro-Jobs zu vermitteln sind.<br />
Die aus Hartz IV resultierenden Maßnahmen wer-<br />
den in <strong>der</strong> Landeshauptstadt <strong>München</strong> <strong>und</strong> in an-<br />
<strong>der</strong>en Städten <strong>und</strong> Landkreisen im Bereich <strong>der</strong><br />
<strong>Erzdiözese</strong> in unterschiedlicher Geschwindigkeit<br />
seit Januar 2005 umgesetzt. Für den Diözesan-<br />
<strong>Caritasverband</strong> ergeben sich daraus in <strong>der</strong> Praxis<br />
auf allen Ebenen Konsequenzen, angefangen bei<br />
<strong>der</strong> Beratung von Arbeitslosen <strong>und</strong> Arbeitslosen-<br />
geld II-Empfängern über die Hilfestellung bei An-<br />
trägen <strong>und</strong> Formularen bis hin zu Interventionen<br />
bei den offiziellen Stellen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> zuständigen ARGE<br />
sowie zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in<br />
unterschiedlichen Einrichtungen <strong>und</strong> Diensten.<br />
In <strong>München</strong> hat die Caritas r<strong>und</strong> 110 Arbeitsgele-<br />
genheiten in unterschiedlichen Einrichtungen ge-<br />
schaffen. Im gesamtverbandlichen Bereich wer-<br />
den r<strong>und</strong> 300 Stellen angeboten: in Altenhilfe-<br />
<strong>und</strong> Behin<strong>der</strong>teneinrichtungen, in Caritaszentren,<br />
Beratungseinrichtungen <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>gärten. Die<br />
Art <strong>der</strong> Beschäftigungen reicht von einfachen Hilfs-<br />
tätigkeiten in Klei<strong>der</strong>kammern, Hilfen im Haus-<br />
halt, Bring- <strong>und</strong> Holdiensten über Verwaltungstä-<br />
tigkeiten wie Telefon- <strong>und</strong> Schreibdienste, Dolmet-<br />
scherdienste bis zu höher qualifizierten Aufgaben<br />
im Medien- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeitsbereich.<br />
Individuelle Qualifizierung <strong>der</strong> Zusatzjobber<br />
gewährleisten<br />
Die vom Diözesanverband <strong>und</strong> <strong>der</strong> Weißer Rabe<br />
GmbH ins Leben gerufene Vermittlungsstelle<br />
agiert als Schnittstelle zwischen ARGE, Einrich-<br />
tungen <strong>und</strong> interessierten Arbeitslosen. Damit<br />
soll zum einen eine passgenaue Vermittlung von<br />
Arbeitsgelegenheiten erreicht <strong>und</strong> zum an<strong>der</strong>en<br />
die tatsächliche individuelle Qualifizierung <strong>der</strong><br />
Zusatzjobber gewährleistet werden. Denn diese<br />
Menschen sind nicht als billige Hilfskräfte o<strong>der</strong><br />
günstige Alternative zu teuren Neueinstellungen<br />
zu mißbrauchen.<br />
Die Vermittlungsstelle hat <strong>der</strong> Münchner ARGE im<br />
ersten Quartal 2005 die Stellenangebote <strong>der</strong> Ein-<br />
richtungen vorgelegt. Diese halten einen ausge-<br />
feilten Vertragsentwurf für die Arbeitsgelegenhei-<br />
ten bereit. Die Caritas-Mitarbeiter erwarten ihre<br />
neuen „Kollegen auf Zeit“ <strong>und</strong> sind bereit, ihrer-<br />
seits einiges an Mühe in die nötige Einarbeitung<br />
zu investieren – auch dieser Aspekt <strong>der</strong> „Zusatz-<br />
Johanna Schilling<br />
Geschäftsführerin<br />
<strong>der</strong> Weißer Rabe GmbH<br />
11
12<br />
jobs“ muss beleuchtet werden, denn was für die<br />
einen ein willkommener Wie<strong>der</strong>-Einstieg in die<br />
Teilhabe am Erwerbsleben ist, bedeutet für die an-<br />
<strong>der</strong>en einen Mehraufwand an Arbeit.<br />
Lei<strong>der</strong> hat die Umsetzung <strong>der</strong> neuen Strukturen<br />
von Sozialreferat <strong>und</strong> Agentur für Arbeit in Mün-<br />
chen ganze sechs Monate in Anspruch genommen,<br />
so dass die Caritas-Einrichtungen in <strong>der</strong> Landes-<br />
hauptstadt erst ab Juni mit <strong>der</strong> Zuteilung „ihrer“<br />
1-Euro-Jobber rechnen können. Bis dahin, so die<br />
Zusage <strong>der</strong> Kommune, soll die Umwandlung <strong>der</strong><br />
BSHG-Stellen, die vorrangig behandelt wurde, ab-<br />
geschlossen sein.<br />
Mit seinem Prinzip des For<strong>der</strong>ns <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ns ist<br />
Hartz IV zunächst ein aus sozialer <strong>und</strong> ethischer<br />
Sicht gerechtes Konzept. Allerdings darf das För-<br />
<strong>der</strong>n nicht zugunsten des For<strong>der</strong>ns in den Hinter-<br />
gr<strong>und</strong> treten, da wir sonst Gefahr laufen, dass Ver-<br />
antwortungen einseitig verteilt <strong>und</strong> Menschen mit<br />
ihren Sorgen <strong>und</strong> Ängsten allein gelassen werden.<br />
Genau das aber geschieht momentan, <strong>und</strong> des-<br />
halb wird Hartz IV von <strong>der</strong> Öffentlichkeit <strong>und</strong> den<br />
Medien zunehmend kritisiert. Es ist verständlich,<br />
wenn nach sechsmonatigem Warten auf eine Ar-<br />
beitsgelegenheit <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene Qua-<br />
lifizierung Hoffnung <strong>der</strong> Verärgerung weicht. So<br />
führt die Umsetzung eigentlich guter <strong>und</strong> sozial<br />
richtiger Ansätze zu einer Schieflage, die nur<br />
durch schnelle Vermittlung durch die Arbeitsge-<br />
meinschaften korrigiert werden kann.<br />
Auch als Caritas sind wir von dieser Entwicklung<br />
irritiert. Deshalb nehmen wir die kommunalen<br />
Stellen in die Pflicht <strong>und</strong> for<strong>der</strong>n alle Beteiligten<br />
auf, die einmal begonnene Reform mit Beginn <strong>der</strong><br />
zweiten Jahreshälfte zügig <strong>und</strong> effizient umzuset-<br />
zen - im Interesse unserer Klienten, aber auch, um<br />
den nötigen sozialen Umbau nicht zu gefährden.<br />
Beschäftigungsbetriebe müssen aufrecht<br />
erhalten werden<br />
In einem weiteren Bereich ist die Caritas ganz un-<br />
mittelbar von <strong>der</strong> Arbeitsmarktreform betroffen.<br />
Wir bieten eine Reihe von Beschäftigungsprojek-<br />
ten für Menschen an, die durch alle Raster <strong>der</strong> Ar-<br />
beitsvermittlung fallen - <strong>und</strong> das nicht erst seit<br />
Hartz IV: Langzeitarbeitslose mit psychischen Be-<br />
hin<strong>der</strong>ungen, zum Beispiel. Diese so genannten<br />
BSHG (B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz)-Stellen fallen durch<br />
die Reform völlig weg; auch die bisherigen ABM-<br />
Stellen sind rückläufig. An ihre Stelle treten die<br />
1-Euro-Jobs bzw. werden reguläre Beschäftigungs-<br />
verhältnisse in 1-Euro-Jobs umgewandelt.<br />
Im Gegensatz zu den BSHG- wie auch ABM-Model-<br />
len begründet <strong>der</strong> 1-Euro-Job jedoch kein regulä-<br />
res Arbeitsverhältnis. Es ist deshalb zu befürch-<br />
ten, dass die Motivation <strong>der</strong> „Mitarbeitenden“<br />
geringer sein wird. Dies hat u. a. Auswirkungen auf<br />
die Qualität <strong>der</strong> Dienstleistung <strong>und</strong> führt zu finan-<br />
ziellen Einbußen in den Beschäftigungsbetrieben.<br />
Die Folge: Beschäftigungsbetriebe als Arbeitgeber<br />
für individuell beeinträchtigte <strong>und</strong> sozial benach-<br />
teiligte Menschen werden zusehends vom Markt<br />
verschwinden, da die Finanzierung nicht mehr ge-<br />
sichert ist. Die gesellschaftliche wie auch die ar-<br />
beitsmarktpolitische Perspektive dieser Menschen<br />
wäre hierdurch stark gefährdet.<br />
Die Caritas sieht es deshalb als ihre anwaltliche<br />
Pflicht an, dieser Entwicklung entgegen zu treten.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> spielen Beschäftigungsprojek-<br />
te bzw. Integrationsfirmen eine bedeutende Rolle,<br />
da sie die nötigen Instrumentarien <strong>und</strong> das Know-<br />
how besitzen, um diese Zielgruppen zu beschäfti-<br />
gen. In diesem Zusammenhang muss erwähnt<br />
werden, dass diese Projekte <strong>und</strong> Firmen zahl-<br />
reiche Dauerarbeitsplätze für schwer behin<strong>der</strong>te<br />
Menschen geschaffen haben, die ihnen eine be-<br />
rufliche wie auch persönliche Lebensperspektive<br />
bieten. Der Weiße Rabe hat mehr als 20 Dauer-<br />
arbeitsplätze geschaffen.
Probleme mit <strong>der</strong> Finanzierung auf allen Ebenen<br />
� För<strong>der</strong>ung durch die Kommune<br />
<strong>München</strong>:<br />
Es ist unklar, ob die Stadt <strong>München</strong> im Jahr<br />
2006 freiwillige Leistungen in Höhe von 33 Mio.<br />
Euro an die Beschäftigungsprojekte erbringt.<br />
Mit Wegfall des BSHG entfällt für die Kommune<br />
die Finanzverantwortung für Leistungen „Hilfe<br />
zur Arbeit“. Im Stadtrat in <strong>und</strong> zwischen den<br />
Fraktionen werden kontroverse Debatten über<br />
das Einbringen bzw. den Rückzug <strong>der</strong> Kommu-<br />
ne aus dieser För<strong>der</strong>ung diskutiert. Für die Be-<br />
schäftigungsträger bedeuten die freiwilligen<br />
Leistungen in vielen Fällen das wirtschaftliche<br />
Überleben; für die Zielgruppen ein angemesse-<br />
nes <strong>und</strong> notwendiges Instrumentarium zur<br />
Sicherung <strong>der</strong> beruflichen Perspektive.<br />
� Problematik <strong>der</strong> Co-Finanzierung:<br />
Die Beschäftigungsprojekte haben in <strong>der</strong> Regel<br />
ein kompliziertes Finanzierungssystem, in dem<br />
die Leistungen diverser Zuschussgeber aufein-<br />
an<strong>der</strong> aufbauen <strong>und</strong> aufeinan<strong>der</strong> abgestimmt<br />
sind:<br />
Der Bezirk Oberbayern z.B. för<strong>der</strong>t sozialversi-<br />
cherungspflichtige Beschäftigung psychisch<br />
kranker Menschen, das Integrationsamt sozial-<br />
versicherunsgspflichtige Beschäftigung von<br />
schwer behin<strong>der</strong>ten Menschen. Zusatzjobs<br />
stellen keine sozialversicherungspflichtige Be-<br />
schäftigung dar, so dass den Trägern zum Über-<br />
leben notwendige För<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kom-<br />
mune <strong>München</strong> Drittmittel in Höhe von mehre-<br />
ren 100.000 Euro verloren gehen. Deshalb hat<br />
sich die ARGE <strong>München</strong> nun doch für die Schaf-<br />
fung von ca. 250 ABM-Stellen entschlossen.<br />
Jedoch sind diese bis zum heutigen Tag nicht<br />
eingerichtet, was finanzielle Ausfälle seit ca. 5<br />
Monaten für die Beschäftigungsprojekte be-<br />
deutet.<br />
� Hat man bei Gestaltung <strong>und</strong> Verab-<br />
schiedung an Menschen mit multiplen<br />
Vermittlungshemmnissen gedacht?<br />
Leistungen nach dem SGB II erhalten Men-<br />
schen, die erwerbsfähig sind. „Erwerbsfähig<br />
ist, wer nicht wegen Krankheit o<strong>der</strong> Behinde-<br />
rung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter<br />
den üblichen Bedingungen des allgemeinen<br />
Arbeitsmarktes mindestens drei St<strong>und</strong>en täg-<br />
lich erwerbsfähig zu sein“ (§ 8 SGB II). Die In-<br />
strumentarien des SGB II haben die Priorität,<br />
d.h. 1. Arbeitsmarkt <strong>und</strong> bisher kurze Maßnah-<br />
medauer in den Beschäftigungsprojekten (6<br />
Monate). Der Gesetzgeber hat jedoch die Tat-<br />
sache außer Acht gelassen, dass Menschen mit<br />
multiplen Vermittlungshemmnissen (z.B. psy-<br />
chisch Kranke) durchaus erwerbsfähig sind, je-<br />
doch in <strong>der</strong> Regel nicht bereits nach 6 Monaten<br />
<strong>und</strong> auch nur schwierig in den ersten Arbeits-<br />
markt zu integrieren sind. Viele Unternehmen<br />
zahlen lieber die Ausgleichabgabe als schwer<br />
behin<strong>der</strong>te Menschen einzustellen. (Solange<br />
Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl von schwer<br />
behin<strong>der</strong>ten Menschen nicht beschäftigen (Be-<br />
schäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für<br />
jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Ausgleichs-<br />
abgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX)<br />
Die Höhe <strong>der</strong> Ausgleichsabgabe beträgt je<br />
Monat <strong>und</strong> unbesetztem Pflichtplatz:<br />
• 105 Euro bei einer Beschäftigungsquote<br />
ab 3% bis unter 5%<br />
• 180 Euro bei einer Beschäftigungsquote<br />
ab 2% bis unter 3%<br />
• 260 Euro bei einer Beschäftigungsquote<br />
unter 2%<br />
Sonstige Beschäftigungsanreize EGZ (Einglie-<br />
<strong>der</strong>ungszuschuss) o<strong>der</strong> MLA (Min<strong>der</strong>leistungs-<br />
ausgleich) werden sukzessive eingeschränkt,<br />
da <strong>der</strong> För<strong>der</strong>umfang zurückgefahren wird.<br />
13
Wolfgang Obermair<br />
Vorstand Ressort II<br />
Trägereinrichtungen<br />
<strong>und</strong> Beteiligungen<br />
14<br />
Wolfgang Obermair<br />
Aufgaben vor Ort verän<strong>der</strong>n sich<br />
Dem sozialen Wandel müssen gestaltende Impulse gegeben werden<br />
Wenn in Politik <strong>und</strong> in Öffentlichkeit vom sozialen Wandel gesprochen wird, den unsere Gesellschaft zur<br />
Zeit erlebt, wirft das ein ganz bestimmtes Licht auf diese Entwicklung. Wandel ist ein passives Geschehen,<br />
das heißt, es wird etwas von außen bewegt, ohne die Möglichkeit <strong>der</strong> Einflussnahme. Und in <strong>der</strong> Tat ist das<br />
häufig <strong>der</strong> Fall: Einsparungen, Kürzungen, Streichungen beschneiden das soziale Angebot für die Men-<br />
schen, <strong>und</strong> wer davon abhängig ist, erlebt einen Wandel seines Lebens - lei<strong>der</strong> allzu oft hin zur Verschlech-<br />
terung. Im Gegensatz zum Wandel ist die Verän<strong>der</strong>ung ein aktives Geschehen. Verän<strong>der</strong>ung bedeutet kre-<br />
ative Anpassung an gesellschaftliche Umstrukturierungen <strong>und</strong> lösungsorientierte Weiterentwicklung.<br />
Die freie Wohlfahrtspflege hat innerhalb<br />
<strong>der</strong> sozialen Gesellschaft eine wichtige<br />
Funktion als Erbringer sozialer Dienstleis-<br />
tungen <strong>und</strong> sozialer Arbeit. Mit einem jähr-<br />
lichen Umsatz von 55 Milliarden Euro <strong>und</strong><br />
1.284 100 Beschäftigten – das sind 3,5%<br />
<strong>der</strong> sozialabgabepflichtigen Arbeitnehmer<br />
in <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik - ist sie ein wichtiger<br />
volkswirtschaftlicher Faktor.<br />
Darüber hinaus ist sie eine tragende Säule<br />
des Sozialstaats, weil sie die jeweiligen po-<br />
litischen Entwicklungen kritisch <strong>und</strong> aus<br />
<strong>der</strong> Perspektive anwaltschaftlichen Enga-<br />
gements für die gesellschaftlichen Rand-<br />
gruppen dieses Staats begleitet.<br />
Unter diesen Voraussetzungen haben wir zum ei-<br />
nen ein ökonomisches Interesse daran, dem sozi-<br />
alen Wandel verän<strong>der</strong>nde Impulse zu geben, zum<br />
an<strong>der</strong>en betrachten wir das bewusste Handeln zur<br />
Sicherung des Sozialen Friedens als unsere mora-<br />
lische Pflicht <strong>und</strong> einen Beitrag, den unsere sozi-<br />
alstaatliche Verfassung braucht.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ist festzustellen, dass sich<br />
die aktuelle Diskussion um die Notwendigkeit, un-<br />
seren Sozialstaat umzubauen, im Ungleichgewicht<br />
befindet, denn sie ist einseitig auf das Thema Kos-<br />
teneinsparung fokussiert. Dadurch drohen essen-<br />
tielle Werte aus dem Blick zu geraten, die unsere<br />
Gesellschaft seit <strong>der</strong> Nachkriegszeit geprägt <strong>und</strong><br />
ihre menschlich-soziale Qualität ausgemacht ha-<br />
ben. Die Art <strong>und</strong> Weise, wie eine Gesellschaft mit<br />
ihren hilfebedürftigen Mitglie<strong>der</strong>n umgeht, mit al-<br />
ten Menschen, mit Behin<strong>der</strong>ten, mit Familien <strong>und</strong><br />
Kin<strong>der</strong>n, prägt nicht nur ihr Bild in <strong>der</strong> Öffentlich-<br />
keit, son<strong>der</strong>n ist auch ein Garant für ein stabiles<br />
soziales System <strong>und</strong> somit eine wesentliche wirt-<br />
schaftliche Komponente. Nur eine ausgeglichene<br />
Gesellschaft hat die nötige Stabilität, um wirt-<br />
schaftliche Engpässe langfristig zu überwinden<br />
<strong>und</strong> sich verän<strong>der</strong>ten Gegebenheiten konstruktiv<br />
anzupassen.<br />
Wie begegnet die Freie Wohlfahrtspflege<br />
dem Verän<strong>der</strong>ungsdruck?<br />
Die demographische Entwicklung in Deutschland<br />
weist eine beunruhigende, manche Sozialexperten<br />
sprechen von einer dramatischen, Tendenz auf. Bis<br />
zum Jahr 2020, so die Prognosen, ist bereits fast<br />
je<strong>der</strong> zweite B<strong>und</strong>esbürger über 60. Dazu steigt die<br />
Zahl <strong>der</strong> Singles stetig an. Das bedeutet eine deut-<br />
liche Verringerung familiärer Bindungen <strong>und</strong> damit<br />
einen Wegfall von privaten Sicherungen <strong>und</strong> Ver-<br />
antwortlichkeiten in sozialen Notsituationen.<br />
Schon jetzt sind die Sozialkassen deutlich über-<br />
lastet. Die Agenda 2010 hat mit ihrem zögerlichen<br />
Bemühen um soziale Verän<strong>der</strong>ungen bislang vor<br />
allem Einschnitte in das soziale Sicherungssystem<br />
gebracht, aber noch keine finanziellen Entlastun-<br />
gen. Die aktuelle politische Situation mit ihrer Un-<br />
gewißheit eines möglichen Regierungswechsels<br />
verstärkt die Unsicherheit im Hinblick auf die drin-<br />
gend notwendigen Reformen. Zu diesen innenpo-<br />
litischen Problemen kommen weitere auf europä-
ischer Ebene, die mit dem kulturellen <strong>und</strong> wirt-<br />
schaftlichen Wandel im Zuge des europäischen<br />
Einigungsprozesses einher gehen.<br />
Wie begegnet die Freie Wohlfahrtspflege diesem<br />
Szenario? Als <strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> Mün-<br />
chen <strong>und</strong> <strong>Freising</strong> ist uns vor allem wichtig, unser<br />
Engagement nicht im Jammern <strong>und</strong> Klagen über<br />
bestehende Verhältnisse zu erschöpfen. Das ist<br />
we<strong>der</strong> politisch sinnvoll noch ethisch vertretbar.<br />
In unserer Eigenschaft als Helfer <strong>und</strong> Anwalt <strong>der</strong><br />
Bedürftigen verfolgen wir soziale Entwicklungen,<br />
gesellschaftliche Trends <strong>und</strong> politische Maßnah-<br />
men unter dem Aspekt <strong>der</strong> Auswirkungen auf das<br />
soziale Klima <strong>und</strong> kommentieren <strong>und</strong> kritisieren<br />
sie in diesem Sinn. Dazu bieten wir sozial verträg-<br />
liche Lösungsvorschläge an.<br />
Wir halten den Kontakt sowohl zur Politik als auch<br />
zu den Entscheidungsträgern im öffentlichen <strong>und</strong><br />
sozialen Bereich <strong>und</strong> bleiben mit unserer Arbeit<br />
immer am Puls <strong>der</strong> Gesellschaft: Nah. Am Nächsten.<br />
Das schließt ein flexibles Anpassen an die verän-<br />
<strong>der</strong>ten Rahmenbedingungen ein, denen die sozia-<br />
le Landschaft in den letzten 2o Jahren unterworfen<br />
war. So hat zum Beispiel auch im sozialen Dienst-<br />
leistungsbereich <strong>der</strong> Wettbewerb Einzug gehalten,<br />
dem wir durch einen fortwährenden Prozess von<br />
Umstrukturierungsmaßnahmen Rechnung tragen,<br />
die dazu dienen, unsere Effizienz zu steigern <strong>und</strong><br />
gleichzeitig die Kompetenz <strong>und</strong> Qualität <strong>der</strong> Arbeit<br />
vor Ort sicherzustellen.<br />
Durch die Öffnung Europas sind alle Märkte mitei-<br />
nan<strong>der</strong> verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> auch die Angebote im so-<br />
zialen Bereich nicht mehr auf einzelne Län<strong>der</strong> be-<br />
grenzt. Freie gemeinnützige Träger werden in ab-<br />
sehbarer Zeit immer stärker in Konkurrenz treten.<br />
Das erfor<strong>der</strong>t europaweit wettbewerbstaugliche<br />
Konzeptionen in den sozialen Dienstleistungsbe-<br />
reichen <strong>der</strong> Zukunft.<br />
Unser Anliegen ist es, unsere Leistungen noch<br />
transparenter zu machen <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Konkurrenz<br />
<strong>der</strong> freien Träger zu profilieren - sowohl unseren<br />
Kooperationspartnern gegenüber als auch im Hin-<br />
blick darauf, dass auch die hilfesuchenden Men-<br />
schen berechtigte Ansprüche auf Qualität, Leistung<br />
<strong>und</strong> Menschlichkeit haben.<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen werden zu Schwer-<br />
punkten in <strong>der</strong> operativen Arbeit<br />
Die Zukunft beginnt heute - wir reagieren<br />
auf die gesellschaftlichen Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
indem wir die größten Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
zu Schwerpunkten unserer Arbeit machen:<br />
1. „Wohnen im Alter“<br />
2. Arbeitslosigkeit<br />
3. Kin<strong>der</strong>tagesbetreuung<br />
„Wohnen im Alter“ bedeutet für viele Menschen<br />
einschneidende Verän<strong>der</strong>ungen in ihrer gewohn-<br />
ten Lebenssituation. Wenn die Familie fehlt, in <strong>der</strong><br />
Menschen auch im Alter geborgen leben können,<br />
müssen an<strong>der</strong>e Rahmenbedingungen geschaffen<br />
werden, die einen Lebensabend in Würde <strong>und</strong> An-<br />
nehmlichkeit ermöglichen. Dazu gehören unter-<br />
schiedliche Wohnformen für Senioren, eine maß-<br />
geschnei<strong>der</strong>te, auf die jeweiligen Bedürfnisse <strong>der</strong><br />
Menschen abgestimmte Betreuung, eine qualitativ<br />
ausgezeichnete, garantiert sichere <strong>und</strong> vertrauens-<br />
volle Pflege - in <strong>der</strong> gewohnten Umgebung, <strong>der</strong><br />
eigenen Wohnung o<strong>der</strong> einem komfortablen, an-<br />
genehmen <strong>und</strong> zugleich fürsorglichen Haus.<br />
Unser <strong>Caritasverband</strong> hat mit seinen Einrichtungen<br />
<strong>der</strong> Altenpflege, den Altenheimen, den Sozialsta-<br />
tionen <strong>und</strong> Caritas-Zentren ein Konzept entwickelt,<br />
das Senioren heute <strong>und</strong> in Zukunft diese Perspek-<br />
tiven ermöglicht. Ob sich Handeln tatsächlich an<br />
dem auch in <strong>der</strong> Politik oft beschworenen „christ-<br />
lichen Menschenbild“ orientiert, zeigt sich nicht<br />
zuletzt <strong>und</strong> ganz konkret im Umgang mit alten,<br />
hochbetagten <strong>und</strong> sterbenden Menschen: Die Ca-<br />
ritas wendet sich mit ihrem differenzierten <strong>und</strong> be-<br />
dürfnisorientierten Angebot gegen alle Versuche,<br />
alte Menschen als Belastung zu sehen <strong>und</strong> aus<br />
dem gesellschaftlichen Leben auszugrenzen.<br />
Arbeitslosigkeit mag eine globale Erscheinung<br />
sein, dennoch bleibt sie ein sozialer Skandal. Zur<br />
Unterstützung <strong>der</strong> sozialen Reformen haben wir im<br />
<strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> eigene Konzepte<br />
entwickelt <strong>und</strong> stellen Ausbildungsplätze in den<br />
eigenen Einrichtungen bereit. Wir qualifizieren<br />
15
16<br />
Langzeitarbeitslose, um ihnen den Wie<strong>der</strong>ein-<br />
stieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern bzw. zu<br />
ermöglichen (Lesen Sie dazu auch die Beiträge<br />
von Johanna Schilling <strong>und</strong> Ludwig Mittermeier auf<br />
den Seiten 11 <strong>und</strong> 22)<br />
Darüber hinaus begleiten wir die Entwicklung von<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Arbeitspolitik kritisch <strong>und</strong> ak-<br />
tiv, denn auf Gr<strong>und</strong> unserer Erfahrung, die sich aus<br />
<strong>der</strong> Kenntnis <strong>der</strong> Realität <strong>der</strong> Menschen speist,<br />
sind wir nicht nur qualifizierte Berater für Hilfesu-<br />
chende <strong>und</strong> von Arbeitslosigkeit Betroffene, son-<br />
<strong>der</strong>n auch für Politiker <strong>und</strong> Entscheidungsträger.<br />
Die Caritas hat in ihrem Engagement nicht zuletzt<br />
diejenigen im Blick, die es auf dem Arbeitsmarkt<br />
aufgr<strong>und</strong> beson<strong>der</strong>er „Handicaps“ beson<strong>der</strong>s<br />
schwer haben - auch in dieser Option zeigt sich die<br />
beson<strong>der</strong>e Wertorientierung <strong>der</strong> Caritas.<br />
Eine ausreichende <strong>und</strong> gute Kin<strong>der</strong>tagesbetreuung<br />
schließlich ist Gr<strong>und</strong>voraussetzung für eine funk-<br />
tionierende, sozial intakte Gesellschaft. Nur wenn<br />
die Betreuung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> gesichert ist, können<br />
beide Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen - in<br />
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das für viele<br />
Familien von existentieller Bedeutung. An<strong>der</strong>er-<br />
seits brauchen wir in Deutschland ebenso wie in<br />
den an<strong>der</strong>en europäischen Län<strong>der</strong>n mehr Kin<strong>der</strong>.<br />
Aber nur die Aussicht auf eine gesicherte Betreu-<br />
ung <strong>und</strong> eine gute schulische Laufbahn kann, zu-<br />
sammen mit den entsprechenden finanziellen Un-<br />
terstützungen, ein Anreiz für junge Paare sein, Kin-<br />
<strong>der</strong> zu bekommen.<br />
Auch bei uns gibt es einen großen Nachholbedarf<br />
bei <strong>der</strong> Bereitstellung von Betreuungsplätzen für<br />
0 bis 3-jährige. Im Rahmen <strong>der</strong> Kostendiskussion<br />
bieten Kommunen vermehrt die Übergabe eigener<br />
Kin<strong>der</strong>betreuungsstätten an. Vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
des kommenden Bayerischen Kin<strong>der</strong>tagesstätten-<br />
gesetzes weitet unser <strong>Caritasverband</strong> seine Kom-<br />
petenz im Bereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>tagesbetreuung kon-<br />
sequent aus: in unseren Kin<strong>der</strong>tagesstätten, un-<br />
seren Horten, unseren Jugendzentren, den Heilpä-<br />
dagogischen Tagesstätten <strong>und</strong> unserem Kin<strong>der</strong>dorf<br />
Irschenberg. Unser Ziel ist es, mit an<strong>der</strong>en katho-<br />
lischen Trägern zusammen zu wirken <strong>und</strong> dabei<br />
auch die pastorale Einbindung zu intensivieren,<br />
also den sozialen <strong>und</strong> den pastoralen Auftrag von<br />
vornherein miteinan<strong>der</strong> zu verbinden. Kin<strong>der</strong> sind<br />
unsere Zukunft, deshalb müssen wir ihnen eine<br />
gute Zukunft ermöglichen. Von klein auf.<br />
Kompetenz aus christlichem<br />
Verständnis heraus<br />
Im <strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> <strong>München</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Freising</strong> arbeiten aktuell mehr als 6.500 Mitarbei-<br />
terinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter in insgesamt 6 Geschäfts-<br />
bereichen: dem Institut für Bildung <strong>und</strong> Entwick-<br />
lung, den Altenheimen, den Behin<strong>der</strong>teneinrich-<br />
tungen <strong>und</strong> in den Caritaszentren mit ihren vielfäl-<br />
tigen Diensten. Als Vorstand halten wir zu allen<br />
Einrichtungen Kontakt, denn nur, wenn wir wissen,<br />
wie es an <strong>der</strong> Basis aussieht, können wir die rich-<br />
tigen Schritte einleiten. Dazu gehören regelmäßi-<br />
ge Besuche des Vorstands „VorOrt“.<br />
Unser <strong>Caritasverband</strong> ist seit Jahren Vorreiter in<br />
einer mitarbeiterorientierten <strong>und</strong> innovativen Per-<br />
sonalentwicklung, die ein wesentlicher Faktor bei<br />
<strong>der</strong> aktiven Gestaltung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungsprozesse<br />
des Verbands war <strong>und</strong> ist. Zu einem mo<strong>der</strong>nen,<br />
wettbewerbsfähigen Unternehmen gehören nicht<br />
nur Transparenz in allen Bereichen, son<strong>der</strong>n auch<br />
<strong>der</strong> Wille, sich offen <strong>und</strong> flexibel auf neue Voraus-<br />
setzungen einzustellen, ohne bewährte Kompe-<br />
tenzen <strong>und</strong> ureigene Traditionen aus dem Auge zu<br />
verlieren.<br />
Die Orientierung am christlichen Menschenbild<br />
gibt unserem Streben nach bestmöglicher Quali-<br />
tät in <strong>der</strong> Betreuung, <strong>der</strong> Beratung, <strong>der</strong> Pflege <strong>und</strong><br />
im anwaltschaftlichen Engagement den konkreten<br />
Sinn, als Wohlfahrtsverband <strong>der</strong> katholischen Kir-<br />
che immer Nah. Am Nächsten zu sein: Nah an den<br />
Nöten, den Sorgen <strong>und</strong> den Bedürfnissen <strong>der</strong> Men-<br />
schen. Dieser christliche Impuls, <strong>der</strong> die Caritas<br />
auszeichnet, ist die Gr<strong>und</strong>lage, aus <strong>der</strong> heraus wir<br />
wirtschaftliche Verän<strong>der</strong>ungen verantwortungsvoll<br />
gestalten <strong>und</strong> umsetzen - für eine soziale Zukunft<br />
unserer Gesellschaft.
Hohe Qualität sorgt für Anerkennung<br />
Diözesanverband festigt Marktstellung<br />
Zahlen - Daten - Fakten<br />
Nach <strong>der</strong> schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in den drei Jahren zuvor zog die Konjunktur 2004 in<br />
Deutschland erstmals wie<strong>der</strong> stärker an. Die Impulse, die zu einem realen Anstieg des Bruttoinlandspro-<br />
dukts von 1,7% führten, kamen vor allem vom Außenhandel, während die Inlandsnachfrage weiter hinter<br />
den Erwartungen zurückblieb. Ausschlaggebend dafür waren die anhaltenden Unsicherheiten <strong>der</strong> Men-<br />
schen in Bezug auf die Renten- <strong>und</strong> Krankenversicherung. Auch die Angst um den Arbeitsplatz <strong>und</strong> die<br />
zusätzlichen Belastungen <strong>der</strong> privaten Haushalte durch die Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> gesetzlichen Krankenver-<br />
sicherung (höhere Zuzahlungen, Praxisgebühr) sowie Preissteigerungen bei Energie <strong>und</strong> Treibstoffen<br />
spielten eine Rolle.<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> war nicht mit nennens-<br />
werten Verbesserungen <strong>der</strong> Rahmenbedingungen<br />
zu rechnen, die für das Handeln gemeinnütziger<br />
Verbände wie <strong>der</strong> Caritas bestimmend sind. Wich-<br />
tigster Faktor waren die anhaltenden finanziellen<br />
Probleme <strong>der</strong> öffentlichen Haushalte; hinzu kamen<br />
weitere Störfaktoren wie zum Beispiel die wie<strong>der</strong>-<br />
kehrende Diskussion über die Absenkung von<br />
Qualitätsstandards in <strong>der</strong> Sozialarbeit.<br />
Trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen ist<br />
es gelungen, die Marktstellung des Diözesan-<br />
<strong>Caritasverband</strong>s als großer regionaler Anbieter<br />
sozialer Dienstleistungen zu festigen.<br />
Ausschlaggebend dafür war einerseits die hohe<br />
Qualität <strong>der</strong> erbrachten Leistungen <strong>und</strong> die damit<br />
zusammenhängende hohe Anerkennung in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit, an<strong>der</strong>erseits wirkten sich auch die<br />
geringe Preissteigerungsrate <strong>und</strong> die mo<strong>der</strong>aten<br />
Tariferhöhungen positiv aus.<br />
Das gesetzte Ziel, die Beratung <strong>und</strong> Unterstüt-<br />
zung bedürftiger Menschen durch wirtschaft-<br />
lichen Erfolg nachhaltig zu gewährleisten <strong>und</strong> Ent-<br />
wicklungen in <strong>der</strong> Sozialpolitik zu begleiten <strong>und</strong><br />
zu för<strong>der</strong>n, konnte daher auch im Berichtsjahr<br />
konsequent verfolgt werden.<br />
17<br />
Zahlen - Daten - Fakten 2004
18<br />
Insgesamt positives Geschäftsjahr 2004<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen über einen Dreijahreszeitraum<br />
zeigt nachfolgende Übersicht:<br />
Angesichts <strong>der</strong> Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Refinan-<br />
zierung <strong>der</strong> bezuschussten Beratungsdienste <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> ambulanten Pflegedienste verlief das Geschäfts-<br />
jahr erwartungsgemäß.<br />
Die Ergebnisverbesserung resultiert aus mehre-<br />
ren Faktoren. Zum einen konnte das Finanzergeb-<br />
nis erheblich gesteigert werden; die eingetretene<br />
Erhöhung von T€ 1.293 ist auf eine Beruhigung<br />
<strong>der</strong> Kapitalmärkte zurückzuführen. Zum an<strong>der</strong>en<br />
war auch eine erfreuliche Zunahme <strong>der</strong> Schenkun-<br />
gen <strong>und</strong> Erbschaften zu verzeichnen, die zu einer<br />
Zunahme von T€ 457 im ideellen Bereich führte.<br />
Die Umsatzerlöse aus Pflege- <strong>und</strong> Betreuungs-<br />
leistungen in stationären <strong>und</strong> teilstationären<br />
Einrichtungen konnten auf 200,9 Mio € (Vorjahr<br />
189,1 Mio €) gesteigert werden. Neben einer Erhö-<br />
hung <strong>der</strong> verfügbaren Plätze waren auch Entgelt-<br />
anpassungen sowie eine insgesamt verbesserte<br />
Auslastung <strong>der</strong> Einrichtungen dafür verantwort-<br />
lich. Die Abnahme um T € 2.474 bei den Zuweisun-<br />
gen <strong>und</strong> Zuschüssen rührt im Wesentlichen von<br />
<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zuschussrichtlinien <strong>der</strong> staat-<br />
lichen <strong>und</strong> kommunalen Zuschussgeber her. Die<br />
sonstigen betrieblichen Erträge blieben nahezu<br />
unverän<strong>der</strong>t.<br />
Verän<strong>der</strong>ung<br />
2004 2003 2002 2004 2003<br />
T € T € T € T € %<br />
Erträge aus Pflege <strong>und</strong> Betreuung 200.900 189.084 175.980 11.816 6,2<br />
Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 52.059 54.533 55.630 - 2.474 - 4,5<br />
Auflösung Investitionszuschüsse 1.200 1.094 1.039 106 9,7<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge 2.949 2.623 3.281 326 12,4<br />
Ideelle Erträge 7.485 7.476 6.319 9 0,1<br />
Sonstige betriebliche Erträge 13.082 10.778 10.714 2.304 21,4<br />
277.675 265.588 252.963 12.087 4,6<br />
Personalaufwand 201.366 194.407 182.235 6.959 3,6<br />
Sachaufwand 32.639 32.317 31.268 322 1,0<br />
Unterstützungen 735 1.183 2.093 - 448 - 37,9<br />
Instandhaltungen 7.211 6.401 7.361 - 810 - 12,7<br />
Abschreibungen 11.047 12.044 12.903 - 997 - 8,3<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 1.735 1.763 1.874 - 28 - 1,6<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20.764 16.703 17.561 4.061 24,3<br />
275.497 264.818 255.295 10.679 4,0<br />
Jahresergebnis vor Verwendung 2.178 770 - 2.332 1.408<br />
Der Personalaufwand erhöhte sich um 3,6 Prozent<br />
auf 201,4 Mio €; die Personalaufwandsquote blieb<br />
mit 72,5 Prozent (Vorjahr 72,0%) <strong>der</strong> Gesamtlei-<br />
tung nahezu unverän<strong>der</strong>t. Auch <strong>der</strong> Sachaufwand<br />
blieb unverän<strong>der</strong>t; bei den sonstigen betrieblichen<br />
Aufwendungen kam es zu einer Zunahme um<br />
4,06 Mio €, die im Wesentlichen auf eine Erhö-<br />
hung <strong>der</strong> Rückstellungen für unterlassene Instand-<br />
haltungen (2,5 Mio €) sowie auf erhöhte Aufwen-<br />
dungen für Leiharbeitnehmer zurückzuführen ist.
Effizientes Risikomanagement gewinnt<br />
immer mehr an Bedeutung<br />
Für Anbieter sozialer Dienstleistungen besteht<br />
das hauptsächliche Risiko in <strong>der</strong> dramatischen fi-<br />
nanziellen Lage <strong>der</strong> öffentlichen Haushalte <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> damit einhergehenden Hektik in <strong>der</strong> Gesetz-<br />
gebung. So wurden zum Beispiel in den letzten<br />
Jahren neue Gesetze auf den Weg gebracht, die<br />
vorgeblich die Qualität in den Pflegeeinrichtun-<br />
gen verbessern sollen, in erster Linie jedoch mehr<br />
Bürokratie <strong>und</strong> Dokumentationsaufwand verursa-<br />
chen, ohne dass die dafür notwendigen finanziel-<br />
len Mittel zur Verfügung stehen. Seit geraumer<br />
Zeit ist auch eine schleichende Reduzierung <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>mittel sowohl für den laufenden Betrieb<br />
vieler Einrichtungen als auch für notwendige In-<br />
vestitionen zu beobachten.<br />
Mit dem Auftreten neuer Anbieter aus dem privat-<br />
gewerblichen Bereich am Markt sozialer Dienst-<br />
leistungen kommt es zu einer Verschärfung <strong>der</strong><br />
Wettbewerbssituation, die die Auslastung vieler<br />
Einrichtungen negativ beeinflusst. Effizientes<br />
Risikomanagement gewinnt deshalb immer mehr<br />
an Bedeutung. Entscheidend ist dabei die Bestim-<br />
mung maßgeblicher fachdienstspezifischer Para-<br />
meter. Mit dem verbandsweiten Controllingsys-<br />
tem, das regelmäßig Daten aus den Einrichtungen<br />
erhebt <strong>und</strong> auswertet, ist die Caritas in <strong>der</strong> Lage,<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter am Jahresende<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
erfor<strong>der</strong>liche Entscheidungen zeitnah umzusetzen.<br />
Durch das bereits seit Jahren eingeführte interne<br />
Qualitätsmanagementsystem ist es darüber hin-<br />
aus gelungen, auftretende Qualitätsmängel früh-<br />
zeitig zu erkennen <strong>und</strong> weitgehend abzustellen.<br />
Angesichts <strong>der</strong> jüngsten Steuerschätzungen ist<br />
mit einer weiteren Verschlechterung <strong>der</strong> öffentli-<br />
chen Haushalte zu rechnen. Das wird unmittelbare<br />
Auswirkungen auf die Bereitstellung von Zuschüs-<br />
sen haben, aber auch „Deckelungen“ <strong>der</strong> leis-<br />
tungsabhängigen Vergütungen in den teilstatio-<br />
nären <strong>und</strong> stationären Einrichtungen nach sich<br />
ziehen. Zusätzlicher wirtschaftlicher Druck ent-<br />
steht durch bereits erkennbare finanzielle Aus-<br />
fälle im Zuge <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> Sozialgesetzbü-<br />
cher II <strong>und</strong> XII <strong>und</strong> die zu erwartende Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Pflegeversicherung.<br />
Kontinuierliche Organisationsentwicklungs- <strong>und</strong><br />
Qualitätsmanagementprozesse <strong>und</strong> eine effizien-<br />
tere Erbringung von sek<strong>und</strong>ären Dienstleistungen<br />
durch den verstärkten EDV-Einsatz bieten geeig-<br />
nete Einsparungspotentiale ohne Qualitätsverlust<br />
<strong>der</strong> Primärleistungen. Weitere Ergebnisverbesse-<br />
rungen lassen sich durch eine effizientere Prozess-<br />
gestaltung im Verwaltungsbereich, aber auch durch<br />
verstärkte Maßnahmen zur zusätzlichen Mittelge-<br />
winnung erreichen.<br />
19<br />
Zahlen - Daten - Fakten 2004
20<br />
Beschäftigungsumfang<br />
Arbeitsbereiche <strong>der</strong> Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0
Einrichtungen in Trägerschaft des DiCV Zahl <strong>der</strong> Einrichtungen<br />
Offene Altenarbeit/Alten- <strong>und</strong> Servicezentren/Seniorenbegegnungsstätten 13<br />
Sozialstationen/Familien-Kurzzeitpflege 31<br />
Offene Behin<strong>der</strong>tenarbeit 3<br />
Erziehungsberatungsstellen 19<br />
Kin<strong>der</strong>garten/Kin<strong>der</strong>hort 17<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten 15<br />
Kin<strong>der</strong>dorf inkl. Schule <strong>und</strong> HPT 1<br />
Mädchenheim inkl. Schule 1<br />
Jugendwohnheime 3<br />
Gemeindeorientierte Soziale Arbeit <strong>und</strong> Projekte 39<br />
Freiwilligenzentren 6<br />
Auslän<strong>der</strong>beratung 35<br />
Schuldnerberatung 15<br />
Essen auf Rä<strong>der</strong>n/Mobile Dienste 9<br />
Fachambulanz für Suchtkranke 16<br />
Fachambulanz für Essstörungen 1<br />
Tagesstätten für psychisch Kranke 9<br />
Suchtkliniken <strong>und</strong> Reha 3<br />
Fahrtendienst/Mobiler Hilfsdienst 5<br />
Sozialpsychiatrische Dienste 32<br />
Wohnprojekte 7<br />
Wohnungslosenhilfe 3<br />
Schulen:<br />
För<strong>der</strong>schule 1<br />
Fachakademie für Heilpädagogik 1<br />
Fachakademie für Sozialpädagogik 1<br />
Berufsfachschule für Kin<strong>der</strong>pflege 1<br />
Fachschulen für Altenpflege 2<br />
Fachschule für Heilerziehungspflege <strong>und</strong> -hilfe 1<br />
Alten- <strong>und</strong> Pflegeheime 29<br />
Frühför<strong>der</strong>stellen 2<br />
Wohnheime für behin<strong>der</strong>te Menschen 4<br />
Heilpädagogische Tagesstätten 5<br />
Werkstätten für behin<strong>der</strong>te Menschen 4<br />
Sonstige Dienste 21<br />
21<br />
Zahlen - Daten - Fakten 2004
Ludwig Mittermeier<br />
Leiter des Caritaszentrums<br />
<strong>Freising</strong><br />
22<br />
Ludwig Mittermeier<br />
„Meine Wohnung kam mir fast wie ein Gefängnis vor...“<br />
Bereits im Januar 25 Zusatzjobs besetzt - von den ersten Erfahrungen<br />
im Arbeitsprojekt Rentabel des Caritaszentrums <strong>Freising</strong><br />
Mit dem Arbeitsprojekt Rentabel leistet die Caritas seit 1999 ihren Beitrag dazu, dass mit dem Verlust des<br />
Arbeitsplatzes nicht auch gleich <strong>der</strong> Verlust von Selbstwert <strong>und</strong> eines sinnvollen Lebens einhergeht.<br />
Schwerpunkt bei diesem Projekt ist die Betreuung von Menschen, die aufgr<strong>und</strong> verschiedener Probleme<br />
(Sucht, Schulden, psychische Erkrankung uvm.) nicht wie<strong>der</strong> in den Arbeitsmarkt eingeglie<strong>der</strong>t werden<br />
können. Im Kaufhaus für Gebrauchtmöbel <strong>und</strong> -kleidung sowie den angeschlossenen Dienstleistungsbe-<br />
reichen bietet Rentabel diesen Menschen echte Beschäftigung.<br />
Mit <strong>der</strong> Einführung des SGB II (Hartz IV) ergeben<br />
sich nun neue Herausfor<strong>der</strong>ungen: die sogenann-<br />
ten „Ein-Euro-Jobs“. Diese Zuatzjobs, wie die offi-<br />
zielle Bezeichnung lautet, stellen eine Form von<br />
öffentlich geför<strong>der</strong>ter Beschäftigung nach dem<br />
§ 16 SGB II dar.<br />
Vorrangiges Ziel dieses Instruments ist die Heran-<br />
führung von Langezeitarbeitslosen an den Arbeits-<br />
markt. Es dient insbeson<strong>der</strong>e dazu, einerseits die<br />
soziale Integration zu för<strong>der</strong>n <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits<br />
die Beschäftigungsfähigkeit aufrecht zu erhalten<br />
bzw. wie<strong>der</strong>herzustellen <strong>und</strong> damit die Chance zur<br />
Integration in den regulären Arbeitsmarkt zu erhö-<br />
hen. Soweit <strong>der</strong> beabsichtigte Effekt.<br />
In <strong>der</strong> Praxis muss sich allerdings erst noch erwei-<br />
sen, was davon wirklich realisiert werden kann,<br />
vor allem mit Blick auf die Frage, welche Bedeu-<br />
tung diese Arbeitsgelegenheiten für die Betroffe-<br />
nen haben <strong>und</strong> was die Einführung dieses Instru-<br />
ments für die Arbeitsprojekte <strong>und</strong> Einsatzstellen<br />
bedeutet.<br />
Bis auf einige wenige sind alle Betroffenen<br />
in das Projekt hineingewachsen<br />
„Wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich<br />
richtig, zu Rentabel zu gehen. Ich habe wie<strong>der</strong><br />
das Gefühl, dass man mich braucht.“<br />
Peter T., 47, seit vier Jahren ohne Arbeit<br />
„Langsam gewöhne ich mich wie<strong>der</strong> an einen<br />
festen Arbeitstag mit geregeltem Ablauf. Das<br />
hätte ich alleine wohl nicht mehr geschafft.“<br />
Andreas B., 25, seit drei Jahren ohne Arbeit<br />
„Mir bringt die Arbeit viel, denn ich bin endlich<br />
wie<strong>der</strong> unter Menschen <strong>und</strong> versauere nicht zu<br />
Hause.“ Roswitha M., 54, seit zwei Jahren ohne<br />
Arbeit<br />
„In dem Ein-Euro-Job sehe ich die Chance, mich<br />
wie<strong>der</strong> an ein geregeltes Arbeitsleben zu ge-<br />
wöhnen.“ Günther M., 44, seit drei Jahren ohne<br />
Arbeit<br />
Diese Aussagen von Betroffenen sind repräsenta-<br />
tiv für den überwiegenden Teil <strong>der</strong> bei Rentabel<br />
Beschäftigten. Sie zeigen ansatzweise, welchen<br />
Nutzen die Zusatzjobs für Betroffene haben kön-<br />
nen. Die Integration in die Abläufe des Arbeitspro-<br />
jektes verlief überwiegend positiv, wenn auch<br />
nicht immer reibungslos, denn die Menschen, die<br />
von <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft zu uns vermittelt<br />
werden, haben in <strong>der</strong> Regel einen hohen Beglei-<br />
tungs- <strong>und</strong> Unterstützungsbedarf. Sie werden in<br />
die bestehenden Arbeitsteams eingeteilt <strong>und</strong> haben<br />
dort die Möglichkeit, sich unter realen Bedingun-<br />
gen wie<strong>der</strong> in Arbeitsabläufen zurecht zu finden.
Bis auf einige wenige Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitar-<br />
beiter sind alle in das Projekt „hineingewachsen“.<br />
Sie stellen sich den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sind enga-<br />
giert bereit, sowohl ihre Situation im Arbeitsalltag<br />
als auch im privaten Bereich zu verän<strong>der</strong>n. Er-<br />
reicht wird dies in vielen kleinen Schritten durch<br />
einen „Hilfeplan“, den wir mit jedem Einzelnen<br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> persönlichen Situati-<br />
on individuell erarbeiten. An einem Tag <strong>der</strong> Woche<br />
finden zudem Schulungen in den Bereichen sozia-<br />
les Kompetenztraining <strong>und</strong> Bewerbungshilfen statt.<br />
In den meisten Fällen gelingt es, die soziale<br />
Integration zu unterstützen<br />
Mit dem beschriebenen Ablauf gelingt es in den<br />
meisten Fällen, die soziale Integration zu unter-<br />
stützen <strong>und</strong> die Beschäftigungsfähigkeit wie<strong>der</strong><br />
herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten. Klar ist<br />
aber auch, dass damit <strong>der</strong> nahtlose Übergang<br />
nach 6 bis 9 Monaten in den ersten Arbeitsmarkt<br />
noch lange nicht erreicht ist. Zum einen ist dafür<br />
die Laufzeit solcher Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
zu kurz, zum an<strong>der</strong>en ist ein Arbeitsprojekt immer<br />
noch ein geschützter Rahmen, in dem viel Unter-<br />
stützung geleistet wird.<br />
Deshalb ist es aus unserer Sicht von entscheiden-<br />
<strong>der</strong> Bedeutung, dass Betroffene, die nach einer<br />
gewissen Zeit <strong>der</strong> Qualifizierung <strong>und</strong> Schulung die<br />
nötige Sicherheit <strong>und</strong> Stabilität gewonnen haben,<br />
einen weiteren Schritt gehen müssen.<br />
Durch die Einrichtung von zwei Koordinierungs-<br />
stellen für die Landkreise <strong>Freising</strong> <strong>und</strong> Erding ver-<br />
suchen wir, Personen aus Rentabel heraus in<br />
kirchliche Einrichtungen <strong>und</strong> Pfarreien weiterzu-<br />
vermitteln. Immer noch im Rahmen eines Zusatz-<br />
jobs – aber bereits in einem an<strong>der</strong>en sozialen Kon-<br />
text <strong>und</strong> mit erhöhten Anfor<strong>der</strong>ungen. Die Beglei-<br />
tung dieser Mitarbeiter sowie <strong>der</strong> Einsatzstellen<br />
erfolgt über die Sozialpädagogen, die für die Ko-<br />
ordinierung dieser Aufgabe verantwortlich sind.<br />
Das gibt allen Beteiligten die für diesen Schritt<br />
nötige Sicherheit.<br />
Vieles ist in <strong>der</strong> Praxis kritisch zu betrachten<br />
Mit <strong>der</strong> Umsetzung des SGB II fielen alle Zuschüs-<br />
se <strong>der</strong> Kommunen ersatzlos weg. Pauschalförde-<br />
rungen sind im Rahmen des Gesetzes nicht mög-<br />
lich bzw. kommen seitens <strong>der</strong> Arbeitsgemein-<br />
schaft nicht in Frage. Die Mantelför<strong>der</strong>ung von<br />
500,- Euro pro Person reicht nicht aus, um den ge-<br />
samten Bereich kostendeckend finanzieren zu<br />
können. Der Arbeitsaufwand für die Einrichtung<br />
steigt, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Eindruck erhärtet sich, dass das<br />
einzige Ziel <strong>der</strong> politisch Verantwortlichen in den<br />
Kommunen darin besteht, auf Kosten <strong>der</strong> Betrof-<br />
fenen zu sparen.<br />
Der durch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften<br />
beabsichtigte Effekt „Alles in einem Haus - aus<br />
einer Hand o<strong>der</strong> schnelle Hilfe unter einem Dach“<br />
wurde nicht erzielt. Die Betroffenen müssen zwi-<br />
schen zwei Gebäuden „pendeln“, <strong>und</strong> trotz guter<br />
Zusammenarbeit <strong>und</strong> Kooperation mit <strong>der</strong> Arbeits-<br />
gemeinschaft in <strong>Freising</strong> sind unkomplizierte,<br />
klare Absprachen <strong>und</strong> gemeinsame Regelungen in<br />
<strong>der</strong> Praxis meist schwer zu realisieren.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass die nötigen Verän<strong>der</strong>un-<br />
gen realisiert werden - vor allem unter <strong>der</strong> Ein-<br />
sicht, dass für die Menschen, die beson<strong>der</strong>e Pro-<br />
blemkonstellationen mitbringen, <strong>der</strong> Versuch <strong>der</strong><br />
Integration ohne Arbeitsprojekte wie Rentabel be-<br />
reits im Ansatz misslingt. Für die Dienste <strong>der</strong> Cari-<br />
tas ist eine Positionierung nötig, denn es wäre<br />
fatal, diesen Bereich ausschließlich privaten An-<br />
bietern im Bereich Vermittlung, Bildung <strong>und</strong> Qua-<br />
lifizierung zu überlassen.<br />
Das Caritaszentrum <strong>Freising</strong> beteiligt sich an <strong>der</strong><br />
Umsetzung von „Hartz IV“ nicht deshalb, weil wir<br />
das Gesetz als solches <strong>und</strong> die Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Zusatzjobs im Beson<strong>der</strong>en ohne Vorbehalte unter-<br />
stützen. Im Gegenteil: Vieles ist kritisch zu betra-<br />
chten. Wir beteiligen uns, weil es zu den Aufgaben<br />
<strong>der</strong> Caritas gehört, Menschen in beson<strong>der</strong>s schwie-<br />
rigen sozialen Lagen zu begleiten <strong>und</strong> zu unter-<br />
stützen. Zudem können wir aus <strong>der</strong> Erfahrung <strong>der</strong><br />
Praxis heraus zu den zentralen sozialpolitischen<br />
Themen dieser Zeit konkret Stellung beziehen.<br />
23
Norbert Huber<br />
Geschäftsführer<br />
Caritaszentren<br />
<strong>München</strong> Stadt/Land<br />
Willibald Strobel-Wintergerst<br />
Referent<br />
Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
sowie Sozialpsychiatrische<br />
Dienste<br />
24<br />
Norbert Huber / Willibald Strobel-Wintergerst<br />
Kin<strong>der</strong>reich <strong>und</strong> ohne Arbeit in <strong>München</strong><br />
Leben mit 345 Euro im Monat? Armut wird zum anonymen Zustand auf Dauer<br />
Waren Münchner bis vor kurzem noch ein wenig stolz darauf, gegenüber vielen b<strong>und</strong>esweiten sozialpoliti-<br />
schen Entwicklungen besser da zu stehen, so scheint spätestens seit Einführung von Hartz IV diese beru-<br />
higende Perspektive dahin zu sein: 89.000 Menschen waren im ersten Quartal 2005 bei <strong>der</strong> Agentur für<br />
Arbeit als arbeitslos gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es noch 69.000 (ARGE für Beschäftigung <strong>München</strong><br />
GmbH; 2005). Dahinter steckt zwar auch eine statistische Größe, die ihre Ursache in dem durch das „Vierte<br />
Gesetz für mo<strong>der</strong>ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ erweiterten Begriff <strong>der</strong> Erwerbsfähigkeit hat, je-<br />
doch vergrößert sich <strong>der</strong> Abbau von Arbeitsplätzen in <strong>München</strong>.<br />
Die Hoffnung für arbeitslose Münchner, in abseh-<br />
barer Zeit wie<strong>der</strong> in ein Arbeitsverhältnis zu gelan-<br />
gen, ist in Anbetracht <strong>der</strong> gerade mal 8.800 offe-<br />
nen Stellen (I/2005) brüchig. Wem die Rückkehr in<br />
ein reguläres Arbeitsverhältnis nicht gelingt, muss<br />
mit 345 Euro im Monat (Alg II) auskommen. Ange-<br />
sichts <strong>der</strong> sehr hohen Miet- <strong>und</strong> Lebenshaltungs-<br />
kosten in <strong>München</strong> trifft dies kin<strong>der</strong>reiche Familien<br />
beson<strong>der</strong>s hart. Mit Hartz IV wurde <strong>der</strong> bewährte<br />
Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Hilfe nach dem individuellen Bedarf<br />
aufgegeben. Armut wird zum anonymen Zustand<br />
auf Dauer. Kin<strong>der</strong> aus armen Familien geraten in<br />
eine Armutsfalle, aus <strong>der</strong> es kaum ein Entrinnen<br />
gibt. Das Risiko für Familien, in Armut zu fallen,<br />
steigt mit jedem Kind.<br />
Gibt es noch kin<strong>der</strong>reiche Familien - auch in Mün-<br />
chen? Durchaus! Kin<strong>der</strong>reichtum heute ist nicht<br />
mehr mit dem früheren Begriff <strong>der</strong> Großfamilie<br />
gleichzusetzen. Kin<strong>der</strong>reich ist heute eine Familie<br />
mit drei <strong>und</strong> mehr Kin<strong>der</strong>n; <strong>und</strong> das trifft immerhin<br />
auf jede achte Familie zu (Bierschock/ifB, 2004).<br />
Reich im wirtschaftlichen Sinn sind diese Familien<br />
oft auch, wie die Statistiken zeigen. Das sind sie<br />
dann aber deshalb, weil gesicherte <strong>und</strong> hohe Ein-<br />
kommen Voraussetzungen sind für Kin<strong>der</strong>reichtum<br />
<strong>und</strong> nicht dessen Folge.<br />
Nachweislich sinkt mit jedem Kind das „bedarfs-<br />
gewichtete Pro-Kopf-Einkommen“ nach dem Bam-<br />
berger-Ehepaare-Panel deutlich ab (Staatsinstitut<br />
für Familienforschung Bamberg, 2003). Gegenüber<br />
dem in unserem Beispiel 1 aufgezeigten Fall würde<br />
das Panel ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Ein-<br />
kommen von 1.690 Euro errechnen - Familie Cramer<br />
liegt also weit darunter.<br />
Armut hat tiefgreifende <strong>und</strong> nachhaltige<br />
Folgen - insbeson<strong>der</strong>e inmitten von<br />
Reichtum<br />
Armut ist eine Situation, in <strong>der</strong> Menschen verküm-<br />
mern. Armut bedeutet, auf vielfache Weise ausge-<br />
schlossen zu sein. Arme leiden nicht nur daran, an<br />
vielen gesellschaftlichen Gütern nicht mehr teil-<br />
haben zu können, was gerade im reichen Mün-<br />
chen erfahrbar wird. Sie haben auch nicht mehr die<br />
Mittel, sich gegen Lebensrisiken abzusichern. Ver-<br />
schuldung, Krankheit <strong>und</strong> eine Häufung von Kon-<br />
flikten sind die bekanntesten Folgen. „Armut stört<br />
die Entwicklung, weil zuviel Stress in <strong>der</strong> Familie<br />
ist“ - so resümiert die Familienforscherin Walpert.<br />
Armut hat tiefgreifende <strong>und</strong> nachhaltige Folgen!<br />
Schule <strong>und</strong> Bildung wäre zwar noch eine <strong>der</strong> weni-<br />
gen Möglichkeiten, Armut nicht von einer Genera-<br />
tion an die an<strong>der</strong>e weiterzugeben. Aber schon am<br />
Ende <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule sind die Würfel meist gefal-<br />
len, mit dem Ergebnis, dass ärmere Kin<strong>der</strong> von Bil-<br />
dungschancen ausgeschlossen werden. Vor die-<br />
sem Hintergr<strong>und</strong> wird professionelle Hilfe durch<br />
Soziale Beratung, Erziehungsberatung, Schuldner-<br />
beratung, qualitativ hochwertige Kin<strong>der</strong>betreuung<br />
<strong>und</strong> Schulsozialarbeit beson<strong>der</strong>s wichtig. Hierüber<br />
können individuelle <strong>und</strong> z.T. auch strukturelle De-<br />
fizite ausgeglichen werden. Menschen in Not er-<br />
halten Hilfe, Zuspruch <strong>und</strong> mit vereinten Kräften<br />
Selbstvertrauen <strong>und</strong> Lebensperspektiven.<br />
Die Sozialpolitik <strong>und</strong> <strong>der</strong> Arbeitsmarkt als die we-<br />
sentlichen Schlüsselfaktoren für das Entstehen von<br />
Armut (Definition Unicef) müssen von allen Man-
datsträgern <strong>und</strong> gesellschaftlichen Kräften auf die<br />
Bekämpfung von Kin<strong>der</strong>armut ausgerichtet wer-<br />
den. Das „Vierte Gesetz für mo<strong>der</strong>ne Dienstleis-<br />
tungen am Arbeitsmarkt“ bleibt diesen Beweis,<br />
Armut - insbeson<strong>der</strong>e Kin<strong>der</strong>armut - zu verhin<strong>der</strong>n,<br />
noch schuldig.<br />
Festzustellen bleibt also:<br />
1. Familien mit Kin<strong>der</strong>n sind immer weniger<br />
gegen existenzielle Risiken abgesichert.<br />
2. Das Armutsrisiko steigt mit jedem Kind.<br />
3. Die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen des<br />
Arbeitsmarktes verschärfen diese Situation.<br />
Fallbeispiel 1:<br />
4. Der Staat zieht sich mit zunehmendem Kosten-<br />
druck (Gemeindefinanzen) aus seiner Verant-<br />
wortung.<br />
5. Familien mit Kin<strong>der</strong>n werden mit ihrem Risiko<br />
bzw. mit ihrer Armut im Stich gelassen.<br />
6. Erwerbstätige Eltern tragen gegenwärtig eine<br />
dreifache Last:<br />
a) sie erwirtschaften Renten für die ältere<br />
Generation<br />
b) sie erziehen <strong>und</strong> versorgen ihre Kin<strong>der</strong><br />
unter hohem Risiko<br />
c) sie müssen für ihre eigene Altersversorgung<br />
mehr beitragen als je zuvor, weil sie nicht<br />
mehr damit rechnen können, dass nachfol-<br />
gende Generationen für ihre Renten auf-<br />
kommen (können).<br />
7. Der Verlust des Arbeitsplatzes zehrt in wesent-<br />
lich kürzerer Zeit Rücklagen <strong>und</strong> Vermögens-<br />
werte (Eigentumswohnung/Eigenheim) auf<br />
<strong>und</strong> lässt Familien schneller in Armut mit all<br />
ihren Folgen abrutschen.<br />
8. Der Verlust des Arbeitsplatzes löst weitere<br />
Krisen aus <strong>und</strong> verschärft somit die Situation<br />
B. Cramer (Name geän<strong>der</strong>t) ist allein erziehende Mutter von fünf Kin<strong>der</strong>n im Alter von 9 bis 18 Jahren.<br />
Zusammen mit Kin<strong>der</strong>geld (820 Euro), Unterhaltsvorschuss (164 Euro) <strong>und</strong> Alg II (1.083 Euro) steht<br />
dem Sechspersonenhaushalt ein Gesamteinkommen von 2.067 Euro zur Verfügung. Nach Abzug<br />
von Miete (672 Euro) <strong>und</strong> Strom (85 Euro) verbleibt <strong>der</strong> Familie zum Lebensunterhalt ein Betrag von<br />
1.310 Euro, wovon noch Fahrtkosten für den Schulbesuch - drei Kin<strong>der</strong> besuchen das Gymnasium -<br />
sowie Telefonkosten zu bestreiten sind. Die sechsköpfige Familie muss mit 1.100 Euro auskommen,<br />
ein Pro-Kopf-Einkommen von 183,30 Euro.<br />
Bei wirtschaftlicher Haushaltsführung mag dies für Essen, Trinken, Drogerieartikel reichen. Zusätz-<br />
liche Ausgaben für Kleidung, Schulmaterialien, Nebenkosten- o<strong>der</strong> Stromnachzahlung, allgemeine<br />
„Teilhabe am kulturellen Leben“ können hiervon nicht mehr bestritten werden.<br />
Die Mutter ist gelernte Krankenschwester. Um nach 18 Jahren wie<strong>der</strong> in den Beruf einsteigen zu<br />
können, bräuchte sie dringend entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen. Seitens <strong>der</strong> ARGE wurde<br />
ihr mitgeteilt, dass zunächst vorrangig die Personengruppe von 15-25 Jahren „versorgt“ werden<br />
müsse <strong>und</strong> sie daher in absehbarer Zeit keinen Termin bei ihrem Sachbearbeiter erhalten könne.<br />
25
26<br />
in den Familien: Lern- <strong>und</strong> Leistungsschwä-<br />
chen, Stress, Steigerung von Aggressionen,<br />
Rückzug, Erziehungsprobleme, gesteigerte<br />
Krankheitsanfälligkeit, Ehe- bzw. Partner-<br />
schaftskonflikte. Die Betroffenen leiden an<br />
dieser Situation. Die entstehenden Beschädi-<br />
gungen haben langfristig wirkende Folgen.<br />
9. Dem verschärften Konkurrenz- <strong>und</strong> Leistungs-<br />
druck in Schulen <strong>und</strong> Hochschulen sind Kin<strong>der</strong><br />
aus kin<strong>der</strong>reichen Familien insbeson<strong>der</strong>e dann<br />
nicht mehr gewachsen, wenn sie aus wirt-<br />
schaftlichen Gründen mittelbar o<strong>der</strong> unmittel-<br />
bar an diesem gnadenlosen „Wettbewerb“ gar<br />
nicht erst teilnehmen können. Hier wird <strong>der</strong><br />
Gr<strong>und</strong>stein für eine neue Ära von Familien-<br />
armut gelegt.<br />
10. Die geringe Hoffnung von Kin<strong>der</strong>n, Jugend-<br />
lichen <strong>und</strong> ihren Eltern, sich aus eigenen<br />
Kräften <strong>und</strong> dauerhaft aus <strong>der</strong> Brüchigkeit<br />
dieser Lebensbedingungen emporarbeiten<br />
Fallbeispiel 2:<br />
Eine Beamtenfamilie mit vier Kin<strong>der</strong>n im Alter von 4 bis 11 Jahren (11/9/7/4). In die Erziehungsbe-<br />
ratung kommt <strong>der</strong> älteste Junge auf Veranlassung <strong>der</strong> Lehrerin. Er war in <strong>der</strong> Schule gemobbt worden<br />
<strong>und</strong> hatte sich rücksichtslos verteidigt. Nach einem dieser Vorfälle wurde er mit zwei an<strong>der</strong>en Buben<br />
vom Klassenausflug ausgeschlossen. Daraufhin beleidigte er die Lehrerin <strong>und</strong> griff sie tätlich an.<br />
Die Eltern befinden sich im Trennungsjahr, wohnen aber aus Geldmangel weiter in <strong>der</strong> gemeinsamen<br />
kleinen Wohnung. Der Vater verbringt wegen dieser Spannungssituation viel Zeit außerhalb <strong>und</strong><br />
verbraucht dafür einen Teil des kleinen Gehaltes.<br />
Die Familienmitglie<strong>der</strong> haben kaum ein Eckchen für sich. Der Konflikt eskaliert, weil die Eheleute<br />
sich <strong>und</strong> den Kin<strong>der</strong>n nicht mehr aus dem Weg gehen können. Die finanzielle Versorgung wird immer<br />
schwieriger - die Mutter geht abends bzw. nachts putzen, um ihren Kin<strong>der</strong>n das Notwendigste kaufen<br />
zu können. Die Kin<strong>der</strong> beleidigen den Vater; verlangen Geld von ihm. Die Abwesenheit <strong>der</strong> Mutter<br />
führt zu mehr TV-Konsum, späterem Schlafengehen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, Erschöpfungszuständen <strong>der</strong> Mutter<br />
usw. Der Teufelskreis von Abwesenheit <strong>der</strong> Mutter <strong>und</strong> Flucht des Vaters aus <strong>der</strong> Erziehungsrolle<br />
sowie <strong>der</strong> Überfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Mutter führt zu destruktiven Aggressionen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>.<br />
Die Betreuung des Jungen bzw. <strong>der</strong> Mutter lief über zwei Jahre hinweg - alternierend in gemeinsa-<br />
men <strong>und</strong> getrennten Sitzungen. Die schulische Isolation, Leistungsverweigerung <strong>und</strong> schlechten<br />
Zensuren bei dem Buben besserten sich wesentlich. Ein Bonmot ist die Äußerung des ältesten Bu-<br />
ben in <strong>der</strong> Spielst<strong>und</strong>e gegenüber <strong>der</strong> Sozialpädagogin: „Gut, dass ich die Lehrerin gehauen habe,<br />
sonst hätte ich Dich nie kennen gelernt!“<br />
bzw. befreien zu können, för<strong>der</strong>t den Rück-<br />
zug aus <strong>der</strong> Eigenverantwortung.<br />
Die Positionen bzw. For<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
Caritas lauten daher:<br />
� Das Alg II ist mit 345 Euro viel zu niedrig<br />
angesetzt.<br />
� Einmalige finanzielle Hilfen müssen zur<br />
Ergänzung wie<strong>der</strong>eingeführt werden.<br />
� Bei <strong>der</strong> Bekämpfung von Armut werden nicht<br />
selten die von Armut Betroffenen bekämpft,<br />
statt die Armutsursachen. Solidarische Hilfe<br />
<strong>und</strong> Selbsthilfe können sich nur dann erfolg-<br />
reich ergänzen, wenn das gesellschaftliche<br />
Klima von Partnerschaftlichkeit geprägt ist,<br />
die Arme, insbeson<strong>der</strong>e kin<strong>der</strong>reiche Arme,<br />
als Akteure ernst nimmt.
Vom Managersessel in die Schuldnerfalle<br />
Rapi<strong>der</strong> sozialer Abstieg für ehemals gut Verdienende<br />
Axel Hannemann<br />
Armut breitet sich aus in Deutschland. Sie erfasst Arbeitslose, kin<strong>der</strong>reiche Familien, allein Erziehende<br />
ebenso wie alte, kranke <strong>und</strong> behin<strong>der</strong>te Menschen <strong>und</strong> immer häufiger - ehemals gut verdienende Manager,<br />
Selbständige o<strong>der</strong> Unternehmer, die mit ihrem Geschäft gescheitert sind. Das verbindende Element: mit<br />
Hartz IV fallen sie alle tief. Es gibt in Deutschland inzwischen nicht nur eine „neue Qualität“ von Arbeitslosen,<br />
son<strong>der</strong>n auch eine neue Form von finanziellem Abstieg <strong>und</strong> dem damit verb<strong>und</strong>enen Prestigeverlust.<br />
3,13 Millionen Haushalte in Deutschland<br />
sind überschuldet, an<strong>der</strong>thalb mal so viele<br />
wie vor zehn Jahren, mehr als je zuvor. Ihre<br />
Verbindlichkeiten sind so hoch, dass sie<br />
keine Chance haben, sie je zurückzuzah-<br />
len. Manchmal verbirgt sich hinter dem<br />
privaten Ruin die schlichte Unfähigkeit, mit<br />
Geld umzugehen, aber immer öfter <strong>der</strong><br />
Umstand, dass heute im Gegensatz zu frü-<br />
her <strong>der</strong> klassische Weg - arbeiten, einen<br />
Kredit aufnehmen, ein Haus kaufen, sich<br />
etwas aufbauen - in Deutschland nicht<br />
mehr funktioniert. (DIE ZEIT 10.03.2005 Nr.11)<br />
Was jahrzehntelang Normalität war, endet von<br />
heute auf morgen auch für gut Verdienende in <strong>der</strong><br />
finanziellen Katastrophe (<strong>und</strong> oft nicht nur in <strong>der</strong><br />
finanziellen), weil plötzlich <strong>der</strong> Arbeitsplatz weg<br />
ist o<strong>der</strong> die Aufträge <strong>und</strong> damit das Einkommen.<br />
Dann steigen die Schulden in <strong>der</strong> Regel in rasanter<br />
Weise, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Abstieg nach unten ist unaufhalt-<br />
sam, insbeson<strong>der</strong>e, wenn kein soziales Netz vor-<br />
handen ist, in dem die Betroffenen aufgefangen<br />
werden können.<br />
Beson<strong>der</strong>s erschreckend dabei ist die Tatsache,<br />
dass es sich vor allem um die so genannte Mittel-<br />
schicht handelt, die Stück für Stück abbröckelt.<br />
Ehemals gültige Maximen wie „das kann mir nicht<br />
passieren“ sind heute Makulatur. Betroffen sein<br />
kann je<strong>der</strong>, wirklich je<strong>der</strong>, <strong>und</strong> zwar ohne eigenes<br />
Verschulden. Das ist das, was die Menschen in<br />
Deutschland so mit Angst erfüllt - das Gefühl, sel-<br />
ber nicht unbedingt die Kontrolle darüber zu ha-<br />
ben, wie ihre Zukunft verlaufen wird. Und <strong>der</strong> Pro-<br />
test <strong>der</strong> Bevölkerung ob dieser Ungewissheit wäre<br />
vermutlich viel lauter, wenn es nicht an<strong>der</strong>erseits<br />
so viele Menschen <strong>und</strong> Institutionen wie die Caritas<br />
gäbe, die Arbeitslose im Krisenfall auffangen.<br />
Die nachfolgenden Fallgeschichten demonstrieren<br />
auf eindrucksvolle Weise, wie unspektakulär <strong>der</strong><br />
Weg verlaufen kann, <strong>der</strong> Familien ins Bodenlose<br />
stürzt: keine schweren Unfälle, keine außerge-<br />
wöhnlichen Krankheiten, kein Hereinfallen auf be-<br />
trügerische Spekulanten. Nichts, was nicht je<strong>der</strong><br />
Zeit auch den Nachbarn treffen könnte - die Tragik<br />
liegt im Alltäglichen.<br />
Beispiel Walter A.:<br />
Walter A., 57 Jahre alt, war kaufmännischer Leiter<br />
eines mittelständischen Betriebs. Er hatte ein sehr<br />
gutes Einkommen, so dass <strong>der</strong> Familie ein gehobe-<br />
ner Lebensstandard möglich war.<br />
Seine Frau hatte während <strong>der</strong> Ehe nie einen Beruf<br />
ausgeübt; die Kin<strong>der</strong> waren mittlerweile aus dem<br />
Haus. Monatliche Zahlungsverpflichtungen bestan-<br />
den für eine 1996 erworbene Immobilie in den neu-<br />
en B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong>n, einer so genannten Schrottim-<br />
mobilie, die nicht zu vermieten war. Familie A. hatte<br />
das Objekt aus Steuerspargründen erworben.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> schwieriger Auftragslage wurden in <strong>der</strong><br />
Firma personelle Einsparmaßnahmen erfor<strong>der</strong>lich<br />
<strong>und</strong> Herr A. „wegrationalisiert“; er erhielt eine Ab-<br />
findung in Höhe von 25.000,00 Euro <strong>und</strong> bezog seit<br />
1. November 2000 zunächst Arbeitslosengeld. Herr<br />
A. hoffte, die Zeit bis zur Rente durch Selbständig-<br />
keit überbrücken zu können. Ab 1. Februar 2001 er-<br />
Axel Hannemann<br />
Geschäftsführer<br />
Caritaszentren Region Nord<br />
27
28<br />
Walter A., 57 Jahre alt<br />
hielt er für seine selbständige Tätigkeit (Franchise-<br />
nehmer) von <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit eine<br />
sechsmonatige Überbrückungshilfe. Die Abfindung<br />
in Höhe von 25.000,00 Euro wurde als Gr<strong>und</strong>lage<br />
für Investitionen beim Franchisegeber eingebracht.<br />
Bedauerlicherweise konnte Walter A. durch seine<br />
Selbständigkeit keine Existenzgr<strong>und</strong>lage schaffen.<br />
Das Ganze erwies sich als Flop. Seine Restforde-<br />
rung in Höhe von 14.000,00 Euro gegen den Fran-<br />
chisegeber ist uneinbringbar. Seine eigenen mo-<br />
natlichen Kreditraten zahlte er von seinen Erspar-<br />
nissen. Er musste sich erneut arbeitslos melden,<br />
erhielt Arbeitslosengeld <strong>und</strong> bis Ende 2004 schließ-<br />
lich Arbeitslosenhilfe in Höhe von 1.500,00 Euro.<br />
Seit 1. Januar 2005 bezieht Walter A. Leistungen<br />
nach Alg II. Für sich <strong>und</strong> seine Frau hat er einen An-<br />
spruch von 622,00 Euro für Lebenshaltungskosten<br />
einschließlich Strom, Telefon etc. Hinzu kommen<br />
die Kosten für die Unterkunft (inkl. Heizung <strong>und</strong><br />
Nebenkosten) in angemessener Höhe für Wohn-<br />
raum bis maximal 65 qm. (in Dachau max. 564,85<br />
Euro <strong>und</strong> Nebenkosten!) Herr <strong>und</strong> Frau A. hatten<br />
Glück <strong>und</strong> fanden eine günstigere Wohnung. Das<br />
Schuldenproblem für die Schrottimmobilie kann<br />
nur über den Weg eines Verbraucherinsolvenzver-<br />
fahrens gelöst werden.<br />
Beispiel Familie S.:<br />
So wie Familie S. leben viele Familien: Reihenhaus,<br />
Garten, Garage <strong>und</strong> Balkon. Spielzeug vom zehn-<br />
jährigen Christian im Wohnzimmer <strong>und</strong> im Garten.<br />
Urlaubsfotos im Gang <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Küche. Das, was<br />
jahrelang ihr Zuhause war, müssen sie nun aufge-<br />
ben. Klaus <strong>und</strong> Beate S., 48 <strong>und</strong> 44 Jahre alt, beide<br />
Architekten, können ihre Miete nicht mehr zahlen.<br />
Alle Rücklagen - Sparbücher, Lebensversicherun-<br />
gen - sind aufgebraucht, dafür haben sie Schulden<br />
in Höhe von 300.000 Euro.<br />
Und so ist es dazu gekommen: Klaus S. arbeitete<br />
viele Jahre in einer Baufirma, seine Frau in einem<br />
Architektenbüro. Er verdiente damals 12.000 DM<br />
im Monat, seine Frau nicht viel weniger. Um für ihr<br />
Alter vorzusorgen, kauften sie sich zwei Wohnun-<br />
gen in den neuen B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong>n <strong>und</strong> nahmen da-<br />
zu einen Kredit auf in <strong>der</strong> Annahme, dass dies bei<br />
den beiden guten Einkommen <strong>und</strong> den Mietein-<br />
nahmen kein Problem sei <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kredit bald zu-<br />
rückgezahlt sein würde.<br />
Doch es kam an<strong>der</strong>s, denn Herr S. verlor seine Ar-<br />
beit <strong>und</strong> musste bald feststellen, dass er keine<br />
neue Stelle mehr finden würde. Während er früher<br />
von an<strong>der</strong>en Firmen abgeworben wurde <strong>und</strong> immer<br />
höhere Gehälter verlangen konnte, war er jetzt „zu<br />
alt“. Also machte er sich als Architekt selbständig.<br />
Die Auftragslage war jedoch mäßig, <strong>und</strong> zur glei-<br />
chen Zeit kam es zu Problemen mit den Mietwoh-<br />
nungen: Es wurde immer schwerer, Mieter zu fin-<br />
den, die Miete musste gesenkt werden.<br />
Klaus S., Architekt, 48 Jahre alt<br />
Für das Ehepaar bedeutete das zusätzliche 500<br />
Euro monatlich für die Abzahlung <strong>der</strong> Kredite. Die<br />
Schulden stiegen an. Aber Frau S. hatte noch ihren<br />
Job, <strong>und</strong> beide hofften auf eine Besserung <strong>der</strong> Auf-<br />
tragslage sowie des Mietmarktes im Osten. Doch<br />
<strong>der</strong> nächste Schlag kommt, als im Frühjahr 2004<br />
auch Beate S. betriebsbedingt entlassen wird. In-
zwischen sind kaum mehr Einnahmen da, dafür jede<br />
Menge Ausgaben in Form von Miete, Kreditzinsen<br />
etc. - die Familie steht vor dem finanziellen Ruin.<br />
Beispiel Helmut B.:<br />
Helmut B., 47 Jahre alt, war angestellter Geschäfts-<br />
führer einer GmbH in <strong>der</strong> Herstellung von Softwa-<br />
re. Für die GmbH musste er am 1. Oktober 2002<br />
wegen drohen<strong>der</strong> Zahlungsunfähigkeit Insolvenz<br />
anmelden; er selber wurde arbeitslos. Dabei hatte<br />
er noch Glück im Unglück, weil er nicht persönlich<br />
haften musste, z.B. für private Kreditverpflichtun-<br />
gen für die GmbH. Berechtigte Schadensersatzan-<br />
sprüche von Gläubigerseite gab es ebenfalls nicht.<br />
Helmut B., ehemaliger Geschäftsführer, 47 Jahre alt<br />
Als Geschäftsführer hatte Herr B. ein sehr gutes Ge-<br />
halt bezogen <strong>und</strong> demzufolge einen hohen Lebens-<br />
standard. Er bewohnte eine Dachterrassenwoh-<br />
nung, die er vor 10 Jahren gekauft <strong>und</strong> größtenteils<br />
über einen hohen Kredit finanziert hatte. Er fuhr ein<br />
Auto <strong>der</strong> Luxusklasse; verreiste häufig mit seiner<br />
Fre<strong>und</strong>in. Es ging ihm gut! Für seine Eigentums-<br />
wohnung hatte er eine monatliche Rate in Höhe von<br />
1.500 Euro an die Bank zu zahlen. Außerdem war<br />
er seinen Söhnen aus erster Ehe gegenüber unter-<br />
haltspflichtig, da beide noch studierten.<br />
Von Oktober 2002 bis Dezember 2004 bezog er<br />
Arbeitslosengeld I. Seit 1. Januar 2005 steht ihm<br />
lediglich die Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitslose nach<br />
Hartz IV in Höhe von 345 Euro zu. Herr B. hat bis<br />
jetzt ergebnislos versucht, eine neue Beschäfti-<br />
gung zu finden. Ablehnungsgründe: sein Alter<br />
<strong>und</strong> Überqualifizierung.<br />
Mit Zustimmung <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esagentur hat er ver-<br />
sucht, während des Bezugs von Arbeitslosengeld I<br />
eine Selbständigkeit aufzubauen. Die Einnahmen<br />
aus den Aufträgen decken aber gerade seine Un-<br />
kosten. Auf das Arbeitslosengeld anrechnungsfä-<br />
hige Einkünfte (nach Steuern) hat er bisher nicht<br />
erzielt.<br />
Herr B. hatte in den ersten 18 Monaten seiner Ar-<br />
beitslosigkeit eine monatliche Einnahmeneinbuße<br />
von r<strong>und</strong> 40 Prozent zu verkraften. Schon unter<br />
dieser Situation war es ihm nicht mehr möglich ge-<br />
wesen, den gewohnten Lebensstandard zu halten.<br />
Seine Kreditverpflichtung für die Eigentumswoh-<br />
nung konnte er zunächst noch aus seinen Rückla-<br />
gen bestreiten. Nachdem es immer aussichtsloser<br />
wurde, in Kürze einen Job zu finden, veräußerte er<br />
schließlich (mit Verlust) das Objekt im freihändigen<br />
Verkauf. Es besteht noch eine Restfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Bank in Höhe von 50.000,00 Euro.<br />
Herr B. ist mittlerweile in eine 50qm große Woh-<br />
nung umgezogen; die Kosten übernimmt die Kom-<br />
mune über Alg II. Der gute Lebensstandard musste<br />
einer bescheidenen Lebensführung weichen. Die<br />
Ersparnisse einschließlich seiner privaten Renten-<br />
versicherung wurden zur Tilgung <strong>der</strong> Darlehens-<br />
for<strong>der</strong>ung eingebracht. Die psychische Belastung,<br />
die seine anhaltende Arbeitslosigkeit mit sich<br />
bringt, ist groß. Ehemalige Fre<strong>und</strong>e gehen auf Dis-<br />
tanz. Geld für Kultur <strong>und</strong> Geselligkeit fehlen. Für ihr<br />
Studium <strong>und</strong> die Lebenshaltungskosten müssen<br />
die Söhne selbst sorgen bzw. sonstige Transfer-<br />
leistungen sicherstellen.<br />
Die Bank drängt auf Zahlung des Restkredits <strong>und</strong><br />
hat ihm mit <strong>der</strong> Kündigung des Girokontos ge-<br />
droht ....<br />
29
Susanne Liebmann<br />
Leiterin <strong>der</strong> Caritas-Kontaktstelle<br />
<strong>und</strong> Tagesstätte für<br />
Menschen mit Behin<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>München</strong>-Neuperlach<br />
Michael Geiben<br />
Referent Geschäftsführung<br />
Behin<strong>der</strong>teneinrichtungen<br />
30<br />
Susanne Liebmann / Michael Geiben<br />
„Ich lass mich doch nicht unterkriegen,<br />
ich will arbeiten!“<br />
Arbeitssuche auf vier Rä<strong>der</strong>n: Menschen mit Behin<strong>der</strong>ungen<br />
auf dem langen Marsch durch die Institutionen<br />
Wie muss sich ein Mensch mit Behin<strong>der</strong>ungen fühlen, <strong>der</strong> mit hohem Einsatz <strong>und</strong> Engagement trotz zahl-<br />
reicher Widrigkeiten <strong>und</strong> Hürden endlich Schule <strong>und</strong> Berufsausbildung absolviert hat <strong>und</strong> nun feststellt,<br />
dass er kaum eine Chance auf eine berufliche Perspektive hat <strong>und</strong>, damit verb<strong>und</strong>en, auf eine Verbesse-<br />
rung seiner sozialen <strong>und</strong> finanziellen Situation? Der arbeiten <strong>und</strong> einen persönlichen Lebensentwurf <strong>und</strong><br />
damit einen Sinn entwickeln will; <strong>der</strong> auch im Lebensbereich „Arbeit“ sein Bedürfnis nach „normalen“ zwi-<br />
schenmenschlichen Beziehungen, Anerkennung <strong>und</strong> sozialer Bedeutung realisieren will.<br />
Angesichts steigen<strong>der</strong> Arbeitslosenzahlen ist Er-<br />
werbsarbeit mittlerweile zu einem kostbaren, da<br />
längst nicht mehr selbstverständlichen Gut ge-<br />
worden. An<strong>der</strong>erseits werden „Normalität“ <strong>und</strong><br />
„Status“ in unserer Gesellschaft in hohem Maß<br />
durch beruflichen Erfolg, Arbeitsleistung <strong>und</strong> vor<br />
allem durch intellektuelle Fähigkeiten bestimmt.<br />
Unter dieser Prämisse sind Menschen mit körper-<br />
licher, geistiger o<strong>der</strong> Mehrfachbehin<strong>der</strong>ung be-<br />
son<strong>der</strong>s benachteiligt, denn sie werden damit au-<br />
tomatisch <strong>und</strong> - analog <strong>der</strong> Systematik <strong>der</strong> Hilfen -<br />
„systematisch“ ausgegrenzt. Daran än<strong>der</strong>t auch<br />
die Tatsache nichts, dass für diese „beson<strong>der</strong>en“<br />
Menschen fürsorgliche Strukturen als „Ersatz“<br />
(für das „normale“ Leben?) bereit gestellt wer-<br />
den: das An<strong>der</strong>s-Sein, die Ausgrenzung wird da-<br />
durch oft nur um so deutlicher.<br />
Karin P.*: 26 Jahre alt <strong>und</strong> Rollstuhlfahrerin,<br />
beschreibt ihre Erfahrungen:<br />
“Schule überstanden <strong>und</strong> die Noten okay. Jetzt<br />
gehe ich also auf Arbeitssuche. Als gut infor-<br />
mierte Schülerin weiß ich, dass ich als Mensch<br />
mit Behin<strong>der</strong>ung auf vier Rä<strong>der</strong>n laut Gesetz<br />
Anspruch auf vielfältige Unterstützung habe.<br />
Klingt doch alles super, o<strong>der</strong>? Nach dem ich<br />
nun über alles, was meine Arbeitssuche be-<br />
trifft, informiert bin, ziehe ich los. Der Marsch<br />
durch die Institutionen beginnt.<br />
Eine <strong>der</strong> ersten Stationen auf meinem Weg ist<br />
wie bei allen Arbeitssuchenden das Arbeits-<br />
amt. Ich arbeite mich mühsam durch die ver-<br />
schiedenen Abteilungen. Vom Arbeitsvermitt-<br />
ler, <strong>der</strong> sich nicht zuständig fühlt, zum Reha-<br />
Berater, den ich mit dem Hinweis auf den Inte-<br />
grationsfachdienst wie<strong>der</strong> verließ. Viele Ge-<br />
spräche, viele anstrengende Wege <strong>und</strong> kein<br />
Ergebnis auch nur in Sicht. Meine Stimmung ist<br />
ein wenig gedrückt. Aber ich lass mich doch<br />
nicht unterkriegen: ich will arbeiten!“<br />
Oft werden nur die Defizite in den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong><br />
gerückt<br />
Es sind jedoch nicht nur die vielfach unüberschau-<br />
baren <strong>und</strong> oft überfor<strong>der</strong>ten Strukturen <strong>der</strong> öf-<br />
fentlichen Hilfesysteme, die Menschen mit Behin-<br />
<strong>der</strong>ungen so zu schaffen machen. Es sind zudem<br />
Ängste <strong>und</strong> häufig lei<strong>der</strong> auch Vorurteile potenti-<br />
eller Arbeitgeber <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Mitarbeiter, mit de-<br />
nen die Bewerberinnen <strong>und</strong> Bewerber mit Behin-<br />
<strong>der</strong>ungen konfrontiert werden <strong>und</strong> sich auseinan-<br />
<strong>der</strong>setzen müssen - wenn sie dazu überhaupt eine<br />
Chance haben.<br />
Dagegen scheinen die Ausgleichsabgaben, die<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeber entrichten muss, kalkulierbarer.<br />
Leicht werden scheinbar erkannte (o<strong>der</strong> vermute-<br />
te) Defizite <strong>der</strong> Bewerber/innen in den Vor<strong>der</strong>-<br />
gr<strong>und</strong> gerückt. Es sind ja tatsächlich zuerst die
Unterschiede, <strong>und</strong> nicht die Ressourcen, die au-<br />
genfällig sind: die Bewerberin kann nicht gehen,<br />
sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Das kann<br />
unbewusst auch Vermutungen, Spekulationen<br />
<strong>und</strong> Zuschreibungen auslösen, die viel weitrei-<br />
chen<strong>der</strong> sind. Gängige Beispiele: die Bewerberin<br />
ist bestimmt auch psychisch nicht so belastbar,<br />
viel mehr krank als an<strong>der</strong>e, hat womöglich auch<br />
viele private Probleme, da kommt auf mich als Ar-<br />
beitgeber sicher einiges zu.<br />
Aus unserer Erfahrung können solche Vorurteile<br />
deutlich verneint werden. Zum einen stehen den<br />
Arbeitgebern vielfältige Unterstützungs- <strong>und</strong> Be-<br />
ratungsmöglichkeiten offen. Zum an<strong>der</strong>en sind<br />
sich BewerberInnen mit Behin<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Be-<br />
deutung ihres Arbeitsplatzes für ihr Leben be-<br />
wusst <strong>und</strong> daher hochmotiviert, alles zu tun, um<br />
sich zu bewähren <strong>und</strong> Vorurteilen „by doing“ zu<br />
begegnen. Mit dieser Sichtweise <strong>der</strong> Dinge sind<br />
jedoch die Wenigsten vertraut, denn oft fehlt es<br />
einfach an <strong>der</strong> Erfahrung mit MitarbeiterInnen mit<br />
Behin<strong>der</strong>ung.<br />
Karin P.*: „Als „fitte“ Behin<strong>der</strong>te habe ich na-<br />
türlich schon lange Bewerbungen abgeschickt.<br />
Außerdem telefoniere ich geeignete Stellenan-<br />
gebote in den Zeitungen durch. Immer wie<strong>der</strong><br />
mache ich dabei die Erfahrung, dass, sobald<br />
ich meine Behin<strong>der</strong>ung erwähne, <strong>der</strong> Job „lei-<br />
<strong>der</strong>“ schon vergeben ist. Auch in meinem Brief-<br />
kasten liegen viele Absagen; zu Vorstellungs-<br />
gesprächen kommt es selten. Erhalte ich tat-<br />
sächlich einmal eine Einladung, habe ich oft<br />
schon beim Betreten des Raumes das Gefühl,<br />
dass mir Vorbehalte entgegen schlagen <strong>und</strong><br />
mein Gegenüber letzten Endes das „Risiko“<br />
nicht eingehen möchte, das ein behin<strong>der</strong>ter<br />
Mitarbeiter eventuell mit sich bringt. Mit dem<br />
Satz „... wir kommen auf Sie zu ...“, auf den<br />
noch nie ein Anruf folgte, werde ich dann meist<br />
verabschiedet.“<br />
Die Caritas engagiert sich aus ihrer im Leitbild ver-<br />
ankerten anwaltschaftlichen Sorge auch in die-<br />
sem Bereich trotz schwieriger finanzieller Rah-<br />
menbedingungen. In den Einrichtungen <strong>der</strong> Kon-<br />
taktstelle <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tagesstätte für Menschen mit<br />
Behin<strong>der</strong>ungen in <strong>München</strong>-Neuperlach können<br />
sich Betroffene Beratung, Rat <strong>und</strong> Informationen<br />
holen. Das gilt auch für Angehörige <strong>und</strong> Arbeitgeber.<br />
„Ich hoffe immer noch, den für mich passenden<br />
<strong>und</strong> mutigen Arbeitgeber zu finden“<br />
Susanne Liebmann, die beide Einrichtungen lei-<br />
tet, ist selbst Rollstuhlfahrerin <strong>und</strong> kennt die Pro-<br />
blematik sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus<br />
Arbeitnehmersicht. Aus <strong>der</strong> Erkenntnis heraus,<br />
dass die größte Hürde im Zugang zu Erwerbsar-<br />
beit u.U. in den Köpfen <strong>der</strong> Menschen zu suchen<br />
ist, betont sie: „Normalität für Menschen mit Be-<br />
hin<strong>der</strong>ungen bedeutet nicht eine oberflächliche<br />
Verdrängung o<strong>der</strong> rhetorische Vermeidung <strong>der</strong><br />
Unterschiede von Menschen mit <strong>und</strong> ohne Behin-<br />
<strong>der</strong>ungen, denn es gibt sie ja tatsächlich. Norma-<br />
lität bedeutet aber auch nicht Ausgrenzung <strong>und</strong><br />
Isolation aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> wahrgenommenen o<strong>der</strong><br />
vermuteten Unterschiede, auch wenn sie zu-<br />
nächst fürsorglich gemeint ist. Normalität ist ganz<br />
einfach <strong>und</strong> konkret Lebensqualität, was die Ent-<br />
wicklung eines individuellen Lebensstils <strong>und</strong> die<br />
Möglichkeit zur Teilhabe an dem beinhaltet, was<br />
in einer Gesellschaft als normal betrachtet wird.<br />
Und dazu gehört die Erwerbsarbeit. Auf diesem<br />
Weg sowohl die Betroffenen zu unterstützen <strong>und</strong><br />
zu begleiten als auch auf die Verantwortung hin-<br />
zuweisen, <strong>der</strong> die Gesellschaft sich stellen muss,<br />
ist unsere tägliche Aufgabe.“<br />
Lassen wir zum Schluss noch einmal Karin P.*<br />
zu Wort kommen:<br />
„Ich sah kein Land mehr <strong>und</strong> wusste nicht, ob<br />
ich noch die Kraft habe, um mich weiterhin mit<br />
Behörden <strong>und</strong> Arbeitgebern herumzuschlagen.<br />
In meiner Enttäuschung wandte ich mich an die<br />
Caritas-Kontaktstelle, dort habe ich Leute ge-<br />
f<strong>und</strong>en, die mir beim Durchstehen dieser für<br />
mich schwierigen Zeit helfen. So kann ich mei-<br />
nen Frust loswerden <strong>und</strong> immer wie<strong>der</strong> einen<br />
neuen Anlauf nehmen. Ich hoffe immer noch,<br />
den für mich passenden <strong>und</strong> mutigen Arbeitge-<br />
ber zu finden.“<br />
* Name durch die Red. geän<strong>der</strong>t<br />
31
Angelika Schmidbauer<br />
Geschäftsführerin IN VIA<br />
Katholische Mädchensozialarbeit<br />
e.V.<br />
32<br />
Angelika Schmidbauer<br />
Armut ist erblich<br />
Teilhabechancen <strong>und</strong> Zukunftsperspektiven von Jugendlichen werden mehr<br />
denn je vom sozialen <strong>und</strong> Bildungsstatus <strong>der</strong> Herkunftsfamile bestimmt<br />
Je<strong>der</strong> nicht schulpflichtige Jugendliche zwischen 15 <strong>und</strong> 25 Jahren soll seit Januar 2005 eine Vermittlung in<br />
eine Arbeit, Ausbildung o<strong>der</strong> eine „Arbeitsgelegenheit“ erhalten. Damit beinhaltet Hartz IV zwar das Ver-<br />
sprechen auf Vermittlung, ein rechtlich einklagbarer Anspruch ist jedoch nicht gegeben. Ebenso wenig ist<br />
garantiert, dass genügend betriebliche Ausbildungsplätze vorhanden sind, um allen Jugendlichen eine<br />
geeignete Ausbildung zu ermöglichen. Es ist daher zu befürchten, dass sich vor allem gering qualifizierte<br />
Jugendliche ohne Schulabschluss <strong>und</strong> ohne Aussicht auf Ausbildung allzu schnell mit <strong>der</strong> Vermittlung in<br />
Hilfsarbeiten o<strong>der</strong> Arbeitsgelegenheiten, den sogenannten Ein-Euro Jobs, abfinden müssen.<br />
Da nach neuen gesetzlichen Regelungen erwerbs-<br />
fähigen Personen jede Arbeit zumutbar ist, sind<br />
Wi<strong>der</strong>sprüche kaum möglich. Die unter dem Motto<br />
„För<strong>der</strong>n <strong>und</strong> For<strong>der</strong>n“ vorgesehenen Sanktionen<br />
bei Maßnahmeabbruch o<strong>der</strong> Nichteinhalten von<br />
Absprachen, sind bei Jugendlichen deutlich schär-<br />
fer angelegt, als bei allen an<strong>der</strong>en Langzeitarbeits-<br />
losen. So erfolgt <strong>der</strong> sofortige Wegfall des ALG II<br />
für die Dauer von drei Monaten; nur Kosten für Un-<br />
terkunft <strong>und</strong> Heizung werden dann noch direkt an<br />
den Vermieter überwiesen. Für den weiteren not-<br />
wendigen Lebensunterhalt (Nahrung, Kleidung,<br />
Körperpflege) sind Sachleistungen auf Gutschein-<br />
basis vorgesehen.<br />
Die Einglie<strong>der</strong>ung von Jugendlichen in die<br />
Arbeitswelt wird durch Hartz IV deutlich<br />
schwieriger<br />
Damit wird den betroffenen Jugendlichen die Mög-<br />
lichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben<br />
entzogen, ihre Erfahrungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmög-<br />
lichkeiten werden weiter eingeschränkt, Verwirkli-<br />
chungschancen erheblich behin<strong>der</strong>t. Das steht in<br />
deutlichem Wi<strong>der</strong>spruch zu <strong>der</strong> Tatsache, dass ge-<br />
rade das Jugendalter <strong>der</strong> Lebensabschnitt ist, <strong>der</strong><br />
mehr als je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Orientierungsfel<strong>der</strong> <strong>und</strong> Er-<br />
probungsmöglichkeiten benötigt.<br />
In <strong>der</strong> Vergangenheit wurden arbeitsweltbezogene<br />
Angebote schwerpunktmäßig im Rahmen <strong>der</strong> Ju-<br />
gendsozialarbeit erbracht. Die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> be-<br />
ruflichen Ausbildung sowie <strong>der</strong> Einglie<strong>der</strong>ung in<br />
die Arbeitswelt erfolgte bisher durch sozialpäda-<br />
gogische Beratung <strong>und</strong> Einzelunterstützung <strong>der</strong><br />
Jugendlichen, <strong>der</strong>en Arbeitsplatzchancen beson-<br />
<strong>der</strong>s beeinträchtigt waren. Diese Aufgabe soll nach<br />
<strong>der</strong> Hartz IV Reform künftig von den persönlichen<br />
Ansprechpartnern <strong>der</strong> Arbeitsagenturen übernom-<br />
men werden.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> gesetzlichen Neuregelung wird es<br />
darauf ankommen, ob es gelingt, dass alle Jugend-<br />
lichen ohne Berufsabschluss vorrangig in eine Aus-<br />
bildung vermittelt werden, die ihren Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Neigungen entspricht. Als Jugendhilfeträger<br />
stehen wir hier in beson<strong>der</strong>er Verantwortung <strong>und</strong><br />
sind auf Gr<strong>und</strong> unseres anwaltlichen Auftrags ver-<br />
pflichtet, auf <strong>und</strong> an <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Jugendlichen zu<br />
stehen.<br />
Als Fachverband des <strong>Caritasverband</strong>s - IN<br />
VIA Katholische Mädchensozialarbeit - sind<br />
wir in <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> <strong>München</strong> <strong>und</strong> <strong>Freising</strong><br />
mit vier sozialen Schwerpunkten tätig, in<br />
denen wir „Armutskarrieren“ von Kin<strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen fachliche <strong>und</strong> menschli-<br />
che Hilfe entgegensetzen <strong>und</strong> die Verwirk-<br />
lichungschancen <strong>der</strong> jungen Menschen<br />
steigern wollen:<br />
� Jugendwohnen<br />
� Internationale Mädchenarbeit<br />
� Migration<br />
� Krisendienst am Bahnhof
IN VIA stellt in <strong>München</strong> mehr als 200<br />
Wohnplätze für Mädchen <strong>und</strong> junge Frauen<br />
zur Verfügung. Diese Jugendwohnheime<br />
bieten den Jugendlichen die Möglichkeit,<br />
während ihrer Schul- <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Berufsaus-<br />
bildung in Gemeinschaft <strong>und</strong> mit geeigne-<br />
ter pädagogischer Begleitung zu wohnen.<br />
Darüber hinaus ermöglicht Jugendwohnen,<br />
dass insbeson<strong>der</strong>e min<strong>der</strong>jährige Jugend-<br />
liche, die in ihrem Herkunftsort keine Aus-<br />
bildungsstelle finden, Ausbildungschan-<br />
cen flexibler wahrnehmen können, indem<br />
sie finanzierbare <strong>und</strong> jugendgerechte Un-<br />
terbringungsformen vorfinden.<br />
Armut hat längst auch Jugendliche<br />
erreicht, die motiviert <strong>und</strong> ausbildungswillig<br />
sind<br />
Im Rahmen dieser Aufgabenstellung <strong>der</strong> ausbil-<br />
dungsbegleitenden Hilfe erleben wir unterschied-<br />
liche Erscheinungsformen von Jugendarmut in <strong>der</strong><br />
Ausbildungsphase, wobei es sich bei diesen Ju-<br />
gendlichen eben genau nicht um diejenigen han-<br />
delt, denen man allzu oft <strong>und</strong> allzu leichtfertig ein<br />
Eigenverschulden zuschreibt, ohne ihre tatsächli-<br />
che Lebenssituation genauer beleuchtet zu haben.<br />
Es handelt sich um junge Frauen, die es bereits<br />
geschafft haben, ein bedeutendes Maß an gesell-<br />
schaftlicher Teilhabe zu erreichen, in dem sie über<br />
einen Ausbildungsplatz verfügen o<strong>der</strong> Bildungs-<br />
angebote wahrnehmen können. Doch ist es längst<br />
nicht für jede junge Frau eine Selbstverständlich-<br />
keit, einen Wohnplatz am Ausbildungsort finan-<br />
zieren zu können.<br />
Noch am unkompliziertesten stellt sich die Situa-<br />
tion für Berufsschülerinnen dar, die einige Wochen<br />
im Jahr während ihrer Berufsschulwochen in Mün-<br />
chen Unterkunft in einem unserer Wohnheime fin-<br />
den. Die Finanzierung erfolgt für Auszubildende<br />
aus Bayern über das bayerische Schulfinanzie-<br />
rungsgesetz, das lediglich einen Eigenanteil von<br />
1,30 Euro/Tag an den Verpflegungskosten vorsieht.<br />
Häufiger entstehen Schwierigkeiten, eine Unter-<br />
bringungsmöglichkeit am Ausbildungsort <strong>München</strong><br />
zu finanzieren, bei jungen Frauen, die eine zwei-<br />
bis dreijährige Berufsausbildung absolvieren. Von<br />
ihrem „Lehrlingsgehalt“ müssen sie r<strong>und</strong> 400,-<br />
Euro für Unterkunft <strong>und</strong> Verpflegung investieren.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass Mädchen, obwohl<br />
sie mehrheitlich bessere Schulabschlüsse vorwei-<br />
sen können als Jungen, sich traditionell weiterhin<br />
für „klassische Frauenberufe“ mit relativ geringer<br />
Entlohnung entscheiden <strong>und</strong> dementsprechend<br />
auch über eine geringere Ausbildungsvergütung<br />
verfügen.<br />
Die Suche nach einem Ausbildungsplatz<br />
ist vor allem eine Frage finanzieller<br />
Möglichkeiten<br />
Das Ausbildungsför<strong>der</strong>ungsgesetz im Rahmen <strong>der</strong><br />
„Berufsausbildungsbeihilfe“ sieht zwar Zuschüsse<br />
für die Unterbringung vor, wenn die Ausbildungs-<br />
stelle zu weit vom Wohnort entfernt liegt, doch<br />
reichen diese Zuschüsse bei weitem nicht aus, um<br />
die tatsächlichen Kosten zu decken; bei geringfü-<br />
giger Überschreitung <strong>der</strong> ohnehin niedrig ange-<br />
setzten Einkommensgrenze entfallen Zuschüsse<br />
gänzlich.<br />
Es ist keine Seltenheit, dass junge Frauen aus fi-<br />
nanziellen Gründen um Auszahlung des Verpfle-<br />
gungsanteils an <strong>der</strong> Miete bitten. Sie können es<br />
sich schlichtweg nicht mehr leisten, täglich warm<br />
33
34<br />
zu essen. Die Mietschuldenfor<strong>der</strong>ungen in unse-<br />
ren Jugendwohnheimen nehmen seit 2004 konti-<br />
nuierlich zu.<br />
Die Beobachtung einer zunehmenden Ver-<br />
schuldung von Jugendlichen in Ausbildung<br />
deckt sich mit einer Befragung des Deut-<br />
schen Gewerkschaftsb<strong>und</strong>es im Frühjahr<br />
2003 zur Verschuldung unter Münchner<br />
Auszubildenden. Befragt wurden exempla-<br />
risch 1000 Auszubildende in <strong>München</strong>:<br />
� 34,6 % gaben an, Schulden zwischen<br />
25,- Euro <strong>und</strong> 1.300,- Euro zu haben.<br />
� 26,2 % <strong>der</strong> Betroffenen waren mit<br />
mehr als 1.000,- Euro verschuldet.<br />
2004 hat <strong>der</strong> Bayerische Freistaat seine Finanzie-<br />
rungsbeihilfen für Träger von Jugendwohnheimen<br />
ersatzlos gestrichen <strong>und</strong> damit Verwirklichungs-<br />
chancen von Jugendlichen reduziert. Damit ist die<br />
Suche nach einem Ausbildungsplatz zunehmend<br />
nicht nur eine Frage des Wollens, von Flexibilität<br />
<strong>und</strong> persönlicher Fähigkeit, son<strong>der</strong>n immer mehr<br />
eine Frage <strong>der</strong> finanziellen Möglichkeiten.<br />
Aus Motivation <strong>und</strong> Hoffnung werden<br />
Depression <strong>und</strong> Verzweiflung, insbeson<strong>der</strong>e<br />
bei Flüchtlingsjugendlichen<br />
Dreimal höher als bei deutschen Jugendlichen ist<br />
das Armutsrisiko bei Jugendlichen mit Migrations-<br />
hintergr<strong>und</strong>. Sie haben beim Erwerb von Bildung<br />
deutlich schlechtere Ausgangsmöglichkeiten. Be-<br />
son<strong>der</strong>s prekär ist die Situation bei min<strong>der</strong>jähri-<br />
gen Flüchtlingen, die unbegleitet z.B. aus Nigeria,<br />
Vietnam, Afghanistan o<strong>der</strong> Angola kommen. Ihre<br />
Zahl unter allen Flüchtlingen wird nicht geson<strong>der</strong>t<br />
erfasst, Wohlfahrtsverbände in Deutschland schät-<br />
zen aber, dass es sich um bis zu 10.000 junge<br />
Menschen handelt.<br />
Die Jugendlichen haben unter schwierigsten Be-<br />
dingungen Flucht o<strong>der</strong> Vertreibung aus ihrem Hei-<br />
matland überstanden. Sie erhoffen sich Sicherheit<br />
<strong>und</strong> eine Zukunftsperspektive in Deutschland, doch<br />
auf Gr<strong>und</strong> des unsicheren Aufenthaltsstatus bleibt<br />
vielen jungen Flüchtlingen <strong>der</strong> Zugang zu Sprach-<br />
för<strong>der</strong>kursen, zu Ausbildung <strong>und</strong> Arbeit verwehrt.<br />
Nach geltendem Asylverfahrensgesetz sind 16- <strong>und</strong><br />
17jährige voll handlungsfähig <strong>und</strong> werden daher<br />
wie Erwachsene behandelt, Jugendhilfe erhalten<br />
sie nicht mehr. Ohne Schutz <strong>und</strong> Begleitung wer-<br />
den sie in Unterkünften für Erwachsene unterge-<br />
bracht. Insbeson<strong>der</strong>e für junge Frauen birgt das<br />
erhöhte Risiken. Erfahrungen zeigen, dass unbe-<br />
gleitete Flüchtlingsmädchen häufig innerhalb we-<br />
niger Tage nach ihrer Ankunft in Asylbewerberun-<br />
terkünften sexuelle Ausbeutung erleben. So wird<br />
aus Motivation <strong>und</strong> Hoffnung Depression <strong>und</strong> Ver-<br />
zweiflung.<br />
Gemeinsam mit engagierten Fachkräften aus Ver-<br />
bänden <strong>und</strong> Kommune setzt sich IN VIA Katholi-<br />
sche Mädchensozialarbeit dafür ein, dass Flücht-<br />
lingsjugendliche eine alters- <strong>und</strong> situationsgerech-<br />
te Jugendhilfeversorgung erhalten.<br />
In unseren Jugendwohnheimen stellen wir Wohn-<br />
plätze für junge Flüchtlingsfrauen zur Verfügung,<br />
um eine Unterbringung in Asylbewerberunterkünf-<br />
ten zu vermeiden. Wir sehen die dringende Not-<br />
wendigkeit, Sprachför<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> einfache Quali-<br />
fizierungsangebote vorzuhalten, solange die Ju-<br />
gendlichen noch motiviert <strong>und</strong> erreichbar sind.<br />
Dabei ist es für uns unerheblich, ob die jungen<br />
Frauen eine Bleibeperspektive in Deutschland ha-<br />
ben. Für die Zeit, die sie in unserem Land verbrin-<br />
gen, stehen wir in <strong>der</strong> Verantwortung, eine Ver-<br />
schlimmerung ihrer Lebenssituation zu verhin<strong>der</strong>n.
Wes Kind ich bin, des Chance ich hab´ ?<br />
Armut ist gleichbedeutend mit einem Mangel an Verwirklichungschancen.<br />
� Kin<strong>der</strong> sind mit etwa einer Million die größte Gruppe unter Sozialhilfebeziehern.<br />
Das Risiko für Einkommensarmut liegt bei Kin<strong>der</strong>n bis zu 16 Jahren mit 15% um<br />
1,5% höher gegenüber dem Durchschnittsrisiko <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung (13,5%)<br />
� 1,36 Millionen <strong>der</strong> 20-jährigen waren Ende 2003 ohne Berufausbildung, 36% davon waren<br />
Migrantinnen <strong>und</strong> Migranten.<br />
� Die Chancen eines Kindes aus einem Elternhaus mit einem hohen sozialen Status eine Gymna-<br />
sialempfehlung zu bekommen, liegen r<strong>und</strong> 2,7 mal so hoch wie die eines Facharbeiterkindes.<br />
Für die Bildungschancen eines Kindes sind Bildungsstand <strong>der</strong> Eltern, Sprachkenntnisse <strong>und</strong><br />
Einkommen erhebliche Wirkungsfaktoren.<br />
� 21% <strong>der</strong> Obdachlosen sind Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche; in Zahlen sind das 72.000 junge Menschen<br />
in Deutschland. Etwa 7.000 davon leben über einen längeren Zeitraum auf <strong>der</strong> Straße.<br />
Geldsorgen sind in <strong>der</strong> Schwangerenberatung zunehmend Thema<br />
Fröhlich winkt <strong>der</strong> kleine Sami aus seinem Buggy, als seine Mutter die Schwingtür zur Beratungs-<br />
stelle aufstößt. Sie ist mit ihrem zweiten Kind schwanger, <strong>und</strong> es ist ihr anzusehen, dass sie nicht<br />
nur den Kin<strong>der</strong>wagen mit dem Zweijährigen, son<strong>der</strong>n auch einen Berg Sorgen vor sich herschiebt.<br />
Die finanziellen Probleme <strong>der</strong> Familie sind bei den Beratungsgesprächen zur Schwangerschaft nun<br />
stärker in den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> gerückt. Es gibt Zahlungsrückstände bei Strom- <strong>und</strong> Gasversorger, <strong>und</strong><br />
die junge Frau traut sich nicht mehr, Geld auszugeben für Eisen- <strong>und</strong> Calciumpäparate, die ihr <strong>der</strong><br />
Arzt verordnet hat <strong>und</strong> die von <strong>der</strong> Krankenkasse nicht mehr bezahlt werden.<br />
„Woher nehmen wir nur das Geld?“ Diese Frage steht für viele Klientinnen <strong>der</strong> Katholischen Bera-<br />
tungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Sozialdienst katholischer Frauen e.V. <strong>München</strong> zuneh-<br />
mend im Mittelpunkt ihres Alltags.<br />
Kleine finanzielle Spielräume durch die bedarfsorientierten Hilfen sind weggefallen, Bekleidungs-<br />
hilfe zum Beispiel o<strong>der</strong> eine Son<strong>der</strong>zahlung bei <strong>der</strong> Einschulung eines Kindes. Auch notwendige<br />
<strong>und</strong> sinnvolle Ausgaben wie Zahnbehandlungen o<strong>der</strong> die Anschaffung einer neuen Waschmaschine<br />
können nicht mehr im Familienbudget untergebracht werden.<br />
Nicht einmal auf eine bescheidene Lebensqualität können die Familien inzwischen oft noch achten:<br />
so harrt zum Beispiel eine Familie mit drei kleinen Kin<strong>der</strong>n in einer feuchten Wohnung aus. Lebens-<br />
mittelspenden entlasten den Geldbeutel <strong>und</strong> werden gern in Anspruch genommen. Der kleine Vor-<br />
rat an gespendeten Klei<strong>der</strong>n, Babynahrung <strong>und</strong> Windeln in <strong>der</strong> Beratungsstelle ist deutlich schnel-<br />
ler aufgebraucht als noch vor einem Jahr.<br />
Die Spuren von Armut <strong>und</strong> dauerhaften Geldsorgen zeigen sich durch eine starke psychische Be-<br />
lastung vieler Klientinnen, beson<strong>der</strong>s wenn Arbeitslosigkeit die Situation verschärft o<strong>der</strong> die Frauen<br />
die alleinige Verantwortung für die Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> den Lebensunterhalt tragen.<br />
Pia Klarner-Dirr, Leiterin <strong>der</strong> Schwangerenberatung SkF <strong>München</strong><br />
35
Hubertus Janas<br />
Leiter<br />
Hilfsprojekte im Ausland<br />
36<br />
Hubertus Janas<br />
Wohin mit all‘ dem Geld?<br />
Zur Problematik <strong>der</strong> gerechten Verteilung von Spendengel<strong>der</strong>n<br />
Die Welle <strong>der</strong> Tsunami-Katastrophe flutete auch hierzulande, nämlich als Spendenflut: es wurde gespendet<br />
wie noch nie. Allein <strong>der</strong> <strong>München</strong>er Caritas vertrauten die Menschen 330.000 Euro für die betroffenen Opfer<br />
an. In den katholischen Kirchen <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> wurden noch einmal 1,4 Millionen Euro gesammelt, b<strong>und</strong>es-<br />
weit wurden mehr als 500 Millionen gespendet, <strong>und</strong> die B<strong>und</strong>esregierung legte ihrerseits noch einmal 500<br />
Millionen dazu. Insgesamt gingen also mehr als 1,2 Mrd. Euro aus Deutschland an die Tsunami-Region um<br />
den Indischen Ozean herum.<br />
Soviel Geld will verwaltet <strong>und</strong> vernünftig ausgege-<br />
ben sein, wobei das Verwalten zunächst einmal ein<br />
eher technisches Problem ist. Schwieriger wird es<br />
da schon beim Ausgeben, <strong>und</strong> das nicht nur bei<br />
Tsunami-Spenden, son<strong>der</strong>n bei Spendengel<strong>der</strong>n<br />
überhaupt. Abgesehen von strengen gesetzlichen<br />
Auflagen - zweckgeb<strong>und</strong>ene Spenden dürfen aus-<br />
schließlich dem für sie angegebenen Zweck zuge-<br />
führt <strong>und</strong> müssen zeitnah verwendet werden; man<br />
darf das Geld also nicht günstig anlegen, um sich<br />
dann an den auflaufenden Zinsen zu erfreuen - wird<br />
immer nach Kriterien zu fragen sein, nach denen<br />
das Spendengeld vergeben wird.<br />
Ebenso müssen <strong>der</strong> Spendenzweck, die Ziele, Em-<br />
pfänger o<strong>der</strong> Projekte, denen die Spenden dann<br />
zufließen, vernünftig nachvollziehbar, sinnvoll <strong>und</strong><br />
möglichst langfristig erfolgreich wirksam sein.<br />
Wenn man dann noch mit <strong>der</strong> ganzen Sache an die<br />
Öffentlichkeit gehen kann, um sich dort möglichst<br />
gut zu präsentieren, freuen sich die Leute, die wie-<br />
<strong>der</strong> neue Spenden sammeln sollen. Das nennt man<br />
F<strong>und</strong>raising.<br />
Für ein Unternehmen wie die Caritas - man könnte<br />
sagen: die institutionalisierte Nächstenliebe <strong>der</strong><br />
katholischen Kirche - ist es nun nicht so beson-<br />
<strong>der</strong>s schwierig, ihre Zielgruppe <strong>und</strong> das Hauptkri-<br />
terium ihrer Hilfe auszumachen: es sind die Be-<br />
dürftigen <strong>und</strong> jede Form von Bedürftigkeit bzw.<br />
Leiden, Menschen in Not also o<strong>der</strong> biblisch ge-<br />
sprochen: die Armen, wobei, <strong>und</strong> das nebenbei,<br />
im Neuen Testament die Armen immer auch gera-<br />
de diejenigen sind, die sich nach dem Reich Got-<br />
tes sehnen.<br />
Überall, wo die katholische Kirche ist,<br />
ist auch die Caritas<br />
Bei uns in Deutschland, wohl auch in den an<strong>der</strong>en<br />
westlichen Industrienationen, ist genau definiert,<br />
wer arm <strong>und</strong> was Armut ist (s. Armutsbericht <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong>esregierung). Ebenso ist <strong>der</strong> Umgang mit Ar-<br />
mut wohl organisiert, geordnet <strong>und</strong> das Problem<br />
einigermaßen „abgefe<strong>der</strong>t“.<br />
Die meisten Dienste <strong>der</strong> Caritas für Bedürftige bzw.<br />
Menschen in Not sind refinanziert aus entspre-<br />
chenden Sozialkassen <strong>und</strong> -etats; ein Gutteil <strong>der</strong><br />
Kirchensteuergel<strong>der</strong> fließt dem sozialen Engage-<br />
ment <strong>der</strong> Kirchen zu, denn Wohlfahrtsverbände<br />
decken das gesamte Spektrum <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gesell-<br />
schaft vorkommenden Bedürftigkeit ab. Die obli-<br />
gatorischen Sozialversicherungen sorgen für Vor-<br />
sorge für den Bedarfsfall: Krankheit, Arbeitslosig-<br />
keit, Alter <strong>und</strong> Pflege - <strong>und</strong> dafür, dass die Netto-<br />
gehälter <strong>der</strong> Normalverdiener nicht in den Himmel<br />
wachsen.<br />
An<strong>der</strong>swo in <strong>der</strong> Welt sieht es da schon ganz an-<br />
<strong>der</strong>s aus: Wer z.B. mit Hilfsprojekten im Ausland<br />
zu tun hat, wird bei <strong>der</strong> oben gestellten Frage ganz<br />
schnell <strong>und</strong> ganz laut schreien: „Nur her mit <strong>der</strong><br />
Kohle! Und soviel wie möglich davon!“ Mit den ge-<br />
samten deutschen Tsunami-Spenden könnte man<br />
in Län<strong>der</strong>n wie Rumänien, Bulgarien o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Uk-<br />
raine einiges in Bewegung setzen: helfen, bauen,<br />
satt machen, kurieren... Da bräuchte man gar nicht<br />
weiter nach Afrika o<strong>der</strong> Asien zu schauen, um dort<br />
Not, Leiden <strong>und</strong> Elend zu suchen.
Und in allen diesen Län<strong>der</strong>n ist ja die Caritas vor<br />
Ort, weil die Caritas überall dort ist, wo die katho-<br />
lische Kirche ist. Noch <strong>der</strong> abgelegenste Missionar<br />
mit einer „soliden Sammlung von Tropenkrankhei-<br />
ten“, <strong>der</strong> einem Hungrigen etwas zu essen besorgt,<br />
einem Kranken Medizin gibt, einem alten Sün<strong>der</strong><br />
die Beichte abnimmt o<strong>der</strong> auch einer Frau bei ihrer<br />
Entbindung hilft, ist eine Außenstation, eine De-<br />
pendance <strong>der</strong> Caritas, weil die Caritas das zu tun<br />
versucht, was Jesus getan hat: den Armen helfen,<br />
die Kranken heilen, die Einsamen trösten, nah am<br />
Nächsten sein.<br />
* ohne Caritassammlungen (5.541.641,71 �)<br />
Jesus nachfolgen, indem man an den<br />
Menschen handelt, wie er es getan hat<br />
Damit wäre, in einem ersten Schritt, eine theologi-<br />
sche o<strong>der</strong> einfach biblische Begründung <strong>der</strong> Cari-<br />
tas gegeben: Jesus nachfolgen, ihn nachahmen,<br />
indem man an den Menschen handelt wie er es ge-<br />
tan hat. Das wie<strong>der</strong>um hat mehrere Konsequenzen:<br />
zum einen hat dieses Bemühen <strong>der</strong> Nachahmung<br />
Christi eine etwa 2000-jährige Tradition, <strong>und</strong> zwar<br />
eine immer schon international-globale, die es in<br />
Gestalt <strong>der</strong> Kirche zu ebensolchen international-<br />
globalen Strukturen gebracht hat. Zugespitzt könn-<br />
te man sogar sagen: überall, wo etwas passiert,<br />
ist immer schon Kirche da. (Siehe auch Tsunami!)<br />
Die Caritas als kirchliche Organisation kann also<br />
im Bedarfsfall auf bereits vorhandene Strukturen<br />
zurückgreifen, innerhalb <strong>der</strong>er sie dann, <strong>der</strong> Situ-<br />
ation angepasst, ihre je eigenen entwickelt. In die-<br />
ser Perspektive stellt sich die Frage „Wohin mit<br />
all‘ dem Geld?“ gar nicht mehr o<strong>der</strong> doch sehr an-<br />
<strong>der</strong>s: Geld, Güter, Werte, Hilfen können gar nicht<br />
genug vorhanden sein. Sie müssen aber richtig<br />
verteilt werden. Und das ist die Frage nach <strong>der</strong> Ge-<br />
rechtigkeit!<br />
Zum an<strong>der</strong>en ergibt sich aus <strong>der</strong> Orientierung an<br />
Jesus Christus auch ein bestimmtes Bild vom Men-<br />
schen, das we<strong>der</strong> in ökonomischen Bedingungen,<br />
gesellschaftlicher Eingeb<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Konditioniert-<br />
heit noch in letzter psychologischer Deutung auf-<br />
geht. Kern dieses an<strong>der</strong>en, alternativen, christli-<br />
chen Menschenbildes ist, dass <strong>der</strong> Mensch als vom<br />
absoluten Gott herkommend, von ihm gekannt, ge-<br />
wollt, ja geliebt vorgestellt wird – Christen nennen<br />
diesen absoluten Gott Vater. Daraus ergeben sich<br />
letzter Wert <strong>und</strong> erste Würde jedes einzelnen Men-<br />
schen. Und für diese Erkenntnis waren we<strong>der</strong> Auf-<br />
klärung noch Französische Revolution <strong>und</strong> schon<br />
gar nicht Karl Marx notwendig.<br />
Oft sind es gerade die vergessenen<br />
Regionen, in denen mit langem Atem<br />
geholfen werden muss<br />
Dieses Menschenbild verpflichtet natürlich: Man<br />
lässt den An<strong>der</strong>en, den Nächsten, den Mit-Men-<br />
schen, <strong>und</strong> zwar ausnahmslos, nicht verkommen,<br />
son<strong>der</strong>n hilft, wo es notwendig ist. Konkret heißt<br />
das: zuerst Abdeckung <strong>der</strong> Primärbedürfnisse wie<br />
Essen, Trinken, Kleidung, Wärme, Dach über dem<br />
Kopf, medizinische Versorgung. Wenn das in einem<br />
Katastrophenfall zu geschehen hat, werden Mas-<br />
sen von all‘ dem notwendig gebraucht, <strong>und</strong> das<br />
37
38<br />
wird immens teuer. Es müssen ja nicht nur die ent-<br />
sprechenden Materialien gekauft werden, son<strong>der</strong>n<br />
finanziert werden müssen auch Lagerung, Trans-<br />
port <strong>und</strong> Verteilung. Der letzte Posten in dieser<br />
Kalkulation wären auch Personalkosten, weil man<br />
im Ernstfall wirkliche Profis braucht.<br />
Die Katastrophe, die akute Krise, die mit ihren<br />
Grauen erregenden <strong>und</strong> Mitleid heischenden Bil-<br />
<strong>der</strong>n tagelang jede Nachrichtensendung be-<br />
herrscht, ist jedoch nicht das tägliche Brot des<br />
Helfens. Oft sind es gerade die vergessenen <strong>und</strong><br />
unbeachteten Regionen, in denen mit langem Atem<br />
geholfen werden muss: Wo die Arbeitslosigkeit<br />
zwischen 60 <strong>und</strong> 80 Prozent liegt, wo die Durch-<br />
schnittseinkommen 100 Euro kaum übersteigen<br />
<strong>und</strong> Rentnern nach Abzug von Miete <strong>und</strong> Strom 20<br />
Euro zum Leben bleiben, wo Staat <strong>und</strong> Sozialver-<br />
sicherungen kaum existieren <strong>und</strong> 60 Prozent <strong>der</strong><br />
Familien zerbrochen, auseinan<strong>der</strong>gerissen sind<br />
<strong>und</strong> die Kin<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Strasse nicht spielen, son-<br />
<strong>der</strong>n leben.<br />
Diese Dauerkrisen werden bei uns medial gerade-<br />
zu totgeschwiegen. Es bedurfte erst des Dafur-<br />
Konflikts, bis <strong>der</strong> Sudan bei uns wie<strong>der</strong> in die<br />
Schlagzeilen kam. Mehr als zwei Millionen Tote im<br />
Kongo kamen in unseren Medien gar nicht vor.<br />
Aber warum in die Ferne schweifen... Weißruss-<br />
land, Moldawien, Albanien sind in unserer Nähe,<br />
<strong>und</strong> auch da geht es den Leuten richtig schlecht.<br />
Direkt vor unserer Haustür, den Balkan ´rauf <strong>und</strong><br />
´runter, sieht`s nicht viel besser aus: in Kroatien,<br />
Bosnien, Rumänien, Bulgarien, <strong>der</strong> Ukraine <strong>und</strong><br />
zum Teil auch in Russland.<br />
Es geht um nachhaltiges, ausdauerndes<br />
<strong>und</strong> vertauensvolles Engagement<br />
Überall geht es darum, nicht nur punktuell <strong>und</strong> für<br />
den Augenblick zu helfen, son<strong>der</strong>n langfristig <strong>und</strong><br />
nachhaltig Strukturen des Helfens aufzubauen,<br />
die irgendwann in <strong>der</strong> Lage sind, sich selbst zu er-<br />
halten <strong>und</strong> angepasst an ihre jeweils konkrete Si-<br />
tuation, die immer unterschieden ist von unserer<br />
eigenen, auf die ihnen begegnenden Bedürfnisse<br />
angemessen zu reagieren. Die For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> In-<br />
kulturation, die zumindest seit dem Vaticanum II.<br />
für die Kirche als ganze erhoben wird, gilt ebenso<br />
für die Caritas: deutsche o<strong>der</strong> westliche Maßstäbe<br />
<strong>und</strong> Vorstellungen lassen sich in den seltensten<br />
Fällen übertragen; immer wird <strong>der</strong> Partner vor Ort<br />
entscheiden müssen, wie er - ggfs. auch mit unse-<br />
rem Geld - in seiner Situation am besten hilft.<br />
Es ist also we<strong>der</strong> in akuten Katastrophen noch in<br />
langfristiger Projektarbeit damit getan, schnell,<br />
spektakulär <strong>und</strong> in großem Umfang zu helfen,<br />
son<strong>der</strong>n es geht tatsächlich um nachhaltiges, aus-<br />
dauerndes <strong>und</strong> vertauensvolles Engagement mit<br />
<strong>und</strong> für die Partner in bestimmten Bedarfssituati-<br />
onen - weitestgehend abseits des Interesses <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Aufmerksamkeit <strong>der</strong> Medien. Für diese Art Ar-<br />
beit Bewusstsein zu schaffen <strong>und</strong> Mittel zu mobi-<br />
lisieren, sprich Spenden zu sammeln, ist ein müh-<br />
sames Geschäft. Weil aber <strong>der</strong> Bedarf riesig ist <strong>und</strong><br />
die Not unserer Mitmenschen geradezu bodenlos,<br />
können angesichts all dessen wirklich gar nicht<br />
genug Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden.
„Wert-volle“ Angebote<br />
Schulische Ausbildung <strong>und</strong> Weiterbildung orien-<br />
tieren sich am Leitbild des <strong>Caritasverband</strong>s, in dem<br />
es heißt: „Wir för<strong>der</strong>n die fachlichen, persönlichen<br />
<strong>und</strong> religiösen Entwicklungsmöglichkeiten unserer<br />
Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen gleichermaßen.“<br />
Die Bildungsarbeit des Instituts vermittelt nicht nur<br />
fachliches, methodisches <strong>und</strong> technisches „Know-<br />
how“ (das natürlich auch!), son<strong>der</strong>n hat den gan-<br />
zen Menschen im Blick, auch in seinen Fragen nach<br />
Sinn, Werten <strong>und</strong> Zielen seiner (künftigen) Arbeit.<br />
Fragen des Glaubens <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Wertorientierung thematisieren<br />
Es gibt Bildungsangebote bzw. Bestandteile von<br />
Angeboten, welche ausdrücklich Fragen <strong>der</strong> Wert-<br />
orientierung <strong>und</strong> des Glaubens thematisieren <strong>und</strong><br />
diese mit <strong>der</strong> beruflichen Praxis in <strong>der</strong> Caritas in<br />
Verbindung bringen:<br />
� In Einführungsseminaren für neue Mitarbeiter<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiterinnen ist das Kennenlernen<br />
<strong>und</strong> Aneignen des Leitbildes des Caritasver-<br />
bands ein wesentliches Element.<br />
Neue Mitarbeiter mit Personalverantwortung<br />
absolvieren darüber hinaus zwei zusätzliche<br />
Tage zu den ethisch-religiösen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong><br />
Caritas-Arbeit.<br />
� Der sogenannte „M-Bereich“ des Weiter-<br />
bildungsprogramms (Exerzitien, Besinnung,<br />
Orientierung) wird von <strong>der</strong> Mitarbeiterseel-<br />
sorge verantwortet, in Kooperation mit dem<br />
Dr. Thomas Steinforth<br />
Wert-, Sinn- <strong>und</strong> Glaubensfragen spielen in <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
des Diözesan-<strong>Caritasverband</strong>s eine beson<strong>der</strong>e Rolle<br />
Seit vielen Jahren leistet das Institut für Bildung <strong>und</strong> Entwicklung mit <strong>der</strong> Ausbildung in seinen beruflichen<br />
Schulen <strong>und</strong> mit seinem umfangreichen Weiterbildungsprogramm einen wichtigen Beitrag zur Professio-<br />
nalisierung <strong>der</strong> sozialen, erzieherischen <strong>und</strong> pflegerischen Arbeit <strong>und</strong> zur Weiterentwicklung des Caritas-<br />
verbands als einer „lernenden Organisation“. Die Bildungsarbeit des Instituts versteht sich nicht nur als<br />
Arbeit „für“ die Caritas, son<strong>der</strong>n auch als Arbeit „<strong>der</strong>“ Caritas: Der christliche Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Caritas, ihr Leitbild<br />
<strong>und</strong> ihre Werte sollen auch in <strong>der</strong> Bildungsarbeit zur Geltung kommen. Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung verstehen<br />
sich als „wert-volle“ Angebote: wie aber zeigt sich das?<br />
Institut organisiert <strong>und</strong> umfasst r<strong>und</strong> 35 sehr<br />
gut nachgefragte Angebote mit einem betont<br />
besinnlichen <strong>und</strong> seelsorglichen Charakter.<br />
Die Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen können<br />
ihre religiösen Fragen <strong>und</strong> spirituellen Erfah-<br />
rungen einbringen, sich mit Impulsen <strong>der</strong> Bibel<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> christlichen Tradition auseinan<strong>der</strong><br />
setzen <strong>und</strong> diese in Beziehung zu ihrem beruf-<br />
lichen Alltag setzen.<br />
� Sowohl in den Führungs- als auch in den Fach-<br />
seminaren <strong>und</strong> auch im Ausbildungsprogramm<br />
<strong>der</strong> Schulen finden sich Angebote o<strong>der</strong> Ange-<br />
botsbestandteile, welche die beson<strong>der</strong>en nor-<br />
mativen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Caritas-Arbeit zum<br />
Thema machen, in dem zum Beispiel das Span-<br />
nungsverhältnis zwischen christlichen Zielen<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlichen Notwendigkeiten thema-<br />
tisiert wird. Auch in den fachlichen Weiterbil-<br />
dungen zum Pflege- <strong>und</strong> Kita-Bereich gehören<br />
ausdrücklich Fragen des Menschenbildes <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Ethik zum Standard.<br />
� Die religionspädagogischen Angebote für<br />
Erzieher/innen (Bereich „N“ im Weiterbil-<br />
dungsprogramm) dienen ebenfalls ausdrück-<br />
lich <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> religiösen Entwicklung.<br />
Diese werden in Kooperation mit dem Schul-<br />
referat des Ordinariats angeboten.<br />
Zukünftig wird es sicherlich immer wichtiger wer-<br />
den, den beson<strong>der</strong>en Charakter <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>lagen<br />
caritativer Arbeit ohne falsche Scheu bewusst zu<br />
machen - auch <strong>und</strong> gerade in <strong>der</strong> Bildungsarbeit:<br />
Dr. Thomas Steinforth<br />
Geschäftsführer<br />
Caritas-Institut für<br />
Bildung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
39
40<br />
Viele kirchlich geprägte Führungskräfte, Mitarbei-<br />
ter <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen suchen nach Wegen, den<br />
christlichen Auftrag ihrer Arbeit auch angesichts<br />
wirtschaftlicher Sachzwänge erfüllen zu können.<br />
Und auch viele Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen<br />
ohne eine lebenslang geprägte <strong>und</strong> ungebrochene<br />
kirchliche Identität sind in <strong>der</strong> Regel sehr offen <strong>und</strong><br />
interessiert an einer einladenden Thematisierung<br />
von Wert- <strong>und</strong> Glaubensfragen. Aus- <strong>und</strong> Weiter-<br />
bildung dürfen zwar nicht <strong>der</strong> einzige Ort für solche<br />
Fragen sein - diese müssen ihren Platz auch <strong>und</strong> vor<br />
allem im ganz normalen Führungs- <strong>und</strong> Arbeitsall-<br />
tag finden. Bildungsarbeit aber kann ein guter Ort<br />
sein, persönliches <strong>und</strong> gemeinsames Nachdenken<br />
über das „Warum“ <strong>und</strong> „Wozu“ caritativer Arbeit<br />
anzustoßen <strong>und</strong> zu beleben.<br />
Neben <strong>der</strong> schulischen Ausbildung <strong>und</strong> den klas-<br />
sischen Weiterbildungsseminaren kommen auch<br />
an<strong>der</strong>e Veranstaltungsformen mit „Bildungscha-<br />
rakter“ in Frage, um einen ausdrücklichen Bezug<br />
zu den Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Caritas-Arbeit herzustellen.<br />
So steht beispielsweise auf <strong>der</strong> jährlichen Fachta-<br />
gung <strong>der</strong> Verwaltungsmitarbeiterinnen des Diöze-<br />
san-<strong>Caritasverband</strong>s 2005 die Frage im Mittel-<br />
punkt: „Ich arbeite bei <strong>der</strong> Caritas - was bedeutet<br />
das für mich?“.<br />
Anstoß zur Weiterentwicklung:<br />
„Führungsfeedback“<br />
2004 ist in einer Reihe von Geschäftsbereichen<br />
des DiCV unter wissenschaftlicher Begleitung<br />
ein systematisches „Führungsfeedback“ er-<br />
probt worden. Dieses soll nun angepasst <strong>und</strong><br />
ab 2005 als reguläres Instrument eingeführt<br />
werden.<br />
Auch Formen <strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong> Bildungsarbeit<br />
haben eindeutigen Glaubens- <strong>und</strong><br />
Kirchenbezug<br />
Kirchlicher Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Glaubensbezug <strong>der</strong><br />
Bildungsarbeit des Instituts zeigen sich nicht nur<br />
in einer ausdrücklichen Thematisierung ethischer<br />
<strong>und</strong> religiöser Fragen <strong>und</strong> Inhalte, son<strong>der</strong>n auch<br />
ganz generell in <strong>der</strong> Gestaltungsweise, den Formen<br />
<strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong> Bildungsarbeit.<br />
� Vor allem kommt es darauf an, die einzelnen<br />
Personen (Schüler/innen, Studierende, Wei-<br />
Dabei geben Mitarbeitende mittels eines anonymen <strong>und</strong> wissenschaftlich f<strong>und</strong>ierten Fragebogens<br />
ihrer Führungskraft eine Rückmeldung zu ihrem Führungshandeln. Durch diese Einschätzung <strong>der</strong><br />
„Geführten“ erhält die Führungskraft eine wichtige Ergänzung ihrer Selbstwahrnehmung. Die Aus-<br />
wertung erfolgt mittels eines gebündelten Ergebnisberichts, <strong>der</strong> um Handlungsempfehlungen zur<br />
Weiterentwicklung <strong>der</strong> Führungsrolle ergänzt wird. Wichtig: Wie sich im „Probedurchlauf“ gezeigt<br />
hat, ist das gemeinsame, offene <strong>und</strong> konstruktive Gespräch zwischen Führungskraft <strong>und</strong> Mitarbei-<br />
tenden über die Befragungsergebnisse ein beson<strong>der</strong>s wichtiger Schritt <strong>und</strong> eine effektive Maßnahme<br />
zur Verbesserung von Führung <strong>und</strong> Zusammenarbeit im Sinne <strong>der</strong> „Dienstgemeinschaft“. Und: Der<br />
Fragebogen wird noch überarbeitet <strong>und</strong> bezüglich <strong>der</strong> Auswertungskategorien ausdrücklich an die<br />
wesentlichen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> „Führungsleitlinien“ <strong>der</strong> Caritas angepasst.<br />
terbildungsteilnehmer/innen) als Individuen<br />
<strong>und</strong> nicht als bloße Empfänger vorgefertigter<br />
Bildungsinhalte zu sehen <strong>und</strong> sie in ihren Kom-<br />
petenzen, Erfahrungen, Einschätzungen <strong>und</strong><br />
Fragen zu würdigen <strong>und</strong> aktiv in den Bildungs-<br />
prozess einzubeziehen.<br />
� Ebenso entspricht es dem christlichen Men-<br />
schenbild, in den Bildungsprozessen ein<br />
gemeinsames <strong>und</strong> gemeinschaftliches Lernen<br />
anzuregen <strong>und</strong> zu ermöglichen, in dem sich<br />
die Einzelnen mit ihren jeweiligen Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> Sichtweisen wechselseitig bereichern.
Auch ein Weiterbildungsseminar ist ein Ort, an<br />
dem die „Dienstgemeinschaft Caritas“ erleb-<br />
bar wird.<br />
� Wichtig ist schließlich die achtsame Gestal-<br />
tung des „äußeren Rahmens“ <strong>und</strong> des „Hinter-<br />
gr<strong>und</strong>es“ <strong>der</strong> Bildungsarbeit, denn <strong>der</strong> Hinter-<br />
gr<strong>und</strong> ist für das, was sich davor abspielt,<br />
keinesfalls nebensächlich! Ein Beispiel dafür<br />
ist die Wahl kirchlicher Bildungshäuser <strong>und</strong><br />
Klöster als Ort für mehrtägige Seminare.<br />
Auch diese eher „implizite“ Werte-Orientierung <strong>der</strong><br />
Bildungsarbeit bedarf <strong>der</strong> ständigen Überprüfung<br />
<strong>und</strong> Weiterentwicklung - insbeson<strong>der</strong>e in Ausein-<br />
an<strong>der</strong>setzung mit den haupt- <strong>und</strong> freiberuflichen<br />
Lehrkräften <strong>und</strong> Referenten. In diesem Sinne hat<br />
sich das jährliche Treffen <strong>der</strong> Weiterbildungsrefe-<br />
renten des Instituts 2005 mit fachk<strong>und</strong>iger Unter-<br />
stützung durch Prof. Dr. Rüdiger Funiok S.J. aus-<br />
führlich mit dem Thema „Werte-Orientierung in <strong>der</strong><br />
beruflichen Weiterbildung“ befasst.<br />
Personalentwicklung orientiert sich am<br />
christlichen Menschenbild<br />
Schulische Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung des Instituts<br />
sind eingebettet in ein umfassendes Verständnis<br />
von Personalentwicklung. Diese wird im Rahmen-<br />
konzept „Bilden <strong>und</strong> Entwickeln“ konzeptionell<br />
„unterfüttert“ <strong>und</strong> systematisch gebündelt. Das<br />
Rahmenkonzept ist übrigens 2004 in die Endr<strong>und</strong>e<br />
<strong>der</strong> Ausschreibung des ConSozial-Preises gelangt.<br />
Personalentwicklung im <strong>Caritasverband</strong> orientiert<br />
sich am christlichen Menschenbild: Sie beschränkt<br />
sich nicht auf eine strikt „outputorientierte“ För-<br />
<strong>der</strong>ung von so genannten „high potentials“ (so<br />
wichtig eine gute Führungskräfteentwicklung auch<br />
ist), son<strong>der</strong>n bietet Unterstützung <strong>und</strong> Entwick-<br />
lungsmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden, da alle<br />
ihren Beitrag zur Dienstgemeinschaft leisten. Sie<br />
sieht die Mitarbeitenden als Menschen, die zur<br />
ständigen beruflichen <strong>und</strong> persönlichen Entwick-<br />
lung in <strong>der</strong> Lage, zu dieser aber auch aufgerufen<br />
<strong>und</strong> für diese verantwortlich sind.<br />
Die „Führungsleitlinien“ verpflichten die Führungs-<br />
kräfte auf eine beständige „Selbstreflexion“ <strong>und</strong><br />
Weiterentwicklung ihres Führungshandelns. Der<br />
Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> <strong>und</strong> sein Institut bieten<br />
entsprechende Unterstützung an, z.B. Führungs-<br />
trainings o<strong>der</strong> auch ein qualifiziertes „Führungs-<br />
feedback“ durch die geführten Mitarbeitenden als<br />
Anstoß zur Weiterentwicklung (siehe Kasten).<br />
Neue Wege wagen: Integrative Ausbildung Alten- <strong>und</strong> Krankenpflege<br />
Die Altenpflegeschule St. Korbinian des Instituts für Bildung <strong>und</strong><br />
Entwicklung in Baldham <strong>und</strong> die Krankenpflegeschule Maria Re-<br />
gina <strong>der</strong> Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in<br />
<strong>München</strong> gestalten gemeinsam das Modellvorhaben einer inte-<br />
grativen Pflegeausbildung in <strong>der</strong> Alten- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Krankenpflege. Beide Schulen <strong>und</strong> ihre kirchlichen Träger sowie<br />
die beteiligten Praxisstellen (Altenheime, Sozialstationen, Kran-<br />
kenhäuser) wollen damit den sich wandelnden Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an eine fachlich <strong>und</strong> menschlich hochwertige Pflege noch besser<br />
gerecht werden. Inhaltlich <strong>und</strong> organisatorisch müssen in dem<br />
Projekt neue Wege gegangen werden: ein kirchliches Gemein-<br />
schaftsprojekt, das nur durch das hohe Engagement <strong>der</strong> Projekt-<br />
beteiligten möglich wird <strong>und</strong> das zeigt, dass Verwurzelung in ei-<br />
ner christlichen (Werte-)Tradition <strong>und</strong> Innovationskraft keine<br />
Gegensätze sind.<br />
41
Viola Treudler<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
<strong>und</strong> Projektleiterin<br />
Mentoring<br />
42<br />
Viola Treudler<br />
Frauen für Führung motivieren <strong>und</strong> för<strong>der</strong>n<br />
Der Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> nimmt am Cross-Mentoring<br />
<strong>München</strong> 2005/2006 teil<br />
Der Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> <strong>München</strong> <strong>und</strong> <strong>Freising</strong> e.V. för<strong>der</strong>t weiblichen Führungsnachwuchs im Rahmen<br />
seiner Personalentwicklung. Bereits im Jahr 2003/2004 wurde ein internes Mentoringprojekt zur Unter-<br />
stützung <strong>und</strong> Motivation weiblicher Führungskräfte im Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> durchgeführt. Dieses<br />
Mentoring-Programm ist eingebettet in das Rahmenkonzept „Bilden <strong>und</strong> Entwickeln“.<br />
Um junge weibliche Führungskräfte auch unter-<br />
nehmensübergreifend zu för<strong>der</strong>n, beschloss <strong>der</strong><br />
Vorstand darüber hinaus eine Teilnahme am „Cross-<br />
Mentoring <strong>München</strong> 2005/2006“ - ein Projekt zur<br />
Unterstützung des weiblichen Führungsnachwuch-<br />
ses, bei dem namhafte Münchner Großunterneh-<br />
men wie Allianz, Telekom, BMW, Landeshauptstadt<br />
<strong>München</strong> etc. beteiligt sind. Im Kern geht es dabei<br />
um die För<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> Unterstützung jüngerer,<br />
weiblicher Führungskräfte in ihrer beruflichen <strong>und</strong><br />
persönlichen Entwicklung durch erfahrene ältere<br />
Führungskräfte. Die Tandems Mentee (= jüngere<br />
weibliche Führungskraft) <strong>und</strong> Mentor/-in (= erfah-<br />
rene Führungskraft) treffen sich in regelmäßigen<br />
Abständen über den Zeitraum von einem Jahr. Ein-<br />
gebettet ist das Cross-Mentoring <strong>München</strong> in ein<br />
Rahmenprogramm <strong>und</strong> eine umfangreiche Öffent-<br />
lichkeitsarbeit.<br />
Der Diözesan-<strong>Caritasverband</strong> beteiligt sich mit<br />
zwei Mentees <strong>und</strong> zwei Mentorinnen. Das Aus-<br />
wahlverfahren wurde von einer Projektgruppe ge-<br />
staltet. Tandem-Treffen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Angebote für<br />
die Mentees finden außerhalb <strong>der</strong> Dienstzeit statt.<br />
Die Mentorinnen arbeiten ehrenamtlich, gewinnen<br />
aber durch ihr Engagement Einblicke in an<strong>der</strong>e Un-<br />
ternehmenskulturen <strong>und</strong> sammeln zusätzliche Er-<br />
fahrung in <strong>der</strong> individuellen Begleitung <strong>und</strong> Förde-<br />
rung. Das Projekt läuft von Juni 2005 bis Juni 2006.<br />
Wer nähere Informationen zum<br />
Cross-Mentoring <strong>München</strong> 2005/2006<br />
erhalten möchte, wendet sich an:<br />
V1.3 - Viola Treudler<br />
Projektleitung Mentoring<br />
Hirtenstraße 4<br />
80335 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 55 169-395<br />
eMail: vtreudler@caritasmuenchen.de
Region <strong>München</strong> Stadt/Land<br />
1 CZ Au/Haidhausen/Giesing<br />
2 CZ <strong>München</strong> Ost/Land<br />
3 CZ Innenstadt<br />
4 CZ Laim/Sendling<br />
5 CZ <strong>München</strong> Nord<br />
6 CZ <strong>München</strong> West <strong>und</strong> Würmtal<br />
7 CZ Neuforstenried<br />
8 CZ Neuhausen/Moosach<br />
9 CZ Ramersdorf/Perlach/Ottobrunn<br />
10 CZ Schleißheim/Garching<br />
11 CZ Schwabing/Milbertshofen<br />
12 CZ Taufkirchen<br />
Region Nord<br />
CZ Dachau<br />
CZ Ebersberg<br />
CZ Erding<br />
CZ Fürstenfeldbruck<br />
CZ <strong>Freising</strong><br />
CZ Pfaffenhofen<br />
Verbreitungsgebiet des Diözesan-<strong>Caritasverband</strong>s<br />
Region Süd<br />
CZ Miesbach<br />
CZ Garmisch-Partenkirchen<br />
CZ Bad Tölz/Wolfratshausen<br />
CZ Rosenheim<br />
CZ Bad Aibling<br />
CZ Wasserburg<br />
CZ Prien<br />
CZ Traunstein<br />
CZ Berchtesgadener Land<br />
CZ Mühldorf<br />
43
Jahresbericht 2004/05<br />
<strong>Caritasverband</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Erzdiözese</strong> <strong>München</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Freising</strong> e.V.<br />
Hirtenstraße 4<br />
80335 <strong>München</strong><br />
Telefon: (089) 5 51 69-0<br />
Ihre Spende kommt an!<br />
Spendenkonto · Liga-Bank <strong>München</strong><br />
Kto. 229 77 79 · BLZ 750 903 00<br />
Spendenkonto · Bank für Sozialwirtschaft<br />
Kto. 181 78 01 · BLZ 700 205 00