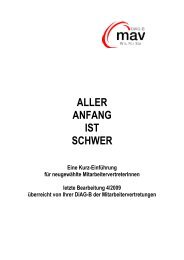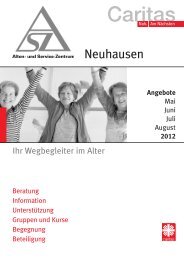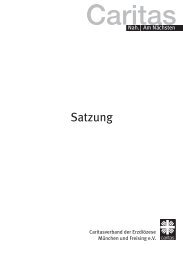kein Seitentitel - Caritasverband der Erzdiözese München und ...
kein Seitentitel - Caritasverband der Erzdiözese München und ...
kein Seitentitel - Caritasverband der Erzdiözese München und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Projekt-Werkstatt Implementierung<br />
Kursmaterial<br />
Palliativkompetenz <strong>und</strong> Hospizkultur entwickeln<br />
Redaktion <strong>und</strong> Entwicklung: Martin Alsheimer<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 20.04.2008; Redaktion: Martin Alsheimer
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Kontakt<br />
Kompetenzzentrum Palliative Care <strong>und</strong> Hospizkultur<br />
Martin Alsheimer<br />
Große Rosengasse 1<br />
85049 Ingolstadt<br />
0172/1476698<br />
E-Mail: Martin.Alsheimer@gmx.de<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
2
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einführung in die Implementierung<br />
Basisartikel Sterbebegleitung als Herausfor<strong>der</strong>ung begreifen<br />
Ausgangslage: Fünf dramatische gesellschaftliche Entwicklungen<br />
Basisartikel Palliativkultur entwickeln<br />
Eine Einführung in die Modellprojekte<br />
Material Ein Einrichtungskonzept visualisieren<br />
Ein Beispiel für ein Hospizkonzept in Bild <strong>und</strong> Stichworten<br />
Basisartikel Qualitätskontrolliertes Sterben?<br />
Zur Diskussion um Qualität <strong>und</strong> Standards in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
2. Arbeitshilfen für den Projekt-Prozess<br />
Thesen 7 Empfehlungen für die Implementierung<br />
Bedingungen für die erfolgreiche Projektarbeit<br />
Material Ein Projekt im Heim kurz gefasst<br />
Projekt: Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben (Neuburg)<br />
Material Ein Projekt in <strong>der</strong> Sozialstation kurz gefasst<br />
Projekt: Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen (Füssen)<br />
Material Schritte <strong>der</strong> Implementierung planen<br />
Sieben notwendige Stufen <strong>und</strong> Aufgaben im Projekt<br />
Material Projektablauf planen<br />
50 Aktionen im Überblick (Beispiel Projekt Füssen)<br />
Ideen Finanzielle Ressourcen entdecken<br />
Ideen für materielle <strong>und</strong> finanzielle Ressourcen <strong>und</strong> Sponsoring<br />
Ideen Um Unterstützung werben<br />
Strategien <strong>und</strong> Argumentationshilfen für die Einführung des Projektes<br />
Material Sterbe: Ist-Zustand (Pflegeheim)<br />
20-Punkte-Check für die Organisation <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
Material Ist-Analyse (Sozialstation)<br />
20-Punkte-Check für die Organisation <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
Material Entwicklungen sichtbar machen<br />
Ein Auswertungsbogen für die Ist-Analyse<br />
Material Veranstaltung für Ist-Analyse planen<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
7<br />
9<br />
26<br />
31<br />
34<br />
39<br />
41<br />
43<br />
46<br />
48<br />
51<br />
54<br />
55<br />
56<br />
60<br />
63<br />
3
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Schritte, Ziele, Methoden <strong>und</strong> Medien<br />
Material Veranstaltung zur Konzept-Diskussion planen<br />
Schritte, Ziele, Methoden <strong>und</strong> Medien (Projekt Hersbruck<br />
Material Fortbildungsthemen wählen<br />
Themen für die Schulung von Mitarbeitern (Beispiel Projekt Füssen)<br />
Material Inhouse-Fortbildungen planen<br />
Konzept für hausinterne Fortbildungen (Beispiel Projekt Eichenau)<br />
Ideen Hilfreiche Haltungen für die Sterbebegleitung för<strong>der</strong>n<br />
Beispiele für Haltungen <strong>und</strong> Möglichkeiten <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung<br />
3. Leitgedanken <strong>und</strong> Konzepte<br />
Thesen Leitgedanken: Sterbebegleitung<br />
10 Thesen zur beson<strong>der</strong>en Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
Dokument Lebensqualität bis zum Abschied<br />
Leitlinien <strong>der</strong> Sozialservicegesellschaft des BRK zum Thema Sterbebegleitung (Ethik-<br />
Kommission)<br />
Konzept Leben bis zuletzt<br />
Konzept zur Sterbebegleitung (Leonhard-Henninger-Haus <strong>München</strong>)<br />
Konzept Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben<br />
Konzept zur Sterbebegleitung (LSt. Augustyn <strong>München</strong>)<br />
Konzept Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen<br />
Konzept zur Sterbebegleitung (Evang.-kath. Sozialstation Füssen, Hospizverein)<br />
4. Musterstandards, Gesprächshilfen,<br />
Arbeitsmaterialien <strong>und</strong> Ideen<br />
Standard Bewohner willkommen heißen<br />
Ritual in <strong>der</strong> Phase des Einzugs<br />
Ideen Situationen für gezielte Gespräche<br />
Wann <strong>und</strong> wie können wir etwas über die Vorstellungen zur letzten Lebensphase erfahren?<br />
Standard Die letzte Lebensphase in den Blick nehmen –<br />
Gesprächsangebot „Rechtzeitig Vorsorge treffen“<br />
Standard Lebensqualität sichern<br />
Vorstellungen zur letzten Lebensphase erfassen<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
41<br />
43<br />
46<br />
48<br />
51<br />
77<br />
79<br />
81<br />
83<br />
87<br />
101<br />
109<br />
111<br />
113<br />
115<br />
4
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material Biografiebogen als Hilfe nutzen<br />
Wichtige Informationen für eine individuelle Pflege<br />
Standard Angehörige wahrnehmen <strong>und</strong> begleiten<br />
Überblick über unterstützende Angebote des Hauses<br />
Material Einen Abend für Angehörige planen<br />
Tipps <strong>und</strong> Anregungen für die Gestaltung<br />
Material 7 Empfehlungen für Angehörige<br />
Teilnehmermaterial für Angehörigenabende<br />
Material Angehörige mit einem Flyer informieren<br />
Textbausteine für ein Faltblatt zur Palliativkultur<br />
Standard Palliative-Care-Fachkräfte nutzen<br />
Aufgaben-Profil für den Einsatz in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Material Schmerzen bei demenziell erkrankten Menschen<br />
erfassen<br />
ECPA-Beobachtungsbogen (Roland Kunz)<br />
Thesen Leitlinien Kooperation mit Ärzten<br />
Hilfen für interne Rollenklärungen <strong>und</strong> Kommunikation<br />
Material Hausärzte zur Kooperation einladen<br />
Textbeispiel für ein R<strong>und</strong>schreiben<br />
Ideen Krisenvorsorge absichern<br />
Wie können Hausärzte eingeb<strong>und</strong>en werden?<br />
Ideen Palliative Notfälle bedenken<br />
Typische Probleme <strong>und</strong> bewährte Lösungen in Projekten<br />
Material Formen <strong>der</strong> Sterbehilfe kennen<br />
Überblick über Formen <strong>und</strong> ihre rechtliche Bewertung<br />
Standard Krisen vorsorgen <strong>und</strong> Notfälle planen<br />
Standard zur Absicherung von Entscheidungen<br />
Material Palliativer Notfallplan: Verfügungen /<br />
Ärztlicher Bericht<br />
Dokumentation wichtiger Entscheidungen<br />
Standard Symptome kontrollieren<br />
Typische Symptome <strong>und</strong> bewährte Lösungen<br />
Material Ehrenamt: Kooperation vorbereiten<br />
Leitfragen für die Klärung einer möglichen Zusammenarbeit<br />
Material Ehrenamtliche: Konflikte vorbeugen<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Entschärfung typischer Probleme<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
121<br />
127<br />
137<br />
143<br />
149<br />
153<br />
157<br />
159<br />
165<br />
167<br />
168<br />
169<br />
170<br />
171<br />
177<br />
183<br />
189<br />
5
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konzept Leitlinien für den Hospizeinsatz im Heim<br />
Regelungen <strong>und</strong> Wünsche für die Zusammenarbeit (Hospizverein Ingolstadt )<br />
Standard Sitzwachengruppe im Heim koordinieren<br />
Regelungen für Einsatz <strong>und</strong> Begleitung<br />
Standard Ehrenamtliche Hospizhilfe anbieten<br />
Hospizhelfer ambulant vermitteln<br />
Basisartikel Hilfreiche Rituale entwickeln<br />
Ein „Bastelkurs“ für gute Rituale<br />
Standard Die Krankensalbung feiern<br />
Erläuterungen zu Ablauf <strong>und</strong> Sinngehalt<br />
Material Abschiedräume gestalten<br />
Empfehlungen für Ort <strong>und</strong> Interieur<br />
Material Trauerkorb zusammenstellen<br />
Ideen für Symbole <strong>und</strong> praktische Hilfen beim Abschied<br />
Hilfen Todesnachricht telefonisch überbringen<br />
Gesprächshilfen für eine schwierige Situation<br />
Standard Verstorbene versorgen – Angehörige unterstützen<br />
Spirituelle, pflegerische <strong>und</strong> rechtliche Aspekte<br />
Material An Verstorbene erinnern<br />
Beispiele für einer Abschieds- <strong>und</strong> Gedenkkultur<br />
Hilfen Angehörige am Totenbett begleiten<br />
Hilfen für Gespräch <strong>und</strong> rituelles Handeln<br />
Material Im Team Gedenkkarte an Angehörige schreiben<br />
Ein Beispiel für eine aufmerksame Nachsorge<br />
Standard Gedenkfeier gestalten<br />
Ein Beispiel für eine gelungene Dramaturgie<br />
Standard Auszubildende auf die Versorgung Verstorbener<br />
vorbereiten<br />
Schritte für eine verantwortungsvolle Praxisanleitung<br />
Standard In die Sterbebegleitung einführen<br />
Praxisanleitung: Auszubildende auf Sterben <strong>und</strong> Trauer vorbereiten<br />
Ablaufplan Veranstaltung zur Patientenverfügung<br />
Lernphase, Ziele, Methoden, Inhalte, Medien<br />
Basisartikel Umgang mit Schuld <strong>und</strong> Schuldgefühlen<br />
Unterscheidungen <strong>und</strong> Hilfen für unterstützende Gespräche<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
195<br />
199<br />
201<br />
205<br />
225<br />
227<br />
231<br />
233<br />
237<br />
245<br />
246<br />
251<br />
253<br />
259<br />
263<br />
266<br />
269<br />
6
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
1<br />
Einführung in die<br />
Implementierung<br />
7
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
8
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Basisartikel<br />
Sterbebegleitung als<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung begreifen<br />
Fünf dramatische gesellschaftliche Entwicklungen<br />
Hinweis zur Verwendung::<br />
Warum sind Palliative Care <strong>und</strong> Hospizarbeit Themen von beson<strong>der</strong>er<br />
gesellschaftlicher Bedeutung? Der einleitende Beitrag wirft fünf Schlaglichter<br />
auf die Entwicklung <strong>der</strong> letzten hun<strong>der</strong>t Jahre, präsentiert Daten<br />
<strong>und</strong> Beispiele <strong>und</strong> formuliert Konsequenzen. Sie können den Text mit<br />
seinen Thesen <strong>und</strong> seinem Zahlenmaterial auch als Impulsreferat verwenden,<br />
um die Notwendigkeit <strong>und</strong> die Chancen einer verbesserten<br />
Palliativversorgung zu untermauern. Die Impulse für Sie als Leser lassen<br />
sich auch an Zuhörer richten.<br />
Einleitende Statements: Welchen <strong>der</strong> folgenden Meinungsäußerungen stimmen<br />
Sie zu?<br />
1. Meinung: „Wenn ich schon sterben muss, dann möchte ich zu Hause sterben.“<br />
2. Meinung: „Wenn ich schon sterben muss, dann hoffe ich, dass es plötzlich<br />
<strong>und</strong> schnell passiert, z. B. möchte ich einschlafen <strong>und</strong> nicht mehr aufwachen.“<br />
3. Meinung: „Ich glaube, dass heute viele Familien lei<strong>der</strong> die Alten <strong>und</strong><br />
Schwerkranken in Einrichtungen abschieben.“<br />
4. Meinung: „Trauer geht nur den engsten Familienkreis etwas an.“<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
9
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1. Entwicklung:<br />
Das institutionalisierte Sterben – Das Sterben wird in Einrichtungen<br />
„verlegt“ <strong>und</strong> die Sterbenden werden Experten übergeben<br />
These: Die Geschichte des Todes ist (…) auch eine Geschichte zunehmen<strong>der</strong><br />
Spezialisierung <strong>und</strong> Institutionalisierung (…) (REST 1992: 45; vgl. ARIÈS<br />
1991: 729 ff). Trauer, Sterben <strong>und</strong> Tod werden zunehmend in Kliniken <strong>und</strong><br />
Heime „verbannt“.<br />
Ein deutliches, allerdings älteres Beispiel: Fast 90 % <strong>der</strong> Menschen, die 1992<br />
im B<strong>und</strong>esland Nordrhein-Westfalen starben, waren zum Zeitpunkt ihres Todes<br />
nach einer Erhebung <strong>der</strong> Landesregierung zufolge nicht zuhause, son<strong>der</strong>n<br />
in Einrichtungen (DER SPIEGEL 1993: 158). Zum Vergleich: 1959/60 lag<br />
<strong>der</strong> Prozentsatz <strong>der</strong> Menschen, für die als Sterbeort eine Einrichtung angegeben<br />
worden war, lediglich bei 44 % (VOGES 1993: 109; SCHWEIDT-MANN<br />
1991). Eine b<strong>und</strong>esweite Statistik zu den Sterbeorten fehlt, weil diese auf den<br />
Totenscheinen von B<strong>und</strong>esland zu B<strong>und</strong>esland unterschiedlich (z. T. gar<br />
nicht) registriert werden. Eine einheitliche Erfassung wird inzwischen auch politisch<br />
gefor<strong>der</strong>t (ENQUETE-KOMMISSION 2005: 75). Es gibt somit lediglich<br />
lokale o<strong>der</strong> regionale Zwischenbilanzen, z. B. in Sachsen, Rheinland-Pfalz,<br />
<strong>der</strong> Stadt Mannheim. Die Angaben über den Sterbeort Heim schwanken in <strong>der</strong><br />
Literatur zwischen 10 <strong>und</strong> 40 % <strong>und</strong> die über den Sterbeort „Eigenes Heim“<br />
zwischen 5 <strong>und</strong> 30 %. Bei aller Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> einzelnen Prozentsätze<br />
bleibt unter „dem Strich“ das Resümee: Die große Mehrheit <strong>der</strong> Deutschen<br />
stirbt in einer Institution!<br />
Bezogen auf das Krankenhaus scheint eine langsame Trendwende einzusetzen:<br />
1980 wurde noch für 55,3 % aller Verstorbenen <strong>der</strong> Sterbeort „Krankenhaus“<br />
angegeben. Inzwischen ist die Zahl auf etwa 48 % gesunken (FALLER<br />
2004: 360). Dafür scheint das Pflegeheim die Institution mit <strong>der</strong> höchsten „Zuwachsrate“<br />
in den letzten Jahren zu sein (Belege für diesen Trend auch bei<br />
BICKEL 1998). Die Zahl <strong>der</strong> in Heimen versorgten Menschen stieg 2003 um<br />
5,9 % an, während <strong>der</strong> Anteil zu Hause Gepflegter von 70,4 % auf 69,2 %<br />
leicht sank. (STATISTISCHES BUNDESAMT 2003: 3). Es findet also eine Art<br />
Verschiebung zwischen den Institutionen statt. Die Devise „ambulant vor stationär“<br />
gilt (noch) nicht für das Sterben (PLESCH-BERGER 2005: 64).<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
10
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Folie 1<br />
Letzte Hilfe wo?<br />
Rheinland-Pfalz<br />
(1995)<br />
OCHSMANN<br />
1997<br />
Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
Sterbefälle über<br />
65 Jahre<br />
BICKEL 1998<br />
ENQUETE-<br />
KOMMISSION<br />
2005<br />
Zusammenstellung: HELLER 2006<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Krankenhaus Altenheim Eigene Wohnung<br />
bzw. außerhalb<br />
von<br />
Institutionen<br />
44,1 % 12,8 % 37,3 %<br />
49,7 % 21,2 % 29,1 %<br />
42-45 % 15-25% 25-30 %<br />
Hospiz: 1-2 % An<strong>der</strong>e Orte: 3-<br />
7 %<br />
Trotz aller persönlichen Anstrengungen des Personals bleiben hartnäckige<br />
Zwänge: Die Institutionalisierung begrenzt, die Spezialisierung verteilt die Ansprechpartner<br />
für die Bedürfnisse Sterben<strong>der</strong> <strong>und</strong> Trauern<strong>der</strong> in die verschiedensten<br />
Zuständigkeitsbereiche. Krankenhäuser <strong>und</strong> auch Pflegeheime sind<br />
auf Sterbebegleitung nicht o<strong>der</strong> nur unzureichend vorbereitet <strong>und</strong> sind fixiert<br />
auf einen an<strong>der</strong>en, nämlich kurativen (heilenden) o<strong>der</strong> rehabilitativen (Handicaps<br />
ausgleichenden) Auftrag. Sterben erscheint als „Betriebsunfall“ o<strong>der</strong> wird<br />
als „persönliches Versagen“ empf<strong>und</strong>en. (Eine empirische Bestätigung finden<br />
Sie z. B. bei: KALUZA, TÖPFERWEIN 2005.)<br />
Die folgende Polarisierung mag etwas überspitzt sein; sie lässt aber das<br />
Spannungsfeld <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ungen für die Sterbebegleitung in Einrichtungen<br />
deutlich erkennen:<br />
11
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Folie 2<br />
Sterben in Institutionen<br />
Zwänge von Institutionen<br />
• einseitige somatische Orientierung<br />
(Reparaturprinzip)<br />
• gleich(gültig-)e Versorgung aller<br />
(Gleichheitsprinzip)<br />
• zeitlich limitierte <strong>und</strong> stark strukturierte<br />
Leistungseinheiten (ökonomisches<br />
Prinzip)<br />
• professionelles Interesse <strong>der</strong><br />
Helfer (Kontrollprinzip)<br />
vgl. HELLER et al., 2000<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Bedürfnisse sterben<strong>der</strong> <strong>und</strong> trauern<strong>der</strong><br />
Menschen<br />
• ganzheitliche Wahrnehmung<br />
• beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit<br />
• zeitlich offene <strong>und</strong> flexibel vereinbarte<br />
Begegnung<br />
• persönliche Begegnung<br />
Die Spannung zeichnet sich auch in den Wünschen zum eigenen Sterben ab:<br />
Fast 90 % <strong>der</strong> Deutschen möchten Zuhause sterben (vgl. DER SPIEGEL<br />
1993: 158). Ein deutlicher Wi<strong>der</strong>spruch zwischen Wunsch <strong>und</strong> Wirklichkeit!<br />
Sterben, Tod <strong>und</strong> Trauer wird – so <strong>der</strong> weitere Trend – gesellschaftlich immer<br />
mehr an so genannte Spezialisten <strong>und</strong> Experten delegiert: Ärzte, Pflegekräfte,<br />
Bestatter. Der Giessener Soziologe Reimer Gronemeyer, , ein kritischer Begleiter<br />
<strong>der</strong> Hospizbewegung, warnt vor einer Vereinnahmung:<br />
„Die Sozialtechniker werden nicht zögern, für jede Sterbestufe einen Experten<br />
zu schulen, damit nichts dem Zufall überlassen bleibt …“ (GRONEMEYER<br />
1990: 169) Fachleute bemühen sich um die Abschaffung des unordentlichen,<br />
spontanen <strong>und</strong> unbegleiteten Sterbens. (…) Da wird noch immer ungeordnet<br />
gestorben, ohne dass die technische <strong>und</strong> therapeutische Voraussetzung für<br />
einen von Expertenhand überwachten Abgang gegeben wird. (…) Die Pfleger<br />
kommen mit Schläuchen <strong>und</strong> Gesprächstechniken. Den Schlauch kann man<br />
abreißen, den Morib<strong>und</strong>enarbeiter (Vorschlag für eine Berufsbezeichnung analog<br />
dem Sozialarbeiter) wird man nicht los. Er will mir meine ‚persönliche<br />
Todesprägung’ ermöglichen. Die werde ich nur haben, wenn ich meine didaktisch<br />
versierten Gesprächspartner zum Teufel jage – <strong>und</strong> wenn es das Letzte<br />
ist, was ich tun kann.“ (GRONEMEYER 1990: 167)<br />
12
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konsequenzen, Chancen <strong>und</strong> Impulse:<br />
• Eine große Herausfor<strong>der</strong>ung heißt: Welche Formen <strong>und</strong> welchen Umfang<br />
von Unterstützung braucht es, um dem Wunsch „ambulant vor stationär“ in<br />
<strong>der</strong> letzten Lebensphase gerecht zu werden? Modellversuche legen nahe,<br />
dass es mit verstärkter ambulanter Palliativversorgung mehr Menschen<br />
möglich ist, zu Hause zu sterben, so gelang dies z. B. bei 60 % <strong>der</strong> Betroffenen<br />
im Projekt SUPPORT (GUNZELMANN U.A. 2002). Frage: Wie<br />
kommt das Heim/die Klinik in die Wohnung?<br />
• Die zweite große Frage lautet: Wie müssen Institutionen verwandelt<br />
(Stichwort: „de-institutionalisiert) werden, damit betroffene <strong>und</strong> beteiligte<br />
Menschen ein „Gefühl von Zuhause“ in dieser verletzlichen Phase empfinden?<br />
Frage: Wie kommt die Wohnung ins Heim/in die Klinik? Auch hier<br />
gibt es bereits eine Reihe Richtung weisende Projekte. (Siehe dazu die<br />
Arbeitseinheit zur „Organisatorischen Kompetenz“)<br />
• Die dritte Frage: Wie können wertvolles Wissen <strong>und</strong> Erfahrungen von professionellen<br />
Kräften in die Begleitung eingehen, ohne dass eine „Expertokratie“<br />
entsteht? Lässt sich Sterbebegleitung lernen? Was bedeutet das<br />
für die Aus- <strong>und</strong> Fortbildung von Pflegekräften?<br />
Die Entwicklung zur Institutionalisierung des Sterbens ist nicht zufällig. Zur Institutionalisierung<br />
des Sterbens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Spezialisierung <strong>der</strong> Begleitung führen<br />
die folgenden vier mächtigen kulturellen Wandlungen. Die Tendenzen sind<br />
durchaus ambivalent. Es liegen in diesen Entwicklungen auch Chancen im<br />
Sinne höherer Freiheitsgrade für die Lebensgestaltung, Individualisierung statt<br />
Normierung <strong>der</strong> Leistungen <strong>und</strong> freiwillig erbrachte Solidarität statt Zwangsverpflichtung<br />
(vgl. zur Ambivalenz <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierung: BECK-GERNSHEIM<br />
1994).<br />
2. Entwicklung:<br />
Das selten miterlebte <strong>und</strong> ausgegrenzte Sterben - Der Tod kommt<br />
spät <strong>und</strong> unheimlich<br />
These: Die Menschen in Deutschland – <strong>und</strong> das ist einmalig in <strong>der</strong> Geschichte<br />
– sterben heute überwiegend im hohen Alter; dadurch aber wird das Sterben<br />
von Menschen heute im persönlichen Umfeld selten miterlebt. Das Unbekannte<br />
ängstigt.<br />
Sicher: „Der Tod ist ein Modethema“ (VINCENT 1993: 294). Allerdings ist er<br />
eher medial auf den Bildschirmen, aber nicht mehr real präsent. Die Unaus-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
13
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
weichlichkeit des eigenen Sterbenmüssens wird im Allgemeinen heute eher<br />
verdrängt. Früher war dagegen <strong>der</strong> Tod in allen Altersstufen gleich gegenwärtig<br />
(IMHOFF 1988: 46 ff.) Die Sterbematrikel einer Pfarrei hätte früher etwa so<br />
lauten können: Christoph Scheuerlein, 3 Jahre, Johanna Stiller, 3 Monate,<br />
Knabe Josef Daumer ,10 Jahre, Jüngling Josef Beierlein, 25 Jahre, Herwig<br />
Nusser, 37 Jahre, Karl Lummer, 62 Jahre, Maria Ho<strong>der</strong>lein, 83 Jahre usw.<br />
Vergleichen Sie dazu die Daten <strong>der</strong> Lebensspannen in den Todesanzeigen in<br />
Ihrer Tageszeitung!<br />
Folie 3<br />
Die Lebenserwartung „früher“ <strong>und</strong> „heute“ im Vergleich<br />
Wie hoch ist die Lebenserwartung<br />
bei Geburt?<br />
Wie viele Menschen erreichen das<br />
60. Lebensjahr?<br />
Wie viele Jahre leben Menschen<br />
durchschnittlich noch, die das 60.<br />
Lebensjahr erreicht haben?<br />
Wie verteilen sich die Todesfälle auf<br />
die Lebensalter?<br />
IMHOFF 2003<br />
früher<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
(19. Jahrhun<strong>der</strong>t)<br />
heute<br />
< 40 Jahre Frauen > 80 Jahre<br />
Frauen: 45 %<br />
Männer: 40 %<br />
Männer > 74 Jahre<br />
Frauen: 93 %<br />
Männer: 87 %<br />
Noch 10 – 12 Jahre Frauen > 23 Jahre<br />
hohe Kin<strong>der</strong>sterblichkeit (bis 50<br />
%), für die nicht im Kindesalter<br />
Sterbenden ungefähr gleich verteilte<br />
Wahrscheinlichkeit in allen<br />
späteren Altersstufen<br />
Männer > 19 Jahre<br />
z. B. > 60 Jahre: 13%<br />
Die Lebenserwartung bei<strong>der</strong> Geschlechter steigt. Ein Mädchen, das 2006 in<br />
Deutschland geboren wird, hat gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden, ein<br />
Junge 95 Jahre.<br />
Heute ist somit <strong>der</strong> Tod durch die Verlängerung <strong>der</strong> durchschnittlich erwartbaren<br />
Lebenszeit ins hohe Alter gerückt worden. Die Sterberate ist stark gesunken.<br />
Natürlich wird niemand diesen Prozess umkehren wollen. Das Credo für<br />
ein „Zurück zur Bevölkerungspyramide“, das entgegen <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen demografischen<br />
Entwicklung so oft geäußert wird, unterschlägt die negativen Faktoren.<br />
Das Bild <strong>der</strong> Pyramide suggeriert Stabilität, jedoch bedeutet dieses „Idealbild“<br />
<strong>der</strong> Alterszusammensetzung <strong>der</strong> Gesellschaft, dass nur ein kleiner Teil<br />
eines Geburtsjahrgangs die Spitze eines hohen Alters erreicht. Der große<br />
„Rest <strong>der</strong> jeweiligen Altersjahrgänge“ – im Bild <strong>der</strong> „Himmel“ neben <strong>der</strong> Pyramide<br />
- würde bereits auf dem Friedhof liegen. Eine Folge des historisch so<br />
einmaligen späten Sterbens: Wir sind selten <strong>und</strong> spät im Leben mit dem Sterben<br />
nahe stehen<strong>der</strong> Menschen konfrontiert. (IMHOF 1996)<br />
14
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiel: „In einer Befragung von 50 Personen im Alter von 20-25 Jahren gaben<br />
nur zwei an, bewusst einen Leichnam gesehen zu haben.“ (SCHMIED<br />
1985: 31) Wenn das Sterben an<strong>der</strong>er nicht mehr miterlebt wird, können Menschen<br />
diesen Prozess nicht einschätzen <strong>und</strong> werden (z. T.) unrealistische Befürchtungen<br />
mit dem Sterben verbinden. Das ausgegrenzte Sterben kann beängstigen<strong>der</strong><br />
sein als das gegenwärtige. Auch das ist einer <strong>der</strong> Gründe, warum<br />
Sterbende in Institutionen gegeben werden (STUDENT, STUDENT 1991:<br />
98). Ergebnis: Aus „heimlich“ wird „unheimlich“.<br />
Das Sterbeideal hat sich gewandelt: „Der Tod war immer ein großer Skandal“<br />
(CANAKAKIS 1993: 78). Das Sterben in früheren Zeiten soll <strong>kein</strong>eswegs<br />
romantisiert werden. „Gezeichnet von Krankheiten <strong>und</strong> Schmerzen, ohne adäquate<br />
medizinische <strong>und</strong> pflegerische Versorgung, in kalten o<strong>der</strong> überhitzten<br />
Kammern, unter heute unvorstellbaren hygienischen Bedingungen, gerade in<br />
Seuchenzeiten meist allein gelassen: so dürfte die Realität vieler Sterbenden<br />
ausgesehen haben.“ (SCHÄFER 1998: 8) Früher war <strong>der</strong> plötzliche, unvorbereitete<br />
Tod gefürchtet, weil er als Strafe gesehen wurde <strong>und</strong> <strong>kein</strong>e Zeit blieb,<br />
die Sünden zu bereuen. Das „Memento mori“ („Gedenke des Todes!“) wurde<br />
als Einübung <strong>und</strong> innere Vorbereitung gepredigt. Heute ist es umgekehrt: 80<br />
% <strong>der</strong> Menschen möchten „schnell“ sterben (WITTKOWSKI 1993) o<strong>der</strong> wie<br />
<strong>der</strong> Regisseur <strong>und</strong> Komiker Woody Allan karikiert: „Ich habe <strong>kein</strong>e Angst vor<br />
dem Sterben. Ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn es passiert …“ (Zitiert<br />
nach: BAUR, SCHMID-BODE 2003: 11).<br />
Konsequenzen, Chancen <strong>und</strong> Fragen<br />
Es gilt wie<strong>der</strong>, den Tod in das Leben zu integrieren. „Die Frage ist: Tut es uns<br />
gut, wenn wir einer Erfahrung ausweichen, die ganz wesentlich zum Leben<br />
gehört? Tut es uns gut, wenn wir den Tod aussperren? (…) An<strong>der</strong>s herum gesagt:<br />
(…) Sterben <strong>und</strong> Leben können gehören zusammen. Das eine spiegelt<br />
sich in dem an<strong>der</strong>en. Sterben ist die an<strong>der</strong>e Seite des Lebens <strong>und</strong> beide Seiten<br />
machen erst unser Sein aus. (PISARSKI 2005: 31) Impuls: Eine alte Inschrift<br />
im Dom zu Schleswig mahnt in einem Wortspiel: „Wir müssen täglich<br />
sterben, damit wir nicht sterben, wenn wir sterben.“ Wie deuten <strong>und</strong> stehen<br />
Sie zu dieser Aussage? Was heißt das ins konkrete Leben übersetzt?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
15
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3. Entwicklung:<br />
Das „lange“ Sterben – Der Tod kommt langsam <strong>und</strong> mühsam<br />
These: Sterben wird heute aufgr<strong>und</strong> an<strong>der</strong>er, neuer Todesursachen <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
medizinischen Möglichkeiten <strong>der</strong> Lebensverlängerung für viele Menschen zu<br />
einer eigenen „Lebensphase“ mit beson<strong>der</strong>en Problemen <strong>und</strong> Chancen.<br />
Die hauptsächlichen Todesursachen sind heute an<strong>der</strong>e als früher: Grassierten<br />
z. B. um 1900 noch „schnelle“ Infektionskrankheiten - mit Ausnahme <strong>der</strong><br />
„langsam“ zehrenden Tuberkulose -, überwiegen heute langwierige chronische<br />
<strong>und</strong> degenerative Leiden. Beispiel: Todesursache „Krebs“: Lag diese<br />
Feststellung um 1900 bei ca. 4 % aller Todesfälle, sind Tumorerkrankungen<br />
1980 bei ca. 21 % <strong>der</strong> Deutschen Ursache ihres Todes. (Detaillierter Zahlenvergleich<br />
bei: SCHMID 1985:18 ff., IMHOFF 1981: 220.) Früher war Sterben<br />
ein Punkt am Ende eines Lebens, heute weitet es sich zu einer eigenen Lebensphase.<br />
Das Leiden an einer lebensbedrohlichen Erkrankung kann sich im<br />
Auf <strong>und</strong> Ab von medizinischem Tun <strong>und</strong> Scheitern über Jahre hinziehen.<br />
Folie 5<br />
Die zehn häufigsten Todesursachen (FALLER 2004: 357)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
chronische ischämische Herzkrankheit ………….<br />
Herzinfarkt …………………………..………..…….<br />
Herzinsuffizienz ….…………………….…………..<br />
Schlaganfall ………………………….…………….<br />
Lungenkrebs….…………………....……………....<br />
Darmkrebs ……………………….…………….…..<br />
chronische Lungenerkrankungen …….…….……<br />
Lungenentzündung .……………………………….<br />
Brustkrebs …………………………………………<br />
Diabetes mellitus ………………………………….<br />
FALLER 2004: 357<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
94 166<br />
64 218<br />
56 955<br />
39 433<br />
39 105<br />
20 363<br />
19 402<br />
18 693<br />
18 010<br />
16 976<br />
Todesursache Nr. 1 sind gegenwärtig Erkrankungen des Herz- <strong>und</strong> Kreislaufsystems.<br />
In den nächsten Jahren werden – so die Prognose –bösartige Tumorerkrankungen<br />
die Liste <strong>der</strong> Todesursachen anführen. (GEKID 2006)<br />
16
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Modelle des Sterbeprozesses<br />
Was passiert in dieser (Über-)Lebenszeit? Angestoßen wurde die Forschung<br />
dazu von den Aufsehen erregenden Pionier-Arbeiten von Elisabeth Kübler-<br />
Ross (� 2004) (vgl. Modelle: KÜBLER-ROSS 1983, 1987: 9-42). Das Magazin<br />
TIME zählte sie 1999 zu den hun<strong>der</strong>t größten Wissenschaftlern <strong>und</strong> Denkern<br />
des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Sie entwickelte in verschiedenen begrifflichen Varianten<br />
ein Phasenmodell typischer Reaktionen im Sterbeprozess: Nicht-wahr-haben-<br />
Wollen, Auflehnung, Verhandeln, Depression, Annahme. Dieses wohl populärste<br />
Modell, das als Krisenmodell auch die Trauermodelle beeinflusste, wurde<br />
inzwischen vielfach kritisiert. Wesentliche Kritikpunkte sind:<br />
• Zu pauschal: Die Behauptung, alle sterbenden Menschen würden diese<br />
Phasen durchlaufen, hält empirisch nicht stand. Menschen zeigen sehr individuelle<br />
Bewältigungsstile.<br />
• Methodisch unscharf: Ähnliche Beschreibungen von Verhaltensweisen<br />
werden von ihr unterschiedlich <strong>und</strong> manchmal eher willkürlich den Phasen<br />
zugeordnet.<br />
• Abfolge nicht zwingend: Die Phasen werden – wie vielfache Forschungsergebnisse<br />
zeigen - nicht linear <strong>und</strong> auch selten „vollständig“ durchlaufen.<br />
Die aufgezeichneten, oft „erfolgreichen“ Prozesse sind wohl eher dem<br />
Charisma von Elisabeth Kübler-Ross in ihrer Begleitung dieser Menschen<br />
zu verdanken.<br />
• Gefahr <strong>der</strong> Wertung: die Beschreibung von Phasen wird unterschwellig zu<br />
„Vorschriften“<br />
(HOWE 1992: 55-66; Übersicht über Phasenmodelle: WITTKOWSKI 1990:<br />
117-140; SCHWEIDTMANN 1991: 27-54).<br />
Das Modell <strong>der</strong> Phasen mag als grobe „Landkarte“ manchmal hilfreich sein,<br />
um Reaktionen zu verstehen. Aber missverstanden als „Fahrplan“ des Sterbens<br />
führt es in Sackgassen <strong>der</strong> menschlichen Begleitung, weil es unterschwellig<br />
wertet, Betroffene <strong>und</strong> Beteiligte unter Druck setzt <strong>und</strong> die Phase<br />
<strong>der</strong> „Annahme“ zum Sterbe-Ideal erhebt (vgl. WILKENING, KUNZ 2003: 27 ff).<br />
Aus dem Einfühlen wird dann ein analysierendes Beobachten (siehe Kritik von<br />
GRONEMEYER oben). Bessere Bil<strong>der</strong>, weil dynamischer als das statische<br />
Stufenschema, sind z. B. das „Rad <strong>der</strong> Emotionen“ (ALBRECHT, ORTH,<br />
SCHMIDT 2004) o<strong>der</strong> das <strong>der</strong> „Gezeiten <strong>der</strong> Gefühle“, wie Elisabeth Kübler-<br />
Ross ihr Modell später selbst kommentiert hat (KÜBLER-ROSS 2004).<br />
Konsequenz: Was wir brauchen, ist kommunikative Flexibilität, um in <strong>der</strong> Begleitung<br />
immer wie<strong>der</strong> neu auf die hohe Unterschiedlichkeit zu reagieren <strong>und</strong><br />
die individuellen Bedürfnisse Betroffener zu erfahren <strong>und</strong> ihnen gerecht zu<br />
werden.<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
17
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Die „Gewitterwolke des langen Sterbens“ wirft große Schatten, nämlich<br />
Schmerzen – körperliche, soziale, psychische <strong>und</strong> spirituelle.<br />
Körperliche Schmerzen: Die „Lebensphase Sterben“ wird oft überschattet<br />
<strong>und</strong> zerquält durch die Schrecken unzureichend behandelter Schmerzen. Z. B.<br />
sterben bis zu 80 % <strong>der</strong> Krebspatienten unter unnötigen Schmerzen (vgl. zu<br />
diesem Skandal: DIE ZEIT 1/1994: 33; geringere Schätzung von 60 % bei<br />
STUDENT 1989: 58.) Deutschland ist immer noch ein Entwicklungsland <strong>der</strong><br />
Schmerztherapie, obwohl im Vergleich zu den 1980er Jahren die Morphin-<br />
Verschreibungen sich inzwischen verzwanzigfacht haben (FALLER 2004:<br />
361). So stieg <strong>der</strong> Morphinverbrauch von 0,8 kg pro 1 Millionen Einwohner im<br />
Jahre 1985 auf fast 17,7 kg pro 1 Millionen Einwohner im Jahre 2002. Gemessen<br />
aber am Bedarf bedeutet dies immer noch eine extreme Unterversorgung<br />
von Schmerzpatienten, die starke Opioide benötigen. Der tatsächliche<br />
Verschreibungsbedarf wird auf etwa 80 kg Morphin pro 1 Million Einwohner<br />
geschätzt (vgl. KLASCHIK 2003a). Dänemark etwa setzt durchschnittlich pro<br />
Kopf <strong>der</strong> Bevölkerung 15 Mal mehr Morphin ein. Die Ursachen für die mangelhafte<br />
schmerztherapeutische Versorgung sind vielfältig:<br />
• fehlende o<strong>der</strong> unzureichende schmerztherapeutische Ausbildung <strong>der</strong> Ärzte.<br />
Palliativmedizin ist 2005 nur an wenigen Universitäten verbindlich in<br />
das Medizinstudium integriert (Bonn, Köln, Aachen, <strong>München</strong>, Göttingen,<br />
Jena);<br />
• hartnäckige Vorurteile (Mythen) <strong>der</strong> Schmerztherapie bei Ärzten, Betroffenen<br />
<strong>und</strong> ihren Angehörigen: Gefahr <strong>der</strong> Abhängigkeit, therapeutisch letztes<br />
Mittel, Risiko <strong>der</strong> Eintrübung. Allein schon die Einreihung unter die „Betäubungsmittel“<br />
weckt falsche Assoziationen <strong>und</strong> Ängste vor ihrem Einsatz (z.<br />
B. Kontrollverlust, Beschleunigung des Todes);<br />
Ergebnisse einer Untersuchung 1997: Nur etwa ein Drittel (33,1 %) <strong>der</strong> befragten<br />
Ärzte kennt den WHO-Stufenplan <strong>und</strong> nur etwas mehr als ein Drittel<br />
(36,9 %) besitzt die notwendigen Betäubungsmittel-Rezeptvordrucke.<br />
(ENQUETE-KOMMISSION 2005: 31)<br />
Schmerzen haben neben <strong>der</strong> körperlichen Seite immer auch eine psychische,<br />
soziale <strong>und</strong> spirituelle Dimension, die zu selten berücksichtigt wird. Der Arzt<br />
Johann-Christoph Student, ein langjähriger Streiter für die deutsche Hospizbewegung,<br />
fasst diese Dimensionen zusammen:<br />
• „das Bedürfnis, im Sterben nicht alleingelassen zu sein (was nicht ständige<br />
Anwesenheit an<strong>der</strong>er bedeuten muss! - Bemerkung des Autors M.A.);<br />
• das Bedürfnis, noch letzte Dinge‚ ‚unerledigte Geschäfte’ (KÜBLER-<br />
ROSS) zu regeln;<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
18
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• das Bedürfnis, die Sinnfrage (Sinn des Lebens, Sinn des Sterbens u. ä.)<br />
zu stellen <strong>und</strong> die Frage des ‚Danach’ zu erörtern“. (STUDENT 1989: 64 f.)<br />
Eine Kurzbeschreibung dieser Schmerzdimensionen:<br />
Soziale Schmerzen: Gerade bei Sterbenden kommt es oft zu tragischen<br />
Wendungen im Verhalten <strong>der</strong> Umgebung. Wird jemand als „im Sterben liegend“<br />
eingestuft, verringern sich die Kontakte o<strong>der</strong> auch die pflegerische Anwesenheit<br />
deutlich. Untersuchungen zufolge halbiert sich (oft gegen die<br />
Wahrnehmung <strong>der</strong> Pflegenden) die Kontakt- <strong>und</strong> Pflegezeit, wenn jemand<br />
„aufgeben“ wird (vgl. gesammelte Untersuchungen bei SCHMIED 1985: 48<br />
ff.). Es gibt einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen den Ängsten von<br />
Ärzten <strong>und</strong> Pflegekräften <strong>und</strong> ihrem Verhalten (NEIMEYER, MOSER,<br />
WITTKOWSKI 2003).<br />
Eine weitere Beziehungsangst ist <strong>der</strong> Kontrollverlust in <strong>der</strong> letzten Lebensphase,<br />
d. h. die Sorge vor einem Zuwenig an Therapie <strong>und</strong> umgekehrt vor einem<br />
Zuviel.<br />
Psychische Schmerzen: Wir leben oft nicht in <strong>der</strong> Gegenwart, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong><br />
Zukunft <strong>und</strong> vertagen deshalb vieles. Motto: „Nach <strong>der</strong> Pensionierung kommt<br />
die Freiheit des Reisens o<strong>der</strong> die Erfüllung meiner wahren Interessen …“ Trifft<br />
uns eine schwere Krankheit, wird diese Zukunft bedroht. Versäumtes, Verschobenes<br />
meldet sich dann - die „unerledigten Geschäfte“, wie Elisabeth<br />
Kübler-Ross das Vertagte bezeichnet.<br />
Spirituelle Schmerzen: Schwere Krankheit lässt die existenziellen Fragen<br />
des Lebens nach Identität (Wer bin ich?), Sinn (Wozu lebe ich?) <strong>und</strong> Transzendenz<br />
(Was überlebt von mir? Wohin sterbe ich?) oft in schmerzhafter Form<br />
aufbrechen. Zum Beispiel: Wer bin ich, wenn ich wegen meiner Erkrankung<br />
nichts mehr leisten kann? O<strong>der</strong> was überlebt meine leibliche Vernichtung?<br />
Konsequenzen, Chancen <strong>und</strong> Impulse:<br />
• Wir benötigen in Medizin <strong>und</strong> Pflege einen umfassenden Schmerzbegriff,<br />
<strong>der</strong> nicht nur somatisch verengt ist, son<strong>der</strong>n einen weiten Blick auf an<strong>der</strong>e<br />
Schmerzquellen eröffnet. Dieses Verständnis ist ein beson<strong>der</strong>es Verdienst<br />
von Dame Cicely Saun<strong>der</strong>s, neben Elisabeth Kübler-Ross <strong>der</strong> zweiten<br />
großen Pionierin <strong>der</strong> Hospizbewegung.<br />
• Das “lange Sterben“ gibt vielleicht die Chance – die nicht zum Entwicklungszwang<br />
werden darf – diese Zeit als krisenreiche <strong>und</strong> bewusste Lebensphase<br />
Sinn gebend zu erleben. „Sterben, eine Zeit <strong>der</strong> Selbstentwicklung“,<br />
nennt es die 1983 an Krebs gestorbene Anne-Marie Tausch<br />
(TAUSCH 1987: 214). Mit dieser Deutung möchten wir <strong>kein</strong>esfalls das lan-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
19
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
ge Sterben verklären.<br />
• Impulse: Würden Sie es wissen wollen, wenn Sie von einer möglicherweise<br />
lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind? Was spricht dafür? Was<br />
dagegen? Wenn Sie die Frage bejahen: Was würde sich in Ihrem Leben<br />
verän<strong>der</strong>n?<br />
4. Entwicklung:<br />
Die Familien sind allein gelassen, die Pflegekräfte überfor<strong>der</strong>t –<br />
Das Sterben trifft auf verän<strong>der</strong>te Familienstrukturen<br />
These: Familien sind in den langen Sterbephasen oft alleingelassen <strong>und</strong> überfor<strong>der</strong>t.<br />
Pflegekräfte fühlen sich auf die Aufgabe <strong>der</strong> Sterbebegleitung oft unzureichend<br />
vorbereitet.<br />
Es gilt zunächst dem verbreiteten Vorurteil zu wi<strong>der</strong>sprechen, „Familien würden<br />
egoistisch Sterbende abschieben“. Im Gegenteil: Noch nie wurden so viele<br />
Menschen in den Familien gepflegt. Das ist übrigens <strong>kein</strong> Wi<strong>der</strong>spruch zu<br />
den oben genannten Zahlen des Sterbens in Einrichtungen! R<strong>und</strong> 90 % <strong>der</strong><br />
Pflegebedürftigen werden zurzeit in <strong>und</strong> von Familien gepflegt – bis in die<br />
Schlussphase.<br />
Die Herausfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> familiären Pflege ist historisch völlig neu. Sie wird<br />
durch zwei gegenläufige Entwicklungen geprägt:<br />
• Die Zahl <strong>der</strong> Pflegebedürftigen <strong>und</strong> die Dauer ihrer Pflege steigt. Sie<br />
hat sich in 30 Jahren verdoppelt (HEDTKE-BECKER 1992). Mag die Pflegezeit<br />
früher Tage, Wochen, allenfalls Monate gedauert haben, so beträgt<br />
sie heute im Durchschnitt drei bis fünf Jahre. Die Familien sind mit <strong>der</strong><br />
langwierigen <strong>und</strong> aufwändigen Pflege häufig überfor<strong>der</strong>t, gerade in <strong>der</strong><br />
letzten Lebensphase des Betroffenen. Die dabei am häufigsten genannten<br />
Probleme:<br />
• die Isolierung <strong>der</strong> Angehörigen durch die „R<strong>und</strong>-um-die-Uhr-Pflege“<br />
<strong>und</strong> durch die abschreckende Wirkung des drohenden Todesfalls auf<br />
die soziale Umgebung.<br />
• das Erleben von Schmerzen <strong>und</strong> Verfall.<br />
• Die Zahl <strong>der</strong> möglichen familiären Pflegenden <strong>und</strong> Begleiter nimmt<br />
ab. Das so genannte Pflegepotenzial, d. h. die Bereitschaft <strong>und</strong> Möglichkeit,<br />
häusliche Pflege zu übernehmen, sinkt kontinuierlich (KLIE 2006). Die<br />
familiären Netze für Schwerstkranke <strong>und</strong> Sterbende werden kleiner o<strong>der</strong><br />
zerreißen gänzlich durch folgende Entwicklungen:<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
20
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Die durchschnittliche Kin<strong>der</strong>zahl <strong>der</strong> Familien hat sich verringert <strong>und</strong><br />
damit auch das Potenzial <strong>der</strong> Hilfe. Beispiel: 1900: 4 Kin<strong>der</strong> – 1980: 1,5<br />
Kin<strong>der</strong>. Der Anteil von Ehepaaren ohne Kin<strong>der</strong> ist von knapp 34 % auf<br />
38 % angewachsen (BIB 1993).<br />
• Die Zahl <strong>der</strong> Ledigen, Verwitweten <strong>und</strong> Geschiedenen steigt. (Detaillierte<br />
Zahlen: DETTLING 1994: 69) „Die Beziehungen werden, da sie<br />
nicht mehr selbstverständlich sind, nun dünner, fragiler, mehr vom persönlichen<br />
Zutun, auch von äußeren Umständen (z. B. Ortswechsel)<br />
abhängig. (…) Der Verpflichtungscharakter <strong>der</strong> Bindungen nimmt stetig<br />
ab“ (BECK-GERNSHEIM 1994: 10).<br />
In Studien zur Arbeitsbelastung gehört die Konfrontation mit Sterben <strong>und</strong> Tod<br />
neben Zeitdruck, mangeln<strong>der</strong> Anerkennung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Aussichtslosigkeit einer<br />
Besserung bei Patienten zu den Hauptbelastungen von Pflegekräften (z. B.<br />
ZIMBER ET AL 2000; BGW 2002: 8). In einer Untersuchung von OCHSMANN<br />
hatte die Mehrzahl <strong>der</strong> Pflegekräfte höhere Angstwerte vor dem eigenen Sterben<br />
als die Normalbevölkerung (OCHSMANN 2001). In einer neueren Studie<br />
zur Sterbebegleitung in Sachsen fühlen sich 61 % <strong>der</strong> Pflegekräfte im Krankenhaus<br />
<strong>und</strong> 46 % ihrer Kollegen im Pflegeheimen stark belastet, wenn Patienten<br />
o<strong>der</strong> Bewohner sterben (KALUZA 2005: 117, 198).<br />
Konsequenzen, Chancen <strong>und</strong> Impulse: Es braucht vielgestaltige, angepasste<br />
Formen <strong>der</strong> Unterstützung, damit die Familien Kraft <strong>und</strong> Mut finden, ihre<br />
sterbenden Angehörigen zu begleiten. Außerdem müssen neue Netze einer<br />
freiwilligen Solidarität mit Schwerkranken geknüpft werden, wo Familienbindungen<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er sozialer Halt angespannt, zerrissen sind o<strong>der</strong> gänzlich<br />
fehlen.<br />
Einige <strong>der</strong> zurzeit diskutierten <strong>und</strong> verhandelten For<strong>der</strong>ungen sind:<br />
• Karenzzeiten: Der pflegende Angehörige (<strong>der</strong> Begriff schließt auch nahe<br />
stehende Personen ein) kann sich wie beim Mutterschutzurlaub eine berufliche<br />
Auszeit nehmen <strong>und</strong> nach einer bestimmten Pflegezeit wie<strong>der</strong> sicher<br />
auf seinen Arbeitsplatz zurückkehren. (ENQUETE-KOMMISSION 2005);<br />
• weiterer Aufbau nachbarschaftlicher o<strong>der</strong> hospizlicher ehrenamtlicher<br />
Netzwerke;<br />
• Integration von Palliative Care in die Gr<strong>und</strong>ausbildung von Pflegenden,<br />
Ärzten <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en in die Sterbebegleitung involvierten Berufsgruppen,<br />
verstärkte Fortbildung <strong>und</strong> Begleitung.<br />
Impuls: Wie sähe es in Ihrem familiären Netz aus, wenn Familienmitglie<strong>der</strong><br />
ernsthaft über längere Zeit krank werden würden? Wer könnte <strong>und</strong> würde<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
21
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Pflege organisieren <strong>und</strong> leisten? Würden Sie Hospizhelfer in Anspruch nehmen?<br />
Impuls: Wie könnte eine gute Vorbereitung aussehen? Was würden Sie sich<br />
als künftige Pflegekraft wünschen?<br />
5. Entwicklung:<br />
Die Trauerkultur ist verarmt – Es fehlt Verständnis für Trauer <strong>und</strong><br />
es fehlen stimmige Rituale<br />
These: Rituale, die <strong>der</strong> Trauer immer wie<strong>der</strong> Form <strong>und</strong> Ausdruck <strong>und</strong> den<br />
Trauernden Sicherheit geben können, sind verloren gegangen.<br />
Wir sind arm geworden an Ritualen des Abschieds. Sie ersparen nicht die<br />
Schmerzen, aber sie helfen dabei, sie aktiv zu durchleben. Es gibt nur noch<br />
Reste einer Trauerkultur, die sich im Wesentlichen auf die Zeit <strong>der</strong> Bestattung<br />
beschränken.<br />
Ein Beispiel: Ich nehme Sie kurz auf eine „mo<strong>der</strong>ne Beerdigung“ mit, sofern<br />
die Bestattung nicht - wie es Trend ist - anonym geschieht, d. h. ohne Anwesenheit<br />
einer Trauergemeinde. Auf dieser Beerdingung stehen Sie zunächst<br />
vor einem bereits verschlossenen Sarg, <strong>der</strong> in einer öffentlichen Aufbahrungshalle<br />
hinter einer Glasscheibe mit Kunstlicht angestrahlt wird. Einen direkten<br />
Abschied vom Verstorbenen gibt es nicht. Die Bestattungsrede ist an den<br />
Pfarrer o<strong>der</strong> Bestattungsredner delegiert. Der Trauerzug folgt dann dem Pfarrer<br />
zur Grabstelle. Die gibt es allerdings nicht im eigentlichen Sinne, weil Erdaushub<br />
<strong>und</strong> Grab mit Kunstrasen unsichtbar gemacht wurden. Nichts erinnert<br />
an Vergänglichkeit. Der Sarg bleibt aufgebockt. Auf das Hinabsenken wird<br />
verzichtet, um die Hinterbliebenen zu schonen. Nach dem Segen geht <strong>der</strong><br />
Pfarrer. Die nächste Bestattung drängt. Die Schar <strong>der</strong> Trauernden bleibt zunächst<br />
ratlos zwischen den Grabsteinen zurück <strong>und</strong> löst sich dann auf.<br />
Häufig gibt es heute eher anonymisierende, isolierende <strong>und</strong> blockierende Regeln,<br />
z. B. „stille Trauer“, „in engstem Familienkreis“, „Sich-Beherrschen“ als<br />
Ideal, schnelles Wegschaffen <strong>der</strong> Leiche usw. (vgl. CANACAKIS 1993;<br />
BÖLSKER-SCHLICHT 2005, BODE, ROTH 1999).<br />
Es fehlen den Zurückgelassenen vor allem geeignete Rituale (z. B. <strong>der</strong> Erinnerung)<br />
<strong>und</strong> die stützende Gemeinschaft für die scheinbare Ewigkeit <strong>der</strong><br />
Trauer danach. Ein Abschied kommt dabei selten allein: Angehörige verlieren<br />
nicht nur z. B. ihren Partner, son<strong>der</strong>n oft auch den Kontakt zu ihren verunsicherten<br />
<strong>und</strong> ungeduldigen Fre<strong>und</strong>en. Eine Witwe erzählt: „Zorn <strong>und</strong> Tod sind<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
22
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
in unserer Gesellschaft absolute Tabus. Wie viele Male haben Menschen mich<br />
angeschaut <strong>und</strong> gesagt: ‚Lächle’, wenn ich schon alle meine Energien aufbringen<br />
musste, um nur auf den Beinen zu bleiben? Wie viele Male fühlten<br />
sich Leute durch meine Wutausbrüche abgestoßen? Zu oft, <strong>und</strong> das lehrt mich<br />
meine Wut zu verbergen.“ (CAINE 1990: 48)<br />
Was hier am Einzelbeispiel deutlich wurde, scheint die Gesellschaft zu durchziehen.<br />
Der Trauerforscher Jorgos Canacakis klagt:<br />
„In Gesellschaften, in denen Profit, Konsum <strong>und</strong> Materielles den Vorrang vor<br />
<strong>der</strong> Menschlichkeit, Umwelt <strong>und</strong> Solidarität beanspruchen, wo Jugend,<br />
Schönheit <strong>und</strong> permanente Ges<strong>und</strong>heit bis zum Exzess propagiert werden,<br />
um Alter, Krankheit, Behin<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> das Sterben mit allen Mitteln zum Verschwinden<br />
zu bringen, ist Trauer am falschen Platz. Trauer macht ja alles kaputt.<br />
Sie zerstört unsere schöne Welt <strong>der</strong> Werbung. Sie ist wie <strong>der</strong> Elefant im<br />
Porzellanladen unserer hochtechnologischen Illusionen <strong>und</strong> Bemühungen um<br />
ein Leben ohne Ende. ‚Plastik’ ist dafür ein Symbol; es ist nicht kaputtzukriegen.<br />
(…) Plastikwelten brauchen nicht zu trauern, weil sie nicht kaputtgehen.“<br />
(Canacakis 1993: 34)<br />
Konsequenzen, Chancen <strong>und</strong> Impulse: Die Unsicherheit durch den Verlust<br />
von festen alten Ritualen kann auch als Chance gesehen werden. Wir haben<br />
die Freiheit, in <strong>und</strong> mit den Gemeinschaften, in denen wir leben <strong>und</strong> arbeiten,<br />
passende <strong>und</strong> stimmige rituelle Formen des Trauerns selbst zu entwickeln.<br />
Impuls: Haben Sie Beispiele von Ritualen, die Ihnen gefallen? Was würden<br />
Sie sich in Zeiten von Trauer an Unterstützung wünschen?<br />
Literatur zu Sterben, Tod <strong>und</strong> Trauer in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Gesellschaft<br />
ARIÈS P.: Bil<strong>der</strong> zur Geschichte des Todes. <strong>München</strong>, Wien 1984<br />
ARIÈS P.: Geschichte des Todes. 5. Aufl. dtv <strong>München</strong> 1991<br />
BAUR E. G.., SCHMID-BODE W.: Und Danach? Wie <strong>der</strong> Tod <strong>kein</strong>e Angst macht. Hoffman <strong>und</strong><br />
Campe Verlag, Hamburg 2003<br />
BODE S, ROTH F: Der Trauer eine Heimat geben. Für einen lebendigen Umgang mit dem Tod.<br />
Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1999<br />
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT HOSPIZ E. V. (Hrsg.): Hospizkultur im Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim.<br />
Indikatoren <strong>und</strong> Empfehlungen zur Palliativkompetenz. Der Hospiz Verlag, Wuppertal<br />
2006 (Bestelladresse: hospiz-verlag@t-online.de)<br />
CANAKAKIS J.: Ich sehe deine Tränen. Trauern, Klagen, Leben können. 8. Aufl., Kreuz Verlag,<br />
Stuttgart 1993<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
23
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
DER SPIEGEL: Tod: Auch mal heulen. Ein neuer Beruf entsteht: Sterbebegleiter helfen Todkranken<br />
beim Abschied vom Leben. Der Spiegel (47) 1993: 158-162<br />
ELIAS N. (1991): Über die Einsamkeit <strong>der</strong> Sterbenden. 7. Aufl., Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.<br />
M. 1991<br />
FALLER H.: Wie man in Deutschland stirbt. In: SOMMER Th. (Hrsg.): Leben in Deutschland.<br />
Anatomie einer Nation. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004: 352-363<br />
GESELLSCHAFT DES EPIDEMOLGSCHEN KREBSREGISTERS IN DEUTSCHLAND<br />
(GEKID), ROBERT KOCH-INSTITUT (Hrsg.): Krebs in Deutschland. Häufigkeiten <strong>und</strong> Trends.<br />
5. überarbeitete Ausgabe, Saarbrücken 2006<br />
GRONEMEYER R. (1990): Die Entfernung vom Wolfsrudel. Über den drohenden Krieg <strong>der</strong><br />
Jungen gegen die Alten. 3. Aufl. .. Düsseldorf 1990<br />
HELLER A.: Kultur des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende gestalten. 2. erweiterte<br />
Aufl. Lambertus, Freiburg im Br. 2000<br />
HOWE J.: Die Phasentheorie des Sterbens von Kübler-Ross. In: HOWE J. (Hrsg.): Lehrbuch<br />
<strong>der</strong> psychologischen <strong>und</strong> sozialen Alternswissenschaft. Bd. 4: Sterben – Tod – Trauer. Heidelberg<br />
1992: 54-68<br />
IMHOF A. E.: Reife des Lebens. Gedanken eines Historikers zum längeren Dasein. <strong>München</strong><br />
1988<br />
IMHOF A. E. (Hrsg.): Die Zunahme unserer Lebensspanne seit 300 Jahren <strong>und</strong> ihre Folgen.<br />
Kohlhammer, Stuttgart 1996<br />
KALUZA J., TÖPFERWEIS G.: Sterben begleiten. Zur Praxis <strong>der</strong> Begleitung Sterben<strong>der</strong> durch<br />
Ärzte <strong>und</strong> Pflegekräfte. Trafo Verlag, Berlin 2005<br />
KLASCHIK E: Entwicklung <strong>und</strong> Stand <strong>der</strong> Palliativmedizin. In: HUSEBÖ S., KLASCHIK E.<br />
(Hrsg.): Palliativmedizin. Springer, Heidelberg u.a., 2003<br />
KRUSE A.: Die Endlichkeit des Lebens. Psychologische Bewältigung von Sterben <strong>und</strong> Tod. In:<br />
SCHEIDGEN H. (Hrsg.): Die allerbesten Jahre. Thema Alter. Beltz Verlag, Weinheim, Basel<br />
1988: 135-146<br />
KRUSE A.: Wohnen im Heim. Endstation o<strong>der</strong> Lebensort? Huber Verlag, Bern 1994<br />
KRUSE A.: Das letzte Lebensjahr. Zur körperlichen, psychischen <strong>und</strong> sozialen Situation des alten<br />
Menschen am Ende seines Lebens. „. Aufl., Kohlhammer, Stuttgart 2006<br />
KÜBLER-ROSS E.: Leben bis wir Abschied nahmen. Kreuz Verlag, Stuttgart 1979<br />
KÜBLER-ROSS E.: Was können wir noch tun? Antworten auf Fragen nach Sterben <strong>und</strong> Tod<br />
KÜBLER-ROSS E.: Interviews mit Sterbenden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1983<br />
KÜBLER-ROSS E., KESSLER D.: Geborgen im Leben. Droemer Knaur Verlag 2003<br />
NAUCK F., OSTGATHE C., KLASCHIK E.: Symptoms and symptom control during the last 3<br />
days of life. European Journal of Palliative Care 7 2003: 81 ff<br />
OCHSMANN R U. A.: Sterbeorte in Rheinland-Pfalz. Zur Demographie des Todes. Mainz 1997<br />
(Reihe: Beiträge zur Thanatologie, Heft 8)<br />
OCHSMANN R.: Sorge um an<strong>der</strong>e – Sorge um sich: Burn-Out in <strong>der</strong> Altenpflege. In: Existenz<br />
<strong>und</strong> Logos. Zeitschrift für sinnzentrierte Therapie, Beratung, Bildung (2) 2001<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
24
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
PISARSKI W.: Auch am Abend wird es licht sein. Die Kunst, zu leben <strong>und</strong> zu sterben. Claudius<br />
Verlag, <strong>München</strong> 2005<br />
SCHÄFER D.: Sterben, Tod <strong>und</strong> Sterbebegleitung. Pflegedokumentation 51 (4) 1998<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Bericht Pflegestatistik 2003. Pflege im Rahmen <strong>der</strong> Pflegeversicherung.<br />
Deutschlan<strong>der</strong>gebnisse www.destatis.de/download/d/solei/bericht03deutschl,pdf<br />
15.6.05<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
25
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Basisartikel<br />
Palliativkultur entwickeln<br />
Eine Einführung in die Modellprojekte<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zukunft: Entwicklung von Palliativkompetenz im<br />
Heim<br />
In einer groß angelegten Studie zur Praxis <strong>der</strong> Sterbebegleitung in sächsischen<br />
Pflegeheimen <strong>und</strong> Krankenhäusern wurde folgende „Gewissensfrage“<br />
an die Mitarbeiter gestellt: „Sie kennen Ihr Pflegeheim/Krankenhaus selbst am<br />
besten. Wenn Sie die Bedingungen überschauen, würden Sie in Ihrem<br />
Heim/Krankenhaus sterben wollen?“ (KALUZA, TÖPFERWEIN 2005: 210 f.)<br />
Wie wäre Ihre Antwort für die Pflegeeinrichtung, in <strong>der</strong> Sie arbeiten o<strong>der</strong> die<br />
Sie kennen?<br />
Für Pflegeheime als Orte <strong>der</strong> letzten Lebensphase gehört die Sterbebegleitung<br />
immer schon zu den Kernaufgaben. Das ist nicht neu. Es gibt aber in den<br />
letzten Jahren dramatische Entwicklungen: wachsende Pflegeintensität, drastisch<br />
sinkende verbleibende Lebenszeit, Zunahme ethisch spannungsreicher<br />
<strong>und</strong> hochsensibler Entscheidungssituationen, unterbewertete Schmerztherapie<br />
<strong>und</strong> Symptomkontrolle, steigen<strong>der</strong> Anteil demenziell erkrankter Menschen,<br />
hoch belastetes Pflegepersonal, immer drücken<strong>der</strong>e For<strong>der</strong>ung nach Wirtschaftlichkeit.<br />
(Pleschberger 2005; Brüll 2005). Heime entwickeln sich zugespitzt<br />
zu „Orten <strong>der</strong> Konzentration <strong>der</strong> Unerträglichen“ (Dörner 2003; vgl. Gronemeyer<br />
2004). Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite hat sich das praktische <strong>und</strong> theoretische<br />
Wissen in Palliativpflege <strong>und</strong> -medizin deutlich erweitert.<br />
Pflegeheime sind in Not. Hospize genießen in <strong>der</strong> öffentlichen Aufmerksamkeit,<br />
aber auch in <strong>der</strong> Wahrnehmung von Pflegekräften inzwischen einen hohen<br />
Status. Geschieht dagegen in Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen ein Sterben II. o<strong>der</strong><br />
III. Klasse? (vgl. Sangathe Husebö 2003: 387) Inzwischen hat die Politik<br />
die wachsende Bedeutung <strong>und</strong> die Dringlichkeit <strong>der</strong> Palliativversorgung erkannt:<br />
„Diese palliativmedizinische <strong>und</strong> palliativpflegerische Kompetenz in die<br />
Alten- <strong>und</strong> Pflegeheime zu integrieren, wird eine <strong>der</strong> größten Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> nächsten Jahre sein.“ (Enquete-Kommission 2005: 35 f). Es ist allerdings<br />
noch offen, ob dieser politischen Mahnung auch (finanzielle) Unterstützung<br />
für die Einrichtungen folgt.<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
26
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Palliativkompetenz im Heim: 20 Fragen als Wegweiser<br />
Wann lässt sich nun von einer Hospizkultur <strong>und</strong> von Palliativkompetenz im<br />
Heim sprechen? Wie lässt sich diese unter den Bedingungen <strong>der</strong> stationären<br />
Altenpflege för<strong>der</strong>n? Die B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft (BAG) Hospiz hat dazu<br />
im November 2005 ein Arbeitspapier ihrer Fachgruppe „Hospizarbeit in Einrichtungen“<br />
verabschiedet. Es ist eine Art „Landkarte für Palliativkompetenz im<br />
Heim entstanden“. Sie basiert auf den Erk<strong>und</strong>ungen <strong>und</strong> Erfahrungen aus einer<br />
Reihe von Praxisprojekten in Heimen. In Form von 20 Fragenbündel liefert<br />
das Papier „Indikatoren <strong>und</strong> Empfehlungen für die Implementierung von Palliativkompetenz<br />
für Pflegeheime“ (BAG 2005). Die Schlüsselfragen fungieren<br />
als Wegweiser. Ich nenne einige dieser BAG-Fragen <strong>und</strong> nutze sie, um in einem<br />
kleinen Streifzug einige <strong>der</strong> Antworten aus Modellprojekten „Palliativkompetenz<br />
<strong>und</strong> Hospizkultur“ gerafft vorzustellen.<br />
Beispiel: Fragen zur Kultur <strong>und</strong> Leitung des Hauses<br />
Hat sich das Haus eine Zeit lang schwerpunktmäßig mit <strong>der</strong> Sterbe- <strong>und</strong> Abschiedskultur<br />
beschäftigt? Gibt es ein Projekt zur Implementierung von Palliative<br />
Care <strong>und</strong> Hospizidee? Wird o<strong>der</strong> wurde hausintern <strong>und</strong> schriftlich ein Text<br />
mit „Leitgedanken zur Sterbebegleitung“ entwickelt, <strong>der</strong> Auskunft gibt, welche<br />
Gr<strong>und</strong>auffassung von den Mitarbeitenden getragen <strong>und</strong> gelebt wird, wenn es<br />
um die Themen Sterben-Tod-Abschied geht? Wird o<strong>der</strong> wurde die Sterbe- <strong>und</strong><br />
Abschiedskultur <strong>der</strong> Einrichtung ausführlich im Zusammenhang erfasst <strong>und</strong><br />
benannt (Analyse <strong>der</strong> bestehenden Kultur) <strong>und</strong> auch gewürdigt?<br />
Die Implementierung von Palliativkompetenz ist - wie jede tief greifende Organisationsentwicklung<br />
- ein längerfristiger, sensibler Prozess (Laufzeit: mindestens<br />
ein bis zwei Jahre). Einige Häuser gehen in Einzelinitiative vor, an<strong>der</strong>e<br />
nutzen externe Beratung. Einige Träger, z. B. Diakonisches Werk Bayern, <strong>Caritasverband</strong><br />
<strong>München</strong> o<strong>der</strong> Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten<br />
Kreuzes, investieren inzwischen erhebliche Mittel, um Freiräume für Projektgruppen<br />
o<strong>der</strong> Qualitätszirkel in ihren Einrichtungen zu schaffen. Neben <strong>der</strong><br />
aufwändigen, intensiven, direkten Projektberatung gibt es nun auch die Variante<br />
<strong>der</strong> so genannten Projekt-Werkstatt für Träger, die „flächendeckend“ die<br />
palliative Versorgung in ihren Einrichtungen verbessern wollen: Jeweils ein<br />
Tandem, bestehend aus einer Leitungskraft <strong>und</strong> einer erfahrenen Mitarbeiterin<br />
eines Hauses, initiieren <strong>und</strong> mo<strong>der</strong>ieren eine Projektgruppe in ihrer Einrichtung<br />
<strong>und</strong> werden dabei durch die Projekt-Werkstatt mit einem einführenden<br />
Workshop <strong>und</strong> durch regelmäßige Praxisberatung in <strong>der</strong> Gruppe unterstützt.<br />
Die Modellprojekte umfassen in <strong>der</strong> Regel eine Ist/Soll-Analyse. Für die Bestandsaufnahme<br />
verwenden wir als Projektbegleiter die BAG-Fragen als Fra-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
27
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
gebogen. Die Ist-Analyse kann eingebettet in „Startveranstaltungen“ sein.<br />
Hierbei werden die MitarbeiterInnen <strong>der</strong> gesamten Einrichtung für das Projekt<br />
sensibilisiert <strong>und</strong> motiviert, die vorhandenen Anstrengungen in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
gesichtet <strong>und</strong> gewürdigt <strong>und</strong> eine gemeinsame Vision mit konkreten<br />
Verän<strong>der</strong>ungsvorgaben entwickelt (z.B. schmerztherapeutische Versorgung<br />
verbessern, ungewollte Krankenhauseinweisungen verringern, Sicherheit in<br />
<strong>der</strong> palliativen Pflege gewinnen). Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme<br />
werden in <strong>der</strong> Projektgruppe des Hauses Schritt für Schritt Leitlinien <strong>und</strong><br />
Standards entwickelt <strong>und</strong> erprobt. In den Leitlinien werden Gr<strong>und</strong>haltungen<br />
formuliert, denen sich die Mitarbeiter in <strong>der</strong> Sterbebegleitung verpflichtet fühlen,<br />
überprüfbare Ziele gesetzt <strong>und</strong> ein Spektrum von Maßnahmen genannt.<br />
Die praktischen Ideen in einem Konzept zu klammern, hat sich als hilfreich<br />
erwiesen: Die Leitlinien zur Sterbebegleitung sind ein nachprüfbares Versprechen<br />
<strong>der</strong> Einrichtung nach außen <strong>und</strong> fungieren als „Verfassung“ nach innen.<br />
Flankiert wird die Arbeit <strong>der</strong> Projektgruppe durch Informationsveranstaltungen<br />
für Bewohner, Angehörige, Ärzte <strong>und</strong> Mitarbeiter. In einer Reihe von internen<br />
Fortbildungen werden die pflegerischen, kommunikativen <strong>und</strong> persönlichen<br />
Kompetenzen <strong>der</strong> Mitarbeiter geför<strong>der</strong>t, damit die entwickelten neuen Standards<br />
auch möglichst optimal erbracht werden können. Es hat sich dabei bewährt,<br />
wenn möglichst alle Mitarbeiter eine kompakte palliative Basisschulung<br />
haben. Die Robert Bosch Stiftung hat übrigens dazu speziell für Pflegeheime<br />
ein Fortbildungsmodell „Palliative Praxis„ entwickelt. In <strong>der</strong> Beratung achten<br />
wir darauf, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch unter den Bedingungen<br />
vor Ort umsetzbar sind <strong>und</strong> nicht überfor<strong>der</strong>n. Neben interner Qualitätsverbesserung<br />
ist auch eine Vernetzung mit externen Diensten (Krankenhäuser,<br />
Hausärzten, Hospizverein) vorgesehen. Beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit richten<br />
wir im Projekt auf die „Nachhaltigkeit“, d. h. auf die Frage, über welche<br />
Möglichkeiten palliative Idee <strong>und</strong> Praxis auch über den Zeitraum eines Projektes<br />
lebendig bleiben kann.<br />
Fragen <strong>und</strong> Beispiele zu Bewohnern <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
Werden die Wünsche, Bedürfnisse <strong>und</strong> Vorstellungen <strong>der</strong> BewohnerInnen <strong>und</strong><br />
Angehörigen zu diesem Thema erfasst (z. B. beim Heimeinzug, <strong>der</strong> Beratung<br />
zur Patientenverfügung, <strong>der</strong> Dokumentation <strong>der</strong> Vorsorgevollmacht)? Werden<br />
die Ideen, Bedürfnisse <strong>und</strong> Vorstellungen aller Mitarbeiter erfasst <strong>und</strong> gewürdigt?<br />
Besteht hier Spielraum für individuelle Vorlieben, Abneigungen <strong>und</strong> Fähigkeiten?<br />
(…) Werden neue Mitarbeiter auf das Thema eingestimmt (Bewerbungsgespräch)<br />
Werden neue Mitarbeiter <strong>und</strong> Auszubildende in die Sterbegleitung<br />
<strong>und</strong> in die Abschiedskultur eingeführt?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
28
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Sterbebegleitung beginnt bereits mit dem Einzug. Das bedeutet Vorstellungen,<br />
Wünsche, Ängste möglichst frühzeitig in taktvoller Weise zu thematisieren <strong>und</strong><br />
direkt mit den Bewohnern o<strong>der</strong> – falls dieses nicht möglich – mit den autorisierten<br />
Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Natürlich muss dabei immer<br />
auch die Freiheit <strong>der</strong> Betroffenen gewahrt bleiben, hier nichts besprechen <strong>und</strong><br />
regeln zu wollen. In <strong>der</strong> Regel sind diese Gesprächsangebote willkommen <strong>und</strong><br />
werden erleichtert angenommen. Über 80% <strong>der</strong> Menschen wünschen sich<br />
rechtliche Informationen. (Deutsche Hospiz Stiftung 2005). Einige Häuser haben<br />
deshalb Mitarbeiter schulen lassen, um möglichst niedrigschwellig Bewohner<br />
<strong>und</strong> Angehörige zu <strong>der</strong>en Fragen <strong>der</strong> Vorsorge zu informieren. o<strong>der</strong><br />
sie nutzen die Expertise von kooperierenden Hospizdiensten <strong>und</strong> vermitteln<br />
spezielle Beratung o<strong>der</strong> bewährte Dokumente <strong>der</strong> Vorsorge. Eine ärztlich beratene<br />
Notfallplanung kann eine wichtige Ergänzung sein, die den Beteiligten<br />
in absehbaren Krisen Sicherheit gibt.<br />
Sterbebegleitung ist immer Teamarbeit. Auch die Kollegen, die nicht direkt am<br />
Sterbebett begleiten wollen o<strong>der</strong> können, leisten ihren Beitrag: Sie ermöglichen<br />
Kollegen, einige Minuten länger am Bett zu bleiben, weil sie <strong>der</strong>en Aufgaben<br />
außerhalb des Krankenzimmer übernehmen. Eine zentrale Frage in<br />
den meisten Projekten ist, wie mehr Zeit für Sterbebegleitung gewonnen werden<br />
kann. Die Antwort darauf ist vielschichtig <strong>und</strong> wird in Beratung <strong>und</strong> Fortbildung<br />
entwickelt: intensivere Begegnung (Qualität des Augenblicks statt<br />
Quantität), die (überhöhten) Ideale einer Sterbebegleitung überprüfen („Dauerpräsenz<br />
am Bett“, Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Leid-Problematik), interne <strong>und</strong><br />
externe Hilfen vor Ort organisieren (z. B. Kooperationen mit Sitzwachengruppen,<br />
ehrenamtlichen Hospizdiensten).<br />
Mit den neuen Ausbildungsordnungen hat sich die Pflege verjüngt. Viele Auszubildende<br />
sind unter 20 Jahre <strong>und</strong> „kennen“ Sterben nur aus dem Krimi im<br />
Fernsehen. In den Projekten werden Schritte überlegt, wie diese behutsam an<br />
verschiedene Situationen, z. B. Versorgung Verstorbener“, herangeführt werden<br />
können. Auch entlastende Teamrituale des Gedenkens sind häufig Teil<br />
<strong>der</strong> Projektinitiativen. Das kann von <strong>der</strong> einfachen „Schweigeminute“ in <strong>der</strong><br />
Übergabe bis hin zu kleinen Gedenkfeiern im Rahmen von Teamsitzungen<br />
reichen. Ein F<strong>und</strong>us von Texten <strong>und</strong> Musik vereinfacht die Gestaltung <strong>und</strong><br />
regt persönliche Beteiligung <strong>und</strong> Kreativität an.<br />
Fragen <strong>und</strong> Beispiele zu Angehörigenarbeit<br />
(…) Wie werden Angehörige <strong>und</strong> Bezugspersonen ggf. in die Sterbebegleitung<br />
einbezogen? Haben ihre Bedürfnisse dabei Gewicht?<br />
Die Einrichtung muss Initiative entwickeln, nicht <strong>der</strong> Angehörige. Die kleinen<br />
Gesten <strong>der</strong> Unterstützung sind dabei wichtig: möglichst frühzeitig ins Ge-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
29
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
spräch kommen, Ansprechpartner im Team benennen, Anleitung kleiner praktischer<br />
Hilfen, Anbieten von Essen <strong>und</strong> Trinken, unkompliziertes Bereitstellen<br />
eines Gästebetts, Ermutigen, sich auch Auszeiten zu gönnen, Ermöglichen eines<br />
Abschieds in räumlich angenehmer Atmosphäre ohne Zeitdruck (mindestens<br />
bis zu 24 Std.), Angebote für symbolisch-rituellen Abschied (symbolische<br />
Gegenstände, Bildkarten Texte, Gebete, Musik), Begleitung am Totenbett,<br />
persönliche Nachfrage <strong>der</strong> Bereichsleitung durch Karte <strong>und</strong> Anruf nach einigen<br />
Wochen, Möglichkeiten des Gedenkens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Erinnerung (z. B. Gedenkfeier).<br />
Im Kontakt mit Angehörigen ist die Gr<strong>und</strong>haltung entscheidend, mit <strong>der</strong> ihnen<br />
Pflegekräfte begegnen: Begegnung ohne moralische Beurteilung. „Angehörige<br />
sind Leidtragende <strong>und</strong> Leidende wie <strong>der</strong> Sterbende selbst.“ (Pauls 2003). Sie<br />
haben das Recht, unkooperativ zu sein. Sie haben das Recht, sich auf ihre<br />
Weise dem Unausweichlichen zu nähern (Müller 2003).<br />
Sterbebegleitung: Die Organisation ist entscheidend<br />
Bei den Antworten auf die eingangs gestellte Frage, ob Mitarbeitern sich ein<br />
Sterben in <strong>der</strong> eigenen Einrichtung vorstellen können, liefert die sächsische<br />
Studie einen doppelten Bef<strong>und</strong>: 1. Fast die Hälfte <strong>der</strong> Pflegekräfte misstraut<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung im eigenen Haus. 2. Der Grad des Vertrauens steigt, je<br />
mehr <strong>der</strong> oben genannten organisatorischen Faktoren erfüllt sind …<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
30
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übersicht: Schaubild<br />
Ein Einrichtungskonzept visualisieren<br />
Ein Beispiel für ein Hospizkonzept in Bild u.Stichworten<br />
• Seelsorgerliche Besuche<br />
• Beteiligung an Aussegnung<br />
<strong>und</strong> Gedenkfeiern<br />
• Auf Wunsch Bestattungsfeier<br />
• Hotline für Beratung<br />
bei<br />
Schmerztherapie<br />
• Erstellen von<br />
Notfallplänen<br />
• Unterstützung<br />
durch systematischeSchmerzbeobachtung<br />
(z.<br />
B. bei Demenzkranken)<br />
• Angehörigenabende<br />
zum<br />
Thema<br />
• Beson<strong>der</strong>e<br />
Gespräche<br />
zur Vorsorge<br />
• Beson<strong>der</strong>e<br />
Unterstützung<br />
in <strong>der</strong> Zeit des<br />
Sterbens <strong>und</strong><br />
Abschieds (z.<br />
B. Begleitung<br />
am Totenbett)<br />
• Abschiedsbuch<br />
• Große halbjährlicheGedenkfeier<br />
• Dreistufige Fortbildung: Basiskompetenzen für alle Mitarbeiter (z. B. „Pflege in <strong>der</strong><br />
terminalen Phase“ , Basiswissen Schmerztherapie, Schmerzbeobachtung bei<br />
Demenzkranken, Gr<strong>und</strong>haltung Begleitung)<br />
• ,Training für beson<strong>der</strong>e Situationen(z. B. Begleitung am Totenbett <strong>und</strong> spezielle<br />
Vertiefung von Palliative-Cae-Kräften<br />
• Palliative-Care-Fachkräfte im Team mit klarem Aufgabenprofil (Aufgaben u.a.: Beratung<br />
<strong>und</strong> Anleitung von KollegInnen)<br />
• Beson<strong>der</strong>e zeitliche Absprachen für die Sterbebegleitung<br />
• Einarbeitungskonzept „Sterbebegleitung“ für Auszubildende<br />
• Monatliches Abschiedsritual im Team in Gedenken an Verstorbene<br />
• Bei belastenden Todesfällen Supervision möglich<br />
• Konzept entwickelt mit Leitgedanken <strong>und</strong> Standards<br />
• Projektgruppe tagt regelmäßig<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
• Liefern geeiste o<strong>der</strong> angedickte Hilfen für<br />
die M<strong>und</strong>pflege<br />
• Sorgen für Blumenschmuck <strong>und</strong> Utensilien<br />
im Trauerkorb (Z. B. Karten, Kerzen)<br />
• Sind geschult im Verhalten in <strong>der</strong> terminalen<br />
Phase (z. B. bei Zimmerreinigung)<br />
• Vereinbarung: mindestens<br />
24 Std. Aufbahrungszeit<br />
• Ansprechen<strong>der</strong> Abschiedsraum<br />
mit gestaltetem Flur<br />
(„Baum des Lebens“)<br />
• Überführung mit letzten Geleit<br />
durch HL/PDL <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
• Kooperation mit Hospizverein<br />
FFB<br />
• Koordination über Hospizbeauftragte<br />
• Angebot von Gesprächen<br />
zur Vorsorge<br />
• Informationen <strong>und</strong> Hilfen<br />
beim Erstellen von Patientenverfügungen<br />
• Thema Sterben auch in<br />
Gesprächsgruppen („Beschäftigung“)<br />
• Symbole des Gedenkens<br />
(Trauerflor)<br />
• Wand des Gedenkens<br />
31
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Literatur zu Palliativkultur im Pflegeheim<br />
Alsheimer, M.; Stich, V. (2005): Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen. Pilotprojekt zur Palliativversorgung<br />
im ambulanten Bereich. Bayreuth: Bayerische Stiftung Hospiz (Arbeitshilfen 6)<br />
Alsheimer, M.; Schmidt, D. (2006): Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben. Projekt zur<br />
Palliativversorgung im Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim. Erscheint voraussichtlich im Dezember 2006.<br />
Bayreuth: Bayerische Stiftung Hospiz<br />
BAG – B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz e. V. (2005): Hospizkultur im Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim.<br />
Indikatoren <strong>und</strong> Empfehlungen zur Palliativkompetenz<br />
Brüll, H.-M. (2005): Sterbebegleitung im Heim. Eine qualitative Erk<strong>und</strong>ungsstudie zur Situation<br />
<strong>und</strong> zu Werteeinstellungen von Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern in <strong>der</strong> stationären Altenhilfe.<br />
Schriften des Instituts für Bildung <strong>und</strong> Ethik, Nr. 4. Weingarten: Pädagogische Hochschule<br />
Weingarten<br />
Deutsche Hospiz Stiftung (11/2005): Wie denken die deutschen über die Patientenverfügung<br />
(http://www.hospize.de/ftp/tns_studie_05.pdf)<br />
Dörner, K. (2003): „Ein gelungenes Leben bedarf <strong>der</strong> Last“ (Interview). Die Zeit, 06.03.2003 (11)<br />
Enquete-Kommission „Ethik <strong>und</strong> Recht <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Medizin“ des Deutschen B<strong>und</strong>estages.<br />
Zwischenbericht, 22.06.05. (www.dgpalliativmedizin.de>>Downloads)<br />
Gronemeyer, R. (2004): Kampf <strong>der</strong> Generationen. <strong>München</strong>: DVA<br />
Heimerl, K.; Heller, A.; Kittelberger, F. (2005): Daheim sterben. Palliative Kultur im Pflegeheim.<br />
Freiburg: Lambertus<br />
Heimerl, K.; Heller, A.; Zepke, G.; Zimmermann-Seitz, H. (2000): Individualität organisieren –<br />
OrganisationsKultur des Sterbens. Ein interventionsorientiertes Forschungs- <strong>und</strong> Beratungsprojekt<br />
des IFF mit <strong>der</strong> DiD. In: Heller, A. et al. (Hg.) (2000): Wenn nichts mehr zu<br />
machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 2. Aufl., Freiburg:<br />
Lambertus, 39-73<br />
Heller, A.; Heimerl, K.; Metz, Ch. (Hg.) (2000): Kultur des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende<br />
gestalten. 2. erw. Aufl., Freiburg im Br.: Lambertus<br />
Heller, A.; Heimerl, K.; Berlach-Pobitzer, I. (2002): Leben bis zuletzt. Palliativbetreuung in den<br />
Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen <strong>der</strong> Inneren Mission <strong>München</strong>. Bewohnerbefragung im Alten- <strong>und</strong><br />
Pflegeheim Ebenhausen. Dokumentation. Wien: IFF<br />
Heller, A.; Dinges, S.; Heimerl, K.; Reitinger, E.; Wegleitner, K. (2003): Palliative Kultur in <strong>der</strong><br />
stationären Altenhilfe. Zeitschrift für Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie 36, 360-365<br />
Husebö, S.; Klaschik, E. (2003): Palliativmedizin. Praktische Einführung in Schmerztherapie,<br />
Ethik <strong>und</strong> Kommunikation. 3. Aufl., Berlin; Heidelberg; New York: Springer<br />
Kaluza, J.; Töpferwein, G. (2005): Sterben begleiten. Zur Praxis <strong>der</strong> Sterbebegleitung durch<br />
Ärzte <strong>und</strong> Pflegende. Eine empirische Studie. Berlin: trafo verlag<br />
Kojer, M. (Hg.) (2002): Alt, krank <strong>und</strong> verwirrt. Einführung in die Praxis <strong>der</strong> Palliativen Geriatrie.<br />
Freiburg im Br.: Lambertus<br />
Lilie, U. (2004): Zur Implementierung <strong>der</strong> Hospizidee in Krankenhäuser <strong>und</strong> Einrichtungen <strong>der</strong><br />
Altenhilfe. In: Lilie, U.; Zwierlein, E. (2004): Handbuch integrierte Sterbebegleitung. Gütersloh:<br />
Gütersloher Verlagshaus, 45-49<br />
Müller, M.; Kessler, G. (2000) (Hg.): Implementierung von Hospizidee <strong>und</strong> Palliativmedizin in die<br />
Struktur <strong>und</strong> Arbeitsabläufe eines Altenheimes. Bonn: Pallia Med Verlag<br />
Müller, M. (2004): Dem Sterben Leben geben. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus<br />
Orth, Ch.; Alsheimer, M. (2005): „… Nicht sang- <strong>und</strong> klanglos gehen.“ Abschlussbericht über die<br />
Implementierungsphase von palliativer Versorgung <strong>und</strong> Hospizidee im Alten- <strong>und</strong> Pflege-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
32
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
heim Leonhard-Henninger-Haus, <strong>München</strong>. Bayreuth: Bayerische Stiftung Hospiz (Arbeitshilfen<br />
5)<br />
Pauls, C. (2003): Perspektivenerweiterung: Die Würde <strong>der</strong> Angehörigen am Sterbebett. Vortrag<br />
im Deutschen Ethikrat (www.chrispaul.de/artikel.html)<br />
Pleschberger, S. (2005): Nur nicht zur Last fallen. Sterben in Würde aus <strong>der</strong> Sicht alter Menschen.<br />
Freiburg im Br.: Lambertus<br />
Reitinger, E.; Heller, A.; Tesch-Römer, C.; Zeman, P. (2004): Leitkategorie Menschenwürde.<br />
Zum Sterben in stationären Pflegeeinrichtungen. Freiburg im Br.: Lambertus<br />
Sangathe Husebö, B.: (2003): Palliativmedizin in <strong>der</strong> Geriatrie. Wie alte, schwer kranke Menschen<br />
leben <strong>und</strong> sterben. In: Husebö, S.; Klaschik, E. (2003): Palliativmedizin. Praktische<br />
Einführung in Schmerztherapie, Ethik <strong>und</strong> Kommunikation. 3. Aufl., Berlin; Heidelberg; New<br />
York: Springer<br />
Wilkening, K.; Kunz, R. (2003): Sterben im Pflegeheim. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
33
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Qualitätskontrolliertes Sterben?<br />
Zur Diskussion um Qualität <strong>und</strong> Standards in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
Hinweis zur Verwendung::<br />
Begrifflichkeiten wie „Management, Standards, Qualität“ in Verbindung mit<br />
„Sterbebegleitung“ provozieren verständlicherweise Wi<strong>der</strong>stände. Der Beitrag<br />
begründet zunächst, warum Sterbebegleitung nicht nur eine zwischenmenschliche,<br />
son<strong>der</strong>n auch eine organisatorische Herausfor<strong>der</strong>ung ist. Natürlich gibt<br />
es die Gefahr <strong>der</strong> technischen Deformierung von Standards. Um diesen Risiko<br />
zu begegnen, formulieren wir Ansprüche an „Standards“ in <strong>der</strong> Sterbebegleitung.<br />
Der Beitrag soll Sie in Ihrer Argumentation unterstützen, wenn es darum geht,<br />
Verständnis den organisatorischen Rahmen für eine gelingende Sterbebegleitung<br />
zu wecken. Gleichzeitig können Sie mit Hilfe <strong>der</strong> Maßstäbe die gesammelten<br />
Arbeitshilfen dieses Ordners, aber auch das entwickelte eigene Material<br />
prüfen.<br />
Die so genannte „Gewissensfrage“ in einer groß angelegten Studie zur Praxis<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung in sächsischen Pflegeheimen <strong>und</strong> Krankenhäusern lautete<br />
wie folgt: „Sie kennen Ihr Pflegeheim/Krankenhaus selbst am besten.<br />
Wenn Sie die Bedingungen überschauen, würden Sie in Ihrem<br />
Heim/Krankenhaus sterben wollen?“ (KALUZA, TÖPFERWEIN 2005: 210 f.)<br />
Das Ergebnis: Je weiter entfernt die Befragten von <strong>der</strong> konkreten Pflegesituation<br />
in <strong>der</strong> jeweiligen Einrichtung arbeiten, umso höher ist <strong>der</strong>en Zustimmung.<br />
Während nur knapp die Hälfte <strong>der</strong> Pflegekräfte in Heimen <strong>und</strong> nur etwas mehr<br />
als ein Drittel des Pflegepersonals in Krankenhäusern sich ein Sterben in <strong>der</strong><br />
eigenen Einrichtung vorstellen können, bejahen Pflegedienstleitungen (63%<br />
Heim, 48% Krankenhaus) <strong>und</strong> Einrichtungsleiter (75% Heim, 57% Krankenhaus)<br />
diese Frage deutlicher. Die Untersuchung zeigt einen weiteren interessanten<br />
Zusammenhang: Je besser bestimmte Situationen <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
organisiert sind, umso stärker ist die Bejahung bei <strong>der</strong> „Gewissensfrage“.<br />
Die zitierte <strong>und</strong> eine ganze Reihe weiterer Studien zur Situation <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
in Einrichtungen legen nahe, dass Sterbebegleitung nicht nur als zwi-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
34
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
schenmenschliche Begegnung o<strong>der</strong> persönliche Erfahrung zu sehen ist, son<strong>der</strong>n<br />
– wie es die ENQUETE-KOMMISSION ETHIK UND RECHT DER<br />
MODERNEN MEDIZIN (2005) formuliert - auch als eine beson<strong>der</strong>e organisatorische<br />
„Herausfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zukunft“ begriffen werden muss.<br />
„Wir leben in einer Gesellschaft von Organisationen. Wesentliche gesellschaftliche<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen – wie z. B. Bildung, Ges<strong>und</strong>heit o<strong>der</strong> Recht – werden<br />
in Organisationen bearbeitet. Wir leben aber nicht nur in Organisationen, wir<br />
sterben auch dort. Im deutschsprachigen Raum sterben bis zu 80% <strong>der</strong> Menschen<br />
in einer Institution – im Krankenhaus o<strong>der</strong> im Pflegeheim. Die Umsetzung<br />
des Konzeptes <strong>der</strong> Palliative Care greift in die Strukturen <strong>und</strong> Entscheidungen,<br />
in die Normen <strong>und</strong> Werte <strong>der</strong> Organisationen ein <strong>und</strong> verän<strong>der</strong>t sie.<br />
(…) Organisationen lernen an<strong>der</strong>s als Personen. Personen lernen beispielsweise<br />
in Fortbildungen, Organisationen lernen über Entscheidungen <strong>und</strong> über<br />
neue o<strong>der</strong> verbesserte Kommunikationsstrukturen. Ein zentrales Instrument<br />
für das Lernen von Organisationen sind Projekte …“ 1<br />
„Qualitätskontrolliertes Sterben …“ Der Giessener Soziologe <strong>und</strong> Theologe<br />
Reimer Gronemeyer schüttelt sich bei <strong>der</strong> Vorstellung, dass nun auch das<br />
Sterben unter Qualitätsgesichtspunkten gestellt wird 2 Darf Sterbebegleitung<br />
„standardisiert“ werden? Der Versuch, Sterbebegleitung in Leitgedanken, Ziele<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen zu fassen, mag zunächst befremden. „O Herr, gib jedem<br />
seinen eigenen Tod; das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe<br />
hat, Sinn <strong>und</strong> Not ..“ 3 , betet Rilke Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts angesichts des<br />
„mo<strong>der</strong>nen“ einheitlich geregelten Ablebens <strong>und</strong> <strong>der</strong> unpersönlichen Sterbebegleitung<br />
in den großen Spitälern. Dieses Verständnis von Standard <strong>und</strong> diese<br />
Form <strong>der</strong> Standardisierung wäre auch für uns ein Alptraum. 4<br />
Sterben ist <strong>und</strong> bleibt ein individueller Prozess. Wir behaupten <strong>und</strong> formulieren<br />
mit unseren verschiedenen Standards <strong>kein</strong>e Rezepte wie Sterbebegleitung<br />
abzulaufen hat. 5 Was wir schaffen wollen ist ein verlässlicher Rahmen von<br />
1 HEIMERL K., HELLER A., PLESCHBERGER S.: Implementierung <strong>der</strong> Palliative Care im Überblick.In:<br />
KNIPPING C. (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. Mit einem Geleitwort von Reimer Gronemeyer. Verlag Hans<br />
Huber, Bern 2006, S. 55<br />
2 Vgl. zu dieser Horrorvorstellung eines „Qualitätskontrollierten Sterbens“; GRONEMEYER R.: Die späte Institution.<br />
Das Hospiz als Fluchtburg. In: GRONEMEYER R., LOEWY E.: Wohin mit den Sterbenden. Hospize<br />
in Europa. Ansätze zu einem Vergleich. LIT Verlag, Münster 2002: 143<br />
3 RILKE R. M.: Das St<strong>und</strong>enbuch. Das Buch von <strong>der</strong> Armut <strong>und</strong> dem Tode. 1903<br />
4 Siehe zur Qualitätsdiskussion: HÖVER G.: Neue Herausfor<strong>der</strong>ungen für die Qualitätssicherung in <strong>der</strong><br />
Hospiz- <strong>und</strong> Palliativarbeit. Die Hospiz-Zeitschrift (3), 2003: 4-7. GRAF G., ROSS, J.: Brauchen wir Qualitätssicherung<br />
in <strong>der</strong> Hospizarbeit? Die Hospiz-Zeitschrift (3), 2003, 14-17<br />
5 Wir teilen das Verständnis von Adelheid von Stoesser. Siehe: STÖSSER A. v.: Pflegestandards. Erneuerung<br />
<strong>der</strong> Pflege durch Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Standards. 3. erweiterte <strong>und</strong> überarbeitete Auflage, Springer Verlag,<br />
Berlin 2003<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
35
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Kommunikation <strong>und</strong> palliativpflegerischer Qualität. „Was Qualität ist, weiß <strong>der</strong><br />
Patient am besten.“ 1 Dieser Rahmen soll einerseits möglichst viel an Individualität<br />
des Sterbenden <strong>und</strong> an Kommunikation <strong>der</strong> Betroffenen ermöglichen<br />
<strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits den Mitarbeitern in <strong>der</strong> Pflege <strong>und</strong> den kooperierenden Ärzten<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Unterstützung geben. Wir organisieren <strong>und</strong> ermöglichen<br />
somit Möglichkeiten, aber <strong>kein</strong>e Zwinglichkeiten! Unsere Standards verstehen<br />
wir als „wissensbasierte Problemlösungen“ 2<br />
Unsere Ansprüche an palliative Standards<br />
Damit sind drei Ansprüche o<strong>der</strong> Prinzipien für das Entwickeln von Standards<br />
verb<strong>und</strong>en:<br />
• Die Standards müssen in ihren Zielen <strong>und</strong> Inhalten begründet werden <strong>und</strong><br />
nachvollziehbar sein. Entsprechend knüpfen wir jeweils in den Einführungen<br />
Begründungszusammenhänge <strong>und</strong> liefern in Info-Blöcken o<strong>der</strong> in<br />
Klammern Details zu Handlungsempfehlungen, wo uns dies für das bessere<br />
Verständnis notwendig erscheint.<br />
• Die Standards sollen ethisch vertretbare Evaluierungswege <strong>der</strong> Qualität<br />
zeigen. 3 Deshalb legen wir bei den entwickelten <strong>und</strong> gesammelten Standards<br />
Wert auf überprüfbare Zielformulierungen <strong>und</strong> Anregungen für die<br />
Bewertung aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Betroffenen <strong>und</strong> Beteiligten.<br />
• Und: Sie sollen Denken <strong>und</strong> Kommunikation in <strong>der</strong> Situation anregen,<br />
nicht abschalten! In vielen Standards geben wir entsprechende Impulse<br />
für das Gespräch o<strong>der</strong> für die Schärfung <strong>der</strong> Wahrnehmung. Die wichtigste<br />
Vorbeugung gegen ein starres Verständnis von Standards ist Kommunikation.<br />
Unter diesen Maximen haben wir in verschiedenen Projekten Standards zu<br />
Schlüsselfragen entwickelt. Die beson<strong>der</strong>s gelungenen <strong>und</strong> anregenden haben<br />
wir in diesem Begleitordner zusammengestellt. Er ist insofern ein echtes,<br />
lebendiges Gemeinschaftswerk. Es wächst durch die Praxis stetig von Projekt<br />
zu Projekt. 4<br />
1 HEILMANN B.: Umbau des Wohlfahrtssystems. Hospiz als Vorreiter? In: GRONEMEYER R., LOEWY E.<br />
H. (Hrsg.): Wohin mit den Sterbenden. Hospize in Europa. Ansätze zu einem Vergleich. LIT Verlag, Münster<br />
2003, S. 71<br />
2 BARTOLOMEYCZIK S.: Sinn <strong>und</strong> Unsinn von Pflegestandards. Heilberufe (5), 2002: 12-16. DIES.: Pflegestandards<br />
kritisch betrachtet. Die Schwester / Der Pfleger (10), 1995: 888-892<br />
3 HERRLEIN P.: Qualität <strong>und</strong> Lebbarkeit. Die Hospiz-Zeitschrift (3), 2003: 18 f.<br />
4 Hier werden Sie zusätzlich fündig, wenn Sie auf <strong>der</strong> Suche nach Standards <strong>und</strong> Leitlinien sind:<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
36
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Dieses Handbuch für die Projekt-Werkstatt Implementierung nimmt natürlich<br />
nicht die Mühen des Weges ab, eigene Kultur(standards) zu entwickeln. Aber<br />
es liefert einen „Rucksack anregen<strong>der</strong> Beispiele“. Wir haben die Dokumente<br />
deshalb weitgehend in <strong>der</strong> Konkretisierung für die jeweilige Einrichtung belassen,<br />
in denen die Standards entwickelt <strong>und</strong> auf die sie zugeschnitten wurden<br />
(z. B. Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Verantwortlichkeiten o<strong>der</strong> Regelungen für die<br />
Dokumentation im System <strong>der</strong> Einrichtung). Die Übertragbarkeit muss sowieso<br />
im Detail geprüft werden. Transfer ist immer ein Prozess <strong>der</strong> Anpassung<br />
<strong>und</strong> Umwandlung für die die eigene Praxis vor Ort.<br />
Wichtige Gr<strong>und</strong>sätze palliativer Standards<br />
Die Leitlinien <strong>und</strong> Standards entfalten <strong>und</strong> konkretisieren jeweils palliatives<br />
<strong>und</strong> hospizliches Denken, das von folgenden Gr<strong>und</strong>sätzen getragen ist:<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> ganzheitlichen Versorgung <strong>und</strong> Begleitung <strong>der</strong> Betroffenen<br />
mit ihren physischen, psychischen, sozialen <strong>und</strong> spirituellen Belangen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> interdisziplinären Arbeit in multiprofessionellen Teams<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> berufs- <strong>und</strong> bereichsübergreifenden Kooperation<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Orientierung an den Bedürfnissen <strong>und</strong> am Willen <strong>der</strong> Betroffenen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Einbeziehung Angehöriger als beson<strong>der</strong>s Betroffene mit ihrem<br />
jeweils eigenen erleben<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Einbeziehung von Ehrenamtlichen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> fachlichen <strong>und</strong> haltungsmäßigen Vorbereitung, Begleitung<br />
<strong>und</strong> Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung aller Mitarbeiter<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> nachgehenden Trauerbegleitung 1<br />
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT HOSPIZ V. V., DEUTSCHER CARITASVERBAND E.V.,<br />
DIAKONISCHES WERK DER EVANG. KIRCHE DEUTSCHLANDS: Sorgsam. Qualitätshandbuch für stationäre<br />
Hospize. Der Hospiz Verlag, Wuppertal 2004<br />
GRAF G.: Schritte zur Hospiarbeit in <strong>der</strong> stationären Altenhilfe aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Geschäftsführung. In: Die<br />
Hospiz-Zeitschrift (23) 2005<br />
MÜLLER M., KESSLER G.: Implementierung von Hospizidee <strong>und</strong> Palliativpflege in die Struktur <strong>und</strong> Arbeitsabläufe<br />
eines Altenheimes. Eine Orientierungs- <strong>und</strong> Planungshilfe. Pallia Med Verlag, Bonn 2000<br />
ORTH C., ALSHEIMER M. U.A.: „… nicht sang- <strong>und</strong> klanglos gehen“. Abschlussbericht zur Implementierung<br />
<strong>der</strong> Hospizidee im Leonhard-Henninger-Haus <strong>der</strong> Inneren Mission <strong>München</strong>. Heft 5 <strong>der</strong> Arbeitshilfen<br />
<strong>der</strong> Bayerischen Stiftung Hospiz (www.bayerische-stiftung-hospiz.de)<br />
ALSHEIMER M., STICH V. U. A.: Vernetzte Sterbebegleitung im ambulanten Bereich. Eine Handreichung<br />
(nicht nur) für Sozialstationen. Heft 6 <strong>der</strong> Arbeitshilfen <strong>der</strong> Bayerischen Stiftung Hospiz (www.bayerischestiftung-hospiz.de)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
37
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Was heißt nun Versorgungsqualität am Lebensende? Fünf Aspekte erweisen<br />
sich nach Forschungsergebnissen aus <strong>der</strong> Sicht von Patienten <strong>und</strong> Bewohnern<br />
als zentral 2 :<br />
• „Angemessene Schmerz- <strong>und</strong> Symptombehandlung<br />
• Vermeidung unangemessener Verlängerung des Lebens<br />
• Herstellung eines Gefühls von Kontrolle (darüber, was entschieden wird.<br />
M.A.)<br />
• Schadensabwendung von Angehörigen<br />
• Stärkung <strong>der</strong> Beziehung von Angehörigen“<br />
Aus diesen Wünschen haben wir in inhaltlichen Variationen die Ziele in den<br />
Standards abgeleitet. Es sind kommunikative Ziele, denn was konkret „angemessen“<br />
o<strong>der</strong> „unangemessen“, „Kontrolle“ o<strong>der</strong> „Schadensabwendung“ <strong>und</strong><br />
„Stärkung“ bedeuten, entscheiden die Betroffenen. Das muss immer wie<strong>der</strong><br />
erk<strong>und</strong>et, beraten, verhandelt o<strong>der</strong> begründet vermutet werden.<br />
Verbürgen <strong>und</strong> verbessern unsere Standards wirklich letztendlich Qualität?<br />
Darüber können letztendlich nur die verschiedenen Betroffenen <strong>und</strong> Beteiligten<br />
– Schwerkranke, Angehörige, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Ärzte – Auskunft<br />
geben.<br />
1 Vgl. die Zusammenstellung von Gr<strong>und</strong>sätzen u. a. bei HEIMERL K., HELLER A., KITTELBERGER F.:<br />
Daheim sterben. Palliative Kultur im Pflegeheim. Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau 205, S. 20 f.<br />
2 SINGER P., BOWMAN K.: Versorgungsqualität am Lebensende. Eine globale Herausfor<strong>der</strong>ung. In:<br />
EWERS M., SCHAEFFER D. (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung <strong>und</strong> Pflege von Menschen in <strong>der</strong><br />
letzten Lebensphase. Verlag Hans Huber, Bern 2005,S. 23<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
38
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
2<br />
Arbeitshilfen für den<br />
Projekt-Prozess<br />
39
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
40
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Thesen<br />
7 Empfehlungen für die<br />
Implementierung<br />
Bedingungen für eine erfolgreiche Projektarbeit<br />
Hinweise zur Entstehung <strong>und</strong> Verwendung::<br />
Was scheint für den Erfolg einer Implementierung hilfreich? In den folgenden<br />
sieben Merksätzen o<strong>der</strong> Thesen fassen wir Erfahrungen zusammen, die wir<br />
durch Erfolge <strong>und</strong> Irrtümer in unserer Projektarbeit <strong>der</strong> letzten Jahre gewonnen<br />
haben.<br />
Sie können die Hinweise für die Reflexion ihre Planung verwenden: Werden<br />
die einzelnen Empfehlungen im Projekt aufgegriffen? Wenn ja: wie?<br />
1. Mitarbeiterorientierung: Im Mittelpunkt das Personal! Dieses muss das<br />
Projekt tragen <strong>und</strong> umsetzen können. Deshalb stehen die Mitarbeiter mit<br />
ihren Erfahrungen, Überlegungen, Befürchtungen, Haltungen <strong>und</strong> Wünschen<br />
im Zentrum <strong>der</strong> Befragung <strong>und</strong> des Austausches. Die verschiedenen<br />
Mitarbeitergruppen, Positionen <strong>und</strong> Arbeitsbereiche müssen gut in <strong>der</strong><br />
Projektgruppe vertreten sein. Das Konzept soll <strong>kein</strong> unerfüllbarer Wunschzettel<br />
werden.<br />
2. Realistisch bleiben: Entlasten statt Belasten durch das Projekt! Die<br />
beabsichtigten Vorgaben <strong>und</strong> Maßnahmen müssen geprüft werden, ob sie<br />
unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen wirklich tragbar sind. Der vorübergehende<br />
Aufwand, den ein Projekt immer mit sich bringt, muss überschaubar<br />
<strong>und</strong> akzeptabel sein.<br />
3. Wertschätzung: Ausgangspunkt unserer Arbeit ist die jeweilige Kultur<br />
des Hauses! Die bisherigen Leistungen, das persönliche Engagement,<br />
die gelebten Traditionen <strong>und</strong> Standards müssen gewürdigt <strong>und</strong> ins Bewusstsein<br />
gerückt werden, bevor Ergänzendes o<strong>der</strong> Neues entwickelt<br />
werden darf.<br />
4. Anstöße von außen – Verwandlung von innen: Oft ist es leichter, innerhalb<br />
<strong>der</strong> Organisation etwas zu bewegen, wenn neutrale Berater den Prozess<br />
mo<strong>der</strong>ieren <strong>und</strong> Vorschläge einbringen.<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
41
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
5. Motivation: Auf zügige <strong>und</strong> konkrete erste Erfolge achten! Aus den<br />
anstehenden Aufgaben wählen wir in <strong>der</strong> Regel zunächst diejenigen aus,<br />
die eine schnelle Umsetzung versprechen. Rasche spürbare Erfolge erhöhen<br />
Ausdauer <strong>und</strong> Durchhaltevermögen für längerfristige <strong>und</strong> schwierigere<br />
Prozesse.<br />
6. Entscheidend: Rückendeckung durch Träger <strong>und</strong> Leitung: Der Wille<br />
<strong>und</strong> die Beteiligung <strong>der</strong> Leitungskräfte ist notwendig, damit das Projekt auf<br />
allen Ebenen <strong>und</strong> in allen Bereichen Eingang findet <strong>und</strong> die finanziellen<br />
<strong>und</strong> personellen Ressourcen dafür gesichert sind. Vorbildfunktion!<br />
7. Transparenz: Bedeutung, Schritte <strong>und</strong> Ergebnisse müssen immer erkennbar<br />
sein für Mitarbeiter, Bewohner o<strong>der</strong> Patienten, Angehörige,<br />
Ärzte! Das Verständnis für das Projekt wird in einer Reihe vorbereiten<strong>der</strong><br />
o<strong>der</strong> flankieren<strong>der</strong> Info-Veranstaltungen <strong>und</strong> Fortbildungen gesichert.<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
42
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Ein Projekt im Heim präsentieren 1<br />
Zusammenfassung eines Projektes für die PR-Arbeit<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Wie lässt sich ein Projekt knapp vorstellen? Das nachfolgende Beispiel des Alten-<br />
<strong>und</strong> Pflegeheim Neuburg a. d. Donau liefert Ihnen Formulierungshilfen<br />
<strong>und</strong> Textbausteine für die Präsentation des eigenen Projektes.<br />
Unter dem Leitmotiv „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben - Palliativkultur<br />
im Altenheim St. Augustin Neuburg a.d.D. haben wir Anfang 2005 ein<br />
Projekt in unserem Haus gestartet. „Zuhause“ bedeutet für uns, dass Bewohnerinnen<br />
unseres Hauses gerade in <strong>der</strong> letzten Lebensphase - in ihrer Krankheit<br />
<strong>und</strong> im Sterben -<br />
• ein hohes Maß an selbst bestimmter Lebensgestaltung <strong>und</strong> unterstützter<br />
Entscheidungsfreiheit ermöglicht wird <strong>und</strong><br />
• sie dabei das Gefühl wertschätzen<strong>der</strong> Beziehung, Geborgenheit <strong>und</strong> Intimität<br />
erleben.<br />
Inspiriert wurden wir bei diesem Projekt von <strong>der</strong> Hospizbewegung mit ihren<br />
ambulanten <strong>und</strong> stationären Einrichtungen. Diese hat bei <strong>der</strong> Sterbe- <strong>und</strong><br />
Trauerbegleitung Pionierarbeit geleistet. Insbeson<strong>der</strong>e unter dem Titel „Palliative<br />
Care o<strong>der</strong> auf Deutsch: Palliativversorgung“ wurden in den letzten Jahren<br />
wertvolle Erkenntnisse <strong>und</strong> Erfahrungen gesammelt. Palliative Care ist ein beson<strong>der</strong>er<br />
Ansatz, den wir in unserem Haus verankern: Es bezeichnet eine umfassende<br />
<strong>und</strong> angemessene Versorgung Schwerkranker <strong>und</strong> Sterben<strong>der</strong> sowie<br />
ihrer Angehörigen in Krankheit, im Sterben <strong>und</strong> nach dem Tod. Palliative<br />
Care befasst sich mit optimaler Schmerz- <strong>und</strong> Symptomkontrolle <strong>und</strong> achtet<br />
auf alles, was die individuelle Lebensqualität sichert o<strong>der</strong> erhöht. Palliative Care<br />
verkörpert eine beson<strong>der</strong>e Gr<strong>und</strong>haltung: Sterben wird als Teil des Lebens<br />
begriffen; es wird we<strong>der</strong> beschleunigt noch gegen den Willen des Betroffenen<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“, Pflegeheim <strong>der</strong> Bamherzigen<br />
Brü<strong>der</strong>, St. Augustyn Neuburg a.d.D., Franziskaner Str. B 127, 86633 Neubug a.d.Donau, Projektleitung:<br />
Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dora Schmidt (PDL)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
43
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
verlängert. Palliative Care ist immer kooperativ <strong>und</strong> interdisziplinär angelegt.<br />
Sie versucht zum Wohle des Betroffenen alle notwendig Beteiligten über Berufs-<br />
o<strong>der</strong> Bereichsgrenzen hinweg zu vernetzten.<br />
Wie sieht die Integration dieser Idee in unserem Haus bisher praktisch aus?<br />
Wir orientieren uns im Projekt an den Indikatoren zur „Palliativkompetenz im<br />
Heim“ <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz. Unter <strong>der</strong> Projekt-Beratung von<br />
Martin Alsheimer vom Kompetenzzentrum für Palliative Care (Gemeinnützige<br />
Gesellschaft für soziale Dienste, Nürnberg) haben wir zunächst in großen Auftaktveranstaltungen<br />
eine Ist-Analyse durchgeführt. Seit März 2005 entwickeln<br />
wir in einer siebenköpfigen, hoch motivierten <strong>und</strong> engagierten Projektgruppe<br />
Leitlinien <strong>und</strong> eine Reihe hilfreicher Standards, wie die Sterbe- <strong>und</strong> Trauerbegleitung<br />
zukünftig aussehen soll. Neue Standards sind z.B.: Individuelle Lebensqualität<br />
erfassen, Informieren über Patientenverfügung, Krisenvorsorge<br />
<strong>und</strong> Notfallplanung, Kooperation mit Hospizverein, Schmerzbeobachtung bei<br />
demenziell erkranken Menschen, pflegerische Hilfen bei Schmerzen, Atemnot,<br />
Obstipation usw., Anleitung von Auszubildenden <strong>und</strong> mehr<br />
Eine Beson<strong>der</strong>heit: Alle MitarbeiterInnen des Hauses (Pflege, Verwaltung,<br />
Hauswirtschaft) wurden in einer kompakten, jeweils zweitägigen Fortbildung<br />
auf die Pflege <strong>und</strong> die psychosoziale Unterstützung Sterben<strong>der</strong> vorbereitet. Es<br />
gibt also zukünftig in unserem Haus ein einheitliches Verständnis zu den<br />
Problemen, Möglichkeiten <strong>und</strong> Aufgaben in <strong>der</strong> Sterbebegleitung <strong>und</strong> Pallativversorgung.<br />
Den pflegerischen Teil <strong>der</strong> Schulung hat Frau Angelika Plößl übernommen,<br />
die den ambulanten Palliativberatungsdienst des Vincenz-<br />
Hospizes in Augsburg leitet. Den psychosozialen Part vermittelte Herr Alsheimer.<br />
Die interne Fortbildung hatte sehr gute Resonanz. In einem weiteren<br />
gemeinsamen Fort-bildungstag wird 2006 die Arbeit mit den Standards geübt<br />
werden, so dass diese optimal erbracht werden können. Eine Mitarbeiterin absolviert<br />
zudem einen umfangreichen Basiskurs Palliative Care, um die Kolleginnen<br />
in Zweifels- <strong>und</strong> Konfliktfällen gut beraten zu können. Neben <strong>der</strong> internen<br />
Qualitätsverbesserung ist auch eine Vernetzung mit externen Diensten<br />
(Krankenhäuser, Hausärzten) vorgesehen. Der Hospizverein hat uns bereits<br />
seine Unterstützung zugesagt, ein Fortbildungsangebot für Hausärzte zur<br />
„Schmerztherapie im Alter“ ist geplant.<br />
Beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit richten wir im Projekt auf die Angehörigen <strong>und</strong><br />
unsere Abschiedskultur. Zurzeit gestalten wir mit <strong>der</strong> Künstlerin Ruth Borisch<br />
einen neuen Aufbahrungsraum, <strong>der</strong> als „Oase des Abschieds“ den Angehörigen<br />
die so wichtigen letzte „Begegnung“ mit dem Verstorbenen in einer warmen<br />
Atmosphäre ermöglichen soll. Für diesen Umbau haben wir um finanzielle<br />
Unterstützung geworben. Bereits jetzt gibt es auf je<strong>der</strong> Etage kleine Konso-<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
44
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
len als „Erinnerungsaltäre“ für aktuell Verstorbene. Ende November fand eine<br />
Gedenkfeier für die Menschen statt, die in diesem Jahr im Haus verstorben<br />
sind. Auch MitarbeiterInnen, die jemanden aus ihrer Familie betrauern, waren<br />
eingeladen. In einer kleinen Zeremonie mit Meditation, Musik <strong>und</strong> Texten wurden<br />
von fast 50 Angehörigen eindrucksvoll Erinnerungen gesammelt, Dankbarkeiten<br />
ausgedrückt, aber auch eventuell noch Belastendes formuliert. Verhin<strong>der</strong>te<br />
Angehörige konnten uns Fürbitten zuschicken. Je<strong>der</strong> Verstorbenen<br />
wurde mit Namen <strong>und</strong> einer Kerze gedacht. Ermutigt durch die überaus positiven<br />
Reaktionen werden wir künftig jedes Jahr zu diesem Ritual einladen.<br />
Das gesamte Projekt wird großzügig durch die Bayerische Stiftung Hospiz geför<strong>der</strong>t.<br />
Aber nicht nur das Geld war wichtig. Entscheidend ist die Motivation<br />
<strong>der</strong> MitarbeiterInnen. Es war <strong>und</strong> ist spürbar: Die MitarbeiterInnen tragen das<br />
Projekt. Wir sind zuversichtlich: Im St. Augustin entsteht eine gemeinsame<br />
Palliativkultur, die auch wirklich gelebt wird!<br />
Dora Schmidt (Pflegediensteiterin), Martin Alsheimer (Projektbegleiter)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
45
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiel<br />
Ein Projekt in <strong>der</strong> Sozialstation präsentieren<br />
1<br />
Zusammenfassung für die PR-Arbeit<br />
Hinweis zur Verwendung::<br />
Wie lässt sich ein Projekt knapp vorstellen? Das nachfolgende Beispiel <strong>der</strong><br />
Kath.-Evang. Sozialstation Füssen liefert Ihnen Formulierungshilfen <strong>und</strong> Textbausteine<br />
für die Präsentation eines eigenen Projektes.<br />
Unter dem Leitmotiv „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben - Palliativkultur<br />
im Altenheim St. Augustin Neuburg a.d.D. haben wir Anfang 2005 ein<br />
Projekt in unserem Haus gestartet. „Zu Die Implementierung von Palliative Care<br />
in bestehende, „gewachsene“ Einrichtungen ist immer ein längerfristiger,<br />
sensibler Prozess (Laufzeit des Projektes: 08/2003 bis 05/2005).<br />
Das Projekt umfasste eine Ist/Soll-Analyse. Sie war eingebettet in eine so genannte<br />
„Start-Veranstaltungen“. Durch sie wurden die Mitarbeiter für das Projekt<br />
motiviert, gleichzeitig wurde die vorhandene Kultur <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
<strong>der</strong> Sozialstation gewürdigt <strong>und</strong> eine erste Vision <strong>der</strong> künftigen Formen <strong>der</strong><br />
Sterbebegleitung entworfen.<br />
Ausgehend von dieser gewonnenen Bestandsaufnahme <strong>und</strong> Vision entwickelte<br />
<strong>und</strong> erprobte seit 11/2003 eine Projektgruppe Schritt für Schritt Leitlinien<br />
<strong>und</strong> detaillierte Standards für eine vernetzte Sterbebegleitung. (z.B. Organisation<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung im Team, Symptomkontrolle in <strong>der</strong> Terminalphase<br />
usw.)<br />
Die Projektgruppe war interdiszipinär besetzt. Es gehörten zu ihr:<br />
• ein Internist des Krankenhauses Füssen mit palliativmedizinischer Zusatzausbildung<br />
• die Einsatzleiterin <strong>und</strong> die Leiterin <strong>der</strong> örtlichen Hospizgruppe,<br />
• die Geschäftsführerin <strong>und</strong> eine <strong>der</strong> PDLs <strong>der</strong> Sozialstation<br />
• 10 Mitarbeiter aus ambulanter Pflege <strong>und</strong> Kurzzeitpflege<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein<br />
Ostallgäu e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika<br />
Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
46
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• ein Mo<strong>der</strong>ator (pädagogischer Leiter <strong>der</strong> Palliative-Care-Fortbildung <strong>der</strong><br />
GGSD)<br />
Punktuell wurden Vertreter aller genannten beteiligten Institutionen zu dieser<br />
Arbeit hinzugezogen, z.B. Geistliche <strong>der</strong> beiden Konfessionen. Flankiert wurde<br />
die Projektarbeit durch Informationsveranstaltungen <strong>und</strong> Pressearbeit für<br />
Angehörige <strong>und</strong> eine interessierte Öffentlichkeit <strong>und</strong> durch Fortbildungen für<br />
Hausärzte <strong>und</strong> Pflegekräfte an<strong>der</strong>er Dienste.<br />
Das Herzstück des Projektes<br />
In mehreren internen Fortbildungen <strong>und</strong> einem abschließenden „Planspiel“<br />
schulten wir die pflegerischen, kommunikativen <strong>und</strong> persönlichen Kompetenzen<br />
aller Pflegekräfte <strong>der</strong> Sozialstation, damit die entwickelten Standards optimal<br />
erbracht werden können (z.B. Rollenspiele Krisengespräch, Basiswissen<br />
Schmerztherapie). Wir können feststellen: (Fast) alle Mitarbeiter <strong>der</strong> Sozialstation<br />
Füssen <strong>und</strong> <strong>der</strong> integrierten Kurzzeitpflege haben diese Basisschulung<br />
durchlaufen. Palliative Care ist so zum gemeinsamen Verständnis geworden.<br />
In geson<strong>der</strong>ten Gesprächen mit einer Krankenkasse wurden die Möglichkeiten<br />
ausgelotet, wie bei Bedarf unkompliziert <strong>der</strong> Hausarzt durch den Palliativmediziner<br />
des Krankenhauses beraten werden kann.<br />
Beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit wurde auf die „Nachhaltigkeit“ gelegt: Bereits im<br />
Projekt wurden Verfahren geschaffen, die auch nach Abschluss das Konzept<br />
sichern, fortlaufend evaluieren <strong>und</strong> anpassen helfen. Wir sind uns deshalb sicher:<br />
Was entwickelt wurde bleibt auch lebendig.<br />
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ gibt sich in ihrer Reihe „Leben in Deutschland“<br />
2004 euphorisch: „Palliativ ist ein schönes Wort. Hell <strong>und</strong> klar steht es, wenn<br />
einer Glück hat, am Ende einer unheilbaren Krankheit. Und verspricht Lin<strong>der</strong>ung,<br />
wenn Heilung nicht mehr möglich ist. ... Die häusliche Betreuung<br />
schwerstkranker Patienten ist eine Revolution des Sterbens in Deutschland,<br />
wie sie zuletzt in den fünfziger Jahren stattfand, als Intensivmediziner das Leben<br />
in vitale Funktionen aufteilen <strong>und</strong> dies apparativ ersetzen.“<br />
Unser Modell-Projekt will <strong>und</strong> wird dafür sorgen, dass in unserer Region die<br />
ambulante Palliativersorgung in <strong>der</strong> Sterbebegleitung nicht nur „Glücksfall“<br />
bleibt, son<strong>der</strong>n zum „Regelfall“ wird. Ein gutes Stück haben wir für unseren<br />
Bereich bereits geschafft. Wir hoffen auf Nachahmung <strong>und</strong> Verbreitung.<br />
Martin Alsheimer (Projektberater)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
47
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Schritte <strong>der</strong> Implementierung planen<br />
Sieben notwendige Stufen <strong>und</strong> Aufgaben im Projekt<br />
Hinweise zur Entstehung <strong>und</strong> Verwendung::<br />
Welche Etappen gibt es bei <strong>der</strong> Implementierung? Das Stufenschema nennt<br />
typische Entscheidungen <strong>und</strong> Aufgaben, die im Projekt auf Sie zukommen.<br />
Die Stufen folgen einer gewissen Planungslogik, sind aber nicht als strenges<br />
<strong>und</strong> zwingendes Nacheinan<strong>der</strong> zu verstehen. Sie müssen die Treppe als<br />
Ganzes im Blick haben <strong>und</strong> im Projektprozess flexibel auf <strong>und</strong> ab steigen.<br />
Zum Beispiel: Sie können schon zu einem frühen Zeitpunkt darauf achten, wie<br />
Sie die Nachhaltigkeit auch über den zeitlichen Projektrahmen hinaus sichern.<br />
O<strong>der</strong>: Das Interesse von Mitarbeitern könnte auch zunächst über Fortbildungen<br />
geweckt werden, die im Bild <strong>der</strong> Treppe erst auf Stufe vier vorgesehen<br />
sind. O<strong>der</strong>: Die Leitlinien werden erst zu einem späten Zeitpunkt formuliert,<br />
um bereits Vorhandenes <strong>und</strong> neu Entwickeltes zu beschreiben <strong>und</strong> in die Fassung<br />
eines Einrichtungskonzeptes zu bringen. O<strong>der</strong>: Das Ausprobieren in <strong>der</strong><br />
Praxis zwingt Sie dazu, über eine geplante Maßnahme in <strong>der</strong> Projektgruppe<br />
noch einmal gründlich nachzudenken …<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
48
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stufen Aufgaben<br />
Das Netz stetig verbessern, Bewährtes an an<strong>der</strong>e weitergeben:<br />
Die Weiterentwicklung des Konzeptes in <strong>der</strong> Einrichtung zukünftig sichern<br />
(= Lebendige Palliativkultur“), Unterstützung an<strong>der</strong>er Einrichtungen<br />
durch die Veröffentlichung <strong>der</strong> Ergebnisse (= Handreichung)<br />
Das neue Netz ausprobieren:<br />
Entworfene Standards im pflegerischen Alltag umsetzen, Zwischenbilanzen<br />
<strong>und</strong> Erfolgskontrollen machen 6<br />
Das Netz nach außen erweitern <strong>und</strong> verankern:<br />
5<br />
Mit an<strong>der</strong>en Diensten die Zusammenarbeit regeln<br />
Das Netz nach innen verstärken <strong>und</strong><br />
mit vielen Händen halten<br />
Alle MitarbeiterInnen ins Boot nehmen 4<br />
Ein tragfähiges Netz<br />
entwerfen:<br />
Das Konzept entwickeln 3<br />
Das vorhandene<br />
Netz prüfen / Vision:<br />
Ist/Soll-Analyse<br />
Vorbereiten<br />
1<br />
2<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
7<br />
• Erfahrungen<br />
einholen<br />
• Konsequenzen<br />
• Organisatorische <strong>und</strong><br />
persönliche Verbindungen<br />
gezielt<br />
verbessern<br />
• Notwendiges Wissen<br />
schulen<br />
• Entworfene Standards im gesamten<br />
Team diskutieren<br />
• Vorschläge aus dem Team einflechten<br />
• Notwendiges Wissen <strong>und</strong> Können schulen<br />
(= Fortbildungen)<br />
• Leitlinien ausformulieren<br />
• Vorhandene Standards überprüfen <strong>und</strong> verbessern<br />
• Neue Standards entwickeln<br />
• Auf Umsetzbarkeit (zeitlich, personell) überprüfen<br />
• Einzelne Elemente im Kleinen erproben<br />
• Systematisch <strong>und</strong> umfassend bisherige Praxis reflektieren <strong>und</strong> würdigen:<br />
Womit sind wir zufrieden? Was belastet uns organisatorisch / persönlich?<br />
• Zukunftsbild „Sterbebegleitung“ entwerfen (= Elemente für Leitlinien):<br />
• Daraus Arbeitsprogramm für Projektgruppe ableiten<br />
• Themen für Fortbildungsprogramm entsprechend abstimmen<br />
• Mögliche Träger <strong>und</strong> Beteiligte sensibilisieren, ihre Bereitschaft erk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> wenn notwendig<br />
für Projekt motivieren<br />
• Finanzierung des Projektes sichern,<br />
• Zeitrahmen <strong>und</strong> Schritte abstecken, Projektgruppe gründen<br />
• Instrumente des Projektes (z.B. Projektgruppe, Fortbildungen) klären<br />
49
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
50
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Projektablauf planen 1<br />
50 Aktionen im Überblick<br />
Hinweise zur Entstehung <strong>und</strong> Verwendung::<br />
Wie sehen die Projektstufen <strong>und</strong> –aufgaben praktisch aus? Die Übersicht<br />
sammelt die verschieden kleinen <strong>und</strong> großen Aktionen, die im Projekt Füssen<br />
„Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen …“ durchgeführt worden sind, in das Raster<br />
<strong>der</strong> sieben Stufen.<br />
Sie erhalten dadurch einen Eindruck von <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Maßnahmen <strong>und</strong> vielleicht<br />
auch die eine o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Idee für Ihre Planung.<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein<br />
Ostallgäu e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika<br />
Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
51
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
2003 2004 2005<br />
Juli -<br />
Sept.<br />
Projekt-<br />
1<br />
beschreibung<br />
Gespräche<br />
mit Sozialministerium<br />
Okt. -<br />
Dez.<br />
Palliativ-<br />
Kurs A1<br />
Schulung<br />
<strong>der</strong> Projektgr.<br />
Projektgr.<br />
1 Treffen<br />
Entwurf <strong>der</strong><br />
Leitlinien<br />
Ist-Analyse<br />
im Team<br />
<strong>und</strong> im Palliativ-Kurs<br />
A1<br />
Arbeitsprogamm<br />
Bildung<br />
<strong>der</strong> Projektgr.<br />
Gespräche<br />
mit KH +<br />
ärztl. KV<br />
Pressearb.<br />
Jan. -<br />
März<br />
Vorstellen<br />
im Dekanatsrat<br />
Öffentl.<br />
Vortrag<br />
Palliativpflege<br />
Palliativ-<br />
Kurs A2<br />
Schulung<br />
<strong>der</strong> Projektgr.<br />
Projektgr.<br />
„Hausaufgaben“<br />
Projektgr.<br />
2 Treffen<br />
Presse-<br />
Artikel<br />
Benefizkonzert<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
April –<br />
Juni<br />
Palliative<br />
Praxis:<br />
Erprobung<br />
von Standards<br />
Fortbild.<br />
Schmerztherapie<br />
mit<br />
Dr. Biensack<br />
Gespräch<br />
Hausärzte<br />
Palliativ-<br />
Kurs B1<br />
Schulung<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Mitarbeiter<br />
Projektgr.<br />
3. + 4.<br />
Treffen<br />
Leitlinien<br />
<strong>und</strong> Standards<br />
Gespräche<br />
mit gerontopsychiatrischen<br />
Fachdienst<br />
Juli<br />
Sept.<br />
Projektgr.<br />
5. Treffen<br />
Redaktion<br />
des Gesamtkonzeptes<br />
Palliative<br />
Praxis:<br />
Erprobung<br />
von Standards<br />
Palliativ-<br />
Kurs B2<br />
Gäste:<br />
Seelsorger<br />
Verhandlung<br />
AOK<br />
Palliativ-<br />
Kurs B2<br />
Schulung<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Mitarbeiter<br />
Projektgr.<br />
5. Treffen<br />
ZusammenarbeitHospizverein<br />
Okt. -<br />
Dez.<br />
Projektgr.<br />
6. Treffen<br />
Redaktion<br />
des Gesamtkonzeptes<br />
Vortrag für<br />
pflegende<br />
Angehörige<br />
Projektgr.<br />
6 Treffen<br />
Absprachen<br />
mit Krankenhaus<br />
Teambesprechung<br />
zu neu entwickelten<br />
Standards<br />
Projektgr.<br />
6. Treffen<br />
Nacharbeit<br />
zu einzelnenStandards<br />
Jan. -<br />
März<br />
Präsentation<br />
auf<br />
AltenpflegeKongress<br />
Feierlicher<br />
Abschluss<br />
Planspiel +<br />
Besprechung<br />
<strong>der</strong><br />
Standards<br />
für alle Mitarbeiter<br />
Einführung<br />
des palliativärztlichenKonsiliardienstes<br />
April –<br />
Juni<br />
Vorbereitung<br />
<strong>der</strong><br />
Veröffentlichung<br />
Juli<br />
Sept.<br />
Veröffentlichung<br />
Bayer.<br />
Stiftung<br />
Hospiz<br />
52
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ideen<br />
Finanzielle Ressourcen entdecken<br />
Ideen für materielle <strong>und</strong> finanzielle Ressourcen <strong>und</strong><br />
Sponsoring 1<br />
Hinweise zur Entstehung <strong>und</strong> Verwendung::<br />
Ein Projekt braucht auch finanzielle Ressourcen. Vielleicht soll <strong>der</strong> Aufbahrungsraum<br />
verän<strong>der</strong>t werden, vielleicht braucht es beson<strong>der</strong>e Investitionen in<br />
Fortbildungen, die das vorgesehene Budget übersteigen. Die folgenden Ideen<br />
<strong>und</strong> Aktionen waren bereits erfolgreich. Die praktische Sammlung stammt aus<br />
einer Projekt-Werkstatt <strong>der</strong> RKS.<br />
• Briefe an Bestatter vor Ort (Siehe Musterbrief)<br />
• Berufsschule macht Duftlampen für Aufbahrungsraum (Idee Rosenheim)<br />
• Schulklassen <strong>der</strong> Altenpflege gestalten Räumlichkeiten (Beispiel Aschaffenburg, preisgekrönt,)<br />
• Pflegeschulen gestalten Textsammlungen für Abschiedsraum (Beispiel Martin Alsheimer<br />
Ingolstadt)<br />
• Lokaler Künstler ansprechen für die Gestaltung von Abschiedsräumen<br />
• Vernissage mit Bil<strong>der</strong>verkauf für Palliativprojekt<br />
• Studenten-Projekte (z. B. Journalistik-Studiengänge o<strong>der</strong> Schulen)<br />
• Angehörige spenden zweckgeb<strong>und</strong>en für Projekt<br />
• Hospizvereine för<strong>der</strong>n Fortbildung; gemeinsame Fortbildung planen<br />
• Lionsclub o<strong>der</strong> Rotary-Club gewinnen<br />
• För<strong>der</strong>töpfe für Sozialsponsoring oft bei Kommunen vorhanden <strong>und</strong> erfahrbar<br />
• För<strong>der</strong>verein gründen, um Spenden zu sammeln<br />
• Stiftungen in <strong>der</strong> Region suchen (CD beim Sozialministerium, Frau Weigand)<br />
• Flohmarkt, Basare mit Leuten von außen (z. B. Projekt „Zeit für Helden“) veranstalten<br />
(Standgebühren)<br />
• Konfirmanten-Spende; Pfarrer auf Projekt hinweisen<br />
• Benefizkonzert (z. B. mit lokalen Gesangsvereinen, Musikgruppen)<br />
• Angehörigenabende durch Schulklassen von Pflegeschulen gestalten lassen<br />
• Fußballvereine ansprechen<br />
1 Entwickelt in <strong>der</strong> Projekt-Werkstatt: „Hospizkultur <strong>und</strong> Palliativkompetenz entwickeln“ PW 0606,<br />
Sozial-Servicegesellschaft des BRK 2006 - 2007, Kursleitung: Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Frank<br />
Kittelberger (IMM), TN: 22 Vertreter von Pflegeheimen <strong>der</strong> RKS, Protokoll: Coaching-Tage am 14./15.06.07<br />
in Ettal<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
53
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ideen<br />
Um Unterstützung werben 1<br />
Strategien <strong>und</strong> Argumentationshilfen für die Einführung<br />
des Projektes<br />
Hinweise zur Entstehung <strong>und</strong> Verwendung::<br />
Ein Projekt stoßen oft auf Wi<strong>der</strong>stände. Die folgenden Vermutungen zu möglichen<br />
Ursachen <strong>und</strong> Motiven wurden aus verschiedenen Rollenspielen gewonnen.<br />
Sie können als Anregung dienen, wie Sie behutsam mit typischen Wi<strong>der</strong>ständen<br />
umgehen können.<br />
Hintergr<strong>und</strong>-Ängste Strategien <strong>und</strong> Argumentationshilfen<br />
Angst:<br />
„Was kommt auf uns zu?“<br />
(Unübersichtlichkeit des Aufwandes)<br />
Angst:<br />
Es wird noch mehr in den Zeitrahmen<br />
gestopft<br />
Projekt kann als Abwertung <strong>der</strong> bisherigen<br />
Sterbebegleitung aufgefasst<br />
werden.<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Übersicht über den ungefähren Zeitrahmen <strong>und</strong><br />
Aufwand geben<br />
Kontrolle geben: „Alles wird erst im Kleinen ausprobiert.“<br />
„Es wird nichts eingeführt, das Mitarbeitern<br />
nicht tragbar o<strong>der</strong> erfüllbar erscheint.“<br />
Fragen stellen, was sich die Beteiligten erhoffen.<br />
Das gemeinsame Ziel betonen<br />
Konkrete Entlastungen aufzeigen, z. B, Kooperationen<br />
mit Hospizhelfern<br />
Gefühl <strong>der</strong> Gemeinsamkeit för<strong>der</strong>n: Es gab in <strong>der</strong><br />
Vergangenheit öfter den Wunsch, unsere Sterbebegleitung<br />
zu verbessern. Jetzt haben wir endlich<br />
die Gelegenheit dazu.<br />
Versprechen: Wir versuchen, das Thema in unseren<br />
bisherigen Besprechungsrahmen einzubauen.<br />
Vermeiden: wi<strong>der</strong>ständige Kollegen bloß zu stellen<br />
(provoziert Rache)<br />
Bei starkem Wi<strong>der</strong>stand Gespräch vertagen <strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> bei einem passen<strong>der</strong> Gelegenheit auf einzelne<br />
KollegInnen zugehen. „Ich hätte Dich gerne dabei<br />
… Was wäre Dir möglich?<br />
1 Entwickelt in <strong>der</strong> Projekt-Werkstatt: „Hospizkultur <strong>und</strong> Palliativkompetenz entwickeln“ PW 0606,<br />
Sozial-Servicegesellschaft des BRK 2006 - 2007, Kursleitung: Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Frank<br />
Kittelberger (IMM), TN: 22 Vertreter von Pflegeheimen <strong>der</strong> RKS, Protokoll: Coaching-Tage am 14./15.06.07<br />
in Ettal<br />
54
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Sterbebegleitung: Ist-Zustand<br />
analysieren (Pflegeheim)<br />
20-Punkte-Check mit Schlüsselfragen<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Wie können Sie zusammen mit den Mitarbeitern die Abschiedskultur Ihrer Einrichtung<br />
erfassen <strong>und</strong> würdigen? Wir haben Schlüsselfragen zu einem Check<br />
zusammengefasst. Der Fragebogen ermöglicht einen differenzierten Blick auf<br />
den bestehenden organisatorischen Rahmen <strong>der</strong> Sterbebegleitung in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Einrichtung. Gleichzeitig wird über die Fragen sichtbar, welche Aspekte<br />
für eine umfassende Palliativ- o<strong>der</strong> Hospizkultur noch wichtig sein können.<br />
Sie können den Fragebogen in Teamsitzungen o<strong>der</strong> Startveranstaltungen für<br />
ein Projekt einsetzen. Die Fragen ließen sich auch mit Wertungen zum Ankreuzen<br />
kombinieren (z. B. „Die Frage finde ich wichtig“ „Hier sollten wir intensiv<br />
nachdenken <strong>und</strong> neue Regelungen finden“ usw.) o<strong>der</strong> mit Skalen, auf denen<br />
die Zufriedenheit mit <strong>der</strong> Praxis in <strong>der</strong> Einrichtung erfasst werden kann<br />
(„Ist bereits sehr gut verwirklicht“ - - - - - „Braucht dringend eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
o<strong>der</strong> Verwirklichung“). Die Teilnehmer können z. B. in Partnerarbeit o<strong>der</strong><br />
Kleingruppen die Fragen durchgehen <strong>und</strong> sich gegenseitig berichten, ob es für<br />
sie organisatorische Antworten auf diese Fragen gibt <strong>und</strong> wenn ja, welche. Sie<br />
machen sich dabei als Erinnerungshilfen Notizen auf den Fragebogen. Eventuell<br />
bewerten die Teilnehmer die Fragen jeweils nach ihrer Bedeutung <strong>und</strong> ihrer<br />
Zufriedenheit mit <strong>der</strong> organisatorischen Lösung vor Ort (z. B. in Form von<br />
Schulnoten).<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
55
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1. Blickpunkt Träger/Leitung: Gibt es ein schriftliches Konzept o<strong>der</strong> Leitlinien<br />
<strong>der</strong> Sozialstation zur Sterbebegleitung? Wenn ja: Ist dieses o<strong>der</strong> sind<br />
diese den Mitarbeitern bekannt? Wird das Konzept von allen Mitarbeitern<br />
getragen? Macht es Aussagen darüber, wann Sterbebegleitung beginnt<br />
<strong>und</strong> was sie alles umfasst? Ist das Konzept verständlich <strong>und</strong> mit konkreten<br />
Maßnahmen verb<strong>und</strong>en?<br />
2. Wird das Thema Sterbegleitung in Prospekten/Heimmedien (z. B. Heimzeitung)<br />
angesprochen? Wenn ja: wie?<br />
3. Blickpunkt Bewohner: Werden (gezielt) Informationen über Wünsche<br />
o<strong>der</strong> Vorstellungen zur letzten Lebensphase gesammelt? Wenn ja: wie?<br />
Werden diese Wünsche gesichert (z. B. durch Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,<br />
Notfallplanung)? Werden Bedürfnisse von demenziell erkrankten<br />
Menschen für die Sterbebegleitung beson<strong>der</strong>s ermittelt? Wenn<br />
ja: wie?<br />
4. Werden Bewohner bei Lebensbewältigung, Lebenskrisen, Lebensrückschau<br />
beson<strong>der</strong>s unterstützt? Wenn ja: wie? (Beispiel: Biografiearbeit)<br />
Gibt es beson<strong>der</strong>e Verfahren für demenziell erkrankte Menschen, die die<br />
Mitarbeiter dabei anwenden? Wenn ja: welche? (Beispiel: Validation)<br />
5. Blickpunkt Angehörige: Werden Angehörige vorbereitet <strong>und</strong> in die Sterbebegleitung<br />
gezielt einbezogen <strong>und</strong> unterstützt? Wenn ja: wie?<br />
6. Werden Angehörige beim Abschiednehmen von Verstorbenen unterstützt?<br />
Wenn ja: wie?<br />
7. Blickpunkt: Ärzte: Wird die schmerztherapeutische Versorgung <strong>und</strong> die<br />
Behandlung quälen<strong>der</strong> Symptome gesichert? Wenn ja: wie? Gibt es beratende<br />
Unterstützung, wenn <strong>der</strong> behandelnde Hausarzt an Grenzen kommt<br />
(z. B. „Hotline Schmerzbertung“, Palliativ- Beratungsdienst u.ä.)<br />
8. Wird bei Entscheidungen (z. B. PEG-Versorgung) fachlich, ethisch <strong>und</strong><br />
rechtlich verantwortbar <strong>und</strong> nachvollziehbar verfahren? Wenn ja: wie?<br />
Wird für absehbare Krisen <strong>und</strong> Komplikationen <strong>und</strong> für Notfälle Vorsorge<br />
getroffen <strong>und</strong> das Verfahren miteinan<strong>der</strong> abgestimmt (z. B. „Run<strong>der</strong><br />
Tisch“)? Wenn ja: wie?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
56
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
9. Blickpunkt Mitbewohner: Gibt es für Mitbewohner in Zwei- o<strong>der</strong> Mehrbettzimmern<br />
beson<strong>der</strong>e Regelungen in <strong>der</strong> Sterbephase o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Zeit<br />
nach dem Versterben eines Bewohners? Wenn ja: welche?<br />
10. Werden Mitbewohner beim Abschiednehmen unterstützt? Wenn ja: wie?<br />
11. Blickpunkt Bestatter: Werden Verstorbene im Haus aufgebahrt? Wenn<br />
ja: wie? Gibt es dafür einen beson<strong>der</strong>en Raum? Wenn ja: Sind dieser <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Zugang zu ihm ansprechend gestaltet? Wenn ja: wie?<br />
12. Sind <strong>der</strong> Transfer von Verstorbenen durch die Pflegekräfte im Haus, die<br />
Einsargung <strong>und</strong> die Überführung durch den Bestatter würdig gestaltet?<br />
Wenn ja: wie?<br />
13. Blickpunkt Seelsorge: Ist die Zusammenarbeit mit Seelsorgern in <strong>der</strong><br />
Sterbebegleitung gut geregelt (z. B. Angebote seelsorglicher [seelsorglich<br />
o<strong>der</strong> seelsorgerisch]Begleitung, Art <strong>und</strong> Weise <strong>der</strong> Vermittlung durch Pflegekräfte)?<br />
Wenn ja: wie? Welche Formen von Seelsorge begreifen Pflegekräfte<br />
als ihre Aufgabe? Sind sie darauf vorbereitet?<br />
14. Blickpunkt Hauswirtschaft: Gibt es eine Einbindung <strong>der</strong> hauswirtschaftlichen<br />
Mitarbeiter in die Sterbebegleitung? Wenn ja: wie? Sind diese gut<br />
darauf vorbereitet? Wenn ja: wie?<br />
15. Blickpunkt ehrenamtliche Kräfte (z. B. Hospizhelfer): Haben ehrenamtliche<br />
Kräfte im Heim Bedeutung? Wenn ja: welche? Sind die ehrenamtlichen<br />
Kräfte ausreichend auf die beson<strong>der</strong>e Begleitung Sterben<strong>der</strong> im<br />
Heim vorbereitet? Ist die Kooperation klar <strong>und</strong> für alle Seiten befriedigend<br />
geregelt (z. B. Form <strong>und</strong> Umfang <strong>der</strong> Mitarbeit, Art <strong>der</strong> Einsätze, Einbindung<br />
<strong>und</strong> Akzeptanz im Team, Verfahren bei Konfliktfällen, Ansprechpartner<br />
im Heim, Formen <strong>der</strong> Anerkennung <strong>und</strong> Begleitung <strong>der</strong> ehrenamtlichen<br />
Helfer)? Wenn ja: wie?<br />
16. Blickpunkt Pflegekräfte: Praktizieren die Pflegekräfte in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
beson<strong>der</strong>e pflegerische Maßnahmen? Wenn ja: welche? Sind<br />
Pflegekräfte dafür beson<strong>der</strong>s vorbereitet worden (z. B. durch Fortbildungen<br />
in Palliative Care)?<br />
17. Wird Zeit für die Sterbebegleitung organisiert? Wenn ja: wie? Gibt es für<br />
die Sterbebegleitung beson<strong>der</strong>e Absprachen im Team? Wenn ja: welche?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
57
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
18. Wird Pflegekräften Raum <strong>und</strong> Zeit für ihre Gefühle in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
gegeben? Wenn ja: wie? Wie werden auftretende Reaktion von Vorgesetzten<br />
<strong>und</strong> Kollegen bewertet? Gibt es Angebote <strong>der</strong> Entlastung (z. B. Rituale)?<br />
Wenn ja. Welche?<br />
19. Werden neue Mitarbeiter <strong>und</strong> Auszubildende herangeführt <strong>und</strong> angeleitet<br />
bei <strong>der</strong> Sterbebegleitung? Wenn ja: wie? Ist Sterben, Tod, Trauer Thema<br />
in Bewerbungsgesprächen? Wenn ja: in welcher Form?<br />
20. Werden im Heim Formen <strong>der</strong> Erinnerung <strong>und</strong> des Gedenkens an Verstorbene<br />
gepflegt? Wenn ja: welche?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
58
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Sterbebegleitung: Ist-Zustand<br />
analysieren 1 (Sozialstation)<br />
Ein 20-Punkte-Check mit Schlüsselfragen<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Wie können Sie zusammen mit den Mitarbeitern die Abschiedskultur Ihrer Einrichtung<br />
erfassen <strong>und</strong> würdigen? Wir haben Schlüsselfragen zu einem Check<br />
zusammengefasst. Der Fragebogen ermöglicht einen differenzierten Blick auf<br />
den bestehenden organisatorischen Rahmen <strong>der</strong> Sterbebegleitung in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Einrichtung. Gleichzeitig wird über die Fragen sichtbar, welche Aspekte<br />
für eine umfassende Palliativ- o<strong>der</strong> Hospizkultur noch wichtig sein können.<br />
Sie können den Fragebogen in Teamsitzungen o<strong>der</strong> Startveranstaltungen für<br />
ein Projekt einsetzen. Die Fragen ließen sich auch mit Wertungen zum Ankreuzen<br />
kombinieren (z. B. „Die Frage finde ich wichtig“ „Hier sollten wir intensiv<br />
nachdenken <strong>und</strong> neue Regelungen finden“ usw.) o<strong>der</strong> mit Skalen, auf denen<br />
die Zufriedenheit mit <strong>der</strong> Praxis in <strong>der</strong> Einrichtung erfasst werden kann<br />
(„Ist bereits sehr gut verwirklicht“ - - - - - „Braucht dringend eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
o<strong>der</strong> Verwirklichung“). Die Teilnehmer können z. B. in Partnerarbeit o<strong>der</strong><br />
Kleingruppen die Fragen durchgehen <strong>und</strong> sich gegenseitig berichten, ob es für<br />
sie organisatorische Antworten auf diese Fragen gibt <strong>und</strong> wenn ja, welche. Sie<br />
machen sich dabei als Erinnerungshilfen Notizen auf den Fragebogen. Eventuell<br />
bewerten die Teilnehmer die Fragen jeweils nach ihrer Bedeutung <strong>und</strong> ihrer<br />
Zufriedenheit mit <strong>der</strong> organisatorischen Lösung vor Ort (z. B. in Form von<br />
Schulnoten).<br />
1 Veröffentlicht in: Alsheimer, M.; Stich, V. (2005): Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen. Vernetzte Palliativversorgung<br />
im ambulanten Bereich. www.bayerische-stiftung-hospiz.de >>Arbeitshilfen >>Heft 6<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
59
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1. Gibt es ein schriftliches Leitbild o<strong>der</strong> Leitlinien zur Sterbebegleitung in <strong>der</strong><br />
Sozialstation? Wenn ja: Sind dieses o<strong>der</strong> diese den MitarbeiterInnen bekannt?<br />
Wird es von allen getragen? Macht es Aussagen darüber, wo<br />
Sterbebegleitung beginnt <strong>und</strong> was es alles umfasst?<br />
2. Wird die Sterbegleitung in Prospekten über die Arbeit <strong>der</strong> Sozialstation<br />
angesprochen? Wenn ja: wie?<br />
3. Werden gezielt Informationen über Wünsche o<strong>der</strong> Vorstellungen zur letzten<br />
Lebensphase gesammelt? Wenn ja: wie? Werden diese Wünsche<br />
gesichert? Werden Bedürfnisse von demenziell erkrankten Menschen für<br />
die Sterbebegleitung beson<strong>der</strong>s ermittelt? Wenn ja: wie?<br />
4. Werden PatientInnen unterstützt bei Lebensbewältigung <strong>und</strong> Lebensrückschau?<br />
Wenn ja: wie? Gibt es beson<strong>der</strong>e Verfahren für demenziell<br />
erkrankte Menschen, die die MitarbeiterInnen anwenden?<br />
5. Werden Angehörige in die Sterbebegleitung gezielt miteinbezogen <strong>und</strong><br />
unterstützt? Wenn ja: wie?<br />
6. Werden Angehörige beim Abschiednehmen von Verstorbenen unterstützt?<br />
Wenn ja: wie?<br />
7. Haben ehrenamtliche HospizhelferInnen in <strong>der</strong> Sozialstation Bedeutung?<br />
Wenn ja: welche? Ist eine eventuelle Kooperation befriedigend geregelt<br />
(z.B. Wann werden die ehrenamtlichen HelferInnen angefor<strong>der</strong>t? Von<br />
wem? Wie schnell <strong>und</strong> zuverlässig ist <strong>der</strong> Einsatz? Wie wird bei Konfliktfällen<br />
verfahren?) Wenn ja: wie?<br />
8. Verläuft die Zusammenarbeit mit Hausärzten gut? Wird in Konfliktfällen<br />
befriedigend verfahren? (Konfliktfall z.B. Schmerztherapie, PEG-<br />
Versorgung, Einweisungen)<br />
9. Praktizieren die Pflegekräfte in <strong>der</strong> Sterbebegleitung beson<strong>der</strong>e pflegerische<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Aufmerksamkeiten? Wenn ja: welche?<br />
10. Sind die Entscheidungen in <strong>der</strong> Regel nachvollziehbar, ob jemand noch in<br />
eine an<strong>der</strong>e Einrichtung (z.B. Krankenhaus, Pflegeheim) verlegt wird?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
60
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
11. Ist die Überleitung zwischen Krankenhaus <strong>und</strong> Sozialstation gut geregelt?<br />
Wenn ja: wie?<br />
12. Wird <strong>der</strong> Verstorbene durch die Sozialstation noch versorgt / aufgebahrt?<br />
Gibt es hier Angebote <strong>der</strong> Sozialstation? Werden Angehörige dabei unterstützt?<br />
13. Wird die Sterbebegleitung im Team beson<strong>der</strong>s abgesprochen? Wenn ja:<br />
wie?<br />
14. Wird den Gefühlen von Pflegekräften Raum <strong>und</strong> Zeit gegeben? Wenn ja:<br />
wie?<br />
15. Wird Zeit geschaffen für die Sterbebegleitung? Wenn ja: wie?<br />
16. Werden neue MitarbeiterInnen herangeführt <strong>und</strong> angeleitet bei <strong>der</strong> Sterbebegleitung?<br />
Wenn ja: wie?<br />
17. Werden in <strong>der</strong> Sozialstation Formen <strong>der</strong> Erinnerung an Verstorbene gepflegt?<br />
Wenn ja: wie?<br />
18. Ist Sterben, Tod, Trauer Thema in Bewerbungsgesprächen? Wenn ja: in<br />
welcher Form?<br />
19. Gibt es eine Nachsorge für Angehörige? Wenn ja: in welcher Form?<br />
20. Ist die Zusammenarbeit mit Seelsorgern befriedigend geregelt? Wenn ja:<br />
wie?<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
61
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material / Visualisierung<br />
Entwicklungen sichtbar machen<br />
Ein Auswertungsbogen für die Entwicklungsschritte<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Die Übersicht bringt es auf den Punkt: Wo sehen die Teilnehmer einer Projekt-<br />
Werkstatt o<strong>der</strong> eines internen Projektes den Entwicklungsstand <strong>der</strong> Palliativkultur<br />
Ihres Hauses? Sie können die Übung <strong>und</strong> die Auswertungstabelle nutzen,<br />
um ein Meinungsbild innerhalb Ihres Hauses zu gewinnen. Die Übung<br />
kann in Abständen wie<strong>der</strong>holt werden: Wie sehen die Mitarbeiter innerhalb<br />
eines Projektes das Ausgangsniveau? Welche Zwischenbilanzen lassen sich<br />
ziehen? Wo sehen wir uns am offiziellen Ende eines Projektes?<br />
Anleitung<br />
• Ein Pfad von 1 – 10 wird ausgelegt. Lassen Sie nun die Teilnehmer auf<br />
den ausgelegten Ziffern sich zu den nachfolgenden Fragen positionieren.<br />
Sie können die Übung natürlich auch (anonymisiert) schriftlich machen<br />
lassen.<br />
• Wo sehe ich den Entwicklungsstand unserer Einrichtung? (1 = Wir stehen<br />
ganz am Anfang; je<strong>der</strong> macht es so, wie er für richtig hält; 5 = Wir haben<br />
uns auf einige Standards verständigen können; es gibt aber noch einiges,<br />
was wir entwickeln <strong>und</strong> durchdenken müssen, 10 = Wir können versichern:<br />
bei uns gibt es eine optimale Palliativversorgung) Eintrag mit x<br />
• Wo sehe ich mich <strong>und</strong> meine Fähigkeiten zur Sterbebegleitung? (1 = sehr<br />
unsicher, 10 = sehr sicher) Eintrag mit �<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
62
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Auswertung Datum:<br />
10 10<br />
9 9<br />
8 8<br />
7 7<br />
6 6<br />
5 5<br />
4 4<br />
3 3<br />
2 2<br />
1 1<br />
Durchschnittswert Einrichtung:<br />
Auswertung Datum:<br />
10 10<br />
9 9<br />
8 8<br />
7 7<br />
6 6<br />
5 5<br />
4 4<br />
3 3<br />
2 2<br />
1 1<br />
Durchschnittswert Einrichtung:<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
63
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Didaktische Planung<br />
Veranstaltung für Ist-Analyse planen<br />
Schritte, Ziele, Methoden <strong>und</strong> Medien<br />
Zielgruppe: MitarbeiterInnen aus Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung<br />
Zeitbedarf: ca. 90 Minuten<br />
Mitarbeiterversammlung<br />
Titel: Leben bis zuletzt – Wie wir gemeinsam einen guten Rahmen schaffen können …<br />
Zeit<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
5’ Einsteigen<br />
Ziel: Die Teilnehmer<br />
(TN) kennen den<br />
Rahmen <strong>und</strong> den<br />
Sinn des Projektes<br />
Ziel: Die TN fühlen<br />
sich durch die Verbindung<br />
mit positiven<br />
<strong>und</strong> negativen<br />
Fallgeschichten in<br />
ihrem Erleben <strong>der</strong><br />
Praxis angesprochen<br />
20’ Erarbeiten<br />
1. Schritt<br />
Ziel: Die TN fühlen<br />
sich persönlich angesprochen<br />
Die TN bringen für<br />
sie wichtige Anliegen<br />
auf den Punkt<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
Begrüßung<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Fallgeschichte erzählen<br />
Mischung aus positiven <strong>und</strong> negativ Erlebnissen<br />
Kurzvortrag<br />
Entwicklung einer guten Kultur<br />
<strong>der</strong> Begleitung<br />
Was uns in <strong>der</strong> Leitung wichtig ist …<br />
Inhaltliche Stichworte:<br />
• Wachsende Bedeutung <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
• Wichtig: guten Rahmen schaffen<br />
• Entlastung suchen<br />
• Vernetzung herstellen<br />
•<br />
Arbeit mit Symbolen<br />
Mein Symbol für …<br />
Was mir als Mitarbeiter am Herzen<br />
liegt …<br />
Die TN wählen ein Symbol (Gegenstand,<br />
Bild) aus, zeigen es in <strong>der</strong> R<strong>und</strong>e<br />
<strong>und</strong> kommentieren es kurz. Symbole erleichtern<br />
das persönliche Sprechen <strong>und</strong><br />
veranschaulichen die Anliegen.<br />
Impulse, z. B.:<br />
• Was verbinde ich mit Sterbebegleitung?<br />
• O<strong>der</strong>: Was braucht Sterbebegleitung<br />
beson<strong>der</strong>s?<br />
• O<strong>der</strong>: Was ist mein Anliegen/Ziel bei<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung?<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Plenum<br />
Heimleiter,<br />
PDL o<strong>der</strong><br />
Projektgr.-<br />
Leiter<br />
Materialien<br />
Medien<br />
� Gestaltung <strong>der</strong><br />
Mitte<br />
� Bild Netz<br />
Plenum � Symbole mitbringen<br />
(Bil<strong>der</strong>, Gegenstände,<br />
z. B.<br />
Steine, Fe<strong>der</strong>,<br />
Uhr, zerbrochener<br />
Zweig, Hammer<br />
usw.)<br />
�<br />
64
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Zeit<br />
15’<br />
15’<br />
15’<br />
15’<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
Erarbeiten<br />
2. Schritt<br />
Ziel: Die TN machen<br />
sich bewusst, was<br />
sie bereits leisten<br />
<strong>und</strong> fühlen dieses<br />
gewürdigt<br />
Erarbeiten<br />
3. Schritt<br />
Ziel: Die TN analysieren<br />
<strong>und</strong> benennen<br />
Vorgänge <strong>und</strong><br />
Bereiche, wo sie unsicher<br />
o<strong>der</strong> unzufrieden<br />
sind<br />
Die Leitung erhält<br />
Themenvorschläge.<br />
5’ Integrieren<br />
1. Schritt<br />
Ziel: Die TN bewerten<br />
die persönliche<br />
Bedeutung einzelner<br />
Punkte.<br />
Ziel: Die Leitung erhält<br />
eine Prioritätenliste<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Kartenabfrage<br />
Was gut läuft …<br />
Impulse:<br />
• Gehen Sie gedanklich die letzten<br />
„Sterbefälle“ durch.<br />
• Bitte halten Sie schlagwortartig fest,<br />
was Sie bereits bei <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
machen <strong>und</strong> womit Sie<br />
zufrieden sind!<br />
• Jedes Schlagwort = eine grüne Karte?<br />
Auswertung: Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse<br />
gemeinsam vor <strong>und</strong> heften die<br />
Karten an die Pinnwand.<br />
Die Leitung würdigt die Ergebnisse.<br />
Kartenabfrage<br />
Hier fehlt uns etwas …<br />
Impulse:<br />
• Gehen Sie gedanklich die letzten<br />
„Sterbefälle“ durch.<br />
• Wo fühle ich mich unsicher?<br />
• Was läuft schief?<br />
• Worüber sollten wir in einer Projektgruppe<br />
nachdenken, um die Sterbebegleitung<br />
zu verbessern?<br />
Auswertung: Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse<br />
gemeinsam vor <strong>und</strong> heften die<br />
Karten an die Pinnwand<br />
Punktabfrage:<br />
Das ist mir beson<strong>der</strong>s wichtig<br />
…<br />
Impulse:<br />
• Sie bekommen jeweils drei Klebepunkte.<br />
Überlegen Sie, welche <strong>der</strong><br />
Probleme vorrangig bearbeitet werden<br />
sollen.<br />
• Bitte kommen Sie nun alle an die<br />
Pinnwand <strong>und</strong> kleben die Punkte auf<br />
die Karten, die für Sie beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig sind.<br />
Prioritätenliste<br />
Der Leiter <strong>der</strong> Veranstaltung fasst das<br />
Ergebnis zusammen <strong>und</strong> gibt einen<br />
Ausblick, wie es mit <strong>der</strong> Projektarbeit<br />
weitergeht.<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Gruppenarbeit<br />
För<strong>der</strong>t Austausch<br />
<strong>und</strong><br />
schafft Sicherheit<br />
beim<br />
Beschriften<br />
<strong>der</strong> Karten<br />
Plenum<br />
Gruppenarbeit<br />
Plenum<br />
Materialien<br />
Medien<br />
� Pinnwände<br />
� Karten (grün)<br />
� Filzstifte<br />
� Pinnwände<br />
� Karten (rot)<br />
� Filzstifte<br />
�<br />
Plenum � Klebepunkte (Alternative:<br />
Stifte zum<br />
Ankreuzen o<strong>der</strong> Bepunkten)<br />
65
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Zeit<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
10’ Integrieren<br />
2. Schritt<br />
Ziel: Die TN machen<br />
sich <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en<br />
deutlich, wie stark<br />
sie im Moment das<br />
Thema <strong>und</strong> die weitere<br />
Arbeit daran interessiert.<br />
Ziel: Die TN erfahren,<br />
dass ihre unterschiedlichesInteresse<br />
<strong>und</strong> Bereitschaft<br />
nicht bewertet wird.<br />
Ziel: Die Leitung<br />
sieht evtl. Bereitschaft<br />
zur weiteren<br />
Mitarbeit in einer<br />
Projektgruppe<br />
5’ Auswerten<br />
Ziel: Die TN geben<br />
ohne großen Aufwand<br />
Rückmeldung.<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Standbild<br />
Wie stark interessiert mich<br />
das Thema?<br />
Impulse:<br />
Der Leiter macht deutlich, dass die TN<br />
bei <strong>der</strong> folgenden persönlichen Aufstellung<br />
nicht beurteilt werden. „Je<strong>der</strong> hat<br />
ein unterschiedlich starkes Interesse<br />
am Thema o<strong>der</strong> braucht Abstand. Das<br />
ist völlig in Ordnung … Für uns ist es<br />
für die weitere Arbeit wichtig zu sehen,<br />
wie stark das Thema interessiert …“<br />
Vorgehen:<br />
• Wir legen nun in <strong>der</strong> Mitte mit <strong>der</strong><br />
Schnur einen Innenkreis <strong>und</strong> einen<br />
Außenkreis.<br />
• Bitte stellen Sie sich je nach Ihrem<br />
<strong>der</strong>zeitigen Interesse auf:<br />
• 1.Innenkreis=Interesse sehr<br />
hoch; evtl. Bereitschaft zur Mitarbeit<br />
in einer Projektgruppe<br />
• 2. Kreis=Interesse mittel,<br />
• 3. Ring=Ich brauche zurzeit Abstand<br />
zum Thema Sterben<br />
• Tauschen Sie sich bitte mit den TN<br />
in Ihrer Nähe aus, wie die Veranstaltung<br />
für Sie war …<br />
Danke für’s Mitmachen<br />
Plakat<br />
„Auswerten im Vorbeigehen<br />
…“<br />
Impulse:<br />
Bitte tragen Sie beim Rausgehen auf<br />
<strong>der</strong> verdeckten Flipchart noch ein, wie<br />
Sie die heutige Veranstaltung empf<strong>und</strong>en<br />
haben. Kreuzen Sie die entsprechende<br />
(Schul-)Note an. Wenn Sie wollen,<br />
können Sie uns auch noch einen<br />
Kommentar hinterlassen.<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Plenum<br />
Plenum<br />
Materialien<br />
Medien<br />
Entwickelt: Projekt-Werkstatt Hospizkultur (DW Bayern), April 2008 Bamberg<br />
MA<br />
� Farbige, dickere<br />
Schnüre<br />
� Flipchart (vor Blicken<br />
geschützt)<br />
�<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
66
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Didaktische Planung<br />
Veranstaltung zur Konzept-<br />
Diskussion planen<br />
Schritte, Ziele, Methoden <strong>und</strong> Medien (Projekt Hersbruck)<br />
Zielgruppe: MitarbeiterInnen aus Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung<br />
Leitziel: Kennenlernen des Konzeptentwurfes – Abgleich mit den Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Ideen <strong>der</strong> MitarbeiterInnen <strong>und</strong> praktisches Training palliativpflegerischer<br />
Hilfen<br />
Zeitbedarf: ca. 180 Minuten<br />
Info-Veranstaltung für Mitarbeiter<br />
Titel (Vorschlag): Sterbebegleitung – „Ein neues Konzept – Passend auch für uns?“…<br />
Zeit<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
15’ Einsteigen<br />
Ziel: Die Teilnehmer<br />
(TN) kennen den<br />
Rahmen <strong>und</strong> den<br />
Sinn des Projektes<br />
Ziel: Die TN fühlen<br />
sich durch die Verbindung<br />
mit positiven<br />
<strong>und</strong> negativen<br />
Fallgeschichten in<br />
ihrem Erleben <strong>der</strong><br />
Praxis angesprochen<br />
Ziel: Die TN kennen<br />
Vorgeschichte <strong>und</strong><br />
die bisherigen<br />
Schritte<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
Begrüßung<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Fallgeschichte(n) erzählen<br />
Mischung aus positiven <strong>und</strong> negativen<br />
Erlebnissen.<br />
Kurzvortrag<br />
Entwicklung einer guten Kultur<br />
<strong>der</strong> Begleitung – Unsere<br />
bisherigen Schritte<br />
Was uns in <strong>der</strong> Projektleitung wichtig<br />
ist …<br />
Inhaltliche Stichworte:<br />
• Wachsende Bedeutung <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
• Wichtig: guten Rahmen schaffen<br />
• Entlastung suchen<br />
• Vernetzung herstellen<br />
Unsere bisherigen Schritte:<br />
Strecke mit ausgeschnittenen Fußspuren<br />
markieren. Der Leiter wan<strong>der</strong>t<br />
beim Berichten auf <strong>der</strong> ausgelegten<br />
Spur …<br />
• 1. Schritt im Projekt …<br />
• 2. Schritt …<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Plenum<br />
Heimleiter,<br />
PDL o<strong>der</strong><br />
Projektgr.-<br />
Leiter<br />
Materialien<br />
Medien<br />
� Bestuhlung:<br />
Stuhlkreis<br />
� Gestaltung <strong>der</strong><br />
Mitte<br />
� Schablone Fußspuren<br />
(aus Karton<br />
geschnitten)<br />
67
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Zeit<br />
25’<br />
5x 4’<br />
Gespräch<br />
+ Zeit<br />
zum<br />
Schreiben<br />
<strong>der</strong><br />
Karten)<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
Erarbeiten<br />
1. Schritt<br />
Ziel: Die TN reflektieren<br />
Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> können sich dabei<br />
austauschen<br />
Ziel: Die TN fühlen<br />
sich persönlich angesprochen<br />
Die TN bringen für<br />
sie wichtige Anliegen<br />
auf den Punkt,<br />
die für den anschließenden<br />
Abgleich mit<br />
dem Konzept genutzt<br />
werden können<br />
45’ Erarbeiten<br />
2. Schritt<br />
Ziel: Die TN kennen<br />
die Überlegungen<br />
aus <strong>der</strong> Konzeptgruppe<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Methode „Kugellager“<br />
Sterbebegleitung persönlich<br />
„Was mich als MA bei <strong>der</strong><br />
Sterbebegleitung beschäftigt<br />
…“<br />
Anleitung:<br />
Die TN setzen sich in einen Innenkreis<br />
<strong>und</strong> in einem Außenkreis paarweise<br />
gegenüber. Die Leitung gibt einen Impuls/eine<br />
Frage für den wechselseitigen<br />
Erfahrungs- <strong>und</strong> Meinungsaustausch<br />
zwischen den jeweiligen Partnern.<br />
Die Leitung beendet die Gespräche<br />
jeweils nach ca. 5 Min. z. B. durch einen<br />
Gongschlag. Am Ende des jeweiligen<br />
Gesprächs können die TN eine<br />
o<strong>der</strong> zwei Karten beschriften, die von<br />
<strong>der</strong> Leitung an die Pinnwand geheftet<br />
werden.<br />
Danach setzen sich die TN gegenläufig<br />
(= „Kugellager“) einen Stuhl weiter, so<br />
dass neue Partner für das nächste Gespräch<br />
zusammenkommen.<br />
Impulse, z. B.:<br />
• Was mich bei <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
beson<strong>der</strong>s interessiert …<br />
• Wo ich mich manchmal unsicher<br />
fühle …<br />
• Ein Erlebnis, das mich beschäftigt<br />
hat …<br />
• Was mir im Rahmen <strong>der</strong> Arbeit bei<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung gut getan hat<br />
…<br />
• Was mir im Rahmen <strong>der</strong> Arbeit bei<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung fehlt …<br />
Vortrag mit Diskussion<br />
Sterbebegleitung organisatorisch<br />
Vorschläge für ein Konzept<br />
Die Leitung stellt das Konzept vor <strong>und</strong><br />
versucht – wo es passt - zusammen mit<br />
den TN Verbindungen zu einzelnen Ergebnissen<br />
<strong>der</strong> Gespräche (= Karten <strong>der</strong><br />
TN ) herzustellen. Evtl. müssen die<br />
Stichworte auf den Karten noch erläutert<br />
werden.<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Partnerarbeit<br />
Materialien<br />
Medien<br />
� Pinnwände<br />
(Zeichnung auf<br />
<strong>der</strong> Pinnwand-<br />
Bespannung:<br />
Körbe für die einzelnen<br />
Impuls-<br />
Fragen)<br />
� Nadeln<br />
� DIN A4-Karten (für<br />
jeden Impuls eine<br />
an<strong>der</strong>e Farbe)<br />
� Filzstifte (pro TN<br />
einen)<br />
Plenum � Kopiertes Konzept<br />
als TN-Material<br />
zum Mitlesen<br />
� Evtl Overheadprojektor<br />
68
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Zeit<br />
Lernphase<br />
Ziele<br />
15’ Integrieren /<br />
Transfer<br />
Ziel: Die TN fühlen<br />
sich mit ihren Vorstellungen<br />
<strong>und</strong> Fragen<br />
einbezogen<br />
Methode<br />
Inhalte<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Diskussion<br />
Das Konzept in <strong>der</strong> Diskussion<br />
Impulse:<br />
• Wo bietet das Konzept Antwort auf<br />
meine Unsicherheiten <strong>und</strong> Fragen?<br />
• Welche Vorschläge habe ich als<br />
MitarbeiterIn?<br />
• Abschluss: Was ist für mich unklar<br />
o<strong>der</strong> offen geblieben?<br />
Sozialform<br />
Verantwortung<br />
Materialien<br />
Medien<br />
20 Pause � Kaffee/Tee<br />
45’ Erarbeiten<br />
3. Schritt<br />
Ziel: Die TN kennen<br />
die Überlegungen<br />
aus <strong>der</strong> Konzeptgruppe<br />
5’ Integrieren /<br />
Transfer<br />
5’ Integrieren<br />
insgesamt<br />
Ziel: Die TN sind<br />
darüber orientiert,<br />
wie das Projekt weiter<br />
geht<br />
5’ Auswerten<br />
Ziel: Die TN bewerten<br />
ihren persönlichen<br />
<strong>und</strong> fachlichen<br />
Lernerfolg<br />
Ziel: Die Leitung erhält<br />
eine Prioritätenliste<br />
Demonstration / Übungen<br />
Sterbebegleitung praktisch<br />
Pflegerische Hilfen<br />
Beispiele:<br />
• Lagerung „Nest“<br />
• M<strong>und</strong>pflege<br />
• usw.<br />
Bei welchen Patienten kann ich das<br />
Gezeigte evtl. einsetzen o<strong>der</strong> vorschlagen?<br />
Kurzvortrag<br />
Unsere nächsten Schritte ..<br />
Fragebogen:<br />
Das nehme ich heute mit …<br />
Impulse:<br />
• 3 Erkenntnisse / Eindrücke, die ich<br />
heute mitnehme<br />
• Was hat mir weniger gefallen?<br />
• Was hat mir gut gefallen?<br />
• Das schlage ich für das nächste<br />
Treffen vor:<br />
� Kuchen<br />
Plenum � DVD<br />
Lehrbuch Student, Napiwotzki<br />
� Kopiertes TN-<br />
Material zum<br />
Nachlesen (Auszüge<br />
aus Lehrbuch)<br />
� Material zum Üben,<br />
z. B. Kissen<br />
Plenum � Fragebogen<br />
Entwickelt: Projekt-Werkstatt Hospizkultur (DW Bayern), April 2008 Bamberg<br />
69
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiel<br />
Fortbildungsthemen wählen 1<br />
Themen für die Schulung von Mitarbeitern (Beispiel Projekt<br />
Füssen)<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Welche Themen tauchen in den Fortbildungen auf? Das Beispiel aus dem<br />
Projekt Füssen zeigt Ihnen, welche Inhalte von den Mitarbeitern aus dem Curriculum<br />
des zertifizierten Basiskurses „Palliative Care <strong>und</strong> Hospizarbeit“ (160<br />
Std.) für den kleineren Rahmen <strong>der</strong> internen Schulungen gewählt wurden.<br />
Die Liste gibt Ihnen einen groben Überblick <strong>und</strong> hilft evtl. gewünschte Inhalte<br />
abzufragen o<strong>der</strong> diese zu ergänzen<br />
Fast alle MitarbeiterInnen <strong>der</strong> Sozialstation Füssen haben in zwei Gruppen einen<br />
Palliative-Care-Kurs kompakt durchlaufen. Diese interne Fortbildung<br />
war dreiteilig angelegt: Sie bestand aus zwei Schulungen mit je 12 U.-Std., in<br />
denen Basiswissen trainiert wurden, <strong>und</strong> einem Planspiel bzw. einer Besprechung<br />
<strong>der</strong> entwickelten Standards anhand eigener Praxissituationen.<br />
Der Umfang <strong>der</strong> internen Fortbildung betrug pro Gruppe insgesamt 30 U.-Std.<br />
Die Schwerpunkte wurden jeweils auf die Interessen <strong>der</strong> TeilnehmerInnen<br />
abgestimmt. In beiden Gruppen wurden folgende Themen in Form von Impulsreferaten,<br />
Rollenspielen, kleinen praktischen Demonstrationen, Besprechungen<br />
<strong>und</strong> Übungen behandelt:<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein<br />
Ostallgäu e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika<br />
Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 28.10.2009; Redaktion: Martin Alsheimer<br />
70
Projekt-Werkstatt - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Organisatorische Themen<br />
• Leitlinien zur Sterbebegleitung<br />
• Integration <strong>der</strong> Palliativpflege in die ambulante Pflege<br />
Palliativ-medizinische <strong>und</strong> –pflegerische Themen<br />
• Basiswissen Schmerztherapie<br />
• Übelkeit / Erbrechen<br />
• Obstipation<br />
• Ernährung<br />
• Flüssigkeitssubstitution pro <strong>und</strong> contra in <strong>der</strong> Terminalphase<br />
• M<strong>und</strong>pflege<br />
• Palliative W<strong>und</strong>versorgung<br />
Rechtlich-ethische Themen<br />
• Rechtliche Fragen (Sterbehilfe, Vorsorgemöglichkeiten)<br />
• Vorstellungen zu letzten Lebensphase erfahren<br />
• Einweisung ins Krankenhaus - Beratungshilfen<br />
Psycho-soziale <strong>und</strong> spirituell-religiöse Themen<br />
• Persönliche Leitbil<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
• Unterstützende Gespräche bei Schuldgefühlen<br />
• Krisengespräche bei Lebensmüdigkeit<br />
• Gr<strong>und</strong>haltung in <strong>der</strong> Begleitung (Nähe / Distanz-Probleme)<br />
• Persönliche Hilfen vor Überfor<strong>der</strong>ung<br />
• Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Hospizhelfer<br />
• Trauer <strong>und</strong> Trauerbegleitung<br />
• Umgang mit Verstorbenen (Versorgung, Transfer, Aufbahrung)<br />
• Rituale entwickeln<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand 20.04.2008; Redaktion: Martin Alsheimer
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Hilfe<br />
Inhouse-Fortbildungen planen 1<br />
Konzept für hausinterne Fortbildungen<br />
Einführung<br />
Fortbildungen sind ein wichtiges Instrument, um den Boden für eine hospizliche<br />
Kultur zu bereiten. Ein wichtiger Gr<strong>und</strong>satz für die Fortbildung in Palliative<br />
Care ist: Haltung vor Technik.<br />
„Palliative Care ist nicht nur eine Aneinan<strong>der</strong>reihung von sinnvollen Maßnahmen <strong>und</strong> aus Erfahrung<br />
<strong>und</strong> Forschung gesammelten Wissen – Palliative Care ist zuallererst Reflexion <strong>und</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit unserer persönlichen Haltung, mit <strong>der</strong> wir sterbenden Menschen <strong>und</strong> ihren<br />
Angehörigen begegnen. Gemeint sind Werte wie Respekt, Empathie, Wahrhaftigkeit, Menschenfre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> Selbstachtung. Palliative Care ist an <strong>kein</strong>en Ort geb<strong>und</strong>en. Voraussetzung<br />
ist die Bereitschaft, sich mit den Themen Sterben, Tod <strong>und</strong> Trauer auseinan<strong>der</strong>zusetzen –<br />
auch mit persönlichen Erfahrungen <strong>und</strong> Befürchtungen. 2 “<br />
Die Kunst <strong>der</strong> Fortbildungen ist es, diese Haltungen (= persönlich durchdachtes<br />
Handeln) zu entwickeln, dabei die organisatorischen Stützen <strong>und</strong> Spielräume<br />
zu prüfen (= organisatorisch durchdachtes Handeln), so dass die beson<strong>der</strong>e<br />
Fähigkeiten <strong>und</strong> das spezielles Wissen erworben <strong>und</strong> auch angewendet<br />
werden können (= fachlich durchdachtes Handeln).<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Leben bis zuletzt“, Evangelisches Pflegezentrum Eichenau, Bahnhofstr. 117,<br />
82223 Eichenau; Projektleitung: Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dirk Spohd (HL), Ruth Wagner (PDL)<br />
2 Kränzle, S., Schmid, U., Seeger, C.: Palliative Care. Handbuch für Pflege <strong>und</strong> Begleitung. Heidelberg:<br />
Springer 2005, S. IX<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 72
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
OrganisatorischeMöglichkeiten<br />
Persönliche Haltung<br />
Palliative Fähigkeiten,<br />
Wissen, Fertigkeiten<br />
Wir haben uns für ein gestuftes Fortbildungsprogramm entschieden:<br />
• Ein thematisch breit angelegtes Basisprogramm für möglichst viele MitarbeiterInnen<br />
aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung sichert<br />
ein tragfähiges Gr<strong>und</strong>verständnis für hospizliches Handeln im Haus. Unser<br />
Ziel: Persönliche <strong>und</strong> fachliche Sicherheit in Alltagssituationen <strong>der</strong> Begleitung<br />
Sterben<strong>der</strong> <strong>und</strong> ihrer Angehörigen. Entsprechend unserem<br />
Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Vernetzung laden wir hier auch ehrenamtliche Kräfte aus<br />
Besuchsdienst <strong>und</strong> Hospizverein dazu ein.<br />
• Darauf aufbauend bieten wir für MitarbeiterInnen, die in beson<strong>der</strong>en Situationen<br />
pflegen <strong>und</strong> begleiten, spezialisierte Fortbildungseinheiten an.<br />
• Für die Palliative-Care-Kräfte in unserem Haus sorgen wir, dass sie über<br />
ihre Weiterbildung hinaus, Kenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten in externen Fortbildungen<br />
vertiefen können.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 73
1<br />
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Fortbildungsprogramm (Beispiel Projekt Eichenau)<br />
3<br />
Palliative-Care-Fachkräfte<br />
Einführung von Auszubildenden <strong>und</strong> neuer Mitarbeiter<br />
Vermittlung von pflegerischen Fertigkeiten <strong>und</strong> Wissen<br />
(Multiplikatoren-Rolle)<br />
2 Programm für Mitarbeiter in beson<strong>der</strong>en Situationen<br />
(8 U.-Std.)<br />
Übermittlung<br />
<strong>der</strong> Todesnachricht<br />
Begleitung am<br />
Totenbett<br />
Umsorgen Verstorbener<br />
Pflege in <strong>der</strong><br />
Terminalphase<br />
Palliative Notfälle<br />
Basisprogramm für MitarbeiterInnen in Alltagssituationen <strong>der</strong> Sterbe- <strong>und</strong><br />
Trauerbegleitung (24 U.-Std.)<br />
Verständnis von Trauerprozessen<br />
Unterstützung von Abschied<br />
als professionelle<br />
Dienstleistung<br />
Verhalten am Pflegebett<br />
Rechtliches Basiswissen<br />
Reflexion eigener Haltungen <strong>und</strong><br />
Erfahrungen zu Sterben, Tod <strong>und</strong><br />
Trauer<br />
Gr<strong>und</strong>haltung <strong>der</strong> Begleitung -<br />
Kommunikation in Krisen<br />
Vorstellungen von Lebensqualität<br />
erfassen<br />
Pflegerische Themen, z.<br />
B. M<strong>und</strong>pflege, Lagerungen,<br />
beson<strong>der</strong>e Waschungen,Flüssigkeitsgabe<br />
Schmerzbeobachtung<br />
(z. B. bei demenziell erkranktenBewohnerInnen)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 74
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Hilfreiche Haltungen für die<br />
Sterbebegleitung för<strong>der</strong>n<br />
Beispiele für Haltungen <strong>und</strong> Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung<br />
Als Leitung für Rückhalt<br />
im Team sorgen<br />
Bei Entscheidungen<br />
Antwort geben: Was<br />
wollte ich damit erreichen?<br />
Teamritual zum Abschied<br />
Besprechung von<br />
„Fällen“<br />
Gelebte Vorbil<strong>der</strong><br />
auf allen Ebenen<br />
Übung:<br />
Mein Schutzmantel<br />
Rückhalt<br />
Solidarität<br />
Verantwortung<br />
Akzeptanz <strong>der</strong><br />
Realität (gegen<br />
Aktivismus)<br />
Entwickelt: Projekt-Kolleg Caritas 2007<br />
Achtsamkeit<br />
Zuversicht<br />
Flexibilität Toleranz<br />
Demut Offenheit für<br />
Neues<br />
Sinneswahrnehmung<br />
schulen<br />
Spirituelle<br />
Angebote<br />
Einüben von<br />
Ver-halt-ensweisen<br />
(von außen nach innen<br />
wirken)<br />
Im Team darauf achten,<br />
dass Meinungen<br />
auch stehen bleiben<br />
dürfen<br />
Bestätigung für Geleistetes<br />
erhöht Offenheit<br />
für Neues<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 75
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3<br />
Leitgedanken<br />
Konzepte<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 76
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 77
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Thesen<br />
Leitgedanken: Sterbebegleitung 1<br />
10 Thesen zur beson<strong>der</strong>en Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
1. Sterben ist ein ganz individueller, ein einmaliger Prozess. Der Sterbende<br />
führt die Regie. Eine gute Sterbebegleitung bedeutet, alle eigenen Ideale,<br />
Vorstellungen, Rezepte beiseite zu stellen <strong>und</strong> die Wünsche des an<strong>der</strong>en<br />
zu erk<strong>und</strong>en o<strong>der</strong> zu ertasten. Es braucht eine Atmosphäre <strong>der</strong> Offenheit.<br />
2. Sterben gehört zum Leben; Sterbende sind Lebende. Eine gute Sterbebegleitung<br />
bedeutet nichts Spektakuläres. Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung.<br />
Die Aufgabe ist, eine Lebenszeit zu ermöglichen, die lebenswert ist.<br />
Es sind die kleinen Dinge des Alltags, die wichtig sind (z. B. Achtsamkeit<br />
im Kontakt, Aufmerksamkeit für beson<strong>der</strong>e Wünsche)<br />
3. Sterben heißt Loslassen des Lebens. Um etwas loslassen zu können,<br />
muss es mir gehören. „Loslassen“ lässt sich nicht verordnen. Es geht nicht<br />
darum, den Tod anzunehmen, son<strong>der</strong>n sich das Leben anzueignen. Eine<br />
gute Sterbebegleitung bedeutet, den an<strong>der</strong>en bei dieser Lebensschau zu<br />
unterstützen – soweit er es will. Sterbebegleitung ist Biografiearbeit.<br />
4. Sterben ist ein Weg, den je<strong>der</strong> allein gehen muss. Sterbebegleitung bedeutet,<br />
diese unaufhebbare Grenze zu akzeptieren. Wir können nicht beurteilen,<br />
ob ein Sterben „gut“ o<strong>der</strong> „schlecht“ ist. Vieles, was im Sterben passiert,<br />
bleibt rätselhaft o<strong>der</strong> verborgen.<br />
5. Sterben ist oft ein schwerer Weg, <strong>der</strong> mit physischen, sozialen, psychischen<br />
<strong>und</strong> spirituellen Schmerzen verb<strong>und</strong>en ist. Eine gute Sterbebegleitung<br />
bedeutet, das Schmerzgeschehen umfassend zu sehen <strong>und</strong> für eine<br />
gute Schmerztherapie als Basis zu sorgen.<br />
6. Sterben führt an <strong>und</strong> über Grenzen – auch über Grenzen <strong>der</strong> Sprache.<br />
Vieles ist nicht sagbar. Sterbebegleitung bedeutet, weitere Ausdrucksmöglichkeiten<br />
(z. B. Symbole, Körpersprache, z. B. Berührung, Atem) zu entdecken<br />
<strong>und</strong> anzubieten.<br />
1 Vorlage: Martin Alsheimer, Didaktische Materialien (2003)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 78
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
7. Sterben konfrontiert uns mit <strong>der</strong> Endlichkeit <strong>und</strong> Zerbrechlichkeit des eigenen<br />
Lebens. Sterbebegleitung bedeutet, dass ich als Begleiter immer wie<strong>der</strong><br />
meine eigenen „unerledigten Geschäfte“ (E. KÜBLER-ROSS) kläre<br />
<strong>und</strong> mich des Lebens freue.<br />
8. Sterben fügt sich nicht in Phasen, Regeln <strong>und</strong> Zeitvorgaben (Prognosen).<br />
Eine gute Sterbebegleitung braucht Flexibilität, Absprachen, Zusammenarbeit.<br />
Sie bedeutet auch, sich Hilfen zu suchen, wenn die eigenen Kräfte<br />
nicht ausreichen, z. B. Kooperation mit Ehrenamtlichen. Sterbebegleitung<br />
ist Teamarbeit <strong>und</strong> <strong>kein</strong>e Einzelaktion.<br />
9. Sterben betrifft nicht nur eine Person. Es trifft Familie, Fre<strong>und</strong>e, Mitbewohner.<br />
Sterbebegleitung bedeutet, auch das jeweilige Umfeld zu berücksichtigen.<br />
Sterbebegleitung heißt aber auch, auszuhalten <strong>und</strong> zu akzeptieren,<br />
dass Beziehungen manchmal schwierig, zerrüttet o<strong>der</strong> zerstört sind. Wir<br />
können als Begleiter nicht Harmonie herstellen. Wir sind als Pflegekräfte<br />
<strong>kein</strong>e Ersatztöchter o<strong>der</strong> –söhne <strong>und</strong> dürfen hier auch nicht mit den leiblichen<br />
Angehörigen in Konkurrenz treten.<br />
10. Sterben ist ein persönlicher Prozess, Sterbebegleitung eine beson<strong>der</strong>e<br />
zwischenmenschliche Begegnung. Beides braucht einen organisatorischen<br />
Schutzraum. Sterbebegleitung bedeutet, sich für einen schützenden<br />
Rahmen in <strong>der</strong> jeweiligen Einrichtung o<strong>der</strong> Organisation einzusetzen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 79
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Entwurf<br />
Lebensqualität bis zum Abschied<br />
Leitlinien <strong>der</strong> Sozialservicegesellschaft des BRK zum<br />
Thema Sterbebegleitung (Ethik-Kommission)<br />
Sterbebegleitung verstehen wir als Lebensbegleitung. Bewohnerwünsche werden<br />
in den Häusern <strong>der</strong> RKS gerade in <strong>der</strong> letzten Lebensphase beson<strong>der</strong>s<br />
berücksichtigt. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
dafür sind: Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, ausführliche Biografiearbeit,<br />
persönliche Gespräche <strong>und</strong> Vermittlung von spezieller Beratung<br />
Sterbebegleitung bedeutet für uns, gute palliativmedizinische <strong>und</strong> palliativpflegerische<br />
Versorgung. Voraussetzung dafür sind palliativpflegerische Basiswissen<br />
bei möglichst allen Mitarbeitern, spezielle Kompetenz durch Palliativfachkräfte<br />
<strong>und</strong> beson<strong>der</strong>e Zusammenarbeit mit Ärzten, die uns in diesem Ziel<br />
unterstützen.<br />
Sterbebegleitung heißt für uns, das Selbstbestimmungsrecht zu achten. Wir<br />
ermutigen dazu, rechtzeitig entsprechende Vorsorge für ges<strong>und</strong>heitliche Krisensituationen<br />
zu treffen, in denen <strong>der</strong> Bewohner sich nicht mehr direkt mitteilen<br />
kann. Entsprechende eindeutige Willensäußerungen, wie z. B. Patientenverfügungen,<br />
Notfallplanung sind für uns bindend. Falls <strong>kein</strong>e Entscheidungen<br />
getroffen sind, unterstützen wir betreuende Angehörige <strong>und</strong> behandelnde Ärzte<br />
dabei, den mutmaßlichen Willen des Bewohners zu erforschen.<br />
Sterbebegleitung braucht hohen Respekt gegenüber nationalen, ethnischen<br />
<strong>und</strong> religiösen Unterschieden. Wir tragen dafür Sorge, dass religiös <strong>und</strong> kulturell<br />
geprägte Vorstellungen auch in <strong>der</strong> letzten Lebensphase gelebt werden<br />
können. Entsprechende Wünsche werden im Vorfeld erfasst.<br />
Sterbebegleitung braucht Angehörige. Wir sehen Angehörige als wichtigen,<br />
unersetzbaren Partner. Das bedeutet für uns, sie je nach Wünschen <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
in die pflegerische <strong>und</strong> psychosoziale Begleitung einzubeziehen <strong>und</strong><br />
zu sehen, wo sie beson<strong>der</strong>e Informationen <strong>und</strong> Ermutigung benötigen.<br />
Sterbebegleitung führt an eigene Grenzen. Wir geben den Mitarbeitern Raum<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten für die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit den Themen Sterben, Tod<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 80
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
<strong>und</strong> Trauer. Dieser Prozess kann geför<strong>der</strong>t werden zum Beispiel durch Entwicklung<br />
von Teamritualen, durch kollegiale Gespräche, Gesprächskreise,<br />
Fortbildungen <strong>und</strong> supervisorische Begleitung.<br />
Sterbebegleitung nutzt die Unterstützung <strong>und</strong> den beson<strong>der</strong>en Beitrag, den<br />
freiwillige Helfer leisten. Wir legen Wert auf eine gut abgeklärte Zusammenarbeit<br />
mit den örtlichen Hospizvereinen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en ehrenamtlichen Helfern,<br />
die uns in unserem palliativen Gedanken unterstützen.<br />
Sterbebegleitung endet für uns nicht mit dem Tod des Bewohners. Abschied<br />
braucht Zeit <strong>und</strong> Raum. Deswegen legen wir beson<strong>der</strong>n Wert auf Abschiedsformen,<br />
die von den Beteiligten als würdig empf<strong>und</strong>en werden. Wir pflegen<br />
auch beson<strong>der</strong>e Formen des Gedenkens an verstorbene Bewohner.<br />
Entwurf: Projekt-Werkkstatt Hospizkultur, RKS 2006-2007<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 81
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konzept-Beispiel<br />
Leben bis zuletzt 1<br />
Konzept zur Sterbebegleitung<br />
(Leonhard-Henninger-Haus <strong>München</strong>)<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Welche Gedanken <strong>und</strong> organisatorischen Ideen würden Sie in ein Konzept zur<br />
Sterbebegleitung aufnehmen? Das Beispiel präsentiert eine knappe Variante<br />
für Leitlinien zur Sterbebegleitung. Sie können als Diskussions- <strong>und</strong> Formulierungshilfe<br />
verwenden, um in <strong>der</strong> Projektgruppe eigene Leitlinien zu entwickeln.<br />
Die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Projektgruppe können dabei Formulierungen aus dem Material<br />
übernehmen, Abschnitte umformulieren o<strong>der</strong> eigene Gedanken entwickeln.<br />
Der sterbende Mensch steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Er bestimmt<br />
die Art <strong>und</strong> Weise <strong>der</strong> Begleitung. Vorrang hat in <strong>der</strong> Regel, was die<br />
sterbende Person jeweils braucht.<br />
Sterbebegleitung verstehen wir zunächst als Lebensbegleitung. Sterben beginnt<br />
für uns vor dem akuten körperlichen Sterben. Deshalb ist es uns wichtig,<br />
Wünsche im Vorfeld durch entsprechende Gesprächsangebote zu erk<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> zu dokumentieren. Die Menschen, die in unserem Hause leben, werden<br />
mit <strong>der</strong> Sterbekultur, die im Leonhard-Henninger-Haus gepflegt wird, vertraut<br />
gemacht: "Leben bis zuletzt". Dazu gehören u. a. das Abklären, ob <strong>und</strong> wie<br />
Angehörige bei <strong>der</strong> Sterbebegleitung mitwirken können <strong>und</strong> wollen <strong>und</strong> das Informieren<br />
über die Möglichkeiten <strong>der</strong> Patientenverfügung <strong>und</strong> Vollmacht, um<br />
Vorstellungen abzusichern.<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Leben bis zuletzt“, Evangelisches Pflegeheim Leonhard-Henninger-Haus <strong>München</strong><br />
(IMM), Gollierstr. 75-79, 80339 <strong>München</strong>; Projektleitung: Christel Orth (CHV <strong>München</strong>), Martin Alsheimer<br />
(GGsD, Nürnberg), Frank Cylek (HL)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 82
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Sterben ist <strong>und</strong> bleibt dabei ein ganz individueller Prozess. Sterbebegleitung<br />
lässt sich zeitlich <strong>und</strong> inhaltlich nicht detailliert im Voraus festlegen, aber es<br />
lässt sich ein verlässlicher Rahmen schaffen, <strong>der</strong> diese Individualität schützt.<br />
Die folgenden Leitlinien formulieren wichtige Überzeugungen für die Sterbebegleitung<br />
im Leonhard-Henninger-Haus.<br />
Sterbebegleitung - eine Herausfor<strong>der</strong>ung für alle Beteiligten<br />
Das Sterben von Menschen führt uns oft an Grenzen - im Team <strong>und</strong> persönlich.<br />
Begleitung bedeutet, uns nicht mit zu idealistischen Vorstellungen zu überfor<strong>der</strong>n<br />
(z.B. Vorstellung einer ständigen Betreuung „r<strong>und</strong> um die Uhr“).<br />
Sterbebegleitung ist Teamarbeit. Entscheidend ist ein guter Informationsaustausch<br />
zwischen den Beteiligten (Mitarbeiter, Angehörige, Betreuer, Ärzte).<br />
Wo immer möglich, werden wir flexibel sein <strong>und</strong> Unterstützung für die Betroffenen<br />
<strong>und</strong> für das Team organisieren (z.B. ehrenamtliche Kräfte, "Springer" im<br />
Haus), um die jeweiligen Pflege-Bezugspersonen für die Aufgabe <strong>der</strong> Begleitung<br />
zu entlasten. Die unterschiedlichen persönlichen Beziehungen, die es im<br />
Team zum sterbenden Menschen gibt, sollen dabei beachtet <strong>und</strong> genutzt werden.<br />
Das nahe Sterben von Menschen, die wir pflegen <strong>und</strong> betreuen, konfrontiert<br />
uns als Mitarbeiter in <strong>der</strong> Altenpflege persönlich mit unserer eigenen Endlichkeit<br />
<strong>und</strong> Zerbrechlichkeit. Es eröffnet in ganz beson<strong>der</strong>er Weise die existentiellen<br />
Gr<strong>und</strong>fragen: "Wer bin ich? Wozu lebe ich? Wohin sterbe ich?" Die jeweils<br />
eigenen Antworten (die Gr<strong>und</strong>haltung) fließen dabei entscheidend ein in<br />
das professionelle Handeln. Wir werden entsprechend sensibler auf Sinn- <strong>und</strong><br />
Identitätsfragen von Bewohner reagieren. Sterbebegleitung bedeutet für uns<br />
deshalb, dass wir - ohne Zwang - bereit sind, uns mit dieser Thematik persönlich<br />
<strong>und</strong> im Team immer wie<strong>der</strong> auseinan<strong>der</strong>zusetzen. Fortbildungen <strong>und</strong> Austausch<br />
im Team för<strong>der</strong>n diesen Prozess. Auch in Bewerbungsgesprächen <strong>und</strong><br />
in <strong>der</strong> Anleitung neuer Mitarbeiter spielen Fragen <strong>der</strong> Sterbebegleitung eine<br />
wichtige Rolle.<br />
Sterbebegleitung - Einbeziehung von Angehörigen<br />
Sterbebegleitung bedeutet für uns, Angehörige beson<strong>der</strong>s einzubeziehen. Bereits<br />
im Vorfeld werden sie über die Möglichkeiten im Leonhard-Henninger-<br />
Haus informiert <strong>und</strong> im akuten Fall unterstützt (z.B. Übernachtung möglich).<br />
Sie sollen sich immer als willkommene Gäste fühlen <strong>und</strong> als die wichtigen Bezugspersonen.<br />
Wir versuchen hier, eine entsprechende Atmosphäre <strong>der</strong> Offenheit<br />
<strong>und</strong> des Vertrauens zu schaffen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 83
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Wir sehen dabei natürlich auch unsere Grenzen. Der sterbende Mensch steht<br />
in einem Beziehungsgeflecht, das möglicherweise Konflikte birgt. In solchen<br />
Konfliktfällen können wir nur gelegentlich <strong>und</strong> begrenzt vermitteln. Wichtig ist<br />
uns deshalb bereits im Vorfeld, Zuständigkeiten zu klären (z.B. Betreuungsverfügung<br />
o<strong>der</strong> Bevollmächtigung, Ansprechpartner innerhalb <strong>der</strong> Familie), um<br />
in Krisenzeiten handlungsfähig im Sinne des Betroffenen zu sein, wenn sich<br />
dieser nicht mehr direkt äußern kann.<br />
Sterbebegleitung - Lin<strong>der</strong>ung des körperlichen Leids<br />
Körperliches Leid muss so weit wie möglich gelin<strong>der</strong>t werden. Eine unserer<br />
Hauptaufgaben ist es, uns für eine gute schmerztherapeutische Versorgung<br />
<strong>und</strong> eine wirksame Symptomkontrolle einzusetzen (z.B. Atemnot, Krämpfe).<br />
Eine gute Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten ist dabei beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig. Für absehbare Krisen soll möglichst frühzeitig vorgesorgt <strong>und</strong> entsprechende<br />
Absprachen getroffen werden.<br />
Sterbebegleitung - würdige Verabschiedung von Verstorbenen<br />
Sterbebegleitung endet für uns nicht mit dem Tod <strong>der</strong> Menschen. Wir achten<br />
im Leonhard-Henninger-Haus beson<strong>der</strong>s darauf, dass die Verabschiedung<br />
würdig, dass heißt entsprechend den Wünschen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kultur <strong>der</strong> Verstorbenen<br />
<strong>und</strong> ihrer Angehörigen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kultur des Hauses erfolgt. Entsprechende<br />
Vorstellungen werden nach Möglichkeit frühzeitig in Gesprächen erfragt<br />
<strong>und</strong> dokumentiert. Wir ermutigen dazu, einen persönlichen Abschied zu<br />
finden. Erfahrungsgemäß können hier beson<strong>der</strong>s Rituale hilfreich sein. Als ein<br />
zentrales Angebot für Angehörige, Mitbewohner <strong>und</strong> Pflegekräfte hat sich das<br />
Ritual <strong>der</strong> Aussegnung bewährt.<br />
Die Achtung vor den Toten wird auch in <strong>der</strong> Versorgung <strong>der</strong> Verstorbenen<br />
sichtbar. Diesen Respekt erwartet das Haus deshalb auch von den Bestattern.<br />
Abschied braucht Zeit. An die verstorbenen Menschen wird innerhalb <strong>der</strong> Gemeinschaft<br />
des Leonhard-Henninger-Hauses in beson<strong>der</strong>er Weise auf <strong>der</strong><br />
Feier zum Jahresende erinnert.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 84
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 85
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konzept-Beispiel<br />
Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein<br />
Zuhause geben 1<br />
Konzept zur Sterbebegleitung (St. Augustin, Neuburg /D)<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Welche Gedanken <strong>und</strong> organisatorischen Ideen würden Sie in ein Konzept zur<br />
Sterbebegleitung aufnehmen? Das Beispiel präsentiert eine umfangreiche Variante<br />
für Leitlinien zur Sterbebegleitung. Sie können sie als Diskussions- <strong>und</strong><br />
Formulierungshilfe verwenden, um in <strong>der</strong> Projektgruppe eigene Leitlinien zu<br />
entwickeln.<br />
Die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Projektgruppe können dabei Formulierungen aus dem Material<br />
übernehmen, Abschnitte umformulieren o<strong>der</strong> eigene Gedanken entwickeln.<br />
Einleitung<br />
„Wir wissen, dass dem menschlichen Leben ein zeitliches Ende gesetzt ist<br />
<strong>und</strong> dass es zur Fülle in Christus berufen ist; deswegen setzen wir uns für das<br />
Recht ein, in Würde sterben zu dürfen… 2<br />
Die Begleitung Schwerkranker <strong>und</strong> Sterben<strong>der</strong> sowie <strong>der</strong>en Angehöriger ist<br />
eine christliche <strong>und</strong> menschliche Aufgabe. In unserem christlichen Gr<strong>und</strong>verständnis<br />
hat je<strong>der</strong> Mensch <strong>und</strong> jede Lebensphase – <strong>und</strong> gerade auch die Zeiten<br />
von Krankheit <strong>und</strong> Sterben – einen eigenen Wert <strong>und</strong> eine eigene Würde.<br />
Wie lässt sich dieser große Leitbegriff „Würde“ fassen? Die Würde des Menschen<br />
wurzelt für uns in seiner Gottesebenbildlichkeit. „Wir sind überzeugt,<br />
dass wir im Menschen Christus begegnen. So basiert die alltägliche Pflegeroutine,<br />
d. h. die Pflege eines Hilfsbedürftigen auf ‚spiritueller Dimension’.“ 3 Im<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“, Pflegeheim <strong>der</strong> Bamherzigen<br />
Brü<strong>der</strong>, St. Augustyn Neuburg a.d.D., Franziskaner Str. B 127, 86633 Neubug a.d.Donau, Projektleitung:<br />
Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dora Schmidt (PDL)<br />
2 Barmherzige Brü<strong>der</strong> Wien, <strong>München</strong>, Frankfurt (Hg.) (2000): Charta <strong>der</strong> Hospitalität (…). Die Betreuung<br />
kranker <strong>und</strong> hilfsbedürftiger Menschen in <strong>der</strong> Nachfolge des heiligen Johannes von Gott. <strong>München</strong>: Johann<br />
von Gott Verlag, S. 5<br />
3 Formulierung des Menschenbildes in unserem Pflegekonzept (Altenheim St. Augustin, 22.02.2005), S. 1<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 86
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
praktischen Handeln <strong>der</strong> Sterbebegleitung muss Menschenwürde durch zwei<br />
komplementäre Aspekte verwirklicht werden:<br />
• Wir beachten das Selbstbestimmungsrecht des Menschen (= Autonomieaspekt<br />
<strong>der</strong> Menschenwürde).<br />
• Wir möchten den Menschen durch die Art <strong>der</strong> Pflege <strong>und</strong> Begleitung erleben<br />
lassen, dass er mit <strong>und</strong> trotz seiner Krankheit <strong>und</strong> Gebrechlichkeit<br />
wertvoll um seiner selbst willen ist (= Fürsorgeaspekt <strong>der</strong> Menschenwürde).<br />
1<br />
Beide Aspekte sind spannungsreich aufeinan<strong>der</strong> bezogen <strong>und</strong> ergänzen sich<br />
wechselseitig. Sie müssen zusammen gesehen <strong>und</strong> immer wie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> täglichen<br />
Beziehung in Balance gebracht werden. Wir halbieren sonst jeweils<br />
Menschenwürde. „Autonomie“ heißt deshalb für uns nicht, Menschen in ihren<br />
Entscheidungen ratlos, überfor<strong>der</strong>t <strong>und</strong> einsam werden zu lassen. „Fürsorge“<br />
bedeutet für uns nicht, Menschen mit „besserem Wissen“ zu entmündigen. 2<br />
Autonomie braucht Fürsorge - <strong>und</strong> Fürsorge benötigt Autonomie.<br />
Neben dem Schlüsselbegriff <strong>der</strong> Würde prägt ein zweiter Gedanke unsere Arbeit.<br />
Als Leitmotiv unseres Projektes haben wir den Titel gewählt: „Im Leben<br />
<strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“. Wie interpretieren wir dieses Versprechen,<br />
das in unserem Titel steckt?<br />
Auch wenn Bewohnerinnen noch zustimmen konnten <strong>und</strong> unser Haus ausgesucht<br />
haben, ist <strong>der</strong> Wechsel von Zuhause in ein Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim selten<br />
im eigentlichen Sinne freiwillig o<strong>der</strong> gewünscht. Meist wurde er durch die Umstände<br />
<strong>und</strong> die Entwicklung von Krankheit <strong>und</strong> Behin<strong>der</strong>ungen erzwungen. Mit<br />
unserem Wahlspruch „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ maßen<br />
wir uns nicht an, diesen Verlust zu bagatellisieren <strong>und</strong> verlorene Heimat ersetzen<br />
zu können o<strong>der</strong> zu wollen. Mit „Zuhause“ meinen wir deshalb weniger eine<br />
bestimmte Wohnadresse. Als Zuhause bezeichnen die meisten Menschen<br />
den Ort, an dem<br />
• ihnen ein hohes Maß an selbstbestimmter Lebensgestaltung <strong>und</strong> unterstützter<br />
Entscheidungsfreiheit ermöglicht wird.<br />
• sie das Gefühl wertschätzen<strong>der</strong> Beziehung, Geborgenheit <strong>und</strong> Intimität<br />
erleben. 3<br />
1 Siehe auch Präambel <strong>der</strong> Leitlinien <strong>der</strong> Kath.-Evang. Sozialstation Füssen <strong>und</strong> des Hospizvereines Kaufbeuren<br />
Ostallgäu. In: Alsheimer, M. / Stich, V. (2005): Vernetzte Sterbebegleitung im ambulanten Bereich.<br />
Eine Handreichung (nicht nur) für Sozialstationen, Heft 6 <strong>der</strong> Arbeitshilfen <strong>der</strong> Bayerischen Stiftung<br />
Hospiz (www.bayerische-stiftung-hospiz.de)<br />
2 Ähnlich polarisiert den Begriff <strong>der</strong> Würde auch: Reitinger, E. / Heller, A. / Tesch-Römer, C. Zeman, P.<br />
(2004): Leitkategorie Menschenwürde. Zum Sterben in stationären Pflegeeinrichtungen. Freiburg im Br.:<br />
Lambertus, S. 12 f.<br />
3 Vgl. zu den Vorstellungen, die in Umfragen mit „Zuhause“ assoziiert werden: Ewers, M. (2002): Dimensionen<br />
von Patientenorientierung in <strong>der</strong> Pflege Schwerkranker. In: Pleschberger, S. / Heimerl, K. / Wild, M.<br />
(2002) (Hg.): Palliativepflege. Gr<strong>und</strong>lagen für Praxis <strong>und</strong> Unterricht. Wien: facultas, 83<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 87
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Es gilt, diesen Rahmen im Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim zu gestalten - als einzelne<br />
Mitarbeiterin, aber auch als gesamte Organisation. „Es muss klar sein: Mehr<br />
denn je muss Christlichkeit organisational verankert werden“ 1<br />
Dieses Zuhause immer wie<strong>der</strong> im Leben <strong>und</strong> im Sterben zu schaffen, ist unsere<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung. Es zeigt sich: Die Bedeutungen von „Würde“ <strong>und</strong> „Zuhause“<br />
liege nahe nebeneinan<strong>der</strong>.<br />
Ein beson<strong>der</strong>er Prüfstein stellt in diesem Zusammenhang <strong>der</strong> hohe Anteil demenziell<br />
erkrankter Bewohnerinnen in unserem Haus dar (ca. 50% <strong>der</strong> Bewohnerinnen<br />
2 ). Wie kann Würde realisiert werden, wenn Menschen die Fähigkeit<br />
verlieren, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen <strong>und</strong> mit an<strong>der</strong>en<br />
Menschen in Kontakt zu treten? Was kann hier Zuhause schaffen, wenn<br />
Menschen in fremden Welten wan<strong>der</strong>n? Hier benötigen wir eine große Sensibilität<br />
für die verän<strong>der</strong>te Kommunikation <strong>und</strong> die ethische Probleme, 3 um Würde<br />
im Leben <strong>und</strong> Sterben zu sichern. Wir haben deshalb in unserem Konzept<br />
„Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ immer wie<strong>der</strong> auch Aussagen<br />
darüber gemacht, wie wir Würde für demenziell erkrankte Menschen sichern.<br />
10 Merkmale unseres Konzeptes<br />
1. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ nimmt eine Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Zukunft an.<br />
Die stationäre Altenpflege hat sich dramatisch in den letzten Jahren verän<strong>der</strong>t<br />
– auch in unserem Haus. Das Eintrittsalter <strong>der</strong> Bewohnerinnen ist gestiegen,<br />
<strong>der</strong> Anteil schwerstpflegebedürftige <strong>und</strong> demenziell erkrankter Menschen im<br />
Heim ist gewachsen, die durchschnittlich noch verbrachte Lebensspanne im<br />
Heim hat sich deutlich verkürzt. Immer mehr Menschen kommen sterbend zu<br />
uns. „Ein Drittel <strong>der</strong> eintretenden Personen stirbt innerhalb von drei Monaten,<br />
<strong>und</strong> ein zweites Drittel nach spätestens sechs Monaten.“ 4 Viele Einrichtungen<br />
sind auf diese Situation nur unzureichend eingestellt. Die Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation<br />
WHO, vierte Altenpflegebericht <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> die En-<br />
1<br />
Heimerl, K. / Heller, A. / Kittelberger, F. (2005): Daheim sterben. Palliative Kultur im Pflegeheim. Freiburg<br />
im Br.: Lambertus, 25<br />
2<br />
Wir verwenden hier wie auch in unseren an<strong>der</strong>en Texten immer die weibliche Form. Sie macht auf die<br />
Realität im Heim aufmerksam: Die Mehrheit <strong>der</strong> Bewohnerinnen <strong>und</strong> Mitarbeiterinnen sind Frauen.<br />
3<br />
Reiinger, E. / Heller, A. / Tesch-Römer, C. / Zemann, P. (2004); Leitkategorie Menschenwürde. Zum Sterben<br />
in stationären Einrichtung. Freiburg im Br.: Lambertus, 11<br />
4<br />
Sallis Gross, C. (2005): Der ansteckende Tod: Sterbeverläufe im Alters- <strong>und</strong> Pflegeheim,. In: Ewers, M. /<br />
Schaeffer, D. (2005) (Hg.): Am Ende des Lebens. Versorgung <strong>und</strong> Pflege von Menschen in <strong>der</strong> letzten<br />
Lebensphase. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber, S. 167.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 88
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
quetekommission des Deutschen B<strong>und</strong>estages beklagen, dass ältere Menschen<br />
in deutschen Pflegeheimen palliativmedizinisch <strong>und</strong> – pflegerisch unterversorgt<br />
sind, <strong>und</strong> for<strong>der</strong>n neben flankierenden politischen Rahmenbedingungen<br />
entsprechende konzeptionelle Anstrengungen in den Heimen. 1 Diese<br />
politischen For<strong>der</strong>ungen wollen wir gerne praktisch nachkommen. Zugleich<br />
wollen mit unserem Qualitätshandbuch zur Sterbebegleitung innerhalb <strong>und</strong><br />
außerhalb unseres Trägers ein Stückchen vorausgehen <strong>und</strong> Wege zeigen.<br />
2. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ schützt <strong>und</strong> för<strong>der</strong>t die<br />
Individualiät in <strong>der</strong> Sterbebegleitung <strong>und</strong> for<strong>der</strong>t Kreativität <strong>und</strong> Flexibilität<br />
in <strong>der</strong> Pflege.<br />
Darf Sterbebegleitung „standardisiert“ werden? Der Versuch, Sterbebegleitung<br />
in Leitgedanken, Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen zu fassen, mag zunächst befremden.<br />
„O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod; das Sterben, das aus jenem Leben<br />
geht, darin er Liebe hat, Sinn <strong>und</strong> Not …“ 2 , betet Rilke Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
angesichts „mo<strong>der</strong>nen“, einheitlich geregelten Ablebens <strong>und</strong> unpersönlicher<br />
Sterbebegleitung in den großen Spitälern. Diese Form von Standardisierung<br />
wäre auch für uns ein Alptraum. 3 Sterben ist <strong>und</strong> bleibt ein ganz individueller<br />
Prozess. Wir formulieren mit unseren verschiedenen Standards<br />
<strong>kein</strong>e Rezepte, wie Sterbebegleitung abläuft 4 . Was wir schaffen wollen ist ein<br />
verlässlicher Rahmen von Kommunikation <strong>und</strong> pflegerischer Qualität. „Was<br />
Qualität ist, weiß <strong>der</strong> Patient am besten.“ 5 Dieser Rahmen soll einerseits möglichst<br />
viel an Individualität des Sterbenden <strong>und</strong> die Beziehungen <strong>der</strong> Betroffenen<br />
ermöglichen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>seits unseren Mitarbeiterinnen in <strong>der</strong> Pflege <strong>und</strong><br />
den kooperierenden Ärzten Sicherheit <strong>und</strong> Unterstützung garantieren. Wir organisieren<br />
Möglichkeiten, aber <strong>kein</strong>e Zwinglichkeiten! Standards verstehen wir<br />
als „wissensbasierte Problemlösung“ 6 . Sie sollen Denken <strong>und</strong> Kommunikation<br />
anregen, nicht abschalten!<br />
1 Vgl. WHO: Better Palliative Care for Ol<strong>der</strong> Peopl. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe<br />
Enquete-Kommission Ethik <strong>und</strong> Recht <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Medizin (2005): Zwischenbericht. Verbesserung <strong>der</strong><br />
Versorgung Schwerstkranker <strong>und</strong> Sterben<strong>der</strong> in Deutschland durch Palliativmedizin <strong>und</strong> Hospizarbeit<br />
(BT-Drucksache 15/5858). (Download möglich z. B. über: www.dgpalliativmedizin.de)<br />
BMfJ (Hg.): 4. Altenbericht. Risiken, Lebensqualität <strong>und</strong> Versorgung Hochaltriger unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung<br />
demenzieller Erkrankungen<br />
2 Rilke, R.M. (Quelle muss ich noch nachschauen; wahrscheinlich „St<strong>und</strong>enbuch“)<br />
3 Vgl. zu dieser Horrorvorstellung eines „Qualitätskontrolliertem Sterbens“: Gronemeyer, R. (2002): Die späte<br />
Institution. Das Hospiz als Fluchtburg. In: Gronemeyer, R. .; Loewy, E. H. (Hg.) (2992): Wohin mit den<br />
Sterbenden. Hospize in Europa – Ansätze zu einem Vergleich. Münster: LIT, 143<br />
4 Vgl. zu diesem Verständnis von Standards: Stösser, A. von (2003): Pflegestandards. Erneuerung <strong>der</strong><br />
Pflege durch Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Standards. 3. erweiterte <strong>und</strong> überarbeitete Auflage. Berlin: Springer<br />
5 Heilmann, B. (2002): Umbau des Wohlfahrtssystems – Hospiz als Vorreiter? In: Gronemeyer, R.; Loewy,<br />
E. H. (Hg.) (2992): Wohin mit den Sterbenden. Hospize in Europa – Ansätze zu einem Vergleich. Münster:<br />
LIT, 71<br />
6 Bartolomeyczik, S. (2002): Sinn <strong>und</strong> Unsinn von Pflegestandards. Heilberufe (5), 12-16. Dies. (1995):<br />
Pflegestandards kritisch betrachtet. Die Schwester / Der Pfleger (10), 888-892<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 89
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ ist palliativen <strong>und</strong><br />
hospizlichen Gr<strong>und</strong>sätzen verpflichtet<br />
Die Leitlinien <strong>und</strong> Standards entfalten <strong>und</strong> konkretisieren für unser Haus palliatives<br />
<strong>und</strong> hospizliches Denken, das von folgenden Gr<strong>und</strong>sätzen getragen<br />
ist 1 :<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> würdevollen <strong>und</strong> ganzheitlichen Versorgung <strong>und</strong> Begleitung<br />
<strong>der</strong> Betroffenen mit ihren physischen, psychischen, sozialen <strong>und</strong> spirituellen<br />
Belangen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> interdisziplinären Arbeit in multiprofessionellen Teams<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> berufs- <strong>und</strong> bereichsübergreifenden Kooperation<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Orientierung an den Bedürfnissen <strong>und</strong> am Willen <strong>der</strong> Betroffenen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Einbeziehung <strong>der</strong> Angehörigen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> Einbeziehung von Ehrenamtlichen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> fachlichen <strong>und</strong> haltungsmäßigen Vorbereitung, Begleitung<br />
<strong>und</strong> Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen<br />
• Gr<strong>und</strong>satz <strong>der</strong> nachgehenden Trauerbegleitung<br />
4. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ basiert auf Praxis-<br />
Projekten<br />
Bei den folgenden Leitlinien wie auch bei einzelnen Standards haben wir uns<br />
dankbar durch verschiedene Projekte zur Implementierung <strong>der</strong> Hospizidee in<br />
stationäre Einrichtungen inspirieren lassen 2 . Viele <strong>der</strong> Vorschläge <strong>und</strong> Ideen<br />
1 Vgl. die Zusammenstellung von Gr<strong>und</strong>sätzen u. a. Heimerl, K. / Heller, A. / Kittelberger, F. (2005): Daheim<br />
sterben. Palliative Kultur im Pflegeheim. Freiburg im Br.: Lambertus, S. 20 f.<br />
2 B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. / Deutscher <strong>Caritasverband</strong> e.V. / Diakonisches Werk <strong>der</strong> Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland (2004): SORGSAM. Qualitätshandbuch für stationäre Hospize. Wuppertal:<br />
<strong>der</strong> hospiz verlag;<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. (202/3): Die Hospiz-Zeitschrift, Heft 13: Leitbild <strong>und</strong> Hospiz.<br />
Graf, G. (2005/1): Schritte zur Hospizarbeit in <strong>der</strong> stationären Altenhilfe aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Geschäftsführung.<br />
In: Die Hospiz-Zeitschrift, Heft 23<br />
Leitlinien / Konzepte zur Sterbebegleitung finden Sie bei:<br />
Müller, M. / Kessler, G. (2000): Implementierung von Hospizidee <strong>und</strong> Palliativpflege in die Struktur <strong>und</strong><br />
Arbeitsabläufe eines Altenheimes. Eine Orientierungs- <strong>und</strong> Planungshilfe. Bonn: Pallia Med Verlag<br />
Orth, Ch. / Alsheimer, M. (2005): „… nicht sang- <strong>und</strong> klanglos gehen“. Abschlussbericht zur Implementierung<br />
<strong>der</strong> Hospizidee im Leonhard-Henninger-Haus <strong>der</strong> Inneren Mission <strong>München</strong>. Heft 5 <strong>der</strong> Arbeitshilfen<br />
<strong>der</strong> Bayerischen Stiftung Hospiz (www.bayerische-stiftung-hospiz.de)<br />
Alsheimer, M./ Stich, V. (2005): Vernetzte Sterbebegleitung im ambulanten Bereich. Eine Handreichung<br />
(nicht nur) für Sozialstationen. Heft 6 <strong>der</strong> Arbeitshilfen <strong>der</strong> Bayerischen Stiftung Hospiz (www.bayerischestiftung-hospiz.de)<br />
Leitlinien zur Sterbebegleitung (2005) im Caritas-Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim Marienheim Glonn, Bezug: PDL<br />
Frau Mahn, Rotterstr. 10, 85625 Glonn, Tel. 08093 / 90 90 88<br />
Alsheimer, M. (o. J.): Leitgedanken: Sterbebegleitung. F<strong>und</strong>ament für die Entwicklung von Konzeption<br />
von Konzepten <strong>und</strong> Standards. Didaktische Materialien für die Alten- / Krankenpflege <strong>und</strong> Hospizarbeit.<br />
Bezug: M. Alsheimer, Bullbug 11, 86633 Neuburg<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 90
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
haben wir geprüft, ob <strong>und</strong> wie sie in unserer Einrichtung umsetzbar sind. Einiges<br />
war bereits als lebendige Praxis in unserem Haus verwirklicht. Das Konzept<br />
nutzt nicht nur Vorhandenes. Wir haben uns als Einrichtung auf den Weg<br />
eines Praxis-Projektes begeben. Auf diesem Weg wird Bewährtes gesichert<br />
<strong>und</strong> neues erprobt. Alle Mitarbeiterinnen sind daran über Projektgruppen o<strong>der</strong><br />
Fortbildungen beteiligt.<br />
5. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ ist ein Konzept <strong>der</strong> Lebensbegleitung.<br />
Wann beginnt eigentlich Sterbebegleitung? Wir verengen Sterbebegleitung<br />
nicht auf die Terminalphase (die Wochen mit zunehmend eingeschränkter Aktivität<br />
vor einem absehbaren Tod) o<strong>der</strong> auf die Finalphase (die letzten 72<br />
Std.) 1 . So wichtig eine kompetente palliative Pflege gerade in diesen Phasen<br />
ist, die oft schwer o<strong>der</strong> nur rückblickend zu erkennen sind, so hilfreich ist es,<br />
frühzeitig mit Betroffenen <strong>und</strong> Angehörigen über ins Gespräch zu kommen.<br />
Für uns beginnt deshalb die (Sterbe-)Begleitung bereits mit dem Einzug <strong>der</strong><br />
Bewohnerin.<br />
Sie endet auch nicht mit dem Tod <strong>der</strong> Bewohnerin, son<strong>der</strong>n wir praktizieren<br />
sie in Form beson<strong>der</strong>er Aufmerksamkeit für die Angehörigen zeitlich weit darüber<br />
hinaus (z. B. jährliche Gedenkfeier). Selbstverständlich muss dabei immer<br />
<strong>der</strong> Freiheit <strong>der</strong> Beteiligten gewahrt werden, sich mit dem Thema (nicht)<br />
auseinan<strong>der</strong>zusetzen.<br />
6. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ folgt abgesicherten<br />
Zielen<br />
Was heißt Versorgungsqualität am Lebensende? Fünf Aspekte erweisen sich<br />
nach Forschungsergebnissen aus <strong>der</strong> Sicht von Patienten als zentral 2 :<br />
• „Angemessene Schmerz- <strong>und</strong> Symptombehandlung<br />
• Vermeidung unangemessener Verlängerung des Lebens<br />
• Herstellung eines Gefühls von Kontrolle<br />
• Schadensabwendung von Angehörigen<br />
• Stärkung <strong>der</strong> Beziehungen von Angehörigen“<br />
1 Zu <strong>der</strong> begrifflichen Einteilung:: Albert, E. (1993): Hilfen bei <strong>der</strong> Gewinnung <strong>und</strong> Erhaltung von Lebensqualität.<br />
In: Ders.: Bewältigungshilfen für den Krebskranken. Stuttgart, New York: Thieme-Verlag, S.<br />
2 Singer, P. / Bowman, K. (2005): Versorgungsqualität am Lebensende: Eine globale Herausfor<strong>der</strong>ung. In:<br />
Ewers, M. / Schaeffer, D. (2005) (Hg.): Am Ende des Lebens. Versorgung <strong>und</strong> Pflege von Menschen in<br />
<strong>der</strong> letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, S. 23<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 91
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Aus diesen Wünschen haben wir in inhaltlichen Variationen unsere Ziele abgeleitet.<br />
Es sind kommunikative Ziele, denn was konkret „angemessen“ o<strong>der</strong><br />
„unangemessen, „Kontrolle“ o<strong>der</strong> „Schadensabwendung“ <strong>und</strong> „Stärkung“ bedeuten,<br />
darüber entscheiden die Betroffenen. Das muss immer wie<strong>der</strong> erk<strong>und</strong>et,<br />
beraten, verhandelt o<strong>der</strong> begründet vermutet werden.<br />
7. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ ist ein Angebot zu interdisziplinärer<br />
Kooperation <strong>und</strong> Kommunikation<br />
Unsere Leitlinien richten sich an verschiedene Personengruppen. Sie sind<br />
• unser Versprechen an die Bewohnerinnen unseres Hauses <strong>und</strong> ihre Angehörigen,<br />
• ein Kooperationsangebot an unsere Partner in Behandlung, Pflege <strong>und</strong><br />
Betreuung,<br />
• die Orientierung für uns als Mitarbeiterinnen,<br />
• ein Beitrag für die Entwicklung heimübergreifen<strong>der</strong> Qualitätsstandards unseres<br />
Trägers 1<br />
8. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ öffnet ein weites Blickfeld:<br />
Sterben <strong>und</strong> Sterbebegleitung hat einen Betroffenen <strong>und</strong> viele Beteiligte.<br />
In unseren Leitlinien nehmen wir die folgende Betroffenen <strong>und</strong> Beteiligten systematisch<br />
in den Blick <strong>und</strong> formulieren auf sie bezogen unsere Gr<strong>und</strong>haltungen,<br />
Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen 2 :<br />
• Bewohnerinnen<br />
• Angehörige<br />
• Hausärzte / Krankenhaus<br />
• Mitbewohnerinnen<br />
• Bestatter<br />
• Ehrenamtliche Kräfte<br />
• Seelsorger<br />
• Mitarbeiterinnen in Pflege <strong>und</strong> Betreuung, Verwaltung <strong>und</strong> Hauswirtschaft<br />
• Leitung<br />
1 So gewünscht im Provinzialrat <strong>der</strong> Bayerischen Ordensprovinz <strong>der</strong> Barmherzigen Brü<strong>der</strong> am 31.01.05<br />
2 Eine ähnliche Systematisierung liefert auch K. Wilkening in Ihrem Gr<strong>und</strong>lagenbuch: Wilkening, K. / Kunz,<br />
R. (2003): Sterben im Pflegeheim. Perspektiven <strong>und</strong> Praxis einer neuen Abschiedskultur. Göttingen: Van<strong>der</strong>hoeck<br />
<strong>und</strong> Rupprecht<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 92
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
9. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ ist ein überprüfbares<br />
Konzept einer gelebten Palliativkultur mit hohen Qualitätsstandards<br />
Wie sieht die Palliativkultur in unserem Haus aus? In den nachfolgenden Leitlinien<br />
formulieren wir Gr<strong>und</strong>haltungen, denen wir als Mitarbeiterinnen in <strong>der</strong><br />
Sterbebegleitung verpflichtet fühlen, setzen überprüfbare Ziele <strong>und</strong> entwickeln<br />
ein Spektrum von Maßnahmen. Diese werden in beson<strong>der</strong>en Standards<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> präzisiert. Wir haben dabei unsere Antworten anhand<br />
von Schlüsselfragen entwickelt, die die B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz als<br />
Indikatoren für palliative Kompetenz aufgestellt hat. 1 Die Leitlinien <strong>und</strong> Standards<br />
sind nicht Papier; sie sind Teil eines umfangreichen Projektes des gesamten<br />
Hauses. Interne Fortbildungen, Diskussionen <strong>und</strong> Absprachen, Erprobungsphasen<br />
sorgten dafür, dass Leitlinien <strong>und</strong> Standards zukünftig optimal<br />
umgesetzt werden können.<br />
10. „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ ist ein Konzept, das<br />
stetig entwickelt wird<br />
Palliative Betreuung ist in unserem Verständnis <strong>kein</strong> Konzept, das abgeschlossen<br />
ist. Es bedarf <strong>der</strong> steten Überprüfung, ob <strong>und</strong> wie es wirksam ist,<br />
<strong>und</strong> es braucht gut bedachte Weiterentwicklung. Wir haben deshalb eine Reihe<br />
von Möglichkeiten entwickelt, durch die wir direkt <strong>und</strong> indirekt ins Gespräch<br />
kommen wollen, wie das praktizierte Konzept erfahren wird – <strong>und</strong> natürlich:<br />
wie wir es verbessern können. Wir halten z. B. über telefonische Nachgespräche<br />
Kontakt mit den nächsten Angehörigen, holen die Rückmeldung (natürlich<br />
mit Erlaubnis) auch über einen Fragebogen ein. Außerdem organisieren den<br />
regelmäßigen Austausch zu den Fragen <strong>der</strong> Sterbebegleitung im Team, suchen<br />
gezielt den Kontakt mit den Hausärzten <strong>und</strong> den KollegInnen im Krankenhaus.<br />
Die Erfahrungen werden in einem Qualitätszirkel regelmäßig aufgenommen.<br />
Unser Anspruch: eine lebendige Hospizkultur im Haus.<br />
1 BAG Hospiz Fachgruppe: Hospizarbeit in Einrichtungen (erscheint im Herbst 2005). Siehe auch Fragebogen:<br />
„Wie gut ist die Sterbebegleitung bei uns organisiert? 20 organisatorische Fragen. Bezug: M. Alsheimer,<br />
Bullbug 11, 86633 Neuburg<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 93
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: Bewohnerinnen<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Leben <strong>und</strong> Sterben ist ein individueller,<br />
ein einmaliger Prozess. Im<br />
Leben <strong>und</strong> Sterben ein Zuhause<br />
geben bedeutet für uns, die Bedürfnisse,<br />
Vorstellungen <strong>und</strong> Wünsche<br />
<strong>der</strong> Bewohnerin zu erk<strong>und</strong>en<br />
o<strong>der</strong> zu ermitteln <strong>und</strong> nicht eigene<br />
Vorstellungen aufzudrängen o<strong>der</strong><br />
überzustülpen.<br />
Was Lebensqualität in bestimmten Situationen<br />
bedeutet, kann nur <strong>der</strong> einzelne<br />
für sich sagen. Vorrangig entscheidet<br />
also die Bewohnerin über<br />
Maßnahmen o<strong>der</strong> gibt die Richtung<br />
an. Der Sterbende führt „Regie“. Dies<br />
ist allerdings oft nicht mehr direkt <strong>und</strong><br />
aktiv möglich, son<strong>der</strong>n benötigt persönliche<br />
Stellvertretung, die im Sinne<br />
<strong>der</strong> Betroffenen entscheiden <strong>und</strong><br />
Maßnahmen verantworten muss.<br />
Entscheidungen sind in <strong>der</strong> Regel<br />
<strong>kein</strong> einmaliger Akt, son<strong>der</strong>n ein längerer<br />
Prozess. Die Ausein<strong>der</strong>setzung<br />
mit diesen Fragen braucht Zeit, Raum<br />
für Fragen <strong>und</strong> Zweifel, fachk<strong>und</strong>ige<br />
Beratung, mutige Mitverantwortung.<br />
Je früher über die Fragen nachgedacht<br />
wird, umso besser.<br />
„Ich kann einen Sterbenden nur gut<br />
begleiten, wenn ich den Weg zu ihm<br />
rechtzeitig gesucht <strong>und</strong> gef<strong>und</strong>en habe.“<br />
1<br />
Bewohnerin<br />
sieht ihre individuellverstandeneLebensqualitätgesichert<br />
(Bei Demenz:Bewohnerin<br />
scheint<br />
sich nachweislich<br />
wohl zu<br />
fühlen)<br />
Bewohnerin<br />
fühlt sich in<br />
Zweifeln <strong>und</strong><br />
Fragen ernst<br />
genommen.<br />
Bewohnerin<br />
fühlt sich gut<br />
informiert <strong>und</strong><br />
weiß, dass Leben<br />
bis zuletzt<br />
im Heim möglich<br />
ist - ohne<br />
Verkürzung,<br />
aber auch ohne<br />
ungewollte Verlängerung<br />
• Frühzeitiges Abklären, was Lebensqualität<br />
jeweils bedeutet; dabei Eingehen auf evtl.<br />
Ängste, persönliche Erfahrungen mit dem<br />
Sterben an<strong>der</strong>er, welche Maßnahmen auf<br />
jeden Fall nicht gewollt ist<br />
� Gesprächsleitfaden Lebensqualität<br />
sichern<br />
• Bei Demenz: biografisch bedeutsame Informationen<br />
erk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> sorgfältige Zusammenschau<br />
aktueller Reaktionen<br />
� Biografiebogen<br />
• Bei Demenz / komatösen Zuständen:<br />
Training von Mitarbeiterinnen über Formen<br />
nonverbaler Kommunikation in Kontakt zu<br />
sein (Atemarbeit, Basale Stimulation)<br />
� Planung Fortbildungen<br />
• Mut, im pflegerischen Alltag auf direkte<br />
o<strong>der</strong> versteckte Anfragen zum Thema<br />
Sterben zu reagieren<br />
� Interne Fortbildung „Übung Vorstellungen<br />
zur letzten Lebensphase erfahren“<br />
• Regelmäßige Basisschulung von allen<br />
Mitarbeiterinnen zu ethisch-rechtlichen<br />
Fragen<br />
� Interne Fortbildung „Ethisch-rechtliche<br />
Entscheidungen am Lebensende“<br />
• Spezielle Schulung einzelner Kräfte, um<br />
auf Wunsch über Patientenverfügung,<br />
Vorsorgevollmacht <strong>und</strong> Betreuung sachk<strong>und</strong>ig<br />
zu informieren � Ausgebildete<br />
Mitarbeiterinnen für Informationsgespräche<br />
zur Vorsorge 2<br />
• Geeignete Vorsorgedokumente sind vorrätig;<br />
Adressen für weitere Information vorhanden<br />
� Vorsorgemappe des Bayerischen<br />
Staatsministerium für Justiz 3<br />
1 Kojer, M. (o.J.): Palliative Geriatrie. (Vortrag) Download: www.Bayerische-Stiftung-Hospiz.de (Vorträge)<br />
2<br />
Angebote zur Beraterschulung, z. B. Christophorus Hospizakademie, Programm unter www,.izpmuenchen.de<br />
3<br />
Diese beson<strong>der</strong>s empfohlene Vorsorgemappe wurde von Medizinrechtlerm, Medizinern <strong>und</strong> erfahrenen<br />
HospizpraktikerInnen e<br />
Entwickelt. Download unter http://www.justiz.bayern.de/vorsorge.pdf<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 94
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Sterben gehört für uns zum Leben;<br />
Sterbende sind Lebende.<br />
Im Leben <strong>und</strong> Sterben ein Zuhause<br />
geben bedeutet für uns Lebensbegleitung.<br />
Sterbebegleitung ist so<br />
verstanden nichts Spektakuläres.<br />
Die Aufgabe ist, eine Lebenszeit zu<br />
ermöglichen, die jeweils lebenswert<br />
erscheint. Es sind die kleinen<br />
Dinge des Alltags, die wichtig sein<br />
können, z. B. Achtsamkeit im Kontakt,<br />
Da-Sein ohne Geschäftigkeit,<br />
Aufmerksamkeit für die täglichen Bedürfnisse,<br />
Humor)<br />
So verstanden beginnt Sterbebegleitung<br />
bereits mit dem Einzug <strong>der</strong> Bewohnerin.<br />
Unsere Erfahrung: Im Sterben verdichtet<br />
sich das Leben. Die Lebensängste<br />
sind oft auch seine Sterbeängste<br />
<strong>und</strong> die Lebenshoffnungen<br />
prägen auch seine Sterbenshoffnungen<br />
Sterben heißt, sich das Leben „anzueignen“.<br />
Im Leben <strong>und</strong> Sterben<br />
ein Zuhause bedeutet für uns, Menschen<br />
bei ihrer „Lebensernte“ zu<br />
unterstützen 1 .<br />
Wir dienen – soweit von <strong>der</strong> Bewohnerin<br />
gesucht <strong>und</strong> zugelassen – als<br />
Anteil nehmende „Zeugen“ eines Lebens.<br />
In dieser Beziehung entwickeln<br />
sich Chancen, Lebensschätze zu ordnen,<br />
rückblickend vielleicht Sinn im<br />
Unverstanden zu entdecken, Versäumtes<br />
zu betrauern, Verschuldetes<br />
zu verzeihen. Auch in <strong>der</strong> Demenz<br />
tauchen Lebensthemen auf. Integrative<br />
Validation 2 ist eine gute Hilfe, diese<br />
Themen auszudrücken.<br />
Bewohnerin<br />
kann ihren Lebensstil<br />
pflegen<br />
<strong>und</strong> erfährt<br />
Achtung gegenüber<br />
ihren<br />
Werten <strong>und</strong><br />
Gewohnheiten<br />
Bewohnerin<br />
kann mit<br />
Ängsten leben<br />
Bewohnerin erfahren<br />
sich mit<br />
ihrer LebensleistunggewürdigteinschließlichBitterkeiten<br />
<strong>und</strong><br />
Trauer<br />
• Situative Aufmerksamkeit während <strong>der</strong><br />
Pflege <strong>und</strong> regelmäßiges Erfassen von<br />
Zufriedenheit<br />
� Pflegevisite<br />
• Kontakte zu Haustieren werden vermittelt.<br />
(Auch diese können Lebens- <strong>und</strong> Sterbebegleiter<br />
sein)<br />
� „Ein tierisches Vergnügen – Nachmittage<br />
mit dem Besuchsdienst des Tierheims“<br />
• Ängste nicht wegreden, son<strong>der</strong>n Raum<br />
geben („Klagemauer“); Wissen um hilfreiche<br />
Impulse <strong>und</strong> Symbolsprache des<br />
Trostes („Gesten helfen oft mehr als Worte“)<br />
� Interne Fortbildung „Menschen in<br />
Krisen begleiten“<br />
• Aushalten <strong>der</strong> eigenen Hilflosigkeit <strong>und</strong><br />
Reflexion <strong>der</strong> eigenen oft überhöhten Erwartungen<br />
in <strong>der</strong> Pflege („Therapeutisierung“<br />
<strong>der</strong> Begleitung); immer wie<strong>der</strong> sich<br />
(gegenseitig) erinnern, dass Mitgefühl ohne<br />
Erwartungsdruck die Basis für wirkliche<br />
Nähe<br />
� Interne Fortbildung: „Begleitung von<br />
Menschen bei Lebensmüdigkeit“<br />
• Demenz: Training von Mitarbeiterinnen auf<br />
Ängste validierend zu reagieren<br />
• Schaffen eines biografisch ausgerichteten<br />
anregenden Milieus (über Gegenstände,<br />
Musik, Formen <strong>der</strong> Geselligkeit, Symbole,<br />
Gesprächsanlässe), das Selbstachtung<br />
unterstützt, schöne Erinnerungen weckt,<br />
Traurigkeiten zulässt.<br />
• Respekt <strong>der</strong> Pflegekräfte vor dem Vertraulichen,<br />
Verschlossenen, Fremden<br />
� Interne Fortbildung: „Kreative lebensgeschichtliche<br />
Impulse“<br />
1 Lückel, K. (1993): Das war mein Leben. „Lebensbilanz“ in <strong>der</strong> Begleitung schwerkranker, sterben<strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
trauern<strong>der</strong> Menschen. Ein Beitrag aus <strong>der</strong> Gestaltseelsorge. Wege zum Menschen, 45. Jg., 198 f.<br />
Lukas, E. (2004): Alles fügt sich <strong>und</strong> erfüllt sich. Die Sinnfrage im Alter, 6. Auflage, Gütersloh: Gütersloher<br />
Verlagshaus, 47 ff.<br />
2 B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft Hospiz (Hg.) (2004): Mit-Gefühlt. Curriculum zur Begleitung Demenzkranker<br />
in ihrer letzten Lebensphase. Wuppertal: <strong>der</strong> hospiz verlag<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 95
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: Angehörige<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Sterben betrifft nicht nur eine Person.<br />
Es trifft Menschen, die dieser<br />
Person angehören. Wir verstehen<br />
unter Angehörige nicht nur Familienmitglie<strong>der</strong>,<br />
son<strong>der</strong>n auch Fre<strong>und</strong>innen,<br />
Nachbarinnen o<strong>der</strong> Betreuerin.<br />
Im Leben <strong>und</strong> Sterben ein Zuhause<br />
geben bedeutet für uns, Angehörige<br />
einzubeziehen <strong>und</strong> nach unseren<br />
<strong>und</strong> ihren Möglichkeiten zu unterstützen.<br />
Sie sind für die meisten<br />
Menschen von zentraler Bedeutung.<br />
Angehörige sind eine Brücke zum<br />
bisherigen Leben. Wir sehen <strong>und</strong><br />
brauchen sie als Partnerinnen. Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
innerhalb von Familien<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Generationen begreifen<br />
wir als Normalität. Gerade das Sterben<br />
eines Familienmitglieds erschüttert<br />
das ganze System.<br />
Es ist eine verbreitete Erfahrung (…),<br />
dass <strong>der</strong> Sterbende häufig das kleinere,<br />
die Angehörigen hingegen das<br />
größere Problem sind <strong>und</strong> haben.“ 1<br />
Das heißt für uns auch auszuhalten<br />
<strong>und</strong> zu akzeptieren, dass Beziehungen<br />
in Familien manchmal entfremdet,<br />
zerrüttet o<strong>der</strong> zerstört sind. Wir<br />
können <strong>und</strong> wollen diese familiären<br />
Beziehungen nicht ersetzen <strong>und</strong><br />
Tochter o<strong>der</strong> Sohn „spielen“. Aber wir<br />
können <strong>der</strong> Bewohnerin die uns jeweils<br />
mögliche Beziehung anbieten:<br />
menschliche Nähe bei professioneller<br />
Distanz. Wir vertrauen dabei auch auf<br />
die Unterschiedlichkeit im Team, die<br />
unterschiedliche Sympathien zulässt.<br />
Angehörige erfahren<br />
sich<br />
auch in <strong>der</strong><br />
Sterbebegleitung<br />
als die<br />
wichtigsten <strong>und</strong><br />
willkommene<br />
Partnerinnen –<br />
Begegnung<br />
ohne Vorwürfe<br />
Angehörige<br />
fühlen sich -<br />
nach ihren<br />
Wünschen <strong>und</strong><br />
Möglichkeiten<br />
informiert - einbezogen<br />
<strong>und</strong><br />
unterstützt in<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
• Frühzeitiges Abklären, dabei Eingehen auf<br />
evtl. Schuldgefühle, persönliche Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Mitwirkung, Verantwortlichkeiten<br />
bei stellvertretenden Entscheidungen<br />
(z.B. Betreuung), Beratung in Fragen <strong>der</strong><br />
Vorsorge<br />
� Gesprächsleitfaden „Lebensqualität<br />
sichern“ � Gesprächsleitfaden „Hilfe<br />
bei Schuldgefühlen“<br />
• Besprechen, wie mit Konflikten <strong>und</strong> Beschwerden<br />
umgegangen wird<br />
� Interne Fortbildung „Begleiten von<br />
Angehörigen – Umgang mit Vorwürfen“<br />
• Anbieten von Vermittlung bei familiären<br />
Konflikten mit verständnisvoller Distanz<br />
diplomatischer Neutralität, Diskretion <strong>und</strong><br />
Zurückhaltung<br />
• Info-Abende für Angehörige mit Themen<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung in regelmäßigem<br />
Abstand<br />
• Eine Ansprechpartnerin für Angehörige in<br />
<strong>der</strong> Schicht wird genannt<br />
• Informieren nach Absprache<br />
• Anleitung kleiner praktische Hilfen für<br />
sterbenden Bewohnerinnen (z. B. M<strong>und</strong>pflege)<br />
• Anbieten von Essen <strong>und</strong> Trinken in <strong>der</strong><br />
Zeit <strong>der</strong> Begleitung<br />
• Gästebett vorhanden, das ins Zimmer gestellt<br />
werden kann<br />
• Fernbleibende o<strong>der</strong> selten kommende Angehörige<br />
ohne Vorwurf begegnen<br />
• Anleitung für den Umgang mit demenziell<br />
erkrankten Bewohnerinnen<br />
• Gästezimmer (3. Stock), um übernachtenden<br />
Angehörigen Auszeiten zu ermöglichen<br />
• Zusammenfassung im � Faltblatt „Wenn<br />
mein Angehöriger im Heim stirbt …“<br />
1 Student, J.-Ch. / Mühlum, A. / Student, U. (2004): Soziale Arbeit in Hospiz <strong>und</strong> Palliative Care. <strong>München</strong>:<br />
UTB, S. 54<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 96
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Nicht nur die Bewohnerin selbst befindet<br />
sich in einer noch nie da gewesenen<br />
Situation. Auch ihre Angehörigen<br />
sind in einer neuen Situation. Viele<br />
Menschen haben Krankheit <strong>und</strong><br />
Sterben bisher nicht nah <strong>und</strong> direkt in<br />
ihrer Umgebung erlebt. Es kann<br />
schwer sein, den Verfall eines nahen<br />
Angehörigen zu erleben.<br />
Der Tod mag – obwohl für Außenstehende<br />
vielleicht erwartbar – den nahen<br />
Angehörigen doch überraschend<br />
treffen. Das Sterben – gerade das<br />
Sterben eines nahen Menschen –<br />
provoziert oft ein Chaos an Gefühlen.<br />
Es verstört <strong>und</strong> löst manchmal Reaktionen<br />
aus, die auch die Umgebung irritieren<br />
mag. Wir wissen, Trauer ist<br />
nicht nur Traurigkeit, son<strong>der</strong>n Trauer<br />
hat viele Gesichter: Schock, <strong>kein</strong> Gefühl<br />
mehr, Wut, Erleichterung, Dankbarkeit.<br />
Auch ein Fernbleiben kann<br />
eine Trauerreaktion sein. Trauer kann<br />
sich auch in Schuldvorwürfe gegenüber<br />
an<strong>der</strong>en verwandeln.<br />
Trauer braucht Ausdruck. Wir wissen<br />
um die heilsame Kraft von Ritualen<br />
<strong>und</strong> ermutigen Angehörige dazu, die<br />
vielfältigen heiminternen Angebote zu<br />
nutzen <strong>und</strong> nach ihren Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Bedürfnissen mitzugestalten.<br />
Angehörige<br />
sehen sich in<br />
<strong>der</strong> Zeit des<br />
Abschieds <strong>und</strong><br />
danach gut unterstützt<br />
• Belastende Ereignisse <strong>und</strong> Gefühle in all<br />
ihrer Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeit ohne Wertung<br />
besprechen<br />
� Interne Fortbildung „Begleiten von<br />
Angehörigen – Umgang mit Trauerreaktionen“<br />
• Abschied in räumlich angenehmer Atmosphäre<br />
ohne Zeitdruck möglich (mindestens<br />
bis zu 24 Std.)<br />
� Gestaltungskonzept: Raum des Abschied<br />
• Anbieten symbolisch-ritueller Möglichkeiten<br />
(symbolische Gegenstände, Bildkarten<br />
Texte, Gebete, Musik) Texte „tröstliche<br />
Gedanken“<br />
� Standard: Versorgung <strong>und</strong> Verabschiedung<br />
Verstorbener<br />
• Angebot � „Buch <strong>der</strong> Erinnerung“ gestalten<br />
(ein Blatt kann mitgenommen <strong>und</strong><br />
später eingeheftet werden)<br />
• Gesprächspartnerinnen organisieren (z. B.<br />
Hospizhelferinnen), falls Zeit nicht ausreicht<br />
� Konzept: Sitzwachengruppe<br />
• Adressen bereithalten <strong>und</strong> aktualisieren<br />
für „nachgehende Trauerbegleitung“ <strong>und</strong><br />
Trauergruppen (z. B. „Trauercafe“)<br />
• Einladung zur Aussegnung � Handreichung<br />
„Das Ritual <strong>der</strong> Aussegnung“<br />
• Gemeinsame Kondolenzkarte <strong>der</strong> Mitarbeiterinnen<br />
schicken „Motiv: Wir denken<br />
an Sie …“ � Abschiedsritual im Team“<br />
• Beteiligen des Hauses bei <strong>der</strong> Bestattung<br />
in symbolischer o<strong>der</strong> persönlicher Form<br />
• Gestalten von Erinnerungsfeiern, die auch<br />
persönliche Zeichen ermöglichen<br />
� Handreichung Gedenkfeier<br />
• Erfahrungen von Angehörigen zur Sterbebegleitung<br />
in unserem Haus werden eingeholt<br />
<strong>und</strong> für Verbesserungen, aber auch<br />
Anerkennung von Leistungen <strong>der</strong> Mitarbeiterinnen<br />
genutzt<br />
� Fragebogen „Wie sind Sie als Angehörige/r<br />
zufrieden? � Gesprächshilfe<br />
Telefonische Nachsorge<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 97
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: Mitbewohnerinnen<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Das Sterben betrifft die Gemeinschaft<br />
<strong>der</strong> Mitbewohnerinnen. Wie<br />
wir mit Sterbenden <strong>und</strong> Verstorbenen<br />
umgehen, setzt Zeichen für die<br />
Lebenden.<br />
Im Leben <strong>und</strong> Sterben ein Zuhause<br />
geben bedeutet für uns, aus dem<br />
Sterben für die lebenden Mitbewohnerinnen<br />
<strong>kein</strong> ängstigendes<br />
Tabu zu machen, son<strong>der</strong>n vielfältige<br />
<strong>und</strong> persönliche Möglichkeiten<br />
des Abschieds anzubieten.<br />
In Zeiten des Sterbens von Bewohnerinnen<br />
gilt unsere Aufmerksamkeit<br />
auch beson<strong>der</strong>s den Mitbewohnerinnen.<br />
In unserem sichtbaren Umgang<br />
mit Sterben <strong>und</strong> Tod erfahren sie ein<br />
Stück eigene Zukunft. „Es ist wie ein<br />
Vorsterben“ (Aussage einer Bewohnerin).<br />
Entsprechend kann dieses<br />
Verhalten Ängste provozieren o<strong>der</strong> –<br />
wie wir hoffen – Ängste verringern.<br />
Verstorbene verschwinden in unserem<br />
Haus nicht spurlos <strong>und</strong> heimlich.<br />
Alles was heimlich ist wird unheimlich.<br />
Dazu braucht es Offenheit ohne ein<br />
Bedrängen. Unsere Maxime: Wir gestalten<br />
alle Maßnahmen so, dass jede<br />
Mitbewohnerin den Abstand wahren<br />
darf o<strong>der</strong> die Form von Beteiligung<br />
findet, wie sie es jeweils benötigt.<br />
Wir pflegen <strong>kein</strong>e Kultur des Todes,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> lebendigen Verbindung.<br />
Mitbewohnerinnen<br />
fühlen<br />
sich über Abschiedskultur<br />
<strong>und</strong> aktuelle<br />
Sterbeprozesse<br />
gut informiert<br />
<strong>und</strong> einbezogen<br />
Mitbewohnerinnen<br />
können<br />
ihren gewünschtenAbstand<br />
zum<br />
Thema <strong>und</strong><br />
Geschehen<br />
wahren<br />
Mitbewohnerinnen<br />
erleben<br />
den Umgang<br />
mit sterbenden<br />
<strong>und</strong> verstorbenen<br />
Menschen<br />
als würdig<br />
Mitbewohnerinnen<br />
pflegen<br />
Erinnerungskultur<br />
mit Menschen,<br />
denen<br />
sie sich verb<strong>und</strong>en<br />
fühlen<br />
• Thematisierung von Sterben <strong>und</strong> Tod ist<br />
immer wie<strong>der</strong> im Beschäftigungskreis <strong>und</strong><br />
in beson<strong>der</strong>en Veranstaltungen<br />
• Mitbewohnerinnen werden eingeladen, in<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung durch den Sitzwachenkreis<br />
mitzumachen.<br />
� Konzept „Sitzwachengruppe“<br />
• Symbolische Aufnahme <strong>und</strong> Verabschiedung<br />
von Bewohnerinnen über den „Baum<br />
des Lebens“ (Jedes Blatt ist eine Bewohnerin)<br />
• Absprache in Doppelzimmern, ob Mitbewohnerin<br />
auch in dieser Zeit bleiben will;<br />
ein Paravent kann Intimität wahren; ansonsten<br />
steht in <strong>der</strong> Regel ein Ausweichzimmer<br />
zur Verfügung<br />
• Ansprechend gestaltete Todesanzeigen<br />
<strong>und</strong> kleine „Erinnerungsaltäre“ für aktuell<br />
verstorbene Bewohnerinnen auf jedem<br />
Stockwerk<br />
• Brennende Kerze zu den Essenszeiten am<br />
Platz <strong>der</strong> Verstorbenen<br />
• Erinnern an Verstorbene in <strong>der</strong> Heimzeitung<br />
• Ermutigen, persönlich sich bei befre<strong>und</strong>eten<br />
Bewohnerinnen zu verabschieden<br />
• Einladen zur Aussegnung, Andacht <strong>und</strong><br />
Rosenkranz<br />
• Nach Möglichkeit <strong>und</strong> Wunsch Fahrgelegenheiten<br />
zur Beerdigung organisieren<br />
o<strong>der</strong> eine symbolische „Teilnahme“ ermöglichen<br />
(z. B. Kerze den Angehörigen<br />
mitgeben)<br />
• Auf Wunsch Totenbildchen als Erinnerung<br />
besorgen <strong>und</strong> verteilen<br />
• Angebot einer Andacht im Heim, wenn<br />
Bewohner im Krankenhaus stirbt (Bewohnerin<br />
ist durch Foto in unserer Mitte präsent)<br />
• Einladung zur jährlichen Erinnerungsfeier<br />
mit <strong>der</strong> Möglichkeit, diese mitzugestalten<br />
� Programmplanung „Beschäftigung“<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 98
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: Ärzte / Krankenhaus<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung Unsere Ziele Unsere Maßnahmen<br />
Sterben ist oft ein schwerer Weg,<br />
<strong>der</strong> mit physischen, sozialen, seelischen<br />
<strong>und</strong> spirituellen Schmerzen<br />
verb<strong>und</strong>en.<br />
Im Leben <strong>und</strong> Sterben ein Zuhause<br />
geben bedeutet für uns, für eine<br />
optimale Schmerztherapie <strong>und</strong><br />
Symptomkontrolle zu sorgen <strong>und</strong><br />
diese pflegerisch <strong>und</strong> begleitend zu<br />
unterstützen<br />
Etwa 80% <strong>der</strong> Bewohnerinnen in Pflegeheimen<br />
leiden krankheitsbedingt an<br />
chronischen Schmerzen 1 .<br />
Schmerz ist nicht nur eine physische<br />
Wahrnehmung, son<strong>der</strong>n kann beeinflusst,<br />
verstärkt o<strong>der</strong> überlagert werden<br />
durch psychische Faktoren. Deshalb<br />
versuchen wir alle Faktoren, die<br />
die Schmerzintensität beeinflussen<br />
können, in den Blick zu bekommen<br />
(z.B. Angst, Sorgen, Schlaflosigkeit).<br />
Schmerz kann nicht objektiv von außen<br />
bemessen, son<strong>der</strong>n nur subjektiv<br />
angegeben werden. Wir folgen dem<br />
Gr<strong>und</strong>satz: „Schmerz ist, was <strong>der</strong> Patient<br />
sagt, <strong>und</strong> existiert, wann immer<br />
er es sagt.“ 2 An erster Stelle stehen<br />
eine optimale Schmerztherapie <strong>und</strong><br />
Symptomkontrolle. Die Behandlung<br />
liegt zunächst in <strong>der</strong> Verantwortung<br />
des Hausarztes. Wir unterstützen<br />
durch gute Schmerzbeobachtung,<br />
fachk<strong>und</strong>ige Beratung <strong>und</strong> mit Hilfe<br />
<strong>der</strong> pflegerischen Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Schmerz- <strong>und</strong> Symptomlin<strong>der</strong>ung. Wir<br />
wissen, dass in <strong>der</strong> Schmerztherapie<br />
oft noch Aufklärung bedarf bei Betroffenen,<br />
Angehörigen, Betreuerinnen<br />
<strong>und</strong> Ärztinnen.<br />
Die Bewohnerinnen<br />
haben<br />
die Sicherheit,<br />
dass in Zeiten<br />
<strong>der</strong> Krise in ihrem<br />
Sinne gehandelt<br />
wird<br />
Ungewollte<br />
Einweisung in<br />
ein Krankenhaus<br />
wird vermieden<br />
Die Entscheidungen<br />
sind<br />
klar <strong>und</strong> korrekt<br />
dokumentiert.<br />
Die wichtigen<br />
Dokumente<br />
sind korrekt<br />
hinterlegt<br />
Die Bewohnerinnen<br />
fühlen<br />
sich schmerzfrei<br />
o<strong>der</strong> für sie<br />
erträglich<br />
schmerzreduziert<br />
Symptome sind<br />
erträglich<br />
gelin<strong>der</strong>t<br />
• Möglichst frühzeitig wird Bewohnerin /<br />
Betreuerin auf die Möglichkeit <strong>der</strong> Krisenvorsorge<br />
/ Notfallplanung aufmerksam<br />
gemacht <strong>und</strong> eine entsprechende Beratung<br />
vermittelt <strong>und</strong> im Gespräch unterstützt<br />
� Standard „Krisenvorsorge<br />
treffen“ „Krankenhaus – ja o<strong>der</strong> nein?“<br />
• Hausärzte werden über die gewünschte<br />
Notfallplanung in unserem Haus informiert<br />
<strong>und</strong> die Art <strong>der</strong> Dokumentation abgesprochen<br />
� Musterbrief für Hausärzte <strong>und</strong> Notärzte<br />
• Notfallplan ist möglichst für jede Bewohnerin<br />
angelegt <strong>und</strong> bekannt<br />
� Dokumentation: Notfallplan / Ärztlicher<br />
Bericht<br />
• Die Mitarbeiterinnen wissen über Verhalten<br />
in Notfällen Bescheid<br />
� Interne Fortbildung „Ethischrechtliche<br />
Entscheidungen am Lebensende“<br />
• Eine ausgebildete Palliative-Care-Fachkraft<br />
im Heim steht Ärzten pflegerisch beratend<br />
zur Seite<br />
• Anlegen einer kleinen � Fachbibliothek<br />
zur Schmerztherapie <strong>und</strong> Symptomkontrolle<br />
• Regelmäßige Fortbildungsveranstaltung<br />
für Hausärzte zu „Schmerztherapie“<br />
• � Hotline zu örtlichem Schmerztherapeut<br />
für kollegiale Beratung in schwierigen<br />
Fällen wird angeboten o<strong>der</strong> selbst genutz<br />
• Unterstützung <strong>der</strong> ärztlichen Schmerztherapie<br />
durch gute Dokumentation <strong>der</strong> pflegerischen<br />
Mitarbeiterinnen<br />
� Standard „Schmerzmanagement“ �<br />
Dokumentation „Schmerzerfassung bei<br />
demenziell erkrankten Bewohnerinn<br />
1<br />
Kojer, M. / Schmidl, M. (o.J.): Praxis <strong>der</strong> palliativen Geriatrie (Vortrag). Download: www.bayerischestiftung-hospiz.de<br />
(Arbeitshilfen, Vorträge)<br />
2<br />
Binsack, T. (2000): Ganzheitliche Aspekte im Umgang mit Schmerz. In: Hiemenz, T. / Kottnik, R. (Hg.):<br />
Chancen <strong>und</strong> Grenzen <strong>der</strong> Hospizbewegung. Freiburg i.Br.: Lambertus, S. 77-81.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 99
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konzept-Beispiel<br />
Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen 1<br />
Konzept zur Sterbebegleitung (Sozialstation Füssen)<br />
Hinweise zur Verwendung::<br />
Welche Gedanken <strong>und</strong> organisatorischen Ideen würden Sie in ein Konzept zur<br />
Sterbebegleitung aufnehmen? Das Beispiel präsentiert eine Variante für Leitlinien<br />
zur Sterbebegleitung, die . Sie können als Diskussions- <strong>und</strong> Formulierungshilfe<br />
verwenden, um in <strong>der</strong> Projektgruppe eigene Leitlinien zu entwickeln.<br />
Die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Projektgruppe können dabei Formulierungen aus dem Material<br />
übernehmen, Abschnitte umformulieren o<strong>der</strong> eigene Gedanken entwickeln.<br />
Unsere Aufgabe: Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen für ein<br />
Sterben in Würde<br />
Sterben ist ein ganz individueller Prozess. Sterbebegleitung lässt sich zeitlich<br />
<strong>und</strong> inhaltlich nicht detailliert im Voraus festlegen. Aber: Wir können einen verlässlichen<br />
Rahmen schaffen, <strong>der</strong> diese Individualität ermöglicht <strong>und</strong> schützt.<br />
Darin sehen wir unsere beson<strong>der</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung.<br />
In unserem christlichen Gr<strong>und</strong>verständnis hat je<strong>der</strong> Mensch <strong>und</strong> jede Lebensphase<br />
- <strong>und</strong> gerade auch die Phase <strong>der</strong> Krankheit <strong>und</strong> des Sterbens - einen<br />
eigenen Wert <strong>und</strong> eine eigene Würde.<br />
Die Würde eines Menschen wurzelt in seiner Gottesebenbildlichkeit. Im praktischen<br />
Handeln <strong>der</strong> Sterbegleitung muss die Menschenwürde durch folgende<br />
beiden Aspekte, die sich gegenseitig bedingen, von uns verwirk-licht werden:<br />
• Wir möchten den schwerkranken Menschen durch die Art unserer Pflege<br />
<strong>und</strong> Begleitung erleben lassen, dass er mit <strong>und</strong> trotz seiner Krankheit <strong>und</strong><br />
1 Entwickelt im Projekt: „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“, Pflegeheim <strong>der</strong> Bamherzigen<br />
Brü<strong>der</strong>, St. Augustyn Neuburg a.d.D., Franziskaner Str. B 127, 86633 Neubug a.d.Donau, Projektleitung:<br />
Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dora Schmidt (PDL)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 100
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gebrechlichkeit wertvoll um seiner selbst willen ist (= Beziehungs-Aspekt<br />
<strong>der</strong> Menschenwürde).<br />
• Wir achten das unbedingte Selbst-bestimmungsrechtes des schwerkranken<br />
Menschen <strong>und</strong> versuchen, es immer wie<strong>der</strong> zu sichern (= Autonomie-Aspekt<br />
<strong>der</strong> Menschenwürde).<br />
Die folgenden Leitlinien zur Sterbebegleitung formulieren Überzeugungen <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter <strong>der</strong> kath.-evang. Sozialstation <strong>und</strong> Kurzzeitpflege Füssen <strong>und</strong> des<br />
Hospizvereines Kaufbeuern / Ostallgäu. Wir halten fest, was wir unter Sterbebegleitung<br />
verstehen, was diese alles umfasst <strong>und</strong> welche Gr<strong>und</strong>haltungen<br />
uns wichtig sind. Nach innen bieten die Leitlinien uns Orientierung <strong>und</strong> weisen<br />
uns den Weg für detaillierte organisatorische Überlegungen <strong>und</strong> Vereinbarungen.<br />
Nach außen sind sie unser Versprechen für die Betroffenen <strong>und</strong> ihre<br />
Familien.<br />
Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung<br />
Sterbebegleitung verstehen wir als Lebensbegleitung. Im Mittelpunkt steht<br />
deshalb alles, was das Leben bewegt:: Traurigkeiten <strong>und</strong> Heiterkeiten, Rückblicke<br />
<strong>und</strong> Hoffnungen, Glaubensfragen <strong>und</strong> Zweifel, Schmerzen <strong>und</strong> Wohlbefinden<br />
- kurz: die "kleinen Dinge" des Alltags <strong>und</strong> die großen Fragen des Lebens<br />
... Um hier unterstützen<strong>der</strong> Partner sein zu dürfen, braucht es Vertrauen.<br />
Dieses kann entstehen über unser Interesse am Leben des an<strong>der</strong>en, unsere<br />
Verlässlichkeit, unsere Achtsamkeit. Biografiearbeit ist deshalb für uns ein<br />
wertvoller Schlüssel für eine individuelle Pflege <strong>und</strong> Sterbebegleitung. Wir blicken<br />
zurück auf das, was jemand geprägt hat (= Unterstützung bei <strong>der</strong> Lebensbilanz),<br />
beachten, was den Menschen im Augenblick beson<strong>der</strong>s beschäftigt<br />
(= Lebensbewältigung) <strong>und</strong> erk<strong>und</strong>en, mit welchen Ängsten <strong>und</strong> Hoffnungen<br />
er seine Zukunft sieht (Lebensplanung). Mit Erlaubnis des Betroffenen<br />
halten wir bedeutsame Informationen fest, um eine biografie-orientierte Pflege<br />
zu sichern (� Siehe Biografiebogen Sozialstation).<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: Wir respektieren die Gefühle <strong>und</strong> Gedanken <strong>der</strong> Patienten<br />
<strong>und</strong> versuchen, diese nicht auszureden, abzulenken o<strong>der</strong> zu verharmlosen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 101
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Im Mittelpunkt: Die Vorstellungen <strong>und</strong> Wünsche von Patienten<br />
Sterbebegleitung bedeutet für uns, Wünsche zur letzten Lebensphase zu erspüren<br />
<strong>und</strong> zu respektieren. Wir sind hellhörig für entsprechende Signale. Je<br />
nach Verfassung <strong>und</strong> Bereitschaft <strong>der</strong> Patienten suchen wir auch das direkte<br />
Gespräch (z.B. über Behandlungsziele, lebensverlängernde Maßnahmen,<br />
persönliche Wünsche <strong>und</strong> Sorgen) (� Leitfaden für Gespräch: Vorstellungen<br />
zur letzten Lebensphase). Wir erk<strong>und</strong>en, ob Patientenverfügungen existieren,<br />
ermutigen dazu, sich damit auseinan<strong>der</strong>zusetzen <strong>und</strong> vermitteln bei<br />
Interesse entsprechende Information (� Vorstellungen sichern - Informationen<br />
zu Vorsorgedokumenten. )<br />
Wir sind offen für Glaubensfragen, knüpfen - wenn gewollt - den Kontakt zur<br />
Seelsorge <strong>und</strong> informieren den Kranken über die Möglichkeiten, zusätzliche<br />
Unterstützung durch den Hospizdienst zu bekommen. Geäußerte Wünsche<br />
zur letzten Lebensphase o<strong>der</strong> zur Behandlung nach dem Versterben werden<br />
mit Einverständnis des Betroffenen entsprechend in <strong>der</strong> Dokumentation gesichert.<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: Der kranke Mensch führt Regie! Nur er weiß letztendlich,<br />
was für ihn gut <strong>und</strong> wichtig ist. Wir stehen lediglich unterstützend <strong>und</strong> beratend<br />
zur Seite.<br />
Sterbebegleitung ist praktische Unterstützung für höhere<br />
Lebensqualität<br />
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Sterbenden in seiner gewohnten Umgebung<br />
zu belassen. Wir stellen bei Bedarf die notwendigen Hilfsmittel zur<br />
Verfügung <strong>und</strong> geben Anleitung, um sie sicher <strong>und</strong> effizient einzusetzen. Betroffene<br />
<strong>und</strong> Angehörige können wir zusätzlich zur Pflege gezielt entlasten<br />
durch unser breites Leistungsangebot bei <strong>der</strong> hauswirtschaftlichen Versorgung<br />
(Einkauf, Wäsche, Wohnungsreinigung, Essen auf Rä<strong>der</strong>)<br />
Sterbebegleitung ist Teamarbeit <strong>und</strong> persönliche Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
Das Sterben von Menschen führt uns oft an Grenzen - im Team <strong>und</strong> persönlich.<br />
Bei <strong>der</strong> Begleitung sollten wir uns selbst nicht mit zu hohen Erwartungen<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 102
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
überfor<strong>der</strong>n (z.B. Vorstellung einer ständigen Betreuung r<strong>und</strong> um die Uhr<br />
durch die Pflegekräfte).<br />
Sterbebegleitung braucht nicht nur persönliches Engagement einzelner Pflegekräfte,<br />
son<strong>der</strong>n erfor<strong>der</strong>t vor allem Teamarbeit. Entscheidend ist ein guter<br />
Informationsaustausch zwischen den Beteiligten (Leitung, Mitarbeiter <strong>der</strong><br />
Pflege <strong>und</strong> Hauswirtschaft, Angehörige, Betreuer, Ärzte, Seelsorge, Hospizdienst).<br />
Wo immer möglich, werden wir flexibel sein <strong>und</strong> Unterstützung für die<br />
Betroffenen <strong>und</strong> die beteiligten Teammitglie<strong>der</strong> organisieren (z.B. Hospizhelfer,<br />
Springer im Team). Wir achten <strong>und</strong> nutzen dabei die unterschiedlichen<br />
<strong>und</strong> beson<strong>der</strong>en persönlichen Beziehungen, die im Team zum jeweiligen<br />
kranken Menschen <strong>und</strong> seiner Familie entstanden sind. Entsprechend stellen<br />
wir ein kleines Pflegeteam zusammen, das mit dem Sterbenden <strong>und</strong> seiner Situation<br />
vertraut ist. Das gesamte Pflegeteam unterstützt diese Gruppe, so<br />
dass die Kollegen möglichst ohne Zeitnot arbeiten können.<br />
Das nahe Sterben von Menschen, die wir betreuen, konfrontiert uns als Mitarbeiter<br />
in <strong>der</strong> Pflege persönlich mit unserer eigenen Endlichkeit <strong>und</strong> Zerbrechlichkeit.<br />
Deshalb brauchen <strong>und</strong> schaffen wir im Team Aufmerksamkeit <strong>und</strong><br />
Raum für Gefühle <strong>und</strong> Gedanken. "Der Tod unterbricht bei uns die Tagesordnung".<br />
Wir pflegen im Team das gemeinsame Gedenken an Verstorbene <strong>und</strong><br />
för<strong>der</strong>n Möglichkeiten für einen persönlichen Abschied. Bei Belastungen einzelner<br />
Kollegen suchen wir im Gespräch nach guten Lösungen.<br />
Wir nutzen für die eigene Selbstpflege z.B. die verschiedenen Fortbildungen in<br />
diesem Bereich. Hospizverein <strong>und</strong> Sozialstation organisieren hier regelmäßige<br />
Angebote. Das Thema Sterbebegleitung ist auch Teil des Bewerbungsgespräches<br />
<strong>und</strong> einer guten Einarbeitung.<br />
Sterbebegleitung heißt für uns auch, dass wir uns immer wie<strong>der</strong> unserer eigenen<br />
christlichen Gr<strong>und</strong>haltung vergewissern (z.B. Was gibt mir Halt angesichts<br />
von Krankheit <strong>und</strong> Leiden?). Für diese Auseinan<strong>der</strong>setzung gibt es in unserer<br />
Einrichtung entsprechend Raum <strong>und</strong> Zeit (z.B. Fortbildungen, Besinnungstage).<br />
Dies ermöglicht uns, mit Offenheit <strong>und</strong> Wertschätzung an<strong>der</strong>en Glaubensrichtungen<br />
o<strong>der</strong> Weltanschauungen zu begegnen.<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: In die Sterbebegleitung fließen immer eigene Überzeugungen<br />
ein. Als Begleiter sind wir bereit, unsere Einstellungen immer wie<strong>der</strong><br />
zu klären, uns <strong>der</strong> eigenen "unerledigten Geschäfte" (Elisabeth Kübler-<br />
Ross) zu stellen <strong>und</strong> für einen ges<strong>und</strong>en Ausgleich <strong>und</strong> für die Selbstpflege zu<br />
sorgen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 103
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Sterbebegleitung ist Einbeziehung ehrenamtlicher Hospizhelfer<br />
Schwere Krankheit hat nicht nur körperliche Auswirkungen, son<strong>der</strong>n bringt<br />
sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen große Verunsicherung<br />
<strong>und</strong> Ängste mit sich. Sterbebegleitung bedeutet für uns, im Sinne <strong>der</strong> Betroffenen<br />
ein Netzwerk zu knüpfen <strong>und</strong> zu nutzen. Deshalb arbeiten wir sehr<br />
eng mit dem Hospizverein Kaufbeuren / Ostallgäu zusammen.<br />
Die Hospizbegleitung ist ein Angebot für Menschen, die von einer voraussichtlich<br />
unheilbaren Erkrankung getroffen sind <strong>und</strong> bei denen die Lebenserwartung<br />
begrenzt erscheint. Hospizhelfer ersetzen nicht Pflegedienst <strong>und</strong> Haushaltshilfe,<br />
aber sie ergänzen <strong>und</strong> entlasten die professionellen Helfer.<br />
Wir empfehlen den Betroffenen, Hilfe <strong>und</strong> Unterstützung durch die geschulten,<br />
ehrenamtliche Hospizhelfer in Anspruch zu nehmen. (� Standard: Anbieten<br />
<strong>der</strong> ehrenamtliche Hospizhilfe) Dazu informieren wir über die Tätigkeit<br />
<strong>der</strong> Helfer <strong>und</strong> ihre vielfältigen Möglichkeiten <strong>der</strong> Unterstützung (�� Infoblatt:<br />
Hospizhelferdienst). Auf Wunsch stellen wir den Kontakt zur Einsatzleitung<br />
des Hospizvereines her.<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: Sozialstation <strong>und</strong> Hospizverein verstehen ihre Leistungen<br />
als wichtige wechselseitige Ergänzungen zum Wohle <strong>der</strong> Schwerkranken<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> betroffenen Familien. Wir kooperieren ohne Konkurrenzgefühle in<br />
gegenseitiger Loyalität durch dichten Informationsaustausch <strong>und</strong> klaren Absprachen.<br />
Sterbebegleitung ist gute palliativmedizinische Versorgung<br />
Sterbebegleitung bedeutet für uns, den Patienten ein Leben bis zuletzt <strong>und</strong> ein<br />
Sterben möglichst ohne physische Schmerzen zu ermöglichen. Dies ist ein<br />
wichtiges Element menschlicher Würde. Voraussetzung dafür ist die kollegiale,<br />
unvoreingenommene Zusammenarbeit mit vielen Berufsgruppen, insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> enge Kontakt mit den Hausärzten. Wir klären, ob <strong>und</strong> wie weit <strong>der</strong><br />
jeweilige Hausarzt über Wünsche <strong>und</strong> eventuelle Entscheidungen des Patienten<br />
informiert ist. Wichtig ist uns auch gutes Krisenmanagement: Um die<br />
Wünsche von Patienten zu respektieren <strong>und</strong> �� Krisenvorsorge zu treffen,<br />
werden vorbeugend mit den behandelnden Ärzten <strong>und</strong> den Angehörigen möglichst<br />
frühzeitig Handlungsweisen bei absehbaren Komplikationen besprochen<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 104
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
<strong>und</strong> dokumentiert <strong>und</strong> eine entsprechende Notfallmedikation bevorratet.<br />
(� ���������lan: Verfügungen - Ärztlicher Bericht) Damit bei Einweisungen<br />
<strong>und</strong> Entlassungen aus dem Krankenhaus <strong>kein</strong>e wichtige Informationen vergessen<br />
werden, haben wir ein entsprechendes Überleitungsmanagement vereinbart.<br />
Durch Gespräch, sorgfältige Beobachtung <strong>und</strong> Dokumentation erhalten wir<br />
Auskunft über den jeweiligen Schmerzzustand. ���Wenn<br />
notwendig, drängen wir<br />
darauf, palliativ-medizinisch ausgebildete Ärzte konsiliarisch hinzuzuziehen.<br />
Wir verstehen uns hier als "Anwalt von Patienten". In Kooperation von Pflegedienst<br />
<strong>und</strong> Hospizverein haben wir uns für den Aufbau eines palliativmedizinischen<br />
Beratungsdienstes in <strong>der</strong> Region eingesetzt. � Abrechnung<br />
palliativer Beratung - Vertrag mit Krankenkasse<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: Wir praktizieren interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
<strong>und</strong> fühlen uns verantwortlich für eine optimale Kooperation im Sinne <strong>der</strong> Patienten.<br />
Nicht zuletzt: Sterbebegleitung ist partnerschaftliche Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Angehörigen<br />
Sterben trifft nicht nur eine Person. Es betrifft Familie <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e. Diese sind<br />
beson<strong>der</strong>s vertraut mit dem Sterbenden, aber auch beson<strong>der</strong>s betroffen von<br />
<strong>der</strong> Situation. Wir sehen unser Verhältnis zu den Angehörigen als eine Art<br />
Partnerschaft zum Wohle des Patienten. Es ist uns deshalb beson<strong>der</strong>s wichtig,<br />
Angehörige in <strong>der</strong> Pflege auf die Sterbebegleitung vorzubereiten, sie anzuleiten<br />
<strong>und</strong> einzubeziehen. Wir unterstützen <strong>und</strong> beraten sie fachlich, brauchen<br />
<strong>und</strong> nutzen aber auch umgekehrt <strong>der</strong>en Sicht <strong>und</strong> Kenntnisse für eine individuelle<br />
Pflege des Patienten. Wir zeigen Offenheit für Fragen von Angehörigen<br />
zur letzten Lebensphase <strong>und</strong> weisen frühzeitig auf weitere Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Unterstützung in unserem ambulanten Netzwerk hin (z.B. Hospizhelfer, Seelsorge).<br />
Wenn es gewünscht <strong>und</strong> es <strong>der</strong> jeweiligen Pflegekraft auch möglich<br />
ist, ermutigen <strong>und</strong> unterstützen wir Angehörige beim Verabschieden von Verstorbenen.<br />
Unsere Gr<strong>und</strong>haltung: Wir betrachten unsere Rolle als "Gäste" im Haus <strong>und</strong><br />
sehen Angehörige als wichtige Partner in <strong>der</strong> Pflege. Allerdings sehen wir<br />
auch unsere Grenzen. Wo Angehörige fehlen o<strong>der</strong> ausgefallen sind, können<br />
wir sie nicht ersetzen - trotz <strong>der</strong> vielleicht entstandenen Vertrautheit zwischen<br />
Patienten <strong>und</strong> uns. Der sterbende Mensch steht außerdem manchmal in einem<br />
familiären Beziehungsgeflecht, das Konflikte birgt. In solchen Konfliktfäl-<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 105
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
len können wir zwar als Außenstehende in Gesprächen entlastend <strong>und</strong> wertvoll<br />
sein, aber erfahrungsgemäß nur gelegentlich <strong>und</strong> begrenzt vermitteln. Unser<br />
Leitgedanke: In diesen Situationen müssen wir beson<strong>der</strong>s achtsam sein,<br />
nicht zu werten <strong>und</strong> zu verurteilen, son<strong>der</strong>n eine verständnisvolle Distanz zu<br />
allen Konfliktparteien zu wahren.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 106
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 107
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
4<br />
Musterstandards,<br />
Gesprächshilfen,<br />
Materialien <strong>und</strong><br />
Ideen<br />
Zu dieser Sammlung gehören bewährte Standards, die in<br />
verschiedenen Projekten entwickelt wurden, o<strong>der</strong> Ergebnisse<br />
aus Projekt-Beratungen <strong>und</strong> Projekt-Werkstätten. Deshalb<br />
werden Sie in einzelnen Standards „Spuren“ örtlicher Beson<strong>der</strong>heiten<br />
finden (z. B. Verantwortlichkeiten, Regelungen vor<br />
Ort usw.). Die Musterstandards können Sie als Anregung o<strong>der</strong><br />
als direkte Vorlage für Besprechungen in Ihrer Projekt-<br />
Gruppe nutzen, um eigene, gut zugeschnittene Standards zu<br />
schaffen. Quellen bitte angeben. Wir danken allen Projekt-<br />
Gruppen <strong>und</strong> Teams, die ihre Ergebnisse im Sinne eines<br />
wechselseitigen Gebens <strong>und</strong> Nehmens zur Verfügung stellen<br />
<strong>und</strong> zu dieser stetig wachsenden Sammlung beitragen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 108
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard<br />
Bewohner willkommen heißen 1<br />
Ritual in <strong>der</strong> Phase des Einzugs<br />
Einführung<br />
Eine Abschiedskultur beginnt beim Heimeinzug. Gerade dieser Übergang, <strong>der</strong><br />
von vielen Beteiligten gefürchtet wird, braucht eine beson<strong>der</strong>e (rituelle) Aufmerksamkeit,<br />
wenn er gelingen soll.<br />
Durchführung<br />
Verantwortlich: Bezugspflegekraft<br />
Vorbereitung / Rahmen / Beteiligte<br />
Blumen besorgen (lassen), Bildkarten, Kaffee, Tasse (evtl. mit Namenszug);<br />
Zeit: ca. eine St<strong>und</strong>e; Zeitpunkt: 2-4 Tage nach Einzug; Ort: Zimmer des Bewohners;<br />
evtl. weitere Bewohner dazu einladen<br />
Eröffnung<br />
Die Pflegekraft überreicht dem Heimbewohner Blumen, wünscht eine gute Zeit<br />
für den Einzug <strong>und</strong> steckt den zeitlichen Rahmen des „Besuches“ ab <strong>und</strong> klärt<br />
ab, ob die Zeit günstig ist. Impulse für den Einstieg: Wie waren denn die ersten<br />
Tage hier bei uns? Gab es etwas, was Sie vermisst haben? Wie haben<br />
Sie sich aufgenommen gefühlt?<br />
1. Phase: Rückbesinnung = Loslösung<br />
Der Bewohner kann über die ersten Tage im Heim berichten <strong>und</strong> über Herkunftsort<br />
erzählen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Pflegekraft – wenn vorhanden – Bil<strong>der</strong> zeigen.<br />
Pflegekraft unterstützt durch Fragen. Beispiele: Welche Gegenstände schaffen<br />
ein Gefühl von Zuhause? Welche persönlichen Objekte müssten noch besorgt<br />
werden? Von was fiel die Trennung schwer usw. (Hilfe, um Altes in Erinnerung<br />
zu nehmen)<br />
1 Ritual entwickelt von Arbeitsgruppe Marienheim Glonn (Obb.) <strong>und</strong> Martin Alsheimer<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 109
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
2. Phase = Höhepunkt<br />
Die Pflegekraft spricht Segenswünsche aus <strong>und</strong> lässt von Bewohner Wünsche<br />
formulieren. Der Bewohner wählt aus einer Schale mit Bildkarten eine aus.<br />
Der Segenswunsch wird auf eine Bildkarte geschrieben <strong>und</strong> im Zimmer aufgestellt<br />
(symbolisiert Kraft für den Wechsel <strong>und</strong> Vertrauen, dass <strong>der</strong> Übergang<br />
gelingt)<br />
3. Phase = Neuanbindung<br />
Bewohner bekommt persönliche Tasse (mit Namenszug) geschenkt (symbolisiert:<br />
Willkommen, Hoffnung, dass Bewohner sich künftig zu Hause fühlt)<br />
Abschluss:<br />
Eine gemeinsame Tasse Tee/Kaffee zusammen trinken<br />
Eventuell weitere Bewohner dazu einladen („Patenschaften“ für die erste Zeit<br />
stiften)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 110
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übersicht<br />
Situationen für gezielte Gespräche<br />
Wann <strong>und</strong> wie können wir etwas über die Vorstellungen<br />
zur letzten Lebensphase erfahren?<br />
Wann Wie Empfohlene<br />
Fragen aus<br />
dem Pool<br />
Vor dem Einzug<br />
Bei <strong>der</strong> Aufnahme<br />
Bei <strong>der</strong> Besichtigung des<br />
Hauses<br />
Nach dem Tod von Mitbewohnern<br />
o<strong>der</strong> Angehörigen<br />
Bei <strong>und</strong> nach Info-Abenden<br />
(z. B. über Vorsorgemöglichkeiten)<br />
In <strong>der</strong> Eingewöhnungszeit<br />
durch Gesprächsangebote<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Biografiearbeit<br />
Über formale Fragen (z. B. zur Patientenverfügung)<br />
erste Resonanzen erfassen<br />
Erzählen über die Palliativ-Angebote des<br />
Hauses<br />
Im R<strong>und</strong>gang die jeweiligen Symbole <strong>und</strong><br />
Zeugnisse <strong>der</strong> Erinnerungskultur <strong>der</strong> Einrichtung<br />
erläutern <strong>und</strong> als Gesprächsaufhänger<br />
nutzen<br />
Für Gruppen- o<strong>der</strong> Einzelgespräche 4<br />
Anknüpfen an vorhandene o<strong>der</strong> nicht vorhandene<br />
Pat.-Verfügung als Einstieg o<strong>der</strong><br />
eingebettet in Fragen zur Eingewöhnung<br />
(Siehe Begleitmaterial)<br />
Bei Gesprächen über erlittene Verluste<br />
könnten Vorstellungen zum eigenen Sterben<br />
thematisiert werden<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 111<br />
1<br />
2<br />
3<br />
5<br />
6<br />
7
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 112
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Leitfaden/Standard<br />
Die letzte Lebensphase in den Blick<br />
nehmen –<br />
Gesprächsangebot „Rechtzeitig Vorsorge treffen“ 1<br />
Einführung in den Standard<br />
Dieses beson<strong>der</strong>e Gesprächsangebot ist nur ein <strong>der</strong> Möglichkeiten, wie Wünsche<br />
zur letzten Lebensphase erfahren werden können. Es gibt eine ganze<br />
Reihe von Situationen, um über das Thema Vorsorge, Sterbebegleitung <strong>und</strong><br />
Abschiedskultur ins Gespräch zu kommen.<br />
Beispiele:<br />
• Beim Einzug über formale Fragen, z. B. nach einer Patientenverfügung<br />
o<strong>der</strong> über das Erzählen vom Konzept „Leben bis zuletzt“<br />
• Bei <strong>der</strong> Besichtigung des Hauses: Im R<strong>und</strong>gang können auch die Symbole<br />
<strong>und</strong> Zeugnisse <strong>der</strong> Erinnerungskultur (z. B. Gedenkwand) gezeigt<br />
<strong>und</strong> erläutert werden.<br />
• Nach dem Tod von MitbewohnerInnen: Das direkte Erleben o<strong>der</strong> auch<br />
die Bekanntmachung des Todes von Nachbarn kann in Einzelgesprächen<br />
o<strong>der</strong> in Gesprächsr<strong>und</strong>en aufgegriffen werden.<br />
• Bei <strong>und</strong> nach Info-Abenden (z. B. über Möglichkeiten <strong>der</strong> Vorsorge)<br />
• Im Rahmen <strong>der</strong> Biografiearbeit, z. B. über das Erzählen von erlittenen<br />
Verlusten <strong>und</strong> über die Art <strong>und</strong> Weise, wie Bekannte o<strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong><br />
gestorben sind.<br />
Das Gespräch über die Zukunft ist somit nicht die einzige Gelegenheit. Es erlaubt<br />
allerdings, in konzentrierter Weise über Lebensqualität auch am Ende<br />
des Lebens zu reden.<br />
Je<strong>der</strong> Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen, was „Lebensqualität“ (= innere<br />
Zufriedenheit, Wohlgefühl) in bestimmten Situationen ausmacht. Deshalb<br />
können diese Faktoren in <strong>der</strong> Regel nur in einem persönlichen Gespräch erschlossen<br />
werden. Es sind oft kleine Details, die zum Wohlgefühl beitragen.<br />
1 Entstanden in <strong>der</strong> Projekt-Beratung des Pflegezentrums Eichenau 2007<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 113
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Im Mittelpunkt dieses Gesprächsangebotes stehen zwei Situationen:<br />
• die aktuelle Situation des Einzugs, die oft als Krisenzeit erlebt wird.<br />
• Situationen, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Betroffene sich nicht mehr direkt mitteilen kann, um<br />
vorbeugend Wünsche <strong>und</strong> Vorstellungen - auch rechtlich – in <strong>der</strong> Krise zu<br />
sichern.<br />
Das Gespräch ergänzt das biografische Gespräch (� Biografiebogen) <strong>und</strong> bereitet<br />
die medizinisch-pflegerische Krisenvorsorge vor (� Schmerzmanagement<br />
� Krisenvorsorge / Notfallplan). Das Gespräch wird entwe<strong>der</strong> direkt<br />
<strong>der</strong> neu eingezogenen Bewohner angeboten o<strong>der</strong> - falls diese nicht mehr ansprechbar<br />
ist – <strong>der</strong>en Betreuer. Über Aushang wird den Bewohnern <strong>und</strong> Angehörigen<br />
auf die ständig bestehende Möglichkeit aufmerksam gemacht, über<br />
Wünsche <strong>und</strong> Sorgen <strong>und</strong> die Möglichkeit <strong>der</strong> Vorsorge ins Gespräch zu<br />
kommen.<br />
Ziele<br />
1. Absicherung von Wünschen: Die Pflegekräfte kennen die individuellen<br />
Vorstellungen von BewohnerInnen <strong>und</strong> berücksichtigen diese entsprechend.<br />
2. Persönliche Entlastung: Das Gespräch wird von den Beteiligten als entlastendes<br />
Angebot erlebt, dass Raum gibt für Gefühle <strong>und</strong> Vorstellungen<br />
bezogen auf mögliche aktuelle <strong>und</strong> zukünftige Krisenzeiten. Bewohnerin /<br />
Betreuerin fühlen sich ermutigt, Regelungen für Krisenzeiten zu treffen.<br />
3. Sicherheit: Die Pflegekräfte fühlen sich sicher, welche Maßnahmen vom<br />
Betroffenen gewollt sind, falls er sich nicht mehr mitteilen kann.<br />
Rahmen<br />
• Verantwortlich: PÜL, Palliative Care-Fachkraft, Vertretung nach Absprache<br />
• Zeitpunkt: möglichst in den ersten Wochen nach Einzug<br />
• Zeitbedarf: ca. 1 Std.<br />
• Vorbereitung: Im Rahmen des � Aufnahmegespräches wird durch Bewohnerverwaltung<br />
abgefragt, ob eine Patientenverfügung <strong>und</strong> Bevollmächtigungen<br />
/ Betreuung vorhanden sind <strong>und</strong> auf dieses weiterführende<br />
Gesprächsangebot hingewiesen: „Unser Motto in unserem Haus ist „Leben<br />
bis zuletzt! Wir möchten deshalb möglichst viel erfahren, was für Sie<br />
selbst / Ihren Vater o<strong>der</strong> Ihre Mutter in guten o<strong>der</strong> schlechten Zeiten wich-<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 114
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
tig ist im Leben …“ Entscheiden lassen, wer teilnehmen soll; Zeit arrangieren<br />
(Titel des Gesprächs: „Rechtzeitig Vorsorge treffen“)<br />
• Ort: ungestörte Atmosphäre, eventuell mit Kaffee / Tee<br />
Durchführung<br />
Wichtig für die Gesprächsführung:<br />
• Das Gespräch soll eine Atmosphäre <strong>der</strong> Offenheit schaffen. Der Leitfaden<br />
dient lediglich als Strukturierungshilfe. Umfang <strong>der</strong> Fragen <strong>und</strong> Reihenfolge<br />
sind nicht zwingend. Das Gespräch folgt eher dem Fluss des Erzählens.<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft vergewissert sich zu Beginn, ob das<br />
vereinbarte Gespräch zu diesem Zeitpunkt auch wirklich passt.<br />
• Falls in einem gemeinsamen Gespräch Angehörige die Betroffene dominieren<br />
sollten, lenkt die PDL / Palliative-Care-Fachkraft immer wie<strong>der</strong> zurück<br />
<strong>und</strong> holt die Meinung <strong>der</strong> Bewohnerin ein (Bsp. „Wie sehen Sie das<br />
selbst?“ „Was meinen Sie dazu, was Ihre Tochter / Ihr Sohn sagt?“).<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft weist darauf hin, dass die Beteiligten<br />
natürlich nicht antworten müssen, falls ihnen Fragen zu weit gehen, bzw.<br />
dass auch später noch etwas ergänzt, verän<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich revidiert<br />
werden kann.<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft verdeutlicht zu Beginn noch einmal<br />
den Sinn des Gesprächs („Möglichst viele Wünsche berücksichtigen <strong>und</strong><br />
Sicherheit schaffen …“), benennt den Zeitrahmen <strong>und</strong> bedankt sich für<br />
die Zeit, die sich die Beteiligten nehmen.<br />
• Sie holt sich das Einverständnis ein, dass sie sich während des Gesprächs<br />
einige Notizen machen kann. Das Dokumentierte kann später<br />
vor- o<strong>der</strong> gegengelesen werden.<br />
Gesprächshilfen<br />
Vorschläge für den Einstieg<br />
• „Wie waren denn die ersten Tage für Sie?“ (Ziel: Entlastung bei akuten<br />
Nöte)<br />
• Hätten wir noch etwas tun können, um Ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern?“<br />
(Ziel: Verbesserung des Aufnahmeverfahrens)<br />
• „Wie läuft denn Ihr Tag so zurzeit ab? … Entspricht das Ihren Vorstellungen,<br />
mit denen Sie zu uns gekommen sind?“ (Ziel: Klärung des Erlebens<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 115
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
in <strong>der</strong> aktuellen Situation)<br />
• „Gibt es Gegenstände von Ihrer früheren Wohnung, die Sie beson<strong>der</strong>s<br />
vermissen?“ Beispiele: wichtige Andenken, Kleidungsstücke, Möbel,<br />
Haushaltsgegenstände, Bettwäsche, Parfum, Fotos, religiöse Utensilien<br />
<strong>und</strong> Devotionalien. (Ziel: Zuhause schaffen)<br />
Thema: Vorsorge<br />
Vorschläge für den Einstieg<br />
• Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: was würden Sie sich Ihre die Zukunft<br />
wünschen?<br />
• Falls es Ihnen ges<strong>und</strong>heitlich schlechter gehen sollte <strong>und</strong> Sie sich nicht<br />
direkt mitteilen können, gibt es etwas, auf das wir beson<strong>der</strong>s achten sollen?<br />
• Ich habe gesehen, dass Sie bereits eine Patientenverfügung angelegt<br />
haben. Gibt es etwas, das wir wissen <strong>und</strong> beson<strong>der</strong>s berücksichtigen<br />
müssen`?<br />
• „Es wird zurzeit viel über Patientenverfügungen <strong>und</strong> Vollmacht gesprochen.<br />
Für uns ist wichtig, dass nichts passiert, was Sie nicht wollen …<br />
Wissen Sie über die Möglichkeiten <strong>der</strong> Vorsorge Bescheid?“ (Ziel: Information<br />
nach Bedarf)<br />
• Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie an Behandlung<br />
nicht mehr wollen, falls Sie sich nicht mehr selbst äußern könnten?“<br />
• Ich habe gesehen, dass Sie <strong>kein</strong>e Patientenverfügung haben … Würde<br />
das für Sie in Frage kommen, das schriftlich festzulegen, was Sie in Zeiten<br />
schwerer Krankheit haben <strong>und</strong> nicht mehr haben wollen?<br />
Vertiefungen, Weiterführung<br />
• „Haben Sie schon einmal mit Ihrem Hausarzt darüber gesprochen?“ Die<br />
PDL / Palliative-Care-Fachkraft klärt ab, ob ein Gespräch � Krisenvorsorge<br />
/ Notfallplan gewünscht wird <strong>und</strong> ermutigt dazu.<br />
• „Wer sollte denn in diesem Fall für Sie stellvertretend entscheiden <strong>und</strong> eine<br />
Betreuung übernehmen?“<br />
• „Haben Sie mit dieser Person schon einmal darüber gesprochen? Wie hat<br />
diese reagiert?“<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 116
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• „Wem möchten Sie denn auf <strong>kein</strong>en Fall eine Betreuung zumuten? Wer<br />
sollte auf <strong>kein</strong>en Fall mit einer Betreuung beauftragt werden?“<br />
• „Wenn sollten wir unbedingt informieren, falls sich Ihr Zustand verän<strong>der</strong>n<br />
sollte?“<br />
• „Wen möchten Sie dann gerne um sich haben, falls es Ihnen mal ges<strong>und</strong>heitlich<br />
schlechter gehen sollte?“ „Wen eher nicht?“<br />
Thema: Ehrenamtliche<br />
• „Wenn es Ihnen einmal nicht gut gehen sollte: Wären Sie damit einverstanden,<br />
dass wir eine Sitzwache organisieren, damit sie nicht allein in<br />
<strong>der</strong> Nacht sind?“<br />
• Würden Sie sich jemanden wünschen, <strong>der</strong> Sie nach Absprache besucht?<br />
Thema: Religion<br />
• Würden Sie sich im weitesten Sinne als gläubiger Mensch bezeichnen?<br />
• „Welche Bedeutung hat Religion für Sie?“<br />
• „Wünschen Sie sich in Krankheit o<strong>der</strong> im Sterben eine religiöse Begleitung?<br />
Wie soll diese aussehen? Was möchten Sie auf <strong>kein</strong>en Fall?“<br />
• Gibt es etwas, das Ihnen geholfen hat, als es Ihnen in früherer Zeit einmal<br />
schlecht ging?<br />
Abschluss<br />
• Die PÜL / Palliative-Care-Fachkraft schließt das Gespräch abschließend<br />
nach: „Gibt es etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt <strong>und</strong> was wir noch<br />
nicht angesprochen haben?“ „Hat Sie das Gespräch belastet?“<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 117
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 118
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard / Gesprächsleitfaden<br />
Lebensqualität sichern 1<br />
Vorstellungen zur letzten Lebensphase erfassen<br />
Einführung in den Standard<br />
Je<strong>der</strong> Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen, was „Lebensqualität“ (= innere<br />
Zufriedenheit, Wohlgefühl) in bestimmten Situationen ausmacht. Deshalb<br />
können diese Faktoren in <strong>der</strong> Regel nur in einem persönlichen Gespräch erschlossen<br />
werden. Es sind oft kleine Details, die zum Wohlgefühl beitragen.<br />
Im Mittelpunkt dieses Gesprächsangebotes stehen zwei Situationen:<br />
• die aktuelle Situation des Einzugs, die oft als Krisenzeit erlebt wird.<br />
• Situationen, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Betroffene sich nicht mehr direkt mitteilen kann, um<br />
vorbeugend Wünsche <strong>und</strong> Vorstellungen - auch rechtlich – in <strong>der</strong> Krise zu<br />
sichern.<br />
Das Gespräch ergänzt das biografische Gespräch (� Biografiebogen) <strong>und</strong> bereitet<br />
die medizinisch-pflegerische Krisenvorsorge vor (� Schmerzmanagement<br />
� Krisenvorsorge / Notfallplan). Das Gespräch wird entwe<strong>der</strong> direkt<br />
<strong>der</strong> neu eingezogenen Bewohner angeboten o<strong>der</strong> - falls diese nicht mehr ansprechbar<br />
ist – <strong>der</strong>en Betreuer. Die Bewohnerin / <strong>der</strong> Betreuer entscheidet,<br />
wer sonst zum Beispiel aus dem Kreis <strong>der</strong> Familie noch beim Gespräch beteiligt<br />
sein soll, um wichtige Informationen zur Lebensqualität zusammenzutragen<br />
bzw. um Entscheidungen mit zu tragen.<br />
Ziele<br />
• Absicherung von Wünschen: Die Pflegekräfte kennen die individuellen<br />
Vorstellungen von BewohnerInnen <strong>und</strong> berücksichtigen diese entsprechend.<br />
• Persönliche Entlastung: Das Gespräch wird von den Beteiligten als ent-<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“, Pflegeheim <strong>der</strong> Bamherzigen<br />
Brü<strong>der</strong>, St. Augustyn Neuburg a.d.D., Franziskaner Str. B 127, 86633 Neubug a.d.Donau, Projektleitung:<br />
Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dora Schmidt (PDL)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 119
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
lastendes Angebot erlebt, dass Raum gibt für Gefühle <strong>und</strong> Vorstellungen<br />
bezogen auf mögliche aktuelle <strong>und</strong> zukünftige Krisenzeiten. Bewohnerin /<br />
Betreuerin fühlen sich ermutigt, Regelungen für Krisenzeiten zu treffen.<br />
• Sicherheit: Die Pflegekräfte fühlen sich sicher, welche Maßnahmen vom<br />
Betroffenen gewollt sind, falls er sich nicht mehr mitteilen kann.<br />
Rahmen<br />
• Verantwortlich: PDL, Palliative Care-Fachkraft, Vertretung nach Absprache<br />
• Zeitpunkt: möglichst in <strong>der</strong> ersten Woche nach Einzug<br />
• Zeitbedarf: ca. 1 Std.<br />
• Vorbereitung: Im Rahmen des � Aufnahmegespräches wird abgefragt,<br />
ob eine Patientenverfügung <strong>und</strong> Bevollmächtigungen / Betreuung vorhanden<br />
sind <strong>und</strong> auf dieses weiterführende Gesprächsangebot hingewiesen:<br />
„Unser Motto in unserem Haus ist „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause<br />
schaffen! Wir möchten deshalb möglichst viel erfahren, was für Sie<br />
selbst / Ihren Vater o<strong>der</strong> Ihre Mutter in guten o<strong>der</strong> schlechten Zeiten wichtig<br />
ist im Leben …“ Entscheiden lassen, wer teilnehmen soll; Zeit arrangieren<br />
(Titel des Gesprächs: „Lebensqualität – Was ist Ihnen wichtig!“)<br />
• Ort: ungestörte Atmosphäre, eventuell mit Kaffee / Tee<br />
Durchführung<br />
Wichtig für die Gesprächsführung:<br />
• Das Gespräch soll eine Atmosphäre <strong>der</strong> Offenheit schaffen. Der Leitfaden<br />
dient lediglich als Strukturierungshilfe. Umfang <strong>der</strong> Fragen <strong>und</strong> Reihenfolge<br />
sind nicht zwingend. Das Gespräch folgt eher dem Fluss des Erzählens.<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft vergewissert sich zu Beginn, ob das<br />
vereinbarte Gespräch zu diesem Zeitpunkt auch wirklich passt.<br />
• Falls in einem gemeinsamen Gespräch Angehörige die Betroffene dominieren<br />
sollten, lenkt die PDL / Palliative-Care-Fachkraft immer wie<strong>der</strong> zurück<br />
<strong>und</strong> holt die Meinung <strong>der</strong> Bewohnerin ein (Bsp. „Wie sehen Sie das<br />
selbst?“ „Was meinen Sie dazu, was Ihre Tochter / Ihr Sohn sagt?“).<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft weist darauf hin, dass die Beteiligten<br />
natürlich nicht antworten müssen, falls ihnen Fragen zu weit gehen, bzw.<br />
dass auch später noch etwas ergänzt, verän<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich revi-<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 120
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
diert werden kann.<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft verdeutlicht zu Beginn noch einmal<br />
den Sinn des Gesprächs („Möglichst viele Wünsche berücksichtigen <strong>und</strong><br />
Sicherheit schaffen …“), benennt den Zeitrahmen <strong>und</strong> bedankt sich für<br />
die Zeit, die sich die Beteiligten nehmen.<br />
• Sie holt sich das Einverständnis ein, dass sie sich während des Gesprächs<br />
einige Notizen machen kann. Das Dokumentierte kann später<br />
vor- o<strong>der</strong> gegengelesen werden.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 121
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Leitfragen Gespräch mit Bewohnerin (auf Entscheidung gemeinsam mit<br />
Angehörigen)<br />
• Einstieg: „Wie waren denn die ersten Tage für Sie?“ (Ziel: Entlastung bei akuten Nöte)<br />
• War unsere � Orientierungshilfe eine Erleichterung für Sie? Haben Sie irgendetwas vermisst,<br />
was wir hätten tun können, um Ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern? (Ziel: Verbesserung<br />
des Aufnahmeverfahrens)<br />
• „Wie läuft denn Ihr Tag so zurzeit ab? … Entspricht das Ihren Vorstellungen, mit denen<br />
Sie zu uns gekommen sind? (Ziel: Klärung des Erlebens in <strong>der</strong> aktuellen Situation)<br />
• „Gibt es Gegenstände von Ihrer früheren Wohnung, die Sie beson<strong>der</strong>s vermissen?“ Beispiele:<br />
wichtige Andenken, Kleidungsstücke, Möbel, Haushaltsgegenstände, Bettwäsche,<br />
Parfum, Fotos, religiöse Utensilien <strong>und</strong> Devotionalien. (Ziel: Zuhause schaffen)<br />
• „Gibt es Personen, z. B. aus Ihrer Nachbarschaft, zu denen Sie gerne weiter Kontakt halten<br />
möchten? Darauf hinweisen, dass Kaffeekränzchen leicht im Heim zu organisieren<br />
sind. (Ziel: Beziehungen erhalten)<br />
• „Es wird zurzeit viel über Patientenverfügungen <strong>und</strong> Vollmacht gesprochen. Für uns ist<br />
wichtig, dass nichts passiert, was Sie nicht wollen (was Ihr Vater / Ihre Mutter nicht gewollt<br />
hätte) … Wissen Sie über die Möglichkeiten <strong>der</strong> Vorsorge Bescheid? (Ziel: Information<br />
nach Bedarf)<br />
• Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie an Behandlung nicht mehr wollen,<br />
falls Sie sich nicht mehr selbst äußern könnten?“<br />
• „Haben Sie schon einmal mit Ihrem Hausarzt darüber gesprochen?“ Die PDL / Palliative-<br />
Care-Fachkraft klärt ab, ob ein Gespräch � Krisenvorsorge / Notfallplan gewünscht wird<br />
<strong>und</strong> ermutigt dazu.<br />
• „Wer sollte denn in diesem Fall für Sie stellvertretend entscheiden <strong>und</strong> eine Betreuung<br />
übernehmen?“<br />
• „Haben Sie mit dieser Person schon einmal darüber gesprochen? Wie hat diese reagiert?“<br />
• „Wem möchten Sie denn auf <strong>kein</strong>en Fall eine Betreuung zumuten? Wer sollte auf <strong>kein</strong>en<br />
Fall mit einer Betreuung beauftragt werden?“<br />
• „Wenn sollten wir unbedingt informieren, falls sich Ihr Zustand verän<strong>der</strong>n sollte?“<br />
• „Wen möchten Sie dann gerne um sich haben?“ „Wen eher nicht?“<br />
• „Wenn es Ihnen einmal nicht gut gehen sollte: Wären Sie damit einverstanden, dass wir<br />
eine Sitzwache organisieren, damit sie nicht allein in <strong>der</strong> Nacht sind?<br />
• „Welche Bedeutung hat Religion für Sie?“<br />
• „Wünschen Sie sich in Krankheit o<strong>der</strong> im Sterben eine religiöse Begleitung? Wie soll diese<br />
aussehen? Was möchten Sie auf <strong>kein</strong>en Fall?“<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft schließt das Gespräch abschließend nach: „Gibt es<br />
etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt <strong>und</strong> was wir noch nicht angesprochen haben?“<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 122
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Leitfragen für Gespräch mit bevollmächtigter o<strong>der</strong> betreuenden Person(en)<br />
• Einstieg: „Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung nicht einfach für Sie war, … zu<br />
uns ins Pflegeheim zu bringen … (Ziel: Erleichterung für mögliche Schuldgefühle)<br />
• War unsere � Orientierungshilfe eine Erleichterung für Sie? Haben Sie irgendetwas vermisst,<br />
was wir hätten tun können, um Ihnen in dieser Zeit des Einzugs von … zu helfen?<br />
(Ziel: Verbesserung des Aufnahmeverfahrens)<br />
• Wie waren denn die ersten Tage nach dem Einzug von … für Sie? Hatten Sie das Gefühl,<br />
als Bevollmächtigte o<strong>der</strong> Betreuerin gut aufgenommen worden zu sein? (Ziel: Klärung <strong>der</strong><br />
aktuellen Situation)<br />
• „Gibt es etwas, das für die Bewohnerin ein Stückchen Heimat bedeutet? Bsp.: persönliche<br />
Gegenstände, Utensilien des Alltags Gerüche, Musik. Was könnten Sie noch bringen o<strong>der</strong><br />
besorgen? (Ziel: Ein Zuhause schaffen)<br />
• „Welche Personen könnten für die Bewohnerin wichtig sein? Auf wen reagiert sie erkennbar?“<br />
(Ziel: Beziehungen erhalten)<br />
• „Sie sind ja Bevollmächtigte / Betreuerin … Das kann ja auch Entscheidungen mit sich<br />
bringen, Maßnahmen auf Wunsch des Betroffenen einzustellen o<strong>der</strong> zu unterlassen. Haben<br />
Sie Fragen dazu, was möglich, erlaubt o<strong>der</strong> sogar geboten ist?“ (Ziel: Information<br />
nach Bedarf)<br />
• „Wissen Sie, was die Bewohnerin an Behandlung nicht mehr will?“ „Wie hat sie das ausgedrückt?“<br />
Wenn nicht direkt geäußert: „Woraus schließen Sie das?“ 1<br />
• „Wie stehen Sie zu diesen Wünschen <strong>der</strong> Bewohnerin?“ „Wie sehen das an<strong>der</strong>e aus dem<br />
Kreis <strong>der</strong> Familie?“ Wie sehen Sie den ges<strong>und</strong>heitlichen Zustand? Entwicklung?<br />
• „Haben Sie schon einmal mit dem Hausarzt darüber gesprochen?“ Die PDL / Palliative-<br />
Care-Fachkraft klärt ab, ob ein Gespräch � Krisenvorsorge / Notfallplan gewünscht wird<br />
<strong>und</strong> ermutigt dazu.<br />
• Wer aus dem Kreis <strong>der</strong> Angehörigen könnte Schwierigkeiten damit haben?“<br />
• „Wann <strong>und</strong> wie wünschen Sie informiert zu werden, falls sich <strong>der</strong> Zustand <strong>der</strong> Bewohnerin<br />
verän<strong>der</strong>n sollte?“ „Wer sollte noch informiert werden <strong>und</strong> wie <strong>und</strong> von wem?“<br />
• „Wen möchte <strong>der</strong> Betroffene wohl gerne um sich haben?“ „Wen eher nicht?“<br />
• „Wenn <strong>der</strong> Zustand kritisch werden sein sollte: Wären Sie damit einverstanden, dass wir<br />
eine Sitzwache organisieren, damit sich die Bewohnerin nicht allein in <strong>der</strong> Nacht fühlt?“<br />
• „Welche Bedeutung hat Religion für die Bewohnerin?“<br />
• „Wissen Sie, ob sich die Bewohnerin in Krankheit o<strong>der</strong> im Sterben eine religiöse Begleitung<br />
gewünscht hat? Wenn ja: Wie soll diese aussehen? Was möchte sie nicht?“<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft schließt das Gespräch abschließend nach: „Gibt es<br />
etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt <strong>und</strong> was wir noch nicht angesprochen haben?“<br />
1 Diese Frage ist oft leichter zu beantworten, wenn die Wünsche nicht direkt geäußert wurden. Siehe Loewy,<br />
E. H. / Springer-Loewy, R. (2002): Ethische Fragen am Lebensende. In: Pleschberger, S. / Heimerl, K. /<br />
Wild, M. (Hg.): Palliativpflege: Gr<strong>und</strong>lagen für Praxis <strong>und</strong> Unterricht. Wien: facultas, S. 136.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 123
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Auswertung (bezogen auf Ziele)<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft fasst zusammen, was sie schriftlich<br />
festgehalten hat, <strong>und</strong> klärt ab, ob das Wesentliche richtig erfasst worden<br />
ist.<br />
• Sie erklärt, wo <strong>und</strong> wie die Informationen dokumentiert werden sollen<br />
(Ergänzung zum � Biografiebogen), <strong>und</strong> holt das Einverständnis ein.<br />
• Die PDL / Palliative-Care-Fachkraft fragt nach, wie das Gespräch von<br />
dem / den Beteiligten empf<strong>und</strong>en worden ist. (Belastend o<strong>der</strong> entlastend?)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 124
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Biografiebogen als Hilfe nutzen<br />
Wichtige Informationen für eine individuelle Pflege<br />
Liebe Angehörige,<br />
diesen Bogen haben wir entwickelt, um möglichst viele Wertvorstellungen,<br />
wichtige Erlebnisse <strong>und</strong> Beziehungen, persönlichen Vorlieben <strong>und</strong> Abneigungen<br />
zu kennen <strong>und</strong> zu berücksichtigen. Wir fragen nach bestimmten Lebensstationen,<br />
aber vor allem zur Gegenwart. Ihre Informationen dienen uns als<br />
Hintergr<strong>und</strong> für eine individuelle Pflege <strong>und</strong> Begleitung von Ihnen / von Ihrem<br />
Angehörigen. Bitte bedenken Sie: Gerade wenn Ihr Angehöriger sich nicht<br />
mehr mitteilen kann o<strong>der</strong> demenziell erkrankt „in früheren Zeiten lebt“, können<br />
diese Informationen uns helfen, ihn / sie besser zu verstehen<br />
Wir wissen, dass die Fragen Vertrauen brauchen. Sie können dabei sicher<br />
sein: Die gesammelten Daten werden vertraulich behandelt. Ausschließlich<br />
befugte Personen haben Zugang zur Dokumentation. Generell gilt: Alle Ihre<br />
Angaben sind freiwillig. Sie können auch nur bestimmte Fragen beantworten<br />
<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e auslassen. Vielleicht wollen Sie sich auch mit jemandem besprechen.<br />
Wählen Sie aus, was wir in Pflege <strong>und</strong> Begleitung nach Ihrer Einschätzung<br />
wirklich von Ihnen / Ihrem Angehörigen wissen sollen. Natürlich können<br />
Sie zu <strong>der</strong> einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Frage später noch Informationen geben.<br />
Auch wir stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen zum Bogen haben<br />
o<strong>der</strong> Sie etwas erzählen, aber nicht aufschreiben wollen.<br />
Sollte <strong>der</strong> Platz nicht reichen, heften Sie bitte einfach entsprechend Blätter mit<br />
dem Stichwort o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Frage dazu. Danke!<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 125
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1. Allgemeine Informationen<br />
• Name:<br />
• Vorname:<br />
• Evtl. Mädchenname<br />
• Evtl. beson<strong>der</strong>e Rufnamen / Spitznamen:<br />
• Geburtsdatum:<br />
• Geburtsort:<br />
2. Herkunftfamilie (Kindheit, Jugendzeit)<br />
• Mutter:<br />
• Beson<strong>der</strong>er Rufname<br />
• Aufgabenfeld / Beruf:<br />
• Bedeutung / Verhältnis zu ihr<br />
• Vater:<br />
• Beson<strong>der</strong>er Rufname:<br />
• Aufgabenfeld / Beruf:<br />
• Bedeutung / Verhältnis zu ihm:<br />
• Wodurch wurde die Lebenssituation beson<strong>der</strong>s geprägt? (Z. B. finanzielle<br />
Verhältnisse, Abwesenheit von Elternteilen usw.?)<br />
• Geschwister (In welcher Geschwisterfolge stehen Sie / Ihr Angehöriger?)<br />
Reihenfolge<br />
Name, evtl. beson<strong>der</strong>er<br />
Rufname<br />
Geburtsdatum<br />
Evtl. Sterbedatum<br />
<strong>und</strong> Ursache<br />
Verhältnis zur Person /<br />
heutiger Kontakt<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 126
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
An<strong>der</strong>e wichtige Personen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendzeit<br />
• Wichtige Orte <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendzeit (Bedeutung des jeweiligen Ortes)<br />
• Wodurch war die Erziehung geprägt? (Z. B. Erziehungsstil, Aufgaben <strong>und</strong><br />
Pflichten des Kindes, Verbote, Freiheiten?)<br />
• Welche Vorlieben hatten Sie / Ihre Angehörige als Kind? (Z. B. Beschäftigung<br />
/ Spiele, Getränke, Essen / Naschereien, Gerüche / Düfte, Musik,<br />
Tiere?)<br />
• Schulbildung (Z. B. Bedeutung <strong>der</strong> Schule, Vorlieben, Abneigungen?)<br />
• Berufsausbildung(en) (Z.B. Wunschsberuf? Bedeutung für die Person?)<br />
• Welche Ereignisse aus dieser Zeit sind sonst noch wichtig, um Verhalten,<br />
Abneigungen <strong>und</strong> Wünsche zu verstehen?<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 127
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3. Eigene Familie / Erwachsenenzeit<br />
• Ehe- o<strong>der</strong> Lebenspartner<br />
Jahr d.<br />
Verbindung<br />
Name, evtl. beson<strong>der</strong>er<br />
Rufname<br />
Beruf<br />
• Ehelosigkeit gewollt o<strong>der</strong> ungewollt?<br />
Geburtsdatum<br />
Evtl. Trennungsdatum<br />
Evtl. Sterbedatum<br />
<strong>und</strong> Ursache<br />
• An<strong>der</strong>e wichtige Personen <strong>der</strong> Erwachsenzeit (Bedeutung?)<br />
• Wichtige Orte <strong>der</strong> Erwachsenenzeit (Bedeutung? Wo war „Heimat“?)<br />
• Wodurch wurde das gemeinsame Leben jeweils beson<strong>der</strong>s geprägt? (Z. B.<br />
Aufgabenverteilung innerhalb <strong>der</strong> Partnerschaft, finanzielle Verhältnisse,<br />
beson<strong>der</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Probleme?)<br />
• Welche Vorlieben hatten Sie / Ihre Angehörige als Erwachsene? (Z. B.<br />
Beschäftigung / Spiele, Getränke, Essen / Naschereien, Gerüche / Düfte,<br />
Musik, Tiere?)<br />
Verhältnis zur Person /<br />
heutiger Kontakt<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 128
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Evtl. beruflicher Weg (Z. B. Bedeutung <strong>der</strong> Aufgaben für Sie / Ihre Angehörige,<br />
beson<strong>der</strong>e Vorlieben <strong>und</strong> Fähigkeiten?)<br />
• An<strong>der</strong>e wichtige Aufgaben im Leben (Z. B. beson<strong>der</strong>s Engagement, Hobbys?)<br />
• Welche Ereignisse aus dieser Zeit sind sonst noch wichtig, um Verhalten,<br />
Abneigungen <strong>und</strong> Wünsche zu verstehen?<br />
• Leibliche Kin<strong>der</strong> o<strong>der</strong> angenommene Kin<strong>der</strong><br />
Reihe Name, evtl. beson<strong>der</strong>er<br />
Rufname<br />
Beruf<br />
Geburtsdatum<br />
Evtl. Sterbedatum<br />
<strong>und</strong> Ursache<br />
• Kin<strong>der</strong>losigkeit gewollt o<strong>der</strong> ungewollt? Was bedeuten Ihnen / Ihrem Angehörigen<br />
Kin<strong>der</strong>?<br />
• Wodurch wurde das Verhältnis zu den Kin<strong>der</strong>n jeweils beson<strong>der</strong>s geprägt?<br />
(Z. B. beson<strong>der</strong>s wichtig war …? Beson<strong>der</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Probleme?)<br />
• Welche Ereignisse aus dieser Zeit sind sonst noch wichtig, um Verhalten,<br />
Abneigungen <strong>und</strong> Wünsche zu verstehen?<br />
Verhältnis zur Person /<br />
heutiger Kontakt<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 129
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3. Gegenwart (Lebenseinstellungen)<br />
• Wie sähe ein Tag aus, an dem Sie es sich so richtig gut gehen lassen?<br />
• Wie sieht zurzeit ein typischer Tag aus?<br />
• Was ist unverzichtbar, damit es Ihnen / Ihrem Angehörigen gut geht?<br />
• Was gibt Ihnen / Ihrem Angehörigen Sicherheit?<br />
• Welche Dinge sind wichtig für eine „Zuhause-Gefühl“?<br />
• Was ist Ihnen / Ihrem Angehörigen „heilig“?<br />
• Welche Gewohnheiten / Rituale sollen wir berücksichtigen?<br />
• Welche Themen beschäftigen Sie / Ihren Angehörigen zurzeit?<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 130
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Was macht Ihnen / Ihrem Angehörigen Sorgen?<br />
• Gibt es wichtige Abneigungen? Was können Sie / kann Ihr Angehöriger<br />
überhaupt nicht leiden?<br />
• Welche Menschen sind Ihnen / Ihrem Angehörigen zurzeit beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig?<br />
• Was wäre für die nächste Zukunft wichtig?<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 131
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
4. Weltanschauung / Religiöse Einstellungen<br />
• Was gibt Halt im Leben? Was hat Ihnen / Ihrem Angehörigen in schwierigen<br />
Zeiten bisher geholfen?<br />
• Spielt Religiosität eine Rolle? In welcher Form?<br />
5. Einstellungen zu Krankheit / Behin<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> zu Therapie / Pflege<br />
• Wie kommen Sie / kommt Ihr Angehöriger mit Krankheit(en) o<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ung<br />
zurecht?<br />
• Was erschwert Ihnen / Ihrem Angehörigen das Leben mit <strong>der</strong> Erkrankung /<br />
Behin<strong>der</strong>ung?<br />
• Was erhoffen Sie / erhofft sich Ihr Angehöriger für die nächste Zukunft?<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 132
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Was würde Ihnen / Ihrem Angehörigen in Ihrer jetzigen Situation beson<strong>der</strong>s<br />
helfen o<strong>der</strong> unterstützen?<br />
• Was erwarten Sie / erwartet Ihr Angehöriger von uns? Auf was sollen wir<br />
beson<strong>der</strong>s achten?<br />
• Was wäre noch wichtig für uns zu wissen? Wofür haben Sie in diesem Bogen<br />
<strong>kein</strong>en geeigneten Platz o<strong>der</strong> <strong>kein</strong>e passende Frage gef<strong>und</strong>en?<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 133
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 134
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard<br />
Angehörige wahrnehmen <strong>und</strong> begleiten<br />
1<br />
Überblick über unterstützende Angebote des Hauses<br />
Einführung<br />
Pflege <strong>und</strong> Betreuung in einer traditionellen Sichtweise konzentriert sich auf<br />
den einzelnen Bewohner. Im Konzept von Palliative Care dagegen sind die<br />
Angehörigen genauso wichtig wie die hoch betagten, schwerkranken o<strong>der</strong><br />
sterbenden Menschen selbst. Sie bilden zusammen eine so genannte Behandlungseinheit.<br />
Sterben betrifft nicht nur eine Person. Es trifft Menschen,<br />
die dieser Person angehören. Wir verstehen unter Angehörige nicht nur Familienmitglie<strong>der</strong>,<br />
son<strong>der</strong>n auch Fre<strong>und</strong>Innen, Nachbarn o<strong>der</strong> BetreuerIn -<br />
kurz alle, die Bedeutung im Leben des Bewohners haben.<br />
Angehörige sind eine Brücke zum bisherigen Leben. Wir sehen <strong>und</strong> brauchen<br />
sie einerseits als Partnerinnen für eine gute Pflege, an<strong>der</strong>erseits sind<br />
Sie selbst Betroffene, die manchmal unsere persönliche Unterstützung brauchen.<br />
Oft geht <strong>der</strong> Heimaufnahme eine lange, familiäre (Leidens-)Geschichte<br />
voraus. Manchmal sind Angehörige selbst schon älter, krank, erschöpft, mit<br />
Schuldgefühlen belastet. 2 Gerade das Sterben eines Familienmitglieds erschüttert<br />
das ganze System „Angehörige“. „Es ist eine verbreitete Erfahrung<br />
(…), dass <strong>der</strong> Sterbende häufig das kleinere, die Angehörigen hingegen das<br />
größere Problem sind <strong>und</strong> haben.“ 3 Sie müssen mit dem Verlust leben. „Angehörige<br />
<strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e sind vom Sterben eines geliebten Menschen in mehrfacher<br />
Sicht betroffen. Sie leiden mit dem Sterbenden, antizipieren den Verlust<br />
<strong>und</strong> werden mit <strong>der</strong> eigenen Sterblichkeit mit allen damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Unsicherheiten <strong>und</strong> Ängsten konfrontiert.“<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Leben bis zuletzt“, Evangelisches Pflegezentrum Eichenau, Bahnhofstr. 117,<br />
82223 Eichenau; Projektleitung: Martin Alsheimer (GGsD, Nürnberg), Dirk Spohd (HL), Ruth Wagner (PDL)<br />
2 Heller, A., Schumann, F. (2006): Wi<strong>der</strong> die Integration <strong>der</strong> Angehörigen in die Arbeit von Pflegeheimen. In:<br />
Heller, A., Heimerl, K., Husebö, S. (Hg): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte<br />
Menschen würdig sterben können. 3. aktualisierte <strong>und</strong> erw. Aufl. Freiburg im Br.: Lambertus, S.273<br />
3 Student, J.-Ch. / Mühlum, A. / Student, U. (2004): Soziale Arbeit in Hospiz <strong>und</strong> Palliative Care. <strong>München</strong>:<br />
UTB, S. 54<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 135
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1 Uns sind folgende Gr<strong>und</strong>haltungen für die Begegnung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
von Angehörigen wichtig:<br />
• Begegnung als Menschen auf gleicher Augenhöhe: Es steht uns nicht<br />
zu, Verhalten von Angehörigen zu bewerten. Uns ist klar, dass Beziehungen<br />
ihre (Vor-)Geschichten haben. Auseinan<strong>der</strong>setzungen innerhalb von<br />
Familien <strong>und</strong> <strong>der</strong> Generationen begreifen wir als Normalität. Angehörige<br />
können eine gewisse, vorurteilsfreie Aufmerksamkeit <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>lichkeit<br />
erwarten. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir versuchen deshalb<br />
immer wie<strong>der</strong> (z. B. über kollegiale Beratung) auftauchende Vorurteile zu<br />
kontrollieren, die unseren unvoreingenommenen Blick trüben könnten.<br />
• Eigene Wege zugestehen: Angehörige dürfen ihren ganz eigenen Weg<br />
haben, sich dem Unausweichlichen zu nähern (o<strong>der</strong> es zu meiden). Sie<br />
müssen sich nicht unseren Vorstellungen von „guten Angehörigen“ fügen.<br />
• Beziehungen akzeptieren, wie sie sind: Wir akzeptieren, dass Beziehungen<br />
in Familien manchmal entfremdet, zerrüttet o<strong>der</strong> sogar zerstört<br />
sind. Wir können <strong>und</strong> wollen diese familiären Beziehungen nicht ersetzen<br />
<strong>und</strong> die („bessere“) Tochter o<strong>der</strong> den („besseren“) Sohn „spielen“.<br />
Manchmal gibt es noch die Chance von Klärung o<strong>der</strong> Versöhnung. Wir<br />
respektieren aber auch, wenn dies den Beteiligten nicht möglich ist.<br />
• Sterben als Extremsituation auch für Angehörige verstehen: Nicht nur<br />
die Bewohnerin selbst befindet sich durch Krankheit <strong>und</strong> im Sterben in einer<br />
noch nie da gewesenen Extremsituation. Auch ihre Angehörigen geraten<br />
in einer neuen Situation. Viele Menschen haben Krankheit <strong>und</strong> Sterben<br />
bisher nicht nah <strong>und</strong> direkt in ihrer Umgebung erlebt. Es kann schwer<br />
sein, den Verfall eines nahen Angehörigen zu erleben. Dieses Erleben<br />
kann sich sehr unterschiedlich ausdrücken. Auch das Fernbleiben, das<br />
nicht wahrhaben Können o<strong>der</strong> Vorwürfe gegenüber Pflegekräften <strong>und</strong><br />
Heim können (verständliche) Trauerreaktionen sein.<br />
Auf <strong>der</strong> Basis dieses Verständnisses bieten wir eine Reihe von Möglichkeiten,<br />
um Angehörige „im Vorfeld“, während des Sterbens <strong>und</strong> nach dem Tod des<br />
Bewohners zu unterstützen. Wir wissen um Hemmschwellen <strong>und</strong> warten nicht,<br />
bis Angehörige sich mit Wünschen zu melden trauen, son<strong>der</strong>n wir ergreifen Initiative<br />
<strong>und</strong> gehen auf sie zu.<br />
1 ebenda<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 136
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Unterstützung vor dem Sterben des Bewohners<br />
• Homepage / Heimzeitung: Auf <strong>der</strong> Homepage <strong>und</strong> in <strong>der</strong> monatlich erscheinenden<br />
Heimzeitung („Der Hausflüsterer“) wird ein Stück Abschiedskultur<br />
des Hauses lesbar, z. B. über Nachrufe, Bil<strong>der</strong> von Gedenkfeiern,<br />
über Porträtieren <strong>der</strong> Ansprechpartner für beson<strong>der</strong>e Nöte <strong>und</strong> Anliegen,<br />
durch Informationen über Vorsorgemöglichkeiten usw. Wir signalisieren:<br />
„Sterben ist ein Thema im Haus. Wir haben ein offenes Ohr für Angehörige.“<br />
• Gute Information: 80% <strong>der</strong> Sterbeprozesse sind nicht dramatisch <strong>und</strong><br />
überraschend, son<strong>der</strong>n „kündigen“ sich an. Wir versuchen immer wie<strong>der</strong><br />
im Gespräch wahrzunehmen, wie Angehörige den Krankheitsverlauf sehen<br />
<strong>und</strong> welche Hoffnungen o<strong>der</strong> Befürchtungen damit verb<strong>und</strong>en sind.<br />
Wichtig ist auch, sich mit den Angehörigen über die gewünschte Art <strong>und</strong><br />
Weise zu verständigen, wie diese über ges<strong>und</strong>heitliche Verän<strong>der</strong>ungen informiert<br />
werden wollen.<br />
• Regelmäßiger Angehörigenkreis: Dieses monatliche Treffen wird <strong>der</strong>zeit<br />
von <strong>der</strong> Seelorge veranstaltet <strong>und</strong> geleitet. Es bietet Angehörigen beson<strong>der</strong>en<br />
Raum für Fragen <strong>und</strong> Nöte – auch zum Thema Krankheit, Sterben<br />
<strong>und</strong> Abschied.<br />
• Spezielle Angehörigen-Abende: In größeren Abständen bieten wir Angehörigenabende,<br />
die mit speziellen Impulsen das Thema „Sterben <strong>und</strong><br />
Abschied“ in den Mittelpunkt stellen.<br />
• Infomappe: Die Verwaltung gibt zum Einzug über die Infomappe Hinweise<br />
auch zum Thema Sterbebegleitung <strong>und</strong> Abschiedskultur im Haus.<br />
• Aufnahmegespräch: Im Rahmen <strong>der</strong> Aufnahme (� Aufnahme) fragen<br />
wir u. a. nach, ob eine Patientenverfügung <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Bevollmächtigungen<br />
vorhanden sind. Daraus können eventuell erste wichtige Informationen<br />
über die Vorstellungen von Bewohnern gewonnen werden, bzw. sich Ansatzpunkte<br />
für ein späteres Gespräch ergeben.<br />
• Beson<strong>der</strong>e Gesprächsangebote: Angehörige können sich mit ihren<br />
Fragen zu Vorsorgevollmacht <strong>und</strong> Patientenverfügung im Haus beraten<br />
lassen (GesprächspartnerIn: PÜL)<br />
• Seelsorgerliche Aufmerksamkeit: Die Pflegekräfte informieren in Teamsitzungen<br />
die SeelsorgerInnen, wenn sie bei Angehörigen eine beson<strong>der</strong>e<br />
Belastung verspüren o<strong>der</strong> vermuten, so dass diese ein Gespräch anbieten<br />
können.<br />
• Vermittlung Arzt-Angehörige: Falls es Unsicherheiten, Missverständnisse<br />
o<strong>der</strong> Fragen zur ärztlichen Versorgung <strong>und</strong> Behandlung gibt, bieten die<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 137
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stationsleitungen o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en StellvertreterInnen an zu vermitteln. Bei beson<strong>der</strong>en<br />
Fragen können die Stationsleitungen o<strong>der</strong> ihre Stellvertreter die<br />
Palliative-Care-Kräfte des Hauses hinzuziehen.<br />
• Kontakt mit Besuchsdienst o<strong>der</strong> ehrenamtlichen HospizhelferInnen:<br />
Bei Bedarf empfehlen die Stationsleitungen o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en StellvertreterInnen<br />
die Begleitung o<strong>der</strong> Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte an <strong>und</strong> organisieren<br />
auf Wunsch den Kontakt.<br />
Unterstützung von Angehörigen in <strong>der</strong> Zeit des Sterbens<br />
des Bewohners<br />
• Gastfre<strong>und</strong>schaft zeigen: Ein Pflegesessel kann für Übernachtung o<strong>der</strong><br />
Sitzwache unproblematisch ins Zimmer gestellt werden. Wir bieten Essen<br />
<strong>und</strong> Trinken an. Natürlich ist wie immer die Anwesenheit ohne zeitliche<br />
Begrenzung möglich <strong>und</strong> willkommen. Diese Gastlichkeit ist selbstverständlich<br />
nicht nur auf die Zeit des Sterbens beschränkt, aber sie ist in<br />
dieser beson<strong>der</strong>s sensiblen Zeit sehr wichtig.<br />
• Anleitung kleiner praktische Hilfen (z. B. M<strong>und</strong>pflege, Einreibungen,<br />
Schweiß abwischen). Kleine pflegerische Tätigkeiten erleichtern Angehörigen<br />
oft die Berührung. Sie können darüber ihre Zuneigung <strong>und</strong> Fürsorge<br />
zeigen <strong>und</strong> erleben sich als weniger hilflos. Wir klären immer wie<strong>der</strong><br />
ab, was Angehörige machen können <strong>und</strong> auch wollen.<br />
• Entlastung <strong>und</strong> Sicherheit geben: Wir versichern Angehörigen, dass wir<br />
beson<strong>der</strong>s aufmerksam pflegen <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Regel zu zweit am Krankenbett<br />
sind. Wir ermutigen sie auch, sich Auszeiten zu gönnen, falls wir den Eindruck<br />
haben, dass sie sich überfor<strong>der</strong>n.<br />
Unterstützung von Angehörigen in <strong>der</strong> Zeit nach dem<br />
Sterben<br />
• Informiertes Haus: Verwaltung / Leitung wird über Hinweis bei den Postfächern<br />
in <strong>der</strong> Verwaltung über Sterben <strong>und</strong> Tod von BewohnerInnen informiert,<br />
damit sie Angehörigen angemessen begegnen <strong>und</strong> ihnen kondolieren<br />
können.<br />
• An <strong>der</strong> Aufbahrung mitwirken: Angehörige werden ermutigt zum rituellen<br />
Abschied bei <strong>der</strong> Aufbahrung. Zeit: In <strong>der</strong> Regel bleibt <strong>der</strong> Verstorbene<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 138
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
mindestens noch 24 Std. im Haus. (Näheres siehe � Standard: Umsorgen<br />
Verstorbener <strong>und</strong> ihrer Angehörigen) Erfahrungsgemäß kann<br />
diese persönliche Form des Abschieds sehr hilfreich sein (z. B. über rituelles<br />
Waschen o<strong>der</strong> Berühren, Ankleiden, Anzünden einer Kerze, Aufstellen<br />
eines Kreuzes, Erinnerungssymbole aussuchen, Musik hören, Reden <strong>und</strong><br />
Schweigen usw.). Für viele findet in dieser feierlichen Atmosphäre über<br />
das achtsame Tun <strong>der</strong> eigentliche Abschied statt, <strong>der</strong> in tröstlicher Erinnerung<br />
bleibt. Das Antlitz Verstorbener zeigt oft einen tiefen Frieden <strong>und</strong><br />
kann somit tröstlich sein.<br />
• Aussegnung: Die Aussegnung, d. h. die Verabschiedung des Toten von<br />
seinem letzten Wohnort in <strong>der</strong> Gemeinschaft kann ein weiteres wichtiges<br />
Ritual sein. Gebet <strong>und</strong> Segen können trauernde Angehörige stärken. Falls<br />
die SeelsorgerInnen nicht erreichbar sind, gibt es im Stationszimmer eine<br />
entsprechende Handreichung zur Aussegnung.<br />
• Heft „Abschied nehmen“: In <strong>der</strong> Verwaltung können Angehörige das<br />
weitere Vorgehen für Überführung <strong>und</strong> Bestattung besprechen. Dort erhalten<br />
sie auch die Broschüre „Abschied nehmen“ <strong>der</strong> Evangelischen Heimstiftung<br />
Stuttgar, die ihnen zusätzlich in ansprechen<strong>der</strong> Weise Informationen<br />
zu den Formalitäten <strong>der</strong> Bestattung <strong>und</strong> Anregungen zum Verabschiedung<br />
gibt.<br />
• Beileidskarte: In <strong>der</strong> persönlich gehaltenen Beileidskarte wird <strong>der</strong> Verstorbene<br />
noch einmal gewürdigt. Verantwortung: SL<br />
• Wand <strong>der</strong> Erinnerung: Wir bieten Angehörige an, mit einem Symbol o<strong>der</strong><br />
einem Bild die Wand <strong>der</strong> Erinnerung auf <strong>der</strong> Station mit zu gestalten.<br />
• Nachsorge: Karte nach ca. einem Monat: Das Team unterzeichnet eine<br />
Gedenkkarte, die an die beson<strong>der</strong>e „Kontaktperson“ unter den Angehörigen<br />
(z. B. Betreuer) geschickt wird. Damit verb<strong>und</strong>en ist das Angebot,<br />
vorhandene Fotos des Verstorbenen (z. B. Heimleben, Heimfeiern) zuzusenden.<br />
• Nachruf in <strong>der</strong> Hauszeitung: Die Ausgabe <strong>der</strong> Heimzeitung, in <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Nachruf erschienen ist, wird an Angehörige geschickt. In <strong>der</strong> Regel zusammen<br />
mit <strong>der</strong> Karte.<br />
• Gedenkfeier: Die Angehörigen haben die Möglichkeit, im Rahmen einer<br />
Gedenkfeier <strong>der</strong> Toten zu erinnern. Sie werden dazu schriftlich eingeladen.<br />
Diese Form <strong>der</strong> Erinnerung wird zwei Mal im Jahr gepflegt.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 139
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 140
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Planungshilfe<br />
Einen Abend für Angehörige planen<br />
Tipps <strong>und</strong> Anregungen für die Gestaltung 1<br />
Einführung<br />
Im Rahmen von Maßnahmen <strong>und</strong> Projekten zur Implementierung von Hospizidee<br />
<strong>und</strong> Palliativbetreuung kommt es immer wie<strong>der</strong> vor, dass Projektgruppen<br />
Informationsveranstaltungen planen. Manchmal sind es externe Zielgruppen<br />
(Angehörige, Hausärzte, Seelsorger) die informiert werden sollen. Diese Menschen<br />
sind in <strong>der</strong> Begleitung von Bewohnern wichtig, haben aber selten den<br />
Einblick in Projektstrukturen o<strong>der</strong> auch nur die Gr<strong>und</strong>gedanken des Palliative<br />
Care. Manchmal sind es aber auch Mitarbeitergruppen innerhalb des Hauses,<br />
die über ein Projekt unterrichtet werden wollen. Dies können einzelne Berufsgruppen<br />
sein (z.B. Pflege), für die solche Informationen wichtig sind. Nur wer<br />
weiß, was so ein Projekt soll <strong>und</strong> wie es funktioniert, kann sich auch in diese<br />
Gr<strong>und</strong>haltung einfinden <strong>und</strong> sie unterstützen. Manchmal sind solche Veranstaltungen<br />
aber auch für alle Mitarbeiter gedacht (Hausworkshop, Mitarbeiterversammlung)<br />
um die nötige Gr<strong>und</strong>sensibilisierung <strong>und</strong> Basishaltung zu vermitteln.<br />
Implementierungsprojekte leben davon, dass alle an ihrem Platz davon<br />
wissen <strong>und</strong> mittun, wenn sie gefragt sind.<br />
In diesem Papier sollen daher Tipps <strong>und</strong> Anregungen für das Durchführen<br />
einer Veranstaltung gegeben werden. Das Papier wird dies am Beispiel eines<br />
Angehörigenabends ausarbeiten.<br />
Es ist jedoch möglich, die hier gegebenen Tipps <strong>und</strong> Merkposten auch bei<br />
Veranstaltungen für an<strong>der</strong>e Zielgruppen zu beachten <strong>und</strong> zu nutzen.<br />
1 Erarbeitet von: Liselotte Balbach, Irene Bauer, Elisabeth Eberhardt, Dirk Glaser, Stefan Mücke, Christian<br />
Müller, Maria Reiß, Petra Volk, Robert Wagner, Petra Winter<br />
am 4.4.2007 in Steinerskirchen im Rahmen einer Projektwerkstatt Implementierung des DW Bayern<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 141
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Überlegungen zu den Zielen <strong>und</strong> zur Zielgruppe<br />
Vor <strong>der</strong> Planung einer Veranstaltung muss klar sein, was wir wollen <strong>und</strong> wen<br />
wir erreichen möchten. Dazu einige mögliche Aussagen:<br />
Im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> steht die Botschaft: Angehörige sind in unserem Blickwinkel<br />
zentral! Sie sind immer betroffen <strong>und</strong> beteiligt. Angehörige sind in unserem<br />
Heim auch immer gegenwärtig. Wir treffen sie an jedem Ort. Sie sind in Gedanken<br />
präsent wenn wir uns um die Bewohner kümmern.<br />
Angehörige haben Wünsche <strong>und</strong> Bedürfnisse. R<strong>und</strong> um das Sterben brauchen<br />
sie unsere erhöhte Aufmerksamkeit, Zuwendung <strong>und</strong> Unterstützung.<br />
Gleichzeitig müssen wir damit rechnen, dass sie nicht verlässlich sind, in Phasen<br />
eigener Unsicherheit. Dies darf so sein!<br />
Wir haben auch im Blick, dass mit dem Begriff „Angehörige“ eine größere<br />
Gruppe von Menschen gemeint ist. Fre<strong>und</strong>e, Nachbarn, flüchtige Bekannte -<br />
sie alle können vom Tod betroffen sein. Wir nennen sie deshalb besser „nahe<br />
stehende Personen“ o<strong>der</strong> auch „Zugehörige".<br />
Das Ziel unseres Projektes ist es, Ängste zu min<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Sicherheit zu vermitteln,<br />
Einbeziehung in die Sterbebegleitung anzubieten <strong>und</strong> Angehörige dazu<br />
zu ermutigen.<br />
Es geht um das Signal: Wir sind am Thema dran! Damit werden Angehörige<br />
auch versichert, dass das Sterben ihrer ihnen Nahestehenden bei uns im Blick<br />
ist. So können auch Hemmungen abgebaut werden, sich mit diesem Thema<br />
auseinan<strong>der</strong> zu setzen.<br />
Merkposten: Wichtig ist es, an einem solchen Abend Einzelkontakte anzubieten,<br />
da nicht alle Menschen in einer großen Gruppe über ihre Sorgen sprechen.<br />
Merkposten: Niemanden vergessen! Oft sind es an<strong>der</strong>e Menschen die trauern,<br />
als wir im ersten Moment denken.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 142
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Anregungen zu den Inhalten des Angehörigenabends:<br />
Informationen über Ideen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>ansatz unseres Hospizprojektes<br />
Beim Angehörigenabend sollte die Gr<strong>und</strong>idee <strong>der</strong> Implementierung vorgestellt<br />
werden. Ein kurzer Input über das Anliegen <strong>und</strong> unser Vorgehen ist unerlässlich.<br />
Klar muss sein, warum wir diesen Abend gerade heute ansetzen (Anlass) <strong>und</strong><br />
warum sie, die Angehörigen, heute eingeladen wurden. In diesem Rahmen<br />
kann über die Abschiedskultur des Hauses ausführlich informiert worden werden.<br />
Es geht um Informationen über die Hospizidee, über die Haltung, die bei<br />
uns dahinter steht <strong>und</strong> über Maßnahmen <strong>und</strong> Organisationsaspekte. Einzelne<br />
Zitate (z.B. von Cicely Saun<strong>der</strong>s) können hier hilfreich sein.<br />
Wir berichten in diesem Zusammenhang auch über die konkrete Projektarbeit<br />
<strong>und</strong> die Projektgruppe. Wir berichten von Schulungen <strong>und</strong> von Arbeitstreffen<br />
<strong>der</strong> Projektgruppe. Die Angehörigen sollen sich vorstellen können, wie hier<br />
gearbeitet wird! Deshalb dürfen an diesem Abend auch Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Projektgruppe<br />
auftauchen <strong>und</strong> erzählen. Wir betonen auch, dass es um interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit geht. Verschiedene Berufsgruppen im Haus beschäftigen<br />
sich mit dem Thema. Es ist nicht nur Sache <strong>der</strong> Pflege! Beson<strong>der</strong>s Ehrenamtliche<br />
gehören in <strong>der</strong> Sterbebegleitung für uns als Partner zum Angebot.<br />
Merkposten: Keine falschen Versprechungen machen! Nur erzählen, was im<br />
Haus wirklich geschieht.<br />
Inhalte: Einige Beispiele<br />
• Wir erzählen an diesen Abend davon, dass wir Wünsche unserer Bewohner<br />
erfragen. Wir nehmen auch die Wünsche <strong>der</strong> Angehörigen <strong>und</strong> <strong>der</strong> beteiligten<br />
Berufsgruppe ernst. Wir berichten davon, wie wir das tun (Fragebogen<br />
vorstellen? Ist-Analyse erläutern).<br />
• Sehr anschaulich <strong>und</strong> lebhaft kann über Rituale <strong>und</strong> Aussegnung erzählt<br />
werden. Hier haben wir den Gedenktisch, die Erinnerungsecke, das Kondolenzbuch<br />
<strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Sachen, die wir zeigen können! Auch <strong>der</strong> Sterbekoffer,<br />
wenn er im Haus verwendet wird, soll präsentiert werden.<br />
• Bedeutsam ist es, die Vernetzung <strong>der</strong> Berufsgruppen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ehrenamtlichen<br />
deutlich zu machen. Sie dürfen live auftreten!<br />
• Ein an<strong>der</strong>es Thema wäre <strong>der</strong> Rahmen <strong>und</strong> Spielraum, den wir in <strong>der</strong> Terminalphase<br />
von Patienten <strong>und</strong> Bewohnern eröffnen. Wenn jemand stirbt,<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 143
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
erfährt er beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit. Dies reicht bis in die Pflegeplanung.<br />
• An dieser Stelle kann von Schmerz- <strong>und</strong> Symptomkontrolle erzählt werden.<br />
• Wichtig wäre es, spätestens hier die mögliche Einbindung <strong>der</strong> Angehörigen<br />
ins Gespräch zu bringen. Das beginnt bei <strong>der</strong> Möglichkeit von Übernachtungsplätzen<br />
<strong>und</strong> reicht bis zu konkreten Einbeziehung in die Sterbebegleitung<br />
(Stichwort: "Anfassen erlaubt")<br />
Merkposten. All dies sind nur Beispiele! Es ist <strong>kein</strong> „Muss“. Individualität geht<br />
vor.<br />
Anregungen für Planung <strong>und</strong> Durchführung<br />
Der Zeitpunkt einer solchen Veranstaltung muss gut überlegt werden. Passt<br />
es zur Saison? Was ist <strong>der</strong> Anlass? Gibt es eine Tradition solcher Angehörigenabende?<br />
Gut geplant werden muss dann die Zahl <strong>der</strong> möglichen Teilnehmer. Die<br />
Raumgröße muss stimmen! Einladungen mit Rückmeldung helfen Ihnen, die<br />
Zahl genauer einschätzen zu können.<br />
Auch die Einladung zu diesem Abend muss aussagekräftig sein. Vielleicht mit<br />
Zitaten zum Thema, mit Nennung <strong>der</strong> geplanten Referenten <strong>und</strong> mit Namen<br />
<strong>der</strong> Verantwortlichen.<br />
Merkposten: Je konkreter <strong>und</strong> ansprechen<strong>der</strong> die Einladung, desto mehr interessierte<br />
Besucher werden kommen.<br />
Die Teilnehmer, Veranstalter, Referenten <strong>und</strong> Gäste müssen alle gut auf diesen<br />
Abend vorbereitet werden. Dies bedeutet für jede dieser Gruppen etwas<br />
an<strong>der</strong>es!<br />
Die gesamte Vorbereitung sollte nicht in einer Hand liegen! Am besten ist es,<br />
wenn die Projektgruppe diesen Abend gemeinsam plant.<br />
Als Kernzeit für den Angehörigenabend sollten 90 Minuten ausreichen. Bitte<br />
Zeit davor <strong>und</strong> vor allen Dingen danach einplanen, damit ein informelles Beisammensein<br />
ermöglicht wird. Ein "open end" ist nie verkehrt.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 144
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Die Leitung des Abends sollte die Leiterin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Projektgruppe<br />
haben! Die Projektgruppenmitglie<strong>der</strong> sollten vorgestellt werden. Ganz wichtig<br />
ist es, dass eine feste Mo<strong>der</strong>ation für diesen Abend erkennbar ist.<br />
Einige methodische Tipps:<br />
• Gut geeignet, um die Teilnehmer interessiert <strong>und</strong> in Bewegung zu halten,<br />
sind „Murmelgruppen“ zu kurzen Fragen. Dies bringt Energie in die Veranstaltung,<br />
bewahrt uns vor peinlichem Schweigen o<strong>der</strong> vor einzelnen<br />
Dauerrednern.<br />
• Wir stellen ein Flipchart auf, an <strong>der</strong> einzelne Fragen aufgeschrieben werden,<br />
die aus dem Publikum kommen. Dies ermutigt die Teilnehmer <strong>und</strong><br />
zeigt ihnen, dass wir sie ernst nehmen. Fragen die sofort beantwortet<br />
werden können, streichen wir durch. Dies sichert den Erfolg des Abends.<br />
• Es hat sich auch bewährt, einzelne Medien o<strong>der</strong> Arbeitsblätter auszulegen.<br />
Vielleicht können auch Bil<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Gegenstände gezeigt werden, die<br />
mit dem Thema zu tun haben.<br />
• Der Raum darf nicht steril sein ("Wohlfühlumgebung"). Verköstigung kann<br />
auflockern auf - aber bitte nicht so viel, dass es vom Thema ablenkt!<br />
Auch die Öffentlichkeitsarbeit zu dieser Veranstaltung will bedacht sein.<br />
• Laden wir die Presse ein?<br />
• Schreiben wir einen Bericht über diese Veranstaltung für die Hauszeitung?<br />
• Wer macht Fotos? Wir wollen die Angehörigen auch nicht im Unklaren<br />
lassen, wenn es eine Dokumentation dieses Abends gibt. Sie sollen wissen,<br />
wo sie das nachlesen können.<br />
Merkposten: Wir werden an diesen Abend immer wie<strong>der</strong> daran erinnern, dass<br />
Einzelgespräche möglich <strong>und</strong> gewünscht sind. Es bleibt nicht bei dieser Gruppeninformation.<br />
Generell sind solche Informationsveranstaltungen für Externe <strong>und</strong> für Mitarbeiter,<br />
für Betroffene <strong>und</strong> Beteiligte in größeren Abständen wichtig. Sie stärken<br />
die Rolle des Projektes in <strong>der</strong> Einrichtung <strong>und</strong> festigen die Kultur einer Einrichtung.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 145
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 146
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Textbausteine<br />
7 Empfehlungen für Angehörige<br />
Teilnehmermaterial für Angehörigenabende<br />
1. Verbleibende gemeinsame Lebenszeit nutzen<br />
Man kann selten genau sagen, wann ein Leben zu Ende geht. Deshalb nutzen<br />
die die Zeit, die Ihnen mit Ihrem Angehörigen in Heim. Sie sind als Angehöriger<br />
durch niemanden zu ersetzen. Was möchten <strong>und</strong> können Sie Ihrem Angehörigen<br />
noch an Aufmerksamkeit schenken? Mit welchen Gefühlen möchten<br />
Sie in zehn Jahren auf diese letzte gemeinsame Lebensphase zurückblicken?<br />
2. Von „heim“-lichen Schuldgefühlen lösen<br />
Lösen Sie sich von Schuldgefühlen. Das Heim ist angesichts schwerer Krankheit,<br />
demenziellen Verän<strong>der</strong>ungen eine gute Alternative zu langjähriger, überfor<strong>der</strong>n<strong>der</strong><br />
häuslicher Pflege, die manchmal Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Familie zerstört.<br />
Lassen Sie sich nicht einreden, dass die Hilfe durch ein Heim ein Abschieben<br />
sei. Die heutigen Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Pflege sind völlig neu, was die Länge<br />
<strong>und</strong> Schwere <strong>der</strong> Pflege betrifft, <strong>und</strong> nicht mit „früher“ vergleichbar. Machen<br />
Sie stattdessen durch guten Kontakt mit Ihrem Angehörigen aus dem Heim<br />
ein zweites Daheim.<br />
3. Individuelle Pflege unterstützen<br />
Unterstützen Sie uns bei <strong>der</strong> individuellen Pflege. Sie sind unser wichtigster<br />
Partner bei dieser Bemühung. Um Ihren Angehörigen im Heim persönlich gerecht<br />
zu werden, brauchen wir Wissen über Gewohnheiten, Eigenheiten, Vorlieben<br />
<strong>und</strong> Abneigungen. Wir brauchen Sie <strong>und</strong> Ihre Kenntnis beson<strong>der</strong>s,<br />
wenn sich Ihr Angehöriger nicht o<strong>der</strong> nur schwer noch direkt mitteilen kann.<br />
Was gibt Ihrem Angehörigen im Heim ein Gefühl von Zuhause? Natürlich werden<br />
wir immer wie<strong>der</strong> an Grenzen des Machbaren stoßen, aber Grenzen gibt<br />
es auch zuhause. Das Persönlichste ist sowieso Ihre Beziehung zu Ihrem Angehörigen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 147
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
4. Rechtzeitig Vorsorge treffen <strong>und</strong> miteinan<strong>der</strong> sprechen<br />
Vorsorge ist wichtig für den Fall, dass sich Ihr Angehöriger nicht mehr selbst<br />
äußern kann. Wir informieren Sie hier gerne <strong>und</strong> haben bewährte Musterdokumente<br />
bereitliegen. Wenn es noch möglich ist, wäre es gut, wenn Ihr Angehöriger<br />
eine Patientenverfügung anlegt, die seinen Willen für bestimmte Situationen<br />
(z. B. dauerhafte Bewusstlosigkeit, fortgeschrittene Demenz) dokumentiert.<br />
Sie können – auch als Ehefrau o<strong>der</strong> –mann, Tochter o<strong>der</strong> Sohn - Ihren<br />
Angehörigen <strong>und</strong> seinen Willen nur dann wirksam vertreten, wenn Sie dazu<br />
ermächtigt worden sind. Möglichkeiten sind eine Vorsorgevollmacht o<strong>der</strong> eine<br />
Betreuungsverfügung. Zusammen mit dem behandelnden Arzt können (<strong>und</strong><br />
müssen) Sie dann im Sinne des Betroffenen auch über Krankenhauseinweisung<br />
o<strong>der</strong> den Verzicht darauf, eventuelle lebensverlängernde Maßnahmen<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Einstellung entscheiden. Sprechen Sie innerhalb <strong>der</strong> Familie darüber,<br />
damit Entscheidungen im Sinne <strong>und</strong> nach dem Willen des Betroffenen<br />
möglichst gemeinsam getroffen <strong>und</strong> verantwortet werden. Die entscheidende<br />
Frage ist: Was hätte Ihr Angehöriger in dieser Situation seiner Krankheit wohl<br />
gewollt, wenn er sich jetzt direkt dazu äußern könnte?<br />
5. Für eine gute Schmerztherapie eintreten<br />
Treten Sie für eine gute Schmerztherapie ein. Sie sind unser Verbündeter.<br />
Sprechen Sie mit uns <strong>und</strong> dem Hausarzt, wenn Sie den Eindruck haben, ihr<br />
Angehöriger muss unnötig Schmerzen leiden. Es gibt heute viele Möglichkeiten,<br />
Schmerzen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e quälende Symptome wirksam zu lin<strong>der</strong>n. Wir unterstützen<br />
die Schmerztherapie durch eine gute Schmerzbeobachtung <strong>und</strong><br />
achten dabei beson<strong>der</strong>s auf die oft vergessenen demenziell erkrankten Bewohner.<br />
Eine beson<strong>der</strong>s ausgebildete Palliative-Care-Fachkraft im Haus kann<br />
Sie <strong>und</strong> die Mitarbeiter beraten, was man pflegerisch noch Erleichterndes für<br />
Ihren Angehörigen tun kann. Ihr Hausarzt kann zudem die beson<strong>der</strong>e Beratung<br />
<strong>der</strong> Schmerzambulanz am Neuburger Krankenhaus nutzen.<br />
6. Angebote <strong>der</strong> Unterstützung nutzen<br />
Gerade in <strong>der</strong> letzten Zeit können Unruhe <strong>und</strong> Angst des schwerkranken,<br />
sterbenden Angehörigen <strong>und</strong> die Suche nach menschlicher Nähe beson<strong>der</strong>s<br />
gesteigert sein. Unsere ehrenamtliche Sitzwachengruppe mit freiwilligen Mitarbeitern<br />
aus <strong>der</strong> Pflege, Hauswirtschaft <strong>und</strong> Hospizhelfern des Hospizvereines<br />
Neuburg bietet Ihnen an, mit Ihnen zusammen ein möglichst starkes Netz<br />
<strong>der</strong> Begleitung in den letzten Wochen o<strong>der</strong> Tagen zu knüpfen. In <strong>der</strong> Regel ist<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 148
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ihr Angehöriger <strong>kein</strong> Frem<strong>der</strong> für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, son<strong>der</strong>n<br />
ihnen durch die tägliche Arbeit o<strong>der</strong> durch Besuche im Heim bereits bekannt.<br />
Unsere Mitarbeiter zeigen Ihnen zudem gerne, was Sie selbst noch Gutes tun<br />
können, auch wenn <strong>der</strong> Schwerkranke scheinbar nichts mehr wahrnimmt.<br />
7. Sich Zeit für einen würdigen Abschied nehmen<br />
Oft hat <strong>der</strong> Abschiedsschmerz schon in <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> schweren Erkrankung,<br />
Pflegebedürftigkeit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> demenziellen Verän<strong>der</strong>ung eingesetzt. Trotzdem<br />
<strong>und</strong> gerade auch deswegen ist die Zeit unmittelbar nach dem Versterben beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig. Es gilt, dem Bild des manchmal schweren Sterbens das Bild<br />
des Friedens im Tod dazu zu stellen. Für Sie als Angehörige ist es eine Ausnahmesituation.<br />
Wir legen Wert darauf, dass Sie diesen Abschied von einem<br />
für Sie wichtigen Menschen als würdig <strong>und</strong> auch als hilfreich erleben können.<br />
In unserer Einrichtung wird nicht schnell „entsorgt“. Uns ist die Zeit am Totenbett<br />
wichtig <strong>und</strong> „heilig“. Keine Stoppuhr soll dabei für Ihre Trauer ticken. Die<br />
Aufbahrung, die Atmosphäre in unserem Abschiedsraum („Oase <strong>der</strong> Trauer“),<br />
die Zeichen <strong>der</strong> Erinnerungen an den Verstorbenen auf seiner Wohnetage, die<br />
Gestaltung im Gedenkbuch <strong>und</strong> die rituellen Angebote unterstützen Sie. Auch<br />
in <strong>der</strong> Zeit danach sind Sie <strong>und</strong> <strong>der</strong> Bewohner nicht vergessen. In einer jährlichen<br />
Gedenkfeier gibt es Gelegenheit, das gemeinsame Leben <strong>und</strong> den Verstorbenen<br />
zu erinnern <strong>und</strong> zu würdigen.<br />
So schwer diese Zeit des Sterbens Ihnen oft scheint, so kann in ihr eine Kraftquelle<br />
für Ihr weiteres Leben liegen.<br />
Das Sterben eines Menschen bleibt<br />
als wichtige Erinnerung zurück bei denen,<br />
die weiterleben.<br />
Aus Rücksicht auf sie, aber auch<br />
Aus Rücksicht auf den Sterbenden<br />
Ist es unsere Aufgabe,<br />
einerseits zu wissen,<br />
was Schmerz <strong>und</strong> Leiden verursacht,<br />
an<strong>der</strong>erseits zu wissen,<br />
wie wir diese Beschwerden effektiv behandeln können.<br />
Was immer in den letzten St<strong>und</strong>en geschieht,<br />
kann viele W<strong>und</strong>en heilen,<br />
aber auch in unerträglicher Erinnerung verbleiben …<br />
Cicely Saun<strong>der</strong>s<br />
(Pionierin <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Hospizbewegung)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 149
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 150
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Formulierungshilfen<br />
Angehörige mit einem Flyer<br />
informieren<br />
Textbausteine für ein Faltblatt zur Palliativkultur 1<br />
Titel: Wenn nichts mehr zu machen ist,<br />
können wir noch manches tun …<br />
Untertitel: Palliative Care – ein beson<strong>der</strong>s Angebot unserer Einrichtung<br />
Bildmotiv Hände<br />
Palliative Betreuung bedeutet:<br />
die Behandlung <strong>und</strong> Pflege von Menschen, die an einer nicht heilbaren<br />
Krankheit leiden o<strong>der</strong> die aufgr<strong>und</strong> ihres hohen Alters nur noch eine begrenzte<br />
Lebenszeit haben.<br />
Wir möchten dabei ein weitgehend beschwerdefreies, würdevolles Leben bis<br />
zuletzt ermöglichen. Die Lebensqualität <strong>und</strong> <strong>der</strong> Wille <strong>der</strong> Betroffenen stehen<br />
für uns im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>.<br />
Wir achten dabei ganzheitlich auf die jeweiligen körperlichen, psychischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> spirituellen Bedürfnisse. Wir wissen um unsere Grenzen <strong>und</strong> sehen<br />
die Lebens- <strong>und</strong> Sterbebegleitung als gemeinsame Aufgabe.<br />
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie hier Anliegen o<strong>der</strong> Fragen haben:<br />
Ansprechpartner: …<br />
Tel.: …<br />
1 Entwurf: Projekt-Werkstatt RKS, 2006-2007<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 151
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Vorschlag für Gedicht<br />
Geh nicht vor mir her –<br />
Ich kann dir nicht folgen,<br />
denn ich suche meinen eigenen Weg.<br />
Geh nicht hinter mir –<br />
Ich bin gewiss <strong>kein</strong> Leiter!<br />
Bitte bleib an meiner Seite – <strong>und</strong> sei nichts als ein Fre<strong>und</strong><br />
Und mein Begleiter<br />
Albert Camus<br />
Palliative Care übersetzen wir in unsere Sterbebegleitung durch folgendes<br />
Haltungen <strong>und</strong> Handlungen:<br />
Persönlich begleiten:<br />
• ganzheitliche Betreuung<br />
• <strong>und</strong> dabei die persönlichen Biografie berücksichtigen<br />
Angehörige einbinden:<br />
• ermutigen <strong>und</strong> Anleiten in <strong>der</strong> Sterbegleitung<br />
• praktische Unterstützung<br />
• Auszeiten ermöglichen<br />
• Abschied in Ruhe ermöglichen<br />
Leiden lin<strong>der</strong>n:<br />
• für Schmerztherapie <strong>und</strong><br />
• <strong>und</strong> psychosoziale Betreuung sorgen<br />
Leben lebenswert halten:<br />
• unterstützende Lebensbegleitung,<br />
• orientiert an den Werten des jeweiligen Menschen<br />
Individuellen Bewohnerwillen respektieren:<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 152
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Gespräche über Vorstellungen anbieten<br />
• Patientenverfügungen berücksichtigen<br />
Achten <strong>der</strong> Menschenwürde:<br />
• respektvoller Umgang mit den Betroffenen <strong>und</strong> ihren Angehörigen,<br />
• ohne Vorurteile <strong>und</strong> Wertungen in schwierigen Situationen<br />
Therapeutisch beson<strong>der</strong>s unterstützen:<br />
• Aromatherapie, Basale Stimulation, Atemtherapie<br />
• enge Zusammenarbeit mit an<strong>der</strong>en Therapeuten<br />
• Respektvoller Umgang mit den Betroffenen <strong>und</strong> ihren Angehörigen,<br />
Informationen geben:<br />
• bei Unsicherheiten <strong>und</strong> Fragen ansprechbar sein<br />
• Palliative-Care-Pflegekräfte in <strong>der</strong> Einrichtung bei beson<strong>der</strong>en Anliegen<br />
Vertrauen schaffen:<br />
• mit Angehörigen, Ärzten, ehrenamtlichen Helfern zum Wohle <strong>der</strong> Betroffenen<br />
zusammenarbeiten<br />
• gemeinsam auf erwartbare Krisen <strong>und</strong> eventuelle Notfallsituationen vorbereiten<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 153
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 154
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übersicht<br />
Palliative-Care-Fachkräfte nutzen<br />
Aufgaben-Profil für den Einsatz in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Palliative-Care-Fachkräfte sind beson<strong>der</strong>s geschulte examinierte Pflegekräfte,<br />
die eine Weiterbildung Palliative Care im Umfang von 160 Std. absolviert haben<br />
(Curriculum Kern, Müller, Aurnhammer). Im Zentrum dieser Weiterbildung<br />
stehen die medizinisch-pflegerischen, psychosozialen <strong>und</strong> spirituellen Aspekte<br />
<strong>der</strong> Sterbebegleitung. Der Kurs qualifiziert Pflegekräfte, innerhalb Ihrer jeweiligen<br />
Einrichtung (Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim, Sozialstation, Krankenhaus, Hospiz,<br />
Palliativstation) palliativ-pflegerisch zu arbeiten, zu beraten <strong>und</strong> anzuleiten.<br />
Für die Fachkräfte in ambulanten Hospiz- <strong>und</strong> Palliativberatungsdiensten ist<br />
<strong>der</strong> Kurs verpflichtend (Anfor<strong>der</strong>ungsprofil, Rahmenvereinbarung nach § 39 a<br />
Abs. 2 Satz 6 SGB V).<br />
Ziele<br />
• Sicherheit: Die Pflegekräfte im Haus fühlen sich bei speziellen palliativen<br />
Pflegeproblemen sicher.<br />
• Zuverlässige palliative Pflege: Palliative Pflege wird bei allen Bewohnern<br />
gewährleistet, die diese Form <strong>der</strong> Betreuung benötigen.<br />
Aufgaben<br />
• Anleitung: Die Palliative-Care-Fachkräfte leiten Pflegekräfte am Krankenbett<br />
o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Übergabe an.<br />
• Kontrolle palliative Pflege: Die Palliative-Care-Fachkraft kontrolliert die<br />
besprochenen Pflegemaßnahmen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Dokumentation. Sie übernimmt<br />
die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung <strong>der</strong><br />
Maßnahmen (in Absprache mit <strong>der</strong> SL / stellvertretenden SL des jeweiligen<br />
Bereiches)<br />
• Fortbildungen: Die Palliative-Care-Kräfte organisieren o<strong>der</strong> gestalten<br />
selbst kleine, interne Fortbildungen zur palliativen Pflege, um ihr praktisches<br />
Wissen weiterzugeben.<br />
• Beratung: Die Palliative-Care-Fachkraft berät bei beson<strong>der</strong>en Problemstellungen.<br />
Die Beratung wird von <strong>der</strong> jeweiligen Stationsleitung angefor<strong>der</strong>t.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 155
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 156
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Dokumentation<br />
Schmerzen bei demenziell erkrankten<br />
Menschen erfassen<br />
ECPA-Beobachtungsbogen (Roland Kunz)<br />
Vorname<br />
Familienn.<br />
geb.:<br />
Bewertet durch:<br />
Dimension 1: Beobachtung außerhalb <strong>der</strong> Pflege<br />
Datum Gesamtwert<br />
Beobachtungsfeld 1: Verbale Äußerungen: Stöhnen, Klagen, Weinen, Schreien<br />
Verhalten Anmerkung zur Situation<br />
0 BewohnerIn macht <strong>kein</strong>e Äußerungen hinsichtlich<br />
Schmerzen*<br />
1 Schmerzäußerungen, wenn BewohnerIn angesprochen<br />
wird<br />
2 Schmerzäußerung, sobald jemand in <strong>der</strong> Nähe ist<br />
3 Spontane Schmerzäußerung o<strong>der</strong> immer wie<strong>der</strong> leises<br />
Weinen, Schluchzen, auch wenn BewohnerIn anscheinend<br />
niemand in ihrer Umgebung wahrnimmt*<br />
4 Spontanes Schreien bzw. qualvolle Äußerungen<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 157
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beobachtungsfeld 2: Gesichtsausdruck (Blick <strong>und</strong> Mimik)<br />
Verhalten Anmerkung zur Situation<br />
0 Entspannter Gesichtsausdruck<br />
1 Besorgter, gespannter Blick<br />
2 Ab <strong>und</strong> zu anscheinend schmerzhaftes Verziehen des<br />
Gesichts, Grimassen*<br />
3 Schmerzhaft verkrampfter Blick*<br />
4 Vollständig starrer Blick / Ausdruck<br />
Beobachtungsfeld 3: Spontane Ruhehaltung<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Anmerkung zur Situation<br />
Keinerlei Schonhaltung erkennbar<br />
Vermeidung einer bestimmten Position, Haltung<br />
Person wählt ständig eine Schonhaltung, aber kann<br />
sich noch bewegen<br />
Person sucht erfolglos eine schmerzfreie Schonhaltung<br />
Person bleibt vollständig immobil<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 158
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Dimension 2: Beobachtungen während <strong>der</strong> Pflege<br />
Beobachtungsfeld 4: Abwehr bei <strong>der</strong> Pflege<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Anmerkung zur Situation<br />
Person zeigt <strong>kein</strong>e Angst<br />
Ängstlicher Blick, angstvoller Ausdruck bei pflegerischen<br />
Maßnahmen*<br />
Person reagiert mit körperlicher Unruhe<br />
Person reagiert mit abwehrenden Bewegungen*<br />
Person schreit, stöhnt, jammert<br />
Beobachtungsfeld 5: Reaktion bei <strong>der</strong> Mobilisation<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Anmerkung zur Situation<br />
Person steht auf / lässt sich mobilisieren ohne spezielle<br />
Beachtung<br />
Person hat gespannten Blick / scheint Mobilisation<br />
<strong>und</strong> Pflege zu fürchten<br />
Person klammert mit den Händen / macht Gebärden<br />
während Mobilisation <strong>und</strong> Pflege<br />
Person nimmt während Mobilisation / Pflege Schonhaltung<br />
ein<br />
Person wehrt sich gegen Mobilisation <strong>und</strong> Pflege<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 159
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beobachtungsfeld 6: Reaktionen während <strong>der</strong> Pflege schmerzhafter Zonen<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Person zeigt <strong>kein</strong>erlei auffällige Reaktionen während<br />
<strong>der</strong> Pflege ( z. B. bei einer W<strong>und</strong>versorgung<br />
Person reagiert, Reaktion ist allerdings nicht deutlich<br />
als Schmerzreaktion einzuordnen*<br />
Person reagiert bereits bei flüchtiger Berührung<br />
schmerzhafter Zonen*<br />
Person reagiert beim Anfassen schmerzhafter Zonen<br />
Es ist unmöglich, sich schmerzhaften Zonen zu nähern<br />
Beobachtungsfeld 7: Verbale Äußerungen während <strong>der</strong> Pflege<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Keine Schmerzäußerungen während <strong>der</strong> Pflege*<br />
Schmerzäußerung, wenn man sich an die Person<br />
wendet<br />
Schmerzäußerung, sobald Pflegekraft sich in <strong>der</strong> Nähe<br />
<strong>der</strong> Person aufhält<br />
Spontane Schmerzäußerung o<strong>der</strong> immer wie<strong>der</strong> leises<br />
Weinen, Schluchzen, auch wenn BewohnerIn anscheinend<br />
niemand in ihrer Umgebung wahrnimmt*<br />
Spontanes Schreien bzw. qualvolle Äußerungen<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 160
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Dimension 3: Auswirkungen auf Aktivitäten<br />
Beobachtungsfeld 8: Auswirkungen auf den Appetit<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Keine Verän<strong>der</strong>ungen bezüglich Appetit erkennbar<br />
(gilt auch für die Essenseingabe)*<br />
Person hat einen leicht reduzierten Appetit – bei<br />
Speisen, die sie sonst mag (gilt auch für die Essenseingabe)*<br />
Person muss im Unterschied zu früherem Essverhalten<br />
animiert werden – bei Speisen, die sie sonst mag,<br />
- einen Teil <strong>der</strong> Mahlzeiten zu essen (gilt auch für die<br />
Essenseingabe)*<br />
Person ist trotz Auffor<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> sonstiger Animation<br />
nur ein paar Bissen (gilt auch für die Essenseingabe)*<br />
Person verweigert jegliche Nahrung ( gilt auch für die<br />
Essenseingabe)*<br />
Beobachtungsfeld 9: Auswirkungen auf den Schlaf<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Person schläft anscheinend gut / wirkt beim Aufwachen<br />
ausgeruht*<br />
Person hat gegenüber bisherigen Schlafverhalten<br />
Schwierigkeiten einzuschlafen o<strong>der</strong> erwacht verfrüht*<br />
Person hat gegenüber bisherigen Schlafverhalten<br />
Schwierigkeiten einzuschlafen <strong>und</strong> erwacht verfrüht*<br />
Person wacht zusätzlich nachts auf <strong>und</strong> ist unruhig<br />
Person findet <strong>kein</strong>en o<strong>der</strong> selten Schlaf<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 161
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beobachtungsfeld 10: Auswirkungen auf Bewegungen<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Person bewegt sich wie gewohnt ohne Zeichen von<br />
Schmerz*<br />
Person bewegt sich wie gewohnt, vermeidet nun aber<br />
gewisse Bewegungen<br />
Person bewegt sich im Vergleich zu ihrem vorherigen<br />
Verhalten seltener <strong>und</strong> deutlich verlangsamt<br />
Person ist immobil<br />
Person wirkt apathisch o<strong>der</strong> unruhig<br />
Beobachtungsfeld 11: Abwehr bei <strong>der</strong> Pflege<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Verhalten Evtl. Anmerkung zur Situation<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 162
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Thesen<br />
Leitlinien Kooperation mit Ärzten<br />
Hilfen für interne Rollenklärungen <strong>und</strong><br />
Kommunikation 1<br />
Verbindendes Ziel: Für das Gelingen <strong>der</strong> Sterbebegleitung ist jede Berufsgruppe<br />
gleich wichtig. Bei aller Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> Kompetenzen eint uns<br />
das Ziel, die Lebensqualität des Bewohners bis zum Schluss zu erhalten.<br />
Beson<strong>der</strong>e Verantwortung <strong>der</strong> Pflege: Unsere beson<strong>der</strong>e Verantwortung<br />
als Pflegende sehen wir neben <strong>der</strong> umfassenden direkten pflegerischen<br />
Betreuung in einer guten Dokumentation zur Schmerzerfassung <strong>und</strong> Symptomkontrolle.<br />
Ärzte sind in ihren Entscheidungen auch abhängig von <strong>der</strong><br />
Qualität <strong>der</strong> Informationen, die sie von uns Pflegekräften erhalten. Deshalb ist<br />
es wichtig, dass wir als Pflegekräfte unsere Beobachtungen systematisch führen,<br />
Ergebnisse abgleichen <strong>und</strong> in den Aussagen einheitlich auftreten.<br />
Initiative ergreifen: Hausärzte sollen sich in unseren Einrichtungen als willkommene<br />
Kooperationspartner fühlen. Als Pflegekräfte gehen wir auf Hausärzte<br />
zu, benennen verbindliche Ansprechpartner, nehmen uns Zeit für Visiten<br />
(spart hinterher Zeit!) <strong>und</strong> sind im Ton entgegenkommend <strong>und</strong> korrekt. Wir<br />
überprüfen immer wie<strong>der</strong>, ob diese Atmosphäre stimmt, indem wir die Perspektive<br />
wechseln: Wie würde es uns als Gäste <strong>und</strong> Kooperationspartner in<br />
unserem Haus gehen?<br />
Kooperationen pflegen: Kooperation braucht eine beson<strong>der</strong>e Basis. Deshalb<br />
suchen wir nicht nur den direkten Gesprächskontakt bei <strong>der</strong> Visite, <strong>der</strong> ja<br />
oft zeitlich von beiden Seiten stark begrenzt ist, son<strong>der</strong>n laden im Rahmen<br />
des Projektes die Ärzte auch zu Informationsveranstaltungen ein, bzw. nutzen<br />
vorhandene Gesprächskreise (z. B. Ärzte-Stammtisch) für den intensiven Gedankenaustausch.<br />
1 Die Leitlinien sind aufgr<strong>und</strong> von Gruppendiskussionen in einer Projekt-Werkstatt <strong>der</strong> RKS 2006-2007 ent-<br />
standen<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 163
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Krisenvorsorge mo<strong>der</strong>ieren: Frühzeitige Krisenvorsorge <strong>und</strong> Notfallplanung<br />
ist uns ein wichtiges Anliegen. Diese dienen auch zur rechtlichen Absicherung<br />
für die Ärzte <strong>und</strong> uns als Pflegekräfte. Wir regen deshalb entsprechende Gespräche<br />
zwischen Arzt <strong>und</strong> Bewohner/Betreuer/Angehörige an. Unsere Rolle<br />
kann dabei die von Mo<strong>der</strong>atoren sein, die zudem pflegerische Möglichkeiten<br />
einbringen. Wir sorgen dafür – wenn notwendig -, dass wichtige Dokumente<br />
(z. B. Patientenverfügung, Notfallplan) an behandelnde Ärzte weitergegeben<br />
werden.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 164
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Hausärzte zur Kooperation einladen<br />
Textbeispiel für ein R<strong>und</strong>schreiben<br />
Sehr geehrter Dr. ….,<br />
seit Anfang des Jahres 2005 organisieren wir unter dem Leitmotiv „Im Leben<br />
<strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ eine gute Palliativversorgung für unser<br />
Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim St. Augustin.<br />
Wie Sie ja als Hausarzt wissen, sind gerade die Ungewissheiten das, was<br />
Menschen in ihrer letzten Lebensphase beson<strong>der</strong>s belasten. Werde ich vielleicht<br />
noch ins Krankenhaus gebracht <strong>und</strong> muss dort sterben? Werden<br />
Schmerzen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Nöte im Heim beherrschbar sein? Gleichzeitig sehen<br />
sich viele verunsichert, was ihre Rechte als Patienten angeht …<br />
Wir haben deshalb einige Standards für unser Haus entwickelt, um diesen<br />
Ängsten <strong>und</strong> vorhersehbaren Krisen <strong>und</strong> Komplikationen vorzubeugen. Neben<br />
frühzeitigen Gesprächsangeboten zum Thema „Lebensqualität sichern“ (mit<br />
Betroffenen o<strong>der</strong> – falls nicht mehr möglich – mit autorisierten Angehörigen<br />
o<strong>der</strong> Betreuern) <strong>und</strong> einer guten Schmerzerfassung von unserer Seite (z. B.<br />
bei Demenzkranken) sind dies vor allem Gespräche zur Krisenvorsorge<br />
<strong>und</strong> Notfallplanung. Diesen beson<strong>der</strong>en Standard haben wir Ihnen beigelegt<br />
mit <strong>der</strong> Bitte um Ihr fachliches Urteil. Er wird in unterschiedlichen Varianten<br />
bereits in einigen Heimen praktiziert. Als Hausarzt haben Sie hier eine<br />
Schlüsselfunktion. Was halten Sie von diesem Vorgehen? Könnten Sie diese<br />
Art <strong>der</strong> Krisenvorsorge mittragen?<br />
Unsere Mitarbeiterin, Frau …, wird in den beiden nächsten Wochen ein Gespräch<br />
innerhalb Ihrer Sprechst<strong>und</strong>en mit Ihnen verabreden. Wir sind zuversichtlich,<br />
dass es uns gemeinsam gelingen wird, einen Rahmen zu schaffen,<br />
<strong>der</strong> die Vorstellungen <strong>und</strong> Wünsche von BewohnerInnen sichert <strong>und</strong> schützt<br />
Für das Heim St. Augustin<br />
….<br />
P. S. Bei <strong>der</strong> hausärztlichen Schmerztherapie gibt es gerade bei älteren Menschen immer wie<strong>der</strong><br />
Komplikationen, die kollegiale Beratung benötigen. Wir freuen uns deshalb, dass Herr Dr.<br />
Herrmann von <strong>der</strong> Neuburger Schmerzambulanz sich bereit erklärt hat, bei Fragen <strong>der</strong><br />
Schmerztherapie Sie je<strong>der</strong> Zeit telefonisch zu beraten. Auf dieses Angebot möchten wir Sie<br />
jetzt schon hinweisen.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 165
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ideensammlung<br />
Krisenvorsorge absichern<br />
Wie können Hausärzte eingeb<strong>und</strong>en werden?<br />
• Einladung von Ärzten zum Gespräch zum Austausch von Wünschen <strong>und</strong><br />
wechselseitigen Erwartungen<br />
• Weitergabe <strong>der</strong> Info-Broschüren des CHV (zur Schmerztherapie, Ernährung,<br />
Atemnot)<br />
• Fortbildungsangebot in Kooperation mit <strong>der</strong> Kassenärztlichen Vereinigung<br />
mit Fortbildungspunkten bewertet<br />
• R<strong>und</strong>brief an Hausärzte mit <strong>der</strong> Frage, ob diese sich an <strong>der</strong> Wertanamnese<br />
<strong>und</strong> Notfallplanung beteiligen<br />
• Information von Angehörigen (z. B. gegen das Schreckgespenst „verhungern<br />
lassen“ <strong>und</strong> den Druck mancher Ärzte)<br />
• Problem: Vorbehalt von Ärzten, Medikamente für den Notfall zu verschreiben,<br />
die vielleicht nie gebraucht werden. Idee: Ärztlicher Medikamentenschrank<br />
im Pflegeheim mit Bedarfsmedikamenten<br />
• Hotline mit ausgewiesenen Schmerztherapeuten für die Beratung <strong>der</strong><br />
Hausärzte organisieren<br />
• Ärztliche Foren nutzen, z. B. Ärzte-Stammtisch, um für die Idee <strong>der</strong> Notfallvorsorge<br />
zu werben <strong>und</strong> zu informieren<br />
• Einen hausärztlichen Notdienst unter den Hausärzten des Pflegeheimes<br />
für die Wochenenden anregen, statt auf Rettungsdienst angewiesen zu<br />
sein. Erfahrungen in Berlin: Modell senkt die Einweisungsrate an Wochenende<br />
um 30%.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 166
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Formen <strong>der</strong> Sterbehilfe<br />
Überblick über Formen <strong>und</strong> ihre rechtliche Bewertung<br />
Tötung<br />
auf Verlangen<br />
-<br />
Verboten<br />
Sterbehilfe<br />
Aktive Sterbehilfe Passive Sterbehilfe<br />
Beihilfe<br />
zum Suizid<br />
+<br />
Privat erlaubt,<br />
allerdings<br />
sind Anwesendeverpflichtet<br />
zur<br />
Rettung, weil<br />
Suizidversuch<br />
rechtlich als<br />
Unfall bewertet<br />
wird)<br />
Medizinern<br />
standesrechtlichverboten<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
Indirekte Sterbehilfe<br />
+<br />
Schmerztherapie<br />
mit Risiko <strong>der</strong> Lebensverkürzung<br />
erlaubt. Bei sachk<strong>und</strong>iger<br />
Therapie<br />
ist dieses Risiko<br />
aber gering.<br />
Sterben zulassen<br />
Palliativmedizinisch<br />
<strong>und</strong> –pflegerische<br />
Unterstützung, psychosozialerBeistand<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 167<br />
+<br />
Auf Wunsch<br />
des Betroffenen<br />
geboten!<br />
……………….<br />
-<br />
Ohne gesicherten<br />
Willen<br />
unterlassene<br />
Hilfeleistung !<br />
+<br />
Geboten!<br />
Mangelnde Schmerztherapie<br />
ist unterlassene<br />
Hilfeleistung.
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übersicht<br />
Palliative Notfälle bedenken<br />
Typische Probleme <strong>und</strong> bewährte Lösungen in Projekten<br />
Standard<br />
Gemeinsames Besprechen im<br />
Team: Bei welchen Bewohner sind<br />
Krisen aufgr<strong>und</strong> des Krankheitsbildes<br />
wahrscheinlich? Wie gehen wir<br />
Problem: Erkennen durch die Pflege-<br />
damit um?<br />
kräfte, wann jemand als palliativer Bewohner<br />
einzuschätzen ist.<br />
Scheu vor klarer Dokumentation Fallbesprechungen im Team<br />
Unsicherheit mancher Hausärzte, Notfall-Situationen<br />
gut abzusprechen <strong>und</strong><br />
vorzubereiten<br />
Fehlendes flächendeckendes Beratungsangebot<br />
Mangelnde Routine (bei palliatven Notfällen)<br />
Fehlende Bedarfsmedikation<br />
Im Vorfeld Heimaufsicht/MDK bei<br />
absehbaren Konfliktfällen einbeziehen<br />
Kooperation mit routinierten Palliativ-Beratungsdiensten<br />
Vorgespräche (Erfassen von Sterbewünschen)<br />
Verstärkung durch eigene Palliativkräfte<br />
(evtl. mit Hospitationen/Praktikum<br />
im Hospiz)<br />
„Arzt-Schrank“ im Heim (mit vereinbartem<br />
Zugang für Pall.-Care-<br />
Pflegekraft)<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 168
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übersicht<br />
Krisen vorsorgen <strong>und</strong> Notfälle planen<br />
Standard zur Absicherung von Entscheidungen<br />
Wir unterscheiden zwischen akuten <strong>und</strong> palliativen Notfällen. Akute Notfälle<br />
(z. B. Herzinfarkt) sind überraschend <strong>und</strong> nicht vorhersehbar. Palliative Notfälle<br />
dagegen sind bestimmte Komplikationen <strong>und</strong> Krisensituationen (z. B.<br />
Schmerzen, Blutungen usw.), die aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Erkrankung wahrscheinlich<br />
<strong>und</strong> absehbar sind. Diese Situationen gilt es frühzeitig in den Blick zu nehmen<br />
<strong>und</strong> Vorentscheidungen zu treffen, wie gehandelt werden soll.<br />
Entscheidungsberechtigt sind<br />
• zum <strong>der</strong> Arzt mit seiner medizinische Indikation. (Was sind meine Behandlungsangebote<br />
für die Situation? Welche Behandlung bringt für den Patienten<br />
noch einen Nutzen o<strong>der</strong> schadet ihm zumindest nicht? Was braucht<br />
es zur Absicherung <strong>der</strong> Entscheidung, z. B. an Medikamenten)<br />
• zum an<strong>der</strong>en natürlich <strong>der</strong> Bewohner / Patient bzw. dessen Stellvertreter<br />
(Bevollmächtigter o<strong>der</strong> Betreuer) mit seinem Willen für diese Situation.<br />
(Was sind meine Wünsche für die Situation? Welche Behandlung möchte<br />
ich erhalten, tolerieren o<strong>der</strong> ablehnen?)<br />
Info: Diese ärztlichen <strong>und</strong> betreuenden Entscheidungen stehen übrigens nicht unter <strong>der</strong> Aufsicht<br />
des MDK o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Heimaufsicht. Das Vorm<strong>und</strong>schaftsgericht wird nur angerufen, wenn<br />
Arzt <strong>und</strong> Bevollmächtigter uneins sind o<strong>der</strong> bei begründetem Verdacht, dass <strong>der</strong> Wille missbräuchlich<br />
angeführt wird.<br />
Unsere Aufgabe als Einrichtung sehen wir, eine Kultur <strong>der</strong> ethischen Entscheidungsfindung<br />
zu schaffen, d. h. Entscheidungsprozesse möglichst<br />
frühzeitig anzuregen <strong>und</strong> - wenn gewünscht – die Beteiligten beratend zu unterstützen<br />
<strong>und</strong> die dokumentierten Ergebnisse zu sichern. Da gerade die Pflegekräfte<br />
vor Ort die jeweiligen Behandlungsentscheidungen mittragen <strong>und</strong><br />
umsetzen müssen, scheint uns die Einbindung <strong>der</strong> Pflege in die Gespräche<br />
sinnvoll <strong>und</strong> notwendig. In diesem Standard haben wir für den Weg <strong>der</strong> Entscheidungsfindung<br />
einige Schritte <strong>und</strong> Leitfragen zur Orientierung festgehalten.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 169
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ziele<br />
1. Offene Kommunikation: Die Betroffenen (Bewohnerin, Angehörige) <strong>und</strong><br />
Beteiligten (Pflegekräfte, ÄrztInnen) kommen frühzeitig in eine offene<br />
Kommunikation. Das Thema "Krisenvorsorge" <strong>und</strong> die Gesprächspartner<br />
sind von <strong>der</strong> Bewohnerin gewünscht.<br />
2. Sorgfältig abwägende Abklärung: Das Vorgehen bei erwartbaren<br />
Krankheitsverläufen <strong>und</strong> möglichen Komplikationen sind mit ihren Folgen<br />
<strong>und</strong> Alternativen mit <strong>der</strong> Bewohnerin besprochen worden. Die Beratung<br />
wird von den Betroffenen <strong>und</strong> Beteiligten als hilfreich <strong>und</strong> einfühlsam bewertet.<br />
3. Informiertes Einverständnis: Die geplanten Maßnahmen (umfasst auch<br />
Abbruch <strong>und</strong> Sterben zulassen) für Krisen o<strong>der</strong> Notfälle entsprechen dem<br />
informiert-erklärten o<strong>der</strong> mutmaßlichen Willen.<br />
4. Sicherheit <strong>der</strong> Beteiligten: Die MitarbeiterInnen <strong>und</strong> die betroffenen Angehörigen<br />
fühlen sich sicher im Umgang mit den erwartbaren möglichen<br />
Krisen. Sie können die geplanten einzelnen Maßnahmen fachlich nachvollziehen,<br />
sie persönlich mittragen <strong>und</strong> - soweit notwendig - praktisch<br />
ausführen.<br />
5. Keine ungewollte Einweisung: Die ungewollte Einweisung in ein Krankenhaus<br />
wird vermieden.<br />
6. Klare Dokumentation: Die Entscheidungen sind klar <strong>und</strong> korrekt dokumentiert.<br />
Die wichtigen Dokumente sind am richtigen Ort hinterlegt.<br />
Organisierter Rahmen: Die notwendigen Hilfsmittel sind vorhanden <strong>und</strong> die<br />
benötigten Medikamente ausreichend bevorratet. Vorbereitung<br />
• Bei <strong>der</strong> Aufnahme: Im wird durch die Verwaltung abgeklärt, ob bereits Patientenverfügung<br />
<strong>und</strong> Vorsorgevollmachten <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> Betreuungsverfügung<br />
vorliegen, wer davon weiß <strong>und</strong> wo diese hinterlegt sind. Ein Duplikat<br />
kommt zu den Unterlagen auf Station, damit diese schnell verfügbar ist (z.<br />
B. an Wochenenden). Im Aufnahmegespräch wird empfohlen, eine Kopie<br />
beim behandelnden Arzt zu deponieren. (Siehe Standard � Aufnahme)<br />
• Über beson<strong>der</strong>s Gesprächsangebot: Falls die Möglichkeiten <strong>der</strong> Vorsor-<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 170
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
ge unbekannt sind, werden sie auf Wunsch erläutert. Sofern sich die Betroffenen<br />
darüber hinaus näher informieren o<strong>der</strong> eine Verfügung anlegen<br />
wollen, können diese ein Informationsgespräch (Siehe: Die letzte Lebensphase<br />
in den Blick nehmen) vereinbaren (Zuständig: Pflegeüberleitungskraft<br />
= PÜL). Auf Wunsch erhalten BewohnerInnen zur Vorbereitung<br />
die Vorsorgemappe des Bayerischen Justizministeriums. Falls das Thema<br />
die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt überfor<strong>der</strong>t, signalisiert die PÜL, dass<br />
sie auch zukünftig dafür ansprechbar ist. Sie klärt ab, ob sie die Betreffenden<br />
noch einmal darauf ansprechen darf. Falls die Bewohnerin sich nicht<br />
mehr äußern kann, wird im Bedarfsfall mit den autorisierten Angehörigen<br />
(Bevollmächtigten) / Betreuer <strong>der</strong>en mutmaßlicher Wille rekonstruiert.<br />
• Über Aushang werden die BewohnerInnen informiert, dass sie je<strong>der</strong> Zeit<br />
Informationsgespräche mit <strong>der</strong> PÜL vereinbaren können.<br />
• Bei <strong>der</strong> pflegerischen Versorgung sind die beteiligten Pflegekräfte hellhörig<br />
für angedeutete o<strong>der</strong> direkt geäußerte Ängste o<strong>der</strong> Vorstellungen <strong>der</strong><br />
Betroffenen o<strong>der</strong> von Angehörigen) z. B. zum weiteren Krankheitsverlauf.<br />
Sie greifen entsprechende Äußerungen auf <strong>und</strong> fragen nach. Die Pflegekräfte<br />
informieren die Stationsleitung o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Stellvertretung darüber.<br />
• Im Falle schwerer Krankheit: Das Gespräch zur Krisenvorsorge wird beson<strong>der</strong>s<br />
empfohlen, wenn <strong>der</strong> Tod innerhalb von vier Wochen <strong>kein</strong>e Überraschung<br />
wäre o<strong>der</strong> eine lebensbedrohliche Grun<strong>der</strong>krankung vorliegt. Die<br />
PÜL klärt nach Rücksprache mit <strong>der</strong> Stationsleitung je nach Bereitschaft<br />
<strong>und</strong> Dringlichkeit ab, ob ein beratendes Gespräch mit dem Hausarzt zum<br />
Thema "Krisenvorsorge-Notfall" vermittelt werden soll. Entscheidend ist<br />
aber immer die Bereitschaft des Betroffenen. Wenn gewollt, wird besprochen,<br />
wer bei einem Gespräch dabei sein soll. In <strong>der</strong> Regel erfolgt <strong>der</strong> Anstoß<br />
zur Krisenvorsorge <strong>und</strong> palliativen Notfallplanung zum Krisengespräch<br />
über den Betreuer o<strong>der</strong> den Bevollmächtigten.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 171
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Durchführung<br />
Das Beratungsgespräch zur Krisenvorsorge (Leitfaden für das Vorgehen)<br />
• Verantwortlich: Hausarzt <strong>und</strong> BewohnerIn o<strong>der</strong> Bevollmächtigter o<strong>der</strong><br />
Betreuer, unterstützt von <strong>der</strong> Stationsleitung o<strong>der</strong> Schichtleitung. Bei Bedarf<br />
nutzen diese die Kompetenzen einer <strong>der</strong> Palliative-Care-fachkräfte<br />
des Hauses.<br />
• Ziel benennen: Es gilt, gemeinsam vorsorglich Wege zu überlegen, die<br />
von <strong>der</strong> betroffenen Bewohnerin sind o<strong>der</strong> in ihrem Sinne wären (oberster<br />
Maßstab!) <strong>und</strong> die die Angehörigen möglichst mittragen können.<br />
• Verän<strong>der</strong>barkeit betonen: Die Bewohnerin wird darauf hingewiesen, dass<br />
Än<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Ergänzungen je<strong>der</strong>zeit möglich sind. Das festgelegte Verfahren<br />
in Krisen gilt nur, wenn die Bewohnerin sich in <strong>der</strong> akuten Situation<br />
nicht mehr direkt äußern kann. Ansonsten gilt immer <strong>der</strong> aktueller Wille.<br />
• Die Gesprächspunkte werden kurz abgesprochen. Als Leitfaden für das<br />
Gespräch können eventuell auch Punkte aus <strong>der</strong> jeweiligen Patientenverfügung<br />
dienen, sofern erstellt.<br />
• Krankheitsgeschichte <strong>und</strong> Diagnose<br />
• Wie sehen die Beteiligten die momentane ges<strong>und</strong>heitliche Situation?<br />
Was sind die beson<strong>der</strong>en Sorgen aufgr<strong>und</strong> des Krankheitsverlaufes?<br />
Welche Komplikationen könnten auftreten? Was könnte man aus ärztlicher<br />
Sicht zur Lin<strong>der</strong>ung tun?<br />
• Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen zu Krankenhauseinweisung, Sterben im<br />
Heim, Wünsche zur Wie<strong>der</strong>belebung, PEG-Versorgung <strong>und</strong> die dahinter<br />
stehenden persönlichen Werte. (Was führt Sie dazu?)<br />
• Gibt es Entwicklungen, wo <strong>der</strong> Hausarzt zu einer Einweisung raten<br />
würde? Wie steht <strong>der</strong> Betroffene dazu? Falls Einweisung notwendig<br />
werden sollte <strong>und</strong> auch gewünscht wird: Gibt es eventuell Wünsche<br />
zum Krankenhaus? Falls nicht das örtliche Krankenhaus gewählt wird,<br />
wird auf die eventuellen zusätzlichen Transferkosten hingewiesen.<br />
• Seelsorgerlicher Beistand <strong>und</strong> Begleitung durch den ehrenamtlichen<br />
Hospizdienst können erörtert werden.<br />
• Die momentane Medikation wird durchgegangen <strong>und</strong> die Indikation <strong>und</strong><br />
Dosierung von Notfall-Medikamenten besprochen. Der Arzt stellt die<br />
entsprechenden Rezepte aus.<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 172
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Auswertung (bezogen auf Ziele)<br />
• Wichtig: Es gilt auch Betroffene in den Blick zu nehmen, die am Gespräch<br />
nicht direkt beteiligt waren (z.B. an<strong>der</strong>e Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Familie). Von wem<br />
könnten eventuell Bedenken o<strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>stände kommen? Wie soll damit<br />
umgegangen werden?<br />
• Der Protokollführer fasst immer wie<strong>der</strong> laut die Ergebnisse zusammen <strong>und</strong><br />
vergewissert sich, ob die Bewohnerin diese richtig verstanden hat <strong>und</strong> die<br />
Ergebnisse so eintragen werden sollen.<br />
• Am Ende <strong>der</strong> Besprechung: Der Protokollführer liest die (wichtigsten)<br />
schriftlich fixierten Vereinbarungen noch einmal laut im Wortlaut vor.<br />
• Die angelegten Dokumente werden von allen entsprechend ihrer Funktion<br />
unterschrieben.<br />
• Mit dem Hausarzt wird abgesprochen: Wann <strong>und</strong> wo ist er erreichbar in<br />
Notfällen, beson<strong>der</strong>s an Wochenenden, Feiertagen, Nachtst<strong>und</strong>en, Urlaub.<br />
Wer ist <strong>der</strong> Vertretungsarzt? Ist er informiert? Wann ist dieser erreichbar?<br />
• Entsprechendes wird dokumentiert.<br />
• Der Notfallplan wird so hinterlegt, dass er zu je<strong>der</strong> Zeit schnell verfügbar ist<br />
� Stationsakte unter „Wichtige Unterlagen“<br />
• Der Hausarzt <strong>und</strong> die beteiligten Pflegekräfte besprechen unter Umständen<br />
mit den Angehörigen separat eventuelle Symptome, die sie beunruhigen<br />
könnten (z.B. Rasselatmung, Blutungen, Atemnot) <strong>und</strong> gehen ihr Verhalten<br />
in Notfällen durch. Es wird nachgefragt, was die Angehörigen beson<strong>der</strong>s<br />
belasten könnte.<br />
• Falls Krankenhauseinweisung notwendig werden sollte, sind folgende Dokumente<br />
als Kopien vorbereitet (sofern vorhanden): Pat.-Verfügung, Notfallplan<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 173
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Dokumentation<br />
Palliativer Notfallplan: Verfügungen / Ärztlicher Bericht<br />
An <strong>der</strong> Besprechung am………………. haben teilgenommen: ….……………………………………………………………………………………….<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
1. Personalien des Bewohners / <strong>der</strong> Bewohnerin<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................<br />
Name Geburtsdatum<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Anschrift<br />
Patientenverfügung � vorhanden, hinterlegt: ………………...……………………………………………………….. � nicht vorhanden<br />
2. Wichtige Adressen<br />
Hausarzt:<br />
Palliativberatung/Palliativarzt<br />
Ärztliche Vertretung<br />
Tel. Praxis<br />
Tel. Praxis<br />
Tel. Praxis<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 174<br />
Tel. außerhalb<br />
Tel. außerhalb<br />
Tel. außerhalb
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
3. Krankheitsgeschichte / Aktuelle Diagnosen<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 175
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
4. � Direkt erklärter Wille � mutmaßlicher Wille des / <strong>der</strong> Bewohner/s/in<br />
z.B. zu Krankenhauseinweisung, Reanimation, Sterben zu Hause, künstlicher Ernährung, persönliche Werte in <strong>der</strong> Situation<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………<br />
Beson<strong>der</strong>e Hinweise für die Einweisung in ein Krankenhaus:<br />
� Der Wunsch des / <strong>der</strong> Bewohner/s/in ist es, im Evangelischen Pflegezentrum Eichenau zu bleiben. Diagnostische Maßnahmen o<strong>der</strong> eine<br />
Einweisung in ein Krankenhaus sollen nur dann erfolgen, wenn sie einer besseren Beschwerdelin<strong>der</strong>ung dienen <strong>und</strong> im Heim nicht durchgeführt<br />
werden können.<br />
� Sollte aus guten Gründen eine Einweisung notwendig werden, möchte er / sie nach Möglichkeit auf <strong>kein</strong>en Fall in folgendes Krankenhaus<br />
überwiesen werden:<br />
� Bevorzugtes Krankenhaus:<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Name <strong>der</strong> gewünschten Einrichtung, Anschrift, Telefon<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………O<br />
rt, Datum Unterschrift BewohnerIn / PatientIn o<strong>der</strong> Bevollmächtigte / Betreuer<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 176
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
5. Notfallplan<br />
Muss vom behandelnden Arzt ausgefüllt werden!<br />
Beispiele für mögliche Komplikationen <strong>und</strong> beschwerliche Symptome: Schmerzen, Atemnot, aktute Blutungen, Darmverschluss, Schluckstörungen, Übelkeit/Erbrechen<br />
Mögliche Komplikationen<br />
Vom Patienten gewünschte Behandlung<br />
� geäußert � ermittelt<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 177<br />
Vom Arzt verordnete Maßnahmen
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Mögliche Komplikationen<br />
Vom Patienten gewünschte Behandlung<br />
� direkt geäußert � ermittelt<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 178<br />
Vom Arzt verordnete Maßnahmen<br />
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Ort, Datum Unterschrift Arzt / Ärztin<br />
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Ort, Datum Unterschrift BewohnerIn / PatientIn o<strong>der</strong> Bevollmächtigte / Betreuer
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer 179
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standards<br />
Symptome kontrollieren 1<br />
Typische Symptome <strong>und</strong> bewährte Lösungen<br />
Entwickelt von: Projektgruppe "Palliativversorgung im ambulanten Bereich", Stand: 28.06.2004<br />
Entwurf: Rita Bühlt, Beate Rehfeldt, Hilde Erd, Dr. Peter Lechner<br />
Redaktionelle Überarbeitung: Martin Alsheimer / Beate Augustyn<br />
Symptome (Übersicht)<br />
• Schluckstörungen<br />
• Akute Blutungen<br />
• Atemnot / Rasselatmung<br />
• Schmerzen<br />
• Darmverschluss<br />
• Krampfanfälle<br />
Ziele<br />
1. Lin<strong>der</strong>ung von Leiden: Auftretende Komplikationen sollen optimal gemin<strong>der</strong>t werden.<br />
2. Sicherheit <strong>der</strong> Beteiligten: Die MitarbeiterInnen <strong>und</strong> die betroffenen Angehörigen fühlen<br />
sich sicher im Umgang mit den erwartbaren Krisen. Sie können die geplanten einzelnen<br />
Maßnahmen nachvollziehen, sie persönlich mittragen <strong>und</strong> – soweit notwendig – praktisch<br />
ausführen.<br />
3. Keine ungewollte Einweisung: Die ungewollte Einweisung in ein Krankenhaus wird<br />
vermieden.<br />
4. Organisierter Rahmen: Die Erreichbarkeit notwendiger HelferInnen ist organisiert. Die<br />
notwendigen Hilfsmittel sind vorhanden <strong>und</strong> die benötigten Medikamente ausreichend<br />
bevorratet.<br />
Symptomkontrolle: Schluckstörungen<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein Ostallgäu<br />
e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer<br />
(GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
180
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Vorbereitung<br />
• Im Vorfeld abklären, ob <strong>der</strong> Kranke künstlich ernährt werden möchte o<strong>der</strong> nicht (������ndard<br />
Krisenvorsorge treffen)<br />
• Das Pro <strong>und</strong> Contra einer künstlichen Ernährung gemeinsam abwägen lassen (��� ��tscheidungshilfe<br />
Pro <strong>und</strong> Contra PEG-Versorgung.<br />
• Auf Alternativen zur PEG (z.B. Infusion) hinweisen<br />
• Aufklären des Patienten / Angehörigen bei Angst vor dem "Verhungern".<br />
• Regelmäßiges Beobachten o<strong>der</strong> Befragen des Betroffenen / <strong>der</strong> Angehörigen, in welchen<br />
Zusammenhängen die Schluckstörungen auftreten<br />
Symptome<br />
• Schmerzen beim Schlucken<br />
• Nahrung, Flüssigkeit, Speichel bleiben in M<strong>und</strong> <strong>und</strong> Rachenraum hängen<br />
• Patient verschluckt sich oft<br />
Völlegefühl<br />
Maßnahmen<br />
• Erhöhte Aufmerksamkeit bei M<strong>und</strong>pflege: Diese ist entscheidend für das Entstehen von<br />
Durstgefühl<br />
• Darreichungsform überprüfen <strong>und</strong> umstellen. Regel: Flüssiges geht besser als Festes,<br />
Dickflüssiges geht besser als Dünnflüssiges<br />
• Säfte andicken, Breie verdünnen<br />
• Gefrorenes zum Abschwellen geben<br />
• Strohhalm zum Trinken erleichtert den Schluckakt<br />
• Aufrecht im Sitzen essen lassen<br />
• Langsam mit kleinem Löffel essen<br />
• Anhalten, sorgfältig zu kauen<br />
Palliativarzt für die Beratung:<br />
Dr. Peter Lechner, Krankenhaus Füssen<br />
Tel. 08362 / 5000<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
181
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Symptomkontrolle: Akute Blutungen<br />
Vorbereitung<br />
• Im Vorfeld abklären, ob mit akuten Blutungen zu rechnen ist. (Kann auftreten z.B. bei<br />
Tumoren im HNO-Bereich, Bronchialkarzinomen, Gesichtstumore, bei Leberkarzinom,<br />
Darmdivertikel)<br />
• Aufklären des Patienten / Angehörigen bei Angst vor dem „Verbluten".<br />
Info: "Für einen Patienten, <strong>der</strong> sterben will, kann eine (erwartete) akute Blutung ein gnädiges Ende bedeuten."<br />
(Bausewein 2000, S. 294).<br />
• Dunkle Handtücher mil<strong>der</strong>n den dramatischen Eindruck, den starke Blutungen hervorrufen<br />
können<br />
• Kompressen bevorraten<br />
Lokalisation<br />
• Oberer <strong>und</strong> unterer Gastrointestinaltrakt<br />
• M<strong>und</strong>, Hals, Nase<br />
• Pulmonal<br />
• Urogenitaltrakt<br />
Maßnahmen<br />
• Eine Person muss bei dem Kranken bleiben<br />
• Angehörige evtl. aus dem Zimmer schicken<br />
• Vorbereitete dunkle o<strong>der</strong> bunte (nicht weiße) Handtücher zum Abdecken des Kranken<br />
nehmen, damit Blut nicht dramatisch sichtbar wird.<br />
• Eventuell Kompression durchführen, z.B. bei HNO-Tumor im Halsbereich Arterie abdrücken.<br />
• Seitenlagerung (wegen Erstickungsgefahr) durchführen, damit Atemwege frei bleiben.<br />
Medikamentöse Therapie<br />
• Medikamente, z.B. Tavor-Blättchen (angstlösend, beruhigend), Valium (beruhigend)<br />
• Arzt informieren<br />
• � Notfallplan beachten<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
182
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Symptomkontrolle: Akute Atemnot / Rasselatmung<br />
Vorbereitung<br />
• Im Vorfeld abklären, ob <strong>der</strong> Kranke beatmet werden soll o<strong>der</strong> nicht ����Standard Krisenvorsorge<br />
treffen.<br />
• Angehörige informieren über terminale Rasselatmung: diese ist ein Normalfall <strong>und</strong> für den<br />
Patienten <strong>kein</strong>e lebensbedrohliche Situation.<br />
Info: Inwieweit <strong>der</strong> Patient selbst durch die Rasselatmung beeinträchtigt wird <strong>und</strong> sie ihn belastet, ist ungeklärt.<br />
Prüfen, ob vorgesehene Medikamente bevorratet sind ��� Notfallplan<br />
Maßnahmen<br />
• Atmung ist häufig erschwert<br />
• Atmung ist unregelmäßig.<br />
• Atmung rasselt. Sie ist mit Bronchialsekret versetzt. Dies geschieht oft bei zu hoher Flüssigkeitszufuhr<br />
o<strong>der</strong> Wassereinlagerung.<br />
• Die Atmung wird schneller o<strong>der</strong> flacher werden.<br />
• Zeitweise entstehen Atempausen o<strong>der</strong> Schnappatmung.<br />
• Die Atmung kann auch langsamer <strong>und</strong> schwächer werden, so dass wir denken mit jedem<br />
Atemzug, es könnte <strong>der</strong> letzte sein (Lungenödem).<br />
Maßnahmen<br />
• Es braucht oft nicht abgesaugt zu werden, da <strong>der</strong> Schleim in <strong>der</strong> Regel tiefer in den Bronchien<br />
sitzt <strong>und</strong> man mit dem Absauggerät (Schlauch) nicht bis dahin kommt. Dieser könnte<br />
im ungünstigsten Fall Verletzungen an <strong>der</strong> Luftröhre verursachen. Überprüfen, ob das<br />
Absaugen eine Lin<strong>der</strong>ung bringt. Es gibt Situationen, in denen es notwendig ist.<br />
• Überprüfen, ob Infusion o<strong>der</strong> Wassereinlagerung Atmung belasten.<br />
• Oberkörper hoch lagern <strong>und</strong> bei starker Sekretbildung in eine Halbseitenlage bringen, um<br />
die Sekretion leichter abfließen zu lassen.<br />
• Frische Luft zuführen, beengende Kleidung öffnen.<br />
• Beruhigend auf den Patienten einwirken, z.B. mit ihm atmen <strong>und</strong> ihn so in einen ruhigeren<br />
Rhythmus führen.<br />
Medikamentöse Therapie<br />
• Medikamente, z.B. Buscopan senkt die Schleimproduktion.<br />
• Morphium (Schmerzbekämpfung) erleichtert das Gefühl von Atemnot). Tavor nimmt panikartige<br />
Atemnot-Attacken. (Kleine Blättchen lösen sich schnell auf <strong>der</strong> Zunge auf.)<br />
� Notfallplan beachten<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
183
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Symptomkontrolle: Akute Schmerzen<br />
Vorbereitung<br />
• Wichtig: ganzheitliche Schmerzbetrachtung. Schmerzen können viele Zusammenhänge<br />
haben. Gute Schmerztherapie setzt voraus, dass die möglichen Zusammenhänge von<br />
körperlichen, sozialen, seelischen <strong>und</strong> spirituellen Schmerzen beachtet werden.<br />
• Schmerzbeobachtung mit geeigneter Dokumentation, z.B. � Schmerzerfassung bei<br />
demenziell erkrankten Menschen – Beobachtungsbogen 1<br />
• Darauf achten, dass je<strong>der</strong> Patient eine geeignete Bedarfsmedikation verschrieben bekommt<br />
<strong>und</strong> diese auch ausreichend vor Ort bevorratet ist. (Siehe � Notfallplan – Medikation)<br />
Maßnahmen<br />
• Bei chronischen Schmerzen ist die kontinuierliche Gabe <strong>und</strong> Bedarfsmedikation wichtig.<br />
• Darauf achten, ob die Form <strong>der</strong> Medikamentengabe noch situationsgerecht ist (oral,<br />
Pflaster, Injektion, rectal, über PEG, Infusion) <strong>und</strong> den Arzt benachrichtigen, wenn Form<br />
nicht mehr passt o<strong>der</strong> möglich ist (z.B. Schluckstörungen).<br />
Bei Bedarf Palliativarzt anrufen: Dr. Lechner, Krankenhaus Füssen, Tel. 08362 / 5000<br />
1 Beobachtungsbogen abgedruckt in: Wilkening, K. / Kunz, R. 2003: Sterben im Pflegeheim. Perspektiven <strong>und</strong> Pra-<br />
xis einer neuen Abschiedskultur. Göttingen: Van<strong>der</strong>hoeck u. Ruprecht, S. 235 ff.)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
184
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Symptomkontrolle: Darmverschluss<br />
Maßnahmen bei Darmverschluss<br />
• Eine Person sollte dabei bleiben.<br />
• Vorbereitete bunte Tücher verwenden.<br />
• Zusammen mit Hausarzt Angehörige darauf vorbereiten <strong>und</strong> aufklären, dass in diesem<br />
Stadium eventuell Stuhlgang erbrochen werden kann <strong>und</strong> wie sie sich verhalten sollen.<br />
• Mit dem Hausarzt Medikamentengabe abklären, z.B. Paspertin supp., MCP gtt, Tavor expidet,<br />
Vomex supp.<br />
Maßnahmen bei Krampfanfällen<br />
• Eine Person sollte dabei bleiben.<br />
• Zahnprothesen entfernen (Verschluckungsgefahr).<br />
• Decken, Kissen vorbereiten.<br />
• Gegenstände in <strong>der</strong> Nähe des Kranken entfernen (Verletzungsgefahr).<br />
Mit dem Hausarzt Medikamentengabe abklären, z.B. Diazepam-Rektiole. (Im Kühlschrank<br />
aufbewahren!)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
185
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beratungshilfe<br />
Ehrenamt: Kooperation vorbereiten<br />
Leitfragen für die Klärung einer möglichen Zusammenarbeit<br />
Einleitung<br />
Sicher: Es gibt für die Kooperation von Heimen <strong>und</strong> Hospizvereinen viele Beispiele einer guten<br />
Praxis 1 . Die Bef<strong>und</strong>e zur generellen Bereitschaft für eine Zusammenarbeit sind allerdings<br />
zwiespältig. Auf <strong>der</strong> einen Seite befürworten Pflegekräfte den Ausbau von Hospizdiensten. Auf<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite stehen sie aber – trotz beklagten Zeitmangels – einem Einsatz ehrenamtlicher<br />
HospizhelferInnen mehrheitlich skeptisch bis ablehnend gegenüber. Sie befürchten Belastung<br />
statt Entlastung. Die Einschätzung erfolgt – so ein weiterer Bef<strong>und</strong> – mehrheitlich auf<br />
Verdacht ohne praktische Erfahrung.<br />
Umgekehrt zeigt sich aber auch die Hospizbewegung gegenüber den stationären Einrichtungen<br />
eher reserviert. Verbreitetes Ziel <strong>der</strong> Hospizarbeit ist das Sterben zuhause. Heime erscheinen<br />
dagegen eher als Sterbeorte 2. Klasse. Deshalb wurden Heime als mögliche Orte<br />
des hospizlichen Engagements wurden relativ spät „entdeckt“. Die Abwertung zeigt sich auch<br />
darin, dass <strong>der</strong> Einsatz von freiwilligen HelferInnen in Heimen aus <strong>der</strong> finanziellen För<strong>der</strong>ung<br />
fällt.<br />
Die Checklisten dienen dazu, die Chancen <strong>und</strong> Möglichkeiten einer Kooperation auszuloten.<br />
Sie sind zunächst als heim- <strong>und</strong> vereinsinterne Klärungshilfen gedacht. Aber sie können auch<br />
als Besprechungshilfe für Kooperationsverhandlungen dienen.<br />
1 Beispiele: Müller M.; Kessler, G. (2000): Implementierung <strong>der</strong> Hospizidee in die Struktur <strong>und</strong> Arbeitsabläufe eines Altenheims.<br />
Eine Orientierungs- <strong>und</strong> Planungshilfe. Bonn: ALPHA Rheinland, beson<strong>der</strong>s 108-132<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
186
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ziele<br />
• Geklärte Erwartungen: Die Verantwortlichen bei<strong>der</strong> Seiten wissen um die wechselseitigen<br />
Wünsche <strong>und</strong> Möglichkeiten. Die Betroffenen sind einbezogen.<br />
• Verankerung <strong>der</strong> Kooperation im Heim <strong>und</strong> Hospizverein: Die organisatorische Integration<br />
ist auf beiden Seiten detailliert besprochen <strong>und</strong> in den Konsequenzen durchdacht.<br />
• Entdeckung weiterer Vernetzung: Die jeweiligen Möglichkeiten „vertrauensbilden<strong>der</strong>“<br />
Vernetzungen werden erkannt <strong>und</strong> genutzt.<br />
Fragen an das Heim<br />
Blickpunkt: Bereitschaft zur Kooperation<br />
• Wie sieht die gr<strong>und</strong>sätzliche Bereitschaft <strong>der</strong> MitarbeiterInnen aus, mit ehrenamtlichen<br />
Kräften zusammenzuarbeiten? Wie wurde diese Bereitschaft ermittelt?<br />
• Von wem ist <strong>der</strong> Wunsch nach Zusammenarbeit ausgegangen?<br />
• Wird <strong>der</strong> Einsatz von HospizhelferInnen gr<strong>und</strong>sätzlich auch von <strong>der</strong> Vertretung <strong>der</strong> BewohnerInnen<br />
(Heimbeirat) gewünscht?<br />
• Welche Erfahrungen gab es bei <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen (z. B. Besuchsdiensten)<br />
bereits in <strong>der</strong> Vergangenheit? Wo haben MitarbeiterInnen aufgr<strong>und</strong> bisheriger<br />
Erfahrungen Vorbehalte gegenüber ehrenamtlichen Kräften?<br />
• Sind Konkurrenzgefühle (z. B. bezogen auf Anerkennung bei BewohnerInnen) spürbar?<br />
Blickpunkt: Erwartungen <strong>und</strong> Aufgaben<br />
• Was verbinden MitarbeiterInnen mit „Hospizarbeit“?<br />
• Welche Aufgaben sehen MitarbeiterInnen / Leitung für ehrenamtliche Kräfte (Tätigkeitsprofil?)<br />
• Wo sehen die MitarbeiterInnen / die Leitung einen Bedarf für den Einsatz von ehrenamtlichen<br />
HospizhelferInnen? Wo würden sich die MitarbeiterInnen durch ehrenamtliche HospizhelferInnen<br />
entlastet fühlen?<br />
• In welchem Umfang würden sich MitarbeiterInnen ehrenamtliche Einsätze wünschen?<br />
• Zu welchen Zeiten würden MitarbeiterInnen beson<strong>der</strong>s Entlastung brauchen? (Beispiel:<br />
Nachtwachen?)<br />
• Was würden die MitarbeiterInnen als „Kompetenzen-Überschreitung“ o<strong>der</strong> als „Einmischung<br />
empfinden“?<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
187
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: organisatorische Einbindung<br />
• Welche Modelle <strong>der</strong> Kooperation scheinen für das Haus sinnvoll? Modell 1: Begrenzte<br />
Einsätze von HospizhelferInnen bei einzelner Personen (= „Klassische Begleitung einzelner<br />
Menschen) – Modell 2: feste, dauerhafte Zuordnung von HospizhelferInnen zu einzelnen<br />
Etagen / Stationen im Heim (= kontinuierlicher Besuchsdienst, aus dem sich Sterbebegleitungen<br />
entwickeln können) Kürzere „Notfall-Dienst“? Krisenintervention für Angehörige?<br />
• Wer könnte verantwortlicher KoordinatorIn / AnsprechpartnerIn für die HospizhelferInnen<br />
im Haus sein (Hospizbeauftragte/r)?<br />
• Was wären die genauen Aufgaben <strong>der</strong> Hospizbeauftragten? Bekommt die Hospizbeauftragte<br />
ausreichend Anerkennung, Rückendeckung <strong>und</strong> evtl. auch zeitliche Freistellungen<br />
für die Aufgaben (z.B. Gespräche mit HospizhelferInnen)? Sind hierzu verbindliche schriftliche<br />
Regelungen getroffen?<br />
• Wie sollen BewohnerInnen auf die HospizhelferInnen hingewiesen werden? Wie werden<br />
die Aufgaben beschrieben?<br />
• Wie stark möchte die Einrichtung bei <strong>der</strong> Auswahl von ehrenamtlichen Kräften mitentscheiden?<br />
Was erwartet das Heim von ehrenamtlichen Kräften an persönlichen, sozialen,<br />
praktischen Fähigkeiten? Welche Auswahlkriterien hat <strong>der</strong> Hospizverein?<br />
• Wer darf HospizhelferInnen „anfor<strong>der</strong>n“? Wie wird die Unterstützung angefor<strong>der</strong>t?<br />
• Wie werden die HospizhelferInnen eingeb<strong>und</strong>en in das Haus / das Team? Wer leitet vor<br />
Ort an? Wo haben die HospizhelferInnen ihren Platz für Rückzug <strong>und</strong> Gespräch? Wie soll<br />
in <strong>der</strong> Regel ein Besuch ablaufen (Beispiele: Anmeldung? Vorinformation zu Beginn einholen?<br />
Abmeldung am Ende?) Wie <strong>und</strong> von wem werden HospizhelferInnen bei Verän<strong>der</strong>ungen<br />
informiert? Wie werden eventuelle pflegerelevante Beobachtungen <strong>der</strong> HospizhelferInnen<br />
eingeholt, genutzt <strong>und</strong> dokumentiert? (Beispiele: punktuelle Teilnahme an Übergaben,<br />
Teamsitzungen, Teilnahme an Aufnahmegesprächen mit Angehörigen in akuten Notfällen?)<br />
Was unterliegt <strong>der</strong> Schweigepflicht?<br />
• Wie wird bei Konflikten verfahren? Wer ist AnsprechpartnerIn beim Hospizverein?<br />
• Wie werden die Einsätze <strong>und</strong> die Zusammenarbeit evaluiert? (Beispiel: regelmäßige Treffen<br />
von Hospizbeauftragten / Verantwortliche des Hospizvereins)<br />
• Welche Formen <strong>der</strong> Anerkennung <strong>und</strong> Wertschätzung bietet die Einrichtungen? (Beispiele:<br />
kostenlos Kaffee / Tee, Einladungen zu Feiern <strong>und</strong> Ausflügen des Hauses, Geburtstagskarte,<br />
Präsent am Jahresende usw.)<br />
• Wie wird die Unterstützung des Hospizvereines honoriert (z. B. Spende am Jahresende)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
188
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Blickpunkt: weitere organisatorische Vernetzung Heim-Hospizverein<br />
• Wo sieht das Heim neben dem praktischen Einsatz von HospizhelferInnen weitere Möglichkeiten<br />
für eine Zusammenarbeit? (Beispiele: Gegenseitige Nutzung von Fortbildungsveranstaltungen?<br />
Anbieten von Praktikaplätzen für HospizhelferInnen in Vorbereitungskursen?<br />
Referenten-Tätigkeit von MitarbeiterInnen des Heimes im Rahmen <strong>der</strong> HospizhelferInnen-Ausbildung)<br />
Was wäred durch die Verwaltung abgeklärt, ob bereits Patientenverfügung<br />
<strong>und</strong> Vorsorgevollmachten <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> Betreuungsverfügung vorliegen, wer davon<br />
weiß <strong>und</strong> wo diese hinterlegt sind. Ein Duplikat kommt zu den Unterlagen auf Station, damit<br />
diese schnell verfügbar ist (z. B. an Wochenenden).<br />
Fragen an den Hospizverein<br />
Blickpunkt: Bereitschaft zur Kooperation<br />
• Wie sieht die gr<strong>und</strong>sätzliche Bereitschaft des Vereins aus, auch Kräfte im Heim einzusetzen?<br />
• Über welche personellen Möglichkeiten verfügt <strong>der</strong> Hospizverein? Wie viele Helferinnen<br />
wären bereit, Menschen im Heim zu begleiten? (Ausschließlich? Gelegentlich? Nachtwachen?<br />
Schnelle “Krisenkräfte“?)<br />
• Gibt es bereits Erfahrungen <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Einrichtungen?<br />
• Welche Vorbehalte gibt es auf Seiten des Hospizvereins? (Beispiele: Sorge, nur „billige<br />
Arbeitskräfte“ zu liefern? Vorbehalte gegenüber Pflege im Heim?)<br />
• Welche Indikationen hat <strong>der</strong> Hospizverein für die Betreuung? Ab wann beginnt für den<br />
Hospizverein „Sterbebegleitung“? Gibt es Beschränkungen auf bestimmte Krankheitsbil<strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> auf Menschen mit deutlich beschränkter Lebenszeit?<br />
Blickpunkt: Erwartungen <strong>und</strong> Aufgaben<br />
• Für welche Aufgaben sind die Hospizhelferinnen vorbereitet?<br />
• Werden auch Menschen mit demenziellen Verän<strong>der</strong>ungen begleitet? Sind die Hospizhelferinnen<br />
darauf vorbereitet? (Die Begleitung demenziell erkrankter Menschen benötigt eine<br />
beson<strong>der</strong>e Gr<strong>und</strong>haltung <strong>und</strong> spezielle Verhaltensweisen, z. B. Validation. Erwartungen<br />
des persönlichen Erkennens, Entwickeln einer persönlichen Beziehung, wechselseitigem<br />
Interesse <strong>und</strong> „intensiven“ Gesprächen wird in <strong>der</strong> Regel enttäuscht.)<br />
• Würde <strong>der</strong> Verein auch eine Trauerbegleitung für einzelne Angehörige übernehmen (in <strong>der</strong><br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
189
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Sterbephase einer Bewohnerin, nach dem Tod einer Bewohnerin)?<br />
• Zu welchen Zeiten würden Hospizhelferinnen beson<strong>der</strong>s gut verfügbar sein?<br />
• Welche Aufgaben würden Hospizhelferinnen nicht übernehmen?<br />
• Was würden die Hospizhelferinnen als „Zumutung“o<strong>der</strong> „Einmischung“ empfinden?<br />
Blickpunkt: organisatorische Einbindung<br />
• Welche Modelle <strong>der</strong> Kooperation würde <strong>der</strong> Hospizverein bevorzugen? Modell 1: Begrenzte<br />
Einsätze von HospizhelferInnen bei einzelner Personen (= „Klassische Begleitung einzelner<br />
Menschen) – Modell 2: feste, dauerhafte Zuordnung von HospizhelferInnen zu einzelnen<br />
Etagen / Stationen im Heim (= kontinuierlicher Besuchsdienst, aus dem sich Sterbebegleitungen<br />
entwickeln können)<br />
• Wer könnte verantwortlicher Koordinatorin / Ansprechpartnerin im Hospizverein sein für<br />
Fragen <strong>und</strong> Konflikte im Heim?<br />
• Wie verläuft im Heim <strong>der</strong> übliche Weg <strong>der</strong> Anfrage <strong>und</strong> Vermittlung? Ist dieser Weg<br />
schnell, übersichtlich <strong>und</strong> effektiv genug für die Bedürfnisse <strong>der</strong> Einrichtung?<br />
• Wie wünschen sich die Hospizhelferinnen die Einbindung ins Team?<br />
• Wie soll im heim auf das Angebot des Hospizvereins hingewiesen werden? Welche Bezeichnungen<br />
<strong>und</strong> Basis-Informationen sind dem Verein wichtig?<br />
• Welche Erwartungen hat <strong>der</strong> Verein hinsichtlich Anleitung <strong>und</strong> Betreuung <strong>der</strong> Helferinnen<br />
durch das Haus?<br />
Blickpunkt: weitere organisatorische Vernetzung Heim-Hospizverein<br />
• Welche Angebote des Hospizvereins können auch von Mitarbeiterinnen des Heimes genutzt<br />
werden? Wie werden diese Angebote vermittelt?<br />
• Welche Bereitschaft <strong>und</strong> Möglichkeiten gibt es im Hospizverein, sich über die Begleitung<br />
im Heim zu engagieren? (Beispiele: Gestalten von Gedenkfeiern? Teilnahme an Qualitätszirkeln<br />
zurm Thema Sterbebegleitung)<br />
• Können Pflegekräfte auch im Rahmen <strong>der</strong> Vorbereitungskurse geschult werden, um z. B.<br />
Koordinationsaufgaben im Heim für Hospizhelferinnen zu übernehmen?<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
190
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Literatur: Ehrenamtliche<br />
MERSCH R.: Das Spannungsfeld zwischen professionell Handelnden <strong>und</strong> ehrenamtlich Engagierten. Grin Verlag<br />
2005 (Online-Archiv www.grin.com, Dokument Nr. 40933)<br />
OLK T., JAKOB G.: Professionelles Handeln <strong>und</strong> ehrenamtliches Engagement – ein „neuer“ Blick auf ein „altes“<br />
Problem. Sozialmagazin (3) 1995<br />
STUDENT J.-C., MÜHLUM A., STUDENT U.: Soziale Arbeit in Hospiz <strong>und</strong> Palliative Care. Reinhardt Verlag, <strong>München</strong><br />
2004 (bes. 41-43, 61-66)<br />
WESSELS C.: Freiwilliges soziales Engagement <strong>und</strong> professionelle soziale Dienstleistungen: zwischen Konkurrenz<br />
WILKENING K., KUNZ R.: Sterben im Pflegeheim. Perspektiven <strong>und</strong> Praxis einer neuen Abschiedskultur. BAY R.<br />
H.: Erfolgreiche Gespräche durch aktives Zuhören. 5. Auflage, Expert Verlag, Renningen 2006<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
191
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gesprächshilfe<br />
Ehrenamtliche: Konflikte vorbeugen<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Entschärfung<br />
Einführung<br />
Es gibt für die gute Zusammenarbeit von Einrichtungen <strong>und</strong> Ehrenamtlichen viele Beispiele (z.<br />
B. MÜLLER, KESSLER 2000: 108-132, WILKENING, KUNZ 2003, ORTH, ALSHEIMER<br />
2005). Aber insgesamt ist die institutionelle Einbeziehung ehrenamtlicher Hospizarbeit wohl<br />
eher selten, wie die groß angelegte empirische Studie von Kaluza <strong>und</strong> Töpferwein zur Sterbebegleitung<br />
zumindest für das B<strong>und</strong>esland Sachsen konstatiert. Der Bef<strong>und</strong> zur Kooperationsbereitschaft<br />
von Pflegekräften ist zwiespältig, ja paradox: Auf <strong>der</strong> einen Seite befürworten<br />
Pflegekräfte mit großer Mehrheit den Ausbau von Hospizdiensten <strong>und</strong> eine stärkere Zusammenarbeit.<br />
Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite stehen eine nicht zu unterschätzende Gruppe aber – trotz<br />
beklagtem Zeitmangel – einem Einsatz ehrenamtlicher Hospizhelfer skeptisch bis ablehnend<br />
gegenüber. Tenor: „Ich halte die Arbeit von Hospizhelfern (…) nicht für notwendig, denn die<br />
Begleitung Sterben<strong>der</strong> bewältigen wir genauso gut.“ 41% <strong>der</strong> Pflegekräfte in Pflegeheimen<br />
stimmen dieser Aussage zu, 28% sind es im Krankenhaus, 25% im ambulanten Bereich.<br />
(KALUZA, TÖPFERWEIN 2005: 97 ff., 178 ff., 344 ff.) Das Urteil basiert – so ein weiterer Bef<strong>und</strong><br />
– mehrheitlich auf Verdacht ohne die Erfahrung einer praktischen Zusammenarbeit. Die<br />
Forscher resümieren: „Noch bestehende Unsicherheiten <strong>und</strong> Vorbehalte müssen mit Aufklärung<br />
<strong>und</strong> Transparenz offensiv begegnet werden.“ (KALUZA, TÖPFERWEIN 2005: 350). In<br />
einer nicht repräsentativen Befragung des Vincentz-Verlages befürchtet eine knappe Mehrheit<br />
<strong>der</strong> Pflegekräfte eher eine Belastung statt Entlastung durch Hospizhelfer.<br />
Aussagen zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern<br />
„Zum Hospiz-Verein gibt es Kontakte, Frau R. hält Vorträge zur Sterbebegleitung, die macht das auch sehr schön,<br />
sehr anschaulich, das geht wirklich unter die Haut … Das ist eben, muss ich sagen, das ist Theorie <strong>und</strong> das an<strong>der</strong>e<br />
ist die Praxis. In <strong>der</strong> Praxis gibt es <strong>kein</strong>e Helfer, die Sterbebegleitung machen, das habe ich noch nirgends erlebt.<br />
Ich arbeite seit 10 Jahren als Stationsschwester <strong>und</strong> habe in <strong>der</strong> Zeit noch nicht einmal eine Sterbebegleitung von<br />
einem Fremden erlebt. Bis zu einem gewissen Grad wäre die Zusammenarbeit mit einem Hospiz für das Heim von<br />
Vorteil. Aber, `ne Sterbebe-gleitung, denke ich mal, kann am besten <strong>der</strong>jenige machen, <strong>der</strong> den Menschen schon<br />
vornweg betreut hat. Da ist ein Vertrauensverhältnis da. Jemanden kommen zu lassen, ist vielleicht nur in den wenigsten<br />
Fällen hilfreich, man weiß nicht, wie viel <strong>der</strong> Bewohner noch mitbekommt.“ (Krankenschwester, Wohnbereichsleiterin,<br />
52 Jahre)<br />
„Die kommen einmal in <strong>der</strong> Woche für eine halbe St<strong>und</strong>e, das bringt nichts, man bräuchte im Gr<strong>und</strong>e fast r<strong>und</strong> um<br />
die Uhr jemanden.“(Altenpflegerin, Wohnbereichsleiterin, 58 Jahre)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
192
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Mögliche Reibungspunkte <strong>und</strong> Fragen<br />
aus <strong>der</strong> Sicht von Pflegekräften<br />
Konkurrenzgefühl: Die Ehrenamtlichen<br />
nehmen mir einen Teil meiner Anerkennung.<br />
Ich mache die „Schmutzarbeit“, sie<br />
ernten den „Lohn“. Das was Ehrenamtliche<br />
tun, könnte ich auch, wenn ich nur die Zeit<br />
dafür bekäme.<br />
Unsicherheitsgefühl: Was können <strong>und</strong><br />
dürfen ehrenamtliche Hospizhelfer eigentlich?<br />
Einmischung in pflegerische Entscheidungen:<br />
Ehrenamtliche Hospizhelfer kennen<br />
pflegerische Arbeitsweisen (z. B. aktivierende<br />
Pflege) o<strong>der</strong> meine momentanen<br />
Belastungen nicht <strong>und</strong> verunsichern eventuell<br />
Betroffene <strong>und</strong> Angehörige mit ihren<br />
Kommentaren.<br />
Kontrollgefühl: Ehrenamtliche Helfer beobachten<br />
mein Handeln <strong>und</strong> geben Beobachtungen<br />
unkontrollierbar weiter.<br />
Verordnete Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit<br />
ist ein Wunsch <strong>der</strong> Leitung.<br />
Ich empfinde es als „von oben“ verordnet.<br />
Fremdheitsgefühl: Ich kenne die ständig<br />
wechselnden ehrenamtlichen Kräfte nicht.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Organisatorische Ideen<br />
Gemeinsame Ziel- <strong>und</strong> Aufgabenklärung:<br />
Nicht nur die Aufmerksamkeit auf den<br />
Schwerkranken <strong>und</strong> seine Familie richten,<br />
son<strong>der</strong>n auch besprechen, was Pflegekräfte<br />
entlasten würde <strong>und</strong> was davon ehrenamtlich<br />
geleistet werden kann. Die Vorteile einer<br />
Kooperation werden in vorbereitenden Gesprächen<br />
herausgearbeitet. Ein Aufgabenprofil<br />
wird festgelegt <strong>und</strong> veröffentlicht.<br />
Regelmäßige kurze Vor- <strong>und</strong> Nachbesprechung<br />
von Einsätzen: Das ermöglicht<br />
Beobachtungen anzusprechen <strong>und</strong> irritierende<br />
Verhaltsweisen aufzuklären. Der Ansprechpartner<br />
im Pflegeteam wird benannt<br />
<strong>und</strong> auch die Art <strong>der</strong> Dokumentation <strong>der</strong> ehrenamtlichen<br />
Beobachtungen <strong>und</strong> Leistungen<br />
wird geklärt.<br />
Konfliktmanagement: Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt<br />
Schweigepflicht nach außen <strong>und</strong> eine kollegiale<br />
Loyalität. Verein <strong>und</strong> Einrichtung vereinbaren,<br />
wer bei nicht direkt lösbaren Konflikten<br />
für Vermittlung <strong>und</strong> Entscheidungen<br />
zuständig ist (Koordinationskräfte im<br />
Heim/Hospizverein) <strong>und</strong> wie im einzelnen<br />
bei Kritik verfahren werden soll.<br />
Abklären <strong>der</strong> Bereitschaft: Das Pflegeteam<br />
wird in die Entscheidung einbezogen (z. B.<br />
Kooperation auf Probe).<br />
Mitspracherecht des Pflegeteams bei Auswahl<br />
fester ehrenamtlicher Mitarbeiter.<br />
Fester Stamm: Ehrenamtliche Hospizhelfer<br />
sind einer bestimmten Einrichtung zugeordnet<br />
<strong>und</strong> kommen mit einem bestimmten<br />
193
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Vermittlungsproblem: Wie biete ich Betroffenen<br />
o<strong>der</strong> den verantwortlichen Angehörigen<br />
ehrenamtliche Hospizhilfe an, ohne<br />
dass ich mit dem Wort „Sterbegleiter“ Ängste<br />
o<strong>der</strong> Abwehr auslöse?<br />
Unterlegenheitsgefühl: Der ehrenamtliche<br />
Hospizhelfer gibt sich als „Experte“ aus, <strong>der</strong><br />
eine umfangreichere Vorbereitung auf die<br />
Aufgabe Sterbebegleitung genossen hat als<br />
ich. In meiner breiten pflegerischen Ausbildung<br />
ist das Thema Sterbebegleitung nicht<br />
o<strong>der</strong> nur am Rande behandelt worden.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Zeitkontingent regelmäßig (als Besuchsdienst)<br />
auf Station.<br />
Integration in die Teamkommunikation<br />
Ehrenamtliche werden punktuell zu Teamsitzungen<br />
eingeladen <strong>und</strong> sind auch symbolisch<br />
Teil des Teams (z. B. Fotos auf <strong>der</strong><br />
Mitarbeitertafel <strong>der</strong> Station)<br />
Frühzeitiges Angebot: Die Möglichkeit von<br />
Sitzwachen <strong>und</strong> ehrenamtlichen Hospizdiensten<br />
wird in <strong>der</strong> Einrichtung den Patienten/Bewohnern<br />
frühzeitig bekannt gemacht.<br />
Die Einstellung <strong>der</strong> Betroffenen dazu wird im<br />
Gespräch ermittelt.<br />
Informeller Kontakt: Ehrenamtliche Hospizhelfer<br />
kommen über Alltagsdienste in<br />
persönlichen Kontakt mit Betroffenen (z. B.<br />
Kaffee/Tee bringen).<br />
Sprachregelung: Ehrenamtliche Hospizhelfer<br />
werden als Besuchsdienst für schwer erkrankte<br />
Menschen tituliert <strong>und</strong> eingeführt.<br />
Infomaterial: Die Pflegekräfte haben einen<br />
schnellen Zugriff auf Infomaterial des Vereins,<br />
das die Aufgaben <strong>der</strong> Hospizhelfer gut<br />
beschreibt.<br />
Transparenz <strong>der</strong> Kompetenzen: Die Pflegekräfte<br />
kennen Umfang <strong>und</strong> Schwerpunkte<br />
<strong>der</strong> Vorbereitung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Kräfte.<br />
Die eigenen Kompetenzen werden profiliert<br />
(Siehe Aufgabenschwerpunkte oben)!<br />
Gemeinsame Fortbildungen: Pflegekräfte<br />
werden vom Verein auch zu Hospizfortbildungen<br />
eingeladen. Umgekehrt können ehrenamtliche<br />
Hospizhelfer interne Fortbildungen<br />
<strong>der</strong> Einrichtung nutzen. Evtl. gibt es<br />
auch gemeinsame Supervision o<strong>der</strong> kollegiale<br />
Praxisberatung im Team.<br />
194
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Thesen<br />
Leitlinien für den Hospizeinsatz<br />
im Heim<br />
Konzept Hospizverein Ingolstadt (Juli 2005)<br />
Der Einsatz von HH im Heim unterscheidet sich von <strong>der</strong> Begleitung im ambulanten Bereich. In<br />
<strong>der</strong> Regel setzt im Heim eine Begleitung nicht erst bei einem Krankheitsbild mit klarer Hospizindikation<br />
<strong>und</strong> fortgeschrittene Verlauf ein. Der Einsatz konzentriert sich auch nicht unbedingt<br />
nur auf eine Person. Die Aufgaben sind somit offener <strong>und</strong> unbestimmter, <strong>der</strong> Übergang zu einem<br />
Besuchsdienst ist fließend; es braucht deshalb einen guten Rahmen <strong>und</strong> klare Verantwortlichkeiten,<br />
um den jeweiligen Einsatz auszuhandeln.<br />
Wir möchten von <strong>der</strong> Einrichtung ein klares Bekenntnis zur Kooperation. Die wechselseitigen<br />
Verpflichtungen <strong>und</strong> die gemeinsam entwickelten Regelungen sind Inhalt einer vertraglichen<br />
Vereinbarung. Wir möchten neben <strong>der</strong> Bereitschaft <strong>der</strong> Leitung auch einen eindeutigen Beschluss<br />
(Abstimmung) des Pflegeteams, dass sie den Einsatz des jeweiligen HH in ihrem Bereich<br />
/ ihrer Station befürworten.<br />
Unsere Angebote <strong>und</strong> Wünsche an das Heim als Partner<br />
• Wir möchten als Verein eine feste Ansprechpartnerin im Heim („Hospizbeauftragte / Stellvertreterin“).<br />
Der Hospizverein benennt umgekehrt eine feste Ansprechpartnerin (Koordinationskraft).<br />
Beide entscheiden über Konflikte, die sich nicht direkt lösen lassen.<br />
• Die Hospizbeauftragte des Heimes <strong>und</strong> die Koordinationskraft des Vereines vereinbaren<br />
eine regelmäßige Besprechung <strong>und</strong> Bewertung <strong>der</strong> Zusammenarbeit.<br />
• Die HH müssen persönlich im Team eingeführt <strong>und</strong> vorgestellt werden, so dass sie <strong>und</strong> ihre<br />
Aufgaben allen Kolleginnen bekannt sind.<br />
• Heim <strong>und</strong> Hospizverein legen vorab fest, welche Aufgaben HH im Haus gr<strong>und</strong>sätzlich übernommen<br />
werden könnten.<br />
• Die Art, Ort <strong>und</strong> Umfang <strong>der</strong> Dokumentation <strong>der</strong> HH zu ihren Einsätzen werden abgesprochen.<br />
• Die Stationsleitung bespricht mit <strong>der</strong> jeweiligen HH gr<strong>und</strong>sätzlich, wo sich die HH während<br />
ihres Einsatzes aufhalten kann, wo Platz für Tasche <strong>und</strong> Mantel ist (Spind) <strong>und</strong> welchen<br />
Zugang sie zum Stationszimmer hat.<br />
• Die freiwilligen HospizhelferInnen (HH) können in <strong>der</strong> Regel <strong>kein</strong>e bestimmten Zeiten versprechen,<br />
son<strong>der</strong>n nur einen ungefähren Umfang <strong>und</strong> prinzipiell mögliche Zeiten. Hospiz-<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
195
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
verein <strong>und</strong> Heim klären wir vorab, welche Zeiten für das Haus entlastend wären. Der HH<br />
regelt selbst in persönlicher Absprache mit <strong>der</strong> Stationsleitung die Zeiten des jeweiligen<br />
Einsatzes (z.B. Verfügbarkeit in <strong>der</strong> kommenden Woche). Die Zeiten <strong>der</strong> Anwesenheit<br />
werden für das Team sichtbar ausgehängt <strong>und</strong> in Übergaben darauf hingewiesen.<br />
• Die HH informieren die Hospizbeauftragte, wenn sie über eine längere Zeit abwesend sind<br />
(z. B. Urlaub).<br />
• Die HH meldet sich zu Beginn <strong>und</strong> am Ende des Einsatzes bei <strong>der</strong> jeweiligen Schichtleitung,<br />
um sich über Beson<strong>der</strong>heiten des Tages zu informieren <strong>und</strong> umgekehrt abschließend<br />
Rückmeldung zu geben.<br />
• Die HH klärt gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>und</strong> situativ ab, ob sie neben dem direkten Einsatz auch an<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben im Umfeld übernehmen kann <strong>und</strong> mag. Beispiele: Besuche bei Verlegung ins<br />
Krankenhaus, Gespräche für Angehörige in Sterbephase <strong>und</strong> unmittelbar nach Tod <strong>der</strong><br />
Bewohnerin, Unterstützung <strong>der</strong> Pflegekräfte bei Aufbahrung, Mitwirkung bei Erinnerungsfeiern<br />
• Die HH klärt mit <strong>der</strong> Schichtleitung jeweils ab, für welche Unterstützung <strong>der</strong> jeweils betreuten<br />
Person sie professionelle Hilfe holen soll <strong>und</strong> was sie selbst übernehmendarf (z. B. Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Heimbewohnerin beim Gang zur Toilette)<br />
• Die Hospizbeauftragte / Schichtleitung informiert die HH, wenn Bewohnerinnen ins Krankenhaus<br />
verlegt werden o<strong>der</strong> sich im Sterben befinden.<br />
• Die HH kann nach Absprache an Teamsitzungen teilnehmen, z.B. Fallbesprechungen,<br />
Übergaben. Es gilt natürlich für alle Informationen Schweigepflicht nach außen.<br />
• Die HH ist auch symbolisch präsent auf <strong>der</strong> Station, z.B. auf Foto- <strong>und</strong> Infotafeln mit Namen<br />
des Pflegeteams.<br />
• Wir möchten, dass die Einrichtung das Engagement des Vereins am Jahresende mit einer<br />
Spende würdigt.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
196
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Konzept / Standard<br />
Sitzwachengruppe im Heim koordinieren 1<br />
Projekt St. Augustin, Neuburg a. d. D.<br />
Einleitung<br />
Ehrenamtliche haben innerhalb des Teams „vor allem die Aufgabe von ‚Fachleuten fürs Alltägliche’“<br />
2 Sie verkörpern jene unbezahlte <strong>und</strong> unbezahlbare menschliche Solidarität. Diese wird<br />
getragen von <strong>der</strong> Einsicht, dass <strong>der</strong> Sterbende dem eigenen Schicksal nur ein Stück Weg<br />
voraus ist. Das Geben <strong>und</strong> Nehmen ist dabei nicht einseitig, son<strong>der</strong>n immer wechselseitig: als<br />
Ehrenamtlicher gebe ich ein wenig meiner (Lebens-)Zeit <strong>und</strong> ernte dafür möglicherweise eine<br />
tiefe (Lebens-)Erfahrung. Damit dieses gelingt, braucht es Achtsamkeit im Kontakt <strong>und</strong> Zurückhaltung,<br />
eigene Vorstellungen dem „fremden Sterben“ aufzudrücken.<br />
Menschen in dieser hochsensiblen <strong>und</strong> sehr verletzbaren Zeit zu begleiten, braucht Vertrauen.<br />
Wir setzen deshalb in unserem Haus auf vertraute Personen: Kollegen aus Pflege, Hauswirtschaft<br />
<strong>und</strong> Verwaltung, die außerhalb ihres Dienstes Zeit schenken, <strong>und</strong> ehrenamtliche Kräfte<br />
des Besuchsdienstes, aus den Reihen <strong>der</strong> rüstigen Bewohner <strong>und</strong> vom Hospizverein Neuburg<br />
e.V.. Der Vorteil dieses Modells: Alle Beteiligten kennen sich untereinan<strong>der</strong>. Auch die Bewohner<br />
kennen die eingesetzten Helfer. Der Kontakt ist somit nicht künstlich, son<strong>der</strong>n Beziehungen<br />
sind bereits gewachsen.<br />
Ziele<br />
• Gewollter Einsatz: Die schwerkranken <strong>und</strong> sterbenden Menschen reagieren erkennbar<br />
beruhigt bzw. haben bereits im Vorfeld einer Sitzwache zugestimmt.<br />
• Wechselseitige Unterstützung: Die Pflegekräfte fühlen sich unterstützt <strong>und</strong> können sich<br />
1<br />
Konzept entwickelt im Projekt „Im Leben <strong>und</strong> im Sterben ein Zuhause geben“ – Altenheim St. Augustin Neuburg a.d.D. (2005)<br />
2<br />
Student, J.-Ch. (1999): Die Rolle <strong>der</strong> Freiwilligen Helferinnen <strong>und</strong> Helfer. In: Ders. (1999) (Hg.): Das Hospiz-Buch. 4. erw. Aufl.,<br />
Freiburg im Br.: Lambertus, S. 151<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
197
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
auf pflegerische Aufgaben konzentrieren.<br />
• Ergänzung <strong>der</strong> Sterbebegleitung <strong>der</strong> Angehörige: Die Angehörigen fühlen sich durch<br />
die Sitzwachengruppe unterstützt, nicht verdrängt <strong>und</strong> haben <strong>der</strong> Anwesenheit gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
<strong>und</strong> situativ zugestimmt.<br />
• Gut vorbereitete <strong>und</strong> begleitete Einsätze: Die ehrenamtlichen Helfer sehen sich als anerkannte<br />
Partner im Heim <strong>und</strong> erfahren ausreichende Vorbereitung <strong>und</strong> Begleitung.<br />
Konzept<br />
• Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sitzwache: Mitarbeiter aus <strong>der</strong> Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung, ehrenamtliche<br />
Kräfte aus Besuchsdienst, Bewohnergemeinschaft, Hospizverein Neuburg / D.<br />
e.V.<br />
• Verantwortung für Sitzwachengruppe: Palliative Care-Fachkraft des Hauses, Vertretung<br />
nach Absprache. Aufgaben: Einladung <strong>und</strong> Mo<strong>der</strong>ation <strong>der</strong> halbjährlichen Treffen <strong>der</strong><br />
Sitzwachengruppe (Erfahrungsaustausch, kleine Fortbildungseinheiten auf Wunsch), AnsprechpartnerIn<br />
bei Konflikten, die sich nicht direkt lösen lassen; Ansprechpartner bei Belastung<br />
• Aufgaben <strong>der</strong> ehrenamtlichen Helfer: direkte Begleitung nach Absprache vor Ort (z.B.<br />
für kleine Annehmlichkeiten sorgen, M<strong>und</strong>pflege, stille Anwesenheit, Gespräche mit Angehörigen),<br />
Kontakt mit Bewohnern während Krankenhausaufenthalten, Unterstützung von<br />
Angehörigen z.B. unmittelbar nach dem Versterben von Bewohnern, Mithilfe bei Ritualen<br />
des Hauses (z. B. Gedenkfeier). Die jeweilige Bereitschaft für spezielle Aufgaben (z. B.<br />
Begleitung am Totenbett) wird aus einer Liste ersichtlich, die in jedem Stationszimmer<br />
aushängt.<br />
• Umfang des Einsatzes: ca. 1 Einsatz pro Quartal, st<strong>und</strong>enweise (<strong>kein</strong>e R<strong>und</strong>-um-die-Uhr-<br />
Betreuung notwendig!)<br />
• Aufnahme in die Sitzwachengruppe: Entscheidung nach einem Gespräch mit PDL / Palliative-Care-Fachkraft<br />
• Einführung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Helfer: Die ehrenamtlichen Helfer erhalten – sofern sie<br />
nicht Mitarbeiter des Hauses sind – eine schriftliche Orientierungshilfe (Ansprechpartner,<br />
Versicherungsschutz, Beson<strong>der</strong>heiten bei nächtlicher Sitzwache, Notruf, Möglichkeiten<br />
zum Rauchen <strong>und</strong> zum Entspannen). Gr<strong>und</strong>sätzlich sind auch einführende Einsätze zu<br />
zweit möglich.<br />
• Begleitung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Helfer: Gespräche mit Palliative-Care-Fachkraft nach<br />
Bedarf möglich; ansonsten halbjährliche Treffen zum Erfahrungsaustausch<br />
• Schulung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Helfer: Die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sitzwachengruppe können<br />
Fortbildungsangebote des Hospizvereines Neuburg / D. e.V. <strong>und</strong> auch an<strong>der</strong>er regionaler<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
198
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Hospizvereine nutzen. Die Übernahme von Gebühren durch die Einrichtung muss vorher<br />
beantragt <strong>und</strong> durch die Heimleitung genehmigt werden. Außerdem gibt es auf Wunsch<br />
kleinere Fortbildungseinheiten im Rahmen <strong>der</strong> halbjährlichen Treffen.<br />
• Anerkennung: Die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sitzwachengruppe erhalten jährlich als Anerkennung<br />
des Hauses eine kleines „Überraschungsgeschenk“. Eine Fototafel nennt <strong>und</strong> zeigt die<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sitzwachengruppe.<br />
Durchführung einer direkten Begleitung<br />
• Verantwortung für Einsatz: Schichtleitung (Liste mit Namen, Telefonnummern <strong>und</strong><br />
Einsatzzeiten, beson<strong>der</strong>e Aufgaben, z. B. Begleitung am Totenbett) hängt im Dienstzimmer<br />
jedes Pflegebereiches)<br />
• Vorbereitung: Die Schichtleitung klärt mit Betroffenen (wenn möglich) <strong>und</strong> Angehörigen<br />
(„Würde es Ihnen gut tun, wenn nachts jemand still aufpasst?“). Bereits im Gespräch �<br />
Lebensqualität sichern wird auf die Sitzwachengruppe hingewiesen. Die Angehörigen<br />
werden auch gefragt, ob sie eine Sitzwache übernehmen wollen.<br />
• Rahmen: Die ehrenamtlichen Helfer melden sich kurz zu Beginn bei <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Schichtleitung, um Beson<strong>der</strong>heiten abzuklären. Am Ende <strong>der</strong> Begleitung informieren die<br />
ehrenamtlichen Helfer die Schichtleitung.<br />
• Dokumentieren: Die Schichtleitung dokumentiert die berichteten Beson<strong>der</strong>heiten in den<br />
Pflegebericht<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
199
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
200
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard / Gesprächshilfe<br />
Ehrenamtliche Hospizhilfe anbieten 1<br />
Hospizhelfer ambulant vermitteln (Hospizverein Füssen)<br />
Ziele<br />
• Klare Indikation: Die Pflegekräfte wissen, wann <strong>der</strong> Hospizverein in den betroffenen Familien<br />
als Unterstützung ins Gespräch gebracht werden kann.<br />
• Kompetente Information: Die Pflegekräfte kennen die Einsatzmöglichkeiten <strong>der</strong> Hospizhelfer.<br />
• Taktvolles Gespräch: Die Pflegekräfte kennen mögliche Hemmschwellen, die Hospizhilfe<br />
anzunehmen, <strong>und</strong> wissen entsprechende Anregungen, wie sie das Angebot einbringen<br />
können.<br />
• Wirkungsvolle Hilfe: Die Angehörigen / <strong>der</strong> Schwerkranke empfinden die Unterstützung<br />
als entlastend <strong>und</strong> nicht belastend. Einsatz <strong>und</strong> Än<strong>der</strong>ungswünsche werden unkompliziert<br />
geregelt.<br />
Durchführung<br />
Vorbereitung<br />
• Indikation: Die Hospizhilfe wird ins Gespräch gebracht, ...<br />
• wenn Angehörige über Überfor<strong>der</strong>ung klagen (Fall 1). Das Angebot ist auch nur für<br />
Angehörige als Entlastung möglich.<br />
• wenn das Sterben / <strong>der</strong> Tod zum Thema durch die Betroffenen gemacht wird (Fall 2)<br />
• wenn die Pflegekräfte, die in <strong>der</strong> betroffenen Familie eingesetzt sind, zur Einschätzung<br />
kommen, dass die Lebenszeit des Patienten deutlich begrenzt ist <strong>und</strong> sein Tod sie in<br />
den nächsten Wochen nicht überraschen würde (Fall 3)<br />
Abklärung: Bevor die Pflegekräfte den Hospizdienst anbieten, klären sie telefonisch ab, ob<br />
Hospizhelfer verfügbar sind.<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein Ostallgäu<br />
e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer<br />
(GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
201
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Durchführung<br />
Beratungsgespräch<br />
Das Angebot <strong>der</strong> ehrenamtlichen Hilfe kann von <strong>der</strong> Pflegekraft situativ angemessen ins Gespräch<br />
mit dem Betroffenen <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> den (pflegenden) Angehörigen eingebracht werden.<br />
(Siehe auch � Krisenvorsorge treffen). Das Angebot wird in <strong>der</strong> Regel noch nicht im Erstgespräch<br />
besprochen, weil es erfahrungsgemäß sonst überfor<strong>der</strong>nd sein könnte <strong>und</strong> eine<br />
schnelle Ablehnung provoziert.<br />
• Einstieg über praktisches Hilfsangebot an Angehörige: "Sie haben geäußert, dass Sie<br />
bei ... mehr Unterstützung o<strong>der</strong> Entlastung bräuchten. Wir als Schwestern können das<br />
lei<strong>der</strong> nicht bieten, aber es gibt die Möglichkeit von ehrenamtlichen Hospizhelfern.<br />
• Übersicht über die Hilfen. Hinweis: Einsatz nach Bedarf; Hilfe kostenlos; <strong>kein</strong>e Mitgliedschaft<br />
notwendig, speziell ausgebildete <strong>und</strong> erfahrene Frauen <strong>und</strong> Männer; Schweigepflicht.<br />
• Zur Ermutigung positive Erfahrung ein- bringen: "Ich kann bestätigen, dass Hospizhelfer<br />
schon oft geholfen haben. Und es erleichtert mich auch als Pflegekraft, wenn ich weiß,<br />
dass Sie noch zusätzlich unterstützt werden ..." O<strong>der</strong>: "Ich kenne einige Helfer persönlich.<br />
• Hemmschwelle "unbekanntes Angebot": Hinweisen auf telefonische Beratung. "Soll<br />
ich <strong>der</strong> Hospiz-Einsatzleitung Bescheid geben, dass sie bei Ihnen anruft, um Sie zu beraten?<br />
Das ist völlig unverbindlich ..." Weitergeben des � Faltblattes "Hospizhelferdienst".<br />
"Sie können das, was ich gesagt habe, noch einmal in Ruhe nachlesen <strong>und</strong> sich<br />
durch den Kopf gehen lassen ..."<br />
• Auf Offenheit des Angebotes hinweisen: "Es lässt sich alles besprechen <strong>und</strong> abklären ..."<br />
• Hemmschwelle "frem<strong>der</strong> Mensch im Haus": Darauf hinweisen: "Ich kann mir vorstellen,<br />
dass man einen fremden Menschen zunächst nur ungern im Haus hat ... Die Hilfe ist<br />
immer erst einmal auf Probe zum Beschnuppern. Sie müssen den Helfer auch nicht unterhalten.<br />
Und es ist auch in Ordnung, wenn Sie ihn nicht (mehr) brauchen. Das ist völlig<br />
unkompliziert ..."<br />
• Erinnern: "Ich war als Pflegekraft auch einmal eine Fremde für Sie ..."<br />
Auswertung (bezogen auf Ziele)<br />
• PDL fragt in Teamgesprächen nach, ob Pflegekräfte den Einsatz von Hospizhelfern erwägen.<br />
Es wird geklärt, wie man konkret das Angebot einbringen könnte <strong>und</strong> welche<br />
Hemmschwellen in <strong>der</strong> betroffenen Familie gesehen werden. Das �� Faltblatt "Hospizhelferdienst"<br />
liegt in <strong>der</strong> Sozialstation zum Mitnehmen auf.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
202
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Der persönliche Kontakt zwischen den Pflegekräften <strong>der</strong> Sozialstation / Kurzzeitpflege<br />
<strong>und</strong> den Hospizhelfern wird durch gemeinsame Fortbildungen gepflegt. Bei diesen Fortbildungen<br />
werden auch auftauchende sachliche Fragen <strong>und</strong> persönliche Erfahrungen<br />
zum Einsatz von Hospizhelfern ausgetauscht.<br />
• Wenn es zur praktischen Begleitung durch Hospizhelferinnen kommt, achten die Pflegekräfte<br />
aufmerksam darauf, wie die Hilfe ankommt. Auffallende Störungen werden an die<br />
Einsatzleitung des Hospizvereines weitergegeben.<br />
• Bei praktischen Einsätzen suchen die eingesetzten Pflegekräfte nach Bedarf telefonisch<br />
o<strong>der</strong> persönlich den Kontakt mit den jeweiligen Hospizhelfern / Einsatzleitung, um sich<br />
über die Hilfe o<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen abzustimmen.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
203
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
204
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gr<strong>und</strong>lagentext <strong>und</strong> Handlungsanleitung<br />
Hilfreiche Rituale entwickeln 1<br />
Rituale im Team selbst entwickeln – Ein „Bastelkurs“ für Rituale<br />
Einleitung<br />
"Unsere Kultur ist arm geworden an Ritualen für die wichtigen Lebensübergänge, z.B. in Zeiten<br />
<strong>der</strong> Trauer!", lautet eine Klage. „Von den eigentlichen Ritualen blieb nichts o<strong>der</strong> wenig.<br />
Dennoch ist ein Bedürfnis nach dem, was die Rituale leisteten, noch o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> vorhanden.“<br />
(FLAMMER 2004: 28) Diese kulturelle Entwicklung bringt Belastungen, birgt aber auch Chancen.<br />
Sicher: Es fehlen uns einerseits tradierte hilfreiche Orientierungen in Zeiten von Krisen<br />
<strong>und</strong> Verän<strong>der</strong>ung. An<strong>der</strong>erseits sind wir aber auch frei geworden von den damit oft verb<strong>und</strong>enen<br />
Zwängen o<strong>der</strong> sinnentleerten Verhaltensweisen. Wir können selbst stimmige Rituale für<br />
<strong>und</strong> mit den eigenen Lebens- <strong>und</strong> Arbeitsgemeinschaften (z. B. Familie <strong>und</strong> Team) kreieren.<br />
Diese Kreativität will dieser Beitrag för<strong>der</strong>n. Etwas despektierlich formuliert: Die Arbeitseinheit<br />
ist wie ein kleiner „Koch- o<strong>der</strong> Bastelkurs“ aufgebaut. Zunächst sichte ich die nötigen Zutaten<br />
o<strong>der</strong> Rohstoffe für Rituale in Form einer Definition ausgebreitet <strong>und</strong> gesichtet. Aus Definition<br />
(„Man nehme …“), Wirkungsweisen <strong>und</strong> Ablaufphasen entsteht sozusagen ein Gr<strong>und</strong>rezept,<br />
das über die „rituellen Gr<strong>und</strong>themen“ mit Gestaltungsmöglichkeiten angereichert wird.<br />
In die Form von Leitfragen gegossen, lassen sich daraus für alle möglichen Übergangssituationen<br />
im Heim Ideen entwickeln. Die verschiedenen Rituale, die wir an an<strong>der</strong>e Stelle in dieser<br />
Arbeitshilfe bereits vorgestellt haben, sind mit Hilfe dieser Leitfragen entstanden <strong>und</strong> strukturiert<br />
worden. Zwei weitere Beispiele („Sich frei schreiben“ <strong>und</strong> "Alte <strong>und</strong> neue Hospizgruppe<br />
von Ehrenamtlichen verbinden“) aus <strong>der</strong> „Ritual-Küche“ von Projekten habe ich diesem Text<br />
beigefügt.<br />
1<br />
Der Beitrag basiert auf meinen Materialien zum Unterricht, z. T. veröffentlicht auf <strong>der</strong> Homepage <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für<br />
Palliativmedizin, Projekt: Palliative Care – Lehren, Lernen, Leben.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
205
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Das „Geheimnis“: Was sind eigentlich Rituale?<br />
Fünf Merkmale einer beson<strong>der</strong>en Handlung<br />
Rituale erleben eine gewisse Renaissance o<strong>der</strong> Konjunktur in <strong>der</strong> Aufmerksamkeit. Noch in<br />
den 70er <strong>und</strong> 80er Jahren wurde in <strong>der</strong> sozialwissenschaftlichen Auslegung „Ritual“ begrifflich<br />
eingeschmolzen <strong>und</strong> für alle Formen von Routine (z. B. Samstagseinkauf beim Bäcker, jahreszeitlicher<br />
Wechsel von Autoreifen) verwendet, bzw. vor allem als Herrschaftsinstrument<br />
verdächtigt. Auch in <strong>der</strong> Pflegetheorie wird Ritual oft synonym für „routinierte Handlungen“ benutzt,<br />
z. B. für einen bestimmten Ablauf, mit <strong>der</strong> ein Bewohner zu Bett gebracht wird. „Ritual"<br />
wird deswegen begrifflich oft verwechselt mit "Gewohnheit". Eine Unterscheidung lohnt sich,<br />
weil klare Merkmale es uns erleichtern, Rituale zu entwickeln.<br />
Definition<br />
Ritual = Handlungen mit … Gewohnheit = Handlungen mit …<br />
1. mit einem geregelten, wie<strong>der</strong>holbaren Ablauf<br />
2. mit hoher Aufmerksamkeit<br />
3. mit Symbolisierungen zelebriert<br />
4. mit emotionaler Beteiligung vollzogen<br />
5. mit persönlichem Sinn gefüllt<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
mit einem geregelten, wie<strong>der</strong>holbaren Ablauf<br />
ohne beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit<br />
praktisch ausgerichtet<br />
ohne Gefühlsbeteiligung, "automatisch"<br />
ohne bewusste Bedeutung, nur zweckmäßig (Vereinfachung)<br />
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��<br />
Fließende Übergänge:<br />
Großes Ritual (Zeremonie) - Kleines Ritual (ritualisierte Handlung) - Gewohnheit<br />
Es wird dabei deutlich:<br />
• Weniger das Was (ich mache) ist entscheidend für ein Ritual, son<strong>der</strong>n das Wie (ich es vollziehe). Beispiel:<br />
Wenn wir eine Kerze anzünden o<strong>der</strong> löschen o<strong>der</strong> wenn wir einen Verstorbenen waschen, kann das als<br />
schnelle, gedankenlose, funktionell ausgerichtete Routine geschehen; wir können dieselbe Handlung aber<br />
auch durch Aufmerksamkeit <strong>und</strong> symbolisch verstanden zum rituellen Akt erheben.<br />
• Der Übergang ist oft fließend. Ein Ritual kann zur Gewohnheit verflachen o<strong>der</strong> umgekehrt eine Gewohnheit<br />
kann zum Ritual erhoben werden (Beispiel: Aus dem äußerlichen Duschen wird eine „innere Reinigung“: Ich<br />
stelle mir dabei vor, wie Belastungen <strong>und</strong> Sorgen abgespült werden <strong>und</strong> im Abfluss verschwinden …)<br />
• Abschiedsrituale (im Heim) müssen auch <strong>kein</strong>e aufwendigen, groß angelegten Zeremonien sein. Das Einfache<br />
wirkt.<br />
206
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Erläuterungen zur Definition<br />
Geregelter, wie<strong>der</strong>holbarer Ablauf<br />
Eine Gemeinsamkeit von Ritualen <strong>und</strong> Gewohnheiten führt zur Verwechslung: Beide haben<br />
einen geregelten, wie<strong>der</strong>holbaren Ablauf. (Übergangs-)Rituale folgen allerdings einem beson<strong>der</strong>en,<br />
unterschwelligen Muster, die einen Übergang o<strong>der</strong> Wechsel gestalten. Gewohnheiten<br />
haben diese innere Ordnung nicht. Hier beginnen bereits wesentliche Unterschiede.<br />
Hohe Aufmerksamkeit<br />
Rituale können nicht beiläufig, nebenher praktiziert werden, son<strong>der</strong>n brauchen Aufmerksamkeit.<br />
Es muss klar sein <strong>und</strong> durch den Rahmen gesichert: Ich begehe ein Ritual. Sie benötigen<br />
eine Art "feierlicher Absicht". (FISCHEDICK, 2004: 15).<br />
Wenn ich dagegen mein morgendliches Programm starte, geschieht das ohne Aufmerksamkeit.<br />
Es funktioniert im Halbschlaf: Teewasser aufstellen, Zähneputzen, Rasieren, Duschen -<br />
das spart Zeit, braucht <strong>kein</strong>e Konzentration. Eine Gewohnheit.<br />
Symbolisierungen<br />
Kern von Ritualen sind Symbolisierungen (z.B. durch Gebärden, Gegenstände, Musik, Düfte),<br />
die in sinnlich wahrnehmbarer Gestalt Gefühle <strong>und</strong> Beziehungen ausdrücken <strong>und</strong> formen.<br />
Symbole sind vieldeutig <strong>und</strong> erlauben auch, Wi<strong>der</strong>sprüchliches <strong>und</strong> Unsagbares auszudrücken.<br />
Dabei kann alles mit Bedeutung aufgeladen werden. Beispiel: Die Lesebrille, die ein Verstorbene<br />
immer getragen hat, wird auf dem Erinnerungstischchen vor seiner Tür zum wichtigen,<br />
symbolischen Gegenstand werden, die diesen toten Menschen repräsentiert mit seiner Lesefreude,<br />
kritischen Sichtweise usw. Die Krücke, die er in den letzten Monaten gebraucht hat, erinnert<br />
mit ihren Gebrauchsspuren <strong>und</strong> Narben als Sinnbild seiner Tapferkeit .<br />
Beispiel: Ich kann eine Kerze am Abend ganz praktisch <strong>und</strong> gewohnheitsmäßig anzünden, um<br />
mir etwas stimmungsvolle Beleuchtung zu verschaffen. Ich kann dieses "Universalsymbol"<br />
aber auch entzünden als tieferes Zeichen für eine innere Verb<strong>und</strong>enheit mit einem Menschen.<br />
Ausdruck von Emotion <strong>und</strong> Beziehung<br />
Rituale lösen Emotionen aus <strong>und</strong> geben ihnen gleichzeitig Form <strong>und</strong> Halt. Gleichzeitig können<br />
auch Beziehungen symbolisch geordnet werden, z.B. ein Wechsel im Status. Beispiel: In einem<br />
"Ritual für Paare, die sich trennen" des Evangelischen Beratungszentrums <strong>München</strong> e.V.<br />
(o.J.) kommt das Paar durch eine Türe in den Raum. Es wird erinnert an die "guten Zeiten"<br />
<strong>und</strong> es werden (in Formeln) Schuld <strong>und</strong> Vergebung sowie die eigenen Anteile an <strong>der</strong> Trennung<br />
eingestanden. Mit <strong>der</strong> Rückgabe <strong>der</strong> Ringe geben sich die Partner frei. Fürbitten thematisieren<br />
die Zukunft. Die Getrennten verlassen den Raum in verschiedenen Richtungen.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
207
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Sinn<br />
Rituale müssen als persönlich sinnvoll erlebt werden, um wirksam zu sein. Wenn ich als Tourist<br />
bei einem exotischen Regentanz zu sehen, ist es für mich <strong>kein</strong> Ritual, son<strong>der</strong>n ein folkloristisches<br />
Event. Wir erleben viele Rituale als persönlich entleert. Sie werden zum Brauch,<br />
weil man es eben so macht, o<strong>der</strong> vielleicht sogar zur Zwangsveranstaltung.<br />
Gewohnheiten benötigen dagegen <strong>kein</strong>e innere Sinnfüllung. Sie genügen nur einem Zweck:<br />
<strong>der</strong> Vereinfachung des täglichen Lebens.<br />
Die „Kräfte“: Wie wirken Rituale?<br />
Vier Funktionen o<strong>der</strong> Wirkungsweisen guter Rituale<br />
Rituale helfen "Schwellen- <strong>und</strong> Krisensituationen" zu bewältigen. Sie entfalten dabei in unterschiedlicher<br />
Weise vier Funktionen:<br />
• Die psychische Funktion von Ritualen<br />
Sie geben unterschiedlichen Gefühlen Ausdruck, lösen sie aus, dosieren <strong>und</strong> ordnen sie<br />
aber auch gleichzeitig. Gefühle bekommen eine Fassung.<br />
• Die soziale Funktion von Ritualen<br />
Sie führen Menschen zusammen (o<strong>der</strong> trennen sie), vermitteln Solidarität, verteilen klare<br />
Status <strong>und</strong> Rollen o<strong>der</strong> schaffen Schutzräume.<br />
• Die spirituelle Funktion von Ritualen<br />
Sie gestalten symbolisch existenzielle Fragen nach Sinn (Wozu erlebe ich das?), Identität<br />
("Wer bin ich?“) <strong>und</strong> Perspektiven (Wohin geht mein neue Weg?)<br />
• Die zeitliche Funktion von Ritualen<br />
Sie dienen <strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ung eines Prozesses <strong>und</strong> setzen einen klaren Anfang <strong>und</strong> ein Ende.<br />
Erläuterungen zu den Funktionen<br />
Die psychische Funktion von Ritualen<br />
Sie geben unterschiedlichen Gefühlen Raum, dosieren <strong>und</strong> ordnen sie. "Trauer braucht Ausdruck!"<br />
Rituale können über symbolische Handlungen (Gebärden, Musik, usw.) Trauer ins<br />
Fließen bringen. Symbole sind ja die Sprache unserer Seele. Gleichzeitig geben sie Halt. Psychologische<br />
Untersuchungen (CANACAKIS 1987) belegen: man kann sich über Rituale „ges<strong>und</strong><br />
trauern“. Aber nicht jedes Ritual ist in diesem Sinne hilfreich. Als sinnentleerte Zwangsrituale<br />
können sie auch blockierend wirken. Gute Rituale dagegen bieten Möglichkeiten für wi<strong>der</strong>sprüchliche<br />
Gefühle (z.B. Wut, Dankbarkeit) <strong>und</strong> lassen Platz für eigene Ausdrucksformen.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
208
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Die soziale Funktion von Ritualen<br />
Sie führen Menschen zusammen (o<strong>der</strong> trennen sie) <strong>und</strong> verteilen klare Rollen. "Trauer braucht<br />
Gemeinschaft!" Rituale organisieren <strong>und</strong> demonstrieren Solidarität <strong>und</strong> Verb<strong>und</strong>enheit (z.B.<br />
Ritual "Nachbarn kochen für Trauernde"). Sie legen auch neue Rollen fest <strong>und</strong> machen sie<br />
sichtbar.<br />
Die spirituelle Funktion<br />
Rituale gestalten existentielle Fragen ("Wer bin ich? Wozu lebe ich? Wohin sterbe ich?) Rituale<br />
berühren uns in unserer existentiellen Tiefe <strong>und</strong> drücken Vertrauen in eine höhere Ordnung<br />
aus. Wir können damit wichtige Punkte unseres Lebens markieren <strong>und</strong> deuten auf symbolische<br />
Weise den möglichen Sinn von alltäglichen Grenzen <strong>und</strong> beson<strong>der</strong>en Krisen <strong>und</strong> Übergängen<br />
(z.B. neuer Tag, neue Arbeitsstelle, Trennung einer Beziehung)<br />
Die zeitliche Funktion<br />
Sie dienen <strong>der</strong> Glie<strong>der</strong>ung eines Prozesses <strong>und</strong> schaffen einen zeitlichen Rahmen. "Trauer<br />
braucht Zeit!" Rituale, z.B. <strong>der</strong> Erinnerung, ermöglichen, immer wie<strong>der</strong> für eine bestimmte Zeit<br />
in die Trauer zu gehen. Gleichzeitig setzen Rituale auch ein gutes Ende, um in den (pflegerischen)<br />
Alltag wechseln zu können.<br />
"Die Funktion des Rituals, wie ich es verstehe, ist es, dem menschlichen Leben Form zu verleihen, <strong>und</strong> zwar nicht<br />
durch ein bloßes Ordnen auf <strong>der</strong> Oberfläche, son<strong>der</strong>n in seiner Tiefe." (Joseph CAMPBELL, amerikanischer Mythenforscher;<br />
zitiert nach VON WELTZIEN, 1997: 8)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
209
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Die Dramaturgie: Wie verlaufen Rituale?<br />
Drei Phasen bei (Übergangs-) Ritualen<br />
Einen wun<strong>der</strong>baren roten Faden, um Rituale praktisch zu entwickeln, liefern die Forschungen<br />
von VAN GENNEP. Der Völkerk<strong>und</strong>ler entdeckte bereits vor hun<strong>der</strong>t Jahren, dass die großen<br />
Übergangsrituale - bei aller Vielfalt <strong>der</strong> kulturellen Formen - unterschwellig immer in drei Phasen<br />
geglie<strong>der</strong>t sind. Ich spiele die drei Phasen am Beispiel einer Erdbestattung mit Trauerfeier<br />
durch:<br />
1. Phase: Loslösung (durch Erinnerung)<br />
Beispiel: Bei Bestattungen lösen wir uns durch die persönlichen o<strong>der</strong> offiziellen Erinnerungen<br />
an den Verstorbenen. Wer war dieser Mensch? Wie war meine Beziehung zu ihm? Wo bin<br />
ich dem Verstorbenen dankbar? Wir können uns nur lösen, wenn wir uns unserer Verb<strong>und</strong>enheit<br />
vergewissern!<br />
2. Phase: Übergang (Höhepunkt / Schwelle)<br />
Beispiel: Bei Erdbestattungen ist <strong>der</strong> Übergang jener dramatische Augenblick, wenn <strong>der</strong> Sarg<br />
abgesenkt wird. Jetzt wird sichtbar: Der Verstorbene ist nicht mehr leiblich auf <strong>der</strong> Erde, son<strong>der</strong>n<br />
muss Platz finden im "Herzen <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Erinnerung".<br />
3. Phase <strong>der</strong> Neuanbindung (durch Ausblick)<br />
Beispiel: Der "Leichenschmaus" - wie immer man auch dazu stehen mag - kann für diese<br />
Phase stehen. Man vergewissert sich <strong>der</strong> Gemeinschaft <strong>und</strong> kehrt sinnlich <strong>und</strong> sinnfällig durch<br />
das gemeinsame Essen ins Leben zurück. Das ist auch – symbolisch vorweggenommen - die<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Trauernden auf ihrem weiteren, oft langen Trauerweg.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
210
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Rituale: Türen zu neuem Leben<br />
Typische Übergangssituationen in Institutionen<br />
Rituale können wertvolle Hilfen bei (schwierigen) Übergängen sein. Gerade das Leben <strong>und</strong><br />
Arbeiten in einer Einrichtung wie Krankenhaus, Pflegeheim o<strong>der</strong> Hospiz ist von solchen Übergängen<br />
o<strong>der</strong> Grenzen durchzogen. Das Phasenmodel <strong>der</strong> Rituale kann nun als eine Art<br />
„Bastelanleitung“ dienen, um eigene Rituale für den Arbeitsbereich zu entwickeln o<strong>der</strong> vorhandene<br />
auf ihre Stimmigkeit hin zu prüfen.<br />
Beispiele für große <strong>und</strong> kleine Übergangssituationen im Heim<br />
• Aufnahme, Einzug im Heim<br />
• Verän<strong>der</strong>ungen im Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
• Geburtstage<br />
• Jahrestage<br />
• Teamtreffen eröffnen <strong>und</strong> schließen<br />
• Versorgung Verstorbener<br />
• Aufbahrung<br />
• Verabschiedung<br />
• Geleit von Verstorbenen<br />
• Gedenken an Verstorbene<br />
• Aufnahme ins Team<br />
• Abschied aus dem Team<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
211
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Trennung, Segen, Dank … ausdrücken<br />
Rituelle Gr<strong>und</strong>themen <strong>und</strong> Beispiele für ihre Gestaltung<br />
In Palliative Care – <strong>und</strong> natürlich nicht nur da - gibt es existenzielle Gr<strong>und</strong>themen, die rituell<br />
gestaltet werden können. Oft werden diese Themen mit ähnlichen symbolischen Handlungen<br />
inszeniert. Die Übersicht zeigt Beispiele <strong>und</strong> sammelt weitere Möglichkeiten <strong>der</strong> symbolischen<br />
Gestaltung. So entsteht ein kleines Repertoire symbolischer Handlungen, das Ihre Kreativität<br />
für die Entwicklung konkreter Rituale inspirieren kann. (Vgl. FISCHEDICK 2004: 122 f.)<br />
Gr<strong>und</strong>thema<br />
Annahme mit <strong>der</strong> Aufgabe,<br />
einverstanden zu<br />
werden, sich einzulassen<br />
Trennung mit <strong>der</strong> Aufgabe,<br />
sich zu lösen,<br />
Vergangenes zu würdigen,<br />
freizugeben <strong>und</strong><br />
frei zu werden, etwas<br />
abzuschließen<br />
Verwandlung mit <strong>der</strong><br />
Aufgabe, Einstellungen<br />
<strong>und</strong> Bewertungen zu<br />
än<strong>der</strong>n<br />
Reinigung<br />
Dank<br />
Schutz, Abwehr<br />
Segen, Zuspruch<br />
Beispiele für symbolische<br />
Handlungen<br />
Hände öffnen, Symbol in die<br />
Hand nehmen, etwas zum Herzen<br />
führen, eine symbolische<br />
Verbindung knüpfen, auf etwas<br />
zugehen, sich verbeugen<br />
Zerschneiden, zerschlagen, eine<br />
symbolische Bindung durchtrennen,<br />
zurückgeben, verneigen,<br />
sich abwenden, weggehen<br />
Verbrennen, verzieren, waschen,<br />
Kleidung wechseln, etwas<br />
wegschwimmen lassen, etwas<br />
dem Wind überlassen, etwas<br />
in die Erde bringen<br />
Baden, duschen, untertauchen,<br />
Teilwaschungen, Salbungen,<br />
räuchern, etwas ablegen<br />
Etwas opfern, hergeben,<br />
schmücken, verteilen, sich verneigen<br />
Mit Zeichen versehen, Handauflegen,<br />
Salbungen, Kreis bilden,<br />
räuchern<br />
Handauflegen, mit Zeichen versehen,<br />
Salbung<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Beispiel innerhalb eines konkreten<br />
Rituals<br />
Mit einer farbig durchwirkten kräftigen Schnur haben<br />
sich die Teilnehmer eines Hospizkurses in <strong>der</strong> Form eines<br />
Netzes verb<strong>und</strong>en.<br />
Beim Abschied aus einem Team schneidet die ausscheidende<br />
Kollegin als Zeichen <strong>der</strong> Verb<strong>und</strong>enheit <strong>und</strong><br />
Trennung ein Stück Schnur ab, das die an<strong>der</strong>en<br />
Teammitglie<strong>der</strong> halten.<br />
Die Teilnehmer einer Gruppe trauern<strong>der</strong> Angehörigen<br />
setzen in Form von Papierschiffchen Sätze ihrer Trauer<br />
in einen Fluss.. Bei einem Gedenkritual für trauernde<br />
Angehörige nehmen sich die Teilnehmer Samen (z. B.<br />
Wildblumen-Mischung o<strong>der</strong> Kerne von Sonnenblumen)<br />
aus einer Schale mit dem Impuls: Was lebt vom Verstorbenen<br />
in mir weiter?<br />
Die Teilnehmer einer Inhouse-Fortbildung Palliativpflege<br />
streichen symbolisch zu Beginn einer Unterrichtsst<strong>und</strong>e<br />
Alltagsbelastungen ab.<br />
Die Teilnehmer verneigen sich nach einer intensiven<br />
Erzählr<strong>und</strong>e über persönliche Erlebnisse voreinan<strong>der</strong><br />
im Kreis.<br />
Am Ende eines Kurstages bilden die Teilnehmer einen<br />
Kreis <strong>und</strong> ziehen sich für die Rückkehr in den Alltag<br />
durch Streichungen mit den Händen symbolisch einen<br />
schützenden Mantel an<br />
Der neu eingezogene Heimbewohner schreibt eine<br />
Hoffnung o<strong>der</strong> „Fürbitte“ für den nächsten Lebensabschnitt<br />
auf eine Bildkarte, die er sich ausgesucht hat,<br />
<strong>und</strong> stellt diese auf.<br />
212
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Rituale kreativ entwickeln<br />
Eine Handlungsanleitung<br />
„Der Einsatz von Ritualen (…) an Sterbenden kann sehr hilfreich <strong>und</strong> stärkend sein. Im Zeitalter <strong>der</strong> Säkularisierung<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Individualisierung müssen solche Rituale aber nicht nur gut inszeniert, son<strong>der</strong>n auch sorgfältig<br />
geplant <strong>und</strong> ihr Einsatz in mehrfacher Hinsicht überlegt werden: Passt das Ritual zum Patienten <strong>und</strong> seiner Situation?<br />
Bin ich (…) in <strong>der</strong> Ausführung dieses Rituals sicher <strong>und</strong> erlebe ich es selbst als orientierend? Wer<br />
wünscht den Einsatz dieses Rituals – <strong>der</strong> Patient o<strong>der</strong> die Angehörigen? Werden solche Fragen nicht hinreichend<br />
vor dem Einsatz eines Rituals geklärt, können sie stärker verunsichern als orientieren <strong>und</strong> drohen ‚sehr<br />
schnell zu Klischees zu verkommen’ (…) Rituale sollten einen sinnvollen Platz innerhalb einer Begleitung haben,<br />
sie ersetzen die Begleitung nicht: ‚Das Ritual kanalisiert Emotionen, aber diese Emotionen <strong>der</strong> Angst, <strong>der</strong><br />
Schuld, <strong>der</strong> Verzweiflung müssen … durchgearbeitet werden.’ 1 “ (LILIE 2003: 86)<br />
Rituale lassen sich nicht einfach kopieren <strong>und</strong> blind übernehmen. Am besten sind eigene<br />
Ideen, die auch die Personen <strong>und</strong> Möglichkeiten vor Ort im Blick haben. Die Merkmale <strong>und</strong><br />
Funktionen von Ritualen sind in Leitfragen umformuliert, die das Nachdenken unterstützen<br />
sollen. Insbeson<strong>der</strong>e das Phasenmodel <strong>der</strong> Rituale kann als eine Art „Bastelanleitung“ genutzt<br />
werden, um (im Team) eigene Rituale für den Arbeitsbereich zu entwickeln o<strong>der</strong> vorhandene<br />
auf ihre Stimmigkeit hin zu prüfen. Hinweis: Die Beispiele im Anschluss sind entsprechend<br />
dieser Anleitung aufgebaut <strong>und</strong> können als Orientierung dienen.<br />
Anleitung<br />
Für welche (Übergangs-)Situation ist das Ritual gedacht? Gibt es einen guten Titel?<br />
Wer sind die beteiligten Personen? Wie ist <strong>der</strong> Grad <strong>der</strong> Betroffenheit?<br />
Durch wen könnte das Ritual angeboten werden? Wer übernimmt die „Regie“? (Verantwortlich?)<br />
Soll es offiziell als Ritual bezeichnet <strong>und</strong> eingeführt werden?<br />
Wie sieht <strong>der</strong> zeitliche <strong>und</strong> räumliche Rahmen aus? Was wäre günstig?<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Übergreifende Fragen: Wie könnten die einzelnen Phasen des Rituals gestaltet werden?<br />
213
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Übergreifende Fragen: Wie könnten die einzelnen Phasen des Rituals gestaltet werden?<br />
Welche Symbole (Handlungen, Musik, Objekte, Bil<strong>der</strong>) sind dabei den Beteiligten zugänglich<br />
<strong>und</strong> nicht zu fremd o<strong>der</strong> von vielleicht unerwünschten Bedeutungen überlagert? Gibt es<br />
vielleicht „ein tragendes Symbol“ im Ritual? Welche rituellen Gr<strong>und</strong>themen tauchen auf (z.<br />
B. Dank, Schuld usw.) Welche Gefühle könnten dabei im Ritual einen (symbolischen) Ausdruck<br />
bekommen? Was passt zu <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Beziehung <strong>der</strong> Beteiligten?<br />
Ideen für die Eröffnung?<br />
Ideen für Phase 1: Loslösung?<br />
Ideen für Phase 2: Wie könnte <strong>der</strong> Höhepunkt / Wendepunkt markiert werden?<br />
Ideen für Phase 3: Neuanbindung <strong>und</strong> Ausblick?<br />
Ideen für den Abschluss?<br />
1<br />
JOSUTTIS M.: Praxis des Evangeliums zwischen Politik <strong>und</strong> Religion. Gr<strong>und</strong>probleme <strong>der</strong> Praktischen Theologie. Gütersloher<br />
Verlagshaus, Gütersloh 1988, 199<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
214
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiele: Kleinstrituale im (pflegerischen) Alltag<br />
Schnelle Schleusen für die täglichen Übergänge<br />
Als Pflegekräfte wan<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> eilen Sie ständig zwischen unterschiedlichen Welten: In einem<br />
Zimmer wird vielleicht gefeiert <strong>und</strong> gescherzt, in einem an<strong>der</strong>en wartet jemand auf einen Bef<strong>und</strong>,<br />
im nächsten wird gestorben <strong>und</strong> getrauert. Und diese Welten sind nur wenige Meter<br />
voneinan<strong>der</strong> getrennt … Wie ist dieser Wechsel zu verkraften? O<strong>der</strong> wie kann man „heil“ aus<br />
<strong>der</strong> beruflichen in die private Welt zurückkehren – <strong>und</strong> umgekehrt? Rituelle Handlungen können<br />
hier wie eine Art „Schleuse“ wirken, um eine Metapher von E. SCHÜTZEN-DORF (2006)<br />
aufzunehmen.<br />
Beispiele für kleine, persönliche rituelle Handlungen<br />
• Die Arbeitskleidung bewusst am Ende des Tages ausziehen <strong>und</strong> aufhängen<br />
• In die Arbeitskleidung (<strong>und</strong> die berufliche Rolle) schlüpfen wie in einen dünnen Schutzmantel<br />
• Einen kleinen Stein (symbolisch für das kommende Schwere) vor <strong>der</strong> Arbeit in die Tasche<br />
stecken <strong>und</strong> ihn nach <strong>der</strong> Arbeit bewusst wie<strong>der</strong> ablegen<br />
• Sich vor dem Patientenzimmer gedanklich sammeln <strong>und</strong> auf die Person hinter <strong>der</strong> Tür<br />
vorbereiten <strong>und</strong> drei Mal vor <strong>der</strong> Tür tief durchatmen.<br />
• Den Arbeitsplatz bewusst am Ende des Tages aufräumen<br />
• Die ablaufende Musik einer Spieluhr im Zimmer einer Heimbewohnerin fungiert als Abschiedsritual<br />
nach <strong>der</strong> pflegerischen Tätigkeit<br />
• …<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
215
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ritual-Beispiel1: Sich „frei“ schreiben<br />
Ein Brief-Ritual als persönliche Bewältigungshilfe<br />
Schreiben schützt <strong>und</strong> stützt. Es erlaubt nach Worten zu tasten <strong>und</strong> zwingt zu einer gewissen<br />
Klarheit <strong>der</strong> Gedanken. Das Medium des Briefes kann sowohl eine gute Anregung für Patienten<br />
o<strong>der</strong> Bewohner (Beispiel STÄHLI 2004: 44) als auch für Angehörige <strong>und</strong> Pflegekräfte sein,<br />
sich „frei zu schreiben“.<br />
Das Ritual ist hier als ein nachträgliches Abschiednehmen von verstorbenen Menschen inszeniert.<br />
Natürlich könnte <strong>der</strong> Adressat des schriftlichen Zwiegesprächs auch eine lebende Person<br />
sein, <strong>der</strong> gegenüber man sich schuldig fühlt. Häufig fehlen bei einem Abschied die Worte.<br />
Worte können Schlüssel sein, um sich „los zu schließen“. Worte, die ich gerne noch gesagt<br />
hätte, o<strong>der</strong> Worte, die ich gerne noch gehört hätte … Es gilt etwas nachzutragen, damit ich<br />
nicht „nachtragend“ werde. Das folgende Ritual bietet über das Medium eines Briefes an<br />
den/die Verstorbene/n die Chance, in einen inneren Kontakt zu kommen, etwas zu klären <strong>und</strong><br />
die Erinnerung gut in das eigene Leben zu integrieren.<br />
Durchführung<br />
1. Phase: Rückbesinnung = Loslösung<br />
Um mit <strong>der</strong>/dem Verstorbene/n in einen inneren Kontakt zu kommen, suchen Sie eine symbolische<br />
Tätigkeit, die Sie mit <strong>der</strong>/dem Verstorbenen verb<strong>und</strong>en hat. Beispiele: Teetrinken aus<br />
dem Lieblingsgeschirr <strong>der</strong> Verstorbenen o<strong>der</strong> etwas backen, was Sie <strong>und</strong> er/sie gerne gegessen<br />
haben o<strong>der</strong> eine Musik hören, die Sie erinnert. Vielleicht gibt es einen Platz/Ort, an dem<br />
Sie sich <strong>der</strong>/m Verstorbene/n nahe fühlen …<br />
2. Höhepunkt = Übergang, Verwandlung<br />
• Zur Einstimmung auf das Schreiben können Sie eine Kerze anzünden.<br />
• Schreiben Sie <strong>der</strong>/dem Verstorbene/n einen Brief mit direkter Anrede.<br />
• Hilfen zum Nachdenken <strong>und</strong> Schreiben:<br />
• Was liegt mir noch am Herzen o<strong>der</strong> geht mir immer wie<strong>der</strong> durch den Kopf?<br />
• Was hätte ich gerne noch gesagt?<br />
• Was hätte ich umgekehrt gerne noch vom/von <strong>der</strong> Verstorbenen gehört? Was hätte ich noch gebraucht?<br />
• Was hat mich vielleicht verletzt?<br />
• Was bin ich schuldig geblieben?<br />
• Was tut mir leid?<br />
• Was verzeihe ich?<br />
• Wofür bin ich nicht verantwortlich, weil es nicht in meiner Macht war?<br />
• Wofür bin ich dankbar?<br />
• Was braucht noch Zeit? Welche Erfahrung nehme ich für mein weiteres Leben an?<br />
• Wo erbitte ich Hilfe?<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
216
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Fühlt es sich leicht an? Lassen Sie den Brief eine Weile ruhen. Was würde wohl <strong>der</strong>/die<br />
Verstorbene zu diesem Brief sagen?<br />
3. Phase = Neuanbindung<br />
Was möchten Sie mit dem Brief machen? Folgen Sie dabei Ihrer Intuition. Beispiele: Sie können<br />
den Brief verbrennen, wegschwimmen lassen, vergraben. Sie können den Brief jemanden<br />
Vertrauten vorlesen, sozusagen als Zeugen. Das entfaltet oft noch einmal eine ganz eigene,<br />
heilsame Kraft.<br />
Beispiel: „Herr S. wirkt bedrückt. Er erlebt sich selbst wie von einem fest gefügten Panzer umschlossen. Herr S. hat<br />
in dieser Enge wie<strong>der</strong>holt das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen. Als wir den Patienten einmal fragen, was<br />
ihn belaste, antwortet er, er spüre Schuld gegenüberseiner Ehefrau, die seit einigen Jahren in einem Pflegeheim<br />
sei. (Herr S. sah seine Frau zuletzt vor etwa zwei Jahren). Er müsse die meiste Zeit des Tages <strong>und</strong> <strong>der</strong> Nacht an<br />
sie denken. Die Stieftochter des Patienten bezeichnet Herrn S. vor seiner Krankheit als einen Menschen, <strong>der</strong> nur<br />
an sich gedacht habe. Er sei in vielem ein egoistischer Mensch gewesen. So hielt es ihr Stiefvater für nicht erfor<strong>der</strong>lich,<br />
einen Arzt zu verständigen, als seine Frau einen Schlaganfall erlitt. Erst auf ihr Drängen hin sei er dazu bereit<br />
gewesen. Die hinzugezogene Atemtherapeutin des Teams sieht die Atemeinschränkung im Kontext <strong>der</strong> familiären<br />
Beziehung <strong>und</strong> bietet dem Patienten die Möglichkeit eines Rituals an, in welches dieser einwilligt. Den Pflegenden<br />
teilt sie das Gespräch mit. Für etwa eine halbe St<strong>und</strong>e wird eine Kerze auf seinem Nachtkästchen angezündet.<br />
Sie bittet Herrn S. daraufhin, dass er seiner Frau gute, warme <strong>und</strong> fre<strong>und</strong>liche Gedanken zuschicken möge, wobei<br />
er sein Körperbewusstsein auf sein Herz lenken solle. Sie bestärkt ihn in <strong>der</strong> Vorstellung, dass seine Frau diese<br />
Botschaft wirklich erhalte. Am nächsten Vormittag, als seine Stieftochter zu Besuch ist, können beide im Denken an<br />
seine Frau/ihre Mutter weinen. In einem nächsten Schritt regen wir gegenüber Herrn S. an, während des Abendrituals<br />
eine Fotografie seiner Frau aufzustellen. Die Atemtherapeutin stellt die Frage, inwieweit er sich vorstellen<br />
können, einen Brief an seine Frau zu schreiben, <strong>der</strong> jedoch nicht notwendig abgeschickt müsse. Dort könne alles<br />
das stehen, was ihn belaste, er könne auch um Verzeihung bitten. Am darauf folgenden Tag möchte Herrn S einen<br />
Brief diktieren, doch gelingt ihm nur das Anredewort ‚Liebe ...’ Später gibt er den Inhalt eines ganzen Briefes zur<br />
Nie<strong>der</strong>schrift an, <strong>der</strong> dann seiner Frau von <strong>der</strong> Stieftochter vorgelesen wird. Wir erleben Herrn S. nach <strong>der</strong> Durchführung<br />
dieses Rituals (das Brennen <strong>der</strong> Kerze auf dem Nachtkästchen wird noch längere Zeit beibehalten) deutlich<br />
entlastet. Es fällt etwas von seiner Bedrückung <strong>und</strong> Schwere ab. Ein bewegen<strong>der</strong> Ausdruck davon ist, dass er<br />
mit seiner Stieftochter für einen Augenblick weinen kann. Die Entstehung <strong>und</strong> Durchführung des Rituals ist ein<br />
schönes Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Atemtherapeutin <strong>und</strong> Pflegenden.“ (STÄHLI 2004:<br />
44 f.)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
217
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ritual-Beispiel 2: Alte <strong>und</strong> neue (Hospiz-) Gruppe von Ehrenamtlichen<br />
verbinden<br />
Ein Ritual für den Aufbruch in eine gemeinsame Arbeit<br />
Wie könnten „neue“ <strong>und</strong> „alte“ Hospizgruppen zu einem gemeinsamen Team zusammengeführt<br />
werden? Dieser Vorschlag integriert ein kleineres Abschluss-Ritual für die jeweilige Zusammenarbeit<br />
in den bisherigen Gruppen in ein großes Auftakt-Ritual für eine künftige gemeinsame<br />
Arbeit. („Ritual im Ritual“)<br />
Ritual entwickelt von: Martin Alsheimer, Hospizgruppe Fürstenfeldbruck<br />
Durchführung<br />
Verantwortlich: Koordinatorin des Vereins, weitere Verantwortliche nach Absprache<br />
Vorbereitung/Rahmen/Beteiligte<br />
Stifte, Papier, Kassettenrekor<strong>der</strong>, Sekt, Saft, Gläser, Papier für „Steckbriefe“, neue Gruppenkerze<br />
(Für Varianten: farbige Seidentücher entsprechend <strong>der</strong> Teilnehmerzahl o<strong>der</strong> unterschiedliche<br />
Steine, die beschriftet werden können, z. B. mit Plaka-Farbe o<strong>der</strong> Filzstift, Korb,<br />
Eröffnung;<br />
• Das bisherige Hospizteam <strong>und</strong> die neue, ausgebildete Gruppe treffen sich zunächst getrennt<br />
in zwei Räumen.<br />
• Der Ablauf wird kurz vorgestellt; je ein Verantwortlicher leitet das Ritual in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Gruppe, gibt die entsprechenden Impulse <strong>und</strong> achtet auf die Zeit.<br />
• Auftakt kann ein Tanz o<strong>der</strong> eine Musik sein, die für die jeweilige Gruppe eine Bedeutung<br />
hat.<br />
• Die jeweilige Gruppenkerze wird entzündet.<br />
1. Phase: Rückbesinnung = Loslösung aus bisheriger Gruppe<br />
• Die Mitglie<strong>der</strong> erhalten Papier <strong>und</strong> Stift, um eine „Patchwork-Rede“ vorzubereiten. Impuls:<br />
Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit denke, dann erinnere ich mich (gerne) an …<br />
• Die Mitglie<strong>der</strong> formieren sich zum Kreis. Reihum werden nun die Erinnerungen vorgetragen.<br />
So entsteht eine gemeinsame Abschlussrede. Eine gemeinsame Verbeugung als<br />
Dankeschön für das bisherige Vertrauen schließt die Rede.<br />
• Die einzelnen Gruppenmitglie<strong>der</strong> gestalten nun als Vorbereitung auf das Zusammentreffen<br />
mit <strong>der</strong> unbekannten Gruppe eine Art „Steckbrief“, <strong>der</strong> Persönliches in Stichworten <strong>und</strong><br />
Symbolen festhält. Die möglichen Stichworte <strong>und</strong> Fragen des Steckbriefes werden in <strong>der</strong><br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
218
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gruppe ausgewählt. Beispiele: Mein Symbol o<strong>der</strong> mein Lebensmotto …, beson<strong>der</strong>e Interessen,<br />
was ich nicht mag …, eine wichtige Erfahrung für meine Hospizarbeit usw.<br />
2. Phase = Höhepunkt<br />
• Die Gruppen gehen mit ihrer noch brennenden Gruppenkerze in einen neuen Raum (o<strong>der</strong><br />
die „jüngere Gruppe“ geht zur „älteren Gruppe“). Mit dem Feuer <strong>der</strong> beiden Gruppenkerzen<br />
wird die neue Kerze entzündet.<br />
• Die alten Gruppenkerzen werden mit vereinten Kräften ausgepustet.<br />
• Die beiden Gruppen bilden nun einen gemischten Kreis.<br />
• Vorstellungsr<strong>und</strong>e mit Hilfe <strong>der</strong> Steckbriefe<br />
• Gemeinsames Anstoßen mit Saft/Sekt auf die zukünftige Arbeit<br />
• Variante: Die Teilnehmer können jeweils ein farbiges Tuch auswählen, das künftig Ihnen gehört (= tragendes<br />
Symbol für Verbindung, Schutz „Pallium“). An einem Holzreifen knoten nacheinan<strong>der</strong> die Teilnehmer ihr Tuch<br />
fest <strong>und</strong> sprechen dabei jeweils einen Wunsch für die zukünftige Zusammenarbeit aus. Es entsteht aus den<br />
einzelnen Tüchern eine farbiges „Sonnenrad“. Dieses kleine Ritual kann auch zukünftig bei Teamtreffen für die<br />
Einstiegsr<strong>und</strong>e praktiziert werden, evtl. mit einem Impuls zum Ankommen (Wie bin ich heute da?)<br />
• Variante: Die Teilnehmer können jeweils einen Stein aussuchen <strong>und</strong> ihn mit ihrem Amen beschriften. Die Steine<br />
werden in <strong>der</strong> Mitte zu einer Gestalt (Kreis, Spirale o. a.) formiert. Bei diesem Akt werden Wünsche zur<br />
künftigen Hospizarbeit formuliert. Der Steine werden am Ende des Treffens in einen Korb o<strong>der</strong> in eine Schale<br />
gelegt. Sie können bei künftigen Teamtreffen für den Auftakt genutzt werden. Beispiel: Wer ein beson<strong>der</strong>es Anliegen<br />
beim Treffen hat, setzt seinen Stein ins Zentrum.<br />
3. Phase = Neuanbindung<br />
• Für die Teilnehmer bleibt Zeit zum Plau<strong>der</strong>n<br />
• Organisatorisches kann besprochen werden<br />
• Gemeinsamer Kreistanz zum Abschluss<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
219
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Literatur zum Thema Rituale<br />
ALSHEIMER M., Aktionsform Ritual. In: ALSHEIMER M, MÜLLER U, PAPENKORT U.: Spielend Kurse planen. Die<br />
Methodenkartothek (nicht nur) für die Erwachsenenbildung. Lexika Verlag, <strong>München</strong> 1996<br />
ALSHEIMER M., STICH V.: Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen. Sterbebegleitung im ambulanten Bereich. Ein Pilot-<br />
Projekt <strong>der</strong> kath.-evang. Sozialstation Füssen <strong>und</strong> des Hospizvereins Ostallgäu. Bayerische Stiftung Hospiz, Bayreuth<br />
2005 (www.bayerische-stiftung-hospiz.de)<br />
BARTOSCH H.: Rituale. In: LILIE, U.; ZWIERLEIN, E. (Hg.): Handbuch integrierte Sterbebegleitung. Gütersloher<br />
Verlagshaus Gütersloh 2004, 115-122<br />
BARTOSCH H.: Rituale an <strong>der</strong> Lebenssschwelle – Das Florence-Nightingale-Krankenhaus <strong>und</strong> seine palliativen Rituale.<br />
In: BARTOSCH H., COENEN-MARX C., ERCKENBRECHT J. F., HELLER A. (Hrsg.): Leben ist kostbar. Der<br />
Palliative Care- <strong>und</strong> Ethikprozess in <strong>der</strong> Kaiserswerther Diakonie. Lambertus Freiburg im Br. 2005, 84-99<br />
BASLÉ B., MAAR N.: Alte Rituale – neue Rituale. Geborgenheit <strong>und</strong> Halt im Familienalltag. Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg,<br />
Basel Wien 1999<br />
BAYER H. J.: „Wie lange ist eigentlich nie mehr?“ Den Alltag menschlich gestalten – neue Rituale entwickeln. In:<br />
SMEDING RM. E: W., HEITKÖNIG-WILP, M. (Hrsg.): Trauer erschließen. Eine Tafel <strong>der</strong> Gezeiten. Hospiz-Verlag,<br />
Wuppertal 2005: 181-187<br />
BELLIGER A., KRIEGER D. J. (Hrsg.): Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch. Westdeutscher Verlag, Opladen<br />
2003<br />
BICKEL L., TAUSCH-FLAMMER D. (Hrsg): In meinem Herzen die Trauer. Her<strong>der</strong>, Freiburg, Basel, Wien 1998<br />
BLIERSBACH G.: Rituale. Was das Leben zusammenhält. Psychologie heute. 31 (4) 2004: 28-31<br />
BRATHUHN S., DROLSHAGEN CH.: Manchmal wir ein Wort zum Zeichen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh<br />
2005<br />
CANACAKIS J.: Ich sehe deine Tränen. Trauern, Klagen, Leben können. Kreuz Verlag, Stuttgart 1987<br />
DIAKONIE IN DÜSSELDORF (Hrsg.): Rituale. Segnen – Aufbahren – Verabschieden (Broschüre für Rituale im Altenheim)<br />
1999. Bestelladresse: Evangelischer Gemeindedienst, Abteilung Leben im Alter. Langerstraße 20 a,<br />
40233 Düsseldorf<br />
FISCHEDICK H.: Die Kraft <strong>der</strong> Rituale. Lebensübergänge bewusst erleben <strong>und</strong> gestalten. Kreuz Verlag, Stuttgart<br />
2004<br />
FLAMMER A.: Brauchen wir wie<strong>der</strong> Übergangsrituale? Psychologie heute. 31 (4) 2004: 28-31<br />
GROSSE-KOCK H.-J.: Glauben gestalten. Vincentz Verlag, Hannover 1992<br />
IMBER-BLACK E.: Rituale <strong>und</strong> Geheimnisse, Geheimnisse <strong>und</strong> Rituale. In: WELTER-ENDERLIN R.,<br />
HILDENBRAND B. (Hrsg.): Rituale. Vielfalt in Alltag <strong>und</strong> Therapie. Carl-Auer, Heidelberg 2002, 78 ff.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
220
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
KAST V.: Sich einlassen <strong>und</strong> loslassen. Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg 1994<br />
LAMP I, KÜPPER-POPP, K: Abschied nehmen am Totenbett. Rituale <strong>und</strong> Hilfen für die Praxis. Gütersloher Verlagshaus,<br />
Gütersloh 2006<br />
LANDER H.-M., ZOHNER M.-R.: Trauer <strong>und</strong> Abschied. Ritual <strong>und</strong> Tanz für die Arbeit mit Gruppen. Matthias-<br />
Grünewald-Verlag, Mainz 1992<br />
LILIE U.: Zur Seelsorge an Sterbenden. Die innere Haltung des seelsorgers in <strong>der</strong> Sterbebegleitung ist entscheidend.<br />
In: LILIE U., ZWIERLEIN E. (Hrsg.): Handbuch Integrierte Sterbebegleitung. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh<br />
2004, 82-87<br />
OTTERSTEDT C.: Rituale bei Abschied – Stützungen <strong>der</strong> Seele. In: BURGHEIM W. (Hrsg.): Qualifizierte Begleitung<br />
von Trauernden <strong>und</strong> Sterbenden. Medizinische, rechtliche, psycho-soziale <strong>und</strong> spirituelle Hilfestellungen. Bd.<br />
2, Kap. 4.10, Forum Verlag, Merching 2005, 1-28<br />
REFERAT SCHULPASTORAL DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART (Hrsg.): Erprobte Rituale <strong>und</strong> Methoden<br />
zum Umgang mit Tod <strong>und</strong> Trauer in <strong>der</strong> Schule 2005 (http://schulpastoral.drs.de/Methoden<strong>und</strong>Ritual.pdf)<br />
RESSEL H.: Rituale für den Alltag. Warum wir sie brauchen – wie sie das Leben erleichtern. Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg,<br />
Basel Wien 1998<br />
SCHÜTZENDORF E. (2006): Wer pflegt, muss sich pflegen. Prävention <strong>und</strong> Burnout in <strong>der</strong> Altenpflege. Springer<br />
Verlag, Berlin 2006<br />
STUTZ P.: 50 Rituale für die Seele. Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg im Br. 2003<br />
VAN GENNEP A.: Übergangsriten. Rites des Passages. Campus Verlag, Frankfurt a. M. 2005<br />
VON WELTZIEN D.: Die Welt <strong>der</strong> Rituale. Goldmann, <strong>München</strong> 1994<br />
VON WELTZIEN D.: Praxisbuch <strong>der</strong> Rituale. Goldmann, <strong>München</strong> 1997<br />
WINTER F.: Sind traditionelle Übergangsrituale <strong>der</strong> Kirchen heute noch hilfreich? In: BAUER-MEHREN R., KOPP-<br />
BREINLINGER K., RECHENBERG-WINTER P. (Hrsg.): Kaleidoskop <strong>der</strong> Trauer. Ro<strong>der</strong>er Verlag, Regensburg<br />
2003, 114-120<br />
ZIRFAS J.: Vom Zauber <strong>der</strong> Rituale. Der Alltag <strong>und</strong> seine Regeln. Reclam, Leipzig 2004<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
221
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Internetadressen zum Thema Rituale<br />
www.trauerherbege.de<br />
Ein Internetportal <strong>der</strong> Katholischen Erwachsenenbildung <strong>der</strong> Diözese Trier mit Texten <strong>und</strong> Musikhinweisen. Es bietet<br />
aber vor allem Online-Trauerseminare (über Passwortgeschützte „Seminarräume“), öffentliche Chats für Trauernde<br />
<strong>und</strong> virtuelle Rituale an (z. B. Trauerbrief schreiben, Blumen pflanzen usw.).<br />
www.portal-<strong>der</strong>-erinnerung.de<br />
Ein Internetportal <strong>der</strong> Katholischen Erwachsenenbildung <strong>der</strong> Diözese Trier mit Texten <strong>und</strong> Musikhinweisen.<br />
www.aphorismen.de<br />
Die Datei umfasst 100 000 Aphorismen, Gedichte. Über ein Stichwortregister lassen sich die Texte schnell aufblättern.<br />
Medien<br />
WOISIN M.-G.: Tanzbil<strong>der</strong> des Weges (mit Begleit-CD). Metanoia Verlag, Kindhausen o. J. (Bestelladresse:<br />
www.metanoia-verlag.ch)<br />
WOISIN M.-G.: Tanzsymbole in Bewegung (mit Begleit-CD <strong>der</strong> Musikgruppe Wibazzi) Metanoia Verlag, Kindhausen<br />
o. J. (Bestelladresse: www.metanoia-verlag.ch)<br />
Ritual- <strong>und</strong> Textsammlungen<br />
ALLERT-WYBRANIETZ K.: Trotz alledem. Verschenktexte. 20. Auflage, Kreuz Verlag, Stuttgart 1984<br />
APFEL W.: Die schönsten Zitate <strong>und</strong> Weisheiten <strong>der</strong> Welt. Capitol Verlag, Weinheim o. J.<br />
BERGER-ZELL C.: Gedenkgottesdienst für Verstorbene am Ewigkeitssonntag 2005<br />
(http://www.trauernetzt.de/trauernetz/trauernetz-neu-be-uns_734.htm)<br />
BICKEL L., TAUSCH-FLAMMER D. (Hrsg.): Ich möchte dich begleiten. Texte von Abschied <strong>und</strong> Hoffnung. Her<strong>der</strong><br />
Verlag, Freiburg im Br. 1999<br />
BICKEL L., TAUSCH-FLAMMER D.: In meinem Herzen die Trauer. Texte für schwere St<strong>und</strong>en. Her<strong>der</strong> Verlag,<br />
Freiburg im Br. 2003<br />
BICKEL L., TAUSCH-FLAMMER D.: Je<strong>der</strong> Tag ist kostbar. Endlichkeit erfahren – intensiver leben. Her<strong>der</strong> Verlag,<br />
Freiburg im Br. 2006<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
222
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
BRENNI P.: Beerdigungsgottesdienste <strong>und</strong> Gedächtnisfeiern. Rex Verlag, Luzern, Stuttgart, 1998<br />
DIRSCHAUER K.: Worte zur Trauer. 2. Auflage, Claudius Verlag, <strong>München</strong> 2005<br />
ENZNER-PROPST B.: Heimkommen. Segensworte, Gebete <strong>und</strong> Rituale für die Kranken- <strong>und</strong> Sterbebegleitung.<br />
Claudius Verlag, <strong>München</strong> 2005<br />
FREINTHALER A.: Abschiedsrituale. Abschieds-, Trauer- <strong>und</strong> Gedenkfeiern. 5. Auflage, Pastoralamt Linz, Linz<br />
2005 (Bestelladresse: www.behelfsdienst.at)<br />
HAARHAUS F.: Jetzt <strong>und</strong> in <strong>der</strong> St<strong>und</strong>e unseres Todes. Gebete, Meditationen <strong>und</strong> Segensfeiern. Echter Verlag,<br />
Würzburg 2001<br />
HARENBERG B.: Harenberg Lexikon <strong>der</strong> Sprichwörter <strong>und</strong> Zitate. Harenberg Kommunikation Verlags- <strong>und</strong> Medien<br />
GmbH & Co.KG, Dortm<strong>und</strong> 1997<br />
LAUDERT-RUHM G., OBERNDÖRFER S.: … <strong>und</strong> das Leben bekommt mich zurück. Kreuz Verlag, Stuttgart 2005<br />
LÖDEL R.: Seelsorge in <strong>der</strong> Altenhilfe. Ein Praxisbuch. Patmos Verlag, Düsseldorf 2003<br />
MULTHAUPT H.: Mögen Gottes Engel immer an deiner Seite sein. Irische Segenswünsche für Zeiten <strong>der</strong> Trauer.<br />
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006<br />
MUNTANJOHL F.: Ich will euch tragen bis zum Alter hin. Gottesdienste, Rituale <strong>und</strong> Besuche im Pflegeheimen.<br />
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005<br />
SCHUPPER F.: Wir bleiben, wenn du gehst. Gebete, Lesungen <strong>und</strong> Lie<strong>der</strong> am Sterbebett. Gütersloher Verlagshaus,<br />
Gütersloh 2004<br />
SCHWIKART G.: Die richtigen Worte im Trauerfall – Textbeispiele <strong>und</strong> Formulierungshilfen. Butzon <strong>und</strong> Bercker,<br />
Kevelaer 1998<br />
SCHWIKART G.: Wun<strong>der</strong>bar geborgen. Trauerfeiern <strong>und</strong> Beerdigungsansprachen mit Texten von Dietrich Bonhoeffer.<br />
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005 a<br />
SCHWIKART G. (Hrsg.): Von Tag zu Tag. Ein Begleiter durch das Trauerjahr. Kreuz Verlag, Stuttgart 2005 b<br />
TWER K.-J.: „Ich kann es noch nicht fassen …“ Begleitung <strong>und</strong> Betreuung von Trauernden in <strong>der</strong> Gemeindearbeit.<br />
Mit praktischen Modellen von Trauerabenden <strong>und</strong> Beispielen für Seelsorgegespräche. Gütersloher Verlagshaus,<br />
Gütersloh 2003<br />
STUTZ P.: Gottesdienst feiern mit Trauernden. Neue Modelle. Rex Verlag, Luzern, Stuttgart 1998<br />
VOSS-EISER M.: „Noch einmal sprechen von <strong>der</strong> Wärme des Lebens …“ Texte aus <strong>der</strong> Erfahrung von Trauernden.<br />
Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg im Br. 1999<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
223
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
224
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard / Ritual<br />
Die Krankensalbung feiern<br />
Erläuterungen zu Ablauf <strong>und</strong> Sinngehalt<br />
Einleitung<br />
Die Krankensalbung ist eines <strong>der</strong> Sakramente <strong>der</strong> katholischen Kirche. Früher wurde sie „letzte<br />
Ölung“ genannt; seit dem II. Vatikanischen Konzil (1962 - 1965) hat sich das Verständnis<br />
geän<strong>der</strong>t: Die Krankensalbung soll Menschen für die Herausfor<strong>der</strong>ungen ihrer Erkrankungen<br />
stärken (Große-Kock 1992, 65 ff.). Der Ablauf einer Krankensalbung wird in <strong>der</strong> folgenden Beschreibung<br />
mit Hilfe <strong>der</strong> Ritualphasen geglie<strong>der</strong>t.<br />
Durchführung<br />
Verantwortlich: Priester; Pflegekräfte können bei <strong>der</strong> Vorbereitung unterstützen <strong>und</strong> „assistieren“.<br />
Vorbereitung/Rahmen/Beteiligte<br />
• Tisch mit Blumen, einem Palmzweig, einer Kerze, einem Kreuz, einer Schale mit Weihwasser,<br />
etwas Watte zum Eintauchen in das Öl (geweihtes Olivenöl), Salz zum Zeichen<br />
<strong>der</strong> Stärkung. Anregung: Die notwendigen Symbole sollten in <strong>der</strong> Institution schnell verfügbar<br />
sein (z. B. Utensilien in einem Ritual-Koffer).<br />
• Der Priester bringt das Salböl mit (= tragendes Symbol).<br />
• Nach Möglichkeit, die Angehörigen vorher einladen. Die Krankensalbung ist eine Feier <strong>der</strong><br />
Gemeinschaft. Es können sich vorab Fürbitten für den Kranken überlegt werden.<br />
Der Kranke soll dem Ritual folgen können; nur in Ausnahmen wird das Ritual Bewusstlosen<br />
gespendet.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
225
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Eröffnung<br />
• Der Priester betritt den Raum <strong>und</strong> begrüßt die Anwesenden mit dem Friedensgruß.<br />
• Er segnet den Kranken <strong>und</strong> das Zimmer mit Weihwasser <strong>und</strong> erläutert den Sinn <strong>der</strong> Salbung.<br />
1. Phase: Rückbesinnung = Loslösung<br />
• Der Kranke hat die Möglichkeit <strong>der</strong> Beichte. Die an<strong>der</strong>en Anwesenden verlassen in dieser<br />
Zeit den Raum<br />
• Wenn <strong>kein</strong>e Beichte abgelegt wird, sprechen alle ein gemeinsames Schuldbekenntnis.<br />
• Einer <strong>der</strong> Angehörigen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Priester liest einen passenden Text aus <strong>der</strong> Bibel vor (z.<br />
B. Mt 8, 5 – 10, 13: Heilung des Dieners des Hauptmanns von Kafarnaum)<br />
2. Höhepunkt = Übergang, Verwandlung<br />
• Für den Kranken werden Fürbitten gesprochen.<br />
• Der Priester legt dem Kranken schweigend die Hände auf.<br />
• Der Priester salbt den Kranken mit <strong>der</strong> ölgetränkten Watte durch ein Kreuzzeichen auf<br />
Stirn <strong>und</strong> Hände. Dazu spricht er Segensworte <strong>und</strong> ein Gebet für den Kranken. „Durch<br />
diese heilige Salbung helfe dir <strong>der</strong> Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit<br />
<strong>der</strong> Kraft des Heiligen Geistes: Der Herr, <strong>der</strong> dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner<br />
Gnade richte er dich auf."<br />
• Eventuelle Erweiterung (gehört nicht zur offiziellen Liturgie): Angehörige salben den Kranken<br />
an den Stellen, wo sie ihm „Kraft <strong>und</strong> Heilung“ wünschen.<br />
3. Phase = Neuanbindung<br />
• Alle Anwesenden sprechen das Vaterunser<br />
• Alle haben nun die Möglichkeit, die Kommunion zu empfangen.<br />
Abschluss<br />
Die Feier endet mit dem Schlusssegen.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
226
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiele / Konzept / Empfehlungen<br />
Abschiedräume gestalten<br />
Empfehlungen für Ort <strong>und</strong> Interieur<br />
Einführung<br />
„Unser Aufbewahrungsraum, äh … ich meine: Aufbahrungsraum liegt im Keller …“ Dieser<br />
Versprecher von Pflegekräften ist bezeichnend <strong>und</strong> treffend. Viele <strong>der</strong> Räume in Kliniken <strong>und</strong><br />
Pflegeheimen für die Toten sind hässliche Kammern. Steril. Kalt. Gekachelt. Dunkel. Die Toten<br />
leiden nicht darunter, aber die Lebenden. „In diesen Räumen kann man nicht Abschied<br />
nehmen, da möchte man nur schnell weg!“, urteilt <strong>der</strong> Bestatter Fritz Roth (GARHAMMER<br />
2004: 322). Wie werden die Aufbahrungsräume vor Ort erlebt? In welchen Räumen würde ich<br />
mir eine letzte Begegnung mit einem geliebten Angehörigen zutrauen? Welche Deutungsangebote<br />
für Leben <strong>und</strong> Tod könnten vor Ort hilfreich sein? (siehe dazu: HOLZSCHUH 2004;<br />
www.puetz-roth.de)<br />
Beispiele<br />
Ein trostloser Gang zu einem typischen Aufb(ew)ahrungsraum<br />
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen lieben Menschen verloren. Ich nehme Sie nun mit auf den schweren Gang<br />
zum Aufbahrungsraum <strong>der</strong> Einrichtung, in <strong>der</strong> er gestorben ist. Sie sind nicht schnell genug gekommen, zu spät jedenfalls<br />
für die Verabschiedung im Zimmer. Der Verstorbene wurde bereits in den Aufbahrungsraum gebracht. Wir<br />
müssen – wie so oft bei Abschiedsräumen – in den Keller. Über uns verlaufen unverputzte Kabelstränge <strong>und</strong> ein<br />
Gewirr von Rohren. Rechts wummert die Heizung hinter einer schweren Tür. Für Unbefugte verboten. Wir schieben<br />
uns nun an ausrangierten Bettgestellen vorbei <strong>und</strong> biegen in einen Gang ein. Es riecht etwas süßlich. Der Abfallschacht<br />
endet ganz in <strong>der</strong> Nähe. Verrenkte Stehlampen warten vor uns auf Reparatur, zwei verkratzte Rollstühle,<br />
Kabeltrommeln <strong>und</strong> ein farbbespritzter Rollwagen mit allerlei Werkzeug stehen vor einen Raum: die Werkstatt des<br />
Hausmeisters. Zehn Meter weiter stoppen wir vor einer Metalltür. Abschiedsraum steht auf einem Schild. Wir<br />
schließen auf. Die Kälte steht im dunklen Raum wie eine Wand. Zunächst tasten wir nach dem Schalter für die Beleuchtung.<br />
Kaltes Neonlicht bestrahlt hart den Raum. Hinter <strong>der</strong> Bahre hängt ein schweres dunkles Kreuz. Auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite <strong>der</strong> Kammer hat jemand einen Kunstdruck mit Heftstreifen angeklebt im Versuch, den Raum zu verschönern<br />
– ein Engelbild im Nazarener Stil. Der obere Rand ist schon etwas eingerissen, ein Wasserfleck verzieht<br />
den Kopf des Engels ins Unförmige. Hinter einem Vorhang in düsterem Violett ist ein Waschbecken versteckt. Zwei<br />
Rohrstühle sind in einer Ecke gestapelt. Auf einer Konsole stehen ein zweiarmiger elektrischer Kerzenleuchter <strong>und</strong><br />
eine verstaubte Plastik-Topfblume. Der Fußboden <strong>und</strong> die untere Hälfte <strong>der</strong> Wände sind gekachelt. Ein Abfluss ist<br />
in den Boden eingelassen. Der Raum ist so klein, dass Sie zurückweichen, weil nur wenig Platz zwischen Bahre<br />
<strong>und</strong> Wänden ist. Der Verstorbene ist gänzlich abgedeckt mit einem weißen Laken. Die Konturen sind durch das<br />
Tuch hindurch gut erkennbar…<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
227
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ein Gegenbild: Ein Ort für trostreiche Trauer - Konzept eines Aufbahrungsraumes<br />
An den Räumlichkeiten des Abschiedszimmers kommt man täglich vorbei. Sie liegen nämlich leicht zugänglich im<br />
ersten Stock am Ende eines belebten Ganges, <strong>der</strong> allerdings auch über ein separates Treppenhaus betreten bzw.<br />
verlassen werden kann. Unkompliziert kommt man über dieses Treppenhaus in den Garten, falls man frische Luft<br />
<strong>und</strong> etwas Ruhe für sich braucht. Mit großen Pflanzen <strong>und</strong> einem Teppich wurde auf dem breiten Gang eine geschützte<br />
Zone abgegrenzt. Die vorhandene Architektur zwang zu Kompromissen. Ursprünglich lag <strong>der</strong> Aufbahrungsraum<br />
im Keller. Ein Stoffsofa <strong>und</strong> zwei farblich dazu passende Sessel sind auf dem Teppich zu einer Sitzgruppe<br />
arrangiert. Auf einem Tischchen kann man Kaffee abstellen.<br />
Die Tür aus hellem Holz kann weit geöffnet werden. Dadurch ist es auch möglich, dass eine größere Gemeinde<br />
sich am Ritual <strong>der</strong> Aussegnung beteiligen kann (außerdem erleichtert dies die Überführung ohne „Akrobatik“ mit<br />
dem Sarg). Neben <strong>der</strong> Tür steht auf einer Tafel „Abschiedsraum – Oase <strong>der</strong> Trauer“. Darüber ist in einen Wechselrahmen<br />
ein Bild des Verstorbenen mit seinen Lebensdaten eingelegt worden.<br />
Der fast quadratische Raum hinter <strong>der</strong> Tür ist so groß, dass man Abstand zur Bahre des Verstorbenen halten kann,<br />
sofern man dies wünscht. Tageslicht o<strong>der</strong> warmes gedämpftes Gelblicht erfüllt den Raum. Er ist schlicht, wirkt nicht<br />
überfüllt <strong>und</strong> ist wohnlich. Durch zwei große Fenster geht <strong>der</strong> Blick auf Bäume <strong>und</strong> den Himmel. In den ersten<br />
Stock kann von außen niemand neugierig hineinschauen. Der Verstorbene ist vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.<br />
Die Fensterflügel können geöffnet werden. Für die Sommerzeit ist prophylaktisch ein Fliegengitter angebracht.<br />
Durch einen kreisr<strong>und</strong>en Obergaden fällt indirektes Licht. Wenn die Vorhänge an den großen Zimmerfenstern<br />
etwas zugezogen werden, flutet eine Lichtbahn deutlich durch diesen Lichtgaden von oben auf den Körper des<br />
Toten. Die Bahre ist von drei Seiten her zugänglich. Bequeme Holzstühle stehen bereit. In einer Ecke ist eine Sesselgruppe<br />
zum Verweilen. Die Farbwahl ist warm. Das Wandbild gegenüber dem Toten ist von einer örtlichen<br />
Künstlerin gestaltet worden. Es ist ein Triptychon, das wie die gesamte Umgestaltung des Raumes von einem<br />
Wohltätigkeitsclub am Ort gesponsert wurde. An einer an<strong>der</strong>en Wand sind einige Gebete <strong>und</strong> Gedichte gut lesbar<br />
in Rahmen aufgehängt. Sie laden zum Lesen ein. Vielleicht mag jemand eines dieser Gebete o<strong>der</strong> einen jener Texte<br />
sprechen, weil es o<strong>der</strong> er ihm in <strong>der</strong> Situation etwas bedeutet. Diese <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Texte sind auch zusammen mit<br />
Motivkarten in einer flachen Holzschale ausgebreitet. Es darf etwas zur Erinnerung mitgenommen werden, ermuntert<br />
eine kleine Standtafel in <strong>der</strong> Schale. Ein CD-Player mit integriertem Kassettenrekor<strong>der</strong> steht auf einem schlichten<br />
Holzkubus, falls Angehörige Musik hören wollen, die <strong>der</strong> Tote gemocht hat, o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> kleinen Sammlung<br />
von CDs etwas auswählen wollen. Ein Telefon ermöglicht den schnellen Kontakt zur Verwaltung o<strong>der</strong> zum Dienstzimmer<br />
des Pflegepersonals. Auch eine (Sofortbild-)Kamera gehört zur Ausstattung, die die zuständige Pflegekraft<br />
den Angehörigen anbieten kann. Aus einem schlichten Brunnen rinnt Wasser mit leisem Plätschern <strong>und</strong> erinnert an<br />
Leben. Unterschiedliche Kerzen (die nach Hause mitgenommen werden dürfen) <strong>und</strong> Streichhölzer sind vorhanden,<br />
ebenso religiöse Devotionalien wie Kreuz, Engelfiguren, Weihwasserbehälter. Schreibmaterial liegt bereit.<br />
Neben <strong>der</strong> Bahre ist ein Holztisch, auf dem Blumen <strong>und</strong> Gegenstände des Toten arrangiert werden können. Der<br />
Verstorbene selbst ist nur bis zum hoch gelagerten Oberkörper mit einem rostroten, leichten Tuch abgedeckt. Angehörige<br />
haben bereits bei ihrem ersten Besuch am Vormittag einige persönlich mitgebrachte bzw. aus dem F<strong>und</strong>us<br />
gewählte Symbole auf die Decke gelegt …<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
228
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Leitlinien für die Gestaltung von Aufbahrungsräumen<br />
• Keinen abgelegenen, „unbekannten“ Ort wählen!<br />
• Auch <strong>der</strong> Weg zu den Räumlichkeiten ist wichtig für die letzten Eindrücke <strong>der</strong> Angehörigen<br />
(Sieht die Umgebung des Raumes nach Entsorgung o<strong>der</strong> Umsorgung <strong>der</strong> Toten aus?).<br />
• Ein leichter <strong>und</strong> separater Zugang ins Freie lässt Erholung zu <strong>und</strong> schützt vor neugierigen<br />
Blicken.<br />
• Ein Vorraum o<strong>der</strong> eine geschützte Zone mit bequemer Sitzgelegenheit gibt den Angehörigen<br />
Gelegenheit, sich vor <strong>der</strong> Begegnung zu sammeln.<br />
• Der Raum ist für verschiedene Rituale in größerer Gemeinschaft erweiterbar.<br />
• Für islamischen Totenkult kann die Bahre nach Osten ausgerichtet werden. In einem Nebenraum<br />
ist ein großer Steintisch mit fließendem Wasser für die Totenwaschung.<br />
• Die Raumgröße soll individuell notwendigen Abstand zum Toten erlauben.<br />
• Symbolisches (Gedichte, Gebete, Gegenstände) soll Deutungen für Tod <strong>und</strong> Leben ermöglichen.<br />
• Unterschiedliche Medien laden zur Gestaltung <strong>und</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung ein (Fotografieren,<br />
Schreiben, Beigaben aufsuchen usw.).<br />
• Die gewählte Farbgestaltung strahlt Wärme <strong>und</strong> Geborgenheit aus.<br />
• „Warme“ Materialien werden verwendet.<br />
• Schlichtes, nicht ablenkendes Interieur lässt die Zentrierung <strong>der</strong> Aufmerksamkeit auf den<br />
Verstorbenen zu.<br />
• Bequeme Stühle erlauben längeres Sitzen (Sitzwache).<br />
• Körpernahe Kühlung <strong>der</strong> Toten erlaubt angenehme Raumtemperatur für die Lebenden.<br />
• Ein bereitgestelltes Telefon ermöglicht schnellen Kontakt mit Pflegekräften o<strong>der</strong> Verwaltung.<br />
(Siehe dazu: HOLZSCHUH 2004, 2006)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
229
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
230
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Material<br />
Trauerkorb zusammenstellen<br />
Ideen für Symbole <strong>und</strong> praktische Hilfen beim Abschied<br />
• Kreuz in verschieden Varianten (figürlich, abstrakt)<br />
• Engelfiguren<br />
• Marienstatue<br />
• Kerzen in unterschiedlichen Formen, Farben, Größen <strong>und</strong> Stärken (auch als Erinnerung<br />
zum Mitnehmen gedacht)<br />
• Kerzenhalter, Gläser<br />
• lange Streichhölzer<br />
• Symbole (z. B. Fe<strong>der</strong>n, Blumenzwiebeln, Getreidekörner, Blätter, Baumscheibe mit Jahresringen,<br />
Papierschmetterlinge)<br />
• Verschiedene Schälchen <strong>und</strong> Vasen, um Blumen <strong>und</strong> Symbole zu fassen<br />
• Weihwasser<br />
• Sand für Kerzenschale<br />
• Briefpapier, Kuverts, Stifte<br />
• Zeichenpapier, Pastellkreiden (z. B. als Angebot für Kin<strong>der</strong>, etwas für den Verstorbenen zu<br />
malen)<br />
• Karten mit Bil<strong>der</strong>n von Wegen, Türen, Stufen, Händen, Engeln, Regenbogen, Lichtern,<br />
weiten Landschaften, Sonnenuntergängen, Segelbooten, Meer usw.) (Karten z. B. bei Verlag<br />
am Eschbach o<strong>der</strong> www.bestattungsinstitut.de/card.html)<br />
• Textkarten zum Aussuchen, Vorlesen <strong>und</strong> Aufstellen (auch als Erinnerung zum Mitnehmen)<br />
(Textsammlungen z. B. bei BICKEL, TAUSCH-FLAMMER 1998, 1999;<br />
FREINTHALER 2003; GÄBE 2001; HANGLBERGER 2004; NEYSTERS, SCHMITT 2004;<br />
HAARHAUS 2001; LAMP, KÜPPER-POPP 2006; SCHWICKART 2001)<br />
• farbige Tücher für Gestaltung des Nachtkästchens<br />
• Körperöl zum Salben des Verstorbenen<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
231
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Bücher <strong>und</strong> Materialempfehlungen 1<br />
Evangelisches Gesangbuch Ausgabe für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Großdruckausgabe.<br />
1<br />
Die Buchempfehlungen <strong>und</strong> Materialliste wurden übernommen von <strong>der</strong> Evang. Heimstiftung Stuttgart, Dr.<br />
Mäule<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Gesangbuchverlag Stuttgart GmbH<br />
ISBN 931895-06-8<br />
Zeit zu leben – Zeit zu sterben Preis €21,00 (bei <strong>der</strong> HV zu bestellen)<br />
Du bist mir täglich nahe. Sterben, Tod, Bestattung,<br />
Trauer. Eine evang, Handreichung<br />
für Menschen, die trauern <strong>und</strong> für<br />
die, die sie in ihrer Trauer begleiten<br />
Ich geb` dir einen Engel mit… Erfahrungen<br />
mit einem Symbol.<br />
+ 1 Bronzeengel<br />
Typisch! Kleine Geschichten für an<strong>der</strong>e<br />
Zeiten.<br />
V. Kast (Hg.), Diese vorüberrauschende<br />
blaue einzige Welt<br />
Schutzgebühr € 1,00. Zu bestellen über Vereinigte, Ev. Luth. Kirche<br />
Deutsch-lands, Email: zentrale@velkd.de, www.velkd.de<br />
Alleinvertrieb: An<strong>der</strong>e Zeiten e.V., Hamburg; Preis: € 16,50, Email:<br />
vertrieb@an<strong>der</strong>ezeiten.de, www.an<strong>der</strong>ezeiten.de<br />
s.o. (An<strong>der</strong>e Zeiten), Preis € 6,00<br />
Pendo-Verlag Zürich, Preis € 12,90,<br />
ISBN 3-85842-545-1<br />
J. Bauer, Opas Engel Carlsen-Verlag Hamburg, Preis € 11,00<br />
Utensilien<br />
ISBN 3-551-51543-3<br />
32 Karten „Was bleibt, ist die Liebe Verlag am Eschbach, ISBN 978-3-88671-742-2, Preis € 14,90<br />
Aussegnung Verstorbener Handreichungen zur Gestaltung (aus Württemberg, Baden, Hannover)<br />
Flyer „Abschied nehmen“ bei <strong>der</strong> HV kostenlos zu bestellen<br />
Kunst-Doppelkarten im Format B 6 je € 2,30 im Präsenz-Verlag,<br />
Kerzenstän<strong>der</strong> (Sonne/Mond bzw.<br />
Kreuz/Krippe) <strong>und</strong> Kerze<br />
Email: info@praesenz-verlag.de; www.präsenz-verlag.de<br />
Preis: je € 30,00. Kunsthandwerk Wolfgang & Claudia Burlein<br />
Brühlstr. 6, 73271 Holzmaden<br />
Tel. 07023/72536<br />
Duftlampe mit Kerze <strong>und</strong> Duftöl Preis für Duftlampe: € 14,00.<br />
Tischkreuz (Buchenholz) , Art. „alfa“,<br />
Best.Nr. 108<br />
Rosenkranz (Olivenholz) II, Art. Nr.<br />
R 120190<br />
Kunsthandwerk Burlein (s.o.)<br />
Preis: € 21,25. Bestelladresse:Sinnob-jekte Hamburg,<br />
www.sinnobjekte.de Email: kontakt@sinnobjekte.de;<br />
Preis: 13,99. Email: kontakt@marienfiguren.de<br />
Handkreuz aus Bethlehem (Olivenholz) Preis: € 6,00. Altenwerk <strong>der</strong> <strong>Erzdiözese</strong> Freiburg, Email: altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de<br />
232
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard / Gesprächshilfe<br />
Todesnachricht telefonisch überbringen<br />
Einführung<br />
Die Übermittlung <strong>der</strong> Todesnachricht am Telefon kann für beide Seiten eine beson<strong>der</strong>e<br />
Stresssituation sein. Die Kommunikation ist auf Sprechen <strong>und</strong> Hören eingeschränkt. Die Situation<br />
ist dadurch schwerer kontrollierbar als im direkten Kontakt. Beispiel: Der Angehörige legt<br />
in einer Schockreaktion abrupt auf o<strong>der</strong> fängt an zu schreien. (Die Polizei übermittelt deshalb<br />
bei Unfalltod nie am Telefon, son<strong>der</strong>n sucht den direkten Kontakt, um die Angehörigen emotional<br />
auffangen zu können.) „Wenn Angehörige auf den Tod vorbereitet <strong>und</strong> vielleicht sogar<br />
explizit übers Telefon informiert werden wollen, kann man wohl bedenkenlos anrufen, doch bei<br />
einem plötzlichen Tod kann <strong>der</strong> Überbringer <strong>der</strong> Nachricht die Reaktion <strong>der</strong> (…) Angehörigen<br />
nicht einschätzen.“ 1 Deshalb bedarf es hier beson<strong>der</strong>er Vorüberlegungen <strong>und</strong> Konzentration<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiterin.<br />
Eine Untersuchung <strong>der</strong> Universität Dortm<strong>und</strong>, in <strong>der</strong> 171 Überbringer <strong>der</strong> Hiobsbotschaft (Unfälle)<br />
befragt wurden, zeigt folgendes Spektrum an Reaktionen: 96 traurig, entsetzt, fassungslos<br />
– 36 nüchtern, gefasst, gelassen – 16 ausgesprochen apathisch, lethargisch – 21 wütend,<br />
hysterisch, mit Vorwürfen – 11 konnten die Nachricht nicht begreifen – Ein völliger Zusammenbruch<br />
ist eher selten (Arzt schicken!) 2<br />
1 Übermittlung am Telefon. In: Käsler-Heide, H. (1999): Diagnose: Sterben <strong>und</strong> Tod. Berlin u. a.: Springer Verlag, S. 103<br />
2 Ahrens, C (2001): Todesnachrichten: Mitgefühl zeigen. Deutsches Ärzteblatt 98 (34-35), S. A-2164 f<br />
(www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=28387)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
233
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ziele<br />
• Anteilnahme: Die Angehörige fühlt sich persönlich angesprochen <strong>und</strong> in ihren ersten Reaktionen<br />
verstanden.<br />
• Sicherheit in <strong>der</strong> Kommunikationssituation: Die Mitarbeiterin kann die Situation auf<br />
Seite <strong>der</strong> Angehörigen einschätzen <strong>und</strong> sorgt für Unterstützung <strong>und</strong> Selbstkontrolle <strong>der</strong><br />
Angehörigen.<br />
• Klarheit: Die Angehörige ist informiert über die weiteren Schritte <strong>und</strong> weiß, dass sie Zeit<br />
hat.<br />
• Ermutigung <strong>der</strong> Angehörigen: Die Angehörige fühlt sich ermutigt, in die Einrichtung zu<br />
kommen, um vor Ort für sie passende Möglichkeiten eines Abschieds zu suchen.<br />
Vorbereitung<br />
• Verantwortlich: Die Pflegefachkraft in <strong>der</strong> Schichtleitung / die leitende Pflegefachkraft<br />
• Vereinbarungen in <strong>der</strong> Dokumentation sichten: Die Pflegefachkraft schlägt in <strong>der</strong> Dokumentation<br />
nach, welche Angehörige wie <strong>und</strong> wann über ges<strong>und</strong>heitliche Verän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>und</strong> Todesfall informiert werden wollen.<br />
• Sich Zeit für das Telefonat verschaffen. Prüfen, ob alle notwendigen Daten da sind (Eintrag<br />
in <strong>der</strong> Dokumentation, wer wann informiert werden soll; Adresse, falls es zu den eher<br />
selten heftigen Reaktionen kommt <strong>und</strong> ein Arzt geschickt werden muss.)<br />
Info: Mangelnde Zeit s so eine Dortmun<strong>der</strong> Studie - scheint das größte Problem bei <strong>der</strong> Vermittlung zu sein (Ahrens 2001:<br />
A-2164)<br />
• Einstellen auf Gespräch: Sich innerlich auf das Gespräch vorbereiten, um präsent zu<br />
sein (Kurzentspannung)<br />
• Überraschen<strong>der</strong> Todesfall: Bei einem überraschenden Todesfall gilt es vorab zu überlegen,<br />
ob es eventuell Kontaktpersonen in <strong>der</strong> Nähe gibt (z. B. Seelsorger), die die Nachricht<br />
in <strong>der</strong> Wohnung überbringen können. Falls die Pflegefachkraft die Reaktionen nicht einschätzen<br />
kann, von beson<strong>der</strong>en Risiken weiß o<strong>der</strong> die Angehörige bereits im Vorfeld „außergewöhnliche<br />
Reaktionen“ gezeigt hat, ist für das Telefonat eine Notlüge erlaubt. Beispiel:<br />
„ … Ich muss Ihnen lei<strong>der</strong> sagen, dass es … wesentlich schlechter geht. Ich bitte Sie<br />
deshalb zu kommen. Aber er / sie ist so weit stabil. Aber Sie haben Zeit. Vielleicht ist es<br />
besser ein Taxi zu nehmen …“<br />
Es ist wichtig, diese Notlüge aufzuklären, sobald <strong>der</strong> Angehörige vor Ort ist. Beispiel: „…<br />
Es tut mir furchtbar leid; ich muss Ihnen lei<strong>der</strong> mitteilen, dass Ihr … bereits gestorben war,<br />
als ich Sie anrief, weil ich Angst um Sie hatte, wenn Sie mit dieser Nachricht ganz allein<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
234
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
sind.“ 1 „Ich hoffe, Sie nehmen mir diese Notlüge nicht übel …“<br />
Es ist wichtig, die Notlüge aufzulösen. Sonst verstrickt sich <strong>der</strong> Angehörige vielleicht in<br />
Schuldgefühle, weil er nicht schnell genug gekommen ist, o<strong>der</strong> er macht <strong>der</strong> übermittelnden<br />
Pflegekraft Vorwürfe, nicht früher angerufen zu haben.<br />
Empfehlungen / Regeln für das Überbringen 2<br />
• Identität sicher stellen: „Bin ich verb<strong>und</strong>en mit … Sie sind <strong>der</strong>/die … von Herrn/Frau …“<br />
Ich bin … Sie kennen mich durch …“<br />
• Anteilnahme ausdrücken: „Ich habe lei<strong>der</strong> eine traurige Nachricht für Sie.“<br />
• Ohne Umschweife informieren: „Ihr/Ihre … ist verstorben.“<br />
• Immer wie<strong>der</strong> Zeit zum Reagieren geben<br />
• Auf Fragen eingehen<br />
• Situation vor Ort klären <strong>und</strong> eventuelle Unterstützung ansprechen: „Ist im Moment<br />
noch jemand bei Ihnen?“ „Wen könnten Sie anrufen?“<br />
• Mitgefühl, Verständnis für Reaktion ausdrücken: „Das war für Sie überraschend …“<br />
„Auf diese Nachricht müssen Sie sich erst einstellen …“<br />
• Keine Wertung: Es ist wichtig beim Telefonat (<strong>und</strong> natürlich auch später), die Trauerreaktionen<br />
nicht zu bewerten. Auch scheinbar unterkühlte, nüchterne Antworten („Ich habe <strong>kein</strong>e<br />
Zeit zu kommen; ich muss erst einkaufen …“) können natürliche Schockreaktionen auf<br />
die Ausnahmesituation „Tod eines Angehörigen“ sein.<br />
• Den weiteren Ablauf <strong>und</strong> die Möglichkeiten erläutern: „Ihr Angehöriger kann mindestens<br />
noch …St<strong>und</strong>en im Zimmer bleiben. Der Arzt kommt voraussichtlich um … Wann<br />
können Sie kommen? … Wir werden immer wie<strong>der</strong> zu Ihrem/Ihrer … schauen. Wen wollen<br />
Sie informieren <strong>und</strong> eventuell mitbringen? Alles Weitere können wir hier vor Ort besprechen.“<br />
• Wenn <strong>der</strong> Angehörige ablehnt zu kommen: Bedenkzeit lassen: „Lassen Sie sich es<br />
durch den Kopf gehen … Sie können ja später noch einmal anrufen. Unsere Erfahrung ist:<br />
Vielen Angehörigen waren hinterher eher dankbar <strong>und</strong> erleichtert, noch einmal da gewesen<br />
zu sein.“<br />
• Zeit lassen: „Sie brauchen jetzt nichts überstürzen. Wenn möglich, kommen Sie mit dem<br />
Taxi. Vielleicht kann Sie auch jemand fahren …“<br />
• Darauf hinweisen, wer den Angehörigen vor Ort empfängt o<strong>der</strong> ansprechbar ist: „Ich<br />
bin noch bis … für Sie da <strong>und</strong> würde mich dann um Sie kümmern. Ab … ist dann … hier.<br />
Ich werden sie / ihn informieren.“<br />
1 Käsler-Heide, H. (1999), S. 104<br />
2 Siehe zu den Regeln auch: Lasogga, F. (2001): Psychische erste Hilfe beim Überbringen von Todesnachrichten. Rettungs-<br />
dienst 24 (5), S. 446-450<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
235
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Rückruf-Nummer hinterlassen<br />
• Versichern, ob Gespräch beendet werden kann: „Ist es in Ordnung für Sie, wenn ich<br />
jetzt auflege, o<strong>der</strong> kann ich noch etwas für Sie tun?<br />
Auswertung:<br />
• Die Pflegekraft geht noch einmal das Gespräch gedanklich durch.<br />
• Die Pflegekraft kann – wenn es angemessen erscheint - den Angehörigen zu einem späteren<br />
Zeitpunkt darauf ansprechen, wie er die Art <strong>und</strong> Weise <strong>der</strong> telefonischen Übermittlung<br />
erlebt hat. „Ich habe immer ein bedrückendes Gefühl, wenn ich jemanden benachrichtigen<br />
muss … Wie haben Sie die Art <strong>und</strong> Weise empf<strong>und</strong>en, wie Ihnen <strong>der</strong> Tod Ihres/Ihrer …<br />
beigebracht worden ist?“<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
236
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard<br />
Verstorbene versorgen – Angehörige<br />
unterstützen 1<br />
Spirituelle, pflegerische <strong>und</strong> rechtliche Aspekte<br />
Einführung<br />
„Pflegende betrifft <strong>der</strong> Umgang mit Verstorbenen in beson<strong>der</strong>em Maße. Sie sind meist zum<br />
Zeitpunkt des Todes anwesend, ‚legen letzte Hand am Verstorbenen an’ <strong>und</strong> sind im Kontakt<br />
mit den Angehörigen. Es drängt sich die Frage auf, warum die Berufsgruppe <strong>der</strong> Pflegenden –<br />
trotz dieser beruflichen Nähe – bisher wenig Einfluss genommen hat, um Gestaltungsformen<br />
für die Betreuung <strong>der</strong> Verstorbenen <strong>und</strong> ihrer Angehörigen zu entwickeln.“ (PLENTER,<br />
UHLMANN 2000: 82) Auch Ärzte übersehen, welche Rolle sie mit ihrer beruflichen Autorität in<br />
dieser wichtigen Trauerpassage haben. Manchmal behin<strong>der</strong>n sie den Abschied durch Falschinformation<br />
(WEBER, OCHSMANN, HUBER 1997).<br />
Pflegende sind - neben dem Bestatter <strong>und</strong> eventuell dem Seelsorger <strong>und</strong> dem Arzt - Schlüsselfiguren<br />
o<strong>der</strong> Vorbil<strong>der</strong> für den Umgang mit Verstorbenen. Ihre Aufgabe besteht auch darin,<br />
Fremdes <strong>und</strong> Ungewohntes in dieser Situation für Angehörige zugänglich zu machen.<br />
Ziele<br />
• Achten <strong>der</strong> Würde: Der Umgang mit Verstorbenen wird von allen Beteiligten als würdig<br />
empf<strong>und</strong>en <strong>und</strong> entspricht <strong>der</strong> Persönlichkeit <strong>und</strong> Kultur des Verstorbenen.<br />
• Sicherheit: Die Mitarbeiter fühlen sich sicher im Umgang mit Verstorbenen <strong>und</strong> können<br />
die einzelnen Maßnahmen fachlich <strong>und</strong> persönlich nachvollziehen.<br />
• Abschiednehmen <strong>der</strong> Mitarbeiter: Die Mitarbeiter empfinden Versorgung <strong>und</strong> Aufbahrung<br />
als gute Möglichkeit für den eigenen Abschied <strong>und</strong> können Angehörige entsprechend<br />
ermutigen.<br />
• Achten <strong>der</strong> gesetzlichen Vorgaben: Die gesetzlichen Vorgaben zur ärztlichen Leichenschau<br />
werden erfüllt.<br />
• Unterstützung <strong>der</strong> Angehörigen: Angehörige fühlen sich unterstützt in <strong>der</strong> für den<br />
1 Entwickelt im Projekt: „Ein Netz <strong>der</strong> Begleitung knüpfen“, Evang.-kath. Sozialstion Füssen <strong>und</strong> Hospizverein Ostallgäu<br />
e.V., Am Ziegelstadel 12, 87629 Füssen, Projektleitung: Marianne Pfeifer (PDL), Veronika Stich (Hospizverein), Martin Alsheimer<br />
(GGsD, Nürnberg)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
237
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Trauerprozess so wichtigen "Schleusenphase" (SMEDING, HEITKÖNIG-WILP 2005),<br />
d.h. in den Tagen zwischen Tod <strong>und</strong> Beerdigung. Sie erleben das Verhalten <strong>der</strong> Pflegekräfte<br />
auch im Rückblick als hilfreich für ihren Abschied. (Aufgabe: Den Tod be-greifen<br />
können)<br />
• Auslegung im Sinne einer Palliativkultur: Versorgung <strong>und</strong> Aufbahrung werden im Sinne<br />
einer Palliativ- o<strong>der</strong> Abschiedskultur ausgelegt, d.h. es wird alles getan, genutzt <strong>und</strong><br />
angeboten, was den individuellen Trauerprozess <strong>der</strong> Beteiligten för<strong>der</strong>t. Die Beteiligten<br />
fühlen sich dabei nicht gezwungen.<br />
• Gute Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit wird von den Beteiligten (Angehörigen,<br />
Arzt, Bestatter) als klar abgesprochen <strong>und</strong> störungsfrei erlebt.<br />
Vorbereitung<br />
• Mögliche Vorbereitung <strong>der</strong> Angehörigen: Die persönlichen <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> kulturellen Wünsche<br />
<strong>und</strong> Beson<strong>der</strong>heiten zum Umgang mit dem verstorbenen Bewohner können Thema<br />
eines entsprechenden Gespräches zur "letzten Lebensphase" sein, das mit dem Bewohner<br />
o<strong>der</strong> seinen Angehörigen geführt wird. ("Gibt es etwas, auf das wir nach dem Tod achten<br />
sollen?"). Entsprechende Wünsche sind dokumentiert <strong>und</strong> nachzulesen. Wenn möglich,<br />
versuchen wir die Angehörigen auf den Todeseintritt <strong>und</strong> die Zeit danach vorzubereiten<br />
<strong>und</strong> geben ihnen zusätzlich hilfreiche schriftliche Informationen (z. B. Werkblatt „Hinüberschauen“<br />
ist vorrätig 1 ) an die Hand. Sind Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Familie, ermutigen wir die Eltern,<br />
diese in das Abschiednehmen einzubeziehen (z. B. Kin<strong>der</strong> könnten Bild für Sterbenden,<br />
Verstorbenen malen).<br />
• Absprachen mit Arzt: Wenn <strong>kein</strong>e Vitalzeichen mehr feststellbar sind, wird <strong>der</strong> Hausarzt<br />
benachrichtigt (Vertretung: Arzt vom Dienst). Die Pflegefachkraft klärt für das weitere Vorgehen<br />
ab, wann <strong>der</strong> Arzt kommen wird. (Je nach Umständen: zur Feststellung des Todes,<br />
zur ärztlichen Leichenschau.) Es wird mit dem Arzt besprochen, welche medizinischen<br />
Hilfsmittel vor <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau eventuell entfernt werden dürfen (Infusion,<br />
PEG, Katheter, Ausschalten von Wechseldruckmatraze u.a.). Dies wird dokumentiert.<br />
Info: Zeichen des nahenden Todes: unregelmäßige, schnappende o<strong>der</strong> rasselnde Atmung - unregelmäßiger,<br />
aussetzen<strong>der</strong> Pulsschlag - abfallen<strong>der</strong> Blutdruck - sinkende Temperatur in Armen <strong>und</strong> Beinen (Ausnahme: Infekt)<br />
- kalte, blasse o<strong>der</strong> bläulich marmorierte Haut an Händen <strong>und</strong> Füßen - weißes Dreieck um Nase <strong>und</strong><br />
M<strong>und</strong> - Eintrübung <strong>der</strong> Augen - schwindendes Bewusstsein. Unsichere Zeichen des eingetretenen Todes:<br />
Bewusstlosigkeit – Atemstillstand - <strong>kein</strong>e Bewegung - <strong>kein</strong> wahrnehmbarer Herzschlag o<strong>der</strong> Puls - <strong>kein</strong>e Reaktion<br />
auf sprachlichen o<strong>der</strong> körperlichen Kontakt - leicht geöffnete Augenlie<strong>der</strong> mit Fixierung auf Punkt - entspannter<br />
Kiefer - eventuell Abgang von Urin <strong>und</strong> Stuhl durch Muskelentspannung (Schaffler; u.a. 2000: Pflege<br />
heute - Lehrbuch <strong>und</strong> Atlas für Pflegeberufe)<br />
1 Kath. Landvolkbewegung Deutschlands (2004): „Den Abschied gestalten“. Anregungen, Gebete <strong>und</strong> Gottesdienste für die Zeit<br />
zwischen Tod <strong>und</strong> Beerdigung (Broschüre). Bestelladresse: www.behelfsdienst.at<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
238
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Benachrichtigen von Angehörigen: Falls Angehörige / Betreuer / Hospizhelfer nicht bereits<br />
anwesend sind, werden - wie im Vorfeld abgesprochen - diese entsprechenden Ansprechpartner<br />
von <strong>der</strong> leitenden Pflegefachkraft informiert. Es wird abgeklärt, wann <strong>und</strong><br />
wie <strong>der</strong> jeweilige Angehörige kommen kann. Bei Aufgeregtheit wird ein sicheres Verkehrsmittel<br />
empfohlen (z.B. Taxi, Mitfahrgelegenheit). Den Angehörigen wird zur Beruhigung<br />
versichert, dass <strong>der</strong> Sterbende, bzw. <strong>der</strong> Tote beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit erfährt, bis<br />
<strong>der</strong> Angehörige kommen kann. Wichtig ist Sicherheit durch entsprechende Information zu<br />
geben: Welche Schritte sind für den Angehörigen jetzt möglich <strong>und</strong> nötig? Wie viel Zeit<br />
bleibt? Was passiert mit dem verstorbenen Menschen jetzt weiter in <strong>der</strong> Einrichtung?<br />
• Hinführung von Angehörigen: Wenn Angehörige kommen, ermutigen Sie, sich den Verstorbenen<br />
anzuschauen. Respektieren Sie aber auch den Wunsch nach Distanz. Wenn<br />
gewünscht, erzählen Sie den Angehörigen als „Augenzeuge“, wie <strong>der</strong> Verstorbene auf Sie<br />
wirkt. Bereiten Sie die Angehörigen – wenn notwendig – auf Begegnung <strong>und</strong> Anblick vor<br />
(z.B. Verfärbungen, Lage im Bett, Totenstarre).<br />
Info: „Acht<strong>und</strong>neuzig Prozent aller Verstorbenen kann man gut anschauen, <strong>und</strong> man kann sich an ihren Geruch<br />
gewöhnen. Viele Tote verän<strong>der</strong>n auch noch ihr Aussehen, <strong>und</strong> zwar Tag für Tag. Manche bekommen sogar<br />
wie<strong>der</strong> Farbe ins Gesicht. Die Wahrnehmung von Verän<strong>der</strong>ungen des Körpers, zum Beispiel Leichenflecke,<br />
zeigt aber dem Hinterbliebenen, dass er nicht Lebendiges beerdigt. Beerdigt wird das, was an uns Menschen<br />
vergänglich ist. Die Persönlichkeit des Verstorbenen jedoch, seine Worte <strong>und</strong> Gedanken, sind unsterblich<br />
<strong>und</strong> leben mit den Hinterbliebenen weiter.“ (BODE, ROTH 1999: 82)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
239
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Durchführen <strong>der</strong> Versorgung<br />
• Dokumentieren: Wenn <strong>der</strong> Bewohner verstorben ist, wird im Pflegebericht mit Datum,<br />
Uhrzeit eingetragen: "Keine Vitalzeichen feststellbar! Eventuell angeben, wer bei <strong>der</strong> Feststellung<br />
mit anwesend war. Dieses Dokumentieren muss nicht sofort erfolgen. „Die Stille<br />
nach dem Eintritt ist oft zu wertvoll, als dass sie sofort durch Funktionshandlungen unterbrochen<br />
werden sollte.“<br />
Info: Den Tod darf nur <strong>der</strong> Arzt feststellen. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, so dürfen<br />
an <strong>der</strong> Leiche nur Verän<strong>der</strong>ungen vorgenommen werden, die aus Gründen <strong>der</strong> öffentlichen Sicherheit<br />
dringend erfor<strong>der</strong>lich sind. Ansonsten darf <strong>der</strong> Verstorbene vor <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau wie unten beschrieben<br />
versorgt werden (Siehe: Bayerische Bestattungsverordnung, §2). Natürlich: Folge von vorausgegangener<br />
Erkrankung. Nicht natürlich: Selbsttötung, Unfall (z.B. Sturz), Behandlungsfehler, Vergiftung, Gewalteinwirkung.<br />
(Siehe: Klingshorn, H. 2001: Erläuterungen zur Bayerischen Bestattungsverordnung II, S. 20) Bei<br />
nicht natürlichem Tod ist die Leichenschau auch zur Nachtzeit zu veranlassen (BAYERISCHE<br />
BESTATTUNGSVERORDNUNG §1)<br />
• Gr<strong>und</strong>haltung in <strong>der</strong> Situation: Die Pflegekräfte lassen nach dem Versterben des Bewohners<br />
sich <strong>und</strong> anwesenden Angehörigen eine Zeit <strong>der</strong> Besinnung <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> des Gebetes<br />
in diesen wichtigen Augenblicken des Lebens. � Zur Unterstützung sind Texte,<br />
Kerzen, Musik vorhanden. Die folgenden Handlungen haben nicht nur funktionellen, son<strong>der</strong>n<br />
vor allem rituellen Charakter. Entscheidend ist hier das achtsame Tun, das einen Abschied<br />
<strong>und</strong> den Trauerprozess för<strong>der</strong>t. Ein weiteres Prinzip: „Wenn man einen Verstorbenen<br />
versorgt, versorgt man ihn so wenig wie nötig! Nicht zu verwechseln, mit so wenig wie<br />
möglich! (BETRAM 2001)<br />
• Einbeziehung von Angehörigen: Die Pflegekraft informiert die Angehörigen über die einzelnen<br />
Schritte <strong>der</strong> Versorgung <strong>und</strong> klärt ab, ob <strong>und</strong> wie sich die Angehörigen beteiligen<br />
wollen. Die Angehörigen werden dabei ermutigt, bei <strong>der</strong> ersten Versorgung des Verstorbenen<br />
vor <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Aufbahrung danach mitzuwirken.<br />
("Nach unserer Erfahrung tut das vielen Angehörigen gut ...") Was im Einzelnen getan wird<br />
<strong>und</strong> was dem jeweiligen Angehörigen möglich ist, wird im Geschehen immer wie<strong>der</strong> erneut<br />
abgesprochen. Auf Hemmungen ohne Drängen eingehen: "Wie könnten wir Sie unterstützen?"<br />
Eventuell Bedenkzeit lassen, z.B. bis zur Aufbahrung. Auf mögliche Irritationen vorbereiten:<br />
eventuell seufzerähnliche Laute, weil Luft beim Umlagern entweicht, <strong>und</strong> möglicherweise<br />
Entleerung von Darm <strong>und</strong> Blase, weil die Muskulatur sich entspannt.<br />
Info: Es gibt <strong>kein</strong> "Leichengift"! Es ist den Angehörigen <strong>und</strong> den Pflegekräften freigestellt, ob sie Handschuhe<br />
<strong>und</strong> Plastikschürze anziehen wollen. Beson<strong>der</strong>er Schutz ist eigentlich nur bei Verstorbenen nötig, wenn vorher<br />
bereits übertragbare Krankheiten bekannt waren. Hier müssen dann entsprechende Schutzmaßnahmen fortgesetzt<br />
werden, bzw. eingehalten werden (Näheres siehe Bayerische Bestattungsverordnung § 7). "Bei jedem<br />
Neugeborenen strecken die Menschen die Hände aus. Auch die Grablegung sollte wie<strong>der</strong> eine Aufgabe <strong>der</strong><br />
Angehörigen <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e werden." (SITZMANN 2002: 10)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
240
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Der Verstorbene wird vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt. Gr<strong>und</strong>sätzlich: Keine<br />
schwere Bettdecke verwenden.<br />
Info: Im Tod fällt die natürliche Schutzschranke (Rheindel’sche Barriere) weg, die die Haut „wasserdicht“<br />
macht. Dadurch wird die Hautoberfläche leicht fettig <strong>und</strong> feucht. Dieser Prozess wird durch eine schwere Bettdecke<br />
noch geför<strong>der</strong>t. (BERTRAM 2001: 26 f.)<br />
• Die Augen werden geschlossen. Ein leichtes, sanftes Massieren mit einem feuchten Wattebausch<br />
kann dabei helfen. Gerade dieser Akt ist sehr persönlich <strong>und</strong> sollte auf jeden Fall<br />
zunächst den engsten Angehörigen angeboten werden. Dabei darauf achten, ob das untere<br />
o<strong>der</strong> das obere o<strong>der</strong> ob beide Augenli<strong>der</strong> durch entsprechend gerichtetes Streichen geschlossen<br />
werden müssen.<br />
Info: „Das Schließen <strong>der</strong> Augen des Verstorbenen sollte nicht durch dauerhaftes Auflegen eines Gegenstandes<br />
o<strong>der</strong> eines getränkten Wattebausch erfolgen. Denn durch den Tod sinkt <strong>der</strong> Augapfel wegen seines relativ<br />
hohen Eigengewichts in die Augenhöhlen zurück. Wenn nun zum Verschließen <strong>der</strong> Augen noch zusätzlich ein<br />
– wenn auch geringes – Gewicht auf den Augapfel drückt, fällt er noch tiefer in die Höhle zurück. Dadurch erreichen<br />
Sie zwar ein geschlossenes Augenlied, aber auch einen unbefriedigenden optischen Eindruck.“<br />
(BERTRAM 2001: 32)<br />
• Falls erfor<strong>der</strong>lich wird <strong>der</strong> Intimbereich gereinigt <strong>und</strong> mit einer Einlage <strong>und</strong> Netzhose versorgt.<br />
Die Pflegekräfte bereiten Zellstoff zum Schutz vor. Eventuelle offene Stellen werden<br />
mit geeignetem Verbandsmaterial abgedeckt. Falls Angehörige beim Waschen im Intimbereich<br />
anwesend sind o<strong>der</strong> sich beteiligen wollen, klären Sie bitte ab, ob <strong>der</strong> Verstorbene<br />
dieses zu Lebzeiten zugelassen hat.<br />
• Das Gesicht wird von <strong>der</strong> Pflegekraft o<strong>der</strong> von Angehörigen mit kaltem Wasser mit einem<br />
Waschlappen o<strong>der</strong> Leinentuch gewaschen. Betrachten Sie das Waschen als rituell: Es<br />
geht nicht nur um die körperliche Reinigung, son<strong>der</strong>n um eine Geste des Respekts <strong>und</strong><br />
Abschieds.<br />
Info: Warmes Wasser <strong>und</strong> Lauge för<strong>der</strong>t die Bildung einer Waschhaut. Empfehlung Nicht rubbeln, son<strong>der</strong>n<br />
kleine abrollende Bewegungen. (BERTRAM 2001: 32).<br />
Das Ritual des Waschens Verstorbener wird in vielen Kulturen gepflegt. Es symbolisiert die Vorbereitung auf<br />
eine an<strong>der</strong>e Welt; „Christen vergleichen es mit dem Taufritual“ (FIEDLER 2001: 185). Trauerpsycholgisch gedeutet<br />
kann über diese Handlung <strong>und</strong> das Medium Wasser die Berührung des Verstorbenen leichter fallen.<br />
„Berührung berührt!“ Es ermöglicht ein Be-greifen im wahrsten Sinne des Wortes.<br />
• Wenn möglich wird das Gebiss eingesetzt.<br />
• Bis zur ärztlichen Leichenschau wird ein frisches, leicht zu öffnendes Flügelhemd o<strong>der</strong><br />
persönliches Nachthemd angezogen, das hinten aufgeschnitten ist. Beim Drehen des Verstorbenen<br />
wird vorsorglich ein feuchtes Tuch (haftet besser) auf das Gesicht gelegt (Flüssigkeit<br />
kann aus Gesicht <strong>und</strong> Nase austreten). Der Verstorbene wird bis zum Bauch zugedeckt.<br />
Die Hände liegen über <strong>der</strong> Decke.<br />
Info: Bei <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau muss <strong>der</strong> Verstorbene vollständig entkleidet werden (Bayerische Bestattungsverordnung<br />
§3). Deshalb sollte die Bekleidung auch im Zustand <strong>der</strong> Totenstarre leicht auszuziehen sein.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
241
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• Der Oberkörper wird leicht erhöht gelagert.<br />
Info: Hochlagern vermeidet entstellende Verfärbungen am Kopf durch rotviolette Totenflecken. Diese entstehen<br />
durch Blut, das durch die Schwerkraft in die tiefer gelegenen Körperteile sickert <strong>und</strong> so zu Hautverfärbungen<br />
führt.<br />
• Der M<strong>und</strong> wird - nur wenn möglich - durch eine Kinnstütze geschlossen (z.B. durch feuchtes,<br />
gerolltes Handtuch)<br />
Info: Nicht hochbinden, weil es den Anblick entstellt! Der Brauch, den M<strong>und</strong> zu schließen, folgt zwar ästhetischen<br />
Empfindungen, wurzelt aber in <strong>der</strong> alten Annahme <strong>und</strong> Furcht vieler Religionen, dass die "Seele durch<br />
den M<strong>und</strong> wie<strong>der</strong> eintreten könne".<br />
• Die Hände werden übereinan<strong>der</strong> gelegt, die Arme körpernah angewinkelt.<br />
Info: Hände nicht falten – nur wenn es beson<strong>der</strong>s gewünscht wurde - da sonst die ärztliche Leichenschau bei<br />
Totenstarre erschwert wird. Das Anlegen <strong>der</strong> Arme erleichtert die spätere Aufbahrung <strong>und</strong> Einsargung.<br />
• Falls Angehörige nicht anwesend sind: Wie verfügt werden Wertgegenstände (Ringe,<br />
Schmuck) am Körper belassen o<strong>der</strong> entfernt <strong>und</strong> gesichert. Beides wird dokumentiert (Liste!)<br />
Falls Schmuck entfernt wird, wird <strong>der</strong> eingetütete Schmuck bei <strong>der</strong> Verwaltung abgegeben<br />
<strong>und</strong> quittiert (werktags) o<strong>der</strong> im Stationstresor eingeschlossen.<br />
• Das Bett wird so gestellt, dass es von beiden Seiten zugänglich ist. Stühle werden dazugestellt.<br />
• Die Heizung wird zurückgedreht, <strong>der</strong> Raum gelüftet. Eventuell stellen Sie eine elektrisch<br />
betriebene Duftlampe auf.<br />
• Pflegeutensilien werden vom Nachtkästchen geräumt. Wenn gewünscht, werden Symbole<br />
(Kerze, Rosenkranz, Blume) aufgestellt <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> persönliche Dinge (Brille, Bil<strong>der</strong>, "Lieblingsgegenstände")<br />
arrangiert.<br />
• Ärztliche Leichenschau: Bei <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau bieten die Pflegekräfte an, den<br />
Arzt zu unterstützen. Der Arzt füllt den Totenschein aus (Personalien des Toten, Todeszeitpunkt,<br />
Todesart, evtl. Hinweise auf übertragbare Erkrankung usw.)<br />
Info: Die ärztliche Leichenschau ermittelt die Todesart <strong>und</strong> sichtet die sicheren Todeszeichen: Totenflecke<br />
(zeigen sich in <strong>der</strong> Regel nach ca. 1-4 Std. nach dem Versterben, Ursache: siehe oben. Todesstarre (beginnt<br />
nach 2-12 Std., abhängig von Temperatur, Medikamenten, Anstrengungen des Todeskampfes.) Sie beginnt<br />
zunächst an <strong>der</strong> Muskulatur von Unterkiefer, Hals <strong>und</strong> Nacken <strong>und</strong> breitet sich zu den Extremitäten hin aus. Je<br />
nach Umständen löst sie sich in umgekehrter Reihenfolge nach ca. 1 - 6 Tagen. Ursache: Die Totenstarre entsteht<br />
durch Kontraktion <strong>der</strong> Muskulatur, die so ihre Energievorräte aufbraucht. (Ausführlicher Beitrag in Stationsordner<br />
„Sterbebegleitung“ abgelegt. MADEA, DETTMAYER, 2003)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
242
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Durchführen <strong>der</strong> Aufbahrung<br />
• Nach <strong>der</strong> ärztlichen Leichenschau kann <strong>der</strong> Tote in den Räumen <strong>der</strong> Kurzzeitpflege aufgebahrt<br />
werden. Wohnte die/<strong>der</strong> Verstorbene in einem Einzelzimmer, geschieht dies dort;<br />
ansonsten im Abschiedsraum. Der Tote kann nach Absprache mit den Angehörigen bis zu<br />
36 Std. in den Räumlichkeiten bleiben. Die anwesende verantwortliche Pflegekraft weist<br />
die Angehörigen darauf hin, dass auch die Möglichkeit einer häuslichen Aufbahrung besteht<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Verstorbene auch dorthin überführt werden kann.<br />
Info: Die Aufbahrung ist die Zeit des Abschieds. Dieser braucht Zeit <strong>und</strong> möglichst wenig Reglementierung.<br />
"Die menschenwürdige Aufbahrung eines Verstorbenen kann helfen bei <strong>der</strong> Trauerarbeit <strong>der</strong> nahen Angehörigen<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> professionellen Helfer." (SITZMANN 1999: 12.) An die Einrichtung des Aufbahrungsraumes werden<br />
vom Gesetz <strong>kein</strong>e beson<strong>der</strong>en Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt. Die Überführungsfrist ist in den einzelnen Län<strong>der</strong>gesetzen<br />
zur Bestattung meist auf 36 Std. festgelegt; sie kann auf Antrag verlängert werden.<br />
Info: In Bayern ist die Zeit in <strong>der</strong> Bestattungsordnung nicht festgelegt. Kommunale Ordnungen machen entsprechend<br />
sehr unterschiedliche Vorschriften.<br />
• Für die Aufbahrung kann <strong>der</strong> Tote eingekleidet werden. Eventuell geäußerte o<strong>der</strong> übermittelte<br />
persönlichen Wünsche werden dabei berücksichtigt (z.B. Lieblingskleid, Hochzeitsanzug).<br />
Empfohlen wird das Einkleiden durch mindestens drei Personen auszuführen.<br />
Schwierige Kleidungsstücke können am Rücken aufgeschnitten werden.<br />
Info: Bei <strong>der</strong> Bekleidung von Toten ist leicht vergängliches Material zu verwenden (Bayerische Bestattungsverordnung<br />
§ 30 Abs. 4). Straßenklei<strong>der</strong> o<strong>der</strong> -anzüge sind als solche anzusehen (Siehe: KLINGSHORN 2001:<br />
9) "Ein Verstorbener sollte von mindestens drei Personen eingekleidet werden. Eine Person sollte den Verstorbenen<br />
statisch heben <strong>und</strong> halten, damit die beiden an<strong>der</strong>en Personen ihn problemlos ankleiden können."<br />
(Sitzmann 1999)<br />
Anregungen für körpernahe Kühlung: Ist eine Kühlung (Sommer) notwendig, eventuell<br />
Trockeneis in den Sarg legen (kann von Brauereien bezogen werden.) Günstige Alternative:<br />
Kühlmodule (für Kühlbox)<br />
• Der Verstorbene kann noch von den Angehörigen <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Pflegekräften rasiert <strong>und</strong> gekämmt<br />
werden. Empfehlung: Angefeuchteter, weitzahniger Kamm. Keine Bürste! Bei gelocktem<br />
Haar werden die Strähnen einzeln behandelt.<br />
• Wichtig: Die Pflegekräfte informieren über die Möglichkeiten <strong>der</strong> Aussegnung o<strong>der</strong> von<br />
Abschiedsritualen (Werkblatt „Hinübergehen“; in <strong>der</strong> Station vorrätig) Sie ermutigen zur<br />
"Totenwache" <strong>und</strong> bieten Kaffee/Tee an. Eltern werden ermutigt, auch ihre Kin<strong>der</strong> in dieses<br />
Abschiednehmen einzubeziehen.<br />
• Wenn Pflegekräfte o<strong>der</strong> Angehörige nicht anwesend sind, wird <strong>der</strong> Raum verschlossen.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
243
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Auswertung (bezogen auf Ziele)<br />
• Die Pflegekräfte vergewissern sich in dieser Zeit <strong>der</strong> Versorgung/Aufbahrung immer wie<strong>der</strong>,<br />
wie es den Angehörigen geht <strong>und</strong> welche Unterstützung sie brauchen.<br />
• Die Pflegekräfte besprechen bei <strong>der</strong> Übergabe das Vorgehen mit den geglückten <strong>und</strong><br />
den eventuell schwierigen Ereignissen <strong>und</strong> Prozessen.<br />
• Die verantwortliche Pflegefachkraft (Stationsleitung) erk<strong>und</strong>igt sich regelmäßig, wie die<br />
Art <strong>der</strong> Zusammenarbeit von den Beteiligten gesehen wird (Ärzte, Bestatter).<br />
• Die Stationsleitung ruft ca. drei Monate nach dem Versterben den Ansprechpartner unter<br />
den Angehörigen an <strong>und</strong> erk<strong>und</strong>igt sich, wie die Unterstützung rückblickend bewertet<br />
wird.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
244
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Beispiele<br />
An Verstorbene erinnern<br />
Beispiele für einer Abschieds- <strong>und</strong> Gedenkkultur<br />
Wichtig: Die Idee muss immer mit den unmittelbar Betroffenen (z. B. Heimbewohner, Angehörige) gut abgestimmt<br />
sein, damit aus <strong>der</strong> Gedenkkultur <strong>kein</strong>e Gedenkdiktatur wird.<br />
• Trauerflor an <strong>der</strong> Tür: Mitarbeiter/Angehörige schmücken die Tür des Verstorbenen. Idee: St.-Josef-Heim,<br />
<strong>München</strong><br />
• Persönliche Gegenstände, die im Leben <strong>der</strong> verstorbenen Person eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung hatten (z. B. Pullover,<br />
Kreuz, Strickzeug usw.) werden an einem beson<strong>der</strong>en Platz arrangiert, bis <strong>der</strong>jenige bestattet wurde. Idee:<br />
Altenheim St. Augustin, Neuburg a. d. D.<br />
• Angehörige suchen Steine aus <strong>und</strong> beschriften diese. Die Steine können nach <strong>der</strong> Erinnerungsfeier mitgenommen<br />
werden. Alternative: kleine Blumentöpfe mit Erde zum Beschriften <strong>und</strong> Bemalen, in die Samenkörner<br />
gesät werden. Idee: Palliativstation am Klinikum Ingolstadt<br />
• Symbolkerze: Auf eine große Kerze applizieren Angehörigen mit Knetwachs den Namen des Verstorbenen<br />
<strong>und</strong> Symbole. Idee: HOLTZBECK 2004: 8<br />
• Objekte gestalten o<strong>der</strong> „Grabbeigaben“ aussuchen: Angehörige werden ermutigt, z. B. für die Aufbahrung o<strong>der</strong><br />
Aussegnungsfeier etwas mitzubringen, das symbolisch Ihre Trauer ausdrückt (z. B. zerbrochener Zweig)<br />
• Gedenklichter im Foyer: Eine große Kerze wird in einer mit Sand gefüllten Schale in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Rezeption<br />
<strong>der</strong> Einrichtung aufgestellt. Kleinere Kerzen stehen bereit, um von Angehörigen, Mitbewohner o<strong>der</strong> Pflegekräften<br />
für ein Gedenken o<strong>der</strong> Gebet für den Verstorbenen entzündet zu werden.<br />
• Ein „Lebensbaum“ mit Fotos von Bewohnern <strong>und</strong> Mitarbeitern als Blätter: Bereits beim Einzug eines Bewohners<br />
wird – wenn möglich mit dem Betroffenen zusammen – ein Blatt gestaltet <strong>und</strong> am Baum des Lebens <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Gemeinschaft befestigt. Auch Mitarbeiter sind Teil dieses Baumes. Bei Tod o<strong>der</strong> beruflichen Abschied aus<br />
<strong>der</strong> Gemeinschaft werden die Blätter an das Wurzelwerk des Baumes gebettet. Idee: Altenheim St. Josef, Gerolfing<br />
• „Kreuzweg“: Ein großes Kreuz wird von Mitbewohnern, Angehörigen <strong>und</strong> Pflegekräften beim Versterben eines<br />
Bewohners mit einem Quadrat aus starker Silber- o<strong>der</strong> Goldfolie (z. B. 10x10 cm) beklebt, in die Wünsche, Erinnerungen<br />
o<strong>der</strong> ein Symbol mit stumpfen Bleistift eingraviert wurden. (Idee: REFERAT SCHULPASTORAL<br />
2005; ähnlich Leonhard-Henninger-Haus, <strong>München</strong> ORTH, ALSHEIMER 2005)<br />
• Gedenkwand mit Fotos/Objekten Verstorbener in <strong>der</strong> Einrichtung: Die Gedenkwand kann selbst in ihrer Gestaltung<br />
einen symbolischen Charakter annehmen (z. B. Motive: Reisekoffer, Tor, Schiff, Brücke, Weg, Wolken<br />
usw.). Die Gedenkwand könnte auch zur „Klagemauer“ werden. Idee REFERAT SCHULPASTORAL 2005<br />
• Nachruf für die Heimzeitung mit den Angehörigen des Verstorbenen gemeinsam gestalten. Gab es ein zentrales<br />
Lebensmotto des Verstorbenen? Aus einer Sammlung von Bil<strong>der</strong>n kann dann ein stimmiges Motiv ausgewählt<br />
werden. Idee: St. Elisabeth, Gaimersheim<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
245
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Hilfen/Fallbeispiel /<br />
Angehörige am Totenbett begleiten<br />
Hilfen für das Gespräch <strong>und</strong> rituelles Handeln<br />
Einführung<br />
„Den eigenen Tod, den stirbt man nur, aber mit dem Tod <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en muss man leben“, bangt<br />
die jüdische Lyrikerin Mascha Kaléko (1912-1975). Der Mainzer Klinikseelsorger Erhard Weiher<br />
(2004, 2005) zeigt die Bedeutung <strong>der</strong> Situation nach dem Versterben <strong>und</strong> die vielen kleinen<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Begleitung <strong>der</strong> Angehörigen. Seine Beiträge dazu wurden in dieser Arbeitseinheit<br />
in ein Fallbeispiel <strong>und</strong> Empfehlungen verwandelt.<br />
Im Unterschied zur verbreiteten Annahme, dass die erste Begegnung mit dem Verstorbenen<br />
im gefühlsgelähmten Schock vorbeizieht, erinnern sich 92 Prozent <strong>der</strong> Trauernden, dass in<br />
dieser unmittelbaren Zeit nach dem Tod ihre Trauerreaktionen am heftigsten gewesen seien.<br />
Wie die Situation erlebt wird <strong>und</strong> wie sich Ärzte, Pflegende, Seelsorger, Bestatter etc. verhalten,<br />
bleibt in intensiver Erinnerung. „Qualitative Untersuchungen (z. B. an <strong>der</strong> Klinik in Augsburg)<br />
lassen darauf schließen, dass ein qualifiziertes Reagieren <strong>der</strong> Professionellen in <strong>der</strong> Zeit<br />
unmittelbar nach dem Tod die spätere Trauer erleichtert.“ 1 (Weiher 2004, 4)<br />
1 Weiher, E. (2004): Die Sterbest<strong>und</strong>e im Krankenhaus. Was können die Professionellen im Umkreis des Todes tun? Beiträge<br />
zur Thanatologie (28), S. 4. (www,uni-mainz.de/Organi-sationen/thanatologie/Literatur/heft 28.pdf)<br />
Siehe auch Weiher, E. (1997): Pflege <strong>und</strong> Seelsorge unterstützen gemeinsam die Angehörigen. Abschied am Totenbett. Pflegezeitschrift<br />
50 (4), S. 168-170<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
246
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Fallgeschichte<br />
„Nein, ich kann das nicht, ich will ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie ich ihn gekannt habe …“ Die Tochter,<br />
Frau Semrock, zögert. Vor ein paar St<strong>und</strong>en erst war sie hier gewesen. Sicher, dem Vater ging es nicht gut. Die<br />
Schwestern hatten sie informiert. Aber nichts deutete darauf hin, dass es so schnell gehen würde. Und jetzt liegt er<br />
hinter dieser Tür …<br />
Die Schwester am Telefon hatte sie schon gefragt, ob noch jemand mitkommen könne. Aber wen sollte sie bitten,<br />
so früh am Morgen? Sie hatte ihr empfohlen, dass sie sich ein Taxi nehmen solle. Und sie hätte Zeit. Nein, sie wollte<br />
nicht warten. Und jetzt steht sie vor <strong>der</strong> Tür. Schwester Maria, die sie bereits kannte, ist ihr schon entgegengekommen.<br />
Sie hat ihr Beileid ausgesprochen. „Ich bin selbst überrascht; Sie wissen ja, dass ich Ihren Vater mochte<br />
…“ Niemand hatte <strong>der</strong> Tochter den unterschwelligen Vorwurf gemacht, dass es doch absehbar war. Das hatte Frau<br />
Semrock befürchtet.<br />
„Möchten Sie eine Tasse Tee o<strong>der</strong> Kaffee, Sie haben die Zeit. Wir haben bis jetzt lediglich ein paar pflegerische<br />
Sachen aufgeräumt <strong>und</strong> das Kopfteil etwas höher gestellt, aber sonst nichts verän<strong>der</strong>t. Ihr Vater liegt leicht auf <strong>der</strong><br />
Seite. Er wirkt auf mich friedlich. Ich dachte vorhin zunächst noch, er schläft. Den Arzt kommt erst gegen halb<br />
neun. Wissen Sie, er muss noch warten mit <strong>der</strong> Untersuchung. Ihr Vater bleibt noch mindestens vier St<strong>und</strong>en bei<br />
uns hier auf Station. Anschließend kann er noch mindestens bis morgen bei uns im Abschiedsraum aufgebahrt<br />
bleiben, wenn sie möchten …“ Sie nennen ihn hier noch „Ihren Vater“, nicht „<strong>der</strong> Verstorbene“. Frau Semrock registriert<br />
es.<br />
Nun steht sie unschlüssig vor <strong>der</strong> Tür. Sie war schnell gekommen. Den Vater wollte sie nicht allein lassen; jetzt<br />
weiß sie nicht mehr, was sie will. Die Schwester steht neben ihr: „Ich weiß, ich war damals auch unschlüssig, als<br />
meine Mutter gestorben ist, ob ich zu ihr gehen soll o<strong>der</strong> kann. Aber ich war so froh, dass ich es dann doch gewagt<br />
habe … Aber natürlich können Sie ihn auch später noch sehen …“ Schwester Maria wartet.<br />
„Ist es Ihnen recht, wenn ich mit Ihnen gehe – o<strong>der</strong> wollen sie allein sein? Ich habe meinen Kolleginnen Bescheid<br />
gesagt. Niemand drängt uns.“ Die Tochter nickt, drückt die Klinke, wartet aber, bis die Schwester vorausgeht. Gedämpftes<br />
Licht brennt bereits im Zimmer. Die Schwester bietet ihr an, ein paar Minuten mit ihr still innezuhalten. „Ist<br />
das in Ordnung für Sie? Sie können solange bei Ihrem Vater bleiben wie sie wollen …“<br />
„Mögen Sie sich setzen? Wohin wollen Sie Ihren Stuhl?“ Beide lassen nun die Atmosphäre auf sich wirken. Es<br />
herrscht nach <strong>der</strong> Betriebsamkeit <strong>der</strong> letzten Tage - mehrfache Arztvisiten, die Unruhe des Kranken - Frieden im<br />
Zimmer. Ein Frieden, <strong>der</strong> vom Verstorbenen auszugehen scheint. Draußen hört man die erwachende Straße. Vögel<br />
zwitschern. Hier scheint die Zeit still zu stehen. Der Verstorbene wirkt trotz des leicht geöffneten M<strong>und</strong>es nicht gequält,<br />
auch wenn die Falten tief eingegraben sind. Die Augen sind geschlossen. Lediglich das linke scheint etwas<br />
zu blinzeln. Das Gesicht ist von <strong>der</strong> langen Krankheit gezeichnet. Die Hände liegen wachsbleich auf <strong>der</strong> Decke.<br />
Die Schwester eröffnet nach einer Zeit ein Gespräch über den Verstorbenen. „Das es jetzt so schnell ging … Sie<br />
haben anstrengende Tage hinter sich … Er hat lange gekämpft … Wie haben Sie es in den letzten Tagen erlebt?“<br />
Die Tochter beginnt zu erzählen, von <strong>der</strong> Schwere <strong>der</strong> letzten Zeit, dem Chaos im Haushalt, die berufliche Hektik,<br />
<strong>der</strong> Hoffnung, dazwischen die Besuche hier. Und das Zuschauen-Müssen, wie ihr Vater kämpft. Die Schwester<br />
fragt, was sie ihrem Vater gewünscht hätte. Frau Semrock überlegt <strong>und</strong> bestätigt, ja, er sei immer schon ein Kämpfer<br />
gewesen. So wie er gestorben sei, habe er auch gelebt. Nie aufgeben!<br />
Dann entschuldigt sie sich, dass sie nicht weinen könne. Dazwischen Pausen. Sie erzählt von dem Schuldgefühl,<br />
das sie nun habe, weil sie gestern so früh gegangen sei <strong>und</strong> ihr Vater ohne sie sterben musste. Schwester Maria:<br />
„Wir machen oft diese Erfahrung, dass Menschen dann sterben, wenn niemand im Raum ist. Vielleicht ist das Gehen-Können<br />
für den Menschen leichter …“ Frau Semrock nickt, klagt aber erneut, warum sie nicht noch länger<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
247
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
geblieben sei. „Was würde Ihr Vater zu Ihnen <strong>und</strong> Ihrem Vorwurf sagen, den sie sich machen?“, fragt nun Maria.<br />
Frau Semrock lacht kurz auf. „Ach er; <strong>der</strong> hat mich immer getröstet. Auch die letzten Tage noch. Ich soll mich nicht<br />
so quälen im Leben.“ Frau Semrock schluchzt, lacht dazwischen kurz, schluchzt.<br />
Maria gibt <strong>der</strong> Tochter ein Taschentuch, die Nase läuft. Beide schweigen eine kleine Weile. „Wer wäre denn noch<br />
gerne heute da? Wen möchten Sie später noch informieren?“<br />
„Möchten Sie eine Kerze anzünden? Ich habe Ihnen bereits eine mitgebracht, die sie auch später mitnehmen können<br />
… Es geht Ihnen sicher vieles durch den Kopf <strong>und</strong> durch das Herz … Wir haben ein bisschen Zeit zum Erzählen.“<br />
(Wann hat eigentlich die Krankheit angefangen? Wer gehört noch zur Familie? Hatten Sie gute Jahre miteinan<strong>der</strong>?)<br />
Maria fragt Frau Semrock, ob sie allein bleiben wolle. Frau Semrock verneint. Es tue gut, dass sie da sei. Maria<br />
ermutigt nun Frau Semrock: „Vielleicht möchten Sie Ihrem Vater noch alle guten Wünsche <strong>und</strong> Gedanken mitgeben,<br />
die in Ihnen sind …“<br />
„Vielleicht möchten Sie Ihrem Vater danken …“<br />
„Vielleicht wollen Sie ihm noch gedanklich o<strong>der</strong> laut sagen, was sie schmerzt …“<br />
Schwester Maria fragt Frau Semrock, als diese sie nach einiger Zeit wie<strong>der</strong> anblickt, ob sie gläubig sei. Frau Semrock<br />
nickt. „Ich mache Ihrem Vater ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Wenn Sie möchten, können Sie ihn auch berühren<br />
…“ Frau Semrock segnet die Hände <strong>und</strong> die Stelle des Herzens auf dem Schlafanzug ihres Vaters.<br />
„Ich möchte Ihren Vater gerne auch Gott anvertrauen, wenn Sie damit einverstanden sind … Wir können dazu das<br />
‚Vater unser“ beten. Beide beten nun laut das „Menschheitsgebet“. …<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
248
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Anregungen für die Begleitung<br />
• Reden Sie nichts weg o<strong>der</strong> bagatellisieren Sie nicht, son<strong>der</strong>n beschreiben Sie aufrichtig!<br />
(„Er hat gekämpft …“)<br />
• Klären Sie immer wie<strong>der</strong> die Situation! („ … Sind Sie damit einverstanden?“)<br />
• Informieren Sie über die nächsten Schritte <strong>und</strong> Möglichkeiten <strong>und</strong> geben Sie so Sicherheit!<br />
(„Ihr Vater kann noch mindestens vier St<strong>und</strong>en auf unserer Station bleiben …“)<br />
• Sprechen Sie aus ihrer Erfahrungen <strong>und</strong> Ihrem persönlichem Erleben, aber unterstellen<br />
o<strong>der</strong> deuten Sie nicht. (Beispiel für eine Deutung wäre: „Ihr Vater wollte Ihnen die Situation<br />
nicht zumuten“ führt eventuell zu Schuldgefühl bei Angehörigen: „Bin ich zu<br />
schwach?“) Lassen Sie stattdessen Platz für die Ausdeutung <strong>der</strong> Angehörigen. („Wie haben<br />
Sie die letzten Tage erlebt?“)<br />
• Enthalten Sie sich schneller, drängeln<strong>der</strong> Psychologisierungen, z. B. die Angehörigen wollen<br />
das nahe Ende nicht wahrhaben<br />
• Schaffen Sie sich etwas Zeit für die Begleitung durch Absprachen auf <strong>der</strong> Station („Die<br />
Kolleginnen wissen Bescheid …“)<br />
• Zeigen Sie Möglichkeiten auf, ohne zu drängen („Sie können sich Zeit lassen mit <strong>der</strong> Entscheidung<br />
…)<br />
• Würdigen Sie die Leistung o<strong>der</strong> Gefühle <strong>der</strong> Angehörigen („Es war sicher eine anstrengende<br />
Zeit …“ „Ich kann mir vorstellen, es war nicht einfach für Sie …)<br />
• Regen Sie symbolisch-rituelles Handeln an, z. B. Kerze anzünden, Gegenstände aussuchen<br />
<strong>und</strong> drapieren!<br />
• Seien Sie Vorbild im Umgang mit den Verstorbenen, z. B. Berührung!<br />
• Beziehen Sie Nicht-Anwesende gedanklich mit ein („Wer gehört noch zum Kreis?“ „Wer<br />
konnte nicht kommen?“ „Wer wäre noch beson<strong>der</strong>s wichtig?“)<br />
• Knüpfen Sie eventuell an spirituellen Vorstellungen an! („Gibt es religiöse Symbole o<strong>der</strong><br />
Gebete, die Ihnen o<strong>der</strong> <strong>der</strong>/m Verstorbenen etwas bedeuten?“)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
249
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
250
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard / Textentwurf<br />
Im Team Gedenkkarte an Angehörige<br />
schreiben<br />
Ein Beispiel für eine aufmerksame Nachsorge<br />
Nach den Betriebsamkeiten <strong>und</strong> Aufregungen <strong>der</strong> ersten Tage (Bestattung organisieren,<br />
Nachlass regeln, Zimmer räumen usw.) wird es um die Angehörigen nach dem Tod eines Bewohners<br />
meist stiller. Die Aufmerksamkeit <strong>der</strong> Umgebung lässt nach. In dieser Zeit wird eine<br />
Geste <strong>der</strong> Solidarität <strong>und</strong> des Gedenkens erfahrungsgemäß sehr positiv von den Angehörigen<br />
aufgenommen. Diese Form <strong>der</strong> Nachsorge ist wenig aufwändig, gleichzeitig aber persönlich.<br />
Sie unterstützt Team <strong>und</strong> Angehörige gleichermaßen, indem die Aktion menschliche Solidarität<br />
vermittelt <strong>und</strong> wertvolle Rückmeldung für die Sterbebegleitung <strong>der</strong> Einrichtung liefern kann.<br />
Ziele<br />
• Anteilnahme <strong>und</strong> Trost: Die Angehörige fühlt sich persönlich angesprochen <strong>und</strong> wertet<br />
es als beson<strong>der</strong>e Aufmerksamkeit.<br />
• Guter Abschied im Team: Die Mitarbeiterinnen haben eine weitere Möglichkeit, sich zu<br />
entlasten <strong>und</strong> erfahren umgekehrt über die Rückmeldung des Angehörigen Anerkennung<br />
ihrer Arbeit.<br />
• Rückmeldung: Die Mitarbeiterinnen erfahren aus <strong>der</strong> Sicht von Angehörigen, was sie gut<br />
gemacht haben <strong>und</strong> auf was sie eventuell zukünftig achten können.<br />
Durchführung<br />
Verantwortlich: Verantwortliche Pflegefachkraft<br />
Vorbereitung / Rahmen / Beteiligte<br />
• Zeit: ca. drei bis vier Wochen nach dem Tod des Bewohners, Adressat ist die nächste Angehörige<br />
(z. B. Betreuerin)<br />
• Karte, Sammlung von kleinen Gedichten, Zitaten zum Thema Abschied zur Auswahl<br />
• Das Unterschreiben <strong>der</strong> Karte kann in ein Abschiedsritual des Teams eingebettet sein. (�<br />
Sich im Team durch Abschiedsritual entlasten)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
251
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Textvorschlag<br />
Titel: Das Team von Station … erinnert sich gerne an …<br />
Das Team <strong>und</strong> ich sitzen gerade in unserer Teamr<strong>und</strong>e zusammen <strong>und</strong> denken an Sie <strong>und</strong> Ihre<br />
verstorbene Mutter. Eine Kerze haben wir auch angezündet. Wir haben ein Gedanken ausgewählt<br />
<strong>und</strong> auf die Rückseite <strong>der</strong> Karte geschrieben, den wir trostreich fanden.<br />
Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist uns ein beson<strong>der</strong>es Anliegen.<br />
Wir fragen uns, wie es Ihnen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en Familienangehörigen geht <strong>und</strong> wie Sie die Zeit des<br />
Abschieds in unserem Haus erlebt haben. Über eine kurze Rückmeldung würden wir uns<br />
freuen. Sie können uns auch ruhig sagen, falls Sie etwas irritiert, gestört o<strong>der</strong> gekränkt hat.<br />
Wie ja schon bei unserer letzten Begegnung vereinbart, dass ich Sie anrufen kann. Ich würde<br />
mich gerne bei Ihnen in den nächsten Tagen melden, um Sie zu fragen, wie es Ihnen geht <strong>und</strong><br />
wie Sie die Zeit bei uns erfahren haben.<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüßen<br />
………………………………….…..<br />
Verantortliche Pflegefachkraft (Stationsleitung)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
252
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard/ /Ritual<br />
Gedenkfeier gestalten<br />
Ein Beispiel für eine gelungene Dramaturgie<br />
Verantwortlich: Mitarbeiter des Arbeitskreises Gedenkfeier nach Absprache<br />
Titel: „Wir werden nichts vergessen, was wir miteinan<strong>der</strong> gelebt haben …“<br />
Vorbereitung/Rahmen<br />
• Empfehlung: Es sollten bei diesem Ritual nicht mehr als 20 Verstorbene im Mittelpunkt <strong>der</strong><br />
Feier stehen, weil sonst das Ritual zu lange dauern würde. Erfahrungsgemäß ist für jeden<br />
Verstorbenen mit etwa zwei bis drei Angehörigen zu rechnen.<br />
• Die Einladungen werden verschickt. Die Zahl <strong>der</strong> Teilnehmer sollte gut überschaubar bleiben;<br />
deshalb wird um eine Rückantwort gebeten. Empfehlung: Der Abstand zum Zeitpunkt<br />
des Todes sollte mindestens drei Monate betragen, damit <strong>der</strong> Verlust für die Angehörigen<br />
nicht zu „frisch“ ist.<br />
• In <strong>der</strong> Einladung (ca. einem Monat vor <strong>der</strong> Gedenkfeier) werden die Angehörigen auch<br />
darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch eine Fürbitte o<strong>der</strong> Erinnerung formulieren <strong>und</strong><br />
zuschicken können, wenn sie nicht an <strong>der</strong> Gedenkfeier teilnehmen können o<strong>der</strong> wollen.<br />
Diese würde dann – wenn gewünscht – bei <strong>der</strong> Gedächtnisfeier stellvertretend von einer<br />
Mitarbeiterin vorgelesen. So wäre auch eine Beteiligung trotz Abwesenheit möglich. Niemand<br />
soll sich zum Ritual gedrängt fühlen. Auch Mitarbeiter, die im vergangenen Zeitraum<br />
seit <strong>der</strong> letzten Gedenkfeier Angehörige verloren haben, können zu dieser Gedenkfeier<br />
eingeladen werden.<br />
Raumgestaltung/Materialien/Medien<br />
• Stuhlkreis (auch mit einigen Stühlen in einer zweiten Reihe, falls jemand mehr Abstand<br />
<strong>und</strong> „Schutz“ haben möchte)<br />
• Tücher <strong>und</strong> Blätter für die Mitte (Deko-Material)<br />
• Faltblatt mit dem Ablauf <strong>und</strong> den Texten auf jedem Stuhl ausgelegt<br />
• CD-Player<br />
• Kerzen <strong>und</strong> Kerzengläser, lange Zündhölzer<br />
• Klangschale<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
253
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Durchführung<br />
Übersicht: Das Ritual folgt dem Phasenschema für Übergangsrituale. Es wird zunächst über<br />
Begrüßung, kurzes Kennenlernen <strong>der</strong> Sitznachbarn <strong>und</strong> poetische <strong>und</strong> musikalische Einstimmung<br />
ein Rahmen geschaffen, <strong>der</strong> feierliche Aufmerksamkeit <strong>und</strong> Sicherheit ermöglichen soll.<br />
In <strong>der</strong> Phase <strong>der</strong> „Erinnerung/Loslösung“ werden durch Meditation <strong>und</strong> Schreiben <strong>der</strong> Trauer<br />
Ein- <strong>und</strong> Ausdrucksmöglichkeit gegeben. Zentrales Medium des „Höhepunkts“ ist das Universalsymbol<br />
des Lichtes. Dass die Trauerzeit auch eine Zeit des Wachsens im Dunklen ist, wird<br />
über das Symbol-Geschenk <strong>der</strong> Blumenzwiebel ausgedrückt. Ein einfacher Kreistanz führt aus<br />
dem Ritual hinaus.<br />
Eröffnung/Rahmen<br />
• Mit dem Klang <strong>der</strong> Klangschale wird das Ritual eröffnet.<br />
• Die Heimleitung begrüßt die Angehörigen <strong>und</strong> gibt eine Übersicht zum Ablauf.<br />
• Der 1. Text zum Thema Gedenken wird rezitiert (z. B. Paul Tillich: … die eigentliche Todesangst<br />
ist immer die Angst vor dem Vergessen-Werden …“<br />
• Die Anwesenden werden gebeten, sich kurz den jeweiligen Sitznachbarn zur Rechten <strong>und</strong><br />
zur Linken vorzustellen (= Sicherheit durch Kontakt)<br />
• Einstimmung über ein Musikstück (z. B. Instrumentalstück „Borg mir Dein Licht“, Jörg Hufeisen<br />
2005)<br />
4. Phase: Rückbesinnung = Loslösung<br />
Motto: Wir erinnern uns <strong>und</strong> blicken zurück<br />
• Ein 2. Text zur Bedeutung von Erinnerung wird vorgetragen (z. B. Hermann Hesse: … Auf<br />
unserer Stufe muss das Totenopfer in unserer eigenen Seele vollzogen werden, durch<br />
Gedenken, durch genaueste Erinnerungen, durch Wie<strong>der</strong>aufbau des geliebten Wesens in<br />
unserem Inneren …“)<br />
• Die Anwesenden werden zu einer Besinnung eingeladen, die verschiedene Seiten <strong>und</strong><br />
Facetten <strong>der</strong> jeweiligen Beziehung zum verstorbenen Angehörigen in die Erinnerung holt.<br />
Einige Impulse <strong>der</strong> Meditation werden kurz vorab benannt, damit sich die Teilnehmer etwas<br />
unter <strong>der</strong> Besinnung vorstellen <strong>und</strong> sich darauf einstellen können. Die Teilnehmer<br />
können für die Meditation die Augen schließen, wenn sie möchten.<br />
Text für Meditation<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
254
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ich erinnere mich …<br />
• Ich erinnere mich an eine schöne Situation, in <strong>der</strong> ich mich <strong>der</strong> verstorbenen Person sehr nahe o<strong>der</strong><br />
sehr verb<strong>und</strong>en gefühlt habe …<br />
• Ich erinnere mich an Eigenheiten … Was habe ich vielleicht übernommen?<br />
• Ich erinnere mich an typische Aussprüche …<br />
• Vielleicht wurden wir uns auch fremd. Vielleicht litt mein Angehöriger an Demenz …<br />
• Vieles ist nicht vorhersehbar, was uns hinterher leid tut. Diese Versäumnisse gehören zu unserem<br />
Menschsein. Vielleicht hätte ich dem Verstorbenen zu Lebzeiten noch gerne etwas gesagt … Was<br />
hätte die verstorbene Person wohl zu mir gesagt, wenn sie meine Worte jetzt hören würde? Vielleicht<br />
hätte ich gerne noch etwas gehört, was mir <strong>der</strong> Verstorbene zum Abschied sagen könnte …<br />
• Für was bin ich dankbar?<br />
• Vielleicht gibt es auch Menschen, die für mich wichtig waren in <strong>der</strong> Zeit des Sterbens meines Angehörigen<br />
<strong>und</strong> in <strong>der</strong> Zeit danach …<br />
• Ein 3. Text wird zitiert (z. B. Rainer Maria Rilke: Herbst)<br />
• Der folgende Teil des Erinnerungsrituals wird vorab kurz erläutert. Eine große Schale o<strong>der</strong><br />
ein Korb mit Stiften <strong>und</strong> mit farbigen DIN A4-Blättern wird herumgereicht, die in Form von<br />
verschiedenen Herbstblättern geschnitten wurden. Farbe <strong>und</strong> Blattform stehen für unterschiedliche<br />
Satzanfänge, die auf die Blätter kopiert wurden. Gelbes Ahornblatt = Ich bin<br />
dankbar für … Oranges Kastanienlaub = Ich erinnere mich gerne an … Rotes Buchenblatt<br />
= Ich brauche noch Zeit für …<br />
• Wer von den Anwesenden mag, kann nun diesen Impulsen auf den Blättern folgen <strong>und</strong> die<br />
jeweiligen Sätze persönlich weiter schreiben.<br />
• Wer möchte, legt die beschriebenen Blätter wie<strong>der</strong> zurück in den Korb o<strong>der</strong> in die Schale.<br />
Die Mitarbeiter des Arbeitskreises legen diese in <strong>der</strong> Mitte aus <strong>und</strong> lesen einige Erinnerungen<br />
vor. Es bleibt auf diese Weise anonym, von wem das jeweilige Blatt stammt. Für den<br />
Betroffenen kann es hilfreich sein, das Geschriebene noch einmal laut zu hören. Für an<strong>der</strong>e<br />
Anwesende mag es ein Gedanke sein, <strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um eigene Dankbarkeiten, schöne Erinnerungen<br />
o<strong>der</strong> Nöte in <strong>der</strong> Trauerzeit zum Ausdruck bringt.<br />
• Wenn Erinnerungen von Angehörigen geschickt wurden, können diese – sofern gewünscht<br />
– an dieser Stelle des Rituals vorgelesen <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> ausgelegt werden.<br />
Beispiele für Erinnungsblätter<br />
Ich erinnere mich gerne an …<br />
• Deine weiche, gut riechende Haut, an die vielen gemeinsamen St<strong>und</strong>en, z. B. beim Kaffee-Trinken<br />
<strong>und</strong> an Dein gutes Essen<br />
• meine Kindheit, an Weihnachten mit meiner Mutter, an das Weihnachtsgebäck <strong>und</strong> an die Zimtster-<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
255
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
ne, die so einmalig waren.<br />
Ich bin dankbar für …<br />
• Deine Hilfsbereitschaft <strong>und</strong> für die schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Ich vermisse Dich sehr!!<br />
• die Unterstützung durch meine Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Zeit nach dem Tod meines lieben Mannes.<br />
Ich brauche noch Zeit …<br />
• um mir selbst zu vergeben. Denn am Schluss war meine Kraft auch zu Ende, Dich so leiden sehen zu<br />
müssen. Bitte verzeih’ mir!<br />
• ganz zu begreifen, dass sie nicht mehr unter uns weilt.<br />
5. Höhepunkt = Übergang, Verwandlung<br />
• Die folgende Handlung wird durch ruhige Musik getragen (z. B. von Pachelbel o<strong>der</strong> Bach).<br />
• Ein Mitglied des Arbeitskreises verliest laut den Namen eines verstorbenen Bewohners<br />
<strong>und</strong> bringt eine Kerze mit Kerzenglas zu dessen Angehörigen. Es wird dort leise <strong>und</strong> kurz<br />
mit den Angehörigen abgesprochen, ob einer <strong>der</strong> Angehöriger die Kerze selbst in die Mitte<br />
bringen kann o<strong>der</strong> ob diesen Akt das Mitglied des Arbeitskreis übernimmt, weil die Trauernden<br />
zu sehr berührt sind. Die Angehörigen entzünden die Kerze.<br />
• Der nächste Name wird erst dann genannt, wenn die Kerze in <strong>der</strong> Mitte aufgestellt wurde<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Angehöriger, bzw. sein Stellvertreter wie<strong>der</strong> auf seinen Platz zurückgekehrt ist.<br />
Diese Feierlichkeit durch Ordnung <strong>und</strong> Ruhe in <strong>der</strong> Handlung ist wichtig (FISCHEDICK<br />
204: 15). Je<strong>der</strong> Verstorbene erhält symbolisch einen Platz in <strong>der</strong> Mitte. Die Kerzen können<br />
zu einer Gestalt geordnet werden (z. B. Kreis, Herz, Kreuz Spirale, Stern). Wenn das gewollt<br />
ist, sollten die Umrisse in <strong>der</strong> Mitte schon angedeutet sein (z. B. mit Kieselsteinen als<br />
„Platzhalter“)<br />
• Die Musik klingt leise aus. (Die Lautstärke des CD-Players wird langsam reduziert.)<br />
• Wenn alle Verstorbenen mit Namen genannt <strong>und</strong> mit Kerzen repräsentiert sind, wird ein<br />
Gebet (z. B. Vaterunser) gesprochen. Wer möchte, betet mit.<br />
• Fürbitten, die von den Mitglie<strong>der</strong>n des Arbeitskreises abwechselnd vorgetragen werden,<br />
beenden diese Phase.<br />
6. Phase = Neuanbindung<br />
• 4. Text vortragen (z. B. Friedrich Bonhoeffer: „… Man muss sich hüten, in den Erinnerungen<br />
zu wühlen, sich ihnen auszuliefern, wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort<br />
betrachtet …“)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
256
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
• In einem Korb o<strong>der</strong> einer Schale werden Blumenzwiebeln verschenkt. Impuls: Auch die<br />
Trauer braucht ihre Zeit …Was ist meine Hoffnung?<br />
• Ein 5. Text, <strong>der</strong> gedanklich zum Weiterleben hinführt, wird vorgelesen (z. B. Borges:<br />
„Wenn ich noch einmal leben könnte … würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen …“<br />
o<strong>der</strong> Reuter: „Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen …“ o<strong>der</strong> v. Droste-Hülshoff: „<br />
… Alles ist gut.“ o<strong>der</strong> Koholet: „Alles hat seine Zeit“.<br />
• Ein leicht zu lernen<strong>der</strong> Kreistanz wird gezeigt. (z. B. WOISIN o.J.a: Navida Dau von <strong>der</strong><br />
Gruppe WibazziI); weitere Auswahl <strong>und</strong> Musikhinweise bei LANDER, ZOHNER 1992,<br />
Empfehlungen für Lie<strong>der</strong> aus dem Gebetbuch: LÖDEL2003)<br />
• Musik <strong>und</strong> Tanz r<strong>und</strong>en <strong>und</strong> beenden das Ritual.<br />
Abschluss<br />
Die Feier endet mit „irischen Segenswünschen“ (z. B. Sammlung bei MULTHAUPT 2006) des<br />
Heimleiters <strong>und</strong> <strong>der</strong> Einladung zu einem Imbiss (im Stehen).<br />
Verwendete Literatur für die Textauswahl: BICKEL, TAUSCH-FLAMMER 2003, DIRSCHAUER 2005<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
257
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
258
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard mit Gesprächsimpulsen<br />
Auszubildende auf die Versorgung<br />
Verstorbener vorbereiten 1<br />
Schritte für eine verantwortungsvolle Praxisanleitung<br />
Einführung<br />
Junge Auszubildende haben schon viele Tote gesehen – in <strong>der</strong> Regel allerdings nur auf dem<br />
Bildschirm: bis zum 14. Lebensjahr im Durchschnitt etwa 18.000. (HURTH 2001: 512). Es ist<br />
meist ein gewaltsamer Tod. Etwa 40 % <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zwischen sechs <strong>und</strong> zehn Jahren glauben<br />
deshalb, Menschen sterben durch Erschießen (HURTH 2001; 2004). Wenn die jeweiligen<br />
„Tatort-Kommissare“ Hinterbliebene befragen, zeigen sich kaum Spuren von Trauer. Tote verschwinden<br />
schnell. Totenwache o<strong>der</strong> Todengedenken sind im Drehbuch nicht vorgesehen.<br />
Wenn auch <strong>der</strong> Tod auf diese verzerrte Weise medial allgegenwärtig <strong>und</strong> nah scheint, so ist er<br />
im realen Leben meist sehr fern. Die Mehrheit <strong>der</strong> Erwachsenen in Deutschland hat bis zum<br />
40. Lebensjahr noch <strong>kein</strong>en Verstorbenen aus <strong>der</strong> Nähe gesehen. (WILLMANN 2004) „Was<br />
fehlt, ist die Erfahrung <strong>und</strong> damit das gr<strong>und</strong>legende Wissen, das die Normalität des Sterbens<br />
<strong>und</strong> des Todes beinhaltet. Anfänger in Pflegeberufen spüren dieses Defizit am deutlichsten.<br />
Häufig erleben sie ihre erste Begegnung mit Sterbenden <strong>und</strong> Toten als Schock, <strong>und</strong> zwar<br />
dann, wenn sie nicht genügend darauf vorbereitet wurden.“ (BODE; ROTH 1998: 51; siehe<br />
dazu auch: KNOBLING 1999). Wir treffen also in <strong>der</strong> Anleitung zur Versorgung Verstorbener<br />
auf eine komplexe Situation. Es gibt vermutlich viele Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong> Phantasien, aber wenig o<strong>der</strong><br />
<strong>kein</strong>e reale Erfahrung. Wie können Auszubildende an diese Situation herangeführt werden?<br />
Eine echte kommunikative Herausfor<strong>der</strong>ung.<br />
1<br />
Entwickelt von: Martin Alsheimer/Kurs Praxisanleitung Ingolstadt 2005<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
259
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Ziele<br />
• Der Auszubildende kennt die notwendigen pflegerischen Handlungen <strong>und</strong> ihre rechtlichen<br />
<strong>und</strong> trauerpsychologischen Hintergründe.<br />
• Der Auszubildende fühlt sich sicher in <strong>der</strong> Pflegesituation.<br />
• Der Praxisanleiter erkennt eventuelle Ängste gegenüber dieser Situation.<br />
• Der Auszubildende begreift die Versorgung <strong>und</strong> Aufbahrung von Verstorbenen als Chance<br />
für den persönlichen Abschied von dem verstorbenen Menschen.<br />
Durchführung<br />
1. Schritt: Erk<strong>und</strong>en<br />
• Der Praxisanleiter bespricht mit dem Auszubildenden den Standard <strong>der</strong> Einrichtung zur<br />
Versorgung Verstorbener. Dabei werden pflegepraktische, rechtliche, trauerpsychologische<br />
<strong>und</strong> organisatorische Fragen geklärt. Wichtig für dieses Gespräch: angenehme, ungestörte<br />
Atmosphäre<br />
• Sie besprechen gemeinsam die bisherigen Erfahrungen (o<strong>der</strong> Vorstellungen) im Umgang<br />
mit Toten.<br />
• Der Praxisanleiter spricht eventuelle Ängste an; die Schritte <strong>der</strong> Heranführung werden abgesprochen<br />
<strong>und</strong> auf den Auszubildenden hin abgestimmt (Impuls: „Was könnte Ihnen/Dir<br />
den ersten Umgang mit Verstorbenen erleichtern?“)<br />
• (Heim/Klinik) Der Praxisanleiter zeigt den Aufbahrungsraum (ohne aufgebahrten Toten)<br />
<strong>und</strong> bespricht die Wirkung des Raumes auf den Auszubildenden.<br />
2. Schritt: Begegnen<br />
• Der Praxisanleiter fragt bei einem aktuellen Todesfall, ob <strong>der</strong> Auszubildende in seinem<br />
Beisein den Verstorbenen anschauen möchte (ohne pflegerische Handlung).<br />
• Der Praxisanleiter bietet ein Vorbild für die persönliche Verabschiedung (z. B. Verbeugung,<br />
Gebet, „Anrede <strong>der</strong> Toten“, Berührung).<br />
• Der Praxisanleiter fragt nach, wie es dem Auszubildenden geht.<br />
• Der Praxisanleiter ermutigt den Auszubildenden, den toten Menschen zu berühren (ohne<br />
Zwang).<br />
• Der Praxisanleiter lädt den Auszubildenden zu einem einrichtungsüblichen Verabschie-<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
260
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
dungsritual ein (z.B. Aussegnung).<br />
3. Schritt: Mitwirken bei <strong>der</strong> Versorgung <strong>und</strong> Aufbahrung<br />
• Der Praxisanleiter lädt den Auszubildenden ein, nach seinen Möglichkeiten bei <strong>der</strong> Versorgung<br />
mitzuwirken. Er lässt ihm dabei die Freiheit auch wie<strong>der</strong> abzubrechen, wenn es<br />
ihm zu viel wird.<br />
• Der Praxisanleiter sorgt dafür, dass die Versorgung in einer Atmosphäre <strong>der</strong> Ruhe <strong>und</strong><br />
Besinnung passiert. Er ist Vorbild in dieser Situation. (Er kann z. B. auf den Frieden, <strong>der</strong><br />
oft auf den Gesichtern von Verstorbenen liegt, aufmerksam machen o<strong>der</strong> wie in einer<br />
Pflege bei Lebenden mit dem Verstorbenen sprechen)<br />
• Der Praxisanleiter erklärt den jeweiligen nächsten Schritt <strong>und</strong> bereitet vor <strong>der</strong> jeweiligen<br />
pflegerischen Handlung den Auszubildenden auf eventuell irritierende o<strong>der</strong> erschreckende<br />
Phänomene vor (z. B. Seufzerlaute beim Drehen des Verstorbenen durch entweichende<br />
Luft, Austreten von Körperflüssigkeit usw.)<br />
Auswertung:<br />
• Der Praxisanleiter nimmt sich Zeit für ein anschließendes Gespräch mit dem Auszubildenden<br />
(Impuls: „Wie haben Sie/hast Du die Situation erlebt?)<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
261
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
262
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Standard mit Gesprächsimpulsen<br />
In die Sterbebegleitung einführen 1<br />
Praxisanleitung: Auszubildende auf Sterben <strong>und</strong> Trauer vorbereiten<br />
Ziele<br />
• Die Auszubildenden können eigene Erfahrungen <strong>und</strong> eigenes Wissen, persönliche Vermutungen<br />
<strong>und</strong> Ängste im Gespräch reflektieren <strong>und</strong> fühlen sich ernst genommen.<br />
• Die Auszubildenden kennen Leitgedanken <strong>und</strong> (heiminterne) Beson<strong>der</strong>heiten bei <strong>der</strong> Begleitung<br />
<strong>und</strong> Pflege sterben<strong>der</strong> Menschen<br />
• Die Auszubildende erhalten Informationen zu Fragen, die sie bewegen.<br />
• Der Praxisanleiter erkennt eventuelle Ängste im Vorfeld <strong>und</strong> kann individuell unterstützten.<br />
• Die Auszubildende <strong>und</strong> Praxisanleiter treffen Vereinbarungen zu praktischen Hinführung<br />
<strong>und</strong> bleiben zum Thema im Gespräch.<br />
Durchführung<br />
Zeitpunkt: Im Rahmen eines Anleitungstages möglichst im 1. Ausbildungsjahr<br />
1. Schritt: Persönliche Erzählungen als Einstieg<br />
Der Praxisanleiter erzählt, wie er die erste (berufliche) Konfrontation mit dem Sterben erlebt<br />
hat. Er kann berichten, was ihm damals eventuell geholfen hat o<strong>der</strong> was er an Unterstützung<br />
vielleicht vermisst hat o<strong>der</strong> er sich gewünscht hätte. Dieser persönliche Einstieg soll die Auszubildenden<br />
im weiteren Gespräch ermutigen, auch ihre Ängste o<strong>der</strong> Wünsche zu äußern.<br />
(„Coole Fassade ist nicht notwendig!“)<br />
2. Schritt: Über Erfahrungen ins Gespräch kommen, den Wissenstand erk<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
Fragen sammeln<br />
Impulse<br />
• „Was hast Du / habt Ihr in <strong>der</strong> Schule schon zum Thema Sterbebegleitung gehört o<strong>der</strong><br />
1 Entwickelt in einer Fortbildung zum Thema am 02.07.2009 im Alten- <strong>und</strong> Pflegeheim St. Augustin <strong>der</strong> Barmherzigen Brü<strong>der</strong> in<br />
Neuburg a.d.D.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
263
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
gelernt?“<br />
• „Was hast Du / habt Ihr hier in <strong>der</strong> Einrichtung schon erlebt o<strong>der</strong> besprochen?“<br />
• „Was interessiert Dich / Euch zum Thema Sterbebegleitung beson<strong>der</strong>s?“<br />
• „Gibt es etwas, das Dir / Euch Sorgen bereitet?“ (Evtl. nachfragen, wie o<strong>der</strong> in welcher Situation<br />
die Ängste entstanden o<strong>der</strong> aufgetaucht sind)<br />
3. Schritt: Gezielt informieren, Fragen <strong>und</strong> Ängste aufgreifen<br />
Leitgedanken<br />
• Das Heim ist in <strong>der</strong> Regel das letzte Zuhause. Beobachtung <strong>der</strong> letzten Jahre: Die Menschen<br />
kommen in die Einrichtung immer älter, immer kränker, die verbleibende Lebenszeit<br />
im Heim wird immer kürzer. Die Sterberate ist 50% pro Jahr im Durchschnitt<br />
• Sterben ist ein natürlicher Prozess. Der Anblick eines Toten ist nicht grauenvoll (wie im<br />
gewaltsamen Fernseh-Thriller)<br />
• Je<strong>der</strong> stirbt seinen eigenen Tod. Wir müssen uns lösen von eigenen idealisierten Vorstellungen,<br />
wie ein „guter Tod“ aussehen sollte.<br />
• Das Sterben liegt nicht in unserer Macht. Wenn jemand stirbt, müssen sich Pflegekräfte<br />
nicht schuldig fühlen.<br />
• Betroffenheit (z. B. Tränen) sind <strong>kein</strong> Zeichen fehlen<strong>der</strong> Distanz o<strong>der</strong> „Professionalität“,<br />
son<strong>der</strong>n spiegeln persönliche Beziehungen, die in <strong>der</strong> Pflege entstehen können. Alle Gefühle<br />
sind in Ordnung (z. B. auch Erleichterung). Offenheit <strong>und</strong> Erzählen-Dürfen schützen<br />
vor Überfor<strong>der</strong>ung <strong>und</strong> sind wichtiger Teil einer „professionellen Haltung“..<br />
Basisinformationen (Auf was achten wir in <strong>der</strong> Einrichtung?)<br />
o Achtsamkeit gegenüber Angehörigen<br />
o Schmerzlin<strong>der</strong>ung, Symptomkontrolle (z. B. Atemnot)<br />
o Wünsche, die für die Situation erfasst worden sind (siehe Beispiele Dokumentation)<br />
o Oft verän<strong>der</strong>te Reaktionen (Achtung: Wünsche können sich än<strong>der</strong>n!)<br />
o Auch wenn <strong>der</strong> Betroffene anscheinend nicht mehr reagiert, sprechen wir ihn bei allen pflegerischen<br />
Handlungen immer an <strong>und</strong> erklären, was wir tun.<br />
o Pflege nach Absprache im Team immer anpassen. Leitfrage: Was belastet den Sterbenden<br />
vielleicht nur? Wir dürfen weglassen, was quält!<br />
o Was passiert nach dem Versterben im Haus? Informieren über die Regelungen <strong>der</strong> Einrichung<br />
Der Praxisanleiter macht die Informationen mit Beispielen anschaulich <strong>und</strong> fragt im Gespräch<br />
nach, was die Auszubildende beson<strong>der</strong>s interessiert.<br />
4. Schritt: Weitere Schritte <strong>und</strong> Umgang mit Belastungen besprechen<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
264
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
� Der Praxisanleiter klärt mit den Auszubildenden, wie sie an die Aufgabe <strong>der</strong> Sterbebegleitung<br />
herangeführt werden möchten (z. B. mit ins Zimmer gehen dürfen, ohne gleich pflegerisch<br />
aktiv werden zu müssen). Er sorgt dafür, dass diese Vereinbarungen im Pflegeteam<br />
bekannt sind.<br />
� Der Praxisanleiter ermutigt dazu, sich bei Problemen, die mit den KollegInnen vor Ort nicht<br />
ausreichend zu klären sind, sich an die Praxisanleitung zu wenden.<br />
� Die Praxisanleitung zeigt weitere Möglichkeiten, sich den Themen Sterben, Tod <strong>und</strong> Trauer<br />
anzunähern (z. B. Teilnahme an Abschiedsritual, Gedenkfeier, Besichtigung des Aufbahrungsortes,<br />
Anschauen des Bildbandes „Noch einmal leben vor dem Tod“ 1 )<br />
� Der Praxisanleiter gibt die Konzeption/Standards zur Sterbegleitung an die Auszubildenden<br />
zum Lesen mit. „Welche Informationen findest Du beson<strong>der</strong>s wichtig?“ „Wo hast Du<br />
Fragen?“ Der Praxisanleiter vereinbart die Gelegenheit <strong>und</strong> den Zeitpunkt, um über Konzeption<br />
<strong>und</strong> Standards zu sprechen.<br />
� Der Praxisanleiter fragt nach, welche Unterstützung sich die Auszubildenden noch wünschen?<br />
:<br />
Nachbereitung<br />
Der Praxisanleiter sucht regelmäßig (alle zwei Monate) das Gespräch mit den Auszubildenden:<br />
„Wie geht es Dir/Euch mit <strong>der</strong> Anleitung vor Ort“ „Gibt es Erfahrungen in <strong>der</strong> Sterbebegleitung?“<br />
1 LAKOTTA B., SCHELS W.: Noch mal Leben vor dem Tod. Wenn Menschen sterben. Deutsche Verlags-Anstalt<br />
<strong>München</strong> 2004<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
265
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Entwurf Ablaufplanung<br />
Angehörigenabend zur Patientenverfügung<br />
Lernphasen, Lernziele, Inhalte, Methoden <strong>und</strong> benötigtes Material<br />
Titel: Liebe Dein Leben <strong>und</strong> denk’ an den Tod – Vorsorge treffen<br />
Zeit Lernphase / Ziele<br />
19:00 Einsteigen 1<br />
Ziel: Die Tn erfahren<br />
die Diskrepanz zwischen<br />
eindeutiger<br />
Rechtslage <strong>und</strong> dem<br />
verwirren<strong>der</strong> Bild in<br />
den Medien<br />
19:10 Einsteigen 2<br />
Ziel: Die Tn kommen<br />
in persönlichen<br />
Kontakt <strong>und</strong> präzisieren<br />
ihre Erwartungen<br />
19:20 Erarbeiten 1<br />
Ziel: Die Tn erhalten<br />
einen Einblick in<br />
rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
erfahren die unterschiedlicheHaltungen<br />
von Ärzten.<br />
Methoden<br />
Inhalte<br />
Kurze Begrüßung<br />
Methode Erzählen<br />
Schlagzeilen<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Der Kursleiter (Kl) liefert über Zeitungsschlagzeilen<br />
Beispiele für die Verwirrung<br />
bei <strong>der</strong> Sterbehilfe. Ziel des Abends:<br />
Klarheit.<br />
Motto: „Die Rechtslage ist eindeutig!“<br />
Der Kl liefert einen Überblick über die<br />
Schritte des Abends an <strong>der</strong> Flipchart<br />
Methode Partnergespräch:<br />
„Meine Fragen“<br />
Die Tn machen sich mit den Nachbarn<br />
(zu zweit o<strong>der</strong> zu dritt bekannt). Sie<br />
schreiben ihre Fragen auf Karten (1<br />
Frage = 1 Karte!). Der Kl sammelt die<br />
Beiträge <strong>und</strong> fragt evtl. nach, wenn die<br />
Formulierung unklar ist.<br />
Hinweis: Die Fragen dienen als Ausgangspunkt<br />
für die „Expertenbefragung“<br />
Methode Videobetrachtung<br />
„Leben wi<strong>der</strong> Willen“<br />
Im Film kommen unterschiedliche<br />
Sichtweisen von Ärzten zu Wort. Ein<br />
Verfassungsrichter klärt die Rechtlage.<br />
An mehreren Schicksalen wird die<br />
rechtsbrüchige Praxis, aber auch Wege<br />
des Sterben Zulassens gezeigt.<br />
Impulse für die Filmbetrachtung<br />
• Welche Informationen finde ich<br />
wichtig?<br />
• Wo habe ich Antworten erhalten auf<br />
meine Fragen?<br />
• Welche Fragen stellen sich mir?<br />
Sozialform<br />
Verantwortlich<br />
Materialien / Medien<br />
Plenum � CD-Player mit Hintergr<strong>und</strong>musik<br />
vor<br />
<strong>der</strong> Veranstaltung (löst<br />
evtl. Beklemmung<br />
beim Warten)<br />
Partnerarbeit<br />
Plenum<br />
� Folie o<strong>der</strong> Plakat<br />
mit montierten<br />
Zeitungsschlagzeilen<br />
� Flipchart<br />
� Karten (Din A4<br />
längs)<br />
� Dicke Filzstifte<br />
� Evtl. Klemmbretter<br />
zum Schreiben<br />
� Pinnwand („Unsere<br />
Fragen“)<br />
� DVD-Player +<br />
Fernseher o<strong>der</strong><br />
Beamer + Laptop<br />
+ Lautsprecher<br />
� Film „Leben wi<strong>der</strong><br />
Willen“<br />
aus <strong>der</strong> Reihe „Sterben<br />
verboten“<br />
266
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Zeit<br />
Lernphase / Ziele<br />
Methoden<br />
Inhalte<br />
20:00 Transfer 1 Methode Kugellager<br />
20:15<br />
Ziel: Gibt Raum für<br />
Erzählungen <strong>und</strong><br />
persönliche Betroffenheiten<br />
20:25 Transfer 2<br />
Ziel: Die Tn gewinnen<br />
Klarheit auf ihre<br />
Fragen<br />
20:50 Auswertung 1<br />
Ziel: Die Tn reflektieren<br />
persönliche<br />
Konsequenzen<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Anleitung: Die Tn setzen sich in einen<br />
Innenkreis <strong>und</strong> in einem Außenkreis<br />
paarweise gegenüber. Die Leitung gibt<br />
einen Impuls/eine Frage für den wechselseitigen<br />
Erfahrungs- <strong>und</strong> Meinungsaustausch<br />
zwischen den jeweiligen<br />
Partnern.<br />
Die Leitung beendet die Gespräche<br />
jeweils nach ca. 5 Min. z. B. durch einen<br />
Gongschlag. Danach setzen sich<br />
die Tn gegenläufig (= „Kugellager“) einen<br />
Stuhl weiter, so dass neue Partner<br />
für das nächste Gespräch zusammenkommen.<br />
Impulse, z. B.:<br />
• Welche Informationen waren für<br />
mich neu o<strong>der</strong> wichtig?<br />
• Was gilt es bei <strong>der</strong> Vorsorge zu bedenken?<br />
Was wäre meine Antwort<br />
auf die Frage „Wollen Sie Ihren Vater<br />
/ Ihre Mutter verhungern <strong>und</strong><br />
verdursten lassen?“<br />
• Welche Frage hat sich für mich geklärt?<br />
Welche Fragen stellen sich<br />
mir noch? Auftrag: Karte schreiben<br />
für die Pinnwand<br />
Sozialform<br />
Verantwortlich<br />
Materialien / Medien<br />
Partnerarbeit � Karten<br />
� Dicke Filzstifte<br />
� Evtl. Klemmbretter<br />
zum Schreiben<br />
� Pinnwand („Unsere<br />
Fragen“)<br />
Pause � Pausengetränke<br />
Methode „Expertenbefragung“<br />
Was ich noch wissen will …<br />
Die Tn haben die Möglichkeit, offene<br />
Fragen zu stellen, die bisher <strong>kein</strong>en<br />
Platz o<strong>der</strong> Antwort gef<strong>und</strong>en haben.<br />
Der Kl o<strong>der</strong> ein eingeladener Referent<br />
greift Fragen an <strong>der</strong> Pinnwand auf <strong>und</strong><br />
klärt diese.<br />
Beispiele:<br />
• Reichweite <strong>der</strong> Patientenverfügung<br />
• Formulierungsvorschläge<br />
Usw.<br />
Methode Partnergespräch<br />
Impuls: Mein nächster Schritt? Die Tn<br />
äußern laut Überlegungen o<strong>der</strong> besprechen<br />
diese mit dem Nachbarn<br />
�<br />
Plenum � Vorlage<br />
Pat.Verfügungen<br />
<strong>und</strong> Vorsorgevollmachten<br />
Plenum �<br />
� Literatur<br />
267
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
20:55 Auswertung 2<br />
Ziel: Die Tn bewerten<br />
den persönlichen<br />
Nutzen <strong>der</strong> Veranstaltung<br />
Methode: Punktabfrage<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
Verabschiedung „Wie gehe<br />
ich nach Hause?“<br />
Anleitung: „Bitte machen Sie im Hinausgehen<br />
auf <strong>der</strong> Skala („Viel gebracht<br />
… Nichts gebracht) einen Punkt.<br />
Danke!“<br />
Einzelarbeit � Flipchart mit Grafik<br />
� Stift zum Bepunkten<br />
268
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Gr<strong>und</strong>lagentext <strong>und</strong> Handlungsanleitung<br />
Umgang mit „Schuldgefühlen“ 1<br />
Unterscheidungen <strong>und</strong> Anregungen für unterstützende Gespräche<br />
Kennen Sie das: Angehörige, die sich quälen, weil sie in den Minuten des Sterbens nicht am<br />
Bett anwesend waren, o<strong>der</strong> die sich Vorwürfe machen, dass sie trotz aufopfern<strong>der</strong> Pflege Leiden<br />
<strong>und</strong> Tod nicht verhin<strong>der</strong>n konnten? O<strong>der</strong> Schwerkranke, die sich <strong>und</strong> Gott anklagen? „Überhaupt<br />
ist bei Schicksalsschlägen die Schuldfrage allgegenwärtig.“ (RENZ 2006: 97)<br />
O<strong>der</strong> ich gerate als Begleiter selbst in Not <strong>und</strong> mache mir Vorwürfe, z. B. zu wenig Zeit gegeben<br />
zu haben. Wie lassen sich Schuldgefühle verstehen? Wie kann ich an<strong>der</strong>e (<strong>und</strong> mich) bei<br />
auftauchenden Schuldgefühlen unterstützen?<br />
Unterscheidungen: Schuld, Schuldgefühle, Schuldgedanken<br />
„Schuld ist untrennbar mit dem Menschsein verb<strong>und</strong>en. … Diese Schuldfähigkeit weist auf<br />
Freiheit hin; Freiheit im Tun wie auch Freiheit, er selbst zu sein.“ (STÄHLI 2004: 33).<br />
Ich unterscheidet zwischen Schuld <strong>und</strong> Schuldgefühlen o<strong>der</strong> - in <strong>der</strong> Begrifflichkeit von M.<br />
HIRSCH (1998: 12 f.) - zwischen realen <strong>und</strong> irrealen Schuldgefühlen (ähnlich: KÜBLER-<br />
ROSS, KESSLER 2001: 117). Schuld o<strong>der</strong> Verantwortung hat etwas mit Wissen, Können, Absichten<br />
zu tun. Schuldig werde ich, wenn ich<br />
� etwas besser gewusst habe<br />
� etwas besser gekonnt hätte<br />
� etwas auch so beabsichtigt habe<br />
In Schuldgefühlen wuchert die oft unbewusste Anmaßung an sich selbst, alles zu wissen o<strong>der</strong><br />
in seinen Folgen zu überblicken <strong>und</strong> für alles verantwortlich o<strong>der</strong> im Handeln (all)mächtig zu<br />
sein. Der Blick ist grüblerisch in die Vergangenheit gerichtet. Typisch ist das gedankliche Drehen<br />
im Kreis: „Ach, hätte ich doch …!“ Wenn ich etwas nicht gewusst, gekonnt, gewollt habe,<br />
ist das Geschehene nicht schuldhaft, son<strong>der</strong>n tragisch zu nennen. Schuld dagegen ist maßvoll:<br />
„Ja, da habe ich einen Fehler gemacht.“ Der Blick richtet sich in die Zukunft.<br />
Eine zweite wichtige Differenzierung: Schuldgefühle sind <strong>kein</strong>e direkten Gefühle wie etwa<br />
Wut, Liebe, Angst. Sie sind Gedanken. Schuldgedanken sind Interpretationen. Ich sitze inner-<br />
1<br />
Der Beitrag von M. Alshemer ist eine überarbeitete Version des Unterrichtsmoduls „Schuld <strong>und</strong> Schuldgefühle“ im Rahmen des<br />
Projektes „Palliative Care – Lehren, Lernen, Leben“ (www.dgpalliativmedizin.de) Erschienen in: Hospiz-Dialog NRW 11/2008<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
269
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
lich zu Gericht (PAUL 2006:: 77). Ich kann diese den Betroffenen nicht einfach mit einem<br />
„Freispruch“ wegnehmen o<strong>der</strong> wegreden, son<strong>der</strong>n es braucht Raum, Geduld <strong>und</strong> Klärungshilfen,<br />
um tatsächliche Verantwortung von überhöhten Selbstansprüchen zu trennen. Das sind<br />
oft lange Verwandlungsprozesse.<br />
Unterscheidungen: Schuldgedanken als „psychische Last“ <strong>und</strong><br />
Schuldgedanken als „psychische List“<br />
Ich möchte zwei Zugänge o<strong>der</strong> Ansätze zum Umgang mit Schuldgefühlen o<strong>der</strong> Schuldgedanken<br />
eröffnen <strong>und</strong> Gesprächsimpulse durchspielen.<br />
Ein erstes Verständnis: Ich habe Regeln meiner inneren Wertewelt gebrochen <strong>und</strong> habe deshalb<br />
Schuld- <strong>und</strong> Bestrafungsgedanken. Bei perfektionistischen Ansprüchen können Schuldgefühle<br />
zum erdrückenden „Ballast“ werden.<br />
Einen zweiten Ansatz zum Verständnis von Schuldgedanken verdanke ich <strong>der</strong> Trauerbegleiterin<br />
Chris Paul: Meine Welt (Beziehungen, Ordnung, Kontrolle) ist zerbrochen <strong>und</strong> ich brauche<br />
deshalb Schuldgedanken als zunächst hilfreichen „Klebstoff“ o<strong>der</strong> als „schützende Hülle“, die<br />
Erklärungen liefern für Unerklärbares <strong>und</strong> Bindungen, z.B. zum Verstorbenen, aufrechterhalten.<br />
Hier haben Schuldgedanken zunächst eine entlastende Funktion: „Schuld als affektivkognitives<br />
Phänomen kann Angehörige von Sterbenden, Mitarbeitenden auf Palliativstationen,<br />
Sterbenden selbst <strong>und</strong> Angehörigen nach dem Tod viele schwierige Fragen <strong>und</strong> Situationen<br />
erleichtern.“ (PAUL 2002: 17). Ich bezeichne diese Schuldgedanken als „psychische List“, die<br />
das Unerträgliche vorübergehend erträglicher macht.<br />
Diese Differenzierungen sind wichtig. Je nachdem, welche Funktion Schuldgefühle haben,<br />
werden die Möglichkeiten <strong>der</strong> Unterstützung im Gespräch an<strong>der</strong>s aussehen. Im ersten Fall<br />
kann es eine Entlastung werden, im Gespräch die tatsächliche Verantwortung zu prüfen.<br />
(„Realitätsprüfung“ WORDON 2007). Sie ermöglichen, Schuldgefühle eventuell in bewusst<br />
angenommene Schuld zu verwandeln, die Verantwortlichkeiten zu relativieren o<strong>der</strong> ganz aufzulösen.<br />
Im zweiten Fall geht es um das langsame Entwickeln an<strong>der</strong>er Bindungsmöglichkeiten<br />
(z. B. Dankbarkeit), die Schuldgefühle ablösen können.<br />
Wie kann ich im Gespräch unterstützen? Ich spiele einige Gesprächsimpulse, mögliche Wirkungen<br />
<strong>und</strong> Reaktionen am Beispiel <strong>der</strong> anfangs genannten Selbstvorwürfe durch: Eine Angehörige,<br />
Tochter eines Verstorbenen im Pflegeheim, grämt sich, dass sie in <strong>der</strong> Zeit des unmittelbaren<br />
Sterbens nicht anwesend war. Mir geht es bei den Impulsen natürlich nicht um<br />
Gesprächsformeln, son<strong>der</strong>n um die Anschaulichkeit des Gesprächssituation.<br />
Gesprächshilfen für Schuldgedanken als psychische Last<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
270
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
1. Schuldgefühle ernst nehmen<br />
Gesprächsimpuls: „Ich kann mir vorstellen, es ist nicht einfach für Sie, das auszusprechen“<br />
2. Die Perspektive/Blickrichtung wechseln lassen (LÜCKEL 1990)<br />
Gesprächsimpuls: „Was würde denn <strong>der</strong> Betroffene wohl zu Ihnen sagen, wenn er Sie <strong>und</strong><br />
Ihre Selbstvorwürfe jetzt hören könnte?<br />
Eventuelle Wirkung: Meist ist die imaginierte (vermutete) Antwort wohlwollen<strong>der</strong> als <strong>der</strong><br />
Vorwurf, den sich die Betroffenen zunächst selbst machen.<br />
Beispiel für eine Reaktion: „Er hätte wohl gesagt: ‚Ist gut, Mädchen, ich weiß ja, dass Du<br />
mir gut bist …’ Das hat er oft zu mir gesagt, als ich ihn noch zuhause gepflegt habe …“<br />
2. Autorität <strong>und</strong> Anspruch <strong>der</strong> Vorwürfe prüfen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Macht Ihnen jemand diese Vorwürfe, die sie jetzt gerade geäußert haben?“<br />
„Wenn Sie diese Schuldvorwürfe „hören“, vernehmen Sie da eigentlich Ihre Stimme<br />
o<strong>der</strong> sagt das jemand an<strong>der</strong>er in diesem Ton zu Ihnen?“<br />
Eventuelle Wirkung: Manchmal sind Schuldgefühle übernommen. Die Frage hilft zu klären,<br />
ob diese Erwartungen auch wirklich die Selbstansprüche des Betroffenen sind o<strong>der</strong> ob die<br />
Maßstäbe von jemand übernommen wurden. Eine zusätzliche Frage kann etwas Distanz.<br />
„Finden Sie diesen Vorwurf an Sie berechtigt?.“<br />
Beispiel für eine Reaktion: „Ich glaube, es ist <strong>der</strong> alte Vorwurf, ‚Du bist nie da, wenn es<br />
darauf ankommt.’ Das sagt meine Schwester häufig. Aber das finde ich nicht berechtigt.<br />
Ich war die letzten Wochen oft im Krankenhaus …“<br />
3. Mit Erfahrungswissen entlasten<br />
Gesprächsimpuls: „Wir erleben es oft, dass Menschen anscheinend allein sein wollen im<br />
Sterben. Vielleicht brauchen sie hier noch einmal die ganze Kraft. Ich habe für mich eine<br />
bildhafte Vorstellung verb<strong>und</strong>en mit einer Frage, die mir hilft: ‚Aus welchem Zimmer würde<br />
ich leichter durch die Türe gehen: aus einem Zimmer, in dem Menschen sind, die ich liebe<br />
<strong>und</strong> die mich halten o<strong>der</strong> aus einem Zimmer, das leer ist?’“<br />
An<strong>der</strong>er Impuls: „Manchmal lässt sich ein Zusammenhang entdecken, was bei einem<br />
Menschen das Leben geprägt hat <strong>und</strong> was ihm nun im Sterben wichtig war. Vielleicht sehen<br />
Sie ja einen Zusammenhang zwischen Leben <strong>und</strong> Sterben bei Ihrem Vater?“<br />
Eventuelle Wirkung: Schuldgefühle sind oft Selbstvorwürfe in Einsamkeit <strong>und</strong> Nichtwissen.<br />
Erleichternd kann es sein, dass es an<strong>der</strong>en in solchen Situationen ähnlich erging o<strong>der</strong><br />
dass es entlastende Zusammenhänge gibt, die „professionelle o<strong>der</strong> erfahrene Autoritäten“<br />
aufzeigen.<br />
Beispiel für eine Reaktion: „Ja, mein Vater war schon immer eher ein Einzelkämpfer. Er<br />
hat vieles mit sich ausgemacht. Vielleicht wollte er auch bei diesem ‚letzten Kampf’ allein<br />
sein …“<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
271
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
4. Tatsächliches Wissen prüfen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Haben Sie es damals wirklich besser gewusst. Haben Sie gewusst o<strong>der</strong><br />
wissen können, dass Ihr Vater in den nächsten St<strong>und</strong>en stirbt?“<br />
Eventuelle Wirkung: Im Rückblick sind wir immer klüger. Entscheidend für Schuld o<strong>der</strong><br />
Unschuld ist aber unser Wissen in <strong>der</strong> damaligen Situation. Ansonsten maßen wir uns den<br />
(Über-)Anspruch des Hellsehen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Allwissenheit an. Die Frage führt zurück zum damaligen<br />
Wissensstand in <strong>der</strong> entscheidenden Situation, bzw. erinnert an die Unübersichtlichkeiten<br />
<strong>der</strong> Situation.<br />
Beispiel für Reaktion: „Nein, das habe ich nicht gewusst. Dass es ihm schlecht geht, ja,<br />
das schon. Aber dass er in <strong>der</strong> St<strong>und</strong>e stirbt, in <strong>der</strong> ich gerade im Auto nach Hause sitze,<br />
dass habe ich nicht geahnt. Auch die Schwestern vor Ort nicht. Die waren auch überrascht.“<br />
4. Tatsächlich vorhandene Handlungsmöglichkeiten prüfen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Sie machen sich den Vorwurf, dass Sie nicht da gewesen sind, son<strong>der</strong>n<br />
nach Hause gefahren sind. Es war ja nicht genau absehbar: Hätten Sie denn ganze<br />
Tage o<strong>der</strong> Wochen hier sein können, um zu verhin<strong>der</strong>n, dass Ihr Vater allein stirbt? Und<br />
was wäre mit Ihnen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>en Menschen vielleicht passiert, wenn Sie so gehandelt hätten?“<br />
Eventuelle Wirkung: Schuldgefühle entspringen oft einer großen Verantwortungsbereitschaft.<br />
Wir haben nicht nur Verantwortung gegenüber einer Person, son<strong>der</strong>n müssen<br />
Rücksicht auf uns selbst <strong>und</strong> auf an<strong>der</strong>e nehmen, mit denen wir auch verb<strong>und</strong>en sind. Die<br />
Frage löst aus <strong>der</strong> gedanklichen Fixierung auf eine Person <strong>und</strong> macht an<strong>der</strong>e Verantwortlichkeiten<br />
geltend. Sie relativiert den Anspruch <strong>der</strong> „Allmacht“ (= alles machen können).<br />
Beispiel für Reaktion: „Ich war gerade an diesem Tag völlig erschöpft wie ich gefahren bin.<br />
Ich war auch nur kurz bei ihm, weil ich so müde war <strong>und</strong> ich wusste, dass mein Sohn heute<br />
früher von <strong>der</strong> Schule nach Hause kommt …“<br />
5. Tatsächlich vorhandene Absicht überprüfen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Lag das in Ihrer Absicht, dass es jetzt so gekommen ist?“<br />
Eventuelle Wirkung: Auch die Rechtsprechung prüft die Absicht <strong>und</strong> fällt entsprechend<br />
Freispruch, mil<strong>der</strong>nde Umstände, z. B. „Fahrlässigkeit“, wenn eine Tatabsicht fehlte. Meist<br />
liegen <strong>kein</strong>e Absichten vor, jemanden zu schädigen.<br />
Beispiel für Reaktion: „Natürlich war es <strong>kein</strong>e Absicht. Ich wäre gerne bei ihm gewesen –<br />
aber vielleicht lag das ja nicht in <strong>der</strong> Absicht meines Vaters …“<br />
Gesprächshilfen: Schuldgedanken als psychische List<br />
Dieser Ansatz stammt von den Trauerberaterinnen Chris Paul <strong>und</strong> Monika Müller.<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
272
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
„Meine erste Beobachtung war: Manche Menschen, die sich schuldig fühlen, wollen ihre Schuld behalten <strong>und</strong> sind<br />
unter <strong>kein</strong>en Umständen bereit, sie sich ausreden zu lassen (…)<br />
Schuld kann Erklärungen geben, wo es <strong>kein</strong>e mehr gibt.<br />
Schuld kann eine, wenn auch eingebildete, Macht über Leben <strong>und</strong> Tod geben.<br />
Schuld kann Bindungen aufrechterhalten, die durch Sterben <strong>und</strong> Tod getrennt werden.<br />
Für all diese positiv nützlichen Funktionen des Prinzips Schuld sind unsere herkömmlichen Interventionen als Reaktion<br />
auf Schuldgefühle nutzlos. Solange Schuld positiven Nutzen erfüllt, liegt es nicht im Bedürfnis <strong>der</strong> sich<br />
schuldig Fühlenden <strong>und</strong> Denkenden, diese Schuld zu verlieren, zu vergeben o<strong>der</strong> verziehen zu bekommen. Vielmehr<br />
liegt es in ihrem Interesse, das zugr<strong>und</strong>e liegende Bedürfnis zu erkennen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Wege zu finden, dieses<br />
Bedürfnis zu erfüllen.“ PAUL 2002: 17)<br />
Wenn Schuldgedanken diese wichtige „Krücken-Funktion haben“ braucht es Zeit, bis an<strong>der</strong>e<br />
Deutungen wachsen können. Mögliche Gesprächsrichtungen könnten z. B. sein:<br />
• An<strong>der</strong>e Verbindungen wie z. B. Dankbarkeit mit dem Betroffenen suchen (Impuls: Wo fühlen<br />
Sie sich ihm nahe? Wofür sind Sie ihm dankbar? Was waren auch gute Zeiten?)<br />
• Rätselhaftes, fremdes Verhalten anerkennen? (Impuls: Was werden Sie wahrscheinlich<br />
nie verstehen können?<br />
• Unverzeihbares stehen lassen (Impuls: Was werden Sie dem an<strong>der</strong>en wahrscheinlich nie<br />
verzeihen können?)<br />
• Das „Warum“ in ein „Wozu“ verwandeln (Impuls: Gibt es in dem Geschehenen trotz allem<br />
einen Sinn für Ihr weiteres Leben?“)<br />
Was bleibt? Ausgleich, Wie<strong>der</strong>gutmachung, Vergebung<br />
Wenn Betroffene sich zu realen Versäumnissen bekennen, geht es um einen lebensför<strong>der</strong>nden<br />
Umgang mit <strong>der</strong> Schuld.<br />
1. Die Schuld besetzte Situation ausgleichen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Was hätten Sie vielleicht Ihrem Vater noch gerne gesagt? (Wenn Sie<br />
es nicht sagen möchten, vielleicht können Sie es aufschreiben …) Was hätten Sie vielleicht<br />
gerne noch von ihm gehört?<br />
Eventuelle Wirkung: Schuldgefühle entstehen aus Versäumnissen. Die Frage ermutigt,<br />
Ungesagtes o<strong>der</strong> Ungehörtes nachzuholen, um die Situation gut zu schließen <strong>und</strong> um sich<br />
damit von Schuldgefühlen „los zu schließen“.<br />
Beispiel für Reaktion: „Ich hätte ihm gerne noch gesagt, dass er ein guter Vater für mich<br />
war – auch wenn ich ihm das nicht so gezeigt habe …“<br />
2. Bei Schuld: Wie<strong>der</strong>gutmachung <strong>und</strong> Vergebung suchen (lassen)<br />
Gesprächsimpuls: „Wenn Sie sagen, Sie sind gefahren, obwohl Sie es wussten, dass es<br />
ein Fehler sein wird: Welche Wie<strong>der</strong>gutmachung gäbe es vielleicht?“ „Was müsste passie-<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
273
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
ren o<strong>der</strong> was könnten Sie tun, um es sich Verzeihen zu können?“ „Was würde Ihnen Ihr<br />
verstorbener Vater wohl für Ihr weiteres Leben wünschen?“)<br />
Eventuelle Wirkung: Schuld verlangt nach einem gewissen Ausgleich. Wenn dieser nicht<br />
direkt geleistet werden kann, sind vielleicht stellvertretende „Opfer“ möglich. Das „Opfer“<br />
darf allerdings nicht größer sein als die begangene Schuld. Sonst entsteht ein neues Ungleichgewicht,<br />
Leid <strong>und</strong> neue Schuld. Es genügt oft ein Bekenntnis zur Verantwortung, um<br />
Verzeihung zu bekommen o<strong>der</strong> sich selbst verzeihen zu können.<br />
Beispiel für Reaktion: „Mein Vater hat sich immer für den Sportverein eingesetzt. Das war<br />
sein Leben. Ich konnte damit ja nie viel anfangen. Ich werde in seinem Namen eine Spende<br />
machen <strong>und</strong> dafür sorgen, dass ein paar Tribünenbänke eine Plakette mit seinem Stifternamen<br />
bekommen …“<br />
Literatur<br />
HÜLSHOFF T.: Emotionen. 2. überarbeitete. Auflage. Verlag E. Reinhardt, <strong>München</strong>, Basel, 2001<br />
KÜBLER-ROSS E., KESSLER D.: Geborgen im Leben. Wege zu einem erfüllten Dasein. Kreuz Verlag, Stuttgart<br />
2001<br />
LÜCKEL K.: Begegnung mit Sterbenden. „Gestaltseelsorge“ in <strong>der</strong> Begleitung sterben<strong>der</strong> Menschen. Mit einem<br />
Vorwort von Hilarion Petzold. 3. Auflage. Kaiser Verlag, <strong>München</strong> 1990<br />
MÜLLER M., SCHNEGG M.: Unwie<strong>der</strong>bringlich – Vom Sinn <strong>der</strong> Trauer. Her<strong>der</strong> Verlag, Freiburg im Br. 2001<br />
PAUL C.: Schuldgefühle im Trauerprozess. Vortrag auf <strong>der</strong> AGUS-Jahrestagung 2002<br />
(http://www.veid.de/936.0.html)<br />
PAUL C.: Schuld-Denken <strong>und</strong> Schuld-Fühlen. Vortrag auf dem 5. Kongress <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin<br />
in Aachen 2004 (http://www.chrispaul.de/artikel.html<br />
PAUL C.: Warum hast du uns das angetan? Begleitbuch für Trauernde, wenn sich jemand das Leben genommen<br />
hat. 5. überarbeitete <strong>und</strong> erweiterte Auflage. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006<br />
RENZ M: Zeugnisse Sterben<strong>der</strong>. Todesnähe als Wandlung <strong>und</strong> letzte Prüfung. 3. Auflage. Jungfermann, Pa<strong>der</strong>born<br />
2006<br />
SPECHT-TOMANN M., TROPPER D.: Zeit des Abschieds. Sterbe- <strong>und</strong> Trauerbegleitung. 5. Auflage. Patmos Verlag,<br />
Düsseldorf 2005 (bes. 99-106)<br />
STÄHLI A.: Umgang mit Emotionen in <strong>der</strong> Palliativpflege. Ein Leitfaden. Kohlhammer, Stuttgart 2004<br />
WORDON W.: Beratung <strong>und</strong> Therapie in Trauerfällen. Hans Huber Verlag, Bern 2007<br />
WOLF, D.: Wenn Schuldgefühle zur Qual werden. Wie Sie Schuldgefühle überwinden <strong>und</strong> sich selbst verzeihen<br />
lernen. PAL Verlag, Mannheim 2006<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
274
Projekt-Werkstatt Hospizkultur - Kursmaterial<br />
…………………………………………………………………………………………<br />
Didaktisches Handbuch<br />
Anleitung Gruppenarbeit<br />
Vorbereitung eines Angehörigenabends<br />
• Wie würden Sie einladen?<br />
• Titel <strong>der</strong> Veranstaltung? Untertitel?<br />
• Ziele für den Abend nachprüfbar formulieren? (Die Angehörigen fühlen sich bgut informiert<br />
über …)<br />
• Inhalte: Welche Informationen sind Ihnen wichtig? Wie bringen Sie diese rüber (Medien/Methoden)<br />
Wie beteiligen Sie die Angehörigen?<br />
• Welche Reaktionen befürchten Sie evtl.? Wie bereiten Sie sich darauf vor?<br />
• Abschluss? Angebote darüber hinaus? Material zum Mitgeben?<br />
•<br />
…………………………………………………………………………………………………………………<br />
Stand: 26.04.2008 Redaktion: Martin Alsheimer<br />
275