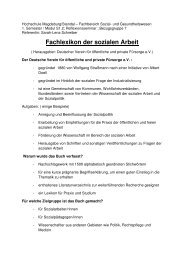Komplexes Modell methodischen Handelns - puwendt.de
Komplexes Modell methodischen Handelns - puwendt.de
Komplexes Modell methodischen Handelns - puwendt.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Alles hat Metho<strong>de</strong><br />
Vorlesung im Sommersemester 2010<br />
12. Juli 2010:<br />
<strong>Komplexes</strong> <strong>Mo<strong>de</strong>ll</strong> <strong>methodischen</strong> <strong>Han<strong>de</strong>lns</strong><br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
1. Anschluss an die Vorlesung am 7. Juli 2010<br />
Zur Erinnerung:<br />
• Case Management ist eingebettet in (aus Aspekten einer ver<strong>de</strong>ckten<br />
Ökonomisierung heraus) die Soziale Arbeit überwölben<strong>de</strong>n Überlegungen<br />
zu Effektivität und Effizienz, Kun<strong>de</strong>nmo<strong>de</strong>ll und Produktorientierung,<br />
betont dabei aber eine eigenständige fachliche Perspektive, ohne doch<br />
gänzlich für managerielle „Hoffnungen“ (bzw. Zwänge [Oktroys])<br />
unempfänglich zu sein.<br />
• Case Management <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit und Fallmanagement <strong>de</strong>r<br />
Beschäftigungsaktivierung nach <strong>de</strong>m BA-Fachkonzept stellen zwei<br />
gegenläufige Entwicklungen und ein Spannungsverhältnis dar: in<br />
Anbetracht seines autoritatives Zuschnitts kann das Fallmanagement nach<br />
<strong>de</strong>m SGB II nicht wirklich als Case Management gelten.<br />
• Case Management integriert eklektisch und fallspezifisch konfiguriert<br />
unterschiedliche Metho<strong>de</strong>n bzw. Instrumente <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
1
2.1. Metho<strong>de</strong>nbegriff (12. April 2010)<br />
• „Metho<strong>de</strong> ist <strong>de</strong>r theoretisch geklärte Handlungsplan, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r<br />
Rückschau erkannte und berechtigte Weg <strong>de</strong>r Praxis, <strong>de</strong>r sich in<br />
gewisser Gesichertheit planend in die Zukunft richtet, wenn auch<br />
immer in Bereitschaft, sich von erneuter Besinnung weiterhin<br />
korrigieren und berichtigen zu lassen“ (Erika Hoffmann)<br />
• Metho<strong>de</strong>n stellen - maximal offen für die Bedingungen und<br />
Rahmungen <strong>de</strong>s Fel<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r in ihm han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Akteure -<br />
Unterstützung als Anregung und Vermittlung bei <strong>de</strong>r Alltags- bzw.<br />
Lebensbewältigung <strong>de</strong>r Subjekte zur Verfügung;<br />
• zu differenzieren sind Metho<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n eigene<br />
Instrumente (bzw.: Instrumente sind Teile von Metho<strong>de</strong>n).<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.2.1. Methodisches Han<strong>de</strong>ln (19. April 2010)<br />
• Methodisches Han<strong>de</strong>ln in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ist stets methodisch<br />
strukturiert, d. h. situationsangemessen geplant (und daher situativ<br />
offen), als Prozess zirkulär gestaltet, durch Aushandlung und<br />
Vereinbarung mit <strong>de</strong>n Subjekten geprägt und flexibel angelegt.<br />
• Als methodisches Grundmo<strong>de</strong>ll liegt eine Abfolge aus Analyse<br />
(Bestandsaufnahme), methodischer (Vor-) Klärung (Wahl Metho<strong>de</strong>n<br />
und Instrumente), Aushandlung (Vereinbarungen, ggfs. Anpassung<br />
Metho<strong>de</strong>n/Instrumente), Realisierung (Vollzug <strong>de</strong>s Vereinbarten),<br />
Evaluation (Prüfung Ertrag/Erfolg) und ggfs. Rückspeisung in die<br />
Analyse (und Anpassung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>) bzw. Abschluss nahe.<br />
• Eingebettet ist dieses Grundmo<strong>de</strong>ll in geeignete Verfahren und<br />
Techniken <strong>de</strong>r Kontaktanbahnung und (sofern möglich) <strong>de</strong>s<br />
Abschlusses.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2
2.2.2. Methodisches Grundmo<strong>de</strong>ll<br />
methodische<br />
Klärung<br />
Aushandlung<br />
Kontakt<br />
Analyse<br />
Abschluss<br />
Realisierung<br />
Evaluation<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.3. Empowerment (3. Mai 2010)<br />
methodische<br />
Klärung<br />
Aushandlung<br />
Kontakt<br />
Analyse<br />
Abschluss<br />
Empowerment spielt in<br />
allen Phasen <strong>methodischen</strong><br />
<strong>Han<strong>de</strong>lns</strong> eine zentrale Rolle<br />
Realisierung<br />
Evaluation<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
3
2.4. Einzelfallarbeit (10. Mai 2010)<br />
• Die im Anschluss an <strong>de</strong>n US-amerikanischen Metho<strong>de</strong>ndiskurs und<br />
die durch <strong>de</strong>n Nationalsozialismus abgebrochene <strong>de</strong>utsche<br />
Metho<strong>de</strong>ndiskussion entwickelte „klassische“ Einzelhilfe ist in<br />
Deutschland im Zuge <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>nkritik <strong>de</strong>r 1960er/70er Jahren<br />
„generalüberholt“ wor<strong>de</strong>n.<br />
• Einzelfallarbeit heute stellt - partizipativ - auf lebensweltliche<br />
Bezüge, Kompetenzen und Quellen ab.<br />
• Eingeschlossen ist empowerment-orientiertes Han<strong>de</strong>ln, das<br />
(verborgene, „verschüttete“, vergessene) Ressourcen in <strong>de</strong>r<br />
Lebenswelt erschließt und protektive Faktoren als personale bzw.<br />
soziale Kompetenzen (in <strong>de</strong>r Lebenswelt) stimuliert.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.5. Soziale Beratung (17. Mai 2010)<br />
• Soziale Beratung ist keine Form <strong>de</strong>r Therapie; auf Ebene <strong>de</strong>r<br />
Beratungsbeziehung können gleichwohl Aspekte <strong>de</strong>r nicht-direktiven<br />
(therapeutisch-orientierten) Beratung eine zentrale Rolle spielen.<br />
• Soziale Beratung fin<strong>de</strong>t vor allem als Lebensberatung (und nur im<br />
<strong>de</strong>finierten/limitierten Ausnahmefall als Rechtsberatung) statt.<br />
• Zentral ist die Selbstklärung durch das Subjekt; Einschätzungen <strong>de</strong>s<br />
Beraters/<strong>de</strong>r Beraterin sind methodisches Hilfsmittel und in <strong>de</strong>r<br />
Problembewältigung nur nachrangig.<br />
• Unterschiedliche Instrumente (gesprächstrukturierend, inspirierend)<br />
kommen situationsangemessen und situationsreflexiv zum Einsatz.<br />
• Die Kompetenz <strong>de</strong>s/<strong>de</strong>r Sozialen zur situativen Selbstreflexion und<br />
Selbststeuerung bestimmt <strong>de</strong>n Verlauf und <strong>de</strong>r Ertrag <strong>de</strong>r Beratung<br />
(mit).<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
4
2.6. Hilfeplanung (31. Mai 2010)<br />
• Hilfeplanung ist als Teil <strong>de</strong>s Prozesses zur Bewältigung einer<br />
komplexen Situation o<strong>de</strong>r eines Problems in <strong>de</strong>r alltäglichen<br />
Lebensbewältigung zu verstehen.<br />
• Anamnestische und diagnostische Prozeduren sind integrale<br />
Bestandteile eines strukturierten Hilfeplanungsprozesses.<br />
• Hilfeplanung als methodisches Instrument dient auch <strong>de</strong>r<br />
I<strong>de</strong>ntifikation entwicklungsfähiger (personaler bzw. sozialer<br />
Ressourcen).<br />
• Verpflichtend ist die Beteiligung <strong>de</strong>r Subjekte, unterschiedlich<br />
allerdings <strong>de</strong>r Grad ihrer Einbindung und Selbst-Expertenschaft.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.7. Soziale Gruppenarbeit (7. Juni 2010)<br />
• Soziale Gruppenarbeit als Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit fußt auf<br />
Erkenntnisse <strong>de</strong>r Kleingruppenforschung und <strong>de</strong>r Gruppendynamik.<br />
• Sie schließt an die Erfahrung von Menschen unmittelbar an, dass in<br />
Gruppen Ergebnisse schneller, wirkungsvoller und auch von<br />
höherer Qualität erreicht wer<strong>de</strong>n können.<br />
• Soziale nutzen die Gruppe als „Ort“ pädagogischer Inszenierungen,<br />
gemeinsame Lernerfahrungen zu ermöglichen, in<strong>de</strong>m (ggfs.<br />
problematische) soziale Situationen aufgegriffen, thematisiert und<br />
bearbeitet wer<strong>de</strong>n und das Subjekt aus <strong>de</strong>r Gruppe heraus angeregt<br />
erhält, diese Situationen künftig (besser) bewältigen zu können.<br />
• Der/Die Soziale fungiert hierbei als Initiator/in, Motivator/in,<br />
Mo<strong>de</strong>rator/in und auch „Hilfs-Ich“, aber auch als Kontrolleur/in.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
5
2.8. Gemeinwesenarbeit/GWA (14. Juni 2010)<br />
• GWA als „klassische“ Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ist erst relativ<br />
spät (in <strong>de</strong>n späten 1960er Jahren) in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit<br />
Deutschlands „angekommen“.<br />
• Sie integriert in sich unterschiedliche methodische Ansätze und<br />
Instrumente.<br />
• GWA realisiert sich aktuell zunehmend mehr als stadtteilbezogenes<br />
Quartiersmanagement mit aktivieren<strong>de</strong>m Vollzugsanspruch.<br />
• Sozialen kommt hierbei die Funktion zu, als intermediäre Akteure<br />
zwischen <strong>de</strong>n „Welten“ (1. <strong>de</strong>r Lebenswelt <strong>de</strong>r Subjekte und 2. <strong>de</strong>n<br />
Aktivierungserwartungen <strong>de</strong>r staatlichen Politik) und ihren<br />
kontroversen Ansprüchen und Erwartungen (z. B. in Bezug auf <strong>de</strong>n<br />
generellen Anspruch und die Reichweite <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rung nach<br />
stärkerer Eigenverantwortung <strong>de</strong>r Individuen) zu vermitteln.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.9. Netzwerkarbeit (21. Juni 2010)<br />
• Netzwerke stellen im Kontext Sozialer Arbeit vor allem Ressourcen<br />
sozialer Unterstützung - emotional, kognitiv, interaktiv - zur<br />
Verfügung.<br />
• Natürliche wie künstliche Netzwerke entwickeln sich dynamisch. Ihr<br />
„Status“ wie ihre Verän<strong>de</strong>rungen sind netzwerkanalytisch zu<br />
betrachten.<br />
• Sozialen kommt die Aufgabe zu, <strong>de</strong>n Subjekten bei <strong>de</strong>r Nutzung<br />
(bzw. Akquise, Entwicklung, Stabilisierung, Reaktivierung) <strong>de</strong>r in<br />
Netzwerken eingelegten Ressourcen Unterstützung zu geben (Netzwerkarbeit<br />
1. Ordnung).<br />
• Ihr intermediärer Zugang verlangt von <strong>de</strong>n Sozialen die eigener (1.<br />
organisationsbezogener und 2. persönlicher) Netzwerke, um selbst<br />
Netzwerkarbeit leisten zu können (Netzwerkarbeit 2. Ordnung).<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
6
2.10. Sozialmanagement (28. Juni 2010)<br />
• Sozialmanagement als relativ neuer Bereich in <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit nimmt in erster Linie nicht <strong>de</strong>n Fall o<strong>de</strong>r das Feld in<br />
<strong>de</strong>n Blick, son<strong>de</strong>rn die Prozesse, die bei <strong>de</strong>r Bearbeitung eines Falles<br />
o<strong>de</strong>r im Handlungsvollzug im Feld eine Rolle spielen.<br />
• Mit <strong>de</strong>n Instrumenten <strong>de</strong>s Sozialmanagements wer<strong>de</strong>n Prozesse und<br />
Organisationen in Bezug auf gegebene Optimierungspotenziale<br />
überprüft, um so zu einer höheren Effizienz <strong>de</strong>s Mitteleinsatzes und<br />
einer höheren Effektivität in Bezug auf <strong>de</strong>n Grad <strong>de</strong>r Erreichung<br />
bzw. Realisierung gesetzter Ziele beizutragen.<br />
• Relativ neu ist <strong>de</strong>r Versuch, auf Grundlage einer sog. Evi<strong>de</strong>nzbasierung<br />
im Verweis auf gelungene Prozesse bzw. <strong>de</strong>r<br />
Dokumentation gelungenen Instrumenteeinsatzes faktisch zur<br />
Standardisierung sozialen <strong>Han<strong>de</strong>lns</strong> beizutragen.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
2.11. Case-/Fallmanagement (5. Juli 2010)<br />
• Case Management (CM) integriert eklektisch und fallspezifisch<br />
konfiguriert unterschiedliche Metho<strong>de</strong>n und (v. a.) Instrumente <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Arbeit.<br />
• CM ist eingebettet in die Soziale Arbeit überwölben<strong>de</strong>n<br />
(ökonomistischen) Überlegungen zu Effektivität und Effizienz,<br />
Kun<strong>de</strong>nmo<strong>de</strong>ll und Produktorientierung, betont dabei aber eine<br />
eigenständige fachliche Perspektive, ohne doch gänzlich für<br />
managerielle „Hoffnungen“ unempfänglich zu sein.<br />
• CM <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit und Fallmanagement im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
Beschäftigungsaktivierung nach <strong>de</strong>m BA-Fachkonzept (FM) stellen<br />
zwei gegenläufige Entwicklungen und ein Spannungsverhältnis dar:<br />
in Anbetracht seines autoritativen Zuschnitts kann das FM nicht als<br />
Case Management, son<strong>de</strong>rn bloß als Fallverwaltung gelten.<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
7
3.1. Metho<strong>de</strong>n als Kunst 1.1<br />
Einige Statements aus <strong>de</strong>r Praxis:<br />
• Sozialberater: „das kann man nicht lernen, das ist Erfahrung“<br />
• Jugendarbeiter: „dass man sowohl mit Nähe als auch mit Distanz<br />
umgehen kann, aber auch gleichzeitig rüberbringen muss, dass man<br />
nicht nur mit <strong>de</strong>n Jugendlichen arbeitet, (son<strong>de</strong>rn auch) mit<br />
Erwachsenen, dass man in <strong>de</strong>r Lage ist, Vertrauen aufzubauen“<br />
• ASD-Mitarbeiterin: „das ist halt heute so, und morgen schon wie<strong>de</strong>r<br />
so an<strong>de</strong>rs“<br />
• Jugendarbeiter: „Ehrlichkeit, dass man nicht verlogen sein darf, dass<br />
man ganz klar rüberbringen muss, dass man selbst kein<br />
Jugendlicher mehr ist. (…) Das ist etwas sehr Wichtiges, dass man<br />
ein bisschen echt rüberkommt und nicht als <strong>de</strong>r Sozialarbeiter o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> kommt, <strong>de</strong>r kontrolliert, son<strong>de</strong>rn da<br />
muss sich mehr entwickeln“<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
3.1. Metho<strong>de</strong>n als Kunst 1.2<br />
• Jugendarbeiterin „Wie ich mit <strong>de</strong>n Jugendlichen umgehe, das ist<br />
je<strong>de</strong>s Mal verschie<strong>de</strong>n, man weiß auch nicht, in welche Situation<br />
man kommt, aber mitunter unterdrückt man schon seine eigenen<br />
Bedürfnisse o<strong>de</strong>r das, was einen quält, und schauspielert es an<strong>de</strong>rs<br />
raus, und auf einmal hören sie dann doch alle zu. Es ist manchmal<br />
ein leises Gespräch, manchmal wird es ganz laut, aber die<br />
Flexibilität muss da sein“<br />
• Berufsberaterin: „Mir brauch‘ man nichts vorzumachen, ich seh‘ das<br />
sofort“<br />
• Schulsozialarbeiterin: „heute ist es notwendig, Vereinbarungen<br />
(schriftlich; PUW) zu schließen, früher ging das noch auf Grundlage<br />
persönlicher Absprachen“<br />
• Stu<strong>de</strong>nt 2. Semester: „Sozialarbeiter müssen gute Schauspieler sein“<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
8
3.1. Metho<strong>de</strong>n als Kunst 1.2<br />
Wie hängt das zusammen?<br />
O<strong>de</strong>r: Wenn <strong>de</strong>r Wald vor lauter Bäumen …:<br />
• „Wenn Sie direkt vor einem Baum stehen, ist es ziemlich dunkel,<br />
ziemlich unscharf konturiert, es zeigt sich kein Weg am Hin<strong>de</strong>rnis<br />
vorbei.<br />
• Gehen Sie einen Schritt zurück, sehen Sie etwas an<strong>de</strong>res – einen<br />
Baum, viele Bäume, vielleicht sogar einen Weg zwischen <strong>de</strong>n<br />
Bäumen.<br />
• Gehen Sie noch drei Schritte zurück, erklimmen Sie einen Baum,<br />
dann sehen Sie noch etwas ganz an<strong>de</strong>res – vielleicht <strong>de</strong>n Wald,<br />
<strong>de</strong>n Wal<strong>de</strong>srand, Ackerland, ein Haus …<br />
• Je<strong>de</strong>r Blick ist an<strong>de</strong>rs, nicht besser o<strong>de</strong>r schlechter, richtig o<strong>de</strong>r<br />
falsch, son<strong>de</strong>rn ganz einfach an<strong>de</strong>rs“ (Hargens 2000: 9f)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
3.2. Drei Typen von Professionalität<br />
B. K. Müller sieht drei Typen von Professionalität:<br />
• geschlossener Typ: „es wird eine bestimmte Betrachtungsweise<br />
kultiviert und mit <strong>methodischen</strong> Instrumentatrien versehen, die<br />
zugleich als Ausblendfilter für an<strong>de</strong>re Sichtweisen funktionieren“<br />
• autistischer Typ: „Er nimmt die jeweils existieren<strong>de</strong>n Praktiken eines<br />
Berufsfel<strong>de</strong>s zum Maß aller Dinge, wehrt je<strong>de</strong> Kritik als vom ‚grünen<br />
Tisch‘ kommend, als nicht praktikabel, als überfor<strong>de</strong>rnd etc. ab.<br />
Umgekehrt wird dann je<strong>de</strong>s Mißlingen zum Beweis für die ganz<br />
beson<strong>de</strong>rs großen fachlichen Anfor<strong>de</strong>rungen und die extrem<br />
schwierigen Klienten“<br />
• offener Typ: „<strong>de</strong>r versucht, die Einengung jenes ‚geschlossenen‘<br />
Typus zu vermei<strong>de</strong>n, ohne dabei in ein … ‚von allem ein bißchen‘<br />
zu verfallen“ (Müller 1997: 147f)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
9
3.3. (Offene) Methodische Professionalität 1<br />
• Burkhard K. Müller entwickelt eine Kunstlehre <strong>de</strong>s Fallverstehens:<br />
„klassische“ Metho<strong>de</strong>n, hermeneutischer Zugang und soziologische<br />
wie ethnologische Forschung wer<strong>de</strong>n im Konzept <strong>de</strong>r<br />
„multiperspektivischen Fallarbeit“ verknüpft; er spricht von einem<br />
„offenen Typus sozialpädagogischer Professionalität“, <strong>de</strong>r<br />
professionelle Handlungskompetenz mit forschen<strong>de</strong>r Praxis<br />
verbin<strong>de</strong>t (Müller 1991)<br />
• ihm geht es (im Rückgriff auf Mollenhauer und Uhlendorff) um ein<br />
„Hin und Her“ zwischen zwei „Erkenntniswegen“ als <strong>de</strong>n „‚Wegen‘<br />
zur Besonnenheit praktischen <strong>Han<strong>de</strong>lns</strong>“, d. h. um einen<br />
„‚Blickwechsel‘ zwischen Zuordnen, Begriffe fin<strong>de</strong>n, Klassifizieren<br />
einerseits; und an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>r Einstellung, sich aller immer schon<br />
getroffenen Einordnungen zu enthalten“ (Müller 1997: 151)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
3.3. (Offene) Methodische Professionalität 2<br />
Hans Thiersch:<br />
• „Pädagogischer Umgang ist eine Form <strong>de</strong>s Umgangs im Leben.<br />
Trotz aller notwendigen Standards, aller notwendigen Kriterien für<br />
gelingen<strong>de</strong> und misslingen<strong>de</strong> Möglichkeiten, für Ressourcen und<br />
Gefährdungen, ist Pädagogik, wie das Leben überhaupt,<br />
unübersichtlich, unplanbar, zufallsbestimmt“;<br />
• sie unterliegt auch „jenen Fügungen <strong>de</strong>s Lebens, die je<strong>de</strong>nfalls …<br />
nicht technologisch verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n können, also nicht in einem<br />
or<strong>de</strong>ntlichen Zweck-Mittel Kontext stehen“;<br />
• für Subjekte be<strong>de</strong>utsame Pädagog/inn/en „sind oft faszinierend,<br />
schwierig, unkonventionell, knubbelig, aus ‚krummem Holz<br />
geschnitzt‘, wie sich vielleicht in Abwandlung von Kant formulieren<br />
lässt“ (Thiersch 2009: 159f)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
10
3.3. (Offene) Methodische Professionalität 3<br />
Maja Heiner:<br />
• Trotz einer zu erwarten<strong>de</strong>n Ausdifferenzierung <strong>de</strong>r alltagsnahen<br />
Aufgaben Sozialer Arbeit … ist <strong>de</strong>rzeit davon auszugehen, dass<br />
‚Ganzheitlichkeit‘ als Merkmal <strong>de</strong>r Kompetenzdomäne <strong>de</strong>r Sozialen<br />
Arbeit erhalten bleibt.<br />
• Zusammen mit ‚Partizipation‘ bzw. ‚Aushandlungsorientierung‘ wird<br />
Ganzheitlichkeit auch künftig zu <strong>de</strong>n zentralen Prinzipien<br />
professionellen <strong>Han<strong>de</strong>lns</strong> zählen.<br />
• Außer<strong>de</strong>m ist die Profession … an <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung sozialer<br />
Gerechtigkeit beteiligt. Nicht zuletzt han<strong>de</strong>lt es sich hier um eine<br />
Aufgabe, die in dieser Form nicht auf Laien übertragbar ist.<br />
• ‚Reflexivität‘ als berufsunspezifisches Merkmal run<strong>de</strong>t diesen Katalog<br />
grundlegen<strong>de</strong>r professioneller Fähigkeiten ab“ (Heiner 2007: 533)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
3.3. (Offene) Methodische Professionalität 4<br />
Wilfried Ferchhoff:<br />
• In <strong>de</strong>r „‚helfen<strong>de</strong>n Beziehung‘ von Mensch zu Mensch fin<strong>de</strong>t eine<br />
Abwehr von verbindlichen und generalisierbaren Regeln und<br />
Techniken statt,<br />
• und es wer<strong>de</strong>n neben nicht-methodisierbarer Intuition und Weisheit<br />
persönliche Haltungen, innere Voraussetzungen, Fähigkeiten und<br />
Eigenschaften erwartet,<br />
• die auf innere, echte und authentische persönliche Hingabe,<br />
Einfühlungsvermögen, Akzeptanz etc. zielen“ (Ferchhoff 1993: 710)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
11
3.3. (Offene) Methodische Professionalität 5<br />
Carola Flad, Sabine Schnei<strong>de</strong>r und Rainer Treptow<br />
(in ihrer Studie zur Professionalität in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r- und Jugendhilfe):<br />
• „Es ist die Person, die das organisieren<strong>de</strong> Zentrum für die von ihr<br />
erwarteten Reflexions- und Unterstützungsleistungen ist.<br />
• Sie ist es, die <strong>de</strong>n Sinngehalt eines Jugendhilfeauftrags <strong>de</strong>utet, <strong>de</strong>n<br />
Hilfeplan gestaltet, über diese o<strong>de</strong>r jene Vorgehensweise<br />
entschei<strong>de</strong>t. Sie ist es, die das dazu nötige Fachwissen entwe<strong>de</strong>r<br />
abruft o<strong>de</strong>r es selbst herstellt, Wissensbedarf bemerkt und ihn<br />
gegebenenfalls ausgleicht“ (Flad/Schnei<strong>de</strong>r/Treptow 2008: 241)<br />
mit Thomas Harmsen (2009: 256): „Professionalität ist eine<br />
subjektive, handlungsorientierte, reflexive und flexible<br />
Konstruktionsleistung“<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
4.1. Professionelle methodische Grundhaltung<br />
zentrale Aspekte dieser Grundhaltung:<br />
Lebensweltorientierung, Empowerment,<br />
Stärken- und Ressourcenorientierung,<br />
Empathie, Authentizität, Takt und Respekt,<br />
wertschätzen<strong>de</strong> Aktivierung und Beteiligung,<br />
Fähigkeit sich einzubringen/abzugrenzen<br />
methodische<br />
Klärung<br />
Aushandlung<br />
Kontakt<br />
Analyse<br />
Abschluss<br />
Realisierung<br />
Evaluation<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
12
4.2. Professionelles methodisches Han<strong>de</strong>ln<br />
(engagierten)<br />
Dialog führend<br />
Handlungstheorien<br />
1. und 2. Ordnung<br />
ermittelnd = sammelnd<br />
(Anamnese, Diagnose)<br />
methodische<br />
Klärung<br />
eklektisch,<br />
multiperspektivisch<br />
und fallorientiert<br />
auswählend<br />
„grundberatend“<br />
Aushandlung<br />
Kontakt<br />
Analyse<br />
Abschluss<br />
ins Feld gehend<br />
(in Kontakt kommen)<br />
Realisierung<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
vernetzend<br />
kooperierend<br />
intermediär<br />
Evaluation<br />
4.3. Professionelle methodische Kompetenzen 1<br />
Mit Peter Löchterbach:<br />
• berufliches Selbstverständnis (z. B. Ressourcenorientierung,<br />
Empowerment)<br />
• Sach- und Systemkompetenz (z. B. arbeitsfeldspezifisches<br />
Fachwissen, Organisationswissen)<br />
• Metho<strong>de</strong>n- und Verfahrenskompetenz (z. B. Networking,<br />
Assessment, Evaluation)<br />
• Soziale Kompetenz (z. B. Kommunikationskompetenz, [aktive wie<br />
passive] Kritik- und Konfliktfähigkeit)<br />
• Selbstkompetenz (z. B. Kontaktfähigkeit, Authentizität, Belastbarkeit)<br />
(Löchterbach 2002: 218)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
13
4.3. Professionelle methodische Kompetenzen 2<br />
O<strong>de</strong>r mit Franz Stimmer, <strong>de</strong>r von „Beziehungskompetenz“ spricht:<br />
• „Neben <strong>de</strong>r Sachkompetenz ist in <strong>de</strong>r professionellen sozialpädagogischen<br />
Praxis Beziehungskompetenz zu erwerben und zu för<strong>de</strong>rn.<br />
• Beziehungskompetenz wird hier <strong>de</strong>finiert als ein System sich<br />
wechselseitig beeinflussen<strong>de</strong>r Aspekte, nämlich Sozialkompetenz<br />
(Beziehung herstellen, verständigungsorientiert han<strong>de</strong>ln ...)‚<br />
Metho<strong>de</strong>nkompetenz und Selbstkompetenz (Reflexion auf die<br />
eigenen Motive und Kapazitäten …)“<br />
Beratungsbeziehung im Anschluss an C. Rogers bzw. Tausch/Tausch<br />
(Vorlesung 17. Mai 2010)<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
5. Zusammenfassung<br />
Die Metho<strong>de</strong>nanwendung in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit ist<br />
• aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Verfahrensweise:<br />
prinzipiell methodisch strukturiert, sammelnd und sortierend,<br />
eklektisch und (maximal) flexibel<br />
• aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Situation, <strong>de</strong>s Problems, <strong>de</strong>s Falls:<br />
immer fallspezifisch und multiperspektivisch<br />
• aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>s Subjekts:<br />
grundsätzlich nah und distanziert, respekt- und taktvoll<br />
• aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r/<strong>de</strong>s Sozialen:<br />
geprägt durch eine intermediäre Position<br />
Metho<strong>de</strong>nanwendung ist damit Navigation: ein Sich-Bewegen im<br />
Fluss gelebten Lebens und Kunst, in <strong>de</strong>ssen Wi<strong>de</strong>rsprüchen einen<br />
Weg zu fin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Menschen in <strong>de</strong>r Bewältigung ihres Alltag<br />
gerecht wird<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
14
Literatur<br />
• Fehren, O.: Gemeinwesenarbeit als intermediäre Instanz: emanzipatorisch o<strong>de</strong>r<br />
herrschaftsstabilisierend; in: neue praxis 6/2006: 575 - 595<br />
• Ferchhoff, W.: Was wissen und können Sozialpädagogen? In: Pädagogische<br />
Rundschau, Nr. 6/1993: 705 - 719<br />
• Flad, C., Schnei<strong>de</strong>r, S., und Treptow, R.: Handlungskompetenz in <strong>de</strong>r Jugendhilfe,<br />
Wiesba<strong>de</strong>n 2008<br />
• Hargens, J.: Bitte nicht helfen! Es ist auch schon so schwer genug, Hei<strong>de</strong>lberg<br />
2000<br />
• Harmsen, T.: Konstruktionsprinzipien gelingen<strong>de</strong>r Professionalität in <strong>de</strong>r Sozialen<br />
Arbeit; in: Becker, R., u. a. (Hg.), Professionalität in <strong>de</strong>r Sozialen Arbeit,<br />
Wiesba<strong>de</strong>n 2009: 255 - 264<br />
• Heiner, M.: Soziale Arbeit als Beruf, München und Basel 2007<br />
• Löchterbach, P.: Qualifizierung im Case-Management; in: <strong>de</strong>rs., u. a. (Hg.), Case<br />
Management, Neuwied 2002: 201 - 226<br />
• Müller, B. K.: Sozialpädagogisches Können, 3. Aufl. Freiburg/Brsg. 1997<br />
• Thiersch, H.: Authentizität; in: <strong>de</strong>rs., Schwierige Balance, Weinheim und München<br />
2009: 143 - 160<br />
Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt<br />
15