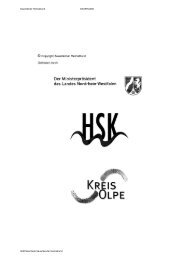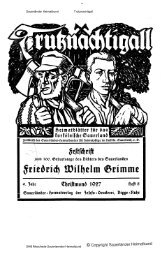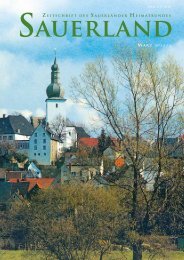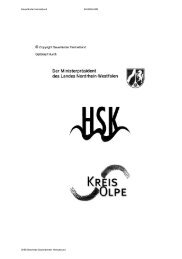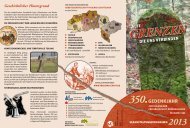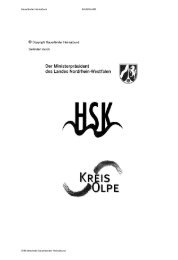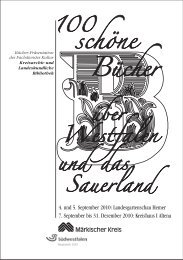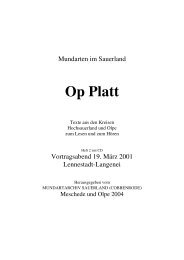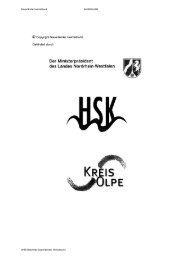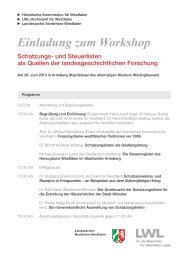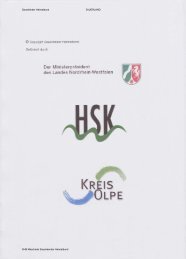Text - Sauerländer Heimatbund e.V.
Text - Sauerländer Heimatbund e.V.
Text - Sauerländer Heimatbund e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Heft 1<br />
Vortragsabend<br />
15. März 2001<br />
Winterberg-Züschen<br />
ISSN 1612-3328
Mundarten im Sauerland<br />
Op Platt<br />
<strong>Text</strong>e aus den Kreisen<br />
Hochsauerland und Olpe<br />
zum Lesen und zum Hören<br />
Heft 1 mit CD<br />
Vortragsabend 15. März 2001<br />
Winterberg-Züschen<br />
Herausgegeben vom<br />
MUNDARTARCHIV SAUERLAND (COBBENRODE)<br />
Meschede und Olpe 2008
DANKSAGUNG<br />
Der Trägerverein MUNDARTARCHIV SAUERLAND e.V. dankt<br />
allen öffentlichen und privaten Einrichtungen und Unternehmen für<br />
die großartige Unterstützung mit Rat und Tat und für die Gewährung<br />
von finanziellen Mitteln, die das Projekt „Mundarten im Sauerland“<br />
von 1998 bis 2001 und seither die Arbeit des Mundartarchivs Sauerland<br />
ermöglicht haben.<br />
Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
Die Sparkassen<br />
im Kreis Olpe<br />
Gemeinde<br />
Eslohe<br />
Hochsauerlandkreis<br />
Kreis Olpe<br />
Impressum<br />
Herausgeber und Copyright ©: Trägerverein Mundartarchiv Sauerland e.V.<br />
Nachdruck, fotomechanische, elektronische und tontechnische Wiedergabe von <strong>Text</strong> & Ton<br />
sind urheberrechtlich geschützt und ohne Einzelgenehmigung des Herausgebers nicht<br />
gestattet. Herausgeber und Autoren gestatten den Nachdruck der <strong>Text</strong>e und CDs für<br />
Unterrichtszwecke in Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung.<br />
Tonaufnahmen und <strong>Text</strong>übertragungen: Dr. Werner Beckmann<br />
c/o Mundartarchiv Sauerland Stertschultenhof in Cobbenrode, Olper Str. 3,<br />
59889 Eslohe, Telefon 02973-818554. E-mail: mundartarchiv@gmx.de<br />
Satz und Layout: Thomas Feldmann / Beate Scholemann, Kreis-VHS Olpe<br />
Redaktion: Klaus Droste, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Trägervereins<br />
ISSN 1612-3328<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Einführung in die Schriftenreihe MUNDARTEN IM SAUERLAND 5<br />
1. Elisabeth Oberließen, Züschen Nu well iëck ugg mol<br />
wat vertellen 9<br />
2. Franz Reineke, Braunshausen* So’n Wendadoak 11<br />
3. Hedwig Habitzki, Westernbödefeld Dat witte Froihjohr 12<br />
4. Helmut Geilen, Niedersfeld Daue Klocken in Reëm 14<br />
5. Ursula Sommer, Altastenberg De Prossjaan 15<br />
6. Heribert Schmidt,<br />
Wulmeringhausen Froihjohrsputz 17<br />
7. Bruno Völlmecke, Hallenberg* Eehn Friehlingsdag 19<br />
8. Theresia Imberg, Niedersfeld Hexennacht 1974 21<br />
9. Regina Brieden, Züschen Tufelnbroden 22<br />
10. Maria Kleinsorge, Züschen, und<br />
Josefa Hoffmann, Züschen Dorfgespräch op Platt 23<br />
11. Maria Droste, Welschen-Ennest De Amtskuckuck 26<br />
12. Franz Völlmecke, Züschen 125. Jubilläum van der<br />
St. Hubertus-Breiderschaft 28<br />
13. Bruno Senge, Silbach Use Ahnen 29<br />
14. Bernhard Kresin, Rüthen De Oikbäom 31<br />
15. Anna Grundhoff, Düdinghausen Vam Brautbacken sau<br />
vör 70 Johren 34<br />
16. Johanna Balkenhol, Brilon Dei erfüllte Wunsk 39<br />
17. Hubert Hoffmann, Bruchhausen Paul un Karel wollen<br />
Fiske fangen 40<br />
18. Hildegund Winzenick, Züschen Dat leiwe Geld 42<br />
19. Karl-Heinz Schreckenberg,<br />
Brilon Dönekes 44<br />
3
Der Plattdeutsche Vortragsabend in Züschen wurde gemeinsam veranstaltet<br />
vom Förderverein für Kultur, Denkmalpflege und Naturschutz Züschen e.<br />
V., von der Katholischen Frauengemeinschaft Züschen und vom Sauerländer<br />
<strong>Heimatbund</strong> im Rahmen des Projektes „Mundarten im Sauerland“. Die<br />
Veranstaltung wurde vorbereitet und geleitet von Dr. Werner Beckmann und<br />
Klaus Droste.<br />
Zum Einfluß des hochdeutschen Sprechalltags und der Medien<br />
(Zeitung, Radio, Fernsehen) auf den gesprochenen plattdeutschen<br />
Wortschatz während des Interviews<br />
Da das Plattdeutsche heute nicht mehr die alltägliche Sprache ist,<br />
macht sich der Einfluß des Hochdeutschen, das inzwischen die<br />
Sprache des täglichen Lebens geworden ist, bemerkbar. Auch im<br />
vorliegenden Interview wird manchmal statt eines rein plattdeutschen<br />
Ausdruckes seine hochdeutsche Entsprechung verwandt, so heißt es<br />
manchmal „häochduitsch“ statt plattdeutsch „häochduitsk“. In solchen<br />
Fällen ist im <strong>Text</strong> in der Regel die plattdeutsch zu erwartende<br />
Variante gesetzt worden, um den Lesern das <strong>Text</strong>verständnis nicht zu<br />
erschweren.<br />
* Anmerkung:<br />
Der Braunshauser und der Hallenberger Dialekt gehören zu den<br />
hessischen und damit zu den hochdeutschen Mundarten.<br />
4
Einführung<br />
In der vorliegenden Schriftenreihe MUNDARTEN IM SAUERLAND<br />
werden mundartliche Tonaufnahmen und deren Verschriftlichungen<br />
aus den Kreisen Hochsauerland und Olpe veröffentlicht. Die Tonaufzeichnungen<br />
entstanden bei Plattdeutschen Vortragsabenden und bei<br />
Einzelinterviews mit Sprechern aus allen Städten und Gemeinden der<br />
beiden Kreise.<br />
Die Schriften und CDs sind bestimmt für den Einsatz in Schulen und<br />
sonstigen Bildungseinrichtungen; weitere Verwendungen ( z.B. bei<br />
Lesungen, bei lokalen Festen, für historische und linguistische Forschungen,<br />
u.ä.) sind gestattet, wenn diese gemeinnützig sind bzw.<br />
ohne die Absicht, Gewinne zu erzielen.<br />
Das MUNDARTARCHIV SAUERLAND ist hervorgegangen aus<br />
dem vom Sauerländer <strong>Heimatbund</strong> getragenen Projekt MUND-<br />
ARTEN IM SAUERLAND, das von 1998 bis 2001 im Rahmen der<br />
Regionalen Kulturpolitik in der Region Sauerland gefördert wurde<br />
vom Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des<br />
Landes NRW, vertreten durch den Regierungspräsidenten in Arnsberg<br />
und seine Mitarbeiter. Die ehrenamtliche Geschäftsführung lag in den<br />
Händen von Klaus Droste, Leiter der Volkshochschule des Kreises<br />
Olpe. Die wissenschaftliche Betreuung gewährleistete die Kommission<br />
für Mundart- und Namenforschung des Landschaftsverbandes<br />
Westfalen-Lippe, vertreten durch Prof. Dr. Hans Taubken. Die Tonund<br />
<strong>Text</strong>aufzeichnungen führte Dr. Werner Beckmann als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter des Projektes und nunmehr Leiter des<br />
Mundartarchivs durch.<br />
Das Projekt konnte nur verwirklicht werden mit der großzügigen<br />
Anschubfinanzierung und der anschließenden jährlichen Unterstützung<br />
durch die Kulturstiftung der Westfälischen Provinzialversicherungen<br />
und des Kultusministeriums NRW. Die beiden Kreise<br />
Hochsauerland und Olpe haben sowohl das Projekt von Anfang an als<br />
auch das Mundartarchiv seit seiner Gründung 2001 durch regelmäßige<br />
Zuwendungen mitgetragen. Schließlich leisteten die neun Sparkassen<br />
in den beiden Kreisen einen erheblichen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung<br />
während der Projektphase.<br />
5
Im Trägerverein MUNDARTARCHIV SAUERLAND E.V. tragen<br />
sieben Körperschaften und Vereine als „Gründerpaten“ die Verantwortung<br />
für die kontinuierliche Arbeit des Archivs: die Kreise<br />
Hochsauerland und Olpe, die Gemeinde Eslohe, der Sauerländer<br />
<strong>Heimatbund</strong> e.V., die Christine Koch Gesellschaft e.V., der Heimatund<br />
Förderverein Cobbenrode e.V. und der Museumsverein Eslohe<br />
e.V. Weitere persönliche Mitgliedschaften und private Spenden zeigen<br />
das Interesse in der Bevölkerung für die Pflege der plattdeutschen<br />
Sprache. Unterstützung gewähren ferner der Westfälische <strong>Heimatbund</strong>,<br />
die Stiftung Westfalen Initiative sowie als bedeutende<br />
Sponsoren der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und seit 2003 die<br />
RWE Gas AG.<br />
Bedeutung und Situation der sauerländischen Mundarten<br />
Das ehemalige Kurkölnische Sauerland stellt innerhalb der niederdeutschen<br />
Mundartlandschaften eine besonders archaische Region dar.<br />
Laut- und formengeschichtlich sowie lexikalisch bildet sie ein<br />
kompliziertes Bild mit hoher Varianz und ist deshalb vom sprachwissenschaftlichen<br />
Standpunkt her gesehen absolut exklusiv. Nirgendwo<br />
im niederdeutschen Raum können Sprachwissenschaftler so tiefe<br />
Einblicke in die Entwicklungsgeschichte dieser seit mehr als 1000<br />
Jahren überlieferten Sprache gewinnen.<br />
Ursache ist die relative Unzugänglichkeit der Region in früheren<br />
Zeiten, die älteste Sprachzustände bis in die heutigen Mundarten<br />
bewahrt hat, während in anderen verkehrsgünstigeren Regionen<br />
zahlreiche Ausgleichsprozesse stattgefunden haben.<br />
Während das Plattdeutsch noch vor 100 Jahren als funktionierendes<br />
Kommunikationssystem vorhanden war, ist der Mundartgebrauch –<br />
gerade auch wegen der kleinregionalen Differenziertheit – zuerst in<br />
den Städten und nach dem 2. Weltkrieg auch auf dem Lande rapide<br />
zurückgegangen, stärker als in Regionen mit größeren sprachlichen<br />
Gemeinsamkeiten. Wenn man mit jemandem aus einem schon wenig<br />
entfernt liegenden Ort sprechen will, bedient man sich lieber des<br />
Hochdeutschen, um Missverständnisse zu vermeiden. Der Rückgang<br />
gilt heute gleichermaßen auch innerhalb der Dörfer, Nachbarschaften<br />
und Familien, ein Tribut an die moderne mediale Gesellschaft.<br />
6
Autochthone Sprecher sauerländischer Mundarten sind heute – von<br />
Ausnahmen abgesehen – 60 Jahre alt und älter. Die tatsächlich gesprochenen<br />
Mundarten aufzuzeichnen und ihren sprachlichen Reichtum<br />
für die Nachwelt zu sichern, war und ist die wichtigste Aufgabe.<br />
Das Projekt MUNDARTEN IM SAUERLAND hat diese Sicherung<br />
auf zwei Ebenen erfüllt: Einerseits wurde schriftlich überlieferte<br />
Sprache (Dialektliteratur) erfasst und allgemein zugänglich archiviert,<br />
andererseits wurde der Schwerpunkt auf eine direkte Erfassung der<br />
heute noch gesprochenen Ortsdialekte durch Aufzeichnung von<br />
Interviews gelegt. Es geht dabei nicht um Folklore oder um<br />
Idealisierung vergangener Zustände, sondern um Inventarisierung<br />
dessen, was an Informationen noch erreichbar ist.<br />
Das MUNDARTEN-Projekt und das daraus hervorgegangene<br />
MUNDARTARCHIV SAUERLAND haben innerhalb des westfälischen<br />
Raumes und eigentlich für den ganzen norddeutschen Raum<br />
Modellcharakter, denn nirgendwo stehen bisher für eine so umfassende<br />
Region Daten zur Aussprache, zum Wortschatz, zur Syntax,<br />
zum Brauchtum, zu Redensarten, zum Liedgut usw. mit einer derartigen<br />
Belegdichte zur Verfügung.<br />
Parallel zum plattdeutschen Sprachatlas, der mit den flächendeckend<br />
aufgenommenen Tonbandinterviews entstanden ist, erschließt sich mit<br />
den Verschriftlichungen nach und nach eine, vom kirchlichen,<br />
gemeindlichen und familiären Jahreskreis geprägte, Sitten- und Kulturgeschichte<br />
des Sauerlandes. Mundartforschung, Volkskunde und<br />
Literaturwissenschaft werden in vielfacher Hinsicht von den Projektergebnissen<br />
und der Arbeit des Mundartarchivs befruchtet.<br />
Die Aufgaben des MUNDARTARCHIVS Sauerland<br />
Das Archiv erfüllt langfristig die folgenden Forschungs- und Dienstleistungsaufgaben:<br />
• die wissenschaftliche Archivierung der Tondokumente mit den<br />
heute gesprochenen Mundarten;<br />
• die Verschriftlichung der Tonaufnahmen in die niederdeutsche<br />
Sprache;<br />
7
• die Erfassung und Sammlung der schriftlich überlieferten<br />
Mundartliteratur der Region, der Sekundärliteratur und weiterer<br />
Dokumente über die Mundart;<br />
• die wissenschaftliche Beratung von linguistischen, literarischen<br />
und kulturkundlichen Forschungsvorhaben;<br />
• die Vorbereitung der „<strong>Text</strong> + Ton“-Veröffentlichungen von<br />
Arbeits-/Unterrichtsmaterialien für Schulen, Erwachsenenbildungseinrichtungen,<br />
plattdeutsche Arbeitskreise, Hochschulen und<br />
andere interessierte Institutionen und Personen in Form von <strong>Text</strong>heften<br />
und Tonträgern (CD) für jeden Mundartbereich in den 19<br />
Städten und Gemeinden der beiden Kreise;<br />
• die Vorbereitung einer Sammlung ausgewählter literarischer <strong>Text</strong>e<br />
(Anthologie), wiederum begleitet von Tonträgern;<br />
• die Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von<br />
Plattdeutschen Vortragsabenden und beim Plattdeutschen Unterricht<br />
in Schulen (Vermittlung von plattdeutschen Sprechern).<br />
Allen bisherigen und gegenwärtigen Förderern von MUNDARTEN<br />
IM SAUERLAND und MUNDARTARCHIV SAUERLAND sei an<br />
dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Intensiver Dank und hohe<br />
Anerkennung gebührt insbesondere allen Autoren und Sprechern der<br />
Mundarten in über 200 Interviews, bei Plattdeutschen Vortragsabenden<br />
und zahlreichen Konferenzen der plattdeutschen Arbeitskreise im<br />
ehemals kurkölnischen Sauerland.<br />
Die Schriftenreihe MUNDARTEN IM SAUERLAND will die plattdeutsche<br />
Muttersprache in <strong>Text</strong> + Ton an und in die jungen Generationen<br />
weitergeben und damit die Mundarten im Sauerland lebendig<br />
erhalten.<br />
Dr. Werner Beckmann, Leitung des Mundartarchivs Sauerland<br />
Klaus Droste, Projektgründung und Geschäftsführung des Mundartarchivs Sauerland<br />
Georg Scheuerlein, Vorsitzender des Trägervereins Mundartarchiv Sauerland<br />
Prof. Dr. Hans Taubken, wissenschaftl. Projektbegleitung; Geschäftsführer der<br />
Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalen (LWL)<br />
Dieter Wurm, ehem. Vorsitzender des Sauerländer <strong>Heimatbund</strong>es<br />
8
1. Nu well iëck ugg mol wat vertellen<br />
Elisabeth Oberließen, Züschen<br />
För dei frömmeden Lüde mott iëck dann noch siëgen. Hi unse alle<br />
Frau Göpel - dei Tüschers henn se alle - oder het se alle kannt - dat<br />
wor unse Hebamme.<br />
Se verstong är Geschäft, un jede Familie harre miët iär te donne. Un<br />
ümme düese Frogge - bu sall iëck dat nu siëgen, ümme düese Frogge<br />
wor ganz Tüschen verlegen. Wann dei nit ewiäst wör bi Dag un bi<br />
Nacht, bei härre dann de kleinen Blagen ebracht? Sau wor dat nu bi<br />
uns im Dorp. Wann me se brukere, stong se ümmer parot.<br />
Wann’t irgendwann wor wier sau wiet, reipen se de Frogge, un’t wor<br />
auk Tied. Dei kam saufort un halp en wennig noh, un et duerte nit<br />
lange, dann wor dat Kind do. Tau der Frogge do harren Vertruggen de<br />
Lüde. Diän Dotter diän harren se nit neidig dobie. Et gaffte auk im<br />
ganzen Wintermerigge blaut twei, ennen för de Menschen un ennen<br />
för’t Veih. Dei Frogge kreig nu för all dat Wejjen, dat Helpen un dat<br />
Praktezeiern, dat domols anderster wor ase in düen Dagen, dei Frogge<br />
dei kreig seß Mark för jedes Blage. Egal ob en Mäken oder Jungen se<br />
harre hoalt, se kreig seß Mark un domiëre wor alles betahlt. Wann me<br />
siëck dat üewerliëget, dann siëget me siëck woall, dat wor för de<br />
Arbet nit teviëll. Dat mott siëck dei Frogge auk selbest woall siëgen<br />
un wor domet lange am Üewerliëgen, un kam dann domiëre rut: Se<br />
können sülke Saken nit meh för’n allen Pries maken. Un se härre siëck<br />
alsau dacht, et wör klor, et wör doch meh Arbet un et wör auk sau<br />
schwor. Sei härren van nu aan för dat Kinger-Hoallen en Daler meh te<br />
betahlen. Dat gaffte nu, mi könnt dat nit meh verstohn, in unsem<br />
Dorpe ne kleine Revolutiaun. Ach, wat konn me do för’n Daler alles<br />
keipen. Dat schmitt je diän ganzen Hushalt rein üeber diän Haupen.<br />
Auk bi uns im Husse wor dat en Problem. Sesse woren alle do. Mi<br />
wöllt dovanne schwiejen, dei Freide wor do woall optekrijjen. Unse<br />
Mutter wor auk saufort domiëre inverstohn, ase dei andern seäggden:<br />
Do mötten mi wat donn.“ Un twei Dage drop bi uns im Üeberdorpe do<br />
hellen se Rot. Do kamen se alle binein: Schmieres Hedwig, Harbeken<br />
Kathriene, Kaspers Anna un Antönnekes Luwiese. Dei Stobe wor vull.<br />
Se saten biem Kaffee un kreijen raude Ohren, alle Froggen, dei wier<br />
9
sau wiet woren. Un do bi Kaffee un Kaffeekauken, do hett se eärk<br />
dann besproken, do hett se dann lause leäggt un schwadroniert, dat<br />
mächten se nit miëre, un hett protestiert: „Dat möchte siëck dat Frogge<br />
selbest woall siëgen, dat wör teviëll Geld, dat können se nit dräjen. Et<br />
wör nit blaut för’n paar - düese Weäken, mit teihn, twölf Blagen<br />
möchte jeder doch riäken, un ümmer diän Opschlag, dat leip in de<br />
Kosten, me sall kenne Kinger meh krijjen, do sall me siëck resten. Un<br />
van meh Arbet te schwatzen, dat wör doch gemein, dei Blagen wören<br />
doch genau noch sau klein, un se können eärk et Geld nit ut der Siede<br />
schnieden, un se möchten nu alle binein hallen!<br />
Un dat Enge vam Leid: et bleif ase vörher. Dei Frogge kreig seß Mark<br />
un kennen Pennig meh. Sau kamen mi hi, bu iëck dat nu vertelle, noch<br />
för’n allen Pries op de Welt, för seß Mark.<br />
Un dat well iëck ugg siëgen, brümme iëck ugg dovan schwatze. Wann<br />
ugg nu sau’n Döneken nit van mi pässet, un geiht ock vlichte auk wat<br />
tweärs, odder het süß aan mi wat uttesetten, dann denket, wat söllt mi<br />
te schängen aanfangen! För seß Mark kann me nit meh verlangen.<br />
Worterklärungen<br />
ugg - euch / frömmeden - fremden / siëgen - sagen / hi - hier / unse<br />
alle - unsere alte / dei Tüschers henn - die Züschener hatten / het se -<br />
haben sie / miët - mit / te donne - zu tun / Frogge - Frau / bu - wie /<br />
bei - wer / Blagen - Kinder / Vertruggen - Vertrauen / Dotter - Arzt,<br />
Doktor / neidig - nötig / Wintermerrige - Winterberg (Stadt und<br />
Ortsteile) / Wejjen - Wehen (bei der Geburt) / düen - diesen / mott -<br />
muß / sülke - solche / keipen - kaufen / schmitt - wirft, schmeißt / sesse<br />
- sechs / miëre - mit / mi - wir / mi könnt - wir können / me - man / ase<br />
- als / hellen se - hielten sie / binein - zusammen / het se eärk - haben<br />
sie sich / dräjen - tragen / düese Weäken - diese Wochen / teihn - zehn<br />
riäken - rechnen / Opschlag - Aufschlag / resten - ausruhen, Pause<br />
machen / Siede - Seite / Leid - Lied / et bleif - es blieb / brümme -<br />
warum / van mi - von mir / vlichte - vielleicht / tweärs - quer / süß -<br />
sonst, außerdem / schängen – schimpfen<br />
10
2. So’n Wendadoak<br />
Franz Reineke, Braunshausen<br />
Verfasser: Robert Reineke<br />
Geschnigget hot’s de ganze Noacht,<br />
alles es vull Eis un Schnie,<br />
de Schwalen honn sich weck gemacht,<br />
da Wenda koam det Johr ze frieh!<br />
Zügefroren es da Bach,<br />
de Leide, die honn rode Nasen,<br />
am Dache hänken lange Zappen,<br />
un em Goarden senn de Hoasen.<br />
De Sau, die hinket uff da Letta,<br />
se hot Schinken, rönz un dicke,<br />
Schpäck un Wärschte gitt’s jetz wedda,<br />
So’n Wendadoak, däs es en Glicke.<br />
De Oma es an Kaffeemahlen,<br />
se gönnt sich hedde en halwes Lot.<br />
Biem Megga leeft de Wannemehle,<br />
em Backhaus richt’s no frischem Brot.<br />
Da Schmett, dä kloppet’s Eisen weech,<br />
de Pääre brüchen nöwwe Stullen -<br />
un bi Grönd, do es was loß,<br />
do es grad ne Küh biem Bullen.<br />
Da Hansesmann geht met da Flinde,<br />
hä mächt do newa en de Gringe,<br />
un da Schweenfranz met da Schälle<br />
bringet ne Bekanntmachinge.<br />
Alle Känga fahren Schledden,<br />
van da Schüle bis uff de Bricke,<br />
was kann do noch scheena senn<br />
als so’n Wendadoak, däs es en Glicke.<br />
11
Worterklärungen<br />
geschnigget - geschneit / Schwalen - Schwalben / Wendadoak -<br />
Wintertag / det Johr - dieses Jahr / Leide - Leute / senn - sind / hinket<br />
- hängt / rönz - rund / hedde - heute / Megga - Meier (Eigenname)<br />
leeft - läuft / Wannemehle - Gerät zum Reinigen des Getreides,<br />
„Wannemühle“ / Pääre - Pferde / nöwwe - neue / Stullen -<br />
Hufeisenstollen / hä mächt - hier: er geht / newa en de Gringe -<br />
hinüber in die Gründe / Grönd - (Eigenname) / Schweenfranz -<br />
Schweinehirten-Franz / Känga - Kinder<br />
3. Dat witte Froihjohr<br />
Hedwig Habitzki, Westernbödefeld<br />
Verfasser: August Beule, Ramsbeck<br />
Wat briuset de Sturm, wat riusket de Wald,<br />
Wat magg dät Huilen beduien?<br />
Et Froihjohr is do met aller Gewalt,<br />
Ik höre de Schneiklocken luien.<br />
Doch, wat us dei Klöckelkes gistern het lutt<br />
Is dün Dag all ömmerweyse über us schutt.<br />
Met wittem Gewand, ´n grein Kränsken im Hoor,<br />
Kam et Froihjohr met Grillen un Schrullen.<br />
Niu hiät seyn Gefolge sik schrecklich dütt Johr<br />
Beynoh op et Däotgohn verkullen.<br />
Un wenn vey ok selber den Schnowwen mol kritt,<br />
Dann is dät nau ümmer dät Schliëmmeste nit!<br />
Dat Finkengeschlecht, de Heer un Frau Staar,<br />
Verschliuket Lakritzpastillen,<br />
Het alle ne boisen Rachenkatarrh,<br />
Heer Kuckuck dei drinket Kamillen.<br />
Professer van Stuark op der Fuask-Klapperjagd,<br />
Kreig Fuast in de Feite ganz wahn üwer Nacht.<br />
12
In Leiwerkes Huisken was et säo blank,<br />
Frau Drossel woll se beseiken.<br />
Doch woorten beide Familien krank,<br />
Trotz Buasttei und Feldawetheiken.<br />
Un Zeisigs Trilinchen van Baukfinkenstadt,<br />
Is van Influenza taum Stiärwen malat.<br />
En Hase, en Foß, en Dachs, düese drei<br />
Het neulich beym Froihjohrsvergnügen<br />
Op Reihkämpers Balle danzet im Schnei<br />
Un den Ziegenpeiter kriegen.<br />
Heer Peitrus, ik bidde, o stuire diär Näot,<br />
Süß stierwet et Froihjohr, d’ Gefolgschaft geiht däot.<br />
Worterklärungen<br />
witte - weiße / Huilen - Heulen / beduien - bedeuten / luien - läuten<br />
het lutt - haben geläutet / dün Dag - heute / ömmerweyse - eimerweise<br />
us - uns / schutt - geschüttet / grein - grün / dütt - dieses / beynoh -<br />
beihnahe / Däotgohn - Totgehen, Sterben / verkullen - erkältet / vey -<br />
wir / Schnowwen - Schnupfen / kritt - (wir) kriegen, bekommen / nau -<br />
noch / verschliuket - verschlucken / het alle - haben alle / Fuask -<br />
Frosch / Fuast - Frost / Feite - Füße / wahn - sehr, besonders,<br />
nachdrücklich / Leiwerken - Lerche / beseiken - besuchen / Buasttei -<br />
Brusttee / Feldawetheike - Feldapotheke / malat - krank / Foß - Fuchs<br />
Reihkämper - Rehkämper / stuire - gebiete Einhalt, mach ein Ende<br />
Näot - Not<br />
13
4. Daue Klocken in Reëm !<br />
Helmut Geilen, Niedersfeld<br />
Iek was en Junge vlichte van drütteihn, värteihn Johren. Domols<br />
gaffte’t in der Kerke giëger me Köster noch ene Vize-Köster. Un dei<br />
Vize-Köster, dat was iek. Obgawe vamme Vize-Köster was et, üwwer<br />
de Weake bi denn Alldagesmissen bü’m Pasteren helpen aantetauhen,<br />
denn Missedauener-Plan optesetten un te luën. Un op dat Luën, do<br />
wöre we ganz verrückt, eëk wann’t sehr anstrengend was. Wü<br />
mochten dör denn dunklen Kerkenteren hejer kleteren bit an dat<br />
Klockensäl. Domols worten de Klocken noch mit der Hand elutt, nit<br />
ase gitzundes, dat me ne Schalter rümmeschmitt un dann gäht dat loß,<br />
nä, domols noch mit dänn Sälen.<br />
Et was Groindunersdag, vlicht niëgentauhnhundertdrauenfuffzig<br />
(1953) oder –twänfuffzig (52), iek wäät dat nit mehr seë geneie - denn<br />
Moargen was Misse wiäst, un op Groindunersdag was et jo seë: Bi me<br />
Gloria spielte de Öärgel noch, dann schellten de Missedauener, un<br />
dann was Schluß mit me Luën un mit me Schellen. Van do ab worte<br />
bleëß noch geklappert. Ne Klapper was en Holtedingen, en Breat met<br />
me Stiele do ane un en Heamerken droppe, un wann me domië ase mit<br />
me Hamer schloog, dann gaffte dat en ganzen treërigen Ton. Un mit<br />
deam treërigen Tone geng dat van der Wandlunge aan, de ganzen<br />
Kardage.<br />
Ja, et was Groindunersdag, de Burschen striepeten imme Dorpe<br />
rümme, un do kuckete iek an der Iëre: Iek denke: Dunderkühle, et is<br />
bale twealwe, et mott Engel des Heren elutt weren. Iek op et Fahrrad<br />
bü de Kerke, un schnell op en Teren ekletert. De Iëre schloog:<br />
twealwe Iëre. Iek denke: Halt, getz. Iek nahm et Sääl un schlog met<br />
der dritten Klocke drauemol aan. Un dan beatte me en „Gegrüßet seist<br />
du, Maria“. Un seë machte me dat drauemol, un wann me dat<br />
hingerenander hatte, dann lutte man mit der anderen Klocke noh. Ja,<br />
wunderbar. Iek machte dat; iek dachte all, en Wunder wat iek emacht<br />
hädde, Engel des Heren elutt op Groindunersdag, Mi was gar niks<br />
oppefallen. Iek wier vam Teren rin, un ungen op der Trappe, do stong<br />
dann de richtige Köster, de ‚alle Köster’, säggte wü, stong do, schloog<br />
mi links un rechts wat ümme de Ohren un saggte: „Dië dumme Junge,<br />
14
de Klocken sind doch in Reëm!“ - Jo un, wann gitzundes de Köster<br />
ennem Missedauener ennen ümme de Ohren högget, dann landet’e vör<br />
me Kadi.<br />
Worterklärungen<br />
Reëm - Rom / vlichte - vielleicht / drütteihn - dreizehn / giëger - hier:<br />
neben / me - dem / Weake - Woche / Alldagesmissen – Werktagsmessen<br />
/ bü - bei / aantetauhen - anzuziehen / luën - läuten / eëk - auch<br />
wü - wir / Kerkenteren - Kirchturm / hejer - höher / Klockensäl -<br />
Glockenseil / elutt - geläutet / gitzundes - jetzt, nun, heute, heutzutage<br />
rümmeschmitt - umdreht, eig. „herumschmeißt“ / ick wäät - ich weiß<br />
seë - so / geneie - genau / Heamerken - Hämmerchen / domië - damit<br />
ase - wie, als / treërigen - traurigen / striepeten - streiften, liefen / Iëre<br />
- Uhr / bale - bald / twealwe - zwölf / et mott - es muß / drauemol -<br />
dreimal / me - man / lutte man - läutete man / noh - nach / ungen -<br />
unten / de ‚alle Köster’ - der ‚alte Küster’ / säggte wü - sagten wir /<br />
dië - du / högget - haut, schlägt / landet’e - landet er<br />
5. De Prossjaan<br />
Ursula Sommer, Altastenberg<br />
De heilige Erasmus is Kiärkenpatraan<br />
oppem Astmerge, un an diäm Daag<br />
girret jedes Johr ne grate Prossjaan,<br />
dat’e Doarp un Feller beschützen magg.<br />
Un alt un jung, un graat un klaan,<br />
da maket mi bei diär Prossjaan.<br />
De Laü de maket iärk ganz fein,<br />
un blosen dött de neddernöösche Musikverein.<br />
De Fahnen gatt dann mi vöraan<br />
un aak de Statue vamme Kiärkenpatraan.<br />
Un weil et sa’ne graten Heiligen was,<br />
15
is aak de Statue nit grade klaan;<br />
un da te schliepen, was wirlich kenn Spass,<br />
de Driäger mochte düchtig draan.<br />
Erasmus, dat wiet’e sieker all,<br />
imme Kalender amme twedden Juni stäht.<br />
Un dann is et määstens ase überall<br />
aak op em Astmerge manchmol ziemlich häät.<br />
Ase de Astmeschen bei sa hätem Wiär<br />
en Johr mol wier dör’n Kräuzeberg tügen,<br />
do gengen diäm Driäger de Nerven dör:<br />
„Wachte, Ersmus, gleik kümmes’e te liegen.<br />
Asse de Schwäät me drüppelte in Hiemet un Bükse,<br />
do flaag de Erasmus in de Büsche.<br />
Dau brenges mik nit mehr van en Bänen!<br />
Wann de nit lapen kanns,<br />
dann bleif nächstens terhämen!<br />
Un seit diäm Daag, sa stäht et geschrieben,<br />
is de Erasmus in diär Kiärke bliewen.<br />
Worterklärungen<br />
Prossjaan - Prozession / oppem - auf dem / Astmerge - Astenberg<br />
girret - gibt es / grate - große / mi - mit / Laü - Leute / iärk - sich / dött<br />
- tut / neddernöösche - aus Nordenau / gatt - gehen / aak - auch / sa -<br />
so / da - die, diese / schliepen - schleppen / Driäger - Träger / wiet’e -<br />
wißt ihr / sieker - sicher / all - schon / ase - wie, als / häät - heiß<br />
Astmeschen - Astenberger, Bewohner des Ortes Astenberg / Wiär -<br />
Wetter / tügen - zogen (Vergangenh. von ziehen) / wachte - warte /<br />
Schwäät - Schweiß / Hiemet - Hemd / Bükse - Hose / flaag - flog / dau<br />
- du / van en Bänen - von den Beinen / lapen - laufen / terhämen - zu<br />
Hause<br />
16
6. Froihjohrsputz<br />
Heribert Schmidt, Wulmeringhausen<br />
Jo, meyne leiwen Fruggens, düt Gedichtken is extro füär ugg macht<br />
woren; un diän Mannsluien kann ick bläoß diän Rot giewen: Wann de<br />
Fruggens düsen Drang het, gatt ne öüt diäm Wiäge.<br />
Froihjohrsputz<br />
Kucket de Fruggens met em Ees öüt der Diär,<br />
dann sind se am Rüstern un Wisken.<br />
Loot dick nit blicken un mak dick derdiär,<br />
un fuske ne blaat nit dertüsken.<br />
Im Höüse do steiht alles diärnein,<br />
Fenster un Diären sind uap rieten.<br />
Sau kann me de Fruggens schüweln seihn,<br />
öüt diän Schränken weert alles riut eschmieten.<br />
Tellers un Köppkes, et ganze Porzellan,<br />
saugar Zoppen- und Puddingschütels,<br />
alles weert wienert un kümmet nau draan,<br />
un am Enge de Pötte un Kietels.<br />
Dat gurre Silber van Ommas Mama,<br />
dei anderen Zinn- un Silbersaken,<br />
dat Kaffeegeschirr van Tante Rosa,<br />
weert röüt satt taum Roinemaken.<br />
Se buselt diän ganzen Dag balle tau<br />
un kritt känne Teyt mehr taum Iäten.<br />
En Schöleken Kaffe oder Kakau,<br />
ne richtige Mohlteyt kann me vergiäten.<br />
17
Am Obend, do doit ’ne et Kruiße dann weih,<br />
nit blaat et Kruiße, nei, alle Knuaken,<br />
se sind sau richtig ferrig un moih,<br />
et helpet niks, se mottet nau kuaken.<br />
Doch dät mäket de Fruggens sau richtig krank,<br />
kummet de Kerls dann obends no Heime,<br />
un sütt nit, dät alles sau blitzeblank,<br />
un sind sau blind ase ’ne Oihme.<br />
Un froget dann naa: „Bat hiäste sau macht,<br />
in der Noberskopp Kaffe drunken?<br />
Oder hiäste op em Sofa laggt?“<br />
Dann können se sau dotüsker funken.<br />
Worterklärungen<br />
Fruggens - Frauen / Ääs - Hintern / öüt - aus / Diär - Tür / mak dick<br />
derdiär - verschwinde, hau ab, geh fort / bläoß - nur, bloß / dertüsken -<br />
dazwischen / diärnein - durcheinander / schüweln - schuften, schwer<br />
arbeiten / weert - wird / riut eschmieten - hinausgeworfen,<br />
hinausgeschmissen / Köppkes - Tassen / Zoppen - Suppen / Puddingschütels<br />
- Puddingschüsseln / Enge - Ende / Kietels - Kessel / gurre -<br />
gute / röüt satt - hinausgesetzt, hinausgestellt / buseln - sich geschäftig<br />
hin und her bewegen / se kritt - sie kriegen, bekommen / Teyt - Zeit /<br />
dött - tut / Kruiße - Kreuz, Rücken / Knuaken - Knochen / ferrig -<br />
fertig, hier: erschöpft / moih - müde / se mottet - sie müssen / obends -<br />
abends / no Häime - nach Hause / sütt - sehen / ase - wie, als / Oihme<br />
- Onkel / bat - was / hiäste - hast du / laggt - gelegen<br />
18
7. Eehn Frielingsdag<br />
Bruno Völlmecke, Hallenberg<br />
Verfasserin: Margret Glade-Pfänder<br />
Bearbeitung: Amalie Ante-Feisel<br />
Vam Kärchtorne schlähdt de Ühr fünwe. ’s es noch destr. Mähr senn<br />
frieh uffgestehn. Hidde wärrt em Wahle Hulz g’hullt. Ehrscht ä moh<br />
geeht’s ennen Schtall. De Gaile fühdern. Öhch ds angere Veeh waärt<br />
versorjet. Nüh de Lättr nuff uff’n Heipärts. Hai un Straäkkerlinge<br />
naahb schmässen. Dn Haisack schtoppen. En dr Käche schteeht ds<br />
Friehstecke uffm Dösche:<br />
Eehn Leehb Backhausprot, Buttr, Läwwer- un Plühtworscht,<br />
Kwätschnmühs, ’ne Scheppe heehße Milch, nn Dippen met fröschem<br />
Schmanne un Kaffee. Ennen Protbaidl kummen gschmährte Schtecker<br />
met Schaänken un Maärch un en Bimmchen Kaffee. Eehne Fläsche<br />
Biehr wärt in de nöwwe Zeidinge gewäckklt. ´so gitt’s em Wahle nit<br />
nür zu aässen un zu traänken, mähr honn öhch noch was zu laähsen.<br />
De Paähre wärrn enngespannt. De lange Kedde wärrt noch annen<br />
Dingewaähn ahngehankn. De Geehsel, dr Hüht; ds rohde Schnuppdüch<br />
als Halsdüch immegebungen. „Hommersch?!“ Dr ahle Rock daff<br />
nit fähln, wanns Raähn git. ’s pleehp awwer treehje, dr Wänd kahm<br />
uff. So geeht’s de Kehnichschtrohße nuff bis zür Zäjjenaäcke. Hie<br />
steht dr Zäjjenhärte un bleehst uff sim Härnchen. De Zäjjen kummn<br />
ahngehippet: se honn’s Härnchen g’hoort. Daähs essn G’rämmpele<br />
unn Gelöhfe. Un met vell Gzänke un Gmekkere löhfen de Zäjjen an<br />
de Heehde. An jehdem Bischelchen un Behmchen machen de Zäjjen<br />
haalt. Se fraässen gahr zü gährne de grienen Blaähtchen vannen<br />
Strichern un Beehmen. Uffn Wissen gitt’s Klee, Butterposten, wesse<br />
Johannesplummen, gaähle duppelte Schmaärjeplummen un vell<br />
saftijes Krahs.<br />
Mähr fahrn waidr ennen Hulzwahlt. Uff dr Heeh schteehn zwee Rehe.<br />
Als ds Führwaärk nejer kimmet, machn se säch ausm Stöhwe. Öhch’n<br />
Hahse leehft noch haängerhaär. De Väjjel sängen, dr Ehchelhähr<br />
fliehjet hook enns Ploohe.<br />
19
Ds Klufterhulz schtunk am Waähje. Es wärdt uffg’ladt. Bieh dr Aärwett<br />
wärrt sech nit ingerhaalen. Dr aahle Hainr mehnt, de meehrschten<br />
Leide schwatzen züvell mett aährem Mauhle.<br />
Nüh geehts z’räcke en de Schtaaht. En dr Krohßen Schtrohße schteehn<br />
de Noobern binanger. Haikammps August schaällt aus. Häh bringget<br />
ds Nöwweste inger de Leide. Klaich simmr dr heehme. Haängerm<br />
Hause wärrt ds Klufterhulz am Hulzhais-chen uffge-iddert.<br />
De Klokken laiden; ’s es Mittaak. Hidde gitt’s Aärwessensoppe met<br />
Haärrnworscht un därchwassenem, gereechertem Schpaäck, en Käppchen<br />
Kaffe unnen Schtaäkke Muppes.<br />
Worterklärungen<br />
destr - dunkel, düster / mähr - wir / hidde - heute / em Wahle - im<br />
Walde / ä moh - einmal / Gaile fühdern - Pferde füttern / öhch - auch<br />
Lättr - Leiter / Heipärts - Heuboden / Straäckerlinge - Strohbunde<br />
naahb - hinunter / Käche - Küche / Plühtworscht - Blutwurst<br />
Kwätschenmühs - Zwetschenmus / Scheppe - kleiner Topf, Milchtopf<br />
Dippen - Schüssel / Protbaidl - Brotbeutel / Stecker - Stücke, hier:<br />
Brotschnitten / Maärch - Meerrettich / Bimmchen - Kännchen /<br />
nöwwe - neue / gitt - gibt / Paähre - Pferde / Dingewaähn -<br />
Düngewagen / Geehsel - Peitsche, „Geißel“ / Hüht - Hut / hommersch<br />
- haben wir’s / Raähn - Regen / pleehp - blieb / treehje - trocken<br />
Wänd - Wind / Kehnichstrohße - Königsstraße / nuff - hinauf<br />
Zäjjenaäcke - Ziegenecke / bleest - bläst / Heehde - Höhe /Bischelchen<br />
- kleiner Busch / Behmchen - Bäumchen / Strichern - Sträuchern<br />
Butterposten - Butterblumen / Schmaärjeplummen - Trollblumen<br />
Krahs - Gras / Heeh - Höhe / ausm Stöhwe - aus dem Staube<br />
Klufterhulz - Klafterholz, Meterholz / ingerhaalen - unterhalten / aahle<br />
- alte / z’räcke - zurück / Krohße Strohte - Große Straße, heute<br />
Petrusstraße / binehn - zusammen / häh - er / klaich - gleich / simmr -<br />
sind wir / dr heehme - zu Hause / haängerm - hinterm / uffge-iddert -<br />
aufgeschichtet / laiden - läuten / Aärwessensoppe - Erbsensuppe<br />
Haärrnworscht - Bregenwurst / Käppchen - Tasse / Staäcke - Stück<br />
Muppes - eine Art Hefekuchen<br />
20
8. Hexennacht niegentauhnhundertvärunsiebenzig (1974)<br />
En echt niesfellsk Vertellmeken<br />
Theresia Imberg, Niedersfeld<br />
Bië van allershiär bekannt, woorte amme Oawend tem eersten Maue<br />
in Niesfelle van denn Rüserbüterken ehexet. Se hadden sick op<br />
Hahnen Plätzken edropen un troffelten op de Bärmeke. Et wören<br />
jümmer daue glüken Luë, mit dean Spargitzken edrieben woorte, seë<br />
eëk Schlossers Händerk. Eëk düt Johr woorte haue van denn Hexen<br />
hämesocht. Im was dat klor; un dorümme laggte haue sick op de Liër,<br />
ümme de Rüserbüterken te schnappen. Ase de Hexen amme Wiärken<br />
wören, kaam Händerk ümme de Ecke efeget un hadde balle seë enne<br />
Miëlopp amme Schlawittken. Haue tüsselte ne diärenään un lurrte:<br />
„Dië alle Rotzliëppel! Glüük hogg’ ick dü diän Ees appelwääk! De<br />
Sääle mott mië’m Balge riëter!“ Daue Rüserbüterken schräggelden un<br />
danzeden ümme diän Etterkopp herümme, un et gaffte en wahne<br />
Rosseweh. Ase Händerk daue Hexe anesoh, krääg haue en wahnen<br />
Tuck op dat Hiärte. Haue dee en daupen Söcht un kratzede sick hinger<br />
de Ohren un rauep: „O hauliget Kaneënenrohr! Dau Düwel sall mick<br />
hoallen! Dat is ge use Pasteër!“ Et gaffte’n wahne Gelächter, un eëk<br />
de Pasteër lachede mië.<br />
Worterklärungen<br />
niesfellsk - niedersfelder, aus Niedersfeld / Vertellmeken - Erzählung/<br />
bië - wie / allershiär - altersher / tem eersten Maue - zum ersten Mai<br />
Niesfelle - Niedersfeld / Rüserbüterkes - junge Burschen zwischen 14<br />
und 18 Jahren / edropen - getroffen / troffelten - trotteten / Bärmeke -<br />
Ortsteil / daue - die / glüken - gleichen / Luë - Leute / Spargitzken -<br />
Schabernack / seë - so / eëk - auch / Händerk - Heinrich / düt - dieses<br />
haue - er / hämesocht - heimgesucht / laggte - legte / Liër - Lauer / ase<br />
- als / balle - bald / Miëlopp - „Maulauf“, Schimpfwort / tüsselte –<br />
schüttelte / diärenään - durcheinander / lurrte - schrie, brüllte / dië -<br />
du / alle - alter / Rotzliëppel - Rotzlöffel / hogg’ ick - haue ich,<br />
schlage ich / dü - dir / Ees - Hintern / appelwääk - apfelweich / Sääle -<br />
21
Seele / mott - muß / mië’m Balge riëter - (zusammen) mit dem Leibe<br />
heraus / schräggeln - schreien, lärmen / Etterkopp - Wüterich<br />
Rosseweh - Krach, Geschrei / anesoh - ansah / wahn - groß, mächtig,<br />
stark / Tuck - Schlag / Hiärte - Herz / haue dee - er tat / en daupen<br />
Söcht - einen tiefen Seufzer / rauep - rief / hoallen - holen / ge - ja,<br />
doch / use - unser<br />
9. Tufelnbroden<br />
Regina Brieden, Züschen<br />
Tufeln broden! Wat för Freude<br />
för Kinger un för alle Lüde.<br />
Ob Jung, ob Alt, ob Graut, ob Klein,<br />
ob fiewe oder teihne!<br />
Düett Tufeln broden heät schon Traditiaune,<br />
dobi harren Ellern un Blagen ümmer gurre Lune.<br />
Jo, domols wur im Herbest eis Tufeln ebroden,<br />
wann se op deäm eigenen Acker riepe woren.<br />
Lädt en Verein taum gemütlicken Nommedag in,<br />
sau fröget me eis: Kann’t auk Tufelnbroden sinn?<br />
Tufeln broden in Gottes finner Natur<br />
mit Buëtter, Ziepeln, Schinken un viëll Beier!<br />
Jo, wann me sau bi deäm Füre sittet<br />
un enne Tufel no der andern verputzet,<br />
sitt Schinken, Buëtter un Ziepeln alle,<br />
dann mott en Schnäpsken her<br />
ümme te verdeilen alles.<br />
Eis en Schnäpsken, dann noch ente.<br />
„Op ennem Bein könn me jo nit stohn“, siëgen alle.<br />
Na, no deäm tweiden un dritten Schnaps<br />
weren alle gemütlick, sou ganz ohne Hast.<br />
Dat Beier iës keihle, sau mott et woall sinn.<br />
Mi Lachen un Vertellen<br />
bis de Mond am Hiëmel schient.<br />
22
Wird et dann kalt, de Nacht bricket an,<br />
gatt mi frauh heime,<br />
siëgen taum Schluß: „Op Wiedersenn!“<br />
Un mi fröjjen uns alle op dat nächste Mol!<br />
Worterklärungen<br />
Tufelnbroden - Kartoffelnbraten / fiewe - fünf / teihne - zehn / düett -<br />
dieses / Ellern - Eltern / Blagen - Kinder / gurre - gute / ebroden -<br />
gebraten / riepe - reif / me - man / eis - erst / finner - feiner, schöner<br />
Ziepeln - Zwiebeln / Beier - Bier / Füre - Feuer / sitt - sind / mott -<br />
muß / verdeilen - verteilen / ente - eins / siëgen - sagen / tweiden -<br />
zweiten / weren - werden / keihle - kühl / Vertellen - Erzählen / gatt mi<br />
- gehen wir / frauh - früh / fröjjen - freuen<br />
10. Dorfgespräch op Platt<br />
Maria Kleinsorge und Josefa Hoffmann, Züschen<br />
Maria: Na, Sefa, heaste Faschtobend uut den Knoken?<br />
Sefa: O, ut den Knoken! Iëck heww et gar nit drinne hat!<br />
Maria: Ein Glücke, dat düese unwiesen Dage rümme sitt.<br />
Sefa: Jo, mi wollen abber früher mol sau geren no Köln op en<br />
Faschtobend. Dat wollen me alle ge mol miëddemaken,<br />
Leannhoffs Anneliese, un miene Nobersche, düett Wahlen Mia<br />
un iëck. Abber et heat keinmol eklappet. Och, de eine wor<br />
krank, un de andere hadde kein Geld, un de andere härre kein<br />
Tied. Awwer - vör twei Johren, do was’t, do sitt me abber<br />
emol do weast. Dann iës et auk ümmer noch sau kolt, im<br />
Febberwar, wann de Faschtobend do iës. Mi taugen uns en<br />
dicken Mantel aan, Mützen op en Kopp, un düett Wahlen Mia,<br />
dat hadde noch sau’n allen, sau’n allen Muff von früher, mit<br />
guëddem Pelz, wo me sau de Hänge siëck sau schön drinne<br />
wearmen kann. Deän heng et siëck ümme’n Hals, un af geng et<br />
23
no Köln. Sau ne paar Mark fuffzig hadde me siëcker in der<br />
Taschke, abber nit viëll. Un bu mi dohiënekamen, o, düett<br />
Leannhoffs Anneliese, dat wor rein ut deam Hüsken, dat raap<br />
sofort „Kölle Alaaf!“ un „Helau!“ un „Helau“ un „Alaaf“. Un<br />
iëck hadde mi sau ne alle Papiertute miëddenoammen van<br />
Heime. Iëck sochte mi dann sau’n paar Kamellen op, dei dei<br />
andern vam Wagen dorinschmeiten. Aber dat Anneliese, dat<br />
nahm siëck do kein Tied för. Dat schwenkere de Arme in de<br />
Heih un raap: „ Helau un Alaaf un Alaaf un Helau!“ Un miët<br />
der Tied, do stotte’t dat Mia sau’n wennig in de Ribben, un do<br />
seaggte’t: „Jä, wat steihs du denn noch ümmer sou stille do<br />
rümme? Beweg du diëck doch auk emol en kitzken. Brümme<br />
heas du dann dei Hänge ümmer noch im Muff?“ „Jo“,<br />
seaggte’t Mia, „iëck bee den Rausenkranz.“<br />
Maria: Iëck sie frauh , dat et guës op et Freihjohr taugeiht.<br />
Sefa: Jo, wann et Freihjohr kümmet, dann geiht owwer auk de Orbet<br />
laus! Eimol mötte me de Muulhalden utenandernkratzen, un<br />
dann mötte me Fohren hacken, un dann Steine lesen, un Water<br />
dieken! Früher, do wollen se ümmer geren dat Water op de<br />
Wiësen henn, dat Austerwater, dat et Gras denn beätter wässet,<br />
denn früher hadden se kein Tied un kein Geld för<br />
Kunstdünger. Un dann, un wann dat dann sau wiet wor, dann<br />
mochten se in en Garten un mochten graben. Jo, un dann<br />
mochten se met der Drebeligge den Mist do rinfeihern in en<br />
Garten, dann mochten se en selwer schliëpen, denn: „Wo kenn<br />
Mistus, do kenn Christus“. Dat wor all ümmer sau! Ja, un bann<br />
se no nit te Streiche kamen un woren en eisten Mai noch nit<br />
ferrig, dann brukern se eärk nit te wundern, dat en andern<br />
Morgen en Fuulbaum im Garten stong!<br />
Maria: Awwer dat Orwen an der Tüscher Luft dee en guëtt un is sau<br />
gesund. Wat wor dat domols schliëmm, ase de HIAG noch<br />
ungen im Dorpe wor.<br />
Sefa: Jo, do wor de Luft owwer auk manchmol orig verpestet.<br />
Maria: Iëck weit noch, ar unse Vatter vör me Husse stong un för de<br />
Nobersche seäggte: Wat stinket de HIAG wier sau! Do seaggte<br />
24
Winters Mariechen: „Dei sall woall stinken, wann do sau viëlle<br />
Mannslüde orwen.“<br />
Sefa: Do harr et Mariechen awwer auk wirklich recht.<br />
Maria: Sefa, nu morr ik di awwer fix no wat vertellen. Unse Ellern<br />
woren mol met uns Blagen am Drachenfelsen. Do konn me op<br />
sau nem Iësel rieden. Un unse Hugo woll doch sau gerne op<br />
dat Dier. Awwer dat kostere twintig Pennige. Do seäggte unse<br />
Vatter: „Dat iës te düer! Do het mi kenn Geld för. Awwer de<br />
Hugo bleif ümmer am Piltern, hei woll doch sau gerne op deän<br />
Iësel. Unse Mamma hoorte siëck dat sau ne Wiele aan, un dann<br />
seäggte se: „ Jaust, niämm du den Jungen doch mol op dei<br />
Schuller.“<br />
Sefa: Dat wor noch billiger ase twintig Pennige.<br />
Worterklärungen<br />
Sefa - Josefa / heaste - hast du / Faschtobend - Fastnacht, Karneval<br />
hat - gehabt / düese - diese / unwiesen - verrückten / sitt - sind / mi<br />
wollen - wir wollten / miëddemaken - mitmachen / Nobersche -<br />
Nachbarin / sitt me - sind wir / mi taugen - wir zogen / Hänge - Hände<br />
heng - hängte / hadde me - hatten wir / bu - wie / dohiënekamen -<br />
dahinkamen / raap - rief / van Heime - von zu Hause / iëck sochte mi -<br />
ich suchte mir / dei - die / dorinschmeiten - da hineinwarfen / Tied -<br />
Zeit / Heih - Höhe / miët - mit / stotte’t - stieß sie (wörtl.: stieß es) / en<br />
kitzken - ein wenig, ein bißchen / brümme - warum / frauh - froh /<br />
guës - jetzt, nun / Orbet - Arbeit / mötte me - müssen wir / Muulhalden<br />
- Maulwürfshügel / Fohren - Furchen / dieken - deichen / henn -<br />
haben / Austerwater - Osterwasser / beätter wasset - besser wächst<br />
mochten se - mußten sie / Drebeligge - hölzerners Gestell zum<br />
Forttragen von Mist / rinfeihern - hineinfahren / schliëpen -<br />
schleppen, hier: auf das Feld (als Dünger) bringen / bann - wann / nit<br />
te Streiche kamen - nicht zurecht kamen, nicht fertig wurden / eisten -<br />
ersten / ferrig - fertig / Fuulbaum - noch nicht grünender Strauch1, am<br />
1. Mai einem Mitbürger in den Garten gesetzt, signalisierte, daß<br />
dieser seinen Garten nicht fristgerecht in Ordnung gebracht hatte /<br />
25
Orwen - Arbeiten / Tüscher Luft - Luft von Züschen / dee en guëtt - tat<br />
ihnen gut / HIAG - in Züschen (nicht mehr) ansässige Fabrik<br />
maichmol - manchmal / orig - gehörig, ordentlich / iëck weit - ich<br />
weiß / Nobersche - Nachbarin / Mannslüde - Männer (wörtl.:<br />
Mannsleute) / morr ick - muß ich / Blagen - Kindern / Iësel - Esel<br />
rieden - reiten / twintig - zwanzig / hoorte - hörte / Wiele - Weile /<br />
Jaust - Jost, Josef / Schuller - Schulter<br />
11. De Amtskuckuck<br />
Maria Droste, Welschen-Ennest<br />
Seo imme Johre 25 (fiefentwintig),<br />
do kam vam Amt ne Mahnung aan.<br />
Biem Prüfen, un ver allem gründleg,<br />
steng unse Stuiër uaben aan.<br />
De Mutter schmeit dean Wisch in’t Fuiër<br />
un saggte: „Doi is doch betahlt.“<br />
Neo liuter heww iëck miene Stuiër<br />
op Mark un Penninge betahlt.”<br />
Taum twedden Mol kam seo’ne Mahnung.<br />
Met Schwung fleog doi deanselben Weag.<br />
Bi’m dridden Mol wor Fänden aansaggt,<br />
un gliek no Middag, selben Dags.<br />
„Se wellt vam Amt dean Kuckuck schicken“,<br />
siëtt de Mutter, „heer niu guët tau.<br />
Dean sall hoi ver dean Ees dann dricken<br />
im Stall der allen bunten Kauh.“<br />
26
„Doi werd ne in de Miste schieten“.<br />
Soi gong in’t Feld. Doi Kerel kam aan.<br />
Iëck loit ne diëse Iutkunft wiëten.<br />
Hoi fong en wahn Gelachter aan.<br />
Dann gong hoi wiehernd in dean Kauhstall.<br />
Dean Ziëll hong hoi ver’n Stand der Liese.<br />
Do hong hoi guët in diësem Fall.<br />
Seo wor’t wall fregger Art un Wiese.<br />
Niu wirkleg kam no en paar Dagen<br />
de amtlege Bescheid herbi.<br />
De Quittung wor im Amt vergraben.<br />
„Niu suihste, seo’ne Schlamperie!“<br />
Worterklärungen<br />
imme - um / biem - beim / ver - vor / steng - stünde, würde stehen<br />
schmeit - warf, schmiß / Fuiër - Feuer / neo liuter - noch immer /<br />
miene - meine / Stuiër - Steuer / twedden - zweiten / fleog - flog / gliek<br />
- gleich / siëtt - sagt / heer - höre / niu - jetzt, nun / sall hoi - soll er /<br />
ver dean Ees - vor den Hintern / dear allen bunten Kauh - der alten<br />
bunten Kuh / dricken - drücken / iëck loit - ich ließ / Iutkunft -<br />
Auskunft / wahn - groß, mächtig, stark / Ziëll - Zettel / hong hoi -<br />
hängte er / wall fregger - wohl früher / suihste - siehst du<br />
27
12. Et hundertfiewentwintige (125.) Jubiläum<br />
van der Tüscher St.-Hubertus-Schützenbreiderschaft<br />
Franz Völlmecke, Züschen<br />
Vam Aller 125 (hundertfiefuntwintig),<br />
doch im Herten jung,<br />
denn Glaube, Sitt’ un Heimat,<br />
giëtt Tüscher Schützen Schwung.<br />
Dat sall in unsem Tüschen<br />
auk ümmer widdergohn:<br />
Glaube, Sitte, Heimat,<br />
doför mi Schützen stohn.<br />
Goatt schütze ümmer wier<br />
unse Schützenbreiderschaft,<br />
un lote düesen Wahlsprüeck<br />
dann sinn uns Saft un Kraft.<br />
Deän Bund wöllt hauch mi hallen<br />
met grautem Goattvertruggen,<br />
ase Breider uns verhallen<br />
un op sinne Hülpe buggen.<br />
Worterklärungen<br />
Aller - Alter / im Herten - im Herzen / giëtt - gibt / widdergohn -<br />
weitergehen / doför - dafür / mi - wir / wöllt - wollen / hauch - hoch<br />
hallen - halten / grautem - großem / Goattvertruggen - Gottvertrauen<br />
ase Breider - wie Brüder / buggen - bauen<br />
28
13. Use Ahnen<br />
Bruno Senge, Silbach<br />
Manker Bürger van us no weit<br />
bo lange use Doarp besteiht.<br />
Et wor vör über 700 (siebenhundert) Johren,<br />
an emme Dage wie dündag oder moren,<br />
do fengen use Ahnen<br />
sau langsam an te planen.<br />
Se sochten out ne Stelle<br />
nit te hauge, nit te daap,<br />
bo schön Water out ’ner Quelle<br />
an ihren Hütten rinner laap.<br />
Un rund herümme de Biärge,<br />
de staunten ümmer mehr.<br />
Bat maket do dä Zwiärge,<br />
bo kumet da blaus hiär?<br />
Se kamen out diäm Harz no hey<br />
un het nit rastet, rugget,<br />
se grabern dann no Erz un Bley<br />
un het et Doarp ebugget.<br />
Ok bleiben se dann ümmer hey<br />
trotz Elend, Hunger un Naut,<br />
denn altens fangen se wenig Bley<br />
un harren ok wenig Braut.<br />
Un van diär kargen Landwirtschaft<br />
an diän schäwen Biärgen<br />
konnten sä trotz Mögge un Kraft<br />
nur wenig, wenig iärben.<br />
29
Ok dä out em Handwärker-Stand<br />
hätt altens Naut elieren<br />
beym Nagel-Maken nur van Hand<br />
am Föuer in ner Nagel-Schmieren.<br />
Sau geng et nau widder ne lange Teyt,<br />
bit de Handel kam.<br />
Do wor et endlick dann sau weyt,<br />
dät de grötteste Naut en Enge nahm.<br />
Mit Saatzen un mit Wüllenschore<br />
gengen se in alle Welt,<br />
un kamen blaus einmol heime im Johre<br />
met diäm vielen Geld.<br />
Vey sind stolz op use Ahnen,<br />
vey sind stolz op iähre Wiärke.<br />
Et Doarpsiegel heffe an allen Fahnen.<br />
Un et hänget in diär Halle un in diär Kiärke.<br />
Worterklärungen<br />
use - unsere / manker - mancher / us - uns / no - noch / weit - (er)<br />
weiß / bo - wie / dündag - heute / moren - morgen / fengen - (sie)<br />
fingen / out - aus / hauge - hoch / däp - tief / rinner - hinein / läp - lief<br />
bat - was / bo - wo / kumet - kommen / hey - hier / rugget - geruht<br />
Bley - Blei / ebugget - gebaut / Naut - Not / altens - manchmal, hin<br />
und wieder / Braut - Brot / schäwen - schiefen / elieren - gelitten /<br />
Föüer - Feuer / Nagel-Schmiere - Nagelschmiede / widder - weiter<br />
Teit - Zeit / bit - bis / grötteste - größte / Säätzen - Sensen / heime -<br />
nach Hause / vey - wir / et - das / heffe - haben wir<br />
30
14. De Oikbäom<br />
Bernhard Kresin, Rüthen<br />
En Oikbäom, prächtig, gräot un schoin<br />
op Schuiern Hoawe amme Tore,<br />
stont ä en Wächter, brav un trui<br />
all viëlle hunnert Johre.<br />
Geschlechter soh hei kumen - gohn,<br />
soh schaffen un erwiärwen,<br />
soh Glücke un Loid, soh Lust un Näot<br />
bis tau deäm leßten Eärwen.<br />
Dei stont niu oines Dages am Bäom<br />
met opgekrempelten Moggen,<br />
reip suine Knechte all herbui,<br />
se wollen de Oike hoggen.<br />
„Niu brenget Sage, Axt un Buil,<br />
un spigget in de Fuiste,<br />
dütt kostet Schwoit, dei Oikenspiek<br />
het wahne dicke Knuiste.“<br />
Dat harr de Nower Oihme hoort,<br />
en Frönd vam seälgen Schuiern.<br />
Hei reip deän jungen Biuern op’e Suit,<br />
en Woort met eamme te kuiern.<br />
„Franz, höör mol tau, kumm mol met rin,<br />
kumm, dau mui deän Gefallen!<br />
Verstoh ick recht, dei schoine Bäom,<br />
dei leiwe Bäom, dei sall fallen?<br />
Dei Bäom was jeidem leif un weärt<br />
suit Generatiäonen,<br />
en Heiligtum op Schuiern Hoawe,<br />
deän weß diu nit verschäonen?<br />
„Ganz recht, de Müller heät ne kofft,<br />
hei well ne moren halen.<br />
31
En guëtt Geschäft, 800 (achthunnert) Mark<br />
well hei doför betahlen.<br />
O, Oihme, säoviëll Geld,<br />
wenn ick dat wöll nit neämmen,<br />
ick gloiwe woall, ick möchte mick<br />
föär mui un jiu alle scheämmen.“<br />
„Jo, scheämm di duiner Unvernunft,<br />
dat diu säowat kanns planen,<br />
dat diu verräßt föär’n Jiudasläohn<br />
en Eärfdoil duiner Ahnen.<br />
Föär lumpige 800 (achthunnert) Mark<br />
riß diu deäm Hoaf ne Lücke.<br />
Schläß diu deän Bäom, ick segge di,<br />
schläß diu duin Glück in Stücke.<br />
An duiner Ellern Hochtuitsdag,<br />
et was vöär 60 (seßtig) Johren,<br />
saat alles üm deän Oikenbäom.<br />
Duin Vadder saggte met deän Woren:<br />
'Hui saten muine Ahnen all<br />
an earem Hochtuitsdage.<br />
Se gliëcken alle der Ruige noh<br />
deäm Bäom vam echten Schlage.<br />
Un söll noh mui en annern Wind<br />
döär eare Kräonen weggen,<br />
ick gloiwe woall, ick möchte mi<br />
im Grawe ümmedreggen.' “<br />
Franz wor fünte, hei woar stuif,<br />
hei boit sick in de Tunge.<br />
„Hui, Oihme, hui is muine Hand,<br />
ick scheämme mi, ä’n Junge.<br />
Dei Bäom bliff stohn, dat schwör ick di,<br />
buim Heile muiner Soile.<br />
32
Hei is mi niu un nimmermähr<br />
föär 8000 (achtdiusend) Mark nit te feile.<br />
Ick was jo blind, niu seih ick klor.<br />
Viëllen Dank föär jiue Lähren.<br />
Wat muinen Ellern hoilig was,<br />
Dat soll äok ick in Ehren hollen!“<br />
Worterklärungen<br />
Oikbäom - Eichbaum / gräot - groß / schoin - schön / op Schuiern<br />
Hoawe - auf dem Hof des Bauern Schüer / ä - wie, als / trui - treu / all<br />
- schon / soh hei - sah er / erwiärwen - erwerben / Loid - Leid / Näot -<br />
Not / leßten - letzten / Moggen - Ärmel / reip - rief / suine - seine / se<br />
wollen - sie wollten / hoggen - hauen, fällen / niu - nun, jetzt / Sage -<br />
Säge / Buil - Beil / spigget - spuckt / Schwoit - Schweiß / Oikenspiek -<br />
Eichenstamm / wahn - groß, mächtig, stark / Knuist - Ast, Knorren<br />
Nower Oihme - der Nachbar, der Onkel genannt wird / Frönd -<br />
Freund / vam seälgen Schuiern - vom verstorbenen Schüer (wörtl.:<br />
vom seligen Schüer) / Biuer - Bauer / op’e Suit - an die Seite / kuiern -<br />
sprechen, reden / dau - tu, du sollst tun / mui - mir / leiwe - liebe / suit<br />
- seit / weß diu - willst du / verschäonen - verschonen / heät ne kofft -<br />
hat ihn gekauft / hei well - er will / moren - morgen / guëtt - gut<br />
neämmen - nehmen / ick gloiwe - ich glaube / ick möchte - ich müßte<br />
jiu - euch / diu verräßt - du verrätst / Earfdoil - Erbteil / riß diu - reißt<br />
du / schläß diu - schlägst du / di - dir / saat - saß / se gliëcken - sie<br />
glichen / noh mui - nach mir / Kräonen - Kronen / weggen - wehen<br />
rümmedreggen - herumdrehen / fünte - wütend / stuif - steif / hei boit -<br />
er biß / hui - hier / bliff - bleibt / schweär ick di - schwöre ick di /<br />
Soile - Seele / seih ick - sehe ich / hollen - halten<br />
33
15. Vam Brautbacken sau vör 70 (siëbenzig) Johren<br />
Anna Grundhoff, Düdinghausen<br />
Bit 1931 (niëgentehnhunderteinendrießig) worte in Eggejopkes dat<br />
Braut för de Familjen imme Dorpe backet. Minne Oma verstund wuat<br />
dovan un was van allen Lüden guëtt geliëdden. Sei konnte tauhoiren,<br />
wuat in der Backstobe an Niggem vertallt worte un bu öäwer annere<br />
Mensken Guëddes un Schlechtes vertallt worte, lachede ödder zeigede<br />
en ernst Gesichte, beheel iäwer alles för siëck.<br />
An de Backstowe kann iëck miëck noch genau erinnern, iëck wor<br />
grade fief Johre. Miët schmolen Steinen in Fiskgrätmuster was de<br />
Boadden geplostert. An diän Wängen tau’r rechten un linken Siede,<br />
van Qualm un Rauk schwart gefärbet, wassen Bräder taum Aflägen<br />
van Braut aangebracht. Do hengen vorne lange Stuakieren, Forken un<br />
Schüppen. Imme grauten Steinbackowen flackerde dat Füer. Taum<br />
Anheiten hoalte Oma Spöne uut diär Dreggestobe.<br />
Holt för’t Backen brachte gede Familje miëdde. Scheite van ungefähr<br />
ennem Meter, sau viëll Braude, sauviëll Scheite.<br />
Oma hadde ümmer frisk Braut, weil Braut de Backelauhn was. Bu<br />
köstlek schmachte en Stücke mit friskem Braut un selwes gemachter<br />
Buëtter. Diän finnesten Kauken leet ick doför stohn.<br />
Niëgentehnhunderteinendrießig brannte Eggejopkes Hus af, dat<br />
Eldernhus van miener Mömme. Nommedags giëggen veer Uhre stunt<br />
iëck gerade vör me Fenster up diär Schlopstobe, kreig en grauten<br />
Schrecken. Eggejopekes Huus stund in Flammen. Iëck kreisk<br />
jömmerlek: „Omas Huus briënnt, Omas Huus briënnt!“ Harte<br />
grienend rannte Mömme Hals öäwer Kopp öäwer Hawors Wiëse noh<br />
iärem Eldernhuse. De Füerwehr kam herbi, iäwer de Flammen<br />
schlaugen uut Fenstern un Dören hiëmmelhauge. De Schinken un<br />
Wöärste, dei imme Rauke hengen, flaugen bi diär Gluthitze dör de<br />
Luft.<br />
Wilmes Huus mochte verschont bliewen. Einege Möbel konnten<br />
gereddet weren. In korter Tied brannte Eggejopekes, dat alde, gäl<br />
aangestriëckene Fachwerkhuus, af. Auk dei hauge Dänne, en<br />
Markenteiken vör me Huusplatz, brannte lichterloh. Bloß de Stamm<br />
miët kahlen, angebrannten Ästen bleif öäwereg.<br />
34
En Johr drup worte enn nigget Huus miët Backstäinen gebugget. Enen<br />
Backowen woll Tante Mariechen nit imme Huse hawwen, dei Onkel<br />
Jakob späder friggede. Wuat nu? Up Drägges Huusplatz buggede<br />
Gemeinde en nigget Backhuus.<br />
Raben Heinrich, un noh me twedden Weltkriege Hoawes Anton,<br />
worten ase Backmester aangestallt.<br />
Miët twiälf Johren droffte iëck bi me Backen helpen un konnte dat<br />
balle alleine. „Samstag will wi backen, iëck hawwe’t Backen bi<br />
Hoawes Anton bestallt. Ümme niëgene sall de Deig do sinn“, siäget<br />
Mömme, „en half Braut un twei Knäpperken liëgget bloß noch imme<br />
Brautkasten.“<br />
In diär Küecke tüsker twei Stoihlen steiht de Backetrog. Pappe<br />
driëgget up me Puckel en halwen Sack Roggenmähl herbi, sau fufzeg<br />
Pund, un schütt dat Mähl in diän hölternen Backetrog. Dat Mähl is van<br />
diär niggen Ernte, wuat de Strickmüeller mohlt hadde. Hei küemmet<br />
alle veer Wiäcken in’t Dorp miët sinnem Pärrewagen un höällt<br />
Roggen un Weiten van Buren un Landwerten taum Mahlen. Uns<br />
brachte hei am Mondage twei Säcke terügge. Mömme verdeilt dat<br />
Mähl imme Troge. Up me Diske steiht en Düppen miët friskem<br />
Suerdeig. Hermes hadden vörgistern gebacken un frisken Deig<br />
rinnedrucht.<br />
Dei Suerdeig geiht in diär Verwand- un Noberskopp rigge ümme un<br />
weert noh me Gebruuk wiëdder gefüllt. Mutter höällt miëtt iärer Hand<br />
diän Klumpen Suerdeig uut me Düppen un drücket diän in’t Mähl<br />
midden imme Troge un vermenget iän mit Mähl. „Morgen frauh is de<br />
Deig uppegohn“, siäget sei.<br />
Am anderen Morgen noh me Frauhstücke treck iëck dei bunte<br />
Kiëddelschörte aan, waske mi de Hänge un dann an de Arwet. Miët<br />
ennem Ömmer vull lauwarmem Water vermenge iëck diän<br />
upgegohnen Deigbrei miët diäm ganzen Mähl. Enne Handvull Salt<br />
draff nit fählen. Nu kneten! De Deig is noch toh, en veerel Ömmer<br />
Water geite iëck noch hintau, drücke un knete, dat de Schweit vamme<br />
Koppe strullert. „De Deig weert guëtt“, lowet miëck de Mömme, „sau<br />
15 (fieftehn) Braude konn wi dovan backen.“ Dat uutgewaskene<br />
Düppen fülle iëck miët düemm frisken Deig un stelle dat in de<br />
Miälkkammer. Enne andere Familje mäket dovan Gebruuk.<br />
35
De Uhre zeiget half niëgene aan. Rin miët diäm Deig in diän miët<br />
ennem witten Linnendauk uutstaffeerten Waskekorf! Van diär Schüre<br />
hoalle iëck mi en Rollwagen, läge fieftehn lange Hölter van ennem<br />
Meter Länge in diän Wagen, för gedet Braut bruket me enne Spliëtte.<br />
Mutter un iëck packet nu diän schworen Koarf miët Deig up dat Holt.<br />
Iëck teh diän Wagen, un Mömme schüwet hingene, an Spiëllmanns<br />
verbi diär Egge rup. Hoawes Anton is ümmer guëtt upgeliägt un<br />
roipet: “Niämmet ugg de Tied, ohne ugg fange wi nit aan.<br />
Gehandrigen Marie un Gerkes Thres backet miëdde.“<br />
Imme Backowen flackert all dat Füer. Anton schmitt de<br />
Backespliëtten van diän dree Familjen up dei Flammen imme Owen.<br />
Anton is en Schlitzohr. Öäwer’t Wiäckenenge weert de Backowen<br />
kalt. Mondages bruket me de duwwelte Menge Holt taum Anheiten.<br />
De Buren imme Dorpe hat iäre Holteberge un könnt auk de duwwelte<br />
Menge Hölter brengen.<br />
Bit düese tau glöggenden Koallen verbrannt sitt un de Owen heit is<br />
taum Backen, vertellt Tünnes en paar Witze. Wi Fruggen sittet up<br />
Schemelen un hallt en Pröhleken. Anton spitzet de Auhren.<br />
Gehandrigen Marie beklaget siëck: „Hat doch boise Bursken bi diär<br />
Hochtied van Anneliese uut diär Kamer dree Kauken estohlen, weil<br />
dat Fenster uppe stund. Sau ne verdorbene Jugend!“<br />
Mömme kucket miëck aan. Wuat weert wuall uut düemm Mäken? De<br />
Backespliëtten sitt nau tau Koallen verbrannt. Anton schüwet düese<br />
tesammen un schütt se mit diär Schüppe in dat schmale Becken vör<br />
me Owen. Wi kuëmmet in’t Schweiten van diär Hitze, unse Gesichter<br />
glögget.<br />
Nu konn wi gestern. Gerkes Thres fänget aan, dann Gehandrigen<br />
Marie. Et leßte goh wi an’t Wiärk. Mömme un iëck formet imme<br />
Wessel Brautliewe. Unse Teiken op diän Brauden is en Krüze. Gerkes<br />
Thres mäket ennen Kreis un Gehandrigen Marie drücket ennen Striëck<br />
up dat Braud. Anton schüwet alle Braude mit enner langen Schaufel in<br />
diän Owen.<br />
De ierene Döre vamme Owen weert taugeschowen, dei Deig von den<br />
Brauden mott gären, wi säget: „Upgohn.“<br />
36
Noh fief Minuten höällt Anton alle Braude wiëdder ut me Owen. Wi<br />
niämmet düese aan, läget se in’t Regal un wisket miët ennem naten<br />
Dauk dröäwer. Sau weert dei Braude glänzend.<br />
Nu küemmet dei eigentleke Backtied. Alle Braude kuëmmet wiëdder<br />
in diän Owen. „In enner Stunde is ugge Braud gar“, säget Anton,<br />
„ümme elf Uhre konn gi dat afhoallen.“<br />
Mömme geiht no Heime, et Middagäten mott ekoket wären. Iëck<br />
besoike Oma un loise sei bi me Buënnen af. Ase de Köster lütt, goh<br />
iëck in de Backstobe de Braude aftehoallen. Van wiedem ruke iëck dat<br />
friske Braud. Dei 15 (fieftehn) Braude läge iëck in diän Korf, en Braut<br />
behällt Anton ase Backelauhn. Miët diäm Rollwagen föhre iëck heim.<br />
Sau 14 (veertehn) Dage kuëmme wi met düenn Brauden uut.<br />
Samsdages weert bloß bit Middag ebacken. Weil de Backowen noch<br />
heit is, brenget gerade Timmermanns Mia un Wilmes Elisabeth ennen<br />
Streuselkauken up nem Bliäke taum Backen. Hi geiht de Deig schnell<br />
up un de Kauken weert besonders brun un knuspereg.<br />
Tau’r Kaffeetied schnitt Mömme en frisk Braud aan. Wi Blagen sittet<br />
ümme diän Disk, schmärt Schmalt un Roiwenkrut up dei Stücker.<br />
Mömme hällt sick an’t Schnieden un frögget sick öäwer unsen<br />
Hunger.<br />
De Knäpperken vamme Braude schmecket amme besten.<br />
Worterklärungen<br />
bit - bis / Eggejopke - (Eigenname) / Braut - Brot / Lüde - Leute /<br />
guëtt - gut / tauhoiren - zuhören / nigge - neu / bu - wie / öäwer - über<br />
ödder - oder / beheel - behielt / Pade - Patentante / fauhlte - fühlte<br />
leep ick - lief ich / dör - durch / Pädeken - kleiner Pfad, kleiner Weg<br />
fief - fünf / Boadden - Boden / Wänge - Wände / Siede - Seite / wassen<br />
- waren / Aflägen - Ablegen / hengen - hingen / Stuakieren -<br />
Stocheisen / Forken - Gabeln / Anheiten - Anheizen / Dreggestobe -<br />
Drechsel-Stube / miëdde - mit / finnesten - feinsten, schönsten / kreig -<br />
bekam, kriegte / ick kreisk - ich schrie, ich weinte / harte grienend -<br />
laut weinend / hiëmmelhauge - himmelhoch / flaugen - flogen /<br />
mochte - mußte / gäl - gelb / bleif - blieb / nigge - neu / gebugget -<br />
37
gebaut / hawwen - haben / friggete - heiratete / Raben - (Eigenname)<br />
Hoawen - (Eigenname) / Drägges - (Eigenname) / innetogen -<br />
eingezogen (zum Wehrdienst) / droffte iëck - durfte ich / balle - bald /<br />
wi - wir / ümme niëgene - um neun (Uhr) / siäget - sagt / en half Braut<br />
- ein halbes Brot / Knäpperken - die Enden des Brotlaibes / tüsker -<br />
zwischen / Stoihle - Stühle / driëgget - trägt / Strickmüeller -<br />
(Eigenname) / alle veer Wiäcken - alle vier Wochen / Mömme -<br />
Mutter / Düppen - Schüssel / Suerdeig - Sauerteig / Hermes -<br />
(Eigenname) / rinnedrucht - hineingedrückt / rigge ümme - reihum<br />
Gebruuk - Gebrauch / gefullt - gefüllt / höällt - holt / frauh - früh<br />
uppegohn - aufgegangen / treck iëck - ziehe ich / Kiëddelschörte -<br />
Kittelschürze / waske mi - wasche mir / Arwet - Arbeit / Ömmer -<br />
Eimer / Salt - Salz / draff - darf / toh - zäh / veerel - viertel / geite iëck<br />
- gieße ich / hintau - hinzu / Schweit - Schweiß / strullert - in kleinen<br />
Rinnsalen fließen / konn wi - können wir / düemm - diesem<br />
Miälkkamer - Milchkammer / half niëgene - halb neun (Uhr) / witt -<br />
weiß / Linnendauk - Leinentuch / Waskekorf - Waschkorb / Schüre -<br />
Scheune / hoalle iëck mi - hole ich mir / gedet - jedes / bruket me -<br />
braucht man / Spliëtte - Holzscheit / iëck teh - ich ziehe / schüwet<br />
hingene - schiebt hinten / Spiëllmanns - (Eigenname) / roipet - ruft<br />
niämmet ugg - nehmt euch / Gehandrigen - (Eigenname) / Gerkes -<br />
(Eigenname) / Wiäckenenge - Wochenende / weert - wird / Buren -<br />
Bauern / hat - haben / glöggend - glühend / Tüennes - Anton / Fruggen<br />
- Frauen / hallt en Pröhleken - halten ein Schwätzchen / Auhren -<br />
Ohren / dree - drei / Mäken - Mädchen / Backespliëtten - Holzscheite<br />
für den Backofen / Schweiten - Schwitzen / glögget - glühen / gestern -<br />
vorgebackene Brotlaibe mit feuchtem Tuch abwischen / et leßte -<br />
zuletzt / Wessel - Wechsel / Brautliewe - Brotlaibe / Teiken - Zeichen<br />
Striëck - Strich / ieren - eisern / mott - muß / wi säget - wir sagen<br />
höällt - holt / läget - legen / naten - nassen / Backtied - Backzeit / ugge<br />
- euer / konn gi - könnt ihr / no Heime - nach Hause / iëck besoike -<br />
ich besuche / uënnen - buttern / van wiedem - von weitem / föhre iëck<br />
- fahre ich / met düenn Brauden - mit diesen Broten / Timmermanns -<br />
(Eigenname) / Wilmes - (Eigenname) / up nem Bliäke - auf einem<br />
Blech / hi - hier / brun - braun / schnitt - schneidet / Blagen - Kinder /<br />
Roiwenkrut - Rübenkraut / frögget - freut<br />
38
16. Dei erfüllte Wunschk<br />
Johanna Balkenhol, Brilon<br />
En Ehepaar, nit mehr ganz jung an Johren,<br />
dei beide all sau ümme de Säcksig woren,<br />
dei gengen spazeiern im Park am See,<br />
un do drapen se dann ne gude Fee!<br />
Dei küerte dei beiden fründlick an,<br />
un dat me sik bey är wat wünschken kann.<br />
„Seet mick mant, bat jey begehrt,<br />
un forts wärd ugg dei Wunschk erfüllt!“<br />
Dei Frugge winket höflick dankend af:<br />
„Ick wünschke niks, weil ick all alles haww’.“<br />
Dei Mann hingegen mennte: „Wann et müglick is,<br />
ick härre gern ne Frugge, dei diärtig Johre jünger is.<br />
„In Ordnung“, siëtt dei Fee,<br />
un schürret äre blonde Hore.<br />
„Van nöi aan biste niëgenzig Johre!“<br />
Worterklärungen<br />
drapen - trafen / bey är - bei ihr / seet mick mant - sagt mir nur / jey -<br />
ihr / wärd ugg - wird euch / Frugge - Frau / diärtig - dreißig / schürret<br />
- schüttelt / niëgenzig – neunzig<br />
39
17. Paul un Karel wollen Fiske fangen<br />
Hubert Hoffmann, Bruchhausen<br />
Et was ne herrlichen Sumer-Viärmiddag. Paul saat viär’m Höüse op<br />
diär Bank, im Schatten van diän Esken. De Balkenklappe was uopen,<br />
un sa konn et Hoi naä gutt en wennig nodroigen. Ok diär Katte, doi<br />
viärne op em Balken in diär Sunne laggte, dee doi sunnige Muorgen<br />
guëtt, un se was diäs ganz tefriän, wann ock hey un do mol ne Floige<br />
op derr Nase saat un soi dann ganz fix met diäm Poitken wier fiär<br />
Rugge suorgere. Jo, do kann me gutt öütresten.<br />
Doch bo Paul sa de Müggen über diäm Flüt danzen un diän eisten Fisk<br />
springen soh, do harr’e openmol Hunger op en paar gebrone Fiske. Jo,<br />
nit nur Hunger, et Water fluot me im Munde tesamen. Bey sick selber<br />
dacht’e noh, boi me dobey wuoll helpen könn. Richtig, seyn Frönd<br />
Karel wußte ümmer Root, un sa geng’e foort diär Strote ropp no<br />
Engeländers. Karel saat aak im Schatten un harr niks biätteres te daun<br />
erre de Peype te stoppen un te paffen. Doch dat Paul saä frah kaam,<br />
mochte doch ne Grund hebben. „Baät hiäste op em Hiärten“, frogere<br />
Karel un puost Paul ne Wolke van diäm gurren Krüllschnitt in’t<br />
Gesichte.<br />
„Weißte, Karel, vey hiät et Hoi op em Balken, un ick har wuoll<br />
Hunger op en paar Fiske. Saä ne Forelle in guder Buter gebron, is<br />
schonn wuot Feynes.“ „Jo, Paul, bo döü dat sa siëßt, kreyge ick aak<br />
schonn Hunger drop. Bat fiär en Glücke, darr ick gistern et Netz<br />
flicket hebbe, vey könn et mol foort öütprobäiern im graten Deyke.<br />
„Da!“ saggte Karel, gaffte Paul dat Bingeseil. „Nöü goh schonn mol.<br />
Ick niämme gleyk dat Netz unger diän Arm un kumme noh.“<br />
Et duerte nit lange, do stöngen se boide bey Niggemoiers Deyke.<br />
Doch bo Paul sa diän Deyk soh, kreig hoi doch en wennig Bammel un<br />
woll wieten, böü doip dat dat Water wör. Bo Karel nöü ok na hören<br />
mochte, dat Paul nit schwemmen konn, do geng’e gar nit feyne mehr<br />
met me ümme. „Döü alle Hospes, eis hiäste Awweteyt op Fiske un<br />
nöü ok na Angest viär’m Water. Morr ick dey dann nöü aak na et<br />
Schwemmen lehren! Na wachte! Hey, toih dat Seil diär’t Netz un dat<br />
Enge bingeste dey ümme’t Leyf. Döü geihst op Niggemoiers Seyte un<br />
40
ick bleybe op diär Strotenseyte. Nöü wieg deyne Heetzen mol sau’n<br />
wennig un stolpere nit ümmer!“<br />
Paul saggte nur „jau“, un et Fisken geng loss. Langsam un bedachtig<br />
tuogen se dat Netz diär’n Deyk; un fast am Enge, bo Karel insoh, dat<br />
sa wie sa känne Fiske imme Netze wören, dee’e, erre wann’e<br />
stolperte, un schonn laggte Paul imme Water. Et gaffte ne wahnen<br />
Plumps, bo doi Twei-Zentners-Kerel in’t Water fell. Karel gaffte sick<br />
alle Mögge, nit te lachen, un halp diäm armen Paul, doi doch sa geren<br />
en paar Fiske harre iäten wollt, öüt’m Water.<br />
Doch dann machte sick Paul Luft un saggte: „Loiber well ick mey<br />
diämnächst ne salterigen Hering iäten, erre met dey na einmol taum<br />
Fisken gohn!“ Jetz lachere Karel hell op un saggte: „Jo, Paul, lot dey<br />
diän salterigen Hering nur guëtt schmecken, doch darr ick dick mol<br />
in’t Water bracht hewwe, is et mey doch wert, dick fiär moren Obend<br />
ümme achte no’m Senger intelaan. Do drinke fe us einen drop!“<br />
Worterklärungen<br />
Viärmiddag - Vormittag / uopen - offen / saä - so / naä - noch<br />
nohdroigen - nachtrocknen / viärne - vorn / dee - tat / diäs ganz tefriän<br />
- damit ganz zufrieden / ock - auch / hey - hier / Floige - Fliege<br />
Pöötken - Pfötchen / Rugge - Ruhe / öütresten - ausruhen / bo - wo<br />
Müggen - Mücken / Flüt - Fluß, Bachlauf / eisten - ersten / soh - sah<br />
harr’e - hatte er / gebrone - gebratene / et Water fluot - das Wasser<br />
floß / bey - bei / dacht’e - dachte er / noh - nach / boi me - wer ihm<br />
geng’e - ging er / foort - sofort / Engelaänders - (Eigenname) / aäk -<br />
auch / daun - tun / Peype - Pfeife / daät - das, daß / baät - was / döü -<br />
du / siëßt - sagst / daärr ick - daß ich / vey könnt - wir können /<br />
graäten - großen / Bingelseil - hier: Angel / kumme no - komme nach /<br />
soh - sah / kreig hoi - bekam er / Bammel - Angst / wieten - wissen /<br />
böü - wie / doip - tief / mochte - mußte / met me - mit ihm / Hospes -<br />
Schelm (Schimpfwort) / eis - erst / hiäste - hast du / Awweteyt -<br />
Appetit / nöü - jetzt, nun / viär - vor / morr ick - muß ich / wachte -<br />
warte / toih - zieh / diär - durch / bingeste dey - bindest du dir / Leyf -<br />
Leib, Körper / wieg - bewege / Heetzen - Hacken, hier: Füße / tuogen<br />
41
se - zogen sie / dee’e - tat er / erre wann’e - als wenn er / wahn - groß,<br />
mächtig / fell - fiel / Mögge - Mühe / loiber - lieber / salterig - salzig<br />
naä einmol - noch einmal / daärr ick dick - daß ich dich / hewwe -<br />
habe / morgen Obend - morgen Abend / Senger - (Eigenname)<br />
intelaan - einzuladen / drinke ve - trinken wir<br />
18. Dat leiwe Geld<br />
Hildegard Winzenick, Züschen<br />
Meichmol hört me de Lüde klagen -<br />
wann dei Politiker roden taum Sparen -<br />
dat Leben wör blaut halb sau schwor,<br />
wenn dat leiwe Geld nit wör.<br />
Unse Männer bruken nit meh för de Arbet rut,<br />
wörn en ganzen Dag bi uns im Huss.<br />
Mi können uns keipen düet un dat,<br />
ohne ümmer te frogen: Wat kostet denn dat?<br />
Un unse Blagen, dei leiwen Kleinen,<br />
kreigen alles, wat se wöllt, ohne lange te greinen.<br />
Un eis mi selbes, wat wörn mi fien,<br />
können ümmer mit de niggeste Maude sinn.<br />
Haut un Rock un Täschken un Kleid<br />
können me ümmer keipen, wann me’t alle wör leid.<br />
Un eis in en Urlaub no Gran Canaria,<br />
feierten mi gliek veiermol im Johr. -<br />
Jo, wat wör dat Leben fien,<br />
brukere me nit ümmer op et Geld te senn.<br />
Aber allet sau iës im Leben,<br />
sall et van jedem Dingen twei Sieden giëbben.<br />
Wör et woal noch sau spannend op de Welt,<br />
ohne dat mi sorgen un jagen noh’ m Geld?<br />
Härren mi nit dat Gefeihl, dat mi alle jo kennen,<br />
uns en wennig meh asse deäm Nohber te güennen?<br />
Oder met deäm suer verdeinten Geld<br />
42
uns wat te keipen, wat us alle lange gefällt?<br />
Oder för’t Auto, för dat mi lange espart,<br />
endlich dei leßte Rate betahlt?<br />
Unsen Mannslüden wör’t doch nit meh geheuer,<br />
können se nit ümmer siëgen: „Frogge, dat iës viël te düer!“<br />
Un eis dat fiene Gefeihl im Leben:<br />
Het me ne gurre Spende egiëbben?<br />
Iëck gleibe, auk unsem Pastauer dee doch wat fehlen,<br />
könn hei nit ümmer dei gurren Kollekten tehlen.<br />
Un eis, wann et eimol geiht an’t Sterben,<br />
härren mi niks meh te vererben.<br />
Drum siëg iëck ugg: Dat Läben wör kenn Läben mehr,<br />
wenn dat leiwe Geld nit wör.<br />
Worterklärungen<br />
meichmol - manchmal / Lüde - Leute / roden - raten / leiwe - liebe<br />
bruken - brauchen / mi - wir / keipen - kaufen / greinen - weinen<br />
niggeste - neueste / Haut - Hut / me’t - man es / alle - alte / feierten mi<br />
- würden wir fahren / gliek - gleich / veiermol - viermal / te senn - zu<br />
sehen / Sieden - Seiten / noh - nach / härren mi - hätten wir / Gefeihl -<br />
Gefühl / meh - mehr / Nohber - Nachbar / güennen - gönnen / suer -<br />
sauer / siëgen - sagen / Frogge - Frau / düer - teuer / eis - erst / het me<br />
- hat man / egiëbben - gegeben / iëck gleibe - ich glaube / dää - täte /<br />
hei - er / siëg iëck - sage ich / ugg - euch, Ihnen / kenn - kein<br />
43
19. Dönekes<br />
Karl-Heinz Schreckenberg, Brilon<br />
Awwer nöi well ick Dönekes vertellen, dei froiher passeiert sind, un<br />
dei dündag passeiert.<br />
Iek wur vör einiger Teyd mol op ner Hochteyd, do saggte in<br />
vörgerückeder Stunde dei Bröitmutter: „Kumm, vertell us eismol<br />
sau’n paar plattduitsche Dönekes. Wann de Lüe lachet, dann iätet se<br />
nit sauviel.“<br />
Twei Breylsche Buren, dei gengen noh’m Schweynemarkt un wollen<br />
Schweyne kaupen. Se kamen noh diäm Händler un frogern: „Bat kost<br />
de Schweyne?“ Do saggte dei: „Fuffzig Mark et Stück“, „Au“, siet<br />
Albert, „dat is te düer, hiäste kenne billigere?“ „Jo“, siet dei Händler,<br />
„iek hebbe hey nau sau’n Kleinte, dat is ne Frühgeburt, dat kannste<br />
kreygen för acht Mark fuffzig.“ „Och“, siet Albert, „dat niämme iek“.<br />
Do siet Willem: „Biste verrückt, bat wißte dann met saume kleinen<br />
Dingen, dat git doch nix Gescheites.“ „Ooch“, saggte Albert, „weißte,<br />
meyne Frugge wur auk ne Frühgeburt un dündag is’e sau dicke.“<br />
Do woll ock mol ne Buren ne Göil kaupen. Hei geng noh me Händler<br />
un frogere, ob hey ne Göil härre. „Jo“, siet düse, iek häbbe hey nau<br />
sau ne allen Hengest, dei is nau gut im Schuß. Do kannste alles mie<br />
maken. Diän kannste vör’n Wagen spannen, diän kannste Schützenfest<br />
vör de Kutske spannen, un do kannste auk no drop riën.Wann de diek<br />
do muorgens ümme seß Uhr in Breylen drop sitten geihst, kannste<br />
ümme sieben Uhr all in Iälerkusen sinn. „O“, saggte dei Bure, „wann<br />
dei nau sau gut is, dann niämme iek ne.“ Dei beiden wurten<br />
handelseinig, un hei nahm diän Göil mië.<br />
Un noh ner Stunde kam’e un brachte ne wier. „Ja,“ saggt’e, „iek<br />
häbbe’t mick üeberlaggt, iek kann ne doch nit bröiken.“ „Borümme?“<br />
siet dann dei Händler. „Jo, borümme wuoll“, saggte de Bure.<br />
Üeberlieg mol, bat sall iek muorgens ümme sieben Uhr all in<br />
Iälerkusen?“ „O“, saggte dei Händler, „do is et doch schoine!<br />
44
Iälerkusen, dat is ent van diän schöndesten Döärpern imme Suerlande,<br />
un do is immer bat laus, un do kann me auk fieren.“<br />
Do wuren mol twei Jungens öit Breylen, de harren in Iiälerkusen<br />
Schützenfeste fiert, froiher, wie dat sau wur: Un do wur dat nau sau,<br />
wenn se nachts heime mochten, do harren se nau kenne Autos un<br />
Taxen, do mochten se te Faute gohn. Un dei nögeste Wiäg van<br />
Iiälerkusen no Breylen, dei geiht üeber diän Borbiärg. Sei machten<br />
siek op diän Wiäg, un dann geng immer biärgop, un als se no ner<br />
Stunde moihe un naatgeschwett uaben bey der Kapelle ankamen, do<br />
stongen se do. Do saggte dei eine: „Je, leiwe Mutter Goaddes, nöi sind<br />
vey alle dreie vull, döi bist vull der Gnade un vey sind vull Schnaps<br />
un Beier. Awwer“, saggt’e, „döi hiäst - döi hiäst et gut, döi kannst hey<br />
stohn un vey mutet nau no Breylen gohn.“<br />
Un dann gengen se laus, imme Duistern, un weyl se kenne Uhr harren,<br />
wußten se nit, böi late darr et wur. Als sei no Breylen rin kamen,<br />
brannte in einem Höise nau Lecht. Se kloppern an, do kam de<br />
Höisheer an’t Fenster un frogere, bat se wöllen. „Ach“, siet dei eine,<br />
„vey het kenne Uhr bey uns, konn chey us wuoll seen, böi late dat et<br />
is?“ Do dreggere siek dei Kerel rümme un reep in de Stuobe: „Marie!<br />
Biste all op diäm Pöttken ewiäst?“ Do reep seyne Frugge van innen:<br />
„Jau, do wur iek grade droppe.“ Do saggte hei: „Jungens, dann is et<br />
feyf Minöiten no twei.“<br />
Twei Rentner stongen in Breylen op en Market. Do siet dei eine: Mick<br />
jüket’t in der Hand. Ick glaube, unse Bundeskanzler well uns de Rente<br />
erhöhen.“ Do siet de eine: „Mick jüket’t am Hingersten, ick glaube,<br />
dei schitt us wat.“<br />
Op einem Burenhoawe, do harren se ne Knecht, dei hette Wilhelm, un<br />
dann na sau ne alle Tante, dei hette Soffie. Dei fauerte de Schweyne<br />
un wur in der Küke. Un eines Dages, do siet düse Willelm för dat<br />
Soffie: Höör mol, heaste Lust, miek te friggen?“ „Ja,“ saggte dat<br />
Soffie, „weiste, ick will jo auk mol ganz gerne dat Sakrament der Ehe<br />
empfangen. Abber – üwerlieg dick dat – ick bin nit mehr et Jüngeste,<br />
un ick bin auk nit mehr sau attraktiv.“ „Och“, siet Willem, „dat is nit<br />
schliem. Bey Dage biste im Stalle un in der Küke, un nachts is’t sau<br />
wie sau duister.“<br />
45
Jo, suorgenvull blickere dei Buere op seyne graute Famillige. Jedes<br />
Johr en Blage. „Sau kann dat nit widdergohn“, saggt’e för seyne<br />
Frugge. „Ab moargen schlop ick op em Balken.“ Do siet seyne<br />
Frugge: „Wann de meinst, dat dat wat hilpet, schlop ick auk do.“<br />
No wor auk ne Rentner, dei wor 65 (feywensekzig) Johre alt, wur auk<br />
Wiedmann, un ha ümmer sau Langeweyle. Ick see: „Weiste wat? Döi<br />
söß nau mol wierfriggen, dann kriste ne junge Frugge, dei maket diek<br />
wier jung.“ „Au jau“, saggt’e, „dat mak ick auk.“ Un dann frigger’e<br />
nau mol wier, un do drap ick ne en paar Wiäken später, Ick see: „Na,<br />
böi is et?“<br />
„Ooch“, siet’e, „ick foihle mick sau jung, ick foihle miek alt wier<br />
fuffzig Johre jünger! Ick see: „Böi maket sick dat dann bemerkbar?“<br />
„Jo“, saggt’e, „ick schmoike all wier heimlek op em Klo.“<br />
Jo, do wur ne Burenhuaff, dei brannte. Un do kam de Füerwehr un<br />
wull löschken. Do siet dei Bure för dei Füerwehr: “Löschket eis diän<br />
Kauhstall, dat diän Köggen niks passeiert.” Do hellen se miet allen<br />
Rohren op diän Kauhstall. Noh ner halben Stunde wur dat Füer öit. Do<br />
siet dei Fuierwehrhauptmann för den Buren: „Befehl ausgeführt!<br />
Kenne Kauh is verbrannt, se sind alle versuappen.“<br />
Jo, do wor ne Famillige, do siet dei Frugge: Et is jetz Fastenteyd.<br />
Weiste wat, unse Nohber, unse Franz, dei well en Fastenopfer<br />
brengen. Dei well de ganze Fastenteyd nit schmoiken. Soffe dat nit<br />
auk maken, en Fastenopfer brengen? Jo, wat make - wat soll vey dann<br />
maken? Do siet hei: “Weiste, süs make vey - dann schlop ick einfach<br />
bit Austern einfach nit mehr bey dey.“ „Ja, dat konne we auk maken,<br />
awwer böi make we dat?“ „Ja“, siet hei, döi schlöpest ungen im<br />
Schlopzimmer un iek goh uaben op en Balken.“ Na ja, se machten dat<br />
auk. Hei geng den eisten Obend op den Balken . Duerte ne Weyle, do<br />
kam de Frugge hingerher.: „Anton, biste auk warme? Oder soll iek<br />
dey nau ne Wulldecke brengen?“ „Nei“, siet hei, „ick bin schoin<br />
warm, iek schlope jo all.“ Twedden Obend datselbe, kam se auk wier<br />
rop: „Biste auk warme? Fruisete nit? Odder soll iek dey ne<br />
Wiärmflaske brengen?“ „Nei“, siet’e, „iek schlope schonn! Ick bin<br />
warme! Drüdden Obend kam se wier. Do siet’e: Bat weste denn nöi<br />
all wier? Lot mick doch schlopen!“ „Jo, ick woll dey nur seen, unse<br />
Nober, dei Franz, dei schmoiket all wier.“<br />
46
Worterklärungen<br />
Dönekes - Witze, lustige Geschichten / froiher - früher / dündag -<br />
heute / iek wur - ich war / Teyd - Zeit / Bröitmutter - Brautmutter<br />
eismol - erst einmal / Luie - Leute / iätet se - essen sie / nöi - jetzt, nun<br />
Breylsche Buren - Bauern aus Brilon / bat - was / siet - sagt / düer -<br />
teuer / hiäste - hast du / iek hebbe - ich habe / hey nau - hier noch /<br />
sau’n Kleinte - so ein Kleines / kreygen - bekommen, erhalten / wißte -<br />
willst du / git - gibt / Frugge - Frau / ock - auch / Göil - Pferd / hei<br />
geng - er ging / düse - dieser / ne allen Hengest - einen alten Hengst<br />
nau - noch / mië - mit / riën - reiten / wann de diek - wenn du dich<br />
Breylen - Brilon / drop sitten geihst - darauf setztest (wörtl.: darauf<br />
sitzen gehst) / Iälerkusen - Elleringhausen (Ort) / iek häbbe’t mi - ich<br />
habe es mir / bröiken - gebrauchen, verwenden, benutzen / borümme -<br />
warum / all in Iälerkusen - schon in Ellerinhausen / dat is ent - das ist<br />
eines / laus - los / fieren - feiern / heime mochten - nach Hause<br />
mußten / mochten se - mußten sie / te Faute - zu Fuß / dei nögeste<br />
Wiäg - der nächste Weg / Borbiärg - Borberg (Berg in Brilon) /<br />
biärgop - bergauf / moihe - müde / naatgeschwett - naßgeschwitzt / döi<br />
- du / vey - wir / vey mutet - wir müssen / laus - los / imme Duistern -<br />
im Dunkeln / böi late - wie spät / Lecht - Licht / konn chey - könnt ihr<br />
seen - sagen / dreggere - drehte / reep - rief / ewiäst - gewesen /<br />
Frugge - Frau / droppe - drauf / feyf - fünf / mick jüket’t - mich juckt<br />
es / dei hette - der hieß / dei fauerte - die fütterte / Küke - Küche / för<br />
dat Soffie - zu der Sofie / friggen - heiraten / duister - dunkel, düster<br />
Blage - Kind / widdergohn - weitergehen / schlop ick - schlafe ich /<br />
ick see - ich sage / döi söß - du solltest / wierfriggen - wieder heiraten<br />
kriste - bekommst du / Wiäken - Wochen / ick foihle - ich fühle / ick<br />
schmoike - ich rauche / Kauhstall - Kuhstall / Kögge - Kühe / hellen<br />
se - hielten sie / öit - aus / versuappen - ertrunken / Nohber - Nachbar<br />
soll vey - sollen wir / süs - sonst / Austern - Ostern / bey dey - bei dir<br />
konne we - können wir / uaben - oben / duerte - dauerte / rop - herauf<br />
fruiseste - frierst du / drüdden Obend - am dritten Abend / weste -<br />
willst du / all - schon<br />
47
Inhaltsverzeichnis der CD Heftseite Zeit<br />
1. Elisabeth Oberließen, Züschen Nu well iëck ugg mol<br />
wat vertellen 9 3:44<br />
2. Franz Reineke, Braunshausen * So’n Wendadoak 11 1:05<br />
3. Hedwig Habitzki,<br />
Westernbödefeld Dat witte Froihjohr 12 1:51<br />
4. Helmut Geilen, Niedersfeld Daue Klocken sind doch<br />
in Reëm 14 2:25<br />
5. Ursula Sommer, Altastenberg De Prossjaan 15 1:29<br />
6. Heribert Schmidt,<br />
Wulmeringhausen Froihjohrsputz 17 1:37<br />
7. Bruno Völlmecke, Hallenberg * Eehn Friehlingsdag 19 2:59<br />
8. Theresia Imberg, Niedersfeld Hexennacht 1974 21 2:03<br />
9. Regina Brieden, Züschen Tufelnbroden 22 1:39<br />
10. Maria Kleinsorge, Züschen, und<br />
Josefa Hoffmann, Züschen Dorfgespräch op Platt 23 4:22<br />
11. Maria Droste, Welschen-Ennest De Amtskuckuck 26 1:39<br />
12. Franz Völlmecke, Züschen 125. Jubilläum van der<br />
St. Hubertus-Breiderschaft 28 0:48<br />
13. Bruno Senge, Silbach Use Ahnen 29 1:51<br />
14. Bernhard Kresin, Rüthen De Oikbäom 31 2:49<br />
15. Anna Grundhoff, Düdinghausen Vam Brautbacken sau<br />
vör 70 Johren 34 8:08<br />
16. Johanna Balkenhol, Brilon Dei erfüllte Wunsk 39 0:51<br />
17. Hubert Hoffmann, Bruchhausen Paul un Karel wollen<br />
Fiske fangen 40 4:27<br />
18. Hildegund Winzenick, Züschen Dat leiwe Geld 42 2:14<br />
19. Karl-Heinz Schreckenberg,<br />
Brilon Dönekes 44 5:56<br />
* Anmerkung:<br />
Der Braunshauser und der Hallenberger Dialekt gehören zu den hessischen und damit<br />
zu den hochdeutschen Mundarten.<br />
48