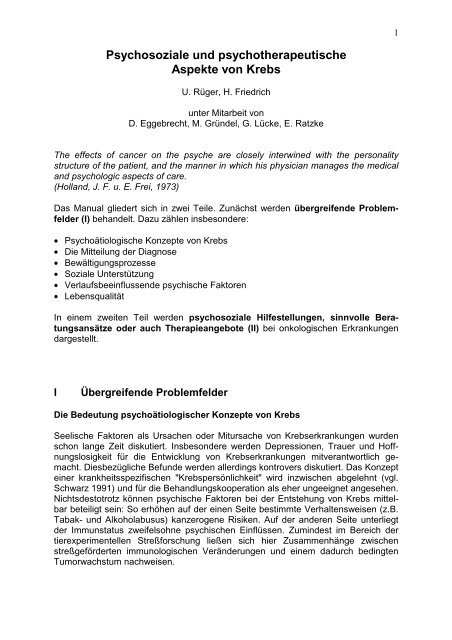Psychoonkologische Aspekte bei Krebserkrankungen
Psychoonkologische Aspekte bei Krebserkrankungen
Psychoonkologische Aspekte bei Krebserkrankungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Psychosoziale und psychotherapeutische<br />
<strong>Aspekte</strong> von Krebs<br />
U. Rüger, H. Friedrich<br />
unter Mitar<strong>bei</strong>t von<br />
D. Eggebrecht, M. Gründel, G. Lücke, E. Ratzke<br />
The effects of cancer on the psyche are closely interwined with the personality<br />
structure of the patient, and the manner in which his physician manages the medical<br />
and psychologic aspects of care.<br />
(Holland, J. F. u. E. Frei, 1973)<br />
Das Manual gliedert sich in zwei Teile. Zunächst werden übergreifende Problemfelder<br />
(I) behandelt. Dazu zählen insbesondere:<br />
• Psychoätiologische Konzepte von Krebs<br />
• Die Mitteilung der Diagnose<br />
• Bewältigungsprozesse<br />
• Soziale Unterstützung<br />
• Verlaufsbeeinflussende psychische Faktoren<br />
• Lebensqualität<br />
In einem zweiten Teil werden psychosoziale Hilfestellungen, sinnvolle Beratungsansätze<br />
oder auch Therapieangebote (II) <strong>bei</strong> onkologischen Erkrankungen<br />
dargestellt.<br />
I<br />
Übergreifende Problemfelder<br />
Die Bedeutung psychoätiologischer Konzepte von Krebs<br />
Seelische Faktoren als Ursachen oder Mitursache von <strong>Krebserkrankungen</strong> wurden<br />
schon lange Zeit diskutiert. Insbesondere werden Depressionen, Trauer und Hoffnungslosigkeit<br />
für die Entwicklung von <strong>Krebserkrankungen</strong> mitverantwortlich gemacht.<br />
Diesbezügliche Befunde werden allerdings kontrovers diskutiert. Das Konzept<br />
einer krankheitsspezifischen "Krebspersönlichkeit" wird inzwischen abgelehnt (vgl.<br />
Schwarz 1991) und für die Behandlungskooperation als eher ungeeignet angesehen.<br />
Nichtsdestotrotz können psychische Faktoren <strong>bei</strong> der Entstehung von Krebs mittelbar<br />
beteiligt sein: So erhöhen auf der einen Seite bestimmte Verhaltensweisen (z.B.<br />
Tabak- und Alkoholabusus) kanzerogene Risiken. Auf der anderen Seite unterliegt<br />
der Immunstatus zweifelsohne psychischen Einflüssen. Zumindest im Bereich der<br />
tierexperimentellen Streßforschung ließen sich hier Zusammenhänge zwischen<br />
streßgeförderten immunologischen Veränderungen und einem dadurch bedingten<br />
Tumorwachstum nachweisen.
Auch wenn diese Ergebnisse durch zukünftige humanwissenschaftliche Forschung<br />
abgesichert werden sollte, so ergeben sich hier für die praktische Behandlung von<br />
Krebskranken keine unmittelbaren Konsequenzen; im Gegenteil zeigen Patienten mit<br />
einer psychogenen Kausalattribuition ihrer Krebserkrankung eine schlechtere Krankheitsbewältigung<br />
und eine größere subjektive Belastung durch die Erkrankung<br />
(Riehl-Emde et al. 1988). Seelische Belastungen auf Seiten des Patienten sollten<br />
deshalb zwar immer vom Arzt berücksichtigt und ggf. angesprochen werden; nach<br />
Möglichkeit sollte aber eine seelische Ursachenzuschreibung nicht gefördert werden.<br />
Nach unserer Meinung sollte zumindest vermieden werden, einen solchen möglichen<br />
Zusammenhang mit der Gefahr einer Schuldzuweisung zu erörtern; dies gilt auch,<br />
wenn der Patient sich nichtsdestotrotz immer wieder die Frage stellt: Warum gerade<br />
ich? Was habe ich Schlimmes getan? Spricht der Patient diese Möglichkeit allerdings<br />
von sich aus an, sollte der Arzt diesem Thema nicht ausweichen, damit der<br />
Patient sich <strong>bei</strong> dieser ihn sehr belastenden Frage nicht alleingelassen fühlt.<br />
Die Gefahren, die eine einseitige seelische Ursachenzuschreibung einer Krebserkrankung<br />
mit sich bringen, drückt die amerikanische Soziologin Susan Sonntag recht<br />
drastisch aus: "Patienten, die darüber belehrt werden, daß sie ihre Krankheit unwissentlich<br />
selbst verursacht haben, läßt man zugleich fühlen, daß sie sie verdient haben!"<br />
(Krankheit als Metapher, 1981).<br />
2<br />
Diagnosemitteilung<br />
Der Patient hat ein Recht auf die Mitteilung der Diagnose. Nur der informed consent<br />
sichert dem Patienten sein Recht auf Selbstbestimmung. Die Aufklärung über die<br />
Erkrankung ist aber kein einzelner Akt, sondern ein schrittweiser Prozeß zwischen<br />
Patient und seinem behandelnden Arzt. Häufig müssen entsprechende Gespräche<br />
mehrfach stattfinden. Zunächst muß der Arzt erfahren, was der Patient über seine<br />
Erkrankung vermutet und auf dieser Grundlage das nachfolgende Gespräch führen.<br />
Da<strong>bei</strong> sind Rückfragen immer möglich, und der Arzt darf nicht den Eindruck vermitteln,<br />
Fragen des Patienten auszuweichen (Therapiemöglichkeit, Verlauf, Nebenwirkung,<br />
Prognose). Die Dauer des Gespräches richtet sich nach der affektiven Befindlichkeit<br />
des Patienten. Wenn zwischen Arzt und Patient bereits die Vertrauensbasis<br />
vor dem Hintergrund mehrerer Vorgespräche steht, so kann eine mittlere Gesprächsdauer<br />
von z. B. 10 bis 15 Minuten ausreichen.<br />
Besonders hervorzuheben ist, daß Diagnosemitteilung bzw. Aufklärung in der Regel<br />
nicht innerhalb eines Gespräches geleistet werden können; die Aufklärung muß sich<br />
an den Abwehr- und Verar<strong>bei</strong>tungsmöglichkeiten des Patienten orientieren (adaptive<br />
Verdrängung) und in bezug auf die Therapie - unabhängig vom Krankheitsstadium -<br />
dem "Prinzip Hoffnung" folgen. Für die Aufklärung des Patienten muß sich e i n Arzt<br />
verantwortlich fühlen; die partielle, ggf. fach- oder befundbezogene Aufklärung ist<br />
weniger günstig; die für den weiteren Behandlungsverlauf wichtige vertrauensvolle<br />
Arzt-Patienten-Beziehung beginnt damit, daß der für den Patienten verantwortliche<br />
Arzt diesen <strong>bei</strong>m Aufklärungsgespräch und nachfolgenden notwendigen Gesprächen<br />
mit seiner Person ganz zur Verfügung steht.<br />
Der Schock nach der Diagnosemitteilung ist normal; entsprechende psychische Reaktionen<br />
wie Bagatellisieren oder ein partielles Verleugnen der gerade mitgeteilten<br />
Erkrankung oder auch ein passageres Derealisationserleben sind notwendig, um
den Diagnoseschock bewältigen zu können. Da<strong>bei</strong> ist von allen mit der Betreuung<br />
und Behandlung der Patienten Betrauten zu beachten, daß das Ausmaß an Krankheitsverleugnung<br />
stündlich wechseln kann und damit auch die Bereitschaft für weitere<br />
notwendige diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Ein entsprechendes<br />
Verhalten auf Seiten des Patienten ist demnach in der einen oder anderen Form zu<br />
erwarten und <strong>bei</strong> seiner Betreuung zu berücksichtigen.<br />
Im weiteren Verlauf wird der Schock nach der unmittelbaren Diagnose-Mitteilung<br />
häufig von Angst und nachfolgender Trauer abgelöst; bisweilen treten auch Schamund<br />
Schuldgefühle in den Vordergrund. Diese Zeit ist wesentlich mit dafür entscheidend,<br />
ob der Patient mittelfristig eher ein hoffnungsvolles oder ein eher depressivresignatives<br />
Grundgefühl entwickelt.<br />
3<br />
Krankheitsbewältigung<br />
Der häufigste Bewältigungsmechanismus <strong>bei</strong> Krebs ist die Krankheitsverleugnung.<br />
Diese ist in ihrer Intensität nicht zeitstabil. Die Patienten bewegen sich zwischen<br />
"Wissen und Nichtwissen, zwischen Akzeptanz und Nichtwahrhabenwollen" (vgl.<br />
Beutel 1988). Dieser Zwischenzustand ("Middle knowledge") ist als Krankheit adaptiv<br />
zu verstehen: Ein gewisses Ausmaß an Verleugnung erhält überhaupt erst die psychische<br />
Stabilität und Handlungsfähigkeit; die Akzeptanz der Realität wiederum ermöglicht<br />
erst die notwendige Compliance <strong>bei</strong> der Behandlung der Erkrankung.<br />
Die Art der Krankheitsbewältigung insgesamt scheint sich auch auf den weiteren Behandlungsverlauf<br />
auszuwirken: Patienten mit einer gewissen Verleugnung und<br />
kämpferischen Grundeinstellungen haben durchschnittlich eine höhere 5-Jahres-<br />
Überlebensrate als Patienten mit einer eher stoischen Grundhaltung gepaart mit<br />
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit (Greer et al. 1979 und Pettingale 1984). Bei Patienten<br />
mit der zweiten Konstellation ist deshalb in jedem Fall die Notwendigkeit einer<br />
psychotherapeutischen Mitbehandlung zu klären. Bei einiger Sensibilität sind diese<br />
Patienten durchaus auch im Rahmen der Routineversorgung zu entdecken; sie benötigen<br />
dann allerdings eine ausführlichere Gesprächsmöglichkeit, um den Hintergrund<br />
ihres Zustandsbildes zu finden. Entdeckt man diese Patienten frühzeitig und<br />
kann sie z.B. im Rahmen einer Krisenintervention behandeln, lassen sich vielfach<br />
langfristig ungünstige Entwicklungen vermeiden.<br />
Soziale Unterstützung<br />
Soziale Unterstützung (social support)) ist keine statische Größe. Sie hängt in der<br />
Regel von schicksalshaften Konstellationen und "objektiven" äußeren Umständen<br />
ab; hierzu zählen z.B. die soziale Lebenswelt des Patienten mit Familie, Verwandtschaft,<br />
Berufskollegen etc.. Insbesondere letztere werden aber auch durch die prämorbide<br />
Persönlichkeit des Patienten, z.B. seine kommunikativen Fähigkeiten mitbestimmt.<br />
Auch für diese Seite des Patienten muß der Arzt Interesse zeigen, ggf. sich<br />
vergewissern, welche soziale Hilfestellungen dem Patienten zur Verfügung stehen<br />
und welche nicht und wo es hier Verbesserungsmöglichkeiten geben könnte. In diesem<br />
Rahmen muß auch geklärt werden, welche Hilfestellung seitens der Familie und<br />
des Freundeskreises möglich ist. Hier muß allerdings auch vor einer moralisierenden<br />
Überforderung der Angehörigen gewarnt werden.
4<br />
Einen nicht unwesentlichen Einfluß übt auch das soziale System Krankenhaus aus:<br />
Hier wirken sich belastende strukturelle Bedingungen, z.B. lange Wartezeiten, ungünstige<br />
räumliche Bedingungen, häufiger Arztwechsel, fehlende Ansprechpartner<br />
sowie Unübersichtlichkeiten in den Zuständigkeiten ungünstig aus. Das Gefühl von<br />
Sicherheit für den Patienten wird in jedem Fall auch dadurch gefördert, daß er für die<br />
Zeit seiner Behandlung eine konstante Beziehung zu seinem Arzt aufbauen kann.<br />
Dies ist <strong>bei</strong> häufigem Arztwechsel eher schwer möglich.<br />
Lebensqualität<br />
Ein wesentliches Ziel der Behandlung von onkologischen Patienten ist es, über alle<br />
Krankheitsstadien hinweg die relativ bestmöglichste Lebensqualität zu erhalten.<br />
Nach heutiger Auffassung definiert diese sich nicht mehr ausschließlich über das<br />
Ausmaß an körperlicher Funktionsfähigkeit, sondern berücksichtigt auch die psychische<br />
und soziale Dimension.<br />
Die heutigen Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie von <strong>Krebserkrankungen</strong> haben<br />
die Überlebenszeit, aber auch die Behandlungszeit verlängert. Damit stellt sich<br />
zwangsläufig die Frage nach der Lebensqualität. Diese läßt sich auf der einen Seite<br />
nach objektiven (meist somatischen) Kriterien definieren. Nach allgemeiner Erfahrung<br />
spielt aber die subjektive Einschätzung der Lebensqualität durch den Patienten<br />
eine viel größere Rolle: im Einzelfall kann eine objektive Einschränkung im somatischen<br />
Bereich durch günstige Umstände in anderen Lebensbereichen (partiell) kompensiert<br />
werden (oder auch nicht). Zum anderen erfährt im günstigen Fall die subjektive<br />
Bewertung der Lebensqualität auch im zeitlichen Längsschnitt eine Relativierung<br />
im Rahmen eines krankheitsadaptiven Prozesses.<br />
Beratung und therapeutische Hilfestellung haben demnach in diesem Bereich die<br />
objektive und subjektive Situation des einzelnen Patienten zu berücksichtigen.<br />
Aus den bisherigen Ausführungen wird leicht deutlich: Krankheitsbewältigung, Lebensqualität<br />
und soziale Unterstützung wirken sich nicht einlinig und ggf. additiv auf<br />
das psycho-soziale Gesamtbefinden des Patienten aus. Vielmehr bestehen hier interdependente<br />
Zusammenhänge. Die Entscheidung über sinnvolle therapeutische<br />
Hilfestellung leitet sich damit auch weniger aus quantitativen Befundscores, sondern<br />
nur aus einer differenzierten qualitativen Beurteilung des Einzelfalls ab.
5<br />
II.<br />
Formen der psycho-sozialen Hilfe, Beratung und Therapie<br />
<strong>bei</strong> onkologischen Erkrankungen<br />
1. Akutkrankenhaus<br />
2. Ambulanz<br />
Supportive Therapie, Krisenintervention, Beratungsgespräche/Kurztherapie<br />
3. Psychotherapie im engeren Sinne<br />
4. Selbsthilfegruppen<br />
5. Angehörigenar<strong>bei</strong>t<br />
6. Sterbebegleitung<br />
7. Soziale und sozialrechtliche <strong>Aspekte</strong><br />
1. Akutkrankenhaus<br />
Die Belastungsintensität im Akutkrankenhaus ist durch den zunehmenden Einsatz<br />
invasiver onkologischer Behandlungsverfahren (z.B. Ganzkörperbestrahlung, Hochdosis-Chemotherapie,<br />
Knochenmark-und Stammzelltransplantation) deutlich gestiegen.<br />
An die Compliance der Patienten werden hohe Anforderungen gestellt. Eine<br />
stützende, Sicherheit und Gelassenheit fördernde Atmosphäre auf der Station mit<br />
den entsprechenden Beziehungsangeboten ist für den Behandlungserfolg daher von<br />
großer Wichtigkeit. Folglich gilt die Ar<strong>bei</strong>t des psychosozialen Mitar<strong>bei</strong>ters im Liaisondienst<br />
nicht nur dem einzelnen Patienten, sondern dem ganzen Milieu, um, wie<br />
Ullrich (1993) formuliert, „die strukturelle Empathie einer Klinik“ zu verbessern. Das<br />
erfordert (im Gegensatz zum Konsiliardienst) eine regelmäßige, unaufgeforderte Anwesenheit<br />
auf der onkologischen Station mehrmals in der Woche mit höherem Integrationsgrad<br />
und entsprechend besserer Informations- und Interventionsmöglichkeit.<br />
Zentral ist da<strong>bei</strong>, die psychosoziale Kompetenz des pflegerischen und ärztlichen<br />
Personals zu unterstützen und zu ergänzen, nicht zu schmälern oder gar zu ersetzen.<br />
Die folgenden Aufgaben sind da<strong>bei</strong> von besonderer Bedeutung:<br />
• psychosoziale Betreuung bzw. supportive Psychotherapie und Krisenintervention<br />
<strong>bei</strong> einzelnen Patienten, die darum bitten oder <strong>bei</strong> denen eine krisenhafte Entwicklung<br />
besondere psychosoziale Kompetenzen erfordert; dazu zählen Einzelkontakte<br />
am Krankenbett, Paar- und Familiengespräche und das Angebot (telefonischer)<br />
Kontaktkontinuität nach Verlegung oder Entlassung, aber auch Bewältigungshilfen<br />
für die Angehörigen nach dem Tod des Patienten;<br />
• Förderung der Wahrnehmung psychosozialer <strong>Aspekte</strong> von Krankheit und Behandlung<br />
<strong>bei</strong> den Mitar<strong>bei</strong>tern durch Thematisieren entsprechender Zusammenhänge<br />
im Gespräch mit Ärzten und Pflegepersonal; beratende Unterstützung <strong>bei</strong><br />
der Behandlung einzelner Patienten;<br />
• Verbesserung von stationären und stationsübergreifenden Strukturen und Abläufen,<br />
die im Lebensraum Klinik eine vermeidbare Mehrbelastung für Patienten, oft<br />
auch für Behandler darstellen; dazu gehört z.B. die Kooperation verschiedener<br />
Berufs- und Behandlergruppen, alle die Mahlzeiten betreffenden Umstände oder<br />
die innenarchitektonische Gestaltung von Räumen und Fluren.
6<br />
2. Ambulanz<br />
Supportive Therapie, Krisenintervention,<br />
Beratungsgespräche/Kurztherapie<br />
Mit der Diagnose Krebs wird der Betroffene mit einer existentiellen physischen und<br />
sozialen Bedrohung in seiner Identität konfrontiert. Sie stehen vor der fortwährenden<br />
und mit jeder medizinischen Maßnahme, Befindlichkeitsveränderung oder Kontrolluntersuchung<br />
wieder aktualisierten Aufgabe, eine Umgangsweise mit ihrer Krankheit<br />
zu finden, die<br />
• der beeinträchtigten körperlichen Leistungsfähigkeit entspricht,<br />
• Auflagen und Erfordernisse der Therapie adäquat berücksichtigt,<br />
• über stabile Verhaltens- und Darstellungsformen nach außen das soziale<br />
Weiterleben ermöglicht.<br />
Krebskranke Menschen müssen sich neu orientieren, in ihren Rollen innerhalb der<br />
Familie, im weiteren sozialen Umfeld und am Ar<strong>bei</strong>tsplatz. Außerdem müssen sie<br />
sich mit dem unsicheren, langfristigen Verlauf und der stigmatisierenden Wirkung<br />
der Krankheitsdiagnose auseinandersetzen. Längere Ar<strong>bei</strong>tsunfähigkeit und oft auch<br />
frühzeitige Berentung in der Folge einer Krebserkrankung bringen eine weitere Fülle<br />
von Problemen hinsichtlich der sozialen Identität, des Selbstwertgefühls und der finanziellen<br />
Situation der Erkrankten und ihrer Familien mit sich.<br />
Für dieses Problemspektrum bedarf es einer Vielfalt von Kontakt- und Beratungsraum,<br />
die den jeweiligen Bedürfnissen der Betroffenen angemessen sind;<br />
• Kurzberatungen, die die Möglichkeit zu punktuellen die medizinische Behandlung<br />
begleitenden und ergänzenden Gesprächen bieten, in denen akute Ängste, z.B.<br />
vor einer Chemotherapie, vor dem nächsten Arztbesuch, den zu erfragenden Befund,<br />
vor der nächsten Kontrolluntersuchung, dem Gespräch mit Angehörigen,<br />
begrenzt auf den aktuellen Kontext angesprochen werden können,<br />
• die Möglichkeit unverbindlicher Kontaktaufnahmen, ohne daß man gleich eine<br />
Psychotherapie aufnehmen muß, nur zum Zwecke, um eine Gelegenheit zu finden,<br />
sich aussprechen zu können, um Ängste, Sorgen, Probleme überhaupt erst<br />
einmal zu thematisieren, den Blick wieder auf die eigenen Hilfsmöglichkeiten zu<br />
lenken, die eigentlichen Anliegen selber klarer erkennen zu können,<br />
• Beratungsangebote in bezug auf Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten<br />
psychosozialer Unterstützung, um dem vorrangigen Anliegen und der aktuellen<br />
Situation angemessene Formen zu geben, z.B. unter Umständen auch eine<br />
Psychotherapie als mögliche Hilfe akzeptieren zu können,<br />
• die Vermittlung von Kontakten zu Menschen in ähnlicher Situation mit ähnlichen<br />
Erfahrungen bzw. Anliegen herstellen zu können,<br />
• schließlich Angebote von betreuten Kleingruppen, die von der Ambulanzberatung<br />
unterstützt werden, die einen themenzentrierten Erfahrungsaustausch und gegenseitige<br />
Unterstützung bieten können.<br />
• Angebote von Krisenberatung zu geben, wenn z.B. Panik auftaucht, Verunsicherungen<br />
oder Enttäuschungen erlebt werden, die man nicht selber lösen kann,<br />
Hilflosigkeit erfahren wird gegenüber Ärzten, Pflegepersonal, anderen Experten,<br />
die mit der Krebsbehandlung zu tun haben oder Krisenunterstützung <strong>bei</strong> heftigen<br />
Auseinandersetzungen und Konflikten in der Familie oder am Ar<strong>bei</strong>tsplatz.
7<br />
3. Psychotherapie im engeren Sinne<br />
Eine Krebserkrankung zerreißt immer einen Lebenszusammenhang und stellt den<br />
bisherigen Sinn eines Lebens in Frage. Sie konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens<br />
und unserer zeitlichen Begrenztheit. In dieser Situation benötigt jeder Mensch<br />
Hilfe und Unterstützung. Es gibt aber Patienten, die diese Situation auch mit üblicher<br />
Hilfestellung weitaus schlechter verar<strong>bei</strong>ten als andere.<br />
Hier müssen wir häufig feststellen, daß die Krebserkrankung eine bereits latent vorhandene<br />
psychische Störung manifest gemacht hat; ein mühsam kompensiertes Lebensgleichgewicht<br />
ist mit der Erkrankung zerbrochen; alte Traumata (Verluste) werden<br />
reaktualisiert oder ein der narzißtischen Kompensation dienender grandioser<br />
Lebensentwurf löst sich "ins Nichts" auf; auf der anderen Seite kann <strong>bei</strong> depressiv<br />
strukturierten Menschen mit strengen Normen und Gewissensbildung die Krankheit<br />
als gerechte Strafe erlebt werden (was die Compliance erheblich beeinträchtigt!) und<br />
zu einem passiv-resignativen Rückzug führen - um nur einige Möglichkeiten <strong>bei</strong>spielhaft<br />
zu nennen.<br />
In diesen Fällen muß die Indikation einer psychotherapeutischen Behandlung im engeren<br />
Sinne durch einen Facharzt für Psychotherapeutische Medizin oder ggf. auch<br />
einen psychologischen Therapeuten in Erwägung gezogen werden. Bei einer solchen<br />
Behandlung sind die durch die körperliche Grunderkrankung gesetzten Grenzen<br />
im Hinblick auf Zielsetzung und Dauer der Psychotherapie zu beachten; die Belastung<br />
durch die Psychotherapie darf ihren Gewinn nicht wieder aufzehren. Deshalb<br />
ist eine enge Zusammenar<strong>bei</strong>t mit dem für die onkologische Behandlung des betreffenden<br />
Patienten verantwortlichen Arzt nötig.<br />
Die Beziehung zum Körper ist mit der Erkrankung einer starken Veränderung und<br />
Belastung ausgesetzt. Hier bietet z. B. das Katathyme Bilderleben dem Patienten die<br />
Möglichkeit, seine innere Erlebniswelt in gefühlsbetonten Bildern zu entdecken,<br />
kreativ zu gestalten und davon Mitteilung zu machen. Der Raum der Imagination wird<br />
durch die empathische Begleitung für den Patienten zum geschützten Erlebnis- und<br />
Entfaltungsraum, in dem er seine Erfahrungen und Vorstellungen symbolisieren<br />
kann. Die Wirksamkeit im Heilungsprozess beruht darauf, daß der Patient seine Innenwelt<br />
bildhaft darstellen kann und damit diffus wahrgenommene Körpergefühle,<br />
Ängste und Erwartungen in Bildern Gestalt annehmen. Auf diese Weise werden sie<br />
anschaulich und mitteilbar. Dieses Verfahren ist allerdings nicht indifferent und darf<br />
<strong>bei</strong> den Malignom-erkrankten Patienten nicht zu forciert in Anwendung gebracht<br />
werden; in jedem Fall muß die Vorgehensweise sich an der aktuellen Belastbarkeit<br />
der Patienten ausrichten.<br />
4. Selbsthilfegruppen<br />
In Selbsthilfegruppen finden sich Menschen zusammen, deren Interesse sich auf die<br />
gemeinsame Bewältigung der Erkrankung und deren psychischen und sozialen Folgen,<br />
von denen sie selbst oder Angehörige betroffen sind, richtet.<br />
Ähnliche Probleme, von denen angenommen wird, daß sie alle haben oder hatten,<br />
halten diese Gruppen zusammen. Das Wissen, daß alle Mitglieder von einem qualvollen<br />
Tod bedroht sein können, bildet die Grundlage, sich hilfreich sein zu können,
indem gemeinsame Ängste, Verzweiflung und Trauer ausgehalten werden und Kraft<br />
und Energie auf die gesunden Anteile, auf Aktivität und Überleben gelenkt wird.<br />
Darüberhinaus bekommen die Erkrankten im Erfahrungsaustausch konkrete Anregungen<br />
und Hilfen für den Alltag. Information über Kurmöglichkeiten, über finanzielle<br />
Unterstützung, über die unterschiedlichen Heilmethoden, Medikamente usw.<br />
Es ist bedeutsam für diese Gruppen, daß sie sich nicht mit den individuellen Intimängsten<br />
des einzelnen in der Gruppe beschäftigen, um nicht so in einen Sog von<br />
Angst und Verzweiflung zu geraten. Die eigene Betroffenheit gefährdet die notwendige<br />
Distanz, die für tatkräftige Unterstützung notwendig ist.<br />
Dagegen kann eine professionell betreute und angeleitete Kleingruppe mit Berater/in,<br />
die in ihrer Ausbildung und anhang praktischer Erfahrung gelernt haben, die<br />
notwendige Distanz zu wahren, die Möglichkeit bieten, in einer überschaubaren geschlossenen<br />
Gruppe sich die individuellen Ängste anzuschauen, sie zu bear<strong>bei</strong>ten<br />
und gegebenenfalls aufzulösen. Es kann sinnvoll sein, sich in einer kleinen Gruppe<br />
Gleichbetroffener auszutauschen und damit die soziale Kompetenz (wieder) zu erproben<br />
und zu erweitern.<br />
Die Anleitung und Begleitung der Gruppe durch einen Berater/in bedeutet gleichsam<br />
auch Schutz vor Überforderung der einzelnen Gruppenmitglieder durch sich selbst<br />
oder durch andere Gruppenmitglieder.<br />
8<br />
5. Angehörigenar<strong>bei</strong>t<br />
Die Diagnose Krebs bedeutet auch für Verwandte und andere nahe Bezugspersonen<br />
eine große Belastung. Sie löst Unsicherheit aus, Angst, daß sie oder der Angehörige<br />
sterben wird, das Gefühl von Verlassenwerden. Häufig werden auch eigene Todesängste<br />
aktualisiert. Das Leben mit einem Menschen in einer physischen und psychischen<br />
Extremsituation, der gequält ist von Angst und belastenden Therapien und oft<br />
auch von Schmerzen, kann zu emotionaler Erschöpfung führen. Angehörige fühlen<br />
sich oft unsicher, wie sie helfen können. Haben Versuche zu helfen nicht den gewünschten<br />
Erfolg, weil die oder der Erkrankte niedergeschlagen ist, kommt es leicht<br />
zu einer negativen Selbsteinschätzung als Helfer mit Gefühlen von Insuffizienz, tiefer<br />
Verunsicherung und Ohnmacht. Hält dieser Zustand länger an, kann Sprachlosigkeit<br />
die Folge sein. Das Leid kann nicht mehr gemeinsam getragen werden, weil die<br />
Gefühle von Depression, Unsicherheit und Resignation oft auch die Patienten zum<br />
Schweigen bringen. Jeder ist dann mit seinem Kummer allein.<br />
Hier bietet eine individuelle Beratung die Möglichkeit, Gefühle wie Angst, Verzweiflung,<br />
Verlassen- und Überfordertsein ungefiltert zum Ausdruck zu bringen, ohne<br />
Rücksicht auf die bzw. den Kranken. Auch feindselige Affekte wie Wut, verlassen<br />
oder allein zurückgelassen zu werden, Ärger über vermeintlich unvernünftiges Verhalten,<br />
durch das der bevorstehende Abschied womöglich beschleunigt werden<br />
könnte, Ekel und Entsetzen über körperlichen Verfall können gegenüber einem<br />
Fremden ausgesprochen werden, ohne die Beziehung zu belasten. Es wird oft wie<br />
eine Befreiung erlebt, die vielfältigen Gefühle angesichts der Krankheit eines nahestehenden<br />
Menschen einmal unkrontrolliert aussprechen zu können. Mitunter ist so<br />
ein Beratungsgespräch der einzige Freiraum, in dem Angehörige selbst einmal Zuwendung,<br />
Interesse und Mitgefühl bekommen und in Ruhe zu sich selbst kommen zu<br />
können.
9<br />
Gerade, wenn sie sich im Alltag vor allem als Helfer gefordert sehen, kann eine offene<br />
Aussprache als Katharsis erlebt werden, die die Voraussetzung schafft, sich wieder<br />
liebevoll und einfühlsam auf die erkrankte Person einlassen zu können. Beratung<br />
für Angehörige ist damit oft Hilfe sowohl für den oder die Ratsuchende/n als auch für<br />
den Patienten. Angehörige können besser mit dem Patienten umgehen, wenn sie<br />
selbst nicht zu belastet sind. Da<strong>bei</strong> ist es wichtig, daß sich die Unterstützung an den<br />
Bedürfnissen des einzelnen Menschen und seiner ganz konkreten Situation orientiert.<br />
6. Sterbebegleitung<br />
Psychotherapeutische und psychosoziale Hilfestellung erfolgt auch in Form der Sterbebegleitung.<br />
Wichtigste Aufgabe hier<strong>bei</strong> ist, dem Patienten sowie seinen Angehörigen,<br />
aber auch dem ärztlichen und pflegerischen Personal, Unterstützung zu geben,<br />
daß sie nicht der Gefahr von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erliegen. So ist es<br />
wichtig, für den einzelnen Patienten den Hintergrund zu verstehen, auf welchem er<br />
mit seiner Krankheit bislang umgegangen und gelebt hat, welche Bedeutung die<br />
Krankheit für ihn hat, welche Bewältigungsmöglichkeiten er für sich entwickelt hat,<br />
und welchen Lebenssinn er seiner bisherigen Existenz gegeben hat. Auf diesem<br />
Hintergrund entwickelt sich eine psychotherapeutische Beziehung zum Patient, der<br />
bewußt oder auch nicht bewußt sich langsam dem Kontext des Sterbens nähert, indem<br />
es wichtig ist, ihm das Gefühl zu vermitteln, daß er nicht aufgegeben worden ist,<br />
daß er vor allem nicht der Hoffnungslosigkeit preisgegeben ist und vor allem das<br />
Gefühl hat, nicht allein zu sein, sondern die Erfahrung macht, in einer "haltenden<br />
Umwelt" zu leben.<br />
Wichtigste Aufgabe der psychotherapeutischen Begleitung kann hier<strong>bei</strong> sein, die<br />
Angehörigen auf diese Aufgabe vorzubereiten und sie da<strong>bei</strong> zu stärken, dem Patienten<br />
zu helfen, mit den Angehörigen in eine angemessene Kommunikation zu treten,<br />
allen Beteiligten behilflich zu sein, über die Endlichkeit des menschlichen Lebens<br />
zu sprechen, die letzten Dinge zu regeln und auch voneinander Abschied zu<br />
nehmen.<br />
Eine ähnliche Aufgabe der psychotherapeutischen Begleitung kann gegenüber dem<br />
onkologischen Team aus Ärzten und Pflegekräften gegeben werden, damit sie das<br />
Gefühl haben, keine Verluste zu erfahren, nicht verloren zu haben und vor allem<br />
aber auch, daß sie in dem Kontext der Endlichkeit des Lebens ebenfalls ein wichtiges<br />
Element für den Patienten darstellen, der gerade von ihnen auch die Hilfe und<br />
Unterstützung erwartet, die ihm in seiner Verzweiflung Sicherheit gewährleistet.<br />
7. Soziale und sozialrechtliche <strong>Aspekte</strong><br />
Für den Tumorpatienten sind - neben der psychosozialen Begleitung - auch die Sicherung<br />
seines der Lebensunterhaltes und die Kostenübernahme für seine ärztliche<br />
und pflegerische Versorgung von zentraler Bedeutung.
Um dieses zu gewährleisten, sieht unser Sozialversicherungssystem verschiedene<br />
Geld- und Sachleistungen vor, auf welche die Versicherten unter bestimmten Bedingungen<br />
Anspruch haben.<br />
So werden von den Krankenkassen nicht nur die Kosten für die Krankenhausbehandlung<br />
getragen, sondern auch - nach Ablauf der Lohnfortzahlung - Krankengeld<br />
erstattet, wenn der Erkrankte weiter ar<strong>bei</strong>tsunfähig ist oder stationär behandelt werden<br />
muß.<br />
Hinsichtlich der Krankenhauskosten und der Arzneien, Heil- und Hilfsmittel sowie der<br />
Fahrtkosten ist allerdings eine Eigenbeteiligung durch den Versicherten vorgeschrieben.<br />
Da diese Zuzahlungspflicht für chronisch Kranke und Versicherte mit<br />
geringem Einkommen eine enorme Belastung bedeuten würde, hat der Gesetzgeber<br />
Härtefallregelungen vorgesehen.<br />
Zum Kreis möglicher sozialrechtlicher Leistungen gehören außerdem Maßnahmen<br />
der medizinischen Rehabilitation (wie Anschlußheilbehandlung und Nach- und Festigungskuren)<br />
sowie die berufliche Rehabilitation. Zeigt sich in deren Verlauf, daß der<br />
Versicherte wegen seiner Krebserkrankung entweder berufs- oder erwerbsunfähig<br />
ist, so kann ihm Rente gewährt werden, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen<br />
gegeben sind. Erfüllt der Betroffene diese Voraussetzungen nicht, so besteht<br />
für ihn die Möglichkeit, einen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen.<br />
Für Patienten, die auf Pflegehilfe angewiesen sind, gelten folgende Regelungen: Ein<br />
Versicherter, der <strong>bei</strong> seiner Erkrankung im häuslichen Bereich versorgt wird, hat neben<br />
der ärztlichen Behandlung auch ein Anrecht auf häusliche Krankenpflege. Patienten,<br />
die längerfristig oder dauerhaft pflegebedürftig sind, erhalten Leistungen aus<br />
der Pflegeversicherung in Form von Sach- oder Geldleistungen. Ist stationäre Pflege<br />
erforderlich, übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten entsprechend dem Grad<br />
der Pflegebedürftigkeit (Höchstgrenze 2.800 DM monatlich).<br />
Zu erwähnen ist ferner, daß nach der Krebserkrankung <strong>bei</strong>m zuständigen Versorgungsamt<br />
ein Ausweis auf Schwerbehinderung beantragt werden kann, der eine<br />
Reihe von Erleichterungen und Nachteilsausgleichen bietet.<br />
Schließlich sei auf die Härtefonds der Deutschen Krebshilfe e. V. und der Deutschen<br />
Krebsgesellschaft sowie einiger Stiftungen hingewiesen, die unter bestimmten Bedingungen<br />
einmalige finanzielle Zuwendungen gewähren.<br />
So intakt dieses soziale Netz wirkt, sollte jedoch nicht übersehen werden, daß viele<br />
Krebspatienten infolge ihrer Krankheit nicht nur in eine psychische Krise geraten,<br />
sondern auch mit einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage rechnen müssen.<br />
Die Übersicht wurde im Auftrag des Tumorzentrums Göttingen erstellt.<br />
10<br />
Anschriften der Autoren:<br />
Prof. Dr. U. Rüger<br />
Prof. Dr. H. Friedrich
Abt. Psychosomatik und Abt. Medizinische Soziologie u.<br />
Psychotherapie<br />
Abt. Medizinische Psychologie<br />
Georg-August-Universität Göttingen Georg-August-Universität Göttingen<br />
unter Mitar<strong>bei</strong>t von:<br />
- Dr. M. Gründel<br />
Abteilung Hämatologie und Onkologiel<br />
Georg-August-Universität Göttingen<br />
- Dr. E. Ratzke<br />
Tumorzentrum<br />
Georg-August-Universität Göttingen<br />
- Dipl.-Psych. D. Eggebrecht<br />
Palliativstation<br />
Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende e.V.<br />
- Gerda Lücke, M.A.<br />
Medizinische Soziologie<br />
Georg-August-Universität Göttingen<br />
11