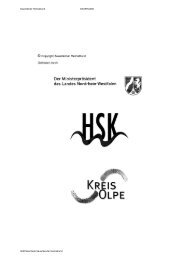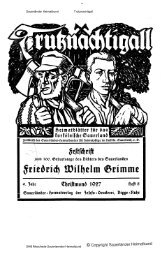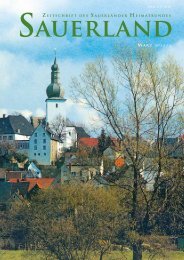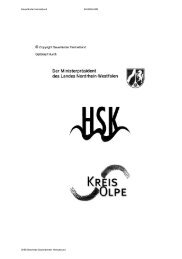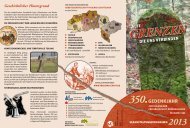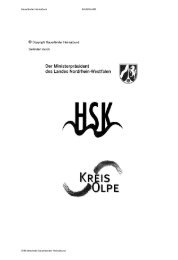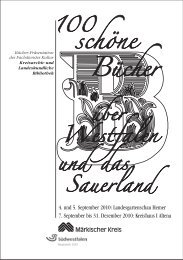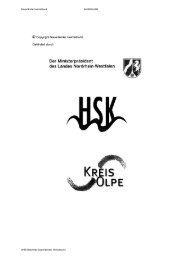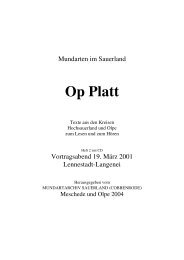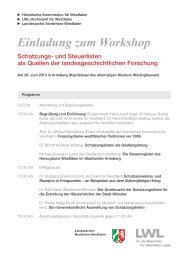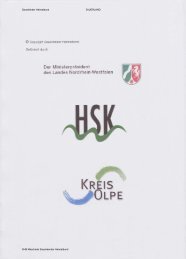Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
Gefordert durch<br />
Der Ministerprasident<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
'i.<br />
-Vi<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Nr. 2 Juni 1984<br />
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
L 2767 F<br />
jfw^<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
FiJnf gute Grunde,warum Sie<br />
bei uns Mitglied<br />
werden sollten.<br />
Erstens die Dividende. Sie ist in der Regel hoher als eine normale<br />
Verzinsung. Dann die Mitsprache, die Sie in verschiedenen<br />
Gremien zu Wort l
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Einheimischer Naturschiefer<br />
an offentlichen<br />
Gebauden<br />
In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung<br />
setzte sich der CDU-Landtagsabgeordnete<br />
Knipschild (Hochsauerlandkreis)<br />
dafur ein, daS mehr<br />
einheimischer Naturschiefer bei denkmalwurdigen<br />
Sffentlichen Bauten verwendet<br />
wird. Er wies auf die sch wierige<br />
wirtschaftliche Lage der jahrhundertealten<br />
sauerlandischen Schieferindustrie<br />
hin. Er machte darauf aufmerksam,<br />
da3 bei Ausschreibungen 6ffentlicherBautragerdieVenwendungwestfaiischen<br />
Naturschiefers hSufig ausdriJcklich<br />
ausgeschlossen wird, und<br />
daB inzwischen die Verwendung von<br />
Naturschiefer zu 84% aus Importen<br />
und nur noch zu 16% aus heimischer<br />
Ware gedeckt wird.<br />
Die Landesregierung antwortete, da3<br />
sie im Rahmen des Technologie-Programms<br />
Bergbau u.a. auch die technische<br />
Entwicklung im heimischen<br />
Schieferbergbau finanziell unterstutzt<br />
habe, und daB zur Zeit ein weiteres<br />
Projekt zur Schieferverarbeitung laufe.<br />
AuBerdemweist die Antwort darauf hin,<br />
daB die Baudienststellen der Staatshochbau-<br />
und der Finanzbauverwaltung<br />
bereits 1971 angewiesen worden<br />
seien, in geeigneten Fallen Natunwerkstein<br />
alternativ mit auszuschreiben,<br />
daB jedoch die Landesregierung kein<br />
Weisungsrecht an die Denkmalpflegeamter<br />
der Landschaftsverbande habe,<br />
in bestimmtem Sinne beratend und<br />
gutachterlich tatig zu werden. Es sei<br />
aber bekannt, daB die Denkmalpflegeamter<br />
stSndig grOBten Wert darauf<br />
legen, daB bei der Instandhaltung,<br />
Instandsetzung und Modernisierung<br />
von geschijtzten DenkmSlern ausschlieBlich<br />
Originalbaustoffe venwendet<br />
wLJrden. Wenn also ursprunglich<br />
ein Denkmal mit sauerlandischem<br />
Schiefer gedeckt war, wiirde auch darauf<br />
hingewirkt, daB bei alien Erneuerungsarbeiten<br />
wieder dasselbe Material<br />
venwendet werde. Im ubrigen sei es<br />
AufgabederEigentumer, ihreDenkmaler<br />
instand zu halten und instand zu<br />
setzen, soweit ihnen das nach dem<br />
Denkmalschutzgesetz zumutbar sei,<br />
und die dafijr notwendigen Bauarbeiten<br />
zu vergeben. Red.<br />
Zeitschrift<br />
des<br />
Sauerlander<br />
<strong>Heimatbund</strong>es<br />
SAUERIAND<br />
FriiherTrutznachtigall, Heimwachtund Sauerlandruf<br />
Titelseite: Kath. Pfarrkirche<br />
St. Peter und Paul, Wormbach<br />
Foto: Friedhelm Ackermann<br />
Aus dem Inhalt: Seite:<br />
Die romanische Apsismalerei<br />
in Berghausen<br />
als Kunstwerk 40<br />
Berghausen<br />
-ein Nach wort 44<br />
Pater Kilian Kirchhoff 46<br />
AnfSnge des Bergbaus<br />
in Ramsbeck 47<br />
Die Drtiggelter Kapelle 50<br />
Dorfpastor, Kunstler und<br />
Volkserzieher<br />
52<br />
Augustin Wibbelt an<br />
Christine Koch 54<br />
BiJcher, Schrifttum 55<br />
Gymnasium Laurentianum 63<br />
Personallen 68<br />
Mitarbeiter: Charlotte Kramer,<br />
Schmallenberg; Dr. Heribert<br />
GruB, Lennestadt; Knut Fr.<br />
Platz, OIpe; Dipl.-lng. Walter<br />
Miederer, Ramsbeck; Hedwig<br />
Jungbluth-Bergenthal,<br />
Schmallenberg; Wilhelm Siepmann,<br />
Wickede; Friedrich Wilhelm<br />
Cordt, OIpe; Theo Hundt,<br />
OIpe; Johannes BOdger, Marsberg;<br />
Dr. Paul Becker, Warendorf;<br />
Norbert VoB, Dusseldorf;<br />
LWL Mtinster; Franz Selter,<br />
Sundern; Klemens PrOpper,<br />
Arnsberg; Alfred Vorderwulbecke.<br />
Bad Oeynhausen; Ferdy<br />
Fischer, Arnsberg<br />
39<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Die romanische Apsismalerei in<br />
Berghausen als Kunstwerk<br />
von Charlotte Kramer,<br />
Schmallenberg<br />
Die Apsismalerei in der Kirclie St. Cyriakus<br />
zu Schmallenberg-Bergliausen<br />
hat europSischen Rang. Ein besonderes<br />
Gluck ist es, daB sie erst in den<br />
dreiBiger Jaliren unseres Jahrtiunderts<br />
„entdeckt" wurde. So ist den<br />
Wandmalereien eine Restaurierung im<br />
Sinne des Historismus erspart geblieben;<br />
das namlich hatte mit groBer<br />
Wahrscheinlichkeit eine mehr oder<br />
weniger vollstandige Ubermalung im<br />
Gesclimack der Zeit bedeutet.<br />
Auf verschiedene Weise kann man<br />
sich den Bildern in der Apsis zuwenden.<br />
Man kann sie ganz unbefangen<br />
betrachten. Sie kOnnen anregen zu<br />
erhabenen Gedanken, Meditationen,<br />
wie Heribert GruB das in SAUERU\ND<br />
<strong>Heft</strong> 4/1982 gekonnt gemacht hat. Man<br />
kann sich aber auch dem Kunstwerk<br />
nShern mit den Augen und Vorstellungen<br />
derer, die das Werk geschaffen<br />
haben, wie sie es aufgefaBt wissen<br />
woliten: kurz, dieses Werk verstehen<br />
als Kunstwerk unterden Bedingungen<br />
der Zeit, in der es entstanden ist.<br />
Die Ausmalung der Kirchen-Apsiden<br />
bindet sich im Mittelalter streng an<br />
theologische Inhalte und foigt in der<br />
Form streng ijberlieferten Regeln. Wir<br />
in unserer Zeit kOnnen es nicht recht<br />
begreifen, daB im Mittelalter dort die<br />
kunstlerisch besten Leistungen<br />
entstehen, wo der Kunstler am strengsten<br />
die uberlieferten Programme aufnimmt.<br />
Trotzdem bleibt den Malern, die<br />
sich im Unterschied zu den Dekorationsmalern<br />
Figuristen nennen, Freiheit<br />
genug; und die besten nutzen sie<br />
eben. Nach den ortlichen Gegebenheiten<br />
entwickein sie innerhalb des<br />
vorgegebenen Rahmens Eigenes.<br />
Kein Bild ist wie das andere; so<br />
erstaunlich es sein mag, es gibt keine<br />
vOllige Ubereinstimmung. Die Komposition<br />
spielt eine groBe Rolle, und wo<br />
immer einem romanische Malerei<br />
entgegentritt, ein formales Schema<br />
wird uberall eingehalten.<br />
Einteilung der Apsis in Zonen<br />
Der Altarraum, oder wie hier in Berghausen<br />
nur die Apsis, wird in Zonen<br />
eingeteilt. Hier sind es drei Zonen und<br />
dazu die Sockelzone, deren Bilder nur<br />
40<br />
noch in Andeutungen erhalten sind.<br />
Die Mittelzone hat meistens Fenster.<br />
Hier ist es eins in der Mitte. Die Fensterlaibungen<br />
sind immer fester Bestandteil<br />
des Bilderprogramms. Mittelpunkt<br />
aller Zonen und Aussagen ist der in die<br />
Kuppel hineinragende thronende<br />
Christus in der Glorie Gottvaters, den<br />
die Kunstler in der Mandoria, „in einem<br />
Regenbogen, wie ein Smaragd anzusehen",<br />
wie es In der Offenbarung<br />
heiBt, fur die Menschen erfahrbar zu<br />
machen versuchten (Off. 4,1-3).<br />
Das Bildprogramm in<br />
Bergiiausen<br />
Wenn wir alle Zonen zunSchst einmal<br />
mehr unter formalem Aspekt betrachten,<br />
dann hebt sich die oberste Zone<br />
deutlich von den anderen ab; lediglich<br />
das Bild links unten - Fortuna mit dem<br />
Rad - geh6rt formal eher zur obersten<br />
Zone.<br />
Worin liegt der Unterschied? In der<br />
obersten Zone haben wir nurfigurliche<br />
Bilder. Alle haben streng reprSsentativ<br />
- feierlichen Charakter. Bei aller SuBeren<br />
Bewegtheit und inneren Beseeltheit<br />
ist es ein statuarisches Gottes-<br />
Links davon stehen die furbittende<br />
Muttergottes und Johannes der Evangelist,<br />
in gleicherRangordnung auf der<br />
anderen Seite Petrus, der Apostelftirst<br />
mit Schlussel und Kreuzstab, daneben<br />
Cyriacus, der Patron dieser Kirche, im<br />
Gewand eines Diakons; er gehSrt zu<br />
den vierzehnNothelfern. Alle Gestalten<br />
stehen angesichts des GOttlichen als<br />
FiJrsprecher vor dem Thron, die ecclesia<br />
triumphans als Gemeinschaft der<br />
Heiligen.<br />
Demgegenuber befinden sich in den<br />
Zonen darunter Bilder ganz anderen<br />
Charakters, keine feierlichen Bildgestalten<br />
mehr, vielmehr Bilder, die die<br />
zeitlose Gestalt Christi und seine zeitlose<br />
Lehre herunterholen in unsere<br />
Welt und somit einbinden in einen geschichtlichen<br />
Zusammenhang. Das<br />
geschieht durch eine Bilderfolge mit<br />
dramatisch aufgeladenen szenischen<br />
Ereignlssen urn Geburt, Wirken, Tod<br />
und Auferstehung Christi, verstanden<br />
als Hergang, als eine Geschichte, als<br />
historische Tatsache. Dem daran<br />
Glaubenden wird der Himmel verburgt,<br />
die Seligkeit des ewigen Lebens.<br />
Das Statuarische in der Himmelszone<br />
und das Episch-Narrative (Erzahlende)<br />
stehen hier in der formalen Bewaitigung<br />
des christlichen Stoffes nebeneinander.<br />
Das eher Statuarische entspricht<br />
mehr orientalisch-byzantinischer<br />
Geisteshaltung, das Episch-<br />
Narrative ist eher abendlSndisch, go-<br />
Anmerkung der Redaktion<br />
Wir haben Frau Kramer gebeten, ihren Vortrag auf der Mitglieden/ersammlung des<br />
Sauerlander Helmatbundes am 1. Oktober 1983 fur diese Zeitschrift zur Verfugung zu<br />
stellen, undHerrnDr. GruB, dazu aus seiner Sictit-nact) <strong>Heft</strong> 4/1982-nocti einmal zur<br />
Feder zu greifen. Wir danl
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
\<br />
sie ihre kiJnstlerische Freiheit entfalten,<br />
so daB die Bilder mehrere Interpretationen<br />
zulassen.<br />
Die Darstellung der Fortuna<br />
Gehen wir auch hier von formalen Gesichtspunkten<br />
an das Bild heran: es ist<br />
weniger narrativ, eher statuarisch, ja,<br />
die vordere Figur ist in einem so streng<br />
antlkisch-byzantinischen Stil verfaBt,<br />
ohne jede Regung, daB man sie geradezu<br />
im Vergleich mit den himmlischen<br />
Figuren - die sind lebendig in<br />
ihrer SuBeren Erscheinung und ihrer<br />
sensibien Spiritualitat - als abgelebte<br />
Gestalt empfinden muB: Die antike<br />
GOttin Fortuna mit ihrem Rad, dem ewigen<br />
Kreislauf eines unerbittlichen Auf<br />
und Ab, hat in dercliristliclien Epoche<br />
so keine Gultigkeit melir.<br />
Damit sind wir auch schon beim inhaltlichen.<br />
Die Dreizeitenlehre des Hugo<br />
von St. Viktor, eines der grSBten Theologen<br />
des 12. Jahrhunderts, mag hier<br />
Pate gestanden haben. Sie durchw/irkt<br />
meines Erachtens die ganze Konzeption<br />
unserer Apsismalerei; Heidentum,<br />
Judentum, Christentum, das ist die geschichtliche<br />
Entwicklung, Oder anders<br />
gesagt: Der „Zeit des Naturgesetzes"<br />
folgt die „Zeit des geschhebenen Gesetzes",<br />
dann die „Zeit der Gnade". Die<br />
Menschen sollten nicht nur von der<br />
SchOnheit ihrer Kirche angezogen<br />
werden, sie sollten vielmehr mit den<br />
Bildern die Bibel kennenlernen und<br />
daruber hinaus durch die Bibel ein Verstandnis<br />
von Welt und Geschichte gewinnen,<br />
um letztlich das eigene Leben<br />
von daher begreifen zu lernen. Vor diesem<br />
Hintergrund kSnnte man die Gestalt<br />
hinter der Fortuna, links mit Krone<br />
und Zepter, rechts mit gesenktem Zepter<br />
und ohne Krone, als Alexander den<br />
GroBen verstehen; er gait in dieser Zeit<br />
als beliebte Symbolfigurfurden Untergang<br />
des Heidentums.<br />
An dieser Stelle sei das Anno-Lied<br />
erwahnt, das um 1180 in Kflln entstanden<br />
ist und uber Kloster Grafschaft in<br />
unserem Raum bekannt gewesen sein<br />
durfte. Da wird Alexanders Himmelfahrt<br />
beschrieben, wie er, von zwei<br />
Greifen gezogen, in einem kupfernen<br />
Wagen in den Himmel getragen wird.<br />
DerWagen schmolz, derKOnigfiel herab.<br />
Die Alexander-Geschichte in Verbindung<br />
mit dem Rad der Fortuna ware<br />
allerdings einmalig. Interessant ist<br />
unter diesem Aspekt genau unter<br />
unserem Bild die Darstellung eines<br />
Greifen. Er gehOrt zur Alexander-Ge-<br />
Die Fotos der Fresken und des Altarraumes warden freundlichen^eise vom Verlag<br />
Grobbel, Fredeburg zur Verfugung gestellt<br />
schichte und ist daruber hinaus Symbol<br />
fur Hoffart und Streiten wider Gott.<br />
Vorbilder aus Griechenland<br />
und Venedig?<br />
Hier sei auch hingewiesen auf ein<br />
Flachrelief am Dom von Venedig aus<br />
dem 12. Jahrhundert. Es paBt von der<br />
Atmosphare her in unseren Zusammenhang:<br />
Alexander in der Mitte, plakativ,<br />
statuarisch wie unsere GOttin<br />
Fortuna, davor fur den Betrachter<br />
erkennbar der Wagensitz als Halbrosette,<br />
wie die Haifte eines Rades, daneben<br />
an der Deichsel zwei Greifen. Alexander,<br />
Rad und Greifen - unser Maler<br />
konnte das gekannt haben. VerbliJffend<br />
ist, daB der romanische Rundbogen<br />
in unserer Kirche, der den Blick<br />
freigibt auf die Apsis, in seiner grauocker-roten<br />
Marmorimitation der Ausstattung<br />
im Kloster Hosios Lukas in der<br />
Nahe von Athen so ahnlich ist, daB<br />
Kunsthistoriker gar von einem „Direktimport"<br />
aus Griechenland sprechen.<br />
Jedenfalls hat sich seit dem 11. Jahrhundert<br />
in Europa eine Gesellschaft<br />
gebildet, die universal, in einem christlich<br />
gepragten Zusammenhang dachte<br />
und sich auch raumlich in diesem<br />
Europa mit einiger Selbstverstandlichkeit<br />
bewegte. Im engeren Sinne bestehen<br />
fur Westfalen Beziehungen zum<br />
Rhein-Maas-Gebiet und nach Niedersachsen<br />
zum Kloster Helmarshausen.<br />
Selbst wenn man Zeitgeschichtliches<br />
hinter den herrschertichen Gestalten<br />
auf unserm Fortuna-Bild vermutet,<br />
etwa die wenig christlichen Thronfolgestreitigkeiten<br />
um Philipp von<br />
Schwaben und Otto IV., wesentlich<br />
ware, zu bedenken, daB das Damonische,<br />
eigentlich dem Heidnischen zugeordnet,<br />
immer wieder in unser<br />
christliches Zeitalter einbrechen<br />
kflnnte. Das Einbrechen des Bosen,<br />
sozusagen aus der Sockelzone, gibt<br />
es des Ofteren, immer wieder anders<br />
gestaltet. Hier dart sich die Phantasie<br />
entfalten, etwa wie die Steinmetze es<br />
durften bei den Wasserspeiern oder<br />
den saulenkapitellen. So wird in Tramin<br />
(Sudtirol) in St. Jakob auf einem<br />
Altarbild von einem Atlanten in der<br />
Sockelzone auf dessen Kopf eine Harpyie<br />
getragen, die sich wie bei uns die<br />
Fortuna in der unteren Bilderzone befindet,<br />
eine Harpyie, ein Wesen, an das<br />
man nicht mehr glaubt, ein anderes<br />
Symbol an eben dieser Stelle dafijr.<br />
41<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
daB das Heidentum grundsatzlich<br />
uberwunden ist im Sinne der Dreizeitenlehre<br />
des Hugo von St. Viktor.<br />
Das Gegenuber:<br />
Der Heilige Nikolaus<br />
Antithetisch zu der sinnlosen Kreislaufbewegung<br />
des Rades der heidnischen<br />
Fortuna steht auf der anderen<br />
Seite das Wirken des heiligen Nikolaus.<br />
Im christlichen Zeitalter braucht<br />
der einzelne das Rad der Fortuna nicht<br />
zu furchten. Man kann sich aufgehoben<br />
und geborgen fijhlen. Nikolaus<br />
rettet die in Seenot Geratenen. Voller<br />
Anteilnahme stellt er seinen Bischofsstab<br />
in das Boot derGefahrdeten. Eine<br />
Sache am Rande: Auf anderen Bildern<br />
dieser Art macht der Heilige sich an der<br />
Takelage zu schaffen. Hier ist er tectinisch<br />
noch nicht so versiert. Man kann<br />
an der Art der Darstellung erkennen,<br />
Hochster Beitrag zur<br />
Kunst- und Kulturpflege<br />
von den Gemeinden<br />
Die Gemeinden leisten im Vergleich zu<br />
den Landern und dem Bund den hochsten<br />
Finanzbeitrag zur Kunst- und Kulturpflege,<br />
wie aus einer Ubersicht der<br />
Kultusministerkonferenz uber die<br />
Entwicklung der Kulturausgaben zwischen<br />
1976 und 1981 hervorgeht. In<br />
diesem Zeitraum stiegen die jahrlichen<br />
offentlichen Ausgaben fur diesen Bereich<br />
urn 73,6 Prozent, namlich von<br />
2,774 auf 4,816 Mrd. DM. Allein der<br />
AnteilderGemeindenbetrug1981rund<br />
56 Prozent, gefolgt von den Landern<br />
mit 41 Prozent und dem Bund mit 2,4<br />
Prozent.<br />
Pro Einwohner wurden den Angaben<br />
zufolge im Jahre 1981 fOr den Kulturbereich<br />
vom Bund 1,90, von den Landern<br />
32 und den Gemeinden 43,70 DM ausgegeben.<br />
Mit 2,6 Mrd. DM wurden<br />
mehrals die Halfte der offentlichen Mit-<br />
tel fur die Theater und die Musikpflege<br />
aufgewendet. 783 Mill. DM entfielen<br />
auf Museen und Ausstellungen, knapp<br />
299 Mill. DM dienten dem Denkmalschutz.<br />
Uber die Entwicklung in den<br />
Jahren 1982/83 verweist die Untersuchung<br />
mangels sonstiger Daten lediglich<br />
auf die Haushaltsansatze der Lander,<br />
die fur beide Jahre Steigerungsraten<br />
von 9,7 beziehungsweise 3,4 Prozent<br />
bei den Kulturausgaben vorsahen.<br />
Red.<br />
auf welche Handschrift die Maler zuruckgehen.<br />
Es wird hier Symeon Metaphrastes<br />
sein, ein byzantinischer Historiker<br />
und Hagiograph, der um das<br />
Jahr 1000 Legenden von Heiligen zusammengestellt<br />
hat.<br />
Auf dem anderen Bild der Nikolausszenen<br />
schaltet sich der Heilige ins offizielle<br />
weltliche Geschehen ein. Die zu<br />
Unrecht von Kaiser Konstantin eingekerkerten<br />
romischen Hauptleute Nepotianus,<br />
Ursus und Apilio vermag der<br />
hi. Nikolaus mit Einverstandnis des<br />
Kaisers zu befreien. Sie danken ihm<br />
auf unserem Bild. Weltliches Prinzip,<br />
imperium, und geistliches Prinzip, sacerdotium,<br />
stehen nebeneinander,<br />
wetteifernd und sich korrigierend.<br />
Die Mitte der Bilder<br />
Diese Uberlegungen um die heidnische<br />
Fortuna und um den hi. Nikolaus<br />
drangen zu dem zentralen Punkt, was<br />
denn das Christliche ausmacht. Das ist<br />
die groBe Thematik des Mittelstreifens.<br />
Nicht nur das Heidentum ist uberwunden,<br />
sondern auch das Heidentum.<br />
Das Alte Testament hat nur noch symbolische<br />
Kraft. „Es muR alles erfullt<br />
werden, was im Gesetz des Moses, bei<br />
den Propheten und in den Psalmen<br />
von mir geschrieben ist", wie es bei<br />
Lukas 24,44 helBt. Die DurchfiJhrung<br />
des Themas erfolgt im Sinne der sogenannten<br />
Romanischen Symmetrie,<br />
das helBt; immer muB sich ein Bild aus<br />
dem Alten Testament auf ein Bild aus<br />
dem Neuen Testament beziehen. Die<br />
Kunstler richteten sich nach Tabellen,<br />
in denen die Bilder verbindlich einander<br />
zugeordnet waren, sogenannten<br />
Konkordanztabellen. Das Geschichtsdenken<br />
des Hugo von St. Viktor hat<br />
auch EinfluB gehabt auf die Entwicklung<br />
dieser Tabellen.<br />
Geistiger und kunstlerischer Mittelpunkt<br />
des Altarraumes ist der Pantokrator.<br />
Die Mandoria lenkt in ihrer unteren<br />
Spitze den Blick abwarts in die Nische<br />
des Mittelfensters hinein. Drei Bilder<br />
aus dem Neuen Testament befinden<br />
sich in der Nische; rechts und<br />
links von der Nische, in der Mittelzone,<br />
sehen wir je zwei Bildergeschichten<br />
aus dem Alten Testament. Wie nun beziehen<br />
sich die vier alttestamentlichen<br />
Bilder auf die drei neutestamentlichen?<br />
Das Bild in der linken Nischenwand<br />
stellt die Verkundigung der<br />
Menschwerdung Christi dar. Dieses<br />
zentrale Ereignis aus dem Neuen Testament<br />
korrespondiert mit der Ge-<br />
schichte, die das innere Bild auf der<br />
linken Seite erzahit: Moses vor dem<br />
brennenden Dornbusch (Exod. 3,5), in<br />
dem Gott Vater als Brustfigur sichtbar<br />
wird, beliebtes Symbol fur das Geheimnis<br />
der Menschwerdung Christi.<br />
In der rechten Nischenwand sehen wir<br />
die Taufe Jesu. Sie markiert den Beginn<br />
der Offentlichen priesterlichenTa-<br />
tigkeit Jesu. Dem entspricht rechts daneben<br />
in der Mittelzone das Bild aus<br />
dem Alten Testament: der Hohepriester<br />
Aaron und seine Sohne stehen vor<br />
dem „ehernen Becken", von dem es<br />
heiBt, daB sie sich darin Hande und<br />
FuBe waschen sollen, wenn sie das<br />
heilige Zelt betreten (Exod. 30,17). Die<br />
Verkundigung der Menschwerdung<br />
Christi und die Taufe Christi zu Beginn<br />
seines offentlichen Wirkens bilden zusammen<br />
mit den beiden alttestamentlichen<br />
Darstellungen den inneren Kern.<br />
Die beiden auBeren Bilder<br />
Links ist im Isaak-Opfer (Gen. 22) der<br />
Augenblick der hochsten Spannung<br />
festgehalten, wie die „Hand Gottes"<br />
Abraham zuruckhalt - ein bekanntes<br />
Symbol fur das Kreuzesopfer Christi.<br />
Rechts ist Samson zu sehen mit den<br />
Pfeilern des von ihm zuvor aus den<br />
Angein gehobenen Stadttores von Gaza,<br />
den Pfeilern, die hier im Bild als<br />
Saulen erscheinen, wie er sie auf einen<br />
Berg tragt, von dem aus man die Stadt<br />
Hebron sieht (Jud. 16) - ein beliebtes<br />
Symbol fOr die Auferstehung Christi.<br />
Diesen beiden alttestamentlichen Bildern<br />
entspricht nur ein neutestamentliches:<br />
das Gotteslamm im Scheitelbild<br />
des Fensters. Freilich korrespondiert<br />
es in seinem Doppelsinn mit beiden<br />
alttestamentlichen Bildern, so daB<br />
die Symmetrie in einzigartiger Weise<br />
hergestellt ist. Als Opferlamm ist das<br />
Gotteslamm Symbol des sich opfernden<br />
Christus und als Osterlamm mit<br />
Kreuzesfahne Symbol des triumphierenden<br />
Christus; es lenkt dann, so vollendet<br />
sich die Komposition, den Blick<br />
wieder nach oben zum Pantokrator,<br />
der wiederkommen wird in „Macht und<br />
Herrlichkeit" (Luk. 21,28), wie es die<br />
aufgehende Sonne durch das streng<br />
nach Osten gerichtete Fenster symbolisch<br />
ankundigt.<br />
So atmet diese Apsismalerei den Geist<br />
scholastischer Theologie und bringt<br />
die Summe christlichen Glaubens in<br />
einem groBen, geschlossenen heilsgeschichtlichen<br />
Zusammenhang<br />
sinnfallig zum Ausdruck.<br />
42<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyriglit Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
\<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander Heitnatbund
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Der Altarraum in Berghausen<br />
- ein Nachwort von Dr. Heribert GruB, Lennestadt<br />
Wer vor den Apsisbildern von Berghausen<br />
einmal fragend, vergleichend<br />
Oder betrachtend venweilte, muB Frau<br />
Kramer danken fur ihren ernsthaften<br />
und ausfuhrlichen Versuch, ein so bedeutsames,<br />
aber leider zu wenig gewurdigtes<br />
Werk „als Kunstwerk unter<br />
den Bedingungen der Zeit, in der es<br />
entstanden ist", zu verstehen. icli<br />
ergreife die Gelegenheit umso bereitwilliger,<br />
weil ich in einer Meditation<br />
zum Advent 1982 in dieser Zeitschrift<br />
versuclnt habe, die Inlialte der Wandmalereien<br />
fur Menschen unserer Zeit<br />
zu erschlieBen. Dabei zielte mein BemufienmefiraufdieuberzeitlichenGefialte<br />
christlicher Biidaussage als auf<br />
ihre wandelbaren Formen und Stilmerkmale.<br />
DerKunstgeschichtlerwiJrde<br />
diese Art des Vorgehens mefir dem<br />
Gebiet christlicfier Ikonograpfiie<br />
zuordnen. Zudetn folgt eine Meditation<br />
ifiren eigenen Gesetzen. Freilicfi darf<br />
sie den kunstgeschicfitlicfien Kontext<br />
nicfit ignorieren. So ist es fur den Kundigen<br />
nicfit uberrascliend, daB beide<br />
Aufsatze sich deutlich unterscfieiden.<br />
Wer sie vergleicht, bemerkt sogleich<br />
den anderen Akzent. Teilweise kommt<br />
Frau Kramer aber auch zu anderen<br />
Ergebnissen. Das damit erOffnete Gesprach<br />
ist eine herzlicfie Einladung<br />
aucfi an v\/eitere Gesprachspartner, die<br />
zu den faszinierenden Malereien von<br />
Berghausen etwas zu sagen haben.<br />
Mit Recht betont Frau Kramer den statuarischen<br />
Gharakter des oberen<br />
Apsisbildes, der dem ostkirchlich-byzantinischen<br />
Muster entspreche. Sie<br />
stellt ihm die episch-narrative Darstellungsweise<br />
der abendiandisch-germanischen<br />
Welt gegenuber, die in der<br />
heilsgeschichtlichen Folge der mittleren<br />
Bildreihe zum Ausdruck komme.<br />
Heinrich Lutzelerhat bekanntlich auch<br />
fur den Christustyp selbst eine Formel<br />
gepragt, die dem „Freund, dem Helden,<br />
Mitstreiter und Konig" des germanischen<br />
Abendlandes den „zeitloserhabenen<br />
Christus" des byzantinischen<br />
Geistesraumes gegenuberstellte.<br />
Auch kann das Prinzip der romanischen<br />
Symmetrie fur die ErschlieBung<br />
unserer Bilder in der Mittelreihe gute<br />
Dienste leisten. Mit seiner Hilfe ordnet<br />
Frau Kramer die beiden AuBenbilder<br />
demGotteslamminderFensterlaibung<br />
zu, die beidseitigen Innenbilder den<br />
SeitenwSnden des Mittelfensters.<br />
Erstaunlich ist nun aber, und dies hatte<br />
bei der Meditation eine gewisse Rolle<br />
gespielt, daB gleichwohl derchronologischen<br />
Abfolge der alttestamentlichen<br />
Heilsgeschichte Rechnung getragen<br />
wird. Sie kflnnte bei einer exklusiven<br />
Anwendung des Symmetrieprinzips<br />
geradezu beliebig werden. Selbst<br />
wenn wir das Lamm des Mittelfensters<br />
in die alttestamentliche Reihe einbeziehen,<br />
steht es als Paschalamm an<br />
der richtigen chronologischen Stelle!<br />
- Sollte dies alles ein Zufall sein?<br />
Im Kreuzungspunkt:<br />
Das Lamm<br />
GestiJtzt auf dIese Beobachtung habe<br />
ich eine horizontale und eine vertikale<br />
Darstellungsrichtung gesehen, bei der<br />
das Lamm im Kreuzungspunkt der<br />
alttestamentlichen und neutestamentlichen<br />
Geschehnisfolge steht. Es ist<br />
Paschalamm in der Exodusnacht<br />
Israels, vermittelt zugleich aber als<br />
Gotteslamm des Neuen Bundes die<br />
christologischen Aussagen des Mittelfensters<br />
zum Pantokrator in der HOhe<br />
der Apsis, von seiner hinweisenden<br />
Bedeutung fur die Feier der Eucharistie<br />
ganz zu schweigen.<br />
Bei einer zu exklusiven Anwendung<br />
des Prinzips der romanischen Symmetrie<br />
sollte ferner vielleicht doch auch<br />
erwartet werden, daB die Bewegungsrichtung<br />
der alttestamentlichen Szenen<br />
auf der rechten Apsisseite eher<br />
zum Mittelfenster zurucklaufen muBte.<br />
Das ist weder bei dem Samsonbild<br />
noch bei der Aaronszene der Fall. Beide<br />
Bilder setzen in ihren Hauptgestalten<br />
die von links nach rechts laufende<br />
Bewegung der linken Bildreihe fort.<br />
Sollte auch dies nur ein Zufall sein?<br />
Deshalb neige ich dazu, ohne die beherrschende<br />
Stellung des Pantokratorbildes<br />
mindern zu wollen, das Lamm<br />
als geheime Mitte und als den Schlussel<br />
der heilsgeschichtlichen Betrachtung<br />
zu sehen: Es ist „Zentralsakrament"<br />
Israels, erfullt und uberboten im<br />
Gotteslamm des Neuen Bundes, gegenwartig<br />
fur alle Menschen in der Eucharistie,<br />
die unter diesem Zeichen gefeiert<br />
wird. -<br />
Die Aaronszene<br />
In ernste Schwierigkeiten geraten wir<br />
aber, wenn das von Frau Kramer beanspruchte<br />
romanische Symmetrieprinzipunszwingen<br />
sollte, der Aaronszene<br />
eine Deutung zu geben, die weder<br />
Pfarrer Rother noch ich zu teilen vermOgen.<br />
Ihre Deutung kann hiereigentlich<br />
nur von der geforderten Zuordnung<br />
dieses Bildes zur Jordantaufe<br />
motiviert sein. Sie sieht hier Aaron mit<br />
seinen SOhnen vor dem ehernen Bekken<br />
bei einer Belehrung uberden Sinn<br />
kultischer Reinheitsgebote vor dem<br />
Gottesdienst. Ich weiB nicht, ob es<br />
Konkordanztabellen gibt, in denen die<br />
von Frau Kramer herangezogenen Geschehnisse<br />
miteinander verbunden<br />
sind. - Auf diesem Bilde aber belehrt<br />
nicht Aaron seine (nach Ex 6, 23) vier<br />
SOhne uber den Sinn des ehernen<br />
Beckens (das GefSB hat hier fur die<br />
Darstellung der StSbe eine reine Hilfsfunktion!),<br />
sondern der „gehOrnte" Moses<br />
die zwOlf StammesfiJrsten Israels<br />
ijber die Legitimation des aaronitischen<br />
Priestertums. Exakt zwOlf Stabe<br />
stehen in dem GefaB, wiederum zw6lf<br />
Hutspitzen lassen sich uber der vor<br />
Moses stehenden Menschengruppe<br />
zahlen (vgl. Num 17,16-24). Besonders<br />
interessant ist aber, daB der figuristische<br />
Maler das durch die Vulgatawiedergabe<br />
(cornuta fades - vgl. Ex 34,<br />
30) in der christlichen Tradition inspirierte<br />
MiBverstandnis, Moses habe ein<br />
„gehOrntes", nicht aber ein von der<br />
Herrlichkeit Gottes „strahlendes<br />
Antlitz" gehabt, dadurch wieder dem<br />
Schriftzusammenhange einpaBt, daB<br />
erdie „strahlenden HOrner" als AusfluB<br />
der Herrlichkeit Gottes vor den Augen<br />
Israels durch eine Kopfbedeckung verhullt.<br />
(Ex 34,30-35); Die Kopftracht des<br />
Hochpriesters hatte nach Ex 39, 30 f.<br />
ein anderes Aussehen. Sie glich mehr<br />
einem Kopfbund, an dem das goldene<br />
Diadem befestigt war. Auf ihm befand<br />
sich die Inschrift: Heilig fur Jahwe. Die<br />
auf unserem Bilde festgehaltene dramatische<br />
Szene kOnnte vor oder nach<br />
derfraglichen Nacht gespielt haben, in<br />
der Gott das Legitimationswunder<br />
nach Num 17,16-24 bewirkte. Moses<br />
lieB die Stabe vor der Nacht eii'isammeln<br />
und hinterher wieder austeilen.<br />
Der Maler stellt ihn mit einem demonstrativen<br />
Gestus vor, der in beide Situationen<br />
passen kOnnte (Num 17, 21-<br />
24). Man darf sich fragen, ob das Symmetrieprinzip<br />
bei der Deutung dieses<br />
44<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Bildes eine gute Hilfe war. Zumindest<br />
muBte die typologische Zuordnung<br />
beider Bilder (Aaronszene - Jordantaufe)<br />
aus einer anderen Perspektive<br />
begrijndet werden.<br />
Fortuna und Nikolaus<br />
Auch die untere Bildreihe - Fortuna<br />
und Nikolaus - folgt der von links nach<br />
rechts weisenden Bewegungsrichtung.<br />
Sie signalisiert in dieserRichtung<br />
auch das Schicksal des Herrschers,<br />
dem rechts vom Rade die Krone<br />
entsinkt. Fortuna ist fur uns eine bewegte<br />
Gestalt. Die Drehbewegung<br />
ihrer Arme wird von dem steigenden<br />
und wiederum rechts herabsinkenden<br />
Knaben verstSrkt. Wahrscheinlich muB<br />
man das erhaben-statuarische Darstellungselement<br />
auf das Christusbild<br />
in der oberen Apsis beschrSnken.<br />
Denn auch Frau Kramer scheint vorauszusetzen,<br />
daB die beiden Nikolausdarstellungen<br />
den episch-narrativen<br />
Darstellungstyp vertreten. Gerade hier<br />
kflnnte aus Symmetriegrunden nSherliegen,<br />
Typ (Fortuna) und Antityp (Nikolaus)<br />
auf die gleiche Darstellungsv\/eise<br />
zu beziehen. An dieser Stelle beruhrt<br />
nach gemeinsamer Deutung die<br />
erhabene Bilderkomposition unseren<br />
Alltag, der - Fortuna zum Trotze - von<br />
segnenden MSchten behOtet ist.<br />
Es gehOrt zu den erregenden Fragen,<br />
die uns hier beschaftigen, welchen<br />
Sinn und Inhalt das Fortunamotiv an<br />
dieser Stelle hat. Ist es eine Allegorie<br />
der Verganglichkeit, eine zeitgeschichtliche<br />
Exhortatio Oder der Versuch,<br />
dunkle, gar damonische Schicksalsmachte<br />
im Zeichen oder im Opfer<br />
des Lammes zu bannen, hat es also<br />
einen apotropaischen*) Sinn? Frau<br />
Kramer erinnert an die Alexanderviten<br />
des Mittelalters, in denen die frevelnde<br />
Himmelfahrl und der jShe Sturz des<br />
heidnischen Weltherrschers thematisiert<br />
sind. Die Deutung fasziniert, ist<br />
aber im Blick auf die Einbeziehung<br />
in einen sakralen Zentralbezirk w/eniger<br />
wahrscheinlich. Auch scheint der<br />
Maler einen zu bewegten Anteil an der<br />
sinkenden Krone und dem schwermutigen<br />
Blick des majestatischen<br />
Herrschers zu nehmen. Die Darstellung<br />
scheint zu entfernt von doktrinaler<br />
Abwertung heidnischen Frevelmutes,<br />
als daB man sich bei solchen Gedanken<br />
beruhigen mOchte.<br />
*) apotropaisch — abwehrend bzw. abwendend<br />
Kunstler in Finnentrop<br />
Im Ratssaal in Finnentrop stellten die beiden in der Gemeinde wirkenden Kunstler<br />
Anneliese Schmidt-Schottler und Benno Heimes aus. In drei Woclien konnten 912 Besucher,<br />
davon 296 Schuler, gezahit werden. - Die Fotos von der Ausstellungseroff-<br />
nung zeigen Benno Heimes, hier mit dem Kunsterzieher und -kritiker Gerhard Loewe<br />
(OIpe) und Anneliese Schmidt-Schottler Fotos: Jochen Krause, Kirchhundem<br />
Zeitgeschichte in<br />
heilsgeschichtlichem Bezug<br />
Hat sich vor den Augen des Kunstlers<br />
nicht eine modernere, eine christliche<br />
„Alexandervita" vollzogen, an der gerade<br />
auch die Geistlichkeit bewegten<br />
Anteil haben muBte? Ich denke an<br />
den jahen Zusammenbruch der Weltherrschaftspiane<br />
des Stauferkaisers<br />
Heinrich VI. Schon huldigten ihm die<br />
KOnige Europas und des Mittelmeerraumes<br />
bis nach Armenien und bis<br />
zum spanischen Emirat. Schon setzte<br />
er an zur endgultigen, vom Papst und<br />
derganzenChristenheitersehntenBefreiung<br />
des Heiligen Landes, da ereilte<br />
den machtgewaltigsten Kaiser des Mittelalters<br />
bei Messina der jahe Tod. Er<br />
starb im Alter des groBen Alexander<br />
(32 Jahre) und an der gleichen Krankheit<br />
(Malaria).<br />
Wie tief die christlichen Zeitgenossen<br />
an solchen Kaiserschicksalen Anteil<br />
nahmen.zeigtderBerichteineszeitgenfissischen<br />
Geistlichen uber des Vaters<br />
Barbarossa tragischen Tod (1190)<br />
in Saleph: „Bei dieser Stelle und bei<br />
diesem traurigen Bericht versagt unser<br />
Griffel und verstummt unsere Rede.<br />
Gott tat nach seinem unerforschlichen<br />
RatschluB sicherlich gerecht, aber<br />
nicht barmherzig." - Bei solcher Deutung<br />
ware die Einbeziehung des Fortuna-Motivs<br />
von der betenden Fursorge<br />
fur den christlichen Kaiser, den<br />
Schirmherrn der abendiandischen<br />
Welt, mitbestimmt. Damit ware gleichfalls<br />
die einzigartige Einbeziehung<br />
dieses Motivs in den Altarraum einer<br />
christlichen Basilika gut zu erkiaren.<br />
Frau Kramer entdeckte beim zweiten<br />
Nikolausbilde ja auch eine deutliche<br />
Zusammenschau weltlicher und sakraler<br />
Motivation. Im ubrigen war die<br />
Zeit nach dem plfltzlichen Tode Heinrichs<br />
Vl. 1197 eine kampferfullte und<br />
unsichere Zeit, Grund genug, bei der<br />
HI. Messe im Sinne der Kaiseridee zu<br />
beten. Unsere Kunstler malten kurz<br />
nach 1200.<br />
Diese letzten Gedanken kOnnen demjenigen<br />
zu subjektiv erscheinen, dem<br />
Kaiseridee und -wirklichkeitdes Mittelalters<br />
ferngeruckt sind. Vielleicht sind<br />
sie aber auch wirklich zu subjektiv. Das<br />
sei in aller Bescheidenheit gesagt. Sie<br />
erheben keinen Anspruch auf kunstgeschichtliche<br />
Kompetenz, wenngleich<br />
ihr Schreiber durch manche<br />
Jahre im Hochschuldienst die Facher<br />
Historische Theologie und Kirchengeschichte<br />
zu vertreten hatte. Frau Charlotte<br />
Kramer aber sei noch einmal herzlich<br />
gedankt fur ihre uberaus kenntnisreichen<br />
und anregenden Ausfuhrungen<br />
zu einem Gegenstand, der in der<br />
Tat, wie auch ich durch den Inhalt dieses<br />
Nachwortes zum Ausdruck bringen<br />
wollte, europaischen Rang besitzt.<br />
Dr. H. GruB<br />
45<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Pater<br />
Kilian Kirchhoff<br />
1892-1944<br />
In diesem Jahr am 24. April, am Osterdienstag,<br />
jahrte sich zum vierzigstenmal<br />
derTodestag des Mannes, der die<br />
reiche Liturgie der Ostkirche fur die lateinische<br />
Kirche des Westens erschloB.<br />
Derverwaiste JungeausRonl
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Uber die Anfange<br />
des Bergbaus in<br />
Ramsbeck in<br />
vorchristlicher Zeit<br />
von Bergwerksdirektor<br />
Dipl.-lng. Walter Miederer,<br />
Ramsbeck<br />
Die Grube ..Vereinigter Bastenberg<br />
und DOmberg" in Ramsbeck, genannt<br />
nacli den beiden Bergen, die das Dorf<br />
einrahmen, muBte trotz einer damals<br />
an der Spitze des deutschen Metallerzbergbaus<br />
liegenden Leistung am<br />
31. Januar1974auswahrungs-und lagerstattenbedingten<br />
Grunden ihre<br />
Produl
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
/ '':":/.<br />
/v<br />
ry<br />
1 i '•<br />
SAUERLAND<br />
werk, die ein neuer Beweis des Miteinander<br />
von Offentlicher Hand und Industrie<br />
sind, da sie vom Hochsauerlandi
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
wenn auch fur sich allein wissenschaftlich<br />
sicher nicht ausreichender<br />
- Beweis fur ein vorchristliches Alter<br />
des Stollens.<br />
Herodot, der bekannte griechische<br />
Geschichtsschreiber, beschreibt die<br />
Veneter als einen Volksstamm der lllyrier,<br />
der nOrdlich des adriatischen<br />
Meeres beheimatet war. Es waren<br />
kleinwuchsige, zwergenhafte Menschen,<br />
die die Berge der Ostalpen und<br />
des nordostlichen Balkans bevolkerten.<br />
Im Altertum und fruhen Mittelalter muBten<br />
die Stollen in muhevoller Handarbeit<br />
mit keilartigen Werkzeugen in das<br />
feste anstehende Gebirge getrieben<br />
werden. In vorchristlicherZeit benutzte<br />
man fiierzu Werkzeuge aus Stein, Serpentinkeile,<br />
Hirchhornpicken U.S.,<br />
spater melBelalinliche Werkzeuge aus<br />
Eisen oder Metall. Da diese Arbeit nur<br />
sehr langsam voranging und kOrperlich<br />
sehr schwer war, versuchte man<br />
mit dem kleinstm6glichen Ausbruch<br />
Oder Stollenquerschnitten durch das<br />
taube Oder unhaltige anstetiende Gebirge<br />
an die ErzgSnge heranzukommen.<br />
D.h. aber, je kleiner die Menschen<br />
waren, die im Bergbau arbeiteten,<br />
desto geringer konnte der Ausbruch<br />
sein, desto hOher war die Vortriebsleistung.<br />
Die Zwerge im Berg<br />
Aus diesem Grund waren kleine Menschen<br />
- Liliputaner oder Zwerge - fur<br />
den Bergbau besonders pradestiniert.<br />
So kommt es, daB bevorzugt kleine,<br />
zwergenhafte Menschen im Bergbau<br />
arbeiteten und auch heute noch<br />
Zwerge immer als Bergleute dargestellt<br />
werden mit langen Zipfelmutzen,<br />
der fruheren Kopfbedeckung der<br />
Bergleute, und mit bergmannischen<br />
Werkzeugen wie Schlagel, Eisen,<br />
Schaufel, Lampe usw. Stets kamen<br />
diese Spezialisten aus der Fremde und<br />
unterschieden sich von der heimischen<br />
Bevolkerung einmal durch ihre<br />
KflrpergrOBe, zum anderen durch ihre<br />
Sprache. AuBerdem machten sie sich<br />
immer auBerhalb bestehender Siedlungen<br />
in ziemlich unzuganglichen<br />
Gegenden, meist mitten im Wald, zu<br />
schaffen, was den Einheimischen verdachtig<br />
war. So kam es haufig zu<br />
Feindseligkeiten und die kOrperlich<br />
unterlegenen, kleinen Bergleute muBten<br />
die Flucht ergreifen und sich verstecken.<br />
Sie rannten in den Wald, verschwanden<br />
in versteckten Stollen-<br />
Der Ramsbecker Ausbeutetaler von<br />
1759 mit dem Bastenberg und dem<br />
Domberg. Foto: Sachtleben Bergbau<br />
GmbH<br />
mundl6chern, in denen sie auch lebten,<br />
und waren wie vom Erdboden verschwunden.<br />
Das konnte nicht mit<br />
rechten Dingen zugehen, meinten die<br />
Verfolger, und schon wurden den kleinen<br />
Bergleuten Zaubermittel, die sie<br />
unsichtbar machten, angedichtet, wie<br />
z.B. die Tarnkappe der Zwerge.<br />
Trotz aller guten Taten blieben diese<br />
auslandischen, kleinwuchsigen Bergleute<br />
immer ein fremdiandisches Element<br />
innerhalb der heimischen Bev6lkerung.<br />
So erklart sich, daB sie als geheimnisumwitterle,<br />
andersgeartete<br />
Menschen, als metallkundige Zwerge<br />
Erdmannchen oder Hainmannchen in<br />
die Volksmarchen und Sagen unseres<br />
deutschen Kulturraumes eingingen<br />
und sich bis heute in dieser Darstellung<br />
erhalten haben.<br />
Ramsbecker Sage<br />
Auch im Ramsbecker Raum sind mit<br />
dem silberhaltigen Metallerzbergbau<br />
eine Vielzahl solcher Sagen verknijpft.<br />
So sollen z.B. in vorchristlicherZeit auf<br />
dem Bastenberg oder Bassmer's<br />
Kopp, wie er fruher hieB, lange Zeit<br />
Zwerge gehaust und nach Blei und Silber<br />
gegraben haben. Die Steine des<br />
von ihnen zum Abfordern angelegten<br />
Weges sollen noch heute vorhanden<br />
sein. Spater sollen diese Zwerge von<br />
den etwas kraftigeren Venedigern, die<br />
durch die Kunde von dem Ramesker<br />
Schatz angelockt aus dem Suden gekommen<br />
waren, erschlagen worden<br />
sein. Der Bergbau wurde dann von den<br />
Venedigern weitergefijhrt. Der ZwergkOnig<br />
- so helBt es - sei am Graafstein<br />
Oder Grabstein auf dem Bassmer's<br />
Kopp begraben, und noch heute<br />
allnachtlich 24.00 Uhr sollen sich dort<br />
die Zwerggeister am Graafstein versammeln,<br />
um ihren letzten KOnig zu<br />
ehren.<br />
Eigentlich ist dies nicht nur ein Marchen<br />
Oder eine Sage im klassischen<br />
Sinn, sondern eine sehr moderne Geschichte,<br />
namlich die Erzahlung uber<br />
die kriegerische Auseinandersetzung<br />
verschiedener Stamme, Rassen oder<br />
Volker in vorchristlicher Zeit um das<br />
Recht der Ausbeutung von Bodenschatzen.<br />
Die Zeiten oder die Menschen<br />
andern sich in dieser Beziehung<br />
im Laufe der Geschichte nur wenig.<br />
Unbestritten ist, daB kleinwuchsige<br />
Menschen in fruheren Zeiten besonders<br />
bergbautauglich waren und daB<br />
die Veneter und Venediger sich ihre<br />
Kleinwuchsigkeit zunutze machten,<br />
um als gesuchte Bergbauspezialisten<br />
mit groBer Erfahrung in den verschiedensten<br />
Gegenden von Europatatigzu<br />
werden. So werden z.B. auch in Schlesien<br />
die kleinwuchsigen Bergleute, die<br />
als erste die dortigen Erzlagerstatten<br />
erschlossen, Venediger-Mannchen<br />
genannt, und auch in den Walensagen<br />
des sachsischen Erzgebirges helBen<br />
die vorgeschichtlichen Zinnbergleute<br />
Venediger.<br />
Ein Indiz fur hohes Alter<br />
Den schon erwahnten nachweislich<br />
bronzezeitlichen Salz- und Kupferbergbau<br />
von Hallstadt und Mitterberg<br />
schreibt die Vorgeschichtsforschung<br />
nach streng wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen den Venetern zu. Damit<br />
liegt die Vermutung nahe, daB diese<br />
kleinen sudlandischen Fachleute aus<br />
ihren Bergbaurevieren in den Karpaten<br />
Oder dem Balkan auch zur ErschlieBung<br />
der hiesigen Bodenschatze<br />
von den keltischen oder illyrischen<br />
Fursten West- und Mitteldeutschlands<br />
zur Hilfe gerufen wurden<br />
und unteranderem in der Ramsbecker<br />
Gegend tatig waren, da der Name „Venetianerstollen"<br />
sicher nicht aus der<br />
Luft gegriffen ist. Der Name „Venetianerstollen"<br />
ist ein ernstzunehmendes<br />
Indiz fur ein vorchristliches Alter des<br />
Ramsbecker Bergbaus, da es keine<br />
andere Erklarung fur diesen Namen<br />
gibt. DaB ihn die Ramsbecker BevOlkerung,<br />
ohne jeglichen Hintergrund,<br />
erfunden haben konnte, ist sicher<br />
mehr als unwahrscheinlich.<br />
Nach der Vernichtung der hochstehendenMetallkulturderlllyrieristjeglicher<br />
Metallerzbergbau nfirdlich der<br />
Alpen in deutschen Landen weitestgehend<br />
erioschen. Neue Anfange sind<br />
erst im fruhen Mittelalter wieder nachzuweisen.<br />
49<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Die Drijggelter<br />
Kapelle<br />
Ein uraltes Baudenkmal steht hoch<br />
LJber dem Mflhnesee in Delecke unmittelbar<br />
neben dem Hof Schulte-Druggelte,<br />
versteckt zwischen den utngebenden<br />
HofgebSuden. EigentiJmer<br />
dieses merkwurdigen Bauwerkes ist<br />
die kath. Kirchengemeinde in Korbekke.<br />
Das Patronat wird ausgeubt durcli<br />
den ReglerungsprSsidenten in<br />
Arnsberg.<br />
Der schlichte AuBenbau zeigt auf<br />
zwOlfeckig niedrigen Wanden ein pyramidenfOrmig<br />
sich zuspitzendes Dach,<br />
von dem ebenfalls soviel Seiten auslaufen.<br />
Daruber steht ein achteckiges<br />
Turmchen mit haubenartlgem Helm.<br />
An der SiJdseite befindet sich der Eingang<br />
als uberdachter kleiner Vorbau.<br />
Nach Osten ist an die ursprunglich<br />
runde Kapelle spSter eine Altarnische<br />
angebaut worden. Licht erhait die Kapelle<br />
durch sieben kleine romanische<br />
Fenster. Im Innern sind zwei SSulenreihen.<br />
Die auBere bestehend aus zwflif<br />
schlanken Grunsandsteinsaulen und<br />
der innere Ring bestehend aus zwei<br />
dickeren gemauerten Saulen und zwei<br />
starken Rundpfeilern. Die schlanken<br />
Saulen sind aus einem Stuck gearbeitetundzurAuBenseitealsKreuzgewOIbe<br />
ausgebildet. Nach innen besteht<br />
ein Tonnengewfllbe. Alle Saulen haben<br />
phantastische Verzierungen der<br />
Kapitale, die mit Kerbschnitzereien<br />
Sterne, Blatter, Tiere und MenschenkOpfe<br />
darstellen.<br />
Welchem Zweck hat diese Kapelle<br />
ursprunglich gedient, bzw. wer hat sie<br />
erbaut?<br />
Hier gehen die Meinungen weit auseinander.<br />
Die einen sagen, die Kapelle sei<br />
ein Heidentempel, wie sie auch von der<br />
landlichen BevOlkerung der naheren<br />
Umgebung im vergangenen Jahrhundert<br />
genannt wurde. Vor allem in der<br />
Zeit von 1933 bis 1945 wurde unter den<br />
in dieserZeit bestehenden politischen<br />
Anschauungen die Kapelle als germanisches<br />
Heiligtum bzw. als Sonnenwendheiligtum<br />
hingestellt. Frau Jakobi-Busing<br />
hat in ihrem Buch „Die Druggelter<br />
Kapelle - Versuch und Deutung<br />
ihrer kultischen Bestimmung" sie dem<br />
katharischen Glaubenssystem zugeordnet.<br />
Bei den Katharern handelt<br />
es sich urn eine Sekte, die ihren Beginn<br />
auf dem Balkan im 10. Jahrhundert<br />
hatte und im 12. Jahrhundert wahr-<br />
scheinlich sich auch bis nach<br />
Deutschland ausgebreitet hatte. Am<br />
meisten wird jedoch die Auffassung<br />
vertreten, daB es sich urn eine Heiliggrabkapelle<br />
handelt.<br />
Diese Meinung wird auch bestSrkt<br />
durch die vorhandenen Dokumente.<br />
Die aiteste Urkunde, in der die Drijggelter<br />
Kapelle enwahnt wird, datiert vom<br />
14. Mai 1217. Graf Gottfried II. von<br />
Arnsberg verabschiedete hier viele mit<br />
dem Kreuz Gezeichnete, die ins Heilige<br />
Land aufbrechen muBten. 32 werden<br />
mit Namen genannt. Hieraus kann der<br />
SchluB gezogen werden, daB die Kapelle<br />
eine besondere Bedeutung hatte,<br />
sonst ware sicher die Verabschiedung<br />
an anderen, damals schon bedeuten-<br />
Foto: Dulberg-Verlag, Soest<br />
den Orten, wie Soest, Arnsberg oder<br />
Dortmund erfolgt. Druggelte muB zu<br />
damaliger Zeit auch schon allgemein<br />
bekannt gewesen sein. Mag sein, daS<br />
die Kapelle s.Z. schon ein Wallfahrtsort<br />
war. Aus dem merkwurdigen Bau<br />
kdnnte man jedenfalls den Nachbau<br />
einer Heiliggrabkapelle erkennen.<br />
Wahrscheinlich haben hier die Kreuzritter<br />
vor ihrer Reise ins Heilige Land<br />
Gluck und Segen fur ihre weite Reise<br />
erfleht. Die Historiker sind daherauch<br />
der Meinung, daB sie Mitte des 12.<br />
Jahrhunderts entstanden ist. Kaiser<br />
Konstantin hat bereits im Jahre 336<br />
n.Chr. Grablegungs- und Auferstehungskirchen<br />
entstehen lassen, die<br />
als Rundbau ausgebildet waren und<br />
50<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
das von 12 SSulen umgebene Grab<br />
Christi umschlossen.<br />
Die Kapelle wird erstmals 1226 genannt,<br />
als Graf Gottfried II. am Samstag<br />
vor Palmsonntag bei der „Kapelle<br />
Druggelte uber dem MohnefluBe" den<br />
Hof Crutiiem Krs. LiJdingfiausen gegen<br />
eine Geldsumme, die er zur Pilgerfahrt<br />
Ins Heillge Land benStigt hat, dem<br />
Agidilkloster in IVIunster uberlSBt.<br />
In der Kapelie befindet sich noch eine<br />
schwere Baumtruhe. Sie ist aus einem<br />
Eichenstamm herausgefiauen und<br />
paBt genau zwiscfien den beiden gemauerten<br />
Pfeilern fiindurch. Es kOnnte<br />
sein, daB dieseTrufie einst zur Grablegung<br />
des Heilandes venwandt wurde<br />
(wie das bei Karfreitagsgottesdiensten<br />
nocli ublichi ist).<br />
Der Regierungsprasident als Patronatsherr<br />
hat Ende der 60er Jahre d.Jh.<br />
eine Unterfundamentierung der nur<br />
gering gegrundeten Grundmauern<br />
durchfuhren lassen. Hierdurch konn-<br />
Dat Namensdagesgeschenk<br />
Heinrich, deLehrun Furster Anton kamen vamStammdiske un wollen haime<br />
gohn. Et was late woaren. De meisten Huiser in der Stroote laggten all imme<br />
Duistern. Mens bey Schausters brannten alle Lechter, un dut'm Finster schaltert:<br />
„Hoch soil sie lebenl"<br />
..DunnenNlar", saggte Anton, Jeck gloiwe, duen Dag Is Anna Do fieri se<br />
Namensdag van der Schaustersken. Kumm, nix as hiene, et Anna gratelaiern!"<br />
..Biste gecK s§o spat nao un dann met lieger Hand?' Heinrich woll widdergohn.<br />
„Datlot mick mens maken", saggte Anton un toag Heinrich bey Schausters ter<br />
Housediar rin. Imme Gang machte Anton halt: ,.BIiv dou hey stohn un wachte.<br />
leckkumme footens wier", un dometstaig holde Kellertrappe rin. Ase hoi wier<br />
ropp kam, harre wat ungerm Lippe un lachere: „Sio, noii konn vey gratelaiern!"<br />
Daiboiden woaren metgraotemHallabegrulBet, unt Anna roip:„Jespaterder<br />
Miend um so schdner die Gastef Anton toag lachend ne Hasenbolle ungerm<br />
Upp denne un saggte: „D§, Anna, taum NamensdagI"<br />
Et Piasaier was graoti Heinrich un Anton saten balle beym Diske, lolten iarg<br />
laten un Drinken guett schmecken un woaren ziemlech de Lesten, dai op de<br />
Strote torkelern. Ase de Anton dann 'm Lehr vertallte, bou hoi de Hasenbolle<br />
bey Schausters out der Tiefkuhltruhe klemmet hair, woll sick de Lehr halv<br />
daotlachen. Hoi lachere sao wahne, dat met wackelege Gebiet out'm Mdule<br />
floag un ne Ecke met me Backentahn in de Goate hockelere. -<br />
Et Anna schante am annern Dage op di§n Filou vamme Furster, asetin de Truhe<br />
kuckere un de twedde Hasenbolle sochte.<br />
De Furster hat em Anna aber ne nigge Bolle taukummen loten.<br />
H. JungUut-Bergenthal<br />
Die Druggelter Kapelle (GrundriB)<br />
ten Venwitterungserschelnungen,<br />
insbesondere die Feuchtigkeit der<br />
SSulen, die ca. 1 m hoch gedrungen<br />
war, gehemmt werden. Die SSulen sind<br />
inzwischen trocken und blattern nicht<br />
mehr ab. AuBerdem wurden die Eisenverspannungen<br />
in den Gewolben, die<br />
man frijher fur die Standfestigkeit fur<br />
erforderlich hielt, entfernt. Das hat wesentlich<br />
zur besseren Anschaulichkeit<br />
beigetragen und die Kapelle dem<br />
ursprunglichen Zustand wieder nSher<br />
gebracht.<br />
Rund um die Kapelle erfolgte eine<br />
Steinpflasterung mit der Abweisung<br />
derOberfiachenwasser vom Gebaude.<br />
Das Dach wurde erneuert und das Gebaude<br />
weiB getuncht.<br />
Wilhelm Siepmann<br />
Wie arbeiteten unsere<br />
Vorfahren?<br />
Kreisheimatbund OIpe<br />
veranstaltet<br />
Jugendwettbewerb<br />
Zu einem Jugendwettbewerb zur Geschichte<br />
der Arbeitswelt im Kreis OIpe<br />
ruft der Kreisheimatbund OIpe auf. Wie<br />
arbeiteten unsere Vorfahren? Mit dieser<br />
Frage sollen sich die jungen Mitburger<br />
auseinandersetzen. Der Wettbewerb<br />
soil zur Beschaftigung mit der<br />
Geschichte des Kreises OIpe anregen.<br />
Durch das Entdecken von Spuren der<br />
Vergangenheit soil das Verstandnis fur<br />
die Situation der Menschen hierzulande<br />
vertieft werden.<br />
Teilnehmen kOnnen Schuler der Sekundarstufe<br />
I und II sowie Jugendliche<br />
und junge Erwachsene bis zum vollendeten<br />
21. Lebensjahr. Einzelpersonen,<br />
Schulklassen und Schuler- und Jugendgruppen<br />
sind teilnahmeberech-<br />
tigt. Der Wettbewerb, fur den Landrat<br />
Host Limper die Schirmherrschaft<br />
ubernommen hat, soil anregen, sich an<br />
Hand ausgewahlter Beispiele intensiv<br />
mit der Arbeitswelt vergangener Tage<br />
zu beschaftigen.<br />
Die Ergebnisse der Nachforschungen<br />
konnen in Texten, als Zeichnungen,<br />
Skizzen, Karten und Fotosammlungen<br />
Oder auch als Modelle dargestellt werden.<br />
Eine Jury unter Vorsitz von KreisheimatpflegerGunther<br />
Becker wird die<br />
Wettbewerbsbeitrage bewerten. EinsendeschluB<br />
ist am 30. Juni dieses<br />
Jahres. Die Arbeiten mussen eingereicht<br />
werden bei der Geschaftsstelle<br />
des Kreisheimatbundes OIpe, Kurfurst-Heinrich-StraBe<br />
34, 5960 OIpe.<br />
Dort kann auch ein Informationsblatt<br />
angefordert werden (Tel. 02761/81-<br />
651),<br />
Als Gewinne sind Geld- und Sachpreise<br />
sowie Rundfluge ausgesetzt. Die<br />
Schule mit den meisten Preistragern<br />
erhait den Preis des Landrats. Co.<br />
51<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Dorfpastor,<br />
KiJnstler und<br />
Volkserzieher<br />
Geistlicher Rat Rarrer Ernst<br />
in Altastenberg wurde 80 Jahre<br />
alt.<br />
Der „hOchste" Priester seiner Diflzese<br />
ist er schon seit mehr als 25 Jahren.<br />
1956 kam Pfarrer Friedrich Ernst nach<br />
Altastenberg, dem hochstgelegenen<br />
Pfarrdorf im Erzbistum Paderborn.<br />
KiJrzlich wurde er in seinem „Einmannbetrieb",<br />
wie er seine l
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Ikonen- and Schieferarbeiten des KiJnstlers Friedrich Ernst<br />
als der Umweltschutz noch kein<br />
Schlagwort war. Er ermutigte und aktivierte<br />
immer wieder seine Gemeindemitglieder<br />
zu verantwortlicher Arbeit<br />
fur das Dorf, seine Vereine, ilire sauerlandisclie<br />
Heimat. So tragt er wesentlich<br />
dazu bei, daB sich die Altastenberger<br />
in besonderer Weise fur ihr Dorf<br />
engagieren. Wie erfreut war Pfarrer<br />
Ernst, dal3 alle Bemuhungen der Dorfbewohner<br />
zur Anerkennung als<br />
„SchOnstes Dorf" auf Bundesebene<br />
fijhrten. Er war niclnt nur fiJr viele<br />
Entwicklungen und Aktivitaten der Initiator,<br />
ertrug auch selbsterfieblich zur<br />
Gestaitung des Dorfes bei. Er renovierte<br />
die Kapelle am Brandtenberg mit eigener<br />
Hand und schmuckte den<br />
Innenraum mit seinen Schieferarbeiten.<br />
Er bemijfite sich um die Erhaltung<br />
der alten Pfarrkirche als Dorf- und<br />
Friedhofskapelle, er sorgte fur die wur-<br />
dige Gestaitung des Kirchplatzes. Die<br />
neue Pfarrkirche Maria Schnee und die<br />
Erweiterung des Friedhofes sind ebenso<br />
Werke seiner Amtszeit, wie die<br />
Anschaffung der Kirchenglocken und<br />
der neuen Orgel!<br />
Nicht zuletzt zeugen uberall in Altastenberg<br />
und im hohen Sauerland<br />
Bildwerke von dem Kunstler Friedrich<br />
Ernst. Kreuzwege, Marienbildnisse,<br />
Ikonen, gemalt Oder in Schiefer gehauen,<br />
sind Aussagen einestiefen religiosen<br />
Empfindens. Er versteht sein<br />
Malen und Bildhauen als eine besondere<br />
Form der Predigt. Er will dem Betrachter<br />
das Heilsgeschehen vergegenwartigen<br />
und bildhaft vor Augen<br />
fuhren.<br />
In seiner Bescheidenheit will er nichts<br />
anderes sein als Seelsorger, einfach<br />
ein Dorfpastor am Kahlen Asten.<br />
Johannes Bodger<br />
Nochmals Nibelungen?<br />
Nein, keine Bange! Es sollen die in <strong>Heft</strong><br />
1/1982 gemachten und im vorigen <strong>Heft</strong><br />
groBenteils wiederholten AusfiJhrungen<br />
hier nicht nochmals aufgegriffen<br />
werden. GewiB, die von H. Ritter aufgestellten<br />
Thesen uber den Nibelungenzug<br />
nach Soest sind und bleiben fur<br />
uns interessant. Die frankischen Brukterer,<br />
nachdem ein Teil ihres Volks vor<br />
der groBen Schlacht von 451 dem Hunnenkonig<br />
Attila und ein anderer Teil<br />
dem frankischen Heer, das auf seiten<br />
des Rftmers Aetius kampfte, zugezogen<br />
waren, Boruktuarier genannt, waren<br />
schlieBlich wohl Vorfahren der<br />
heutigen Sauerlander. Ritters Buch<br />
„Die Nibelungen zogen nordwSrts" war<br />
fur uns somit hochaktuell. Der Nachfolgeband<br />
„Dietrich von Bern, KOnig zu<br />
Bonn" bringt nicht einmal mit „Venedi"<br />
- daB es sich hier nicht um Wenden<br />
handein kann, hat GiJnter Becker in<br />
den OlperHeimatstimmen nachgewiesen<br />
- fur uns etwas Aktuelles. Es sei<br />
deshalb dafijr pladiert, daB, wenn dies<br />
Thema noch einmal aufgegriffen wird,<br />
das durch einen Wissenschaftler geschehen<br />
sollte, dem die Vielschichtigkeit<br />
des Komplexes Nibelungenlied/<br />
Niflunga Saga und die damit verbundenen<br />
vielfachen friJhgeschichtlichen<br />
und sprachwissenschaftlichen Probleme<br />
vertraut sind. Doch Fachleute<br />
dieses Formats werden kaum unsere<br />
Zeitschrift als Forum wahlen. Und<br />
wenn Dr. Ritters Thesen, wie ich hoffe,<br />
von der Wissenschaft aufgegriffen<br />
werden, wird es jedenfalls lange<br />
dauern, bis sich ein konkretes Ergebnis<br />
abzeichnen kann. Darilber naturlich<br />
muBte berichtet werden; aber bis<br />
dahin vergeht noch viel Zeit.<br />
Theo Hundt<br />
Nachtrag/Berichtigung zu<br />
SAUERLAND Nr. 1 Marz 1984:<br />
Bei dem Titelfoto von Friedhelm Ackermann<br />
handelt es sich um die historische<br />
Stockumer (Sundern) Pfarrkirche<br />
St Pankraz (12./13. Jh., Turm noch<br />
alter).<br />
Der Untertitel zu „Nun ade, du mein<br />
lieb Heimatland" (S. 19) muB richtig<br />
lauten: Ein Lied, sein Schopfer und<br />
dessen Geschick, wie es auch im<br />
nachfolgenden Text (Absatz 3) richtig<br />
vermerkt ist.<br />
53<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Augustin Wibbelt<br />
an<br />
Christine Koch<br />
Am 23. Juni 1934 schrieb der in Iserlohn<br />
geborene niederdeutsche<br />
Sprachwissenschaftler Erich NCrrenberg<br />
(1884-1964) seinem Freund<br />
Augustin Wibbelt, dem bedeutenden<br />
IVIunsterlander Erzatiler und Lyril
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
BiJCHER • SCHRinTUM<br />
„Glocken im Sauerland"<br />
Ein neues Buch von<br />
Dr. Magdalena Padberg<br />
Die Sparkasse Finnentrop hat sich<br />
nach der Anbringung eines Glockenspiels<br />
an Ihrer neuen Geschaftsstelle<br />
wieder einmal verdient gemacht, namlich<br />
mil der Herausgabe des Buches<br />
„Glocken im Sauerland", das sie ubrigens<br />
in geschmackvoller Aufmachung<br />
bietet.<br />
Es war fur unsere sauerlSndische Heimat<br />
eine gliJckliche Fijgung, dal3 ihrfijr<br />
ihr Vorhaben eine so kenntnisreiche,<br />
fachvertraute Dr. Magdalena Padberg<br />
zurVerfiJgung stand. Sie konnte.gewiB<br />
auch durch von ihr genannte Heifer<br />
freundlich unterstiJtzt, mit einer FiJlle<br />
von Material aufwarten, das sie in muhsamer<br />
Kleinarbeit zusammengetragen<br />
und zu einem bunten StrauB gefugt,<br />
also sehr ansprechend dargeboten<br />
hat.<br />
Mit welcher Grundlichkeit sie vorgegangen<br />
ist und wie liebevoll sie gewirkt<br />
hat an diesem uppigen, farbigen Gebinde<br />
von Bericht, Erzahlung, Sage,<br />
Gedicht und nicht zuletzt ganz vorzijglichem<br />
Bildmaterial, das verdient hohes<br />
Lob. Sie hat nicht nur unterGefahren<br />
Glockenstijhle erstiegen, urn verlaBliches<br />
Wissensgut zu erlangen, sie<br />
hat auch in unermijdlicher Suche, geradezu<br />
wie ein WiinschelrutengSnger,<br />
alias aufgespurt, was eine illustre Reihe<br />
tails sehr namhafter Autoren zu dem<br />
ihr am Herzen liegenden Thema geschrieben<br />
haben.<br />
IndieserWeltdernuchternanVerdiesseitigung,<br />
die fur Goethes Gedicht von<br />
der wandelnden Glocke nur noch ein<br />
mudes, ja auch grinsendes Lachein<br />
hat und in der man kirchenfremd und<br />
gottverlassan den Klang der Glocke<br />
nur noch nach Phon-Graden bemiBt<br />
und gegen ihren „gesundheitsgefahrdenden<br />
Larm" (nicht aber gagen den<br />
panatranten Disco-Radau) aufbegehrt,<br />
wird uns durch die Verfasserin nahegebracht,<br />
was die Glocke einmal fijr im<br />
tiefsten christliche Manschen bedeutet<br />
hat, als Schiller ihr sein hohes Lied<br />
widmate, um die Ablaufe das Lebens<br />
mit dem GlockanguB in Gleichklang zu<br />
bringen. Bei solcher Betrachtungsweisa<br />
geht uns wieder auf, wie heilsam as<br />
ware, wann wir im Emanzipationsrummel<br />
buntgefiedarter Egoismen gagen<br />
die diesen zuzuschreibende Zerstorung<br />
christlicher Glaubens- und Verhaltansgrundsatze<br />
einiges von dem<br />
zuruckgewinnan kOnnten, was uns in<br />
dam vermeintlichan Fortschritt unversehans<br />
abhandan gekommen ist.<br />
Wir erfahran hier wieder, was die Glokke<br />
den bauerlichen Manschen auf den<br />
einsaman Ackarn und in stillen Wal-<br />
mlendi<br />
darn einmal bedautet hat, denan sie<br />
mit dem draimaligen Angelus tSglich<br />
die Zeit, aber auch die Mahnung zum<br />
Gebat zurief und in denen siedia ohnadies<br />
schon starke Gottbezogenheit<br />
wachhielt. Wir arfahran, daB die Glocke<br />
den Manschen in alien Lebenslagen<br />
beglaitet hat: mit ihrem Sonntags- und<br />
Fastgeiaute, als Sterbeglocke, als<br />
Notglocka bei Branden undfilrVarirrte.<br />
Mit dar am Anfang des Buches stehendan<br />
kurzgefaBten Entwicklungsgaschichte<br />
das immerzu verfainerten<br />
und verbesserten Glockangussas<br />
nimmt uns die Verfasserin an dia Hand<br />
und gaht mit uns den Weg bis in diase<br />
unsere Tage. Sie macht uns bekannt<br />
mit den badautendsten<br />
Glocken unsarer<br />
Heimat und<br />
widmat sich ainpragsam<br />
den<br />
hochachtbaran<br />
saueriandischen<br />
GlockangieBern.<br />
Sie berlchtet<br />
von sagenhaften<br />
Glockengussen,<br />
wie auch Glockan<br />
schicksalen, von<br />
Glockenspruchan,<br />
Weihe-Ritualen,<br />
Glockner- und Lautebrauchen, auch<br />
vom Glockenarsatz durch das „Kliapstern"<br />
in den stillen Tagen der Karwoche.<br />
Und unvarsehens sind wir dann<br />
mit ihr bald auf dem waiten Blumenanger<br />
dichterischar Aussagen, dia - geschickt<br />
varteilt - diesem herrlichen<br />
StrauB von Gadanken, Erinnerungen<br />
und Bildarn leuchtende Farba geben.<br />
Ein bedeutsamer kulturpolitischar Beitrag<br />
zur Geschichta des Sauarlandes,<br />
der unsere Achtung findet und unsaren<br />
Dank ausl6st, aber auch die Hoffnung<br />
auf noch waitere Werke der verdienten<br />
Verfasserin.<br />
Das Buch ist inzwischen im Fachhandel<br />
sowia bei der Sparkasse Finnentrop<br />
und den Sparkassen im Kreis<br />
OIpe und Hochsauerland zum Preise<br />
von 26,— DM arhaltlich. Norbert VoB<br />
Magdalena Padberg: Glocken im Sauerland.<br />
Hrsg. Sparkasse Finnentrop. 1983. 88 S.<br />
Inventar des<br />
Stadtarchivs Soest<br />
Mahr als 10.000 Urkundan und Akten<br />
sind jetztlm„lnventar des Stadtarchivs<br />
Soest" aufgelistet worden. Das Archivamt<br />
des Landschaftsverbandas Westfalan-Lippe<br />
(LWL) stallta das 900seitige<br />
Wark zusammen. Untar anderem<br />
gaban die Chroniken und Urkundan<br />
Auskunft ijbar das Soaster Recht und<br />
seine Bedeutung in der Manse; iJbar<br />
die haldanhafte Verteidigung im 15.<br />
Jahrhundert gegan den K6lnar Erzbischof<br />
als frijharen Stadtherrn, die im<br />
ganzen deutschan Reich Baachtung<br />
fand; iJbar die Einfuhrung dar Reformation<br />
in Westfalen durch Korraspondanzen<br />
zwischan Soestar Stadtherran<br />
mit Luther und Malanchthon. Baarbeitet<br />
wurden die Bestanda des alten<br />
Archivs der Stadt von Wilhelm Kohl<br />
und Gerhard Kohn. LWL<br />
Inventardes Stadtarchivs Soest, Bestand A. Band<br />
9 der Inventare dernichtstaatlichen Archive Westfalens.<br />
Verlag Aschendorff Munster. 1983. 98,—<br />
DM.<br />
Water - warm-saoltrig spoilt mi iim dat Liew,<br />
verwiiehnt as so'n Kattken de Butten, de stiew!<br />
Drum giinn Di all tiedig so'n »Trugg-up-jung-Tau«<br />
wat kump Di entgiagen in Leisbem-Bad chau!<br />
Kur + Einkehr = Bad Waldliesbom<br />
55<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Abgerissenwurde das alte Bauernhaus Heinemann in Herrntrop in der Gemeinde<br />
Kirclihundem vor wenigen Wochen. Zusammen mit einem atinliclien Fachwerktiaus<br />
in unmitteibarer Nalie, das nun allein da stelit, war das l-laus IHeinemann Mittelpunkt<br />
und Zierde des Dorfes Herrntrop. Nachdem sicti iange Jahre i
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Karst und Hohle<br />
Mit seinem Jahrbuch 1982/83 verfolgt<br />
der Verband der Deutschen Hohlenund<br />
Karstforschere.V., Munchen, eine<br />
neue Konzeption: Jeder Jahrgang<br />
steht unter einem regionalen Rahmen<br />
und vereinigt Beitrage zur karst- und<br />
hohlenkundlichen Forschung des jeweiligen<br />
Gebietes. Der Beginn wird mit<br />
Beitragen zur Karst- und Hfihlenforschung<br />
in Westfalen gemacht. IVIehrere<br />
Gebietskorperschaften, Institutionen<br />
und Personen haben durcin Spenden<br />
und Zuschijsse zur Finanzierung<br />
beigetragen.<br />
Das Sauerland nimmt - naturgemaB -<br />
den grol3eren Teil dieses Jalirbuchs<br />
ein. Der riJhrige Scliriftleiter Dieter W.<br />
Zygowski, IVIunster, hat foigende das<br />
Sauerland betreffende wissenschaftliche<br />
Beitrage zusammengebractit:<br />
Gerd Wenzens, Ein Beitrag zur Morphogenese<br />
der Karstiandsctiaften im<br />
nordlichen Saueriand; Dieter W. Zygowski,<br />
Die Holiien der Briloner Hochflaclne;<br />
Karl-Heinz Pielsticker, Ein<br />
neuer HOtiienaufschluB im Kalkgebiet<br />
der f-lohen Liet bei Warstein; Karl-<br />
Heinz Pielsticker, Neuentdeckungen in<br />
der Simonhahle im Lormecketal (Ost-<br />
Sauerland); Arnulf Bruckner u. Dieter<br />
W. Zygowski, Das Kirschhollenloch in<br />
Attendorn (Sud-Sauerland) unter besonderer<br />
Berucksichtigung seiner<br />
pleistozanen Fauna; Karl-Heinz Pielsticker,<br />
Neue Hohlenaufschlijsse im<br />
westlichen Steinbruch in Sundern-<br />
Westenfeld; Dieter Burger, Mikromorphologische<br />
Untersuchungen derVerwitterungsresiduen<br />
im Bereich der<br />
Iserlohner Kalkmulde; Walburga Studen.<br />
Die Schauhohlen des Sauerlandes<br />
und ihre Bedeutung fur den Fremdenverkehr;<br />
Detlef Rothe, Ur- und frutigeschichtliclie<br />
Funde in sudwestfSlischen<br />
Hohlen; Wilhelm Bleicher, Eisenzeitliclie<br />
Funde aus der Honerthohle;<br />
Hartmut Polenz, Uberlegungen<br />
zur Nutzung westfaiischer HOhlen<br />
wahrend der vorrOmischen Eisenzeit.<br />
Weitere 6 Beitrage befassen sich mit<br />
wissenschaftlichen Fragestellungen<br />
des Munsteriander Kreidebeckens. Zu<br />
Kreisschutzenbund<br />
Brilon neues Mitglied<br />
Der Kreisschutzenbund Brilon beschloB<br />
in seiner Kreisdelegiertenversammlung<br />
am 10. April, Mitglied des<br />
Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>es zu werden.<br />
KreisgeschaftsfiJhrer Hankein<br />
formulierte: „Wir hoffen sehr, mit unserem<br />
Beitrag zu einer kooperativen<br />
Arbeit beizutragen, um die gesteckten<br />
Ziele beider Bunde zu verwirklichen." -<br />
Der Vorstand des Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>es<br />
freut sich uberden Beitritt des<br />
Kreisschutzenbundes Brilon und hofft<br />
auf noch engere Zusammenarbeit in<br />
der Zukunft.<br />
alien Aufsatzen sind zahlreiche Fotos,<br />
Zeichnungen, Risse, Tabellen und<br />
ausfiJhrliche Literaturangaben beigegeben.<br />
Karst und HOhle 1982/83. BeitrSge zur Karst- und<br />
HOhlenforschung in Westfalen. Hrsg. v. Verband<br />
der Deutschen HOhlen- und Karstforscher e.V.<br />
Munchen. Munchen 1983. 217 S. mit zahlreichen<br />
Abbiidungen, Tabellen, Tafein und Karten. Kommissionsverlag<br />
Fr. Mangold'sche Buchhandlung,<br />
Blaubeuren. 39,- DM (Auflage: 1.200). PI.<br />
Das SChOne SUDSAUERLAND is.einenAusflugjahrlichwert.<br />
Manche hundert Sonderzuge, tausende von Omnibussen, zahllose Pkw<br />
bringen alljahrlich Erholungsuchende, Reisegesellschaften, Schulen, Klubs zum<br />
Beratung und<br />
Information fur<br />
Ausflijge,<br />
Sonderzuge,<br />
Tagungen, Sitzungen<br />
und alles<br />
Wissenswerte durch<br />
den Kreisverkehrsverband<br />
SiJdsauerland,<br />
5960 OIpe,<br />
SeminarstraBe 22,<br />
Tel. (02761) 6822<br />
^-<br />
Westfalens<br />
groBte und schonste<br />
Talsperre.<br />
FahrplanmaBlger<br />
Schiffsverkehr<br />
in stundlichenfi Turnus<br />
von Ostern bis Ende<br />
Oktober.<br />
MS Bigge,<br />
MS Sauerland,<br />
MS Westfalen.<br />
Gesellschafts- und<br />
Schulfahirten,<br />
Sonderschlffe nach<br />
Vereinbarung.<br />
Zum Biggesee kommen Sie uber die Autobatinen Sauerlandlinie und KOIn-OIpe und die BundesstraBen 54,55,236 Oder mit der<br />
Bundesbahn. Der See bietet Sport und Unterhaltung aller Art, aber auch herrllche ruhige Wanderwege. Das schOnste ist die<br />
2stundige Rundfahrt iJber den See. Die modernen Fahrgastschiffe mit 400 und 550 Sitzpiatzen, Sonnendecks und<br />
geschlossenen Salons sind bewirtschaftet und an kijhlen Tagen befieizt. Sie haben Ubertragungsanlagen fur Musik und<br />
Informationen unterwegs. Das Grachtenboot „Olpe" auf dem Obersee verlangert die Fahrt vom Hauptsee bis OIpe.<br />
Personenschiffahrt Biggesee, 5960 Sondern/Biggesee, Telefon 02761/61011<br />
57<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander Heinnatbund
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
Sauerlandisches Familienarcbiv<br />
Mitteilungen zur Greschichte westfalischer Geschlechter.<br />
Herausgegeben von Franz Honselmann in Padepborn.<br />
,SohOn ist es, den Spuren seines Geschleclites iiachzugehen; deim der Stammbaum<br />
ist liSr den einzelnen das, was die Oschichte des Vaterlandes fur eiii ganzes Volk ist."<br />
Esaias Tegiiur.<br />
Sauerlandisches<br />
Familienarchiv<br />
„Honselmanns Archiv", wie die im Titel<br />
benannte Zeitschrift genannt wurde,<br />
ist trotz ihres Alters eine der wichtigsten<br />
famiiienkundlichen Publikationen<br />
fur das Sauerland. in elf Lieferungen<br />
von 1904 bis 1921 erschienen und dann<br />
lOJalirespaterumeininlialtsverzeichnis<br />
und Register vermehrt als geschlossener<br />
Band fierausgebracht,<br />
war es langst vergriffen und im Antiquariatsbuchhandel<br />
nur mit unwalirscfieinlichem<br />
GliJckerfiaitlJcli. Nun hat<br />
uns der bekannte Paderborner Historiker<br />
Pralat Prof. Dr. Klemens Honselmann<br />
das Werk seines Vaters in einem<br />
Reprint wieder gescfienkt. Das Sauerland<br />
ist ihm dafurzu Dankverpfiichitet.<br />
Das ursprijnglich 216 Seiten umfassende<br />
Werk haben der Herausgeber<br />
und sein Vetter Wilhelm Honselmann<br />
auf einigen wenlgen Seiten urn einen<br />
Lebensiauf des Verfassers Franz Honselmann<br />
und um etiiche ErgSnzungen<br />
vermehrt. Durch den Buchhandel ist es<br />
beim Verlag Bonifaciusdruckerei,<br />
Paderborn, zu beziehen, Preis 48 —<br />
DM.<br />
Honseimanns Archiv befaBt sich in der<br />
Hauptsache mit zwei Familien, den<br />
Hfiynck und Rape, die, im Sauerland<br />
weit verbreitet, in ihren Haupt- und Seitenlinien<br />
zahlreiche bedeutende Pers6nlichkeiten<br />
hervorgebracht haben.<br />
Da auch die angeheiratete Verwandtschaft<br />
mit berucksichtigt wird, ist nicht<br />
erstaunlich, dal3 das Personenregister<br />
fur sich allein 44 Spalten umfaBt und im<br />
Ortsregister rd. 200 Ortschaften<br />
erscheinen. Wo dies der Bedeutung<br />
der PersSnIichkeiten entspricht, wird<br />
ein komplettes Lebensbild gegeben,<br />
so beispieisweise von dem Grafschafter<br />
Abt Coelestin HSynck, (1711-27),<br />
dem Abt Winimar Knipschiid von<br />
Abdinghoff (1728-32), dem Wedinghauser<br />
Abt Adrian Hoynck, ferner<br />
Eduard Rape (1816-88), dem Mitschopfer<br />
des BiJrgeriichen Gesetzbuches,<br />
dem Dichter Josef Rape und der<br />
Dichterin Johanna Baltz (Arnsberg), R.<br />
Rotger Hundt SJ., Bernhard v. Hagen,<br />
Retrus Schultheis, Kaspar Uhlenberg,<br />
SAUERLAND<br />
Johannes Nopel, dem Westphalus<br />
Eremita Dr. Josef Sommer u.a. Mit den<br />
drei Banden des „Sauerlandischen<br />
Geschlechterbuchs", dem in SAUER-<br />
LAND besprochenen vieibandigen<br />
Werke von J. Lauber und dem Schtingel-Buch<br />
von H. und R. Wasser durfte<br />
es zu den wichtigsten Veroffentlichungen<br />
gehoren, die dem Ahnenforscher<br />
hierzuiande zur Verfugung stehen.<br />
Theo Hundt<br />
„Hungheme Strulleken"<br />
Unter diesem Titel gibt der Verkehrsund<br />
VerschOnerungsverein 1881 Kirchhundem<br />
durch seinen engagierten<br />
Vorsitzenden, Helmut Schauerte, seit<br />
Anfang des Jahres ortliche Nachrichten<br />
heraus. Unter Anspielung auf die<br />
Musikalischer<br />
Heimatabend<br />
in Sundern<br />
Ein musikalischer Heimatabend besonderer<br />
PrSgung findet am 31. Aug.<br />
1984 in der Schutzenhalle Sundern<br />
statt. Der MGV CACiLIA SUNDERN,<br />
dem die Chormusik von Georg Nellius<br />
sehr am Herzen liegt, veranstaltet ein<br />
voikstumliches Konzert.<br />
Einen besonder6n Schwerpunkt des<br />
Konzertprogramms bilden die piattdeutschen<br />
Lieder und Ch6re von<br />
Georg Nellius mit den Texten von Christine<br />
Koch. Aber auch Werke des<br />
ailseits bekannten sauerlandischen<br />
Komponisten Gustav Biener aus<br />
Arnsberg stehen auf dem Programm.<br />
Bei dem abwechslungsreichen Programm<br />
wirkenauBer dem veranstaltenden<br />
Chor der bekannte Kinder- und Jugendchor<br />
der Musikschule Arnsberg -<br />
Rreistrager des Landes NRW im Wettbewerb<br />
„Jugend singt" - mit seinem<br />
Dirigenten Gerd Schijttler und als Solist<br />
Alexander Senger vom Staatstheater<br />
Hannover mit, der von Franz Selter<br />
am Flugel begleitet wird.<br />
Schirmherr der Veranstaltung ist der<br />
Vorsitzende des Saueriander <strong>Heimatbund</strong>es,<br />
OKD Dr. MiJllmann. Se.<br />
Bedeutung des Wortes Strulleken - eine<br />
kleine Quelle mit klarem Queiiwasser<br />
- soilen die Dorfbriefe den stiiien<br />
und geheimen Rfaden im Dorfleben<br />
nachgehen „und so versuchen, unseren<br />
MitbiJrgern ihr Dorf interessant zu<br />
machen". - So enthSIt der Dorfbrief Nr.<br />
11nformationen, Nachrichten und kritische<br />
Stellungnahmen, die beinahe<br />
ebensogut im Heimatteil der firtlichen<br />
Tageszeitung stehen kSnnten. Hier hat<br />
der Verkehrs- und Verschonerungsverein<br />
offenbar eine Marktiucke<br />
entdeckt.<br />
l\/leschede war um 800<br />
ein Kleinweller<br />
In einer Informationsveranstaltung der<br />
heimatkundlichen Kommission der<br />
St.-Georgs-Schutzenbruderschaft<br />
Meschede referierte Reinhard KOhne<br />
LJber die vor- und frijhgeschichtiichen<br />
Siedlungsformen im MeschederLand.<br />
Schon in der Stein- und Eisenzeit lassen<br />
sich einzelne kleine Siedlungen<br />
nachweisen. Die eigentliche Landnahme<br />
erfoigte aber erst zwischen dem 8.<br />
und 10. Jahrhundert. Die Rodungen<br />
konzentrieren sich auf die TSIer von<br />
Ruhr und Henne und auf dieTonschiefermulden<br />
von Meschede, Sundern<br />
und Remblinghausen sowie Eslohe.<br />
Einzelhofe und Kleinweiler entstanden.<br />
Zentrale Aufgaben ubernahmen mit<br />
der Erhebung zu Kirchorten Velmede,<br />
Meschede, Calle und Heiiefeld. Im<br />
Kernbereich der Stadt Meschede laBt<br />
sich um 800 ein Kleinweiler von sechs<br />
bis sieben HOfen vermuten. Die alien<br />
Flurnamen „up Wort, Kamp und Feid"<br />
weisen auf das alteste Ackerland hin,<br />
das sich auf der Niederterrasse der<br />
Ruhr und dem Schotterkegei der Henne<br />
befand.<br />
In einer weiteren Vortragsveranstaltung<br />
wird Reinhard Kohne uber die<br />
stadtischen Siedlungsformen des Mittelalters<br />
referieren.<br />
Gunter Kotthoff zeigte Dias von den<br />
Ausgrabungen im Bereich des alten<br />
Pastorats. DieSiedlungsresteausdem<br />
13. bis 15. Jahrhundert soilen in diesem<br />
Jahr welter untersucht werden.<br />
Die heimatkundliche Kommission der<br />
St.-Georgs-Schutzenbruderschaft<br />
Meschede hat sich zur Aufgabe gemacht,<br />
die Geschichte des heimatlichen<br />
Raumes aufzuarbeiten und in einer<br />
Rubiikationsreihe zu veroffentlichen.<br />
58<br />
© Copyright Saueriander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Neu im Stadtarchiv<br />
Arnsberg:<br />
Streifzuge in die Welt<br />
sauerlandischer AInnen<br />
Im Archiv der Stadt Arnsberg gibt es<br />
ein neues interessantes Buch mit der<br />
Uberschrift ..Streifzijge in die Welt meiner<br />
Ahnen", verfaBt von Friedrich H.<br />
Schniewind, SOcking/Starnberg.<br />
IVIan mu3 dem Verfasser hohes Lob<br />
ausspreclien fur die umfangreiche<br />
Arbeit, die er sich mit der Erforschung<br />
der Geschichte seiner Vorfahren gemacht<br />
hat. Ein wesentlicher Tell dieser<br />
Burger mit Rang und Namen stammt<br />
ausdemkurkolnischenSauerland.Der<br />
Bogen ihrer Herkunft spannt sich von<br />
Werl (Floret, Wegmann) uber Arnsberg<br />
(Schultes, Brisken, von Essen, Harbert,<br />
insbesondere Arndts u.a.) bis Bilstein/OIpe<br />
(Freusberg/Blgeleben<br />
u.a.m.). Alle geben sich hier in der Reminiszenz<br />
ein Stelldichein.<br />
Es ist in der Tat - wie der Autor selbst<br />
sagt - fast ein Familienroman, groBartig<br />
angelegt mit vielen liebensw/ijrdigen<br />
Schilderungen und historischen Bildern,<br />
der den Leser augenblicklich<br />
bannt und immer wieder ermuntert,<br />
welter zu blSttern.<br />
Schniewind, der 87jahrigesehrrustige<br />
Verfasser, Sohn des freiberuflich fur<br />
die Stadt Koln tatig gewesenen<br />
Anwaltes und Justlzrates Emil Schniewind,<br />
Ist mutterllcherselts direkter<br />
Nach komme der altelngesessenen Famine<br />
Arndts am Alten Markt zu<br />
Arnsberg.<br />
Hier war Joh. Caspar Arndts (urn 1700)<br />
gelehrter Schrelber beim Oberkellner<br />
von Ducker, bald schon Burggraf, Notar<br />
und Procurator. Sohn Joh. Wilhelm<br />
(geb. 1710), Kurfurstl. gelehrter Rat,<br />
erhlelt die erste Bestallung zum fijrstl.<br />
Thurn- u. Taxisschen Postmeister, der<br />
die ersten Poster Im Herzogtum Westphalenanlegte.<br />
IhmfolgtespaterSohn<br />
Engelbert (geb. 1750), dessen Bruder<br />
Friedrich Arnold (geb. 1758), verheiratet<br />
mit Maria Bigeleben, gehelmer Dlrektor<br />
des Hofgerlchts Arnsberg und<br />
Mitglled der „Gesetzgebungs-Commission<br />
Darmstadt" wurde. Drifter und<br />
letzter Postmeister in Arnsberg war<br />
Friedhch-Franz (geb. 1787), Justizcommissar<br />
zu Arnsberg, der In die Famine<br />
Brisken (Lisette) hinelnheiratete.<br />
Friedrlch-Franz war durch seine<br />
Schwester Marianne mit der Familie<br />
Linhoff verschwagert, die spater - In<br />
preuBischer Zelt - die In Arnsberg<br />
errichtete erste neue Posthalterstelle<br />
iJbernahm.<br />
Wenig bekannt ist, daB „K6nig Lustik",<br />
HIeronymus Bonaparte (J6r6me), den<br />
sein groBer Bruder Napoleon zum K6-<br />
nig von Westfalen mit Resldenz in Kassel<br />
gemacht hatte, auf seiner „Ruckreise"<br />
(1813) im Hause Arndts „erlauchter"<br />
Gast war, und daB iJberhaupt fruher<br />
und spSter immer wieder hohe Persfinllchkeiten<br />
bei den Fiscalen Arndts<br />
In Arnsberg einzukehren pflegten.<br />
Beruhmtester Arndts war Kart Ludwig<br />
(1803-1878), den Franz-Joseph der<br />
Erste, Kaiser von Oesterreich, am 22.3.<br />
1871 - als „hohe Leuchte der Rechtswlssenschaft"<br />
- in den Adelsstand<br />
erhob und ihn - im Anklang an seine<br />
Vaterstadt Arnsberg - „Rltter von<br />
Arnesberg" nannte. Seine erste Frau<br />
(und Gousine) Bertha Arndts gebar<br />
ihm nach 13jahriger Ehe ein Kind<br />
(1844), das aber soglelch starb. Arndts<br />
sollte keine Nachkommen hlnterlassen.<br />
Nachdem Ihm die Frau Bertha Im<br />
Mai 1859 durch den Tod entrlssen wurde,<br />
ging Arndts eine zweite Ehe Im<br />
August 1860 mit Frau MariaGOrres geb.<br />
Vespermann (Tochter eines berijhmten<br />
Ktinstlerpaares) ein. Sie war die<br />
Witwe von Guide Gorres, welche sich<br />
durch dramatlsche Gedichte, Novellen<br />
und muslkallsche Kompositlonen auszelchnete<br />
und In diesem Zusammenhang<br />
auch mit Annette<br />
von<br />
Droste-Hulshoff<br />
in Verblndung<br />
stand.<br />
Schniewlnds<br />
Buch - sauberer<br />
gruner Leinenelnband<br />
mit Golddruck,<br />
130 DIN-A-4-<br />
Selten, Text In<br />
Maschinenschrlft,<br />
dazu<br />
viele Photo-<br />
Abzijge und<br />
Abblldungen<br />
von Dokumenten<br />
nebst elngehenden<br />
Erlauterungen,<br />
sowie<br />
aniiegend eine<br />
Ahnentafel -<br />
weist zu Beginn<br />
eine Uberslcht<br />
derUntertltelzu<br />
den einzelnen behandelten Epochen<br />
bzw. Linien der honorlgen Ahnenreihe<br />
auf, anhand welcher man sich leicht<br />
orlentieren kann. Die mit manchen Historchen<br />
und Ortsschllderungen llebevoll<br />
durchsetzte, bewuBt romanhafte<br />
Schllderung verzichtet auf ein Sachund<br />
Personenverzelchnis sowIe auf eine<br />
Quellenangabe.<br />
Es sind echte „Strelfzuge" geworden,<br />
die der Verfasser fur seine Nachkommen<br />
- so bemerkt er es im Vorwort - In<br />
abwechslungsrelchen Exkurslonen<br />
durchfilhrt.<br />
Ein Exemplar des Buches, es diente<br />
nun auch dieser Rezension, vermachte<br />
der Autor durch persOnliche Ubergabe<br />
an Stadtdlrektor Dr. Cronau dem<br />
Arnsberger Stadtarchiv zur bleibenden<br />
Berelcherung. Klemens Propper<br />
Da diese Veroffentlichung sicherlich<br />
Anfragen interessierter Familienforscher<br />
auslosen wird, sel hier auf einige<br />
Literatur verwiesen: Schulte, Westf.<br />
Kopfe, S. 11, Aschendorff 1978; Deutsches<br />
Geschlechter-Buch, div. Bande,<br />
Starke-Verl. Limburg; Seibertz, Stammbuch<br />
der Fam. S. z. Wildenberg, Manuscript-Ausg.,<br />
1847; Honselmann, Sauerl.<br />
Familienarch. 1904-1931, Schoningh<br />
(jetzt Reprint-neu); Grueber, Ludwig<br />
Arndts, MiJnchen 1904 (hist, polit. Blatter<br />
134);Hofmann, Ludwig von Arndts, Wien<br />
1878, Verl. Alt Holder; Fmux de Lacroix,<br />
Gesch. Arnsbergs, 1895/1971, Verl. Stein<br />
Werl; u.a.m. (KP)<br />
59<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Reype Ahren<br />
Hedwig Jungblut-Bergenthal<br />
In ihrem ersten Werkchen „Van Pastauers,<br />
Lehrs un anneren Luien" stellte<br />
uns Hedwig Jungblut-Bergenthal,<br />
MItglied des „Schrieverkring" in MiJnster,<br />
vonwiegend heitere Musenkinder<br />
vor; aber sction dort kundigt Rotger<br />
Belke-Grobe in seiner Vorrede an, daB<br />
jene Sammlung der Breite ihres mundartlichen<br />
Schreibens nicht gerecht<br />
wird.<br />
Und wirklicti, auchi die Hflrer in ihren<br />
ortlichen Veranstaltungen und die LeserunsererZeitschriftSAUERLAND,<br />
in<br />
der sie zahlreichie BeitrSge veroffentlichte,<br />
werden uberrasctit sein, welcti<br />
neue Saiten dictiterischen Kflnnens in<br />
ihrem neuen Gedichtband zum Erklingen<br />
gebracht werden. Die Verse, die<br />
schon in ihrem ersten Werkchen von<br />
Hedwig Jungblut-Bergenthal<br />
Harausgebef ScHtefertwg&au Heimalmuseum Holthausen<br />
„guter Beobachtungsgabe, Muttenwitz<br />
und hervorragendem Einfuhlungsvermogen<br />
zeugten" (Belke-Grobe), erfahren<br />
hier eine Tiefe und Innerlichkeit,<br />
die manche Landsleute bisher an ihr<br />
noch nicht kannten.<br />
Aus ihrer inneren Sicherheit, als Kind<br />
des einfachen Volkes, in unbedingter<br />
Ehrlichkeit betrachtet sie das Leben<br />
um sich herum und formt es in Versen.<br />
Sie erkennt hier mit klarem Blick das<br />
Echte und das Unechte und nennt es<br />
tapferen Herzens mit ihren wahren Namen.<br />
Fur die soziale Frage braucht sich diese<br />
Frau nicht zu engagieren; sie ist in<br />
sie hineingewachsen, und gerade auf<br />
diesem Gebiete setzt sie starke Akzente.<br />
Die Dichterin macht sich zur Sprecherin<br />
der kleinen Leute. Auf sozialem<br />
Feld sind es vor allem die Familien-<br />
probleme der modernen Zeit, die sie<br />
stark beeindrucken. Immer wieder halt<br />
sie in ergreifenden Szenen das Leid<br />
test, das gerade die Frau auch heute<br />
noch immer in einerWeltderGleichberechtigung<br />
erfahren muB. Trotz bedrijckender<br />
Verhaltnisse sieht die<br />
Dichterin immer wieder das Helle in der<br />
Welt, das Licht, die Freude, den Halt im<br />
Leben. Liebesglilck findet frohe, Liebesleid<br />
ergreifende Worte. Der Jahreslauf<br />
mit seinen frohen Hohepunken<br />
strahit in ihren Versen. Die unberuhrte<br />
Natur beschwOrt sie immer wieder. Es<br />
geht ihr nahe, wenn Birken und Hekkenwege<br />
einer rationellen Linienfuhrung<br />
weichen mussen.<br />
Mutter wachtet<br />
De Uhrschlattdroi!<br />
De Mutter maket de Diar all mol<br />
oapen,<br />
kritt out'm Schaape de bunten<br />
Scholen,<br />
settet se oppen Disk<br />
bey diSn frisk gebackenen Appelkauken<br />
...<br />
De Uhr schiatt vaier! -<br />
Se schiatt feywe,<br />
se schiatt sSsse.<br />
Noij kummet wall kenner mehr,<br />
doch de Diahr stait ummer nSo<br />
oapen.<br />
Auf jeder Seite lesen wir von ihrer<br />
dankbaren Liebe zum Leben, zur Natur,<br />
zum GOttlichen, zum Mitmenschen,<br />
und das alles im kleinen Kreise,<br />
in bescheidenen Verhaltnissen, in<br />
ehrlicher, einfacher Sprache, aber mit<br />
klarem Blick, wacher Beobachtung<br />
und aus gutem Herzen.<br />
leek danke, Heer, dey Dag fiar Dag,<br />
fiSr jeden kloinsten Hiartenschlag,<br />
dai mieck, sSlang et dey gefallet,<br />
op dueser Welt am Liawen hailet...<br />
Dieselben Akkorde klingen an in den<br />
Gedichten „Reype Ahren", „Daoendanz<br />
im November", „Silvestergedanken",<br />
„Dankgebiat". Solch stilie Besinnlichkeit<br />
geht jedoch Hand in Hand<br />
mit ihrem ursprunglichen Humor, vor<br />
allem, wenn es um Kinder geht.<br />
Bey us was schlechtet Wiar,<br />
dat kam vam kloinen Pauleken.<br />
Dai packere seyn Stoileken<br />
un schleyk sleek Out der Diar. ..<br />
Lebte Georg Nellius noch unter uns, er<br />
hatte langst dieses kleine Meisterwerk<br />
plattdeutscher Sprachkunst vertont.<br />
Heute muBten diese kostlichen Verse<br />
Aufnahme in einer Anthologie besonders<br />
gelungener Kinderlieder finden.<br />
Die kunstlerische Gestaltung des<br />
Bandchens lag in den bewahrten HSnden<br />
des Malers und Graphikers Hans-<br />
Georg Bergenthal: Uber den in<br />
Schwarz-WelB gehaltenen Landschaften<br />
liegt ein Hauch von Zartlichkeit und<br />
Melancholie: in duster-geballter Kraft<br />
die Landschaft bei Fleckenberg; kijhn<br />
und eigenwillig die Baumgruppe am<br />
sprudelnden Wasser; bizarr und doch<br />
beschwingt die Birke auf dem Kahlen<br />
Asten.<br />
Es wijrde den Rahmen einer Besprechung<br />
sprengen, wenn wir hier ein<br />
Oder mehrere Gedichte in Form und<br />
Inhalt ausloten wollten; es sollten hier<br />
nur Farbtupfer gesetzt werden, die<br />
unsere Landsleute anregen mflgen,<br />
das Buchlein in ihre HausbiJcherei aufzunehmen.<br />
Alfred VorderwiJIbecke<br />
Unsere<br />
westfalische Heimat<br />
von K. Prumer als Nachdruck<br />
Unter den nicht wenigen Nachdrucken<br />
ijber Westfalen ist nun auch das Buch<br />
„Unsere westfalische Heimat und ihre<br />
Nachbargebiete", mit zahlreichen<br />
Abbildungen aus alter und neuer Zeit,<br />
das Karl Prumer im Jahre 1909 herausgegeben<br />
hat. Auf 464 Seiten mit fast<br />
600 Abbildungen fuhrt dieses Buch<br />
durch Westfalen, beschreibt landschaftliche<br />
und bauliche Schflnheiten,<br />
Landesgebiete und darunterauch<br />
„Das Kolnische Sauerland, das ehemalige<br />
Herzogtum Westfalen" mit Sitten<br />
und Gebrauchen. Unter den uns<br />
interessierenden Fotos sind die noch<br />
unverbauten Ruhrpartien und -taier,<br />
die fijr die Jahrhundertwende typischen<br />
Burg- und SchloBruinen im damaligen<br />
Zustand, Arnsberg vom Bahnhof<br />
aus, Meschede noch ohne<br />
StraBenkreuzungen, die alte Hennestaumauer,<br />
Brilon auf der Hochflache<br />
ohne BetonklOtze, die Ziegenherde in<br />
Winterberg und der erste Aussichtsturm<br />
auf dem „Kahlen Astenberge".<br />
Der Verlag Weidlich in Frankfurt hat<br />
dem umfangreichen Buch durch einen<br />
schonen Leineneinband in gelber Farbe<br />
mit dem westfSlischen RoB auch ein<br />
ansprechendes AuBeres gegeben.<br />
Ferdy Fischer<br />
60<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Sauerlandische Stadte<br />
in Bild und Text:<br />
Arnsberg, Neheim,<br />
Olsberg, Medebach<br />
In Aniehnung an den 1976 erschienenen<br />
Bildband ,,100 Jahre Arnsberg im<br />
Bild", der bald vergriffen war, hat der<br />
Arnsberger Helmatbund es unternommen,<br />
das Thema unter Einbeziehung<br />
der auSeren Stadtteile zu aktualisieren<br />
und dabei einmallge historische Aufnahmen<br />
modernen Fotografien gegenuber<br />
zu stellen. Den Text IJeferte<br />
Arnsbergs fruherer Stadtdirektor Dr.<br />
Hermann Herbold, der auch die meisten<br />
historischen Fotos zur Verfugung<br />
stellte; die Gegenwartsfotos nahm<br />
Friedhelm Ackermann auf. Das Layout<br />
lag in den Handen von Hans Wevering.<br />
So ist in Teamarbeit ein Buch entstanden,<br />
das den Wandel und das Wachsen<br />
der Stadt in den letzten hundert<br />
Jahren anschaulich macht: Fast jeder<br />
der fast rund 250 tiistorischen Fotografien<br />
steht eine Gegenwartsaufnahme<br />
in derselben Bllckrichtung gegenijber.<br />
Neben „Arnsberg 2" wollte sich „Arnsberg<br />
1" nicht in den Schatten gestellt<br />
sehen. Die 625-Jahrfeier Neheims<br />
1983 fand Eingang in ein Buch, das der<br />
Helmatbund Neheim-Husten herausgab.<br />
Die Darstellung der Geschichte<br />
der Stadt, die in der groBen Feier und<br />
dem historischen Festzug ihren Niederschlag<br />
gefunden hatte, wurde von<br />
Franz Clemens Feldmann geschrieben<br />
und mit aktuellen Fotos - farbigen und<br />
schwarzweiSen - von den Festveranstaltungen<br />
geschmuckt. So ist eine lebendig<br />
geschriebene Ortsgeschichte<br />
und zugleich eine anschauliche Dokumentation<br />
derfrohlichen Geburtstagsfeier<br />
entstanden.<br />
Ackermann, Herbold, Wevering: Arnsberg 100<br />
Jahre im Bild. Herausgegeben vom Arnsberger<br />
Helmatbund e.V. • Strobel-Verlag Arnsberg. 1983.<br />
272 S. 44,00 DM. - Franz Clemens Feldmann: Neheim<br />
im Bild der Jahrhunderte. Nachlesezur 625-<br />
Jahr-Feier. Herausgegeben vom Helmatbund Neheim-HiJsten<br />
e.V. • Strobel-Verlag Arnsberg. 1983.<br />
88 8.19,80 DM.<br />
Auch beim Bildband uber Olsberg war<br />
der Ortliche <strong>Heimatbund</strong> Initiator und<br />
Herausgeber. Ein Arbeitsteam unter<br />
Leitung von Fritz Droste brachte Bilder<br />
und Texte der 1975 zusammengefugten<br />
neuen Stadt Olsberg zu einem<br />
ansehnlichen Bildband zusammen,<br />
der den Leserund Betrachtervorallem<br />
durch die rund 700 vorwiegend historischen<br />
Aufnahmen aus alien Orten der<br />
neuen Stadt erfreut. So wird ein guter<br />
Querschnitt aus dem Leben der Stadt<br />
Olsberg und der Geschichte IhrerDOrfer<br />
gezeigt. Die in der Heimatarbeit<br />
erfahrenen Fritz Droste, Otto Knoche<br />
und Heinz Lettermann haben sich zugleich<br />
bemuht, mit diesem Bildband<br />
auch ein Lesebuch zu erstellen, in dem<br />
es viel Wissenswertes uber die geschichtliche<br />
Entwicklung aller Orte,<br />
uber die Menschen, ihre Arbeit, ihre<br />
Werkstatten und ihre Hauser zu lesen<br />
gibt. So ist ein „burgerschaftlichesGeschenk<br />
an die Stadt" (Dr. Mullmann)<br />
entstanden.<br />
Ebenfalls mit Olsberg befaBt sich eine<br />
bebilderte Broschure, die die Sparund<br />
Darlehnskasse Olsberg-Bigge eG<br />
aus AnIaB ihres lOOjahrigen Bestehens<br />
herausgegeben hat. Unter Federfuhrung<br />
des Redakteurs Jochen Krause,<br />
Kirchhundem, wird ein Buchlein vorgelegt,<br />
das besonders deshalb interessant<br />
ist, weil es zahlreiche auf die<br />
Stadtgeschichte bezogene Dokumente<br />
im Faksimile wiedergibt und sich<br />
keineswegs auf die Wirtschaftsgeschichte<br />
beschrSnkt, sondern viele<br />
Lebensbereiche erfaBt und sie in einen<br />
grSBeren Zusammenhang stellt.<br />
Ahnlich ist ein vergleichbares Werkchen<br />
ijber Medebach entstanden,<br />
ebenfalls aus AnIaB des lOOjahrigen<br />
Geburtstages der dortigen Volksbank<br />
im gleichen Jahr 1983. Auch hier<br />
schrieb Jochen Krause die Texte.<br />
Auch hier erfassen Text und Bilder,<br />
zum Teil in Farbe, einen weitaus gr6Beren<br />
Lebensbereich als nur die Weltund<br />
Wirtschaftsgeschichte der Stadt.<br />
Die Fotos, Zeichnungen, Faksimiles<br />
usw. sind mit groBer Sachkunde und<br />
Liebe ausgesucht; wie beim Olsberger<br />
Buchlein erieichtert auch hier das hervorragende<br />
Layout die LektiJre, ja<br />
macht sie zum VergnOgen.<br />
stadt Olsberg. Bilder aus der Geschichte ihrer<br />
Dfirfer. Herausgegeben vom <strong>Heimatbund</strong> der<br />
Stadt Olsberg e.V. Druckerei Karl Hecker Brilon.<br />
1983. 292 S. 45,00 DM.<br />
Olsberg, Geschichte und Tradition. Herausgegeben<br />
von der Spar- und Darlehnskasse Olsberg-<br />
Bigge. Olsberg 1983, 90 S.<br />
Medebach, Geschichte und Tradition. 100 Jahre<br />
Volksbank Medebach. 1983.105 S.<br />
PI.<br />
lUT'M<br />
hliy<br />
HUICR<br />
DIU<br />
--^<br />
Jupp Schottler<br />
Wer ihn gekannt hat, wer ihn je hat<br />
erzShlen horen, wer in den ersten Jahrgangen<br />
dieser Zeitschrift seine Beitrage<br />
gelesen hat, dem sind seine Vertellekes<br />
in Hoch- und Plattdeutsch ebenso<br />
unvergeBlich wie er selbst. Bei aller<br />
Abgekiartheit saB ihm der Schalk im<br />
Nacken, und das gleiche ist der Fall bei<br />
den Personen, die er in seinen Geschichten<br />
sprechen und handein lieB.<br />
Seine Frau und seine Freunde haben<br />
nun aus seinem schriftlichen NachlaB<br />
zusammengesucht was sie fanden,<br />
und es in Druck gegeben. Das Buchlein<br />
hat den Titel „NIU KUIER DIU. Vertellekes<br />
iut'm Siueriand" und ist im<br />
Sauerland-Veriag, Iseriohn, erschienen<br />
(Fester Einband, 80 S., DM 14,80<br />
uberdenBuchhandel).Esenthait zahlreiche<br />
von ihm gesammelte Vertelleken,<br />
bekannte und unbekannte, und ist<br />
illustriert mit Zeichnungen von Anneliese<br />
Schmidt-Schottler, die neben<br />
ihrem kiinstlerischen Beruf als Bildhauerin<br />
das geistige Erbe Jupp<br />
SchOttlers pflegt. Der Veriag hat<br />
strengstensdenNachdruck„Furjeden<br />
Zweck" untersagt; der Versuchung,<br />
die Illustration zur Uberschrift „Siupen"<br />
beispielsweise hier einzufugen, war<br />
schwer zu widerstehen. Schottlers<br />
Buchlein kann getrost ebenburtig neben<br />
Christine Koch's „Wille RSousen"<br />
gestellt werden. Beide sind, jedes auf<br />
seine Weise, typische Beispiele sauerlandischer<br />
Art und Kunst aus Herz und<br />
Wort. Auch wenn sich die Zeiten geandert<br />
haben, Menschen bleiben ihrer<br />
Art mehr getreu als man manchmal<br />
meint. Das neue Buchlein wird unseren<br />
Lesern Freude bereiten und ist auch<br />
zum Verschenken bestens geeignet.<br />
Theo Hundt<br />
61<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
So sah ich Sundern<br />
In ihrem 10. Lebensjahr erhielt die (jetzt nicht mehr neue) Stadt<br />
Sundern ein Buch uber sich selbst: Der Kunstler Hans-Georg<br />
Walther und der Leiter des Sunderner Gymnasiums, Dr. Hubert<br />
Schmidt, stellen ilir Buch „So sah ich Sundern" der Offentlichl
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
Gymnasium<br />
Laurentianum<br />
Es liegt in Arnsberg 2, dem eigentlichen<br />
Arnsberg. (Arnsberg 1 ist Neheim-Husten<br />
- die Bundespost hat es<br />
so bestimmt; wir machten und machen<br />
es mit). Diese Stadt Arnsberg verOffentlichte<br />
1979 als Nr. 12 ilirer StSdtel t<br />
bcc i!atifiif(f)eii SSerfjAttntfie DcS ^6iii3tic^cn itaitl*cntianwm<br />
gu 2lrn§berg,<br />
«S5%cnb bt« SSmtcr«©€mc(ltr« 1827 m 1828.<br />
Cc§rcr.<br />
|§au^^tIc5rcr<br />
SSaabett.<br />
Sau(j.<br />
(Scrrfiig.<br />
©cf)[i'itcr.<br />
?OJard)aiib.<br />
piiffgrc^rcr:<br />
Bimmcrmann,<br />
(5rf)ciincit.<br />
SAUERLAND<br />
gicf)cr.<br />
iKcffgioit.<br />
•Ceuffd) .<br />
^ateim'ici)<br />
®ricchifj)<br />
ycbraifd)<br />
'.'ogif. . .<br />
Diotbcinaiif<br />
Jiatiiiiiiiitf<br />
irbfmibc .<br />
Sffcbtdjtc .<br />
3ctLi'itcn .<br />
2d)6nf(()r&.<br />
Siiigcit . .<br />
3irciitium.<br />
©itrnnie<br />
3n<br />
II.<br />
III.<br />
IV.<br />
V.<br />
VU<br />
Sltfgcmctncr gebtptgti'<br />
II.<br />
(3)<br />
2<br />
8<br />
6<br />
2<br />
2<br />
4<br />
0<br />
(3)<br />
6(3) 6<br />
6<br />
2<br />
1(3)<br />
1<br />
Sfaffen unb ©titnbcn.<br />
HI. I IV. VI. ga.| gjcmerfuiig.<br />
C3) (3)<br />
1<br />
3<br />
I'A<br />
(3)<br />
(2)<br />
I'/c<br />
1<br />
vacat.<br />
' I 4'/,<br />
(3) 3<br />
26(0)20(6)231(3)28(5)24(6)31<br />
©d)ii(i'r<br />
norm<br />
15<br />
16<br />
15<br />
18<br />
24<br />
26<br />
114<br />
tratcit<br />
aui<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
8<br />
(iiib<br />
12<br />
15<br />
14<br />
17<br />
24<br />
24<br />
106<br />
Stbttnrtenteii<br />
8<br />
21<br />
51<br />
26<br />
4<br />
2<br />
21<br />
3<br />
6<br />
10<br />
8<br />
4<br />
12J<br />
mifKr. I. II.<br />
t)ic fc(f>^ gfaf*<br />
ien)varcnn
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
O<br />
/ A# '/^ .. /-;' .i^<br />
'p^'-^'^^P-K /, J*,y^Ji^^,, t^,,^^.*^l.^«^. Cf/a/^uC^y J^AJL^/^.<br />
^/<br />
A<br />
^^g/^.^^^1/.<br />
64<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Dieser Franz Anton Hundt, *Olpe<br />
1809, t OIpe 1842, war wie sein Vater<br />
Gewerke und betrieb den Weuster<br />
Hammer. Er heiratete Maria Anna Harnischmacher<br />
und zog in deren Eiterntiaus,<br />
Westfaiische StraBe 25, eines<br />
der schonsten und grOBten Burgerhauser<br />
in OIpe. Sein eigenes Elternhaus,<br />
Ecke Agatha-ZFrankfurter<br />
StraBe, verblieb derfilteren Schwester<br />
und ihrem Ehemann Robert Bonzel.<br />
IVIit der Abfassung des geplanten Beitrags<br />
lieB ich mir Zeit. Mein GliJck! In<br />
der Zwischenzeit verftffentlichte der<br />
Krelsheimatbund OIpe das Inventar<br />
des „Archivs Vasbach, Kirchhundem",<br />
und dort fand ich unter Nr. 110 ein weiteres<br />
Abgangszeugnis des Gymnasiums<br />
Arnsberg aus demselben Jahr<br />
und (Nr. 109) ein weiteres Zeugnis fur<br />
die Quarta aus1823 verzeichnet. Beide<br />
Zeugnisse seien nachfolgend in vollem<br />
Wortlaut wiedergegeben. Das Abiturzeugnls<br />
entspricht in Aufbau und<br />
Schrift dem vorigen. Auf seine Abbildung<br />
wird daher verzichtet.<br />
Nro. II. - Entlassungs^ZeugniS. -<br />
Engelbert Bruning, Sohn des Koniglichen<br />
Amtsschreibers Hen Bruning zu<br />
Erwitte; war 2 Jahre auf dem hiesigen<br />
Gymnasium - Ein Jahr in Prima.<br />
Auffuhrung. Abiturient lebte mit alien<br />
seinen Mitschulern in Frieden. Gegen<br />
seine Lehrer hat er nie Widersetzlichkeit<br />
Oder Unehrerbietigkeit bewiesen.<br />
FleiB. Abiturient hat aufalle Lehrgegenstande<br />
einen lobenswerthen FleiB verwendet,<br />
die Klassenstunden, wenn er<br />
nicht durch Krankheit davon abgehalten<br />
wurde, regelmaBig besucht, und die<br />
aufgegebenen Arbeiten punktiich<br />
abgeliefert.<br />
Kenntnisse. Mehre lateinische und<br />
leichte griechische Classiker lieset Abiturient<br />
nach gestatteter Ueberlegung<br />
gelaufig und faBt auch das Gelesene im<br />
Zusammenhange auf. Sein lateinisctier<br />
Styl nahert sich zwar der antiken Form,<br />
bedarf aber noch einer fongesetzten<br />
Uebung. Die Geschichtskenntnisse des<br />
Abiturienten sind sehr lobenswerth. In<br />
der fvlathematik ist er verhaltnismaSig<br />
etwaszuruck In derPhyslkbesitztergute<br />
Kenntnisse. Sein deutscher Styl ist<br />
correct und angemessen, und zeugt<br />
theilweise von einem regen und gebildeten<br />
Gefuhle fur das Schone<br />
Arnsberg am 7*" September 1826<br />
Die angeordnete Prufungs-Commission<br />
Sauer.<br />
Hasenclever Baaden. PlaBmann<br />
2 Siege! Na Zwei<br />
Vergleicht man die beiden Zeugnisse,<br />
so stellt man test, daB sie docli selir<br />
individuell abgefaBt sind. WShrend das<br />
Zeugnis fiir Franz Anton Hundt die Lek-<br />
ture, die im Griechisch-Unterricht<br />
durchgenommen wurde, einzein aufzShlt,<br />
wird bei Bruning dieser Lehrbereich<br />
summarisch behandelt und seine<br />
Kenntnis in Geschichte und die Neigung<br />
fiir Deutsch stark betont. In der<br />
Tat hat Engelbert Bruning sein Leben<br />
lang diese Neigung gepflegt. Er wurde<br />
1907 in Enwitte geboren, studierte<br />
Bergfach und ubernahm die Leitung<br />
der Kulenberger Hutte in Wurdinghausen.<br />
Dort heiratete er Franziska<br />
Hoynck, die Erbtochter auf Gut Vasbach,<br />
welches ihre Familie vor zwei<br />
Generationen ebenfalls erheiratet hatte.<br />
Er wurde spater Amtmann In Kirchhundem<br />
und hinterlieB der Nachwelt<br />
einen sehr fruchtbaren literarischen<br />
NachlaB von z.T. groBem heimatkundlichen<br />
Wert. Das andere Zeugnis betrifft<br />
ebenfalls ihn. Es besagt zur Sache<br />
nichts, als daS er fur Quarta die Schule<br />
in Brilon besucht hat. Sein Wortlaut:<br />
Engelbert Bruning war in dem Schuljahre<br />
1822/23 SchiJIer von Quarta. Der<br />
Schuler erwarb sich durch seinen unermudlichen<br />
FleiB und sein gutes Betragen<br />
die Zufriedenheit seiner Lehrer Seine<br />
Fortschritte waren in alien Lehrgegenstanden<br />
loblich.<br />
Neue Mitglieder<br />
bzw. Abonnenten:<br />
Helmut Borgmann, Marl<br />
Alfons Stehling, Bestwig-Heringhausen<br />
Erich Jansen, Bochum<br />
Wilhelm Lingenhoff, Munster<br />
Karl Egon Gordes, Meschede<br />
Elisabeth Cramer, Arnsberg<br />
Bernhard Folle, Buren<br />
Gaby Schroder, Brilon<br />
Reinhold Baumeister, Munster<br />
Katharina Jakobi, Brilon<br />
Gunter Frink, Eslohe<br />
Monika Radant, Lennestadt<br />
Franz Feldhoff, Marsberg<br />
Dr. Dieter Schuiz, Schmallenberg<br />
Arnold M. Klein, Lennestadt<br />
Hartmut P.F. Engel, Kirchhundem-<br />
Welschen-Ennest<br />
Werner Pahlow, Dtisseldorf<br />
Pfarrer Stephan Ernst, Bad Lippspringe<br />
Gerhard Burger, Dortmund<br />
Seiches bescheinigt pflichtmaBig<br />
Brilon den 28^"" August 1823<br />
Franz Budde, Lehrer dieser Klasse.<br />
Am: (Hrn?) Kochling, Lehrer der Religion.<br />
J.C. Sahrer (?), Lehrer der Naturgeschichte,<br />
deutschen Sprache und Geographie<br />
Das war's - bis auf die Siege!: Die beiden<br />
Abgangszeugnisse von Arnsberg<br />
sind zweifach mit rotem Siegellackgesiegelt,<br />
doch auf dem Olper Zeugnis ist<br />
von der Umschrift kaum etwas zu<br />
erkennen. Auf dem Vasbacher Exemplar<br />
ist sie ebenfalls undeutlich. Den<br />
beiden Archivaren Trops (Kreisarchiv<br />
OIpe) und Vornberg (Stadt OIpe und<br />
Gemeinde Kirchhundem) gelang es<br />
gleichwohl, sie zu entziffern. Das linke<br />
(„vordere") Siegel steht fiir die Kflniglich<br />
PreuBische Regierung Arnsberg -<br />
Schulkommission, das andere ist das<br />
des Koniglich PreuBischen Gymnasium<br />
Laurentianum. Das Zeugnis aus<br />
Brilon trSgt nur ein Papiersiegel, und<br />
zwar nicht der Schule, sondern der<br />
Pfarrei. Diese hat also 1823 die ehemalige<br />
Lateinschule der Franziskaner-<br />
Minoriten in Brilon weitergefijhrt.<br />
Theo Hundt<br />
Georg Wilhelm, Meschede<br />
Gunter Haase, Finnentrop<br />
Ewald Stahlschmidt, Winterberg-<br />
GrOnebach<br />
Alma Schult, Landshut<br />
Kreisschutzenbund Brilon<br />
Missionshaus Maria Konigin, Lennestadt-Altenhundem<br />
Heinz Steinhanses, Lennestadt-Saalhausen<br />
Karl Huperz, Lennestadt<br />
Enwin Peetz, Lennestadt<br />
Paul Nagel, Lennestadt<br />
Hubert Mdnnig, Lennestadt<br />
Wilfried MiJer, Arnsberg<br />
Karl-Georg Wuschansky, Arnsberg<br />
Gerd SchSfer, Arnsberg<br />
Helmut Bauerdick, Arnsberg<br />
Wilhelm Hansknecht, Sundern<br />
Josef Jost, Sundern<br />
Edith und Udo Lang, Sundern<br />
Heiner Lenze, Sundern<br />
Friedrike Krajewski, Sundern<br />
Wilhelm Scheffer-Muhlenbauer,<br />
Sundern<br />
65<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
o<br />
Leistung<br />
und<br />
Partnerschaft<br />
Wenn Sie die Dresdner Bank heute im Kreise<br />
der ganz GroBen finden, dann gibt es dafiJr viele<br />
Grijnde. Einer davon ist, dal3 bei alien unseren<br />
Bemuhungen und Leistungen immer der Kunde<br />
im Mittelpunkt steht. GroBcomputer, Klarsichtleser,<br />
elektronische Datenijbermittiung helfen<br />
uns, die Flut der taglichen Geschafte schnell<br />
und zuverlassig abzuwickein und unsere Kunden<br />
so zu betreuen,wie sie es von uns erwarten<br />
konnen. Denn erst dieTechnik einer groBen<br />
Bank gibt uns die Zeit fur eine personliche, auf<br />
die individuellen Probleme des einzelnen Kunden<br />
zugeschnittene Beratung. Daraus entstand die<br />
vertrauensvoile Partnerschaft, die uns mit Kunden<br />
und Geschaftsfreunden in aller Welt verbindet.<br />
Dresdner Bank<br />
Mit dem griinen Band der Sympathie<br />
66<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Unveranderter<br />
Nachdruck:<br />
Statistik Kreis OIpe vor<br />
100 Jahren, ein Schatz<br />
Diese Reprint-Ausgabe einer hfichst<br />
interessanten, just 111 Jahre alten Statistik<br />
des Kreises OIpe bringt uns iJberraschend<br />
viel Neues, viel Bemerkenswertes.<br />
Sie erweitert den Blick „im<br />
Nachhinein" und aufschluBreich in<br />
Spartan der Landeskunde und Nest<br />
StaJi|lih<br />
^retfes ^Ipe.<br />
Titelblatt der alten Ausgabe 1875<br />
sich mit seinen 338 Seiten so gut, daB<br />
der an der Beschreibung der Gegebenheiten<br />
vor 100 Jahren interessierte<br />
Leser uberrascht aufmerkt. Auch er<br />
wird „verbindlichst danken" wie es<br />
weiland so lobend die wohllfibliche<br />
konigliche Regierung tat und „die bis<br />
zum Jahre 1873 reichende Kreisbeschreibung<br />
als eine sehr fleiBige<br />
Arbeit" bezeichnen.<br />
Es ist, wie im Vorwort treffend herausgestellt,<br />
„fur den Landeskundler und<br />
Heimatforscher eine unentbehrliche<br />
Darstellung der Verhaltnisse".<br />
Man muB auch heute noch dem in<br />
Arnsberg geborenen Friedrich Arndts,<br />
kurkolnischer Geheimer und Oberappellationsgerichtsrat,<br />
belpflichten,<br />
wenn er schon 1802 sagte, daB es nur<br />
wenige LSnder gabe, die so arm an statistischen<br />
Darstellungen sei, wie gerade<br />
das alte kurkolnische Herzogtum<br />
Westfalen, das doch den spSteren<br />
neuen preuBischen Regierungsbezirken<br />
Munster, Minden und Arnsberg<br />
seinen stolzen, klangvollen Namen<br />
„Provinz Westfalen" verlieh.<br />
Der ubersichtlich geordnete Inhalt gibt<br />
Auskunft u.a. uber Bevfllkerung, alte<br />
Ortsbezeichnungen In den Amtern<br />
(Stadten) Attendorn, Bilstein, Drolshagen,<br />
KIrchhundem, OIpe, Wenden -<br />
berichtet vom Auswanderungsfieber,<br />
den Motiven zur Auswanderung in den<br />
1830iger Jahren, - iJber Gesundheitsverhaltnisse,<br />
wonach Einwohner oft<br />
schon mit 50 oder 60 Jahren greisenhaft<br />
alt aussahen, - daB damals ihre<br />
HSuser im Sauerland noch vielfach mit<br />
Ziegelsteinfachwerk oder in anderer<br />
leichter Bauart errichtet waren. Alles<br />
Dinge, uber die man heute den Kopf<br />
schuttelt. Zum Thema Ackerbau, Viehzucht<br />
findet man die alten MaBe und<br />
MeBbegriffe, und fremdartig liest sich<br />
heute der Begriff „Siegerlander Race"<br />
(Rasse). Pferdemarkte, Viehmarkte,<br />
Forstschutz, Bergbau- und Huttenwesen,<br />
Fabriken samt alien Produkten<br />
und Produktionen mit dem dazugehflrigen<br />
Handel bzw. Verkehr zu Wasser<br />
und zu Lande, sind hier nur ein kleiner<br />
Tell der schier unerschopflichen Ausfuhrungen.<br />
Von der Schilderung des Armenwesens<br />
und derWohlfahrtspflege in Stadt<br />
und Land gehen die sachlichen, dennoch<br />
fur uns jetzt lustig zu lesenden<br />
Berichte uber zum Polizeiwesen, zu<br />
Kirchen- und Unterrichtsangelegenheiten<br />
und zu Verhaltnissen von Justiz<br />
und Militar,wobei auch die Versorgung<br />
von Veteranen der Freiheitskriege<br />
nicht unerwahnt ist.<br />
Bel den Darstellungen uber Verfassung<br />
und Venwaltung von Ortschaften<br />
sind immer wieder geschichtliche Daten<br />
und Anmerkungen eingestreut.<br />
Besonders wissenswert sind die<br />
Neuerungen zur FiJhrung der Civllstands-Register<br />
ab 1.10.1874, wonach<br />
z.B.diePfarramterfurdieRegistrierung<br />
von Geburten, Heiraten, SterbefSllen<br />
gesetzlich nicht mehr zustandig waren,<br />
sondern solche Beurkundungen<br />
nur noch „besonders angestellten<br />
weltlichen Beamten in Standesamtsbezirken"<br />
vorbehalten blieben. Damals<br />
wurden ubrigens die Zweitschriften<br />
der KirchenbiJcher<br />
eingezogen.<br />
Zum<br />
Gluck werden<br />
diese aber<br />
heute noch<br />
im Personen-<br />
stands-Archiv<br />
Detmold<br />
(vielfach von<br />
1779 bis 1874)<br />
aufgehoben.<br />
Auch uber<br />
Juden und<br />
Dissidenten<br />
kann dort vielfach Auskunft erteilt wer-<br />
den.<br />
Zur Geschichte des Kulturkampfes<br />
wird Langstvergessenes wieder in Erinnerung<br />
gebracht, wie z.B. die „Sistirung"<br />
(Einstellung) der Weiterzahlung<br />
von „pers6nlichen Zulagen" fur die<br />
Pfarrer von Rhode, Kleusheim, Rbmershagen,<br />
Meggen u.a. sowie auch<br />
die „Amtsenthebung" von Geistlichen<br />
an Schulen Oder gar die „L6sung amtlicher<br />
Beziehungen zum Olper Kreis-<br />
blatt".<br />
Welcher Kreis bei uns hat schon solchen<br />
Reichtum an Darstellungen aufzuweisen,<br />
wie er hier im Reprintdruck<br />
„Statistik des Kreises OIpe, Koln 1875,<br />
bei M. Du Mont-Schauberg" zu finden<br />
ist?<br />
Der Kreis OIpe um 1873 - Unveranderter<br />
Nachdruck der Statistik des Kreises<br />
OIpe, Koln 1875, mit einem Vonwort<br />
zur Neuveroffentlichung von Oberkreisdirektor<br />
Dr. Joachim Grunewald<br />
und Kreisheimatpfleger Gunther Bekker,<br />
OIpe 1983; Herausgeber: Der<br />
Oberkreisdirektor des Kreises OIpe.<br />
13,— DM Klemens Propper<br />
Wandern im Sauerland,<br />
Radwandern am Hellweg<br />
In der bekannten Reihe der Kompass -<br />
WanderfuhrerlegtWilfried Schmidt ein<br />
BSndchen „Sauerland-H6henring"<br />
vor, der von Arnsberg ausgehend in einem<br />
weiten Bogen, das Siegerland<br />
kurz streifend, uber die Hohen des<br />
Sauerlandes nach Arnsberg zuruckfuhrt.<br />
Jede Wanderung auf dem 1-16-<br />
henring, der mit 18 Wandertagen veranschlagt<br />
ist und zahlreiche Variationen<br />
zulSBt, ist durch eine Beschreibung<br />
und eine kartographische Wegeskizze,<br />
in der der Streckenverlauf<br />
grun eingezeichnet ist, beschrieben.<br />
Esfehlen nicht die notwendigen und in<br />
Fao vergnogte Taone - Bad Waldleisbem int Grone!<br />
Kur + Einkehr = Bad Waldliesbom<br />
67<br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
jedem guten Wanderfuhrer heute ublichen<br />
Hinweise zu Verkehrs- und Parkm6glichkeiten,<br />
Wegmarkierungen,<br />
Toureniange, Wanderzeit, Steigungen<br />
usw.<br />
Fijr denjenigen, der das Radwandem<br />
vorzieht Oder es - zweckmaBigerweise<br />
- da ausprobieren will, wo es noch<br />
nicht allzu bergig 1st, schrleb Antje<br />
Moller das Buchlein „Radwandern am<br />
Hellweg". Rund 50 Touren sind ausfuhrllch<br />
beschrieben; jedoch fehlen<br />
leider die Karten Oder zumindest eine<br />
Ubersicht uber das zu entdeckende<br />
Gebiet. Dagegen fallen die Hinweise<br />
auf besondere Naturschfinheiten und<br />
die kulturhistorischen Bemerkungen<br />
bei den einzelnen Routen angenelnm<br />
auf.<br />
Kompass - Wanderfuhrer „Sauerland-HOhenring".<br />
Ausgewahit, begangen und beschrieben<br />
von Wilfried Schmidt unter Mitarbeit von Erika<br />
Leimbach. Deutscher Wanderverlag, Stuttgart.<br />
150 S., DM16,80.<br />
Antje Mbller: Radwandern am Hellweg. Von Soest<br />
durch die BOrde, ins Mflhne- und Lippetal. Westtaiische<br />
Verlagsbuchhandlung Mocker & Jahn.<br />
Soest. 87 8., DM 16,80.<br />
PERSONALIEN<br />
Feuenwehr-Ehrenzeichen der Sonderstufe<br />
in SilberfurBernhard Griinebohmer<br />
Bereits 27 Jahre wirkt Bernlnard Grijnebflhmer<br />
aus Lenhausen als Fuhrungskraft<br />
in der Feuenwehr. Innenminister<br />
Dr. Schnoor verlieh detn<br />
Kreisbrandmeister des Krelses OIpe<br />
fur seine Verdienste urn den Feuerschutz<br />
das Feuera/ehr-Ehrenzeichen<br />
der Sonderstufe in Silber. Oberkreisdirektor<br />
Dr. Joachim Grunewald ijberreichte<br />
die Auszeichnung im AnschluB<br />
an eine Sitzung der Stadt- und Gemeindebrandmeister.<br />
1946tratBernhardGrunebohmerindie<br />
Frelwillige Feuerwehr Lenhausen ein.<br />
von 1956 bis 1971 war er Brandmeister<br />
der Loschgruppe Lenhausen und zugleich<br />
stellv. Amtsbrandmeister des<br />
Amtes Serkenrode bzw. nach der kommunalen<br />
Neugliederung stellv. Gemeindebrandmeister<br />
der Gemeinde<br />
Finnentrop, deren Wehrfuhrer er 1971<br />
wurde. Seit dem 1. Juli 1976 bekleidet<br />
er das Amt des Kreisbrandmeisters.<br />
In seiner Amtszeit als Kreisbrandmeister<br />
hat sich Bernhard GrunebOhmer<br />
stets urn enge Zusammenarbeit der<br />
sieben Wehren im Kreis OIpe bemuht.<br />
Sein besonderes Augenmerk gait der<br />
Ausbildung der MSnner im blauen<br />
Rock, vor allem in den Bereichen Funk,<br />
Atemschutz und Strahlenschutz. Eingesetzt<br />
hat er sich auch fur die gute<br />
Ausrustung der heimischen Wehren.<br />
MaBgeblich mitgewirkt hat er an der<br />
Alarm- und Ausruckeordnung.<br />
Fur seine zahlreichen Verdienste wurde<br />
Bernhard GrunebOhmer bereits<br />
mehrfach ausgezeichnet. 1971 verlieh<br />
ihm der Innenminister das Feuerwehr-<br />
Ehrenzeichen in Silber. Der Feuerwehrverband<br />
wurdigt sein Engagement<br />
um den Kampf gegen den roten<br />
Hahn und seinen Einsatz fur die Allgemeinheit<br />
mit der Verlelhung des Deutschen<br />
Feuera/ehr-Ehrenzeichens in<br />
Silber (1974) und in Gold (1980). Co<br />
CLDBUS^<br />
SB WARENH AUSER 28x.mWesten<br />
IM SAUERLAND IN:<br />
BRILON<br />
FINNENTROP<br />
LUDENSCHEID<br />
MESCHEDE<br />
MEINERZHACEN<br />
OLPE<br />
PLETTENBERG<br />
darum immer wieder zu CLOBUS.....<br />
• MAN SPURT, WAS MAN SPART!<br />
68<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Franz-Josef Gante, in Attendorn geboren<br />
und aufgewachsen, wurde vom<br />
Bundesminister der Verteidigung die<br />
hochste Auszelchnung verliehen, die<br />
die Bundeswehr zu vergeben hat: das<br />
Ehrenkreuz in Gold. Der Hauptmann,<br />
beim Fernmeldebatailion 840 in Essen<br />
fur die Versorgung zustandig, erhielt<br />
die Auszeichnung fur beispielhafte<br />
Erfullung der Soldatenpflicht.<br />
*<br />
Der Bundesoberst des Sauerlander<br />
Schutzenbundes, Wilhelm Haake,<br />
wurde in Maaseik (Belgien) in den<br />
„Souveranen Ritterorden des hi. Sebastianus"aufgenommen.DerOrdendes<br />
hi. Sebastianus geht auf Karl den<br />
GroBen zuruck und wird im Jahre 825<br />
erstmals als Ritterorden enwahnt. Wilhelm<br />
Haake wurde die Ehrung fur seine<br />
Verdienste um das Schutzenwesen<br />
zuteil. Dem Prasidium der Europaischen<br />
Schutzenbruderschaften gehort<br />
er seit funf Jahren an.<br />
*<br />
Brilons Ehrenburger und Altpropst<br />
Anton DiJnnebacke und Oberkreisdirektor<br />
Dr. Adalbert Mullmann erhlelten<br />
in der Generalversammlung der<br />
SGV-Abteilung Brilon die silberne<br />
Ehrennadel des Sauerlandischen Gebirgsvereins.<br />
In der Benediktinerabtei Konigsmunster<br />
in Meschede feierte am Sonntag,<br />
13. Mai, Altabt Harduin BieBle die 60.<br />
Wiederkehr des Tages seiner ersten<br />
ProfeB. Der im Jahre 1902 geborene<br />
Oberbayer kam nach seiner Priesterweihe<br />
im Jahre 1929 nach Meschede<br />
und hat hier WurzeIn geschlagen, zunSchst<br />
als Lehrer, dann als Direktor in<br />
der H6heren Schule der Benediktiner,<br />
schlieBlich rund 20 Jahre lang als<br />
erster Abt, der er bis 1976 war.<br />
¥•<br />
Der Bischof von Essen, Dr. Franz<br />
Hengsbach, hat dem Vorsitzenden des<br />
Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>es, Oberkreisdirektor<br />
Dr. Adalbert Mullmann,<br />
brieflich fur das <strong>Heft</strong> 1/1984 von<br />
SAUERLAND gedankt, insbesondere<br />
fur den Artikel „Die Zukunft unserer<br />
sauerlandischen D6rfer". Er wunscht<br />
dem Sauerland, daB es ihm in seinen<br />
Stadten und DSrfern gelinge, sein historisches<br />
Gesicht und seine unverwechselbare<br />
Kultur zu erhalten.<br />
In Anerkennung seiner besonderen Verdienste<br />
um Voll< und Staat liat Bundesprasident<br />
Karl Carstens den CDU-Bundestagsabgeordneten<br />
Wllli Weisklrch<br />
mit dem GroBen Verdlenstkreuz des<br />
Verdienstordens der Bundesrepublik<br />
Deutschland ausgezeichnet. Bundestagsprasident<br />
Dr Rainer Barzel uberreichte<br />
dem Abgeordneten des Wahlkrelses<br />
Olpe-Siegen II die hohe Auszeichnung.<br />
ZINNGESCHIRR<br />
Schott Zinn GmbH • Horlecke 5<br />
5750 Menden • Tel. 02373/1328<br />
69<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Die gro3en Marken<br />
fur Ihren taglichen Bedarf<br />
< Sammy ><br />
Tissue-Toilettenpapier<br />
SnMn^y^^a^<br />
WSmmmmmm<br />
Krepp-Toilettenpapier<br />
Handtuchpapier<br />
"^ h 3il^.<br />
Kuchentucher<br />
j^^^^^^^f<br />
< Sammy ><br />
WEDOi Papierfabril
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
Eine gute ,Adresse"<br />
Wenn's urn vorteilhafte Geldanlagen<br />
Oder<br />
zinsgiinstige Finanzierungen geht,<br />
sind wir Ihre zuverlassigen Partner.<br />
Ihre Geldberater<br />
Die Sparkassen des Sauerlandes<br />
Sparkasse Arnsberg-Sundern • Sparkasse Attendorn • Sparkasse Balve-Neuenrade • Sparkasse Bestwig • Sparkasse<br />
Hochsauerland • Sparkasse Finnentrop • Sparkasse Lennestadt-Kirchhundem • Sparkasse Meschede • Stadtsparkasse<br />
Marsberg • Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden • Stadtsparkasse Schmallenberg.<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>
Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />
SAUERLAND<br />
DA SCHMECKTMAN DIE<br />
FRISCHE DER NATUR.<br />
KROMBACHER PILS.<br />
MIT FELSQUELLWASSER GEBRAUT.<br />
In der wald- und quellreichen Region<br />
am FuBe des Rothaargebirges liegt<br />
die Krombacher Privatbrauerei.<br />
Hier gewinnen wir aus tiefem Felsgestein unser<br />
Brauwasser, das sich fiir ein Spitzenbier<br />
Pilsener Brauart besonders gut eignet.<br />
KROMBACHER PRIVATBRAUEREI<br />
SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />
© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>