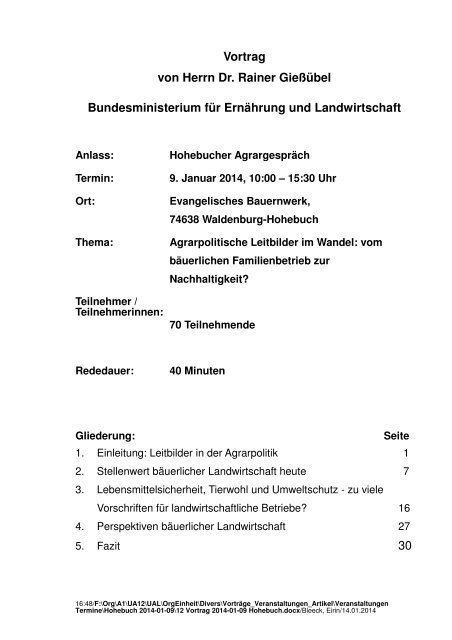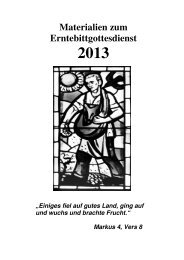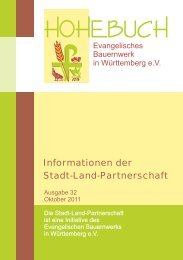Präsentation Dr. Rainer Gießübel - Evangelisches Bauernwerk in ...
Präsentation Dr. Rainer Gießübel - Evangelisches Bauernwerk in ...
Präsentation Dr. Rainer Gießübel - Evangelisches Bauernwerk in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vortrag<br />
von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Ra<strong>in</strong>er</strong> <strong>Gießübel</strong><br />
Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung und Landwirtschaft<br />
Anlass:<br />
Term<strong>in</strong>:<br />
Ort:<br />
Thema:<br />
Teilnehmer /<br />
Teilnehmer<strong>in</strong>nen:<br />
Hohebucher Agrargespräch<br />
9. Januar 2014, 10:00 – 15:30 Uhr<br />
<strong>Evangelisches</strong> <strong>Bauernwerk</strong>,<br />
74638 Waldenburg-Hohebuch<br />
Agrarpolitische Leitbilder im Wandel: vom<br />
bäuerlichen Familienbetrieb zur<br />
Nachhaltigkeit?<br />
70 Teilnehmende<br />
Rededauer:<br />
40 M<strong>in</strong>uten<br />
Gliederung:<br />
Seite<br />
1. E<strong>in</strong>leitung: Leitbilder <strong>in</strong> der Agrarpolitik 1<br />
2. Stellenwert bäuerlicher Landwirtschaft heute 7<br />
3. Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Umweltschutz - zu viele<br />
Vorschriften für landwirtschaftliche Betriebe? 16<br />
4. Perspektiven bäuerlicher Landwirtschaft 27<br />
5. Fazit 30<br />
16:48/F:\Org\A1\UA12\UAL\OrgE<strong>in</strong>heit\Divers\Vorträge_Veranstaltungen_Artikel\Veranstaltungen<br />
Term<strong>in</strong>e\Hohebuch 2014-01-09\12 Vortrag 2014-01-09 Hohebuch.docx/Bleeck, Eir<strong>in</strong>/14.01.2014
Es gilt das gesprochene Wort!<br />
Anrede!<br />
<strong>Dr</strong>. Dirscherl,<br />
Herr Voß (MdL SH, Bundesvorsitzender AbL)<br />
Präsident Tschimpke (NABU)<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Spiller (Institut für Agrarökonomie und rurale Entwicklung<br />
der Universität Gött<strong>in</strong>gen)<br />
1. E<strong>in</strong>leitung: Leitbilder <strong>in</strong> der Agrarpolitik<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren,<br />
als ich me<strong>in</strong>e berufliche Laufbahn im Bundesm<strong>in</strong>isterium für<br />
Landwirtschaft und Forsten 1989 begann, war der bäuerliche<br />
Familienbetrieb unbestritten das Leitbild der Agrarpolitik <strong>in</strong> der<br />
Bundesrepublik Deutschland.<br />
1989 waren <strong>in</strong> der alten Bundesrepublik von den rund 650<br />
Tausend Betrieben rund 47 % kle<strong>in</strong>er als 10ha, rund 46 % größer<br />
10ha bis 50ha und nur rund 7 % bewirtschafteten 50ha und mehr. 1<br />
1 Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1990, S. 31.<br />
16:48/F:\Org\A1\UA12\UAL\OrgE<strong>in</strong>heit\Divers\Vorträge_Veranstaltungen_Artikel\Veranstaltungen<br />
Term<strong>in</strong>e\Hohebuch 2014-01-09\12 Vortrag 2014-01-09 Hohebuch.docx/Bleeck, Eir<strong>in</strong>/14.01.2014<br />
. . .
- 2 -<br />
Bundesm<strong>in</strong>ister Kiechle und die Bundesregierung unter Kanzler<br />
Helmut Kohl standen nach 1983 geradezu für kle<strong>in</strong>e und mittlere<br />
landwirtschaftliche Betriebe, die von Familien mit allenfalls<br />
wenigen familienfremden Beschäftigten bewirtschaftet wurden: „…<br />
wir wollen vor allem den bäuerlichen Familienbetrieb erhalten“ 2 , so<br />
im Agrarpolitischen Programm der CDU von 1983.<br />
Ganz oben stand das Ziel, die E<strong>in</strong>kommen der bäuerlichen<br />
Familien zu sichern.<br />
Die Ausrichtung der Agrarpolitik an marktwirtschaftlichen<br />
Pr<strong>in</strong>zipien oder Wettbewerbsfähigkeit waren damals <strong>in</strong> der<br />
praktischen Agrarpolitik noch ke<strong>in</strong> großes Thema. Daran änderten<br />
auch die teilweise heftigen Kontroversen mit der<br />
„wissenschaftlichen Agrarpolitik“ wenig.<br />
Auch die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft wurde seit den<br />
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts sehr kontrovers<br />
diskutiert, vor allem <strong>in</strong> der Wissenschaft und bei den Kritikern der<br />
landwirtschaftlichen Praxis.<br />
Es fand auch <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensive Diskussion über die<br />
Umweltauswirkungen der Landwirtschaft statt, <strong>in</strong>sbesondere des<br />
Pflanzenschutzes und der Düngung.<br />
2 Ulrich Kluge (1989): Vierzig Jahre Agrarpolitik <strong>in</strong> der Bundesrepublik Deutschland Band 2, S. 286).<br />
. . .
- 3 -<br />
Das neue Pflanzenschutzgesetz trat 1987 <strong>in</strong> Kraft, 25 Jahre nach<br />
dem Ersche<strong>in</strong>en des legendären Buches „Der stumme Frühl<strong>in</strong>g“<br />
von Rachel Carson. Es sollte durch verschärfte Anforderungen<br />
e<strong>in</strong>en besseren Schutz des Naturhaushaltes und des Menschen<br />
gewährleisten. Dies sollte durch bessere Zulassung,<br />
Kennzeichnung und Anwendung von PSM – den<br />
Sachkundenachweis – sowie höhere Anforderungen an<br />
Pflanzenschutzgeräte erreicht werden.<br />
Ebenfalls 1987 wurden von Ländern und Bund Grundsätze der<br />
ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung verabschiedet.<br />
Auch der Begriff der "Guten fachlichen Praxis" stammt aus den<br />
Vorschriften des Pflanzenschutz- und des Düngemittelrechts, wo<br />
er bereits <strong>in</strong> den 1980ern Verwendung fand.<br />
Die erste Düngeverordnung trat 1996 <strong>in</strong> Kraft und setzte die EU-<br />
Nitratrichtl<strong>in</strong>ie von 1991 um.<br />
Gute fachliche Praxis wurde und wird bis heute häufig mit<br />
bäuerlicher Landwirtschaft gleichgesetzt. E<strong>in</strong>e genaue<br />
Beschreibung dessen, was bäuerliche Landwirtschaft ist, bleibt<br />
jedoch schwierig.<br />
. . .
- 4 -<br />
Seit den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die<br />
Agrarpolitik dann über mehrere Reformschritte<br />
marktwirtschaftlicher ausgerichtet. Ohne die Stufen der Reformen<br />
beg<strong>in</strong>nend 1988 im E<strong>in</strong>zelnen zu schildern, g<strong>in</strong>g mit den Reformen<br />
auch e<strong>in</strong>e Änderung des Leitbildes e<strong>in</strong>her. Wettbewerbsfähigkeit<br />
und Unternehmereigenschaft der Landwirte traten mehr <strong>in</strong> den<br />
Vordergrund.<br />
In Deutschland g<strong>in</strong>g e<strong>in</strong> zusätzlicher großer Impuls von der<br />
Wiedervere<strong>in</strong>igung aus, der das agrarpolitische Leitbild<br />
fundamental veränderte.<br />
1993 griff der damalige Bundesm<strong>in</strong>ister Borchert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em<br />
Grundsatzpapier „Der künftige Weg“ diese Veränderungen auf. 3<br />
Zentrales Ziel war nun „e<strong>in</strong>e leistungs- und wettbewerbsfähige,<br />
marktorientierte und umweltverträgliche Landwirtschaft“ und zwar<br />
unabhängig von Betriebs- und Unternehmensform sowie der<br />
Betriebsgröße. Zu den weiterh<strong>in</strong> maßgebenden Pr<strong>in</strong>zipien<br />
bäuerlichen Wirtschaftens gehörten „e<strong>in</strong>e umweltverträgliche, auf<br />
Nachhaltigkeit ausgerichtete kostengünstige Wirtschaftsweise, die<br />
Bodenb<strong>in</strong>dung der Tierhaltung sowie e<strong>in</strong> verantwortlicher Umgang<br />
mit den landwirtschaftlichen Nutztieren.“<br />
3 BMELF (1993): Der zukünftige Weg. Agrarstandort Deutschland sichern. Agrarpolitische Mitteilungen 4/93.<br />
. . .
- 5 -<br />
Unternehmertum, Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und auch das<br />
„Tierwohl“ sollen seither zentral für die Beurteilung agrarpolitischer<br />
Maßnahmen se<strong>in</strong>.<br />
Auch der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die<br />
18. Legislaturperiode steht <strong>in</strong> dieser Denkrichtung. Dort ist zu<br />
lesen:<br />
„Unser Ziel ist e<strong>in</strong>e multifunktional ausgerichtete, bäuerlich<br />
unternehmerische Landwirtschaft, die ressourcen- und<br />
umweltschonend produziert, die Tierwohl, Nachhaltigkeit und<br />
Wettbewerbsfähigkeit mite<strong>in</strong>ander verb<strong>in</strong>det. Leitbild ist e<strong>in</strong>e von<br />
Familien betriebene, regional verankerte, flächendeckende<br />
Landwirtschaft unterschiedlicher Strukturen und<br />
Produktionsweisen. Sie trägt zur Wertschöpfung, gut bezahlter<br />
Arbeit und sicheren E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> den ländlichen Räumen bei.“ 4<br />
Dieses Leitbild korrespondiert mit dem „Leitbild der nachhaltigen<br />
Landbewirtschaftung“ des Nachhaltigkeitsrates, wie es dieser 2012<br />
formuliert hat. 5<br />
Das Fragezeichen im Titel me<strong>in</strong>es Vortrages kann ich demnach<br />
streichen.<br />
4<br />
5<br />
Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 18. Legislaturperiode, S. 121.<br />
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/fileadm<strong>in</strong>/user_upload/dokumente/pdf/Landwirtschaft_Leitbild.pdf<br />
. . .
- 6 -<br />
Es stimmt, das agrarpolitische Leitbild hat sich vom bäuerlichen<br />
Familienbetrieb weg zum nachhaltigen unternehmerisch geführten<br />
Betrieb entwickelt.<br />
Geblieben ist das Leitbild bäuerlicher Wirtschaftsweise, das nach<br />
wie vor mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt wird.<br />
Auch wird bäuerlicher Landwirtschaft die Fähigkeit zugeschrieben,<br />
sich gut an Änderungen anzupassen, sie aufzunehmen und sich<br />
aktiv damit ause<strong>in</strong>ander zu setzen, um so neue Möglichkeiten zu<br />
eröffnen (Resilienz). Hiervon jedoch später.<br />
. . .
- 7 -<br />
2. Stellenwert bäuerlicher Landwirtschaft heute<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
bäuerliches Wirtschaften bleibt also e<strong>in</strong>e Konstante <strong>in</strong> der<br />
agrarpolitischen Diskussion.<br />
Dennoch gibt es ke<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong> anerkannte Def<strong>in</strong>ition bäuerlicher<br />
Landwirtschaft.<br />
Auch das AGRARBÜNDNIS hat 2001 festgestellt: „Bäuerliche<br />
Landwirtschaft“ ist e<strong>in</strong> lebensweltlicher Begriff. Es ist unmöglich<br />
und es ist auch nicht s<strong>in</strong>nvoll, e<strong>in</strong> exaktes Bild zu entwickeln, wie<br />
e<strong>in</strong> bäuerlicher Leitbildbetrieb auszusehen hat und daraus die<br />
notwendigen agrarpolitischen Maßnahmen abzuleiten. Bäuerliche<br />
Landwirtschaft ist nur <strong>in</strong> ihrem Kern zu def<strong>in</strong>ieren, nicht vom Rand<br />
her, an ihren Übergängen zu anderen Wirtschaftsformen.“<br />
Der NEULAND e.V. äußert sich ähnlicher Weise: „Mit dem Begriff<br />
bäuerliche Landwirtschaft wird e<strong>in</strong>e Arbeitsverfassung,<br />
Wirtschaftsweise und Lebensweise beschrieben, die <strong>in</strong> der Regel<br />
auf der Betriebsleiterfamilie und deren Mitarbeitern beruht.“<br />
Woran liegt es, dass bäuerliche Landwirtschaft augensche<strong>in</strong>lich<br />
schwer greifbar ist?<br />
. . .
- 8 -<br />
Die deutsche Landwirtschaft ist heute weit überwiegend Teil der<br />
arbeitsteiligen, <strong>in</strong>ternational verflochtenen Wirtschaft und steht im<br />
Wettbewerb. Sie ist meist spezialisiert und teilweise stark räumlich<br />
konzentriert, <strong>in</strong>sbesondere die Tierhaltung.<br />
Der Übergang von der vor<strong>in</strong>dustriellen, überwiegend<br />
kle<strong>in</strong>bäuerlichen Landwirtschaft zur arbeitsteiligen, <strong>in</strong>dustrielle<br />
Verfahren nutzenden Landwirtschaft ist die Voraussetzung<br />
gewesen, die Industriegesellschaften mit ausreichend und<br />
preiswerten Lebensmitteln und aktuell auch mit Bioenergie zu<br />
versorgen.<br />
Die technologische und kommerzielle Entwicklung erzeugt auch<br />
<strong>Dr</strong>uck, gerade auf kle<strong>in</strong>e landwirtschaftliche Betriebe.<br />
Wenn wir uns vor Augen führen, dass 1950 e<strong>in</strong> Landwirt 10<br />
Menschen ernährt hat und es heute rund 160 Menschen s<strong>in</strong>d.<br />
Ohne E<strong>in</strong>fuhr von Futter aus dem Ausland s<strong>in</strong>d es immer noch 140<br />
Menschen, dann zeigt dies welchen Weg die Landwirtschaft <strong>in</strong><br />
Deutschland zurückgelegt hat.<br />
Das Europäische Parlament spricht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Berichtsentwurf vom<br />
Oktober 2013 über die Zukunft kle<strong>in</strong>er landwirtschaftlicher Betriebe<br />
von e<strong>in</strong>er „Disagrarisation“. 6<br />
Der Berichterstatter Czeslaw Adam Siekierski me<strong>in</strong>t damit genau<br />
das, was wir <strong>in</strong> Deutschland den „Strukturwandel“ nennen:<br />
6 EP 2013/2096(INI) vom 14.10.2013<br />
. . .
- 9 -<br />
Kle<strong>in</strong>e Tierhaltungen, der Anbau bestimmter gebietseigener<br />
Produkte und die landwirtschaftliche Tätigkeit <strong>in</strong> vielen Dörfern<br />
werden aufgegeben.<br />
Derzeit liegt die Wachstumsschwelle, also die Hektarzahl oberhalb<br />
derer sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe erhöht, <strong>in</strong><br />
Deutschland bei 100 ha.<br />
Der jährliche Verlust an Agrarbetrieben betrug 2,2 %, das ist<br />
weniger als die Abnahmerate von durchschnittlich 3,0 % <strong>in</strong> den<br />
Jahrzehnten zuvor.<br />
Der Strukturwandel im Agrarbereich ist noch voll im Gang, hat sich<br />
<strong>in</strong> den vergangenen Jahren aber verlangsamt.<br />
Auch die bäuerlichen Betriebe haben sich verändert und<br />
verändern sich weiter:<br />
• Nach unserer „landläufigen“ Vorstellung ist im bäuerlichen<br />
Betrieb e<strong>in</strong>e enge Verb<strong>in</strong>dung zwischen Betrieb und Haushalt,<br />
<strong>in</strong> Familienbetrieben auch zur Familie vorhanden.<br />
Außerhalb der Landwirtschaft trifft dies <strong>in</strong>sbesondere auch für<br />
kle<strong>in</strong>e Dienstleistungsbetriebe wie das Handwerk zu.<br />
• Die Entscheidungen im Betrieb und die Erledigung der Arbeit<br />
liegen <strong>in</strong> den Händen e<strong>in</strong>er oder e<strong>in</strong>iger weniger Personen.<br />
• Die Arbeit kann von den Familienmitgliedern und von wenigen<br />
Lohnarbeitskräften erledigt werden.<br />
. . .
- 10 -<br />
• Weitere Merkmale bäuerlicher Betriebe s<strong>in</strong>d die Bedeutung des<br />
Eigentums, ihre Ausrichtung auf Nachhaltigkeit<br />
(Generationenverpflichtung) und Stabilität vor kurzfristigem<br />
Gew<strong>in</strong>nstreben.<br />
• Die Tierhaltung erfolgt bodengebunden; das Futter für die<br />
gehaltenen Tiere wird überwiegend selbst angebaut, der Dung<br />
für den eigenen Anbau verwendet.<br />
Dagegen s<strong>in</strong>d ger<strong>in</strong>ge Arbeitsteilung, Handarbeit und<br />
Betriebsgröße heute kaum noch Kennzeichen für bäuerliche<br />
Betriebe.<br />
Industrietypische Produktionsweisen haben seit langem, verstärkt<br />
nach 1950, E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> die gesamte Landwirtschaft gefunden, auch<br />
<strong>in</strong> die ökologische Landwirtschaft.<br />
Wegen des E<strong>in</strong>satzes von Zukauffutter und der Verwendung<br />
technischer E<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d heute landwirtschaftliche Betriebe<br />
weit überwiegend spezialisiert und kapital<strong>in</strong>tensiv, e<strong>in</strong> typisches<br />
Kennzeichen <strong>in</strong>dustrieller Betriebe.<br />
Auch der Boden ist längst nicht mehr überwiegend Eigentum,<br />
sondern <strong>in</strong> Deutschland zu 60 % gepachtet. 7<br />
Die überwiegende Mehrheit der Landwirt<strong>in</strong>nen und Landwirte setzt<br />
heute auf Modernisierung und auf Wachstum. Modernisierung hat<br />
selbst Leitbildcharakter.<br />
Landwirtschaftliche Unternehmer<strong>in</strong>nen und Unternehmer<br />
7 Statistisches Bundesamt 2011: Landwirtschaft auf e<strong>in</strong>en Blick. Ergebnisse aus der Landwirtschaftszählung 2010.<br />
. . .
- 11 -<br />
entwickeln ihr Angebot angesichts abnehmender Marktsteuerung<br />
und –regulierung zunehmend entsprechend der Nachfrage. Das<br />
Unternehmerische ist daher e<strong>in</strong>e wesentliche Triebfeder auch für<br />
das Handeln der Landwirt<strong>in</strong>nen und Landwirte geworden. Kritiker<br />
sprechen auch von Industrialisierung der Landwirtschaft.<br />
In der Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaften des Landbaus im Oktober 2013 war e<strong>in</strong>e<br />
Veranstaltung mit „neue Geschäftsmodelle <strong>in</strong> der Landwirtschaft“<br />
überschrieben.<br />
Die Veranstaltung zielte zwar auf die sehr großen<br />
Agrarunternehmen, die <strong>in</strong> Osteuropa, <strong>in</strong> Late<strong>in</strong>amerika, <strong>in</strong> Afrika<br />
und vere<strong>in</strong>zelt auch <strong>in</strong> Deutschland entstanden s<strong>in</strong>d.<br />
Aber auch wenn wir auf die landwirtschaftlichen Familienbetriebe<br />
schauen, die <strong>in</strong> Deutschland 9 von 10 aller Betriebe ausmachen,<br />
f<strong>in</strong>den wir diese Geschäftsmodelle, die zum<strong>in</strong>dest teilweise gar<br />
nicht so neu s<strong>in</strong>d.<br />
Beispielhaft möchte ich nennen:<br />
• Betriebs- oder Betriebsteilgeme<strong>in</strong>schaften,<br />
• Beteiligungen an anderen Landwirtschaftsunternehmen,<br />
• Beteiligung an Energieunternehmen (W<strong>in</strong>d, Biogas),<br />
• Ausgliederung gewerblicher Betriebsteile,<br />
• Anbau auf zur Bewirtschaftung überlassenen Flächen und<br />
schließlich auch<br />
• vertikale Integration <strong>in</strong> der Lebensmittelkette oder<br />
• Agrarhold<strong>in</strong>gs.<br />
. . .
- 12 -<br />
Trotz oder wegen dieser gravierenden wirtschaftlichen und<br />
sozialen Veränderungen <strong>in</strong> der Landwirtschaft s<strong>in</strong>d strukturelle<br />
Leitbilder, wie es <strong>in</strong>sbesondere der bäuerliche Familienbetrieb bis<br />
<strong>in</strong> die 80-iger Jahre h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> war, nach wie vor bedeutsam.<br />
Dies liegt auch daran, dass bäuerlicher Landwirtschaft die<br />
Fähigkeit zugeschrieben wird, sich gut an Änderungen<br />
anzupassen, sie aufzunehmen und sich aktiv damit ause<strong>in</strong>ander<br />
zu setzen, um so neue Möglichkeiten zu eröffnen (Resilienz) 8 .<br />
Und deshalb ist es auch e<strong>in</strong> Widerspruch unserer Zeit, „dass e<strong>in</strong>e<br />
mehrheitlich städtisch-<strong>in</strong>dustrielle Gesellschaft, die alle Vorzüge<br />
e<strong>in</strong>er technisch-<strong>in</strong>dustriell gestützten Lebensweise genießt, der sie<br />
ernährenden Landwirtschaft schlechth<strong>in</strong> die Industrialisierung zum<br />
Vorwurf macht.“ 9<br />
„Bäuerliche Lebens- und Wirtschaftsformen werden durch die<br />
derzeitige Entwicklung zwar zurückgedrängt, erhalten aber<br />
gleichzeitig neue Aktualität angesichts der S<strong>in</strong>n- und Ökologiekrise<br />
der modernen Industriegesellschaft.“ 10 - oder aber auf e<strong>in</strong>e ebenso<br />
schlichte wie unpräzise Größendiskussion verkürzt wird – wie zum<br />
Beispiel „Massentierhaltung“.<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Vgl. DARNHOFER (2003) Resilienz und die Attraktivität des Biolandbaus für Landwirte, BABF Wien.<br />
HABER (2011).<br />
Vgl. REIMER (1991) Bäuerliche Landwirtschaft – überholt oder e<strong>in</strong>e Vision für die Zukunft. Bauernstimme<br />
01/92, Seite 9<br />
. . .
- 13 -<br />
Es sollte also nachvollziehbar se<strong>in</strong>, dass es angesichts der<br />
existierenden Vielfalt der Betriebs- und Unternehmensformen<br />
schwerfällt, e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong> und politisch akzeptiertes Leitbild für die<br />
Landwirtschaft abzuleiten.<br />
Dies umso mehr, als „bäuerliche Landwirtschaft“ häufig sehr stark<br />
mit Gruppen<strong>in</strong>teressen aufgeladen wird.<br />
Agrarpolitische Maßnahmen müssen e<strong>in</strong>em pragmatischen Ansatz<br />
folgend den bestehenden Problemen der Agrarerzeugung<br />
begegnen.<br />
Die im <strong>in</strong>ternationalen Wettbewerb stark auf Kostenm<strong>in</strong>imierung<br />
gerichtete Agrarproduktion und die wachsende<br />
Bioenergieerzeugung haben auch Probleme geschaffen.<br />
Problematisch s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere:<br />
• e<strong>in</strong>e zunehmende Arbeitsverdichtung und –vere<strong>in</strong>zelung<br />
(soziale und psychische Auswirkungen),<br />
• e<strong>in</strong>e fortschreitende Trennung von Futtererzeugung und<br />
Tierhaltung (Umweltprobleme),<br />
• die Tendenz zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dustriellen Fleischerzeugung<br />
(Tierwohl, Medikamentene<strong>in</strong>satz) oder<br />
• die Reduzierung der Kulturen und der Landschaftsvielfalt im<br />
Ackerbau (Biodiversität).<br />
Die Rücksichtnahme auf soziale Beziehungen auf dem Land,<br />
Natur und Umwelt, Böden und Gewässer sowie auf den Tierschutz<br />
sollten zentrale Ziele der Agrarpolitik se<strong>in</strong>.<br />
. . .
- 14 -<br />
Das heißt nicht, dass Pr<strong>in</strong>zipien bäuerlicher Wirtschaftsweise<br />
ke<strong>in</strong>e Geltung mehr haben. Im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Leitschnur auch für<br />
agrarpolitische Problemlösungen können bäuerliche Pr<strong>in</strong>zipien<br />
dennoch dienen. Diese Pr<strong>in</strong>zipien bäuerlicher Wirtschaftsweise<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
- Unternehmertum und Eigentum,<br />
- Nachhaltigkeit und Generationenverpflichtung,<br />
- Bodengebundenheit und Regionalität.<br />
So verstandene bäuerliche Landwirtschaft kann alle nachhaltigen<br />
Formen der Landwirtschaft <strong>in</strong> verschiedenen Rechtsformen und<br />
Betriebsgrößen e<strong>in</strong>schließen.<br />
An dieser Stelle möchte ich e<strong>in</strong>en Beitrag des<br />
Nachhaltigkeitsexperten SPINDLER zitieren, der <strong>in</strong> der Internet-<br />
Konsultation der Agrarsozialen Gesellschaft zum Thema „Welche<br />
Landwirtschaft wollen wir?“ im November 2013 schrieb: 11<br />
„Die zukünftigen Konfliktfelder im Agrarbereich liegen nicht so sehr<br />
zwischen bäuerlicher und <strong>in</strong>dustrieller Landwirtschaft, sondern<br />
werden von der Kontroverse um nachhaltiges Wirtschaften<br />
geprägt.“<br />
11<br />
SPINDLER (2013) ASG-Onl<strong>in</strong>e-Konsultation November 2013 zum Thema<br />
„Welche Landwirtschaft wollen wir? http://www.asg-goe.de/Onl<strong>in</strong>e-Konsultation.shtml<br />
. . .
- 15 -<br />
Und:<br />
„Auch die Landwirtschaft muss sich <strong>in</strong> Zukunft den negativen<br />
Folgen- und Nebenwirkungen ihrer Tätigkeit stellen und sich<br />
fragen lassen, welchen Beitrag sie zum Geme<strong>in</strong>wohl leistet.“ …<br />
„Dabei müssen von allen Betrieben (ob bäuerlich oder <strong>in</strong>dustriell,<br />
ob ökologisch oder konventionell wirtschaftend, ob groß oder<br />
kle<strong>in</strong>) vorrangig die landwirtschaftsspezifischen Umweltleistungen<br />
dokumentiert und kommuniziert werden.“<br />
Was ist zu dokumentieren und zu kommunizieren? Es s<strong>in</strong>d letztlich<br />
die vom Staat verordneten oder die selbst gegebenen Standards,<br />
die ihren Ursprung <strong>in</strong> den Anforderungen der Bürger<strong>in</strong>nen und<br />
Bürger, der Konsument<strong>in</strong>nen und Konsumenten haben.<br />
. . .
- 16 -<br />
3. Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Umweltschutz - zu<br />
viele Vorschriften für landwirtschaftliche Betriebe?<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren,<br />
anknüpfend an diese Gedanken wird klar, dass jede<br />
Leitbilddebatte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sozialen und politischen Umfeld<br />
stattf<strong>in</strong>det.<br />
Je nachdem, welche landwirtschaftliche Praxis mit dem e<strong>in</strong>en oder<br />
anderen Leitbild verbunden wird, löst dies auch Forderungen<br />
nach staatlichem E<strong>in</strong>greifen aus.<br />
• Konsument<strong>in</strong>nen und Konsumenten, Tierschützer, umwelt- und<br />
entwicklungspolitisch Engagierte und ihre Lobbygruppen fordern<br />
mehr gesetzliche Regelungen, um Sicherheit für Mensch, Tier<br />
und Umwelt zu erreichen.<br />
• Der Lebensmittele<strong>in</strong>zelhandel setzt eigene Standards, um<br />
Kund<strong>in</strong>nen und Kunden z.B. von der Nachhaltigkeit se<strong>in</strong>es<br />
eigenen Sortiments zu überzeugen.<br />
• Landwirte, Lebensmittelunternehmer, die Betreiber von<br />
Nachwachsenden-Rohstoff-Anlagen fordern Rechtssicherheit<br />
für ihr Handeln, auch das mit Regeln verbunden.<br />
Ökonomische, soziale, ökologische Aspekte der Entwicklung <strong>in</strong> der<br />
Landwirtschaft <strong>in</strong> den Blick nehmen und Agrarpolitik darauf<br />
ausrichten, heißt immer auch „Regulierung“.<br />
. . .
- 17 -<br />
In Frankreich wird der Begriff „Regulierung“ ganz<br />
selbstverständlich <strong>in</strong> den Mund genommen und ist fast positiv<br />
besetzt.<br />
Anders <strong>in</strong> Deutschland, wo e<strong>in</strong>e größere Skepsis gegenüber dem<br />
Handeln der Regierungen besteht, <strong>in</strong>sbesondere wenn die eigene<br />
Wirtschaftsfreiheit betroffen ist.<br />
Ökonomisch gesehen, bedeuten höhere Anforderungen zunächst<br />
höhere Kosten, die sich bei größerer Menge an Produkten besser<br />
verteilen lassen.<br />
Die wesentlichen Regelungsbereiche s<strong>in</strong>d heute<br />
Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Umweltschutz, wenn auch <strong>in</strong><br />
unterschiedlicher Intensität und Regelungstiefe.<br />
Seit 2003 s<strong>in</strong>d auch die EU-Agrarzahlungen an Verpflichtungen im<br />
Umweltschutz, bei der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, bei<br />
Tiergesundheit und im Tierschutz gebunden ("Cross-Compliance").<br />
Verbraucher<strong>in</strong>nen und Verbraucher erwarten selbstverständlich<br />
e<strong>in</strong>wandfreie und sichere Lebensmittel und zwar unabhängig<br />
davon, wer sie herstellt und wie sie hergestellt werden.<br />
Für die Landwirtschaft s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere die Vorschriften der<br />
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit bedeutsam.<br />
. . .
- 18 -<br />
Kerngedanken des <strong>in</strong> allen Mitgliedstaaten geltenden EU-<br />
Lebensmittelhygienerechts oder auch des Futtermittelrechts s<strong>in</strong>d<br />
die Stärkung der Eigenverantwortung der<br />
Lebensmittelunternehmer<strong>in</strong>nen und -unternehmer und die<br />
E<strong>in</strong>beziehung der gesamten Lebensmittelkette nach dem Motto<br />
"vom Stall bis auf den Tisch".<br />
Dabei trägt das neue EU-Lebensmittelhygienerecht, das <strong>in</strong> der EU<br />
seit 2006 anzuwenden ist, den besonderen Bed<strong>in</strong>gungen kle<strong>in</strong>er<br />
und mittlerer Betriebe angemessen Rechnung.<br />
Die Regelungen des geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Lebensmittelhygienerechts s<strong>in</strong>d so gestaltet, dass sie e<strong>in</strong> hohes<br />
Maß an Flexibilität im H<strong>in</strong>blick auf die e<strong>in</strong>zuhaltenden<br />
Hygieneanforderungen ermöglichen.<br />
Für e<strong>in</strong>e Vielzahl von E<strong>in</strong>zelfällen s<strong>in</strong>d angemessene und<br />
sachgerechte <strong>in</strong>dividuelle Lösungen <strong>in</strong> Bezug auf die Realisierung<br />
von Hygieneanforderungen des Geme<strong>in</strong>schaftsrechts zulässig.<br />
So s<strong>in</strong>d z.B. starre und detaillierte Anforderungen an die räumliche<br />
und apparative Ausstattung als Voraussetzung für die Zulassung<br />
von Schlachtbetrieben, wie sie <strong>in</strong> den früheren EG-<br />
Fleischhygienevorschriften festgelegt waren, abgeschafft worden.<br />
. . .
- 19 -<br />
Daraus ergeben sich für die Zulassungsbehörden<br />
Beurteilungsspielräume, durch die den <strong>in</strong>dividuellen<br />
Gegebenheiten des zuzulassenden Betriebs, <strong>in</strong>sbesondere bei<br />
handwerklich strukturierten Metzgereien, im jeweiligen E<strong>in</strong>zelfall<br />
durch Festlegung „maßgeschneiderter“ Anforderungen Rechnung<br />
getragen werden kann.<br />
Es kommt aber vor, dass Überwachungs- oder<br />
Zulassungsbehörden andere Vorstellungen im H<strong>in</strong>blick auf die<br />
Ausgestaltung hygienisch akzeptabler Lösungen (z.B. im H<strong>in</strong>blick<br />
auf Gebäude, Ausrüstung, oder Betriebsabläufe) als z.B. e<strong>in</strong><br />
betroffener Direktvermarkter haben.<br />
Derartige Differenzen lassen sich nur durch den konstruktiven<br />
Dialog zwischen Behörden und Unternehmen lösen.<br />
Voraussetzung für die Nutzung der erwähnten Flexibilität ist es,<br />
dass die für den Vollzug der Rechtsvorschriften zuständigen<br />
Behörden die Beurteilungsspielräume des geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Hygienerechts nutzen.<br />
Um dies zu erleichtern, hat das BMEL auf nationaler Ebene <strong>in</strong> der<br />
Allgeme<strong>in</strong>en Verwaltungsvorschrift Lebensmittelhygiene<br />
Auslegungsh<strong>in</strong>weise als Hilfestellung für die zuständigen<br />
Behörden erarbeitet.<br />
Diese mit der Flexibilität verbundenen Beurteilungsspielräume für<br />
die zuständige Behörde s<strong>in</strong>d so gestaltet, dass auch für<br />
Kle<strong>in</strong>stbetriebe angemessene und verhältnismäßige Lösungen<br />
gefunden werden können.<br />
. . .
- 20 -<br />
Insbesondere im H<strong>in</strong>blick auf die Tierhaltung herrscht bei unseren<br />
Mitbürger<strong>in</strong>nen und Mitbürgern e<strong>in</strong>e sehr kritische Haltung<br />
gegenüber den aktuellen landwirtschaftlichen Haltungsverfahren.<br />
E<strong>in</strong> aktuelles Gutachten des Thünen-Instituts im Auftrag der<br />
Stiftung westfälische Landwirtschaft hat dies erneut belegt. 12 Im<br />
Zusammenhang mit modernen tierhaltenden Betrieben wurden<br />
häufig die Begriffe „groß“, „Massenproduktion“, „Automatisierung“<br />
und „spezialisiert“ genannt.<br />
Aus Sicht der Teilnehmer <strong>in</strong> den Gruppendiskussionen im Rahmen<br />
der Studie wäre sogar e<strong>in</strong>e Umstrukturierung der Landwirtschaft<br />
h<strong>in</strong> zu kle<strong>in</strong>eren, vielfältigeren Betrieben wünschenswert.<br />
Die Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes hat<br />
im Juni 2013 e<strong>in</strong> Leitbild beschlossen:<br />
• Es be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong>e gesellschaftlich verankerte Tierhaltung und<br />
betont, dass der Rückhalt der Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger für e<strong>in</strong>e<br />
moderne und nachhaltige Tierhaltung notwendig ist.<br />
• Die besondere Verantwortung der unternehmerischen<br />
Bäuer<strong>in</strong>nen und Bauern für das Tierwohl wird herausgestellt,<br />
und zwar im Interesse des Tieres als Teil der Schöpfung und im<br />
Interesse des Landwirts, der mit den Tieren E<strong>in</strong>kommen erzielt.<br />
12<br />
ZANDER, Elisabeth u.a. (2013) Erwartungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Gutachten im Auftrag der<br />
Stiftung Westfälische Landwirtschaft. Braunschweig.<br />
. . .
- 21 -<br />
Der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik 13 geht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Diskussion über e<strong>in</strong> Gutachten „Wege zu e<strong>in</strong>er gesellschaftlich<br />
akzeptierten Tierhaltung“ davon aus, dass vor dem H<strong>in</strong>tergrund<br />
des sich veränderten „Mensch-Tier-Verhältnisses“ die<br />
gegenwärtigen Haltungsbed<strong>in</strong>gungen nicht zukunftsfähig seien.<br />
Die Landwirtschaft werde mit steigenden Tierwohlanforderungen<br />
konfrontiert. Der Beirat mahnt <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e gesellschaftliche<br />
Debatte darüber an, wie und von wem die Kosten höherer<br />
Tierwohlanforderungen getragen werden sollen.<br />
E<strong>in</strong>en Teil der Verankerung der Tierhaltung <strong>in</strong> der Gesellschaft<br />
wird mit dem Tierschutzrecht erreicht.<br />
Hier werden die Standards def<strong>in</strong>iert, die allgeme<strong>in</strong> gültig s<strong>in</strong>d:<br />
• So wurde mit der am 13. Juli 2013 <strong>in</strong> Kraft getretenen Änderung<br />
des Tierschutzgesetzes e<strong>in</strong>e Verpflichtung des Halters zu e<strong>in</strong>er<br />
tierschutzbezogenen Eigenkontrolle anhand von<br />
Tierschutz<strong>in</strong>dikatoren e<strong>in</strong>geführt.<br />
Damit soll der Eigenverantwortung des Tierhalters für die<br />
tierschutzgerechte Haltung und Betreuung der Tiere e<strong>in</strong> höherer<br />
Stellenwert e<strong>in</strong>geräumt werden.<br />
Das Wohlergehen der Tiere soll anhand der Indikatoren<br />
e<strong>in</strong>geschätzt werden und gegebenenfalls sollen Maßnahmen<br />
zur Verbesserung geplant und umgesetzt werden.<br />
13<br />
WBA (2014) Entwurf für e<strong>in</strong> Gutachten „Wege zu e<strong>in</strong>er gesellschaftlich akzeptierten Tierhaltung“, Kapitel 7,<br />
Empfehlungen.<br />
. . .
- 22 -<br />
• Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes im Juli 2013 wurde<br />
auch der Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration<br />
e<strong>in</strong>geleitet. Danach ist die betäubungslose Ferkelkastration ab<br />
2019 verboten.<br />
• Zur Verbesserung des Tierschutzes gehören daneben weitere<br />
Maßnahmen wie zum Beispiel die Festlegung von<br />
Anforderungen an die Haltungsbed<strong>in</strong>gungen der gewerblichen<br />
Kan<strong>in</strong>chenhaltung. Die geänderte Tierschutz -<br />
Nutztierhaltungsverordnung wird <strong>in</strong> Kürze verkündet.<br />
• Das BMEL ändert aber nicht nur das Tierschutzgesetz und die<br />
Haltungsverordnungen.<br />
Die Änderungen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e umfassende Strategie<br />
zur Zukunft der Nutztierhaltung.<br />
Sie wird durch e<strong>in</strong> Forschungs- und Innovationskonzept<br />
"Nutztiere" flankiert.<br />
Es soll wissenschaftlich fundierte Grundlagen schaffen, wie zum<br />
Beispiel die Entwicklung von Tierwohl<strong>in</strong>dikatoren oder die<br />
Weiterentwicklung bestehender Haltungssysteme.<br />
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist der<br />
Tierschutz herausgehoben:<br />
• „Wir nehmen die kritische Diskussion zur Tierhaltung <strong>in</strong> der<br />
Gesellschaft auf und entwickeln e<strong>in</strong>e nationale Tierwohl-<br />
Offensive.“<br />
. . .
- 23 -<br />
• „Wir werden die Sachkunde der Tierhalter fördern. Gleichzeitig<br />
erarbeiten wir e<strong>in</strong> bundese<strong>in</strong>heitliches Prüf- und<br />
Zulassungsverfahren für Tierhaltungssysteme.“<br />
• „Ziel ist es außerdem, EU-weit e<strong>in</strong>heitliche und höhere<br />
Tierschutzstandards durchzusetzen.“<br />
• „Wir streben e<strong>in</strong>e flächengebundene Nutztierhaltung an. Ziel ist<br />
es, e<strong>in</strong>e tiergerechte Haltung <strong>in</strong> Deutschland zu fördern.“<br />
• „Wir werden überdies e<strong>in</strong>en wissenschaftlichen Diskurs über<br />
Größen tiergerechter Haltung von Nutztieren auf den Weg<br />
br<strong>in</strong>gen.“<br />
Unbestreitbar führt mehr Tierschutz zu höheren Kosten <strong>in</strong> der<br />
Tierhaltung.<br />
Das Landvolk Niedersachsen schätzt e<strong>in</strong>, das im Zuge der<br />
Umsetzung der EU-Vorschrift zur Gruppenhaltung von Sauen bis<br />
zu 20 % der Sauenhaltungen <strong>in</strong> Niedersachsen aufgegeben<br />
wurden.<br />
Das Landesm<strong>in</strong>isterium geht von 11 % aufgegebenen<br />
Sauenhaltungen aus. 14<br />
Höhere Investitions- und Verfahrenskosten <strong>in</strong>folge höherer<br />
Tierschutzanforderungen begünstigen tendenziell größere<br />
Betriebe, wegen der höheren Kosten je Tier <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren<br />
Haltungen.<br />
14<br />
Hannoversche Allgeme<strong>in</strong>e vom 17.10.2013, Tierschutzplan erfüllt.<br />
. . .
- 24 -<br />
Wer die Diskussion über die entsprechenden Gesetze und<br />
Verordnungen verfolgt - z.B. Tierschutz-<br />
Nutztierhaltungsverordnung und Kan<strong>in</strong>chen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Suchmasch<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geben - erkennt e<strong>in</strong> Grundmuster: den<br />
Tierschützern gehen die Regelungen nicht weit genug, Tierhaltern<br />
häufig zu weit.<br />
Hier ist vor allem das mite<strong>in</strong>ander reden nötig, wie es z.B. das<br />
BMEL im Jahr 2012 <strong>in</strong>sbesondere mit der Charta für<br />
Landwirtschaft und Verbraucher <strong>in</strong>itiiert hat.<br />
In der Umweltpolitik haben EU, Bundes- und Landesregierungen<br />
e<strong>in</strong> ausgefeiltes System umweltpolitischer Regelungen für Boden,<br />
Wasser und Luft geschaffen.<br />
Das ist nicht neu, sondern geht aus von der umweltpolitischen<br />
Debatte <strong>in</strong> den siebziger Jahren und den festgestellten<br />
Umweltschäden.<br />
Aktuell ist derzeit die Diskussion um die Umsetzung der EU-<br />
Nitratrichtl<strong>in</strong>ie durch die Düngeverordnung <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Nach den Vorgaben der EU-Nitratrichtl<strong>in</strong>ie ist Deutschland<br />
verpflichtet, die Düngeverordnung <strong>in</strong> vierjährigen Abständen auf<br />
ihre Wirksamkeit zu überprüfen.<br />
Das von der EU-Kommission akzeptierte Aktionsprogramm zur<br />
Umsetzung der Richtl<strong>in</strong>ie ist Ende 2013 ausgelaufen.<br />
Die Kommission vertritt die Auffassung, dass mit Blick auf die<br />
. . .
- 25 -<br />
festgestellte Nitratbelastung der Grundwasserkörper <strong>in</strong><br />
Deutschland die bisherigen Bestimmungen der Düngeverordnung<br />
nur zu unwesentlichen Verbesserungen geführt haben. Aus ihrer<br />
Sicht seien daher zusätzliche Maßnahmen im Bereich der<br />
landwirtschaftlichen Düngung notwendig, um die Ziele der<br />
Nitratrichtl<strong>in</strong>ie und der Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
überschaubaren Zeitraum zu erreichen.<br />
Die vom Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung und Landwirtschaft mit<br />
der Prüfung beauftragte Bund-/Länder-Arbeitsgruppe „Evaluierung<br />
der Düngeverordnung“ hat den Abschlussbericht Mitte November<br />
2012 vorgelegt und Empfehlungen zur Überarbeitung der<br />
Düngeverordnung vorschlagen.<br />
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse bereitet das<br />
Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung und Landwirtschaft zurzeit e<strong>in</strong>e<br />
Änderung der geltenden Düngeverordnung vor und führt dabei<br />
auch e<strong>in</strong>en engen Dialog mit den Ländern sowie Vertretern der<br />
betroffenen Berufsstände.<br />
Umstritten s<strong>in</strong>d vor allem<br />
• neue Vorgaben zur Düngebedarfsermittlung,<br />
• die Verlängerung der Sperrfristen für die Gülleausbr<strong>in</strong>gung und<br />
<strong>in</strong>sbesondere das Verbot der Gülleausbr<strong>in</strong>gung zu Maisstroh im<br />
Herbst,<br />
• höhere Vorgaben für die Ausbr<strong>in</strong>gungstechnik,<br />
. . .
- 26 -<br />
• die Verschärfung der Vorgaben zur Düngung <strong>in</strong> der Nähe von<br />
Gewässern und<br />
• die Erweiterung der Lagerkapazität für flüssige<br />
Wirtschaftsdünger über sechs Monate h<strong>in</strong>aus.<br />
Die Kommission fordert jedoch zusätzlich Maßnahmen und hat<br />
dazu auch Vorschläge unterbreitet, die <strong>in</strong> vielen Punkten über die<br />
von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgeschlagenen<br />
Anpassungen der Düngeverordnung h<strong>in</strong>ausgehen.<br />
Zwischenzeitlich hat die Kommission Mitte Oktober 2013 gegen<br />
Deutschland e<strong>in</strong> Vertrags-Verletzungsverfahren wegen<br />
unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtl<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>geleitet.<br />
Das Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung und Landwirtschaft möchte<br />
bei der anstehenden Änderung der Düngeverordnung<br />
praxisgerechte Lösungen erreichen, die e<strong>in</strong>er fachlichen<br />
Überprüfung standhalten und auch die Umwelterfordernisse<br />
angemessen berücksichtigen.<br />
Praxisgerecht heißt <strong>in</strong>sbesondere, dass auch kle<strong>in</strong>ere<br />
landwirtschaftliche Betriebe die Anpassungen tragen können.<br />
Bei den weiteren Diskussionen mit der Kommission wird sich das<br />
Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung und Landwirtschaft vor allem<br />
auch dafür e<strong>in</strong>setzen.<br />
. . .
- 27 -<br />
4. Perspektiven bäuerlicher Landwirtschaft<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
e<strong>in</strong> bäuerlicher Familienbetrieb soll die sozialen Interessen e<strong>in</strong>er<br />
Familie mit den ökonomischen Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>es Unternehmens<br />
vere<strong>in</strong>en. Hier gibt es Widersprüche, die der Agrarwissenschaftler<br />
Frieder Thomas aus Konstanz treffend so formuliert hat:<br />
„die Familien waren immer am Erhalt ihrer Höfe als konkrete<br />
langfristige Lebens- und Arbeitsgrundlage <strong>in</strong>teressiert und nicht an<br />
der möglichst hohen Verz<strong>in</strong>sung ihres Kapitals.<br />
Dieses Interesse legt risikoarme Entscheidungen bei Kapital und<br />
Ressourcene<strong>in</strong>satz nahe.“<br />
Das wiederum stehe nicht selten im Widerspruch zu kurzfristigem<br />
betriebswirtschaftlichen Erfolg.<br />
Gerade dieser Unterschied zwischen Familie als sozialer und dem<br />
Betrieb als ökonomischer E<strong>in</strong>heit habe jedoch bäuerliches<br />
Wirtschaften ausgemacht. Dadurch würde die Ökonomie begrenzt,<br />
die <strong>in</strong> <strong>in</strong>dustriellen Prozessen vorherrscht. 15<br />
Dazu kommt wie gerade ausgeführt e<strong>in</strong> immer engeres Netz aus<br />
Regelungen zum Schutz derjenigen Güter, die nicht automatisch<br />
mitgeliefert werden, wenn Lebensmittel oder nachwachsende<br />
15<br />
THOMAS, Frieder (2013) ASG-Onl<strong>in</strong>e-Konsultation November 2013 zum Thema<br />
„Welche Landwirtschaft wollen wir? http://www.asg-goe.de/Onl<strong>in</strong>e-Konsultation.shtml<br />
. . .
- 28 -<br />
Rohstoffe erzeugt werden und gleichzeitig preisgünstig se<strong>in</strong> sollen.<br />
Das s<strong>in</strong>d hohe Standards der Lebensmittelsicherheit, des<br />
Tierwohls und des Umweltschutzes – für die Regierungen und<br />
Politik im Krisenfall oder bei Missständen <strong>in</strong> die Pflicht genommen<br />
werden.<br />
Unter diesen Bed<strong>in</strong>gungen sprechen manche vom Ende<br />
bäuerlicher Landwirtschaft. 16<br />
Das BMEL geht die offensichtlichen Widersprüche auf zwei Wegen<br />
an.<br />
Zum e<strong>in</strong>en gibt es angepasste Regelungen oder Ausnahmen,<br />
um die Situation kle<strong>in</strong>erer land- und ernährungswirtschaftlicher<br />
Betriebe zu berücksichtigen:<br />
• So gibt es etwa im Steuerrecht umfangreiche<br />
Sonderbestimmungen für kle<strong>in</strong>ere land- und forstwirtschaftliche<br />
Betriebe, z. B. bei der Gew<strong>in</strong>nermittlung, der E<strong>in</strong>kommens- und<br />
Umsatzsteuer, der Versicherungs-, KfZ- oder Erbschaftssteuer.<br />
• E<strong>in</strong> weiterer wichtiger Bereich ist das bereits erwähnte<br />
Lebensmittelhygienerecht, <strong>in</strong> dem betriebsspezifische und<br />
<strong>in</strong>dividuelle Lösungen für kle<strong>in</strong>ere Betriebe vorgesehen s<strong>in</strong>d.<br />
• Bei der Förderung der erneuerbaren Energien gibt es<br />
größenabhängige Differenzierungen, die den ökonomischen<br />
16 Ste<strong>in</strong>ert, Dieter (2013) Von säuerlich bis bäuerlich. Editorial DLZ-agrarmagaz<strong>in</strong> 9/2013.<br />
. . .
- 29 -<br />
Nachteilen kle<strong>in</strong>er Anlagen Rechnung tragen und e<strong>in</strong>er<br />
Überförderung großer Anlagen entgegenwirken.<br />
• Bei den Umweltauflagen gibt es ebenso spezielle<br />
Ausnahmeregelungen für kle<strong>in</strong>ere Betriebe wie auch im<br />
Tierschutzrecht.<br />
• Im H<strong>in</strong>blick auf die Förderung land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe s<strong>in</strong>d im Rahmen der Geme<strong>in</strong>samen Agrarpolitik bzw.<br />
der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz<br />
ebenfalls Regelungen vorhanden, die kle<strong>in</strong>eren Erzeugern zu<br />
Gute kommen.<br />
• Mit der Umsetzung der jüngsten Agrarreform werden die ersten<br />
Hektare e<strong>in</strong>es Betriebes mit höheren Direktzahlungen gefördert.<br />
Zum zweiten nutzen gerade auch Bäuer<strong>in</strong>nen und Bauern die<br />
Forderungen der Konsument<strong>in</strong>nen und Konsumenten, um sich mit<br />
ihrem Angebot zu präsentieren. Sie heben sich mit ihren<br />
Erzeugnissen und Dienstleistungen von z.B. den standardisierten<br />
Lebensmitteln ab.<br />
Gerade hier s<strong>in</strong>d Tierwohl, regional, öko, nachhaltig – wie es im<br />
Titel dieser Veranstaltung heißt - e<strong>in</strong>e Möglichkeit <strong>in</strong> bäuerlichen<br />
Strukturen auch auf globalisierten und immer weniger geschützten<br />
Agrarmärkten zu bestehen.<br />
. . .
- 30 -<br />
5. Fazit<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren,<br />
ich fasse zusammen:<br />
1. Das Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebes hat sich<br />
weiter entwickelt <strong>in</strong> Richtung Vielfalt und Nachhaltigkeit. 17<br />
2. Zielvorgaben und Anforderungen für die Landwirtschaft<br />
werden zunehmend von e<strong>in</strong>er kritischen Öffentlichkeit –<br />
von den Kunden – gestellt.<br />
3. Höhere Anforderungen verursachen Mehrkosten, die über<br />
den Preis abgegolten werden müssen. Dies ist abhängig<br />
von der Betriebsgröße leichter oder schwerer machbar.<br />
Neue Anforderungen befördern <strong>in</strong>soweit die Veränderung<br />
der Landwirtschaft.<br />
4. Und schließlich: BMEL setzt sich für Regeln e<strong>in</strong>, die auch <strong>in</strong><br />
bäuerlichen Betrieben tragbar s<strong>in</strong>d.<br />
17<br />
Im Koalitionsvertrag formulieren CDU/CSU und SPD:<br />
„Unser Ziel ist e<strong>in</strong>e multifunktional ausgerichtete, bäuerlich unternehmerische Landwirtschaft, die<br />
ressourcen- und umweltschonend produziert, die Tierwohl, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit<br />
mite<strong>in</strong>ander verb<strong>in</strong>det. Leitbild ist e<strong>in</strong>e von Familien betriebene, regional verankerte,<br />
flächendeckende Landwirtschaft unterschiedlicher Strukturen und Produktionsweisen. Sie trägt zur<br />
Wertschöpfung, gut bezahlter Arbeit und sicheren E<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> den ländlichen Räumen bei.“<br />
. . .