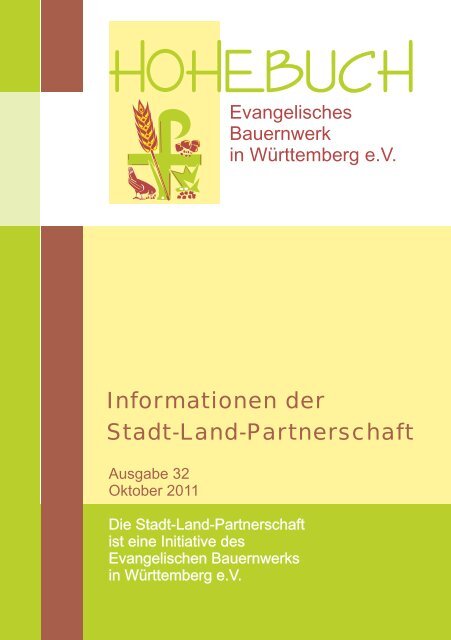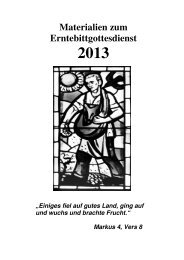Informationen der Stadt-Land-Partnerschaft - Evangelisches ...
Informationen der Stadt-Land-Partnerschaft - Evangelisches ...
Informationen der Stadt-Land-Partnerschaft - Evangelisches ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Informationen</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
Ausgabe 32<br />
Oktober 2011<br />
Die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
ist eine Initiative des<br />
Evangelischen Bauernwerks<br />
in Württemberg e.V.<br />
<strong>Evangelisches</strong><br />
Bauernwerk<br />
in Württemberg e.V.
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Editorial 2<br />
Nachruf Martin Wolf 4<br />
Theologischer Beitrag<br />
§ Vielfalt als Schöpfungsprinzip<br />
Berichte aus <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
§ Herbst-Initiativkreis: Ethischer Konsum bei Jugendlichen<br />
§ Winter-Initiativkreis: Patentierung von Pflanzen und Tieren<br />
§ Frühjahrs-Initiativkreis: <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> Plus – Regionalwert<br />
AG Freiburg und Tübinger Bauern Milch GmbH<br />
§ Sommer-Initiativkreis: Hohenloher <strong>Land</strong>tour – Weg <strong>der</strong> Vielfalt<br />
Agrargespräch 2011<br />
§ Die Reform <strong>der</strong> europäischen Agrarpolitik<br />
<strong>Land</strong> Grabbing<br />
§ Kommt Bauernland in Bankerhand?<br />
Welternährungssicherung<br />
§ Bauern weltweit in einem Boot<br />
60-jähriges Jubiläum <strong>der</strong> Heimvolkshochschule Hohebuch<br />
§ „Wenn’s Hohebuch nicht gäbe, müsst’ man es heute gründen“<br />
Hohebucher Prädikantentag<br />
§ Der ländliche Raum und seine Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Materialien zum Thema „nachhaltige Ernährung“<br />
§ Buchbesprechungen<br />
Auszeichnungen<br />
§ Brenzmedaille für Gudrun Stier und Hansjörg Keyl<br />
§ Bundesverdienstorden für Ulrike Siegel<br />
Jahresergebnis 2010<br />
Termine 51<br />
Herausgegeben von <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
Redaktion: Dr. Clemens Dirscherl (verantwortlich), Barbara Fetzer-Haag,<br />
Pfr. Bernd Hofmann, Hansjörg Keyl, Gerhard Wirth<br />
Redaktionssekretariat: Regina Grigo<br />
<strong>Evangelisches</strong> Bauernwerk, 74638 Waldenburg-Hohebuch, Tel.: 07942/107-70,<br />
Fax: 07942/107-77, E-Mail: c.dirscherl@hohebuch.de<br />
5<br />
9<br />
15<br />
19<br />
22<br />
26<br />
31<br />
35<br />
37<br />
41<br />
43<br />
47<br />
48<br />
49
Editorial<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
wenn Sie diese Zeilen lesen, dann haben Sie unser Info-Heft 2011<br />
schon in die Hand genommen, um darin zu blättern o<strong>der</strong> zu<br />
schmökern. – Es freut uns, wenn Sie weiter lesen und wenn <strong>der</strong> eine<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Beitrag Ihr Interesse findet.<br />
Wir vom Redaktionsausschuss <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
bemühen uns, alljährlich das Info-Heft gut und interessant zu<br />
gestalten. Wir möchten, dass Sie durch unser Heft mit unserer<br />
Hohebucher Arbeit und darüber hinaus auch mit dem Evangelischen<br />
Bauernwerk in Verbindung bleiben – auch wenn Sie nicht an den<br />
Treffen des Initiativkreises o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Veranstaltungen <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<br />
<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> teilnehmen können. Wir möchten Sie darüber<br />
informieren, welche Themen uns beschäftigt haben und was die<br />
Gemeinschaft von Bauern und Verbrauchern im Evangelischen<br />
Bauernwerk <strong>der</strong>zeit bewegt o<strong>der</strong> auch beunruhigt.<br />
Beunruhigend ist sicher die weltweit zunehmende Dimension von<br />
<strong>Land</strong> Grabbing (<strong>Land</strong>nahme) durch kapitalstarke Investoren ebenso<br />
wie auch die Aneignung <strong>der</strong> Schöpfung durch Biopatente. Mit beidem<br />
haben wir uns befasst; darüber ist in diesem Heft zu lesen.<br />
Außerdem berichten wir vom Hohebucher Agrargespräch. Dort ging<br />
es um die Reform <strong>der</strong> Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) <strong>der</strong> EU, die<br />
bis 2014 abgeschlossen sein soll, und die zumindest die Bauern unter<br />
uns sehr bewegt. Natürlich berichten wir über den Hohebucher Tag<br />
bzw. das 60-jährige Jubiläum <strong>der</strong> Heimvolkshochschule Hohebuch<br />
und über die Hohenloher <strong>Land</strong>tour, die schon zur jährlichen Tradition<br />
geworden ist. Und weil es noch viele an<strong>der</strong>e Dinge gab o<strong>der</strong> gibt, die<br />
beunruhigend o<strong>der</strong> bewegend sind, gibt es auch noch eine Fülle an<br />
weiterem Lesenswerten in diesem Heft.
Der theologische Beitrag mit deutlichem Themenbezug steht wie<strong>der</strong><br />
am Anfang. Dieses Mal geht es um die Biodiversität, die sowohl bei<br />
<strong>der</strong> Hohenloher <strong>Land</strong>tour als auch bei unserem Wintertreffen ein<br />
Thema war. Pfarrer Bernd Hoffmann hat eine ganz beson<strong>der</strong>e<br />
Beziehung zur Biodiversität, d.h. zur natürlichen Artenvielfalt. Sein<br />
Pfarrgarten in Großaltdorf ist geradezu eine Oase <strong>der</strong> Wildblumen. Er<br />
erhielt mit seiner Kirchengemeinde dafür den Naturschutzpreis des<br />
<strong>Land</strong>es. Bei <strong>der</strong> Hohenloher <strong>Land</strong>tour durften wir diese wun<strong>der</strong>bare<br />
Schöpfungsvielfalt besichtigen.<br />
Bei allen unseren Beiträgen bemühen wir uns objektiv zu berichten.<br />
Trotzdem bleibt es nicht aus, dass die Meinung des Autors<br />
durchscheint o<strong>der</strong> gar bestimmend ist. Sie, liebe Leserinnen und<br />
Leser, haben dies bisher vielleicht einfach hingenommen. Aber ich<br />
könnte mir gut vorstellen, dass die Eine o<strong>der</strong> <strong>der</strong> An<strong>der</strong>e von Ihnen<br />
sich gelegentlich mit einer Rückmeldung an uns wendet. Sie könnten<br />
dabei auch einmal zur Fe<strong>der</strong> greifen, um ein Thema mit an<strong>der</strong>er<br />
Meinung darzustellen o<strong>der</strong> zu ergänzen.<br />
Ich möchte Sie ermuntern, gelegentlich in Richtung Rückmeldung<br />
aktiv zu werden. Ihre Verbindung zur <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
würde um ein Stück Dialog erweitert. Und für Ihre Rückmeldung<br />
ließe sich im Info-Heft sicher leicht eine Rubrik einrichten – auf alle<br />
Fälle eine Bereicherung für uns. Wenn Sie als Rückmeldung eine E-<br />
Mail schreiben wollen, verwenden Sie am besten die Adresse<br />
c.dirscherl@hohebuch.de.<br />
Ich grüße Sie herzlich im Namen des Redaktionsausschusses<br />
Ihr<br />
Hansjörg Keyl
Nachruf auf unseren Freund Martin Wolf<br />
Die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> trauert um<br />
ihr langjähriges Mitglied Martin Wolf.<br />
Der 54-jährige Diakon kam schon bald<br />
nach Gründung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
nach Hohebuch. 1995 wurde<br />
er als theologischer Vertreter in den<br />
geschäftsführenden Ausschuss gewählt,<br />
dem er bis zuletzt angehörte. Sein<br />
ökologisches Engagement für eine<br />
schöpfungsbewahrende, sozialverträgliche<br />
bäuerliche <strong>Land</strong>wirtschaft und den<br />
Klimaschutz, wofür er sich auch politisch<br />
einsetzte, verband er mit programmatischen<br />
Impulsen für die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong>. Innerhalb des<br />
Aktionsprogramms vertrat er unsere Arbeit zum Thema Einkaufsverhalten<br />
und dem Film „We feed the world“ bei zahlreichen Bildungsveranstaltungen<br />
draußen vor Ort in Kirchengemeinden wie auch bei<br />
<strong>Land</strong>frauenvereinen. Unvergessen bleiben seine theologisch ebenso<br />
fundierten wie geistig anregenden Andachten zu Beginn <strong>der</strong> Initiativkreisversammlungen<br />
in Hohebuch sowie sein Beitrag zum Thema<br />
„Schöpfungsgemäßes Verbraucherverhalten“ anlässlich unserer Feier<br />
zum 20-jährigen Jubiläum.<br />
Am 18. Juli trafen wir uns noch zu einer gemeinsamen Sitzung des<br />
geschäftsführenden Ausschusses, um die Arbeit für den Winter<br />
2011/2012 vorzubereiten. Gut zwei Wochen später verstarb er am 3.<br />
August an den Folgen eines Schlaganfalls.<br />
Wir sind dankbar dafür, dass Martin Wolf mit seiner liebenswerten,<br />
kreativen, schelmischen und versöhnlichen Art Weggefährte unserer<br />
Arbeit wie auch Freund und persönlicher Begleiter war und wissen<br />
ihn in Gottes ewigem Frieden aufgehoben.<br />
Clemens Dirscherl
Theologischer Beitrag<br />
Vielfalt als Schöpfungsprinzip<br />
Wenn ich in den Morgenstunden eines Sommertages durch den<br />
Pfarrgarten gehe, empfängt mich eine Vielfalt von Blüten und Fülle<br />
von Insekten: Es summt über den Mohnblüten im Feldblumenbeet.<br />
In den morgens offenen Blüten <strong>der</strong> Königskerzen und Wilden Karden<br />
im Schmetterlings-Wildbienensaum saugen Hun<strong>der</strong>te von Hummeln,<br />
mehrere Arten von Wildbienen, Schwebebienen und mancher seltene<br />
Schmetterling den köstlichen<br />
Nektar. Das volle überfließende<br />
Leben, Sommerfülle,<br />
<strong>der</strong> „Sommer deiner<br />
Gnad“ (Paul Gerhardt). Eine<br />
einzige Wilde Möhre hat in<br />
ihren 10 - 20 Dolden bis zu<br />
30000 Einzelblüten – Schlaraffenland<br />
für Insekten.<br />
Und die Spatzen und Hausrotschwänzchen wie<strong>der</strong>um füttern<br />
ihre Jungen von diesem reich gedeckten Tisch an Insekten.<br />
Unser naturnaher Pfarrgarten ist gestaltete, kultivierte<br />
Schöpfung – faszinieren<strong>der</strong> Lebensraum für Mensch und Tier.<br />
Die bäuerliche <strong>Land</strong>wirtschaft hat über Jahrhun<strong>der</strong>te die<br />
Vielfalt maßgeblich erhöht: Kultivierung <strong>der</strong> vormals von Wald<br />
beherrschten <strong>Land</strong>schaft durch Fel<strong>der</strong>, Hecken, Wiesen und<br />
Streuobstwiesen hat den Artenreichtum vervielfacht gegenüber<br />
dem einen Lebensraum Wald. Lerchen o<strong>der</strong> Nachtigallen<br />
wan<strong>der</strong>ten ein. Viehställe wurden zum idealen Biotop für<br />
Schwalben. Alte Streuobstwiesen können bis zu 5000 Pflanzen-<br />
und Tierarten beherbergen.
Auch die Bibel hat einen Sinn für die Artenvielfalt in unterschiedlichen<br />
Lebensräumen – am augenfälligsten im Schöpfungspsalm 104:<br />
Quellen entspringen und fließen als Bäche durch die Täler. Daraus<br />
trinken die Wildtiere, und im Laubdach <strong>der</strong> Bäume an ihrem Ufer<br />
singen die Vögel. Sie können sich darin verstecken und Nester bauen<br />
und finden zu fressen. Ihr Gesang freut auch uns Menschen. Eins ist<br />
für das an<strong>der</strong>e da. Die Steinböcke und Murmeltiere haben ihren Platz<br />
im Gebirge, wo sie <strong>der</strong> Mensch normalerweise nicht stört. Der<br />
Psalmbeter staunt und ist begeistert, wie alles ineinan<strong>der</strong> passt und<br />
zusammenleben kann. Ein ökologisches Gleichgewicht.<br />
Im Lob dieses Psalms haben auch die Wildtiere von Gott ihren<br />
Lebensraum und ausdrücklich ein eigenes Lebensrecht. Sie sind<br />
keine Nutztiere des Menschen, son<strong>der</strong>n seine Mitgeschöpfe - mit<br />
dem gleichen Recht zu leben. Wir sollen ihnen einen Platz geben,<br />
statt sie ausrotten. Das zeigt unzweideutig auch <strong>der</strong> Auftrag an Noah<br />
zur Rettung je<strong>der</strong> einzelnen Tierart in <strong>der</strong> Arche. Gott bewahrt seine<br />
Tierarten vor dem Aussterben! Die Artenvielfalt ist von ihm gewollt -<br />
zu seiner Freude, zur Lebensfreude <strong>der</strong> Tiere und zu unserer Freude.<br />
Der rapide Anstieg aussterben<strong>der</strong> und gefährdeter Tier- und<br />
Pflanzenarten – täglich sterben bis zu 300 Arten aus! – hat die UN<br />
bewogen, sich für den Erhalt <strong>der</strong> biologischen Vielfalt einzusetzen.<br />
2010 wurde zum UN-Jahr <strong>der</strong> Biodiversität ausgerufen. Biodiversität<br />
bezeichnet beides: die Vielfalt von Arten und die Vielfalt von Ökosystemen.<br />
Das hat auch wirtschaftliche Gründe: die genetische<br />
Vielfalt zur Gewinnung von Arzneimitteln o<strong>der</strong> Züchtung<br />
zukunftsfähiger Nutzpflanzen soll erhalten werden.<br />
Um den Erhalt <strong>der</strong> Vielfalt auch bei uns zu för<strong>der</strong>n, hat unsere<br />
<strong>Land</strong>esregierung einen „111 Artenkorb“ vorgestellt, in den<br />
gefährdete Pflanzen- und Tierarten aufgenommen sind, die<br />
charakteristisch für einen bestimmten Lebensraum sind. Durch<br />
den Schutz dieser Arten wird gleichzeitig auch <strong>der</strong>en<br />
Lebensraum mit seinen weiteren Arten geschützt. Denn das<br />
Aussterben von Arten kommt großenteils von <strong>der</strong> Zerstörung
Nicht nur <strong>der</strong> Psalm 104 zeigt das Bewusstsein <strong>der</strong> Bibel für<br />
Lebensräume, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Garten Eden aus 1. Mose 2 und die<br />
jüngere Schöpfungserzählung in 1. Mose 1: In den symbolischen<br />
ersten drei Schöpfungstagen werden die Lebensräume für die<br />
Geschöpfe <strong>der</strong> folgenden drei Schöpfungstage geschaffen – entsprechend<br />
<strong>der</strong> Lichtenergie des 1. Tages die materiellen Geschöpfe<br />
<strong>der</strong> Gestirne am 4 Tag – entsprechend des Lebensraumes Wasser<br />
und Luftraum am 2. Tag die Wasser und Lufttiere/Vögel am 5. Tag –<br />
entsprechend <strong>der</strong> grünen Erde als am 3. Tag geschaffener<br />
Lebensraum die <strong>Land</strong>tiere und Menschen am 6. Tag.<br />
Unsere <strong>Land</strong>eskirche för<strong>der</strong>t daher die Erhaltung von Lebensräumen<br />
und Arten, z.B. durch den „Lebensraum Kirchturm“ für Vogelarten<br />
und Fle<strong>der</strong>mäuse, durch Schutz des Wiesenknopf-Ameisenbläulings<br />
(aus dem 111-Arten-Korb) in kirchlichen Grundstücken und durch die<br />
Beteiligung an <strong>der</strong> NABU-Initiative „Kultur-Natur-blüht-auf“. Letzteres<br />
heißt: Die ehemals artenreiche bäuerliche Kulturlandschaft soll<br />
erhalten werden und wie<strong>der</strong> aufblühen – und zwar durch lebendige<br />
Äcker z.B. durch Blühstreifen, blumenbunte Wiesen und lokaltypische<br />
Streuobstwiesen zur Erhaltung alter heimischer Obstsorten. Daran<br />
können Verbraucher und <strong>Land</strong>wirte ohne wirtschaftliche Einbußen<br />
mitwirken.<br />
Vielfalt ist also ein gutes<br />
Schöpfungsprinzip, das wir nicht<br />
ohne negative Folgen missachten<br />
können. Auch die christliche<br />
Gemeinde ist in <strong>der</strong> Bibel ja als<br />
Leib mit ver-schiedenen Organen,<br />
als viel-fältig zusammenwirken<strong>der</strong><br />
Or-ganismus dargestellt. Und auch<br />
in einem landwirtschaftlichen<br />
Betrieb ist Vielfalt eigentlich die<br />
Existenzgrundlage: mehrere<br />
Standbeine reduzieren die<br />
Krisenanfälligkeit. Eine Vielfalt in<br />
<strong>der</strong> Fruchtfolge fängt ungün-stige<br />
klimatische Bedingungen besser<br />
auf. Wenn zwei Sorten
geringen Ertrag bringen, gedeiht dafür die dritte. Die diesjährige<br />
Trockenheit hatte so gesehen auch positive Seiten: wenig<br />
Unkrautdruck, gesunde Kartoffeln, große Blütenvielfalt: die Weg- und<br />
Straßenrän<strong>der</strong> z.B. wirken bunter als sonst, es gab sehr viel Honig.<br />
Und schließlich soll die Segensfülle <strong>der</strong> Schöpfung, die Jesus immer<br />
wie<strong>der</strong> als Gleichnis aufgreift, anschaulich und erlebbar bleiben.<br />
Erst wenn wir einzelne Pflanzen und Tiere kennen und sie wie im<br />
Psalm 104 bewun<strong>der</strong>n, merken wir auch, wenn sie verschwinden.<br />
Erst wenn wir sie wahrnehmen, können wir sie schützen. Auch das<br />
steckt ja in dem Wort „bewahren“ (= hüten, bewachen, ein Auge<br />
drauf haben). Darum ist es eine bleibende Aufgabe für Eltern,<br />
Lehrer, unsere Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit zur Wahrnehmung <strong>der</strong><br />
Vielfalt und zum Staunen anzuleiten. Der Psalmbeter ist reich an<br />
Freude, Glück und Dankbarkeit für die Wun<strong>der</strong>, die er wahrnimmt.<br />
Was uns erfreut, wollen wir auch schützen! Unser Pfarrgarten bietet<br />
Raum zur Wahrnehmung <strong>der</strong> bunten Vielfalt unserer Kulturlandschaft.<br />
Bernd Hofmann
Berichte aus <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> (SLP)<br />
Herbst-Initiativkreis September 2010:<br />
Ethischer Konsum bei Jugendlichen<br />
Unter ethischem Konsum werden neben <strong>der</strong> Befriedigung menschlicher<br />
Bedürfnisse folgende Wertorientierungen im Blick auf das<br />
Konsumverhalten zusammengefasst:<br />
- För<strong>der</strong>ung guter Lebensqualität durch humane Lebensbedingungen<br />
- eine faire Ressourcenaufteilung zwischen Arm und Reich<br />
- Handeln in Rücksicht auf künftige Generationen<br />
- Langfristige Folgen des Konsums im Blick haben<br />
- Minimierung von Ressourcenverbrauch, Müllaufkommen und<br />
Umweltverschmutzung.<br />
Politik mit dem Einkaufskorb<br />
Clemens Dirscherl stellte verschiedene Verbraucherstudien <strong>der</strong> letz-ten<br />
beiden Jahre vor: sie belegen, dass ein wachsen<strong>der</strong> Bevöl-kerungskreis<br />
mindestens <strong>der</strong> über 27-jährigen mit dem Konsum – insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong><br />
Ernährung – auch eine soziale und ökologische Verantwortung verbindet.<br />
Die „Politik mit dem Einkaufskorb“, welche die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
schon seit ihren Anfängen vertritt, ist inzwischen bei einem breiteren<br />
Bevölkerungskreis und daher auch bei den Lebensmittelketten<br />
angekommen. Sie tragen dem Verbraucherverhalten Rechnung durch ein<br />
größeres Ökosortiment und Marken wie „Unser <strong>Land</strong>“, „Unsere Heimat“<br />
o<strong>der</strong> „Von unseren Bauern“, die auf dem Hintergrund von<br />
Unübersicht-lichkeit und Anonymität<br />
<strong>der</strong> Globalisierung auch stärker<br />
nach-gefragt werden. Ein Trend zu<br />
ethisch begründetem Einkaufs-<br />
verhalten ist zu erkennen.
Nestlé z.B. hat durch eine eigene Studie erkannt, dass 40% <strong>der</strong><br />
Bevölkerung – freilich erst nach Alter zunehmend - auf gute,<br />
gesunde Ernährung Wert legt, je 42% auf saisonale und<br />
gentechnikfreie Ernährung, je 36 % auf artgerechte Tierhaltung und<br />
Qualitätssiegel und bis zu 26 % sogar auf eine umweltgerechte<br />
Ernährung. - Auch McDonalds z.B. kauft Fleisch und Kartoffeln<br />
inzwischen aus Deutschland und will nun auch ein Öko-Menü und<br />
ökofairen Kaffee servieren.<br />
Allerdings hat die steigende Nachfrage nach gesunden Produkten<br />
auch einen Haken: Ökofertigprodukte o<strong>der</strong> GVO-freie Produkte sind<br />
auf ihren CO²-Fußabdruck hin zu untersuchen. Macht es z.B. Sinn,<br />
dass GVO-freie Milch von Norddeutschland eingeführt wird, um bei<br />
uns verkauft werden zu können?<br />
Schülerstudie zu „We feed the world“<br />
Interessant ist eine Studie von Stefanie Höll<br />
(Foto) zu ethischem Konsum unter Schülern,<br />
die sie auf <strong>der</strong> IK-Sitzung vorstellte (Bachelor-<br />
Arbeit an <strong>der</strong> Fachhochschule Nürtingen): Auf<br />
<strong>der</strong> Grundlage von drei Szenen aus dem Film<br />
„We feed the world“ von Erwin Wagenhofer<br />
befragte sie 224 Schüler eines Wirtschaftsgymnasiums,<br />
eines Berufskollegs und eines<br />
Gymnasiums im Raum Rastatt zu ihrem<br />
Verbraucherverhalten.<br />
Einige interessante Ergebnisse: „Hilfsbereit, offen für Neues, rück-sichtsvoll<br />
und tierlieb“ waren die häufigsten Persönlichkeits-merkmale, welche je<br />
mindestens zwei Drittel <strong>der</strong> Schüler für sich angaben. Weniger als ein<br />
Fünftel gab an, auch „initiativ“ zu sein). Über zwei Drittel <strong>der</strong> Schüler sprach<br />
am meisten die Filmsequenz „Billige Hühner“ an, ein Drittel – mehrheitlich<br />
Jungen – sprach die Sequenz „Regenwald und Hunger“ an, und weniger als<br />
1 % die
Fleischkonsum – ein „heißes“ Thema<br />
Die Hühnchenszene ging beson<strong>der</strong>s unter die Haut, weil lebendige<br />
Kreaturen wie industrielle Waren über ein Fließband zur weiteren<br />
Verwertung transportiert werden, bis sie schließlich in <strong>der</strong> Schlachterei<br />
als Masthähnchen zur weiteren Verarbeitung am Haken hängen.<br />
Das belegt, dass die fehlende Transparenz von Haltungsformen in<br />
<strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft wohl auch Hintergrund für eine ethische<br />
Gleichgültigkeit beim Verbraucherverhalten ist. Würden tatsächlich<br />
die jeweiligen Fleischerzeugnisse aus <strong>der</strong> Kühltheke des Supermarkts<br />
durch Film, Bild o<strong>der</strong> Text in unmittelbaren Kontext zu ihren Entstehungsbedingungen<br />
gesetzt, könnte sich die Einstellung zu<br />
Lebensmitteln gravierend än<strong>der</strong>n.<br />
Darauf weisen auch weitere Aussagen <strong>der</strong> Jugendlichen zu ihrem<br />
Fleischkonsum hin: 16% haben sich noch nie Gedanken über ihren<br />
Fleischkonsum und die Hintergründe <strong>der</strong> Erzeugung gemacht, 53%<br />
selten o<strong>der</strong> manchmal. Dabei essen zwei Drittel Fleisch, weil es gut<br />
schmecke, wichtige Nährstoffe enthalte o<strong>der</strong> aus Gewohnheit. Mehr<br />
als drei Viertel <strong>der</strong> Jugendlichen finden einen Fleischkonsum unter<br />
den im Film gezeigten Herstellungsbedingungen als ethisch<br />
fragwürdig. Knapp 75% konnten sich nach dem Film vorstellen, nun<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Tierhaltungsform<br />
zertifiziertes o<strong>der</strong> regionales<br />
Fleisch einzukaufen.<br />
Ein Drittel wäre bereit, bei tiergerechter<br />
Haltung von Hühnern<br />
für eine Portion Chicken Mc-<br />
Nuggets 20% mehr zu bezahlen. Auffallend ist, dass bei männlichen<br />
Schülern <strong>der</strong> Fleischkonsum höher ist, die Bereitschaft jedoch, den<br />
Konsum einzuschränken, auf Siegel zu achten und mehr zu bezahlen<br />
geringer als bei Schülerinnen.<br />
Verbraucherbefragung in Hohenlohe
Im Rahmen des Kurses "Persönlichkeitsbildung für landwirtschaftliche Unternehmer"<br />
befassten sich die Meisterschüler <strong>der</strong> <strong>Land</strong>bauakademie Kupferzell<br />
sowie Ostalbkreis mit Rhetorik, Argumentationstraining, Zeitmanagement<br />
und Agrarpolitik. Das Thema Verbraucherverhalten erregte beson<strong>der</strong>es<br />
Interesse und wurde anhand einer Befragung von 500 zufällig<br />
ausgewählten Frauen und Männern in Schwäbisch Hall, Künzelsau,<br />
Öhringen und den beiden Autobahnraststätten Hohenlohe praktisch erprobt.<br />
Nach den Kriterien ihres Einkaufsverhaltens befragt, gaben 32% Qualität,<br />
30% Herkunft, 21% Preis und 17% ökologische Unbedenklichkeit an. Als<br />
Störfaktor bzw. problematisch wurde von 35% <strong>der</strong> Trend zur agrarindustriellen<br />
Tierhaltung benannt, von 23% die Umweltbelastungen für<br />
Klima, Böden und Wasser und – für die Meisteranwärter beson<strong>der</strong>s überraschend<br />
– von 21% <strong>der</strong> aktuelle Agro-Energieboom durch Biogasanlagen<br />
mit hohem Maisanteil. 18% fühlten sich durch Gerüche aus <strong>der</strong><br />
<strong>Land</strong>wirtschaft belästigt, 13% durch Verkehr und 9% durch Lärm. 20%<br />
sahen keinerlei Störfaktoren durch die heimische <strong>Land</strong>wirtschaft.<br />
Durch den zu dieser Zeit aktuellen Dioxinskandal fühlten sich 66% <strong>der</strong><br />
befragten Verbraucher durch Dioxinrückstände in Fleisch und Eiern<br />
gefährdet. 22% sahen keine Gefahr und 12% machten sich keine Gedanken<br />
darüber. Ihr Ernährungsverhalten deswegen verän<strong>der</strong>t, hatten jedoch nur<br />
21%; 64% blieben bei ihrem bisherigen Einkaufsverhalten. 15% gaben<br />
keine Antwort. Hier wurde wie<strong>der</strong> deutlich, dass zwischen Verbrauchereinstellungen<br />
und tatsächlichem Verbraucherverhalten eine große Kluft<br />
besteht, so Dr. Clemens Dirschel, Geschäftsführer des Evang. Bauernwerkes<br />
und EKD-Agrarbeauftragter, <strong>der</strong> den Kurs leitete. Nichtsdestotrotz seien<br />
solche Verbraucherbefragungen wichtig, um die Wünsche und Bedürfnisse<br />
<strong>der</strong> Verbraucher zu erfahren und in <strong>der</strong> zukünftigen Betriebsgestaltung die<br />
Akzeptanz <strong>der</strong> Bevölkerung gewinnen zu können. Zur Freude <strong>der</strong> jungen<br />
<strong>Land</strong>wirte sahen nur 5% <strong>der</strong> Befragten die <strong>Land</strong>wirtschaft als Schuldigen<br />
für den Dioxinskandal, 71% nannten die Futtermittelindustrie als<br />
Hauptverursacher und 33% die Politik. 11% meinten, die Billigmentalität<br />
<strong>der</strong> Verbraucher sei schuld daran.<br />
Barbara Fetzer-Haag
Stellungnahme <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> zum<br />
Dioxinskandal (Februar 2011)<br />
Die Aufdeckung einer absolut zu verurteilenden strafrechtlichen<br />
Handlung – wie in diesem Fall die vorsätzliche o<strong>der</strong> fahrlässige<br />
Vermischung von Fetten – darf nicht zu einer Verunsicherung <strong>der</strong><br />
Verbraucher und Kriminalisierung ganzer Branchen genutzt werden.<br />
Es ist in diesem Fall vielmehr erfor<strong>der</strong>lich die Dioxinproblematik als<br />
Teil unserer Industrieproduktion darzulegen und auch auf das<br />
Vorhandensein von Rückständen im Boden hinzuweisen.<br />
Ökologische und konventionell erzeugte Lebensmittel können also<br />
gleichermaßen betroffen sein.<br />
Im Falle des aktuellen Skandals wurde in einem einzigen Futtermittelwerk<br />
trotz Grenzwertüberschreitungen bewusst belastetes<br />
Material verarbeitet. Durch die Berichterstattung wurde jedoch <strong>der</strong><br />
Eindruck vermittelt, dass die heutige Agrar- und Ernährungsindustrie<br />
generell für die Dioxinbelastung verantwortlich sei. Dies hat zu<br />
einem erheblichen Imageschaden und Preisverfall geführt, <strong>der</strong><br />
gerade für mittel- und kleinbäuerliche Betriebe Existenz gefährdend<br />
ist.<br />
Deshalb appelliert die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> an die Verantwortung<br />
<strong>der</strong> Medien und einzelne Organisationen ihr eigenes<br />
Verhalten ethisch zu überdenken. Eine sensationsorientierte, die<br />
Bevölkerung fast hysterisierende Berichterstattung ist hier nicht<br />
angebracht.
Fairer Konsum – ein Zukunftsthema<br />
Auch die Reaktionen auf die Filmszene „Regenwald und Hunger“<br />
zeigten Betroffenheit und mindestens spontane Bereitschaft zu<br />
Verhaltensän<strong>der</strong>ungen bei den Schülern: Fast 90% sind überzeugt,<br />
dass Armut und Hunger in <strong>der</strong> Dritten Welt mit unserem<br />
Essensverhalten in Verbindung stehen. 60% wären bereit, für ein<br />
Fair Trade-Produkt mehr zu bezahlen! Wichtig ist den Schülern v.a.<br />
<strong>der</strong> Verzicht auf Kin<strong>der</strong>arbeit, gerechte Löhne und faire<br />
Arbeitsbedingungen.<br />
Dennoch sehen die Schülerinnen und Schüler in beson<strong>der</strong>er<br />
Verantwortung zur Verän<strong>der</strong>ung in erster Hinsicht die Politik, gefolgt<br />
von den Verbrauchern, dann auch die Eltern und die Medien.<br />
In <strong>der</strong> anschließenden Diskussion ging es intensiv um den Weg von<br />
<strong>der</strong> Einsicht zur Umsetzung. Die Umfragen fallen von ihrer Leitfrage<br />
nach ethischem Konsum her oft positiver aus als das tatsächliche<br />
Verbraucherverhalten. Bei Jugendlichen, die nur teilweise selber<br />
Lebensmittel einkaufen, ist die Umsetzung wohl noch schwieriger. Es<br />
hängt z.B. auch von <strong>der</strong> Nähe alternativer Einkaufsmöglichkeiten und<br />
vom Preisunterschied ab.<br />
Wie würde dieselbe Untersuchung wohl bei Hauptschülern ausfallen?<br />
Setzt ethischer Konsum Bildung und Einkommen voraus? Auch die<br />
Fähigkeit, frische Produkte zuzubereiten, ist teilweise verloren<br />
gegangen. Würden sich sonst Familien mit geringem Einkommen oft<br />
mit Fertigprodukten ernähren, wenn sie hochwertige regionale<br />
Produkte preisgünstig frisch zubereiten könnten?<br />
Fazit: Ein wachsen<strong>der</strong> Bevölkerungsanteil als auch Jugendliche sind<br />
durchaus bereit, ethisch bewusster zu konsumieren, wenn sie<br />
entsprechend darauf hingewiesen werden und Betroffenheit entsteht.<br />
Eine Investition in schulische und außerschulische Bildung<br />
lohnt sich!<br />
Bernd Hofmann
Winter-Initiativkreis Dezember 2010: Patentierung von<br />
Pflanzen und Tieren – Stand, Entwicklung und ethische<br />
Bewertung<br />
Wem gehört die Schöpfung? Das<br />
war Thema unseres Wintertreffens,<br />
zu dem die Biowissenschaftlerin Dr.<br />
Beatrice van Saan-Klein, Umweltbeauftragte<br />
<strong>der</strong> Diözese Fulda,<br />
nach Hohebuch gekommen war.<br />
Einer ihrer wichtigen Arbeitsbereiche<br />
ist die Umweltethik – dazu<br />
gehört auch die ethische Orientierung<br />
im Konflikt um Biopatente.<br />
Besitzrechte am Leben<br />
Patente sind Besitzrechte, die für Erfindungen erteilt werden und<br />
dem Inhaber das alleinige Verfügungs- und Nutzungsrecht daran<br />
gewähren. Das erscheint durchaus im Sinne <strong>der</strong> Gesellschaft, denn<br />
es regt an, durch mögliche Gewinnerzielung, im Sinne des<br />
Fortschritts weiterhin forschend aktiv und investiv zu sein. Die Frage<br />
ist jedoch, ob dies auch für Biopatente gilt. Für Christen, so die<br />
Referentin, ist das Leben und seine Vielfalt eine Schöpfung Gottes,<br />
weshalb es ein menschliches Besitzrecht am Leben im Grundsatz<br />
nicht geben dürfe. Dieses Schöpfungsverständnis sei nicht nur auf<br />
das Christentum beschränkt, son<strong>der</strong>n werde in vielen monotheistischen<br />
Religionen geachtet.<br />
Biopatente ermöglichen „Biopiraterie“<br />
Bis etwa Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre hat <strong>der</strong> Grundsatz gegolten, dass<br />
die genetische Ressource allen und gleichzeitig niemandem gehören<br />
könne. Auch im Patentrecht hat sich dies ursprünglich so<br />
nie<strong>der</strong>geschlagen, so dass es zunächst keine Patente auf Leben<br />
geben konnte. Heute existieren in den Industriestaaten aber<br />
teilweise weitgehend formulierte Besitzansprüche und auch erteilte<br />
Patentrechte an biologischen Ressourcen. Weil sich aber die<br />
patentierte Bio-Ressource überwiegend in den Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
befindet, die Biopatentrechte und natürlich auch <strong>der</strong> daraus zu
ziehende finanzielle Nutzen aber in den Industriestaaten angesiedelt<br />
sind, entsteht daraus eine entwicklungspolitische Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
für soziale Gerechtigkeit. Unter dem Begriff „Biopiraterie“ wird diese<br />
Ungerechtigkeit drastisch dargestellt: wem gehört die wertvolle Bio-<br />
Ressource, dem Konzern, <strong>der</strong> sie im Labor analysiert hat, o<strong>der</strong><br />
denjenigen Menschen in <strong>der</strong>en natürlichen und kulturellen<br />
Lebensraum die Ressource beheimatet ist.<br />
Biopatente contra biologische Vielfalt<br />
Als Biologin versteht Beatrice van Saan-Klein unter Biodiversität die<br />
Vielfalt <strong>der</strong> Arten und <strong>der</strong> Gene, aber auch die Vielfalt <strong>der</strong><br />
Ökosysteme. Auf <strong>der</strong> Erde seien bisher 1,7 Mio. Arten beschrieben,<br />
30.000 davon seien essbar und viele seien noch unerforscht. Diese<br />
wun<strong>der</strong>bare Vielfalt sei ein Geschenk Gottes, ein Wert an sich und<br />
die Grundlage des Lebens für uns Menschen heute. Aber weil die<br />
Artenvielfalt auch Lösung vieler künftiger Probleme in sich birgt,<br />
stelle sie auch wirtschaftlich gesehen einen Kapitalwert dar. Da die<br />
Artenvielfalt drastisch zurückgehe, erhöhe dies zusätzlich ihren<br />
Marktwert. Die kapitalstarke Wirtschaft <strong>der</strong> Industrielän<strong>der</strong> des<br />
Nordens sei daher bestrebt, sich möglichst viel <strong>der</strong> Rechte an den<br />
biologischen Ressourcen <strong>der</strong> Erde zu sichern. Damit ergäben sich<br />
eine Reihe von Fragen: Wem gehören die Bio-Ressourcen? Wer hat<br />
in Zukunft den Zugriff darauf? Wer zieht den finanziellen Nutzen?<br />
Welchen Einfluss hat dies auf<br />
die Biodiversität sowie auf die<br />
Gen- und Sortenvielfalt <strong>der</strong><br />
Nutzpflanzen? Die großzügige<br />
Erteilung von Biopatenten an<br />
kapitalstarke Konzerne in den<br />
Industriestaaten stelle für die<br />
Nutzungsrechte <strong>der</strong> Menschheit<br />
an <strong>der</strong> Schöpfung eine<br />
große Gefahr dar.<br />
Biopatentrecht begünstigt starke Akteure<br />
Dadurch, dass sich das Patentrecht – natürlich auch das Biopatentrecht<br />
– mit <strong>der</strong> wirtschaftlichen Entwicklung in den Indus-
triestaaten entwickelt habe, hätten die indigenen Völker bei dieser<br />
Entwicklung praktisch nicht mitreden können. Deshalb habe sich das<br />
Biopatentrecht im Interesse <strong>der</strong> starken Wirtschaftsakteure in den<br />
Industriestaaten entwickelt, zu Lasten <strong>der</strong> wirtschaftlich schwachen<br />
Entwicklungslän<strong>der</strong>. Da sich die Patentämter durch die Gebühren für<br />
die erteilten Patente finanzieren müssten, führe dies zu einer<br />
großzügigen Patenterteilung. Zwar habe man die Möglichkeit, gegen<br />
Biopatente Einspruch zu erheben, so dass diese wie<strong>der</strong> zurück<br />
genommen würden, wie zum Beispiel beim Schweinepatent – doch<br />
sei dies nur innerhalb einer begrenzten Frist möglich. Ohne finanziellen<br />
Rückhalt sei man bei Wi<strong>der</strong>spruchsverfahren oftmals chancenlos.<br />
Auch die Hoffnung, dass Patente ja nur auf 20 Jahre erteilt<br />
würden, sei trügerisch, da durch geringfügige Zusatzerfindungen das<br />
Biopatent häufig wie<strong>der</strong> verlängert werden könne.<br />
Inzwischen sei das ganze Patentrecht so kompliziert geworden, dass<br />
eine simple und an sich eng begrenzte biotechnische Verfahrenserfindung<br />
rechtlich zum so genannten Stoffschutz verbreitert<br />
werde. Ein Beispiel dazu sei das Brokkolipatent.<br />
Letztlich werde durch diese<br />
Kompliziertheit <strong>der</strong> angestrebte<br />
politische Prozess zur Reform des<br />
Biopatentrechtes erschwert. In<br />
<strong>der</strong> abschließenden Diskussion<br />
kam deutlich zum Ausdruck,<br />
dass es für Christen keine<br />
Patente auf Leben geben<br />
könne. Nicht nur <strong>der</strong> Schöpfungsgedanke<br />
verbiete dies, son<strong>der</strong>n auch die weltweite Gerechtigkeit:<br />
die Schöpfung und das Leben gehören allen Menschen!<br />
Hansjörg Keyl
Thema Biopatente beim<br />
Bezirksarbeitskreis Göppingen<br />
Mit hohem Tempo werden in <strong>der</strong> EU Patente auf Pflanzen und/o<strong>der</strong><br />
Tiere vergeben. Diese so genannten Biopatente beschränken sich<br />
nicht auf gentechnisch verän<strong>der</strong>te Organismen. Was kommt auf uns<br />
zu, was ist zu befürchten, wenn diese Entwicklung anhält? Hohe<br />
Lizenzgebühren? Nachbau -und Nachzuchtverbot? Abhängigkeit und<br />
Bedrohung <strong>der</strong> Sorten– und Rassenvielfalt? Eine grundlegende<br />
Reform des Biopatentrechts erscheint nötig. Dafür setzen sich aktuell<br />
kirchliche und berufsständische Organisationen ein.<br />
Auch <strong>der</strong> Bezirksarbeitskreis des Evangelischen Bauernwerkes im<br />
Dekanat Göppingen beschäftigt sich mit dieser Thematik. In<br />
Zusammenarbeit mit Bauerverband und <strong>Land</strong>frauen fand dazu in<br />
Süßen eine Vortragsveranstaltung statt. Referentin war Dr. Maren<br />
Heincke vom Evangelischen <strong>Land</strong>dienst aus Hessen-Nassau. Wenn<br />
Wissenschaftler entdeckt haben, so die Referentin, welches Gen für<br />
welche Eigenschaften zuständig ist, können sie beim Europäischen<br />
Patentamt (EPA) in München dafür ein Patent beantragen. Sie wollen<br />
damit natürlich Geld verdienen. Solche Patente seien schon bei<br />
Pflanzen und Tieren vergeben worden. Dramatisch sei es, wenn die<br />
Grenzen zu menschlichen Genpatenten gebrochen würden. In<br />
Amerika seien bereits für ein Drittel des menschlichen Erbgutes<br />
Biopatente erteilt worden. Es gebe bei uns zwar seit 1998 die<br />
Europäische Biopatentrichtlinie, diese entspreche den aktuellen<br />
Schutz-anfor<strong>der</strong>ungen aber keinesfalls.<br />
hjk
Frühjahrs-Initiativkreis März 2011:<br />
<strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> Plus –Regionalwert AG Freiburg<br />
und Tübinger Bio-Bauernmilch GmbH<br />
Seit Jahren arbeitet die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> am Brückenschlag<br />
zwischen <strong>Land</strong>wirtschaft und Verbrauchern. Beim Frühjahrstreffen<br />
ging es um Modelle, welche die Regionalvermarktung intensiv för<strong>der</strong>n.<br />
In gewisser Weise könnte man deshalb auch von einer <strong>Stadt</strong>-<br />
<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> Plus sprechen: finanzielle und partnerschaftliche<br />
Beteiligungen von Verbrauchern als Aktionäre o<strong>der</strong> Gesellschafter an<br />
Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Nahrungsmitteln<br />
innerhalb einer Region. Konkret wurde die Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft<br />
aus <strong>der</strong> Region Freiburg sowie die Tübinger Bio-<br />
Bauernmilch GmbH vorgestellt.<br />
Ein Demeterbetrieb als Ausgangspunkt<br />
Christian Hiß überlegte als Gemüsegärtner vor 30 Jahren wie seine<br />
Zukunft auf dem elterlichen Hof in Eichstetten beim Kaiserstuhl<br />
aussehen könnte. Abschreckende Beispiele waren die hochverschuldeten<br />
Gartenbaubetriebe mit hohen Suizidraten in Holland<br />
sowie die steigende Arbeitsbelastung seiner Kollegen. Außerdem<br />
wollte er den Trend <strong>der</strong> zunehmenden Spezialisierung auf Chicoree,<br />
Spargel o<strong>der</strong> Erdbeeren aus<br />
ökologischen und sozialen<br />
Gründen nicht mitmachen.<br />
Daraus entstand die Idee <strong>der</strong><br />
Regionalwert AG bei Freiburg.<br />
Sein Ziel war es, die 99% reinen<br />
Verbraucher mit den 1%<br />
Bauern zu verknüpfen – und<br />
dies über eine Bürger-Aktiengesellschaft.
Auch die Art und Weise, in <strong>der</strong> heute <strong>Land</strong>- und Gartenbau<br />
überwiegend betrieben werde, sei ein wesentlicher Antrieb für sein<br />
Engagement. Mit vielem, z.B. mit den 90% Hybridsorten im<br />
konventionellen Gartenbau o<strong>der</strong> mit den Substratkulturen in Holland<br />
sei er keinesfalls einverstanden. Letztlich sei es auch wichtig, dass<br />
die Gesellschaft nicht nur als Verbraucher mitbestimmen solle, wie<br />
die <strong>Land</strong>wirtschaft <strong>der</strong> Zukunft aussehen soll.<br />
Die Regionalwert AG investiert im Ernährungsbereich<br />
Die Regionalwert AG hat mit bisher 460 Aktionären ein Grundkapital<br />
von 1,7 Mio Euro. Bei Bürgern wird Kapital gesammelt, um in die regionale<br />
Wertschöpfungskette des Nahrungsfeldes zu investieren. Es<br />
war die Idee von Christian Hiß zum einen die Bürger an <strong>der</strong> regionalen<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft, an <strong>der</strong> Nahrungsverarbeitung und -vermarktung<br />
finanziell zu beteiligen und ihnen so eine Mitbestimmung zu ermöglichen.<br />
An<strong>der</strong>erseits aber soll durch den Verbund <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Wertschöpfungsstufen auch ein Ausgleich erreicht werden für die<br />
traditionell nur geringe Wertschöpfung in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft. Außerdem<br />
soll durch das Finanzierungsmodell <strong>der</strong> Übergang <strong>der</strong> Betriebe<br />
an die Folgegeneration finanziell erleichtert o<strong>der</strong> überhaupt erst ermöglicht<br />
werden. Und nicht zuletzt spielt die ökonomische, ökologische<br />
und soziale Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Warum, so<br />
Christian Hiß einleuchtend, sollte bei Lebensmitteln nicht möglich<br />
sein, was bei Windkraftwerken gängige Praxis sei: zivilgesellschaftliches<br />
Engagement auch für die Agrar- und Ernährungswirtschaft vor<br />
Ort zu mobilisieren. Dabei soll die Investition für den Investor<br />
ausdrücklich ein zweifaches Geschäftsergebnis erbringen: einerseits<br />
den ökonomischen Gewinn und an<strong>der</strong>erseits den ökologisch sozialen<br />
Gewinn innerhalb <strong>der</strong> Region!<br />
Unter <strong>der</strong> Internetadresse www.regionalwert-ag.de können<br />
weitere <strong>Informationen</strong> dazu abgerufen werden.
Naturaliengewinn Milch<br />
Ein weiteres Erzeuger-Verbraucher-Modell stellte <strong>der</strong> <strong>Land</strong>esgeschäftsführer<br />
von Bioland Baden-Württemberg, Dr. Christian<br />
Eichert vor: die Tübinger Bio-Bauernmilch GmbH. Auch hier wird<br />
durch so genannte Genussrechte für 500 Euro/Stück die<br />
Bürgerbeteiligung im Interesse <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft ermöglicht. Sechs<br />
<strong>Land</strong>wirte liefern die Milch, verarbeiten sie und setzen sie im<br />
Großraum Tübingen in so genannten „Ecolean-Milchbeuteln“ ab. Die<br />
Anteilszeichner erhalten zwar nur eine geringe Kapitalverzinsung,<br />
dafür aber eine Naturalausschüttung von wöchentlichen<br />
Milchlieferungen. „Näher und frischer geht’s nicht“, so Eichert zur<br />
Vorteilhaftigkeit dieses Konzepts.<br />
Unter www.bioland-bw.de/download/tuebio-infoflyer.pdf gibt es<br />
im Internet einen Flyer in dem diese GmbH vorgestellt wird<br />
In <strong>der</strong> anschließenden Aussprache überschlugen sich die Ideen <strong>der</strong><br />
Tagungsteilnehmer geradezu: wie wäre es mit einer Hohenloher<br />
Regionalwert AG zur Stärkung <strong>der</strong> regionalen Wertschöpfung und zur<br />
Verbindung zwischen heimischer <strong>Land</strong>wirtschaft und Verbrauchern?<br />
Hansjörg Keyl
Sommer-Initiativkreis Juli 2011:<br />
Hohenloher <strong>Land</strong>tour – Weg <strong>der</strong> Vielfalt<br />
Um die Vielfalt in Natur und <strong>Land</strong>wirtschaft ging es bei <strong>der</strong><br />
diesjährigen Hohenloher <strong>Land</strong>tour. 25 Teilnehmer machten sich auf<br />
den Weg in den <strong>Land</strong>kreis Schwäbisch Hall.<br />
Prämierter Pfarrgarten in Großaltdorf<br />
Unser Mitglied, Pfarrer Bernd Hofmann, begrüßte uns vor seinem<br />
Pfarrhaus in Großaltdorf. Seinen Pfarrgarten hat er vor etwa acht<br />
Jahren als Wildblumen-Garten neu angelegt. Große Sträucher,<br />
Bäume und Gestrüpp hätten alles überwuchert, weswegen er für<br />
eine Neuanlage roden musste.<br />
Der Pfarrgarten ist inzwischen ein einziges buntes<br />
Wildblumenparadies. Es gibt verschiedene Standorte, alle in üppiger<br />
Vielfalt und von großer Sehenswertigkeit – ein Refugium <strong>der</strong><br />
Biodiversität. Die Samen für dieses Kleinod stammen von <strong>der</strong> Firma<br />
Rieger-Hofmann, die heimische Wildblumen in großem Stil vermehrt.<br />
Auf dem Blumen-Kräuterrasen blühen und gedeihen:<br />
Frühling: Krokus, Wiesenschaumkraut, Gänseblümchen, Margeriten-Salbei,<br />
Hornklee<br />
Sommer: Kammgras, Habichtskräuter, Schafgarbe, Heidenelke<br />
Pflege: selten Rasenmähen, Blumeninseln stehen lassen zum Aussamen<br />
mindestens alle zwei bis drei Jahre. Margeriten nicht oft aussamen<br />
lassen, sie nehmen in dem (dem Magerrasen nachempfundenen)<br />
Blumenrasen leit überhand.<br />
Wo gewünscht: häufiges Mähen ergibt blumenarmes Gras<br />
Weitere Tipps erteilt auf Anfrage:<br />
Pfr. Bernd Hofmann, ( 07907-326, E-Mail: pfarramt.grossaltdorf@gmx.de<br />
Auch die Ortschaft Großaltdorf hat sich vom Engagement ihres<br />
Pfarrers anstecken lassen, so gibt es einen Arbeitskreis <strong>der</strong><br />
verschiedene Projekte zur Biodiversität im Ort und auf <strong>der</strong>
Gemarkung realisiert hat, was auch von <strong>der</strong> Ortsvorsteherin<br />
unterstützt wurde:<br />
} eine Führung zu Raritäten <strong>der</strong> heimischen Flur wie Prachtnelken<br />
o<strong>der</strong> Frühlingsenzian und einen Vortragsabend mit Probe alter<br />
heimischer Apfelsorten und daraus veredelter Produkte.<br />
} Brautpaare haben einen Apfelbaum einer alten heimischen Sorte<br />
(z.B. Gewürzluike, Kaiser-Wilhelm) spendiert und auf <strong>der</strong><br />
Gemeindewiese gepflanzt.<br />
} zur Biotopvernetzung wurde eine Benjeshecke angelegt und<br />
mögliche Blühstreifen kartiert. Für den Bauernhof wurde ein<br />
Mähplan für Weg- und Bachrän<strong>der</strong> erstellt, um für Insekten,<br />
Vögel, Feldhasen und Rebhühner in den Stauden Nahrung und<br />
Unterschlupf zu ermöglichen.<br />
} artenarme Wiesen wurden durch Fräsen von Streifen und<br />
Aufbringen von artenreichem Wiesenschnitt blumenreicher<br />
(=Heumulchsaat). Eine kommunale Magerweise wird gepflegt.<br />
} unterstützt vom Bauhof und dem kommunalen Jugendclub<br />
„Dixxn“ wurde eine Hang-Magerwiese umzäunt, um sie durch<br />
Beweidung vor dem Zuwachsen zu bewahren.<br />
Der Initiator des Prachtgartens, unser Mitglied Bernd Hoffmann, hat für sein Projekt<br />
den <strong>Land</strong>esnaturschutzpreis erhalten.
Vielseitige <strong>Land</strong>wirtschaft in Kleinallmerspann<br />
Nächste Station war <strong>der</strong> Aussiedlerhof <strong>der</strong> Familie Blumenstock in<br />
Kleinallmerspann. „Ich bin <strong>Land</strong>wirt geworden, weil mir dies Spaß<br />
macht“, meinte Jörg Blumenstock gleich zu Beginn seiner Führung<br />
durch den Betrieb.<br />
Aus dem traditionellen Bullenmastbetrieb mit Ackerbau und<br />
Verschlussbrennerei ist ein vielfältiger Betrieb mit Ferkelerzeugung<br />
(250 Mutterschweine), Schweinemast (1400 Plätze) und<br />
Biogasanlage geworden. Auf einem <strong>der</strong> großen Dächer steht eine<br />
Photovoltaikanlage und an <strong>der</strong> nahen Windkraftanlage ist man<br />
ebenfalls beteiligt. Spätestens beim Mittagessen wurde deutlich, dass<br />
zum Betriebskomplex Blumenstock auch noch eine attraktive<br />
Gaststube gehört, in <strong>der</strong> von Frau Blumenstock Gruppen und<br />
Festgesellschaften vorzüglich bewirtet werden.<br />
Traditionelles Standbein: Bullenmast<br />
Alle vier Wochen wird eine Gruppe von 30 männlichen Kälbern<br />
versteigert. Sowohl <strong>der</strong> Kälberstall als auch <strong>der</strong> Bullenstall für die<br />
Bullen <strong>der</strong> Premium-Linie sind Offenställe. Neben den Premium-<br />
Bullen <strong>der</strong> Marke Clasivo wird noch eine zweite Produktlinie erzeugt,<br />
die Jörg Blumenstock als „HQZ-Bullen“ o<strong>der</strong> „normale<br />
Qualitätsbullen“ bezeichnet. Für Premium-Bullen bestehen folgende<br />
Kernpunkte: Stroheinstreu, beson<strong>der</strong>s luftiger und heller Stall,<br />
Fütterung ausschließlich mit Getreideschrot, Heu und Stroh,<br />
Schlachtalter 12 Monate und Schlachtgewicht 500 kg. Das Beson<strong>der</strong>e
am Premium-Rindfleisch sei, dass es sehr zart, kurzfaserig und leicht<br />
marmoriert sei.<br />
Naturschutzbund (NABU) Kirchberg: Engagement für Biodiversität<br />
Die Kirchberger NABU-Gruppe engagiert sich seit vielen Jahren in <strong>der</strong><br />
Biotoppflege, z.B. <strong>der</strong> extensiven Nutzung von Wiesen, und <strong>der</strong> Pflege<br />
von Streuobstbeständen. Über die Bereitung und den Vertrieb von<br />
Most und Apfelsaft wird zudem versucht die Streuobstbestände zu<br />
nutzen. Der Vorsitzende Bruno Fischer war bei unserer Führung ganz<br />
in seinem Element. Er hält Schafe und schottische Hochlandrin<strong>der</strong>,<br />
mit denen er extensive Wiesen unter Streuobstbäumen abweidet und<br />
damit zu <strong>der</strong>en Erhaltung beiträgt. Die Hochlandrin<strong>der</strong> sind sehr<br />
robust und können das ganze Jahr auf <strong>der</strong> Weide verbleiben.<br />
Ein beson<strong>der</strong>s reizvolles<br />
Besichtigungsobjekt erlebten<br />
wir in einer<br />
Jagst Auenlandschaft.<br />
Keine Straße, kein Radweg<br />
und keine Eisenbahn<br />
führen durch<br />
diesen Teil des Jagsttals<br />
direkt unterhalb<br />
des Kirchberger Schlosses.<br />
Auch hier wird vom NABU ein Stück Auenwiese extensiv<br />
gepflegt. Es wird nur einmal im Jahr gemäht, was zu einer sehr<br />
vielgestaltigen, bunten Blumenwiese führte.<br />
Ein Trockenhang bei Mistlau war die letzte Kirchberger NABU-Station<br />
und auch <strong>der</strong> Abschluss <strong>der</strong> Hohenloher <strong>Land</strong>tour. Der Botaniker<br />
Peter Hartig zeigte die Pflanzen- und Blumenvielfalt solcher<br />
Trockenlagen: früher wurde die <strong>Land</strong>wirtschaft durch die Nutzung<br />
mit Schafen offen gehalten. Ohne Weidenutzung o<strong>der</strong> gelegentliche<br />
Mahd entsteht aber Buschwald und später Hochwald, wodurch die<br />
Pflanzen- und Blumenvielfalt gefährdet wäre.<br />
Hansjörg Keyl
Hohebucher Agrargespräch 2011<br />
Die Reform <strong>der</strong> europäischen Agrarpolitik<br />
Für unsere <strong>Land</strong>wirtschaft ist die Zukunftsgestaltung <strong>der</strong><br />
europäischen Agrarpolitik ein wichtiges aktuelles Thema. Das<br />
diesjährige Hohebucher Agrargespräch richtete den Blick daher auf<br />
verschiedene inhaltliche Positionen.<br />
Mehr Liberalisierung – aber Direktzahlungen beibehalten!<br />
Warum schon wie<strong>der</strong> eine Agrarreform – so fragte <strong>der</strong> damalige<br />
Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums und heutige Leiter<br />
des Agrarministeriums in Stuttgart, Wolfgang Reimer, und gab auch<br />
gleich die Antwort: Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft und <strong>der</strong><br />
globalen Agrarmärkte sollten durch<br />
eine Liberalisierung <strong>der</strong> Agrarpolitik<br />
erreicht werden. Deshalb stünden<br />
einschneidende Maßnahmen, wie<br />
Rückführung <strong>der</strong> EU-Agrar-Aufwendungen,<br />
Abbau <strong>der</strong> Agrarpreisstützung,<br />
Einführung einheitlicher<br />
Direktzahlungen, Entkoppelung <strong>der</strong><br />
Zahlungen von <strong>der</strong> Produktion und<br />
Bindung <strong>der</strong> Zahlungen an gesellschaftliche<br />
Zusatzleistungen an.<br />
Wolfgang Reimer<br />
Reform heißt nach Wolfgang Reimer auch Bereinigung von<br />
Ungleichheiten. Eine Kürzung bei denjenigen Län<strong>der</strong>n, die bisher<br />
höhere Zahlungen erhalten haben als an<strong>der</strong>e, sei bei <strong>der</strong><br />
anstehenden Reform deshalb sehr wahrscheinlich. Die Höhe <strong>der</strong><br />
Direktzahlungen sei in den Mitgliedslän<strong>der</strong>n bisher unterschiedlich<br />
(110,00 bis 600,00 Euro je Hektar). Für Deutschland seien<br />
Kürzungen zu erwarten. Die Bundesregierung hoffe, dass ihr EU-<br />
Beitrag durch die Reform auf ein Prozent des Bruttosozialproduktes<br />
verringert werde. Offen seien auch das „Greening“ über
Umweltauflagen, die Mindestbeihilfe für Kleinlandwirte, die<br />
Deckelung <strong>der</strong> Zahlung an Großbetriebe, <strong>der</strong> Ausschluss von nicht<br />
aktiven <strong>Land</strong>wirten und Prämien für benachteiligte Gebiete.<br />
Grundsätzlich sei die finanzielle Ausstattung <strong>der</strong> Agrarför<strong>der</strong>ung<br />
zwischen Säule 1 / Marktregelungen und Direktzahlungen sowie<br />
Säule 2 / För<strong>der</strong>ung des ländlichen Raumes in <strong>der</strong> Diskussion.<br />
Wolfgang Reimer sieht zwei Lager bei den Verhandlungen: die<br />
Gruppe <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>, die zu mehr Liberalisierung <strong>der</strong> Agrarpolitik<br />
neigten – dazu gehöre auch Deutschland – sowie die Län<strong>der</strong>, die den<br />
bisherigen Kurs <strong>der</strong> Pauschalför<strong>der</strong>ung für die <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
beibehalten wollten – dazu sei Frankreich zu rechnen.<br />
Subventionsabbau als Strategie<br />
Poul Ottosen stellte als Gesandter-Botschaftsrat und Leiter <strong>der</strong><br />
Abteilung Ernährung, <strong>Land</strong>wirtschaft und Fischerei <strong>der</strong> Königlich<br />
Dänischen Botschaft in Berlin die Position <strong>der</strong> „agrarliberalen Län<strong>der</strong>“<br />
wie Großbritannien, Holland<br />
o<strong>der</strong> auch Skandinavien dar. Die<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft habe in Dänemark<br />
eine Entwicklung zu<br />
größeren Betrieben mit wenig<br />
Arbeitskräften und kostengünstiger<br />
Produktion genommen. Zwei<br />
Drittel <strong>der</strong> Agrarproduktion werde<br />
exportiert, deshalb sei die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Wettbewerbskraft<br />
<strong>der</strong> dänischen <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
im globalen Agrarmarkt<br />
beson<strong>der</strong>s wichtig.<br />
Poul Ottosen<br />
Die Strategie <strong>der</strong> dänischen Agrarpolitik gehe eindeutig zur<br />
Liberalisierung und zum völligen Abbau <strong>der</strong> Agrarsubventionen.<br />
Gemessen an dieser Strategie schreite die Liberalisierung des<br />
Agrarmarktes zu langsam voran. An<strong>der</strong>erseits müsse die<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft umwelt- und klimafreundlicher werden. Es bleibe
unklar, wie die dänische Regierung diese beiden kontroversen Ziele<br />
vereinbaren will.<br />
Zusammenfassend stellte Poul Ottosen For<strong>der</strong>ungen an die GAP-<br />
Reform: mehr Marktorientierung, För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit,<br />
Ausgleich für die Produktion öffentlicher Güter wie<br />
Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz und Biodiversität<br />
(„public money for public goods“). Die Agrarreform müsse<br />
ein grünes Wachstum in den ländlichen Räumen ermöglichen.<br />
Notwendig dazu sei die stärkere För<strong>der</strong>ung von Bildung, Forschung<br />
und Innovation.<br />
Direktzahlung nicht plausibel<br />
Als Vertreter <strong>der</strong> Agrarökonomie und Mitautor des europäischen<br />
Memorandums zur Reformerfor<strong>der</strong>nis <strong>der</strong> europäischen Agrarpolitik<br />
bezeichnete Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Koester von <strong>der</strong> Universität Kiel<br />
die EU-Direktzahlungen an die <strong>Land</strong>wirtschaft innerhalb <strong>der</strong> 1. Säule<br />
als „falsche Anreize“, welche das Gemeinwohl schädigten. Durch<br />
diese Zahlungen würden EU-Gel<strong>der</strong> ohne befriedigende Begründung<br />
in die <strong>Land</strong>wirtschaft fließen. Alle bisherigen Begründungen für<br />
Ausgleichszahlungen erfolgten „aus egoistischen Motiven eines<br />
Berufsstandes“. We<strong>der</strong> die Begründung des Ausgleichs für<br />
Einnahmeausfälle aus den<br />
90er Jahren noch die Begründung<br />
<strong>der</strong> regionalen Ungleichgewichte<br />
o<strong>der</strong> die höheren<br />
Produktionsstandards ließ er<br />
gelten. Stattdessen for<strong>der</strong>te er<br />
klar definierte Umwelteffekte<br />
zu benennen und danach die<br />
Ausgleichszahlungen zielgenau<br />
vorzunehmen: also Abschaffung<br />
<strong>der</strong> 1. Säule und Konzentration<br />
auf die 2. Säule.<br />
Ulrich Koester
Mehr Gewicht für den Umwelt- und Klimaschutz.<br />
Ähnlich wie Professor Koester äußerte sich auch Tobias Reichert,<br />
Agrarexperte <strong>der</strong> umwelt- und entwicklungspolitischen Organisation<br />
„Germanwatch“, <strong>der</strong> die Sichtweise eines Bündnisses von Nichtregierungsorganisationen<br />
präsentierte. Nach wie vor ließen sich Umweltprobleme<br />
<strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft feststellen, wie Nitratüberschüsse,<br />
Verlust <strong>der</strong> Artenvielfalt, Produktion von klimaschädlichen Gasen und<br />
<strong>der</strong> Ausbau von gesellschaftlich nicht akzeptierten „Massentieranlagen“.<br />
Von daher sehe<br />
sich Germanwatch bestätigt,<br />
dass in den Kommissionsvorschlägen<br />
<strong>der</strong> Umwelt- und<br />
Klimagedanke künftig mehr<br />
Gewicht in <strong>der</strong> Agrarpolitik<br />
erhalten sollte. Damit plädierte<br />
er für entsprechende Umwelt-<br />
und Tierschutzstandards sowie<br />
eine Größendegression für die<br />
Agrarför<strong>der</strong>ung.<br />
Tobias Reichert<br />
Wi<strong>der</strong>sprüchliche agrarpolitische Ziele<br />
In <strong>der</strong> anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die beiden<br />
Ziele <strong>der</strong> europäischen Agrarpolitik, För<strong>der</strong>ung einer<br />
multifunktionalen <strong>Land</strong>wirtschaft einerseits und Ausbau ihrer<br />
Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt wi<strong>der</strong>sprüchlich sind. Von<br />
Seiten <strong>der</strong> EU-Kommission wurde bisher keine Strategie zur präzisen<br />
Ausführung einer möglichen Kohärenz entworfen. Als möglicher<br />
positiver Ansatz wurde von Wolfgang Reimer <strong>der</strong> Ausbau einer<br />
Eiweißstrategie innerhalb <strong>der</strong> europäischen Agrarpolitik benannt, um<br />
sich von den enormen Sojaimporten aus Asien und Amerika<br />
unabhängiger zu machen.<br />
Von deutscher Seite aus gebe es dazu Vorschläge, um im Interesse<br />
einer Kreislaufwirtschaft den Körnerleguminosenbau zu för<strong>der</strong>n,<br />
ebenso die Erforschung und den Anbau eines „eingedeutschten“
Sojas, analog zur <strong>Land</strong>wirtschaft ähnlicher Breitengrade wie Kanada<br />
und Kasachstan. Hier sei durchaus auch eine „Greening-Komponente<br />
für die Fruchtfolge“ in <strong>der</strong> ersten Säule vorstellbar.<br />
Hansjörg Keyl<br />
Hohebucher Stellungnahme zur Reform<br />
<strong>der</strong> Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)<br />
• Schon die Gründung <strong>der</strong> EWG 1957 führte zur GAP. Damals war das<br />
Ziel, die Lebensmittelversorgung durch eine dauerhafte Steigerung<br />
<strong>der</strong> landwirtschaftlichen Produktion zu sichern.<br />
• Die GAP wurde mehrfach reformiert unter dem Druck überquellen<strong>der</strong><br />
Agrarmärkte und <strong>der</strong> daraus resultierenden Kostenexplosion im EU-<br />
Haushalt.<br />
• Die jetzige GAP-Reform soll im EU-Haushalt 2014 in Kraft treten. Die<br />
Reform ist schwierig, denn in <strong>der</strong> größer gewordenen EU (27 Län<strong>der</strong>)<br />
gibt es unterschiedliche Vorstellungen.<br />
• Die EU hat einen Dialogprozess angestoßen über die inhaltliche<br />
Ausrichtung <strong>der</strong> GAP. Auch das Evangelische Bauernwerk hat sich mit<br />
einer Stellungnahme beteiligt: „Agrarpolitik in solidarischer Gestaltung“.<br />
Die wichtigsten Kernpunkte sind folgende:<br />
- Erhaltung flächendecken<strong>der</strong> <strong>Land</strong>bewirtschaftung<br />
- Absage an betriebliche Wachstumsszenarien<br />
- Solidarität zwischen Gesellschaft und <strong>Land</strong>wirtschaft<br />
- Solidarität mit Bauern in Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
- Direktzahlungen für <strong>Land</strong>wirte beibehalten (Säule 1)<br />
- För<strong>der</strong>ung für den ländlichen Raum (Säule 2) auf die<br />
<strong>Land</strong>wirtschaft konzentrieren<br />
Die Stellungnahme kann in Hohebuch bestellt werden:<br />
E-Mail: r.grigo@hohebuch.de<br />
( 07942/107-70<br />
Fax: 07942/107-77<br />
Hansjörg Keyl
<strong>Land</strong> Grabbing<br />
Kommt Bauernland in Bankerhand?<br />
„<strong>Land</strong> Grabbing“ wird zunehmend eine<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für die nationale Ernährungssouveränität.<br />
Laut <strong>der</strong> Welternährungsorganisation<br />
FAO gab es<br />
seit 2008 in 32 Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Erde so<br />
genannte Hungeraufstände. Massive<br />
Preissteigerungen für die Grundnahrungsmittel trieben Menschen auf<br />
die Straße.<br />
Agrarspekulationen<br />
Zuletzt war das in Tunesien <strong>der</strong> Fall mit den bekannten Folgen.<br />
Gründe dafür, dass das täglich Brot plötzlich so teuer wird, liegen auf<br />
<strong>der</strong> Hand. Das internationale Kapital sucht sich in Folge <strong>der</strong><br />
Finanzkrise alternativ zu Immobilien und Aktienmärkten neue Stätten<br />
<strong>der</strong> Wertanlage und Spekulation. Ein Run auf Gold, Silber, Erz und<br />
Kupfer setzte ein, aber auch auf agrarische Rohstoffe. Der<br />
internationale Agrar-Rohstoffindex stieg auf den Höchststand seit<br />
drei Jahren. Allein bei Baumwolle waren es 54 Prozent, bei Kakao<br />
und Kaffeeum 30 Prozent. Die Preise für Süßwaren, Kaffee und<br />
Textilien steigen auch hierzulande. Auch Weizen und Mais wird als<br />
„gold corn“ von Finanzspekulanten entdeckt mit dramatischen Folgen<br />
für die Ernährungssicherung in Entwicklungslän<strong>der</strong>n.<br />
Agro-Energie begehrt<br />
Gleichzeitig wurde im Zuge <strong>der</strong> Klimaschutzdebatte und <strong>der</strong><br />
begrenzten Ölreserven international ein Agro-Energieboom<br />
ausgelöst. Je höher an <strong>der</strong> Zapfsäule <strong>der</strong> Benzinpreis klettert, umso<br />
mehr steigt das Interesse an <strong>der</strong> Energie vom Acker. Hinzu kommt,<br />
dass weltweit die rare Ressource Boden nicht beliebig vermehrbar<br />
ist. In Folge von Klimawandel und Bevölkerungswachstum wird<br />
Boden übernutzt, versalzt und erodiert. Umso attraktiver ist es für<br />
Finanzanleger, in wertvolles Ackerland zu investieren. Auch Staaten
und Unternehmen gehen auf globale Shopping-Tour. Sie wollen die<br />
Nahrung ihrer Bevölkerung bzw. die Rohstoffversorgung sichern.<br />
Flächen für Brotgetreide,<br />
auch Sorghum, werden<br />
weltweit in großem Stil<br />
erworben<br />
China hat in den letzten vier Jahren zwei Millionen Hektar <strong>Land</strong><br />
aufgekauft. Allein im Nachbarland Laos waren es 600 000 ha. Von<br />
den bewässerten Reisflächen soll langfristig eine Jahresernte von<br />
zwei Millionen Tonnen Reis eingefahren werden. Flächeneinkäufe in<br />
Afrika kommen hinzu. Auch Malaysia und Thailand sind in Laos,<br />
einem <strong>der</strong> ärmsten Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Erde, aktiv. Dort haben sie sich 15<br />
Prozent des Staatsgebietes angeeignet. Diese Flächen dienen als<br />
Gummirohr-, Zuckerrohr- und Maniok-Plantagen <strong>der</strong> Bioethanol-<br />
Herstellung sowie Eukalyptus- und Akazienwäl<strong>der</strong> zur<br />
Papierproduktion. Südkorea, die Arabischen Emirate und Saudi-<br />
Arabien tätigten <strong>Land</strong>käufe in Pakistan, auf den Philippinen, in<br />
Kambodscha, Indonesien, <strong>der</strong> Mongolei, in Argentinien und<br />
Madagaskar. Das Interesse ist stets das gleiche. Damit sollen die<br />
Nahrungsversorgung <strong>der</strong> eigenen Bevölkerung mit Mais, Weizen und<br />
reis gesichert und Energiereserven vom Acker aufgebaut werden.<br />
Beson<strong>der</strong>s bizarr zeigt sich solches „<strong>Land</strong> Grabbing“ im Sudan, wo<br />
sich Südkorea fast 700 000 ha und die Arabischen Emirate 380 000<br />
ha für den Weizenanbau gesichert haben. In diesem <strong>Land</strong> besteht<br />
für die hungernde sudanesische Bevölkerung ein Importbedarf von
3,2 Mio Tonnen Nahrungsmitteln. Die Globalisierung <strong>der</strong> Agrarmärkte<br />
zeigt damit ihre unbarmherzige und zynische Seite.<br />
<strong>Land</strong>hunger<br />
Die Ziellän<strong>der</strong> erhoffen sich von den <strong>Land</strong>verkäufen die<br />
Nutzbarmachung brachliegen<strong>der</strong> Ackerflächen sowie die Ansiedlung<br />
be- und verarbeiten<strong>der</strong> Industrien und damit neue Arbeitsplätze.<br />
Ebenso hoffen sie auf den Ausbau von Infrastrukturen und die<br />
Einnahme von Devisen, um die Bevölkerung mit günstigen<br />
Nahrungsmitteln auf den Weltmärkten zu versorgen. Ob solche<br />
Hoffnungen berechtigt sind, ist zweifelhaft. Das Gegenteil ist oftmals<br />
<strong>der</strong> Fall. Aufgrund fehlen<strong>der</strong> Bodenrechtstitel, unklarer Grundstücksgrenzen<br />
und begünstigt von <strong>der</strong> Korruption <strong>der</strong> heimischen<br />
Eliten, die selbst Profiteure des <strong>Land</strong>kaufs sind, werden Kleinbauern<br />
von ihrem Grund gejagt und in Hunger und Verarmung getrieben.<br />
Die <strong>Land</strong>flucht in die ohnehin hoffnungslos überfüllten Slums <strong>der</strong><br />
Großstädte wird forciert.<br />
Politischer Handlungsbedarf<br />
Nur durch ein international abgestimmtes Verhandlungsmandat <strong>der</strong><br />
Staatengemeinschaft kann eine Übereinkunft getroffen werden, den<br />
Ausverkauf von Ackerland zugunsten einzelner Län<strong>der</strong> und des<br />
globalen Finanzkapitals zu stoppen. Hier ist die FAO gefor<strong>der</strong>t, die<br />
Initiative zu ergreifen. Japan hat sich immerhin selbst dazu<br />
verpflichtet, <strong>Land</strong>einkäufe nur noch außerhalb von Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
vorzunehmen, weswegen man nach Neuseeland,<br />
Brasilien und in die USA ausgewichen ist.<br />
Noch stehen wir am Anfang des neuen Phänomens „<strong>Land</strong> Grabbing“.<br />
Noch ist Zeit, politisch zu handeln, bevor aus <strong>der</strong> globalen Shopping-<br />
Tour für Ackerflächen aus egoistischen nationalen Motiven bzw.<br />
Interesse an Spekulationsgewinnen langfristig ein Flächenbrand<br />
entsteht. Der ist zu befürchten, wenn die nationale Ernährungssouveränität<br />
von Völkern gefährdet wird. Daraus könnte sich auch<br />
international eine Friedensbedrohung entwickeln.<br />
Clemens Dirscherl
Wenn das <strong>Land</strong> knapp wird –Das Evangelische<br />
Bauernwerk befasste sich mit dem Thema<br />
<strong>Land</strong> Grabbing – was man mit „<strong>Land</strong> grabschen“ übersetzen<br />
könnte – also die Übernahme von Bauernland durch global<br />
agierende kapitalstarke Investoren, ist nicht neu. Neu ist aber die<br />
Dimension, in <strong>der</strong> dies heute in Afrika, Lateinamerika und Asien aber<br />
auch in Osteuropa passiert. Für solidarisch denkende Menschen ist<br />
solch eine Entwicklung beängstigend.<br />
Ackerland als „green gold“ für Spekulanten<br />
Unter diesem Titel befasste sich <strong>der</strong> Bezirksarbeitskreis (BAK)<br />
Leonberg/Ditzingen in Rutesheim mit dem Thema und Clemens<br />
Dirscherl als Referenten.<br />
<strong>Land</strong> Grabbing in Afrika, Südamerika und Asien<br />
Der BAK Schwäbisch Hall griff das Thema in einem Seminar in<br />
Großallmerspann auf. Referentin war Caroline Callenius von Brot für<br />
die Welt. Von Frau Callenius gibt es bei Brot für die Welt (www.brotfuer-die-welt.de)<br />
ein Kampagnenblatt <strong>Land</strong> Grabbing.<br />
Veranstaltung mit Frau Madyam Rahmanian vom Committee<br />
on World Food Security (CFS)<br />
Bei <strong>der</strong> Veranstaltung in Stuttgart mit Frau Rahmanian (u.a.<br />
zusammen mit Brot für die Welt) hat sich <strong>der</strong> Arbeitskreis<br />
Internationale <strong>Land</strong>wirtschaft (AKIL) ebenfalls mit dem Thema<br />
beschäftigt. Bei den weltweiten Anstrengungen zur<br />
Hungerbekämfung des CSF (Sitz in Rom) ist <strong>Land</strong> Grabbing <strong>der</strong>zeit<br />
eines <strong>der</strong> wichtigsten Themen.<br />
hjk
Breites Kooperationsbündnis zum Thema Welt-<br />
ernährungssicherung: Bauern weltweit in einem Boot<br />
Als kleine Sensation kann das<br />
Podiumsgespräch in Sindelfingen<br />
gelten, zu dem nicht nur <strong>der</strong><br />
Eine-Welt-Laden, die Evangelische<br />
und die Katholische Kirche,<br />
das Evangelische Bauernwerk<br />
son<strong>der</strong>n auch Greenpeace und<br />
<strong>der</strong> Kreisbauernverband eingeladen<br />
hatten, um über die<br />
künftige Welternährungssicherung zu diskutieren. Zukunftstragende<br />
Fragen wie Klimaschutz und Welthunger könnten nur durch ein<br />
breites Bündnis von unterschiedlichen Verbänden und Kirchen in die<br />
Politik hineingetragen werden, so Beate Sicorschi vom BUND-<br />
Umweltzentrum Böblingen.<br />
Der Geschäftsführer des Evangelischen Bauernwerks Dr. Clemens<br />
Dirscherl nannte drei Gründe, warum Bauern weltweit in einem Boot<br />
sitzen:<br />
- die Arbeit <strong>der</strong> Bauern werde we<strong>der</strong> ideell noch materiell<br />
geschätzt. Am Wertschöpfungsprozess verdienen Industrie und<br />
Handel. Der Bauer ist billiger Rohstoffproduzent.<br />
- landwirtschaftsfremde Kräfte eignen sich wertvolles Ackerland<br />
an, sei es für Baumaßnahmen bei uns o<strong>der</strong> in Übersee für<br />
Agrospritproduktion von Finanzspekulanten.<br />
- die Politik habe den Agrarsektor als "schrumpfenden<br />
Wirtschaftsbereich" international abgewertet.<br />
Andreas Kindler, Kreisvorsitzen<strong>der</strong> des Bauernverbands Böblingen,<br />
mahnte den gedankenlosen Konsum an, <strong>der</strong> die Arbeit des Bauern<br />
zur Nahrungsversorgung nicht honorieren würde.
Hans-Werner Schwarz vom Eine-Welt-Laden Sindelfingen zeigte die<br />
entwicklungspolitischen Fehlentwicklungen <strong>der</strong> letzten Jahre auf. In<br />
erster Linie sei nicht <strong>der</strong> Hunger in <strong>der</strong> Welt bekämpft, son<strong>der</strong>n neue<br />
Absatzmärkte für Agrarmultis und Lebensmittelkonzerne geschaffen<br />
worden.<br />
Die übereinstimmenden Antworten <strong>der</strong> Referenten auf die Fragen<br />
<strong>der</strong> Zuhörer, wie konkretes verantwortliches Handeln möglich sei:<br />
- mehr Wertschätzung für bäuerliche Arbeit<br />
- die Bereitschaft, für Ernährung mehr Zeit und Geld auszugeben<br />
- lokale und regionale Orientierung<br />
- Geduld für gesellschaftliches und politisches Umdenken.<br />
Barbara Fetzer-Haag<br />
Diskutierten Wege <strong>der</strong> Welternährungssicherung (v.l.n.r.)<br />
Clemens Dirscherl, Andreas Kindler (Kreisbauernverband Böblingen), Beate Sicorschi<br />
(BUND-Umweltzentrum Böblingen), Hans-Werner Schwarz (Eine-Welt-Laden) und<br />
<strong>der</strong> Böblinger Bezirksbauernpfarrer Wolfgang Ristok
60-jähriges Jubiläum <strong>der</strong> Heimvolkshochschule<br />
Hohebuch<br />
„Wenn’s Hohebuch nicht gäbe, müsst’ man es heute<br />
gründen“<br />
Hohebucher Tag zu feiern ist alle zwei Jahre ein Höhepunkt. Ein<br />
Stück Heimat, alte Bekannte, auch die wichtigen gesellschaftlichen<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen gehören dazu. Diesmal jedoch stand wirklich das<br />
Feiern im Mittelpunkt. So viele Freunde Hohebuchs kamen zum 60jährigen<br />
Jubiläum, dass das Festzelt randvoll war.<br />
Gottesdienst mit ausländischen Gästen<br />
Die Hohenloher Kantorei und <strong>der</strong> Posaunenchor Kirchensall gaben<br />
dem Gottesdienst mit <strong>Land</strong>esbauernpfarrer Jörg Dinger die richtige<br />
festliche Stimmung. Bereichert wurde <strong>der</strong> Gottesdienst auch von<br />
zwei Gästen aus Liberia. Nyamah Jallah und Abraham Kollie dankten<br />
für die Möglichkeit mit uns zu feiern und baten uns, ihr <strong>Land</strong> in die<br />
Gebete einzuschließen,<br />
damit <strong>der</strong> zerbrechliche<br />
Frieden gewahrt bleibt<br />
und sie es schaffen, sich<br />
selbst zu ernähren. So<br />
zeigte sich die internationale<br />
Verbundenheit<br />
Hohebuchs.<br />
Lob aus dem <strong>Land</strong>wirtschaftsministerium<br />
Ministerialdirektor Wolfgang Reimer vom Stuttgarter <strong>Land</strong>wirtschaftsministerium<br />
hält nichts von langweiligen, offiziellen Grußworten. Er<br />
beschrieb stattdessen, was für eine große Bedeutung Hohebuch für<br />
ihn hat, wie es ihn geprägt hat. Vor 60 Jahren waren die Probleme<br />
im ländlichen Raum recht eindeutig zu benennen und auch über die<br />
Lösungsansätze gab es klare Ideen. Heute jedoch, nach einem
großen Wandel in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft, gibt es<br />
sehr kontroverse Diskussionen. Geht man von<br />
ökologischen und sozialen Idealen aus, o<strong>der</strong><br />
setzt man da an, wo die Masse <strong>der</strong> Menschen<br />
ist? Hier stelle Hohebuch nicht nur für<br />
bäuerliche Familien eine zuverlässige<br />
Leitplanke <strong>der</strong> Wegbegleitung dar, son<strong>der</strong>n<br />
auch für das Ringen um den richtigen Kurs in<br />
<strong>der</strong> Agrarpolitik und bei ökologischen<br />
Fragestellungen. Zwischen Idealismus und<br />
Pragmatismus solle dazu eine offene,<br />
vorurteilsfreie Auseinan<strong>der</strong>-setzung ab <strong>der</strong><br />
tagespolitischen Hektik auch in Zukunft<br />
geführt werden, wozu die <strong>Land</strong>esregierung<br />
wie bisher die erfor<strong>der</strong>liche Unterstützung<br />
geben wolle.großen Wandel in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft, gibt es sehr kontroverse<br />
Diskussionen. Geht man von ökologischen und sozialen Idealen aus, o<strong>der</strong><br />
setzt man da an, wo die Masse <strong>der</strong> Menschen ist? Hier stelle Hohebuch nicht<br />
nur für bäuerliche Familien eine zuverlässige Leitplanke <strong>der</strong> Wegbegleitung<br />
dar, son<strong>der</strong>n auch für das Ringen um den richtigen Kurs in <strong>der</strong> Agrarpolitik<br />
und bei ökologischen Fragestellungen. Zwischen Idealismus und<br />
Pragmatismus solle dazu eine offene, vorurteilsfreie Auseinan<strong>der</strong>-setzung ab<br />
<strong>der</strong> tagespolitischen Hektik auch in Zukunft geführt werden, wozu die<br />
<strong>Land</strong>esregierung wie bisher die erfor<strong>der</strong>liche Unterstützung geben wolle.<br />
Erich Munz war ein beson<strong>der</strong>er Festredner:<br />
nicht nur als Mitglied <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<br />
<strong>Partnerschaft</strong> – war er doch ein Bauernschüler<br />
des allerersten Hohebucher<br />
Grundkurses von 1951 und wusste einiges<br />
zu berichten. Wer ihn kennt, weiß auch<br />
wie originell und schlitzohrig er seine Zuhörer<br />
durch die sechzigjährige Hohebucher<br />
Geschichte führte. Die Episoden<br />
waren voller Freude, Fröhlichkeit, Kämpfen,<br />
Nachdenklichkeit und Engagement.<br />
Wie Hohebuch eben.<br />
Attraktives Rahmenprogramm<br />
Zum Festprogramm gehörte auch ein hervorragendes Mittagessen<br />
mit vielerlei Auswahl, Kaffee und Kuchen. Nun galt es das gesamte<br />
Gelände zu erkunden. Für die Kin<strong>der</strong> kein Thema, denn überall<br />
fanden tolle Aktionen statt. Karin Kraft musizierte mit einer Gruppe<br />
sangesfreudiger Besucher. Ulrike Siegel gab eine Lesung aus ihrem
aktuellen Buch. Die anschließende Diskussion zeigte, wie stark sich<br />
viele in den gesammelten Geschichten wie<strong>der</strong> gefunden haben.<br />
Große Freude gab es über den neuen Hohebucher Barfußpfad, <strong>der</strong><br />
ebenso eingeweiht wurde wie <strong>der</strong> „Raum <strong>der</strong> Stille“. Äußerst<br />
interessant waren auch die vielen Bil<strong>der</strong>, die die vergangenen 60<br />
Jahre wie<strong>der</strong> lebendig werden ließen. Die Themen von damals –<br />
unglaublich aktuell! Dass eine Bildungseinrichtung, die so am Puls<br />
<strong>der</strong> Zeit arbeitet wie Hohebuch, sich dann doch 60 Jahre lang treu<br />
bleibt, lässt einen nur staunen.<br />
Ehrengast: Wolfgang Huber<br />
Der Festvortrag von Bischof i. R. Prof. Dr. Wolfgang Huber, dem<br />
ehemaligen Ratsvorsitzenden <strong>der</strong> Evangelischen Kirche in<br />
Deutschland, füllte das Festzelt bis zum letzten Platz. Christliche<br />
Orientierung sei wichtig bei Fragen <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft und <strong>der</strong><br />
ländlichen Räumen. Dogmatisches Klammern an Grundsätzen sei<br />
dabei ebenso fehl am Platz wie Relativierung aus Sachzwängen.<br />
Sonst entstehe Gleichgültigkeit gegenüber Werten.<br />
Die evangelische Bildungsarbeit<br />
ziele daher nicht auf<br />
das Erlernen von Fachwissen,<br />
son<strong>der</strong>n auf die immerwährende<br />
Suche nach <strong>der</strong><br />
Grundorientierung <strong>der</strong> eigenen<br />
Existenz. Gerade auch<br />
im Hinblick auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
unserer Welt<br />
wie Klimawandel, Ernährungssicherheit<br />
und Umweltfragen.<br />
Wolfgang Huber appellierte<br />
an die anwesenden<br />
<strong>Land</strong>wirte, ihr Licht gesellschaftspolitisch nicht unter den Scheffel zu<br />
stellen. Sie seien diejenigen, die die Lebensgrundlage <strong>der</strong> Zukunft<br />
sicherstellen. Das berge Wertschätzung und Verantwortung. Er gab
uns noch sechs Grundgedanken, Visionen für unsere Arbeit und<br />
unser Leben, mit auf dem Weg:<br />
mündig im Glauben<br />
mündig in <strong>der</strong> Kirche<br />
mündig in <strong>der</strong> Liebe<br />
mündig im Dialog<br />
mündig im Beruf<br />
mündig in <strong>der</strong> Politik<br />
Der Jubiläumstag machte aufs Neue bewusst, wie wichtig die Bildungsarbeit<br />
in Hohebuch ist. Und dass ein ständiges Anpassen nötig<br />
ist: Im eigenen Leben, in <strong>der</strong> Familie, im Dorf, in Kirche und Politik,<br />
in Technik, Ernährung, Klimaschutz, und den Problemen <strong>der</strong> Einen<br />
Welt. „Wenn es Hohebuch nicht schon gäbe, müsse man es heute<br />
noch gründen.“ Diesem Satz von Wolfgang Huber in seiner Laudatio<br />
kann man nur zustimmen.<br />
Gerhard Wirth<br />
Angela Müller
Der ländliche Raum als Thema beim Hohebucher<br />
Prädikantentag<br />
Die stereotype Unterscheidung zwischen <strong>der</strong> „gottlosen <strong>Stadt</strong>“ und<br />
dem „gottesfürchtigen <strong>Land</strong>“ ist längst überholt. Nicht nur<br />
demografische, son<strong>der</strong>n auch soziale und kulturelle Verän<strong>der</strong>ungen<br />
haben das Leben im Dorf verän<strong>der</strong>t. Dies sagte <strong>der</strong><br />
württembergische <strong>Land</strong>esbischof Frank Otfried July beim Hohebucher<br />
Tag für Prädikanten, die zum Predigen ausgebildet, aber keine<br />
Theologen sind.<br />
<strong>Land</strong>esbischof July (rechts) im Gespräch mit Vertretern <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft,<br />
die auch als Prädikanten aktiv sind<br />
Der Gottesdienst im ländlichen Raum steht nach Ansicht des<br />
<strong>Land</strong>esbischofs vor beson<strong>der</strong>en Herausfor<strong>der</strong>ungen: wenn auch auf<br />
dem <strong>Land</strong>e <strong>der</strong> Bevölkerungsrückgang voranschreitet und die<br />
Kirchennähe schwinde, stelle sich die Frage, „wo Kirche Jesu Christi<br />
lebendig werde“. Dies sei einerseits in <strong>der</strong> Arbeit vor Ort mit<br />
Jugendlichen, Frauen, Männern, in Mutter-Kind-Kreisen, im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Seniorenarbeit, bei Kirchenmusik, aber auch durch das vielfältige<br />
diakonische Angebot <strong>der</strong> Kirche nach wie vor aktuell. Darüber hinaus<br />
stelle <strong>der</strong> Kirchturm selbst in glaubensfernen Kreisen wie den
östlichen Bundeslän<strong>der</strong>n immer noch symbolische Repräsentanz <strong>der</strong><br />
christlichen Botschaft dar.<br />
„Die Kirche muss in <strong>der</strong> Fläche präsent bleiben“, so <strong>der</strong><br />
<strong>Land</strong>esbischof, <strong>der</strong> zugleich aber auch eine Überwindung des<br />
„provinziellen Kirchturmdenkens“ anmahnte. Er habe den Eindruck,<br />
dass es für die Kirchen im Dorf oftmals einfacher sei, mit<br />
Partnergemeinden in Afrika zusammen zu arbeiten als mit <strong>der</strong><br />
unmittelbaren Nachbargemeinde. Von daher appellierte er an die<br />
Bereitschaft zur Kooperation über die engen Gemeindegrenzen<br />
hinweg als Zeichen christlicher Verbundenheit. Gerade im ländlichen<br />
Raum mit seiner Vielfalt an kulturellen Traditionen und<br />
agrarkulturellen Werten in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft seien Ansatzpunkte für<br />
beson<strong>der</strong>e Festlichkeiten und Gottesdienste gegeben, welche weit in<br />
den urbanen Raum hinausstrahlen könnten.<br />
Clemens Dirscherl<br />
Die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> vermittelt gerne <strong>Land</strong>-Prädikanten<br />
und -Referenten für Gottesdienste und Vortragsveranstaltungen<br />
in städtische Kirchengemeinden. Nähere Infos:<br />
Dr. Clemens Dirscherl<br />
( 07942/107-73<br />
E-Mail: c.dirscherl@hohebuch.de
Materialien zum Thema „nachhaltige Ernährung“<br />
Nicht nur Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner wird aktiv<br />
angesichts <strong>der</strong> jährlich über 20 Mio Tonnen in Deutschland<br />
weggeworfener Lebensmittel und initiiert dazu jetzt eine Studie. Auf<br />
380 Seiten befasst sich <strong>der</strong> bekennende<br />
„Öko-Aktivist“ Tristram Stuart mit <strong>der</strong><br />
weltweiten Problematik „Wie wir unsere<br />
Lebensmittel verschwenden“ und fasst<br />
das Fazit im Buchtitel zusammen: „Für<br />
die Tonne“. Im lesenswerten Vorwort<br />
weist die Grün<strong>der</strong>in <strong>der</strong> ersten<br />
deutschen Tafel Sabine Werth aus Berlin<br />
auf die unterschiedliche Perspektive des<br />
Begriffs „Abfall“ hin, bevor <strong>der</strong> Autor<br />
dann seine Erfahrungen von Weltreisen<br />
zwischen Yorkshire, Pakistan und Japan<br />
mit eigenen Recherchen und<br />
Erkenntnissen ausführt. Jedem Kapitel<br />
ist ein thematisches Zitat vorangestellt:<br />
von John Locke, <strong>der</strong> bereits Regeln für einen verantwortlichen<br />
Konsum aufstellte, über die Speisung <strong>der</strong> 5000 aus Johannes 6, das<br />
erste Buch Mose o<strong>der</strong> Wilhelm Shakespeare.<br />
Von <strong>der</strong> Marktkalkulation <strong>der</strong> Lebensmittelindustrie und des<br />
Lebensmitteleinzelhandels über die „Haltbarkeitsmythologie“ und<br />
akribisch aufgeführte Abfalllisten führen langatmige Erzählungen in<br />
Fülle an überflüssigen Detailerfahrungen zu einer überraschenden<br />
Bilanz: ein Lob auf das Schwein. Nach Auffassung Stuarts ließen sich<br />
die Weltprobleme über eine verstärkte Schweinefütterung mit<br />
überschüssigen Agrargütern und Lebensmitteln lösen: sowohl die<br />
Klimabilanzen, die ungleiche Verteilung an Agrarressourcen, bis hin<br />
zur Energieversorgung (Biogas aus Schweinegülle) – eine dann doch<br />
recht schlichte Lösung.<br />
Schwein und an<strong>der</strong>es Fleisch steht bei <strong>der</strong> ehemaligen Vegetarierin<br />
Theresa Bäuerlein inzwischen auf dem Speiseplan. In ihrem Büchlein
„Fleisch essen, Tiere lieben“ macht sie klar „wo Vegetarier sich irren<br />
und was Fleischesser besser machen können“, wie <strong>der</strong> Untertitel<br />
verspricht. Angenehm unaufgeregt und differenziert widmet sich die<br />
Autorin dem heute weltweit steigenden Fleischkonsum und <strong>der</strong> in<br />
Deutschland zunehmend fleischskeptischen<br />
öffentlichen Meinung. Dabei überzeugen<br />
sowohl ihre eigenen Erfahrungen in<br />
gesundheitlicher Hinsicht als ehemalige<br />
Vegetarierin (mineralische Unterversorgung)<br />
als auch ihre deutlichen Worte, dass<br />
Fleischesser nicht die schlechteren Menschen<br />
sind und Vegetarier die Welt verbessern.<br />
Viel eher ist eine gründliche<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung erfor<strong>der</strong>lich. Statt dem<br />
Hunger nach einfachen Wahrheiten (so das<br />
10. Kapitel) zu huldigen kommt die Autorin<br />
zum Ergebnis, dass Fleischverzehr durchaus<br />
gesund ist und es darauf ankommt – wie so oft im Leben – Maß zu<br />
halten. Deutlich plädiert sie für eine artgerechte Tierhaltung und ein<br />
entsprechendes Verbraucherbewusstsein, welches <strong>Land</strong>wirtschaft,<br />
Fleischerhandwerk und Ernährungs- wie Lebensmittelindustrie dazu<br />
treibt, mit einer neuen Wertepräferenz Fleisch zu vermarkten: in<br />
Ehrfurcht vor dem Mitgeschöpf, zu auskömmlichen Preisen für die<br />
bäuerlichen Erzeuger.<br />
Ganz praktisch und flott kommt das<br />
Handbuch „YouthXchange – auf dem Weg<br />
zu nachhaltigen Lebensstilen“ als Schulungsmaterial<br />
für verantwortungsbewussten<br />
Konsum insbeson<strong>der</strong>e für die<br />
Zielgruppe Jugendliche daher. Bunt und<br />
locker aufbereitet mit zahlreichen Tabellen,<br />
Handlungsanleitungen und kurzen<br />
Stellungnahmen ist von UNESCO und<br />
UNEP ein Werkzeugkasten mit Argumenten<br />
und Hilfsmitteln an die Hand gegeben<br />
worden rund um das Thema „Nachhaltiger
Konsum“. Neben kurzen Grundsatzartikeln geht es um Mobilität,<br />
Abfallvermeidung, <strong>Land</strong>wirtschaft und Ernährungsweise, soziale<br />
Verantwortung, Umgang mit Tieren und soziale Verantwortung<br />
gegenüber <strong>der</strong> einen Welt. Die 85-seitige Broschüre überzeugt nicht<br />
nur in ihrer ziel-gruppengerechten Aufmachung, son<strong>der</strong>n auch den<br />
umfassenden weiterführenden Themenhinweisen, insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Internet. Ein hervorragen<strong>der</strong> Themenaufreißer für den Unterricht<br />
bzw. die Jugendarbeit.<br />
Ideal als filmisches Material zur Diskussion ist die WDR-Dokumentation<br />
„Essen im Eimer: die große Lebensmittelverschwendung“. Die<br />
im Internet herunter zu ladende 30-minütige Reportage zeigt, dass<br />
die Hälfte unserer Lebensmittel<br />
in Deutschland im Müll<br />
landen. Das meiste schon auf<br />
dem Weg vom Acker in den<br />
Laden, bevor es überhaupt<br />
den Esstisch erreicht. Das<br />
entspricht etwa 500.000<br />
LKW-Ladungen pro Jahr. Der<br />
Film geht dabei auf die Suche<br />
nach den Ursachen in Supermärkten, Bäckereien und Großmärkten.<br />
Auch Zeitzeugen dieses Skandals kommen zu Wort: Fachminister,<br />
<strong>Land</strong>wirte und europäische Agrarpolitiker. Dabei bleibt es jedoch<br />
nicht nur bei <strong>der</strong> Betroffenheitsreportage, son<strong>der</strong>n es werden auch<br />
kleine Schritte gezeigt, wie man dagegen angehen kann, die<br />
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren: in <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft, im<br />
Handel sowie als Kunde und Staatsbürger. Eine globale<br />
Thematisierung des Stoffs wird gerade vom gleichen Filmemacher<br />
seit September 2011 in den Kinos gezeigt: „Taste the waste“.<br />
Tristram Stuart: Für die Tonne. Wie wir unsere Lebensmittel<br />
verschwenden. Artemis & Winkler Verlag Mannheim 2011, 19,95<br />
Euro, ISBN 978-3-538-07313-5
Theresa Bäuerlein: Fleisch essen, Tiere lieben. Wo Vegetarier sich<br />
irren und was Fleischesser besser machen können. Ludwig-Verlag<br />
München 2011, 12,99 Euro, ISBN 978-3-453-28024-3<br />
UNESCO/UNEP (Hrsg.): YouthXchange – Auf dem Weg zu<br />
nachhaltigen Lebensstilen. Das Handbuch. Erste deutschsprachige<br />
Auflage 2010. Kostenloses Download unter<br />
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/Nach<br />
haltigkeitBroschuereYouthXchange.html<br />
Essen im Eimer: Die große Lebensmittelverschwendung. WDR-<br />
Dokumentarfilm (Erstausstrahlung SWR-Fernsehen am 27.4.2011),<br />
Download unter http://www.planetschule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8459<br />
Das Buch dazu: Stefan Kreutzberger/Valentin Thurn: Die<br />
Essensvernichter. Warum die Hälfte aller Lebensmittel im Müll landet<br />
und wer dafür verantwortlich ist. Kiepenheuer & Witsch Köln 2011,<br />
16,99 Euro, ISBN 978-3-462-04349-5<br />
Clemens Dirscherl
Brenzmedaille <strong>der</strong> <strong>Land</strong>eskirche für Gudrun Stier und<br />
Hansjörg Keyl<br />
Zwei langjährige Aktive <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> (SLP) wurden<br />
mit <strong>der</strong> Brenzmedaille <strong>der</strong> evangelischen <strong>Land</strong>eskirche in Württemberg<br />
ausgezeichnet: Gudrun Stier, Bäuerin aus Ingelfingen-Hermuthausen<br />
und Hansjörg Keyl, Agraringenieur und ehemaliger Mitarbeiter<br />
des <strong>Land</strong>wirtschaftsamtes Bad Mergentheim aus Weikersheim.<br />
Beide sind schon seit frühester Jugend mit Hohebuch verbunden<br />
über ihren Grundkurs zur Persönlichkeitsbildung und sind bis heute<br />
aktiv im Bezirksarbeitskreis Künzelsau bzw. Weikersheim. Beide sind<br />
auch bei <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> engagiert. Hansjörg Keyl von<br />
Anfang an seit 1988, sowohl im Initiativkreis als auch im<br />
Redaktionskreis des Infoheftes. Gudrun Stier kam später als<br />
Vertreterin <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft hinzu und wurde bald auch in <strong>der</strong>en<br />
geschäftsführenden Ausschuss gewählt, dem sie bis heute angehört.<br />
Freuten sich über die hohe landeskirchliche<br />
Auszeichnung: Gudrun Stier und Hansjörg Keyl<br />
Mit Begeisterung beteiligten<br />
sich beide für die SLP<br />
auch bei den evangelischen<br />
und ökumenischen<br />
Kirchentagen, zuletzt in<br />
München. Mit ihrem sozialdiakonischen<br />
Engagement<br />
haben Gudrun Stier und<br />
Hansjörg Keyl die <strong>Land</strong>wirtschaftlicheFamilienberatung<br />
begleitet, in <strong>der</strong>en<br />
Beirat beide seit Gründung<br />
1989 waren, Gudrun Stier<br />
bis heute.<br />
Clemens Dirscherl
Bundesverdienstorden für Ulrike Siegel<br />
„Eine mo<strong>der</strong>ne Frau vom <strong>Land</strong> mit<br />
unermüdlichem Einsatz und Vorbildcharakter“<br />
so wurde die Vorsitzende<br />
des Evangelischen Bauernwerk und<br />
Mitglied <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
Ulrike Siegel anlässlich <strong>der</strong><br />
Verleihung des Bundesverdienstordens<br />
bezeichnet. Als Meisterin<br />
sowohl <strong>der</strong> <strong>Land</strong>wirtschaft sowie<br />
<strong>der</strong> Ländlichen Hauswirtschaft auf<br />
dem familieneigenen Betrieb wie<br />
auch als Agraringenieurin hat sie<br />
alle Facetten des bäuerlichen Arbeitens<br />
und Lebens kennen gelernt.<br />
Trotz vieler Auslandsaufenthalte in<br />
Amerika, Asien und Afrika ist sie<br />
stets ihrer Heimat und <strong>der</strong> Hohebucher<br />
Arbeit treu geblieben. Als<br />
Herausgeberin verschiedener Bücher über das Leben von Bäuerinnen<br />
und Bauerntöchter hat Ulrike Siegel einen neuen Generationsdialog<br />
in Gang gesetzt.<br />
Bei allen persönlich erlebten Schwierigkeiten in <strong>der</strong> eigenen Familie<br />
pflegte sie jeweils Knotenpunkte für ein Netzwerk ehrenamtlicher<br />
Arbeit in Kommunalpolitik als Gemein<strong>der</strong>ätin, in <strong>der</strong> Kirche vor Ort<br />
als Kirchengemein<strong>der</strong>ätin und im Evangelischen Bauernwerk.<br />
Clemens Dirscherl
Jahresergebnis 2010<br />
Im Vergleich zu 2009 hat die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> 2010 fast<br />
gleich viele Einnahmen erhalten: etwas weniger Spendenerträge,<br />
dafür aber eine Vergütung von <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft Ländliche<br />
Erwachsenenbildung Baden-Württemberg (ALEB) für den Stand am<br />
Ökumenischen Kirchentag in München, wo wir auch ALEB-Thematik<br />
mit behandelt haben.<br />
Entsprechend ist auch <strong>der</strong> Aufwand für den Ökumenischen<br />
Kirchentag im letzten Jahr zu Buche geschlagen – und zwar mit fast<br />
3.000 Euro. Insgesamt war <strong>der</strong> Aufwand für die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-
<strong>Partnerschaft</strong> aber im Vergleich zum Jahr 2009 etwas weniger<br />
gewesen. Es wurde weniger Porto und Telefon verbucht. Bei dem<br />
Betrag für Verwaltungskosten sind Materialkosten für den<br />
Ökumenischen Kirchentag enthalten, weil wir für unsere Aktion<br />
„Grüner Daumen für die heimische <strong>Land</strong>wirtschaft“ entsprechende<br />
Flyer, Folientaschen, Stempelkissenfarben, etc. benötigt hatten.<br />
Insgesamt schließt das Jahresergebnis 2010 mit einem Stand <strong>der</strong><br />
Rücklagen von 28.035,53 Euro. Für weitere Rückfragen stehe ich<br />
gerne zur Verfügung!<br />
Clemens Dirscherl
Unsere nächsten Termine<br />
Initiativkreis Winter 2011<br />
Samstag, 10. Dezember 2011<br />
von 10:00 bis 16:00 Uhr<br />
- Die Kuh – Klimakiller durch Methangas? Diskussion mit Buchautorin Dr.<br />
Anita Idel, Berlin<br />
Initiativkreis Frühjahr 2012<br />
Samstag, 10. März 2012<br />
von 10:00 bis 16:00 Uhr<br />
- Essen auf dem Müll? Filmdiskussion zu „Taste the waste“ von Valentin<br />
Thurn<br />
Initiativkreis Sommer 2012<br />
Samstag, 23.6.2012<br />
von 09:30 bis 16:00 Uhr<br />
- Hohenloher <strong>Land</strong>fahrt:<br />
Energiewende mit <strong>der</strong> regionalen <strong>Land</strong>wirtschaft: Besuch des<br />
Bioenergiedorfs Siebeneich<br />
Weitere Treffen:<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung des Evangelischen Bauernwerks am<br />
23.11.2011 im Evangelischen Gemeindehaus in Unterensingen.<br />
Beginn: 09:30 Uhr Gottesdienst in <strong>der</strong> evangelischen Kirche<br />
Hohebucher Agrargespräch am Montag, 9. Januar 2012 zum Thema<br />
„Tierschutz als Herausfor<strong>der</strong>ung für die heimische <strong>Land</strong>wirtschaft“. Mit den<br />
Referenten:<br />
- Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung, Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Deutschen<br />
Tierschutzkommission<br />
- Thomas Schrö<strong>der</strong>, Bundesgeschäftsführer Deutscher Tierschutzbund<br />
- Roland Fechler / Referatsleiter Fleisch und Veredelung beim Deutschen<br />
Bauernverband<br />
- ein/e Vertreter/in <strong>der</strong> Handelsgruppe Lidl & Schwarz<br />
Hohebucher Wochenende am 21./22.4.2012, Thema noch offen
Dank an alle Mitglie<strong>der</strong> und För<strong>der</strong>er<br />
Die <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong> könnte ihre vielfältige kirchliche<br />
Bildungs- und politische Arbeit ohne die tatkräftige<br />
Unterstützung von vielen Freundinnen und Freunden nicht<br />
durchführen. Von daher danken wir ganz herzlich für die<br />
Mitgliedschaft bzw. Spenden, die uns zukommen. Wir sind auch<br />
weiterhin dankbar für entsprechende Zuwendungen, um unser<br />
vielgestaltiges Programm, wie Sie aus dem Infoheft entnommen<br />
haben, durchführen zu können.<br />
Bankverbindung:<br />
Evangelische Kreditgenossenschaft<br />
Stichwort <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
BLZ 520 604 10<br />
Konto-Nr. 518 601 3<br />
Wollen Sie in Ihrer Gemeinde, Ihrem Arbeitskreis o<strong>der</strong> Ihrem<br />
Verein das Thema <strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>, <strong>Land</strong>wirtschaft, Ernährung und<br />
Verbraucher o<strong>der</strong> ähnliches behandeln?<br />
Fragen Sie unsere Referenten an!<br />
Kontakt:<br />
<strong>Stadt</strong>-<strong>Land</strong>-<strong>Partnerschaft</strong><br />
Dr. Clemens Dirscherl<br />
<strong>Evangelisches</strong> Bauernwerk in Württemberg<br />
74635 Waldenburg-Hohebuch<br />
( 07942/107-73<br />
Fax 07942/107-77<br />
E-Mail: c.dirscherl@hohebuch.de
Weitere <strong>Informationen</strong><br />
erhalten Sie auf unserer Homepage unter:<br />
www.hohebuch.de<br />
<strong>Evangelisches</strong> Bauernwerk in Württemberg e.V.<br />
74638 Waldenburg-Hohebuch<br />
Telefon: 07942/107-70<br />
Telefax: 07942/107-77