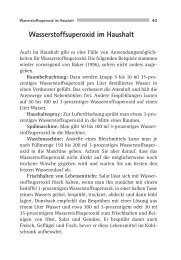Musterseiten (pdf 68 KB)
Musterseiten (pdf 68 KB)
Musterseiten (pdf 68 KB)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12 Inhaltsverzeichnis<br />
3. Die Haltung Bismarcks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />
4. Die Enquête zur Sonntagsruhe 1885/86 . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Das weitere Ringen zwischen November 1885 und<br />
127<br />
Oktober 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
III. Der sozialdemokratische Arbeiterschutzgesetzantrag 1885<br />
im Deutschen Reichstag – Bestandteil einer revolutionären<br />
Parlamentstaktik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />
5. Kapitel: Kaiserliche Gesetzgebung und päpstliche Sozialenzyklika . 135<br />
I. Von den „Februarerlassen“ Kaiser Wilhelm II. 1890 zur<br />
Gewerbeordungsnovelle 1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />
1. Die „Februarerlasse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />
2. Die Genese der „Februarerlasse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
a. Die Entstehung der ersten kaiserlichen Ausarbeitungen . . 136<br />
b. Die Kronratssitzung vom 24. Januar 1890 . . . . . . . . . . . . . .<br />
c. Bismarcks Widerstand gegen die kaiserlichen<br />
137<br />
Arbeiterschutzpläne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />
3. Die Internationale Arbeiterschutzkonferenz . . . . . . . . . . . . . . 141<br />
4. Die Gewerbeordnungsnovelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
a. Die Beratungen des Staatsrates und der Entwurf<br />
143<br />
der Novelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<br />
b. Beratungen und Beschlußfassung im Deutschen Reichstag 144<br />
c. Kurze kritische Würdigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />
II. Die Enzyklika „Rerum novarum“ Papst Leos XIII. 1891 . . . . . . 147<br />
Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147<br />
1. Der Entstehungsprozeß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147<br />
2. Zentrale Gedanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148<br />
3. Die fortwirkende Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />
4. Zur Kritik an „Rerum novarum“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />
III. Schluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152<br />
1. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152<br />
2. Kritische Würdigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1. Kapitel: Die Behandlung der „sozialen<br />
Frage“ von ihren Anfängen bis 1862<br />
I. Die „soziale Frage“ des 19. Jahrhunderts<br />
1. Die Ursachen<br />
Die „soziale Frage“ 1 des 19. Jahrhunderts darf nicht allein oder weitestgehend<br />
als Ausfluß des industriellen Wirtschaftssystems gesehen werden, denn bereits<br />
für die Jahrhundertwende vor der Industrialisierung läßt sich eine weitverbreitete<br />
Armut nachweisen 2 . Jedoch ist die „soziale Frage“ in ihrer Ausprägung<br />
als Arbeiterfrage ein Produkt der Industrialisierung, und die wirtschaftssystemspezifischen<br />
Bedingungen, die die „soziale Frage“ als Arbeiterfrage verursachten,<br />
verschärften Armut und Not breiter Schichten 3 .<br />
Die seit Beginn des 19. Jahrhunderts rasch wachsende Zahl der Bevölkerung 4<br />
und die fortschreitende Auflösung der ständisch gebundenen Wirtschaft in die<br />
der freien Konkurrenz sorgten für eine immer größer werdende „industrielle<br />
Reservearmee“. Die hier zu nennende Stein-Hardenbergische Agrarreform,<br />
die die „Bauernbefreiung“ brachte, sowie die Einführung der Gewerbefreiheit<br />
hatten die soziale Entwurzelung und die Zerstörung der gesicherten Lebensgrundlage<br />
vieler Menschen aus Landwirtschaft und Handwerk zur Folge 5 , aus<br />
denen sich schließlich ein großer Teil des Kontingents der Fabrikarbeiterschaft<br />
rekrutierte 6 .<br />
Eine weitere Ursache der „sozialen Frage“ bildete der technische Fortschritt,<br />
der die Voraussetzungen für die „industrielle Revolution“ schuf, die die<br />
Umwandlung der „überwiegend gewerblich, haus- und handarbeitenden Wirt-<br />
1 Die Bezeichnung „soziale Frage“ beschränkt sich auf die ökonomisch bedingten Probleme.<br />
2 Vgl. W. Fischer: Armut in der Geschichte. Göttingen 1982, 56.<br />
3 Vgl. H. Lampert: Lehrbuch der Sozialpolitik. Berlin – Heidelberg – New York – Tokyo 1985,<br />
26.<br />
4 Im Deutschen Reich erhöhte sie sich von 24,8 Mill. im Jahre 1816, auf 36,1 Mill. im Jahre 1855,<br />
also um 45,6% und bis 1910 auf 64,5 Mill., also um 78,7%. Statistisches Bundesamt. Bevölkerung<br />
und Wirtschaft 1872 bis 1972. Stuttgart 1972, 90. Vgl. Lampert, Sozialpolitik, 26. Diese<br />
explosive Bevölkerungsvermehrung war die entscheidende Quelle für die Entwicklung der<br />
Industriearbeiterschaft. Vgl. ebd. 24.<br />
5 Vgl. ebd. 29–30. Der Verfasser gibt auch bibliographische Hinweise zur Bauernbefreiung und<br />
zur Gewerbefreiheit.<br />
6 Vgl. ebd. 24.
30 1. Kapitel: Die „soziale Frage“ bis 1862<br />
IV. Die Antwort im katholischen Raum 1837 bis 1862<br />
a. F.J. Ritter von Buß<br />
1. Die christlich-soziale Ursprungsidee<br />
zum staatlichen Arbeiterschutz<br />
F.J.Ritter von Buß (1803–1878) 54 sah die Ursachen der „sozialen Frage“ nicht<br />
in der Industrialisierung schlechthin, sondern in dem unchristlichen Individualismus<br />
eines übermächtigen Freiheitsprinzips, der „seit drei Jahrhunderten<br />
… alle Verhältnisse des Lebens verrenkt“ 55 .<br />
Am 25. April 1837 hielt Buß vor der II. Kammer des Badischen Landtages<br />
die erste sozialpolitische Rede in einem deutschen Parlament 56 .<br />
Darin wurde die neue Wirklichkeit scharf analysiert und „ohne Werturteil<br />
und reaktionäre Ablehnung als gegeben“ 57 hingenommen; die Vorteile der<br />
Industrialisierung, die in der Beschäftigung sehr vieler Menschen, der Verbilligung<br />
der Herstellung und der Erhöhung des Wohlstandes bestehen 58 , wurden<br />
gewürdigt, ihre sozialen Auswirkungen von Nachteil, die die Existenzunsicherheit<br />
des Lohnarbeiters, die Schädigung seiner Gesundheit, seine<br />
politische Entrechtung und religiöse Gefährdung sowie die Zerstörung seiner<br />
Familie betreffen 59 , sachlich dargestellt.<br />
Zur Abhilfe verlangte Buß staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik. Cl.<br />
Bauer spricht von einer „Gesamtreform in Gestalt einer vom Staat für die Wirtschaft<br />
zu schaffenden Rechtsordnung und Wirtschaftspolitik“ 60 , die Buß<br />
durchgeführt sehen wollte 61 . Durch Verzicht auf künstliche Beschleunigung<br />
54 Buss wurde 1833 zum Professor für Staatsrecht an die Universität Freiburg i. Br. berufen; seit<br />
1844 lehrte er dort auch Kirchenrecht. Dem badischen Landtag gehörte er 1837 bis 1840, 1846<br />
bis 1848 und 1873 an. Im Jahre 1848 war er Präsident des ersten deutschen Katholikentages, im<br />
gleichen und im folgenden Jahr Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Seit 1874 Mitglied<br />
der Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstages.<br />
55 F.J. von Buss: Die Aufgabe des katholischen Theils teutscher Nation in der Gegenwart oder der<br />
katholische Verein Teutschlands. Regensburg 1851, 79.<br />
56 F.J. von Buss: Über die mit dem fabrikmäßigen Gewerbsbetriebe verbundenen Nachtheile und<br />
die Mittel ihrer Verhütung. Carlsruhe 1837. Abgedruckt in: A.Retzbach: Franz Josef Ritter von<br />
Buß. Zu seinem 50. Todestag (31. Jan. 1928). M. Gladbach 1927, 48–85. Zuvor wurde die Rede<br />
bereits von A.Geck mit einem Geleitwort von A.Bebel neu herausgegeben: F.J.Ritter von Buß:<br />
Zur Geschichte der deutschen Fabrikgesetzgebung. Erste sozialpolitische Rede in einem deutschen<br />
Parlament im Jahre 1837. Offenburg 1904.<br />
57 Cl. Bauer: Wandlungen in der sozialpolitischen Ideenwelt des 19. Jahrhunderts. In: Die soziale<br />
Frage und der Katholizismus. Festschrift zum 40jährigen Jubiläum der Enzyklika „Rerum<br />
novarum“. Hrsg.: Sektion für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft der Görres-Gesellschaft.<br />
Paderborn 1931, 16.<br />
58 Vgl. Buß: Zur Geschichte der deutschen Fabrikgesetzgebung, 5 f.<br />
59 Vgl. ebd. 6–12.<br />
60 Bauer: Wandlungen in der sozialpolitischen Ideenwelt, 16 f.<br />
61 Zu den Forderungen Buß‘, die im folgenden referiert werden, vgl. Buß: Zur Geschichte der<br />
deutschen Fabrikgesetzgebung, 20–31. Eine ausführliche Analyse der Rede Buß‘ bietet R.Birkl:
IV. Die Antwort im katholischen Raum 1837 bis 1862 31<br />
der Industrialisierung, Förderung der Landwirtschaft durch Versicherungsund<br />
Kreditanstalten, Lehr- und Musterwirtschaften und Erhaltung des Handwerkerstandes<br />
durch eine zeitgemäße Gewerbeordnung, Fachbildung, Meisterprüfung<br />
und Genossenschaften sollte ein gesundes Gleichgewicht zwischen<br />
Industrie, Landwirtschaft und Handwerk geschaffen werden. Gegen die<br />
wirtschaftliche Ungesichertheit der Fabrikarbeiter empfahl Buß: gesetzliche<br />
Schutz- und Hilfsmaßnahmen, Hilfskassen für Krankheit und Unfall aus<br />
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen, Verbot des Trucksystems, Werkswohnungen<br />
und Verkaufsstellen in Fabriken, gesetzlicher Schutz der Gesundheit<br />
durch Beschränkung der Kinderarbeit auf sechs bis acht Stunden, gesetzlich<br />
festgelegte Maximalarbeitszeit für Erwachsene von vierzehn Stunden<br />
täglich, Aufsicht durch Medizinalbehörden über die Fabrikbetriebe, gesetzliches<br />
Verbot gesundheitsschädlicher Arbeiten und gesetzlicher Unfallschutz für<br />
Arbeiten an Maschinen. Zugunsten einer gewissen geistigen Bildung befürwortete<br />
Buß: gesetzliche Verpflichtung der Arbeiterkinder zum täglichen<br />
Besuch der Volksschule – notfalls sei eine besondere Fabrikschule zu errichten<br />
–, nach Möglichkeit ein fortführender Unterricht für Arbeiterkinder durch<br />
Gewerbeschulen, Kinderbewahranstalten als Ersatz für fehlende Familienerziehung,<br />
getrennte Beschäftigung von Kindern und Erwachsenen in den<br />
Betrieben, ferner Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit für die erwachsenen<br />
Arbeiter mit beruflicher Ausrichtung, Gründung von Vereinen zur Anschaffung<br />
von Büchern, Werkzeugen und ähnlichem. Die Arbeitsräume der beiden<br />
Geschlechter sollten getrennt sein und die Schankstätten überwacht werden,<br />
um die Erhaltung der guten Sitten zu gewährleisten; an Sonn- und Feiertagen<br />
sei daher jegliche Fabrikarbeit zu untersagen. Zur Sicherung des Arbeitsfriedens<br />
schlug Buß vor: vierteljährliche Kündigungsfrist, Gewerbeaufsicht,<br />
Streikverbot und polizeiliche Bestrafung von Arbeitern, die ausschließlich zur<br />
Erzielung eines höheren Lohnes streiken. Schließlich beantragte er den Erlaß<br />
einer Fabrik-Polizeiordnung, einer Gewerbe- und einer Handelsordnung<br />
sowie eines Ackerbaugesetzes.<br />
Die Abgeordneten der II. Kammer nahmen diese Ausführungen mit nachhaltigem<br />
Beifall auf 62 ; sie anerkannten die Bedeutung der Frage und würdigten<br />
das Verdienst des Antragstellers, waren jedoch eines tieferen Eingehens auf<br />
Buß’ weitsichtige Vorschläge nicht fähig 63 : Die Behandlung seines Antrages<br />
verzögerte sich und kam schließlich infolge des Sessionsschlusses nicht mehr<br />
zustande, so daß die erste parlamentarische Initiative zur Arbeiterschutzgesetzgebung<br />
in Deutschland versandete 64 .<br />
00 Das Buss’sche Sozialreformprogramm als Vorläufer christlicher Parteiprogramme. Ein Beitrag<br />
zur deutschen Parteigeschichte. Phil. Diss. Erlangen 1949, 12–30.<br />
62 Vgl. Birkl: Das Buss’sche Sozialreformprogramm, 30.<br />
63 Vgl. ebd. 31 f.<br />
64 Vgl. ebd. 32 f., bes. 33. Buß forderte in einer Rede vor dem badischen Landtag im Jahre 1846<br />
erneut eine staatliche Arbeiterschutzgesetzgebung; im Anschluß an eine Debatte über den<br />
Zolltarif kam er auf seine Ausführungen von 1837 zurück. Vgl. ebd. 33 ff. In den später folgenden<br />
Jahren traten diese Gedanken einer staatlichen Sozialpolitik bei Buß zurück, da er kirchenpolitisch<br />
beansprucht wurde und sich auch stärker karitativen Fragen widmete. Vgl. ebd. 35 f.