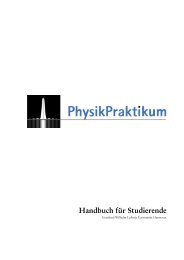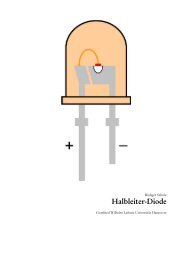D01 Linsen
D01 Linsen
D01 Linsen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>D01</strong><br />
<strong>D01</strong><br />
3. MESSUNG DER BRENNWEITE EINER KONVEXLINSE<br />
Zu Anfang dieser Versuche wird es Sie irritieren, dass Sie nie genau wissen, wo das Bild scharf eingestellt<br />
ist. Und selbst wenn Sie sich entschieden haben, können Sie g und b nicht genau messen. Das ist unbefriedigend,<br />
aber typisch für die Physik: Keine Messung ist exakt. Hier hilft Ihnen nur die Fehlerrechnung weiter.<br />
Vielleicht werden Sie erstaunt sein, wie genau man trotz aller Fehler und Näherungen hier im Versuch die<br />
physikalischen Gesetze bestätigen kann.<br />
3.1. Versuch: Der schnellste Weg, die Brennweite einer Konvexlinse zu bestimmen:<br />
Man bildet einen sehr weit entfernten Gegenstand ab (Sonne) und misst dann direkt die Brennweite f = b.<br />
Ermitteln Sie so zunächst die ungefähren Brennweiten der beiden Konvexlinsen am Arbeitsplatz.<br />
3.2. Versuch:<br />
Genauer gelingt die Bestimmung der Brennweite in einer<br />
Messreihe. Bilden Sie dazu einen Gegenstand (im Versuch<br />
ist das ein 5 mm-Raster) mit einer der Konvexlinsen<br />
auf den Schirm für 6 verschiedene Abstände g scharf ab<br />
(Abb. 5). Messen Sie jeweils g und b.<br />
Abb. 5<br />
Auswertung:<br />
1. Berechnung der Brennweite f mit der Abbildungsgleichung<br />
(1) als Mittelwert mit Fehlerangabe.<br />
2. Grafische Darstellung, aus der man die Brennweite f<br />
direkt ablesen kann (3 Varianten sind möglich).<br />
3.3. Versuch:<br />
Ein systematischer Fehler ist dadurch bedingt, dass man<br />
die <strong>Linsen</strong>mitte auf der optischen Schiene nie genau feststellen<br />
kann. Man kann diesen Fehler mit dem Besselverfahren<br />
(Abb. 6) vermeiden: Gegenstand und Schirm bleiben<br />
bei diesem Verfahren fest stehen (Abstand e) und man<br />
erzeugt zunächst in<br />
Position I ein vergrößertes ( B I ) und dann durch<br />
Verschieben der Linse um d in der<br />
Position II ein verkleinertes ( B II ) Bild.<br />
Da nach der Abbildungsgleichung g I = b II und b I = g II gilt,<br />
erhält man hier die Brennweite aus:<br />
2 2<br />
b+ g= e g= ( e−d)/2<br />
bg e − d<br />
} } f = =<br />
b− g= d b= ( e+ d)/2 b+<br />
g 4e<br />
(7)<br />
Abb. 6 Zum Besselverfahren: Gemessen wird nur<br />
der feste Abstand e und die Verschiebung d der<br />
Linse an einer beliebigen Kante des optischen<br />
Reiters. Die tatsächliche Lage der Linse muss man<br />
nicht bestimmen.<br />
und man muss nur den festen Abstand e und die Verschiebung<br />
d der Linse messen.<br />
Benutzen Sie bitte dieselbe Konvexlinse wie in 3.2.<br />
Der Versuch gelingt nur für einen festen Abstand e ≥ 4f.<br />
Erzeugen Sie die beiden scharfen Bilder und messen Sie<br />
die Verschiebung d, jeder von Ihnen dreimal.<br />
Messen Sie den festen Abstand e, jeder einmal.<br />
Auswertung:<br />
Brennweite f nach Gl. 7 mit den Mittelwerten von d und e<br />
mit Fehlerangabe.<br />
4