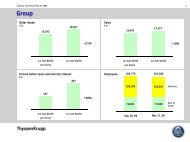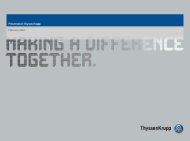forum - Technische Mitteilungen
forum - Technische Mitteilungen
forum - Technische Mitteilungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>forum</strong><br />
<strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong> ThyssenKrupp Juli 2001<br />
TK
02<br />
Impressum<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
ThyssenKrupp AG<br />
Zentralbereich Technik<br />
August-Thyssen-Straße 1<br />
40211 Düsseldorf<br />
Postfach 10 10 10<br />
40001 Düsseldorf<br />
Telefon 0211/8 24-3 62 91<br />
Telefax 0211/8 24-3 62 85<br />
Erscheinungsweise<br />
„<strong>forum</strong> – <strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong><br />
ThyssenKrupp“ erscheint<br />
ein- bis zweimal jährlich<br />
in deutscher und<br />
englischer Sprache.<br />
Nachdruck nur mit<br />
Genehmigung des<br />
Herausgebers.<br />
Fotomechanische<br />
Vervielfältigung<br />
einzelner Aufsätze<br />
ist erlaubt.<br />
Der Versand des<br />
„<strong>forum</strong> – <strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong><br />
ThyssenKrupp“<br />
erfolgt über eine<br />
Adressdatei, die mit<br />
Hilfe der automatisierten<br />
Datenverarbeitung<br />
geführt wird.<br />
ISSN 1438-5635<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Titelbild<br />
Die elektronische Geschäftsabwicklung und<br />
Kundenbetreuung über Internet und Intranet<br />
bietet Produktions-und Dienstleistungsunternehmen<br />
die Grundlage für eine Revolutionierung<br />
von Leistungserstellungsprozessen<br />
und Geschäftsbeziehungen. Die<br />
Einsatzmöglichkeiten reichen von Firmenpräsentationen<br />
im Internet als virtuellem<br />
Schaufenster über die Integration des Beschaffungswesens<br />
mit den E-Commerce-<br />
Anwendungen der Lieferanten, Verkaufsaktivitäten<br />
via Internet bis hin zu Dienstleistungen<br />
für den Kunden durch spezialisierte<br />
Serviceangebote.<br />
In der vorliegenden Ausgabe von <strong>forum</strong> –<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong> ThyssenKrupp<br />
stellen wir netzwerkbasierte Problemlösungen<br />
und innovative Dienstleistungen unserer<br />
Konzernunternehmen vor, die für den<br />
diesjährigen ThyssenKrupp Innovationswettbewerb<br />
eingereicht wurden.<br />
Als besonders anerkennenswerte Leistung<br />
wurden folgende Vorschläge ausgezeichnet:<br />
● „E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing<br />
der Zukunft von Thyssen<br />
Schulte“ mit dem ersten Preis,<br />
● „SerKom – die mobile Kommunikationslösung<br />
für den Servicetechniker“<br />
und „Die neue, modulare<br />
Lenksäule von Krupp Presta“ mit dem<br />
zweiten Preis,<br />
● „Serviceprodukt ‚Schlagleistung‘ –<br />
Hydraulikhammer mit Fernübertragung<br />
der Leistungsdaten durch integrierte<br />
Auswerteelektronik“ mit dem dritten<br />
Preis.<br />
Einzelheiten hierzu können Sie den Beiträgen<br />
dieses Heftes entnehmen.
03<br />
Vorwort<br />
Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Schulz, Vorsitzender des Vorstands der ThyssenKrupp AG<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
innovative Dienstleistungen, die kundenorientiert<br />
effiziente Poblemlösungen bieten,<br />
schaffen neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung.<br />
Über Internet und Intranet können Geschäftsprozesse<br />
einfacher, flexibler, effizienter<br />
und schneller gestaltet werden. In Anbetracht<br />
der Bedeutung dieser Potenziale wurde<br />
der diesjährige Innovationswettbewerb<br />
des ThyssenKrupp Konzerns unter das<br />
Motto „Dienstleistungen und E-Business“<br />
gestellt, dessen Ergebnisse wir Ihnen in der<br />
vorliegenden Ausgabe von „<strong>forum</strong> – <strong>Technische</strong><br />
<strong>Mitteilungen</strong> ThyssenKrupp“ vorstellen<br />
möchten.<br />
Systemgeschäft als Dienstleistung hat sich<br />
Krupp Presta mit der Entwicklung einer modularen<br />
Lenksäule zur Aufgabe gemacht.<br />
Ein Beispiel für völlig neuartige Dienstleistungs-Produkte<br />
ist die Bereitstellung von<br />
Schlagleistung statt des Verkaufs von Bauhämmern<br />
bei Krupp Berco Bautechnik.<br />
Online-Verkauf über das Internet bringt Anbietern<br />
und Kunden Vorteile: Die Vetriebskosten<br />
sinken und der Kunde gewinnt an Flexibilität<br />
und Reaktionsfähigkeit beim Einkauf.<br />
ThyssenKrupp Stahl hat eine E-Commerce-<br />
Plattform im Internet errichtet, über die in<br />
Online-Auktionen Stahl aus Lagerbeständen<br />
verkauft und freie Walzkapazitäten angeboten<br />
werden.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Im TS-Online-Shop von Thyssen Schulte<br />
können sich die Kunden rund um die Uhr<br />
über 120.000 verschiedene Produkte informieren<br />
und diese direkt bestellen.<br />
Auch in anderen Bereichen werden E-Business-Lösungen<br />
eingesetzt: bei Krupp VDM<br />
und Hoesch Hohenlimburg zur Produktinformation,<br />
bei Krupp Bilstein im Aftermarketgeschäft<br />
von Stoßdämpfern, bei Krupp<br />
Polysius im Vertrieb von Ersatzteilen für<br />
Zementwerke und bei Timtec Telematik für<br />
telematikbasierte Systeme in der Transportwirtschaft.<br />
Auf der Beschaffungsseite – Stichwort:<br />
E-Procurement – nutzt eine Vielzahl von<br />
Unternehmen die Vorteile des Inter- und Intranets,<br />
indem z.B. für Verbrauchsmaterialien<br />
interne wie externe Bestellungen auf Basis<br />
elektronischer Produktkataloge erfolgen<br />
und Angebote über Online-Ausschreibungssysteme<br />
eingeholt werden.<br />
Die genannten Beispiele zeigen, dass „New<br />
Economy“ und „Old Economy“ keine Gegensätze<br />
sind, sondern im Zusammenspiel<br />
Kundennutzen und Geschäftserfolg erheblich<br />
steigern.<br />
Ekkehard Schulz<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Ekkehard Schulz,<br />
Vorsitzender des<br />
Vorstands der<br />
ThyssenKrupp AG
04<br />
Inhalt<br />
Daphne Dorighi,<br />
MSS/ECC/E-Promotion Services,<br />
Dr.-Ing. Stefanie Wippermann,<br />
MSS/ECC/E-Promotion Services,<br />
Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg<br />
Seite 9<br />
Online-Verkauf bei ThyssenKrupp<br />
Stahl<br />
ThyssenKrupp Stahl bietet seit Anfang<br />
des letzten Jahres mit dem TKS Online-<br />
Verkauf als erstes Qualitäts-Flachstahlunternehmen<br />
in Europa die Möglichkeit,<br />
Stahl über das Internet zu kaufen. Die Verkaufsaktionen<br />
laufen in Form von Auktionen<br />
ab, bei denen der Kaufinteressent für<br />
die vom Verkauf TKS eingestellten Materialstücke<br />
oder Kapazitäten in einem definierten<br />
Zeitraum sein Gebot abgibt. Nach<br />
Ablauf der Verkaufsaktion werden die Gebote<br />
durch die Verkäufer gesichtet und der<br />
Zuschlag in der Regel nach dem Höchstgebot<br />
erteilt.<br />
Mit dem Online-Verkauf gibt TKS seinen<br />
Kunden die Gelegenheit, von jedem Ort der<br />
Welt den Stahleinkauf einfacher, flexibler<br />
und effizienter zu gestalten.<br />
Zurzeit werden Vorratsmaterial aus der<br />
gesamten Produktpalette, Warmband aus<br />
kurzfristig anstehender Produktion sowie<br />
Ia-Grobblech-Walzkapazität online verkauft.<br />
Als nächster Schritt steht das „Offer-tosell“<br />
auf dem Plan, mit dem gezielt Kunden<br />
mit speziell geschnürten Angeboten über<br />
Internet angesprochen werden können.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Andre-Thorsten Hebel,<br />
Abteilungsleiter Materialwirtschaft,<br />
Dipl.-Kfm. Ralf Müller-Beckhoff,<br />
Abteilungsleiter Informatik-Anwendungen,<br />
Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg<br />
Seite 13<br />
E-Purchasing bei ThyssenKrupp<br />
Stahl durch das internetbasierte<br />
Online-Ausschreibungssystem<br />
„W3AS“<br />
Seit Ende 2000 steht für Ausschreibungen<br />
bei TKS das Online-Ausschreibungssystem<br />
„W3AS“ zur Verfügung. Das System<br />
ist so konfiguriert, dass grundsätzlich<br />
alle Bedarfe an Hilfs- und Betriebsstoffen,<br />
Reserveteilen, Werksgeräten, Produktionsstoffen,<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br />
Investitionsgütern und Dienstleistungen<br />
hierüber ausgeschrieben werden<br />
können.<br />
Durch Integration in das SAP-System<br />
werden alle Aktionen von W3AS automatisch<br />
dort abgebildet. Eine vom Einkäufer<br />
im SAP-System angelegte Anfrage wird<br />
nach W3AS übertragen und dort als „offene“,<br />
d.h. für alle interessierten Lieferanten<br />
zugängliche, oder „geschlossene“, d.h. nur<br />
für vom Einkäufer ausgewählte Lieferanten,<br />
Ausschreibung freigeschaltet.<br />
Die online eingegebenen Angebote werden<br />
automatisch von W3AS in das SAP-<br />
System übertragen. Erst nach Ablauf der<br />
Angebotsfrist erhält der Einkäufer Zugang<br />
zu den eingegangenen Angeboten, wobei<br />
das System automatisch ein Ranking aller<br />
Angebote erstellt.<br />
W3AS führt zu Einsparungen durch Verbesserung<br />
der Einkaufskonditionen infolge<br />
„grenzenlosen“ Wettbewerbs sowie zu einer<br />
Reduzierung der Prozesskosten durch<br />
geringeren administrativen Aufwand.<br />
Ralf Jacke,<br />
Abteilungsleiter Materialwirtschaft,<br />
Dipl.-Kfm. Ralf Müller-Beckhoff,<br />
Abteilungsleiter Informatik-Anwendungen,<br />
Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg<br />
Seite 17<br />
E-Procurement bei ThyssenKrupp<br />
Stahl mittels elektronischer Kataloge<br />
im Intranet/Internet<br />
Die Beschaffung von C-Artikeln wird bei<br />
TKS zukünftig weitestgehend durch direkten<br />
Abruf aus elektronischen Produktkatalogen<br />
erfolgen, die im „Materialwirtschaft<br />
e-shop“ im Intranet zur Verfügung stehen.<br />
Abrufe können alle betrieblichen Mitarbeiter<br />
auslösen, denen vom Kostenstellenverantwortlichen<br />
ein Budget zugewiesen<br />
wurde.<br />
Umfangreiche Suchfunktionen ermöglichen<br />
das schnelle Auffinden der benötigten<br />
Artikel.<br />
Ausgewählte Artikel werden in einem<br />
Warenkorb zwischengespeichert, von dem<br />
aus der direkte Abruf beim Lieferanten erfolgt.<br />
Jeder berechtigte Nutzer kann sich<br />
eigene Warenkörbe anlegen, auf die er jederzeit<br />
ohne weitere Katalogsuche zugreifen<br />
kann.<br />
Die Wareneingänge werden in SAP erfasst<br />
und stoßen dort Gutschriften an, Einbuchung<br />
und Rechnungsprüfung entfallen.<br />
Die Vorteile des Materialwirtschaft e-shop-<br />
Konzepts liegen vorrangig in der erheblichen<br />
Straffung des Beschaffungsprozesses<br />
von Katalogteilen – mit einer wesentlichen<br />
Verkürzung der Beschaffungszeit für<br />
beim Lieferanten gelagerte Artikel – und<br />
der damit einhergehenden Reduzierung<br />
der entsprechenden Prozesskosten.
05<br />
Inhalt<br />
Dipl.-Kfm. Klaus Hedding,<br />
Stellvertretender Marketingleiter,<br />
Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen<br />
Seite 21<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
Mit drei E-Business-Lösungen hat<br />
Hoesch Hohenlimburg eine inhaltliche Verknüpfung<br />
zu den Bereichen Beschaffung,<br />
Service und Vertrieb über das Internet hergestellt.<br />
Das E-Procurement für C-Materialien<br />
wurde eingeführt, um bei der großen Anzahl<br />
von Bestellungen die Prozesskosten<br />
und Durchlaufzeiten zu minimieren. Die Lösung<br />
besteht in einem für jeden Mitarbeiter<br />
zugänglichen elektronischen Katalog für<br />
Büromaterial, Werbemittel und Werkzeuge.<br />
Mit der direkten Auslösung der Bestellung<br />
wird diese automatisch an den Lieferanten<br />
übermittelt; gelieferte Positionen werden<br />
automatisch in SAP R/3 erfasst.<br />
Zielsetzung des Mittelband-Internetauftritts<br />
war die Schaffung einer kommunikativen<br />
Plattform für den Informationsaustausch<br />
zwischen dem Geschäftsbereich<br />
Mittelband und dessen Kunden. Dem Kunden<br />
wird ein tiefer Einblick in den Fertigungsprozess<br />
mit tagesaktueller Verfolgung<br />
des Fertigungsfortschritts seines bestellten<br />
Produkts ermöglicht.<br />
Mit der Implementierung eines Supply-<br />
Chain-Management im Geschäftsbereich<br />
Spezialprofile wurde eine Lösung geschaffen,<br />
einen ständigen und transparenten<br />
Informationsaustausch zwischen dem Endverbraucher,<br />
dem Distributor GSP in USA<br />
(Joint-Venture-Partner) und Hoesch Hohenlimburg<br />
zu gewährleisten. Dem Endverbraucher<br />
stehen über die GSP-Datenbank<br />
für die unterschiedlichsten Fragestellungen<br />
aktuelle Informationen zeitnah zur Verfügung.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Uriel Batres,<br />
CENDI-Promotion Coordinator,<br />
Carlos Hernandez,<br />
Commercial Director,<br />
Mexinox S.A. de C.V., San Luis Potosi, Mexiko<br />
Seite 27<br />
CENDI – eine zur Förderung der<br />
Marktentwicklung von nichtrostendem<br />
Stahl in Mexiko gegründete<br />
Organisation<br />
Mit der Gründung von CENDI ( Centro<br />
Nacional para el Desarollo del Acero Inoxidable)<br />
hat Mexinox gemeinsam mit weiteren<br />
Unternehmen ein nationales Zentrum<br />
zur Förderung nichtrostenden Stahls in<br />
Mexiko geschaffen.<br />
CENDI kanalisiert und koordiniert die<br />
Bemühungen von Produzenten, Zwischenhändlern,<br />
Verarbeitern und Endverbrauchern<br />
in den Bereichen Forschung, Ausbildung<br />
und Werbung für nichtrostenden<br />
Stahl.<br />
CENDI verfügt über eigene Einrichtungen<br />
für praktische Schulungen, in denen Mitarbeiter<br />
mexikanischer Unternehmen zum<br />
„Spezialtechniker für nichtrostenden Stahl“<br />
ausgebildet werden. Außerdem wird ein<br />
Spezialprogramm für das Vertriebspersonal<br />
der Mitgliedsunternehmen angeboten mit<br />
dem Ziel, vorhandenen und potentiellen<br />
Kunden die Vorzüge von nichtrostendem<br />
Stahl aufzuzeigen.<br />
Um das Zusammenwirken der Mitglieder<br />
zu verstärken und die Kontakte zum Kunden-<br />
und Interessentenkreis zu fördern, hat<br />
CENDI eine eigene Website im Internet eingerichtet,<br />
auf der regelmäßig über die Aktivitäten<br />
von CENDI berichtet wird und aktuelle<br />
Informationen zum Thema nichtrostender<br />
Stahl veröffentlicht werden.<br />
Prof. Dr. Heinz Humberg,<br />
Dekan des Fachbereiches Informations- und<br />
Kommunikationstechnik,<br />
Fachhochschule Gelsenkirchen, Abteilung<br />
Bocholt<br />
Dr.-Ing. habil. Ulrich Brill,<br />
Leiter Entwicklung und Qualitätsmanagement,<br />
Krupp VDM GmbH, Werk Altena<br />
Seite 31<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen<br />
Werkstoff im Internet<br />
WDISweb ist ein für die Kommunikation<br />
mit Kunden entwickeltes über Internet und<br />
Intranet zugängliches System, um im Vorfeld<br />
des Beratungsgesprächs den Kunden<br />
schnell zu den Werkstoffen zu führen, die<br />
für die jeweilige Aufgabenstellung am geeignetsten<br />
sind.<br />
Basis für die in WDISweb abrufbaren<br />
Daten sind die in den Werkstofflabors von<br />
Krupp VDM ermittelten Versuchsergebnisse,<br />
die ständig aktuell gehalten werden.<br />
Daneben sind die kompletten Werkstoffdatenblätter<br />
hinterlegt und von WDISweb<br />
aus zugänglich.<br />
Die Werkstoffsuche ist über Werkstoff-<br />
Nummer bzw. Werkstoffbezeichnung, mechanische<br />
Eigenschaften, Einsatzmedien<br />
und Schweißen möglich.<br />
Das Teilsystem SISSY (Schweißinformationssystem)<br />
enthält Informationen über die<br />
Schweißbarkeit von Werkstoffen, Schweißverfahren,<br />
Zusatzwerkstoffe und Mengenbedarf,<br />
unterstützt von Schweißprotokollen.
06<br />
Inhalt<br />
Dr.-Ing. Kurt Orthmann,<br />
Leiter E-Business,<br />
Krupp Bilstein GmbH, Ennepetal<br />
Seite 36<br />
Bilstein-Dämpfer über<br />
www.Bilstein.de<br />
Das Aftermarketgeschäft von Stoßdämpfern<br />
für den Verschleißersatz und<br />
Fahrwerkverbesserung ist eine wichtige<br />
Stütze in der Strategie von Krupp Bilstein.<br />
Um die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen<br />
in diesem Geschäft zu verbessern,<br />
wird hierfür eine E-Business-Lösung entwickelt,<br />
die sowohl die Präsenz bei den<br />
Handelsstufen und Endverbrauchern als<br />
auch die Qualität der Anfragen und der<br />
Auftragsbearbeitung deutlich steigern soll.<br />
Der Internetauftritt von Krupp Bilstein ist<br />
sehr genau auf die unterschiedlichen Anforderungen<br />
der einzelnen Zielgruppen<br />
ausgerichtet. Jeder Kunde kann auf eine<br />
speziell für seine Bedürfnisse zugeschnittene<br />
Plattform zugreifen. Das Werkstatt-<br />
Portal stellt den Werkstätten einen schnellen<br />
und professionellen Service bereit. Ziel<br />
des Bilstein-Clubs ist es, motorsportnahe<br />
Kunden anzuziehen, ihnen die gewünschte<br />
Information optimal aufbereitet zu liefern<br />
und zum Kauf zu animieren. Der werkseigene<br />
Bilstein-Shop in Ennepetal ist das<br />
Testzentrum für den Internetauftritt. Hier<br />
werden die neuen Abläufe und Werkzeuge<br />
getestet, bevor sie für die Kunden freigeschaltet<br />
werden.<br />
Die von Krupp Bilstein gewählte Internet-<br />
Lösung ist höchst innovativ, da sie Werkstattkunden,<br />
Einzelhändler und Endverbraucher<br />
direkt anspricht, ohne dabei die<br />
Zwischenhändler zu verlieren.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Arndt Birkert,<br />
Leiter Sparte Umformtechnik,<br />
Dipl.-Ing. Sven Leonhardt, Teamleiter Methode<br />
IHU,<br />
Klaus Truetsch, Projektleiter,<br />
Krupp Drauz GmbH, Heilbronn<br />
Dipl.-Ing. Ralf Sünkel, Koordination Technologie<br />
Blechumformung,<br />
Thyssen Krupp Automotive AG, Bochum<br />
Seite 41<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
Das Innenhochdruck-Umformen ist eine<br />
wirtschaftliche Alternative zu konventionellen<br />
Fertigungsverfahren der Blechumformung.<br />
Für eine breite Anwendung fehlen<br />
z.Zt. noch qualifiziertes Personal und Erfahrungswissen.<br />
Mit dem „Wissensspeicher Hydroforming“<br />
wird von Krupp Drauz ein System<br />
geschaffen, mit dem die in unterschiedlichsten<br />
Projekten gesammelten Erfahrungen<br />
in Datenbanken – Prozessdatenbank, Materialdatenbank,<br />
Vertriebsdatenbank und<br />
Literaturdatenbank – erfasst werden, die<br />
miteinander verknüpft sind. Bei der Programmierung<br />
der System-Software wurde<br />
großer Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt,<br />
um neue Daten und Erfahrungen problemlos<br />
in das System einpflegen zu können.<br />
Nach Fertigstellung soll das System über<br />
Intranet allen Konzernunternehmen, die<br />
Hydroforming praktizieren, zur Verfügung<br />
gestellt werden, sodass alle im System gespeicherten<br />
Daten von allen Teilnehmern<br />
bei der Entwicklung neuer Bauteile genutzt<br />
werden können.<br />
Edith Ludescher, Einkauf,<br />
Armin Baumann, Materialwirtschaft,<br />
Hans Giger, Einkauf,<br />
Peter Laukas, Einkauf,<br />
Ivo Solèr, SAP-Applikation,<br />
Dieter Thelen, Leiter Einkauf,<br />
Krupp Presta AG, Eschen, Liechtenstein<br />
Seite 46<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen<br />
via Internet bei Krupp Presta<br />
Zur Gewährleistung eines kostenoptimalen<br />
Einkaufs wurde bei Krupp Presta eine<br />
Trennung des Bestellwesens in einen vom<br />
aktuellen Bedarfsfall losgelösten strategischen<br />
Einkaufsteil mit Ausschreibungen,<br />
Vergabeverhandlungen und Konditionsfestlegungen<br />
und einen operativen Einkaufsteil,<br />
bei dem die Verantwortung auf<br />
den Bedarfsträger übertragen wird, eingeführt.<br />
Dieser operative Teil umfasst Artikel<br />
und Material, welche nicht systemtechnisch<br />
innerhalb der bestehenden SAP-Lösung<br />
dispositiv bewirtschaftet werden müssen<br />
(C-Teile). Für jede Warengruppe wurde ein<br />
passender Lieferant festgelegt und das<br />
Sortiment dieser Lieferanten in einem Katalog<br />
zusammengefasst. Online-Bestellungen<br />
seitens der Bedarfsträger gehen an einen<br />
Provider, der den entsprechenden Lieferanten<br />
mit der direkten Lieferung an KPR<br />
beauftragt. Die Abrechnung der einzelnen<br />
Lieferanten erfolgt mit dem Provider, der<br />
wiederum monatlich per Sammelfaktura,<br />
sortiert nach Kostenstellen, mit KPR<br />
abrechnet. Hierdurch wird eine wesentliche<br />
Senkung der Abwicklungskosten erzielt.<br />
Der gewählte Ablauf führt zu erheblichen<br />
Reduzierungen der Lagerbestände bei<br />
gleichzeitiger Beschleunigung der Bestellund<br />
Lieferabwicklung.
07<br />
Inhalt<br />
Dipl.-Ing. HTL Siegfried Dejaco,<br />
Projektmanager Lenkungen,<br />
Krupp Presta AG, Eschen, Liechtenstein<br />
Seite 51<br />
Die neue, modulare Lenksäule<br />
von Krupp Presta<br />
Die Aufgabenstellung lautete, ein modulares<br />
Lenksystem zu entwickeln, das sich<br />
gleichzeitig für Fahrzeuge von drei unterschiedlichen<br />
Automobilherstellern eignet.<br />
Dabei sollte ein höchstmöglicher Anteil an<br />
Gleichteilen erzielt werden.<br />
Die Problemlösung besteht in einem gemeinsamen<br />
Lenkstrang für alle Fahrzeuge<br />
und zwei unterschiedlichen Anbindungen<br />
an das Cockpit. Für das leistungsoptimierte<br />
Fahrzeugsegment wird eine Aluminium-<br />
Anbindung, für die übrigen Fahrzeuge eine<br />
kostenoptimierte Stahlblech-Anbindung<br />
eingesetzt.<br />
Die Weiterentwicklung der modularen<br />
Idee für den Einsatz bei weiteren Fahrzeugplattformen<br />
von Ford führte zu einer im Design<br />
an die Montageabläufe bei Ford angepassten<br />
Lenksäule, die dort „in house“<br />
gefertigt werden kann und somit zu einem<br />
Erhalt gewerkschaftlich abgesicherter<br />
Arbeitsplätze führt.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Dipl.-Wirt.-Ing. Jörg Schulz,<br />
Vertriebs- und Serviceleitung,<br />
Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen<br />
Seite 54<br />
SerKom – die mobile Kommunikationslösung<br />
für den Servicetechniker<br />
In der Aufzugsbranche ist die Effizienz<br />
des Kundenservice ein wettbewerbsbestimmender<br />
Faktor.<br />
Um den Einsatz beim Kunden zu konzentrieren<br />
und kurze Aktivierungs- und Reaktionszeiten<br />
des Servicepersonals zu realisieren,<br />
wurde bei Thyssen Aufzüge mit<br />
„SerKom“ eine mobile E-Commerce-<br />
Lösung für die Service-Abwicklung entwickelt.<br />
Diese Lösung besteht aus einem mit<br />
Notebook, Drucker und Handy ausgestatteten<br />
SerKom-Koffer und einer mit dem<br />
firmeneigenen SAP-System kommunizierenden<br />
Software. Der Servicetechniker hat<br />
damit die Möglichkeit, sich am Einsatzort in<br />
das SAP-System einzuklinken und tagesaktuelle<br />
Auftragsdaten zu laden und nach<br />
Bearbeitung an das System zur Auswertung<br />
zurückzusenden.<br />
Mit einer installierten Diagnosesoftware<br />
können vor Ort Abfragen des Systemzustandes<br />
einer Aufzugsanlage durchgeführt<br />
und Störungen schnell und zielsicher lokalisiert<br />
und behoben werden. Ersatzteilbestellungen<br />
bzw. die Erteilung von Reparaturaufträgen<br />
können direkt beim Servicetechniker<br />
erfolgen.<br />
Mit SerKom wird eine wesentliche Beschleunigung<br />
des Informations- und Datenflusses<br />
bei gleichzeitiger Minimierung<br />
des administrativen Aufwandes erzielt.<br />
Hierdurch werden höhere Kundenzufriedenheit<br />
und engere Kundenbindung erzeugt.<br />
Dipl.-Ing. Lothar Jungemann, Fachbereichsleiter<br />
Service/Ersatzteile,<br />
Dipl.-Ing. Kurt Lemm, Leiter Ersatzteiltechnik,<br />
Dipl.-Ing. Bernd Kripzak, Ersatzteiltechnik,<br />
Krupp Polysius AG, Beckum<br />
Seite 58<br />
B2B im Großanlagenbau –<br />
Vertrieb von Ersatzteilen für<br />
Zementwerke<br />
B2B (Business-to-Business) über<br />
Online-Shops ist mittlerweile ein gängiges<br />
Medium im Vertrieb. Die eigentliche<br />
Herausforderung ist dabei jedoch der<br />
zugrunde liegende Katalog.<br />
Für Händler und Serienhersteller bedeutet<br />
die Erstellung von Katalogen nur die<br />
Umstellung von Papier auf elektronische<br />
Medien. Für Anlagenbauer sind Kataloge<br />
jedoch in der Regel wie ihre Produkte erstellte<br />
Einzelanfertigungen, die direkt auf<br />
einen Kunden zugeschnitten werden.<br />
Man unterscheidet hier zwischen General<br />
E-Catalogues und Tailor-made E-Catalogues.<br />
Ziel eines Online-Shops für Händler und<br />
Serienhersteller ist die möglichst breite<br />
Streuung ihrer Produktinformationen, um<br />
viele Kunden zu erreichen. Gleichzeitig soll<br />
den Kunden die Barriere zum Kauf der Produkte<br />
gesenkt werden.<br />
Im Anlagenbau ist die Kundenbindung in<br />
der Regel schon vorhanden. Ersatzteile<br />
braucht nur, wer bereits eine Anlage betreibt.<br />
Ziel des Online-Shops ist daher vor<br />
allem die Reduzierung der Prozesskosten,<br />
da sowohl auf Hersteller- wie auch auf Betreiberseite<br />
oftmals erheblicher Aufwand<br />
für die Beschaffung von Ersatzteilen betrieben<br />
wird. Das kann nur durch eine möglichst<br />
enge Verzahnung der Vertriebs- und<br />
Beschaffungsprozesse der beiden Handelspartner<br />
geschehen, wobei das heutige<br />
Medium für die Kommunikation der Tailormade<br />
E-Catalogue ist.
08<br />
Inhalt<br />
Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop,<br />
Geschäftsführer Technik,<br />
Dipl.-Ing. Thomas Deimel,<br />
Leiter Entwicklung/Konstruktion,<br />
Krupp Berco Bautechnik GmbH, Essen<br />
Seite 62<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“<br />
– Hydraulikhammer mit Fernübertragung<br />
der Leistungsdaten durch<br />
integrierte Auswerteelektronik<br />
Schwere Hydraulikhämmer werden zunehmend<br />
zur sprengstofflosen Gesteinsgewinnung<br />
in Steinbrüchen eingesetzt. In<br />
derartigen Einsätzen sind die Betriebskosten<br />
von verschiedenen Einflussgrößen abhängig<br />
und schwer abschätzbar. Es besteht<br />
daher der Kundenwunsch, nicht den Hydraulikhammer<br />
zu erwerben, sondern für<br />
die tatsächlich abgeforderte Leistung zu<br />
bezahlen. Für ein derartiges Geschäft fehlte<br />
bisher ein geeignetes Abrechnungssystem.<br />
Ein neu entwickelter elektronischer<br />
Schlagzähler ermittelt Betriebsdaten, die<br />
u.a. eine Aussage über Einsatzdauer,<br />
Schlagzahl und Einsatzart des Hydraulikhammers<br />
sowie über die Arbeitsweise des<br />
Bedieners machen. Die über eine Infrarotschnittstelle<br />
auslesbaren Daten sind die<br />
Grundlage für eine in diesem Markt vollkommen<br />
neue Produktidee, den Vertrieb<br />
von „Schlagleistung“ im Rahmen eines<br />
Full-Service-Angebotes.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Dr. rer. pol. Claus Algenstaedt,<br />
Abteilungsdirektor Zentrales Marketing,<br />
Thyssen Schulte GmbH, Düsseldorf<br />
Seite 67<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im<br />
Werkstoff-Marketing der Zukunft<br />
von Thyssen Schulte<br />
In onlinebasierten Geschäftskonzepten<br />
greifen traditionelle Ansätze von Kundenkommunikation<br />
und Marketingstrategien<br />
nur unzureichend. Deshalb ist die konsequente<br />
Ausrichtung der Online-Kundenpflege<br />
nach den Prinzipien des „One-to-<br />
One-Marketing“ erforderlich. Hierfür sind<br />
vielfältige personalisierte Informationen der<br />
Kunden ebenso notwendig wie die Absicherung,<br />
dass alle Kundenkontakte im Unternehmen<br />
in einem geschlossenen Regelkreis<br />
genutzt werden.<br />
Bei der Entwicklung derartiger Online-<br />
Strukturen kommt dem Einsatz von „digitalen<br />
Agenten“ nach der CyberSmart-Technologie<br />
zentrale Bedeutung zu. Diese Software-Tools<br />
arbeiten system- und plattformunabhängig<br />
in neuronalen Netzen und verbundenen<br />
statistischen Strukturen.<br />
„Digitale Software-Agenten“ sammeln,<br />
speichern und verwalten Daten selbstständig<br />
oder nach vorstrukturierten Regeln der Verkaufsabteilungen.<br />
Sie sind in der Lage,<br />
durch Mechanismen der Wiedererkennung<br />
in Echtzeit kundenindividuelle Informationstransfers<br />
für das Unternehmen zu steuern<br />
und durchzuführen, z.B. in Echtzeit die Angebotssteuerung,<br />
die Vorlage von Alternativprodukten<br />
sowie Feedback-Operationen.<br />
Parallel entstehen auf diese Weise dynamisch-gepflegte<br />
Kundendatenbanken ohne<br />
manuelle Bearbeitung und Datenpflege.<br />
Die CyberSmart-Technologie dürfte inzwischen<br />
einen Entwicklungsstand erreicht haben,<br />
der ihre Berücksichtigung bei der Weiterentwicklung<br />
von „TS Online“ als erfolgversprechend<br />
erscheinen läßt. Es ist eine<br />
mehrjährige Vorlaufphase einzuplanen.<br />
Dr.-Ing. Andreas Bastin,<br />
Geschäftsführer,<br />
Axel Cebulla,<br />
Salesmanager,<br />
Timtec Telematik GmbH, Lünen<br />
Seite 73<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft:Telematikgestütztes<br />
Flottenmanagement via<br />
Internet und Online-Disposition<br />
Um dem zunehmenden Kostendruck<br />
entgegenzuwirken, müssen Transportunternehmen<br />
die Einsparmöglichkeiten in<br />
Fuhrpark und ihrer Organisation durch<br />
optimalen Einsatz von Personal, Fahrzeugen<br />
und Gerät konsequent nutzen.<br />
Mit dem System ATIS MT II hat Timtec<br />
Telematik das erste „intelligente“ Telematiksystem<br />
für den intermodalen Verkehr<br />
entwickelt. Mit diesem System ist ein automatischer<br />
Soll-Ist-Vergleich zwischen den<br />
Plandaten der Disposition und den Ist-<br />
Daten des Transportverlaufes möglich.<br />
Hieraus ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale.<br />
ATIS-Trailer ist ein telematikbasiertes<br />
Flottenmanagementsystem für den Betrieb<br />
und die Überwachung von Sattelaufliegern.<br />
Es besteht aus der Trailer-Box, dem Telematiksystem<br />
am Fahrzeug und dem Internetportal<br />
CargoView, über das alle für den<br />
Nutzer erforderlichen Informationen zur<br />
Verfügung gestellt werden. Neben logistischen<br />
Optimierungseffekten wie Auslastung,<br />
Umlaufoptimierung, Just-in-time-<br />
Kontrolle und Kundenservice liegt ein wesentlicher<br />
Nutzen in der technischen Überwachung<br />
des Fahrzeugs durch die Datenübernahme<br />
aus der Fahrwerkselektronik.
09<br />
Daphne Dorighi,<br />
Dr.-Ing. Stefanie Wippermann<br />
Online-Verkauf bei ThyssenKrupp Stahl<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Präsentation der E-Commerce-Aktivitäten von ThyssenKrupp Stahl<br />
im Internet-Café auf der Hannover Messe 2001 (Bild 1)
10<br />
1 Einleitung<br />
Online-Verkauf bei ThyssenKrupp Stahl<br />
Old Economy – unter dieser Rubrik werden<br />
Stahlproduzenten immer noch allzu<br />
häufig eingestuft. Dass es sich bei diesen<br />
Unternehmen heute um High-Tech-Firmen<br />
handelt, muss verstärkt in die Öffentlichkeit<br />
getragen werden. ThyssenKrupp Stahl<br />
(TKS) geht hier unkonventionelle Wege und<br />
hat den frischen Wind der New Economies<br />
eingefangen. Seit Februar 2000 bietet TKS<br />
als erstes Qualitäts-Flachstahlunternehmen<br />
in Europa die Möglichkeit, Stahl via Internet<br />
zu kaufen. E-Commerce mit dem TKS Online-Verkauf<br />
(Bild 2).<br />
Mit dem TKS Online-Verkauf ist die<br />
Thyssen Krupp Stahl AG Vorreiter in der<br />
Stahlindustrie. Das Unternehmen konnte<br />
sich hierdurch in kürzester Zeit eine herausragende<br />
Position mit Alleinstellungsmerkmal<br />
erarbeiten.<br />
Denn seit längerem ist absehbar, dass<br />
E-Commerce keine Eintagsfliege ist und die<br />
Geschäftsbeziehungen in Zukunft maßgeblich<br />
beeinflussen, wenn nicht sogar revolutionieren<br />
wird. Wer da nicht am Ball bleibt,<br />
wird überrollt. Die Zahlen sprechen für sich:<br />
Gemäß einer Studie der Deutschen Bank<br />
werden im Jahre 2006 mehr als 50 Prozent<br />
der prognostizierten weltweiten Stahlproduktion<br />
von über 800 Mio Tonnen über<br />
E-Commerce-Marktplätze verkauft.<br />
Oberstes Ziel der E-Sales&Service Funktionalitäten<br />
von ThyssenKrupp Stahl ist der<br />
erweiterte Service für die Kunden: Mit dem<br />
Stahleinkauf via Internet wird dem Kunden<br />
ein Wettbewerbsvorteil durch direkten und<br />
schnellen Zugriff auf attraktives Material verbunden<br />
mit kurzen Lieferzeiten verschafft.<br />
Für TKS steht vor allem die Prozessoptimierung<br />
im Vordergrund. Durch den hohen<br />
Anteil automatisierter Vorgänge bei der<br />
E-Commerce-Anwendung kann eine deutli-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Stahleinkauf via Internet mit dem TKS Online-Verkauf (Bild 2)<br />
che Effizienzsteigerung des Vertriebsprozesses<br />
erzielt werden.<br />
2 Stahleinkauf per Mausklick –<br />
weltweit<br />
Nach der Registrierung durch die Abteilung<br />
E-Commerce Services können interessierte<br />
Kunden mit ihrer User-ID und ihrem<br />
Kennwort an den Verkaufsaktionen bei TKS<br />
teilnehmen. Es handelt sich hierbei um so<br />
genannte „Sealed Bid Auctions“, das heißt<br />
die Kunden geben für die eingestellten<br />
Materialstücke oder Kapazitäten in einer<br />
definierten Zeit Gebote ab, die nur für TKS<br />
intern sichtbar sind. Nach Ablauf der jeweiligen<br />
Verkaufsaktion werden die Gebote<br />
durch die verantwortlichen Verkäufer<br />
gesichtet und der Zuschlag in der Regel an<br />
das Höchstgebot erteilt.<br />
Die Materialstücke werden von der<br />
Redaktion des TKS Online-Verkaufs im<br />
E-Competence Center über ein „Redaktions“-Programm<br />
zusammen- und ins Internet<br />
gestellt. Im Vorfeld jeder Verkaufsaktion<br />
können sich die Kunden im Internet über<br />
den genauen Ablauf jeder Verkaufsaktion<br />
informieren. Pro Gebotsseite stehen zwischen<br />
vier und sieben Materialstücke zum<br />
Verkauf an. Die Zeit, in der die Kunden für<br />
bestimmte oder auch für alle Stücke Gebote<br />
abgeben können, variiert je nach Aktion<br />
zwischen vier und sechs Minuten. Um optimale<br />
Sicherheit zu gewährleisten, werden<br />
die Gebote erst durch die Bestätigung mit<br />
einer individuellen Transaktions-ID durch<br />
den Kunden verbindlich. Unter der Rubrik<br />
„Gebote/Zuschläge“ können die Kunden<br />
jederzeit verfolgen, für welche Materialstücke<br />
bzw. Kapazitäten sie bereits Gebote<br />
abgegeben haben.<br />
Nach Ablauf der jeweiligen Aktion erfolgt<br />
bei TKS die Zuschlagsvergabe (Bild 5). Das<br />
Redaktionsprogramm bereitet die eingegangenen<br />
Gebote pro Materialstück in absteigender<br />
Reihenfolge auf, sodass das<br />
Höchstgebot immer an erster Stelle erscheint.<br />
Zeitnah nach der Verkaufsaktion können<br />
die Kunden im Internet unter der Lasche
11<br />
Online-Verkauf bei ThyssenKrupp Stahl<br />
„Gebote/Zuschläge“ einsehen, ob und für<br />
welches Materialstück/Kapazität sie den<br />
Zuschlag erhalten haben. Alle Kunden werden<br />
außerdem gesondert per E-Mail über<br />
den Ausgang ihrer Gebote informiert. Eine<br />
Auftragsbestätigung zu den bezuschlagten<br />
Stücken erhalten die Kunden wie gewohnt<br />
per Post.<br />
Die Anwendung TKS Online-Verkauf ging<br />
im Februar 2000 mit dem Verkauf von Vorratsmaterial<br />
jeden Mittwoch online. Durch<br />
permanente Weiterentwicklung besteht seit<br />
Juni 2000 die Möglichkeit, montags auch<br />
Ia-Walzkapazitäten für Warmband zu ersteigern<br />
(Bild 3). Im November letzten Jahres<br />
startete der Verkauf von Ia-Grobblech-Walzkapazität.<br />
Der Veranstaltungskalender gestaltet sich<br />
zurzeit wie folgt:<br />
Montags: 09.00–10.00 Uhr<br />
Ia-Grobblech-Walzkapazität<br />
10.00–10.30 Uhr<br />
Warmband aus kurzfristig<br />
anstehender Produktion<br />
Mittwochs: 10.00–12.30 Uhr<br />
Vorratsmaterial aus gesamter<br />
Produktpalette<br />
3 Kundennutzen<br />
ThyssenKrupp Stahl bietet seinen Kunden<br />
mit dem TKS Online-Verkauf die Möglichkeit,<br />
von jedem Ort der Welt den Stahleinkauf<br />
einfacher, flexibler und effizienter zu<br />
gestalten. Verbunden hiermit ist der Zugriff<br />
auf eine attraktive Angebotspalette aus<br />
Warm- und Kaltwalzerzeugnissen, die zielgruppen-<br />
und produktgruppenorientiert<br />
kontinuierlich erweitert wird.<br />
Zum Service des TKS Online-Verkaufes<br />
gehört die einfache Handhabung der Internet-Anwendung<br />
genauso wie die zügige Auf-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Gebotsseite für Material aus kurzfristig anstehender Produktion (Bild 3)<br />
Gebotsseite für la-Grobblech-Walzkapazität (Bild 4)
12<br />
Online-Verkauf bei ThyssenKrupp Stahl<br />
tragsabwicklung und die kurzen Lieferzeiten.<br />
Die Verkaufsseiten sind übersichtlich aufbereitet<br />
und einfach zu bedienen.<br />
Die schnelle Zuschlagsvergabe seitens<br />
TKS ermöglicht den Kunden eine frühzeitige<br />
Disposition. Attraktive, kurze Lieferzeiten<br />
verschaffen einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil<br />
– denn Zeit ist Geld.<br />
Flexibilität im Einkauf ist für die Kunden<br />
gegeben: Bei Bezug von ungebeiztem und<br />
gebeiztem Warmband haben die Kunden<br />
nach Zuschlagserhalt einen kompletten Tag<br />
Zeit, ihre gewünschten Walzabmessungen<br />
anzugeben. Bei Geboten für Ia-Grobblech-<br />
Walzkapazität haben Abnehmer die Möglichkeit,<br />
zwischen Abmessungen, Menge,<br />
Zeugnis/Abnahmeart sowie der gewünschten<br />
Transportart auszuwählen (Bild 4).<br />
4 Prozessoptimierung<br />
Deutliche Vorteile des elektronischen Verkaufs<br />
sind Kosteneinsparungen im Vertriebsprozess,<br />
die zurzeit jedoch noch nicht<br />
quantifizierbar sind. So ist der Wegfall<br />
manueller Tätigkeiten durch diverse automatisierte<br />
Vorgänge ein wesentlicher<br />
Bestandteil der Prozessoptimierung. Am<br />
Anfang steht die automatische Übergabe<br />
der E-Commerce-fähigen Vorratsmaterialien<br />
bzw. Walzkapazitäten aus einem zentralen<br />
komissionslosen Bestand an die Redaktionsanwendung.<br />
Nach Zusammenstellung<br />
der Aktion erfolgt die automatische Übergabe<br />
der jeweiligen Aktion aus der Redaktionsanwendung<br />
an die Internet-Applikation<br />
TKS Online-Verkauf. Die Datenrückführung<br />
der eingegangenen Gebote an das Redaktionssystem<br />
nach Aktionsende erfolgt ebenso<br />
automatisch wie die Rückführung der<br />
Zuschlagsergebnisse an personifizierte<br />
Kunden-Webseiten einschließlich der<br />
E-Mail-Benachrichtigung der Kunden. Wei-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Zuschlagsvergabe beim TKS Online-Verkauf (Bild 5)<br />
terhin ist die automatische Übergabe der<br />
online veräußerten Materialien an das kaufmännische<br />
Auftragsabwicklungssystem<br />
(IAB) geplant.<br />
Weiteres Potenzial liegt in der Einsparung<br />
von Vertriebsprovisionen sowie in der<br />
Erlösmaximierung durch das Prinzip des<br />
gesteigerten Wettbewerbs. Die Reduktion<br />
von Lagerkosten durch schnelleren und<br />
höheren Warenumschlag ist ebenfalls<br />
gegeben.<br />
5 Fazit<br />
In dem stark anwachsenden Online-<br />
Markt besteht die Notwendigkeit, aktiv die<br />
E-Entwicklung mitzugestalten, Know-how<br />
aufzubauen und auszuweiten. Das TKS<br />
Online-Verkaufssystem ist ein weiteres<br />
Instrument zur Sicherung und Stärkung der<br />
TKS-Wettbewerbsfähigkeit und zur Untermauerung<br />
der Wachstumsstrategie für die<br />
Zukunft.<br />
Insgesamt konnte bisher über den TKS<br />
Online-Verkauf eine signifikante sechsstel-<br />
lige Tonnage mit gutem Erfolg verkauft<br />
werden. Der Online-Absatzanteil an Warmbandvorratsmaterial<br />
beträgt heute bereits<br />
30 %.<br />
Als nächster Entwicklungsschritt steht<br />
das so genannte „Offer-to-sell“ (OTS) auf<br />
dem Plan. Mithilfe diese Verfahrens kann<br />
der Verkauf gezielt Kunden mit speziell<br />
geschnürten Angeboten via Internet<br />
ansprechen. Dadurch lassen sich die<br />
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden noch<br />
besser abdecken.
13<br />
Andre-Thorsten Hebel,<br />
Dipl.-Kfm. Ralf Müller-Beckhoff<br />
E-Purchasing bei ThyssenKrupp Stahl durch das internetbasierte<br />
Online-Ausschreibungssystem „W3AS“<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
E-Business-Portal der Thyssen Krupp Stahl AG (Bild 1)
14<br />
E-Purchasing bei ThyssenKrupp Stahl durch das internetbasierte Online-Ausschreibungssystem „W3AS“<br />
1 Generelle Entwicklung<br />
Angesichts der verstärkten Globalisierung<br />
der Märkte und des verschärften<br />
internationalen Wettbewerbs ist ein internetbasiertes<br />
Ausschreibungssystem im<br />
weltweiten B2B-Netz für den industriellen<br />
Einkauf von herausragender Bedeutung, ja<br />
unerlässlich. Je nach erreichtem Organisationsgrad<br />
bzw. Preis-Leistungs-Niveau können<br />
die Unternehmen hierüber zum Teil<br />
signifikante Einsparpotenziale bei Prozesskosten,<br />
mehr aber noch bei den Beschaffungskosten<br />
(Einkaufskonditionen) erzielen.<br />
Auch für den interessierten potenziellen<br />
Lieferanten lohnt es sich, seine Produkte<br />
und Leistungen über das Internet anzubieten.<br />
Das von den Zentralbereichen Materialwirtschaft<br />
und Informatik-Anwendungen<br />
der Thyssen Krupp Stahl AG (TKS) konzipierte<br />
und inzwischen in Betrieb genommene<br />
internetbasierte Online-Ausschreibungssystem<br />
„W3AS“ ermöglicht grundsätzlich<br />
allen interessierten Lieferanten weltweit<br />
(internetweit), Angebote zu den darin plat-<br />
Systemarchitektur von W3AS (Bild 2)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
zierten Ausschreibungen direkt über eine<br />
vorgegebene Eingabemaske online abzugeben.<br />
Die Angebote stehen dem Einkäufer<br />
nach Ablauf der Angebotsabgabefrist mit<br />
einem im System erstellten Angebotsvergleich<br />
zur weiteren Bearbeitung inklusive<br />
einer ggf. möglichen bzw. sinnvollen Auktion<br />
(Reverse Auction) zur Verfügung.<br />
2 Ausgangssituation bei<br />
ThyssenKrupp Stahl<br />
Bisher ist für Ausschreibungen je Lieferant,<br />
der zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert<br />
werden soll, eine Anfrage im<br />
SAP-System zu generieren. Die Anfragen<br />
werden einzeln ausgedruckt, unterschrieben<br />
und ohne oder ggf. mit Spezifikationen<br />
bzw. Dokumentationen auf dem normalen<br />
Postweg an die zur Angebotsabgabe aufgeforderten<br />
Lieferanten gesendet. Die<br />
ebenfalls auf Papier eingehenden Angebote<br />
der Lieferanten werden vom Einkäufer im<br />
SAP-System manuell erfasst. Nach Ablauf<br />
der Angebotsfrist ist ein Angebotsvergleich<br />
zu erstellen, auf dessen Grundlage verhan-<br />
delt wird. Im Anschluss an Vergabeverhandlungen<br />
erfolgt die Bestellung über das<br />
SAP-System.<br />
Die konventionelle Vorgehensweise<br />
bedeutet<br />
● einen eingeschränkten, häufig regional<br />
begrenzten Wettbewerb,<br />
● lange Postwege für Anfragen und Angebote<br />
sowie<br />
● lange Vorgangsbearbeitungszeiten im<br />
Einkauf und beim Lieferanten.<br />
3 Das internetbasierte<br />
Ausschreibungssystem „W3AS“<br />
der Thyssen Krupp Stahl AG (TKS)<br />
3.1 Konzeption<br />
Seit September/Oktober 2000 erfolgen<br />
Ausschreibungen mit steigender Tendenz<br />
über das in 5 Monaten entwickelte Online-<br />
Ausschreibungssystem „W3AS“. Das<br />
System ist so konzipiert, dass grundsätzlich<br />
alle Bedarfe an Hilfs- und Betriebsstoffen,<br />
Reserveteilen, Werksgeräten, Produktionsstoffen,<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br />
Investitionsgütern (Anlagen) und<br />
Dienstleistungen hierüber ausgeschrieben<br />
werden können. Für Dienstleistungen ist<br />
eine Ausbaustufe für umfangreiche Leistungsverzeichnisse/-kataloge<br />
und Aufmaßblätter<br />
auf dem Weg der Realisierung<br />
(Fertigstellung Ende Juni 01).<br />
Bei der Entwicklung von „W3AS“ wurde<br />
Wert auf die Verwendung zukunftsweisender<br />
Technologien und die Anbindung an<br />
das ERP-System SAP gelegt, wie die Systemarchitektur<br />
(Bild 2) zeigt.<br />
Durch Integration in das operative SAP-<br />
System werden alle Aktionen und Aktivitäten<br />
von „W3AS“ automatisch dort abgebil-
15<br />
E-Purchasing bei ThyssenKrupp Stahl durch das internetbasierte Online-Ausschreibungssystem „W3AS“<br />
det, so auch die online eingegebenen<br />
Angebote. Das zusätzliche Speichern der<br />
Beleghistorie gewährleistet Revisionssicherheit.<br />
Funktionalität und Benutzeroberfläche<br />
sind auf skalierbarer und internettypischer<br />
Umgebung (SUN/Bea/JAVA/<br />
HTML) realisiert. Über das TKS-Portal<br />
http://www.thyssen-krupp-stahl.de (Bild 1)<br />
bzw. direkt über http://w3as.thyssenkrupp-stahl.com<br />
(Bild 3) steht das System<br />
im Internet zur Verfügung.<br />
3.2 Funktionalitäten<br />
Der Einkäufer legt im SAP-System eine<br />
Anfrage an, die per Mausklick nach<br />
„W3AS“ übertragen wird. Dort erfolgt die<br />
Freischaltung für alle Interessenten internetweit<br />
als „offene“ oder „geschlossene“<br />
Ausschreibung.<br />
„Offene“ Ausschreibungen sind für jeden<br />
interessierten Lieferanten zugänglich,<br />
„geschlossene“ können nur die vom Einkäufer<br />
aus bestimmten Gründen ausgewählten<br />
Lieferanten einsehen. Grundsätzlich<br />
werden „offene“ Ausschreibungen<br />
platziert, „geschlossene“ nur in begründeten<br />
Ausnahmefällen, z.B. wegen des Vorhandenseins<br />
eines besonderen Know-hows<br />
auf Seiten der Lieferanten oder bei TKS<br />
selbst.<br />
Der Einkäufer kann auch bei „offenen“<br />
Ausschreibungen bestimmte Lieferanten<br />
vorgeben, von denen er ein Angebot<br />
erwartet. Das System verfügt über<br />
Tracking-Funktionen, wodurch alle vorgewählten<br />
Lieferanten – ob in einer „offenen“<br />
oder in einer „geschlossenen“ Ausschreibung<br />
– automatisch per E-Mail über die sie<br />
betreffenden Ausschreibungen informiert<br />
werden.<br />
Interessierte Lieferanten können sich auf<br />
der Login-Seite des Systems (Bild 3) als<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Login-Seite des Online-Ausschreibungssystems „W3AS“ (Bild 3)<br />
„registrierte“ User oder als Gäste einloggen.<br />
Beide haben Einblick in die „offenen“<br />
Ausschreibungen, nur registrierte User<br />
auch in die „geschlossenen“, sofern sie<br />
vom Einkäufer fallweise für diese ausgewählt<br />
worden sind.<br />
Möchte ein bisher unbekannter Lieferant<br />
(„Gast“) zu einem „offen“ ausgeschriebenen<br />
Bedarf ein Angebot abgeben, muss er<br />
sich vorher registrieren lassen. Dazu ist ein<br />
Online-Fragebogen auszufüllen, in dem<br />
Angaben zum Unternehmensprofil abgefragt<br />
werden. Die Angaben werden dem<br />
Einkäufer per Mausklick übermittelt. Dieser<br />
prüft, ob es sich um einen geeigneten<br />
Geschäftspartner handeln könnte und veranlasst<br />
im positiven Fall das Anlegen eines<br />
Anbieterstammsatzes durch den Systemadministrator<br />
sowie die User-Freigabe per<br />
E-Mail unter Angabe einer Identnummer<br />
und eines Passwords.<br />
Die Online-Eingabe von Angeboten ist<br />
nur registrierten Usern/Lieferanten möglich!<br />
Anbieter können online eingegebene<br />
Angebote auch zwischenspeichern, um sie<br />
bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt –<br />
jedoch vor Ablauf der Angebotsfrist – weiter<br />
zu bearbeiten und freizugeben. Zu jeder<br />
Ausschreibungsposition sind Anmerkungen<br />
in einem besonderen Feld möglich, etwa<br />
der Hinweis auf technische Abweichungen<br />
oder auf qualitativ vergleichbare aber preiswertere<br />
Alternativen.<br />
Die online eingegebenen Angebote werden<br />
automatisch aus „W3AS“ in das SAP-<br />
System übertragen, wodurch der gesamte<br />
Vorgang im führenden ERP-System transparent<br />
und nachvollziehbar ist.<br />
Für die Auftragsvergabe kommen nur<br />
online eingegebene Angebote infrage, es<br />
sei denn, es handelt sich bei der Ausschreibung<br />
um eine Informationsanfrage,<br />
was in der Ausschreibung kenntlich<br />
gemacht werden kann.<br />
Der Einkäufer erhält erst nach Ablauf der<br />
Angebotsfrist mittels Mausklick Zugang zu
16<br />
E-Purchasing bei ThyssenKrupp Stahl durch das internetbasierte Online-Ausschreibungssystem „W3AS“<br />
den Online-Angeboten und dem vom<br />
System gleichzeitig automatisch generierten<br />
Preis-Angebots-Vergleich. Der Preis-<br />
Angebots-Vergleich berücksichtigt ein Ranking,<br />
sodass die günstigsten Angebote<br />
immer an erster Stelle erscheinen (Bild 4).<br />
Sofern bestimmte Voraussetzungen<br />
erfüllt sind – hierzu gehören im Wesentlichen<br />
die Eindeutigkeit der Bedarfsdefinition<br />
sowie die für alle Anbieter gleichen preislichen,<br />
terminlichen und gewährleistungsmäßigen<br />
Rahmenbedingungen für einen<br />
eventuellen Auftrag – kann der Preis-<br />
Angebots-Vergleich auch Basis für eine im<br />
„W3AS“ ebenfalls konzipierte Vergabeauktion<br />
(Reverse Auction) sein, beispielsweise<br />
mit den drei günstigsten Anbietern.<br />
4 Einführung<br />
Der Erfolg eines internetbasierten Ausschreibungssystems<br />
wie das der Thyssen<br />
Krupp Stahl AG hängt wesentlich von dessen<br />
Bekanntheitsgrad ab. Bei der Informa-<br />
Preis-Angebots-Vergleich (Bild 4)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Entwicklung der Lieferantenzugriffe (Bild 5)<br />
tionsfülle im World Wide Web ist nicht ohne<br />
weiteres zu erwarten, dass mögliche neue<br />
Geschäftspartner selbst bei intensiver<br />
Suche unmittelbar auf die gewünschten<br />
Webseiten stoßen. Vor diesem Hintergrund<br />
hat die Materialwirtschaft von TKS parallel<br />
zur Installation von „W3AS“ eine gezielte<br />
Informationskampagne geführt, und zwar<br />
im Internet selbst, in Suchmaschinen, in<br />
Fachzeitschriften sowie in allen Bestellschreiben<br />
seit Oktober 2000. Im Februar<br />
2000 wurden alle aktuellen Lieferanten mit<br />
einem wesentlichen Einkaufsvolumen<br />
nochmals gezielt angeschrieben mit der<br />
Aufforderung, sich als User im „W3AS“<br />
registrieren zu lassen, da Ausschreibungen<br />
in Zukunft in der Regel nur noch hierüber<br />
erfolgen werden.<br />
Im März 2001 wurden 235, im April 361<br />
Ausschreibungen im „W3AS“ platziert, im<br />
April sind 1.300 Angebote online abgegeben<br />
worden. Die Entwicklung der Lieferantenzugriffe<br />
zeigt Bild 5.<br />
5 Auswirkungen<br />
Die Auswirkungen des internetbasierten<br />
Online-Ausschreibungssystems „W3AS“<br />
bestehen<br />
● vorrangig darin, signifikante Einsparungen<br />
durch Verbesserung der Einaufskonditionen<br />
infolge „grenzenlosen“ Wettbewerbs<br />
erzielen zu können und<br />
● nachrangig in der Reduzierung der Prozesskosten<br />
infolge des voll elektronischen<br />
Ausschreibungsverfahrens statt<br />
der bisherigen, größtenteils manuellen<br />
Papierorganisation.<br />
Quantitative Prognosen sind schwierig.<br />
Promoter, Provider, Profiteure aber auch<br />
Praktiker nennen durchschnittliche Einsparpotenziale<br />
bis in hohe zweistellige Prozentsätze.<br />
Dies ist – von Ausnahmen abgesehen<br />
– unseriös, zumal es abhängig ist von<br />
dem jeweils erreichten Preisniveau einerseits<br />
und dem Organisationsgrad andererseits.<br />
Unstrittig sind jedoch durchschnittliche<br />
Einsparpotenziale im unteren einstelligen<br />
Prozentbereich auch für die Unternehmen,<br />
die bereits ein jeweils gutes Niveau<br />
erreicht haben. Das heißt: Das internetbasierte<br />
Online-Ausschreibungssystem<br />
„W3AS“ ist eine höchst lohnenswerte Investition!
17<br />
Ralf Jacke,<br />
Dipl.-Kfm. Ralf Müller-Beckhoff<br />
E-Procurement bei ThyssenKrupp Stahl mittels<br />
elektronischer Kataloge im Intranet/Internet<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Elemente und Funktionen des E-Procurement im<br />
„Materialwirtschaft e-shop“ von ThyssenKrupp Stahl (Bild 1)
18<br />
E-Procurement bei ThyssenKrupp Stahl mittels elektronischer Kataloge im Intranet/Internet<br />
1 Generelle Entwicklung<br />
Beschaffungsprozesse sind seit Jahren<br />
Gegenstand betrieblicher Reorganisationsmaßnahmen<br />
mit hohem Stellenwert. Dabei<br />
gilt die elektronisch gestützte Beschaffung<br />
von Waren und Dienstleistungen als ein<br />
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Neben<br />
internetbasierten Ausschreibungssystemen<br />
zur verstärkten Nutzung des globalen Wettbewerbs<br />
kommt dem Einsatz elektronischer<br />
Produktkataloge und deren Bereitstellung<br />
über das jeweilige Intranet oder auf internetbasierten<br />
Marktplätzen besondere<br />
Bedeutung zu. Der von den Strategen und<br />
Promotern des E-Business hierfür besetzte<br />
Begriff heißt „E-Procurement“.<br />
Durch E-Procurement entfällt eine Reihe<br />
von Schritten des konventionellen Beschaffungsprozesses.<br />
So können Genehmigungsabläufe<br />
erheblich verkürzt werden.<br />
Die Suche nach geeigneten Artikeln und<br />
deren schnelle Beschaffung direkt durch<br />
den Bedarfsträger im Betrieb beseitigt die<br />
oft aufwendige Papierorganisation über<br />
den Einkauf. Unternehmen, die E-Procurement-Lösungen<br />
einsetzen, profitieren somit<br />
vor allem von beschleunigten rationelleren<br />
Bildschirmmaske der Suchfunktionen (Bild 2)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Beschaffungsprozessen. Durch die Hinterlegung<br />
einer Vielzahl von Produktkatalogen<br />
im Intranet bzw. Internet ergibt sich zudem<br />
ein besserer Produkt- und Preisüberblick.<br />
Der Einstieg in E-Procurement im Sinne<br />
der Nutzung elektronischer Produktkataloge<br />
erfolgt zunächst und vorrangig für den Bedarf<br />
an so genannten „C-Artikeln“, so auch<br />
bei der Thyssen Krupp Stahl AG (TKS).<br />
2 Ausgangssituation bei<br />
ThyssenKrupp Stahl<br />
Die herkömmliche Beschaffung von<br />
C-Artikeln ist bei TKS wie folgt organisiert:<br />
● Hilfs- und Betriebstoffläger<br />
Gelagerte bzw. vom Lieferanten in Form<br />
der Direktversorgung* anzuliefernde Artikel<br />
werden von den Betrieben über SAP<br />
reserviert (= abgerufen).<br />
● Sammelverrechnungsabkommen<br />
Nicht gelagerte Artikel mit einem Einzelwert<br />
< 100 € können mittels Materialanforderungsbeleg<br />
über den Einkauf bei<br />
lokalen Vertragslieferanten abgerufen<br />
werden.<br />
● Bestellanforderung<br />
Alle anderen Artikel werden über eine<br />
SAP-Bestellanforderung (BANF) beim<br />
Einkauf zur Beschaffung angefordert.<br />
Die Prozesszeiten für die Beschaffung<br />
von C-Artikeln von der Bedarfsentstehung<br />
bzw. -ermittlung über Anforderung, Genehmigung,<br />
interne Postwege, Bestellung und<br />
Lieferung bis hin zur Wareneingangsbuchung<br />
liegen in dieser Form – ausgenommen<br />
bei der Direktversorgung* – im Durchschnitt<br />
bei 7 Tagen. Hinzu kommen Rechnungsprüfung<br />
und Bezahlung.<br />
* Direktversorgung: Ehemals bei TKS<br />
gelagerte Artikel wurden bereits in großem<br />
Umfang auf Lieferantenläger übertragen.<br />
Der TKS-Bedarfsträger im Betrieb reserviert<br />
seinen Bedarf wie gehabt in SAP. Die<br />
Reservierung wird elektronisch dem Lieferanten<br />
übermittelt, der die angeforderte<br />
Ware arbeitstäglich anliefert und anschließend<br />
eine Gutschrift erhält.<br />
3 E-Procurement im „Materialwirtschaft<br />
e-shop“ der<br />
Thyssen Krupp Stahl AG (TKS)<br />
In Zukunft erfolgt die Beschaffung von<br />
C-Artikeln bei TKS mehr und mehr durch<br />
den direkten elektronischen Abruf seitens<br />
der betrieblichen Bedarfsträger aus den vom<br />
Einkauf bepreisten elektronischen Produktkatalogen.<br />
Materialwirtschaft schließt hierzu<br />
Rahmenverträge bzw. Konditionsabkommen<br />
über Katalogartikel ab (bzw. benutzt die bereits<br />
in großem Umfang vorhandenen Verträge)<br />
und stellt die entsprechenden Kataloge<br />
den Bedarfsträgern im so genannten<br />
„Materialwirtschaft e-shop“ im Intranet und/<br />
oder ggf. auch auf internetbasierten Marktplätzen<br />
zum Abruf zur Verfügung (Bild 1).
19<br />
E-Procurement bei ThyssenKrupp Stahl mittels elektronischer Kataloge im Intranet/Internet<br />
Abruf beim Lieferanten (Bild 3)<br />
Der von den Zentralbereichen Materialwirtschaft<br />
und Informatik-Anwendungen<br />
der TKS konzipierte „Materialwirtschaft<br />
e-shop“ ist so gestaltet, dass sich berechtigte<br />
User (= betriebliche Bedarfsträger)<br />
über einen Standard-Internet-Browser in<br />
das System einloggen und benötigte Artikel<br />
per Mausklick abrufen können. Die Menüführung<br />
des Systems ist für die User<br />
grundsätzlich selbsterklärend, sodass<br />
umfassende Schulungsmaßnahmen nicht<br />
unbedingt erforderlich sind.<br />
Umfangreiche Suchfunktionen (Bild 2)<br />
ermöglichen den betrieblichen Bedarfsträgern<br />
das schnelle Auffinden von Artikeln.<br />
Neben der Artikelsuche über die Kataloghierachie,<br />
die sich am Klassifizierungsschema<br />
eCl@ss ausrichtet, kann auch innerhalb<br />
eines Katalogs oder über mehrere Kataloge<br />
mittels komplexer Suchmaschinen nach<br />
Artikeln gesucht werden. Außer über die<br />
klassische Suchfunktion nach Text (Volltextsuche),<br />
besteht die Möglichkeit, nach Lieferanten-,<br />
Hersteller- und/oder TKS-Artikelnummer<br />
sowie über Synonyme zu suchen.<br />
Das Suchergebnis (den Artikel) kann sich<br />
der User auf Wunsch mit Bildansichten<br />
anzeigen lassen. Darüber hinaus ist für<br />
jeden Artikel eine ausführliche technische<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Benutzerspezifischer Warenkorb (Bild 4)<br />
Beschreibung hinterlegt.<br />
Alle ausgewählten Artikel werden in<br />
einem Warenkorb zwischengespeichert.<br />
Von diesem Warenkorb aus gelangt der<br />
User in den direkten Abruf beim Lieferanten<br />
(Bild 3). Der Abruf ist mit einer gültigen<br />
Kostenstelle oder einer Auftragskontierung<br />
und der entsprechenden Anlieferstelle zu<br />
ergänzen. Das SAP-Sachkonto „hängt“ für<br />
den Nutzer unsichtbar an der Warengruppe<br />
und wird automatisch mitgeführt. Im Abruf<br />
werden der Gesamtbestellwert und das<br />
aktuell noch verfügbare Budget des<br />
betrieblichen Bedarfsträgers angezeigt.<br />
Jeder berechtigte Nutzer kann individuelle<br />
Standardartikel definieren und sich<br />
eigene („favorisierte“) Warenkörbe (Bild 4)<br />
anlegen, auf die er jederzeit ohne weitere<br />
Katalogsuche direkt zugreifen und einen<br />
Abruf generieren kann.<br />
Abrufe über den „Materialwirtschaft<br />
e-shop“ können nur solche betrieblichen<br />
Mitarbeiter (User/Nutzer) auslösen, für die<br />
der jeweilige Kostenstellenverantwortliche<br />
ein Budget eingerichtet hat und solange<br />
dieses Budget nicht überschritten ist.<br />
Jeder berechtigte Nutzer (Bedarfsträger)<br />
kann sich die von ihm generierten externen<br />
Abrufe und internen Reservierungen – aus-<br />
gewertet nach Zeitraum, Katalog, Artikel,<br />
Kontierung und Budget – zur Selbstkontrolle<br />
am Bildschirm anzeigen lassen.<br />
Der Kostenstellenverantwortliche ist<br />
ebenfalls in der Lage, sich jederzeit auf<br />
Knopfdruck anzeigen zu lassen, wofür und<br />
von wem die von ihm vergebenen Budgets<br />
genutzt werden bzw. bis dahin genutzt worden<br />
sind. Hierdurch wird ihm ein Controllinginstrument<br />
an die Hand gegeben,<br />
das das bisherige, zeitaufwendige Genehmigungsverfahren<br />
(Unterschreiben jeder<br />
einzelnen Anforderung für extern zu beziehende<br />
Güter bzw. jedes einzelnen Materialentnahmescheins<br />
für die Artikel im TKSeigenen<br />
Lager oder die über Sammelverrechnungsabkommen<br />
zu beziehenden Artikel)<br />
auf rationelle Weise ersetzt. Außerdem<br />
ist sichergestellt, dass das von ihm vorgegebene<br />
Budget ohne seine Erlaubnis nicht<br />
überschritten werden kann.<br />
Alle Wareneingänge, die aufgrund der<br />
Abrufe aus dem „Materialwirtschaft<br />
e-shop“ erfolgen, werden wie üblich in SAP<br />
erfasst. Die Wareneingangsbuchung stößt<br />
eine Gutschrift an. Einbuchung und Prüfung<br />
von Rechnungen entfallen.<br />
Die Materialwirtschaft kann über alle<br />
getätigten Abrufe und Reservierungen per
20<br />
E-Procurement bei ThyssenKrupp Stahl mittels elektronischer Kataloge im Intranet/Internet<br />
Knopfdruck für jeden Katalog oder jede<br />
Warengruppe eine ABC-Analyse erstellen<br />
(Bild 5). Dies räumt ihr u. a. die Möglichkeit<br />
ein, mit den Lieferanten eine differenzierte<br />
(z.B. umschlagabhängige) günstigere<br />
Preisgestaltung zu vereinbaren.<br />
Da jede E-Procurement-Lösung nur so<br />
gut ist wie ihre Integration in das bestehende<br />
ERP-System, ist ein wichtiger Bestandteil<br />
des „Materialwirtschaft e-shop“ von<br />
TKS die Schnittstelle zum bestehenden<br />
SAP-System. Jeder Abruf erzeugt automatisch<br />
eine Bestellung oder alternativ, wenn<br />
der benötigte Artikel in der Materialwirtschaft<br />
von TKS noch gelagert ist, eine<br />
Reservierung im SAP-System. Hierdurch<br />
entfällt das Springen zwischen zwei Systemen.<br />
Der betriebliche Bedarfsträger kann<br />
vielmehr neben externen Abrufen gleichzeitig<br />
auf die Artikel der unternehmenseigenen<br />
Materialwirtschaftsläger zugreifen.<br />
Per Klick wird der Abruf vom „Materialwirtschaft<br />
e-shop“-System an SAP übertragen<br />
und verbucht. Dort erfolgt die obligatorische<br />
Prüfung auf Kontierung, Warenempfänger<br />
und ggf. TKS-Artikelnummer.<br />
Bei positiver Prüfung meldet SAP eine entsprechende<br />
Abrufnummer oder bei Waren<br />
mit TKS-Artikelnummer eine Reservierungsnummer<br />
an den „Materialwirtschaft e-shop“<br />
zurück. Unmittelbar danach wird der Abruf<br />
an den jeweiligen Lieferanten wahlweise per<br />
E-Mail im Format EDI, HTML, XML (z.B.<br />
opentrans, idoc etc.), als Text mit oder<br />
ohne Satzstruktur oder über einen internetbasierten<br />
Marktplatz übertragen.<br />
Das System ist so konzipiert, dass neben<br />
den im „Materialwirtschaft e-shop“ von<br />
TKS liegenden Katalogen auch auf allgemeinen<br />
oder branchenspezifischen Internetmarktplätzen<br />
liegende Kataloge zugegriffen<br />
werden kann. Techniken, die dieses<br />
ermöglichen, werden von den marktführen-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
ABC-Analyse (Bild 5)<br />
den Software-Herstellern „Punch out“ oder<br />
„Round Trip“ genannt und verfolgen die<br />
Vision, dass alle Materialien und Produktbeschreibungen<br />
in Zukunft über das Internet<br />
aufzufinden sein werden.<br />
4 Einführung und Nutzung<br />
Das System ist seit langem ausgetestet<br />
und betriebsbereit. Die Nutzung ist jedoch<br />
abhängig von der Verfügbarkeit von Katalogen.<br />
Die Erstellung von Katalogen durch<br />
die Lieferanten ist trotz Orientierung an<br />
Standards – gemessen an der Entwicklungszeit<br />
des Systems selbst – sehr zeitaufwendig.<br />
Selbst weltweit operierende Unternehmen<br />
haben Schwierigkeiten, ihre Kataloge<br />
kurzfristig in der geforderten Datenstruktur<br />
zur Verfügung zu stellen. Die Wahrnehmung<br />
dieser Aufgabe durch spezielle<br />
Provider (Catalogue-Factories) ist – wiederum<br />
gemessen an dem Entwicklungsaufwand<br />
für das System selbst – extrem teuer<br />
und daher möglichst zu vermeiden. TKS<br />
geht davon aus, etwa 15 Kataloge (von ca.<br />
30) bis Ende Juli 2001 eingestellt zu<br />
haben.<br />
5 Auswirkungen<br />
Durch die vollelektronische Abwicklung<br />
wird die Beschaffungszeit für beim Lieferanten<br />
gelagerte Artikel von der Bedarfsfeststellung<br />
bis zum Wareneingang und<br />
zur Gutschrift auf 2 Tage (statt bisher ca.<br />
7 Tage + Rechnungsprüfung) verkürzt. Im<br />
Notfall kann die Anlieferung sogar am Tage<br />
des Abrufs erfolgen. Darüber hinaus wird<br />
es möglich sein, die Mittelbindung durch<br />
die weitere Verlagerung bisher noch eigener<br />
Bestände auf Lieferanten zu reduzieren.<br />
Von großem Wert für den Einkauf ist<br />
zudem die Artikel-, Preis- und Kostentransparenz,<br />
die für Katalogartikel in dieser Form<br />
erstmalig zur Verfügung stehen wird.<br />
Die Vorteile des „Materialwirtschaft e-shop“-<br />
Konzepts der Thyssen Krupp Stahl AG liegen<br />
somit vorrangig in der erheblichen<br />
Straffung des Beschaffungsprozesses für<br />
Katalogartikel/C-Artikel bis hin zur Gutschrift<br />
und der damit einhergehenden Reduzierung<br />
der entsprechenden Prozesskosten.<br />
Alles in allem handelt es sich – wie im<br />
Falle des Online-Ausschreibungssystems<br />
„W3AS“ – um eine höchst wirtschaftliche<br />
Investition!
21<br />
Dipl.-Kfm. Klaus Hedding<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
E-Business-Lösungen von Hoesch Hohenlimburg (Bild 1)
22<br />
1 Einleitung<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
An dem diesjährigen Innovationswettbewerb<br />
war das Unternehmen Hoesch<br />
Hohenlimburg mit dem Beitrag „E-Business@HoeschHohenlimburg“<br />
vertreten.<br />
Inhaltlich reichte das Spektrum dabei vom<br />
● E-Procurement für C-Materialen<br />
● über den Internetauftritt des Geschäftsbereichs<br />
Mittelband<br />
● bis hin zum Supply-Chain-Management<br />
im Geschäftsbereich Spezialprofile<br />
Schwerte<br />
und stellte damit die Verknüpfung zu den<br />
Bereichen Beschaffung, Service und Vertrieb<br />
her.<br />
Alle drei nachfolgend näher vorgestellten<br />
Projekte befinden sich inzwischen im<br />
erfolgreichen praktischen Einsatz.<br />
2 E-Procurement<br />
Die Forderung nach einer E-Procurement-Lösung<br />
resultierte aus dem hohen<br />
Aufwand für die Beschaffung von Materialien<br />
und Dienstleistungen jeglicher Art.<br />
Zunächst konzentrierte man sich dabei auf<br />
C-Materialien, worunter Artikel definiert<br />
werden, die sich in einem elektronischen<br />
Katalog abbilden lassen, für die feste Preisvereinbarungen<br />
getroffen werden können<br />
und die keinen besonderen Sicherheitsvorschriften<br />
unterliegen (Bild 2).<br />
Ziel war es, bei der hohen Anzahl von<br />
Bestellungen die Prozesskosten sowie die<br />
langen Durchlaufzeiten zu minimieren. Für<br />
die Realisierung dieses Projektes wurde ein<br />
Projektteam, bestehend aus Vertretern der<br />
Bereiche Einkauf, Controlling, Rechnungswesen<br />
und Informationstechnik, ins Leben<br />
gerufen. Neben Standard-Kriterien, wie<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
E-Procurement: Ausgangssituation (Bild 2)<br />
z.B. kostenstellenbezogene Abrechnung<br />
und Budgetkontrolle, sollte die HHO-<br />
Lösung voll in die vorhandene SAP R/3-<br />
Umgebung integrierbar sein, wobei die<br />
Softwarekosten je Arbeitsplatz möglichst<br />
klein zu halten waren (Bild 3).<br />
Nach vier Monaten Realisierungszeit und<br />
einer 6-monatigen Pilotphase war im September<br />
2000 das Projekt abgeschlossen<br />
(Bild 4). Von da an stand allen mit Lotus<br />
Notes arbeitenden Mitarbeitern ein Programm<br />
zur Verfügung, auf dessen Basis<br />
Büromittel, Werbemittel und Werkzeuge<br />
über einen elektronischen Katalog zunächst<br />
ausgesucht und dann bestellt werden<br />
E-Procurement: Konzeption (Bild 3)<br />
konnten. Die Bedienbarkeit des neu<br />
geschaffenen Moduls erwies sich dabei als<br />
äußerst anwendungsfreundlich, sodass nur<br />
ein geringer Schulungsaufwand für die Mitarbeiter<br />
erforderlich wurde.<br />
Mit dieser E-Business-Lösung ist es<br />
gelungen, den gesamten logistischen Prozess,<br />
angefangen bei der Bestellung bis hin<br />
zur verursachungsgerechten Verbuchung<br />
des Warenwerts, automatisch in komprimierter<br />
und übersichtlicher Form im SAP<br />
R/3 abzubilden. Sämtliche Transaktionen<br />
sowohl durch den Bestellenden als auch<br />
durch dessen Vorgesetzten sind jederzeit<br />
nachvollziehbar und abrufbar.
23<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
E-Procurement: Realisierung (Bild 4)<br />
Die Prozesskosten konnten dank der<br />
nunmehr direkten Auslösung der Bestellung<br />
und der damit automatischen Übermittlung<br />
an den Lieferanten, der automatischen<br />
Erfassung aller gelieferten Positionen<br />
in SAP R/3 sowie der Begleichung der<br />
Forderungen mittels Gutschriftverfahren um<br />
60 % gesenkt werden. Infolge des hieraus<br />
resultierenden teilweisen Wegfalls zeitaufwendiger<br />
Arbeiten, ließen sich auch die<br />
Durchlaufzeiten im administrativen Bereich<br />
spürbar verkürzen. Insgesamt verringerte<br />
sich die Prozessdauer von ehemals 1 bis 2<br />
Wochen auf jetzt nur noch 3 Tage.<br />
Neben diesen messbaren Kostenvorteilen<br />
ist mit der Umsetzung dieses E-Business-Projektes<br />
gleichzeitig aber auch ein<br />
komfortables und fortschrittliches Beschaffungsinstrumentatrium<br />
geschaffen worden,<br />
das inzwischen ca. 720 Mitarbeitern zur<br />
Verfügung steht.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
3 Internetauftritt des Geschäftsbereichs<br />
Mittelband<br />
Ein weiterer Schritt in Richtung E-Business<br />
war der im Dezember letzten Jahres<br />
fertig gestellte neue Internetauftritt des Geschäftsbereichs<br />
Mittelband (Bilder 5 bis 7).<br />
Zielsetzung war es, eine kommunikative<br />
Plattform zu schaffen, die sich einerseits an<br />
den Bedürfnissen der Kunden orientiert,<br />
gleichzeitig aber auch den Informationsbedarf<br />
potenzieller Interessenten bzw. möglicher<br />
Neukunden befriedigt. Insbesondere<br />
Internetauftritt Mittelband: Ausgangssituation (Bild 5)<br />
auf Grund der produktspezifischen Gegebenheiten<br />
ist ein intensiver und regelmäßiger<br />
Informationsaustausch zwischen dem<br />
Geschäftsbereich Mittelband und dessen<br />
Kunden zwingend notwendig.<br />
So wurden auch der Inhalt und die Form<br />
des Internetauftritts schwerpunktmäßig auf<br />
die Belange der Hauptabnehmergruppen,<br />
nämlich der Kaltwalzindustrie und der<br />
Direktverarbeiter, abgestimmt. Durch<br />
gezielte Informationsaufbereitung und<br />
einem daraus resultierenden unmittelbaren<br />
zusätzlichen Kundennutzen galt es, weitere<br />
Kundenbindungspotenziale auszuschöpfen.<br />
Als interessant für den bereits bestehenden<br />
Kunden erweist sich vor allem der tiefe<br />
Einblick in den Fertigungsprozess, was<br />
bedeutet, dass über einen dem Kunden<br />
zugeteilten Zugangscode nicht nur seine<br />
fertigen Produkte online gesehen, sondern<br />
auch der Fertigungsfortschritt (walzen, beizen,<br />
spalten usw.) tagesaktuell verfolgt<br />
werden können. Hierfür stehen unterschiedlichste<br />
Selektionskriterien zur Verfügung.<br />
So ist es beispielsweise möglich, alle<br />
gebuchten Aufträge, nur Aufträge mit versandbereiten<br />
Mengen oder nur Aufträge,<br />
die bereits versandt wurden, aufzurufen.<br />
Innerhalb dieser Gruppen können weitere
24<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
Internetauftritt Mittelband: Konzeption (Bild 6)<br />
Einschränkungen nach dem jeweiligen<br />
Bestellzeichen und der Abmessung vorgenommen<br />
werden. Um dabei die Aktualität<br />
der Daten zu gewährleisten, werden alle<br />
erforderlichen Informationen in kontinuierlichen<br />
Zeitabständen aus dem internen Auftragsabwicklungs-<br />
und PPS-System auf<br />
den entsprechenden Internetserver transferiert.<br />
Internetauftritt Mittelband: Realisierung (Bild 7)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Darüber hinaus müssen natürlich auch<br />
allgemeine Informationen rund um das<br />
Produkt zur Verfügung gestellt werden. Ein<br />
wichtiges Kriterium ist dabei vor allem das<br />
Güten- und Abmessungsspektrum, das in<br />
übersichtlicher, tabellarischer Form aufbereitet<br />
wurde. Zusätzlich sind innerhalb einzelner<br />
Gütengruppen noch weiter reichende<br />
Informationen, wie metallurgische Eigen-<br />
schaften und/oder chemische Zusammensetzungen,<br />
abrufbar.<br />
Ergänzt wird der Auftritt auch durch bildlich<br />
dargestellte Anwendungsbeispiele, die<br />
über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten<br />
im Bereich der Direktverarbeitung informieren.<br />
In Form eines so genannten Anwendungs-Showrooms<br />
sind unterschiedlichen<br />
Gütengruppen mehrere konkrete Anwendungen<br />
zugeordnet. Selbst ein Blick in die<br />
Fertigung bleibt dem Betrachter nicht verborgen.<br />
Über eine schematische Anlagenübersicht,<br />
die den gesamten Fertigungsablauf<br />
skizziert, können einzelne Aggregate<br />
aufgerufen und bildlich dargestellt werden.<br />
Zusätzlich lässt sich zu jedem Bild noch eine<br />
kurze textliche Beschreibung einblenden.<br />
Um den Anforderungen einer gezielten<br />
und detaillierten Kundenanfrage zu entsprechen,<br />
musste zudem ein anwendungsfreundliches<br />
Anfrageformular entwickelt<br />
werden, und zwar in Form eines einfachen<br />
und sich zum Teil selbst erklärenden Bedienungsmoduls.<br />
Voraussetzung war, möglichst<br />
viele Spezifikationen über ein Auswahlfeld<br />
zur Verfügung zu stellen. Mit der<br />
nunmehr gezielten Umsetzung dieses Formulars<br />
ist es gelungen, dem Kunden ein<br />
Instrument an die Hand zu geben, bei dem<br />
seine Anfragen schnell und unbürokratisch<br />
beantwortet werden können.<br />
Durch die hier beschriebene konsequente<br />
Ausrichtung auf die Belange und Bedürfnisse<br />
der Kunden, die insbesondere durch<br />
die gezielte und teilweise auch individuelle<br />
Informationsbereitstellung zum Ausdruck<br />
kommt, ist der Internetauftritt des<br />
Geschäftsbereichs Mittelband für die Kunden<br />
inzwischen zu einem wichtigen, zeitunabhängigen<br />
Kommunikationselement<br />
geworden. Für den Geschäftsbereich selbst<br />
bedeutet dies aber auch, weitere Kundenbindungspotenziale<br />
erzielen zu können.
25<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
Supply-Chain-Management: Ausgangssituation (Bild 8)<br />
4 Supply-Chain-Management<br />
Eine dem Kunden jederzeit zur Verfügung<br />
stehende präzise und zeitnahe Auskunft<br />
war auch Gegenstand der dritten hier vorgestellten<br />
E-Business-Lösung (Bilder 8 bis<br />
10). So einfach diese Anforderungen bei<br />
Verfügbarkeit von funktionierenden Planungs-<br />
und Fertigungssteuerungssystemen<br />
im eigenen Unternehmen zu erfüllen sind,<br />
so schwierig wird die Realisierung, wenn<br />
die Auskunft gebende Funktion bei einem<br />
Dritten angesiedelt und zudem noch über<br />
mehrere Zeitzonen entfernt ist.<br />
Mitte 1999 hat die Firma GSP (German<br />
Supply-Chain-Management: Konzeption (Bild 9)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Special Profiles), ein Joint Venture mit<br />
Owen Industries, seinen Betrieb in Atlanta,<br />
Georgia, aufgenommen. GSP bedient den<br />
amerikanischen Markt mit Spezialprofilen<br />
aus Schwerte, betreut Kunden, ist aber<br />
auch in der Neuakquisition tätig.<br />
Mit der Implementierung eines Supply-<br />
Chain-Management mit und für GSP sollte<br />
eine Lösung geschaffen werden, die es<br />
ermöglichte, einen ständigen Informationsaustausch<br />
zwischen dem Endverbraucher<br />
und dem Distributor GSP auf der einen<br />
Seite sowie Hoesch Hohenlimburg als Hersteller<br />
auf der anderen Seite zu gewährleisten.<br />
Für diesen Zweck wurde im November<br />
1999 in enger Abstimmung mit dem amerikanischen<br />
JV-Partner ein Team, bestehend<br />
aus dem Vertrieb Spezialprofile und der DV-<br />
Abteilung, zusammengestellt, um das Projekt<br />
zu realisieren.<br />
Zunächst war es erforderlich, alle notwendigen<br />
Daten entsprechend den möglichen<br />
Fragestellungen entlang der Supply-<br />
Chain zu erfassen. Fragestellungen etwa<br />
nach der Auftragsnummer und den Materialnummern<br />
des Endverbrauchers, der<br />
Auftragsnummer von GSP, den GSP-eigenen<br />
Materialnummern und letztlich den<br />
Auftrags- und Materialnummern des<br />
Geschäftsbereichs Spezialprofile bei HHO.<br />
Da die originären Planungs- und Steuerungssysteme<br />
aller beteiligten Partner<br />
unterschiedlich sind und darüber hinaus<br />
auf diese Systeme bei Dritten grundsätzlich<br />
kein Einfluss besteht, erfolgte die Realisierung<br />
mit Hilfe einer Datenbank der Groupware<br />
Lotus Notes, die sich sowohl bei HHO<br />
als auch bei GSP bereits im Einsatz befand.<br />
Um den grundlegenden Gedanken der<br />
Supply-Chain-Datenbank, nämlich der Auftrags-<br />
und Fertigungssteuerungsinformation<br />
in SAP R/3, ergänzt um die Auftragsund<br />
Materialinformation von GSP und<br />
gegebenenfalls auch des Endverbrauchers,<br />
Rechnung zu tragen, wurden zunächst entsprechende<br />
Partnerrollen definiert. Über<br />
eine ins Lotus Notes und SAP integrierte<br />
Schnittstelle konnte somit die SAP-Information<br />
zeitgleich auch in der Supply-Chain-<br />
Datenbank zur Verfügung gestellt und an<br />
den amerikanischen Partner verteilt werden.<br />
Die Verteilung erfolgt generell über Replikation<br />
zwischen dem Datenbank-Exemplar<br />
bei HHO einerseits und dem Exemplar bei<br />
GSP andererseits. Dabei werden genau die<br />
Daten selektiv übertragen, die GSP betref-
26<br />
E-Business@Hoesch Hohenlimburg<br />
Supply-Chain-Management: Realisierung (Bild 10)<br />
fen, d.h. Daten über eigene Aufträge und<br />
über Aufträge von durch GSP betreute Kunden.<br />
Die Verteilzeitpunkte sind so gewählt,<br />
dass bei minimalem Kostenaufwand für<br />
den Abgleich der Auftragsinformationen<br />
über eine Wählverbindung eine optimale<br />
Aktualität der verfügbaren Informationen<br />
existiert. Die Aktualisierung erfolgt jeweils<br />
zu Geschäftsbeginn in USA und Büroschluss<br />
in Deutschland.<br />
Ist darüber hinaus beim Endverbraucher<br />
Lotus Notes im Einsatz, kann die verfügbare<br />
Auftragsinformation ohne großen Aufwand<br />
einen weiteren Schritt entlang des<br />
Supply-Chain verteilt werden. Dadurch<br />
bedingt ist es möglich, endverbraucherspezifische<br />
Auftragsinformationen aus der<br />
Datenbank des amerikanischen Partners<br />
abzurufen.<br />
Über die standardmäßige Eigenschaft<br />
von Lotus Notes Datenbanken, vorhandene<br />
Informationen auch mit Hilfe eines Internet-<br />
Browsers anzusehen, lässt sich für den<br />
Endverbraucher eine Selbstauskunft auch<br />
über das Internet einholen.<br />
Alle Elemente der Informationsdaten-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
bank, wie zum Beispiel Masken, Ansichten<br />
und Meldungen sind grundsätzlich mehrsprachig<br />
angelegt und können aktuell in<br />
den Sprachen Deutsch und US-Amerikanisch<br />
verfolgt werden. Die im Dialog mit<br />
der Datenbank konkret verwendete Sprache<br />
wird automatisch entsprechend der<br />
Sprachversion des Bedienerarbeitsplatzes<br />
selektiert.<br />
Damit stehen speziell dem Endverbraucher<br />
jederzeit für die verschiedensten Fragestellungen,<br />
sei es nach eigenen Bestellnummern<br />
gegenüber dem Verkauf von GSP<br />
oder nach der Verfügbarkeit von Material<br />
anhand von eigenen Materialnummern<br />
gegenüber der Logistik von GSP, aktuelle<br />
Informationen zeitnah zur Verfügung.<br />
Unabhängig von der Fragestellung können<br />
die erforderlichen Informationen kurzfristig<br />
auch über vorliegende Suchkriterien ermittelt<br />
werden.<br />
Auch als eigene Informationsquelle findet<br />
die Datenbank bei GSP Verwendung,<br />
um jederzeit über den Status von Aufträgen<br />
gegenüber dem Geschäftsbereich Spezialprofile<br />
bei HHO im Bilde zu sein. Des Weite-<br />
ren sind Informationen über ausgewählte<br />
Standardprofile in der Datenbank mit aktuellen<br />
Lagerbestandsdaten angereichert, die<br />
für die Disposition bei GSP selbst und hinsichtlich<br />
der Lieferfähigkeit gegenüber dem<br />
Endverbraucher von Bedeutung sind.<br />
Das im November 1999 begonnene Projekt<br />
war im Februar 2000 abgeschlossen<br />
und konnte damit seinen Routinebetrieb<br />
mit all den oben beschriebenen Vorteilen<br />
aufnehmen.<br />
Unabhängig von dem konkreten Anwendungsfall<br />
beim Partner GSP, für den die<br />
Supply-Chain-Anwendung entwickelt<br />
wurde, steht mit dieser Anwendung auch<br />
ein Prototyp bereit, der in ähnlich gelagerten<br />
Konstellationen bei anderen Partnern<br />
ohne nennenswerten Aufwand adaptiert<br />
und kurzfristig zum Einsatz gebracht werden<br />
kann.<br />
5 Fazit<br />
Mit den hier vorgestellten drei E-Business-Lösungen<br />
sollte beispielhaft verdeutlich<br />
werden, wie Hoesch Hohenlimburg sich<br />
auf die schnelllebigen Veränderungsprozesse<br />
insbesondere im Bereich der Informationstechnologie<br />
einstellt und damit gleichzeitig<br />
eine aktive Rolle innerhalb der Stahlverarbeitungsbranche<br />
einnimmt. Der hieraus<br />
resultierende Nutzenzuwachs für die<br />
Kunden bedeutet gleichzeitig auch ein Ausschöpfen<br />
weiterer Kundenbindungspotenziale.<br />
Für diesen Zweck hat Hoesch Hohenlimburg<br />
inzwischen eine multimediale CD<br />
entwickelt. Mit dieser vertonten Präsentation<br />
sollen Lieferanten, Kunden und Interessenten<br />
aufgefordert werden, sich als Partner<br />
von Hoesch Hohenlimburg an den aufgezeigten<br />
Möglichkeiten einer modernen<br />
Kunden-Lieferantenbeziehung aktiv zu<br />
beteiligen.
27<br />
Uriel Batres,<br />
Carlos Hernandez<br />
CENDI – eine zur Förderung der Marktentwicklung von<br />
nichtrostendem Stahl in Mexiko gegründete Organisation<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Eingangshalle des Bürogebäudes von CENDI, überdacht von einer aus<br />
Edelstahl gefertigten Struktur aus Rohren (Bild 1)
28<br />
CENDI – eine zur Förderung der Marktentwicklung von nichtrostendem Stahl in Mexiko<br />
gegründete Organisation<br />
Ansicht der Fassade des Bürogebäudes von CENDI (Bild 2)<br />
1 Hintergrund<br />
Die tiefen und radikalen Änderungen,<br />
welche die mexikanische Wirtschaft in den<br />
letzten Jahren erfahren hat, einschließlich<br />
der verschiedenen Freihandelsabkommen<br />
(wie z.B. das von den USA und Kanada mit<br />
unterzeichnete NAFTA-Abkommen, und<br />
das mit der Europäischen Union unterzeichnete<br />
Abkommen) verlangen nach<br />
neuen Zielen und Herausforderungen, die<br />
wiederum zu ihrer Realisierung verbesserte<br />
Strategien erfordern.<br />
Eine solide und nachhaltige Entwicklung<br />
des mexikanischen Marktes für nichtrostenden<br />
Stahl erfordert die ständige Verfügbarkeit<br />
von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
und technischer Unterstützung für<br />
vorhandene und potentielle Kunden.<br />
Mexinox entschloss sich daher, eine<br />
Organisation ins Leben zu rufen, um ihren<br />
Kunden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
sowie technische Schulungen zur<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Verfügung zu stellen. Zu ihren Kunden<br />
zählen sowohl die Direktkunden der Walzwerke<br />
als auch die Zwischenhändler und<br />
die kleineren Verbraucher, die wiederum<br />
von den Zwischenhändlern beliefert werden.<br />
Die anfängliche Zielsetzung war, eine<br />
Organisation zu gründen, die selbst den<br />
kleinsten Verarbeiter von nichtrostendem<br />
Stahl in Mexiko erreichen kann (Bilder 1<br />
und 2).<br />
Langfristig werden Geschäftsleute und<br />
Anleger angesichts besserer Bildungsvoraussetzungen<br />
auf dem Markt und zufriedenerer<br />
Kunden dazu bereit sein, mehr finanzielle<br />
Mittel in die mexikanische Industrie<br />
für nichtrostenden Stahl zu investieren.<br />
Der Name des im Januar 2000 gegründeten<br />
Verbandes lautet „Centro Nacional<br />
para el Desarrollo del Acero Inoxidable,<br />
A.C. (CENDI)“ (Nationales Zentrum für die<br />
Förderung nichtrostenden Stahls) und<br />
schließt die folgenden Unternehmen ein:<br />
● Mexinox, der mexikanische Hersteller von<br />
Kaltwalzerzeugnissen aus nichtrostendem<br />
Stahl,<br />
● Aceros Anglo, der mexikanische Hersteller<br />
von Langprodukten,<br />
● die acht wichtigsten Zwischenhändler<br />
für nichtrostenden Stahl in Mexiko,<br />
einschließlich Mexinox Trading,<br />
● Fischer Mexicana, Hersteller von Rohren<br />
aus nichtrostendem Stahl (ebenfalls ein<br />
Unternehmen der Mexinox-Gruppe).<br />
Grundriss des Bürogebäudes von CENDI mit den verschiedenen Bereichen für<br />
Büros, Besprechungszimmer und Informationszentrum sowie den Schulungsräumlichkeiten<br />
und Ausbildungswerkstätten (Bild 3)
29<br />
CENDI – eine zur Förderung der Marktentwicklung von nichtrostendem Stahl in Mexiko<br />
gegründete Organisation<br />
2 Hauptziele von CENDI<br />
CENDI ist eine gemeinnützige Organisation<br />
mit dem Ziel, den Verbrauch von nichtrostendem<br />
Stahl in Mexiko zu fördern und<br />
zu entwickeln, und zwar auf der Grundlage<br />
von Forschung und Ausbildung, sowie der<br />
Förderung von nichtrostendem Stahl<br />
durch eine Kanalisierung und Koordinierung<br />
der Bemühungen von Produzenten,<br />
Zwischenhändlern, Herstellern und<br />
Endverbrauchern.<br />
Tag für Tag stärkt CENDI seine Beziehungen<br />
zu gleichartigen Organisationen mit<br />
ähnlichen Zielsetzungen in der ganzen Welt<br />
wie z.B. NiDI in Kanada, Euro Inox in<br />
Europa, SASSDA in Südafrika, CEDINOX<br />
in Spanien, usw.<br />
3 Wesentliche Merkmale von<br />
CENDI<br />
Die wesentlichen Merkmale von CENDI<br />
sind:<br />
● Die aktive Beteiligung sämtlicher Mitglieder<br />
an allen Projekten<br />
Im Vorstand sind alle Mitgliedskategorien<br />
vertreten: Produzenten, Zwischenhändler,<br />
Hersteller und Endverbraucher.<br />
● Aktive finanzielle Beteiligung der Produzenten<br />
und der Vertriebskette<br />
Die Mexinox-Gruppe beteiligt sich mit<br />
maximal 50 % an dem verabschiedeten<br />
Jahresbudget. Die verbleibenden 50 %<br />
werden von der Vertriebskette durch eine<br />
Abgabe in Höhe von US-$ 10,00 finanziert,<br />
die von Mexinox im Auftrag von<br />
CENDI auf jede Tonne nichtrostenden<br />
Stahls erhoben wird, die an einen der<br />
beteiligten Zwischenhändler geliefert<br />
wird.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
In Fachzeitschriften veröffentlichte Anzeige einer für<br />
Edelstahlküchen entwickelten Idee (Bild 4)<br />
● Eigens eingerichtete Räumlichkeiten<br />
Das Bürogebäude von CENDI wurde von<br />
Anfang an mit der spezifischen Zielsetzung<br />
konzipiert und entworfen, die geeignetsten<br />
Einrichtungen für Vorlesungen<br />
und praktische Schulungen zu bieten,<br />
um einen hohen Ausbildungsstandard zu<br />
gewährleisten. Diese Einrichtungen stehen<br />
allen Institutionen der mexikani-<br />
Titelseite der CENDI-Zeitschrift „Enfoque Inoxidable“<br />
mit der Darstellung verschiedener Anwendungsmöglichkeiten<br />
in der Küche (Bild 5)<br />
schen Industrie für nichtrostenden Stahl<br />
zur Verfügung. Eigene Schulungsräumlichkeiten<br />
und Ausbildungswerkstätten<br />
sind vorhanden (Bild 3).<br />
● Schulungsprogramme<br />
CENDI hat ein vollständiges und spezifisch<br />
ausgerichtetes Programm für alletechnischen<br />
Bereiche des nichtrostenden<br />
Stahls entwickelt. Nach erfolgreichem<br />
Abschluss aller Kurse verleiht CENDI den<br />
technischen Mitarbeitern das Zertifikat<br />
eines „Spezialtechnikers für nichtrostenden<br />
Stahl“, mit dem sie ihre Kompetenzen<br />
in Bezug auf nichtrostenden Stahl in<br />
der mexikanischen Industrie unter Beweis<br />
stellen können.<br />
Darüber hinaus steht auch ein Spezialprogramm<br />
für das Vertriebspersonal der<br />
Mitgliedsunternehmen zur Verfügung, um<br />
diesen Kreis mit den erforderlichen Instrumenten<br />
und Informationen auszustatten,<br />
die sie in die Lage versetzen, bestehende<br />
und potentielle Kunden von den Vorzügen<br />
des nichtrostenden Stahls zu überzeugen.<br />
4 Management und Organisation<br />
CENDI ist in drei Bereiche unterteilt, die<br />
alle an einen einzigen Direktor berichten.<br />
Diese Bereiche haben unterschiedliche Verantwortungen<br />
und Einsatzgebiete. Die<br />
Schwerpunkte dieser Bereiche sind im Folgenden<br />
beschrieben.<br />
● Bereich für Verkaufsförderung<br />
Die Aufgabe des Bereichs Verkaufsförderung<br />
schließt den engen Kontakt zu Universitäten,<br />
Beratern, Architekten, Ingenieuren<br />
und ganz allgemein zu all jenen<br />
Institutionen und Behörden ein, die für
30<br />
CENDI – eine zur Förderung der Marktentwicklung von nichtrostendem Stahl in Mexiko<br />
gegründete Organisation<br />
Die Webseite von CENDI wurde eingerichtet, um das Zusammenwirken der Mitglieder zu fördern und ihnen<br />
Informationen, Neuigkeiten und Links auf Websites zum Thema Edelstahl zur Verfügung zu stellen (Bild 6)<br />
Materialspezifikationen und -normung<br />
zuständig sind. Dieser Bereich fördert<br />
nichtrostende Stahlprodukte, die von den<br />
CENDI-Mitgliedsunternehmen hergestellt<br />
werden, indem er neue Geschäftsmöglichkeiten<br />
durch Beiträge in Magazinen,<br />
Broschüren, Videos, im Internet usw.<br />
sucht (Bilder 4, 5).<br />
● <strong>Technische</strong>r Bereich<br />
Dieser Bereich ist für die Entwicklung von<br />
technischen und Marktforschungsprojekten<br />
zuständig, um neue Anwendungen<br />
für nichtrostenden Stahl zu finden. Ständige<br />
Kommunikation mit ähnlichen Organisationen<br />
in der ganzen Welt ermöglicht<br />
es diesem Bereich, neue, in anderen Teilen<br />
der Welt zur Verfügung stehende<br />
Möglichkeiten auch auf den mexikanischen<br />
Markt zu bringen. Die Schulungsprogramme<br />
werden ebenfalls von diesem<br />
Bereich geleitet und entwickelt.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
● Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich<br />
Dieser Bereich ist für die Verwaltung und<br />
Gesamtführung des CENDI-Informationszentrums<br />
verantwortlich, einschließlich<br />
der statistischen Berichterstattung, die<br />
es den Mitgliedern ermöglicht, die Weiterentwicklung<br />
der Industrie für nichtrostenden<br />
Stahl zu verfolgen. Eine schnelle<br />
Bearbeitung der Anforderungen aller Mitglieder<br />
erfolgt ebenfalls durch diesen<br />
Bereich.<br />
5 Internationales Seminar<br />
Am 19. und 20. April 2001 hielt CENDI<br />
sein erstes internationales Seminar ab, das<br />
den nationalen Servicezentren und Verarbeitern<br />
gewidmet war. Mehr als 200 Teilnehmer<br />
besuchten das Seminar und zeigten<br />
damit das zunehmende Interesse für<br />
nichtrostenden Stahl in der mexikanischen<br />
Industrie.<br />
In diesem Seminar wurden die Teilnehmer<br />
mit der aktuellen Situation der Industrie<br />
für nichtrostenden Stahl in der ganzen<br />
Welt vertraut gemacht. Die Vorträge wurden<br />
von einigen der weltweit angesehensten<br />
Experten für nichtrostenden Stahl wie Heinz<br />
H. Pariser, Thomas Pauly, David Slater,<br />
Barry Waters, Alfred Otto, Gary Coates,<br />
Sonsoles Fernandez und Francisco Castillo<br />
gehalten.<br />
Mit dieser Art von internationalen Seminaren<br />
will CENDI den mexikanischen Herstellern<br />
ein vollständigeres Bild und Verständnis<br />
für die Möglichkeiten vermitteln,<br />
die diese viel versprechende und moderne<br />
Industrie bietet.<br />
6 Website<br />
Die Entwicklungen in der Kommunikation<br />
haben die Art des Informationsaustausches<br />
in den Unternehmen verändert. Aus diesem<br />
Grunde ist eines der ersten Projekte<br />
von CENDI die Einrichtung der eigenen<br />
Website. Mit diesem Projekt möchte CENDI<br />
das Zusammenwirken verstärken zwischen<br />
allen Mitgliedern und den Leuten, die daran<br />
interessiert sind, mehr über die Industrie<br />
für nichtrostenden Stahl in Mexiko zu erfahren.<br />
Auf dieser Website werden regelmäßig<br />
Berichte über die Aktivitäten von CENDI<br />
sowie über all die Innovationen und<br />
Geschäftsmöglichkeiten beim nichtrostenden<br />
Stahl veröffentlicht, die für die Mitglieder<br />
von Interesse sein könnten (Bild 6).<br />
Generell sind alle bei CENDI Beschäftigten<br />
verpflichtet, mit ihren Anstrengungen<br />
zur Förderung des mexikanischen Wirtschaftswachstums<br />
durch den Einsatz von<br />
nichtrostendem Stahl beizutragen. Diese<br />
Aufgabe wird zu einem leidenschaftlichen<br />
Ziel und bestärkt durch die tagtägliche<br />
Arbeit die Existenzberechtigung von CENDI.
31<br />
Prof. Dr. Heinz Humberg,<br />
Dr.-Ing. habil. Ulrich Brill<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen Werkstoff im Internet<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Hochleistungswerkstoffe der Krupp VDM GmbH<br />
finden jetzt auch ihren Weg zum Kunden durch<br />
das Intra- und Internet (Bild 1)
32<br />
1 Einleitung<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen Werkstoff im Internet<br />
Das für die Kommunikation mit Kunden<br />
entwickelte System WDISweb ist eine<br />
E-Business-nahe Anwendung, die im Vorfeld<br />
des Beratungsgesprächs dem Kunden<br />
bereits Entscheidungshilfen über die technische<br />
Eignung der Krupp VDM-Produkte<br />
für seine Aufgabe gibt.<br />
Somit dient dieses Internet-Recherche-<br />
System den Zielen, sowohl kompetent und<br />
aktuell über die technischen Parameter zu<br />
informieren, als auch die Mitarbeiter des<br />
Vertriebs und Marketings von Standardanfragen<br />
zu entlasten.<br />
Der Kundennutzen liegt in der uneingeschränkten<br />
Verfügbarkeit des Systems über<br />
das Internet und in der Aktualität der dem<br />
System zugänglichen Daten. Diese werden<br />
nämlich direkt aus den Labordaten ermittelt.<br />
Um die versehentliche Veröffentlichung<br />
sensibler Daten zu vermeiden, muss die<br />
jeweilige Fachabteilung die den Kunden<br />
zugänglichen Daten gezielt freigeben.<br />
Das in WDISweb integrierte Informationssystem<br />
über Schweißtechniken und<br />
Schweißverfahren wird die Kundenbindung<br />
erhöhen. Nicht nur versierte Schweißfachleute,<br />
sondern auch Konstrukteure finden<br />
hier Antworten auf Grundsatzfragen der<br />
Verbindungstechnik.<br />
Ein derartiges Recherchesystem für die<br />
Suche nach Werkstoffen bei Vorgabe der<br />
technologischen Anforderungen ist bisher<br />
nicht bekannt, erst recht nicht im Internet<br />
verfügbar. Dies zeigte u.a. die entsprechende<br />
Resonanz bei der Vorstellung des<br />
Systems auf der ACHEMA 2000.<br />
Die zur Realisierung des Systems eingesetzten<br />
Techniken entsprechen dem<br />
modernen Stand der Entwicklungswerkzeuge<br />
für das Internet. Zur dynamischen<br />
Generierung der Internetseiten wurde die<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Sprache PHP eingesetzt. Die Daten, die<br />
sich aus der Anfrage an die Datenbank<br />
ergeben, werden sowohl in tabellarischer<br />
Übersicht als auch grafisch aufbereitet in<br />
vorbereitete Schablonen eingetragen. Der<br />
Nutzer des Systems sieht in seinem Standard-Web-Browser<br />
eine in sich schlüssige<br />
Darstellung der angeforderten Informationen,<br />
dargestellt nach den Richtlinien des<br />
Corporate Design von ThyssenKrupp.<br />
Das System wurde entwickelt in enger<br />
Kooperation mit der Arbeitsgruppe von<br />
Prof. Dr. Heinz Humberg an der Fachhochschule<br />
Gelsenkirchen, Abteilung Bocholt.<br />
An der Entwicklung beteiligt waren maßgeblich<br />
die Herren Christian Ida, Thomas<br />
Gouders von der FH, Frau Anna Liebelt<br />
sowie Thomas Hartung und Herr Dr. Ulrich<br />
Brill von Krupp VDM, bei dem auch die Leitung<br />
des Projekts lag.<br />
Im Folgenden wird das System WDISweb<br />
näher beschrieben.<br />
Struktur von WDIS (Bild 2)<br />
2 Aufbau von WDISweb<br />
WDISweb ist das Werkstoffdaten-Informationssystem<br />
der Krupp VDM, zugänglich<br />
über Inter- und Intranet. Es wurde auf der<br />
Basis der internen Werkstoffdatenbank<br />
WDIS für die Kunden von Krupp VDM entwickelt,<br />
um sie schnell zu den Werkstoffen<br />
zu führen, die für die jeweiligen Aufgabenstellungen<br />
am geeignetsten sind.<br />
Hierzu greift WDISweb unmittelbar auf die<br />
in den Werkstofflaboren ermittelten Versuchsergebnisse<br />
zu, sodass eine ständige<br />
Aktualität der Daten gesichert ist. Daneben<br />
sind die kompletten Werkstoffdatenblätter<br />
hinterlegt und von WDISweb aus zugänglich.<br />
Bild 2 veranschaulicht die modulare<br />
Struktur von WDIS. Hier sind unter dem<br />
gemeinsamen Dach der Werkstoffgrunddaten<br />
die Teilbereiche mechanische Eigenschaften,<br />
Korrosionsverhalten und
33<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen Werkstoff im Internet<br />
Schweißbarkeit dargestellt. Diese Module<br />
sind direkt einzelnen Fachlaboren zuzuordnen,<br />
die WDIS nutzen, um Versuchsergebnisse<br />
zu erfassen und zu verwalten.<br />
WDISweb ist eine Entwicklung, die letztlich<br />
auf denselben Daten wie WDIS aufsetzt,<br />
diese Daten aber einem größeren<br />
Nutzerkreis zugänglich macht.<br />
Während das Fachlabor eine Probe eines<br />
Werkstoffs erhält, Untersuchungen durchführt<br />
und dann die Ergebnisse in der<br />
Datenbank ablegt, will ein (Werkstoff-)<br />
Anwender in der Regel genau den umgekehrten<br />
Weg gehen: Ausgehend von seinen<br />
Anforderungen will er den geeigneten<br />
Werkstoff finden, also den Werkstoff, der<br />
die technologischen Forderungen mindestens<br />
erfüllt. Neben diesen unterschiedlichen<br />
Sichten auf die Daten sind noch<br />
Mechanismen zur Aufbereitung und Nutzung<br />
der Daten durch Externe vorzusehen.<br />
Die Sicht des Anwenders wurde in Internettechnologie<br />
realisiert und wird im Folgenden<br />
beschrieben.<br />
3 Die Suchwege<br />
Wer bereits die Werkstoffnummer, Herstellerbezeichnung<br />
oder die Alloy-Bezeichnung<br />
eines Werkstoffes kennt, kann direkt<br />
mit diesen Daten eine Anfrage starten.<br />
Sind seine Vorgaben eindeutig, wird er<br />
sofort zum gesuchten Werkstoff geführt,<br />
ansonsten kann er den Werkstoff aus einer<br />
Liste auswählen, Letzteres insbesondere<br />
bei unvollständigen Suchvorgaben. Danach<br />
kann er sich die zu diesem Werkstoff in den<br />
Laboren ermittelten und freigegebenen<br />
Daten anzeigen lassen.<br />
Zudem erhält er hier die Informationen<br />
über die für diesen Werkstoff international<br />
benutzten Bezeichnungen und den Zugriff<br />
auf die Werkstoffdatenblätter (Bild 3).<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Internationale Werkstoffbezeichnungen eines ausgewählten Werkstoffes (Bild 3)<br />
Wird ein Krupp VDM-Werkstoff mit spezifischen<br />
mechanischen Eigenschaften<br />
gesucht, so reicht die Angabe der Mindestanforderung,<br />
z.B. der Festigkeit bei vorliegender<br />
Temperatur.<br />
WDISweb entscheidet automatisch, ob<br />
unter den vorliegenden Voraussetzungen<br />
zeitunabhängige Zugfestigkeiten oder zeitabhängige<br />
Zeitstandfestigkeiten Rm/x angegeben<br />
werden müssen.<br />
Information über die Werkstoffeigenschaften bei verschiedenen Temperaturen (Bild 4)
34<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen Werkstoff im Internet<br />
Ist der Werkstoff ausgewählt, gibt WDISweb<br />
auch eine tabellarische Übersicht über<br />
das umgebende Temperaturspektrum, wie<br />
beispielsweise in Bild 4 gezeigt.<br />
Bei Fragen im Umfeld korrosiver Belastungstests<br />
können Vorgaben hinsichtlich<br />
des Mediums und der Temperatur gemacht<br />
werden. WDISweb findet die Werkstoffe, für<br />
die Prüfungen durchgeführt wurden, und<br />
zeigt die Ergebnisse in einer übersichtlichen<br />
Tabelle an (Bild 5). Dies Bild zeigt die<br />
Abtragsgeschwindigkeit von Nimofer 6928,<br />
der als geeigneter Werkstoff für 60%-ige<br />
30 °C warme Schwefelsäure ermittelt<br />
wurde.<br />
Neben der tabellarischen Ausgabe von<br />
Korrosionswerten ist auch die komfortablere<br />
und informativere Darstellung als so<br />
genanntes ISO-Korrosionsdiagramm, wie<br />
beispielhaft in Bild 6 dargestellt, möglich.<br />
Für schweißtechnische Fragestellungen<br />
liefert WDISweb im Teilsystem SISSY<br />
(Schweiß-Informations-System) Informationen<br />
über die Schweißbarkeit zweier<br />
Werkstoffe, gibt Informationen über vorliegende<br />
Zulassungen, geeignete Schweißverfahren,<br />
Schweißzusatzwerkstoffe und<br />
den Mengenbedarf an Schweißzusatzwerkstoff<br />
für eine genauer vorgegebene<br />
Schweißaufgabe, mit einem konkreten<br />
Schweißprotokoll unterstützt.<br />
Diesem können dann die erforderlichen<br />
Schweißlagen und die Schweißparameter<br />
entnommen werden.<br />
Bild 7 zeigt ein Beispiel für die Schweißaufgabe<br />
einer artgleichen Verbindungsschweißung<br />
von 5 mm dicken Nicrofer<br />
6025 HT-Blechen. Im oberen Teilbild werden<br />
zunächst die geeigneten Schweißzusatzwerkstoffe<br />
angezeigt, nach weiteren<br />
Vorgaben werden die Schweißverfahren<br />
und das Nahtgewicht zur Ermittlung der<br />
benötigten Schweißzusatzmenge ausge-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Ergebnisse korrosiver Belastungstests (Bild 5)<br />
wiesen. Das untere Teilbild gibt die exakten<br />
Schweißparameter für Wurzel-, Füll- und<br />
Decklage an.<br />
Für den in der Schweißtechnik nicht ganz<br />
ISO-Korrosionsdiagramm (Bild 6)<br />
so versierten Nutzer ist in WDIS ein Informationssystem<br />
Schweißtechnik hinterlegt,<br />
in dem Basiswissen über Schweißverfahren,<br />
Nahtvorbereitung usw. erfragt werden kann.
35<br />
4 Technik<br />
WDISweb: Suche nach dem optimalen Werkstoff im Internet<br />
Basis des Informationssystems ist die<br />
mit ORACLE realisierte Datenbank WDIS.<br />
Parallel zur Datenbank wartet ein Webserver<br />
auf eine über Internet oder Intranet<br />
gestellte Anfrage. Dieser startet dann spezielle<br />
Programme, die die Anfrage auswerten<br />
und die jeweiligen Teilsysteme von<br />
WDISweb ansteuern. So werden die Suchanfragen<br />
in Anfragen an die relationale<br />
Datenbank umgesetzt, die von der Datenbank<br />
erhaltenen Daten ausgewertet und<br />
hiermit letztendlich dynamisch die über<br />
Inter- und Intranet verschickten Seiten<br />
generiert.<br />
5 Perspektiven<br />
WDISweb wurde das erste Mal öffentlich<br />
auf der ACHEMA 2000 in Frankfurt vorgestellt.<br />
Seitdem befand sich das System als<br />
interne Testphase im Intranet der Krupp<br />
VDM. Ziel dieser nun abgeschlossenen<br />
Testphase war es, mit den internen Kollegen<br />
und Nutzern im Dialog WDISweb auf<br />
die sachliche Richtigkeit der Aussagen, den<br />
problemlosen Umgang mit dem Programm<br />
und eine ansprechende Darstellung der<br />
Ergebnisse zu prüfen.<br />
Seit Mai 2001 ist WDISweb sowohl in<br />
deutscher als auch englischer Sprache<br />
im Internet aufrufbar.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Informationssystem für schweißtechnische Fragestellungen (Bild 7)
36<br />
Dr.-Ing. Kurt Orthmann<br />
Bilstein-Stoßdämpfer über www.Bilstein.de<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Produktpalette von Krupp Bilstein (Bild 1)
37<br />
Bilstein-Stoßdämpfer über www.Bilstein.de<br />
1 Ausgangssituation<br />
Die Krupp Bilstein GmbH ist ein Unternehmen<br />
der ThyssenKrupp Automotive<br />
Gruppe und trägt gemeinsam mit anderen<br />
Konzernunternehmen zur umfassenden<br />
Kompetenz im Fahrwerksbereich bei. Innovative<br />
Produkte wie das Luftfeder-Dämpfermodul,<br />
das im Jahr 2000 den Innovationspreis<br />
von ThyssenKrupp gewann und in der<br />
S-Klasse von DaimlerChrysler eingesetzt<br />
wird, und das bekannte sehr starke Engagement<br />
von Krupp Bilstein im Motorsport<br />
führten zu einem hohen Bekanntheitsgrad<br />
bei den Automobilherstellern wie auch den<br />
Fahrwerkprofis. Krupp Bilstein ist in der<br />
Erstausrüstung bei vielen Automobilherstellern<br />
vertreten.<br />
Das Aftermarketgeschäft ist eine wichtige<br />
Stütze in der Strategie von Krupp Bilstein<br />
und soll in der Zukunft noch stärker<br />
ausgebaut werden. Krupp Bilstein bietet<br />
Produkte sowohl für den Ersatz der verschlissenen<br />
Dämpfer an, als auch Dämpfer,<br />
die das Fahrverhalten deutlich über den<br />
Standard der Serienausrüstung hinaus verbessern<br />
sollen (Bild 2).<br />
Das Marktvolumen für Ersatz-Stoßdämpfer<br />
(Original Bilstein) im Aftermarket<br />
wird in Deutschland eindeutig von Sachs<br />
und Monroe beherrscht. Im Tuning-Bereich<br />
Einsatzgebiete der Stoßdämpfer von Krupp Bilstein (Bild 2)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
(Sport, Sprint, PSS9) hingegen spielt Krupp<br />
Bilstein neben H&R, Vogtland eine dominante<br />
Rolle. Das gesamte Marktvolumen<br />
für Stoßdämpfer in Deutschland liegt bei<br />
ca. 350 Mio €.<br />
2 Aufgabenstellung<br />
Der Marktanteil von Krupp Bilstein am<br />
gesamten Stoßdämpfermarkt für das Aftermarketgeschäft<br />
in Deutschland ist nicht<br />
zufrieden stellend. In der aktuellen<br />
Vertriebsstruktur werden die Dämpfer in<br />
Deutschland über Gebietsvertreter an den<br />
Großhandel verkauft, der seinerseits die<br />
Dämpfer an den Einzelhandel bzw. an die<br />
Werkstatt weitergibt – mit den jeweiligen<br />
Margen für die einzelnen Handelsstufen.<br />
Umfragen bei den Werkstätten und Einzelhändlern<br />
haben eine Unzufriedenheit der<br />
letzten Handelsstufe (d.h. Werkstätten und<br />
Einzelhändler) ergeben. Die häufigen Kritiken<br />
dieser Handelsstufe lagen in der mangelnden<br />
Betreuung:<br />
● keine Präsenz im Markt – „Wir wollen seit<br />
langem Bilstein kaufen, aber wir kommen<br />
an euch nicht ran!“<br />
● keine Teileverfügbarkeit – „Ihr könnt<br />
nicht liefern, und wenn, dann dauert das<br />
3 Tage!“<br />
● keine Schulungen – „Wir verkaufen aus<br />
dem Katalog heraus, ohne die Produkteigenschaften<br />
genau zu kennen. Wie<br />
sollen wir da den Autofahrer kompetent<br />
beraten?“<br />
Analysen in der eigenen Auftragsabwicklung<br />
haben ähnliche Aussagen ergeben.<br />
Die meisten Anfragen der Kunden waren:<br />
● Haben Sie den Dämpfer verfügbar?<br />
● Was kostet der Dämpfer?<br />
● Um wie viel kann ich mit dem Dämpfer<br />
mein Fahrzeug tiefer legen?<br />
● Gibt es für das Fahrzeug mit dem Dämpfer<br />
ein Gutachten?<br />
Krupp Bilstein kam zu dem Schluss, dass<br />
sich mit dem neuen Medium Internet<br />
sowohl die Präsenz bei der Handelsstufe<br />
Werkstatt/Einzelhandel als auch die Qualität<br />
der Anfragen und Auftragsbearbeitung<br />
deutlich verbessern lässt. Die Aufgabenstellung<br />
an das E-Commerce-Team lautete,<br />
diese Handelsstufe und den Endverbraucher<br />
über das Internet direkt anzusprechen,<br />
aber eine Lösung zu finden, die die<br />
Zwischenhändler mit einbindet.<br />
3 Segmentierung der „Kunden“<br />
Die erfolgskritische Komponente im Verkauf<br />
ist die gezielte Ansprache der Bedürfnisse<br />
der Kunden. Hier müssen die genauen<br />
Bedürfnisse erkannt und befriedigt werden.<br />
Eine unklare Ansprache des Durchschnittskunden<br />
führt häufig zu unbefriedigenden<br />
Ergebnissen, da sich letztendlich<br />
kein Kunde in seinen Bedürfnissen richtig<br />
angesprochen fühlt. So wurden bei dem<br />
geplanten Internetauftritt im ersten Schritt<br />
die Zielkunden und ihre Bedürfnisse sehr<br />
genau analysiert.
38<br />
Bilstein-Stoßdämpfer über www.Bilstein.de<br />
Kundensegmente und -eigenschaften (Bild 3)<br />
Es gibt für Krupp Bilstein viele Kunden:<br />
– Kunden, die kaufen wollen, – Automobilhersteller,<br />
die wissen wollen, wie die Kundenprojekte<br />
bei Krupp Bilstein gerade stehen,<br />
– Lieferanten, die gerne ihre Leistungen<br />
an Krupp Bilstein anbieten wollen,<br />
– Bewerber, die gerne im Bilstein-Team<br />
mitarbeiten wollen (Bild 3).<br />
Der neue Bilstein-Internetauftritt, der in<br />
der Zeit von April bis Oktober 2001 aufgebaut<br />
wird, versucht daher, seine Angebote<br />
sehr genau entsprechend der Kundenbedürfnisse<br />
auszurichten (Bild 4).<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
4 Krupp Bilstein’s Internetauftritt<br />
für die Handelsstufe Werkstatt/<br />
Einzelhändler<br />
Die Kunden dieses Portals sind die Werkstätten,<br />
Einzelhändler, die schnell und professionell<br />
die Stoßdämpfer von Krupp<br />
Bilstein beziehen wollen. Sie legen großen<br />
Wert auf Informationen, die schnell verfügbar<br />
sind, sofort geladen werden können und<br />
keiner langen Ladezeiten bedürfen (Bild 5).<br />
Die Werkstatt hat ein elementares Interesse<br />
daran, ihrem Kunden schnell eine<br />
Lösung für dessen Problem anzubieten und<br />
Jeder Kunde – ob intern oder extern – erhält bei Bilstein die auf<br />
seine Bedürfnisse zugeschnittene Plattform<br />
Kundensegmentierung des Internetauftritts von Krupp Bilstein (Bild 4)<br />
möchte sich nicht in langen Sitzungen<br />
durch viele Seiten „durchklicken“, bis es<br />
zum Ergebnis kommt. So hat die Werkstatt<br />
die Möglichkeit, wenn die Artikelnummer<br />
bekannt ist, auf der 1. Startseite bereits die<br />
Nummer eingeben zu können und den<br />
aktuellen Preis und die Teileverfügbarkeit<br />
abzufragen. Die Werkstatt kann aber auch<br />
zusätzliche Informationen aus dem Werkstattbereich<br />
abfragen wie:<br />
● Einbauanweisungen für die jeweiligen<br />
Artikel<br />
● Stundenwerte für den Einbau<br />
● monentane Aktionen<br />
● Status der aktuellen Aufträge<br />
● Verfügbarkeit spezieller Werkzeuge<br />
● Marketing- und Verkaufsunterlagen<br />
– und das alles kostenlos.<br />
Der Schwerpunkt im Bereich Werkstatt<br />
ist, schnell und professionell Informationen<br />
und Teile zu erhalten. Obwohl der gesamte<br />
Auftritt erst im Oktober online sein soll,<br />
werden Teile davon jetzt schon stückweise<br />
implementiert. So sind zum Beispiel bereits<br />
Kataloge und aktuelle Preislisten im Netz<br />
unter www.Bilstein.de verfügbar.<br />
5 Krupp Bilsteins Internetauftritt<br />
für die Endverbraucher<br />
Der zweite große Kundenbereich beinhaltet<br />
die sportlichen Autofahrer und Motorsportclubs.<br />
Der Schwerpunkt liegt hier bei<br />
den Autofahrern im Alter von 20 bis 30<br />
Jahren, die mit dem Fahrwerk der Serienausrüstung<br />
nicht zufrieden sind. Diese<br />
Kunden wollen technische Informationen<br />
und Hintergründe über ihr Fahrzeug. Sie<br />
entscheiden sich zu 99 % vor dem Betreten<br />
eines Ladens oder der Werkstatt aus Zeitungen,<br />
Katalogen und Testberichten.
39<br />
Bilstein-Stoßdämpfer über www.Bilstein.de<br />
Diese Kunden sind meist hervorragend<br />
informiert und wissen genau, was sie wollen.<br />
Die Information wird seitens Krupp<br />
Bilstein so aufbereitet, dass die Inhalte<br />
selbstsprechend sind und die Hintergründe<br />
klar sind. Die Darstellung nur des Kataloges<br />
im Internet ist hier nicht ausreichend.<br />
Das Prinzip des Auftrittes ist hier ein ganz<br />
anderer als bei den Werkstätten – nämlich<br />
informativ und unterhaltend. Hier sollen<br />
auch größere Grafiken und Videos übertragen<br />
werden (Bild 6).<br />
Der „Club-Auftritt“, der ab September<br />
2001 online sein soll, beinhaltet auch Teile,<br />
die eine „Heimat“ für die Zielkunden aufbauen<br />
sollen. Viele Gespräche mit den<br />
Motorsportclubs haben gezeigt, was die<br />
Kunden wollen: Informationen, Bilder und<br />
die Möglichkeit, direkt im Internet bestellen<br />
zu können. Sie wollen weniger Informationen<br />
über das Unternehmen, sondern<br />
primär über das Produkt.<br />
In den seltensten Fällen bauen die Endverbraucher<br />
die Dämpfer selbst ein. Hier<br />
helfen die Werkstätten bzw. Zwischenhändler,<br />
die dem Endverbraucher den Einbau<br />
abnehmen. Ein komplexes Rabattsystem<br />
gibt sowohl dem Endverbraucher einen<br />
günstigeren Preis, als auch der Werkstatt<br />
bzw. Zwischenhändlern eine Unterstützung<br />
für den Einbau seitens Krupp Bilstein,<br />
sodass sich der Einbau auch für die Partnerwerkstatt<br />
lohnt. Ansonsten besteht die<br />
Gefahr, dass die Werkstatt an dem Einbau<br />
der fremd beigestellten Teile nicht interessiert<br />
ist und den Endverbraucher mit den<br />
gekauften Teilen abweist. Damit ist weder<br />
dem Endverbraucher, noch der Werkstatt,<br />
noch Krupp Bilstein gedient. Der Endverbraucher<br />
ist verärgert – über die „hochnäsige“<br />
Werkstatt, zu der er wohl kaum mehr<br />
fährt, und über Krupp Bilstein, die ihm zwar<br />
die Dämpfer verkauft haben, aber nicht<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Angebote für Werkstätten (Bild 5)<br />
sein Problem gelöst haben, die Dämpfer in<br />
das Auto einzubauen. Krupp Bilstein selbst<br />
ist auch unzufrieden, da der Kunde sicher<br />
nicht mehr bei Krupp Bilstein kauft und<br />
dies auch in seinem Bekanntenkreis entsprechend<br />
artikuliert. Damit dies nicht passiert,<br />
bekommt die Werkstatt, die den Einbau<br />
durchführt, eine finanzielle Unterstützung<br />
seitens Krupp Bilstein, die den Einbau<br />
Angebote für Endverbraucher (Bild 6)<br />
attraktiv macht, ohne dass die Werkstatt<br />
einen Aufwand für die Kundenberatung<br />
und Abwicklung hat.<br />
6 Logistik<br />
Die Lieferung an Werkstätten/Einzelhändler<br />
und Endverbraucher erfordert eine<br />
ganz andere Logistik als die herkömmliche
40<br />
Bilstein-Stoßdämpfer über www.Bilstein.de<br />
an Großhändler und Automobilhersteller.<br />
Letztere bekommen ihre Waren auf Paletten<br />
in großen Gebinden. Häufig werden die<br />
Waren in automatisierten Lägern gelagert<br />
und dort auf Paletten zusammengestellt,<br />
um die Lkws komplett zu beladen und<br />
abzuschicken. Das Grundprinzip baut auf<br />
voll beladene Lastwagen auf, um die Logistikkosten<br />
niedrig zu halten. Das gleiche<br />
Grundprinzip lässt sich auf die vielen kleinen<br />
Lieferungen an Werkstätten/Einzelhändler<br />
und Endverbraucher jedoch nicht<br />
anwenden. Hier gehen kleine Mengen an<br />
den Kunden mit einem hohen Zeitdruck.<br />
Die Ware muss am nächsten Tag beim<br />
Kunden sein – egal in welcher Menge. Die<br />
Erfahrung anderer Firmen im E-Commerce<br />
zeigt, dass der Versand der kleinen Mengen<br />
aus dem herkömmlichen Lager für Großmengen<br />
nicht funktioniert. Krupp Bilstein<br />
hat daher aus der Erfahrung dieser Firmen<br />
gelernt und einen Logistikdienstleister ausgesucht,<br />
der die Teile selbst vorrätig lagert<br />
und den Versand mit Express-Speditionen<br />
wie DPD, UPS durchführt. Wenn der Kunde<br />
bis 17 Uhr bestellt, hat er seine Waren am<br />
nächsten Tag oder gegen eine Beteiligung<br />
am nächsten Morgen bis 8 Uhr – garantiert.<br />
7 Der Bilstein Shop in Ennepetal<br />
als Test<br />
Der Bilstein Shop im Werk in Ennepetal<br />
bei Wuppertal, in dem selbst Kunden und<br />
ThyssenKrupp Mitarbeiter (zu den günstigen<br />
Mitarbeiterrabatten) bedient werden,<br />
ist das Testzentrum für den Internetauftritt.<br />
Dort werden in der Werkstatt die neuen<br />
Abläufe und Werkzeuge getestet, bevor die<br />
Auftritte und Lösungen für alle Kunden freigeschaltet<br />
werden (Bild 7).<br />
Dies ist für Krupp Bilstein eine einzigartige<br />
Möglichkeit, Fehler im Vorfeld auszu-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Der Bilstein-Shop als Nucleus (Bild 7)<br />
schließen und auch praktische Erfahrungen<br />
mit den Kunden und ihren Wünschen zu<br />
sammeln.<br />
8 Krupp Bilsteins Internetauftritt<br />
für neue Mitarbeiter<br />
Das Internet hat bei Krupp Bilstein im<br />
Bereich der Personalsuche und Einstellung<br />
bereits erfolgreich Einzug gehalten. Der<br />
Auftritt wurde bewusst im Sinne der Krupp<br />
Bilstein-Werte gestaltet. Die Startseite<br />
spricht den Teamgedanken, Sportlichkeit<br />
und Hochleistung an. Im weiteren Verlauf<br />
bekommt der Interessent Informationen<br />
über die Krupp Bilstein-Organisation, das<br />
Entwicklungsprogramm für junge Mitarbeiter<br />
mit Potenzial (JUMP) sowie den Auswahlprozess<br />
und Bilder vom Krupp Bilstein-<br />
Event am Hockenheimring – Bilstein-Menschen<br />
zum Anfassen! Hiermit soll dem<br />
Bewerber transparent gemacht werden,<br />
welche Kultur ihn bei Krupp Bilstein empfängt<br />
und wie seine Bewerbung oder seine<br />
Karriere bei Krupp Bilstein verlaufen kann.<br />
9 Zeitplanung des Auftritts<br />
Krupp Bilstein verfolgt eine höchst innovative<br />
Internetlösung, da diese die Handelsstufe<br />
Werkstatt/Einzelhändler und auch<br />
Endverbraucher direkt anspricht, ohne<br />
dabei die Zwischenhändler zu verlieren.<br />
Teile des neuen Auftrittes wie der Personalbereich<br />
sind schon online, während die<br />
anderen Module ab Juni 2001 Stück für<br />
Stück umgesetzt werden. Der neue Auftritt<br />
soll in seiner kompletten Funktionalität im<br />
Dezember online sein, sodass alle Kunden<br />
– Werkstätten, Händler, Endverbraucher,<br />
Automobilfirmen, Lieferanten, Bewerber,<br />
Interessierte – darauf zugreifen und ihre<br />
Bedürfnisse stillen können – egal ob kaufen,<br />
Spaß haben oder sich informieren.<br />
Das Wichtigste ist: Die Besucher behalten<br />
Krupp Bilstein als kompetenten Partner im<br />
Hinterkopf und entscheiden sich beim<br />
nächsten Stoßdämpferkauf – natürlich – für<br />
Krupp Bilstein.
41<br />
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Arndt Birkert,<br />
Dipl.-Ing. Sven Leonhardt,<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
Prozessdatenbank<br />
Kalibrieren<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Klaus Truetsch,<br />
Dipl.-Ing. Ralf Sünkel<br />
Wissensspeicher<br />
Hydroforming<br />
Vertriebsdatenbank<br />
Literaturdatenbank Materialdatenbank<br />
Module des Wissensspeichers Hydroforming (Bild 1)
42<br />
1 Einleitung<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
Die wirkmedienbasierte Umformung,<br />
speziell das Innenhochdruck-Umformen,<br />
zählt mittlerweile zu den etablierten Verfahren<br />
der Blechumformung und wird zunehmend<br />
als wirtschaftliche Alternative zu konventionellen<br />
Fertigungsverfahren wie dem<br />
Tiefziehen angesehen.<br />
Nach wie vor steigt die Zahl der Anwendungen<br />
dieser innovativen Technologie<br />
rasant an, wobei sich als wachstumshemmende<br />
Faktoren der Mangel an qualifiziertem<br />
Personal und das Fehlen von Erfahrungswissen<br />
erweisen.<br />
Neben der Verwaltung und Bereitstellung<br />
technischer Prozessdokumentationen spielt<br />
beim Hydro-Umformen die Nutzung von<br />
Erfahrungswissen eine wesentliche Rolle in<br />
der Optimierung des Planungsvorgangs.<br />
Diese Optimierung ist unerlässlich, wenn<br />
die anspruchsvollen Ziele bei der Reduzierung<br />
der Durchlaufzeit und der Bauteilqualität<br />
erreicht werden sollen.<br />
Um diese Ziele zu verwirklichen, wurde<br />
von der Krupp Drauz GmbH das Projekt<br />
„Wissensspeicher Hydroforming“ initiiert,<br />
das im Folgenden kurz vorgestellt wird.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
2 Konzept des „Wissensspeichers<br />
Hydroforming“<br />
Da das Wissen, welches bei der Durchführung<br />
der unterschiedlichsten Projekte<br />
gesammelt wird, sich im Allgemeinen nicht<br />
in feste Regeln fassen lässt, wird ein<br />
System benötigt, welches die Erfahrungswerte<br />
sinnvoll erfassen und miteinander<br />
verbinden kann.<br />
Die Erfahrungswerte können in folgender<br />
Form vorliegen:<br />
● Texte<br />
Prozesskette eines IHU-Bauteils (Quelle: ULSAC-Projekt) (Bild 2)<br />
● Zeichnungen und Fotos<br />
● Formulare und Protokolle<br />
● Simulationsergebnisse<br />
usw.<br />
Diese Daten müssen in das System eingegeben<br />
werden können, und es muss<br />
möglich sein, gezielt nach bestimmten<br />
Attributen (z.B. Werkstoffe, Geometrien<br />
und Verfahren) zu suchen. Des Weiteren<br />
soll es möglich sein, Inhalte des Wissensspeichers<br />
in Vertriebspräsentationen zu<br />
übernehmen.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu<br />
werden, gliedert sich das System in die vier<br />
Module<br />
● Prozessdatenbank,<br />
● Materialdatenbank,<br />
● Vertriebsdatenbank,<br />
● Literaturdatenbank,<br />
welche alle miteinander verknüpft sind.<br />
2.1 Prozessdatenbank<br />
Die Prozessdatenbank bildet die Basis<br />
des Systems. Mit diesem Modul ist es<br />
möglich, anhand der eingesetzten Prozessschritte<br />
die Herstellung eines Bauteils vollständig<br />
zu beschreiben. Ausgangspunkt ist<br />
dabei die Prozesskette, welche die einzelnen<br />
Schritte der Bauteilherstellung enthält.<br />
In Bild 2 ist beispielhaft die Prozesskette<br />
eines Bauteils (ULSAC-Studie) dargestellt.<br />
In der Prozessdokumentation gibt es zu<br />
jedem einzelnen Prozessschritt ein Datenblattmodell,<br />
in dem alle relevanten Daten<br />
allgemeiner Natur und für den jeweils<br />
untersuchten Prozessschritt zur untersuchten<br />
Position aufgenommen werden. Außerdem<br />
enthalten die Datenblätter Bereiche<br />
für Grafiken und Fotos zur Visualisierung<br />
relevanter Daten. In Bild 3 ist ein Beispiel<br />
eines solchen Datenblatts für den Prozessschritt<br />
„Kalibrieren“ dargestellt.<br />
Es ist möglich, die gesamte Prozesskette<br />
eines Bauteils für die Prozessbeschreibung<br />
in relevanten Schritten zu durchlaufen und<br />
so die Auswirkungen der einzelnen Prozessschritte<br />
auf bestimmte Bauteilmerkmale<br />
(wie z.B. die Wanddickenverteilung) zu<br />
betrachten. Dies erleichtert es auch dem<br />
fachfremden Interessierten, die umformtechnischen<br />
Zusammenhänge zu begreifen<br />
und auf ähnliche Prozessketten und Bauteile<br />
zu übertragen. Ferner sind Bauteilfehler,
43<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
Prozessdatenbank, Beispiel eines Datenblatts (Bild 3)<br />
wie Oberflächenbeschaffenheit, Faltenbildung,<br />
Einschnürung, beschrieben.<br />
Wichtig bei der Gestaltung der Datenblätter<br />
ist die Beschränkung auf die wichtigsten<br />
prozessrelevanten Parameter, um eine aus-<br />
Materialdatenbank, Beispiel eines Werkstoffdatenblatts (Bild 4)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
reichende Übersichtlichkeit der Datenblätter<br />
zu gewährleisten. Zusätzliche Informationen<br />
können zum Teil in den anderen Modulen<br />
des Wissensspeichers abgelegt werden. So<br />
können z.B. weitere Werkstoffparameter<br />
wie Fließkurven oder Ähnliches im Modul<br />
„Materialdatenbank“ abgelegt werden. Da<br />
die Module untereinander verknüpft sind,<br />
ist es ohne Probleme möglich, die ausführlichen<br />
Werkstoffparameter für den betreffenden<br />
Werkstoff mittels Aufruf des entsprechenden<br />
Materialdatenblatts aus dem<br />
Modul „Prozessdatenbank“ heraus anzeigen<br />
zu lassen.<br />
Hierdurch wird eine Anwenderfreundlichkeit<br />
erreicht, durch die gewährleistet wird,<br />
dass das System auch möglichst häufig<br />
eingesetzt und gepflegt wird.<br />
2.2 Materialdatenbank<br />
Bei der Herstellung eines Bauteils durch<br />
Hydro-Umformen spielt die Wahl des richtigen<br />
Halbzeugs eine entscheidende Rolle in<br />
Bezug auf die Bauteilqualität. Mit dem<br />
Materialdatenbankmodul ist die Möglichkeit<br />
eines schnellen Zugriffs auf allgemeine und<br />
spezielle Werkstoffinformationen gegeben.<br />
Diese sind in Form von Werkstoffdatenblättern<br />
abgelegt. Dadurch wird man in die<br />
Lage versetzt, schon zu einem sehr frühen<br />
Projektstadium, bei dem noch keine Prototypen-<br />
oder Simulationsergebnisse vorliegen,<br />
einen für den jeweiligen Anwendungsfall<br />
geeigneten Werkstoff auszuwählen.<br />
Dies reduziert die Anzahl der erforderlichen<br />
Änderungsschleifen sowohl bei der Durchführung<br />
von Simulationen als auch beim<br />
Prototyping.<br />
Zusätzlich zu den Werkstoffkennwerten<br />
müssen Grafiken, insbesondere in der<br />
Form von Fließkurve und Grenzformänderungsdiagramm,<br />
eingebunden werden können.<br />
Ein Beispiel für ein Werkstoffdatenblatt<br />
zeigt Bild 4.
44<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
2.3 Vertriebsdatenbank<br />
Qualitativ hochwertige, aussagefähige<br />
und technisch fundierte Präsentationen im<br />
Themenbereich Hydroforming zu erstellen,<br />
erfordert in der Regel viel Zeit und die Einbeziehung<br />
mehrerer Mitarbeiter, die über<br />
das entsprechende Expertenwissen verfügen.<br />
Aus diesem Grund entstand die Überlegung,<br />
mit Hilfe der Informationen aus<br />
dem „Wissensspeicher Hydroforming“ auf<br />
einfache und schnelle Weise Vertriebsdatenblätter<br />
zu erstellen, mit denen die Vertriebsmitarbeiter<br />
beim Kunden vor Ort verfahrenstechnischeKonstruktionsanforderungen<br />
und umformtechnische Möglichkeiten<br />
erläutern können. Des Weiteren kann<br />
unter Verweis auf ähnliche in der Vergangenheit<br />
durchgeführte Projekte dargestellt<br />
werden, was derzeit mit dem Stand der<br />
Technik machbar ist. Hierdurch wird der<br />
Vertrieb in die Lage versetzt, schon zu<br />
einem sehr frühen Anfragezeitpunkt (am<br />
besten schon beim ersten Kundenkontakt)<br />
den Kunden bestmöglich und in vertrauensbildender<br />
Art und Weise zu beraten.<br />
In Bild 5 sieht man einen Auszug aus<br />
einem mehrseitigen Vertriebsdatenblatt.<br />
2.4 Literaturdatenbank<br />
In der Literaturdatenbank (Bild 6) werden<br />
unterschiedliche Informationen verwaltet,<br />
welche in bestimmte Hauptbereiche, wie<br />
Veröffentlichungen, Versuchsberichte, wissenschaftliche<br />
Texte, technische Informationen,<br />
Patente, Firmeninformationen usw.,<br />
unterteilt werden. Damit die gewünschten<br />
Informationen auch schnell gefunden werden,<br />
ist dieses Modul mit einer intelligenten<br />
Suchmaschine verknüpft. Als Beispiel hierfür<br />
wäre die Internet-Suchmaschine „Google“<br />
zu nennen. Hierdurch ist es möglich,<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Vertriebsdatenbank, Beispiel eines Vertriebsdatenblatts (Quelle: ULSAC-Projekt) (Bild 5)<br />
sich durch Eingabe bestimmter Suchbegriffe,<br />
welche mit einer beliebigen Anzahl von<br />
Nebenbegriffen über logische Verknüpfungen<br />
erweitert werden können, gezielt Informationen<br />
aus dem „Wissensspeicher<br />
Hydroforming“ zu beschaffen.<br />
Struktur der Literaturdatenbank (Bild 6)<br />
Um veröffentlichte Texte ohne Zugriff auf<br />
die entsprechende Datei sinnvoll und<br />
schnell in das System übernehmen zu können,<br />
muss eine Möglichkeit gegeben sein,<br />
diese Texte einzuscannen und über eine<br />
geeignete OCR-Software in den „Wissens-
45<br />
Wissensspeicher Hydroforming<br />
speicher Hydroforming“ einzupflegen.<br />
Alle eingepflegten Texte sollten sowohl<br />
als Office-Dokumente als auch im HTML-<br />
Format auslesbar beziehungsweise editierbar<br />
sein. Dies ist insbesondere für das<br />
Modul „Vertriebsdatenbank“ erforderlich,<br />
damit hier in bedienerfreundlicher Art und<br />
Weise Texte übernommen werden können,<br />
ohne dass ein großer Aufwand zur Nachbearbeitung<br />
erforderlich ist.<br />
Systemarchitektur (Bild 7)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
3 Systemarchitektur und<br />
Umsetzung<br />
Der „Wissensspeicher Hydroforming“<br />
wird derzeit als Windows 9x/NT/2000basiertes<br />
System erstellt. Die Eingabe<br />
erfolgt hier über eine speziell dafür programmierte<br />
Software, wobei die Daten und<br />
Informationen in einer Datenbank hinterlegt<br />
sind. Gleichzeitig ist die Datenbank mit<br />
einem Webserver gekoppelt, welcher die<br />
Ausgabe steuert, demzufolge die Ausgabe<br />
im HTML-Format erfolgt. Dies bedeutet<br />
wiederum, dass auf allen Rechnern, auch<br />
UNIX- und Macintosh-Systemen, welche für<br />
die Ausgabe der Informationen berechtigt<br />
sind, ein Browser der 4. Generation mit<br />
eingeschalteter Javascript-Funktion installiert<br />
sein muss. Das von Krupp Drauz eingesetzte<br />
Konzept ist in Bild 7 visualisiert.<br />
Die Entscheidung, das HTML-Format als<br />
Ausgabemedium einzusetzen, ist erstens<br />
auf die zunehmende Verbreitung des Internets<br />
und zweitens auf die zukünftig konzernweite<br />
Nutzung des Systems, wo die<br />
Informationen im Intranet zur Verfügung<br />
stehen werden, zurückzuführen. Bei der<br />
Programmierung der System-Software<br />
wurde großer Wert auf Benutzerfreundlichkeit<br />
gelegt. Die Benutzung des Systems<br />
sowohl bei der Eingabe als auch bei der<br />
Ausgabe soll selbsterklärend sein. Derzeit<br />
wird der Prototyp des Systems bei Krupp<br />
Drauz an einem Arbeitsplatz eingesetzt und<br />
auf seine Tauglichkeit für den täglichen Einsatz<br />
geprüft.<br />
4 Ausblick<br />
Nach Fertigstellung des „Wissensspeichers<br />
Hydroforming“ wird das System allen<br />
Firmen des ThyssenKrupp Konzerns, welche<br />
Hydroforming praktizieren, über Intranet<br />
zur Verfügung gestellt werden. Diese<br />
können damit die von ihnen durchgeführten<br />
Projekte dokumentieren. Somit können<br />
die im System gespeicherten Informationen<br />
von allen Teilnehmern bei der Entwicklung<br />
neuer Bauteile vorteilhaft genutzt werden.
46<br />
Edith Ludescher,<br />
Armin Baumann,<br />
Hans Giger,<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen via Internet bei<br />
Krupp Presta<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Peter Laukas,<br />
Ivo Solèr,<br />
Dieter Thelen<br />
Von der Artikelsuche zur Bestellung (Bild 1)
47<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen via Internet bei Krupp Presta<br />
1 Ausgangssituation<br />
Am Freitag Nachmittag um 17:30 Uhr<br />
informiert bei Krupp Presta (KPR) der Leitstand<br />
die Instandhaltung über einen<br />
Maschinenschaden: Produktionsstillstand<br />
droht. Zur Reparatur wird ein Teil benötigt,<br />
das im Lager nicht auf Vorrat liegt. Alle Einkäufer<br />
befinden sich bereits im Wochenende,<br />
ebenso die Ansprechpartner beim<br />
Lieferanten/Händler.<br />
In der Not wird die Besorgung des Teils<br />
über das Internet in die Wege geleitet.<br />
Nach 15 Minuten gezielter Suche wird ein<br />
Anbieter gefunden, der in seinem Katalog<br />
das benötigte Teil führt, einen Lagerbestand<br />
anzeigt und anbietet, eine elektronisch<br />
erteilte Bestellung innerhalb von zwei<br />
Stunden auszuführen. Sogar die Expresszustellung<br />
ist im Angebot enthalten. Das<br />
Teil wird bestellt. Nach pünktlichem Eintreffen<br />
wird das Teil umgehend eingebaut und<br />
damit das Risiko eines Bandstillstands<br />
beim Kunden vermieden.<br />
Am Montag Morgen werden die zuständigen<br />
Stellen über die Umgehung sämtlicher<br />
Vorschriften zu einem geordneten Einkauf<br />
mit Bedarfsmeldung, mindestens drei<br />
Angeboten, Kaufentscheidung, Bestellung,<br />
Lieferung, Wareneingangsbuchung etc.<br />
informiert.<br />
Diese Situation, wenn auch gestellt, spiegelt<br />
nur allzu deutlich die Nöte und unterschiedlichen<br />
Prioritäten innerhalb der<br />
gesamten Versorgungskette wider. In<br />
einer nicht vernetzten Abwicklung versucht<br />
jede beteiligte Funktion ohne Rücksicht auf<br />
vor- und nachgelagerte Bereiche, für sich<br />
die optimale Lösung zu realisieren. Zielkonflikte<br />
sind vorprogrammiert.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
2 Die Projektidee<br />
Im Zuge der in mehreren Stufen durchgeführtenBestandsoptimierungen/-reduktionen<br />
verlagerte sich die Tätigkeit der am<br />
gesamten Beschaffungsprozess beteiligten<br />
Mitarbeiter immer mehr in Richtung Terminsicherung.<br />
Ein dem ursprünglichen<br />
Gedanken folgender kostenoptimaler Einkauf<br />
war in der Folge aus Zeitmangel nicht<br />
mehr durchführbar.<br />
Das Ziel war die Trennung des strategischen<br />
Teils des Einkaufs mit Ausschreibungen,<br />
Vergabeverhandlungen und Konditionenfestlegung<br />
vom eigentlichen Beschaffungsvorgang.<br />
Wichtig ist in diesem<br />
Zusammenhang das klare Bewusstsein des<br />
Einkaufs, seine Rolle als Dienstleister zu<br />
den betriebsinternen Kunden neu zu definieren<br />
und das Leistungsangebot entsprechend<br />
anzupassen. Darin sind alle von den<br />
Tätigkeiten eines Beschaffungsvorgangs<br />
betroffenen Kollegen von der Instandhaltung<br />
über das Lager bis hin zum Wareneingang<br />
und der Buchhaltung eingeschlossen.<br />
Prozessbeteiligte (Bild 2)<br />
Weiterhin sollten die rapide zunehmenden<br />
Möglichkeiten des elektronischen Einkaufs<br />
einbezogen werden.<br />
3 Prozessanalyse<br />
3.1 Zeitaufwand der Bestellabwicklung<br />
Entsprechend dem klassisch festgelegten<br />
Beschaffungsablauf wurde bisher bei<br />
KPR jeder Materialeinkauf mit einer separaten<br />
Bestellung oder einem Abruf auf einen<br />
Rahmenvertrag mit dem für jeden einzelnen<br />
Artikel festgelegten Lieferanten durchgeführt.<br />
Dem schlossen sich die gesamten<br />
folgenden Buchungsvorgänge an. Ebenso<br />
klassisch erfolgte die Bestandsführung<br />
innerhalb des vorgegebenen Bewirtschaftungssystems<br />
(SAP R/3) mittels min/max-<br />
Beständen in Abhängigkeit der Wiederbeschaffungszeit<br />
jedes Artikels (Bild 2).
48<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen via Internet bei Krupp Presta<br />
3.2 Prozesskosten<br />
Diese Analyse führte am Beginn zu einer<br />
sehr umfangreichen Diskussion über Inhalte<br />
und Messgrößen. Letztlich spielt dies<br />
jedoch überhaupt keine Rolle, wenn Klarheit<br />
darüber besteht, den Ist-Zustand und<br />
den nach Realisierung erreichten Status<br />
mit den genau gleichen Kriterien zu messen<br />
und zu bewerten. Nach dem bei KPR<br />
festgelegten Umfang ergab sich somit ein<br />
erhebliches Potenzial zur Senkung der operativen<br />
Kosten (Bilder 3 und 4).<br />
3.3 Materialkosten<br />
Eine stichprobenartige Auswertung der<br />
Artikel auf ihre preisliche Optimierung<br />
ergab zumindest bei den Umsatzträgern<br />
keine nennenswerten Möglichkeiten. Allerdings<br />
zeigte die Analyse Ansätze, die zu<br />
der Entscheidung führten, bei Umsetzung<br />
des Konzepts den Bedarf auf Lieferanten,<br />
die sich als Vollsortimenter anbieten, zu<br />
bündeln. Die mögliche Einsparung über die<br />
Prozesskosten sollte eventuelle preisliche<br />
Nachteile auf Artikelebene überwiegen<br />
(Bild 5).<br />
4 Die Lösung<br />
4.1 Bedarfsbündelung<br />
Das gesamte Paket beinhaltet Artikel und<br />
Material, welche nicht systemtechnisch<br />
innerhalb der bestehenden SAP-Lösung<br />
dispositiv bewirtschaftet werden müssen.<br />
Absteigend nach ihrer Umsatzbedeutung<br />
wurde für jede Warengruppe ein passender<br />
Lieferant ausgewählt, der die Kriterien der<br />
preislichen Attraktivität und vor allem die<br />
Bereitschaft der elektronischen Abwicklung<br />
via Internet erfüllt.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Auszug aus der Prozessanalyse (Bild 3)<br />
Das Sortiment dieser Lieferanten, sei es<br />
KPR-spezifisches Material oder Katalogware,<br />
wird in einem gesamten Katalog<br />
zusammengefasst.<br />
4.2 Bestellabwicklung<br />
Die Analyse der Prozesskosten wies in<br />
diesem Bereich die wirklichen Kostentreiber<br />
aus. Das Konzept sieht eine vereinfachte<br />
Abwicklung mit den über die Bedarfsbündelung<br />
definierten Lieferanten vor. Zur Vereinfachung<br />
des Bestellvorgangs wurden<br />
sämtliche Lagerfächer mit Barcode-Etiketten<br />
versehen. Hierauf sind alle für eine<br />
Bestellung notwendigen Daten gespeichert.<br />
Mittels einer mobilen Scanner-Einheit lassen<br />
sich die bedarfsrelevanten Daten erfas-<br />
sen, an einem Terminal auslesen und<br />
direkt in einen Bestellvorgang umwandeln.<br />
Die Bestellungen erfolgen auf Lagerebene<br />
täglich lieferantenunabhängig als Sammelbestellung<br />
an einen Provider (siehe auch<br />
4.3). Dort erfolgt die Auflösung auf die<br />
jeweiligen Lieferanten. Diese wiederum liefern<br />
innerhalb der vereinbarten Lieferfristen<br />
direkt bei KPR an. Die Lieferung ist entsprechend<br />
gekennzeichnet und passiert<br />
ohne speziellen Buchungsvorgang den<br />
Wareneingang in Richtung Besteller. An<br />
dieser Stelle erfolgt der Abgleich mit der<br />
Bestellung und die Ware wird eingelagert<br />
bzw. sofort an den endgültigen Empfänger<br />
ausgeliefert (Bild 6).<br />
Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur<br />
Senkung der Abwicklungskosten kommt
49<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen via Internet bei Krupp Presta<br />
aus dem Bereich der Rechnungsabwicklung.<br />
Wurde bis dahin zu jeder Bestellung<br />
eine Rechnung verarbeitet, ca. 26.000 pro<br />
Jahr, kann durch die Einschaltung des Providers<br />
jetzt mit einer monatlichen Sammelrechnung<br />
abgerechnet werden. Diese läuft<br />
zudem auf elektronischem Wege ein. Es<br />
erfolgt kein Abgleich mit dem Bestellsystem,<br />
da in einem vollelektronischen<br />
Abwicklungssystem von Zahlensicherheit<br />
ausgegangen werden kann. Stichprobenartige<br />
Rechnungsüberprüfungen stellen die<br />
korrekte Abrechnung des Providers mit KPR<br />
sicher. Selbst unter Inkaufnahme eines<br />
möglichen Abrechnungsfehlers ist diese<br />
Form der Abwicklung immer noch kostengünstiger<br />
(Bild 7).<br />
4.3 Einbindung eines externen<br />
Providers<br />
Die geplante Abwicklung via Internet<br />
konnte zum Zeitpunkt der Realisierung nur<br />
mit einem externen Provider dargestellt<br />
werden. Dieser Partner stellt das Bindeglied<br />
für die Anbindung zwischen KPR<br />
und den ausgewählten Lieferanten dar. Auf<br />
Basis der von KPR mit jedem Lieferanten<br />
vereinbarten Rahmenbedingungen werden<br />
Einkaufsvolumen (Bild 5)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Kostentreiber (Bild 4)<br />
dessen Daten als Katalog in das System<br />
eingebunden. Die Datenpflege und jeweilige<br />
Aktualisierung obliegt dem Lieferanten<br />
in Zusammenarbeit mit dem Provider.<br />
4.4 Kosten-Nutzen-Betrachtung<br />
Die Abwicklungsgebühren des Providers<br />
werden auf Basis der seitens KPR abgesetzten<br />
Online-Bestellungen mengenbezogen<br />
verrechnet und in die monatliche Sammelrechnung<br />
einbezogen. Diese Gebühren<br />
werden durch die realisierten Einsparungen<br />
aus dem verschlankten Prozess und den<br />
reduzierten Lagerbeständen weit überkompensiert.<br />
Mit diesem gewählten Ablauf können<br />
die Kunden = Bedarfsträger ohne Zeitverlust<br />
direkt über den Provider bei den<br />
festgelegten Lieferanten zu den fest vereinbarten<br />
Konditionen einkaufen. Dies führt zu<br />
erheblichen Reduzierungen der Lagerbestände<br />
bei gleichzeitiger Beschleunigung<br />
der Bestell- und Lieferabwicklung. Die Verantwortung<br />
für die Bewirtschaftung und<br />
Bestellabwicklung liegt jetzt ohne Schnittstelle<br />
in einer Hand beim Bedarfsträger. Die<br />
hiermit verbundene Wahrnehmung der
50<br />
Bestellablauf (Bild 6)<br />
Auftragspapiere (Bild 7)<br />
Organisiertes dezentrales Einkaufen via Internet bei Krupp Presta<br />
Selbstverantwortung führt zur Steigerung<br />
der Motivation und damit ressourcenschonendem<br />
Umgang mit den zur Verfügung<br />
stehenden Mitteln.<br />
5 Ausblick auf die weitere<br />
Entwicklung<br />
Die Entwicklung der B2B-Programme zur<br />
Nutzung des Internets macht es mittlerweile<br />
möglich, auch aus dem implementierten<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
SAP-Programm heraus via Intranet/Internet<br />
Bestellungen an eingebundene Lieferanten<br />
zu übertragen. Mit dem kürzlich durchgeführten<br />
Release-Wechsel ergibt sich die<br />
Chance, die aus den Barcode-Informationen<br />
generierten Bestelldaten künftig innerhalb<br />
SAP zu nutzen. Damit würde der<br />
Umweg über einen externen Provider<br />
unnötig. Die ersten Feldversuche hierzu<br />
werden ab Juli 2001 beginnen.<br />
6 Fazit<br />
Der Schlüssel zum Erfolg war die klare<br />
Trennung des Bestellwesens in einen strategischen<br />
Einkaufsteil mit Lieferanten- und<br />
Konditionenfestlegung, losgelöst vom<br />
einem aktuellen Bedarfsfall, und die Übertragung<br />
der Verantwortung für den operativen<br />
Teil auf den Bedarfsträger. Diese Philosophie<br />
ist allerdings nicht beschränkt auf<br />
eine Internet-basierte Beschaffung von C-<br />
Teilen. Sie lässt sich ohne große Schwierigkeiten<br />
auf alle Arten der einzukaufenden<br />
Warengattungen und vor allem auch auf<br />
Dienstleistungen übertragen.
51<br />
Dipl.-Ing. HTL Siegfried Dejaco<br />
Die neue, modulare Lenksäule von Krupp Presta<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Modulare Lenksäule von Krupp Presta (Bild 1)
52<br />
Die neue, modulare Lenksäule von Krupp Presta<br />
1 Ausgangssituation<br />
Krupp Presta (KPR) wurde beauftragt,<br />
eine modulare Lenksäule für die Ford C1-<br />
Plattform zu entwickeln. Diese Plattform<br />
wird voraussichtlich im Jahre 2003 in Serie<br />
gehen. Sie gehört zur Basis für die Weiterentwicklung<br />
des Ford Focus und für die<br />
Volvo-Modelle V40/S40 und für den Mazda<br />
323.<br />
Die Aufgabenstellung lautete, ein modulares<br />
Lenksystem zu entwickeln, das sich<br />
gleichzeitig für drei Autohersteller höchst<br />
unterschiedlicher Industrie-Kulturen eignet.<br />
Es wird in 24 verschiedenen Automodellen<br />
eingesetzt und gleichzeitig auf den drei<br />
Kontinenten Europa, Asien und Amerika<br />
vertrieben. Der Kunde geht von einem<br />
Bedarf von bis zu zwei Millionen Fahrzeugen<br />
pro Jahr aus (Bild 2).<br />
2 Problemanalyse<br />
Die besondere Herausforderung bestand<br />
in der Erwartung des Kunden, trotz unterschiedlicher<br />
Anforderungen einen höchstmöglichen<br />
Anteil an Gleichteilen zu erzielen<br />
(Bild 3). Auf Basis der von KPR durchgeführten<br />
Querschnittsanalysen wurde die<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Die Herausforderung: Maximaler Gleichteileanteil trotz unterschiedlicher Anforderungen (Bild 3)<br />
Zahl der sich überschneidenden Anforderungen<br />
analysiert. Die Analyse führte zu<br />
dem Ergebnis, dass für ein Sicherheitsbauteil<br />
wie eine Lenksäule die Technologie von<br />
Volvo die geeignetste Ausgangsbasis darstellt.<br />
Überschneidungen mit Ford Focus<br />
und mit Mazda 323 waren vor allem regional<br />
auf den US-Märkten und auf dem japanischen<br />
Markt zu berücksichtigen.<br />
Einerseits wurde die Variante einer<br />
Lenksäule gefordert, die in erster Linie auf<br />
Leistung und Sicherheit ausgerichtet war,<br />
Die Aufgabenstellung: Entwicklung einer modularen Lenksäule für die C1-Plattform von Ford (Bild 2)<br />
Niedriges Kosten-Target Focus + Mazda übrige Welt<br />
● Hohe Sicherheits-Anforderungen Volvo<br />
● Strenge Gesetzes-Richtlinien USA + Japan<br />
● Hohe „Performance“-Ansprüche Volvo + US-Markt<br />
andererseits waren niedrigstmögliche<br />
Kosten die geforderte Zielsetzung: Bei<br />
einem erwarteten Anteil von 75 % Gleichteilen<br />
und identischen Schnittstellen ein<br />
Widerspruch in sich.<br />
3 Problemlösung<br />
Das Problem konnte durch den Ansatz<br />
● Umsetzung eines gemeinsamen inneren<br />
Lenkstrangs für alle Fahrzeuge und<br />
● zwei unterschiedliche Anbindungen an<br />
das Cockpit<br />
gelöst werden.<br />
Kosten optimiert<br />
Performance optimiert<br />
Eine Magnesium-Anbindung führte zu<br />
den leistungsoptimierten Fahrzeugsegmenten<br />
wie Ford Focus (USA), Volvo V40/S40<br />
und Mazda 323 (USA und Japan) (Bild 4).<br />
Für die übrigen Fahrzeugsegmente des<br />
Ford Focus und Mazda 323 (übrige Welt)<br />
entschied sich KPR für eine Stahlblech-<br />
Anbindung mit einem kostenoptimierten<br />
Design. Die nahe liegende Forderung des
53<br />
Die neue, modulare Lenksäule von Krupp Presta<br />
Kunden nach einer modularen Lösung, die<br />
möglichst das ganze Produkte-Spektrum<br />
abdeckt, führte zu entsprechenden Ideen<br />
und Vorschlägen: einerseits zu einem<br />
Design, das auf optimale Leistung ausgerichtet<br />
ist und – zur Gegenüberstellung – zu<br />
einem Design, das die Forderung nach<br />
möglichst niedrigen Kosten berücksichtigt.<br />
Damit waren die modularen Plattformziele<br />
von C1 im Grunde genommen erreicht.<br />
Einer Umsetzung derselben für den Ford<br />
Focus, den Volvo V40/S40 und den Mazda<br />
323 stand nichts mehr im Wege.<br />
4 Ergebnis<br />
Dass dies der richtige Lösungsweg war,<br />
wurde kurze Zeit später von Ford bestätigt.<br />
KPR wurde aufgefordert, diese Ideen weiterzuentwickeln,<br />
um sie auch für die Plattformen<br />
des Ford Taurus und des Ford<br />
Mustang anwendbar zu machen. Da es<br />
sich dabei um Plattformen handelt, die<br />
gemäß Vereinbarungen von Ford mit den<br />
Gewerkschaften zur Arbeitsplatzsicherung<br />
„in house“ zu fertigen sind, hieß es nun,<br />
Das Entwicklungsergebnis: Maximale Modularität (Bild 5)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Die Problemlösung: 1 Lenkstrang / 2 Anbindungen (Bild 4)<br />
Performance optimiert<br />
Ford Focus<br />
US<br />
eine Krupp Presta-Lenksäule zu entwickeln,<br />
die von Ford selbst gefertigt werden konnte.<br />
Es galt, das Design der modularen Lenksäule<br />
an die Lohnfertigung bei Ford anzupassen<br />
(Bild 5).<br />
Als besonderer Erfolg ist zu werten, dass<br />
auch dieser weitergehende Teil der Herausforderung<br />
an die Entwicklung der modula-<br />
Erweiterung der<br />
modularen Idee<br />
in Ford<br />
gewerkschaftsgesicherte<br />
Plattformen<br />
Volvo V40/S40<br />
US+übrige Welt<br />
Krupp Presta erbrachte Dienstleistung am Kunden durch maximale<br />
Modularität!<br />
Mazda 323<br />
US+Japan<br />
Ford Focus<br />
übrige Welt<br />
Kosten optimiert<br />
Mazda 323<br />
übrige Welt<br />
ren C1-Lenksäule gelöst und damit zwei<br />
Ziele zugleich erreicht werden konnten:<br />
● Erhalt von Arbeitsplätzen beim Kunden<br />
Ford und<br />
● direkte Lieferung eines konkurrenzfähigen<br />
Bauteils aus der Fertigung von<br />
Krupp Presta.<br />
Vom Kunden wurde besonders anerkannt,<br />
dass sein Zulieferer Krupp Presta in<br />
der Lage war, aus einem Entwicklungsauftrag<br />
zusätzlich eine Dienstleistung zu generieren,<br />
die ihm bei der Suche nach Problemlösungen<br />
direkt zugute kam.<br />
Für diese Entwicklungsleistung wurde<br />
Krupp Presta mit dem zweiten Preis beim<br />
diesjährigen Innovationswettbewerb des<br />
Thyssen Krupp Konzerns ausgezeichnet.
54<br />
Dipl.-Ing. Jörg Schulz<br />
SerKom – die mobile Kommunikationslösung<br />
für den Servicetechniker<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
SerKom-Koffer (Bild 1)
55<br />
1 Einleitung<br />
Die Unternehmensgruppe Thyssen Aufzüge<br />
hat sich mit einem breiten Fertigungsprogramm<br />
auf die Beförderung von Personen<br />
und Lasten spezialisiert.<br />
Das Fertigungsprogramm beinhaltet die<br />
Herstellung, Planung und Projektierung von<br />
intelligenten Aufzugslösungen, Fahrtreppen<br />
und -steigen sowie Fluggastbrücken. In<br />
Deutschland unterhält die Thyssen Aufzüge<br />
Deutschland-Gruppe 7 Vertriebs-/Servicegesellschaften<br />
und 3 Produktionsstandorte.<br />
Thyssen Aufzüge beschäftigt ca. 1.100<br />
Servicetechniker bundesweit.<br />
In der heutigen Zeit ist der Service beim<br />
Kunden ein entscheidendes Standbein für<br />
die Unternehmen im harten Wettbewerb.<br />
Im Servicebereich ist es noch möglich,<br />
Wettbewerbsvorteile zu erlangen.<br />
Um die Qualität und Effizienz im Servicegeschäft<br />
zu verbessern, musste etwas<br />
Innovatives getan werden. Unter Effizienz<br />
im Servicegeschäft verstehen wir die<br />
Konzentration des Serviceeinsatzes sowie<br />
kurze Aktivierungs- und Reaktionszeiten<br />
der Servicetechniker beim Kunden.<br />
2 Projekt SerKom<br />
SerKom – die mobile Kommunikationslösung für den Servicetechniker<br />
Der Name „SerKom“ ist ein Kunstwort,<br />
gebildet aus Service und Kommunikation.<br />
Um den Informations- und Datenfluss zu<br />
beschleunigen sowie den Papieraufwand zu<br />
reduzieren, beschloss Thyssen Aufzüge,<br />
neueste Informationstechnologien einzusetzen<br />
und gab jedem Servicetechniker<br />
einen „SerKom-Koffer“ in die Hand (Bild 1).<br />
Dieser Koffer enthält ein Notebook, Drucker<br />
und Handy.<br />
Mit dieser Hardware und der Kommunikationssoftware<br />
„Mobile3“ hat der Servicetechniker<br />
die Möglichkeit, sich direkt vor Ort<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Funktionalitäten mit SerKom (Bild 2)<br />
in das firmeninterne SAP-System einzuklinken<br />
und tagesaktuelle Auftragsdaten hochzuladen,<br />
zu bearbeiten und sofort für die<br />
weitere Bearbeitung, z.B. Fakturierung und<br />
Lohnberechnung, ohne Medienbrüche zeitnah<br />
wieder in das SAP-System zurückzusenden<br />
(Bild 2). Dabei können nicht nur<br />
Service-Techniker bei der Diagnose einer Aufzugsanlage (Bild 3)<br />
auftragsbezogene Daten bearbeitet, sondern<br />
auch nichtauftragsbezogene Daten ins<br />
SAP-System gesendet werden. Neben der<br />
Kommunikationssoftware „Mobile3“ sind<br />
eine Diagnosesoftware für Aufzugsanlagen<br />
und ein elektronischer Ersatzteilkatalog<br />
installiert.
56<br />
SerKom – die mobile Kommunikationslösung für den Servicetechniker<br />
Maske „Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnung“ (Bild 4)<br />
Mit der installierten Diagnosesoftware<br />
hat der Servicetechniker z.B. die Möglichkeit,<br />
Neuanlagen in Betrieb zu nehmen,<br />
Grundeinstellungen vorzunehmen und Fehlerstapel<br />
vor Ort auszudrucken sowie eine<br />
Abfrage des Systemzustandes durchzuführen<br />
(Bild 3).<br />
Der elektronische Ersatzteilkatalog ersetzt<br />
2 dicke und schwere Aktenordner mit ca.<br />
1.000 Seiten, die der Techniker bisher mitführen<br />
musste.<br />
Über vielfältige Such- und Filterfunktionen,<br />
z.B. Teilebenennung, Baugruppenverwendung,<br />
und mit Abfragen nach Bestandteilen<br />
aus erläuterndem Text lassen sich<br />
Ersatzteile in Sekundenschnelle suchen<br />
und finden. Im Unterschied zum bisherigen<br />
Ersatzteilkatalog sind nun Verkaufspreise<br />
im elektronischen Ersatzteilkatalog eingepflegt.<br />
Der Servicetechniker kann auf<br />
Wunsch dem Kunden unproblematisch und<br />
schnell Preisauskünfte für Ersatzteile erteilen,<br />
ohne bei dem jeweiligen Sachbearbeiter<br />
anfragen zu müssen (Bild 4).<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Mobile3 – Auftragsbearbeitung (Bild 5)<br />
3 Kommunikationssoftware<br />
„Mobile3“<br />
Mobile3 ist das Herzstück von SerKom.<br />
Mit dieser Kommunikationssoftware kann<br />
der Servicetechniker seinen gesamten Auftragsbestand<br />
aus dem SAP R/3 laden,<br />
bearbeiten, verwalten und wieder zurücksenden<br />
(Bild 5). Außerdem kann er<br />
nichtauftragsbezogene Daten, z.B. Abwesenheitszeiten,<br />
Urlaubs- und Krankheitstage,<br />
Spesenabrechung etc., erfassen und<br />
für die Lohnberechnung ins SAP R/3<br />
(Modul HR) zurücksenden.<br />
Über einen Gateway kann Mobile3 mit<br />
dem installierten elektronischen Ersatzteilkatalog<br />
kommunizieren und einzelne<br />
Ersatzteile vom Katalog in die Mobile3-<br />
Rückmeldung des Monteurs übertragen.<br />
Auftragsscheine, die der Kunde unterschreibt,<br />
werden aus Mobile3 mit den<br />
bereits erfassten Daten automatisch generiert<br />
und ausgedruckt. Der administrative
57<br />
SerKom – die mobile Kommunikationslösung für den Servicetechniker<br />
Aufwand für den Servicetechniker reduziert<br />
sich dadurch auf ein Minimum.<br />
Die Software wurde in Zusammenarbeit<br />
mit unseren Servicetechnikern erstellt.<br />
Damit haben wir ein Maximum an Bedienerfreundlichkeit<br />
erreicht.<br />
4 Technik<br />
Die Kommunikationssoftware „Mobile3“<br />
ist mit Java und HTML programmiert worden.<br />
Für die Kommunikation wird die Internettechnologie<br />
verwendet (TCP/IP-Protokolle).<br />
Die Auftragsdaten werden über das<br />
GSM-Netz übertragen. Der Servicetechniker<br />
wählt sich per Handy auf einen Router ein,<br />
dieser prüft die Zugangsberechtigung und<br />
leitet dann die Anfrage über einen Server<br />
ins SAP-System. Das SAP-System (SM-<br />
Modul) sucht sich die benötigten Auftragsdaten<br />
zusammen und leitet diese automatisch<br />
über den Server und Router wieder an<br />
das Handy mit angeschlossenem Notebook<br />
zurück. Momentan werden noch 9.600<br />
bit/sec übertragen. Mit der neuen Übertragungstechnik<br />
HSCSD (Kanalbündelung)<br />
von D2 Vodafone lassen sich Übertragungsraten<br />
von ca. 44.000 bit/sec erreichen.<br />
Um Übertragungsgebühren zu sparen,<br />
wurde ein „Short Hold“ installiert, welches<br />
die Verbindung während der Selektion im<br />
SAP R/3 physikalisch trennt. Bei vollständiger<br />
Selektion (bei einer größeren Anfrage,<br />
z.B. Wartungsbestand der letzten 3 Monate,<br />
kann dies mehrere Minuten dauern)<br />
baut der Router über eine Daten-Nr. die<br />
Verbindung automatisch wieder zu dem<br />
User auf und sendet die angeforderten<br />
Daten (Bild 6).<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Schematische Darstellung der Datenübertragung (Bild 6)<br />
5 Realisierte Vorteile<br />
● deutliche Reduzierung der administrativen<br />
Aufgaben des Services-Technikers<br />
(Lohnscheine, Auftragsscheine)<br />
● schnelle Außendienststeuerung und<br />
-planung mit Übertragung aktueller Aufträge<br />
sowie Rückmeldungen<br />
● hohe Flexibilität<br />
● integrierte Diagnosefunktionalitäten<br />
● elektronischer Ersatzteilkatalog, Vorortverkauf<br />
von Ersatzteilen<br />
● keine Papierberge, da z.B. Montageanweisungen,<br />
SRW-Berichte etc. digital<br />
vorliegen<br />
● fortlaufender Zusatznutzen durch neue<br />
Softwarepakete und Funktionszuwächse<br />
der bestehenden Software<br />
● mehr Informationen für den Kunden<br />
durch bessere Auskunftsfähigkeit des<br />
Servicetechnikers<br />
● schnelle Störungs-/Reparaturbehebung<br />
(höhere Verfügbarkeit)<br />
● Ersatzteilbestellung bzw. Erteilung kleinerer<br />
Reparaturaufträge beim Servicetechniker<br />
● keine Medienbrüche, auftragsbezogene<br />
Daten stehen nach Auftragsbearbeitung<br />
durch Servicetechniker sofort für die<br />
Faktura zur Verfügung.<br />
6 Fazit<br />
Der Kundendienst ist ein wichtiger Faktor<br />
zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen.<br />
Thyssen Aufzüge hat mit dem Projekt<br />
SerKom die Vorreiterrolle in der mobilen<br />
Kommunikation in der Aufzugsbranche<br />
übernommen. Dies schafft uns einen klaren<br />
Wettbewerbsvorteil im Kundendienst.<br />
Durch die verbesserte Servicequalität mit<br />
kurzen Aktivierungs- und Reaktionszeiten,<br />
umfassende Informationsmöglichkeiten<br />
gegenüber dem Kunden und Servicetechnikern<br />
sowie eine schnelle und zielsichere<br />
Problemlösung erzeugen wir eine höhere<br />
Kundenzufriedenheit und engere Kundenbindung.
58<br />
Dipl.-Ing. Lothar Jungemann,<br />
Dipl.-Ing. Kurt Lemm,<br />
Dipl.-Ing. Bernd Kripzak<br />
B2B im Großanlagenbau – Vertrieb von Ersatzteilen für Zementwerke<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Vormontierte Laufringstation für einen Drehofen als ein Beispiel für<br />
komplexe, individuell gefertigte Ersatzteile im Großanlagenbau (Bild 1)
59<br />
1 Einleitung<br />
Die Krupp Polysius AG ist ein Unternehmen<br />
der ThyssenKrupp Technologies im<br />
Bereich Engineering und stellt vor allem<br />
Zementwerke, aber auch Anlagen für die<br />
Rohstoffaufbereitung her.<br />
Diese Großanlagen werden sowohl in<br />
ihrer Struktur als auch in ihren Komponenten<br />
individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall<br />
zugeschnitten. Größe und Komplexität<br />
der eingesetzten Komponenten bedingen<br />
ihre individuelle Auslegung.<br />
Nur wenige Anlagenbereiche wie das<br />
automatische Labor zur Qualitätssicherung<br />
in Zementwerken setzen sich aus Standardelementen<br />
zusammen (Bild 2).<br />
Der Vertrieb von Ersatzteilen ist daher<br />
ebenso individuell wie der von Neuanlagen.<br />
Die Anzahl der unterschiedlichen Komponenten<br />
ist im Vergleich zu Serienmaschinen<br />
entsprechend hoch.<br />
Gleichzeitig führt die kontinuierliche Weiterentwicklung<br />
zum Einsatz neuer Lösungen<br />
für bestehende Komponenten.<br />
Großanlagen wie Zementwerke werden in<br />
der ganzen Welt betrieben. Neben der<br />
Sprachenvielfalt schränkt die Zeitverschiebung<br />
oftmals die direkte Kommunikation<br />
zwischen Hersteller und Betreiber ein.<br />
2 B2B im Vertrieb<br />
B2B im Großanlagenbau – Vertrieb von Ersatzteilen für Zementwerke<br />
Der Vertriebsprozess lässt sich allgemein<br />
wie in Bild 3 gezeigt darstellen.<br />
Anhand dieses Modells lassen sich die<br />
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des<br />
B2B (Business-to-Business) im Vertrieb<br />
von Ersatzteilen für den Großanlagenbau<br />
aufzeigen.<br />
Bedingt durch die hohe Komplexität und<br />
Vielfalt der Komponenten ist die technische<br />
Klärung zwischen Betreiber und Hersteller<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
oft sehr langwierig. Hier gilt es, Prozesskosten<br />
durch die Bereitstellung elektronischer<br />
Auswahlmöglichkeiten zu reduzieren.<br />
Bei der kommerziellen Klärung muss<br />
man zwischen Standardteilen (C-Teilen)<br />
und individuell zu kalkulierenden Komponenten<br />
unterscheiden.<br />
Die C-Teile weisen im Großanlagenbau<br />
oft ein Missverhältnis zwischen ihrem Wert<br />
und den eigentlichen Vertriebskosten auf.<br />
Auch hier muss der Prozess entsprechend<br />
standardisiert und automatisiert werden.<br />
Alle größeren Komponenten werden zum<br />
Vorteil für beide Handelspartner individuell<br />
kalkuliert. Die Anforderungen an die kaufmännische<br />
Abwicklung sowohl auf der Hersteller-<br />
wie auf der Betreiberseite reduzieren<br />
hier die Möglichkeiten für B2B. Hier<br />
seien nur einige Probleme genannt wie<br />
interne Genehmigungsverfahren, rechtlich<br />
wirksames Zustandekommen von Verträgen<br />
oder die Bereitstellung von Akkreditiven<br />
und Bürgschaften.<br />
Automatisches Labor (Bild 2)<br />
Die Vielfalt heute bereits eingesetzter<br />
Lösungen im B2B ist im Großanlagenbau<br />
eingeschränkt:<br />
● Öffentliche Marktplätze, an denen verschiedene<br />
Betreiber wie Hersteller partizipieren,<br />
sind für die eigentliche Geschäftsabwicklung<br />
wenig hilfreich. Die nötige<br />
Abstimmung von Betreiber und Hersteller<br />
widerspricht diesem Konzept.<br />
● General E-Catalogues sind übergeordnete<br />
Kataloge, die technisch für C-Teile<br />
sinnvoll sind. Sie bedingen aber durch<br />
die Vielfalt der kommerziellen Konditionen<br />
eine kundenbezogene Zuordnung<br />
der Preise.<br />
● Tailor-made E-Catalogues, also das Zuschneiden<br />
eines Katalogs auf eine Anlage,<br />
bedeutet für den Geschäftsprozess<br />
eine erhebliche Vereinfachung für beide<br />
Seiten. Hier werden nur Teile und Kom-
60<br />
B2B im Großanlagenbau – Vertrieb von Ersatzteilen für Zementwerke<br />
Vertriebsprozess Ersatzteile im Großanlagenbau (Bild 3)<br />
ponenten gezeigt, die in der jeweiligen<br />
Anlage enthalten sind. Für den Betreiber<br />
bedeutet das eine Vereinfachung der<br />
Auswahl der Teile. Für den Hersteller ist<br />
die Eindeutigkeit in der Zuordnung ebenfalls<br />
hilfreich, wobei man allerdings den<br />
Aufwand für die Erstellung eines individuellen<br />
Kataloges berücksichtigen muss.<br />
● Einzelanfragen sind der Regelfall im Vertrieb<br />
von Ersatzteilen für den Anlagenbau.<br />
Hier bietet die Umstellung auf elektronische<br />
Medien wesentliche Verbesserungen<br />
in Bezug auf Schnelligkeit und<br />
Informationsdichte der Antworten. So<br />
können z.B. digitale Fotos, Zeichnungen<br />
oder Animationen an E-Mails gehängt<br />
werden.<br />
3 B2B-Lösungen der Krupp<br />
Polysius AG<br />
Öffentliche Marktplätze werden derzeit<br />
lediglich als Informationsmedium genutzt.<br />
Kunden können hier allgemein einen Eindruck<br />
über die Krupp Polysius AG gewinnen,<br />
sich aber auch über entsprechende<br />
Links gezielte Informationen über Einzelprodukte<br />
oder Referenzen holen. Da es sich<br />
hier nur um Akquisitionsunterstützung handelt,<br />
kann man eigentlich noch nicht von<br />
B2B sprechen.<br />
General E-Catalogues werden im Online-<br />
Shop der Krupp Polysius AG für diverse<br />
Lager- und Standardprodukte genutzt. Als<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Beispiel wird hier der Online-Shop für die<br />
Laborautomation erläutert.<br />
Alle Teile der Laborautomation sind in<br />
verschiedenen E-Catalogues geordnet, was<br />
die Identifizierung der Teile vereinfacht.<br />
Hier werden Ersatzteile für alle bisher<br />
gebauten Laborautomaten aufgelistet. Bislang<br />
sind diese E-Catalogues in zwei Sprachen<br />
nutzbar, in denen auch übergreifende<br />
Suchfunktionen verfügbar sind. Damit ist<br />
die Bedienung denkbar einfach. Teile werden<br />
per Mausklick ausgewählt und die<br />
benötigte Anzahl eingegeben. Diese Auswahl<br />
ist eindeutig, da sie auch die jeweilige<br />
Produktnummer enthält. Durch die Auswahl<br />
werden die Teile einem Warenkorb<br />
Bildschirmdarstellung Online-Shop (Bild 4)<br />
zugeführt, der Produktbeschreibung,<br />
Anzahl, Einzelpreis und Gesamtpreis<br />
anzeigt. Die so erzeugte Einkaufsliste wird<br />
dann per E-Mail an den Ersatzteilvertrieb<br />
geschickt.<br />
Um den Programmieraufwand klein zu<br />
halten, wurde für den Warenkorb eine<br />
Standard-Software eingesetzt. Der eigentliche<br />
Aufwand steckt in der Erstellung und<br />
Aktualisierung der E-Catalogues einschließlich<br />
der Preislisten (Bild 4).<br />
Die Preislisten unterscheiden sich wegen<br />
der kommerziellen Bedingungen. Zwischen<br />
Lieferung „ab Werk“ und „geliefert verzollt<br />
benannter Bestimmungsort“ irgendwo im<br />
entfernten Ausland ist alles möglich. Die<br />
Festlegung der Preisliste erfolgt in einer<br />
Rahmenvereinbarung mit dem jeweiligen<br />
Betreiber, wobei durch das Login zum<br />
Online-Shop die entsprechende Preisliste<br />
den E-Catalogues zugeordnet wird. Der<br />
Benutzer sieht also nur den für ihn relevanten<br />
Preis.
61<br />
B2B im Großanlagenbau – Vertrieb von Ersatzteilen für Zementwerke<br />
Die Praxis zeigt aber, dass die beschaffenden<br />
Abteilungen der Betreiber zwar die<br />
technische Auswahl im Online-Shop treffen,<br />
die eigentliche Bestellung aber dann<br />
doch per Fax mit den entsprechenden<br />
Unterschriften absenden.<br />
Trotzdem reduziert der Online-Shop erheblich<br />
die Prozesskosten auf beiden Seiten,<br />
da durch die eindeutige Auswahl praktisch<br />
keine Rückfragen mehr auftreten. Durch die<br />
zugeordneten Preislisten gibt es auch keine<br />
Anfragen mehr, sondern nur noch direkte<br />
Bestellungen, wenn auch per Fax.<br />
Tailor-made E-Catalogues sind für den<br />
Ersatzteilvertrieb im Großanlagenbau deutlich<br />
breiter einsetzbar, wie das folgende<br />
Beispiel zeigt.<br />
Im Rahmen des Neubaus eines kompletten<br />
Zementwerkes in Südamerika wurde<br />
ein Ersatzteilpaket zusammengestellt, das<br />
aus Herstellersicht dem zweijährigen<br />
Betrieb der Anlage entsprach. Das ergab<br />
einen E-Catalogue von über 2.500 Einzelpositionen<br />
(Bild 5). Per E-Mail wurde über<br />
das Internet zwischen Betreiber und der<br />
Krupp Polysius AG festgelegt, in welchem<br />
Datenbankformat der Austausch dieses<br />
E-Catalogues stattfinden sollte.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Der E-Catalogue wurde gleich in der Landessprache<br />
erstellt und jede Einzelposition<br />
gemäß den geltenden Importvorschriften<br />
mit Preisen versehen. Der Versand des<br />
E-Catalogues erfolgte dann per E-Mail über<br />
das Internet, wobei entsprechendes Informationsmaterial<br />
angehängt wurde. Damit<br />
konnte der Betreiber direkt in der gemeinsamen<br />
Datenbasis arbeiten, wodurch diese<br />
an die Bedürfnisse des Betreibers angepasst<br />
wurde, sich aber auch Klärungsbedarf<br />
einstellte.<br />
Durch einen zweitägigen Besuch beim<br />
Betreiber wurden ausstehende technische<br />
und kommerzielle Details geklärt. Die Auftragserteilung<br />
erfolgte dann per E-Mail,<br />
sicherheitshalber auch noch einmal per<br />
Brief, wobei der Wert des Paketes 5 Mio DM<br />
überstieg.<br />
Dieser Tailor-made E-Catalogue kann<br />
jetzt als Datenbasis für die elektronische<br />
Lagerverwaltung beim Betreiber genutzt<br />
werden und stellt damit die Grundlage für<br />
die weitere Zusammenarbeit im Bereich<br />
Ersatzteile mit dem Betreiber dar. Aus diesem<br />
E-Catalogue können noch jahrelang<br />
über die allgemeine Preissteigerung Richtpreise<br />
ermittelt werden.<br />
Ausschnitt aus der „Masterlist“ eines tailor-made E-Catalogues für ein Zementwerk (Bild 5)<br />
<strong>Technische</strong> Neuerungen können dem<br />
Kunden durch Austausch einzelner Positionen<br />
übermittelt werden, wobei die entsprechenden<br />
Zeichnungen und Animationen<br />
angehängt werden können.<br />
Besonders effektiv werden Tailor-made<br />
E-Catalogues, wenn sowohl auf der Betreiber-<br />
wie auf der Herstellerseite Verknüpfungen<br />
zur internen kommerziellen Software<br />
erstellt werden. Der hierarchisch aufgebaute,<br />
listenförmige Katalog weicht damit einer<br />
vernetzten Matrix, wobei die Einzelpositionen<br />
des E-Catalogues nur noch Links auf<br />
die Datenbasis des Herstellers sind. Die<br />
Aktualität des E-Catalogues entspricht<br />
damit der Aktualität des Datenbestandes<br />
des Herstellers.<br />
Neben den E-Catalogues wird aber auch<br />
die Einzelanfrage im Online-Shop Bestand<br />
haben. Bei der Lieferung von komplexen<br />
Komponenten wie der in Bild 1 gezeigten<br />
Laufringstation für Drehöfen mit einem<br />
Gewicht von 150 Tonnen kann man sicherlich<br />
technische Daten, Zeichnungen und<br />
sonstige Informationen über das World-<br />
WideWeb austauschen. Das Geschäft dürfte<br />
aber trotzdem F2F (Face-to-Face) abgeschlossen<br />
werden!
62<br />
Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop,<br />
Dipl.-Ing. Thomas Deimel<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“ – Hydraulikhammer mit Fernübertragung<br />
der Leistungsdaten durch integrierte Auswerteelektronik<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Hydraulikhammer HM 4000 in der sprengstofflosen<br />
Gesteinsgewinnung (Bild 1)
63<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“ – Hydraulikhammer mit Fernübertragung der Leistungsdaten<br />
durch integrierte Auswerteelektronik<br />
1 Kundenwunsch: Mieten auf<br />
Basis „Full-Service“<br />
Ein neuer Markt für Hydraulikhämmer ist<br />
die sprengstofflose Gesteinsgewinnung.<br />
Weltweit wird das Arbeiten mit Sprengstoff<br />
in Steinbrüchen mehr und mehr zum<br />
Problem. Zum einen führen Auflagen des<br />
Umweltschutzes dazu, dass das Sprengen<br />
stark reduziert oder sogar völlig eingestellt<br />
werden muss, zum anderen gibt es in vielen<br />
Ländern strenge und kostenintensive<br />
Sicherheitsauflagen, damit kriminelle Organisationen<br />
in Steinbrüchen nicht auf einfache<br />
Weise an Sprengstoff gelangen.<br />
Will man mit einem Hydraulikhammer<br />
wirtschaftlich Gestein direkt aus dem Fels<br />
gewinnen, so ist eine sehr hohe Schlagleistung<br />
erforderlich. Für derartige Anwendungsfälle<br />
wurde der in Bild 1 gezeigte HM<br />
4000 entwickelt. Als größtes Gerät einer<br />
Baureihe von insgesamt 15 Typen ist der<br />
HM 4000 der derzeit mit Abstand leistungsstärkste<br />
Hydraulikhammer der Welt. Er<br />
wiegt 7 t und wird über einen 65–120 t<br />
schweren Hydraulikbagger geführt (Bild 2).<br />
Der Kolben des HM 4000 wiegt ca. 350 kg,<br />
hat einen Durchmesser von 210 mm und<br />
wird hydraulisch 450-mal pro Minute auf<br />
eine Aufschlaggeschwindigkeit von ca.<br />
9 m/s beschleunigt. Auf den Meißel wirkt<br />
dabei eine Kraft, die ausreicht, zwei beladene<br />
Jumbo-Jets gleichzeitig anzuheben<br />
(das entspricht einem Gewicht von ca.<br />
650 t). Die Schlagleistung (Schlagenergie x<br />
Schlagzahl) des HM 4000 beträgt entsprechend<br />
ca. 106 kW.<br />
Auf Grund der hohen Dynamik und der<br />
außerordentlichen Belastung der Bauteile<br />
sind Hydraulikhämmer technologisch<br />
äußerst anspruchsvoll, vor allem aber<br />
unterliegen sie hohem Verschleiß und sind<br />
wartungsintensiv. Die Betriebskosten sind<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
HM 4000 an einem 80t schweren Hydraulikbagger |(Bild 2)<br />
abhängig von der Einsatzart sowie von der<br />
Arbeitsweise des Bedieners. Im Markt entsteht<br />
daher zunehmend eine Nachfrage, im<br />
Rahmen eines „Full-Service-Angebotes“<br />
für die Inanspruchnahme der Geräteleistung<br />
zu bezahlen, anstatt das Gerät zu kaufen.<br />
Für ein derartiges Geschäft fehlte bisher<br />
ein hinreichendes Abrechnungssystem.<br />
Blockschaltbild des Schlagzählers (Bild 3)<br />
2 Aufgabe: Entwicklung eines<br />
Abrechnungssystems<br />
Die Einsatzdauer eines Hydraulikhammers<br />
wurde bisher über den Betriebsstundenzähler<br />
des Trägergerätes ermittelt. In<br />
besonderen Einsätzen kamen in der Fahrerkabine<br />
installierte Zähler zum Einsatz, die<br />
die Einschaltdauer des Hydraulikhammers<br />
erfassten, indem die Zeiten zwischen Einund<br />
Ausschalten eines Druckschalters in<br />
der Zulaufleitung gemessen wurden. Diese<br />
Methoden eignen sich jedoch nicht als
64<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“ – Hydraulikhammer mit Fernübertragung der Leistungsdaten<br />
durch integrierte Auswerteelektronik<br />
Basis für ein Abrechnungssystem, weil sie<br />
leicht beeinflusst werden können. Darüber<br />
hinaus ist die Zuordnung Trägergerät–Hydraulikhammer<br />
nicht immer gegeben, da in<br />
vielen Betrieben Träger- und Anbaugeräte<br />
einsatzbezogen zusammengestellt<br />
werden.<br />
Es musste daher ein Gerät entwickelt<br />
werden, das die für ein Abrechnungssystem<br />
notwendigen Daten erfasst und eindeutig<br />
einem bestimmten Hydraulikhammer<br />
zuordnet.<br />
3 Lösung: Elektronischer Schlagzähler<br />
im Hydraulikhammer<br />
Zur Erfüllung der Aufgabe wurde ein<br />
Modul entwickelt, das<br />
● Daten ermittelt, auswertet, speichert und<br />
über eine geeignete Schnittstelle zur Verfügung<br />
stellt,<br />
● über einen Zeitraum von mindestens<br />
10 Jahren vollkommen wartungsfrei<br />
arbeitet,<br />
● so in den Kopf eines Hydraulikhammers<br />
eingebaut ist, dass es vom Kunden<br />
weder manipuliert noch unbemerkt entfernt<br />
werden kann.<br />
Bild 3 zeigt das Blockschaltbild der elektronischen<br />
Schaltung. Wesentliche Elemente<br />
sind:<br />
● Piezo-Sensor inkl. Signalaufbereitung<br />
● Microprozessor mit integriertem Speicher<br />
● Echtzeituhr<br />
● Temperatursensor<br />
● Infrarotschnittstelle<br />
● Spannungsversorgung<br />
Als Signal für die Datenermittlung wird<br />
die durch den Schlagvorgang hervorgerufe-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Aufbereitung des Messsignals (Bild 4)<br />
ne Beschleunigung des Schlagwerkes verwendet.<br />
Sie wird mit einem piezoelektrischen<br />
Schocksensor gemessen, wie er in<br />
jedem Laptop als Teil eines Schutzmechanismus<br />
für die Festplatte eingesetzt wird.<br />
Bild 4 stellt dar, wie das Messsignal aufbereitet<br />
und digitalisiert wird, damit es in<br />
einem Microprozessor weiterverarbeitet<br />
werden kann.<br />
Die in Bild 4 dargestellte Schaltung ist<br />
aus zwei Gründen für die Erfüllung der<br />
gestellten Aufgabe besonders geeignet:<br />
● Bis zum Komparator (5) arbeitet sie mit<br />
der vom Piezo-Sensor generierten Spannung.<br />
Bis zu dieser Stelle ist somit keine<br />
externe elektrische Energiezufuhr notwendig.<br />
● Durch das Hochpassfilter (4) erfolgt eine<br />
Verschiebung des Signals, sodass saubere<br />
Nulldurchgänge erfolgen. Dadurch<br />
passt sich die Schaltung adaptiv an das
65<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“ – Hydraulikhammer mit Fernübertragung der Leistungsdaten<br />
durch integrierte Auswerteelektronik<br />
Auslesen und Übermitteln der Daten (Bild 5)<br />
jeweilige Schlagwerk an. Somit kann<br />
dasselbe Modul sowohl an einem größeren<br />
wie auch an einem kleineren Schlagwerk<br />
eingesetzt werden.<br />
Der Spannungsversorgung und dem<br />
Stromverbrauch wurde bei der Entwicklung<br />
besondere Aufmerksamkeit gewidmet.<br />
Grundsätzlich kamen unterschiedliche<br />
Lösungsansätze infrage. Unter anderem<br />
wurde untersucht, ob der Piezo-Sensor in<br />
Verbindung mit einem Kondensator oder<br />
einem wiederaufladbaren Akkumulator als<br />
einzige Spannungsversorgung für die<br />
Schaltung eingesetzt werden kann. Ein<br />
Kondensator würde sich nach längerer<br />
Pause entladen, ein Auslesen des Moduls<br />
wäre dann erst nach erneuter Inbetriebnahme<br />
des Hydraulikhammers möglich. Ein<br />
Akkumulator würde die angestrebte<br />
Lebensdauer von 10 Jahren nicht erreichen.<br />
Zum Einsatz kommen zwei 3,6V/1Ah<br />
Lithium-Thionyl-Chlorid-Batterien. Zur<br />
Überwachung des Ladezustands wird die<br />
Batteriespannung in Abhängigkeit der<br />
jeweiligen Temperatur gemessen und<br />
angezeigt.<br />
Der Stromverbrauch der Schaltung wird<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
weiterhin minimiert, indem der Microprozessor<br />
nur alle 4 Schläge arbeitet und zwischenzeitlich<br />
abgeschaltet wird. Weiterhin<br />
wird er „geweckt“, wenn über die Infrarotschnittstelle<br />
eine Anfrage zum Auslesen<br />
des Speichers erfolgt. Der Stromverbrauch<br />
der Schaltung beträgt 3 µA im „Schlafzustand“<br />
und 2 mA im „Arbeitszustand“.<br />
Die Reichweite der Batterien beträgt ca.<br />
Auswertungs-Software (Bild 6)<br />
500 Mio Schläge bzw. ca. 18.500 Std.<br />
Einschaltzeit des Hydraulikhammers (das<br />
entspricht bei 2-schichtigem Betrieb einer<br />
Lebensdauer von mehr als 10 Jahren).<br />
Dabei kann 10.000-mal über die<br />
IR-Schnittstelle ausgelesen werden bzw.<br />
ca. 3-mal am Tag.<br />
Die Kommunikation erfolgt über eine<br />
Standard-Infrarotschnittstelle (IRDA 1.1).<br />
Sie ermöglicht das Auslesen des Speichers<br />
sowie das Übermitteln von Daten, Programmen<br />
und Befehlen, über die das<br />
Modul initialisiert und modifiziert werden<br />
kann. Die Initialisierung erfolgt vor Auslieferung<br />
im Werk. Dabei wird neben dem Stellen<br />
der Uhr vor allem die Seriennummer<br />
des zugehörigen Hydraulikhammers sowie<br />
das Auslieferdatum eingelesen.<br />
Über die Eingabe von Passwörtern ist ein<br />
Zugriff auf Daten in unterschiedlichen Ebenen<br />
möglich. Das Auslesen erfolgt über ein<br />
handelsübliches Mobiltelefon bzw. Palmtop<br />
oder Laptop, soweit es mit einer Infrarotschnittstelle<br />
ausgerüstet ist (Bild 5). Die
66<br />
Serviceprodukt „Schlagleistung“ – Hydraulikhammer mit Fernübertragung der Leistungsdaten<br />
durch integrierte Auswerteelektronik<br />
Benutzerspezifische Zugriffsebenen (Bild 7)<br />
Daten werden auf dem Display angezeigt,<br />
können gespeichert und per SMS oder<br />
Internet an die Servicestation übermittelt<br />
werden.<br />
Das Modul zählt die Schläge des Hammers<br />
und wertet sie nach unterschiedlichen<br />
Kriterien aus. Es ermittelt die Einschaltdauer<br />
des Hammers, es berechnet alle<br />
4 Schläge (entsprechend dem Schlafintervall)<br />
die Schlagfrequenz und ermittelt die<br />
Einschaltdauer und Pausenlänge je<br />
Arbeitsspiel. Die Werte werden voreingestellten<br />
Klassen zugeordnet (Bild 6). Die<br />
sich ergebenden Profile sind Anhaltswerte,<br />
um die Einsatzart (hartes oder weiches<br />
Material) und die Arbeitsweise des Bedieners<br />
(minutenlanges Schlagen auf einer<br />
Stelle oder rechtzeitig neues Positionieren<br />
des Meißels) abschätzen zu können.<br />
Die Daten werden in drei unterschiedlichen<br />
Ebenen gespeichert (Bild 7). Auf die<br />
oberste Ebene hat der Kunde Zugriff und<br />
kann sie bei Bedarf über sein Mobiltelefon<br />
wie einen Tageskilometerzähler auch<br />
zurücksetzen. Die Serviceebene dient der<br />
Abrechnung und ist nur über ein entsprechendes<br />
Passwort zugänglich. Die unterste<br />
Ebene enthält die Lebensdauerdaten, auf<br />
die nur im Werk zugegriffen werden kann.<br />
Das Modul speichert die Anzahl der Ausle-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
sevorgänge pro Ebene sowie Datum und<br />
Uhrzeit des jeweils letzten Auslesevorganges.<br />
Dabei hält es fest, ob ein Zurücksetzen<br />
der Daten stattgefunden hat.<br />
Die Elektronik ist in ein Aluminiumgehäuse<br />
eingegossen, das auf der Vorderseite<br />
ein Sichtfenster für die IR-Schnittstelle hat.<br />
Hinter dem Sichtfenster befindet sich<br />
zusätzlich ein Steckkontakt, der nach Zerstören<br />
des Sichtfensters zugänglich wird.<br />
So ist sichergestellt, dass auch bei defekter<br />
IR-Schnittstelle ein Auslesen des Speichers<br />
möglich bleibt.<br />
Der Durchmesser des Moduls beträgt<br />
48 mm, die Höhe 40 mm. Der Einbau im<br />
Kopf des Hydraulikhammers erfolgt in eine<br />
entsprechend eingebrachte Bohrung über<br />
zwei Kunststoffelemente, die mit ihren Bun-<br />
Montage im Kopf des Hydraulikhammers (Bild 8)<br />
den in eine Nut einschnappen (Bild 8). Ein<br />
Ausbau ist nur durch Zerstören der Elemente<br />
möglich. Die Abstimmung der<br />
Dämpfungseigenschaften der Kunststoffelemente<br />
und der Vergussmasse gewährleistet<br />
eine hinreichende Dämpfung des<br />
Beschleunigungsspektrums (Amplituden<br />
bis zum 2000-fachen der Erdbeschleunigung)<br />
als Schutz für die Elektronik bei einer<br />
für die Auswertung hinreichenden Weiterleitung<br />
des Signals.<br />
Die Idee, einen Hydraulikhammer mit<br />
einer derartigen Datenerfassung auszurüsten,<br />
wurde in mehreren Ländern zum<br />
Patent angemeldet.<br />
4 Ausblick: Erstellen eines profitablen<br />
Dienstleistungskonzeptes<br />
Mit dem beschriebenen Modul sind die<br />
Voraussetzungen für eine in diesem Markt<br />
vollkommen neue Produktidee, den Vertrieb<br />
von „Schlagleistung“ im Rahmen<br />
eines Full-Service-Angebotes geschaffen.<br />
Für den Kunden ergibt sich daraus der Vorteil<br />
einer kalkulierbaren Inanspruchnahme<br />
der Leistung eines Hydraulikhammers. Im<br />
Weiteren ist es erforderlich, dieses neuartige<br />
Dienstleistungskonzept betriebswirtschaftlich<br />
und statistisch zu hinterfragen<br />
und so zu gestalten, dass es sowohl für<br />
den Kunden als auch für das Unternehmen<br />
zu einem profitablen Geschäftsmodell wird.<br />
Hierbei sind insbesondere die Fragen der<br />
Kapitalbindung sowie der Kosten für Verschleißteile<br />
und Reparaturen zu beantworten.<br />
Weitere Informationen über Hydraulikhämmer<br />
unter:<br />
www.krupp-berco-bautechnik.com
67<br />
Dr. rer. pol. Claus Algenstaedt<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft<br />
von Thyssen Schulte<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Seit Frühjahr 2000 ist das Online-Informationsund<br />
-Bestellsystem von Thyssen Schulte aktiv.<br />
Der „Business-to-Business“-Ansatz wird zu<br />
einer dialogbasierten Plattform mit Nutzung<br />
modernster, noch in Entwicklung befindlicher<br />
Software-Module ausgebaut (Bild 1)
68<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft von Thyssen Schulte<br />
1 Ausgangssituation<br />
Thyssen Schulte verfügt seit geraumer<br />
Zeit über einen elektronisch gesteuerten<br />
Informations-, Bestell- und Transaktionskanal<br />
für Werkstoff-Kunden. „TS-Online-<br />
Shop“ ist eine Internet-Anwendung, die auf<br />
einem Linux-Server mit darunter liegender<br />
Oracle-Datenbank betrieben wird. Über<br />
eine Schnittstelle besteht volle Vernetzung<br />
mit dem Warenwirtschaftssystem von Thyssen<br />
Schulte. Der Zugang für die Kunden in<br />
dieses spezielle Intranet ist durch Code<br />
gesichert (Bild 2). Als „Business-to-Business“-Ansatz<br />
(vgl. <strong>forum</strong> Juli 2000, Seite<br />
44 ff.) ist „TS-Online“ längerfristig auf die<br />
Integration der gesamten Geschäftsabwicklung<br />
mit den Kunden angelegt. Besondere<br />
Bedeutung hat dabei die Einbeziehung von<br />
modernen Marketing-Konzepten und von<br />
Maßnahmen zur individuellen Kundenbetreuung.<br />
Die Informationsbasis von „TS-Online“<br />
ist mehrstufig. Neben standardisierten Artikelangaben<br />
und hinterlegten kundenindividuellen<br />
Preisen (brutto/netto) für die elektronische<br />
Platzierung und Verfolgung von<br />
Aufträgen wird „TS-Online“ schrittweise zu<br />
Paletten-Hochregalanlage für Langgut sowie Auftragsabwicklung von<br />
Edelstahl-Kommissionen (Bild 3)<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Einstiegsseite von TS Online-Shop und – zusätzlich vermerkt – die bereits nutzbaren Funktionen (Bild 2)<br />
einer umfangreichen Informationsplattform<br />
ausgebaut. Der Ansatz bezieht sich dabei<br />
auf das gesamte breit gefächerte Werkstoffprogramm<br />
(Bild 3) – Stahl, Rohre,<br />
Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe –<br />
ebenso wie auf die vielfältigen verbundenen<br />
Dienstleistungen, zum Beispiel die<br />
Anarbeitung (Bild 4), die heute bereits bis<br />
Sägezentrum Dortmund (Bild 4)<br />
hin zum Laserschneiden von Einzelteilen<br />
oder in Serie nach Kundenmaßen reicht<br />
(Bild 5).<br />
Ziel ist es also, die Werkstoff-Kompetenz<br />
von Thyssen Schulte auch über die elektronische<br />
Informationsplattform den Verarbeiter-Kunden<br />
in Handwerk, Industrie und<br />
Bauwirtschaft zur Verfügung zu stellen
69<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft von Thyssen Schulte<br />
Laserschneiden als besonders materialschonende<br />
Anarbeitung nach Kundenvorgaben bei Thyssen<br />
Schulte (Bild 5)<br />
(Bild 6). Dazu gehört z.B. Hilfe bei der optimalen<br />
Werkstoffauswahl (Bild 7). Jüngst<br />
wurden hierzu erste Programmsequenzen<br />
für die Kunden von TS-Online bereit<br />
gestellt. Mittelfristig soll ein Werkstoff-<br />
Forum entwickelt werden, das allen Kunden<br />
für Fragen rund um die Werkstoffe und<br />
deren Verarbeitung offen steht. Dabei wird<br />
auch an elektronischen Dialog gedacht<br />
(„Chatroom“).<br />
2 Die Aufgabenstellung:<br />
One-to-One-Marketing<br />
Im Internet und bei online-basierten<br />
Business-Konzepten entscheidet der<br />
Benutzer über den von ihm gewünschten<br />
Informations- und Kommunikationsfluss<br />
vom und zum anbietenden Unternehmen.<br />
Gegenüber der klassischen, vielfach persönlich<br />
geprägten Verkaufs- und Kundenbetreuung<br />
tritt also eine inverse Kommunikationssituation<br />
ein: Der Online-Kunde<br />
bestimmt allein, wann, wo, wie, wie lange<br />
und wie oft er das elektronische Angebot<br />
des Unternehmens über Informationen und<br />
Leistungen zu nutzen bereit ist.<br />
Entsprechend greifen traditionelle Marketing-Ansätze<br />
der Kundenbeeinflussung nur<br />
noch unzureichend. Wenn sich Kundenwünsche<br />
weitgehend unbeeinflusst elektro-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
nisch mitteilen und weiterentwickeln können,<br />
wird die individuelle Kundenbetreuung<br />
in den modernen Online-Systemen zum<br />
entscheidenden Erfolgsfaktor für die Sicherung<br />
der zukünftigen Geschäftsbasis. Was<br />
beim persönlichen Verkauf durch intensive<br />
Außen- und Innendiensttätigkeit und langfristig<br />
angelegte Kundenkontakte an Informationen<br />
gesammelt und verfolgt wird,<br />
erfordert bei Online-Geschäftsverbindungen,<br />
die 365 Tage rund um die Uhr jederzeit<br />
verfügbar sind, besondere Vorkehrungen,<br />
will man die individuelle Pflege und<br />
Beeinflussung von Kunden sicherstellen.<br />
Micro- bzw. „One-to-One“-Marketing verlangt<br />
eine weitaus stärkere Personalisierung<br />
und Individualisierung der marketingorientierten<br />
Kundendaten.<br />
Bisher wird die Kundenanalyse vor allem<br />
an produkt- und buchhaltungsrelevanten<br />
Geschäftsdaten aus der Vergangenheit fest<br />
gemacht. Dazu zählen Absatz, Umsatz,<br />
Auftragseingänge oder Zahlungsverläufe.<br />
Allerdings bleibt diese Vorgehensweise mit<br />
Unzulänglichkeiten behaftet, weil sie den<br />
Kunden nur „statisch-historisch“ über<br />
wenige Eckdaten und an wenigen Kontaktpunkten<br />
im Unternehmen abbildet. Die so<br />
gewonnenen Kundeninformationen führen<br />
darüber hinaus häufig zu einer Einordnung<br />
in starre Raster (Segmente).<br />
Anstelle einmaliger statischer Zuordnung<br />
sind Marketing-Maßnahmen auf Basis<br />
dynamischer Informationsprozesse im Hinblick<br />
auf den zu umwerbenden Kunden<br />
wünschenswert. Eine ideale Quelle hierfür<br />
bildet der jeweilige Kunde selbst, der durch<br />
ständigen Dialog und Interaktion mit dem<br />
Unternehmen als Leistungsanbieter vielfältige<br />
bedarfs- und nutzungsrelevante Informationen<br />
bietet. Dies ist der Ansatz für „Customer-Relationship-Management“<br />
(CRM).<br />
Das CRM-Konzept an sich ist nicht neu:<br />
Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ver-<br />
PC-unterstützte Kundenberatung während der Messe Euroblech in Hannover (Bild 6)
70<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft von Thyssen Schulte<br />
läuft danach ganzheitlich auf Basis von<br />
Informationen, die das Unternehmen als<br />
Anbieter von Produkten und Leistungen<br />
individuell auf den jeweiligen Bedarf des<br />
Kunden und seiner Geschäftsprozesse ausrichtet.<br />
Dabei ist die übergreifende Zusammenarbeit<br />
aller Abteilungen und Systeme<br />
mit Kundenkontakten erforderlich.<br />
Für die Umsetzung von CRM-Konzeptionen<br />
ist ein geschlossener Regelkreis im<br />
Sinne der „Closed-Loop-Marketing“-Idee<br />
im Unternehmen erforderlich. Ein solcher<br />
Regelkreis erfasst den Kunden an möglichst<br />
allen Kontaktpunkten, die er mit dem<br />
Unternehmen hat (Außendienst, Innendienst,<br />
Telefonverkauf, Key-Account, Web,<br />
Telefon, Fax/E-Mail, Datensysteme etc.).<br />
Auf diese Weise werden alle Daten aus<br />
dem laufenden Geschäft der operativen<br />
Bereiche und der verbundenen Auswertungen<br />
berücksichtigt. Dateninseln gehören<br />
somit im CRM-Konzept der Vergangenheit<br />
an.<br />
3 Die Anforderung: Speicherung<br />
und Nutzung von komplexen<br />
Kundendaten<br />
Bislang bestanden erhebliche Schwierigkeiten,<br />
die individuellen Kundendaten in<br />
ihrer Vielfalt zu erfassen, auszuwerten und<br />
zu speichern. Die rasante Entwicklung leistungsfähiger<br />
Computer- und Speichertechnik<br />
ermöglicht heute die Speicherung und<br />
Analyse von riesigen Datenmengen.<br />
Kombiniert man diese Technologie mit<br />
der des Internets bzw. von Online-Systemen,<br />
so lassen sich Systeme für die Kundenbetreuung<br />
entwickeln, mit denen der<br />
Dialog zwischen Kunde und Lieferant rund<br />
um die Uhr in Echtzeit abgebildet werden<br />
kann (eCRM). Dies erst bietet die Chance<br />
für ein Online-Marketing, das bewusst<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
„One-to-One“ ausgerichtet ist. Basis dafür<br />
sind die Informationen, die mit jedem Kundenkontakt<br />
im Unternehmen generiert und<br />
– soweit sinnvoll – vom System gespeichert<br />
werden.<br />
One-to-One-Online-Marketing als Plattform<br />
für die ganzheitliche Erfassung von<br />
Kundenbedürfnissen setzt die Nutzung<br />
hochleistungsfähiger intelligenter elektronischer<br />
Netzwerke voraus, die als Kommunikations-<br />
und Transaktionsbasis eigenständig<br />
und sensibel arbeiten („neuronale<br />
Netze“).<br />
Solche neuronalen Netze der Cyber-<br />
Smart-Technologie haben Fähigkeiten, die<br />
den Prinzipien des menschlichen Gehirns<br />
ähnlich sind. Künstliche neuronale Netzwerke<br />
arbeiten als „Connected Systems“<br />
auf Grundlage von Verknüpfungen und<br />
mathematischen Funktionalitäten, wobei<br />
interessanterweise vor allem auch nichtlineare<br />
Zusammenhänge und Beziehungen<br />
innerhalb großer Datenmengen erfasst und<br />
genutzt werden können. Die Stärke dieser<br />
Netze liegt in ihrer Lernfähigkeit: Sie passen<br />
sich in einer Art Selbstorganisationsprozess<br />
an die Entwicklung veränderlicher<br />
Datenstrukturen und Bewegungsmuster an<br />
(„Self-Organizing Maps“). Solche Anpassungsmodelle<br />
können auch unter spezifischen<br />
Informations-, Verkaufs- und Marketingaspekten<br />
vorstrukturiert werden.<br />
Ziel ist es, die kundenbezogenen Daten<br />
und interaktiven Prozesse über derartige<br />
Netze zu erfassen und zu bündeln, um sie<br />
so „real time“ direkt in die Unternehmensabläufe<br />
zu integrieren und für alle relevanten<br />
Abteilungen nutzbar zu machen. Mehrfacherfassungen<br />
im Unternehmen entfallen<br />
durch Vernetzung der relevanten Datenspeicher.<br />
Diese Aufgaben übernehmen in neuronalen<br />
Netzwerken Softwarekomponenten,<br />
so genannte „digitale Agenten“, die selbstständig<br />
oder nach vorgegebenen Unternehmensanweisungen<br />
arbeiten. Ihre Auf-<br />
Beispiel für Parameter-orientierte Werkstoffauswahl auf Basis programmierter Datenverknüpfungen mit<br />
Einbeziehung der Materialverfügbarkeit ab Lager (Bild 7)
71<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft von Thyssen Schulte<br />
CyberSmart-Technologie (Schema): Digitale Software-Komponenten steuern den Kundendialog (Bild 8)<br />
gabe ist die Sammlung und Analyse von<br />
Daten in Echtzeit, die Weiterleitung zur Nutzung<br />
durch Verkauf und Marketing sowie<br />
die Steuerung der Online-Kundenbetreuung<br />
einschließlich Reporting (Bild 8).<br />
„Agenten“ sammeln also selbstständig<br />
Daten über das Benutzerverhalten aus firmeneigenen<br />
Datenbanken oder „bedarfsbezogen“<br />
aus dem Internet und steuern<br />
mit Hilfe aller dieser Informationen das<br />
Angebot für den Kunden so, wie es dem<br />
jeweiligen Bedarfsfall gerecht wird.<br />
Diese Software-Module begleiten die<br />
Nutzer online, speichern und analysieren<br />
alle Transaktionen und geben bei Bedarf<br />
aktive Hilfestellung, wobei auch vordefinierte<br />
Anweisungen („Business-Rules“) zu<br />
Grunde liegen können. Mit Hilfe solcher<br />
Vorgaben können zum Beispiel generelle<br />
oder zeitlich begrenzte Aktionen ausgelöst<br />
werden, selbstständig Alternativ-Produkte<br />
(Bild 9) angeboten oder – parallel hierzu –<br />
die Verkaufsabteilungen auf den konkreten<br />
Bedarfsfall oder den gerade online befindlichen<br />
Kunden aufmerksam gemacht werden.<br />
Ebenso kann das System über vorde-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
finierte Regeln Konditionen verändern und<br />
festgelegte Preisspielräume nutzen.<br />
Die Datenspeicherung folgt nicht starren<br />
Vorgabemodellen, sondern ist dynamisch<br />
und prozessbegleitend angelegt. Auf diese<br />
Weise ist es möglich, individuell auf Kunden,<br />
die das Online-System nutzen, einzugehen<br />
und – abweichend von der derzeit<br />
gängigen Praxis – nicht nur starre, vorgefertigte<br />
Oberflächen mit einheitlichem Layout,<br />
Informationsangeboten oder Interfacegesteuerten<br />
Abläufen zu bieten. Beispielsweise<br />
wäre es für die Kundenbeziehung im<br />
Werkstoffgeschäft sehr nützlich, wenn dem<br />
jeweiligen Kunden eine für ihn individuell<br />
angepasste Website von Thyssen Schulte<br />
gezeigt werden könnte.<br />
Der Einsatz der neuen CyberSmart-Technologie<br />
ermöglicht, Kundenbeziehungen<br />
und Geschäftsprozesse durch Wiedererkennung<br />
von Präferenzen, Kaufgewohnheiten,<br />
Verhaltensmustern bzw. Bedarfsstrukturen<br />
oder anderen wesentlichen Informationen<br />
elektronisch zu analysieren, zu steuern<br />
bzw. zu speichern (Bild 10). Die Wiedererkennung<br />
(„Pattern / Content-Recognition“)<br />
erfolgt auf Grund von Lerneffekten des<br />
Systems oder – wie erwähnt – durch im<br />
System hinterlegte unternehmensspezifische<br />
Anweisungen. Entsprechendes gilt für<br />
Kundenpotenziale bzw. Kundenwertigkeiten<br />
im Sinne der klassischen ABC-Analyse.<br />
Auch diese Daten werden online während<br />
des elektronischen Informations- bzw.<br />
Geschäftsverkehrs miterfasst, ausgewertet<br />
und den zuständigen Abteilungen auf<br />
deren PC-Arbeitsplätzen sofort zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Durch Verknüpfung der Datenquellen<br />
und interaktiver Bewegungsmuster entsteht<br />
langsam eine kundenrelevante Prozessdatenbank.<br />
Dies ermöglicht, die Angebote<br />
über Produkte und Dienstleistungen „maßgenau“<br />
auf den jeweiligen Kunden auszurichten<br />
und laufend nach den aktuellen<br />
Gegebenheiten zu verändern.<br />
Zur Nutzung der hier angedachten Systeme<br />
benötigen die einbezogenen Abteilungen<br />
PC-Arbeitsplätze mit modernen<br />
DHTML-fähigen Browsern („Thin-Client-<br />
Idee“). Das gilt auch für mobile Arbeitsplätze<br />
(Laptops). Die Intelligenz und die Applikation<br />
selbst liegen dabei auf den dafür<br />
vorgesehenen und durch Firewalls gesicherten<br />
Internet-Servern. Zusätzliche<br />
Lager für Kunststoff-Halbzeug in Wuppertal (Bild 9)
72<br />
E-Commerce als Erfolgsfaktor im Werkstoff-Marketing der Zukunft von Thyssen Schulte<br />
Schematische Darstellung der Verarbeitung von Kundendaten und Geschäftsprozessen<br />
im neuronalen Netz (Bild 10)<br />
Installationsprobleme sind nicht zu erwarten,<br />
da es sich insoweit um bekannte Technologien<br />
handelt.<br />
Weil die CyberSmart-Technologie mit<br />
anonymen Kundendaten arbeitet, sind bei<br />
der Speicherung keine besonderen Probleme<br />
nach dem deutschen Teledienstedatenschutzgesetz<br />
(TDDSG) bzw. nach dem Bundesdatenschutzgesetz<br />
(BDSG) zu befürchten.<br />
4 Fazit<br />
Durch mehr personalisierte Kundenbetreuung<br />
und maßgeschneiderte Ansprache<br />
im Online-Geschäftsverkehr eröffnet sich<br />
für Thyssen Schulte als derzeit führendem<br />
Anbieter von Werkstoffen die Chance, sich<br />
zukünftig von umkämpften Massenmärkten<br />
weiter abzusetzen, um sich noch intensiver<br />
und „zielgenauer“ auf den breiten bzw.<br />
spezialisierten Werkstoffbedarf von lukrativen<br />
Kundengruppen auszurichten.<br />
One-to-One-Marketing bzw. Customer-<br />
Relationship-Management (CRM) ist ein<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
ganzheitlicher Ansatz der Kundenbetreuung<br />
und im Marketing, dessen konsequente<br />
Umsetzung einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung<br />
im Werkstoffgeschäft<br />
sichern würde.<br />
Angesichts der umfangreichen Geschäftstätigkeit<br />
von Thyssen Schulte bei Werkstoffen<br />
und Dienstleistungen mit über 80.000<br />
Kundenadressen – der Schwerpunkt liegt<br />
im Sofortbedarf ab Lager – wurde die Nutzung<br />
von Software-Modulen nach der<br />
CyberSmart-Technologie auf der Basis neuronaler<br />
Netze als wesentliche Voraussetzung<br />
für elektronische Verarbeitung der<br />
Massendaten und Online-Kundenbetreuung<br />
identifiziert. Sie arbeiten dialogbasiert, plattformunubhängig<br />
und als offener Standard.<br />
Die CyberSmart-Technologie dürfte in<br />
überschaubarer Zeit einen interessanten<br />
Entwicklungsstand erreichen (Einsatzreife).<br />
Nach Expertenansicht benötigen die Vorbereitung<br />
derartiger Informations- und Steuerungssysteme<br />
und ihre Umsetzung in konkrete<br />
Unternehmensstrukturen einen längeren<br />
Vorlauf.<br />
Glossar<br />
Customer-Relationship-Management (CRM)<br />
Kundenorientierte Geschäftsführung auf<br />
Basis ganzheitlicher Erfassung von Daten<br />
innerhalb und außerhalb des Unternehmens.<br />
CRM arbeitet mit aktuellen Datenbanken<br />
und Software-Modulen, die die<br />
Marktbearbeitung unterstützen. CRM setzt<br />
die Einbeziehung aller kundenbezogenen<br />
Prozesse und Mitarbeiter im Unternehmen<br />
voraus.<br />
eCRM<br />
Hierbei handelt es sich um die Integration<br />
von Internet bzw. Online-Geschäftsverkehr<br />
und CRM. Das Internet wird als technologische<br />
Plattform für das CRM-Konzept eingesetzt.<br />
Die online gewonnenen Daten werden<br />
nahtlos ins CRM-System übernommen<br />
und mit kundenindividuellen Websites nach<br />
dem Prinzip der One-to-One-Kommunikation<br />
mit dem Kunden verbunden.<br />
CyberSmart-Technologie<br />
Informationstechnologie auf Basis natürlicher<br />
Schnittstellen zu Kunden und anderen<br />
Benutzern und deren individuellen<br />
Daten („smarte Inhalte“), die mit „intelligenten“<br />
Software-Komponenten (Smarts /<br />
Agents) arbeitet, um Daten zu verwalten,<br />
wiederzuerkennen und online über „Feedback-Loops“<br />
und Lern-Mechanismen in<br />
Echtzeit zu steuern. CyberSmart-Systeme<br />
können sowohl durch Software-Schnittstellen<br />
als auch durch Anwendungs-„Schnittstellen“<br />
genutzt werden.<br />
Closed-Loop-Marketing<br />
Geschlossener Regelkreis aus Analyse<br />
von Kundendaten sowie Daten und Dokumenten<br />
des operativen Geschäftes und<br />
deren laufende Rückkopplung mit zugrunde<br />
liegenden Netzwerken.
73<br />
Dr.-Ing. Andreas Bastin,<br />
Axel Cebulla<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft: Telematik-gestütztes<br />
Flottenmanagement via Internet und Online-Disposition<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
ATIS MT II, erstes in Serie gefertigtes Telematiksystem für<br />
Eisenbahnwaggons und Wechselbehälter (Bild 1)
74<br />
1 Einführung<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft: Telematik-gestütztes Flottenmanagement<br />
via Internet und Online-Disposition<br />
Der Kostendruck auf die Unternehmen<br />
des Straßengüterverkehrs wächst weiter.<br />
Beispielsweise hat zum 1. Januar 2001 die<br />
Bundesregierung die dritte Stufe der Ökosteuer<br />
eingeführt, und in der Diskussion<br />
steht die Lkw-Maut auf bundesdeutschen<br />
Autobahnen. Auf der anderen Seite fordern<br />
die Kunden der Transportwirtschaft mehr<br />
Informationen zum Transportverlauf und<br />
Daten, die wiederum von Ihren eigenen<br />
EDV-Systemen direkt weiterverarbeitet werden<br />
müssen.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu<br />
werden und den steigenden Kosten entgegenzuwirken,<br />
müssen die Transportunternehmen<br />
die Einsparmöglichkeiten im Fuhrpark<br />
und in Ihrer Organisation ausnutzen.<br />
Geeignete Werkzeuge für das Fuhrparkmanagement<br />
und die Disposition und Auftragsbearbeitung<br />
müssen angeschafft werden.<br />
Vorrangiges Ziel ist der optimale Einsatz<br />
von Personal, Fahrzeugen und Gerät.<br />
Die Nutzung von automatisierten Betriebsund<br />
Kontrollinstrumenten, wie beispielsweise<br />
telematikbasierte Anwendungen, soll<br />
die Kosten reduzieren und gleichzeitig den<br />
Kundenservice und die Transportleistung in<br />
gleichbleibend hoher Qualität sicherstellen.<br />
Welche Lösungen bieten sich an? Mit<br />
Hilfe der Telematiksysteme an den Fahrzeugeinheiten<br />
bzw. Transportbehältern und<br />
einer integrierten Dispositions- und Flottenmanagement-Software<br />
sind sowohl die<br />
hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen, als<br />
auch die Kosteneinsparungen für Transportdienstleistungen<br />
zu erreichen. Im Folgenden<br />
sind die von Timtec Telematik entwickelten<br />
Werkzeuge zur Lösung der<br />
beschriebenen Anforderungen dargestellt.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
2 Telematikbasierte Online-<br />
Disposition von Intermodal<br />
Equipment<br />
Mit dem System ATIS (autarkes Telematik<br />
und Informationssystem) hat die Timtec<br />
Telematik GmbH das erste „intelligente“<br />
Telematiksystem für den intermodalen Verkehr<br />
entwickelt. Intelligent steht hierbei für<br />
eine Funktionalität, die den automatischen<br />
Soll-Ist-Abgleich zwischen den Plandaten<br />
der Disposition und den Ist-Daten aus dem<br />
Betrieb der Fahrzeuge und Ladeeinheiten<br />
abgleicht. In Abhängigkeit dieses Abgleichs<br />
ist somit eine Online-Disposition und eine<br />
erhebliche Automatisierung der logistischen<br />
Planungsvorgänge möglich.<br />
2.1 Systembeschreibung<br />
Die Firmware (Betriebssystem) des Telematiksystems<br />
ATIS wurde in der Form weiterentwickelt,<br />
dass ein automatischer Soll-<br />
Ist-Abgleich zwischen den Plandaten der<br />
Disposition und den Ist-Daten der logistischen<br />
Transportkette möglich ist. Bislang<br />
arbeiteten die am Markt angebotenen Telematiksysteme<br />
– ebenso das von Timtec<br />
Automatischer Soll-Ist-Abgleich (Bild 2)<br />
Telematik angebotene System ATIS – in<br />
der Form, dass in bestimmten Zeitintervallen<br />
Positions- und Ladungszustandsmeldungen<br />
an die Disposition zu Überwachungszwecken<br />
innerhalb der logistischen<br />
Transportkette übertragen wurden. In<br />
bestimmten Anwendungsfällen war auch<br />
die Kopplung mit Sensoren zur Überwachung<br />
der Ladeeinheiten bzw. der Ladung<br />
möglich, sodass bei Über- oder Unterschreitung<br />
bestimmter Schwellwerte eine<br />
„Alarmmeldung“ an die Dispositions- bzw.<br />
Transportüberwachung gesandt werden<br />
konnte.<br />
Die systemtechnische Realisierung einer<br />
automatisierten Soll-Ist-Überwachung<br />
ermöglicht jedoch darüber hinaus einen<br />
funktionalen Betrieb der Telematiksysteme<br />
an den Fahrzeugen und Ladeeinheiten in<br />
exakter Abstimmung mit den Erfordernissen<br />
seitens der Disposition. Beispielhaft<br />
lässt sich dies wie folgt erläutern:<br />
Sobald Fahrzeuge (Güterwagen) oder<br />
Ladeeinheiten (Container, Wechselbrücken<br />
oder Trailer) durch die Disposition für einen<br />
bestimmten Auftrag/Transport eingeplant<br />
werden, werden die Telematiksysteme<br />
exakt für die Überwachung dieser aktuell
75<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft: Telematik-gestütztes Flottenmanagement<br />
via Internet und Online-Disposition<br />
Dienstleistungen im ThyssenKrupp Rechenzentrum (Bild 3)<br />
und tatsächlich geplanten Transportumläufe<br />
„sensibilisiert“, d.h., das Betriebssystem<br />
der Telematiksysteme wird entsprechend<br />
konfiguriert. Für einen Transport beispielsweise<br />
von Neu-Pkws von A nach B wird<br />
exakt der Transportlauf innerhalb der zulässigen<br />
Toleranzen überwacht. Ist der Transport<br />
abgeschlossen, wird das Telematiksystem<br />
wieder in einen „Standardbetrieb“<br />
konfiguriert, und zwar wiederum automatisch.<br />
Möglich wird dies durch eine voll integrierte<br />
Softwarekoppelung zwischen den<br />
Dispositionssystemen und den Telematiksystemen.<br />
Dabei werden die durch den<br />
Disponenten eingestellten Planungsdaten<br />
von der Dispositionssoftware selbstständig<br />
(d.h. ohne zusätzliches, interaktives Einwirken<br />
seitens des Disponenten) übersetzt<br />
und die passenden Konfigurationsmeldungen<br />
per Funk an das Telematiksystem<br />
gesendet. Nach Empfang dieser Meldungen<br />
arbeitet dann das Telematiksystem<br />
exakt nach dieser Konfiguration die Aufgaben<br />
ab und überwacht beispielsweise den<br />
durch den betreffenden Wagen bzw. durch<br />
die betreffende Ladeeinheit gerade abzuarbeitenden<br />
Transportumlauf.<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
2.2 Nutzen für den Anwender<br />
Der automatische Soll-Ist-Abgleich zwischen<br />
den Planungsdaten innerhalb der<br />
logistischen Steuerung und Disposition und<br />
den tatsächlichen Betriebs- und Zustandsdaten<br />
aus dem Transportumlauf bzw. aus<br />
der logistischen Kette bedeutet für die Disposition<br />
von intermodalen Logistikflotten<br />
erhebliche Einsparungspotenziale. Diese<br />
sind insbesondere dadurch begründet,<br />
dass für den Einsatz von Telematik an intermodalen<br />
Flotten keine zusätzlichen Eingaben<br />
seitens der Disposition erforderlich<br />
sind, um die Telematiksysteme optimal der<br />
jeweils aktuellen „Überwachungssituation“<br />
anzupassen. Bislang bzw. bei anderen Produkten<br />
ist hierzu jeweils eine interaktive<br />
Eingabe seitens des Disponenten erforderlich.<br />
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass<br />
beim Einsatz von Telematiksystemen an<br />
intermodalen Flotten (Schienen- und Kombiverkehr)<br />
die Energiethematik das Haupteinsatzproblem<br />
für Telematiksysteme darstellt.<br />
Hintergrund: Intermodale Transporteinheiten,<br />
wie Güterwagen oder Container,<br />
besitzen keine eigene Energieversorgung<br />
an Bord (wie vergleichsweise Lkws<br />
oder Pkws). Aus diesem Grunde muss die<br />
Ressource Energie entsprechend sparsam<br />
gemanagt werden. Mit Hilfe des zuvor<br />
beschriebenen automatisierten Soll-Ist-<br />
Abgleichs ist es gleichzeitig möglich, die<br />
Telematiksysteme immer dann, wenn sie<br />
gerade nicht in einen akuten Transportumlauf<br />
oder Logistikauftrag eingebunden sind,<br />
in eine Art „Sleep-Modus“ zu schalten, d.h.<br />
in einen energiesparenden, deutlich reduzierten<br />
Überwachungsmodus (weniger Einschaltzeiten<br />
der einzelnen Sensoren, der<br />
Funktechnik etc.).<br />
Mit Hilfe dieser zusätzlichen Energiesparmöglichkeiten<br />
ergaben sich weiterhin konstruktive<br />
und technische Möglichkeiten, das<br />
Gesamtgehäuse (l = 200 mm, h = 160 mm,<br />
b = 60 mm ) des Telematiksystems ATIS<br />
deutlich zu reduzieren und mit Hilfe einer<br />
vergleichsweise kleinen Solarfläche eine<br />
Betriebsstandzeit ohne Unterbrechungen<br />
für Nachladung etc. von bis zu 6 Jahren zu<br />
erreichen.<br />
Eine weitere wesentliche Motivation zur<br />
Entwicklung der Konzeption und anschließenden<br />
Umsetzung eines automatischen<br />
Soll-Ist-Abgleichs ist die damit gegebene<br />
Möglichkeit, erhebliche Kommunikationskosten<br />
im Rahmen des Betriebs autarker<br />
Telematiksysteme einzusparen. Dank<br />
des automatischen Abgleichs werden Meldungen,<br />
die gegebenenfalls keinen Nutzen<br />
in der logistischen Kette bringen, erst gar<br />
nicht am Fahrzeug generiert und auch nicht<br />
ATIS T für die Montage im Trailer. Kompakte<br />
All-in-one-Lösung und intergr. Antennen (Bild 4)
76<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft: Telematik-gestütztes Flottenmanagement<br />
via Internet und Online-Disposition<br />
Informationsdienstleistung und Betriebsführung (Bild 5)<br />
kostenpflichtig per Datenfunk übertragen.<br />
Gleichzeitig wird Energie in der Telematikeinheit<br />
gespart. Bezogen auf den Betrieb<br />
größerer Flotten ergibt sich daher hieraus<br />
eine nachhaltige Einsparung der Kommunikationskosten<br />
für den Betrieb von Telematiksystemen.<br />
3 Anwendungsbeispiel:<br />
Trailertelematik mit ATIS T, eine<br />
E-Business-Lösung für die<br />
Transportwirtschaft<br />
ATIS-Trailer ist ein telematikbasiertes<br />
Flottenmanagementsystem für den Betrieb<br />
und die Überwachung von Sattelaufliegern.<br />
Es besteht aus zwei Hauptmodulen, der<br />
Trailertel-Box, dem Telematiksystem am<br />
Fahrzeug, und dem Internetportal Cargo-<br />
View, über das alle für die Nutzer erforderlichen<br />
Informationen zur Verfügung gestellt<br />
werden.<br />
3.1 Systembeschreibung<br />
Die Telematikbox besteht aus dem Bordrechner,<br />
einem GPS-Empfänger (Global<br />
Positioning System), dem GSM-Datenfunk-<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
modem (Global System for Mobile Communication),<br />
der Spannungsversorgung (Akku,<br />
Powermanagementsystem) und hochentwickelten<br />
Industrieschnittstellen zu den<br />
technischen Betriebsmitteln am Trailer<br />
(Fahrwerkselektronik, Kühlaggregat, Temperaturschreiber,<br />
Sensorik für spezielle<br />
Anforderungen).<br />
Das System ist speziell für den Einsatz an<br />
Sattelaufliegern und Trailern entwickelt. Es<br />
kann unabhängig von der Bordspannungsversorgung<br />
des Anhängers arbeiten und<br />
stellt somit die permanente Überwachung<br />
E-Logistik mit CargoView (Bild 6)<br />
des Fahrzeuges sicher. Damit ist gewährleistet,<br />
dass das Fahrzeug selbst und die an<br />
Bord befindliche Ladung unter Kontrolle<br />
des Transportdienstleisters bleiben.<br />
Neben den logistischen Optimierungseffekten<br />
(Auslastung, Umlaufoptimierung,<br />
Just-in-time-Kontrolle und Kundenservice)<br />
ist ein wesentlicher Nutzen die technische<br />
Überwachung des Fahrzeuges durch die<br />
Datenübernahme aus der Fahrwerkselektronik.<br />
Damit ist es möglich, online den<br />
aktuellen technischen Zustand des Trailers<br />
zu überwachen, wie z.B. Bremsen, Reifenluftdruck,<br />
Beleuchtung, Luftfederung,<br />
Achslast, Laufleistung, um nur einige wichtige<br />
Daten zu nennen. Aus diesen technischen<br />
Informationen werden zustandsorientierte<br />
Meldungen und Maßnahmen generiert,<br />
die dem Unternehmer einen zuverlässigen<br />
Betrieb seiner Flotte gewährleisten<br />
und einen vorausschauenden, auf die<br />
Transportaufgaben abgestimmten Wartungs-<br />
und Reparaturplan ermöglichen.<br />
Der Zugriff auf die Trailerflotte erfolgt<br />
über das Internet. Hierfür ist ein neues, auf<br />
die Bedürfnisse der Transportwirtschaft<br />
abgestimmtes, Internetportal entwickelt<br />
worden: das Portal CargoView .
77<br />
E-Business-Lösung für die Transportwirtschaft: Telematik-gestütztes Flottenmanagement<br />
via Internet und Online-Disposition<br />
Funktionsgruppen am Trailer (Bild 7)<br />
Das ATIS T Telematiksystem ist über CargoView<br />
in alle Funktionen der logistischen<br />
Kette, das Supply-Chain-Management<br />
(SCM), integrierbar. Damit stehen bei<br />
Bedarf die Fuhrpark-Informationen auch in<br />
allen entsprechenden Softwaresystemen<br />
zur Verfügung. Die Bereitstellung von<br />
Schnittstellen für vorhandene Systeme ist<br />
dabei ebenso gesichert wie die Integration<br />
von Systemen anderer Hersteller.<br />
Bei Bedarf können erforderliche Softwaremodule,<br />
von einfachen Auswertungen,<br />
Disposition und Flottenmanagement bis hin<br />
zu betriebswirtschaftlichen Gesamtsystemlösungen<br />
wie zum Beispiel SAP R/3, bereitgestellt<br />
werden.<br />
Die Telematik für Trailer steht erst am<br />
Anfang einer rasanten Entwicklung und<br />
wird neue Impulse für das technische und<br />
logistische Management von Transportdienstleistungen<br />
setzen.<br />
3.2 Nutzen für den Anwender<br />
Die Gesamtsystemlösung ist als offenes<br />
und für andere Hersteller nutzbares System<br />
konzipiert. Zurzeit laufen Akquisitionsgespräche<br />
mit weiteren Trailerherstellern, die<br />
<strong>forum</strong><br />
ThyssenKrupp 1/2001<br />
Aussichten sind äußerst vielversprechend.<br />
Mit CargoView wird die gesamte Transportwirtschaft<br />
erreicht, mit für den einzelnen<br />
Anwender (vom kleinen Transportunternehmer<br />
bis zu Großunternehmen mit<br />
Konzernstruktur) maßgeschneiderten<br />
Diensteangeboten.<br />
Timtec Telematik liefert die Hardware für<br />
die Fahrzeugausrüstung, auf die Kunden<br />
zugeschnittene Internetdienste und ebenso<br />
komplexe Branchensoftware-Anwendungen.<br />
Darüber hinaus ist Timtec Telematik<br />
Lieferant der Telekommunikation (D-Netz-<br />
Karten, Satellitenkommunikationsdienste).<br />
Timtec Telematik ist im Sinne von „One-<br />
Stop-Shopping“ der Lieferant für Gesamtsystemlösungen.<br />
ATIS T wird zwischenzeitlich von folgenden<br />
Fahrzeugherstellern eingesetzt bzw.<br />
als Erstausführung angeboten: Kögel Fahrzeugwerke<br />
Ulm; Lamberet Constructions<br />
Isotherms, dem bedeutenden französischen<br />
Aufbauhersteller für Kühlfahrzeuge;<br />
Trailmobile Chicago (USA).<br />
Mit DaimlerChrysler FleetBoard besteht die<br />
exclusive Vereinbarung, Truck- und Trailertelematik<br />
zu verbinden, mit dem Ziel, den Kunden<br />
einen einheitlichen Standard anzubieten.