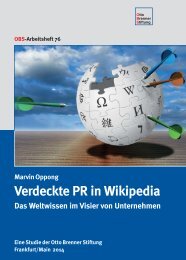BEST OF Otto Brenner Preis 2010 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2010 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2010 - Otto Brenner Shop
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2010</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten<br />
<strong>Preis</strong>träger <strong>2010</strong> · Begründungen der Jury · Prämierte Beiträge<br />
Recherche-Stipendien · <strong>Preis</strong>verleihung <strong>2010</strong> · Ausschreibung 2011
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2010</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten
INHALT
Vorwort<br />
5 Jupp Legrand<br />
Eröffnung<br />
8 Berthold Huber<br />
Festrede<br />
18 Franziska Augstein<br />
<strong>Preis</strong>träger <strong>2010</strong><br />
1. <strong>Preis</strong><br />
29 Carolin Emcke<br />
„Liberaler Rassismus“<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
43 Christoph Lütgert mit NDR-Team<br />
„Panorama – Die Reporter“<br />
„Die KiK-Story“<br />
3. <strong>Preis</strong><br />
49 Markus Metz / Georg Seeßlen<br />
„Von der Demokratie zur<br />
Post demokratie. Eine Gesellschaftsform<br />
in der Krise“<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
55 Willi Winkler<br />
„Die Freuden der Denunziation“<br />
Newcomer-<strong>Preis</strong><br />
69 Karin Prummer / Dominik Stawski<br />
Artikelserie zum Missbrauchsskandal<br />
in der katholischen Kirche<br />
Medienprojektpreis<br />
81 Alfons Pieper<br />
„Wir in NRW – Das Blog“<br />
Recherche-Stipendien I<br />
88 Moderatorin Sonia Seymour<br />
Mikich im Gespräch mit<br />
Jury-Mitglied Thomas Leif<br />
Recherche-Stipendien II<br />
90 Jury-Mitglied Thomas Leif<br />
im Gespräch mit ehemaligen<br />
<strong>Preis</strong>trägern<br />
Ergebnisse abgeschlossener Stipendien<br />
102 Maren-Kea Freese /<br />
Marianne Wendt (2009)<br />
„Immer im Verborgenen“<br />
104 Tina Groll (2009)<br />
„Schrottimmobilien –<br />
Angepumpt und abgezockt“<br />
115 Thomas Schuler (2007)<br />
„Bertelsmannrepublik Deutschland<br />
– Recherchen und Reaktionen“<br />
Ausgewählte Texte und Reden<br />
124 Tom Schimmeck<br />
„Wem gehören die Medien?“<br />
139 Heribert Prantl<br />
Laudatio zur Verleihung<br />
der „Verschlossenen Auster“<br />
148 Thomas Leif<br />
„Journalismus wird immer mehr<br />
zur Kommentierung von Marketing“<br />
170 Die Jury<br />
176 Daten und Fakten<br />
zum <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2010</strong><br />
177 <strong>Preis</strong>träger 2005 – 2009<br />
180 Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für<br />
kritischen Journalismus 2011<br />
183 Impressum<br />
184 Inhaltsverzeichnis der DVD<br />
3
VORWORT
„Es ist herrlich, diesen <strong>Preis</strong> zu bekommen!“ Tom Schimmeck, Festrede 2009<br />
Auch die Ausschreibung zum „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2010</strong>“ ist wieder auf eine überwältigende<br />
Resonanz gestoßen. 571 Bewerbungen unterstreichen, dass der Journalistenpreis<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung hohes Ansehen genießt und eine breite<br />
Wertschätzung erfährt. Aber nicht nur die Zahl der Bewerbungen sind ein Beleg<br />
für den guten Ruf, den sich der „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>“ schon nach sechs Jahren erworben<br />
hat. Etwa die Hälfte der BewerberInnen gab bei der Bewerbung <strong>2010</strong> an,<br />
dass sie den <strong>Preis</strong> bereits vor der Ausschreibung kannten, und gut 100 haben uns<br />
auf persönliche Empfehlungen von KollegInnen bzw. auf Bitten einer Redaktion<br />
die Unterlagen eingereicht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“<br />
zu einer festen Größe geworden ist und in der Fachwelt für Seriosität, Unabhängigkeit<br />
und Professionalität steht.<br />
Der „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus“ steht für den Anspruch,<br />
Beiträge zu prämieren, die in der breiten Masse durch eigenständige und intensive<br />
Recherche auffallen, durch die Themenwahl überzeugen und sich durch<br />
besondere journalistische Qualität auszeichnen. Garant für die treffsichere Auswahl<br />
und die anspruchsvolle Auszeichnung besonderer journalistischer Leistungen<br />
ist die unabhängige und ehrenamtlich tätige Jury.<br />
Die „<strong>Brenner</strong>-Jury“ hat mit ihren Entscheidungen auch <strong>2010</strong> wieder Orientierungsmarken<br />
für außergewöhnliche journalistische Arbeiten gesetzt und Beiträge prämiert,<br />
die den Journalismus von seiner besten Seite zeigen. Carolin Emcke wurde<br />
Anfang November mit dem 1. <strong>Preis</strong> der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung ausgezeichnet. Im<br />
Dezember erhielt sie dann auch den „Deutschen Reporterpreis“ und wurde zur<br />
„Journalistin <strong>2010</strong>“ gekürt. Unser 2. <strong>Preis</strong>träger, Christoph Lütgert mit dem NDR-Team<br />
„Panorama – Die Reporter“, gewann die Wahl zum „Wirtschaftsjournalisten <strong>2010</strong>“.<br />
Mit dem „Best of <strong>2010</strong>“ dokumentieren wir Teile unserer <strong>Preis</strong>verleihung, stellen<br />
die prämierten Beiträge vor, machen die Laudatien der Jury zugänglich und informieren<br />
rund um den „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>“.<br />
Bewerbungen für den „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 2011“ nehmen wir vom 1. April bis zum<br />
15. August an. Die <strong>Preis</strong>verleihung ist am 22. November in Berlin.<br />
Jupp Legrand, Geschäftsführer der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
5
ERÖFFNUNG
Berthold Huber<br />
Rede zur Verleihung der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für<br />
kritischen Journalismus <strong>2010</strong>
Liebe <strong>Preis</strong>trägerinnen und <strong>Preis</strong>träger,<br />
liebe Gäste der <strong>Preis</strong>träger,<br />
liebe Mitglieder der <strong>Preis</strong>-Jury,<br />
sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
herzlich Willkommen zur „Verleihung<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für kritischen<br />
Journalismus“. Es freut mich, dass<br />
wieder Viele unserer Einladung<br />
gefolgt sind. *<br />
Wir haben unseren Journalistenpreis<br />
<strong>2010</strong> zum sechsten Mal ausgeschrieben.<br />
2005 sind wir mit 135 Bewer -<br />
bungen gestartet. In diesem Jahr wurden<br />
der Jury 571 Bewerbungen vorgelegt<br />
– ein neuer Rekord! Kein Sender mit<br />
bundesweiter Bedeutung und auch<br />
keine Zeitung oder Magazin mit überregionalem<br />
Einfluß fehlte bei den<br />
diesjährigen Bewerbungen.<br />
Auch die relevanten Regionalzeitungen<br />
und profilierte Landessender haben<br />
ihr Vertrauen in die Seriosität des<br />
<strong>Preis</strong>es wieder durch zahlreiche und<br />
hervorragende Bewerbungen zum Ausdruck<br />
gebracht. Dem „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“<br />
ist es schon nach wenigen Jahren<br />
gelungen, ein eigenes Profil zu entwickeln<br />
und zu einer „Marke“ zu werden.<br />
Es sind meines Erachtens drei Punkte,<br />
die das Besondere unseres <strong>Preis</strong>es<br />
ausmachen.<br />
Erstens: Der „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“ steht für<br />
journalistische Qualität! Viele Journalistenpreise<br />
verfolgen – mehr oder we -<br />
niger direkt – das Ziel, ein bestimmtes<br />
Thema in den Mittelpunkt zu rücken.<br />
Dass damit häufig kommerzielle Ab sichten<br />
verfolgt oder einseitige Interessenpolitik<br />
betrieben wird, wird nur selten<br />
kaschiert. Die Ausschreibung des<br />
„Bren ner-<strong>Preis</strong>es“ erfolgt hingegen<br />
unter dem Motto „Gründliche Recherche<br />
statt bestellter Wahrheiten!“ Die<br />
unabhängige Perspektive eines Autors<br />
und die journalistische Qualität eines<br />
Beitrages sind Kriterien unserer <strong>Preis</strong>-<br />
Auswahl. Wir fördern kritischen Journalismus<br />
und zeichnen hartnäckige<br />
Recherchen aus. Zum Markenkern<br />
des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es gehört, dass<br />
er keine PR-Arbeiten prämiert oder<br />
bestellte Wahrheiten hofiert.<br />
Zweitens: Der „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>“ steht für<br />
journalistische Vielfalt! Sie werden<br />
* Die Rede zur Verleihung der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für kritischen Journalismus <strong>2010</strong> ist auch als Film-Mitschnitt über die<br />
Homepage des „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es“ zugänglich. (Die Redaktion)<br />
8
sich heute Abend von der spannenden<br />
Vielfalt journalistischer Arbeiten überzeugen<br />
lassen können. Wir zeichnen<br />
einen Fernsehbeitrag aus, der viele Zuschauer<br />
beeindruckt hat. Zeigen aber<br />
auch, wie spannend ein gut gemachtes<br />
Hörfunkstück sein kann. Wir loben die<br />
professionelle Entschlossenheit eines<br />
Newcomer-Teams. Und wir prämieren<br />
einen Blog, der Fehlentwicklungen in<br />
Medien und Politik aufgespürt und viel<br />
Staub aufgewirbelt hat. Wir ehren<br />
„Edel federn“, die sich nicht nur eine<br />
eigene Meinung leisten wollen, sondern<br />
diese auch zum Ausdruck bringen.<br />
Und das mit intellektuellem Mut, glänzender<br />
Schreibe und stilistischer<br />
Sicher heit. Und schließlich vergeben<br />
wir wieder Stipendien, die Nachwuchskräften<br />
finanziellen Freiraum für intensive<br />
Recherchen schaffen sollen.<br />
Diese Vielfalt und Breite zeichnet<br />
unseren <strong>Preis</strong> aus!<br />
Und Drittens: Der „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“ steht<br />
für journalistische Unabhängigkeit! Es<br />
gibt Journalistenpreise, da entscheidet<br />
der Stifter über die <strong>Preis</strong>träger. Da spielt<br />
der Sachverstand von Fachleuten kaum<br />
eine Rolle. Journalistische Kompetenz<br />
ist nur als schmückendes Beiwerk<br />
gefragt. Beim „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“ ist das<br />
anders! Die hohe Wertschätzung, die<br />
er genießt, hängt eng mit seiner Jury<br />
zu sammen. Profil, Professionalität,<br />
Kompetenz, Unabhängigkeit: Dafür<br />
steht sie.<br />
Meine sehr geehrten<br />
Damen und Herren!<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
es ist mir deshalb eine große Freude,<br />
die Mitglieder der Jury begrüßen zu<br />
können.<br />
Liebe Frau Mikich, herzlich Willkommen<br />
und ganz herzlichen Dank für Ihre<br />
engagierte Mitarbeit in der Jury! Und<br />
wir freuen uns sehr, dass Sie wieder<br />
die <strong>Preis</strong>verleihung moderieren.<br />
Herzlich Willkommen, lieber Herr<br />
Schumann! Vielen Dank, dass Sie Ihr<br />
breites Wissen und große Erfahrung<br />
einbringen.<br />
Lieber Herr Prof. Dr. Prantl, herzlich<br />
Willkommen bei der OBS und herzlichen<br />
Dank für Ihr Engagement und<br />
Ihre Unterstützung. Und – soviel Zeit<br />
muß sein – : nachträglich herzlichen<br />
Glückwunsch zur Professur! Außerdem:<br />
Wir wünschen uns, dass Sie als<br />
9
künftiges Mitglied der SZ-Chefredaktion<br />
auch noch Zeit für Ihre unverwechselbaren<br />
Meinungsbeiträge haben.<br />
Lieber Herr Prof. Dr. Lilienthal! Ich heiße<br />
auch Sie herzlich Willkommen. Ich versichere<br />
Ihnen, dass wir froh sind, dass<br />
Sie als einziger Professor für „die Praxis<br />
des Qualitätsjournalismus“ in Deutschland<br />
in der <strong>Brenner</strong>-Jury mitarbeiten.<br />
Lieber Prof. Dr. Thomas Leif, herzlich<br />
Willkommen bei der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung!<br />
Vielen Dank dafür, dass Sie sich<br />
seit Jahren für den <strong>Preis</strong> stark machen<br />
und Ihnen besonders die Nachwuchsförderung<br />
durch unsere Stipendien am<br />
Herzen liegt.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
es ist mir persönlich eine besondere<br />
Freude und für die Stiftung eine Ehre,<br />
die heutige Festrednerin begrüßen zu<br />
können.<br />
Ganz herzlich Willkommen, liebe Frau<br />
Dr. Franziska Augstein!<br />
Wir freuen uns, dass wir die Phalanx<br />
der männlichen Festredner durch -<br />
brochen haben und Sie heute als erste<br />
Journalistin die Ansprache halten.<br />
Frau Augstein wird uns gleich einen<br />
interessanten Einblick in die „Journaille“<br />
geben und dabei von den<br />
Schwierigkeiten berichten, sich „eine<br />
eigene Meinung zu bilden“ – so<br />
zumindest lautet der von ihr gewählte<br />
Titel der Rede. Wir freuen uns und warten<br />
gespannt auf Ihre Ausführungen!<br />
Meine sehr geehrten<br />
Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
ich will die <strong>Preis</strong>verleihung noch für<br />
ein paar persönliche Anmerkungen<br />
nutzen.<br />
Warum – so frage ich mich – strengen<br />
wir uns so wenig an, aus Fehlern, den<br />
eigenen oder denen von anderen, zu<br />
lernen?<br />
Auf dem Höhepunkt der Finanzmarkt-<br />
Krise schien eines klar zu sein: Ein<br />
„Weiter so“ darf es nicht geben. Heute<br />
ist klar: Es geht „Weiter so“. Unter<br />
dem Motto: Auf ein Neues!<br />
Wir befinden uns im Jahr „Eins“ nach<br />
der Krise.<br />
10
Die Strukturen, welche die Krise auslösten,<br />
bestehen unverändert. Nur der<br />
Farbanstrich wird gelegentlich erneuert.<br />
Von einer wirksamen Regulierung<br />
der Finanzmärkte sind wir meilenweit<br />
entfernt. Boni-Zahlungen sind wieder<br />
Alltag. Die Spekulation mit Nahrungsmitteln<br />
und ihren tödlichen Folgen<br />
auch. Anders wirtschaften, nachhaltig<br />
wirtschaften, davon reden viele, nur<br />
wenige handeln danach.<br />
Mein Eindruck ist: Die Phase der Kritik<br />
an der Markt-Gläubigkeit ist bereits<br />
wieder vorbei. Wer in den Abgrund<br />
geschaut hat, der will wahrscheinlich<br />
daran nicht immer wieder erinnert<br />
werden. Nicht die potentiell Leidtragenden,<br />
erst recht nicht die politisch<br />
Verantwortlichen. Andererseits ist die<br />
Empörung weit verbreitet, dass nun<br />
die Opfer der Finanzkrise auch noch<br />
für deren Folgen aufkommen müssen.<br />
Wir haben es also in Öffentlichkeit<br />
und veröffentlichter Meinung mit einer<br />
vielschichtigen Gemengelage zu tun.<br />
Wer sich noch einmal vergegenwärtigt,<br />
wie diese Krise entstanden und verlaufen<br />
ist, der nimmt Daten, Ereignisse<br />
und Entscheidungen zur Kenntnis, die<br />
einem wenigstens im Nachhinein als<br />
fahrlässig, in Teilen fast absurd<br />
erscheinen. Viele Politiker, Wissenschaftler<br />
und Wirtschaftsführer predigten<br />
jahrelang, dass nur freie Märkte<br />
ein Maximum an Wohlstand bringen<br />
und dass der Staat sich so weit wie<br />
möglich zurückziehen sollte. Journalisten<br />
haben diese Ideologie weiter verbreitet<br />
und Politiker haben sie umgesetzt<br />
– unterschiedliche Parteifarben<br />
spielten dabei kaum eine Rolle.<br />
An den Universitäten verdrängten die<br />
Betriebswirte die Volkswirte, die Mikroökonomie<br />
die Makroökonomie. Die<br />
Theorien der Neoklassik, des Monetarismus<br />
und der Angebotsökonomie<br />
verdrängten den Keynesianismus und<br />
die politische Ökonomie.<br />
Der Aufbau einer zockenden Finanz -<br />
industrie wurde nicht als hochriskante<br />
Spekulation kritisiert, sie wurde als<br />
erfolgreiches Geschäft bestaunt und<br />
beklatscht. Die Frage, wie man aus<br />
viel Geld sehr viel mehr Geld machen<br />
kann, ohne den lästigen Umweg über<br />
die Realwirtschaft nehmen zu müssen,<br />
die faszinierte. Kritische Stimmen,<br />
dass dabei der Rest der Welt den Bach<br />
hinunter gehen könnte, haben nicht<br />
wirklich interessiert, kamen gegen den<br />
11
Mainstream nicht an. Und der berechtigte<br />
Hinweis des großen US-Ökonomen<br />
John Kenneth Galbraith, „Finanzgenie<br />
ist man nur bis zum Bankrott“,<br />
wurde nicht gehört.<br />
Mit anderen Worten: Die Krise ist nicht<br />
vom Himmel gefallen, sie ist auch kein<br />
Naturereignis. Sie ist das Ergebnis<br />
menschlichen Willens und politischen<br />
Handelns!<br />
Wie konnte es in den westlichen Öffentlichkeiten,<br />
die alle demokratisch und<br />
offen organisiert sind, die freie Massenmedien<br />
kennen, aber keine Propaganda,<br />
Zensur und Meinungsunter -<br />
drückung, wie konnte es also in die sen<br />
Gesellschaften zu diesem „kollektiven<br />
Wahn“ kommen – wie es der Sozialethiker<br />
Friedhelm Hengsbach genannt<br />
hat. Zu einem kollek tiven Wahn, der<br />
das Denken und Handeln von Börsen,<br />
Aktien, Renditen und Märkten bestimmen<br />
ließ.<br />
Sind den demokratischen Gesellschaften<br />
denn ihre Frühwarnsysteme verloren<br />
gegangen? Und: Funktionieren<br />
sie denn wenigstens in der Zwischenzeit<br />
wieder? Ich habe ernsthafte<br />
Bedenken!<br />
Meines Erachtens steht zumindest<br />
noch eine Aufgabe aus. Eine Aufgabe,<br />
die nichts mit Milliarden und Gesetzen<br />
oder Steuern zu tun hat. Aber mit<br />
geistiger Auseinandersetzung, Orientierung<br />
und dem gemeinsamen öffentlichen<br />
Lernen einer Gesellschaft.<br />
Ich bin sehr dafür, dass das, was<br />
geschehen ist, für die Allgemeinheit<br />
verständlich und zuverlässig rekonstruiert,<br />
analysiert und bewertet wird.<br />
Ich kann aber von einer gründlichen<br />
Aufarbeitung bisher wenig entdecken.<br />
Sie scheint – zumindest von den Eliten<br />
– in einem unausgesprochenen stillen<br />
common sense ad acta gelegt worden<br />
zu sein.<br />
Für mich steht jedenfalls fest: Die<br />
Qualität der öffentlichen Kommunikation<br />
hat direkte Auswirkungen auf die<br />
Qualität der Politik und unserer Demokratie.<br />
Und sie steht und fällt mit der<br />
Qualität der Arbeit der Massenmedien.<br />
Wer vermag es, unsere hoch entwickelten<br />
Gesellschaften davor zu schützen,<br />
in Katastrophen hineinzulaufen? Wer,<br />
wenn nicht eine aufklärende und aufgeklärte<br />
Öffentlichkeit?<br />
12
Ich bin weder Medien-Fachmann noch<br />
Medien-Politiker – und will auch keines<br />
von beiden werden. Aber ich bin selbstverständlich<br />
immer wieder mit Medienfragen<br />
befaßt: als Verwaltungsratsvorsitzender<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung,<br />
die eine viel beachtete Studie zum<br />
Wirtschaftsjournalismus vorgelegt hat<br />
und die im Frühjahr eine Studie zur<br />
„Bild“-Zeitung veröffentlichen wird;<br />
auch als Mitglied der Jury, die über die<br />
<strong>Preis</strong>e entscheidet, die wir heute die<br />
Freude haben überreichen zu können.<br />
Aber vor allem in meiner täglichen<br />
Arbeit als 1. Vorsitzender der IG Metall<br />
bin ich direkt und indirekt mit Fragen<br />
des Zustandes unseres Medien systems<br />
befaßt.<br />
Ich ahne, welchen Zwängen, Einflüssen<br />
und Interessen die meisten Journalisten<br />
tagtäglich bei ihrer Arbeit ausgesetzt<br />
sind: Da gibt es nicht nur die Versuche<br />
von Parteien, im öffentlich-rechtlichen<br />
Mediensystem egoistisch Einfluß zu<br />
nehmen. Da gibt es zahlreiche Institute,<br />
die im Auftrag mächtiger und finanzkräftiger<br />
Auftraggeber versuchen, mit<br />
Umfragen und fragwürdigen Gutachten<br />
die öffentliche Meinung zu steuern.<br />
Ich befürchte, der Fall „Brender“ und<br />
die Manipulationsfabrik „Initiative<br />
Neue Soziale Marktwirtschaft“ bilden<br />
da jeweils nur die Spitze des Eisberges.<br />
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass<br />
das Sparen in und an Redaktionen sehr<br />
wohl dazu führt, schwierige Themen<br />
zu meiden. Und meist sind die schwierigen<br />
Themen die beson ders wichtigen<br />
Themen. Insofern kann Sparen sehr<br />
unspektakulär – und von außen kaum<br />
einsehbar – nach und nach zu letztlich<br />
sehr gravierenden inhaltlichen<br />
Veränderungen in der Auswahl und<br />
Darstellung von Themen führen.<br />
Wir, die Gewerkschaften, und auch die<br />
Gesellschaft insgesamt sollten ein<br />
Interesse an einem gut ausgestatteten<br />
und unabhängig kritisch arbeitenden<br />
Journalismus haben. (Auch dann, wenn<br />
er uns ärgert.) Denn nur er kann der für<br />
diese Demokratie zentralen Aufgaben<br />
nachkommen, ein möglichst breites<br />
Publikum gut zu informieren, ihm verläßlich<br />
Aufklärung zu bieten und bei bedeutenden<br />
Themen und Kontroversen<br />
als Frühwarnsystem zu funktionieren.<br />
Aber: Wie können Redaktionen eine<br />
demokratische öffentliche Diskussion<br />
befördern, deren interne Arbeitsprozesse<br />
geprägt sind: von Hierarchien<br />
13
und Kostendruck, von unsicheren<br />
Beschäftigungsbedingungen und<br />
Personalabbau und von einem oft<br />
vermachteten Meinungsklima?<br />
Ich ziehe aus diesen Rahmenbedingungen<br />
und Fragen einen Schluß: Wir<br />
brauchen eine ernsthafte öffentliche<br />
Debatte über die Produktionsbedingungen<br />
der veröffentlichten Meinung!<br />
In meinen Augen sind Investitionen in<br />
guten Journalismus und die Verbreitung<br />
seiner Produkte Investitionen in<br />
die gesellschaftliche Risikovorsorge,<br />
Investitionen in die Infrastruktur der<br />
Demokratie und Investitionen in die<br />
Mündigkeit der Bürger. Wenn die<br />
Gesellschaft das journalistische System<br />
als eines ihrer Frühwarnsysteme<br />
haben will, dann muß es materiell,<br />
rechtlich und ideell auch so ausgestattet<br />
werden, dass es dieser Aufgabe<br />
besser nachkommen kann.<br />
Hinter diesem Appell steht nicht der<br />
Ruf nach mehr Staat, sondern das ist<br />
ein Plädoyer für eine andere Medienpolitik.<br />
Einer Medienpolitik, die die<br />
Unabhängigkeit des Journalismus<br />
fördert, indem sie dessen Rahmen bedingungen<br />
verbessert. Dafür ist eine<br />
ebenso harte wie hartnäckige Debatte<br />
über die Leistungen des öffentlichrechtlichen<br />
Mediensystems zu führen.<br />
Ich spreche in besonderer Weise über<br />
den unabhängigen öffentlich-rechtlichen<br />
Journalismus, weil er noch viel<br />
mehr als der privat-wirtschaftlich organisierte<br />
Journalismus ein Dienstleister<br />
für Öffentlichkeit, Gesellschaft und<br />
Demokratie zu sein hat. Deshalb werden<br />
an ihn auch besonders hohe<br />
Anforderungen gestellt. Das ist als<br />
Auszeichnung gedacht und als Vertrauensbeweis<br />
zu verstehen.<br />
Aber auch als Herausforderung: Es<br />
wäre an der Zeit, dass das öffentlichrechtliche<br />
Fernsehen, das ein Millionen-<br />
Publikum anspricht, den Ehrgeiz entwickelt,<br />
journalistische Leuchttürme in<br />
der Wirtschafts-Berichterstattung zu<br />
schaffen, die Vorbild für andere<br />
Medien sein könnten.<br />
Liebe Gäste!<br />
Ich sehe die Qualität des Wirtschafts-<br />
Journalismus und des wirtschaftspolitischen<br />
Journalismus auch in einem<br />
engen Zusammenhang mit der Qualität<br />
und Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften.<br />
Kann es guten unabhängigen<br />
14
Wirtschaftsjournalismus geben, wenn<br />
er kaum auf das Wissen von kritischen<br />
Wirtschaftswissenschaften zurückgreifen<br />
kann? Es wird deshalb auch darum<br />
gehen, die selbstkritische Diskussion<br />
der Wirtschaftswissenschaften mit<br />
wei teren Interventionen von außen<br />
zu befördern.<br />
gleich. Sie müssen dieses Projekt der<br />
Aufklärung zu ihrer Sache machen!<br />
Ich danke für die Aufmerksamkeit! –<br />
Und wünsche allen einen schönen<br />
Abend.<br />
Auch diese Debatte kann und muß in<br />
ihren wichtigen Teilen in Medien ge -<br />
führt werden. Morgen, bei der OBS-<br />
Jahrestagung, werden wir das Thema<br />
aufgreifen.<br />
Ich wiederhole heute Abend gerne,<br />
was ich schon mehrmals gefordert<br />
habe: Die Ursachen für die bisher mehr<br />
schlecht als recht bewältigte Finanzmarkt-<br />
und Wirtschaftskrise müssen<br />
öffentlich aufgearbeitet, Ross und<br />
Reiter endlich benannt werden. Es<br />
geht mir um eine im besten Wortsinn<br />
rücksichtslose Aufarbeitung. Eine Aufarbeitung,<br />
bei der meines Erachtens<br />
nicht einmal das Ergebnis, sondern der<br />
Weg, der Prozeß das Entscheidende ist.<br />
Das wird nur gehen, wenn wir die<br />
Massenmedien und den Qualitätsjournalismus<br />
dafür gewinnen. Wir brauchen<br />
sie als Forum und treibende Kraft zu -<br />
Berthold Huber, Verwaltungsratsvorsitzender<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung und Mitglied der<br />
„<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“-Jury<br />
15
FESTREDE
Franziska Augstein<br />
Festrede zur Verleihung der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für<br />
kritischen Journalismus <strong>2010</strong>
Meine sehr geehrten Damen<br />
und Herren!<br />
Die vergangenen Wochen und Monate<br />
waren nicht gerade, was man als<br />
Glanzzeit des deutschen Journalismus<br />
bezeichnen kann. Sie zeugten vielfach<br />
von der Neigung unserer Profession,<br />
sich lieber mit uns selbst und unseren<br />
jeweiligen publizistischen Gegnern als<br />
mit den DINGEN zu beschäftigen.<br />
In der 14. Ausgabe der „Encyclopedia<br />
Britannica“, die 1929 erschien, wird der<br />
„Journalist“ folgendermaßen definiert:<br />
„Während Qualifikation und Status von<br />
Geistlichen, Ärzten und vielen anderen<br />
Berufen klar umschrieben sind, folgt<br />
der Journalist immer noch einer eher<br />
vagen Berufung, bei der weder was er<br />
können muß, noch was er darstellt,<br />
präzise definiert ist.“ Mit anderen Worten:<br />
Journalisten wissen nicht ganz<br />
genau, was sie tun. Und die Öffentlichkeit<br />
weiß es auch nicht. Weil ich selbst<br />
Journalistin bin, will ich nicht behaupten,<br />
hier jetzt Licht ins Dunkel zu bringen.<br />
Zumal, da die Berufe von Ärzten<br />
und Geistlichen auch nicht ganz so präzise<br />
umrissen sind, wie die „Encyclopedia<br />
Britannica“ sich das 1929 vorgestellt<br />
hat: Mancher Arzt tut sich als Prediger<br />
hervor, und mancher Geistliche<br />
ist ein ökonomischer Analyst erster Güte.<br />
Ich mache heute das, was wir Journalisten<br />
am liebsten machen: Die Journaille<br />
kritisieren – und ein bißchen loben.<br />
Einige Usancen sind eingerissen, die<br />
wir alle mitbetreiben, die aber in dem<br />
Maße, wie wir es tun, zur Verdunkelung<br />
der Dinge beitragen und uns, den Journalisten,<br />
nicht zu Lob gereichen.<br />
Man kennt die Geschichte, sie datiert<br />
in einer unerleuchteten Epoche: Da<br />
betritt ein Mann ein Dorf und schreit:<br />
„Das Ende ist nahe. Währet dem Übel,<br />
bevor es euch verschlingt!“ In dem Fall,<br />
an den ich denke, lautet der Satz so:<br />
„Das Muster des generativen Verhaltens<br />
in Deutschland seit Mitte der<br />
sechziger Jahre ist (...) eine (...) negative<br />
Selektion, die den einzigen nachwachsenden<br />
Rohstoff, den Deutschland<br />
hat, nämlich Intelligenz, relativ und<br />
absolut in hohem Tempo vermindert.“<br />
Tja, wenn die Dorfbewohner gerade<br />
nichts Besseres zu tun haben, dann<br />
Die Festrede zur Verleihung der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für kritischen Journalismus <strong>2010</strong> ist auch als Film-Mitschnitt über<br />
die Homepage des „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es“ zugänglich. (Die Redaktion)<br />
18
lauschen sie Thilo Sarrazin. Und<br />
siehe: Der Mann sagt den Dorfbewohnern,<br />
dass sie alle gut sind, nur die<br />
Auswärtigen, die sind schlecht. Die<br />
Vermehrung der Auswärtigen, der<br />
genetisch Minderbemittelten, müsse<br />
man verhindern. Zu den genetisch<br />
Minderbemittelten zählt er dann auch<br />
pikanterweise jene Dorfbewohner, die<br />
seit jeher im Nordosten der Gemeinde<br />
leben. Daraufhin zerteilt sich die Dorfgemeinschaft:<br />
Die eine Hälfte sagt:<br />
„Das musste endlich mal gesagt werden!“<br />
Und die andere Hälfte sagt: Diejenigen,<br />
die sagen, dass das endlich<br />
mal gesagt werden musste: sie sind<br />
mit dem Klammerbeutel gepudert,<br />
haben als Kind zu heiß gebadet, haben<br />
keine Ahnung von der Wirklichkeit.<br />
Oscar Wilde war nahe an der Realität,<br />
als er feststellte (ich übersetze frei):<br />
„Der moderne Journalismus hat viel für<br />
sich. Indem er bildungsfern argumentiert,<br />
bleiben wir im Kontakt mit der Unwissenheit<br />
der Allgemeinheit.“ Oscar<br />
Wilde hatte bekanntlich fast immer<br />
recht: Thilo Sarrazins Thesen sind in der<br />
Tat bildungsfern. Warum sie es sind,<br />
haben aber ein paar kenntnisreiche<br />
Journalisten klargemacht, indem sie die<br />
Argumente seines Buches sauber zerlegten.<br />
Auf die Argumente gehe ich jetzt<br />
nicht ein. Mich interessiert heute: Wie<br />
kam es dazu? Warum bekommt ein<br />
Mann soviel Aufmerksamkeit, dessen<br />
halbgare Thesen alle vulgären Gemeinheiten<br />
in den Schatten stellen, die der<br />
Christdemokrat Roland Koch gegen die<br />
Ausländer vorgebracht hat, als er sich<br />
2003 wieder zum Ministerpräsidenten<br />
von Hessen wählen ließ?<br />
Das hat wenig mit der deutschen „Kollektiv-Seele“<br />
zu tun und sehr viel mit<br />
dem Einfluss der Medien: Die „Bildzeitung“<br />
und der „Spiegel“ haben Vorabdrucke<br />
aus Sarrazins Buch gebracht.<br />
Sarrazin war eh’ schon als eigener Kopf<br />
bekannt. Ich glaube aber: Wäre sein<br />
Buch in den Medien nicht prominent<br />
vorgestellt worden, wäre es nicht zu<br />
einem Bestseller geworden. Der Vorabdruck:<br />
Zur „Bildzeitung“ passt das. Sie<br />
ist im Zweifelsfall national und ausländerfeindlich.<br />
Zum „Spiegel“ passt es<br />
weniger. Der verhielt sich anschließend<br />
denn auch wie der Wilderer, der – das<br />
tote Rehkitz auf der Schulter – vom Förster<br />
erwischt wird: „Hab ich dich!“ sagt<br />
der Förster. Und der Wilderer sagt: „Wie<br />
denn? Was!?“ Und der Förster sagt:<br />
„Na, und was ist das da auf deiner<br />
Schulter?“ Der Wilderer wendet den<br />
19
Kopf, entdeckt das Corpus Delicti auf<br />
seiner Schulter und ruft aus: „huuch!!“<br />
So erging es dem „Spiegel“, der sich<br />
anschließend wirklich Mühe gegeben<br />
hat, die Scharte auszuwetzen. Am besten<br />
hat mir der jüngste „Kinder-Spiegel“<br />
gefallen: Der wird aufgemacht mit einer<br />
16-jährigen Gymnasiastin, die erklärt<br />
„Warum ich ein Kopftuch trage“.<br />
Das Problem an der gesamten Bericht -<br />
erstattung über Sarrazin besteht darin:<br />
Es ging vornehmlich um Sarrazin, es<br />
ging nicht um die eigentliche Frage:<br />
Wie finden wir in unserem Land ein<br />
Verhältnis zwischen den verschiedenen<br />
Bevölkerungsgruppen? Gegen Ausländer<br />
wird gern vorgebracht, dass sie<br />
dem Staat auf der Tasche lägen. Das<br />
gilt für viele Menschen mit fremdem<br />
Pass aber gar nicht. Für viele Deutsche<br />
hingegen gilt es. In kaum einem europäischen<br />
Land ist die Gesellschaft –<br />
statistisch gesehen – so undurchlässig<br />
wie in Deutschland: Wer arm geboren<br />
wird, bleibt arm. Die Bundesrepublik<br />
ist, was das angeht, hermetischer,<br />
ungerechter als viele andere Länder –<br />
Länder, deren Bruttosozialprodukt weit<br />
unter dem unseren liegt. Chancengleichheit:<br />
darum geht es. Bei uns ist sie<br />
weniger ausgeprägt als in den meisten<br />
anderen europäischen Ländern.<br />
Unsere Medien neigen dazu, auch noch<br />
die wichtigsten Themen zu persona -<br />
lisieren. So kommt es dann dazu, dass<br />
Thilo Sarrazin in der Tageszeitung „Die<br />
Welt“ verteidigt wird: Er sei ein „Sündenbock“,<br />
er werde dafür angeklagt,<br />
dass er ausgesprochen habe, was viele<br />
denken. Die Wahrheit ist: Die Ausgegrenzten<br />
sind die Sündenböcke: Sie<br />
müssen dafür zahlen, dass die Gesellschaft<br />
seit Jahrzehnten verabsäumt,<br />
für alle Kinder und Jugendlichen gute<br />
Ausbildungsstätten einzurichten.<br />
Stichwort: Personalisierung. Das ist<br />
generell ein Trend, der in der Presse<br />
von Übel ist. Manche Wirtschaftsteile<br />
lesen sich streckenweise wie die ausgewalzte<br />
Form der beliebten Rubrik<br />
„Das Vermischte“. Da werden Firmenchefs<br />
und Firmenchefinnen porträtiert<br />
so wie sonst Filmstarlets. In der Politik<br />
erleben wir das seit langem. Das ist ja<br />
auch verständlich: Mühsam ist es aus<br />
dem Wörterwust der Politiker Überzeugungen<br />
zu destillieren. Viel einfacher ist<br />
es, über die Leute selbst zu schreiben.<br />
– Dies dann auch gern so oberflächlich,<br />
dass es schon statistisch messbar ist.<br />
Angela Merkel hat bekanntermaßen in<br />
20
der DDR in Physik promoviert. In den<br />
vergangenen zehn Jahren ist sie in den<br />
größeren Zeitungen, von den kleinen<br />
rede ich heute nicht, mehr als 1600 mal<br />
als „Physikerin“ tituliert worden, hunderte<br />
Male als „promovierte Physikerin“.<br />
Der Begriff wurde sehr oft eingesetzt,<br />
um ihren Charakter zu beschreiben. Vor<br />
allem, als es während des Bundestagswahlkampfes<br />
2005 darum ging, Merkel<br />
gegenüber Schröder stark zu machen,<br />
wurde ihr Beruf für sie ins Feld geführt.<br />
Ich zitiere – pars pro toto – aus einem<br />
zeitgenös sischen Artikel in der „Süddeutschen<br />
Zeitung“: „Angela Merkel ist<br />
Physikerin. Sie ist gewohnt, die Dinge<br />
von ihrem Ende her zu denken.“<br />
Ja, ganz im Gegensatz zu – sagen wir<br />
– Metzgern, die wissen, dass jede Wurst<br />
zwei Enden hat, denkt Frau Merkel nur<br />
von einem Ende her. Erstaun licherweise<br />
hat aber auch jeder Metzger die<br />
Angewohnheit, die Dinge „von ihrem<br />
Ende her“ zu denken, im Bezug auf die<br />
Frage nämlich, was er machen muss,<br />
damit sein Geschäft läuft und er bei Jahresende<br />
nicht verschuldet ist. Soviel dazu,<br />
was Angela Merkel als „promovierter<br />
Physikerin“ alles zugute gehalten wird.<br />
Als die Presse 2005 Gerhard Schröder<br />
mehr oder minder unisono runtergeschrieben<br />
hat, wurde aus dem Umstand,<br />
dass Angela Merkel 1986 in<br />
Physik promovierte, alles Mögliche<br />
gemacht. Heute, da die Presse mehr<br />
oder minder unisono für Frau Merkel<br />
nichts mehr übrig hat, hält auch wieder<br />
ihr Studium zur Erklärung her, dies zum<br />
Beispiel unter dem Titel „Das Ende der<br />
Physik“. In dem Artikel wurde übrigens<br />
nicht ihre falsche Politik, sondern ihre<br />
mangelnde Emotionalität beklagt.<br />
Personalisierung ist eine feine Sache.<br />
Wer mag schon erklären, was es mit der<br />
Föderalismusreform auf sich hat? Wer<br />
mag uns näher Einblick geben in die<br />
Wege und Umwege der EU-Verwaltung?<br />
Und vor allem: Wer dankt es den Autoren,<br />
die das tun? Viel einfacher ist es,<br />
derlei Dinge anhand eines Menschen,<br />
eines Politikers darzustellen. Das macht<br />
zwar nichts verständlich, füllt aber das<br />
aus, was die Leute, die in einer Zeitung<br />
für die Werbeanzeigen zuständig sind,<br />
als „Restraum“ bezeichnen. Wenn man<br />
sich als Journalist damit zufrieden gibt,<br />
vom Beruf eines Menschen auf seinen<br />
Charakter zu schließen, hat man auch<br />
nicht viel Arbeit mit einem Porträt. Diese<br />
Haltung wird weithin befördert. Die<br />
meisten Chefredaktionen brauchen Leute,<br />
die viel schreiben – wenn sie keinen<br />
21
Skan dal initiieren können, dann sollen<br />
ihre Texte wenigstens gefühlvoll sein.<br />
Ich will noch etwas bei der Personalisierung<br />
bleiben. Damit einher geht ein<br />
wirklich fataler Umstand: Es hat den Anschein,<br />
dass viele Journalisten sich kein<br />
eigenes Urteil mehr zutrauen. Wenn<br />
Fernseh-Journalisten Interviews führen,<br />
dann fragen sie zum Beispiel gern:<br />
„Wie erklären Sie sich Ihre schlechten<br />
Umfragewerte?“ Und die schreibenden<br />
Journalisten halten es zunehmend genauso.<br />
Da wird zunehmend nicht über<br />
die Arbeit eines Politikers debattiert,<br />
sondern darüber, wie sie ankommt.<br />
Das ist ziemlich absurd. Journalisten<br />
sollten diejenigen sein, die den Politikern<br />
mitteilen, wie ihre Arbeit bei ihnen<br />
ankommt: was sie selbst davon halten.<br />
Stattdessen ziehen die Kollegen sich<br />
oft auf Meinungsumfragen zurück.<br />
Auf diese Weise ist ein Ehepaar hochgespült<br />
worden auf den Wellen der<br />
Meinungsumfragen, das nur in einer<br />
Hinsicht anders ist als andere Politikerehepaare:<br />
Die beiden sind von Adel.<br />
Während „Zeit“, „SZ“ und andere sich<br />
Anfang 2009 noch ein bisschen über<br />
Guttenbergs Gelfrisur lustig machten,<br />
hatten „Welt“ und „Bild“ im Sommer<br />
desselben Jahres begriffen, in welche<br />
Richtung der Zeitgeist ging. In der<br />
„Welt“ war zu lesen: „Er gelt sein Haar,<br />
spielt Klavier, besucht den Gottesdienst<br />
und ist Fan der AC/DC- Hardrocker ...<br />
Mit dieser Harmonie der Gegensätze<br />
befreit ausgerechnet ein Adeliger das<br />
Bürgerliche vom Stigma des Spießigen.“<br />
Eine kleine Frage: Brauchen wir einen<br />
Wirtschafts- oder Verteidigungsminister,<br />
der das Bürgerliche vom Stigma<br />
des Spießigen befreit? Sicher, es gab<br />
auch andere Nachrichten über Guttenberg.<br />
Da war zum Beispiel die dumme<br />
Geschichte mit den Tanklastern in<br />
Kundus. Da hat er sich als unerfahrener<br />
Verteidigungsminister allzu schnell eine<br />
Meinung gebildet, wofür dann zwei<br />
hochrangige Bundeswehroffiziere<br />
büßen mussten. Aber davon ist nicht<br />
mehr die Rede. Guttenberg wird in den<br />
Medien als Selbstdarsteller vorgestellt,<br />
als eine Art Filmstar: da kommt es nur<br />
auf die Darbietung an, nicht auf die<br />
innere Substanz. Die mag er sogar ha -<br />
ben, aber davon erfährt das Publikum<br />
nichts. Das Publikum wird beschallt<br />
mit den Ergebnissen von Meinungsumfragen.<br />
Mittlerweile trauen angeblich<br />
44 Prozent aller Bürger der Ehefrau zu,<br />
dass sie Familienministerin werde. Die<br />
22
Medien, die solche Nachrichten verbreiten<br />
und das betreiben, was man<br />
heutzutage „Hype“ nennt, sind Trendsetter.<br />
Sie selbst sehen sich aber nur<br />
als Berichterstatter. Diese Verkehrung<br />
des Selbstverständnisses der Medien<br />
ist nicht ungefährlich.<br />
Wenn wir einen solchen Journalismus<br />
nicht wollen, dann brauchen wir einen<br />
starken Nachwuchs. Dann brauchen<br />
wir einen Nachwuchs, der die Sachen<br />
so gut kennt, dass er nicht auf Artikel<br />
über Personen ausweichen muss.<br />
Dann brauchen wir junge Journalisten,<br />
die ordentlich studiert haben, und die,<br />
mit exzellentem Fachwissen, mit Fleiß<br />
und mit Leidenschaft den Dingen auf<br />
den Grund und nicht den Personen auf<br />
den Leim gehen. Journalismus ist keine<br />
Live-Style-Veranstaltung. Die Pressefreiheit<br />
ist nicht die Freiheit, in den<br />
Medien politische Parties zu veranstalten;<br />
jedenfalls ist sie nicht in<br />
erster Linie dafür da. Vielleicht ist also<br />
das allererste, was junge Journalisten<br />
lernen müssen, das, was so viele ihrer<br />
alten Kollegen vergessen haben: Journalismus<br />
ist nicht zur Selbstbefrie digung<br />
da und Pressefreiheit nicht dafür,<br />
sich die Arbeit leicht zu machen.<br />
Gustav Freytags Lustspiel „Die Journalisten“<br />
ist 1852 in Breslau uraufgeführt<br />
worden. Es wird heute auf den Bühnen<br />
nicht mehr gespielt, wahrscheinlich<br />
deswegen, weil es ohnehin täglich in<br />
den Verlagshäusern zur Aufführung<br />
kommt. In diesem Stück wird eine<br />
Zeitung von einer neuen Verlegerin<br />
namens Adelheid aufgekauft – die den<br />
Redakteur Bolz dann befragt: „Nun,<br />
Herr Bolz, was soll ich mit Ihnen an -<br />
fan gen?“ Der Kollege Bolz antwortet:<br />
„Ich bin auf alles gefasst; ich wundere<br />
mich über nichts mehr. – Wenn nächstens<br />
jemand ein Kapital von hundert<br />
Millionen darauf verwendet, alle Neger<br />
mit weißer Ölfarbe anzustreichen oder<br />
Afrika viereckig zu machen, mich soll’s<br />
nicht wundern. Wenn ich morgens als<br />
Uhu aufwache, mit zwei Federbüscheln<br />
statt Ohren und mit einer Maus im<br />
Schnabel, ich will zufrieden sein.“<br />
So leicht, so ohne weiteres sollte ein<br />
Journalist nicht zufrieden sein.<br />
Franziska Augstein schreibt seit Anfang 2001<br />
für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung<br />
und betreut seit Jahresbeginn <strong>2010</strong> redaktionell<br />
die Rubrik „Das politische Buch“<br />
23
1 2<br />
3<br />
1 „Newcomer“ Karin Prummer und<br />
Dominik Stawski nach der <strong>Preis</strong>übergabe<br />
2 Jury-Mitglied Volker Lilienthal<br />
bei der Laudatio für den 3. <strong>Preis</strong><br />
3 Jupp Legrand überreicht Alfons<br />
Pieper die Urkunde für den Medienprojekt-<strong>Preis</strong><br />
4 Jury-Mitglied<br />
Heribert Prantl bei der Laudatio auf<br />
den 1. <strong>Preis</strong> 5 Carolin Emcke<br />
zwischen Christoph Lütgert und<br />
Willi Winkler<br />
4 5<br />
24
1 2<br />
3 4<br />
5<br />
1 Jury-Mitglieder verfolgen<br />
die <strong>Preis</strong>verleihung aus<br />
der ersten Reihe<br />
2 „Spezial“-<strong>Preis</strong>träger Willi Winkler<br />
beim Interview 3 Carolin Emcke steht<br />
Moderatorin Sonia Seymour<br />
Mikich Rede und Antwort<br />
4 Moderatorin Sonia Seymour Mikich<br />
im Interview mit Markus Metz, links,<br />
und Georg Seeßlen, Mitte<br />
5 „KiK-Team“ mit NDR-Justitiar<br />
Klaus Siekmann, hinten mit Fliege<br />
6 Jury-Mitglied Harald Schumann<br />
laudatiert den 2. <strong>Preis</strong><br />
6<br />
25
DIE PREISTRÄGER <strong>2010</strong>
Carolin Emcke<br />
Christoph Lütgert mit Team<br />
Markus Metz und<br />
Georg Seeßlen<br />
Willi Winkler<br />
Karin Prummer und<br />
Dominik Stawski<br />
Alfons Pieper
1. <strong>Preis</strong>
29<br />
Carolin Emcke
„Liberaler Rassismus“ (DIE ZEIT, 25. Februar <strong>2010</strong>)<br />
Der Islam soll eine Gefahr für Europa sein – stimmt das? Carolin Emcke plädiert gegen die<br />
Furcht vor den Fremden. In der französischen Islamdebatte zeigt sich das neurotische<br />
Verhältnis des Landes zur Religion. In den Niederlanden führt der Politiker Geert Wilders<br />
vor, wie man mit Demagogie gegen Muslime Stimmen gewinnt.<br />
Carolin Emcke<br />
geboren 1967 in Hamburg<br />
Werdegang:<br />
2007 Freie internationale Reporterin und Autorin, u. a. für DIE ZEIT<br />
2006-2007 Beraterin des Studiengangs „Journalismus“ der Hamburg Media School<br />
1998-2006 „Spiegel“-Redakteurin, als Auslandsredakteurin vornehmlich<br />
in Krisenregionen<br />
2004-2005 Moderation der monatlichen Diskussionsveranstaltung „Streitraum“<br />
an der Schaubühne Berlin<br />
2003-2004 Visiting Professor für Politische Theorie an der Yale University (USA)<br />
1998 Promotion in Philosophie mit einer Dissertation über den Begriff<br />
„Kollektive Identitäten“<br />
1995-1996 Visting Fellow am Department of Political Science der Harvard University<br />
1993 M.A. in Philosophie an der Goethe-Universität, Frankfurt a.M.<br />
Veröffentlichungen, u. a.:<br />
„Kollektive Identitäten – sozialphilosophische Grundlagen“, Frankfurt 2000<br />
„Von den Kriegen – Briefe an Freunde“, Frankfurt 2004<br />
„Stumme Gewalt – Nachdenken über die RAF“, Frankfurt 2008<br />
30
Auszeichnungen:<br />
„Das politische Buch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung (2005)<br />
Förderpreis des Ernst-Bloch-<strong>Preis</strong>es (2006)<br />
Theodor-Wolff-<strong>Preis</strong> (2008)<br />
Deutscher Reporterpreis (<strong>2010</strong>)<br />
Journalistin des Jahres (<strong>2010</strong>)<br />
Homepage:<br />
www.carolin-emcke.de<br />
31
Begründung der Jury<br />
Wenn man einen Text schreibt, wie den, für den Carolin Emcke ausgezeichnet wird,<br />
muß man vor allem mit Widerwärtigkeiten rechnen. Dann kriegt man nicht nur die Briefe<br />
der Ewiggestrigen, die ihre Geiferei und ihre Tiraden mit einem Hakenkreuz unterschreiben.<br />
Dann kriegt man nicht nur maßlose Beschimpfungen und Beleidigungen, wie<br />
sie jeder kennt, der für ein gutes Miteinander von Alt- und Neubürgern in Deutschland<br />
wirbt. Wenn man Muslime gegen Pauchalverdammungen verteidigt, wie Carolin Emcke<br />
das in brillanter Weise getan hat, erlebt man Reaktionen, wie man sie in einer halbwegs<br />
aufgeklärten Gesellschaft nicht für möglich gehalten hätte. Es ist, als sei ein Teil der<br />
bürgerlichen Gesellschaft mit dem Buch von Sarrazin im Marschgepäck zu einem<br />
neuen Kreuzzug aufgebrochen.<br />
Aber Carolin Emcke ist keine, die sich einschüchtern lässt. Carolin Emcke ist eine Ausnahmejournalistin.<br />
Sie ist es nicht nur deswegen, weil sie oft in den Ausnahmegebieten<br />
der Welt arbeitet, also im Irak, im Iran oder in Afghanistan. Sie ist es deswegen, weil<br />
sie (früher beim „Spiegel“, heute vor allem für die „Zeit“) mit einer gedanklichen und<br />
sprachlichen Präzision arbeitet, die ihresgleichen sucht – und mit einem intellektu -<br />
ellen Mut, der bewundernswert ist. Wer wissen will, was aufklärerischer Journalismus ist,<br />
der muss Carolin Emcke lesen. Wer wissen will, warum die Debatte über den Islam in<br />
Deutschland so schauerlich falsch läuft, der muss ihren ausgezeichneten Text studieren.<br />
Der ausgezeichnete Text heißt: „Liberaler Rassismus“. Schon diesen Titel halten die<br />
liberalen und die bürgerlichen Anhänger von Sarrazin und Co für eine Unverschämtheit,<br />
und sie haben recht, weil dieser Text ihnen sagt, warum sie sich schämen müssen:<br />
deshalb, weil der liberale Rassismus sein eigenes Wertesystem missbraucht, wenn er<br />
scheinbar gegen den Rassismus vorgeht, aber den Islam als Ganzes verteufelt. Er missbraucht<br />
sein eigenes Wertesystem, wenn er gegen die Unterdrückung der Frau kämpft,<br />
aber tatsächlich die freie Ausübung des Glaubens verhindern will.<br />
Der neue, modische Rassismus macht alle Muslime für die Fundamentalisten haftbar.<br />
Der belgische Extremist Wilders treibt das auf die Spitze, indem er den Islam auf ei ne<br />
Stufe stellt mit dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Aber damit ist Wilders<br />
wohl gar nicht Extremist, sondern Exponent und Exponat des breiten liberalen<br />
32
Rassismus, den Emcke so eindrucksvoll kritisiert. Carolin Emcke zeigt, wie die Ideale der<br />
Aufklärung pervertiert werden: weil man unter ihrem Deckmantel die Anhänger einer<br />
Weltreligion als Gefahrpersonen pauschalisiert. Emcke appelliert daher, nicht auf das<br />
Kopftuch zu schauen, sondern auf den Menschen darunter: Im Iran, darauf weist sie eindringlich<br />
hin, kämpfen kopftuchtragende Frauen gegen ein Regime der Unterdrückung.<br />
Emcke schwimmt gegen die gängige Meinung; aber sie schwimmt nicht nur; sie argu -<br />
mentiert: sie tut es klug, mit dem präzisen Blick der Kriegsreporterin und mit der<br />
Erfahrung der Journalistin, die die Krisengebiete der Welt kennt. Carolin Emcke schreibt<br />
an gegen die Mehrheitsmeinung – mit dem Mut, der sie als Reporterin in Kriegsgebiete<br />
geführt hat, die von anderen Journalisten nicht mehr betreten werden. Ihr Essay wider<br />
den liberalen Rassismus steht in einer großen geistigen Tradition, in einer Tradition<br />
wider die Kreuzzügler und die Islamophobie, in einer aufgeklärten Tradition des Rationalismus,<br />
die einst mit John Wiclif und Nikolaus von Cues begonnen hat.<br />
Vielleicht erstaunt es unsere <strong>Preis</strong>trägerin, wenn ich ihr einen katholischen Streit -<br />
genossen zur Seite stelle, den verstorbenen Wiener Kardinal Franz König, einen der<br />
ganz Großen der katholischen Religion im 20. Jahrhundert. Er hat vor zwölf Jahren in<br />
einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt: Europa sei zwar durch das<br />
Christentum geprägt und geformt worden; das könne aber heute nicht einfach kopiert<br />
und neu aufgelegt werden. Und auf die Frage, ob er denn die „islamistische Herausforderung“<br />
nicht sehe, antwortete er: „Wenn man nur in der Vergangenheit lebt, ist<br />
das richtig. In der Zukunft muss man zu einem gegenseitigen Respektieren kommen.<br />
Es mag sein, dass momentan das Interesse an einem Dialog nicht besonders groß ist,<br />
aber: Wir – Christentum und Islam, Türkei und Europa – müssen miteinander leben,<br />
nicht nebeneinander.“ Und dann sagte der alte Mann etwas Europäisch-Programmatisches:<br />
„Wir haben so viele verschiedene Kulturen auf heimatlichem Boden, dieser<br />
Reichtum darf nicht nivelliert werden, er muss das vereinte Europa prägen. Der Reichtum<br />
der Sprachen, der Kulturen, der Traditionen und Religionen – er muß hinein<br />
genommen werden in einer wirkliche Union.“<br />
33
Dem weisen alten Kardinal würde wohl heute vorgeworfen werden, was auch Carolin<br />
Emcke vorgeworfen wurde: Diese Argumentation verfolge „eine hinlänglich bekannte<br />
Strategie der Verharmlosung“. Welch ein Unsinn. Der alte Kardinal, er war ein geistiger<br />
Vater des 2. Vatikanischen Konzils, hat für den gegenseitigen Respekt der Kulturen und<br />
Religionen geworben. Und dafür wirbt auch der ausgezeichnete Text von Carolin Emcke.<br />
Es geht nicht nur um Toleranz; es geht um Respekt. Der Gegenbegriff zur Toleranz ist<br />
nämlich die Intoleranz – wir wissen, wie leicht der Wechsel dorthin ist, wie wenig es<br />
hierzu bedarf und wie schwer es ist, wieder zurück zu finden von der Intoleranz zur<br />
Toleranz. Wir brauchen also etwas Tieferliegendes, etwas, das nicht so leicht entwurzelt<br />
werden kann – Respekt. Das Verhältnis des katholischen zum protestantischen Bürger<br />
oder des protestantischen zum katholischen Bürger ist dafür ein Vorbild: sich gegenseitig<br />
nicht nur gewähren, sondern gelten lassen.<br />
„Wir – Christentum und Islam, Türkei und Europa – müssen miteinander leben, nicht<br />
nebeneinander“. Der Satz könnte auch auf der <strong>Preis</strong>urkunde für Carolin Emcke stehen.<br />
Wir zeichnen Carolin Emcke aus, weil aufgeklärte Vernunft in diesen aufgeregten Zeiten<br />
einen ersten <strong>Preis</strong> verdient – und weil ihr Text auf glänzende Weise für das Miteinander<br />
der Menschen, ihrer Kulturen und Religionen wirbt.<br />
vorgetragen von Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
34
Liberaler Rassismus<br />
Die Gegner des Islams tun so, als würden sie Aufklärung und Moderne<br />
verteidigen. In Wahrheit predigen sie den Fremdenhass *<br />
Von dem afroamerikanischen Komiker und Entertainer Bert Williams stammt<br />
der Satz: »Es ist keine Schande, schwarz zu sein. Aber es ist enorm ungünstig.«<br />
Dieser Tage gilt: Es ist keine Schande, Muslim in Europa zu sein, aber es ist<br />
enorm ungünstig.<br />
Muslime im Singular scheint es nicht mehr zu geben. Sie sind als Individuen<br />
unsichtbar, als Leute, denen ihre Mitgliedschaft im lokalen Fußballverein oder<br />
ihre Arbeit als Krankenpfleger wichtiger sein könnte als ihre Herkunft aus Bosnien<br />
oder Afghanistan. Muslime gibt es gegenwärtig selten als Lehrer oder Schlosser,<br />
als Liebhaber von Neil Young oder Munir Bashir, Muslime gibt es selten als gläubig<br />
und schwul, als Atheisten oder Opelaner – nicht weil es sie nicht gäbe, sondern<br />
weil sie so nicht mehr wahrgenommen werden.<br />
Jeder einzelne Muslim wird verantwortlich gemacht für Suren, an die er nicht<br />
glaubt, für orthodoxe Dogmatiker, die er nicht kennt, für gewalttätige Terroristen,<br />
die er ablehnt, oder für brutale Regime in Ländern, aus denen er selbst geflohen<br />
ist. Muslime müssen sich distanzieren von Ahmadineschad in Iran, den Taliban<br />
in Afghanistan, von Selbstmordattentätern und Ehrenmördern, und diese Distanzierung<br />
glaubt ihnen doch keiner, weil alles gleichgesetzt wird: Islam und Islamismus,<br />
Glaube und Wahn, Religiosität und Intoleranz, Individuum und Kollektiv.<br />
Zum Vergleich: Es wird gegenwärtig eine Debatte über sexuellen Missbrauch<br />
in katholischen Schulen geführt, es wird auch nach den Strukturen gefragt, die<br />
den Missbrauch ermöglicht haben. Aber man erwartet nicht von beliebigen<br />
Gläubigen, dass sie sich von solchen Taten distanzieren, und niemand würde<br />
den bekennenden Katholiken Harald Schmidt auffordern, die Praktiken ihm<br />
fremder Jesuitenpatres zu verdammen.<br />
Früher nannte man es Rassismus, wenn Kollektiven Eigenschaften zugeschrieben<br />
wurden – heute dagegen gelten dumpfe Vorurteile als »Angst, die man ernst<br />
nehmen muss«. Was diesen neuen Rassismus rhetorisch so elegant aussehen<br />
* Der preisgekrönte Beitrag ist erschienen in DIE ZEIT am 25.02.<strong>2010</strong>.<br />
35
lässt, ist, dass das Unbehagen gegenüber Muslimen niemals als Unbehagen<br />
gegenüber Muslimen artikuliert wird. Vielmehr kommen die Angriffe stets im<br />
Gewand des Liberalismus und als Verteidigung der Moderne daher. Es sind<br />
Werte einer aufgeklärten, sympathisch pluralistischen Lebensweise, die in<br />
Stellung gebracht werden gegen den Islam.<br />
Dabei werden Muslimen jene Eigenschaften und Überzeugungen zugeschrieben,<br />
die eine moderne Gesellschaft als intolerant geißeln muss. Ein typisches<br />
Beispiel ist der Einwanderungstest des CDU-regierten Bundesandes Baden-<br />
Württemberg, bei dem die Tauglichkeit zur Einbürgerung mit der Haltung der<br />
Einwanderer zur Homosexualität in Verbindung gebracht wird – oder der des<br />
Landes Hessen, der ein modernes Frauenbild abfragt. Wer wollte nicht die mo -<br />
der nen Vorstellungen des Zusammenlebens verteidigen? Das ist ja der Konsens,<br />
auf dem unser Grund gesetz und unsere Gesellschaftsordnung beruhen. Es klingt<br />
auch irgendwie besser und emanzipierter als die Ideologie von Leuten, die dogmatisch<br />
an repressiven Familien- oder Sexualitätsvorstellungen festhalten.<br />
Implizit wird dabei immer auch die eigene liberale Fortschrittlichkeit behauptet.<br />
Vergessen sind die Versuche der CDU, gegen die eingetragene Lebenspartnerschaft<br />
zu votieren, vergessen die Rückständigkeit des Familienbildes der Christlich-Demokratischen<br />
Union, das Festhalten an der Ehe als einer Institution<br />
zwischen Mann und Frau oder das Verweigern des Adoptionsrechts für homo -<br />
sexuelle Paare. Es ist eine eigenwillige Allianz aus atheistisch-kritischem Feminismus<br />
und christlichem Konservativismus, die etwa das Kopftuch als Projektionsfläche<br />
für berechtigte Kritik an der Misshandlung von Frauen einerseits<br />
und zugleich für eine phobische Scheu vor Andersartigkeit instrumentalisiert.<br />
Da überrascht es gelegentlich, wem es auf einmal so außerordentlich um Frauenrechte<br />
geht, und der Verdacht liegt nahe, dass Missachtung vor allem dann entdeckt<br />
wird, wenn es sich um muslimische Formen des Patriarchats und des Ma -<br />
chis mo handelt – als wären die nicht genauso widerwärtig, wenn sie von<br />
Nicht muslimen ausgeübt werden. Wie vielen nichtmuslimischen Bewohnern<br />
Baden-Württembergs oder Hessens die Staatsbürgerschaft entzogen werden<br />
36
müsste, wenn auch sie den Test ihrer aufgeklärten Toleranz ablegen müssten,<br />
bleibt unklar. Intolerant und illiberal sind immer nur die anderen.<br />
So ist eine Diskussion um den Islam in Europa entbrannt, die nicht mehr nur<br />
am rechten Rand Gemüter erhitzt, sondern das bürgerliche Zentrum erreicht hat.<br />
Das Misstrauen gegen muslimische Europäer wird nicht mehr nur von den schrillen<br />
Vertretern rechts-nationalistischer Parteien geschürt – wie Nick Griffin von<br />
der British National Party (BNP) in England, der eine Repatriierung von »nicht<br />
indigenen« Briten fordert, oder Geert Wilders von der Freiheits-Partei (PVV) in<br />
den Niederlanden. Solche Parteien haben es geschafft, dass auf einmal die bürgerliche<br />
Mitte über Konfliktlinien diskutiert, die von rechts außen diktiert wurden:<br />
In der Schweiz sollen Minarette verboten werden, in Frankreich die Totalverschleierung,<br />
und in den Medien wird eine Debatte über die »Eroberung Europas durch<br />
den Islam« geführt.<br />
Was aber hat dieser Blick auf den Islam mit Europa zu tun? Was sagt diese<br />
Diskussion über uns Nichtmuslime, Christen, Juden oder Atheisten, aus?<br />
Wenn eine Minderheit die Mehrheit so verunsichern kann, wie gefestigt ist<br />
dann die eigene Identität?<br />
Muslimische Fanatiker gab es schon früher, Ehrenmorde und Selbstmordattentate<br />
auch. Vielleicht ist es aber kein Zufall, dass der Blick auf die Integration der<br />
europäischen Muslime sich gerade in jener historischen Phase schärft, in der<br />
Europa sich mit seiner eigenen Integration befasst. Möglicherweise gibt es auch<br />
einen Zusammenhang zwischen schrittweiser Emanzipation und gleichzeitiger<br />
Diskriminierung der eben emanzipierten Bürger. Es könnte sein, dass gerade die<br />
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts unter der rot-grünen Bundesregierung<br />
1999 zu Paradoxien bei der Anerkennung der Muslime geführt hat. Wer vorher<br />
als Tunesier oder Iraker wahrgenommen wurde, ließ sich national unterscheiden.<br />
Sobald die Einwanderer Deutsche werden konnten, mussten sie mindestens<br />
Muslime bleiben, sonst wären sie ununterscheidbar gewesen. Erst in den Jahren<br />
nach der rechtlichen Anerkennung als Staatsbürger wurde deutlich, dass die<br />
37
formale Gleichstellung keineswegs eine soziale bedeutete. Wie auch die fran -<br />
zösischen und die Schweizer Islamdiskussionen in eine Zeit der nationalen<br />
Verunsicherung fallen.<br />
Wenn die Konflikte mit Muslimen aber weniger mit den Muslimen als mit uns<br />
selbst und mit Europa zu tun haben, dann sollten wir uns fragen, was die europäische<br />
Aufklärung kennzeichnete, was die historischen Prozesse und Prinzipien,<br />
die sie etablierte – Säkularisierung, Liberalismus und Toleranz –, wirklich<br />
bedeuten und was diese Werte im Umgang mit Muslimen verlangen.<br />
Ursprünglich bezeichnete »Säkularisierung« lediglich den Rechtsakt, durch den<br />
der Besitz und die weltlichen Güter der Kirche geschmälert wurden. Im weiteren<br />
Sinne bezeichnet der Begriff die Verdrängung kirchlicher Autorität aus dem Bereich<br />
weltlicher Herrschaft. Säkularisierung stellt also nicht die Praktiken der Gläubigen<br />
infrage, sondern etabliert das politische System als unabhängig von kirchlichen<br />
Einflüssen – Säkularisierung ist nicht antireligiös, sondern antiklerikal. Die individuelle<br />
Frömmigkeit, aber auch die öffentliche Sichtbarkeit von religiösen Symbolen<br />
sind eine ganz andere Frage.<br />
Wer das Kopftuchtragen an öffentlichen Schulen oder den Bau von Minaretten<br />
untersagen will, sollte sich daher nicht auf die Säkularisierung berufen. Das ist<br />
einer der Gründe, warum die Verfechter des Kopftuchverbots den Schleier auch<br />
nicht als Ausdruck religiösen Glaubens anerkennen, sondern ihn als Instrument<br />
und Symbol der Unterdrückung deklarieren – so wie die Anhänger des Minarettverbots<br />
die Moschee nicht als Gotteshaus, sondern als Raum der Terrorvorbereitung<br />
definieren. Was dem einen die rhetorische Keule der Terrorgefahr, ist dem<br />
anderen die der Unterdrückung von Frauen.<br />
Das Problem ist weniger die Frage, ob es muslimische Mädchen und Frauen<br />
gibt, die zum Tragen des Schleiers gezwungen werden – das kann nicht bezweifelt<br />
werden –, die Frage ist: Was unterdrückt? Wirklich das Stück Stoff selbst? Oder<br />
die patriarchalen Beziehungsgeflechte, die die Autonomie der Frau ignorieren?<br />
38
Stoppt das Verbot des Kopftuchs die Strukturen der Unterdrückung? Oder ergänzt<br />
diese Entscheidung nur das Gefühl der Entmündigung durch Vater oder Ehemann<br />
um das Gefühl der Entmündigung durch Gesellschaft und Staat? Das Kopftuch<br />
darf oder muss die Frau dann nicht mehr tragen, aber wird sie damit auch schon<br />
aus der Struktur der Unterdrückung befreit? Wären nicht Ausbildungs- oder Jobangebote<br />
an muslimische Frauen ein erfolgversprechenderes Instrument der<br />
Emanzipation als ein Burka- oder Kopftuchverbot? Wenn wir die häusliche Verwahrlosung<br />
eines Kindes an seiner Kleidung in der Schule erkennen, glauben<br />
wir dann, die Anordnung von Schuluniformen würde das Problem beheben?<br />
Der Rationalismus der Aufklärung und der liberale Individualismus, auf die sich<br />
die Islamkritiker gern berufen, orientieren sich stets an der Autonomie des einzelnen<br />
Menschen. Was Aufklärung und Liberalismus verteidigen, ist das Selbstbestimmungsrecht<br />
des Individuums: Nicht Kirche, soziale Klasse und Herkunft<br />
sollen über das moderne Subjekt bestimmen dürfen, sondern die autonome,<br />
freie Wahl des Einzelnen muss vom Staat geschützt und verteidigt werden.<br />
Wer das Kopftuch prinzipiell verbietet, muss sich also fragen, ob es wirklich<br />
undenkbar sein soll, dass eine Frau freiwillig ein Kopftuch tragen möchte. Wenn<br />
eine Muslimin ein Kopftuch tragen möchte, muss das in einem liberalen Staat<br />
ebenso schützenswert sein wie ihre Entscheidung, keines zu tragen. Wer Frauen<br />
verteidigen will, sollte ihnen eine selbstbestimmte Wahl ermöglichen, sollte<br />
Gewalt gegen Frauen (ob muslimisch oder nicht) ahnden und die, die sie misshandeln,<br />
verurteilen.<br />
Nun bleibt die Gefahr, die Befürworter eines Burkaverbots zu Recht benennen,<br />
dass das soziale Umfeld, in dem Frauen die Burka tragen, eine solche freie Wahl<br />
vielleicht nicht zulässt. Das ist ein ernst zu nehmender Einwand. Aber wenn<br />
Frauen, wie in Frankreich erörtert, das Burkatragen in Bussen oder U-Bahnen<br />
verboten wird – werden die Frauen, die zur Burka gezwungen werden, dann von<br />
ihren Ehemännern wirklich unverschleiert auf die Straße gelassen? Oder müssen<br />
sie zu Hause bleiben? Die Publizistin Hilal Sezgin hat in der Frankfurter Rundschau<br />
39
dazu den Vorschlag gemacht, Frauen mit Burka sollten lieber Übersetzer zur<br />
Seite gestellt bekommen, um ihre Spielräume zu vergrößern.<br />
Das Erbe der Aufklärung bedeutet, einen Freiraum zu verteidigen, in dem individu -<br />
elle Vorstellungen des Glücks gelebt werden können, ohne dass der Staat intervenieren<br />
darf. Säkularisierung war insofern auch immer gekoppelt an das Prinzip der<br />
Glaubensfreiheit. Das politische System, die Gesetze des Staates, das Bildungswesen<br />
sollten weltlich und dem Einfluss der Kirche entzogen sein, aber innerhalb<br />
dieser politischen Ordnung sollte den Bürgern ihre eigene Religiosität, ihre eigene<br />
Weltanschauung, ihre eigene Vorstellung vom guten Leben gestattet sein.<br />
Dieses Erbe bedeutet die Möglichkeit, sich rational oder irrational, religiös oder<br />
nichtreligiös zu orientieren, es bedeutet die Freiheit, sich nach einer anderen Welt<br />
zu sehnen, aber den Rechtsstaat und die Glaubensfreiheit der anderen anzuerkennen.<br />
Diese Freiheit, sich selbst oder die Realität überschreiten zu wollen, ist<br />
es, die Menschen kreativ sein lässt. Es mögen religiöse oder atheistische Visionen<br />
sein, die uns über uns hinauswachsen lassen. Aber wir verkümmerten in unserem<br />
Gemeinwesen und in unserer Lebensfreude, wenn wir sie beschneiden würden.<br />
Eine Glaubensfreiheit, die eigentlich Zwangsatheismus als einzige Form der<br />
Modernisierung akzeptiert, ist keine. Eine Glaubensfreiheit, die nur den christlichen<br />
Glauben meint, ist auch keine. Toleranz ist in Wahrheit immer Toleranz<br />
von etwas, das einen anwidert oder irritiert. Toleranz dämmt Abneigung, nicht<br />
Zuneigung. Und in modernen, pluralistischen Gesellschaften mit unterschiedlichsten<br />
existenziellen, sexuellen oder ästhetischen Neigungen wird das Tolerieren<br />
von Praktiken und Überzeugungen anderer von jedem verlangt: Die Geißelungen<br />
bei den Osterprozessionen in Sevilla erscheinen den einen so pervers wie anderen<br />
die Sadomaso-Spielchen auf den Christopher-Street-Day-Paraden in Paris oder<br />
Berlin; der männliche Blick, der junge Mädchen unter den Schleier zwingt, er -<br />
scheint den einen ebenso sexistisch wie anderen der, der sie sich in High Heels<br />
quetschen und rundum entblößen lässt; die Vorstellung der Eucharistie ist den<br />
einen so befremdlich wie den anderen der Glaube an 72 Jungfrauen im Paradies;<br />
40
die Wagner-Begeisterten in Bayreuth wirken auf die einen so befremdend wie<br />
auf andere die St.-Pauli-Fans am Millerntor. Wer denkt, nur Muslime glaubten an<br />
unwahrscheinliche Geschichten, sollte gelegentlich in eine Messe gehen oder<br />
Chatrooms im Internet besuchen. Für ähnlich geartete Lebensformen oder Überzeugungen<br />
braucht es keine Toleranz.<br />
Natürlich gibt es eine richtige und notwendige Kritik an radikalem Fundamen talismus<br />
und Gewalt, ob sie nun von Muslimen oder Christen ausgehen (wer meint,<br />
nur unter Muslimen gebe es Antisemiten oder religiös motivierte Kriminelle, sollte<br />
sich die Pius-Brüder ansehen oder die gewalttätigen evangelikalen Abtreibungsgegner).<br />
Aber der Unterschied zwischen Aufklärung und Rassismus macht sich<br />
daran fest, ob diskriminierende Praktiken und Verbrechen angeklagt werden –<br />
oder ganze Bevölkerungsgruppen. Die Gefahr für das Erbe der Aufklärung sind<br />
nicht Andersgläubige, sondern die Ideologen, die politische oder soziale Fragen<br />
in religiöse oder ethnische umdeuten. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit<br />
sind ebenso Feinde der europäischen Idee wie Glaubensfuror und Terrorismus.<br />
Die europäischen Ideale der Aufklärung, der Säkularisierung, der Toleranz und<br />
der Rechte des Individuums scheinen in Europa immer mehr in Vergessenheit zu<br />
geraten. Verteidigt werden sie gegenwärtig am ehrlichsten nicht in Berlin oder in<br />
Paris, sondern in Teheran. Es sind junge Frauen mit Kopftuch, die gegen ein religiös-fundamentalistisches<br />
Regime kämpfen, junge Menschen, die Allahu Akbar,<br />
Allah ist groß, rufen und ihr Leben riskieren im Kampf gegen Despotie. Sie sind<br />
der Beweis dafür, dass Aufklärung und Menschenrechte, Toleranz und Glaubensfreiheit<br />
universal gelten müssen, für Gläubige oder Ungläubige, Muslime oder<br />
Christen, Juden oder Atheisten. Daran sollten wir in Europa uns erinnern.<br />
41
2. <strong>Preis</strong>
43<br />
Christoph Lütgert mit Team
Panorama – Die Reporter „Die KiK-Story“ *<br />
(NDR; gesendet in „ARD-exklusiv“, 4. August <strong>2010</strong>)<br />
25,96 Euro – für diese Summe konnte sich „Panorama“-Reporter Christoph Lütgert in<br />
einer Filiale des Bönener Textil-Discounters KiK von Kopf bis Fuß einkleiden. Auf dem<br />
roten Teppich präsentieren sich zu Werbezwecken auch Promi-Ikonen wie Verona Pooth<br />
in einem Outfit des Textildiscounters. Doch Fragen zu Produktionsmethoden und<br />
Dumpinglöhnen wollte Pooth nicht beantworten. Und auch die Geschäftsführung von<br />
KiK schwieg lange. Dabei gab es viele Vorwürfe, die so unbeantwortet blieben: Verkäuferinnen,<br />
die kaum von ihrem Gehalt leben können, Druck und Kontrollen am Arbeitsplatz<br />
sowie die Ausbeutung in Produktionsländern wie Bangladesh. All das zeigten<br />
Lütgert und sein Team ** in der 30-Minuten-Reportage „Die KiK-Story“.<br />
Christoph Lütgert<br />
geboren 1945<br />
Werdegang:<br />
seit Juni <strong>2010</strong> Ruhestand und freier Mitarbeiter im NDR<br />
1995-<strong>2010</strong> Chefreporter Fernsehen des Norddeutschen Rundfunk (NDR)<br />
1988-1995 Erster Reporter in der „Panorama“-Redaktion des NDR<br />
1986-1988 Hörfunkkorrespondent des NDR im Hauptstadtstudio Bonn<br />
1995-1986 Reporter im WDR-Fernsehstudio Düsseldorf<br />
1970-1985 dpa-Reporter, landespolitischer Korrespondent in NRW,<br />
bundespolitischer Korrespondent in Bonn<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
Leuchtturm-<strong>Preis</strong> vom Netzwerk Recherche (2002)<br />
Fernsehpreis der internationalen Jury der Rias Berlin Kommission (2003 und 2005)<br />
Wirtschaftsjournalist des Jahres (<strong>2010</strong>)<br />
* Der preisgekrönte Fernsehbeitrag ist sowohl über die der Dokumentation beigefügte DVD (hinten, 3. Umschlagseite)<br />
zugänglich als auch u. a. über die Homepage des „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es“. (Die Redaktion)<br />
** Das Team, siehe S. 45, wurde für die „Kik-Story“ zur Redaktion des Jahres <strong>2010</strong> gewählt.<br />
44
Veröffentlichungen, u. a.:<br />
Der Untergang der Estonia – die programmierte Katastrophe (TV-Dokumentation, 1995)<br />
Der Untergang der ME 110 – Rätsel um drei Wehrmachtsflieger (TV-Reportage, 1997)<br />
Der Herausforderer – Kanzlerkandidat Gerhard Schröder (TV-Reportage, 1998)<br />
Panorama – die Reporter: Jagd auf Egon Krenz (2009/<strong>2010</strong>)<br />
Das „KiK-Team“:<br />
Christoph Lütgert, Presenter und Texter<br />
Sabine Puls, Autorin und Rechercheurin<br />
Kristopher Sell, Autor und Rechercheur<br />
Dietmar Schiffermüller, Redaktionsleiter<br />
Britta von der Heide, Redaktion, Kamera, Regisseurin<br />
45
Begründung der Jury<br />
Haben Sie sich nicht auch schon ab und zu gefragt, wie es sein kann, dass in manchen<br />
Läden ein T-Shirt nur einen Euro kostet und man sich für 30 Euro vollständig einkleiden<br />
kann? Klar, man kann es sich denken: Die Ware kommt aus Ausbeuterfabriken in armen<br />
Ländern und auch die Verkäuferinnen kriegen nur Armutslöhne. In der Regel verdrängt<br />
man dann solche Gedanken schnell, so ist sie eben, die Globalisierung, da kann man<br />
eh nichts machen.<br />
Oder kann man vielleicht doch? Kann man versuchen, die Hersteller und die Vermarkter<br />
zu zwingen, für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen,<br />
indem man ihre Praktiken öffentlich macht? Genau das hat dieses Reporterteam des<br />
NDR in diesem Jahr versucht, und ich sage gern, dass ihnen das mit Bravour gelungen<br />
ist. Christoph Lütgert, Sabine Puls, Britta von der Heide und Kristoffer Sell haben mit<br />
ihrem Film „Die Kik-Story“ bewiesen, dass es sehr wohl möglich ist, einen scheinbar<br />
unausrottbaren Missstand für eine breite Öffentlichkeit so aufzubereiten, dass zumindest<br />
jenen, die den Film gesehen haben, künftig das Wegschauen schwer fällt. Wer<br />
diese Reportage über die Methoden des Billigdiscounters KiK gesehen hat, der wird<br />
die Läden dieses Unternehmens künftig so lange meiden, bis es glaubhaft nachweisen<br />
kann, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden und die Näherinnen menschenwürdige<br />
Arbeitsbedingungen genießen.<br />
Das Besondere an diesem Film ist aber nicht, dass er Zahlen und Fakten und Verantwortliche<br />
nennt, das haben auch andere schon vielfach getan. Die herausragende<br />
Leistung liegt vielmehr darin, dass es den Autoren gelungen ist, das Schicksal der für<br />
KiK arbeitenden Näherinnen in Bangladesch und das der Verkäuferinnen ihrer Produkte<br />
in Deutschland wirklich authentisch zu schildern. Die Opfer der menschenverachtenden<br />
Methoden im asiatischen Textilgewerbe werden dem Zuschauer so nahe<br />
gebracht, dass er wirklich versteht, wie ihre Notlage mit der unreflektierten Schnäppchenjagd<br />
bei uns verknüpft ist. Herausragend ist auch, wie es den Autoren gelingt, die<br />
zynische Verachtung der verantwortlichen Manager einzufangen. Perfekt werden da<br />
die Werbeveranstaltungen des Konzerns mit ihrem inszenierten Frohsinn mit den Bildern<br />
aus den Slumwohnungen der Arbeiterinnen in Dacca gegengeschnitten. Und die<br />
dümmlich dreiste Verweigerung des Konzernchefs, dazu Stellung zu nehmen, erzählt<br />
46
alles über seine Einstellung. Selten wurden die Ausbeuter im globalen Textilgeschäft<br />
so deutlich an den Pranger gestellt.<br />
Hervorzuheben ist schließlich, dass die Autoren ihre Zuschauer auch daran teilhaben<br />
lassen, wie der Konzernboss und seine Anwälte versuchen, den Bericht per Gerichtsbeschluss<br />
zu verbieten. Damit demonstrieren sie vorbildlich, wie solchen Anschlägen<br />
auf die Pressefreiheit zu begegnen ist: Nämlich, indem man genau solche Repressalien<br />
öffentlich macht. Dazu gehört allerdings auch, dass man Chefredakteure und Justiziare<br />
hat, die zu ihren Leuten stehen und auch mal einen Prozess riskieren. Das ist leider<br />
keineswegs alltäglich. Insofern gebührt dieser <strong>Preis</strong> nicht den Autoren allein, sondern<br />
auch den Verantwortlichen beim NDR, die keine Kosten und Prozessrisiken gescheut<br />
haben, um das Vorhaben umzusetzen.<br />
Und der große Erfolg der „KiK-Story“ bei den Zuschauern hat ihnen Recht gegeben.<br />
Damit ist der Film auch Beleg dafür, dass aufwändig recherchierte und verständlich<br />
erzählte Reportagen über Missstände in der globalisierten Ökonomie auch zur besten<br />
Sendezeit auf breites Interesse stoßen. Das ist preiswürdig, keine Frage. Und am<br />
besten wäre es, wenn dieser Erfolg den Entscheidern beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen<br />
Mut macht, ihre Gebühreneinnahmen auch für weitere solcher Projekte bereit<br />
zu stellen. Liebe Kollegen, wir brauchen noch viel mehr davon.<br />
vorgetragen von Harald Schumann<br />
47
3. <strong>Preis</strong>
49<br />
Markus Metz<br />
Georg Seeßlen
„Von der Demokratie zur Postdemokratie.<br />
Eine Gesellschaftsform in der Krise“ *<br />
(Hörfunk Bayern 2 „Zündfunk Generator“, 31. Januar <strong>2010</strong>)<br />
Deutschland hat ein Problem: Freiheit und Demokratie beginnen einander zunehmend<br />
ins Gehege zu kommen. Immer mehr Bürger nehmen sich die Freiheit, den demokra -<br />
tischen Staat und seine Organe zu ignorieren, zum Beispiel indem sie nicht zur Wahl<br />
gehen. Zugleich fühlt sich der demokratische Staat bemüßigt, immer stärker in die<br />
Bürger- und Menschenrechte einzugreifen, Daten zu sammeln, Überwachung zu organisieren<br />
oder Maßnahmen auch gegen den Willen der Bevölkerung durchzusetzen.<br />
In ihrem Beitrag beschäftigen sich Markus Metz und Georg Seeßlen mit der Zukunft<br />
eines Systems, das immer als das fortschrittlichste galt: die Demokratie.<br />
Markus Metz<br />
geboren 1958 in Oberstdorf<br />
Werdegang:<br />
seit 1988 freier Journalist und Autor<br />
1987-1988 Geschäftsführer Radio Föhn, Lokalradio-Kleinanbieter für das Oberallgäu<br />
1980-1986 Studium Publizistik, Politik, Theaterwissenschaft an der Freien Universität<br />
Berlin, Abschluss M.A.<br />
Georg Seeßlen<br />
geboren 1948 in München<br />
Werdegang:<br />
Seit ca. 1970<br />
freiberuflicher Autor für verschiedene Tageszeitungen, Zeitschriften<br />
und für den Hörfunk<br />
Studium der Malerei, Kunstgeschichte und Semiologie in München<br />
* Der preisgekrönte Radiobeitrag ist sowohl über die der Dokumentation beigefügte DVD (hinten, 3. Umschlagseite)<br />
zugänglich als auch u. a. über die Homepage des „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es“. (Die Redaktion)<br />
50
Gemeinsame Veröffentlichungen, u. a.:<br />
Krieg der Bilder, Bilder des Krieges. Abhandlung über die Katastrophe<br />
und die mediale Wirklichkeit. Edition Tiamat (2002)<br />
Wir sind BILD! Boulevard-Journalismus, Wertewandel und Menschenwürde (2008)<br />
51
Begründung der Jury<br />
„Zündfunk Generator“ heißt die Sendereihe auf Bayern 2, in der diese Radioarbeit<br />
unserer <strong>Preis</strong>träger Markus Metz und Georg Seeßlen lief. Hier ist der Name im besten<br />
Sinne Programm. Denn Metz und Seeßlen spannen vor unseren wissbegierigen Ohren<br />
einen weiten Bogen voll zündender Gedanken, sie schaffen kraftvolle Aufklärung zum<br />
Hören at it’s best.<br />
Postdemokratie ist ihr Thema, eines, das auch andere Journalisten für sich und uns<br />
entdeckt haben, doch noch viel zu wenige und längst nicht alle so gut und gültig wie<br />
hier. Denn die Entwicklungen, die Metz und Seeßlen nachzeichnen, intelligent interpretieren<br />
und diskutieren, sind bedrohlich. Geringere Partizipation der Bevölkerung<br />
an der Willensbildung und somit eine schwächere Legitimation politischer Entscheidungen<br />
sind dabei nur zwei Schlagworte.<br />
Metz und Seeßlen sind ein bewährtes Autorenduo. Zehn Jahre liegen zwischen den<br />
beiden Männer, Generationsgenossen sind sie nicht, doch überaus kreative Kollegen.<br />
In ihrem preiswürdigen Radiofeature zeigen sie anschaulich, was die vielbeschworene<br />
„Krise der Demokratie“ in der Wirklichkeit bedeutet – und wohin das alles<br />
noch führen kann.<br />
Dabei arbeiten Metz und Seeßlen mit allen Mitteln moderner Funkdramaturgie: mit<br />
kommentiertem O-Ton, mit Expertenstatement, mit eigener Recherche, deren Ergebnisse<br />
in gewinnender Sprache wiedergegeben werden, mit eleganten Musikakzenten,<br />
gelegentlich auch mit Stilmitteln wie Kontrastierung. Ein kurzes Zitat nur: „In der Arztpraxis<br />
hört die Demokratie auf. In der Universität hört die Demokratie auf. Bei öffentlicher<br />
Ruhestörung hört die Demokratie auf. Beim Geld hört die Demokratie auf.“<br />
Als Hörer dürfen wir gut 50 Minuten lang Zeugen dieses öffentlichen Nachdenkens sein,<br />
wir werden bereichert in unserem Wissen und unserer Urteilskraft und am Ende, hoffentlich,<br />
von bloßen Zeugen zu Akteuren. Im Interesse einer revitalisierten Demokratie.<br />
52
Die <strong>Preis</strong>träger haben sich in einem Interview bei ihrer Redaktion im Bayerischen<br />
Rundfunk bedankt. Zitat: „Es ist ein Glückfall, dass hier eine sehr mutige Redaktion<br />
sitzt, die solche Themen auch möglich macht.“<br />
Hoffen wir als das gebührenzahlende Publikum, dass dieses preisgekrönte Exempel<br />
auch ein Symptom ist für eine Renaissance des öffentlich-rechtlichen Reflexionsradios,<br />
und zwar in modernisierter Form: kritisch und klug, informierend, analytisch, geistreich<br />
und gerne auch amüsant.<br />
vorgetragen von Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
53
Spezial-<strong>Preis</strong>
55<br />
Willi Winkler
„Die Freuden der Denunziation“<br />
(„Süddeutsche Zeitung“, 13. Februar <strong>2010</strong>)<br />
Geschichte eines Niedergangs:<br />
einst besaß der Verrat Größe – inzwischen geht es um Datenhehlerei und Steuerbetrug<br />
Willi Winkler<br />
geboren 1957 in Sittenbach (Bayern)<br />
Werdegang:<br />
seit 1998 Pauschalist „Süddeutsche Zeitung“<br />
1991-1998 freier Autor und Übersetzer<br />
1989-1991 Ressortleiter Kultur bei „Der Spiegel“<br />
1988-1989 Redakteur „Die Zeit“<br />
1978-1984 Studium der Linguistik und Literaturwissenschaften<br />
in München und St. Louis<br />
1977-1978 angelernter Lagerarbeiter (Metallbranche)<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
Ben-Witter-<strong>Preis</strong> (1998)<br />
Veröffentlichungen, u. a.:<br />
Der Schattenmann (2011)<br />
Die Geschichte der RAF (2007)<br />
Karl Philipp Moritz (2006)<br />
Übersetzungen:<br />
Übersetzungen von Büchern von John Updike, Anthony Burgess und Woody Allen<br />
56
Begründung der Jury<br />
So einen wie Willi Winkler hätte ich gern zum Kollegen. Er säße dann in einem Büro, ei -<br />
nem Café in der Nähe und hätte Kenntnisse parat, wenn ich ihm von einem Film er zähl te,<br />
der nichts taugt oder ihn zum neuen Buch von Keith Richards befrage (immerhin hat er<br />
über die Stones und Dylan selbst Bücher geschrieben) oder warum der Sarrazin-Hype so<br />
gut funktioniert hat. Er würde inspirieren und mir für ein paar Stunden den Gegenbeweis<br />
liefern, dass das Gros der Journalisten zur Oberfläche verdammt ist. Dass wir Bausteine<br />
einer industriellen Fertigungsstrasse sind, dass unser Geschäft das Flüchtige ist.<br />
Sie fallen eben auf, sie fallen ins Gewicht: die Artikel, Kommentare und Analysen<br />
des freien Journalisten Willi Winkler. Sie zu lesen ist für mich Pflicht und Kür zugleich,<br />
weil solche unverbrauchte Gedanken in schöner Sprachmacht selten geworden sind.<br />
Im Kosmos des Willi Winkler geht es recht frei zu, da kommen Themen und Figuren<br />
zusammen, die kaum miteinander zu tun haben. Oder doch? Hosea Dutschke, Katja<br />
Ebstein, Dieter Kunzelmann, David Lettermann. Die Sünden der deutschen Nachkriegsgeschichte.<br />
Die Bagdad-Istanbul-Bahn. Axolotl Roadkill.<br />
Das Spektrum ist riesig, und Wissensgier, Bildung und das Glück aufzuklären strahlen<br />
aus jedem Text hervor.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts tauchte der Begriff „Renaissance Man“ in der englischen<br />
Kulturkritik auf, gemeint war einer, der auf vielen Feldern der Kultur und Wissenschaft<br />
sich Expertise erwirbt und zu einer eigenen Philosophie zu verweben versteht. So<br />
einer ist Willi Winkler, er schreibt tiefsinniger als ein Generalist, verständlicher als<br />
ein Spezia list, eben ein Renaissance Man und schade, dass dieser Qualitätsbegriff<br />
so nicht im Deutschen existiert. Und auf eine Renaissance Woman möchte man auch<br />
hoffen.<br />
Ob er sich mit dem Zeitgeist der 68er befasst, die RAF analysiert oder für großes<br />
Kino wirbt – Winkler nimmt sich journalistische Freiheit mit vollen Händen, und das<br />
verführt den Leser und die Leserin. Dabei beweist er ein feines Gefühl für „Oben“ und<br />
„Unten“, für Abhängigkeit und Unabhängigkeit.<br />
57
In einem Gespräch im alpha. Forum des Bayrischen Rundfunks sagt Winkler etwas, das<br />
man in Volontärskursen debattieren lassen müsste: „Es gibt keinen Grund, je mandem<br />
vors Schienbein zu treten, es sei denn, er ist reich und mächtig“. Ein Zitat aus dem<br />
amerikanischen Journalismus, das er explizit lobt. Das passiert ihm zu wenig, und<br />
weiter heisst es: „Der Widerspruchsgeist, das grundsätzlich Nicht-Einverstandensein<br />
mit dem, was ist – wäre für mich eine männliche Tugend“. Er ist nicht einverstanden mit<br />
dem, was man früher „die herrschenden Verhältnisse“ nannte. In der Aufmerksamkeitsund<br />
Mediengesellschaft haben sich die Journalisten anscheinend „dafür entschlossen,<br />
nur noch das Streichquartett zu bilden zu dem, was passierte und zu wenig zu zweifeln ...“<br />
Winklers Arbeiten reichen weit über das politische Feuilleton hinaus, er ist feuriger<br />
Gesellschaftskritiker, der sich von der Diktatur des Aktuellen und Modischen nicht<br />
beeindrucken lässt. Diese Rede würde unglaublich lang werden, wenn ich aus allen<br />
Texten, die mir besonders gefielen, zitieren würde. Aber zwei, drei mag ich mir nicht<br />
verkneifen, besonders zu loben.<br />
In seinem großen Essay über „Die Freuden der De nunziation“ zum Beispiel verknüpft<br />
er geistreich den Aufstieg und Fall des Schweizer whistle-blowers Christoph Meili mit<br />
anonymen Steuer-CDs, mit dem notwendigen Verrat des Judas und Deserteuren des<br />
Vietnamkrieges. Das nenne ich assoziieren! Verrat als sittliche Pflicht – eine ungewöhnliche<br />
Fragestellung in einer Zeit des moralischen Relativismus. Und beim Thema<br />
Steuerhinterziehung gilt: selten hat es jemand so genau beschrieben, welche spie -<br />
ßigen, glanzlosen Mechanismen hinter dem Drang stehen, den Staat und die Mitbürger<br />
betuppen zu wollen – weil es jeder so macht.<br />
Lakonisch und böse ist der Artikel über die junge Erfolgsautorin Helene Hegemann, die<br />
für das Buch Axolotl Roadkill ja ganze Passagen von einem Blogger abschrieb – die<br />
Tech nik ihrer Generation. Dass Copyrightverletzungen, kruder Textklau einen freien,<br />
ewig unterbezahlten Autoren besonders irritieren müssen, ist das Eine. Winkler bringt<br />
vor allem den Hype auf den Punkt: „Marketing ist alles, der Markt, so ist er nun mal,<br />
giert nach Frischfleisch...“ Und die 17jährige entzaubert er als Traumfräulein für<br />
alternde Feuilletonherren, denen der „morbide Vitalismus einer wohlstandserschöpften<br />
Jugend“ einen – irgendwie sexuellen – Kick gibt.<br />
58
Beim Lesen über die Person Willi Winkler kam mir eine Vorstellung, warum er diesen<br />
klaren Blick hat. Die Entwicklung zum Schreiber war nichts Geschenktes und Glattes.<br />
Willi Winkler kommt aus einfachen Verhältnissen, ein Kleinhäuslersohn aus einem<br />
153-Seelen-Dorf, dem Bildung die Welt auftat. Vom bayerischen Dorf Sittenbach zu<br />
den feinen Etagen im Norden, zur „Zeit“ und zum „Spiegel“. Ohne Bafög hätte er nicht<br />
studieren können, ein Günstling der Bildungsreform der 70er wie er schreibt. Daher<br />
auch das Unbehagen eines Arbeiterkindes, wenn Studiengebühren diskutiert werden.<br />
Es ehrt Sie, lieber Willi Winkler, wenn Sie in dieser „abgehobenen, abstrakten, akademischen,<br />
journalistischen Sphäre“, das sind Ihre Worte, etwas fremdeln, sich als „Hochstapler“<br />
bezeichnen. Die nassforschen Alpha-Journalisten waren immer schon verdäch -<br />
tig, zu interessiert an Privilegien und Prominenz zu sein. Es tummeln sich in dieser<br />
Society zu viele Maulwerksburschen, die von der eigenen heissen Luft nach oben<br />
getragen werden. Ihre Texte sind anders. Bei Ihnen ist das Gemachte stets wichtiger als<br />
der Macher. Es heisst von „Arbeitgeberseite“, dass Sie sagenhaft produktiv seien, ein<br />
Vielschreiber, dem die Ideen und Projekte nie ausgingen, der gar nicht genug publizieren<br />
kann. Und dass Sie vom Gegenüber volle Präsenz verlangen, ausweichen geht nicht.<br />
Kritischer Journalist, Essayist, Schriftsteller und Übersetzer. Vielleicht ist das nur<br />
möglich, weil Sie sich von den Apparatschiks der Redaktionsetagen losgesagt haben<br />
und Freiberufler wurden.<br />
Das Originäre UND das Skeptische prägen alle Arbeiten wie ein Kammerton. Mit dem<br />
Spezial-<strong>Preis</strong> zeichnet die Jury einen unabhängigen, kritischen Kopf aus, wie er dem<br />
Journalismus gut tut. Der Sprachkünstler und Widerspruchsgeist Willi Winkler lässt<br />
unseren Berufsstand glänzen.<br />
Und wir aus der Jury haben uns schnell und leicht für diesen Winkler entschieden, der<br />
sich für seine Arbeit die eigene Zeit, die eigenen Wertmaß stäbe und den eigenen Raum<br />
nimmt, und darum ist er ein beneidenswerter Mensch.<br />
vorgetragen von Sonia Seymour Mikich<br />
59
Die Freuden der Denunziation<br />
Geschichte eines Niedergangs: Einst besaß der Verrat Größe –<br />
inzwischen geht es um Datenhehlerei und Steuerbetrug *<br />
Der Wachmann Christoph Meili, 28 damals, gelangte am 8. Januar 1997 auf<br />
seinem nächtlichen Rundgang in einen Kellerraum der Schweizerischen Bankgesellschaft<br />
(SBG), in dem Akten geschreddert werden sollten. In einer Bank<br />
fällt viel Papier an, und das Vernichten von Akten ist ein normaler Vorgang. Die<br />
Lagerkapazität ist bald erschöpft, und irgendwann endet selbst fürs Finanzamt<br />
die Aufbewahrungsfrist. Meili langweilte sich auf seiner nächtlichen Tour; später<br />
erzählte er, dass er sich dort in aller Ruhe ein Pin-up-Mädchen anschauen wollte.<br />
Dann jedoch entdeckte er etwas noch viel Interessanteres: Alte Kontobücher lagen<br />
da, Protokolle über Zwangsversteigerungen in Berlin, Gutschriften, Verbuchungen,<br />
normale Geschäfts post, über fünfzig Jahre alt. Meili war im Zweiten Weltkrieg<br />
noch nicht am Leben, er war kein Historiker, er hatte Computer verkauft und<br />
schließlich mit viel Glück diesen Job ergattert, der ihm erlaubte, seine Frau und<br />
seine beiden Kinder zu ernähren.<br />
Aber wer immer es ihm eingegeben haben mag: Meili bemerkte in diesem mitternächtlichen<br />
Bankverlies, dass es sich bei dem Altpapier um die Belege für ein<br />
Verbrechen handelte. Die SBG, die heute UBS heißt und weltweit operiert, hatte<br />
nicht nur die für die Schweiz üblichen Geschäfte mit Diktatoren und Waffenhändlern<br />
gemacht, sondern das nationalsozialistische Deutschland dabei unterstützt,<br />
als die Juden vor und nach ihrer Ermordung auch noch ausgeplündert wurden.<br />
Der Wachmann ging petzen<br />
Ein Schweizer Gesetz sah seit 1996 vor, dass solche Unterlagen aufbewahrt<br />
werden müssten, denn die Schweiz wollte sich endlich zu ihrer wenig ruhm -<br />
reichen Vergangenheit als kollaborierende Finanzmacht bekennen. Die UBS<br />
dagegen wol lte dem lieber aus dem Weg gehen und suchte die Abkürzung über<br />
den Schredder. Christoph Meili stahl die Unterlagen und brachte sie zur Jüdischen<br />
Cultusgemein de in Zürich. Deshalb wurde er von seinem Wachdienst entlassen,<br />
die Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige wegen Diebstahls, denn Meili war<br />
* Der preisgekrönte Beitrag ist erschienen in der Süddeutschen Zeitung am 13.02.<strong>2010</strong>.<br />
60
seiner Aufsichtspflicht etwas zu gründlich nachgekommen und hatte dabei<br />
die Loyalität vernachlässigt.<br />
Es war alles rechtens. Jeder Arbeitsvertrag trifft Vorsorge, dass der Angestellte<br />
über seine Tätigkeit Stillschweigen bewahrt. Er ist seiner Firma zur Loyalität<br />
verpflichtet und wird unter anderem dafür bezahlt, dass er nichts hinausträgt.<br />
Wer über Vorgänge in seiner Firma plaudert, begeht einen Rechtsbruch und<br />
kann jederzeit entlassen werden.<br />
Christoph Meili hatte grob gegen seine Loyalitätspflichten verstoßen. Nachdem<br />
er deswegen von seinen Landsleuten lang genug sekkiert worden war, ging er<br />
mit Frau und Kindern in die USA, wo man ihn maßlos feierte. Er trat bei Galas<br />
auf und sagte als Zeuge im Untersuchungsausschuss aus. 35 <strong>Preis</strong>e sammelte<br />
er ein für seinen Verrat. Die Amerikaner gewährten ihm als erstem Schweizer<br />
politisches Asyl und bürgerten ihn 2005 ein.<br />
Der Verrat zählt zu den schlimmsten Sünden in der säkularen Welt. Er ist ein letzter<br />
Gruß aus einer Zeit, die noch der Religion bedürftig war. Ein Verrat bildet schließlich<br />
die Grundlage für die erfolgreichste Ideologie der Weltgeschichte, für das<br />
Chris tentum. Der erste Verräter war Judas. Seine Geschichte begab sich am ersten<br />
Gründonnerstag, als Jesus sich mit seinen Jüngern an den Tisch setzte, um mit ihnen<br />
das zu feiern, was dann das Letzte Abendmahl wurde. „Einer unter euch, der mit<br />
mir isst, wird mich verraten.“ (Markus 14,18) Die Jünger sind bestürzt, fragen<br />
einander, wer es sein könnte und weisen den Verdacht vorsorglich weit von sich.<br />
Auf dem Gemälde Leonardos im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria<br />
delle Grazie in Mailand sitzt Judas ganz rechts außen. Er ist bereits als der Verräter<br />
entlarvt. Judas öffnet die Hände, als wollte er die Vorwürfe abwehren, wollte weiter<br />
leugnen, was doch offensichtlich ist. „Wehe aber dem Menschen“, fährt Jesus fort,<br />
„durch welchen der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen<br />
besser, er wäre nie geboren worden.“<br />
61
Der Verräter wird nicht bloß von der Tischgesellschaft, sondern aus jeder Gesellschaft<br />
ausgestoßen. Dabei ist er unabdingbar. Judas, der das Vertrauen Jesu und<br />
seiner Jünger missbraucht hat, ist der V-Mann des Weltgeistes. Erst Judas voll -<br />
endet die Heilsgeschichte, weil er Jesus ans Kreuz bringt.<br />
Die Evangelien danken es ihm so wenig wie die Nachwelt, der nur gemeldet wird,<br />
dass sich der Verräter in der Verzweiflung über sein Tun erhängt habe. Judas war<br />
zerrissen zwischen zwei Loyalitäten: Sollte er weiter Christus nachfolgen oder den<br />
Pharisäern, die ihm dreißig Silberlinge für den Verrat bezahlten? Das macht ihn<br />
zu einer einmalig tragischen Figur: Er verrät eine spirituelle Lehre an weltliche<br />
Machthaber; aber wenn er es nicht getan hätte, fehlte der christlichen Lehre das<br />
Fundament, der Opfertod ihres Gründers.<br />
Der Verrat kann eine Sache der Ehre sein –<br />
die Preußen wussten das<br />
Seit sich widerstreitende Loyalitäten anbieten – für den Staat oder für die Kirche,<br />
für einen anderen Staat, für einen anderen Glauben –, gibt es auch den Seitenwechsel<br />
und den Verrat. Der Krieg, der 1789 nach der Französischen Revolution<br />
ausbrach, schuf unendlich viele Loyalitätskonflikte. Schiller wurde Ehrenbürger<br />
der Französischen Revolution und fürchtete doch lieber um seine endlich begonnene<br />
Karriere. Ein anderer ehemaliger Aufrührer, der zum Geheimen Conseil-Rath<br />
avancierte Goethe, zog mit seinem Herzog gleich in den Krieg gegen die Revolution,<br />
die er durch seinen „Werther“, seinen „Götz von Berlichingen“, mit herbeigeführt.<br />
Die Berliner Salonnière Henriette Herz erzählt in ihren Erinnerungen, wie der<br />
Diplomat Friedrich von Gentz, einst glühender Verfechter der Französischen<br />
Revolution, plötzlich zum Reaktionär wurde. „An einem schönen Morgen jedoch<br />
war die Allen welche ihm näher standen sehr bekannte Geldnoth, wenn auch<br />
nicht gehoben – dazu hätte es sehr ansehnlicher Summen bedurft – doch ganz<br />
augenscheinlich gemildert, und die Freisinnigkeit verschwunden.“ Der Revolutionär<br />
war keiner mehr, sondern gekauft. „Eine österreichische Pension hatte<br />
62
eide Wunder bewirkt. Er war damals noch, und noch längere Zeit nachher, als<br />
Kriegsrath beim General-Directorium in preußischen Diensten.“<br />
Der Verrat kann auch eine Sache der Ehre sein. 1812, am Tag vor Silvester, lief eine<br />
preußische Heerschar unter der Führung Yorck von Wartenburgs zu den Russen<br />
über. Die Preußen waren mit Napoleon verbündet und zum Kriegsdienst auch<br />
gegen Russland verpflichtet, ihr Seitenwechsel war also nichts anderes als Hochverrat.<br />
Yorck erwartete das Erschießungskommando, doch dem preußischen König<br />
blieb mit Rücksicht auf die Volksmeinung nichts anderes übrig, als sich diesem<br />
Aufstand anzuschließen und den Verrat zur Staatsraison zu erklären. „Große Opfer<br />
werden von allen Ständen gefordert werden; denn unser Beginnen ist groß, und<br />
nicht geringe die Zahl und die Mittel unserer Feinde“, dröhnte der König. „Keinen<br />
andern Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen<br />
Untergang. Auch diesem würdet Ihr getrost entgegen gehen, um der Ehre willen;<br />
weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag.“<br />
Der Ehrbegriff der preußischen und deutschen Soldaten vertrug sich dann erstaunlich<br />
lang mit dem Nationalsozialismus, doch am 20. Juli 1944 waren einige Offiziere<br />
endlich zum Verrat bereit und gewillt, dabei auch ihr Leben einzusetzen.<br />
Niemand liebt den Verräter. Als der Lehrer Fritz Rodewald im Juni 1972 erfuhr,<br />
dass zwei Leute in seiner Wohnung übernachten wollten, kamen ihm Zweifel. Er<br />
ahnte, wer sich da anmeldete, und wahrscheinlich wusste er sogar, dass es sich<br />
um Ulrike Meinhof und Begleitung handelte. Rodewald hatte viel Erfahrung mit<br />
dem Verrat. Er gehörte zu einem konspirativen Netzwerk, das amerikanische<br />
Soldaten, die sich zur Desertion entschlossen hatten, auf geheimen Wegen an<br />
die Ostsee und ins neutrale Schweden schaffte.<br />
In der Propaganda an der sogenannten Heimatfront waren diese Fahnenflüchtigen<br />
Verräter. Sie schwächten die Wehrkraft, sie schadeten dem Ansehen der USA, sie<br />
verhinderten, dass die amerikanische Armee im Dschungel von Vietnam endlich<br />
den Sieg über die schlitzäugigen Kommunisten davontrug. Doch 1972 glaubte kein<br />
63
vernünftiger Mensch mehr, dass die USA in Vietnam die Freiheit des Westens<br />
ausgerechnet mit Bombenteppichen und Napalmgarben verteidigen sollten. Es war<br />
also eine Frage der Ehre, den wehrpflichtigen Deserteuren zur Flucht zu verhelfen.<br />
Auf andere Art, nämlich mit Rohrbomben, betrieb die RAF im Jahr 1972 den Widerstand<br />
gegen den Vietnamkrieg. Nachdem die USA die Häfen Nordvietnams vermint<br />
hatten, legte die RAF in Deutschland Bomben. In Frankfurt und Heidelberg starben<br />
bei ihren Anschlägen auf US-Einrichtungen vier Menschen, Dutzende wurden<br />
verletzt und verstümmelt. Die RAF hatte die staatlich verordnete Waffenbrüderschaft<br />
mit den USA aufgekündigt und war zur vietnamesischen Volksbefreiungsarmee<br />
übergelaufen.<br />
Rodewald war Teil der Anti-Vietnam-Bewegung, aber er sympathisierte nicht mit<br />
der Gewalt. Deshalb ging er, nach langem Zögern, zur Polizei. Ulrike Meinhof<br />
wurde mit einem gigantischen Waffenarsenal festgenommen, Rodewald galt<br />
fortan als Verräter. Die ausgesetzte Belohnung gab er an die „Rote Hilfe“, aber<br />
er wurde seines Lebens nicht mehr froh.<br />
Der Tragödie hat programmgemäß das Satyrspiel zu folgen. So appellierte der<br />
im Wilhelminismus aufgewachsene Konrad Adenauer 1962 an das Gewissen<br />
der Wehr machtsgeneration, als er im Bundestag von einem „Abgrund von Landesverrat“<br />
sprach und damit den Überfall auf den Spiegel camouflieren wollte,<br />
den er zusam men mit seinem ungeliebten Kronprinzen Franz Josef Strauß unternommen<br />
hatte.<br />
Der Spiegel hatte, wie eine eilends angestellte Untersuchung ergab, keinerlei<br />
militärische Geheimnisse verraten, konnte aber die Regierung stürzen, die ihm<br />
das vorwarf. Die Schriftsteller der Gruppe 47 formulierten sogleich eine Resolution,<br />
in der sie den Landesverrat zur Bürgerpflicht erhoben: „In einer Zeit, die den<br />
Krieg als Mittel der Politik unbrauchbar gemacht hat, halten (die Unterzeichner)<br />
die Unterrichtung der Öffentlichkeit über sogenannte militärische Geheimnisse<br />
für eine sittliche Pflicht, die sie jederzeit erfüllen würden.“<br />
64
Der Verrat als sittliche Pflicht – auch das hat es schon gegeben<br />
Der Verrat als sittliche Pflicht – das hatte etwas von dem hohen Pathos, mit dem<br />
die Diplomaten der „Roten Kapelle“ Hitlers Welteroberungspläne weitergaben.<br />
Da tremolierte das Gewissen, mit dem die Offiziere des 20. Juli 1944 zu Werke<br />
gingen. Doch welche militärischen Geheimnisse hätten die Schriftsteller<br />
Andersch, Roehler, Enzensberger und Johnson schon verraten können? Harro<br />
Schulze-Boysen, Arvid Harnack, Claus Stauffenberg und etliche andere kostete<br />
der Verrat den Kopf. Die aufgeregten Autoren mussten nur eine lächerliche Anzeige<br />
erleiden, und der spielverderberische Staatsanwalt verfolgte sie nicht weiter,<br />
weil er in dem Aufruf bloß eine „strafrechtlich irrelevante’ pathetisch-deklamatorische<br />
Meinungsäußerung’“ erkennen mochte.<br />
Der Verrat ist seither zum alltäglichen Vergehen geworden – jeder, der seine Steuern<br />
hinterzieht, übt den Vaterlandsverrat. Dieser Verrat kommt ohne große Deklamationen<br />
aus, und vor allem kostet er nichts. Steuerhinterziehung ist mindestens<br />
so gründlich verbreitet wie Witze über die Schwiegermutter und ungefähr genauso<br />
originell wie diese. Aber jeder kann es, jeder tut es. „Nein, nein, nein, unsre Steuern<br />
zahl’n wir nicht!“, geht der Refrain, und in seinem Mannesmut vorm Finanzamt,<br />
das sich so leicht übertölpeln lässt, ist jeder ein Stauffenberg, jeder ein Yorck.<br />
Die Allgegenwart des Verrats gebiert notwendig den Denunzianten. Der Verräter<br />
ist über die Jahre vom Helden nicht zum Schurken, sondern zum kleinen Ganoven<br />
herabgesunken. Der Denunziant ist die Kippfigur des braven Bürgers, der, wie es<br />
beim Finanzamt vornehm heißt, „Gestaltungsmissbrauch“ treibt, seine Steuer<br />
verkürzt und das Ersparte in mühseliger Kleinarbeit persönlich über die Landstraße<br />
von Lindau über Bregenz ins sichere Rorschach schafft.<br />
Wie in der Zeichnung von A. Paul Weber linst der Denunziant durch Schlüsse l-<br />
löcher, horcht an der Wand, kopiert heimlich Unterlagen, zählt die Flaschen, die<br />
sich am Morgen in den Papierkörben der Kollegen finden und ist, gegen gutes Geld<br />
selbstverständlich, allzeit bereit, jede Art von Daten zu beschaffen. Vom Verräter<br />
unterscheidet den Denunzianten zunächst einmal nicht viel: Er trägt weiter, was<br />
65
im Vertrauen auf das Schweigen des anderen gesagt, getan oder unterlassen<br />
worden ist. Er ist ein Mitbürger wie du und ich, ein Kollege, ein Freund. Er missbraucht<br />
das Vertrauen anderer, aber nicht, weil er aufs Heldentum spitzt, sondern<br />
um schlichter materieller Vorteile willen. Er ist der Mann der Stunde – glanzlos<br />
und bestimmt kein Held. Und doch spiegelt sich auf jeder neuen CD, die ins<br />
Finanzamt hereingereicht wird und prompt bezahlt wird, die große Tragödie, die<br />
Geschichte des Verrats.<br />
Christoph Meili, so geht die letzte Meldung, ist aus den USA zurück. Er hat seine<br />
Frau verloren, seine Kinder, längst auch das Geld, das er als Belohnung für seinen<br />
Verrat erhalten hat. Er hat nichts. In seiner Heimat gilt er den einen als rechter Tor,<br />
die anderen kennen ihn nur noch als große Nervensäge. Der Verräter Christoph<br />
Meili ist einer der letzten Helden dieser Welt.<br />
66
1<br />
2<br />
3<br />
1 Willi Winkler im Gespräch mit<br />
Berthold Huber und Jupp Legrand<br />
2 + 3 „Spezial“-<strong>Preis</strong>träger<br />
Willi Winkler beim Interview mit<br />
Sonia Seymour Mikich<br />
67
Newcomerpreis
69<br />
Karin Prummer<br />
Dominik Stawski
Artikelserie über Missbrauchsfälle in<br />
der katholischen Kirche<br />
(„Süddeutsche Zeitung“, 13./14. März <strong>2010</strong> ff.)<br />
Titel des ersten Beitrags: „Ratzingers Bistum setzte pädophilen Pfarrer ein“<br />
(13./14. März <strong>2010</strong>)<br />
hier dokumentierter Beitrag: „Wer singen will, muss schweigen“<br />
(31. März <strong>2010</strong>)<br />
Karin Prummer<br />
geboren 1983 in Mainburg<br />
Werdegang:<br />
seit April 2009 Volontärin der „Süddeutschen Zeitung“, München<br />
2008-2009 Autorenbeiträge, FTD, ZEIT Campus, SZ Magazin<br />
2003-2008 Praktika und freie Mitarbeit u.a. bei „Financial Times Deutschland“,<br />
Bayerischer Rundfunk, N 24, Radio Trausnitz<br />
2004-2009 Studium der Journalistik und BWL an der Katholischen Universität<br />
Eichstätt-Ingolstadt<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes (2007-2009)<br />
Stipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung (2004-2009)<br />
Nationaler <strong>Preis</strong>träger des Journalist Award der EU (2008); mit Dominik Stawski<br />
Medienpreis des Bundesforum Familie (2008); mit Dominik Stawski<br />
Dominik Stawski<br />
geboren 1984 in Bergisch Gladbach<br />
Werdegang:<br />
seit April 2009 Volontär der „Süddeutschen Zeitung“, München<br />
70
2007-2009 Beiträge für SZ Magazin, UniSPIEGEL, SPIEGEL, ZEIT Campus<br />
2003-2008 Praktika in Print und Funk, u.a. WDR, ARD Washington,<br />
dpa Washington, SPIEGEL<br />
2006-2007 Auslandsstudium und Lehrtätigkeit am Boston College, USA<br />
2004-2009 Studium der Journalistik und Betriebswirtschaftslehre<br />
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
Stipendiat der Journalistischen Nachwuchsförderung<br />
der Konrad-Adenauer-Stiftung (2005-2009)<br />
Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (2005-2009)<br />
Nationaler <strong>Preis</strong>träger des Journalist Award der EU (2008); mit Karin Prummer<br />
Medienpreis des Bundesforum Familie (2008); mit Karin Prummer<br />
Veröffentlichungen, u. a.:<br />
Die Prozente der Presse. Nutzung und Bewertung von Journalistenrabatten (<strong>2010</strong>)<br />
71
Begründung der Jury<br />
Sie sind Volontäre noch und haben doch schon eine überaus reife journalistische<br />
Leistung hingelegt: Karin Prummer und Dominik Stawski haben im März <strong>2010</strong> in einer<br />
Artikelserie der „Süddeutschen Zeitung“ an zwei schlagenden Beispielen über den verantwortungslosen<br />
Umgang der Katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch berichtet.<br />
Nach monatelangen Nachforschungen, nach einer Recherchearbeit deutlich jenseits<br />
der Arbeitszeitordnung, konnten sie detailgetreu rekonstruieren, wie ein pädophiler<br />
Priester sich mangels kirchlicher Kontrolle immer wieder in gefährlicher Nähe zu<br />
Jugendlichen aufhalten konnte. Und sie deckten in einem kritischen Sittenbild auf,<br />
dass selbst ein weltbekannter Elitechor der katholischen Jugend, die Regensburger<br />
Domspatzen, lange Jahre unter einem grausamen Innenleben mit körperlicher und<br />
sexueller Gewalt litt.<br />
Die beiden Newcomer Prummer und Stawski haben damit ihr Meisterstück gefertigt. Die<br />
besondere Qualität zeigt sich in ihrer Beharrlichkeit, in Sorgfalt und in der Genauigkeit,<br />
mit der sie erkennbar versuchten, auch Entlastendes zusammenzutragen. Neben<br />
der umfassenden Recherche ist es auch der Ton ihrer Darstellung, der die Jury überzeugt<br />
hat. Hier verbindet sich journalistische Distanz mit Dezenz, und die Distanz ist<br />
kein Hinderungsgrund für Empathie. Noch ein D-Wort kommt als Qualitätskriterium<br />
hinzu: Große sprachliche Disziplin zeichnet die Reihe dieser Berichte aus, Disziplin,<br />
die nötig war, um im Milieu des Heiklen und Prekären jeden falschen Ton zu vermeiden.<br />
Mit dieser Art der Berichterstattung über die „größte Kirchenkrise seit 1945“ wird ein<br />
Stück der Menschenwürde wieder zur Geltung gebracht, die man den misshandelten<br />
jungen Menschen einst genommen hat. Für die Betroffenen, die sich den Reportern<br />
Prummer und Stawski anvertraut haben, wird das eine Genugtuung gewesen sein. Im<br />
Sinne kritischer Öffentlichkeit sind die Vorteile für uns, das Publikum, die wichtigsten:<br />
verstärkte Aufmerksamkeit dank konsequenter Unterrichtung über Ungeheuerliches.<br />
Eine tadellose Leistung in Inhalt und Form.<br />
vorgetragen von Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
72
Wer singen will, muss schweigen *<br />
Diese Kinder waren Auserwählte, denn sie gehörten zu einem der ältesten und<br />
berühmtesten Knabenchöre der Welt. Doch was sie bei den Regensburger Domspatzen<br />
erlebten, machte sie sprachlos. Erst jetzt, als Erwachsene, können sie<br />
darüber reden.<br />
Regensburg – Es dauerte Jahrzehnte, bis sie zurückkehrten, an den Ort, der sie<br />
nicht loslässt. Josef Eder zum Beispiel. Er streifte durch die Ruine des Internats,<br />
durch Scherben und Müll.<br />
„Es war gruselig, so als ob ich auf dem Weg durch die Gänge und Räume<br />
erfolglos meine Kindheit suchte. Es war pervers und lebensprägend, was<br />
damals geschah.” (Josef Eder, 45, Choreograph, von 1972 bis 1982 Domspatz)<br />
Josef Eder war acht Jahre alt, als er in den Chor kam, als er in das Internat gehen<br />
durfte. Er war einer der Auserwählten. Als Erwachsener kam er zurück in die<br />
Dom spatzenstraße, um zu sehen, wie seine alte Schule verfiel. Er kam wieder,<br />
wie so viele, die ihre Jahre hier in diesem Dorf, in Etterzhausen bei Regensburg,<br />
als die schlimmsten ihres Lebens beschreiben. Als Straflager. Die Zeit in der<br />
Vorschule der Regensburger Domspatzen.<br />
Die Ehemaligen erzählen jetzt von Schlägen, und die seien nicht die Ausnahme,<br />
sondern die Regel gewesen. Sie erzählen von einem Klima der Angst und von<br />
seelischen Schäden, die geblieben sind. Die meisten haben Jahrzehnte nicht<br />
darüber gesprochen. Sie sind zwischen 28 und 66 Jahre alt, arbeiten als Choreo -<br />
graph wie Eder, als Arzt und Psychotherapeut, Wirtschaftsprofessor, Manager,<br />
Schafzüchter, Pädagoge. Acht Männer aus vier Jahrzehnten Domspatzen, von<br />
1954 bis 1992 – jetzt reden sie, auch wenn zwei ihren Namen nicht nennen wollen.<br />
Die Domspatzen, sie sind einer der ältesten Knabenchöre der Welt, zu dem es<br />
Münzen gibt, Sonderstempel und eine Briefmarke. Ein Chor, der schon vor der<br />
Queen und US-Präsident Ronald Reagan auftrat; der auf Konzertreisen in Japan<br />
von Fans belagert wird.<br />
Jahrzehntelang gab es höchstens Anspielungen. Der Münchner Amerikanistik-<br />
Professor Gert Raeithel beschrieb unter dem Pseudonym Richard W.B. McCormack<br />
das Volk der Bayern und auch die bayerische Sangeslust: „Vorbildlich hierin die<br />
* Die preisgekrönte Artikelserie ist erschienen in der Süddeutschen Zeitung ab 13./14.03.<strong>2010</strong>; der für das Best of <strong>2010</strong><br />
von den Autoren ausgewählte und hier veröffentlichte Beitrag am 31.03.<strong>2010</strong>. (Die Redaktion)<br />
73
Regensburger Domspatzen, die das Publikum in aller Welt bejubelt und denen<br />
man die blauen Flecken kaum noch ansieht, die die Ausbildung bei ihnen hinterließ.”<br />
Auch die Kinder haben es angedeutet: Die Ausgabe einer Faschingszeitung<br />
der Schüler, mehr als 50 Jahre ist das her, hieß „Alptraum”, darunter stand: „Noch<br />
Betten frei”. Niemand fragte nach. Doch jetzt, da die Berichte über Missbrauch<br />
und Misshandlungen nicht abreißen, haben viele den Mut gefunden, das Verdrängte<br />
öffentlich zu machen.<br />
„Wir Domspatzen haben mit Hingabe versucht, unter vielen Entbehrungen,<br />
Woche für Woche im Regensburger Dom die Menschen mit unserem Gesang<br />
ein bisschen glücklich zu machen. Nun verlange ich nur von Seiten der Kirche,<br />
gefälligst mit aller Kraft bei der Aufklärung mitzuwirken.” (Markus Geiger, 37,<br />
Handelsfachwirt, von 1982 bis 1987 Domspatz)<br />
Wilhelm Ritthaler sitzt auf einem antiken Stuhl in seinem Bungalow, vor ihm<br />
liegt ein Blatt Papier. Darauf die elf wichtigsten Stichpunkte zu seinem Leben.<br />
Unter Punkt sechs steht „Suizidalität”. Wilhelm Ritthaler, 63 Jahre alt, Arzt und<br />
Psycho therapeut, will nichts aus seiner Geschichte vergessen, deswegen die<br />
Liste. Neben ihm steht eine Kiste mit Zeitungsausschnitten, Bildern und Prüfungsplänen.<br />
Es ist das, was materiell übrig geblieben ist von seinen elf Jahren als<br />
Domspatz. Die Ausschnitte zeigen ihn als blonden Jungen, er steht weit vorne<br />
im Chor. Es gibt Bilder vom Besuch beim Papst. Zu solchen Anlässen schrieben<br />
Zeitungen Schlag zeilen wie „Lobpreis der Engel”, „Musikalischer Zuckerguß”,<br />
„Domspatzen zwitschern”. Ritthaler war der Klassenprimus, viele Jahre Klassensprecher,<br />
er war nicht der beste Sänger, aber er war gut genug. Er durfte mitreisen<br />
zu den Politikern und den Stars. Nun aber erzählt er von dem, was nicht in den<br />
Zeitungen stand: Dass ein Domspatz so sehr geschlagen worden sei, dass er<br />
eine Kieferoperation gebraucht habe, dass es „öffentliche Hinrichtungen” im<br />
Speisesaal gegeben habe, bei denen Schüler minutenlang zusammengeschlagen<br />
worden seien, und dann das Tischgebet folgte.<br />
„Ich mochte keine Blutwurst. Aber die Ordensschwester zwang mich dazu, sie<br />
aufzuessen. Ich musste mich übergeben. Dann zwang mich die Schwester,<br />
das Erbrochene wieder aufzuessen. Vor den Augen der anderen Schüler, auch<br />
der Direktor und die anderen Schwestern schauten zu. Das war eine der vielen<br />
74
Ernie drigungen. Und es war noch nicht mal die schlimmste.” (Wilhelm<br />
Ritthaler, von 1955 bis 1966 Domspatz)<br />
Als System und als Methode der Erziehung bezeichnen er und die anderen die<br />
Gewalt, mit der sie lebten und lernten. Es gab auch Fälle von sexuellem Missbrauch.<br />
Sie fanden in Ritthalers Zeit im Chor statt, bekannt ist auch ein Fall in<br />
den Siebzigern. Ein Täter ist bereits tot, ein anderer wurde vor kurzem vom Dienst<br />
in einer Pfarrgemeinde suspendiert. Die Bistumsbeauftragte für Fälle körperlicher<br />
Gewalt hat am Dienstag einen Zwischen bericht vorgestellt. Viele Betroffene hätten<br />
sich gemeldet. „Die geschilderten Taten widersprechen der gottgegebenen<br />
Würde der Kinder und Jugendlichen”, erklärt das Regensburger Bistum. Von den<br />
neun Beschuldigten seien mindestens sechs schon gestorben.<br />
Die Laufbahn bei den Domspatzen beginnt oft im Grundschulalter, in der sogenannten<br />
Vorschule. Sie stand einst in Etterzhausen, Anfang der achtziger Jahre<br />
zog sie ins nahe Pielenhofen um. Wer gut ist, schafft es aufs Domspatzengymnasium<br />
in Regensburg. Es ist die Vorschule, die vielen als besonders schlimm in<br />
Erinnerung ist. Die Schüler waren in zwei Gruppen geteilt, eine betreut vom Präfekten,<br />
die andere von einer Erzieherin oder einer Ordensschwester. Wer bei den<br />
Frauen landete, hatte Glück, dort soll es nur selten Übergriffe gegeben haben.<br />
Die Älteren berichten, auch auf dem Gymnasium sei geschlagen worden. Die<br />
Jüngeren, die in den Siebzigern dorthin kamen, empfanden den Übertritt als<br />
Erleichterung. „Regensburg war ein Gymnasium, Etterzhausen ein Schlachtfeld”,<br />
sagt Josef Eder. An der Spitze stand fast 40 Jahre lang Direktor Johann Meier.<br />
Die Schläge und die Gewalt hätten erst geendet, als er 1992 in den Ruhestand<br />
ging und der neue Schulleiter kam. Heute gibt es keine großen Schlafsäle mehr,<br />
heute arbeiten ausgebildete Erzieher in den Domspatzen-Internaten. Mit dem<br />
alten Personal sei auch die Gewalt verschwunden.<br />
Den früheren Direktor Meier beschreiben die Ehemaligen aber als Sadisten und<br />
den Präfekten, der für die Erziehung zuständig war, als nicht minder gewalttätig.<br />
Auch andere Lehrer hätten die Kinder gequält. Auf verstörende Weise gleichen<br />
sich die Strafen, die Erniedrigungen aus den verschiedenen Jahrzehnten.<br />
„Wir standen militärgerecht in Zweierreihen auf dem Gang, um nach Namensaufruf<br />
die Post überreicht zu bekommen. Direktor Meier nutzte diese Momente<br />
75
immer, um seine Strafexekutionen vor den Augen aller durchzuführen. Auf seine<br />
Frage, wer denn einen Kaugummi zwischen die Klavierhämmer geklebt habe,<br />
trat schüchtern und mutig einer meiner Mitschüler nach vorne. Er konnte gar<br />
nicht so schnell schauen, da lag er schon von Meiers Rückhand zu Boden<br />
gemäht vor ihm. Meier trat weiter wie auf ein Stück Vieh auf ihn ein. Er krümmte<br />
sich, Meier ließ ab, ging weg und machte normal mit der Briefübergabe weiter.<br />
Mitzuerleben, wie jemand geschlagen wird, ist fast noch prägender, als selber<br />
geschlagen zu werden. Er stahl damals unsere Seelen.” (Josef Eder)<br />
Josef Eder leitet Tanzprojekte mit Jugendlichen auf der ganzen Welt. Er kommt<br />
aus dem Bayerischen Wald, die Eltern sind Bauern. Als er in den siebziger Jahren<br />
Domspatz wurde, war das ein großer Tag für die Familie. Ein Bekannter organisierte<br />
ein Stipendium, die Eltern hätten das Schulgeld nicht zahlen können.<br />
Josef Eder ist der Typ Surfer. Leinenhemd, bunte Hawaii-Kette, unrasiert, locker,<br />
lustig. Aber geht es um die Domspatzen, kämpft er mit den Tränen. „Es war Angst,<br />
Terror und Charakterbrechung”, sagt er. „Du kannst als Kind ja nicht ein mal be -<br />
werten, ob das, was du erlebst, vielleicht einfach normal ist.”<br />
Psychologen sprechen von einem Schweigekartell. Es kann in geschlossenen<br />
Institutionen entstehen, in denen es ein Machtgefälle und keine Kontrollmechanismen<br />
gibt. Die Opfer begehren nicht auf, sondern leiden still, weil sie nicht<br />
wissen, wie sie die Situation einschätzen sollen. Verängstigt und verschämt<br />
beobachten sie, was die anderen tun. Und weil die das Gleiche tun, schweigen<br />
alle. Wem sollten wir es denn sagen, fragen viele Ehemalige. Den Ordensschwestern?<br />
Niemals hätten die was unternommen, sagen sie, denn die Schwestern<br />
vergötterten die Geistlichen, die Internatsleitung.<br />
„Der Präfekt verübte seine Übergriffe vor allem auf Kinder, deren Eltern aus<br />
einfachen Verhältnissen kamen und kreuzkatholisch waren. Da hatte er nichts<br />
zu befürchten. Mir ging es besser, mein Vater war Akademiker. Ich wurde selbst<br />
nicht sexuell missbraucht und auch nicht so oft geschlagen.” (Dieter Kammerer,<br />
66, pensionierter Pädagoge, von 1954 bis 1963 Domspatz)<br />
„Das Credo war: Man muss hart sein, weil man später mal etwas Besonderes<br />
wird. Also hielt man still. Sie drohten, dass man sonst nicht mit den anderen<br />
Schülern im Dom singen dürfe. Darauf fieberten wir Vorschüler das ganze<br />
76
Jahr hin.” (Manager, 28, von 1990 bis 1992 in der Vorschule Pielenhofen)<br />
Viele Eltern glaubten dem Monsignore und dem Präfekten. Sie werden schon<br />
wissen, was unseren Kindern guttut, sagten sie. Andere beschwerten sich bei der<br />
Schulleitung in Pielenhofen, hätten aber zu hören bekommen, das sei normal.<br />
Wieder andere nahmen ihr Kind von der Schule. Doch oft erfuhren die Eltern gar<br />
nicht erst von den Misshandlungen. Die Briefe in der Vorschule seien zensiert<br />
worden, sagen die Domspatzen. Und viele Jungen dachten, dass sie die Strafen<br />
verdient hätten. Sie wollten ihre Eltern stolz machen, ihnen keine Sorgen bereiten.<br />
„Ich habe Bilder vor Augen von Kindern, die mit ihren eigenen Händen unter<br />
dem Zaun graben, der das Internat umspannt. Sie suchten ihr Heil in der Flucht<br />
nach Hause. Wir sahen immer wieder diese Löcher. Jene, die ausbrachen,<br />
brachte die Polizei ein paar Stunden später zurück. Diese Bilder prägen mich<br />
bis heute.” (Markus Geiger)<br />
„In Etterzhausen gab es etwa acht bis zehn sogenannte Geigenkammern<br />
nebeneinander. Jeder musste darin jeden Tag eine Stunde lang üben. An den<br />
Türen war ein Guckloch wie im Gefängnis, durch das schaute die Kontrollperson,<br />
um zu prüfen, dass man ja übt. Einer meiner Mitschüler hat in die Kammer<br />
geschissen und mit seinem Kot die Wände beschmiert. Für mich war er<br />
damals schon ein Held. Es war der genialste, logischste und vernünftigste<br />
Ausdruck eines Achtjährigen, um sprachlos mit seiner Umwelt zu kommunizieren<br />
und sein Leid auszudrücken.” (Josef Eder)<br />
Aus den Achtjährigen wurden Erwachsene, doch sie schwiegen weiter. Wie kann<br />
es sein, dass jahrzehntelang niemand aufbegehrte? Die Scham der Betroffenen<br />
hört auch im Erwachsenenalter nicht auf, sagen Psychologen. Der stärkste Impuls<br />
sei, die traumatisierenden Ereignisse zu verdrängen und die Zeit zu beschönigen.<br />
„Ich glaube, das Ganze konnte so lange gut gehen, weil wir ja berühmt waren,<br />
ein Pool von talentierten Knaben aus der ganzen BRD. Um es drastisch auszudrücken:<br />
Man pinkelt ja nicht auf sein eigenes Bild.” (Anton Kellner, 53,<br />
Schafzüchter, von 1966 bis 1972 Domspatz)<br />
Viele brauchten Jahrzehnte, um sprechen zu können. Sie begannen, Bücher zu<br />
schreiben, aber sie verstauten sie in Schubladen. Jetzt fassen sie Mut – doch viele<br />
vertrauen dem Regensburger Bistum nicht. Bischof Gerhard Ludwig Müller sagt,<br />
77
die Medien hätten sich die Domspatzen als Opfer ausgesucht. „Ein Glanzstück<br />
des Bistums Regensburg soll in den Dreck gezogen werden. Ein katholisches<br />
Internat mit Buben beschäftigt die Phantasie, die sich genüsslich ausmalt, was<br />
alles hinter den ,hohen Mauern‘ des Musikgymnasiums vorgehen mag.”<br />
Die Opfer sagen, dass sie sich von solchen Sätzen verhöhnt fühlen. Einige<br />
schreiben an das Bistum und schicken die E-Mail in Kopie an Medien. Als am 5.<br />
März die ersten Fälle von Misshandlungen an der Vorschule bekannt wurden, teilte<br />
Bischof Müller mit, dass die Vorschule nicht zu den Domspatzen gehöre. Auch das<br />
ärgert die Opfer. Die Vorschule ist zwar formal selbständig, aber de facto wurde<br />
sie gegründet, um noch früher Domspatzen heranzuziehen. Im Kuratorium der<br />
„Stiftung Etterzhausen der Regensburger Domspatzen” saßen ein Vertreter der<br />
Kirche und der Domkapellmeister, also der Leiter der Domspatzen. Zwischen<br />
1964 und 1994 war das Georg Ratzinger, der Bruder des heutigen Papstes.<br />
Er hat vor kurzem zugegeben, dass er selbst Ohrfeigen ausgeteilt hat. Ratzinger<br />
soll cholerisch gewesen sein, erzählen die Domspatzen. Aber, und das betonen<br />
fast alle, es war kein Terror. Bei ihm war viel Leidenschaft für die Musik. Dass aber<br />
unter seiner Führung Misshandlungen stattfanden, kritisieren sie. In einem Aufsatz<br />
zum Jubiläum des Regensburger Musikgymnasiums schrieb Ratzinger über den<br />
Abschied des gefürchteten Vorschuldirektors Meier, „dass sein Erziehungsstil in<br />
der modernen Zeit nicht mehr verstanden wurde”.<br />
Ratzinger gestand ein, dass ihm Domspatzen auf Reisen von den Schlägen<br />
erzählten, aber er habe nicht gewusst, dass es so schlimm war. Die Ehemaligen<br />
sagen, als Domkapellmeister hätte er es wissen müssen. „Ein Wort von ihm hätte<br />
gereicht”, sagt Wilhelm Ritthaler. „Und der Terror wäre vorbei gewesen.”<br />
Psychische Gewalt wirkt oft traumatisierend: Albträume, Depressionen, wenig<br />
Selbstwertgefühl, Angst vor Menschen, vor Bindungen, vor sexuellen Beziehungen,<br />
das alles können Folgen sein.<br />
„Für mich war das die mit Abstand schlimmste Zeit meines Lebens. Ich<br />
glaube, dass jeder von uns innere Verletzungen davongetragen hat. Als ich<br />
weg war, habe ich versucht, mir zu sagen: Schwamm drüber, ich habe ja<br />
überlebt.” (Gottfried Rühlemann, 52, Hochschulprofessor und Wirtschaftsprüfer,<br />
von 1965 bis 1971 Domspatz)<br />
78
Viele Ehemalige waren und sind deshalb in Psychotherapie. Zwei kamen Ende der<br />
achtziger Jahre auch in die Praxis von Wilhelm Ritthaler. Sie litten unter Depressionen.<br />
Ritthaler sagte ihnen nicht, dass auch er Domspatz war. Er war selbst oft<br />
verzweifelt und lebensmüde. Er erzählt das ruhig, distanziert. Er spricht von<br />
emotionaler Deprivation, von posttraumatischer Belastungsstörung und Flashbacks.<br />
Und er sagt, ohne Therapie hätte er nicht überlebt.<br />
Seit die Medien über Misshandlungen und Missbrauch bei den Domspatzen<br />
berichten, sind viele Ehemalige nicht mehr zur Ruhe gekommen.<br />
„Eigentlich hätte ich am 1. April eine neue Arbeitsstelle antreten sollen. Ich<br />
bin Handelsfachwirt. Aber die letzten Wochen waren einfach zu viel. Diese<br />
vielen Berichte über die Domspatzen haben alles wieder hochkommen lassen.<br />
Die Zeit dort hat mich krank gemacht. Ich beginne jetzt eine Traumatherapie<br />
in München. Ich muss das alles aufarbeiten.” (Markus Geiger)<br />
Wilhelm Ritthaler trifft sich in diesen Wochen mit Psychotherapeuten aus ganz<br />
Deutschland. Er will helfen, ein Institut zur Prävention und Rehabilitation bei<br />
körperlichem, emotionalem und sexuellem Missbrauch zu gründen. Das ist sein<br />
großes Ziel – andere wollen Rache.<br />
„Direktor Meier hat auf seinem Grabstein ,Monsignore‘ stehen (ein päpstlicher<br />
Ehrentitel, Anm. d. Redaktion). Es wäre ein kleines Zeichen der Genugtuung,<br />
diesen ,Monsignore‘ auf seinem Grabstein entfernen zu lassen – auch<br />
wenn er es nicht mehr spüren wird, der Herr Prügeldirektor.” (Angestellter im<br />
öffentlichen Dienst, in den siebziger Jahren in der Vorschule Etterzhausen)<br />
Jeder der acht Männer freut sich, dass nun auch andere reden. Aber sie wissen<br />
auch, dass sie Ärger bekommen werden. Sie wissen, dass sie sich rechtfertigen<br />
werden müssen vor denen, die sie als die Schuldigen sehen. Weil wegen ihnen<br />
nun ein Schatten auf den glänzenden Ruf der Domspatzen fällt.<br />
Es ist nun schon wieder viele Jahre her, dass Choreograph Joseph Eder und die<br />
anderen durch die Ruinen des Internats in der Dompatzenstraße in Etterzhausen<br />
streiften. Wo früher aber die verwitterten Reste des Internats lagen, stehen nun<br />
Einfamilienhäuser mit Pool im Garten. „Plötzlich eine heile Welt”, sagt ein Domspatz.<br />
„Als hätte jemand mit aller Macht die Vergangenheit auslöschen wollen.”<br />
79
Medienprojektpreis
81<br />
Alfons Pieper
„Wir in NRW – Das Blog“<br />
Start des Blogs Dezember 2009<br />
www.wir-in-nrw-blog.de<br />
Alfons Pieper<br />
geboren 1941 in Waltrop (NRW)<br />
Werdegang:<br />
Dezember 2009 Gründung des Blogs „Wir in NRW“<br />
2006 Pensionierung<br />
2003-2006 Chefkorrespondent der WAZ in Berlin<br />
1994-2003 stellv. Chefredakteur und Politikchef der WAZ in Essen<br />
1988-1994 Parlamentskorrespondent der „Augsburger Allgemeinen“<br />
1981-1988 Parlamentskorrespondent der WAZ in Bonn<br />
1973-1981 Politischer Redakteur bei der WAZ<br />
1972-1973 Volontariat bei der WAZ, danach Redakteur<br />
1972 Studium der Geschichte in München<br />
82
Begründung der Jury<br />
Man liest und hört es immer wieder: Das Internet, so heißt es, sei ein per se demo -<br />
kratisches Medium. Ein jeder kann dort veröffentlichen, was er oder sie für richtig<br />
hält. Die etablierten Medien haben kein Monopol mehr auf die Verbreitung von Nachrichten<br />
und Meinungen. Die Bürger können mit wenig Aufwand dagegen halten und<br />
vor allem können sie sich heute mit Hilfe des Netzes untereinander viel schneller<br />
verständigen als ehedem. Doch trotz all der vielen Blogs und Aktivistenseiten im Netz<br />
gilt: professionellen Journalismus hat das Internet keineswegs überflüssig gemacht,<br />
sondern eher im Gegen teil: Die Infoflut ist so gewaltig angeschwollen, dass es eigentlich<br />
nur mit Hilfe von gelernten Informationsarbeitern möglich ist, den Überblick zu<br />
behalten. Kritischer Journalismus bleibt eine Conditio sine qua non für die Herstellung<br />
von Öffentlichkeit, ohne die Demokratie gar nicht funktionieren kann, daran ändert<br />
das Internet erst mal gar nichts.<br />
Doch es gibt Situationen, da kann das Publizieren im Netz zum wahren Rettungsanker<br />
für die demokratische Meinungsbildung werden, dann nämlich, wenn die bezahlten<br />
Profis an der Informationsfront ihre Arbeit nicht mehr richtig tun oder tun können. Wenn<br />
die etablierten Medien bei ihrer Aufgabe versagen, und die Verfehlungen der Mächtigen<br />
gar nicht mehr berichtet werden. Sei es, weil in den Redaktionen ohne Rücksicht auf<br />
die Qualität massenhaft Stellen abgebaut werden oder sei es, weil der Filz zwischen<br />
Politik, Unternehmen, Verlegern und Chefredakteuren dazu führt, dass kritische Journalisten<br />
bei den etablierten Medien gar nicht mehr zum Zuge kommen.<br />
Wie einer solchen Lage richtig zu begegnen ist, das haben unsere diesjährigen <strong>Preis</strong>träger<br />
für das beste Medienprojekt bewiesen. Alfons Pieper, selbst lange Jahre stellvertretender<br />
Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen (WAZ), hat den Niedergang<br />
der politischen Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen lange verfolgt und in<br />
der Zeit vor der Landtagswahl selbst zur publizistischen Nothilfe gegriffen. Gemeinsam<br />
mit fünf Kollegen rief er den Blog „Wir-in-NRW“ ins Leben und schuf so Gegenöffentlichkeit<br />
im besten Sinne des Wortes. Seit Dezember 2009 haben er und sein Team<br />
über all die fragwürdigen Wahlkampfpraktiken des damaligen Ministerpräsidenten<br />
Jürgen Rüttgers und seiner Parteifreunde berichtet, die bei den Zeitungen und Sendern<br />
der Region zunächst gar kein Thema waren.<br />
83
Pieper und seine Kollegen waren es, und eben nicht die Zeitungen und Sender der<br />
Region, die herausbrachten, dass hoch bezahlte Beamte der Staatskanzlei für die<br />
Parteiarbeit abgestellt wurden oder dass angeblich unabhängige Wähler-Initiativen<br />
ihre Ausgaben über ein CDU-Konto abwickelten. Sie prangerten an, dass Industrielle<br />
ihre Parteispenden als Betriebskosten abrechneten oder dass ein aus öffentlichen<br />
Geldern bezahlter Politik-Professor sich in den Dienst der Wahlkämpfer stellte. So<br />
waren die Autoren von „Wir-in-NRW“ bei vielen brisanten politischen Themen nicht<br />
nur ganz vorne mit dabei. Vielfach brachten sie die Berichterstattung der übrigen<br />
Medien überhaupt erst in Gang. Wie nötig diese journalistische Intervention war,<br />
bewies nicht zuletzt der Umstand, dass sich die Regierenden nicht zu schade waren,<br />
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen die Blogger zu veranlassen, obwohl diese<br />
lediglich normale journalistische Arbeit leisteten.<br />
Unbezahlt und in ihrer Freizeit haben die Autoren von „Wir-in-NRW“ auf diesem Weg<br />
vorbildlich demonstriert, wie man Fehlentwicklungen in den Medien und der Politik<br />
bekämpft und korrigiert. Dafür gebührt ihnen Dank und als kleiner Ausgleich für die<br />
viele Mühe dieser <strong>Preis</strong>. Eine Bitte haben wir allerdings: Bleiben Sie dran!<br />
vorgetragen von Harald Schumann<br />
84
1<br />
2<br />
3<br />
1 Moderatorin Sonia Seymour Mikich<br />
im Gespräch mit Jury-Mitglied<br />
Thomas Leif 2 Jury-Mitglied Thomas<br />
Leif im Gespräch mit Gewinnern des<br />
Recherche-Stipendiums 3 Jury-Mitglied<br />
Thomas Leif mit „Handelsblatt“<br />
und <strong>Preis</strong>trägerinnen 4 300 Gäste<br />
verfolgen die <strong>Preis</strong>verleihung<br />
4<br />
85
RECHERCHESTIPENDIEN I + II
Marianne Wendt und<br />
Maren-Kea Freese<br />
Tina Groll<br />
Thomas Schuler
Moderatorin Sonia Seymour Mikich im Gespräch<br />
mit Jury-Mitglied Thomas Leif<br />
Mikich: Redundanz ist manchmal ganz wunderbar. Wir haben schon mehrfach<br />
gehört, aber ich sage es auch noch mal, Recherche kann nicht genug ermutigt<br />
und gefördert werden, gerade weil zu viele Journalisten sich mit dem kurzen<br />
Google-Klick zufrieden geben müssen. Die Zeit nachzuhaken, Gegenzuchecken<br />
wird immer knapper. Investigativer Journalismus ist ein sehr teurer Zeitfresser<br />
und darum helfen die Recherche-Stipendien der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung jungen<br />
Kollegen, sich doch auf diesem schwierigen Terrain zu beweisen. Thomas Leif<br />
wird Ihnen berichten, was in diesem Jahr besonders auffiel und welche Projekte<br />
jetzt mit Hilfe der Stipendien auf den Weg gebracht werden. Thomas Leif ist ein<br />
Kollege, der sich fast besessen um die Jugend kümmert und auch beim „Netzwerk<br />
Recherche“ alles daran setzt, Nachwuchskräfte zu finden, sie zum Glühen zu<br />
bringen und auch zum Glänzen. Thomas, gab es thematische Schwerpunkte in<br />
diesem Jahr ? Irgendein Trend, wofür sich die Leute besonders interessierten?<br />
Leif: Das kann man so leider nicht sagen. Die eingereichten Bewerbungen sind<br />
thematisch sehr, sehr unterschiedlich, auch in der Qualität sehr verschieden.<br />
Einen großen Trend konnten wir nicht entdecken. Auffällig ist, dass die Leute<br />
sehr gerne ins Ausland reisen möchten. Wir sind bei diesen Anträgen, die einen<br />
längeren Auslandsaufenthalt erfordern, aber sehr skeptisch und zurückhaltend.<br />
Mikich: Aber wie war denn die diesjährige Bewerbungslage?<br />
Leif: Knapp 30 Bewerbungen unterschiedlicher Qualität wurden eingereicht.<br />
Daraus haben wir dann die Besten rausgefischt.<br />
Mikich: Und die Besten sind?<br />
Leif: Die Besten sind anonym, weil alle drei, die dieses Mal ein Stipendium<br />
bekommen, schon mitten in den Recherchen sind. Alle arbeiten auf eine ganz<br />
spezifische Art vertraulich und allen drei könnte es schaden, wenn wir jetzt ihre<br />
Namen rausposaunen würden. Sie sollen in Ruhe, mit ganz viel Fleiß und viel<br />
Zeit, arbeiten.<br />
88
Mikich: Auch undercover?<br />
Leif: Einer undercover und die anderen undercover in dem Sinne, dass sie mit<br />
Recherchen einsteigen, wo nicht von vornherein klar ist, das sie das alles, was<br />
da ermittelt und besprochen wird, später auch veröffentlichen.<br />
Mikich: Du hast das ja jetzt Jahr für Jahr begleitet. Auch bei Netzwerk Recherche<br />
kommen natürlich immer wieder junge Leute an mit fantastischen Ideen. Gibt es<br />
Grund zum Optimismus?<br />
Leif: Ja, es wird besser. Wobei man auch zugeben muss, dass es überhaupt nicht<br />
schlimm ist, wenn mal eine Recherche scheitert. Mich hat ein Redakteur vom<br />
„Medium Magazin“ genervt, der ständig nur wissen wollte, wie viele Stipendien<br />
gescheitert seien. Das ist kein Problem, weil wir offen legen, wenn einer abbricht<br />
oder wenn es nicht funktioniert. Wichtig ist, dass ein zweites Prinzip funktioniert,<br />
was wir vorhaben. Nämlich, dass ein erfahrener Journalist oder eine Journalistin<br />
die Stipendiaten begleitet und betreut. Meine Erfahrung ist die: Je intensiver die<br />
Betreuung ist, umso besser ist das Ergebnis. Ich will ein Beispiel nennen: Astrid<br />
Geißler hat wunderbare Arbeit geleistet, ist selbst in Ostdeutschland unterwegs<br />
gewesen und hat dort die Neonazi-Szene beobachtet. Das Recherche-Ergebnis<br />
füllte dann zwei Seiten in der „taz“, Seite 1 und 2! Und sie hat nachher noch einen<br />
großen, renommierten Journalistenpreis damit gewonnen. Das ist sozusagen die<br />
Glücksspirale, die wir anstreben. Nicht immer kann es so sein, aber bei den drei<br />
Stipendien, die wir dieses Jahr vergeben haben, sieht alles schon sehr sehr gut aus.<br />
Mikich: Und jetzt erzählt Thomas Leif, was aus den Stipendiaten der letzten<br />
Jahre wurde. Er sorgt, das habe ich schon angedeutet, wie eine Art Übervater<br />
dafür, dass die Leute auch glänzen. Und Du kannst wirklich zu recht stolz sein<br />
auf Marianne Wendt, Maren-Kea Freese, Tina Groll und Thomas Schuler.<br />
Und ich bitte Sie auf die Bühne.<br />
89
Jury-Mitglied Thomas Leif im Gespräch<br />
mit ehemaligen <strong>Preis</strong>trägern<br />
Leif: Wir wollen zeigen, was aus den Stipendien der vergangenen Jahre geworden<br />
ist, damit Sie wissen und nachvollziehen können, wie sinnvoll und anspruchsvoll<br />
die Stipendien sind.<br />
Wir beginnen mit den beiden Frauen links von mir. Und zwar haben die sich<br />
gekümmert um Analphabeten in Deutschland. „Immer im Verborgenen. In einer<br />
Welt der Schriftkultur“, heißt das Feature *, das als Ergebnis des „<strong>Brenner</strong>-<br />
Stipendiums“ demnächst gesendet wird. Können Sie uns erzählen, was das<br />
Haupt ergebnis Ihrer Untersuchung war?<br />
Wendt: Ich denke, dass frappierendste war, im direkten Gespräch mit den Betroffen<br />
zu erfahren, wie tief und wie weitreichend die Beeinflussung des Alltagslebens<br />
von Leuten ist, die von Analphabetismus betroffen sind. Was weit darüber<br />
hinaus geht, dass eben ein Text oder eine Schrift nicht begriffen werden kann,<br />
sondern dass das komplette Leben im Grunde genommen davon dominiert wird.<br />
Leif: Von wie vielen Menschen geht man in Deutschland offiziell in der Statistik<br />
aus, die dieses Problem haben?<br />
Freese: Bisher wurde von 4 Millionen ausgegangen. Jetzt gibt es neue Zahlen,<br />
die von 9,5 Millionen Menschen sprechen – wenn man auch noch die Risikogruppen<br />
mit dazu nimmt. Bei dieser Zahl sind dann auch die Leute, die wirklich<br />
schon lange in dem Thema engagiert sind, erschrocken.<br />
Leif: Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sprechen von 9,5 Millionen Menschen,<br />
die davon betroffen sind?<br />
Freese: Ja. Es geht bei dieser Zahl um funktionale Analphabeten. D. h.: man hat in der<br />
Schule rudimentäre Buchstabenkenntnisse erworben, aber das nützt einem nicht<br />
viel. Es ist trotzdem eine Art Buchstabenwald, in dem man sich Tag für Tag befindet.<br />
* Wir machen das Feature über die DVD, siehe innere Umschlagseite, zugänglich. (Die Redaktion)<br />
90
Leif: Können Sie uns in aller Kürze vermitteln, was für ein Leid das ist. Was sind<br />
die Handicaps, die diese Menschen im Alltag haben?<br />
Freese: Ich meine, die Probleme im Alltag sind – wenn man so will – das Vordergründige.<br />
Man hat Schwierigkeiten, mit der U-Bahn in einen anderen Bezirk zu<br />
fahren. Das ist so, als wenn wir jetzt irgendwo in China stünden. Hinter diesem<br />
Alltagsproblem gibt es weitere Schwierigkeiten, die dann etwa das Selbstbewusstsein<br />
und die Selbstsicherheit der Leute betreffen.<br />
Leif: Gibt es in Deutschland eine soziale Infrastruktur, die sich mit diesen<br />
Menschen beschäftigt? Wer hilft ihnen eigentlich?<br />
Freese: Leider sehr wenige. Hauptsächlich werden VHS-Kurse angeboten – da<br />
wird ein- bis zweimal die Woche dann abends zwei Stunden geübt. Das ist<br />
natürlich zu wenig. Es gibt ganz wenige Einrichtungen, die wirklich Hilfe und<br />
Unterstützung anbieten. Und selbst das ist, wenn man das absolviert hat,<br />
immer noch nicht ausreichend – muss man ehrlicherweise sagen.<br />
Leif: Also ein Problem, das man ganz gerne beiseite schiebt, was niemand wahrhaben<br />
will. Wie ist es Ihnen denn gelungen, die Menschen zum Sprechen zu bringen?<br />
Das war ja bei Ihrer Recherche, bei Ihrem Feature im Grunde das Wichtigste?<br />
Wendt: Ja. Wir haben zwei Protagonisten gefunden, die wir dann auf dem Weg<br />
leider wieder verloren haben. Wir mussten lernen, mit diesem Verlust umzugehen<br />
und haben dann lange Zeit auch erste Gespräche ohne Mikrofon geführt, um ihnen<br />
die Angst zu nehmen. Wir haben uns dann einmal, zweimal, dreimal, sogar bis<br />
zu sechsmal mit den Leuten über einen längeren Zeitraum getroffen und irgendwann<br />
haben sie gemerkt, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihr Problem nicht<br />
lächerlich finden. Zu dem Titel „Immer im Verborgenen“ sind wir deswegen gekom<br />
men, weil das Hauptproblem ist, dass die Leute schwer zu erreichen sind,<br />
weil sie gar nicht erreicht werden wollen. Sie haben irgendwann, meist sehr früh<br />
in ihrer Biografie, die Erfahrung gemacht, dass Bildung nichts positives ist. Sie<br />
91
fühlen sich bloßgestellt, sie kommen nicht mehr mit, sind abgehängt und dann<br />
verstecken sie sich.<br />
Leif: Was ist Ihre Quintessenz, was Sie uns, den Zuhörern, mitgeben wollen?<br />
Was kann man lernen, was muss die Politik tun, um dieses Problem möglicherweise<br />
etwas einzudämmen?<br />
Wendt: Es ist der schönste und simpelste Satz, den einer der Experten, die sich<br />
mit dem Thema beschäftigen, gesagt hat: „Analphabeten haben keine Lobby!“<br />
Keiner interessiert sich für sie, das Thema ist unschön, es ist unfein.<br />
Freese: Man kann damit nicht punkten in der Politik.<br />
Leif: Was nehmen Sie nach der langen Beschäftigung mit dieser Recherche mit?<br />
Was würden Sie als politische Empfehlung daraus destillieren?<br />
Freese: Lesen und Schreiben e. V., ein Beispiel aus Neukölln, ist erfolgreich und<br />
vergleichbares müsste auch in anderen Bundesländern initiiert werden. Schon<br />
in der Grundschule müssten die Probleme erkannt und behoben werden. Je<br />
später eingegriffen wird, desto überforderter sind die Lehrer in den Schulen.<br />
Leif: Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch noch mal für diese Superarbeit!<br />
Wir kommen zu einem anderen Thema. Tina Groll hat sich mit den sogenannten<br />
Schrottimmobilien beschäftigt. Was ist denn einer Familie in Berlin passiert, die<br />
eine Schrottimmobilie gekauft hat? Vielleicht können Sie ganz kurz schildern,<br />
was der Kern der Story ist.<br />
Groll: Diese Familie, Familie Blaschek aus dem wunderschönen kleinen Städtchen<br />
Thale im Harz, ist gnadenlos abgezockt worden. Die beiden sind Mittel- oder<br />
Kleinverdiener, er ist Krankenpfleger, sie ist medizinisch-technische Assistentin.<br />
Die beiden haben 2 Kinder, die noch in der Ausbildung sind. Und die haben auch<br />
92
ein kleines Einfamilienhäuschen im Harz, das sie noch abzahlen. Eigentlich<br />
wollte die Familie für ihr Alter vorsorgen. Und sind auf ein sogenanntes Steuersparmodell<br />
reingefallen. Eigentlich die klassische Nummer. Sie kennen das vielleicht<br />
noch aus den 90er Jahren. Damals gab es etwa eine halbe Million Schrott -<br />
immobilien, die vor allem über die Bausparkassen vertrieben wurden.<br />
Leif: ... sogenannte Bauherrenmodelle.<br />
Groll: Genau.<br />
Leif: Aber damals sind ja sehr viele Zahnärzte betroffen gewesen, mit denen man<br />
nur begrenzt Mitleid haben kann.<br />
Groll: Das Neue an der Geschichte ist, dass es jetzt die Klein- und die Gering -<br />
verdiener trifft<br />
Leif: ... warum trifft sie das, warum?<br />
Groll: ... und, um den Satz noch zu Ende zu bringen, dass dieses Geschäft vor<br />
allem von Landesbanken und ihren Töchtern vermittelt wurde. Warum trifft sie<br />
das? Die Leute wollen vorsorgen, die Leute wollen eigenverantwortlich handeln.<br />
Sie glauben den Versprechungen und den Aufforderungen, die die Politik macht<br />
und fallen einfach darauf rein. Die Maschen der Betrüger sind gnadenlos. Die rufen<br />
an und sagen: „Ja, wir machen hier ’ne Umfrage zur Steuersparpolitik. Wollen<br />
Sie nicht auch Steuern sparen?“ Und zuerst lassen sich die Leute vielleicht nicht<br />
unbedingt drauf ein. Beantworten vielleicht zwei, drei Fragen und wollen gar<br />
nicht mitmachen. Und ein paar Wochen später kommt ein erneuter Anruf und<br />
dann heißt es: „Sie haben doch neulich an so einer Umfrage teilgenommen. Sie<br />
haben eine Steuersparberatung gewonnen!“ Und dann sind sie in den Fängen<br />
der Betrüger und werden eingelullt.<br />
Leif: Was heißt „in den Fängen der Betrüger“? Die gleichen Leute investieren doch<br />
93
unglaublich viel Zeit, wenn sie sich ein Flachbildschirm kaufen. Gehen sieben<br />
Mal zur Verbraucherberatung, checken das alles rauf und runter. Warum soll<br />
man Mitleid mit den Leuten haben, die sich so über den Tisch ziehen lassen?<br />
Das war ja auch in dem Blog bei „Zeit online“ nachzulesen: „Dummheit muss<br />
bestraft werden!“<br />
Groll: Das waren Leserkommentare, die nach der Veröffentlichung kamen. Ja<br />
natürlich, auch das ist eine Frage, die man den Leuten stellen muss. Die Leute<br />
unterschreiben letztendlich bei diesen Betrügern in den Büros Verträge für<br />
Immobilien. Die kaufen ’ne Schrottwohnung, in der alles schimmelig ist, moderig,<br />
ohne sie sich vorher angesehen zu haben für eine Viertel Million Euro. Denen<br />
wird erzählt, sie würden dann 10 Jahre lang eine Patenschaft übernehmen und<br />
könnten damit 50.000 Euro Steuern sparen. Leute, die ein Gehalt von 1200 Euro<br />
haben. Warum passiert das? Diese Betrüger arbeiten mit psychologischen Mitteln,<br />
die belabern diese Menschen und es passiert einfach. Es ist wie Hexerei, wie<br />
Zauberei. Also sie werden bequatscht und wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und<br />
das Problem ist: Diese Leute, die schämen sich dann hinterher wahnsinnig.<br />
Wenn man ihnen sagt: „Ja, warum sind Sie denn so dumm, warum unterschreiben<br />
Sie denn so einen Vertrag?“ dann schämen sich diese Menschen. Diese Menschen<br />
trauen sich dann auch nicht mehr, sich zusammen zu schließen, in die Öffentlichkeit<br />
zu gehen oder eine Lobby zu gründen.<br />
Leif: Aber machen Sie es den Leuten nicht zu leicht? Auch in Ihrem Text wird ja<br />
von dieser Dummheit überhaupt nicht ...<br />
Groll: Doch, ich habe kritisch nachgefragt.<br />
Leif: Ja, aber nur ganz rudimentär. Wenn man die Blogs liest – 90 Leute haben<br />
geschrieben – findet man häufig das Argument: Zum Betrug gehören immer<br />
zwei. Einer, der betrügt, und ein anderer, der sich betrügen lässt. Das haben Sie<br />
in Ihrer Story relativ knapp behandelt.<br />
94
Groll: Das würde ich so nicht sagen. Wenn man mit den Leuten spricht, stellt<br />
man schnell fest, dass sie „fertig“ sind. Die sind finanziell ruiniert. Und es gibt<br />
keinerlei Chance, diese Schrottwohnung loszuwerden. Wenn man sie für eine<br />
viertel Million Euro nicht los wird, man aber in diesem Vertrag drin hängt, muss<br />
man zahlen, zahlen, zahlen. Man schämt sich irrsinnig dafür, dass man diesen<br />
verdammten kleinen Fehler gemacht hat. Und wird dafür dann auch noch hämisch<br />
von der Öffentlichkeit belacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was mit<br />
den Schrottimmobilien in den 90er Jahren passiert ist auch während der Finanzkrise<br />
mit Landesbanken und ihren Töchtern weitergegangen ist. Und das ist der<br />
Ursprung gewesen in den USA, der zur Finanzkrise geführt hat. Und ich glaube,<br />
dass wir nicht selbstgefällig sein dürfen. Ich glaube auch, dass man verständnisvoll<br />
sein muss. Und ich glaube auch, dass Politik in Verantwortung genommen<br />
werden muss.<br />
Leif: Aber die Politik hat doch jetzt gerade dafür gesorgt, dass es keine wirksamen<br />
Kontrollen dieser Schrottimmobilien gibt. Ein Verbraucherschützer sagte heute<br />
den Satz: Ich fordere gar nicht mehr Kontrollen, weil der Staat die Kontrollen gar<br />
nicht mehr umsetzen kann.<br />
Groll: Es ist absurd, wenn man sich überlegt, dass wir versuchen dafür zu sorgen,<br />
dass kein Gammelfleisch in Umlauf kommt, aber was ständig im Umlauf ist,<br />
sind faule Finanzprodukte, weil die niemand kontrolliert. Es gibt einfach kaum<br />
Kontrolle. Es heißt immer Verbraucherschutz! Aber nun sieht die öffentliche<br />
Finanzaufsicht nicht vor, dass die Verbraucher geschützt werden. Man muss<br />
eigenverantwortlich sein. Es gibt nun diese Beratungsprotokolle. Was machen<br />
die Betrüger? Was machen auch die Banken? Die wissen davon, es ist ein institutionalisiertes<br />
Zusammenwirken. Die fummeln da einen kleinen Halbsatz rein.<br />
Unterschreibt man diese Beratungsprotokolle, unterschreibt man, dass man<br />
über alle Risiken aufgeklärt worden ist. Und diese Leute, diese vielleicht auch<br />
dummen oder naiven Leute, die diesen Steuersparversprechungen glauben,<br />
hängen für immer dran und haben durch diese Beratungsprotokolle jetzt überhaupt<br />
keine Chance mehr, gerichtlich irgendwas zu tun. Ein Riesenproblem bei<br />
95
der Gesetzeslage ist eben auch, dass, wenn ich so dumm war vielleicht mich<br />
darauf einzulassen, ich beweisen muss, dass die Betrüger institutionalisiert<br />
zusammengearbeitet haben mit der Bank. Und das ist nahezu unmöglich.<br />
Leif: Letzte Frage: Warum ist diese tolle Recherche nur in „Zeit online“ erschienen<br />
und nicht im Mutterblatt?<br />
Groll: Ich bin Online-Journalistin, Online-Redakteurin bei „Zeit-online“ und wir<br />
haben uns ganz bewusst dafür entschieden, diese Geschichte nur online laufen<br />
zu lassen, weil wir der Meinung sind, gute, investigative, hartnäckige Recherchen<br />
können auch online stattfinden. Und sie haben online stattgefunden.<br />
Leif: Das war nur keine Antwort auf meine Frage. Liegt es vielleicht daran, dass<br />
die Leser der „Zeit“ zur Zielgruppe der Akquisition gehören?<br />
Groll: Nein. Das liegt nicht daran. Ganz klar: Wir wollten ...<br />
Leif: ... jetzt die ehrliche Antwort! Warum ist es nicht in der „Zeit“ erschienen?<br />
Groll: Weil ich in der Onlineredaktion arbeite und es unbedingt so haben wollte.<br />
Leif: Sie sehen, wie schwer es ist, die Wahrheit zu erfahren. Aber die werden wir<br />
jetzt von Tom Schuler hören. Bitte schön.<br />
Ich will einfach nur mal das „Handelsblatt“ zitieren, das ist ja, sozusagen, die<br />
kritische wirtschaftsinvestigative Zeitung in Deutschland. Und da fragt das Handelsblatt:<br />
„Kommen wir zu einem anderen Buch, anders als das von Sarrazin,<br />
das eine heftige Diskussion über die Bertelsmann Stiftung angestoßen hat.<br />
Haben Sie sich über Thomas Schulers Buch ‚Bertelsmann Republik Deutschland’<br />
sehr geärgert?“ Und Thomas Schuler liest jetzt die Antwort von Herrn Thiel, dem<br />
Chef der Bertelsmann Stiftung.<br />
96
Schuler (liest aus „Handelsblatt“ vor): „Der Vergleich hinkt. Das Buch von Sarrazin<br />
interessiert Millionen, das Buch von Thomas Schuler nur eine überschaubare<br />
Fachöffentlichkeit im Stiftungsbereich. Thomas Schuler beschäftigt sich seit<br />
Jahren mit der Familie Mohn und Bertelsmann. Er unterstellt der Familie eine zu<br />
große wirtschaftliche und politische Macht. Er glaubt sogar, die Stiftung sei in<br />
erster Linie ein Steuersparmodell.“<br />
Leif: Das glaubt Tom Schuler. Und dann gibt es die nächste Frage im „Handelsblatt“:<br />
„Trifft die Kritik zu?“<br />
Schuler (liest aus „Handelsblatt“ vor):<br />
„Nein, das ist doch absurd. Reinhard Mohn hat drei Viertel seines Vermögens<br />
an die Gesellschaft in Form der gemeinnützigen Bertelsmann Stiftung verschenkt.<br />
Er hat immer nach der Maxime ‚Eigentum verpflichtet’ gelebt. Wenn sie ein Vermögen<br />
verschenken, zahlen sie darauf keine Steuern mehr. Aber es ist auch<br />
nicht mehr in ihrem Besitz“.<br />
Leif: „Handelsblatt“ – letzte Frage: „Was lernt die Stiftung aus diesem Buch?“<br />
Schuler (liest aus „Handelsblatt“ vor): „Wir nehmen das Buch als Anregung, die<br />
Arbeit der Stiftung noch transparenter zu gestalten. Alles kann man verbessern,<br />
auch die Bertelsmann Stiftung. Allerdings beschäftigt sich das Buch mit alten<br />
Projekten und Inhalten. Ich hätte mir gewünscht, Herr Schuler hätte sich mehr<br />
mit Gegenwart der Stiftung als mit der Vergangenheit auseinandergesetzt“.<br />
Leif: Das war eine kleine Kostprobe aus dem „Handelsblatt“. Wir wollten es Ihnen<br />
leicht machen, damit Sie wissen, um was es geht.<br />
Herr Schuler, ich glaube für einen politischen Autor gibt es nichts schöneres, als<br />
einen Artikel in der FAZ, wo ein Stiftungsrecht-Experte Ihre Thesen bestätigt und<br />
den Leuten in Gütersloh wirklich Ärger macht. Was haben Sie rausgefunden?<br />
Wie bewerten sie den inneren Charakter der Bertelsmann Stiftung?<br />
97
Schuler: Der Punkt, auf den sich der Stiftungsexperte Prof. Rabert in der FAZ<br />
bezogen hat, war auch mir wichtig: Herauszuarbeiten, dass diese Stiftung immer<br />
vorgibt, gemeinnützig zu sein. Dass aber diese Stiftung eine Konstruktion gefunden<br />
hat, eine Doppelkonstruktion, bei der immer das Wohl des Unternehmens<br />
an erster Stelle steht. Weil nämlich das Unternehmen auf perfekte Art über diese<br />
Stiftung geführt wird. Weil der Satz von Reinhard Mohn „Die Stiftung ist ausschließlich<br />
gemeinnützig tätig“, schon deshalb nicht stimmt, weil die Konstruktion<br />
darauf angelegt ist, mit dieser Konstruktion das Unternehmen zu führen. Da gibt<br />
es vielfältige Gründe, die mit der Ausschüttungspolitik zu tun haben. Die mit aktuellen<br />
Dingen zu tun haben. Das, glaube ich, habe ich versucht herauszuarbeiten.<br />
Leif: Wie hat die Bertelsmann Stiftung es geschafft, in den parlamentarischen<br />
Anhörungen das Stiftungsrecht al Gusto zu gestalten ?<br />
Schuler: Die Stiftung geht da sehr subtil vor und sie besetzt ein Thema. Sie<br />
hatte als einzige Stiftung in Deutschland diesen Reformprozess aktiv begleitet.<br />
Sie hat auch als einzige Stiftung Rederecht in diesem Ausschuss, also vor den<br />
Parlamentariern, bekommen. Ist da sehr gelobt worden für den Einsatz, für die<br />
fachkundige Begleitung und und und. Was sie gemacht hat: Sie hat ein kritisches<br />
Modell, nämlich das eigene Modell, aus dem Feuer genommen. Sie hat verhindert,<br />
dass dieses Modell, das eigentlich im ersten Reformansatz 1997 von Antje<br />
Vollmer beendet werden sollte, Thema war. Das sollte eigentlich als ein schlechtes<br />
Modell geoutet werden, das abgeschafft gehört.<br />
Leif: Ist das eine Glanzleistung der Stiftung gewesen?<br />
Schuler: Es ist niemand aufgefallen.<br />
Leif: Ihnen ist es ja aufgefallen, Gott sei Dank. Können Sie uns noch mal eine<br />
kleine Kostprobe geben. Wie haben Sie eigentlich gearbeitet? Wenn man Ihr<br />
Buch nimmt, ist das im Grunde klassisch amerikanische Schule. Sehr viele Fakten,<br />
sehr dezent, wenig Meinung, wenig Bewertung. Wie haben Sie gearbeitet?<br />
98
Schuler: Ich hatte ja bereits ein Buch davor gemacht, 2004 über die Familie<br />
Mohn. Das hat mir bei manchen Managern, bei Leuten in der Stiftung, aber auch<br />
im Unternehmen Kredit gegeben. Bertelsmann hat in den letzten Jahren einige<br />
hochrangige Leute an die Luft gesetzt. Das waren willkommene Gesprächspartner<br />
für mich. Mein Ansatz war der, dass ich nicht die Überzeugten überzeugen muss,<br />
sondern dass ich versuchen muss, bestimmte Fakten in den Vordergrund zu<br />
rücken, um bei den Ehemaligen hehre Zweifel aufkommen zu lassen.<br />
Leif: Sie haben einen Riesenerfolg gelandet. Ich glaube, kein Buch in diesem<br />
Herbst, im Sachbuchbereich Politik, ist so gut rezensiert worden. Ist es Ihr größter<br />
Erfolg in Ihrem Leben?<br />
Schuler: Höchstens halb. Nachdem ich das Gefühl habe, dass ich das Buch aus<br />
2004 noch mal nachgearbeitet habe – auch in dem Punkt, der die Personalisierung<br />
betroffen hat. Damals ging es mehr um die Ehe, die Familie Mohn und Dinge,<br />
die oft sehr in den Vordergrund gerückt worden sind. Notwendigerweise, auch<br />
von mir, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich glaube, dass ich mit diesem Buch<br />
sehr viel stärker auf das System abgehoben habe. Und habe bewusst, viele<br />
Details, viele persönliche Sachen in den Hintergrund gerückt oder weggelassen.<br />
90 Prozent meiner Recherche sind ja eh für den Abfalleimer. Also, insofern be -<br />
trachte ich es als einen Erfolg. Ja.<br />
Leif: Heute sagte mir ein Stiftungsexperte, dass dieses Buch ganz konkrete<br />
Konsequenzen haben wird. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, welche<br />
Konsequenzen?<br />
Schuler: Ich hoffe natürlich, dass es gewisse Folgen hat. Ich hoffe, dass diese Art<br />
der Trägerstiftung sehr viel mehr auch in die Kritik kommt, als sie bereits jetzt<br />
ist. Dass die Reform, die zum Erliegen kam, weitergeht. Dass irgendein Politiker<br />
das ähnlich wie Antje Vollmer zu seinem Projekt macht. Und es gibt ganz klare<br />
Sachen, die eigentlich wie ein Drehbuch erreicht werden sollen, im Sinne von<br />
Gemeinnützigkeit, Transparenz usw. usf. Und da hoffe ich, dass es voran geht.<br />
99
Leif: Zum Schluss noch mal die kurze Frage: Was ist der Leitsatz der Recherche,<br />
den Sie jetzt gemeinsam aus Ihrer Arbeit mitnehmen. Bei Tom Schuler ist es:<br />
„Qualität kommt von Qual“. Was haben Sie, Frau Groll, am Ende gelernt? Dass<br />
online schreiben einen auch nicht ausfüllen kann, oder was ist die Erkenntnis<br />
der Online-Journalistin?<br />
Groll: Die Erkenntnis der Online-Journalistin ist, dass man natürlich auch online<br />
kritisch recherchieren kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne meinem<br />
Recherche-Mentor Harald Schumann danken dafür, dass auch er einige Überstunden<br />
gemacht und mir dabei geholfen hat, die richtigen kritischen Fragen zu<br />
stellen. Denn teilweise habe ich erst einmal gelernt: Gehe einen Schritt zurück,<br />
wühl dich ganz, ganz tief ein, arbeite hart. Durchackere solche Berge von Akten,<br />
bist du wirklich weißt, welche die richtigen Fragen sind, die du stellen kannst.<br />
Leif: Ihre Quintessenz, was haben Sie, Frau Wendt und Frau Freese, gelernt?<br />
Freese: Ich denke, dass man unterschiedliche Strategien auch bei unterschiedlichen<br />
Menschen haben muss. Und man muss dass irgendwie auch manchmal<br />
intuitiv erfahren. Dann hat man da einen kleinen Fehler gemacht, da muss man<br />
noch mal nachhaken und da muss man es irgendwie noch mal anders probieren.<br />
Wendt: Zu wenig Nähe schadet, weil es einfach kein Ergebnis bringt. Und zuviel<br />
Nähe irgendwann auch blind macht. Das war eine Erkenntnis.<br />
Leif: Mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns von den Rednern hier. Toll,<br />
dass diese Stipendien geklappt haben und die Stiftung sie ermöglicht hat.<br />
100
RECHERCHESTIPENDIEN II<br />
Ergebnisse<br />
abgeschlossener<br />
Stipendien<br />
Marianne Wendt und<br />
Maren-Kea Freese<br />
Tina Groll<br />
Thomas Schuler
Marianne Wendt (2009)<br />
„Immer im Verborgenen –<br />
Als Analphabet in einer Welt der Schriftkultur“ *<br />
Vier Millionen Analphabeten leben in Deutschland. Die Gefahr vor Isolation,<br />
Arbeitslosigkeit und Armut, sowie der schwierige Weg, aus dieser Situation<br />
auszubrechen, sind der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die Autorinnen treffen<br />
verantwortliche Bildungspolitiker, stellen – unter anderem – die Frage, warum<br />
in einem Land, das sich seines hohen Bildungsniveaus rühmt, so wenig gegen<br />
Analphabetismus getan wird. Sie versuchen, mit ihrem Hörfunkfeature dieses<br />
tabuisierte Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.<br />
* Die Recherchen zu diesem Hörfunkbeitrag wurden u.a. ermöglicht durch das Stipendium, das die Autorinnen 2009<br />
von der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung erhielten. Der Hörfunkbeitrag ist über die der Dokumentation beigefügte DVD (hinten,<br />
3. Umschlagseite) zugänglich; eine Kurzfassung über die Homepage des „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es“. (Die Redaktion)<br />
102
Maren-Kea Freese (2009)<br />
rbb, Rundfunk Berlin-Brandenburg<br />
Kulturradio<br />
Künstlerisches Wort<br />
Feature<br />
Sendedatum: 8.12.<strong>2010</strong><br />
Produktion: 27.09 – 01.10.<strong>2010</strong><br />
Regie:<br />
die Autoren<br />
Sprecher: Matthias Scherwenikas<br />
Ton:<br />
Martin Seelig und Anja Bause<br />
Produktion: RBB/NDR <strong>2010</strong><br />
103
Tina Groll (2009)<br />
„Schrottimmobilien – Angepumpt und abgezockt“ *<br />
Sie wollten Steuern sparen und wurden in den Ruin gestürzt:<br />
Die Bank DKB hat reihenweise Schrottimmobilien für Kleinverdiener finanziert.<br />
Plattenbau in Berlin: Als Schrottimmobilien werden<br />
Wohnungen bezeichnet, die zu einem stark überteuerten<br />
<strong>Preis</strong> als Anlageobjekt verkauft wurden<br />
Es ist kurz vor Weihnachten 2009, als das Ehepaar Blaschek aus Thale im Harz<br />
zum ersten Mal seine Eigentumswohnung in der Brüderstraße, Ecke Jägerstraße<br />
in Berlin-Spandau betritt. Kabel hängen lose von der Decke herab, die Wände<br />
sind feucht und schimmlig, eine morsche Spüle steht in der modrig riechenden<br />
Küche. Die 120 Quadratmeter Altbau sind ein Sanierungsfall. Bezahlt haben die<br />
Blascheks dafür 228.000 Euro.<br />
Den Kredit für die Wohnung erhielten der Krankenpfleger und die Wissenschaftlich-Technische<br />
Assistentin von der Deutschen Kreditbank (DKB), einer Tochter<br />
der Bayerischen Landesbank. Kontakt zur DKB hatte das Ehepaar allerdings nie<br />
und 228.000 Euro ist die Wohnung auch nicht wert. Ein Sachverständiger<br />
schätzt sie auf 85.000 Euro, im sanierten Zustand.<br />
* Der dokumentierte Beitrag ist erschienen auf ZEIT-ONLINE am 02.09.<strong>2010</strong>.<br />
104
Guido und Kathrin Blaschek wollten die Wohnung gar nicht kaufen. „Wir dachten,<br />
wir nehmen an einem Steuersparmodell teil“, sagt Guido Blaschek. Er macht<br />
eine Pause. Der Krankenpfleger schämt sich. Die Familie hat eine sogenannte<br />
Schrottimmobilie erworben – und sie sind nicht die einzigen. Bundesweit haben<br />
Anleger überteuerte Wohnungen mit Krediten der DKB gekauft.<br />
105
Vermittelt wurden sie von verschiedenen dubiosen Strukturvertrieben. „Wir gehen<br />
davon aus, dass die DKB Kredite in Höhe von 1,5 bis drei Milliarden Euro im grauen<br />
Immobilienmarkt vergeben hat und zwar vorrangig an Klein- und Mittelverdiener“,<br />
sagt der Berliner Anlegerschutzanwalt Jochen Resch. Die Leute mussten keinerlei<br />
Eigenkapital bereitstellen, sondern wurden dazu verführt, eine Vollfinanzierung in<br />
Anspruch zu nehmen – ähnlich wie die Immobilienfinanzierungen in den USA, die<br />
erst die Kleinverdiener, dann Amerika und schließlich die ganze Welt in die Finanzkrise<br />
stürzten. Im Fall der Familie Blaschek vermittelte eine Firma mit dem Namen<br />
„Die Steuerfüchse“ sowohl die Wohnung als auch den Kredit. Die Firma gibt es<br />
mittlerweile nicht mehr. Die Raten für den Kredit laufen aber weiter.<br />
Angefangen hat alles im Sommer 2008: Das Ehepaar Blaschek bekommt einen<br />
Anruf – einen sogenannten Cold Call, wie es in der Branche heißt. „Angeblich<br />
war es ein Meinungsforschungsinstitut, das eine Umfrage zur Steuerpolitik in<br />
Deutschland machte“, erinnert sich Guido Blaschek. „Wenige Wochen später<br />
wurde ich dann von den Steuerfüchsen angerufen. Sie boten eine Steuerberatung<br />
an und wollten prüfen, ob wir für ein Steuersparmodell infrage kämen.“<br />
106
Ein Mitarbeiter der Firma stattet dem Paar einen Besuch ab und erklärt schnell,<br />
dass Familie Blaschek für ein solches Modell geeignet ist. Da aber Haustür geschäfte<br />
verboten seien, müsse das Ehepaar ins Büro der Steuerfüchse nach<br />
Berlin kommen. Wenige Tage später holt ein Fahrer das Paar ab. Zuvor hat sich<br />
Guido Blaschek über die Firma im Internet informiert. Der Webauftritt wirkt<br />
seriös und auch das Büro macht Blaschek nicht misstrauisch. „Da hingen die<br />
Referenzen an der Wand. Der Geschäftsführer hatte einen Doktortitel, alles sah<br />
ordentlich aus“, sagt er.<br />
Das Beratungsgespräch dauert etwa eine Stunde. Eine Stunde, in denen dem Krankenpfleger<br />
und seiner Frau das Modell einer Immobilienpatenschaft erläutert wird.<br />
„Uns wurde erzählt, dass wir denkmalschützerisch tätig werden. Das Programm sei<br />
auf zehn Jahre angelegt, danach würde das Objekt wieder verkauft“, erinnert sich<br />
Blaschek. Die „Steuerberater“ zeigten dem Paar zwei Wohnungen in Berlin und<br />
Leipzig in einem Hochglanzprospekt und rechnen vor, dass die monatlichen Belastungen<br />
etwa 80 bis 100 Euro betragen würden. Die Steuerersparnis wurde mit<br />
56.000 Euro für einen Zeitraum von zehn Jahren angegeben, sagt Blaschek.<br />
Vermieter würde das Paar nur auf dem Papier, eine Hausverwaltung würde sich<br />
um alles kümmern. Ein Rundum-Sorglos-Paket. „Wir konnten unser Glück kaum<br />
fassen. Das klang alles in sich logisch. Von einem Kredit war nie die Rede, wir<br />
hatten auch nie Kontakt zur Bank“, sagt Blaschek.<br />
Die vermeintlichen Steuerberater bringen das Ehepaar noch am Abend zu einem<br />
Notar. Er und seine Frau unterschreiben die bereits vorbereiteten Unterlagen: einen<br />
Kreditvertrag mit der DKB über 228.000 Euro sowie den Kaufvertrag der 120 Quadratmeter<br />
großen Wohnung in Berlin-Spandau. Den Hochglanzprospekt für die<br />
Immobilie gibt es mit dazu. Einen Schlüssel für die Wohnung allerdings nicht.<br />
So unglaublich es klingt, neu ist das Phänomen nicht. Mindestens 300.000 Ver -<br />
braucher in Deutschland wurden in den neunziger Jahren Besitzer einer sogenannten<br />
Schrottimmobilie, Wohnungen, die von windigen, psychologisch geschulten<br />
Verkäufern deutlich über ihrem tatsächlichen Wert an zumeist Vermögende ver-<br />
107
kauft wurden. Verbraucherschützer gehen sogar von über einer halben Million<br />
Schrottimmobilien aus. Die Kredite kamen von Privatbanken wie der Hypo vereinsbank<br />
(HVB), die rund 100.000 Kredite finanziert haben soll.<br />
„Man sollte meinen, dass Verbraucher heute gewarnt sind“, sagt Frank Pauli, Ba n k enexperte<br />
beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). „Aber immer noch fallen<br />
viele auf die Masche herein.“ Die dubiosen Geschäftemacher haben mit den<br />
Vollfinanzierungen für Kleinverdiener neue Opfer gefunden. Ist der Vertrag erst<br />
unterschrieben, kommt man kaum wieder heraus. „Es mangelt bis heute an einer<br />
gesetzlichen Regulierung“, sagt Pauli. Die Betroffenen müssten beweisen, dass<br />
der Immobilienvertrieb und die Bank institutionalisiert zusammengearbeitet ha -<br />
ben und sie falsch über die finanziellen Folgen des Kaufs informiert worden seien.<br />
Ein institutionalisiertes Zusammenwirken liegt beispielsweise dann vor, wenn<br />
mehrere Wohnungen aus demselben Objekt über die gleiche Bank finanziert<br />
wurden und vom gleichen Vermittler oder Verkäufer veräußert wurden.<br />
Diesen Nachweis müssen auch Guido und Kathrin Blaschek erbringen. An eine<br />
Vermietung der Wohnung in Berlin-Spandau ist nicht zu denken. Rund 1300 Euro<br />
beträgt die monatliche Ratenzahlung für den Kredit. Zusammen haben der Krankenpfleger<br />
und die Wissenschaftlich-Technische Assistentin im Monat etwa 3000<br />
Euro zur Verfügung. Im Heimatort Thale im Harz besitzen sie ein kleines Eigenheim.<br />
Sie haben zwei Kinder. Eines davon ist noch in der Ausbildung. Geld für die<br />
108
dringend nötige Sanierung der Berliner Wohnung hat das Ehepaar nicht. Etwa<br />
40.000 Euro müssten sie investieren, um die Wohnung vermieten zu können.<br />
Die Einnahmen würden aber deutlich unter den Raten liegen, die sie monatlich<br />
an die Bank zahlen müssen.<br />
„Für die Falschberatung der Anlageberater haftet der Verkäufer“, sagt Anlegerschutzanwalt<br />
Resch. Nur müssen sie dies nachweisen können. Er betreut nach<br />
eigenen Angaben fast 1000 Mandanten, die über Strukturvertriebe Wohnungen<br />
erwarben. „Fast jede Woche bekommen wir neue Fälle, alle von der DKB“, sagt<br />
Resch. Die Verkaufsmasche der Vertriebe sei so gewieft, dass die Anleger oft erst<br />
sehr viel später realisieren, dass sie eine Eigentumswohnung erworben haben.<br />
Bei den Blascheks war genau das der Fall. Als sie es bemerkten, war es schon<br />
zu spät. Das Büro der Steuerfüchse in der Brandenburgischen Straße in Berlin<br />
gab es auf einmal nicht mehr. Die Firma hatte ihren Namen zwischenzeitlich in<br />
Steuerschotten, Steueralarm und Steuerlupe gewechselt. Irgendwann stellte sie<br />
ihr Geschäft ganz ein.<br />
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Blascheks noch nicht einen Fuß in ihre Wohnung<br />
gesetzt. Das ändert sich erst, als sie Anlegeranwalt Jürgen Resch beauftragten,<br />
ihre Interessen zu vertreten. Jetzt hofft das Paar, den Kredit in einer außergerichtlichen<br />
Einigung mit der DKB rückabwickeln zu können. Gelingt dies nicht,<br />
müssten sie mindestens 30 Jahre lang abzahlen. Sie wären dann Ende 70.<br />
Anwalt Resch gibt sich optimistisch, dass die Blascheks keine 30 Jahre zahlen<br />
werden. Im Januar erstritt er vor dem Landgericht Berlin ein Urteil, das die DKB<br />
zum Schadensersatz verurteilte. In diesem Fall hatten die Kläger eine Eigentumswohnung<br />
in Berlin-Mariendorf erworben. Die Finanzierung erfolgte ebenfalls über<br />
die DKB. Auch hier wurden die Kläger falsch beraten.<br />
Das Landgericht stellte fest, dass die DKB über einen Wissensvorsprung verfügte,<br />
der den Käufern nicht offenbart wurde. Die Bank arbeitete nach Auffassung des<br />
Gerichts mit den Vermittlern institutionalisiert zusammen. Mindestens zwei weitere<br />
Prozesse haben Anleger inzwischen gegen das Institut in erster Instanz gewonnen.<br />
Die DKB hat Berufung gegen die Urteile eingelegt. Sie behauptet, von den Ver-<br />
109
sprechungen der Kreditvermittler nichts gewusst zu haben. Die Bank bestreitet<br />
zudem, mit ihnen institutionell zusammengearbeitet zu haben. Ob eine Immo -<br />
bilie direkt vom Verkäufer oder von einem Immobilienvermittler vertrieben<br />
werde, sei für die Kreditvergabe der DKB unerheblich.<br />
Der dadurch existierende Interessenskonflikt scheint der Bank egal zu sein: Die<br />
Vertriebe kaufen die Wohnungen zu niedrigen <strong>Preis</strong>en auf und veräußern sie<br />
dann für ein Vielfaches. Außerdem kassieren die Vermittler satte Provisionen<br />
durch die Kreditvermittlung. „Die Banken können auf diese Weise ihr privates<br />
Kreditgeschäft aufblähen. Für die Vermittler gibt es bis zu 35 Prozent Provision“,<br />
sagt Anlegerschützer Resch.<br />
Mittlerweile gibt es ein lukratives Zweit- und Drittmarktgeschäft. Schrottimmobilien,<br />
die irgendwann rückabgewickelt werden konnten, werden von den Ver-<br />
110
trieben erneut billig gekauft, bevor der ganze Spuk wieder von vorne losgeht.<br />
Im Fall der Eigentumswohnung in Berlin-Mariendorf kümmerte sich die Thomas<br />
Friese Unternehmensberatung um die Finanzierung, die sich im Briefkopf als Partner<br />
der DKB bezeichnet. „Zwischenzeitlich hatte die Firma Singularis, der damalige<br />
Partner der DKB, sogar ihr Büro im Wohnhaus des Herrn Friese, wo auch seine<br />
Unternehmensberatung ihr Büro hatte“, sagt Jochen Resch. Die DKB bestätigt,<br />
dass die Unternehmensberatung Immobilienkredite vermittelt habe. Allerdings<br />
betont die Bank, die Kreditvergabe erfolge erst nach eingehender Prüfung der<br />
Unterlagen. ZEIT ONLINE liegen allerdings Dokumente vor, in denen die Thomas<br />
Friese Unternehmensberatung einem Kleinverdiener mit negativem Schufaeintrag<br />
die Finanzierung für eine Eigentumswohnung in Berlin vermitteln wollte. Die<br />
Bank teilt zu diesem Vorgang mit, „dass Darlehensanträge bei der DKB unabhängig<br />
vom Vertrieb und innerhalb einer zentralen Produktionseinheit geprüft<br />
werden. Die DKB vergibt keine Darlehen an Kunden mit unzureichendem Schufa-<br />
Score.“ Doch die Unterlagen legen nahe, dass der Kleinverdiener den Kredit<br />
bewilligt bekommen hätte. Gerade noch rechtzeitig nahm sich der Mann allerdings<br />
einen Anwalt.<br />
„Das ist keine verantwortungsvolle Kreditvergabe“, urteilt der Esslinger Anwalt<br />
Ralph Schäfer. Auch er vertritt viele Mandanten, die überteuerte Wohnungen<br />
gekauft haben. Die Finanzierung erfolgte auch hier häufig über die DKB.<br />
In den meisten Fällen ist die Bank nicht bereit, von ihren Forderungen Abstand<br />
zu nehmen. „Können Kunden ihren Ratenverpflichtungen nicht mehr nachkommen,<br />
findet die DKB gemeinsam eine einzelfallorientierte Lösung, wie Laufzeitstreckungen<br />
oder Ratenanpassungen“, heißt es von der DKB. „Die vorzeitige<br />
Fälligstellung eines Engagements würde allerdings ein Schaden für die Bank<br />
bedeuten.“ Vorzeitige Fälligstellung heißt: Die Bank verlangt die Zahlung der<br />
gesamten Kreditsumme auf einen Schlag zurück. Das können die Anleger aber<br />
nicht leisten. Einziger Ausweg ist dann ein Vergleich oder die Privatinsolvenz.<br />
In beiden Fällen würde die Bank Geld verlieren. Viel lukrativer ist es, die Kreditnehmer<br />
Jahrzehnte lang abzahlen zu lassen.<br />
111
Die DKB kann sich offenbar ihre harte Haltung leisten: Nur ein Bruchteil aller<br />
Fälle komme überhaupt vor Gericht, sagt Anwalt Schäfer. Der Grund ist simpel:<br />
Den meisten ist vorher längst finanziell die Puste ausgegangen – klagen kostet.<br />
„Die Gewinnchancen solcher Fälle betragen etwa zwei Prozent“, sagt Schäfer.<br />
„10 bis 20 Prozent werden verglichen, der Rest wird verloren. Dann zahlen die<br />
Leute 20, 30 Jahre lang die überteuerte Immobilie ab“, sagt Schäfer.<br />
Einer, der seit fast 30 Jahren abzahlt, ist Uwe Weidmann aus Fellbach. Weidmann<br />
ist ein sogenannter Altfall. 1983 erwarb der Programmierer eine 64 Quadratmeter<br />
große Zwei-Zimmerwohnung in Darmstadt. Die Finanzierung – insgesamt<br />
220.000 D-Mark – lief über die heutige DKB-Mutter, die Bayerische Landesbank.<br />
„Eigentlich habe ich damals schon die klassische Masche erlebt“, erinnert sich<br />
Weidmann. Es gab eine Mietgarantie, eine Wohnungsverwaltung, die sich um<br />
alles kümmern sollte und großzügige Steuersparversprechen. Ein Wertgutachten,<br />
eine Wohnungsbesichtigung – auf all das verzichtete Weidmann. Drei Jahre lang<br />
ging auch alles gut, dann blieben die Mietzahlungen aus und die Finanzierung<br />
geriet ins Wanken. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Strukturvertrieb, der die<br />
Wohnung und die Finanzierung vermittelt hatte, längst nicht mehr.<br />
„Ich saß auf einem Berg von Schulden, und die BayernLB ließ nicht mit sich<br />
verhandeln“, sagt Weidmann. Seit über 25 Jahren streitet er nun mit der Bank.<br />
Weidmann hat Anwälte eingeschaltet, sich mit anderen Besitzern von Schrott -<br />
immo bilien ausgetauscht, sogar einen Brief an den Staatsminister des baye -<br />
rischen Finanzministeriums geschrieben. Mittlerweile hat die Familie die Wohnung<br />
in Darmstadt für 25.000 Euro verkauft. Nach fast 30 Jahren sind noch 80.000<br />
Euro bei der Bayerischen Landesbank offen. Jetzt, wo die Kinder erwachsen sind,<br />
käme eine Privatinsolvenz vielleicht doch infrage. „Dann könnten wir dieses<br />
Ding endlich beenden.“ Er wäre dann mit Eintritt ins Rentenalter schuldenfrei.<br />
Einzelne Finanzierungen für Schrottimmobilien kamen bei Landesbanken schon<br />
immer vor. Vor wenigen Jahren stiegen sie aber verstärkt in den Bereich der privaten<br />
Immobilienfinanzierungen ein.<br />
112
Doch muss man nicht auch den Anlegern den Vorwurf machen, nicht eigenverantwortlich<br />
gehandelt zu haben, zu leichtgläubig und möglicherweise auch zu<br />
gierig gewesen zu sein?<br />
Nein, sagt der Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick (Grüne). „Verantwortung<br />
kann man nur dann übernehmen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
stimmen.“ Der Finanzmarkt sei aber immer noch vollkommen intransparent.<br />
Verbraucherschützer fordern seit Jahren eine strengere Regulierung. „Wir brauchen<br />
eine Finanzierungsaufsicht, die auch den Verbraucherschutz umfasst und die<br />
Banken stärker in die Verantwortung nimmt“, sagt Verbraucherschützer Frank<br />
Pauli. „Sie können ihren Schaden noch immer umverlagern und Ausfälle ab schreiben.<br />
Aber die Anleger, die erst einmal durch den Erwerb einer solchen Schrott -<br />
immobilie in die Schuldenfalle geraten sind, kommen bis heute kaum aus dieser<br />
Situation heraus.“ Auch die Novellierung des Anlegerschutzgesetzes hat daran<br />
wenig geändert. Nach wie vor arbeitet die Finanzaufsicht nur im öffentlichen<br />
Interesse, der Verbraucherschutz zählt, anders als in anderen europäischen<br />
Ländern wie Schweden, nicht dazu.<br />
„Solche Kredite lohnen sich vor allem dann, wenn sie in Massen vergeben und verbrieft<br />
werden können“, sagt Grünen-Politiker Schick. Verbriefung heißt: Immobilienkredite<br />
mit unterschiedlichen Ausfallrisiken werden zu Paketen verpackt und in<br />
handelbare Wertpapiere umgewandelt. Schick vermutet, dass genau das auch mit<br />
den Schrottimmobilienkrediten passiert ist. Der Abgeordnete, der auch im Untersuchungsausschuss<br />
um die Pleite der Hypo-Real-Estate (HRE) saß, versuchte herauszufinden,<br />
ob die rund 100.000 Schrottimmobilien-Kredite der HVB an die HRE als<br />
verbriefte Papiere ausgelagert wurden. „Meine Sorge ist, dass es durchaus auch<br />
in Deutschland Entwicklungen in Richtung eines Subprime-Segments gegeben<br />
hat“, sagt der Politiker. Bislang hat er dies aber noch nicht beweisen können.<br />
Subprime in Deutschland? Schick stellte im Januar 2009 eine Anfrage an die<br />
Bundesregierung, wie man den Markt für Kredite mit geringer Bonität in<br />
Deutschland regulieren wolle. Die Antwort sei ein weitgehendes Achselzucken<br />
gewesen. Anleger müssten eigenverantwortlich entscheiden, ob der Erwerb<br />
113
einer Immobilie für sie sinnvoll sei oder nicht. Wenn ein Schaden entstünde,<br />
gebe es ja den Anspruch auf Rückabwicklung. Heißt: An der Beweispflicht der<br />
geprellten Anleger und einem mitunter Jahre dauernden, teuren Rechtsstreit<br />
ändert sich vorerst nichts.<br />
Familie Blaschek hat den Kampf mittlerweile aufgenommen. Berichte über sie<br />
im heute-Magazin und in der Zeitschrift Finanztest haben für Aufmerksamkeit<br />
gesorgt. „Wir haben jetzt wenigstens das Gefühl, etwas tun zu können“, sagt<br />
Guido Blaschek. Sein Vertrauen in die Banken hat er überdies nicht verloren,<br />
wohl aber das in die DKB.<br />
Die Bank selbst kämpft ebenfalls. Sie teilt mit, dass sie bereits im März 2009<br />
ihre Kreditvergaberichtlinien verschärft habe, seither sei auch die Zahl der<br />
Finanzierungen gesunken. Mittlerweile habe man eine Eigenmittelunterlegung<br />
von mindestens acht Prozent eingeführt, heißt es von der DKB. Zudem seien die<br />
Aktivitäten im Bereich der Baufinanzierung eingeschränkt worden. Die Bank<br />
fokussiere sich nun „auf Geschäftsfelder, die weniger Risikoaktiva binden“.<br />
Beim Esslinger Anwalt Schäfer kommen trotzdem ständig aktuelle Fälle hinzu.<br />
„Höhepunkt war vor Kurzem, dass ein Anleger unter dem Vorwand, er würde<br />
eine Werbung auf seinem Fahrzeug angeboten bekommen, in die Verkaufsräume<br />
eines Vermittlers gelockt wurde“, erzählt der Anwalt. Stattdessen wurde<br />
der Kleinverdiener zum Notar geschleppt, um noch einige Steuervorteile zu<br />
gewinnen. Tatsächlich wurde dem Mann aber eine Immobilie verkauft, „die über<br />
die DKB, fix und fertig vorbereitet, finanziert werden sollte“.<br />
Die Bayerische Landesbank hat ihr Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen<br />
Anfang 2009 komplett eingestellt. Aber man betont, „oberste Zielsetzung“<br />
für den Umgang mit den laufenden, problematischen Fällen sei „nicht etwa das<br />
Kredit engagement zu beenden, sondern ein Sanierungskonzept zu entwerfen,<br />
das dem Kreditnehmer hilft, seinen Forderungen langfristig nachkommen zu<br />
können“. So wie bei Uwe Weidmann, der seit über 25 Jahren für seine Schrottwohnung<br />
zahlt.<br />
Die Recherchen für diesen Artikel wurden mit dem Recherchestipendium der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung (OBS) 2009<br />
ermöglicht.<br />
114
Thomas Schuler *<br />
„Bertelsmannrepublik Deutschland –<br />
Recherchen und Reaktionen“<br />
Die Recherchen zu den Geschichten über Stiftungen lassen sich in zwei Kategorien<br />
einteilen: Die eine Sorte betrachtet die Gründer gemeinnütziger Stiftungen<br />
als Helden der Zivilgesellschaft, die ihr Vermögen verschenken. Die andere Sorte<br />
handelt von Steuerflüchtlingen, die ihr Geld mit Hilfe von eigennützigen Familienstiftungen<br />
in der Schweiz oder in Liechtenstein verstecken. Aber inwiefern dient<br />
auch eine gemeinnützige Stiftung privaten Interessen?<br />
Dieser Frage ging ich am Beispiel der Bertelsmann Stiftung nach, weil sie mit<br />
330 Mitarbeitern und 65 Millionen Euro Jahresbudget besonders groß und einflußreich<br />
ist. Man könnte sie als private Universität mit exklusivem Zugang zur<br />
politischen und gesellschaftlichen Elite bezeichnen. Als operative Stiftung fördert<br />
sie nicht, sondern verfolgt nur eigene Projekte (seit 1977 rund 750). Der<br />
Nach kriegsgründer von Bertelsmann, Reinhard Mohn, starb am 3. Oktober 2009.<br />
In seinen Augen war nicht sein Unternehmen (u. a. RTL, Arvato, Gruner + Jahr,<br />
Random House), sondern seine Stiftung sein Lebenswerk. Mit ihr wollte er den<br />
Erfolg seines Unternehmens auf Staat und Gesellschaft übertragen.<br />
Alles sollte messbar sein, damit Wettbewerb entsteht. Was Bertelsmann groß<br />
machte, das sollte das gan ze Land voranbringen. Sein Anspruch war eine<br />
„Bertelsmannrepublik Deutschland“. Den Begriff benutzte er nicht, aber er gibt<br />
seinen Denkansatz wieder.<br />
* Thomas Schuler lebt als freier Journalist in München. 2004 veröffentlichte er das Buch „Die Mohns“ über die Eigentümer<br />
der Bertelsmann AG. „Bertelsmannrepublik Deutschland. Eine Stiftung macht Politik“ ist <strong>2010</strong> im Campus Verlag<br />
erschienen. Die Recherchen zu dem Buch wurden u.a. ermöglicht durch das Stipendium, das der Autor 2007 von der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung erhielt. (Die Redaktion)<br />
115
Die Bertelsmann Stiftung ist ein Zentrum der Macht, mit dem die Familie Mohn<br />
(die noch 23 Prozent der Bertelsmann AG besitzt, aber auch die Stiftung kontrolliert)<br />
Nähe zur Politik schafft, Einfluss nimmt und ihr Unternehmen erhält. Die<br />
Stiftung hat sogar das Politikgeschäft in ihrem ureigenen Bereich beeinflusst,<br />
indem sie vielfältige Aktivitäten, Foren und Schriften zum Stiftungswesen veranstaltet<br />
und herausgegeben hat. Am Ende setzte die rot-grüne Regierung nur Vorschläge<br />
um, die der Stiftung nicht schadeten. Die Stiftung ist für Familie Mohn<br />
in erster Linie ein Finanzierungs- und Führungsinstrument, mit der sie Gewinne<br />
im Unternehmen behalten und reinvestieren kann. Obwohl die Stiftung fast 80<br />
Prozent am Unternehmen besitzt, erhält sie eine Dividende, die einer Minderheitsbeteiligung<br />
entspricht. Von den sieben Milliarden Euro aus dem Verkauf der<br />
AOL-Anteile hat die Stiftung so gut wie nichts erhalten.<br />
Stiftungen sind nicht demokratisch legitimiert. Niemand wählt sie. Und niemand<br />
kann sie abwählen. Sie sind niemandem verantwortlich. Das ist für eine Stiftung,<br />
die politischen Einfluß wahrnehmen will, ein Problem. Deshalb arbeitet die Bertelsmann<br />
Stiftung so gerne mit dem Bundespräsidenten zusammen. Sie gibt Geld<br />
für Projekte und er soll ihr überparteiliche Legitimation verschaffen.<br />
Um zu zeigen, wie die Stiftung Einfluß in Berlin erlangt, suchte ich Projekte, die<br />
den Zugang zur Politik beispielhaft erklären und belegen. Eine wissenschaftliche<br />
Arbeit über Bundespräsident Roman Herzog war so ein Türöffner. Der Autor<br />
Michael Jochum hatte vier Jahre lang Zugang zu allen Mitarbeitern und Terminen<br />
Herzogs, besprach regelmäßig mit Herzog dessen Pläne und behauptete am<br />
Ende, er habe den Anstoß für das Stichwort „Ruck“ zu Herzogs berühmtester<br />
Rede gegeben, die den Startschuß gab für den Wechsel in Berlin und die Reformen<br />
der rot-grünen Regierung. Beleg dafür, wie eng und frei der Mitarbeiter der<br />
Bertelsmann Stiftung im Bundespräsidialamt eingebunden war, ist ein Ge spräch<br />
mit Wilhelm Staudacher, dem ehemaligen Staatssekretär von Herzog. Staudacher<br />
sagt: „Jochum war bei allem dabei.“ Eine geplante Biographie Herzogs hat<br />
Jochum nie veröffentlicht. Sein Projekt ist damit eigentlich gescheitert; aber für<br />
die Bertelsmann Stiftung war sein Zugang dennoch wertvoll. Das gescheiterte<br />
116
Buchprojekt war nicht der einzige Türöffner: immer wieder wurden Herzog und<br />
seine Vorgänger und Nachfolger nach Gütersloh eingeladen, um in ihren Reden<br />
der Stiftung die Gemeinnützigkeit zu bestätigen.<br />
Entgegen der Beteuerungen agiert die Stiftung nicht unabhängig, sondern in<br />
Abstimmung mit den Chefs des Unternehmens und der Familie. Dass die Stiftung<br />
bei der Reform der Rundfunkaufsicht vor zehn Jahren nur vordergründig<br />
unabhängig, tatsächlich aber interessengeleitet und zum Nutzen der Konzerntochter<br />
RTL und des Unternehmen Bertelsmann tätig wurde, hatte ich selbst als<br />
Reporter der Berliner Zeitung 1999 recherchiert und bei der entscheidenden<br />
Tagung in Gütersloh wichtiges Schriftmaterial und Eindrücke gesammelt. Ein<br />
wichtiges Dokument, das den Interessenskonflikt belegt, ist eine schriftliche<br />
Anweisung von Mark Wössner, damals Vorstandsvorsitzender der Stiftung und<br />
zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. An Mitarbeiter der Stiftung<br />
schrieb er, die Stiftung solle sich mit dem Unternehmen koordinieren, um<br />
Argumente für „unsere Seite (Privatfunk)“ zu sammeln. Das Schriftstück erhalte<br />
ich erst nach Redaktionsschluß und verwende es für einen Artikel im SPIEGEL.<br />
Die Rundfunkreform liegt lange zurück. Gibt es weitere, aktuelle Projekte der Stiftung,<br />
bei der sich ihre Interessen vermischen? Beispielsweise indem sie Politiker<br />
gemeinsam ansprechen und ihre Wünsche und Erwartungen formulieren. So luden<br />
Unternehmen und Stiftung 2004 die neue EU-Kommission ein, um ihr zu versichern,<br />
wie sehr man an der EU-Erweiterung interessiert sei, um neue Märkte zu erschließen.<br />
Die Stiftung hielt zahlreiche Konferenzen zur EU-Erweiterung ab und trat für<br />
die Aufnahme Kroatiens ein. Liz Mohn flog eigens zu einem Treffen mit dem kroatischen<br />
Ministerpräsidenten nach Zagreb. Bertelsmann lud den Ministerpräsidenten<br />
nach Gütersloh und Berlin ein. Im gleichen Jahr erhielt das Tochterunternehmen<br />
RTL eine Staatsfernsehlizenz in Kroatien. Zufall? Die Auslagerung von Verwaltungsaufgaben<br />
ist ähnlich problematisch. Die Stiftung riet dazu, das Unternehmen<br />
machte ein Geschäft daraus. Pilotprojekt in Deutsch land ist „Würzburg<br />
integriert“, das Arvato neue Märkte erschließen soll. Problematisch ist schließlich<br />
auch die Einmischung bei der Stiftungsreform selbst – dazu später.<br />
117
Den Einfluß in der Politik beschreibe ich anhand der Arbeitsmarktreform, Hartz IV.<br />
Die Stiftung leistete die Vorarbeit mit einem Bericht für das Bündnis für Arbeit<br />
und organisierte und begleitete im Auftrag des Kanzleramtes die Arbeit der<br />
Hartz-Kommission. Eine kritische Darstellung der Arbeitsrechtlerin Helga Spindler<br />
wird von Mitarbeitern der Bertelsmann Stiftung in vertraulichen Gesprächen als<br />
faktisch richtig bestätigt. Ein Mitglied der Hartz-Kommission, der Politikprofessor<br />
und Arbeitsmarktexperte Günther Schmid, beschreibt auf Anfrage den Einfluß<br />
der Stiftung auf die Reformen und dass sie für Kommissionsmitglieder Reisen<br />
ins Ausland zu jenen Modellen organisierte, die sie für Reformen geeignet hielt.<br />
Die Kommissionsmitglieder seien beeindruckt gewesen, erinnert sich Schmid.<br />
Ich konfrontiere ihn mit Widersprüchen der Arbeitsmarktberichte der Stiftung<br />
mit seiner eigenen Forschung. Das bringt Schmid dazu, über Fehler und Ungenauigkeiten<br />
in den Ländervergleichen der Stiftung zu sprechen.<br />
Der Gründer und langjährige Präsident der ersten privaten Universität in Witten /<br />
Herdecke, Konrad Schily, spricht mit mir über die Promotion von Brigitte Mohn<br />
1993 – ein heikles Thema. Brigitte Mohn hatte gar keines der Fächer studiert, die<br />
in Witten angeboten werden. Ihre Promotion war nur möglich, weil unter Reinhard<br />
Mohn als Vorsitzendem des Direktoriums das Promotionsrecht auf das Studium<br />
fundamentale (eine Art Grundstudium) ausgeweitet worden war. Schily erzählt,<br />
dass Reinhard Mohn bei ihm ungeduldig nachfragte, warum die Promotion seiner<br />
Tochter so lange dauere, und das, obwohl sie insgesamt nur ein Jahr daran<br />
arbeitete. Ein Sprecher der Universität bestätigt, dass Brigitte Mohn die erste<br />
Promovendin im Studium fundamentale war. Daß Mohn die Universität im Laufe<br />
der Jahre mit 35.1 Millionen Euro unterstützt hat, hatte die Stiftung 2003 veröffentlicht.<br />
Besonders fragwürdig ist, dass – wie ich erfahre – Mohn dem wissenschaftlichen<br />
Mentor und Gutachter der Promotion seiner Tochter wenige Monate<br />
später einen Beratervertrag gewährt hat. Den Zweitgutachter betraute er ein jahrelanges<br />
Projekt an. Weder Universität noch Stiftung wollen den Beratervertrag<br />
bestätigen. Die Bestätigung erfolgt erst, als ich im Auftrag des SPIEGEL anfrage.<br />
118
Die Grünen-Politikerin Antje Vollmer wollte die Fehler und Missstände, die sich<br />
beispielsweise in einer geringen Dividenden-Ausschüttung zeigen, mit einer<br />
Reform des Stiftungsrechts korrigieren, wie sie mir sagt. Sie wollte große Stiftungen<br />
wie Bertelsmann und Bosch zwingen, mehr Geld auszuschütten. Vollmer<br />
hoffte auf Kooperation und Einsicht der Stiftungen – vergeblich. Die Bertelsmann<br />
Stiftung engagierte sich wie keine andere Stiftung in dieser Reform -<br />
debatte und hat Vollmers Reformansatz keine Beachtung geschenkt oder mit<br />
Kritik bedacht und stattdessen andere Punkte in den Vordergrund geschoben.<br />
Auch das eine Vermengung eigener und gemeinnütziger Interessen. Meine<br />
These: Die Stiftung war zu mächtig geworden in Kanzler Gerhard Schröders<br />
Amtszeit, als dass er Reformen gegen sie durchsetzen wollte oder konnte.<br />
Stiftungsfachanwälte bestätigen das.<br />
Schließlich interessierte mich, ob die Stiftung sich selbst reformieren kann. Wie<br />
geht sie mit eigenen Fehlern um? Wie effizient arbeitet sie, immerhin ist Effizienz<br />
ihr Zauberversprechen und ihre Begründung für Reformen? Ist das Steuergeld, das<br />
sie selbst einsetzt, effizient eingesetzt? Dazu befrage ich Gerd Wixforth, den ehemaligen<br />
Stadtdirektor von Gütersloh, der nach seiner Pensionierung 1999 fünf<br />
Jahre beratend in der Stiftung gearbeitet hat. Laut Wixforth ist die Effizienz der Stiftung<br />
ein Mythos, an den er selbst jahrzehntelang glaubte, der sich aber aus der<br />
Nähe als völlig falsch herausstellte. „Ich dachte viele Jahre, die Stiftung sei optimal<br />
organisiert und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, dass die eine Hand nicht<br />
weiß, was die andere tut. Das Delegationsprinzip funktioniert vorne und hinten<br />
nicht.“ Interne Bewertungen von Mitarbeitern der Stiftung bestätigen das. Die<br />
Stiftung ist gemeinnützig und agiert steuerfrei. Deshalb geht es auch um die<br />
Frage, wie sehr die Bertelsmann-Stiftung dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. Ist<br />
eine Stiftung, die Politik beeinflusst – und das tut die Bertelsmann-Stiftung –<br />
noch die Privatangelegenheit der Familie Mohn? Ich denke nicht. Die Öffentlichkeit<br />
hat in Deutschland bei Stiftungen aber nichts zu sagen – im Gegensatz zu<br />
den USA. Die Wohltäter betonen gerne, dass ein Stifter wie Reinhard Mohn fast<br />
sein ganzes Vermögen der Allgemeinheit geschenkt hat. Das ist eine geschickte<br />
PR-Formulierung. In Wirklichkeit gehören Stiftungen sich selbst. Die Frage ist,<br />
119
wer sie kontrolliert. Im Falle der Bertelsmann-Stiftung ist das nicht die Allgemeinheit,<br />
sondern die Familie Mohn, die sich ihre Macht über eine komplizierte Stiftungskonstruktion<br />
sichert. Die eigentliche Macht liegt in einer kleinen GmbH, in<br />
der Liz Mohn das Sagen hat.<br />
Reinhard Mohn hat in seinem Buch »Erfolg durch Partnerschaft« 1986 geschrieben,<br />
die dann »nicht mehr durch Erbschaftssteuer belastete Finanzierungskontinuität«<br />
sei die »dominierende Zielsetzung« für die Gründung der Stiftung 1977<br />
gewesen. Die Stiftung sollte verhindern, dass seine Erben Teile des Unternehmens<br />
verkaufen müssen. Familie Mohn hat geschätzte zwei Milliarden Euro Erbschaftssteuer<br />
gespart. Bislang allerdings hat die Stiftung in ihren Projekten weniger<br />
als 900 Millionen Euro ausgeschüttet. Mohns Hinweis auf die Erb schafts steuer<br />
wird heute gerne heruntergespielt oder ganz vergessen. Man tut so, als stehe<br />
nur der Gemeinnutz im Vordergrund. Tatsächlich hat Mohn 1998 im Handbuch<br />
Stiftungen selbst postuliert, die Stiftung arbeite „ausschließlich im Sinne des<br />
übergeordneten Gesellschaftsinteresses“.<br />
Ausschließlich übergeordnete, gemeinnützige Interessen? Die Familie hat die<br />
Satzung der Stiftung mehr als 20 mal geändert, um ihren Einfluss für alle Zeiten<br />
zu sichern und sich nicht mit dem Versprechen der Unabhängigkeit der Stiftung<br />
vertragen. Warum sollte sie nur unabhängig von politischen Parteien sein (wie<br />
sie selbst behauptet)? Warum nicht auch unabhängig vom Unternehmen Bertelsmann<br />
AG und der Eigentümerfamilie Mohn?<br />
Die Recherchen führen zu konkreten Forderungen: Unternehmen sollten nicht<br />
mehrheitlich im Besitz einer gemeinnützigen, steuerbefreiten Stiftung sein und<br />
von ihr verdeckt geführt werden. Die Leitung einer Stiftung (Vorstand) darf nicht<br />
identisch sein mit der Leitung bzw Aufsicht und Kontrolle des Unternehmens<br />
(Aufsichtsrat), an dem sie beteiligt ist – wie es bei Bertelsmann jetzt der Fall ist.<br />
Vorstandsmitglieder einer Stiftung dürfen nicht zugleich Mitglieder des Aufsichtsgremiums<br />
der Stiftung sein (wie jetzt im Fall von Liz Mohn). Die Dividende<br />
muß stärker an die Höhe des Gewinns gekoppelt sein. Schließlich: Die Stiftung<br />
120
muß unabhängig sein von den Erben des Stiftungsgründers. Bei Bertelsmann ist<br />
das Gegenteil der Fall.<br />
Was davon wird die Politik umsetzen? Wird ihr eine Reform gelingen? Das ist die<br />
zentrale Frage des Falles Bertelsmann: werden sich Politiker für eine Reform<br />
stark machen und die Arbeit von Antje Vollmer fortführen? Der tageszeitung<br />
sagte Vollmer als Reaktion auf mein Buch im September <strong>2010</strong>: „Die Stiftung übt<br />
erheblichen Einfluss auf die Politik aus. Das ist nicht illegal, aber die Politik<br />
sollte sich dessen bewusst sein und kann nicht so tun, als wäre die Bertelsmann<br />
Stiftung eine neutrale, nur dem Gemeinwohl verpflichtete Einrichtung.“<br />
Die Politik sei deshalb besonders gefordert, das Stiftungswesen zu reformieren.<br />
Vollmer sagte: „Nachdem es jetzt viel mehr Stiftungen gibt, muss es eine solche<br />
Auseinandersetzung auch im Bundesverband deutscher Stiftungen geben. Vor<br />
15 Jahren war das noch ein sehr exklusiver Club, weil es die vielen neuen Bürgerstiftungen<br />
gar nicht gab. Es geht aber auch nicht, ohne dass jemand aus der<br />
Politik dieses Anliegen für eine gewisse Zeit zu seiner Aufgabe macht. Die Instrumente<br />
sind alle bekannt: Wenn man das 20-Prozent-Modell der USA übernähme<br />
und die Forderung nach Mindestausschüttung, hätte man Bertelsmann schon<br />
ein paar dicke Brocken vorgesetzt.“ Bislang wartet man jedoch vergeblich auf<br />
eine konkrete politische Initiative.<br />
Am Tag des Erscheinens meines Buches kündigte Gunter Thielen, der Chef der<br />
Stiftung, eine rechtliche Prüfung an, die offenbar keine ausreichenden Argumente<br />
anführen konnte, um gegen das Buch rechtlich vorzugehen. So verlegte<br />
die Stiftung sich darauf, auf der eigenen Website gegen mich und mein Buch zu<br />
polemisieren. Doch die Statements der Bertelsmann Stiftung gehen auf den<br />
Inhalt meines Buches und die darin aufgeworfenen Fragen nicht ein: sie findet<br />
offenbar keine Antworten auf berechtigte Fragen. Peter Rawert, ein Hamburger<br />
Professor für Stiftungsrecht, bestätigt meine Kritik und schreibt in der FAZ,<br />
Bertelsmann nutze Lücken im Stiftungsrecht. Er nennt die Stiftungskonstruktion<br />
von Bertelsmann ein „hybrides Gebilde“, weil es unter dem Deckmantel des<br />
Gemeinnutzes eigene Interessen verfolge. Rawert nennt das den „wahren<br />
Skandal des Falles Bertelsmann“.<br />
121
AUSGEWÄHLTE TEXTE<br />
UND REDEN
Tom Schimmeck<br />
Heribert Prantl<br />
Thomas Leif
Tom Schimmeck<br />
„Wem gehören die Medien?“ *<br />
„Wem gehören die Medien?“ war der Titel der Hausaufgabe, die ich für diesen<br />
Kongress bekommen habe. Das klingt zunächst nach einer Fleißarbeit mit vielen<br />
Schaubildern, mit Prozentangaben und Kästchen. In denen Namen wie Bauer,<br />
Burda, Holtzbrinck, Neven Du Mont stehen. Aus denen ersichtlich wird, dass der<br />
Westen der Republik publizistisch in der Hand der WAZ-Gruppe ist – Kenner<br />
reden von der Brost- und der Funke-Linie –, der Süden hingegen in der Hand der<br />
Südwestdeutschen Medien Holding, hinter der eher öffentlichkeitsscheue Eigner<br />
wie etwa ein Herr Schaub stecken.<br />
Außerdem gibt es da noch Verleger wie Ippen und Ganske und wie sie alle<br />
heißen. Und natürlich die mächtigen Witwen Springer und Mohn.<br />
Denen gehören die deutschen Printmedien, die „Holzmedien“, wie wir neuerdings<br />
gern und keck sagen. Schon weil der Begriff automatisch die Assoziation<br />
freisetzt, dass da wohl irgendwie der Wurm drin ist. Wir haben es hier weitgehend<br />
mit alten Imperien zu tun, mit einer Hand voll Milliardären, die sich größtenteils<br />
in der Forbes-Liste der Reichsten der Welt wiederfinden. Alle haben<br />
inzwischen auch ihre Online-Portale, produzieren Firmenblätter, machen<br />
sowieso in TV, Merchandising und so weiter. […]<br />
* Wir dokumentieren (leicht gekürzt) die Rede des Journalisten und Autor Tom Schimmeck, die er auf dem Kongress<br />
„Öffentlichkeit und Demokratie“ am 2. Oktober <strong>2010</strong> in Berlin vortrug und danken ihm für die Abdruckgeneh migung.<br />
(Die Redaktion)<br />
124
Paul Sethe, einer der fünf Gründungsherausgeber der FAZ, spitzte die Zustände<br />
schon 1965 sehr knapp zu: „Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten,<br />
ihre Meinung zu verbreiten.“ 200 wäre heute vielleicht ein bisschen hoch<br />
gegriffen. Und auch der verlegerische Impetus hat sich stark verändert. Früher<br />
war der Verleger der Patriarch, der Talente um sich sammelte. Da durften auch<br />
ein paar dabei sein, die gar nicht seiner Meinung waren. Als Konfetti. Zum<br />
Schmuck. Als Hofnarren. Inzwischen aber hat sich auch hier – Oskar Negt sprach<br />
gestern davon – die rein betriebswirtschaftliche Logik durchgesetzt. Die Inhaber<br />
sind zunehmend verunsichert über die Zukunft ihrer „Holzmedien“.<br />
In den Obergeschossen der Verlagshäuser herrscht eine Mischung aus Resignation<br />
und Aggression. Nicht, dass diese Imperien unmittelbar dem Untergang<br />
geweiht wären. Aber die hochgesteckten Renditeziele sind in den letzten Jahren<br />
doch zeitweise deutlich verfehlt worden.<br />
Das Plus stimmte nicht mehr. Weshalb die Medieneigner die Unternehmens -<br />
berater in Marsch setzten, die Bergers, McKinseys und Co. Allesamt natürlich<br />
Experten in Sachen demokratischer Öffentlichkeit. Die zogen mit dem Rechenschieber<br />
in die Redaktionen. Und kamen – Überraschung – zum Ergebnis, dass<br />
Qualitätsjournalismus doch verdammt teuer ist. Also wurde entlassen, entlassen,<br />
entlassen. Oh nein, Verzeihung: Freigesetzt.<br />
Das klassische „Geschäftsmodell“<br />
Ja, das klassische „Geschäftsmodell“ der Blätter hat Probleme. Aber das Untergangsgeschrei<br />
war auch enorm nützlich, um eine höhere Rendite zu sichern. […]<br />
Immer mehr Medieninhaber betreiben ihr Geschäft, als würden sie Schrauben,<br />
Schnittkäse oder Sonnenschirme verkaufen. Sie haben kein Anliegen mehr das<br />
größer ist als Geld.<br />
Besonders gut sichtbar sind die Folgen eines rein renditeorientierten Betriebs<br />
bei den Privatsendern. Seit 2007 sind Finanzinvestoren auf diesem Sektor<br />
direkt aktiv: Die Permira Beteiligungsberatung GmbH sowie Kohlberg Kravis<br />
125
Roberts & Co (KKR) befehligen ProSiebenSat1. Diese Leute machen keinen Hehl<br />
daraus, dass sie sich genau null Sekunden lang für die gesellschaftliche Rolle<br />
ihrer Sender interessieren.<br />
Information? Aufklärung? Was ist das? Was kostet das?<br />
Kriegen wir die Zuschauer auch billiger? Es ist halt nur ein Investment.<br />
Durch Druck, Betriebsverlegungen und Entlassungen trimmen sie den Börsenkurs<br />
genau so lange, bis sie den besten <strong>Preis</strong> bekommen. Verglichen damit<br />
wirkt manch Altverleger schon wieder wie ein Musterdemokrat. Selbst die FAZ<br />
sprach angesichts des Treibens im Münchner Sender einmal von „Heuschreckenlogik“.<br />
Womit geklärt wäre, wem Printmedien und Privatsender „gehören“.<br />
Im Sinne von: in Besitz sein.<br />
Koch – Wilhelm – Seibert<br />
Und dann haben wir da noch die öffentlich-rechtlichen Sender, die Anstalten,<br />
wie es so schön und manchmal allzu treffend heißt. Das sind diese großen Häuser<br />
mit diesen endlos langen Korridoren, in denen die Machtkämpfe besonders<br />
kompliziert sind. Meiner Ansicht nach ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk<br />
eines der schönsten Geschenke, die uns die alliierten Siegermächte, vorneweg<br />
die Briten, nach 1945 gemacht haben. Aus der verheerendsten Propagandawaffe<br />
der Nazis wurde ein zumindest potentiell demokratisches Medium, das<br />
obendrein, zumindest potentiell, im Besitz aller ist. […]<br />
Die beunruhigendste Tendenz: Die geistige Entleerung der Massenprogramme im<br />
Fernsehen wie im Radio. Die wachsende Neigung, alles was im Hirn einen Funken<br />
schlagen könnte, auf hübschen Sonderkanälen wie Arte oder im Nachtprogramm<br />
wegzusenden. Während die Hauptprogramme nur noch einlullende Massenbe -<br />
spaßung abstrahlen. Vor allem die Christenunion zeigt immer wieder, dass sie ein<br />
gestörtes Verhältnis zum Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat,<br />
ihn eher als Werkzeug betrachtet. Und sich im Zweifel auf die Seite der Medien-Privatbesitzer<br />
schlägt, mit denen sie irgendwie enorm gut befreundet zu sein scheint.<br />
126
Die Verleger haben ihren Spaß mit dieser Regierung. Ihr wichtigstes Schlachtfeld<br />
ist derzeit das Internet. Der Markt der Zukunft. Wo die Verleger mehr verdienen<br />
wollen, etwa mit Hilfe eines neuen sogenannten „Leistungsschutzrechtes“,<br />
dass ihnen – nicht den Urhebern – das Inkasso für Online-Inhalte erleichtern soll.<br />
Zugleich feuern die Medienbesitzer, vor allem der Bundesverband Deutscher<br />
Zeitungsverleger und der Verband Privater Rundfunk und Telemedien seit Jahren<br />
aus allen Rohren gegen die Online-Präsenz der Öffentlich-rechtlichen. Die sollen<br />
aus dem Netz gedrängt werden. Unter tatkräftiger Mithilfe vieler Politiker.<br />
Das erinnert an den Kampf um die Claims in der Antarktis. Wo jeder, der genug<br />
Macht zu haben glaubt, mal eben seine Fahne ins Eis rammt. Um sich Schätze<br />
zu sichern. Auch hier geht es um Marktanteile. Die Erfolge sind erschreckend:<br />
Die Politik war den Medienbesitzern zu willen. Dank eines neuen Medienstaatsvertrages<br />
sind ARD und ZDF seit Neustem gezwungen, zur Löschung ihrer In hal te<br />
im Internet zu schreiten. Eine Massenvernichtung von Information. Stoff, für den<br />
wir Gebühren zahlen. Und der weg muss, damit bei anderen die Kasse stimmt.<br />
Medien sind die Plattform für alle Öffentlichkeit<br />
Medien sind die Plattform für alle Öffentlichkeit, die über unseren persön lichen<br />
Gesichtskreis hinausreicht, über die unmittelbare Familie, die Kollegen, Bekan n -<br />
t en, Freunde und Feinde. Wobei das nicht mehr ganz stimmt: Ein soziales Netzwerk<br />
wie Facebook, das ja ebenfalls Medium ist, strukturiert auch die Wahrnehmung<br />
der unmittelbaren Umgebung neu.<br />
Medien liefern uns das Material zur Deutung der Welt, unserer Welt. Medien<br />
liefern uns Unmengen Informationen frei Haus, auch Sichtweisen und Einsichten,<br />
Lebensstile, Stimmungen, Zerstreuung – Lachen und Weinen inklusive. Weshalb<br />
die Frage so wichtig ist, wem sie gehören. Und wem sie gehorchen.<br />
Politik wird immer mehr zur Seifenoper<br />
Beim Gehorchen tut sich auch so einiges. Vor allem auf jenem Sektor, den ich<br />
„orchestrierte Kommunikation“ nennen möchte. Die industrielle Meinungsmache,<br />
127
den Spin. Es gibt eine wachsende Kontrolle von öffentlicher Darstellung, einen<br />
wachsenden Hang zur Inszenierung. Politik wird immer mehr zur Seifenoper, wird<br />
in Szene gesetzt und vermarktet wie früher nur Margarine, Mode und Popstars.<br />
Das hat mit der Privatisierung der Welt zu tun. Damit, dass immer größere Teile<br />
des Gemeinwesen in den Besitz nicht demokratisch legitimierter Macht übergehen.<br />
Auch mit den Rating-Agenturen. Denn ein klares Triple-A von Standard &<br />
Poor‘s ist heute wichtiger als alles Journalistengeschnatter – für Firmen wie für<br />
Staaten. Das hat überdies damit zu tun, dass sich öffentliche Wahrnehmung<br />
zusehends auf eine kleine Schar von Top-Akteuren verengt, die zumeist auch<br />
nicht mehr als politische Wesen, als artikulierte Interessen, sondern nur mehr<br />
als Solo-Darsteller erlebt werden, die sich auf der polit-medialen Bühne mehr<br />
oder weniger raffiniert präsentieren.<br />
Es ist an der Zeit sich verstärkt mit den Dirigenten dieses Orchesters auseinan -<br />
de rzusetzen. Da ist nicht nur die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, über<br />
deren keckes Treiben wir uns so gerne lustig machen. Meinungsmache ist eine<br />
globale Industrie geworden. Immer mehr sucht sie unser aller Sicht auf die Verhältnisse<br />
zu bestimmen. Keine Figur von Rang tritt mehr in der Öffentlichkeit auf<br />
ohne eine Armada von Imageberatern, Agendasettern und Marketingexperten.<br />
Politische Entscheidungsprozesse sind in allen Stadien den Pressionen einer<br />
kolossalen Lobby-Maschinerie ausgesetzt. Journalisten werden geschickt um -<br />
schmeichelt und mit Geschichten gefüttert. Keine Party steigt mehr ohne Eventmanager.<br />
Selbst Kriege werden heute unter Feuerschutz von mindestens einem<br />
Dutzend PR-Agenturen geführt.<br />
Zu diesem Bild gehört auch das vermeintlich unpolitische Wirken der Zerstreuungsindustrie.<br />
Die Welt der Promis, der Lightshows und des menschelnden<br />
Schwachsinns. Sie führt zur Entkoppelung breiter Massen vom gesellschaftlichen<br />
Diskurs. Sie kreiert eine Art Anti-Welt. Eine Öffentlichkeit, die Wirklichkeit<br />
verweigert. Sie befördert das Auseinanderdriften der Gesellschaft, vertieft den<br />
Graben zwischen Habenden und Habenichtsen. Verschärft das Unten und<br />
128
Oben. Unten macht sich ein fatalistischer Verdruss über die sogenannten Eliten<br />
breit. Während oben die Verachtung gegenüber dem sogenannten einfachen<br />
Volk wächst. Die Mittelschicht lebt derweil in Angst und zeigt einen wachsenden<br />
Drang zur Abgrenzung gegen alles Fremde, das ihr den Platz streitig<br />
machen könnte.<br />
Wem gehören die Medien? Wem sollten sie idealerweise gehören? Die Antwort<br />
ist einfach: Allen. Uns. Medien spiegeln und formen Gesellschaft. Medien sind<br />
der Ort, wo unsere Wirklichkeit beschrieben, reflektiert, debattiert und bewertet<br />
wird. Wo die Gesellschaft zu sich spricht. Zivilisation – das ist die Zügelung von<br />
Macht und Gewalt in einer und durch eine informierte Öffentlichkeit. Medien sind<br />
die Vehikel dieser öffentlicher Kontrolle. Oder sollten es doch sein. Deshalb<br />
nennt man sie die vierte Gewalt.<br />
Ja, es gibt andere Öffentlichkeiten: den Marktplatz, die Parteien, die Gewerkschaften,<br />
Vereine, Initiativen, NGOs. Doch auch, was hier besprochen und getan<br />
wird, erschließt sich einer großen Zahl von Menschen nur über Medien. Es ist<br />
elementar für die Demokratie, wer mitreden darf, wer den Ton angibt. Wie laut<br />
abweichende Meinungen werden dürfen. Und am Ende immer, wer die Entscheidungen<br />
trifft. Die „Elite“ und ihre Experten, die exklusiven Clubs? Die Börse, die<br />
Bürokratie, die Billionäre? So kann es nicht gehen.<br />
Der hochgeschätzte Kollege Mathias Greffrath hat es schon vor Jahren klar um -<br />
rissen: „In den letzten drei Jahrzehnten sind die Medien dem Marktgesetz verfallen.<br />
Ihre neue `Vielfalt´ ist passgenauer Überbau der ökonomischen Basis:<br />
Unterschichten lernen auf Unterschichtenschulen, schlucken Unterschichten -<br />
essen, sehen Unterschichtenfernsehen; Eliten gehen auf Privatschulen, essen<br />
und joggen mit Stil und lesen FAZ, SZ und notfalls Die Welt.“<br />
Deutschland, ein Inkompentenz-Zentrum<br />
Öffentlichkeit ist auch der Ort, in der sich eine Gesellschaft über ihren Fortschritt<br />
verständigt. Da kann es einen schon manchmal rasend machen, wie wenig sich<br />
129
hier in eine gute Richtung bewegt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Ideen<br />
und Visionen heute als bedrohlich, gefährlich und spinnert gelten.<br />
Warum etwa haben wir nicht endlich eine Schule, die alle Kinder fördert, ihnen<br />
hilft, möglichst fröhliche, tolerante, kluge und neugierige Menschen zu werden?<br />
Der Kampf darum tobt seit mindestens 40 Jahren, ein zäher Stellungskrieg in<br />
mittlerweile 16 Fürstentümern. So sehr sich viele mühen, es im konkreten Alltag<br />
gut zu machen – das marode Fundament stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es<br />
darf nicht angetastet werden, es steht unter ideologischem Denkmalschutz.<br />
Unser „bürgerliches Lager“ will es so. Wir sind neben Österreich inzwischen das<br />
letzte Land in Europa, das auf Frühselektion setzt. Das Resultat ist dokumentiert:<br />
eine gigantische Verschwendung von Talent und Lebensglück. Der soziale<br />
Status der Eltern entscheidet weiter über die Chancen der Kinder. Deutschland,<br />
ein Exzellenz-Cluster? Nein, ein Inkompentenz-Zentrum.<br />
Es ist die zweite Demokratie, die wir in Deutschland haben. Die erste ist nicht<br />
zuletzt am Versagen der Medien zugrunde gegangen, an Propaganda, Gleichschaltung,<br />
Duckmäusertum. An einer zunehmend lautstarken Verachtung der<br />
Demokratie. Der Rüstungs- und Medienunternehmer Alfred Wilhelm Franz Maria<br />
Hugenberg, der die halbe deutsche Presse kontrollierte, war einer der wichtigsten<br />
Wegbereiter des Nationalsozialismus. Was genau haben wir seit Hugenberg<br />
dazugelernt??<br />
Ich glaube, eine ganze Menge. So lange öffentlich-rechtlicher Rundfunk halbwegs<br />
funktioniert, so lange Verleger nicht zu Fabrikanten regredieren, sondern<br />
gesellschaftlich verantwortlich handeln – und begreifen, dass ihre Medien nicht<br />
nur einen Warencharakter haben, sondern eine darüber hinausgehende, sehr<br />
grundlegende kulturelle Funktion, ist unser duales System im Prinzip gar nicht<br />
schlecht. Wir genießen einen Murdoch nur in homöopathischen Dosen. Wir<br />
haben kein Fox News. Und, ganz nebenbei, auch kein ZK mehr, dass die Medien<br />
streng steuert und zensiert.<br />
130
Verleger? Das ist ein komisches Wort. Es ist vor Jahrhunderten entstanden und<br />
hieß eigentlich wohl Vorleger. Das war der, der die Kosten für den Druck eines<br />
Buches vorlegte … . Verlegen – das war in Deutschland immer eine Sache des<br />
Clans. Man wurde es qua Geburt – wie Bauer, die Holtzbrincks, Neven DuMont,<br />
auch Axel Springer und Hubert Burda. Oder per Eheschließung. Oder per Adoption.<br />
Der vierte Weg war – nach Kriegsende – die Lizenz. Die alliierten Sieger<br />
über das faschistische Deutschland legten unser Mediensystem vor 65 Jahren<br />
still. Die Herstellung und der Vertrieb von Presse war nur nach Erhalt einer solchen<br />
Lizenz möglich. Weil klar war: Ohne das Versagen und die darauf folgende<br />
Gleichschaltung von Presse und Rundfunk wäre der Triumph des Nationalsozialismus<br />
undenkbar gewesen.<br />
Neue, integre Medienbesitzer sollten fortan die Öffentlichkeit bedienen. Die<br />
Suche nach den richtigen, „demokratisch gesinnten“ Leuten verlief streckenweise<br />
ziemlich mühsam. Findungskommissionen brausten in Jeeps durch das in<br />
jeder Hinsicht verwüstete Land. Gerd Bucerius, Henri Nannen, Rudolf Augstein<br />
und andere erhielten schließlich Lizenzen. Bei Axel Caesar Springer, der eigentlich<br />
Opernsänger werden wollte, fügte es sich doppelt: Er erbte einen kleinen<br />
Verlag – und bekam eine Lizenz. Springer war ein ziemlicher Aufschneider. Als<br />
die Briten ihn fragten, ob er im Dritten Reich verfolgt worden war, soll er geantwortet<br />
haben: „Eigentlich nur von den Frauen!“<br />
Es war ein echter Neuanfang. Na ja, fast. Die Burdas und die Mohns verschleierten<br />
die Rolle ihrer Verlage unter den Nazis. Der deutsche Verleger ist nämlich auch<br />
flexibel. Während des Krieges druckte Burda Generalstabskarten. Und Bertelsmann<br />
„Feldausgaben“ für die Front. Georg von Holtzbrinck war NSDAP-Mitglied.<br />
Der Historiker Wolfgang Benz resümierte sein Wirken so: „Die Geschichte des<br />
Unternehmers Georg von Holtzbrinck im Dritten Reich ist so unspektakulär wie bedrückend.<br />
Er war kein fanatischer Ideologe, kein bösartiger Antisemit, kein wilder<br />
Militarist, er hat sich nur einfach angepasst. Um des Geschäftserfolgs willen.“<br />
131
Und trotzdem: Ein Neuanfang. Als John Seymour Chaloner, Presseoffizier der britischen<br />
Besatzungszone sich 1946 zum ersten Mal mit Rudolf Augstein traf, war<br />
Chaloner 21 Jahre alt. Und Augstein 22. Er bekam die britische Lizenz Nr. 123.<br />
Die Süddeutsche Zeitung hatte die US-Lizenz Nr. 1. Mit dem Grundgesetz 1949<br />
kam dann eine Generallizenz zum Zeitungsmachen. Seither darf jeder. Man<br />
wünscht sich manchmal, dass da wieder einer käme und ein paar mutigen<br />
Habenichtsen die Lizenz zum Medienmachen in die Hand drückte. Aber das<br />
wird nicht passieren. Oder nur um den <strong>Preis</strong> einer Katastrophe.<br />
Maschinenraum der Öffentlichkeit<br />
Das Problem ist nicht nur ein strukturelles. Es hat auch etwas mit der Haltung<br />
des Einzelnen zu tun. Vor allem in meinem Beruf, dem Journalismus. Der ja so<br />
etwas wie der Maschinenraum der Öffentlichkeit ist.<br />
Der Politik- wie der Wirtschaftsjournalismus haben sich im neuen Jahrtausend<br />
schon gründlich blamiert. Wirtschaftsressorts verkamen zu marktfundamentalistischen<br />
Sekten. Deutsche Politschreiber haben sich 2005 mit einer großen<br />
Merkelei lächerlich gemacht. 2009 gaben sie sich dann betont gelangweilt –<br />
was keinen Deut besser war. Die publizistischen Alphatiere fielen in eine postdemokratische<br />
Attitüde, fanden Demokratie plötzlich ziemlich lahm und langweilig<br />
und die Politiker sowieso alle doof.<br />
Global sind wir Journalisten in diesem Jahrtausend bereits an George W. Bush,<br />
Wladimir Putin, Jörg Haider und Silvio Berlusconi gescheitert. Aus höchst unterschiedlichen<br />
Gründen. Die Öffentlichkeit steckt nicht nur in Deutschland in der<br />
Krise. Der Journalismus hat einen Haltungsschaden. Auch, zum Beispiel in den<br />
USA. „Das renommierte Corps der Hauptstadtkorrespondenten“, resümierte der<br />
Pulitzer-<strong>Preis</strong>träger Russell Baker zum Ende der Ära Bush, habe sich „mit Lügen<br />
abspeisen und zur Hilfstruppe einer Clique neokonservativer Verschwörer ma chen<br />
lassen“. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Journalisten kaum noch<br />
Journalismus machen. Im Sinne von: Rausgehen und recherchieren.<br />
132
Wenn die schiere Zahl der Journalisten Garant für hohe Qualität wäre, spottet der<br />
US-Medienökonom Robert Picard, „wäre niemand überrascht worden vom Bankendebakel,<br />
dem Zusammenbruch des sowjetischen Blocks, der internationalen<br />
Schuldenkrise, der US-Hilfe an Regierungen in Zentralamerika, der Iran-Contra-<br />
Affäre, der Kinderarbeit in Entwicklungsländern, dem explosiven Wachstum der<br />
chinesischen Wirtschaft oder dem wachsenden nationalen oder internationalen<br />
Terrorismus“. Denn die Zahl der Journalisten sei ja seit 1970 stark gewachsen.<br />
Das Problem, so Picard: „Die meisten Zeitungsjournalisten kümmern sich um<br />
alles außer den wichtigen Nachrichten. Sie verbringen ihre Zeit, um Geschichten<br />
über Stars, Essen, Autos und Unterhaltung zu schreiben.“ Auch deshalb<br />
erscheint Demokratie immer öfter wie ein Ritual, ein inszeniertes Spiel, eine<br />
hohle Nummer, ein Placebo.<br />
Was eine brandgefährliche Tendenz ist. Weil sie dem Rechtspopulismus die Tür<br />
aufreißt. Dessen Trick es ist, der Komplexität einer sich globalisierenden Welt<br />
die simple Formel entgegenzubrüllen, Schuld zuzuweisen: Den Fremden, den<br />
Muslimen, den Juden, den Linken, den ... – jedenfalls immer den anderen. Er<br />
schafft Fronten und Feindbilder. Es bündelt die Angst der Menschen und zieht<br />
sie an ihr durch die Manege. […]<br />
Medien bestimmen den Diskurs<br />
Sie alle bedienen mit ihren Medien und ihrer Rhetorik die Emotionen des<br />
Volkes. Vor allem dessen Angst. Und bestimmen so den Diskurs. Erregung ist<br />
dabei die wichtigste Waffe. Was wir just im kleinen auch in Deutschland sehen<br />
durften. Bei der sagenhaften Sarrazin-Debatte. Ein Paradestück der seit Jahren<br />
grassierenden Erregungskultur. Ein Musterbeispiel für ein Medientornado, für<br />
jenes Saureiter-Gewerbe, zu dem Journalismus gerne mal verkommt. Ja: Man<br />
muss die Sau rauslassen. Und sie durchs Dorf treiben. Das schafft Aufmerk -<br />
samkeit. Aufregung. Auflage.<br />
Was ist geschehen? Thilo Sarrazin, Sozialdemokrat, Volkswirt, Ex-Senator und<br />
Bundesbanker, schrieb ein Buch: „Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser<br />
133
Land aufs Spiel setzen“. Voller Zahlen. Und voller Verachtung für die vermeintlich<br />
dumme, aber umso vermehrungsfreudigere Unterschicht. Am schlimmsten:<br />
Diese Zugewanderten. Vor allem die Türken. Die ja, das hatte der Banker schon<br />
im vergangenen Jahr laut kundgetan, viel zu viele „Kopftuchmädchen“ produzieren.<br />
Es kam daher als kalte Kosten-Nutzen-Analyse. Für solch ein Buch muss<br />
es Bumm machen. Auf großer Bühne. Und tatsächlich sorgen Bild und Spiegel –<br />
die neue, unheilige Sautreiber-Allianz – für maximalen Lärm. Ihre angeblich 18<br />
Millionen Leser dürfen sich vorab in den knackigsten Phrasen suhlen. Das lohnt<br />
sich – für Sarrazin wie für die Blätter.<br />
Nun stürzen alle anderen Medien dieser Sau hinterher – schreiben, knipsen und<br />
senden, was das Zeug hält. Ein „Aufreger“ ist geboren. Und weil so eine tolle<br />
Erregung schneller zusammenfällt als ein Soufflé, muss nachgeheizt werden.<br />
Zum Beispiel mit ein bisschen erbbiologischem Unfug. Mit ein wenig Gerede von<br />
den Genen der Juden oder der Muslime, der Klugen und der Dummen, der Oberund<br />
der Unterschicht. Das sind Perlen für die Sau. Das kreiert noch mehr Schlagzeilen.<br />
Noch mehr Auflage. Das weckt Empörung und Protest. Was wiederum die<br />
Möglichkeit schafft, die Tabu-Taste zu drücken. Der Spiegel titelt über den<br />
„Volksheld Sarrazin“. Während Bild – das Zentralorgan unterdrückter Minderheiten<br />
– ihren „Klartext-Thilo“ zum Opfer bitterböser Kritiker stilisiert.<br />
Meine Lieblingsschlagzeile: Bild kämpft für Meinungsfreiheit! Das wird man ja<br />
wohl noch sagen dürfen!, heißt es jetzt in großen Lettern, und: Wir wollen keine<br />
Sprechverbote! Illustriert übrigens, oh Gipfel der Ironie, mit einem Foto, dass den<br />
vermeintlich mundtot gemachten Propheten zeigt, wie er von einer gigantischen<br />
Zahl von Mikrofonen bedrängt wird, deren Halter nur das eine wollen: Mehr von<br />
diesem geilen Sarrazin-Superstoff. Nun gehen auch die Lautsprecher flugs in<br />
Stellung. Das Stammpersonal der Talkrunden stürzt sich in den Sautreiber-Strom.<br />
Dampfplauderer wie Arnulf Baring, Hans-Olaf Henkel, Henryk M. Broder und<br />
Matthias Matussek. All die Wellenreiter der öffentlichen Erregungsstürme. Und<br />
die Vollzeit-Pyromanen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, von hinten<br />
halb rechts auf den teuren Sozialstaat und die öde „Konsensgesellschaft“, auf<br />
134
die Muslime und alle sogenannten „Gutmenschen“ niederzugehen. Niedere<br />
Instinkte sind geweckt. Der Lärmpegel steigt. Das Niveau sinkt weiter. Schon<br />
jubelt die NPD. Während Frank Schirrmacher sich in der FAZ die „Frau Merkel“<br />
vorknöpft, weil sie das Buch noch nicht komplett gelesen hat. Dieses „wichtige<br />
Buch“, das auch „Bild“ weiterhin tagtäglich feiert. Das endlich sagt, was das<br />
Volk wirklich will, diese ewig unverstandene, gequälte Masse, dessen neue,<br />
klare Stimme nun Sarrazin heißt. „Die Politik“ hingegen ist ach so bös und fern<br />
und unter aller Sau. „Die Politiker“, so klingt seit Monaten der postdemokratische<br />
Refrain, der auch jetzt wieder laut angestimmt wird, „die Politiker“ taugen ja<br />
sowieso alle gar nichts.<br />
Klassische Rezeptur des Rechtspopulismus<br />
Das ist die klassische Rezeptur des Rechtspopulismus. Sicher: Demokratie –<br />
die Herrschaft des Volkes – kann nur als Annäherung gelingen, bleibt ein Ideal.<br />
Immer bloß bedingt erreichbar. Es wird immer Menschen geben, die nur vor sich<br />
hin leben, nur konsumieren, in Ruhe gelassen werden und ein bisschen bespaßt<br />
werden wollen – von den Medien. Es wird immer Gruppen geben, die sich nur<br />
schwach artikulieren können, die weniger durchsetzungsstark und damit „wert“<br />
sind als potente, lautstarke Interessen.<br />
Umso wichtiger ist, dass Medien für das Recht auf Teilhabe aller an den Entscheidungen<br />
– und am Wohlstand – eintreten. Dass sie gerade jene Menschen<br />
mitreden lassen, die solches nicht qua Amt, Macht, Geld ohnehin tun. Dass sie<br />
immer wieder fragen: Wie sind die Chancen verteilt? Wie sozial, wie frei, wie<br />
gerecht ist unsere Gesellschaft? Wie viel Würde genießt der einzelne? Wie viele<br />
fallen hinten runter? Wer hat noch das Wort? Tatsächlich aber inszeniert die Talk-<br />
Demokratie zumeist nur den stets gleichen Leer-Diskurs einiger hundert Darsteller.<br />
Genug Misere. Reden wir von der Zukunft. Fragen wir uns: Wie eine Öffentlichkeit<br />
herstellen – oder wiederherstellen, die mehr kann, als nur die fetteste Sau<br />
durchs Dorf reiten? Kann der Markt es richten? Was tun, wenn auch auf diesem<br />
Sektor ein Marktversagen eintritt?<br />
135
Jürgen Habermas hat 2007 zur Rettung des seriösen Zeitungswesens eine<br />
gesellschaftliche Alimentierung nach Art des öffentlich-rechtlichen Rundfunks<br />
vorgeschlagen. Weil Leser, Hörer und Zuschauer nicht nur Konsumenten sind,<br />
sondern – Zitat – „zugleich Bürger mit einem Recht auf kulturelle Teilhabe,<br />
Beobachtung des politischen Geschehens und Beteiligung an der Meinungsbildung“.<br />
Weil der durch die Verfassung garantierte Rechtsanspruch auf mediale<br />
Grundversorgung nur durchsetzbar sei, wenn Medien unabhängig von Werbung<br />
und Sponsoreneinfluss bleiben. Staatsknete für die Zeitungen? Die Reaktionen<br />
waren überwiegend unbegeistert.<br />
Es gibt auch andere Modelle: Stiftungen etwa, die unabhängigen Journalismus<br />
fördern. Wie wäre es zum Beispiel mit einer deutschen Filiale des „Center for Investigative<br />
Reporting“? Oder mehr Recherchestipendien, wie sie etwa vom Netzwerk<br />
Recherche oder der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung vergeben werden? Man könnte hier<br />
moderne investigative Auftragsdienste schaffen, nach dem Vorbild des amerikanischen<br />
„Spot us“ – Recherche sozusagen on demand, im bezahlten Leserauftrag.<br />
Als ich vor über 20 Jahren online ging, gab es noch kein World Wide Web. Die<br />
Schirme zeigten grüne Buchstaben. Man musste kryptische Kommandos eingeben,<br />
um auch nur den Inhalt der eigenen Diskette betrachten zu können. Aber<br />
das Internet gab es schon. Und es war ein Hochgefühl, das erste mal in diese<br />
Welt einzutauchen, online zu gehen, mit lächerlichen 300 Bits pro, also, bei<br />
guter Verbindung; knapp 38 Buchstaben pro Sekunde – man konnte mitlesen.<br />
Schon damals gab es Email und Foren. Listserver, auf denen Leute aus aller<br />
Welt sich über Themen austauschten und Informationen zur Verfügung stellten.<br />
Und es war klar: Das wird gut.<br />
Das Internet – ein demokratisches Wunder<br />
Ich weiß, es gibt immer noch viele Leute, auch Journalisten, die finden, das<br />
Internet sei des Teufels und eigentlich sowieso nur eine interaktive Datenbank<br />
für Kinderpornos. Es gibt auch immer noch Snobs, die lieber mit dem Füllfederhalter<br />
schreiben. Das sei ihnen gegönnt.<br />
136
Doch wenn wir über demokratische Öffentlichkeit reden, vor allem über Gegenöffentlichkeit,<br />
nimmt das Internet die absolute Schlüsselrolle ein. Es wächst<br />
rasant. Es liefert nicht nur Unmengen von Informationen. Es verändert auch die<br />
Kommunikation. Sicher: Das Internet ist auch full of shit. Es erhöht das ohnehin<br />
lärmende Grundrauschen. Und viele chatten sich einfach nur ins Nirwana.<br />
Größere Zusammenhänge haben es auch im Internet oft nicht leicht. Man kann<br />
eine große Reportage, eine komplexe Analyse, nicht einfach in 150 Textkrümel<br />
zerbröseln und versimsen oder vertwittern.<br />
Und trotzdem ist das Internet ein demokratisches Wunder. Es ist, als ob ein<br />
guter Geist allen Erdenbürgern – fast allen, auch der Zugang zu Computern ist<br />
begrenzt – eine Druckmaschine in die Hütte gezaubert hätte. Und dazu, was<br />
noch viel wichtiger ist, ein blitzschnelles, weltweites Vertriebssystem. In vielen<br />
Ländern entstehen online neue, gute Medien. In Frankreich etwa haben viele<br />
gefeuerte Redakteure neue digitale Projekte aufgezogen, Internet-Zeitungen wie<br />
Rue89 oder mediapart.<br />
Ein paar Bausteine zum Schluss:<br />
1. Die Enteignung Springers gelang nicht. Das war vielleicht ganz gut so. Die<br />
Linke hätte sich ohnehin nie auf einen Chefredakteur einigen können. Was<br />
bleibt: Die Gesellschaft muss die Medieninhaber viel stärker in die Pflicht<br />
nehmen. Sie handeln nicht mit Schrauben oder Schnürsenkeln. Sie haben<br />
eine enorme demokratische Verantwortung.<br />
2. Wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Renaissance, einen Rundfunk, der tatsächlich<br />
von den gesellschaftlich relevanten Gruppen gesteuert wird. Wir müssen<br />
dem politischen Erstickungstod von Anstalten wie etwa dem Hessischen<br />
Rundfunk entgegentreten. Und die Entleerung der Hauptkanäle verhindern.<br />
3. Wir brauchen ein anderes, freieres, zornigeres, couragierteres journalistisches<br />
Selbstverständnis. Zu viele werden gebrochen durch lebenslange Praktika,<br />
durch den Druck des Marktes. Zu viele schwimmen mit im Mainstream.<br />
137
Übrigens, nebenbei: Es ist – das Wort hab ich lange nicht mehr benutzt –<br />
auch eine Klassenfrage. Wir haben immer besser ausgebildete Journalisten,<br />
aber die feinere Mittelschicht ist hier kolossal überrepräsentiert. Und mit ihr<br />
eine bestimmte Lebenswirklichkeit, eine bestimmte Wahrnehmung. Auch ein<br />
Grund, warum ein Thema wie Mindestlohn es so schwer hat.<br />
4. Wir brauchen Strukturen wie Stiftungen und Vereine, die unabhängigen Journalismus<br />
fördern.<br />
5. Wir müssen mehr große Internet-Experimente wagen. Magazine, Foren und<br />
Portale aufbauen, die echte Öffentlichkeit schaffen. Und Wege finden, damit<br />
sie Erfolg haben und sich tragen.<br />
Warum müssen?<br />
Ganz einfach: Ohne Öffentlichkeit gibt es keine Demokratie.<br />
Und die gehört uns.<br />
138
Heribert Prantl<br />
Laudatio zur Verleihung der „Verschlossenen Auster“ *<br />
Der heilige Christophorus ist, wie allgemein bekannt, der Schutzpatron der<br />
Autofahrer. Aber nicht nur die Autofahrer haben einen Schutzpatron, sondern<br />
auch die Journalisten – die meisten Journalisten wissen das gar nicht. Viele wollen<br />
wohl auch gar keinen katholischen Schutzpatron haben und empfinden ihn als<br />
aufgedrängte Bereicherung. Diese Bereicherung heißt jedenfalls Franz von<br />
Sales: Papst Pius XI. hat ihn im Jahr 1923 zum Journalistenpatron gekürt.<br />
Der heilige Franz von Sales lebte im 16. Jahrhundert und war Bischof von Genf.<br />
1564, am Beginn seiner priesterlichen Tätigkeit, erhielt er den Auftrag, die Menschen<br />
im Chablais, also südlich vom Genfer See, wieder für den katholischen<br />
Glauben zu gewinnen; sie waren zum Calvinismus übergetreten. Als die politischen<br />
Machthaber von dieser Mission des Franz von Sales erfuhren, verboten<br />
sie der Bevölkerung unter Strafe, dessen Predigten zu besuchen. Der junge<br />
Geistliche musste andere Wege finden, seine Botschaft unters Volk zu bringen.<br />
Er druckte also seine Predigten auf Flugblätter, heftete sie an Bäume, Tore und<br />
Haustüren. Und er hatte Erfolg damit: Nach drei Jahren konnte er seinem<br />
Bischof die Rückkehr der Bevölkerung zum katholischen Glauben berichten.<br />
* Das „netzwerk recherche e.V.“ (nr) vergibt diesen „Negativpreis“ im Rahmen ihrer Jahrestagung. <strong>2010</strong> ging die<br />
„Verschlossene Auster“ an die Deutsche Bischofskonferenz als „Auszeichnung“ für die Informationsblockade der<br />
katholischen Kirche. Wir dokumentieren hier ungekürzt die Laudatio von Prof. Dr. Heribert Prantl, vorgetragen am<br />
10. Juli <strong>2010</strong> in Hamburg, und danken ihm und dem „netzwerk recherche“ für die Abdruckgenehmigung. (Die Redaktion)<br />
139
Dieser Erfolg beruhte nicht allein auf dem damals gerade modern gewordenen<br />
Medium Flugblatt, sondern vor allem darauf, dass der Mann die richtigen Worte<br />
fand: Erstens übernahm er nicht den damals bei Glaubensauseinandersetzung<br />
allgemein üblichen polemischen Stil; zweitens war seine Recherche über den<br />
Calvinismus, mit dem er sich auseinandersetzte, sehr präzise; drittens verfasste<br />
er seine Flugblatt-Texte in der Landessprache, was in der vom Latein beherrschten<br />
katholischen Kirche sensationell war.<br />
Franz von Sales konnte also das, was die katholische Kirche heute nicht mehr<br />
kann: Er war glaubwürdig; er kannte die richtigen Worte; er hatte die Sprache,<br />
um Gehör und Glauben zu finden. Diese große Gabe ist der katholischen Kirche<br />
nicht mehr gegeben. Eine Gemeinschaft, die vom Wort lebt wie keine andere, hat<br />
die Sprache verloren. Sie ist sprach- und sprechunfähig geworden, nicht nur, aber<br />
vor allem, wenn es um ihr Verhältnis zur Sexualität geht. Die Diskussion über den<br />
Zölibat samt der Sexualität der Priester ist ein Tabu, die Diskussion über die<br />
katholische Sexuallehre ist ein Tabu, das Reden über Verhütung ist tabu. Wenn<br />
es so viele Tabus gibt, gibt es keine Wahrhaftigkeit mehr. Die Institution, die<br />
diese Tabus aufgestellt hat, geht den heiklen Fragen aus dem Weg, weil sie<br />
keine Antworten geben will. Und wenn die Fragen gleichwohl drängend werden,<br />
schlagen die Antworten Haken wie der Hase auf der Flucht. Ausgerechnet die<br />
Kirche als Fachinstitution für das Benennen und Eingestehen von Verfehlungen,<br />
als Fachinstitution für Schuldbekenntnis, Buße, Reue und Vergebung musste<br />
und muss von Opfern und Medien gezwungen werden, Stellung zu beziehen.<br />
Ritus und Liturgie der Kirche bauen auf den Glauben daran, dass Worte eine Kraft<br />
haben, die sogar Materie verwandeln kann. Das Wort hat die Kraft zur Wandlung.<br />
„Im Anfang war das Wort“ – so beginnt denn auch das Johannesevangelium.<br />
Das bedeutet unter anderem: Der Evangelist Johannes war der erste Kommunikationswissenschaftler.<br />
Und das bedeutet vor allem: Kirche ist Kommunikation.<br />
Ohne Kommunikation gibt es keine Mission, keine Klarheit, keine Wahrheit.<br />
Unterdrückung von Kommunikation ist daher nicht Mission, sondern Demission.<br />
Wenn beispielsweise das Bistum Regensburg gegen das Online-Portal Regens-<br />
140
urg Digital klagt, wenn es Kritiker zum Schweigen bringen will, und sich die<br />
deutsche Bischofskonferenz weigert, dazu eine Stellungnahme abzugeben,<br />
dann mag das zwar juristisch zulässig sein, aber es ist eine Demission.<br />
Die Kirche redet wenig, die Opfer reden viel. Aus der Schweigespirale ist eine<br />
Redespirale geworden; darüber mäkeln kann nur der, der die Opfer nicht kennt.<br />
Seitdem der mutige Pater Klaus Mertes als Rektor des Berliner Canisiuskollegs der<br />
Jesuiten im Januar <strong>2010</strong> in einem Brief an 600 ehemalige Schüler die jahrelangen<br />
sexuellen Übergriffe durch Lehrkräfte an seiner Schule öffentlich bekannt hat,<br />
haben Opfer im ganzen Land den Mut zum Reden gefunden. Die Erschütterung, die<br />
Mertes zu seinem Schritt getrieben hat, sie hat die Mauern der reformpädago -<br />
gische orientierten Odenwald-Schule genauso zum Einsturz gebracht wie die<br />
des konservativen Klosters Ettal. Die Schweigespirale wurde umgedreht; und an -<br />
gesichts der vielen Jahrzehnte, die geschwiegen worden war, kann man nach den<br />
paar Monaten des Erkennens und Bekennens gewiss nicht sagen, dass nun schon<br />
zu viel geredet wird. Dieses Reden ist das beste Mittel gegen sexuelle Gewalt.<br />
Man muss mit den Opfern reden, dann versteht man, worum es geht. Matthias<br />
Drobinski, der Kirchenredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat das so geschildert:<br />
„Sie rufen an und reden und hören gar nicht mehr auf, sie schreiben Mails,<br />
die kein Ende finden, die schreien vor Not und Bitterkeit. Die Verletzung von vor<br />
20, 30 oder 40 Jahren ist ihnen Gegenwart geblieben, die Demütigung, die ins<br />
Intime, ins letzte Eigene vordringt und es zerstört. Ein Erwachsener übt totale<br />
Macht aus über den Körper und die Seele eines Kindes – das allein ist furchtbar.<br />
Dass er es im Namen er Institution, der guten Sache, der Religion, gar Gottes tut,<br />
macht das Verbrechen unfassbar.“ Es ist sexueller Sadismus in Gottes Namen.<br />
Die Kirche war nicht die Täterin des sexuellen Missbrauchs. Aber sie war und ist<br />
die Heimat der Täter. Sie hat ihnen die heiligen Räume zur Verfügung gestellt, in<br />
denen die Täter so geschützt agieren konnten und in denen die Opfer so ungeschützt<br />
waren; sie, die Kirche, hat den Tätern die Würde des Amtes verliehen,<br />
mit der sie sich tarnen und in der sie sich verstecken konnten. Es sind so viele<br />
141
Amtsträger, die als unwürdig entlarvt worden sind, und bei fast allen hat die<br />
Amtskirche so lange weggeschaut. Und lügnerische Figuren wie der zurückgetretene<br />
Augsburger Bischof Walter Mixa haben das Wort Hierarchie zu einem<br />
Synonym für Heuchelei gemacht. Und so sind auch zahllose untadelige, hochengagierte<br />
Seelsorger und Jugenderzieher unter Generalverdacht geraten. Das<br />
ist gewiss nichts, was evangelische Christen klammheimlich freuen kann; denn<br />
dieser Generalverdacht infiziert alles Kirchliche.<br />
Die Kirche hat eine Garantenstellung dafür, dass ihre Amtsträger die heiligen<br />
Räume, die Würde des Amtes und das damit verbundene Vertrauen nicht missbrauchen.<br />
Sie muss Vorsorge treffen, dass das nicht geschieht; und sie muss<br />
Nachsorge treffen, wenn es geschehen ist. Sie hat das so lange nicht getan: Die<br />
Amtskirche, bis hinauf zu dem Mann, der heute Papst ist, hat seinerzeit neue<br />
Verbrechen an Kindern nicht konsequent verhindert, als sie von den alten Verbrechen<br />
erfahren hatten. Sie hat pädophile Priester einfach woanders hin versetzt,<br />
sie hat die Fälle von sexueller Gewalt an Schutzbefohlenen der Kirche viele Jahre<br />
systematisch verschleiert. Und erst in jüngster Zeit hat sie begonnen, die Schleier<br />
abzulegen und wegzureißen – gedrängt von den Opfern und den Medien.<br />
In der Kirche wird nun Klage geführt darüber, dass dieses Drängen nicht immer<br />
in ziemlicher Form geschehe, es wird Klage geführt über den Zorn, die Wut und<br />
den Hass, der angeblich in diesem Drängen steckt. Ja, es gibt diesen Zorn, diese<br />
Wut und es gibt vielleicht auch Hass – es wäre ein Wunder, wenn es nicht so<br />
wäre. Hässliches erzeugt Hass. Eine Kirche, die sich ja als Fachinstitution für<br />
den Umgang mit Verfehlungen begreift, darf sich darüber eigentlich zu allerletzt<br />
wundern. Ich selber wundere mich eher darüber, wie wenig reißerisch, wie sachlich<br />
und sorgfältig die Berichte über sexuelle Gewalt und Misshandlung trotz<br />
alledem ganz überwiegend waren und sind.<br />
Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller sieht seine Kirche von den<br />
Medien viel zu hart angepackt, er sieht bösartige Kräfte am Werk; er sieht die<br />
Kirche einer Verfolgung ausgesetzt wie unter dem Nationalsozialismus. In der<br />
142
Wortwahl steht er alleine. Aber in vielen Predigten wird die Kirche als verfolgte<br />
Unschuld präsentiert, bedrängt von einer feindlichen Kampagne, gejagt von<br />
antiklerikalen Journalisten, die angeblich aus Lust an der Zerstörung der letzten<br />
moralischen Anstalt handeln. Bischof Müller hat den Journalisten, die über die<br />
Regensburger Domspatzen recherchierten, öffentlich „kriminelle Energie“<br />
bescheinigt. Gegen die Kirche, so sagt er, wird gezischt, „als ob man gerade in<br />
einem Gänsestall hier die Gänse aufgeweckt hätte“. In einer Predigt sprach er<br />
von „missbrauchter Pressefreiheit“ und von einer „Diffamierungs-Lizenz, mit<br />
der man scheinbar legal all diejenigen Personen und Glaubensgemeinschaften<br />
ihrer Würde beraubt, die sich dem totalitären Herrschaftsanspruch des Neo-<br />
Atheismus und der Diktatur des Relativismus nicht fügen.“ Es wird bei dieser<br />
Medienschelte, bei dieser Verfluchung so getan, als sei die sexuelle Gewalt<br />
nicht in der Kirche entstanden, sondern ihr von außen angetan worden – vom<br />
„Zeitgeist“ oder vom „Relativismus“.<br />
Der Vorwurf „antikatholischer Propaganda“ wird auf den Webseiten der Regensburger<br />
Ordinariats erhoben, von einer „primitiven Manipulation und gezielten<br />
Volksverdummung“ ist die Rede und von einer Journalismus, der „die Wahrheit<br />
so unverschämt niederhält. Man möchte den Heiligen Franz von Sales zu Hilfe<br />
rufen: nicht für die Journalisten – sondern für einen maßlosen und uneinsich -<br />
tigen Episkopus.<br />
Sicher gibt es journalistische Fehlleistungen: Wenn etwa die Schüler vom<br />
Regens burger Domspatzen-Gymnasium am Schulhof abgefangen werden, wenn<br />
ihnen regelrecht aufgelauert wird, dann ist das eher Stalking als fairer Journalismus.<br />
Solche Verirrungen gibt es, leider, bei anderen Skandalen auch. Aber bei<br />
den sonstigen angeblichen Verfehlungen, die der Regensburger Bischof geißelt,<br />
handelt es sich nicht um Verfehlungen, sondern um Journalismus. Eine „ständige<br />
Wiederholung von Vorgängen aus alter Zeit“ hat der Bischof beklagt, welche nur<br />
den Sinn habe, die Kirche als verderbten Laden darzustellen. Er verkennt, wie Journalismus<br />
funktioniert; er verkennt, wie Aufklärung funktioniert. Franz von Sales<br />
hätte es gewusst. Es ist gewiss richtig, dass die Fakten, dass die einschlägigen<br />
143
„Fälle“ aus den diversen Diözesen und Klöstern immer wieder wiederholt worden<br />
sind, weil die neu entdeckten „Missbrauchsfälle“ in die alten eingereiht wurden.<br />
Das ist aber kein Tort, der der Kirche angetan wird. Es wird auf diese Weise nur<br />
der Fortsetzungszusammenhang hergestellt. Das ist bei Skandalen in der Kirche<br />
nicht anders als bei denen in der Politik, bei Siemens, BP, VW oder den Banken.<br />
Die Amtskirche hat aber geglaubt und glaubt zum Teil immer noch, ihr gebühre<br />
ein schonender Sonderstatus, sie sei unantastbar, weil sie so alt, erhaben und<br />
wertvoll sei. Anders herum wird ein Schuh daraus. Wer, wie es die Kirche tut<br />
und immer getan hat, sich die Rolle der Hüterin der öffentlichen Moral zu schreibt,<br />
wer, wie es die Kirche tut und immer getan hat, gern darauf verweist, dass er<br />
über ein gereiftes Orientierungswissen und über besondere Problemlösungskompetenz<br />
verfüge, der muss sich schon genau anschauen lassen, wenn es um<br />
die Unmoral in den eigenen Reihen geht, und der muss sich fragen lassen, wie<br />
es denn um die Qualität dieses Orientierungswissens bestellt ist und wo die<br />
Problemlösungskompetenz bleibt.<br />
Viel zu lange hat sich die Kirche nur selbst beweihräuchert, sich für sakrosankt<br />
erklärt und vertuscht, was nicht zum Bild von ihr passte. Dabei ist das Herz der<br />
Kirche erstarrt. Statt zuzuhören, Trost zu spenden, Hilfe zu geben und selbst<br />
bußfertig zu sein, hat sie sich verbarrikadiert, kritische Fragen an sich abprallen<br />
lassen und darauf mit rechthaberischen Worten gekontert. Das unselige Ultimatum<br />
von Erzbischof Zollitsch, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,<br />
an Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger war ein<br />
letzter Ausläufer dieser Haltung: Sie sollte sich binnen 24 Stunden für den Vorwurf<br />
entschuldigen, die Kirche würde mit den Strafverfolgungsbehörden nicht<br />
konstruktiv zusammenarbeiten. Dieses katholische Ultimatum hatte bei aller<br />
Empörung etwas Hilfloses, es war ein Ausdruck hilfloser Empörung. Die Zeiten,<br />
in denen die Kirche mit Fluch und Bann beeindrucken konnte, sind eigentlich<br />
lange vorbei.<br />
144
Nach langen Jahren des Schweigens und des Verdrängens hat sich die Amtskirche<br />
schließlich doch noch zur Aufklärung und Verfolgung von sexueller Gewalt durchgerungen.<br />
Sie hat zuletzt Stärke gezeigt beim administrativen Reagieren auf den<br />
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Aber es gibt immer noch, wie bei der<br />
sogenannten apostolischen Visitation des Klosters Ettal, die alte Krähenmoral.<br />
Und über den katholischen Geschmack des Missbrauchsskandals, wie das der<br />
Jesuit Klaus Mertes formuliert hat, kann diese Kirche nach wie vor nicht reden.<br />
Kirche ist Kirche nur dann, wenn sie für andere da ist. Denn Kirche ist ursprünglich<br />
und eigentlich die Stimme der Schwachen. Aber im sogenannten Missbrauchsskandal<br />
überwiegt in der Amtskirche noch immer die Sorge um die Institution<br />
die Anteilnahme mit den Opfern. Es zeigt sich hier das kalte Herz der Kirche.<br />
Wenn sie aber vor allem für sich und zu ihrer Selbstverteidigung da ist, verliert<br />
sie sich. Mehr als jede Kirchenkritik der Kirche schaden kann, schadet sie sich<br />
selbst, wenn sie sich der Diskussion verschließt und versperrt.<br />
Das Problem der Kirche ist nicht die Öffentlichkeit, ihr Problem sind nicht die<br />
Medien, ihr Problem ist die sexuelle Gewalt und ihr Umgang damit. Andere<br />
Diözesen, andere Bischöfe haben ganz anders reagiert als Bischof Müller in<br />
Regensburg. Erzbischof Reinhard Marx in München-Freising hat die Devise<br />
ausgegeben: „Nichts verschweigen, nichts vertuschen, der Wahrheit ins Auge<br />
sehen“. Marx hat diese Devise auch praktiziert. Aber das zentrale Problem<br />
bleibt: Es ist die „Unfähigkeit, die eigenen pathogenen Strukturen und die<br />
Folgen der klerikalen Vertuschungen zu erkennen, zu erörtern und daraus praktische<br />
Konsequenzen zu ziehen“, wie es der Familien- und Religionssoziologe<br />
Franz-Xaver Kaufmann auf den Punkt gebracht hat. Pädophilie ist das Risiko<br />
einer zwangszölibatären und monosexuellen Kirche, der in 2000 Jahren zwar<br />
die Vertreibung der Frauen aus allen Machtpositionen, aber nicht die Entsexualisierung<br />
des Menschen gelingen konnte.<br />
„Die“ katholische Kirche als einen kompakten Block des Wegschauens, als ein<br />
monolithisches Kartell des Schweigens gibt es nicht mehr. Es gibt auf der einen<br />
145
Seite einen Pater Klaus Mertes, den Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin, der<br />
mit seinem Mut zu Aufdeckung und Aufklärung den Schritt hin zu einer kirchlichen<br />
Verantwortungskultur getan hat. Es gibt den Jesuitenprovinzial Stefan<br />
Dartmann, der weltweit alle Jesuiten, die Kinder missbraucht haben, aufgefordert<br />
hat, sich selbst anzuzeigen. Es gibt den wackeren Alois Glück vom Zentralkomitee<br />
der deutschen Katholiken, der den Pflichtzölibat in Frage stellt. Es gibt<br />
den München Erzbischof Reinhard Marx, der das höchst widerstrebende Kloster<br />
Ettal zum öffentlichen Bekenntnis gezwungen hat. Es gibt einen Papst Benedikt<br />
XI., der vor kurzem bekannt hat, dass „die größte Verfolgung“ der Kirche nicht<br />
„von den äußeren Feinden“ kommt, sondern aus dem Inneren, „aus der Sünde<br />
in der Kirche“.<br />
Und es gibt die ganz andere Seite der Kirche, auch in der Person des genannten<br />
Papstes Benedikt XI, der zuletzt die deutschen Bischöfe Zollitsch und Marx<br />
dafür gerügt hat, dass sie mit dem lügnerischen Amtsbruder Mixa nicht gnädig<br />
genug umgegangen seien. Es gibt den Papst, der beharrlich schweigt, wenn alle<br />
Welt eine Erklärung erwartet, der keinen Sinn hat für rechten Augenblick, keinen<br />
Sinn für den Kairos, für das große Mea Culpa, vor dem sein Vorgänger nicht zö -<br />
gerte. Es gibt die Mönche von Ettal, die sich so verfolgt wähnen wie der Regensburger<br />
Bischof Müller, es gibt eine Kirchenpresse, die schnell beleidigt ist. Es<br />
gibt einen Vatikan, dessen Verhalten in Skandal und Krise an die Echternacher<br />
Springprozession erinnert. Im Missbrauchsskandal ist es so, dass die Kurie nicht<br />
nur vor und zurück, sondern auch seitlich springt: Einem Bekenntnis folgen zwei<br />
Beschwichtigungen und drei Ausreden.<br />
Es gibt eine Kirche, deren Selbstmitleid größer ist als das Mitleid mit den Opfern.<br />
Es gibt eine Kirche, die glaubt, sie habe lediglich ein Problem mit angeblich<br />
missliebigen Medien. Dieser Kirche ist dieser Negativpreis, die „verschlossene<br />
Auster“, gewidmet. Ich widme ihn, pars pro toto, dem Bischof meiner Heimat -<br />
diözese Regensburg, dem Bischof Gerhard Ludwig Müller. In diesem Bistum<br />
Regensburg liegt Wackersdorf, der Ort, an dem einst eine Wiederaufbereitungsanlage<br />
gebaut und mit aller Macht und Staatsgewalt gegen den Willen der<br />
146
Bevölkerung durchgesetzt werden sollte. Was Wackersdorf für die CSU war, ist<br />
Bischof Müller für die katholische Kirche: ein Fiasko.<br />
Kirche kann ihr gesellschaftliches Gewicht nicht mit Geld, Geschichte und Steuermitteln<br />
erhalten oder zeugen. Es entsteht von selber durch Glaubwürdigkeit,<br />
und es verfällt mit Unglaubwürdigkeit. Die Kirche braucht das, was die Mediziner<br />
„restitutio in integrum“ nennen, die vollständige Ausheilung. Mit der Forderung<br />
nach Öffnung und Demokratisierung hat Papst Johannes Paul II. einst den<br />
Ostblock gesprengt. Diese Forderung „liegt jetzt auf den Stufen des Petersdoms“<br />
(so Jobst Paul im DISS-Journal 19/<strong>2010</strong>). Damals, im Ostblock, hieß das Neue<br />
„Glasnost“ und „Perestrojka“. Heute, in der katholischen Kirche, heißt es, unter<br />
anderem, Aufhebung des Pflichtzölibats und Frauen-Ordination. Glaubwürdig<br />
wird die Kirche nur dann, wenn sie den Ursachen für die sexuelle Gewalt und<br />
deren jahrzehntelange Vertuschung auf den Grund geht. Sie muss dazu die verstörten<br />
und empörten Fragen der Menschen hören.<br />
Ich habe mit dem Heiligen Franz von Sales begonnen; mit ihm will ich auch<br />
schließen. Dieser heilige Franz von Sales ist nämlich nicht nur Patron der Journalisten.<br />
Er ist auch Patron der Gehörlosen. Als solchen möchte man ihn bitten,<br />
sich doch der katholischen Kirche anzunehmen.<br />
147
Thomas Leif<br />
„Journalismus wird immer mehr zur<br />
Kommentierung von Marketing“<br />
Edward Bernays * hat 1928 einen „Klassiker“ vorgelegt, der heute noch ertrag reicher<br />
ist als zahllose „Standardwerke“ aus der Feder der PR-Meister der Gegen wart.<br />
Sein großer Kunstgriff besteht in der Gleichsetzung von ‘Propaganda’ und ‘PR’.<br />
In einer fast schonungslos-naiven Art entziffert er Schritt um Schritt die PR als<br />
Führungsinstrument demokratischer Öffentlichkeit. Mit seinen nüchternen Analysen,<br />
klugen Fallbeispielen und seinem elitären Habitus richtet er den Lichtkegel<br />
in eine Schattenwelt, die eigentlich von der Intransparenz lebt. Viele seiner Analyse-Bausteine<br />
lassen sich auf den Journalismus unserer Zeit beziehen, der mit<br />
seinen bestellten Wahrheiten zu einem verkrüppelten Journalismus beiträgt.<br />
Die PR-Blaupause der Atomkonzerne<br />
Es gibt Schlüsseldokumente, die belastbar und gerichtsfest sind. Dokumente, die<br />
das wahre Gesicht einer Branche zeigen, die sich gerne diskret und seriös gibt,<br />
mit der Aura nüchterner Argumente und überprüfbarer Fakten schmückt. Es geht<br />
um die Atomenergie-Lobby, die mit der 109-seitigen Studie „Kommunikationskonzept<br />
Kernenergie – Strategie, Argumente und Maßnahmen“ der Öffentlichkeit<br />
eine einmalige Blaupause ihrer bislang verborgenen Praxis und ihrer wahren<br />
Identität geliefert hat.<br />
* Edward Bernays, Propaganda, Neuauflage 2011, Orange Press, Freiburg. Wir danken dem Autor für die Abdruckgenehmigung.<br />
(Die Redaktion)<br />
148
Wer den bislang geheim gehaltenen DNA-Code der Energie-Lobby entziffern und<br />
die Manipulationstechniken dieser Branche verstehen will, ist nicht mehr auf<br />
Sekundärinformationen angewiesen. Diesen Kollateralnutzen hat die Berliner<br />
„Unternehmensberatung für Politik- & Krisenmanagement“ (PRGS) mit ihrer<br />
„Studie“ der Öffentlichkeit beschert. „Gespräche wurden durchgeführt u.a. mit<br />
Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, des Handelsblattes, der Wirtschaftswoche<br />
und der Welt“, schreiben die Autoren der ungewöhnlich detaillierten<br />
Geheim-Studie. „Selbstverständlich wurden diese Gespräche ohne Nennung<br />
(des Auftraggebers) oder des Auftrags geführt.“ Offenbar auch mit Hilfe<br />
dieser Quellen wurden 16 Redakteure der zentralen Leitmedien politisch genau<br />
taxiert und auf der ‘links-rechts-Achse’ eingeordnet. „Lediglich die Welt nimmt<br />
mit Daniel Wetzel als schwarz-grünem Redakteur eine vermittelnde Position zwischen<br />
den Lagern wahr,“ heißt es anerkennend. Warum der Aufwand? Diese<br />
einfache Frage wird von den Lobby-Experten später in entwaffnender Offenheit<br />
beschrieben: „Grundlage des Lobbyings ist fundiertes Material. Politiker bevorzugen<br />
wie Journalisten quellenbasiertes Informationsmaterial, das die Neutralität<br />
der Information suggeriert.“ Die Betonung liegt auf Suggestion, auf dem<br />
Schein der Seriösität, der Anmutung von Wahrheit. In der Studie wird das<br />
gesamte Spektrum der modernen PR und der auf Manipulation gegründeten<br />
Kooperation mit den Medien durchbuchstabiert: gekaufte und frisierte Studien<br />
mit wissenschaftlichem Antlitz, manipulierte Umfragen, Argumentations-Leitfäden,<br />
die Gegenargumente ausblenden und Werbebotschaften priorisieren,<br />
Nega tive Campaigning-Strategien gegen Atomkraft-Kritiker und Jubelbeiträge für<br />
die Förderer der Atomenergie. Das Leistungsversprechen der Autoren für die<br />
Auftraggeber (offenbar die E.on AG), rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2009)<br />
im November 2008 ist kristallklar: „Die Ergebnisse von IfD (Anm. Institut für<br />
Demoskopie Allensbach), Emnid u.a. legen daher immer den Schluss nahe,<br />
dass allein ein Regierungswechsel ausreichen würde, um die Stimmung in<br />
Deutschland pro Kernenergie zu drehen.“<br />
Es handelt sich folglich um ein einmaliges Dokument, das – wie Branchenkenner<br />
bestätigen – allerdings auch in ähnlicher Form als „Maske“ exemplarisch<br />
149
für andere PR-Akteure gilt. Würde Bernays heute reformuliert, müsste die PRGS-<br />
Blaupause seine Sammlung von Fallbeispielen ergänzen. Strategische Leitmotive<br />
von den auf PR spezialisierten Agenturen wie PRGS sind bezogen auf die<br />
Medien folgende Punkte:<br />
• Themen und Positionen – wie im skizzierten Fall die langfristige Laufzeitgarantie<br />
für Atomkraftwerke – werden in Form der sogenannten „orchestrierten<br />
Kommunikation“ in der Öffentlichkeit verankert.<br />
• Semantisch positiv aufgeladene Begriffe und Fahnenwörter wie etwa „Kernenergie<br />
als Brückentechnologie“, eingebettet in das Konzept der „Nachhaltigkeit“,<br />
sollen über die Medien etabliert und verankert werden. Die CDU<br />
nutzt beispielsweise den von der AKW-Lobby erfunden Begriff der „Brückentechnologie“<br />
in ihrer Programmatik.<br />
• Ausgewählte Journalisten und Medien werden mit „bestellten Wahrheiten“<br />
versorgt; sie erhalten frisierte (wissenschaftliche) Studien, passende Meinungsumfragen,<br />
getürkte Statistiken, von PR-Agenturen geschriebene Texte,<br />
Interviews und Meinungsbeiträge etc. Das Spektrum dieser Dienstleistungen<br />
und Informations-Rohstoffe ist schier unbegrenzt. Dazu gehört auch die Vermittlung<br />
von sogenannten „Experten“, die als „Mietmäuler“ einsetzbar sind.<br />
• Medien-Kritiker werden mit allen denkbaren Methoden des negative campaignings<br />
überzogen, diffamiert und disqualifiziert. Ihre Reputation soll<br />
beschädigt werden.<br />
• Blogs, web-Seiten und andere „social media“-Plattformen werden von PR-<br />
Dienstleistern – wie im Fall der Bahnprivatisierung dokumentiert – gezielt<br />
instrumentalisiert und manipuliert.<br />
• Verbände und Organisationen, die sich im Feld des jeweiligen PR-Themas<br />
bewegen, werden mit großem Aufwand auf ihre Korruptionsanfälligkeit hin<br />
getestet und entsprechend instrumentalisiert.<br />
• Diese Aktivitäten werden von den Auftraggebern in einem „eisernen Dreieck“<br />
gesteuert. Dazu gehören sogenannte „Public Affairs Agenturen“ und PR-<br />
Agenturen, die ihre Arbeit nach journalistischen Kriterien ausrichten und<br />
selten Spuren hinterlassen. Affirmative Medien und kühle Lobbyisten bilden<br />
150
und stabilisieren dieses Dreieck. Der Wechsel sehr erfahrener journalistischer<br />
Profis in die PR unterstreicht diesen organischen Prozeß der Professionalisierung<br />
der Branche. Enge Kooperationsbeziehungen bestehen zu Lobbyorga<br />
nisationen und geneigten Politikern.<br />
• Der Handel mit sogenannten „Exklusiv-Informationen“ floriert. Agenturfähige<br />
Informationen werden gegen Wohlverhalten getauscht. Gute Informanten<br />
leben – sozusagen als Gegenleistung – in einer medialen Schonzone. Es gilt<br />
der Grundsatz: „In die Hand, die mich füttert, beiße ich nicht.“<br />
Blaupause für die Manipulation der Medien<br />
All diese Techniken werden in der PRGS-Studie exemplarisch durchgespielt, analysiert<br />
und auf ihre potentielle Wirkung hin ausgewertet. Edward Bernay konnte 1928<br />
dieses Arsenal der PR-Industrie noch nicht beschreiben. Zwischen den (geschönten)<br />
Zeilen seines Propaganda-Buches finden sich aber die argumentativen Muster<br />
der skizzierten „Handwerksordnung“ der professionellen PR fast 100 Jahre später.<br />
Sein professionelles Handwerk gibt PRGS-Geschäftsführer Thorsten Hofmann<br />
künftig in der „Quadriga Hochschule“ in Berlin weiter. Das Tochterunternehmen<br />
der Deutschen Presseakademie (depak) bietet seit April <strong>2010</strong> eine 18-monatige<br />
PR-Ausbildung als berufsbegleitendes Studium in Berlin an (Studiengebühren<br />
bis zu 26.000 Euro, vgl. www.Quadriga.eu). Hofmanns Qualifikationsnachweis<br />
ist offenbar die PRGS-Studie. Der Perfektionist der PR-Manipulationen „verantwortet<br />
innerhalb des Fachbereichs Politics & Public Affairs der Quadriga Hochschule<br />
den kontinuierlichen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis“. Ausgerechnet<br />
die Vorsitzende von Transparency International (TI), Edda Müller, agiert<br />
bei Quadriga ebenfalls als Abteilungsleiterin und optimiert so die Qualifikation<br />
künftiger Lobbyisten und PR-Akteure. Dabei kann der Atom-Berater sich auf<br />
einen renommierten Beirat exponierter Vertreter deutscher Leitmedien verlassen.<br />
Das heißt: Chefredakteure und Generalsekretäre – sogar aus der ARD – assistieren<br />
dem ausgewiesenen PR-Experten Thorsten Hofmann dabei, wie mit den<br />
dokumentierten Manipulations-Techniken die Öffentlichkeit künftig hinter die<br />
Fichte geführt werden kann. Ob diese Beirats-Tätigkeit von renommierten Chef-<br />
151
edakteuren und sogar ARD-Generalsekretären mit den gültigen Staatsverträgen<br />
und den Kodizes der Qualitätsmedien in Einklang zu bringen ist, mögen Justi tiare<br />
und öffentlich-rechtliche Kontrollgremien entscheiden.<br />
In den WDR-Richtlinien für eine unabhängige Wirtschaftsberichterstattung heißt<br />
es eindeutig: „Wir überprüfen alle Themenvorschläge und Beiträge kritisch auf<br />
mögliche PR und Schleichwerbung.“ Der verbindliche Verhaltenskodex für NDR-<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist noch klarer: „Wir nutzen unsere NDR-Tätigkeit<br />
nicht für kommerzielle PR, unangemessen hoch dotierte Nebentätigkeiten<br />
oder andere private Vorteile.“<br />
Die Methoden des führenden Lehrpersonals der Quadriga-Hochschule sind<br />
aktenkundig (www.quadriga.eu). Dass prominente Journalisten aus der ersten<br />
Reihe der Leitmedien diese Methoden, die die Pressefreiheit und die Leitwerte<br />
eines unabhängigen Journalismus faktisch aushöhlen, auch nur tolerieren, ist<br />
sehr bedenklich. Ein erfahrener WDR-Feature-Redakteur der renommierten Sendung<br />
„die story“ wurde jüngst entlassen, weil er sich mutmaßlich vor den PR-<br />
Karren eines Salbenherstellers spannen ließ. Anfang 2011 gewann der Redaktuer<br />
vor dem Arbeitsgericht. Eine drakonische Strafe, die für den WDR sicher<br />
Maßstab für vergleichbare Fälle auf höherer Ebene sein wird.<br />
Journalisten und PR – ein Cocktail aus Naivität und Gewöhnung<br />
Journalismus unter Kosten- und Zeitdruck ist heute immer öfter die verlängerte<br />
Werkbank professioneller PR-Strategen und Marketingabteilungen. Dankbar<br />
nehmen die Medien die Themen und Stories auf, die andere „Redakteure“ in<br />
professionellen PR-Agenturen konzipieren, komponieren und konfektionieren.<br />
Viele Journalisten kommen offenbar auch ohne originäre Informanten aus.<br />
„80 Prozent der Journalisten haben gar keinen echten Informanten – sie glauben,<br />
der Pressesprecher sei ein Informant.“ Diese nüchterne Lageeinschätzung von<br />
Kuno Haberbusch (NDR) (WAMS, 11.6.2008), mit der Textzeile „Redaktionsleiter<br />
von Zapp kritisiert die Faulheit deutscher Journalisten“ zugespitzt, rührte eigentlich<br />
an ein Tabu. Aber die pointierte These provozierte keine Gegenreaktionen;<br />
152
offenbar gab es gar keinen Anlaß für ein Dementi. Haberbusch weist auf Missstände<br />
im Journalismus hin, die auch der Medienforscher Lutz Hachmeister bei<br />
der Wächterpreis-Verleihung der „Stiftung Freiheit der Presse“ in Frankfurt in<br />
einer wegweisenden Rede analysiert hat. Qualitäts-Journalismus müsse unabhängig<br />
von Ökonomie sein, unabhängig von Public Relations und den Standpunkten<br />
der eigenen Medienunternehmen. Guter Journalismus für alle Medien<br />
beruhe auf den „vier Faktoren Zeit, Geld, Recherche und Stil“ (dpa, 7.5.08). Weiter<br />
führte Hachmeister aus: Die „ungesunden Beschleunigungstendenzen im<br />
Online-Journalismus“ seien fühlbar, „auch die verschärfte Konkurrenz um<br />
Pseudo-Nachrichten in der Hauptstadt, wo die wirklich entscheidenden politischen<br />
und legislativen Prozesse, die sich auf der Ebene von Ministerialbeamten<br />
und Lobbyisten abspielen, zu selten reportiert werden“.<br />
Zu den Säulen „Zeit, Geld, Recherche, Stil“ müsste eigentlich auch noch das<br />
Kriterium „Distanz“ hinzukommen. Denn immer häufiger verarbeiten (und veredeln)<br />
Journalisten nur noch die Stoffe, die PR-Ingenieure, Pressesprecher, interessengeleitete<br />
Lobby-Informanten und Marketingabteilungen erfinden und<br />
dosiert weitergeben. Jürgen Leinemann mahnte schon vor einigen Jahren, dass<br />
die größte Korruptionsgefahr im Journalismus von Informanten ausgehe, denen<br />
man auf Grund der zuverlässigen Liefer-Beziehung nicht mehr mit der gebotenen<br />
Distanz begegne. In unserer „cross-medialen Hochgeschwindigkeits-Welt“<br />
wächst der Einfluß dieser oft anonymen Informanten. Wächst die Macht von<br />
Rohstofflieferanten, die fertige Geschichten, frisierte Statistiken und das dazu<br />
passende „wording“ (kostenfrei) in die redaktionellen Kreisläufe der Medien<br />
einspeisen. In diesem System arbeiten immer mehr Journalisten als secondhand-Produzenten<br />
von Medienprodukten aller Art. Immer mehr große Geschichten<br />
werden „kalt“ am Arbeitsplatz mit Material aus dem Fundus oder der Gedankenwelt<br />
der PR- und Lobbyindustrie geschrieben, ohne nur einmal mit einem der<br />
beschriebenen Akteure selbst zu sprechen oder ihre wahren Quellen anzugeben.<br />
Diese Reduzierung auf die ‘Kommentierung von Marketing’ ist weiter verbreitet,<br />
als Journalistenverbände, Kommunikationswissenschaftler, Redaktionsleiter und<br />
Presseräte ahnen wollen. Bernays setzt sich in seinem Buch zynisch von „inves-<br />
153
tigativen Journalisten“ ab. Dazu gibt es heute kaum mehr einen Grund. Es gilt die<br />
vereinfachte Faustformel: Je stärker die PR, umso schwächer der Journalismus.<br />
Inszenierte Exklusivität durch privilegierte PR-Information<br />
Im so genannten ‚Visa-Untersuchungsausschuss’ gegen Joschka Fischer wurde<br />
beispielsweise die Instrumentalisierung der Medien zur Perfektion getrieben. Im<br />
Hintergrund bündelte ein hoch-professioneller und medienerfahrener Mitarbeiter<br />
der CDU/CSU-Fraktion (der heute wieder prominenten Hauptstadtjournalismus<br />
betreibt), die gesamte Pressearbeit. Er führte Journalisten mit seinen Informationen<br />
wie Marionetten und steuerte die Kommunikation gegen Fischer nach „journalistischen<br />
Kriterien“. Sein Erfolgsrezept: er bediente ein führendes Medium<br />
mit den sorgfältig ausgesuchten Dokumenten und steuerte so den Exklusivitätsstrom.<br />
Die so bediente Tageszeitung konnte dann stets mit „Exklusivrecherchen“<br />
aufwarten und die Agenturen entsprechend versorgen. Dieser Kreislauf funktionierte<br />
perfekt, vernebelte den eigentlichen Absender der Botschaften und verlagerte<br />
die Auseinandersetzung vom Parlament in die Medien-Arena. Dieses PR-<br />
Modell hat sich mittlerweile bei nahezu allen Strippenziehern in parlamentarischen<br />
Untersuchungs-Ausschüssen, aber auch bei anderen ‘gesetzten Informationen’<br />
herumgesprochen. Selektiv gefilterte Informationen aus den Akten werden<br />
selektiv weitergegeben, um geadelt mit dem „Stempel exklusive Recherchen“<br />
den Weg über die Nachrichtenagenturen in eine breite Medien öffentlichkeit zu<br />
finden.<br />
Dieser zentrale Lehrsatz der PR-Industrie war 1928 offenbar noch nicht so präsent.<br />
Bernays führt dieses Premium-Prinzip – das spurenfreie Eindringen in journalistische<br />
Kreisläufe – jedenfalls nicht aus. Auch frühere Untersuchungsausschüsse<br />
– etwa zur CDU-Spendenaffaire – wurden mit detailliert abgestuften Hintergrund -<br />
runden für ausgewählte Journalisten unterfüttert und gelenkt. Im Lichte dieser<br />
gängigen Praxis wirkt dieses publizistisch aufgeblasene ‚Ermittlungsverfahren’<br />
in der Rückschau etwas sonderbar. Ein Lehrstück im Fach ‚negative campaigning’<br />
und politischer Doppelmoral. Die gezielte Instrumentalisierung der Medien im<br />
Umfeld des „Visa-Untersuchungsausschusses“ könnte als Lehrbeispiel für mo -<br />
154
dernes agenda setting, gezielte Skandalisierung und professionelles negative<br />
campaigning gelten. Nicht immer verläuft der Kommunikationsprozeß so idealtypisch.<br />
Aber dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die Thema tisierungs-Chancen<br />
von „spin-doctors“ und „Pressesprechern“ im politischen Journalismus. Viele<br />
PR-Dienstleister, Lobbyisten und Kommunikationsexperten haben sich in Berlin<br />
auf dieses Fach spezialisiert. Immer wieder wird die Öffentlichkeit mit kleineren<br />
und größeren „Skandalen“ versorgt. Aus erfolgreichen Kampagnen dieser Art<br />
wächst die Stabilität des „eisernen Dreiecks“.<br />
Reputations-Vernichtung durch negative campaigning der PR-Industrie<br />
Einzelne PR-Agenturen und Lobbyisten haben sich mittlerweile darauf spezia lisiert,<br />
relevante Medien mit negativen Informationen im Sinne ihrer Auftraggeber<br />
zu füttern. Marktvorteile im politischen Wettbewerb erreicht man heute wohl<br />
nicht zuerst mit klugen Ideen und ausgereiften Konzepten, sondern eher durch<br />
die Verbreitung von ‚heiklen’ oder reputationsschädigenden Informationen über<br />
die zu attackierenden Akteure. Kurt Beck machte beispielsweise die Strippenzieher<br />
„aus der zweiten Reihe“ für seinen Sturz vom SPD-Vorsitz verantwortlich.<br />
Ende Dezember <strong>2010</strong> berichtete die Süddeutsche Zeitung von Aktivitäten der<br />
Landes-CDU, die vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl das Privatleben des<br />
Ministerpräsidenten von einem „investigativen“ Journalisten ausspähen ließ.<br />
Dieser beschaffte immerhin Becks Patientendaten, Steuer-Informationen und<br />
andere intime Details aus seinem Privatleben. Erinnerungen an Barschels Praktiken<br />
scheinen wieder auf.<br />
Andrea Ypsilanti konnte die „Wortbruch-Kampagne“ und die zum Teil infamen<br />
Angriffe auf ihre Person und ihr Privatleben nicht überstehen. Ihr wurde ein<br />
„Tricksilanti-Image“ zugeschrieben, das von einzelnen Medien offensiv propagiert<br />
wurde. In der Politik steht das Wachstums-Modell ‚negative campaigning’,<br />
inszeniert von PR-Agenturen oder professionellen ‚Gegner-Beobachtern’, in<br />
einem Konjunktur-Hoch. Ein führender PR-Dienstleister brachte den Kaufmann<br />
Harald Christ, 2009 Mitglied für das Wirtschaftsressort im Schattenkabinett von<br />
Frank Steinmeier (SPD), gezielt in die Nähe von pädophilen Aktivitäten. Die<br />
155
15-seitige Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Münster vom 25.2.<strong>2010</strong> ist ein<br />
atemberaubendes Dokument krimineller Rufzerstörung. Der PR-Profi Norbert H.<br />
Essing hatte demnach nichts unversucht gelassen, den Ruf seines früheren<br />
Kunden zu zerrütten. Bereits in früheren Bundestagswahlkämpfen wurden<br />
wichtige ‚Kampagnen-Themen’ von den Parteien über ausgewählte Journalisten<br />
erfolgreich in die Medien geschleust. Edmund Stoibers Entgleisungen gegenüber<br />
den undankbaren Ostdeutschen wurden etwa von der SPD-Gegnerbeobachtung<br />
mit Hilfe von vermeintlich neutralen ‚Informanten’ erfolgreich in die Öffentlichkeit<br />
geschleust. Was später als „Recherche“ der Medien spektakulär präsentiert<br />
wird, ist oft nur professionell gesteuerte Kommunikation über eine simple Zulieferung.<br />
In Bernays Buch „Propaganda“ steht wenig zu diesen schmutzigen Tricks;<br />
Tendenzen in diese Richtung gab es aber schon damals. PR wird von Bernay als<br />
saubere Disziplin schöngeschrieben; über „schwarze PR“ erfährt man nichts.<br />
In dieser dunklen Disziplin gelten folgende Arbeitsprinzipien. PR-Spezialisten<br />
suchen sich professionelle Informanten, ‚ihre Journalisten’ und ‚ihr Medium’<br />
aus. Der potentielle Wirkungshorizont einer ‚Geschichte’, die Mechanik ihrer<br />
Verwertung, die Garantie der Anonymität, langjähriges Vertrauen in einem Geschäft<br />
von „Geben und Nehmen“ sind nur einige Kriterien, die diese Zusammenarbeit<br />
prägen. Die Faustregel lautet: Je relevanter das Informanten-Material, umso<br />
gezielter wird das „passende Medium“ ausgesucht, das mit Sicherheit „Exklusivmeldungen“<br />
(an nachrichtenarmen Wochenenden) generieren kann. Denn darauf<br />
kommt es an: Parteien, Ministerien, Regierung und Opposition, aber auch<br />
NGO’s haben gelernt, das nicht sie selbst eine „relevante“ Information veröffentlichen<br />
sollten. Der Umweg über eine Exklusiv-Geschichte einer namhaften<br />
Zeitung oder eines Magazins stimuliert den Medien-Hype wesentlich intensiver.<br />
PR-Manipulation über Pseudo-Experten<br />
Die Problematik von (vermeintlichen) Experten als Quellen wird unter Journalisten<br />
oder von professionellen Medienbeobachtern aus der Kommunikations -<br />
wissenschaft systematisch ignoriert. Zu diesem auch von der Medienkritik ignorierten<br />
journalistischen Tabu-Thema gibt es eine hoch interessante interne<br />
156
Anleitung der Nachrichtenagentur AP zum „Umgang mit Quellen“ (AZ: FH/Letzte<br />
Aktua lisierung 02.10.2006). Hier werden alle Mitarbeiter auf die Regeln bei der<br />
Quel lenprüfung, auf die Problematik von blogs und Quellen im www, auf die<br />
Quellenaufbewahrung und Quellenhinweise aufmerksam gemacht. Besonders<br />
aufschlussreich ist das Kapitel ‚Experten/Schwarze Liste’. In dem nicht öffentlichen<br />
Dokument heißt es: „In dieser – bislang noch sehr unvollständigen – Liste<br />
aufgeführte Experten oder Institutionen haben uns aus unterschiedlichen Gründen<br />
schon Probleme bereitet und werden daher in der AP-Berichterstattung nicht<br />
berücksichtigt. Alle AP-Mitarbeiter, die schlechte Erfahrungen mit Experten/<br />
Institutionen gemacht haben, mögen diese bitte per Mail an (...) mailen, damit<br />
wir sie ggf. in diese Liste aufnehmen können.“ Nur zwei Fallbeispiele: „Geheimdienste:<br />
Udo Ulfkotte (nicht unumstrittener Geheimdienstexperte, der inzwischen<br />
auch als ddp-Mitarbeiter firmiert und damit für uns endgültig nicht mehr in Frage<br />
kommt). Gesundheit: Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik<br />
(DIET) (betreibt sehr geschickt verdeckte Produkt-PR; wurde vor zwei Jahren von<br />
der ‘SZ’ als unseriös enttarnt.“ Die interne Liste der Nachrichtenagentur AP ist<br />
eine sehr wertvolle Quelle. Gleichwohl müssten nicht nur die großen Nachrichtenredaktionen<br />
diese Sensibilität pflegen, wenn interessengebundene ‚Rentenexperten’,<br />
‘Börsenexperten’ oder ‚Automobilexperten’ die jeweilige Marktlage<br />
aus ihrer PR-Perspektive erklären. Journalisten suchen sich oft „ihre“ Experten<br />
aus und benutzen sie als „inneres Geländer“ für ihre Story. Eine Prüfung der tatsächlichen<br />
Kompetenzen und Interessen-Verfilzung ist die seltene Ausnahme.<br />
Ein Experte ist heute schon ein Experte, wenn die Medien ihn zum Experten gemacht<br />
haben. Nicht selten spielen auch die permanente Verfügbarkeit des jeweiligen<br />
Experten und dessen sprachliche und intellektuelle Anpassungsleistung<br />
an die (reduzierte, vereinfachende) Erwartungshaltung des jeweiligen Mediums<br />
eine zentrale Rolle.<br />
Die schleichende Veränderung der Nachrichtenfaktoren begünstigt den Zugriff<br />
der PR-Industrie auf die Medien<br />
„Gesprächswert“ ist heute in den meisten Medien wichtiger als der klassische<br />
„Nachrichtenwert“ eines Themas. Skandalisierung, Personalisierung und Visua-<br />
157
lisierung sind heute nahezu unschlagbare Nachrichtenfaktoren, die selbst seriöse<br />
Nachrichtenagenturen nicht mehr ausblenden können. In diesem Zusammen hang<br />
werden der Öffentlichkeit zunehmend Legenden wie die angebliche „online first-<br />
Strategie“ mancher Verlage präsentiert. Selbst gestandene Nachrichtenredakteure<br />
protestieren nicht, wenn sie die news nicht mehr nach den klassischen<br />
Relevanzkriterien, sondern nach den thematischen Bedürfnissen ihrer „Kunden“<br />
auswählen, texten, redigieren und platzieren. Brennpunkte und Themenschwerpunkte<br />
gibt es, wenn der Winter mal ein echter Winter ist, nicht aber zur gezielten<br />
Manipulation der Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Einmal durch Wiederholung<br />
gelernte und mit einer einfachen Story verkaufte Skandale beschäftigen<br />
die Medien oft monatelang. Geschichten im Umfeld von Amtsmissbrauch und<br />
Korruption werden jedoch selten von Journalisten ‚ausgegraben’, sondern oft von<br />
gut präparierten Informanten auf die agenda ‘gesetzt’. Alle Belege und Fakten zu<br />
Rudolf Scharpings verhängnisvoller Verbindung mit dem Waffen-Lobbyisten und<br />
PR-Mann Moritz Hunzinger wurde zunächst dem Spiegel offeriert; erst danach dem<br />
Stern, für den sich der Informations-Deal schließlich auszahlte. Ernst Weltekes<br />
(Ex-Bundesbank) Adlon-Ausflug zur Euro-Taufe mit familiärer Entourage wurde<br />
von seinen Konkurrenten und einstigen Weggefährten im Finanzministerium mit<br />
Hilfe von Kopien der Rechnungsbelege skandalisiert. Auch im Fall der RWE-Lobbyisten<br />
Laurenz Meyer und Hermann-Josef Arentz kannten die professionellen<br />
Informanten die Grammatik der neuen Nachrichtenfaktoren und bauten auf geschicktes<br />
timing, kalkuliertes Dementi, dosierte Materialergänzung – und schließlich<br />
den öffentlichen Abgang. Die Dramaturgie solcher Exit-Prozesse planen PR-<br />
Profis präzise am Reißbrett.<br />
Passivität der PR-Verbände<br />
Oft wird in solchen Fällen – auf Empfehlung von PR-Beratern – mit großem Aufwand<br />
versucht, die ‚Nestbeschmutzer’ (Informanten) zu finden, um die undichten<br />
Löcher zu schließen. Im Fall Florian Gerster, einst Chef der Bundesagentur für<br />
Arbeit (BA), lancierten interessierte Referenten sogar einen FAZ-Artikel. Ganz<br />
unverhohlen wurde die frühere stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-<br />
Kefer an den Informanten-Pranger gestellt: „Die Hauptverdächtige Engelen-Kefer<br />
158
ist unterdessen auf Tauchstation ...“, hieß es lakonisch. (FAZ 29.11.2003). Die<br />
Medien veröffentlichten in diesem Fall zwar das Material von Gersters Konkurrenten<br />
(und Nachfolger Weise), aber sie bohrten nicht nach: Die wirklichen Skandale<br />
um die freihändige Vergabe und mangelhafte Durchführung von millionenschweren<br />
Beratungs-Projekten der BA im IT-Bereich sind bis heute nicht aufgedeckt.<br />
Bei der Berichterstattung über Unternehmens-Skandale gibt es ein wesentliches<br />
Handycap. Einen Informations-Anspruch gegenüber Unternehmen gibt es für<br />
Journalisten nicht. Eigentlich ein Thema für die zahlreichen Berufsverbände der<br />
PR-Industrie, den Bundesverband der Pressesprecher oder den Deutschen Presserat.<br />
Aber auch Chefredakteure könnten sich gegen die als naturgegeben wahrgenommene<br />
Informationssperre wehren. Ähnlich wie bei der Kampagne zur<br />
„Autorisierungs-Zensur von Politiker-Interviews“ oder der Beschränkung von<br />
Promi nenten-Fotografen (‚Fall Caroline’) könnte die ‚Schweige-Zensur’ von<br />
betroffenen Unternehmen, Behörden und Pressestellen prominent thematisiert<br />
werden. Auffällig ist jedoch die Passivität etablierter Verbände, wenn es um die<br />
Negativ-Wirkungen der PR-Akteure auf den Journalismus geht. Die faktische Verschmelzung<br />
hat auch hier offenbar ihre Spuren hinterlassen.<br />
Agenda cutting als professionelle Disziplin der PR-Industrie<br />
Themen platzieren – das ist das Standbein der PR-Industrie. Themen zu verhindern,<br />
zu verzögern und zu blockieren – ist das Spielbein der Branche, die sich<br />
nur ungern in die Karten schauen lässt. Intern gilt die „systematische Informationsblockade“<br />
ohne Spuren zu hinterlassen als die „Königsdisziplin“ der PR-<br />
Branche. Wem es gelingt bereits ausgereifte Recherchen zu verhindern, Artikel<br />
geschmeidig und geräuschlos v o r ihrer Veröffentlichung zu entfernen, darf mit<br />
dem höchsten Respekt der Kollegen rechnen.<br />
Der überall gültige Informations-Ermittlungsanspruch leitet sich aus der Presseund<br />
Rundfunkfreiheit ab. Der Grundkonsens: „Die Presse erfüllt eine öffentliche<br />
Aufgabe. Insbesondere dadurch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet,<br />
Stellung nimmt, Kritik übt und auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt.“<br />
In fast allen Landespressegesetzen gibt es dementsprechend eine aus-<br />
159
drückliche Normierung: „Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der<br />
Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dienenden Auskünfte zu<br />
erteilen,“ heißt es etwa im § 4 Landespressegesetz NRW.<br />
Doch diese Auskunftspflicht der Behörden entwickelt sich in der Praxis immer<br />
mehr zu einer Farce. Ministerien und Behörden mauern immer dann, wenn es<br />
heikel wird. Die Ausnahmeregeln spulen die Pressesprecher auswendig ab:<br />
„Schwebendes Verfahren“, „Vorschriften über die Geheimhaltung“, „Datenschutz“<br />
oder „schutzwürdige Interessen“. Die Abschottung und die von manchen<br />
Ministerien – wie dem Gesundheitsministerium – sogar öffentlich eingeräumte<br />
‚Auswahl’ von Journalisten, die Informationen erhalten, amputiert<br />
gezielt die Pressefreiheit und züchtet einen ‚Generalanzeiger-Journalismus’, wo<br />
Pressesprecher als Füllfederhalter der Medien agieren. Diese Abschottungs-<br />
Techniken, verbunden mit der Androhung juristischer Maßnahmen gegen die<br />
Journalisten, gehören zum Dienstleistungsangebot von PR-Experten. Ein Beispiel:<br />
Immer wieder wurde die Öffentlichkeit zum Thema ‚NPD-Verbot’ gezielt<br />
desinformiert. Führende Politiker versuchen den Konflikt mit dem Bundesverfassungsgericht<br />
allein auf die Rolle der zahlreichen NPD-V-Leute zu reduzieren. Tatsächlich<br />
haben aber die beiden von den Innenministerien eingesetzten Arbeitsgruppen<br />
von Verfassungsschützern und Staatsrechts-Experten gewichtige<br />
andere Gründe gegen ein NPD-Verbot aufgelistet. In einem nicht öffentlichen<br />
Gutachten haben Staatsrecht-Experten die jahrelang abwartende, beobachtende<br />
Rolle der Politik kritisiert, die militante Gewaltbereitschaft der NPD in<br />
Frage gestellt und die hohen Hürden des Parteienverbots juristisch begründet.<br />
All diese Argumente wurden aus dem öffentlichen Diskurs ausgeblendet, auch<br />
weil die Behörden die fundierten, aber unbequemen Berichte der beiden Beratungs-Gremien<br />
nicht herausgeben. Der Fall „NPD-Verbot“ ist nur ein Beispiel<br />
einer zunehmenden Informations-Selektion von Politikern, Wirtschafts- und<br />
Behördenvertretern.<br />
PR-Desinformation durch Informationsverweigerung und gezielte Auslassung.<br />
Diese Technik funktioniert auch, weil zu viele Journalisten sich zu schnell von<br />
den Behörden abweisen lassen. Oft hilft in Konfliktfällen schon die Forderung<br />
160
einer schriftlichen Begründung für die Informations-Blockade. Solche Ablehnungen<br />
– die meist verweigert werden – könnten Journalisten sammeln und öffentlich<br />
machen. Dies wäre der wirksame Protest gegen die konsequente Informationsverhinderung<br />
von Pressesprechern, die sich – bis auf wenige Ausnahmen<br />
– allein den Gesetzen der PR verpflichtet fühlen.<br />
Denn ihr Bild von einer funktionierenden Presse ist ganz einfach. Die Medien sollen<br />
das veröffentlichen, was die Pressestellen ihnen mitteilen. Rückfragen überflüssig,<br />
Nachfragen unnötig. Das rheinland-pfälzische Innenministerium sieht<br />
Me dien so gar in der Rolle eines ausführenden Organs, wie ein entsprechendes<br />
Dokument zum Umgang der Polizei mit den Medien belegt. Wenn diese Praxis<br />
aber weiter kritiklos hingenommen wird, verkümmert die Auskunftspflicht der<br />
Behörden in rasantem Tempo und wird am Ende so praktiziert, wie – schon<br />
heute – die rigide Informationspolitik der Unternehmen. Offenbar verfahren<br />
auch Medienvertreter hier nach dem Motto des Broadway-Kolumnisten Walter<br />
Winchell, der den PR-Leuten aus dem Herzen sprach: „Zu viel Recherche macht<br />
die schönste Geschichte kaputt.“<br />
Der restriktive Umgang mit dem Informationsfreiheitsgesetz auf Bundes- und<br />
Landesebene illustriert zudem – bezogen auf das Informationsverhalten – das<br />
Klima des überholten Obrigkeitsstaates. Veröffentlicht wird nur das, was mit<br />
Hilfe der Ausnahmeregelungen nicht verhindert werden kann. Aber auch hier<br />
muss eingeräumt werden, dass nur wenige Journalisten – fünf Jahre nach Einführung<br />
des Gesetzes im Januar 2011 – an diesem Instrument der Informationsbeschaffung<br />
interessiert sind.<br />
Die Bequemlichkeits-Falle der „Churnalisten“ ist das soziale Kapital<br />
der PR-Akteure<br />
Nicht ausgeklammert werden sollte aber die naive PR-Abhängigkeit, die immer<br />
mehr Journalisten freiwillig eingehen. Diese Grundtendenz belegt eine hochinteressante<br />
Studie aus Großbritannien. Nick Davies, erfahrener Sonderkorrespondent<br />
der britischen Tageszeitung ‚The Guardian’, hat die britische Qualitäts-<br />
161
presse einem aufwändigem Test unterzogen. Seine Ergebnisse sind niederschmetternd<br />
und vielleicht eine Folie für deutsche Kommunikationswissenschaftler,<br />
die ähnliche Tendenzen in der deutschen Medienlandschaft bislang nicht erkennen<br />
konnten. „Ich war gezwungen mir einzugestehen, dass ich in einer korrumpierten<br />
Profession arbeite“, so das Fazit des 400-seitigen Werks mit dem Titel<br />
‚Flat Earth News’. Die Journalisten seien im „professionellen Käfig“ ihrer „Nachrichtenfabriken“<br />
gefangen und zu „Churnalisten“ verkommen. (nach ‘to churn<br />
out’ = auswerfen). Sie schrieben Pressemitteilungen oder Agenturmeldungen<br />
nur noch schnell um, ohne selbst nachzuforschen.<br />
Dieser Zustand mache die Massenmedien äußerst anfällig für die Verbreitung von<br />
Falschmeldungen, irreführenden Legenden und Propaganda. In seiner Buch-Re z-<br />
ension zitiert Henning Hoff in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (www.<br />
faz.net) schockierende Zahlen einer empirischen Untersuchung von 2000 Berichten<br />
(im Frühjahr 2006) der britischen Qualitätspresse. „Sechzig Prozent bestanden<br />
ausschließlich oder hauptsächlich aus PR-Material oder Berichten von Nachrichtenagenturen,<br />
die aber auch nur bei zwei Prozent als Quelle angegeben worden<br />
waren. (...) Nur zwölf Prozent der Texte ließen auf eigene Recherchen schlie ßen.“<br />
Die Ursache für diese Entwicklung – die wohl keine britische Spezialität ist – sieht<br />
Davis so: „Das Grundproblem ist, dass eine kommerzielle Logik die journalistische<br />
abgelöst hat.“ Nicht nur im online-Markt wird heute nicht mehr von Journalismus,<br />
sondern von ‚Geschäftsmodellen’ gesprochen. Journalismus als Wa re, die mit<br />
mög lichst geringem (personellem) Aufwand hergestellt werden soll? Nick Davies<br />
er schütternde Analyse endet mit einer bitteren Botschaft: „Ich fürchte, ich be schreibe<br />
nur den Tumor, der uns umbringt, ohne eine Therapie anbieten zu können.“<br />
Journalisten haben ein naives Verhältnis zu PR<br />
In fast keinem journalistischen Lehrbuch findet sich ein Kapitel zum Thema<br />
„PR“ und Journalismus, in dem die Motive und Methoden der florierenden Branche<br />
untersucht werden. Keine Warnungen, keine Hinweise, keine skeptischen<br />
Gedanken. Vielleicht liegt das daran, dass viele PR-Berater sich selbst als Journalisten<br />
sehen und möglicherweise sogar ihre Mitgliedsbeiträge an die gleiche<br />
162
„Gewerkschaft“ , den DJV oder dju in verdi, abführen. Die meisten Journalisten<br />
haben längst die „Vermittler- und Service-Rolle“ der PR-Agenturen akzeptiert,<br />
„verkaufen“ gerne weiter, was ihnen zuvor „verkauft“ wurde. Ein Ausflug auf<br />
die webseite von www.journalismus.com illustriert das naive Verhältnis vieler<br />
Journalisten gegenüber PR. Die hier aufgelisteten – von der PR-Industrie erfundenen<br />
– Journalistenpreise mag als Dokument dienen, wie Journalismus und PR<br />
zusammengewachsen sind.<br />
Die Kommunikationswissenschaft hat die Kolonialisierung und die Degenerierung<br />
des Journalismus durch PR-Systeme nicht einmal auf der wissenschaftlichen<br />
Tagesordnung. Dissertationen (der Druck wurde von der PR-Agentur<br />
fischerAppelt finanziert) mit dem Titel „Journalismus und Public Relations“ gipfeln<br />
in der bahnbrechenden Analyse, dass die PR und Journalismus „noch nicht<br />
existentiell aufeinander angewiesen“ sind. (Hoffmann, 2001: 239). Offenbar hat<br />
die Forschung in diesem Feld ein ähnliches Verhältnis zu ihrem Gegenstand,<br />
wie ein Atomphysiker von Preussenelektra zur Atomenergie. Diesem „wissenschaftlichen“<br />
Verständnis entspricht eine heikle Tendenz, die in Deutschland<br />
kritiklos hingenommen wird. An zahlreichen Universitäten und Fachhochschulen<br />
werden Journalismus u n d PR parallel gelehrt und in der Praxis trainiert.<br />
Die Verschmelzung zwischen PR und Journalismus wird hier institutionalisiert.<br />
Von einem eigentlich selbstverständlichen Trennungsgebot hat man sich hier<br />
schon lange verabschiedet. Auch die Studierenden scheint dies nicht zu stören:<br />
„Was mit Medien“ steht auf ihrem Plan.<br />
Nicht nur für den Schweizer Publizisten René Grossenbacher steht der publizistische<br />
Sieg der PR-Branche über den recherchierenden Journalismus bereits fest:<br />
„Das Public-Relations-System hat auf Kosten der Medien und der Journalisten<br />
gewonnen; dieser Trend wird anhalten.“ Fast zwei Drittel der Berichterstattung<br />
basieren auf „offiziellen Verlautbarungen, Pressekonferenzen, Pressemitteilungen<br />
und anderen PR-Quellen. Weil nur noch jeder zehnte Artikel aus journalistischer<br />
Initiative entstehe, so Grossenbacher, mutiere der Journalist zunehmend zum<br />
„Textmanager“, der sich „aufs Kürzen und oberflächliches Neutralisieren von<br />
Texten“ beschränke. Die viel beschriebenen Tendenzen im Journalismus – wie<br />
163
die Nutzwert-, Unterhaltungs- und Personalisierungs-Orientierung – fördern<br />
diese Entwicklung. Andere Zwänge des Medienbetriebs führen meist zu der<br />
Frage: „Lässt sich die Story rasch, unkompliziert und ohne großen Aufwand<br />
umsetzen?“ Bei der Beantwortung dieser Frage sind die helfenden Hände der<br />
PR-Referenten auf allen Ebenen gerne behilflich. Sie fungieren gleichsam als<br />
Informations-Lieferanten, als intellektuelle Sauerstoff-Oasen und (kostenlose)<br />
Stoff-Lieferanten für die Medien. PR-Experten werden immer häufiger zu den<br />
intellektuellen Kontaktbeamten, die Journalisten stets mit Rat und Tat zur Seite<br />
stehen. Dieser Tauschprozess – Materiallieferung auf der Basis von Wohlverhalten<br />
– hat mittlerweile eine derartige Dynamik erhalten, dass selbst PR-Mitarbeitern<br />
die Intensität der Entgrenzung „zu weit geht“.<br />
Ein wesentlicher, struktureller Vorteil der PR-Branche ist ihre noch wachsende<br />
Finanzausstattung. Das Instrument der wissenschaftlichen Auftragsforschung<br />
oder der kosmetischen Demoskopie wird beispielsweise gerne „eingekauft“,<br />
um die Medien so mit Nachrichten und „Fakten“ zu füttern. Nicht nur die Deutsche<br />
Bahn AG hat einen neuen Weg eingeschlagen. TV Sender werden mit fertigem<br />
„footage“-Material mit Bildern und O-Tönen ausgestattet. Gleichzeitig darf<br />
man auf keinem deutschen Bahnhof ungestört mit einem Kamerateam drehen.<br />
Nicht nur vom privaten Hörfunk werden „fertige Hörfunkbeiträge“ aus den PR-<br />
Werkstätten ohne Hinweis auf die Quelle des kostenfreien Journalismus gesendet.<br />
Wie sich dieses System in der Fernsehpraxis auswirkt, hat der HR-Redakteur<br />
Ingo Nathusius analysiert. Distanzlosigkeit, Faulheit, derangierte Berufsauffassung<br />
und die soziale Nähe sind demnach die Grundlagen für die Manipulations-<br />
Mechanismen, auf die sich viele Journalisten einlassen. Wie perfekt das System<br />
von „Geben und Nehmen“ mittlerweile organisiert ist, beschreibt Nathusius an<br />
Hand von zahlreichen Praxisbeispielen. Doch die Mischung aus „Bilderwahn<br />
und Zeitdruck“ – sozusagen das Gleitmittel der bestellten Wahrheiten – kommt<br />
nicht ohne die Produzenten im schnellen Geschäft aus: „Es lockt wenig Dichter<br />
und Denker an. Eher mögen vorbehaltlose Einsatzfreude, Flexibilität, ein Hauch<br />
Oberflächlichkeit und eine Prise Eitelkeit vorherrschen. In solchen Strukturen ist<br />
das Bedürfnis nach Selbstkritik und Reflexion gering.“<br />
164
In einer Zeit, in der nach dem großen Boom die Berufsgruppe der Journalisten<br />
zunehmend mit Entlassungen und Niedriglöhnen zu kämpfen hat und PR-Unternehmen<br />
sich als Jobmaschinen anbieten, werden gewohnte Tabuzonen geöffnet,<br />
gelten bewährte Standards nicht mehr. Manche Privatsender müssten sich<br />
eigent lich als „Dauerwerbesendung“ etikettieren; denn immer häufiger wird auf<br />
kostenfreie Beiträge externer Anbieter zurückgegriffen. Journalismus im Gewand<br />
der PR. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass bestimmte Publikationen nicht<br />
für den Lesermarkt, sondern allein für den Anzeigenmarkt kreiert werden. Nicht<br />
selten liefern die Redaktionen das ansprechende Umfeld für die Werbung; zu<br />
diesem Zweck gibt es langfristige Beilagen-Planungen und kurzfristige Absprachen<br />
zwischen Redaktion und Anzeigen-Abteilung. Nicht wenige Verlage unterhalten<br />
noch eigene Konkurrenz-Blätter in ihrer Region, um einen ernsthaften<br />
publizistischen Wettbewerb zu unterbinden. In diesem Klima kann Public Relations<br />
wachsen, wie Champignons im warmen Treibhaus.<br />
Doch all diese Entwicklungen sind nur selten Thema der journalistischen Kritik.<br />
Mit wenigen Ausnahmen. Thomas Gierse von der Rhein-Zeitung beklagte die<br />
bedenklichen Tendenzen bereits im Almanach für Journalisten 2002. Sein pragmatisches<br />
Fazit: „Passives Hinnehmen solcher Trends, Kapitulieren vor den immer<br />
wieder neu formulierten Ansprüchen der PR-Macher muss dennoch nicht sein.“<br />
Medien folgen künftig dem „maximalen werblichen Gesamtnutzen“<br />
Der Kampf um Aufmerksamkeit der Kunden wird im Zeitalter der Reizüberflutung<br />
künftig wesentlich mit Hilfe von PR-Agenten ausgetragen. Die Ausgaben für klassische<br />
Werbung werden weiter abschmelzen. Sponsoring, Medienkooperationen,<br />
Sonderwerbeformen, PR in allen Varianten, Investitionen in social media und an -<br />
dere versteckte Werbeformen wachsen in rasanten Tempo. Ziel ist die möglichst<br />
„kreative inhaltliche und formale Vernetzung unterschiedlicher Werbeträger“,<br />
schrieb Annette Coumont („Spezialistin für vernetzte Kommunikationslösungen“)<br />
schon vor 10 Jahren in der WDR-Hauszeitschrift print (9/2002). „Ziel ist die Verzahnung<br />
von klassischen und nicht-klassischen Medien, um den maximalen<br />
werblichen Gesamtnutzen zu erreichen.“<br />
165
Die Verschmelzung von Journalismus und PR, von Werbung und anderen Kommunikationsangeboten<br />
ist der Megatrend, den Edward Bernays 1928 so noch<br />
nicht beschrieben hat. Den manipulativen Gehalt einer „dressierten Öffentlichkeit“<br />
konnte man allerdings aus der Fülle seiner Fallbeispiele herauslesen.<br />
Schafft sich der Journalismus als Anhängsel der PR selbst ab?<br />
Jürgen Leinemann, ein Urgestein des deutschen Politik-Journalismus, hat gefährliche<br />
Grundtendenzen im Medienbetrieb schon früh auf den Punkt gebracht:<br />
„Alles, was nach Drama aussieht, kommt gut an. Die Leute wollen Helden und<br />
Schurken, Richtig und Falsch.“ Diese Publikumswünsche werden von den PR-<br />
Spezialisten erkannt, die „Kunden“ entsprechend bedient. Dazu kommt die fast<br />
dominierende Haltung vieler Journalisten, mit ihren Rückfragen lediglich eine<br />
taktische Absicherung ihrer Hypothesen im Herdentrieb, des gerade gültigen<br />
mainstreams oder verbreiteter Vorurteile, vorzunehmen. Fundierte Sachanalysen<br />
und kompetente Einordnung von Fakten und Prozessen auf der Grundlage langjähriger<br />
fachlicher Beobachtung werden so zu seltenen Ausnahmen.<br />
Das heikelste Problem im Verhältnis von „PR und Journalismus“ ist die Ignoranz<br />
vieler Journalisten gegenüber den vom PR-System ausgehenden verdeckten<br />
Angriffen auf die Unabhängigkeit der Medien und der forcierten Gefährdung der<br />
journalistischen Profession. Gegen diese Abwehrhaltung ist (noch) kein Kraut<br />
gewachsen. Aber vielleicht kann man wirksame Gegenmittel empfehlen:<br />
Bernays Buch „Propaganda“.<br />
166
Die Dokumentationen<br />
nr-Werkstatt:<br />
Die Einsteiger<br />
nr-Werkstatt:<br />
Online-Journalismus<br />
nr-Werkstatt:<br />
Fact-Checking<br />
nr-Werkstatt:<br />
Werte und Orientierungen<br />
können kostenfrei gegen einen adressierten und<br />
ausreichend frankierten Rückumschlag (DIN C5, 1.50 Euro)<br />
beim netzwerk recherche bezogen werden.<br />
Bezugsadresse:<br />
netzwerk recherche e.V.<br />
Geschäftsstelle<br />
Stubbenhuk 10, 5.OG<br />
20459 Hamburg<br />
www.netzwerkrecherche.de<br />
infoπnetzwerkrecherche.de<br />
@
DIE JURY
169<br />
Sonia Seymour Mikich<br />
Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
Harald Schumann<br />
Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Berthold Huber
Sonia Seymour Mikich<br />
Geboren 1951<br />
Redaktionsleitung des ARD-Magazins Monitor<br />
Werdegang<br />
2004 - April 2007: Redaktionsleitung der ARD/WDR-Dokumentationsreihe „die story“<br />
Seit Januar 2002: Redaktionsleitung und Moderatorin des ARD-Magazins Monitor, WDR Köln<br />
1998 - 2001: Korrespondentin und Studioleitung des Deutschen Fernsehens in Paris<br />
1992 - 98: Korrespondentin des Deutschen Fernsehens in Moskau (ab 1995: Studioleitung)<br />
1982 - 84: Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk, Redakteurin und Reporterin<br />
1979 - 81: wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arnold-Gehlen-Forschungsgruppe am Institut<br />
für Soziologie an der RWTH Aachen. Freie Journalistin für Zeitschriften, Tageszeitungen und<br />
Aufsatzsammlungen<br />
1972 - 79: Studium Politologie, Soziologie und Philosophie an der RWTH Aachen mit<br />
Magisterabschluss Februar 1979<br />
1970 - 72: Volontariat bei der Aachener Volkszeitung<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Telestar als Beste Reporterin (1996); Bundesverdienstkreuz (1998); Deutscher Kritikerpreis für<br />
Auslandsberichterstattung (2001); Marler Fernsehpreis für Menschenrechte (2007); ASF-<strong>Preis</strong><br />
Rote Rose (2011)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Der Wille zum Glück. Lesebuch über Simone de Beauvoir, Reinbek 1986; Planet Moskau.<br />
Geschichten aus dem neuen Rußland, Köln 1998<br />
170
Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
Geboren 1953<br />
Ressortchef Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung<br />
Werdegang<br />
Seit 2011: Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung<br />
Seit 1995: Ressortchef Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung<br />
Seit 1988: Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Zunächst innenpolitischer Kommentator<br />
und innenpolitischer Redakteur mit Schwerpunkt Rechtspolitik<br />
1981 - 87: Richter an verschiedenen bayerischen Amts- und Landgerichten sowie Staatsanwalt<br />
Studium der Philosophie, der Geschichte und der Rechtswissenschaften. Erstes und Zweites<br />
Juristisches Staatsexamen, juristische Promotion, juristisches Referendariat. Parallel dazu<br />
journalistische Ausbildung<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Thurn und Taxis-<strong>Preis</strong> für die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (1982); Leitartikelpreis der<br />
Pressestiftung Tagesspiegel Berlin (1989); Pressepreis des Deutschen Anwaltvereins (1992);<br />
Geschwister-Scholl-<strong>Preis</strong> (1994); Kurt-Tucholsky-<strong>Preis</strong> (1996); Siebenpfeiffer-<strong>Preis</strong> (1998/99);<br />
Theodor-Wolff-<strong>Preis</strong> (2001); Rhetorikpreis für die Rede des Jahres 2004 der Eberhard-Karls-<br />
Universität Tübingen; Erich-Fromm-<strong>Preis</strong> (2006); Arnold-Freymuth-<strong>Preis</strong> (2006); Roman-Herzog-<br />
Medienpreis (2007); Justizmedaille des Freistaats Bayern (2009)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Kein schöner Land. Die Zerstörung der sozialen Gerechtigkeit, München 2005; Der Terrorist als<br />
Gesetzgeber. Wie man Politik mit Angst macht, München 2008<br />
171
Harald Schumann<br />
Geboren 1957<br />
Redakteur für besondere Aufgaben bei „Der Tagesspiegel“, Berlin<br />
Werdegang<br />
Seit 10. 2004: Redakteur „Der Tagesspiegel“ Berlin<br />
2003 - 04: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
2000 - 02: Ressortleiter Politik bei SPIEGEL ONLINE<br />
1992 - 2000: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
1990 - 91: Leitender Redakteur beim Ost-Berliner „Morgen“<br />
1986 - 90: Wissenschaftsredakteur beim SPIEGEL<br />
1984 - 86: Redakteur für Umwelt und Wissenschaft bei der Berliner tageszeitung, Studium<br />
der Sozialwissenschaften in Marburg, Landschaftsplanung an der TU Berlin, Abschluss als<br />
Diplom-Ingenieur<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Bruno-Kreisky-<strong>Preis</strong> für das politische Buch (1997); Medienpreis Entwicklungspolitik (2004);<br />
Gregor Louisoder-<strong>Preis</strong> für Umweltjournalismus (2007); „Das politische Buch“, Friedrich-Ebert-<br />
Stiftung (2009); „Der Lange Atem“, Journalistenverband Berlin-Brandenburg (<strong>2010</strong>)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Futtermittel und Welthunger, Reinbek 1986; Die Globalisierungsfalle (gemeinsam mit Hans-Peter<br />
Martin), Reinbek 1996; attac – Was wollen die Globalisierungskritiker? (mit Christiane Grefe und<br />
Mathias Greffrath), Berlin 2002; Der globale Countdown, Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung –<br />
die Zukunft der Globalisierung (gemeinsam mit Christiane Grefe), Köln 2008<br />
172
Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
Geboren 1959<br />
Inhaber der Rudolf Augstein Stiftungsprofessur für „Praxis des Qualitätsjournalismus“ (Uni Hamburg)<br />
Werdegang<br />
2005 - 2009: Verantwortlicher Redakteur von „epd medien“<br />
1997 - 2005: stellv. Ressortleiter „epd medien“<br />
Seit 1989: Redakteur beim Evangelischen Pressedienst (epd)<br />
1999: Lehrbeauftragter für Medienkritik und Medienjournalismus an der Universität Frankfurt/M.<br />
1996 - 98: journalistischer Berater und Autor der Wochenzeitung „DIE ZEIT“<br />
1988: Redakteur von „COPY“ (Handelsblatt-Verlag)<br />
1987: Dr. phil. in Germanistik der Universität-GH Siegen<br />
1983: Diplom-Journalist der Universität Dortmund<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Leipziger <strong>Preis</strong> für die Freiheit und Zukunft der Medien (2006); Nominierung zum Henri Nannen<br />
<strong>Preis</strong> in der Sparte „Bestes investigatives Stück“ (2006); „Fachjournalist des Jahres“ (2005);<br />
„Reporter des Jahres“ (2005); „Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen“ der Journalistenvereinigung<br />
„netzwerk recherche e. V.“ (2004); zweiter <strong>Preis</strong> „Bester wissenschaftlicher Zeitschriftenaufsatz“<br />
der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft<br />
(DGPuK) (2004); „Besondere Ehrung“ beim Bert-Donnepp-<strong>Preis</strong> für Medienpublizistik (2002);<br />
Hans-Bausch-Mediapreis des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart (1997)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Professionalisierung der Medienaufsicht (Hrsg., Wiesbaden 2009); Literaturkritik als politische<br />
Lektüre, Am Beispiel der Rezeption der ,Ästhetik des Widerstands’ von Peter Weiss (Berlin 1988);<br />
Sendefertig abgesetzt. ZDF. SAT.1 und der Soldatenmord von Lebach (Berlin 2001); TV-Dokumentation<br />
„Der Giftschrank des deutschen Fernsehens“ 1994 auf VOX/DCTP.<br />
173
Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Geboren 1959<br />
1. Vorsitzender ‘netzwerk recherche e. V.’<br />
Werdegang<br />
Seit 2009: Moderator von „2+Leif“ (SWR)<br />
Seit 2001: Vorsitzender der Journalistenvereinigung netzwerk recherche e. V.<br />
Seit Januar 1997: Chefreporter Fernsehen beim SWR in Mainz<br />
Seit März 1995: Redakteur/Reporter beim SWR-Fernsehen<br />
Seit Mai 1985: fester freier Mitarbeiter beim Südwestrundfunk Mainz in den<br />
Redaktionen Politik, ARD Aktuell, Report u. a.<br />
1978 - 85: Studium der Politikwissenschaft, Publizistik und Pädagogik an der<br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Bis 1989: Promotion an der<br />
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt / Main<br />
Veröffentlichungen, u.a.<br />
Die strategische (Ohn)-Macht der Friedensbewegung. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen<br />
in den achtziger Jahren (Opladen 1990); Rudolf Scharping, die SPD und die Macht (zus. mit<br />
Joachim Raschke) (Reinbek 1994); Leidenschaft: Recherche. Skandal-Geschichten und Enthüllungs-<br />
Berichte (Hrsg.) (Opladen 1998); Mehr Leidenschaft: Recherche. Skandal-Geschichten und Enthüllungsberichte.<br />
Ein Handbuch zu Recherche und Informationsbeschaffung (Hrsg.) (Opladen 2003);<br />
Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland (Hrsg.) (Wiesbaden 2006); Beraten und Verkauft.<br />
McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater (Gütersloh 2007); 10. Auflage; Aktua -<br />
lisierte Neuauflage; (München 2008) (Taschenbuch); Angepasst und Ausgebrannt. Die Parteien<br />
in der Nachwuchsfalle (München 2009)<br />
174
Berthold Huber<br />
Geboren 1950<br />
Erster Vorsitzender der IG Metall und<br />
Präsident des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes (IMB),<br />
Vorsitzender des Verwaltungsrates der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Werdegang<br />
Seit 2007: Erster Vorsitzender der IG Metall<br />
2003 - 2007: Zweiter Vorsitzender der IG Metall<br />
1998 - 2003: Bezirksleiter für Baden-Württemberg<br />
1993 - 1998: Koordinierender Abteilungsleiter<br />
1991 - 1993: Abteilungsleiter<br />
ab 1990: Hauptamtliche Tätigkeit bei der IG Metall in Ostdeutschland<br />
1985: Studium der Geschichte und Philosophie an der Universität Frankfurt<br />
1978: Betriebsrats- und Gesamtbetriebsratsvorsitzender<br />
1971: Ausbildung zum Werkzeugmacher und Tätigkeit bei der Firma Kässbohrer<br />
(heute Evo-Bus) in Ulm<br />
Aufsichtsratmandate<br />
Audi AG, Ingolstadt (stellvertretender Vorsitzender); Siemens AG, München (stellvertretender<br />
Vorsitzender); Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart; Volkswagen AG, Wolfsburg (stellvertretender<br />
Vorsitzender)<br />
175
Daten und Fakten zum <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2010</strong><br />
Termine<br />
Bewerbungszeitraum 01.04. – 13.08.<strong>2010</strong><br />
Jury-Sitzung<br />
21.09.<strong>2010</strong> Frankfurt/Main<br />
<strong>Preis</strong>verleihung<br />
03.11.<strong>2010</strong> Berlin<br />
Eingereichte Bewerbungen 571<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 438<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> Spezial 52<br />
Newcomer-/Medienprojektpreis 55<br />
Recherche-Stipendium 26<br />
<strong>Preis</strong>gelder<br />
45.000 Euro (insgesamt)<br />
1. <strong>Preis</strong> 10.000 Euro<br />
2. <strong>Preis</strong> 5.000 Euro<br />
3. <strong>Preis</strong> 3.000 Euro<br />
Spezial-<strong>Preis</strong><br />
10.000 Euro<br />
drei Recherche-Stipendien<br />
je 5.000 Euro<br />
Newcomer-/Medienprojektpreis<br />
2.000 Euro<br />
<strong>Preis</strong>träger<br />
Medienprojektpreis<br />
Newcomerpreis<br />
Recherche-Stipendien *<br />
Alfons Pieper, freier Journalist<br />
Karin Prummer und Dominik Stawski, Volontäre<br />
1. <strong>Preis</strong> Carolin Emcke (DIE ZEIT)<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
Christoph Lütgert mit Redaktion<br />
„Panorama – Die Reporter“(NDR)<br />
3. <strong>Preis</strong> Markus Metz und Georg Seeßlen (Bayern 2)<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
Willi Winkler, freier Autor<br />
* Die Namen der <strong>Preis</strong>träger <strong>2010</strong> werden erst mit dem Abschluss der Stipendien öffentlich gemacht, damit der Erfolg<br />
der Recherche nicht gefährdet wird.<br />
176
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2009<br />
„Spezialpreis“<br />
2009 Christian Semler (freier Autor, taz)<br />
für seine Beiträge zu Demokratie und Bürgerrechten;<br />
Würdigung seines journalistischen Gesamtwerkes<br />
2008 Christian Bommarius (Berliner Zeitung)<br />
Gesamtwürdigung für Kommentare, Leitartikel, Meinungsbeiträge<br />
2007 Tom Schimmeck (freier Autor und Publizist)<br />
„Angst am Dovenfleet“ (taz, 30. Dezember 2006)<br />
2006 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2005 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
„1. <strong>Preis</strong>“<br />
2009 Marc Thörner<br />
„Wir respektieren die Kultur – Im deutsch kontrollierten Norden Afghanistans“<br />
(Deutschlandfunk, 6. Februar 2009)<br />
2008 Anita Blasberg und Marian Blasberg<br />
„Abschiebeflug FHE 6842“ (Die Zeit – Magazin Leben, Nr. 03/2008)<br />
2007 Michaela Schießl<br />
„Not für die Welt“ (Der Spiegel, 19/2007)<br />
2006 Redaktion „Der Tag“ (HR)<br />
für Radiobeiträge „Der Tag – hr2“<br />
2005 Marcus Rohwetter<br />
„Ihr Wort wird Gesetz“ (Die Zeit, 6. Oktober 2005)<br />
„2. <strong>Preis</strong>“<br />
2009 Ulrike Brödermann und Michael Strompen<br />
„Der gläserne Deutsche – wie wir Bürger ausgespäht werden“<br />
(ZDF, 7. April 2009)<br />
2008 Jürgen Döschner<br />
„Fire and Forget – Krieg als Geschäft“ (WDR 5, 21. März 2008)<br />
2007 Ingolf Gritschneder<br />
„Profit um jeden <strong>Preis</strong> – Markt ohne Moral“ (WDR, 28. Februar 2007)<br />
177
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2009<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
2006 Frank Jansen<br />
Gesamtwürdigung für Langzeit-Reportagen über die Opfer rechtsextremer<br />
Gewalt in Deutschland<br />
2005 Nikola Sellmair<br />
„Kollege Angst“ (Stern, 31. März 2005)<br />
„3. <strong>Preis</strong>“<br />
2009 Simone Sälzer<br />
„Leben in Würde“<br />
(Passauer Neue Presse, Artikelserie 21. Februar – 25. Mai 2009)<br />
2008 Steffen Judzikowski und Hans Koberstein<br />
„Das Kartell – Deutschland im Griff der Energiekonzerne“<br />
(ZDF, Frontal 21, 14. August 2007)<br />
2007 Markus Grill<br />
Gesamtwürdigung für pharmakritische Berichterstattung<br />
2006 Redaktion „ZAPP“ (NDR)<br />
„Verdeckt, versteckt, verboten – Schleichwerbung und PR in den Medien“<br />
(NDR, 2. November 2005)<br />
2005 Brigitte Baetz<br />
„Meinung für Millionen – Wie Interessengruppen die öffentliche Meinungsbildung<br />
beeinflussen“ (Deutschlandfunk, 26. August 2005)<br />
„Newcomer-/Medienprojekt-<strong>Preis</strong>“<br />
2009 Attac Deutschland<br />
für Plagiat der Wochenzeitung „Die Zeit“<br />
2008 Andrea Röpke<br />
für „langwierige und schwierige Recherchen in der Neonazi-Szene“<br />
2007 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2006 Lutz Mükke<br />
„Der Parlamentsbroker“ (Medienmagazin Message, 4. Quartal 2005)<br />
2005 Maximilian Popp<br />
„Passauer Neue Mitte“ (Schülerzeitung „Rückenwind“, März 2005)<br />
Andreas Hamann und Gudrun Giese<br />
„Schwarzbuch Lidl“<br />
178
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2009<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
„Recherche-Stipendien“<br />
2009 Sandro Mattioli<br />
„Auf Dreck gebaut: Wie sich die Müllmafia in Deutschland etabliert“<br />
Tina Groll<br />
„Angepumpt und abkassiert: Subprime in Deutschland“<br />
Marianne Wendt, Maren-Kea Freese<br />
„Ich schreibe, also bin ich. Als Analphabet in einer Welt der Schriftkultur“<br />
2008 Veronica Frenzel<br />
„Das Geschäft mit illegalern Einwanderern“<br />
Clemens Hoffmann<br />
„Verkaufte Kinder – Kinderhandel in der Ukraine“<br />
Günter Bartsch<br />
„Helios Media: Das Geschäft mit der Eitelkeit“<br />
2007 Katrin Blum<br />
„Was kostet das Leben – oder sind wir vor dem Tod wirklich alle gleich?“<br />
Thomas Schuler<br />
„Softpower – zum Einfluss der Stiftungen in Deutschland“<br />
Martin Sehmisch<br />
„Unkontrollierte Macht? Wie die Monopolstellung einer lokalen Tageszeitung<br />
die politische Landschaft verändert – und wie sich Widerstand formiert“<br />
2006 Boris Kartheuser<br />
„Beispiel: RFID-chips“ (Recherche im Bereich „Datenschutz“)<br />
Thomas Schnedler<br />
„Stell mich an!“ (Selbstversuch im Bereich „Leiharbeit“)<br />
Melanie Zerahn<br />
„Beispiel: Studenten-Praktikum“<br />
2005 Golineh Atai<br />
„Auslandsadoptionen im Globalen Kindermarkt“<br />
Julia Friedrichs<br />
„McKinsey und ich“<br />
Astrid Geisler<br />
„Das vergessene Land? Über den leisen und stetigen Aufstieg der Rechtsextremen<br />
in Ostvorpommern“<br />
179
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong><br />
für kritischen Journalismus 2011
„Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste<br />
Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit.“<br />
(<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> 1968)<br />
Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 2011<br />
Es werden Beiträge prämiert, die für einen kritischen Journalismus<br />
vorbildlich und beispielhaft sind und die für demokratische und gesellschaftspolitische<br />
Verantwortung im Sinne von <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> stehen.<br />
Vorausgesetzt werden gründliche Recherche und eingehende Analyse.<br />
Der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> ist mit einem <strong>Preis</strong>geld<br />
von 45.000 Euro dotiert, das sich wie folgt aufteilt:<br />
1. <strong>Preis</strong> 10.000 Euro<br />
2. <strong>Preis</strong> 5.000 Euro<br />
3. <strong>Preis</strong> 3.000 Euro<br />
Zusätzlich vergibt die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung:<br />
für die beste Analyse (Leitartikel, Kommentar, Essay)<br />
den <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
10.000 Euro<br />
in Zusammenarbeit mit „netzwerk recherche e. V.“<br />
drei Recherche-Stipendien von je<br />
5.000 Euro<br />
und für Nachwuchsjournalisten oder Medienprojekte<br />
den „Newcomer- / Medienprojektpreis“ 2.000 Euro<br />
Einsendeschluss: 15. August 2011<br />
Die Bewerbungsbögen mit allen erforderlichen Informationen erhalten Sie unter:<br />
www.otto-brenner-preis.de<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
E-mail: info@otto-brenner-preis.de<br />
Tel.: 069 / 6693 - 2576<br />
Fax: 069 / 6693 - 2786
Spendenkonten der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung ist die gemeinnützige Wissenschaftsstiftung der IG Metall mit Sitz in<br />
Frankfurt/Main. Als Forum für gesellschaftliche Diskurse und Einrichtung der Forschungsförderung<br />
ist sie dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Besonderes Augenmerk gilt dabei<br />
dem Ausgleich zwischen Ost und West.<br />
Sie ist zuletzt durch Bescheid des Finanzamtes Frankfurt/M. V-Höchst vom 20. März 2009 als<br />
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig anerkannt worden.<br />
Aufgrund der Gemeinnützigkeit der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung sind Spenden steuerlich absetzbar<br />
bzw. begünstigt.<br />
Geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger an, damit wir Ihnen nach Eingang<br />
der Spende eine Spendenbescheinigung zusenden können oder bitten Sie in einem kurzen<br />
Schreiben an die Stiftung unter Angabe der Zahlungsmodalitäten um eine Spendenbescheinigung.<br />
Spenden erfolgen nicht in den Vermögensstock der Stiftung, sie werden ausschließlich für Projekte<br />
entsprechend des Verwendungszwecks genutzt.<br />
Bitte nutzen Sie folgende Spendenkonten<br />
Für Spenden mit zweckgebundenem Verwendungszweck zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung zu den Schwerpunkten:<br />
– Förderung der internationalen Gesinnung und des Völkerverständigungsgedankens<br />
Konto: 905 460 03 Konto: 161 010 000 0<br />
BLZ: 500 500 00 oder BLZ: 500 101 11<br />
Bank: HELABA Frankfurt/Main Bank: SEB Bank Frankfurt/Main<br />
Für Spenden mit zweckgebundenem Verwendungszweck zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung zu den Schwerpunkten:<br />
– Angleichung der Arbeits- und Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland<br />
(einschließlich des Umweltschutzes),<br />
– Entwicklung demokratischer Arbeitsbeziehungen in Mittel- und Osteuropa,<br />
– Verfolgung des Zieles der sozialen Gerechtigkeit.<br />
Konto: 905 460 11 Konto: 198 736 390 0<br />
BLZ: 500 500 00<br />
oder<br />
BLZ: 100 101 11<br />
Bank: HELABA Frankfurt/Main Bank: SEB-Bank Berlin<br />
Verwaltungsrat und Geschäftsführung der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung danken für die finanzielle<br />
Unterstützung und versichern, dass die Spenden ausschließlich für den gewünschten<br />
Verwendungszweck genutzt werden.<br />
182
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt / Main<br />
Verantwortlich<br />
Jupp Legrand<br />
Redaktion<br />
Jan Burzinski, Jupp Legrand<br />
und Burkard Ruppert<br />
Fotonachweis<br />
Dany Hunger (S.6, 16, 24-26, 43,<br />
67, 85) © OBS<br />
Artwork<br />
N. Faber de.sign, Wiesbaden<br />
Druck<br />
ColorDruck Leimen<br />
Redaktionsschluss<br />
4. März 2011<br />
183
Inhaltsverzeichnis der DVD<br />
1. Eröffnungspräsentation zur <strong>Preis</strong>verleihung <strong>2010</strong><br />
2. 2. <strong>Preis</strong>: Fernsehbeitrag:<br />
„Die KiK-Story“<br />
3. 3. <strong>Preis</strong>: Hörfunkbeitrag:<br />
„Von der Demokratie zur Postdemokratie“<br />
4. Ergebnis des Recherche-Stipendium 2009, Marianne Wendt und Maren Kea-Freese:<br />
Radio-Feature: „Immer im Verborgenen –<br />
Als Analphabet in einer Welt der Schriftkultur“<br />
184
www.otto-brenner-preis.de<br />
www.otto-brenner-stiftung.de