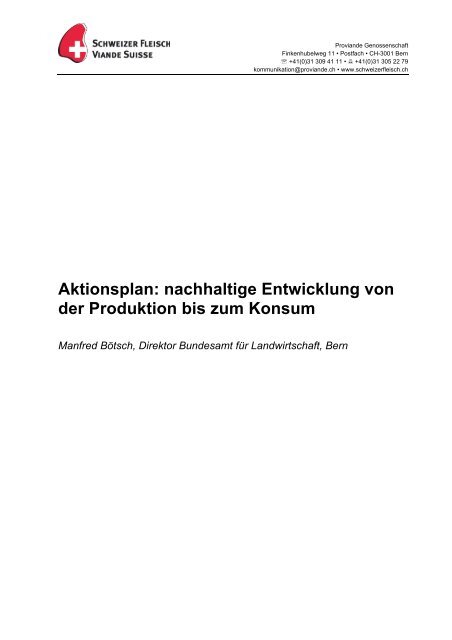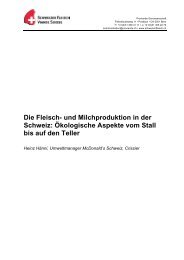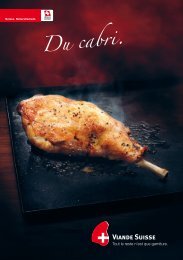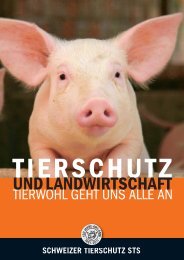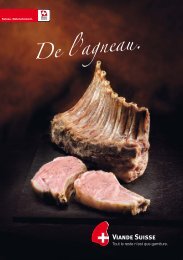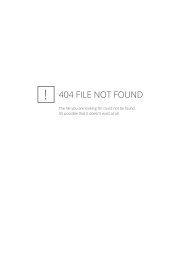Referat - Schweizer Fleisch
Referat - Schweizer Fleisch
Referat - Schweizer Fleisch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Proviande Genossenschaft<br />
Finkenhubelweg 11 • Postfach • CH-3001 Bern<br />
+41(0)31 309 41 11 • +41(0)31 305 22 79<br />
kommunikation@proviande.ch • www.schweizerfleisch.ch<br />
Aktionsplan: nachhaltige Entwicklung von<br />
der Produktion bis zum Konsum<br />
Manfred Bötsch, Direktor Bundesamt für Landwirtschaft, Bern
Manfred Bötsch: Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung von der Produktion bis zum Konsum<br />
Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung von der<br />
Produktion bis zum Konsum<br />
Manfred Bötsch<br />
Direktor Bundesamt für Landwirtschaft, Bern<br />
Wir sind gut unterwegs auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem in der<br />
Schweiz. Trotzdem bleiben wir gefordert. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz (vgl.<br />
<strong>Referat</strong> von Frau Steinemann) ist nach wie vor zu gross. Und weltweit haben wir Unterernährung<br />
und Hungertod längst nicht besiegt; im Gegenteil, die Zahl der betroffenen Menschen<br />
steigt leider wieder an. Überdies sind heute 600 Millionen Menschen von einer Wasserknappheit<br />
betroffen. Sie könnten aus nachvollziehbaren Gründen die Migrationsströme anschwellen<br />
lassen. Soziale Instabilitäten, ja gar bewaffnete Konflikte um Wasser, sind heute<br />
leider schon Realität. Was können wir tun? Muss da einem der Bissen <strong>Schweizer</strong> <strong>Fleisch</strong><br />
nicht im Halse stecken bleiben, wenn gleichzeitig in unserem Lande das Übergewicht zu den<br />
grösseren Problemen im Gesundheitssektor zählt?<br />
Globale Situation<br />
Neben einer knappen Milliarde Menschen, die unterernährt sind und dringend zusätzliche<br />
Nahrungsmittel benötigen, gibt es mehr als eine Milliarde Menschen, die an Übergewicht<br />
leiden und hohe Gesundheitskosten verursachen. Die Bevölkerung der Welt wächst zudem<br />
jährlich um 75 Mio. Einwohner, was der Bevölkerung von Deutschland entspricht. Diese<br />
Menschen müssen zusätzlich ernährt werden können, obwohl die dazu nötigen Ressourcen<br />
wie die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) oder das Wasser beschränkt sind. Die LN in Form<br />
von Wiesen und Ackerfläche umfasst weltweit rund fünf Milliarden Hektaren. Diese Fläche<br />
kann nicht ausgedehnt werden, ohne Wald zu roden oder Sümpfe und Moore trockenzulegen.<br />
Diese Optionen sind aus Gründen der Klimaproblematik und der Biodiversität keine<br />
valablen Alternativen. Verschärfend kommt hinzu, dass wir weltweit wegen Versalzung, Erosion<br />
oder Wassermangel rund eine Million Hektaren LN pro Jahr verlieren. Von den fünf Milliarden<br />
Hektaren können aus natürlichen Gründen nur rund 1,6 Milliarden Hektaren als Ackerfläche<br />
genutzt werden, auf der Getreide, Mais, Gemüse, Kartoffeln, Reis usw. angebaut<br />
werden können. Der Rest, also rund 3,4 Milliarden Hektaren, sind als Wiesen, Weiden,<br />
Steppen oder Alpen zu nutzen.<br />
Wie bei uns in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts können sich heute im asiatischen<br />
Raum dank steigender Kaufkraft immer mehr Personen den Konsum von <strong>Fleisch</strong> leisten.<br />
Diese einerseits erfreuliche Wohlstandssteigerung strapaziert andererseits das Ökosystem<br />
zusätzlich. Für die Produktion einer tierischen Kalorie braucht es je nach System nämlich<br />
zwei bis acht Kalorien aus der pflanzlichen Produktion. Oder für die Produktion eines Kilos<br />
Weizen braucht es rund 1000 Liter Wasser und für die Produktion eines Kilos Rindfleisch<br />
braucht es rund 15000 Liter. Auch die Treibhausgasbilanz von <strong>Fleisch</strong> ist im Vergleich zu<br />
1
Manfred Bötsch: Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung von der Produktion bis zum Konsum<br />
pflanzlichen Produkten meist ungünstiger. Aus diesen Gründen wird der <strong>Fleisch</strong>konsum an<br />
sich in Frage gestellt. Ist dies eine angebrachte Forderung?<br />
Nein, sie schiesst übers Ziel hinaus. Abgesehen davon, dass der Mensch biologisch zu den<br />
«Allesfressern» gehört und daher evolutionsbiologisch auf eine gemischte Ernährung eingestellt<br />
ist, weisen längst nicht alle rein pflanzlichen Diäten eine ökologisch bessere Bilanz auf<br />
(vgl. Carlson-Kanyama, 1998). Auch aus ökologischer bzw. agronomischer Sicht ist die Forderung<br />
nicht zielführend. Weil, wie dargelegt, mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlich<br />
nutzbaren Flächen aus ökologischen Gründen als Grasland genutzt werden müssen, braucht<br />
es Tiere, welche das pflanzliche Material in Form von Gras, Silofutter oder Heu veredeln. Der<br />
Mensch kann dieses pflanzliche Material nicht selber verwerten. Kühe, Ziegen, Schafe, Kamele,<br />
Yaks und Büffel jedoch können dieses Raufutter nutzen (daher nennt man sie auch<br />
Raufutterverzehrer) und produzieren Milch und <strong>Fleisch</strong> als hochwertige Lebensmittel, aber<br />
auch nützliche Wolle und Leder. Würde auf dieses Nahrungspotenzial verzichtet, wäre die<br />
Ernährungssituation der Weltbevölkerung mehr als prekär. Es ist daher einerseits aus ethischer<br />
Sicht unabdingbar, die Grünlandflächen dieser Welt mit Raufutterverzehrern zu nutzen.<br />
Andererseits ist damit keinem Luxuskonsum von <strong>Fleisch</strong> das Wort gesprochen. Wird<br />
nämlich der Raufutterverzehrer zum direkten Nahrungskonkurrenten des Menschen, kippt<br />
die Bilanz zulasten der tierischen Produktion. Wie immer in der Natur geht es somit um das<br />
Optimum. Mindestens so viele tierische Produkte, wie durch die Nutzung der Wiesen und<br />
Weiden anfallen, sollten Eingang in die Rationengestaltung des Menschen finden.<br />
Der Einfluss der Tierhaltung auf die THG-Emissionen ist mit 18 Prozent an den gesamten<br />
anthropogenen Emissionen nicht zu ignorieren. Das Minderungspotenzial dieses Bereiches<br />
ist entsprechend zu nutzen. Da die natürlichen Ressourcen beschränkt sind, braucht es in<br />
der Land- und Ernährungswirtschaft weitere Fortschritte in der Ressourceneffizienz. Gemäss<br />
der FAO sind dazu vermehrte Mittel in die Forschung, Innovation und Beratung zu investieren.<br />
Auch müssen die Länder ihre Agrarpolitiken auf das Konzept der Multifunktionalität ausrichten<br />
und Hand bieten zu fairen Handelsregeln. Letzteres ist aus ökologischer Sicht nebst<br />
den ökonomischen Gründen insofern auch unabdingbar, weil die einzelnen Länder ihren<br />
natürlichen Bedingungen entsprechend nicht alle Nahrungsmittel selber produzieren können<br />
und folglich auf einen Austausch angewiesen sind.<br />
Auf dieser internationalen Ebene ist vor allem der Staat gefordert.<br />
Nationaler Handlungsspielraum<br />
Im Sinne einer allgemeinen Vorbemerkung ist festzuhalten, dass nicht nur die Politik und die<br />
Produzenten von Nahrungsmitteln gefordert sind, sondern auch jeder Konsument, jede Konsumentin!<br />
Staatsaufgaben<br />
Der Staat hat mit den politischen Rahmenbedingungen Anreize für eine nachhaltige Landwirtschafts-<br />
und Ernährungspolitik zu geben. Umwelt- und tiergerechter Landbau muss sich<br />
lohnen. Die Ressourceneffizienz muss weiter verbessert werden. Aus dem natürlichen Potenzial<br />
der LN der Schweiz ist das Optimum herauszuholen. Auch gilt es, die Qualitätsführerschaft<br />
weiter auszubauen (vgl. dazu Land- und Ernährungswirtschaft 2025, Diskussionspapier<br />
des BLW zur strategischen Ausrichtung der Agrarpolitik). Ein Kernanliegen muss der<br />
2
Manfred Bötsch: Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung von der Produktion bis zum Konsum<br />
Schutz der LN sein. Die Schweiz verliert einen Quadratmeter LN pro Sekunde. Mit der beschränkten<br />
und unabdingbaren Ressource Boden müssen wir sorgsamer umgehen. Dafür<br />
braucht es eine stringentere Raumplanung. Mit einem zielgerichteteren Direktzahlungssystem<br />
kann die Biodiversität gestärkt, die vielfältige Landschaft erhalten, die Wasserqualität<br />
weiter verbessert und das Tierwohl gesichert werden. Die diesbezüglichen Vorschläge hat<br />
der Bundesrat im Bericht zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems in die politische<br />
Diskussion eingebracht.<br />
In der Tierhaltung gilt es dafür zu sorgen, dass die Nutztiere umweltgerecht gehalten und<br />
artgerecht gefüttert werden und nicht direkte Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen<br />
werden. Unsere Ernährungsstile sind qualitativ und quantitativ der biologischen Kapazität<br />
unserer Erde anzupassen. Diese Forderung bedingt, dass der Konsument ausreichend und<br />
einschlägig informiert wird. Über den ökologischen Fussabdruck des gekauften Nahrungsmittels<br />
wird heute nicht adäquat informiert. Dem Staat obliegt es auch, durch angemessene<br />
Unterstützung Forschung, Beratung und Innovation zu fördern. Zahlreiche Fragen sind heute<br />
noch ungeklärt, viele Probleme harren einer Lösung. Da das öffentliche Interesse an diesen<br />
Fragen und Themen gross ist und es oft um öffentliche Güter geht, braucht es unabhängige<br />
staatliche Forschung.<br />
Aufgaben der Land- und Ernährungswirtschaft<br />
Fortschrittliche Unternehmer der Land- und Ernährungswirtschaft haben längst erkannt, dass<br />
es in ihrem ureigenen Interesse liegt, die Ergebnisse einer nachhaltigen Entwicklung in ihre<br />
Unternehmensentscheide einzubeziehen. Zuweilen stehen zwar kurzfristige Finanzinteressen<br />
in Konflikt mit den Nachhaltigkeitszielen, aber diesen zum Trotz wird sich längerfristig<br />
nur nachhaltiges Wirtschaften durchsetzen.<br />
Der Transport von Nahrungsmitteln verursacht – je nach Quelle – rund vier bis acht Prozent<br />
der „ernährungsbedingten“ THG-Emissionen. Dabei machen der Import aus Übersee<br />
und/oder der Transport mit dem Flugzeug den grössten Anteil aus. Mit der Optimierung der<br />
Logistik kann der Nahrungsmittelhandel bereits zu wesentlichen Verbesserungen beitragen.<br />
Zumindest könnte er den Konsumenten mit entsprechenden Informationen versorgen, was<br />
einige ja bereits tun.<br />
Die Produktionsverfahren auf den landwirtschaftlichen Betrieben wie auch in der Verarbeitung<br />
haben bekanntermassen starken Einfluss auf die Ökobilanzen. Aufwändige Gefrieroder<br />
Trocknungsprozesse verursachen oftmals erhebliche Emissionen oder sind sehr energieintensiv.<br />
Die Land- und Ernährungswirtschaft kann ausserdem wesentliche Verbesserungen<br />
der Ökobilanzen erreichen, wenn dafür gesorgt wird, dass die Abfälle wiederverwertet<br />
und in die Stoffkreisläufe zurückgeführt werden. Die Tatsache, dass Schlachtabfälle heute<br />
wegen der BSE-Krise teilweise verbrannt werden, ist aus ökologischer Sicht so schnell als<br />
möglich zu korrigieren. Dieses wertvolle Eiweiss kann bei sachgerechtem Umgang problemlos<br />
wiederverwertet werden.<br />
Rüstabfälle oder Nebenprodukte können in Biogasanlagen zuerst zur Energieproduktion genutzt<br />
und alsdann als wertvoller Dünger zurück auf die Felder gebracht werden. Es müssten<br />
im biologischen System der Nahrungsproduktion die Stoffkreisläufe möglichst geschlossen<br />
werden. Produktionssysteme mit hohem Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz schneiden<br />
3
Manfred Bötsch: Aktionsplan Nachhaltige Entwicklung von der Produktion bis zum Konsum<br />
in aller Regel hinsichtlich der Ökobilanzen ungünstig ab. Landwirte und Verarbeiter sind gefordert,<br />
die Ressourceneffizienz weiter zu verbessern. Der biologische Landbau oder die<br />
integrierte Produktion, welche in der Schweiz weit verbreitet sind, können und müssen weiter<br />
optimiert werden. Die Wirtschaft hat es in der Hand, die tierische Produktion in eine art- und<br />
umweltgerechtere Richtung zu führen. Die Schweiz ist ein natürliches Grasland und hat eine<br />
Rindviehproduktion, die vergleichsweise noch stark auf Raufutter von Wiesen und Weiden<br />
basiert. Diesen Vorteil gilt es zu nutzen, umso mehr, als von wissenschaftlicher Seite zunehmend<br />
noch Argumente geliefert werden, welche für gesundheitliche Vorteile solcher Art<br />
produzierter Produkte sprechen. Es ist auch Aufgabe der Wirtschaft, die Konsumenten verständlich<br />
und sachgerecht zu informieren. Hier setzt auch die Qualitätsstrategie an, die zur<br />
Zeit ausgearbeitet wird.<br />
Aufgaben des Konsumenten<br />
Auch der Konsument ist gefordert. In erster Linie soll er sich mit einer Mischkost angemessen<br />
ernähren und „bewegt“ halten. <strong>Fleisch</strong>konsum mit Mass ist ethisch und ökologisch korrekt.<br />
Der Konsument soll Produkte aus umwelt- und tiergerechtem Landbau bevorzugen.<br />
Weiter kann er durch den saisongerechten Kauf von Produkten aus der „Region“ die Ökobilanz<br />
positiv beeinflussen. Mit klimafreundlichem Einkauf und mit Recycling des Abfalls kann<br />
der Konsument weitere Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung leisten.<br />
Bilanz<br />
Unser ökologischer Fussbadruck ist zu gross. Aus globaler Sicht ist die Ernährung einer stetig<br />
wachsenden Bevölkerung eine echte Herausforderung, da die dazu nötigen Ressourcen<br />
wie Boden und Wasser beschränkt sind. Leistet jeder Akteur (Staat, Wirtschaft, Konsument)<br />
seinen Beitrag, steht der Weg hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem offen. Wir tun<br />
gut daran, uns danach auszurichten, auch wenn wir zuweilen lieb gewordene Gewohnheiten<br />
aufgeben müssen. Panik und Radikallösungen sind fehl am Platz, ebenso wenig sind Ignoranz<br />
oder Trödelei konstruktive Lösungsansätze.<br />
Der Mischkost gehört die Zukunft. Der Konsum tierischer Produkte, somit auch von <strong>Fleisch</strong>,<br />
ist sowohl aus ökologischer als auch aus evolutionsbiologischer Sicht vernünftig. Vernunft<br />
hat immer auch etwas mit Masshalten zu tun. Beherzigen wir dies, so können wir nicht nur<br />
mit gutem Gewissen essen, sondern auch mit viel Genuss. Beides gehört übrigens zu einer<br />
umfassend verstandenen Gesundheit – und die wünsche ich Ihnen!<br />
«<strong>Schweizer</strong> <strong>Fleisch</strong>»:<br />
9. Symposium «<strong>Fleisch</strong> in der Ernährung», Zentrum Paul Klee Bern, 1. September 2010<br />
4