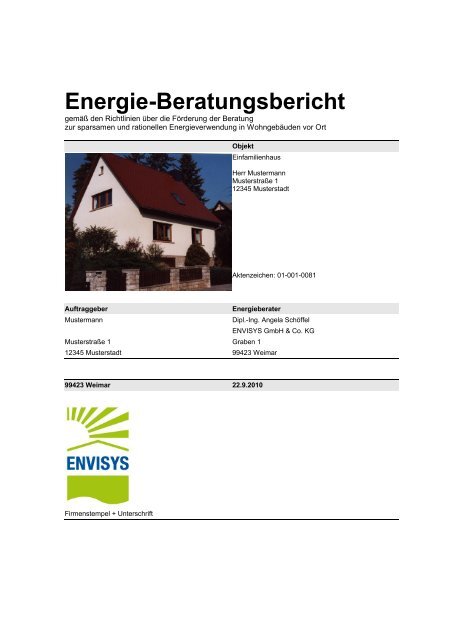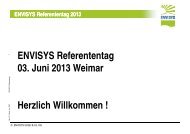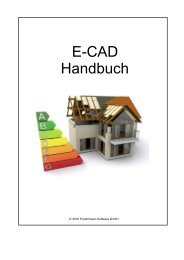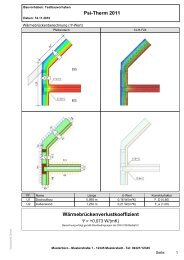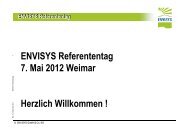Energie-Beratungsbericht - Envisys
Energie-Beratungsbericht - Envisys
Energie-Beratungsbericht - Envisys
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Energie</strong>-<strong>Beratungsbericht</strong><br />
gemäß den Richtlinien über die Förderung der Beratung<br />
zur sparsamen und rationellen <strong>Energie</strong>verwendung in Wohngebäuden vor Ort<br />
Objekt<br />
Einfamilienhaus<br />
Herr Mustermann<br />
Musterstraße 1<br />
12345 Musterstadt<br />
Aktenzeichen: 01-001-0081<br />
Auftraggeber <strong>Energie</strong>berater<br />
Mustermann Dipl.-Ing. Angela Schöffel<br />
Musterstraße 1 Graben 1<br />
ENVISYS GmbH & Co. KG<br />
12345 Musterstadt 99423 Weimar<br />
99423 Weimar 22.9.2010<br />
Firmenstempel + Unterschrift
Inhalt<br />
10/2010<br />
1 Zusammenfassung 5<br />
1.1 Allgemeines 5<br />
1.2 Ergebnisse im Überblick 6<br />
2 Einleitung 9<br />
2.1 Nachrüstpflichten bei Anlagen und Gebäuden 9<br />
2.2 Aufgabenstellung 10<br />
2.3 Grundlagen der Berechnungen 10<br />
2.4 Wichtige Begriffe 11<br />
3 Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des Gebäudes 13<br />
3.1 Grunddaten 13<br />
3.2 Nutzerverhalten 15<br />
3.3 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle 15<br />
3.4 Transmissionen durch Wärmebrücken 16<br />
3.5 Thermografische Untersuchung des Gebäudes 16<br />
3.6 Beschreibung und Bewertung der Lüftung 17<br />
3.7 Luftdichtigkeitsprüfung des Gebäudes 17<br />
3.8 Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage 18<br />
3.9 Beschreibung und Bewertung der Warmwasserbereitung 19<br />
3.10 Ergebnisse der Photovoltaik-Anlage 19<br />
3.11 Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude 21<br />
3.12 <strong>Energie</strong>bilanz im Ist-Zustand 21<br />
3.13 Beurteilung des Gebäudes nach der <strong>Energie</strong>einsparverordnung 25<br />
3.14 Schwachstellen des Gebäudes 26<br />
4 Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude 27<br />
5 Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparvarianten 31<br />
5.1 Variante: Sanierung Gebäudehülle 32<br />
5.1.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 32<br />
5.1.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Gebäudehülle 34<br />
5.2 Variante: Sanierung Anlage 36<br />
5.2.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 36<br />
5.2.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage 38<br />
5.3 Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage 39<br />
5.3.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 39<br />
5.3.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage 41<br />
5.4 Variante: Sanierung Hülle und Anlage 43<br />
5.4.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 43<br />
5.4.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Hülle und Anlage 45<br />
5.5 Maßnahmenbeschreibung 49<br />
5.5.1 Schrägdach, Untersparrendämmung 49<br />
5.5.2 Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal 49<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 2
10/2010<br />
5.5.3 Deckendämmung einblasen, begehbar 49<br />
5.5.4 Kellerdeckendämmung abgehängt 49<br />
5.5.5 Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 50<br />
5.5.6 Innendämmung, Kalzium Silikatplatten 50<br />
5.5.7 Fensteraustausch, Passivhausqualität 50<br />
5.5.8 Blower-Door-Test 51<br />
5.5.9 Pelletheizkessel 51<br />
5.5.10Anschluss an Heizwärmebereiter 52<br />
5.5.11TWW-Speicher klein - (150 l) 52<br />
5.5.12Heizleitungen alle dämmen 52<br />
5.5.13TWW Leitungen dämmen 53<br />
5.5.14Elektronisch geregelte Heizungspumpe 53<br />
5.5.15Brauchwasser-Solarkollektor 53<br />
5.5.16Pufferspeicher - (1000l) 54<br />
5.5.17Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 54<br />
5.5.18Lüftungskonzept erstellen 55<br />
5.6 Vergleich der Varianten 57<br />
5.6.1 Vergleich der technischen Verbesserung der Gebäudehülle 57<br />
5.6.2 Vergleich der <strong>Energie</strong>kennzahlen 57<br />
5.6.3 Umweltwirkung 58<br />
5.6.4 Vergleich der Primärenergie der Varianten 59<br />
5.6.5 Wirtschaftlichkeit der Varianten 60<br />
5.7 Ergänzende Angaben zum Vergleich der Varianten 63<br />
5.7.1 Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien 63<br />
5.7.2 Amortisationszeiten der Maßnahmepakete in verschiedenen Szenarien 63<br />
6 Anhang: Ergänzende Angaben 65<br />
6.1 Empfehlungen zum <strong>Energie</strong>sparen und gesunden Wohnen 65<br />
6.1.1 Anmerkungen zur Behaglichkeit 65<br />
6.1.2 Allgemeine <strong>Energie</strong>spartipps 65<br />
6.1.3 Hinweise zur Luftfeuchte 65<br />
6.1.4 Hinweise zum richtigen Lüften 66<br />
6.1.5 Hinweise zum Stromsparen 67<br />
6.1.6 Heizungsmodernisierung 68<br />
6.1.7 Thermische Solaranlage zur Warmwasser-Bereitung 69<br />
6.1.8 Regenwassernutzung 69<br />
6.1.9 Photovoltaik-Anlage 69<br />
6.1.10Allgemeine Anmerkungen zu Wärmedämmverbund-System (WDVS) 70<br />
6.2 Erläuterungen zu Wärmebrücken 71<br />
6.3 Entsorgungskonzept 72<br />
6.4 Bewertungsschemata 73<br />
6.5 Anhang: Berechnung der Transmissionen durch die Bauteile 74<br />
6.6 Bauteilnachweis nach EnEV 75<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 3
10/2010<br />
6.6.1 Bauteile mit Abgrenzung nach oben 75<br />
6.6.2 Bauteile mit Abgrenzung nach unten 78<br />
6.6.3 Bauteile mit seitlicher Abgrenzung 79<br />
6.6.4 Fensterbauteile 82<br />
6.7 Förderungen 84<br />
6.8 Internetadressen 84<br />
6.9 Glossar 84<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 4
1 Zusammenfassung<br />
1.1 Allgemeines<br />
10/2010<br />
Der Beratungsempfänger Mustermann plant die Modernisierung des betrachteten Gebäudes, um<br />
den jährlichen <strong>Energie</strong>verbrauch zu senken und die <strong>Energie</strong>kosten sowie Schadstoffemissionen zu<br />
minimieren.<br />
Der vorliegende <strong>Beratungsbericht</strong> hat die Aufgabe, eine möglichst genaue Ist-Analyse des<br />
Gebäudes zu erstellen, um auf dieser Grundlage Empfehlungen für energetische Sanierungsvarianten<br />
zu entwickeln. Ziel dabei ist die Empfehlung von Sanierungsvarianten, die ein Optimum an<br />
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit ermöglichen.<br />
Die Berechnung des <strong>Energie</strong>bedarfs und der Wirtschaftlichkeit von <strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen<br />
beruht auf dem LEG (Leitfaden energiebewusste Gebäudeplanung) des IWU Darmstadt (Institut für<br />
Wohnen und Umwelt).<br />
Auf Wunsch des Beratungsempfängers bzw. auf Empfehlung des Beraters wurden für die<br />
<strong>Energie</strong>sparmaßnahmen folgende Varianten untersucht:<br />
- Sanierung Gebäudehülle<br />
- Sanierung Anlage<br />
- Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
- Sanierung Hülle und Anlage<br />
Hinweise:<br />
- Der <strong>Beratungsbericht</strong> wurde nach bestem Wissen auf Grund der verfügbaren Daten erstellt.<br />
Irrtümer sind vorbehalten.<br />
- Alle in diesem Bericht getätigten Aussagen zur <strong>Energie</strong>einsparung beruhen auf Berechnungen<br />
und Prognosen, d.h. theoretischen <strong>Energie</strong>bilanzen, bei denen unter anderem zum<br />
Nutzerverhalten und zu anderen, nicht genau bekannten Größen sinnvolle Annahmen getroffen<br />
werden müssen. Diese Annahmen wurden mit Sorgfalt getroffen und wurden anhand<br />
der bekannten <strong>Energie</strong>verbrauchswerte des jetzigen Gebäudezustands kritisch geprüft.<br />
Dennoch sind die berechneten <strong>Energie</strong>einsparungen nur Näherungen.<br />
- Die Randdaten der Wirtschaftlichkeit sind ebenfalls gewissenhaft, weder zugunsten noch<br />
zu ungunsten einer Investition gewählt. Insbesondere bei den Investitionskosten handelt es<br />
sich um Schätzkosten, wie sie im Rahmen der <strong>Energie</strong>beratung üblich sind.<br />
- Die Durchführung und der Erfolg einzelner Maßnahmen bleiben in Ihrer Verantwortung. Sie<br />
sollten, insbesondere bei bedeutenden Investitionen in Baumaßnahmen und Heizungsanlagen<br />
immer mehrere Vergleichsangebote einholen und kritisch prüfen. Um Fehler zu vermeiden<br />
und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen, sollten Sie für die Umsetzung<br />
einen Fachplaner (Architekten oder Ingenieur) hinzuziehen.<br />
- Der <strong>Beratungsbericht</strong> ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte bleiben dem Unterzeichner<br />
vorbehalten. Der <strong>Beratungsbericht</strong> ist nur für den Auftraggeber und nur für den<br />
angegebenen Zweck bestimmt.<br />
- Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit der schriftlichen Genehmigung<br />
des Verfassers gestattet.<br />
- Eine Rechtsverbindlichkeit folgt aus unserer Stellungnahme nicht. Sofern im Falle entgeltlicher<br />
Beratungen Ersatzansprüche behauptet werden, beschränkt sich der Ersatz bei jeder<br />
Form der Fahrlässigkeit auf das gezahlte Honorar.<br />
- Der <strong>Beratungsbericht</strong> wurde dem Auftraggeber in einem Exemplar überreicht.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 5
1.2 Ergebnisse im Überblick<br />
Zusammenfassung<br />
Das betrachtete Gebäude befindet sich energetisch in einem sehr schlechten Zustand.<br />
10/2010<br />
Die Gebäudehülle weist entsprechend der Konstruktion und dem Baualter hohe Wärmeverluste<br />
auf. Besonders die Außenwände verursachen einen hohen <strong>Energie</strong>verlust. Der berechnete<br />
<strong>Energie</strong>bedarf liegt über dem Durchschnitt von älteren frei stehenden Gebäuden und ist als hoch<br />
einzustufen.<br />
Die Fenster wurden 1978 ausgetauscht. Sie entsprechen damit dem Stand dieser Zeit und<br />
verursachen einen entsprechend hohen <strong>Energie</strong>bedarf.<br />
Die Heizung stammt aus dem Jahr 1975 und hat entsprechend hohe Anlagenverluste. Die<br />
Leitungen (Heizungs- und Warmwasserleitungen) sind schlecht gedämmt.<br />
Zur Senkung des <strong>Energie</strong>bedarfs schlagen wir folgende Maßnahmen vor:<br />
- Dämmung der Außenwände<br />
- Dämmung des Daches<br />
- Dämmung oberste Geschossdecke und Abseitenwand<br />
- Einbau einer Brennwertheizung<br />
- Anschluss der Warmwasserbereitung an die Heizung<br />
- Dämmung aller Heizungs- und Warmwasserleitungen<br />
- Brauchwassersolaranlage einschließlich Erneuerung des Warmwasserspeichers<br />
- Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung<br />
Die Dämmung der Kellerdecke bringt energetisch nicht sehr viel. Diese kann aber in Eigenleistung<br />
erfolgen. Für die Behaglichkeit (Fußwärme) ist dies sicher von Bedeutung.<br />
Wir haben die Maßnahmen in sinnvollen Modernisierungsvarianten zusammengefasst. Diese<br />
betreffen entweder nur die Gebäudehülle, die Anlage, oder eine Kombination. Jede Variante wird<br />
hinsichtlich ihrer Einsparwirkung, Investitionskosten, Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung<br />
dargestellt und miteinander verglichen. Wir raten dringend zu einer Variante unter Einbeziehung<br />
der Gebäudehülle. Eine Komplettvariante bildet das wirtschaftliche Einsparpotenzial ab. Mit ihr<br />
lassen sich ca. 70 % der zurzeit eingesetzten <strong>Energie</strong> einsparen. Es ergeben sich interessante<br />
Fördermöglichkeiten.<br />
In Variante 004 Sanierung Hülle und Anlage kann das KfW-Programm (Kreditanstalt für Wiederaufbau)<br />
<strong>Energie</strong>effizient Sanieren 151 in Anspruch genommen werden, was einem geldwerten<br />
Vorteil von ca. 12.000 € entspricht. Dies erhöht noch deutlich die ohnehin gute Wirtschaftlichkeit<br />
dieser Modernisierung.<br />
Neben der qualitativen Verbesserung geht mit einer Sanierung auch eine Wertsteigerung der<br />
Immobilie, eine Verbesserung des Fassadenschutzes, des sommerlichen Wärmeschutzes sowie<br />
ggf. steuerliche Vorteile mit einher.<br />
Nachfolgend werden die untersuchten <strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen mit dem Ist-Zustand verglichen.<br />
Detaillierte Angaben zu den Varianten finden Sie im Abschnitt "Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparmaßnahmen".<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 6
Energetische Verbesserung<br />
10/2010<br />
Objektzustand Endenergie*) Einsparung Investition Inv. pro m² Amortisation<br />
[kWh/m²a] % € €/m² Jahre<br />
Ist-Zustand 446 --- --- --- ---<br />
Sanierung<br />
Gebäudehülle<br />
121 73 21.222 235,8 12<br />
Sanierung Anlage 401 10 10.699 118,9 9<br />
Sanierung Anlage<br />
mit Solaranlage<br />
402 10 20.138 223,8 17<br />
Sanierung Hülle<br />
und Anlage<br />
100 78 40.860 454,0 12<br />
*) entspricht der <strong>Energie</strong>kennzahl<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Kennzahlen in einer Grafik:<br />
Umweltwirkung<br />
Objektzustand CO2 NOX CO2-Minderung.<br />
[kg/a] [g/a] in %<br />
Ist-Zustand 13.170 11.264 ---<br />
Sanierung Gebäudehülle 4.061 3.355 69,2<br />
Sanierung Anlage 786 25.453 94,0<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage 917 25.568 93,0<br />
Sanierung Hülle und Anlage -198 6.529 101,5<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 7
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Emissionen in einer Grafik<br />
10/2010<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 8
2 Einleitung<br />
Das Thema <strong>Energie</strong>einsparung ist in aller Munde. Die Nachhaltigkeit, die damit verbunden ist,<br />
schont Klima sowie Umwelt und sichert <strong>Energie</strong>reserven. Für den Einzelnen sind diese Effekte<br />
nicht sofort spürbar; hier zählen die jährlichen Ausgaben und der Wohnkomfort.<br />
10/2010<br />
Etwa ein Drittel der CO2-Emission in Deutschland sind auf den <strong>Energie</strong>verbrauch von Gebäuden<br />
zurückzuführen. Das sind in Deutschland fast 300 Millionen Tonnen CO2. Um diese kaum<br />
vorstellbar große Menge langfristig zu vermindern, hat sich Deutschland zusammen mit 34<br />
weiteren Industrieländern dazu verpflichtet, im Rahmen des Kyoto-Protokolls diese CO2-Emission<br />
um insgesamt 5,2% im Vergleich zum Referenzjahr 1990 zu senken. Im Rahmen der EU-internen<br />
Lastenverteilung haben die EU-Umweltminister für Deutschland schließlich eine Reduktionsquote<br />
von 21% festgelegt.<br />
Auf Grund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung haben sich die Rohölweltmarktpreise in den<br />
letzten 6 Jahren überproportional erhöht. Nach Expertenprognosen wird sich dieser Trend (nicht<br />
mehr ganz so steil) auch in den nächsten Jahren fortsetzen.<br />
Entwicklung des Rohölweltmarktpreises in $/Barrel, Quelle: www.tecson.de<br />
2.1 Nachrüstpflichten bei Anlagen und Gebäuden<br />
Wesentliche Nachrüstpflichten für den Gebäudebestand im Rahmen der EnEV:<br />
Hinweis: Bei Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen, von denen eine der Eigentümer selbst<br />
bewohnt, gelten die Nachrüstpflichten nur bei Eigentümerwechsel.<br />
- Bis zum 31.10.2004 waren gemäß BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) Wärmeerzeuger<br />
mit einem Abgasverlust größer 11 % (Nennwärmeleistung 4 - 25 kW), größer 10 %<br />
(Nennwärmeleistung 25 - 50 kW) und größer 9 % (Nennwärmeleistung über 50 kW) auszutauschen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 9
10/2010<br />
- Bis zum 31.12.2006 waren gemäß EnEV alle Standardheizkessel, die vor dem 1.10.1978 in<br />
Betrieb genommen wurden, gegen moderne Technik auszutauschen.<br />
Ausnahme: Brennwert- und Niedertemperaturkessel, Anlagen mit einer Nennleistung < 4 KW<br />
oder > 400 KW, Anlagen für reine Warmwassererzeugung, Anlagen befeuert mit festen Brennstoffen.<br />
- Für Heizkessel, deren Brenner nach dem 01.10.1996 erneuert worden sind, gilt die Frist bis zum<br />
31.12.2008.<br />
- Neue Heizungen, die in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, müssen die Bestimmungen<br />
der EU-Heizkesselrichtlinie erfüllen.<br />
- Bis zum 31.12.2006 waren alle zugänglichen ungedämmten Wärmeverteilungsleitungen, die<br />
sich in unbeheizten Räumen befinden, zu dämmen.<br />
- Bis zum 31.12.2006 waren alle obersten Geschossdecken von beheizten Räumen, die nicht<br />
begehbar, aber zugänglich sind, zu dämmen. Die erforderlichen Dämmstärken sind im Anhang<br />
der EnEV aufgeführt.<br />
Hausbesitzer interessiert der <strong>Energie</strong>verbrauch ihres Gebäudes aus ökologischen und ökonomischen<br />
Gründen. Dazu muss bekannt sein, woher die <strong>Energie</strong> kommt und wohin sie geht<br />
(<strong>Energie</strong>ströme). Das Aufzeigen der <strong>Energie</strong>ströme wird als <strong>Energie</strong>bilanz des Gebäudes<br />
bezeichnet. Dazu werden alle dem Gebäude in einem Jahr zugeführten <strong>Energie</strong>mengen und alle<br />
das Gebäude verlassende <strong>Energie</strong>mengen gegenübergestellt. In der <strong>Energie</strong>bilanz wird der<br />
rechnerische Endenergiebedarf festgelegt. Dieser <strong>Energie</strong>bedarf dient als Maßstab für die<br />
energetische Beurteilung des Gebäudes. Die aus der <strong>Energie</strong>bilanz resultierenden Ergebnisse sind<br />
Ausgangspunkt für weitere Berechnungen und Bewertungen zur <strong>Energie</strong>optimierung.<br />
2.2 Aufgabenstellung<br />
Der vorliegende <strong>Beratungsbericht</strong> beschreibt, durch welche Maßnahmen am zu untersuchenden<br />
Gebäude wie viel <strong>Energie</strong>, <strong>Energie</strong>kosten und CO2 eingespart werden können und in welchem<br />
Umfang diese Maßnahmen wirtschaftlich sind. Die zugehörigen Berechnungen (<strong>Energie</strong>bilanzen,<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen) werden unter weitgehend realistischen Randbedingungen<br />
(Nutzer, Klima, Kosten, usw.) durchgeführt, so dass diese für die Zukunft repräsentativ sind.<br />
Es werden insbesondere solche Maßnahmen vorgeschlagen, für welche Kredite und Zuschüsse<br />
aus dem Bundesförderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in Anspruch genommen<br />
werden können. Die Nachweise für die Erlangung von Fördermitteln entsprechen den Vorgaben<br />
der KfW, werden aber im Rahmen des Berichtes nicht erstellt.<br />
Der Bericht ist nach Vorgabe der BAFA-Richtlinien einer Vor-Ort-Beratung verfasst.<br />
2.3 Grundlagen der Berechnungen<br />
Vom Eigentümer wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:<br />
� Baubeschreibung des zu untersuchenden Gebäudes<br />
� Bestandspläne<br />
� Verbrauchsdaten für den Zeitraum von 3 Jahren<br />
� Schornsteinfeger-Messprotokoll für den Heizkessel<br />
� diverse Produktbeschreibungen für die Komponenten der Anlagentechnik<br />
Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Begehung weitere Informationen zur Nutzung, zum<br />
Zustand der Gebäudehülle (insbesondere der U-Werte) und der Anlagentechnik (Leitungslängen,<br />
Leitungsdämmung, usw.) gewonnen. Die restlichen Daten wurden aus der Literatur bzw. dem<br />
Internet entnommen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 10
2.4 Wichtige Begriffe<br />
Wichtige Begriffe, die Sie im Bericht immer wieder finden, werden an dieser Stelle erläutert. Die<br />
weiteren Details folgen an der entsprechenden Stelle im Bericht.<br />
10/2010<br />
<strong>Energie</strong>bilanz<br />
Die <strong>Energie</strong>bilanz stellt den <strong>Energie</strong>mengen, die ein Gebäude verliert, die <strong>Energie</strong>mengen<br />
gegenüber, die dem Gebäude zugeführt werden. Diese Bilanz umfasst üblicherweise die<br />
<strong>Energie</strong>mengen für die Beheizung und Trinkwarmwasserbereitung, aber nicht den Haushaltsstrom.<br />
Üblicherweise werden die <strong>Energie</strong>mengen in einer <strong>Energie</strong>bilanz als kWh (Kilowattstunden)<br />
angegeben.<br />
<strong>Energie</strong>gewinne und <strong>Energie</strong>verluste<br />
Zu den <strong>Energie</strong>gewinnen (Zufuhr), die ein Gebäude neben der eingekauften <strong>Energie</strong> in Form von<br />
Gas, Öl, Fernwärme, Strom usw. hat, zählen die solaren Wärmegewinne über die Fenster und die<br />
inneren Wärmegewinne, z. B. aus der Abwärme seiner Bewohner. Zu den <strong>Energie</strong>verlusten<br />
(Abfuhr), die ein Gebäude hat, zählen Wärmeverluste aus Transmission (Durchlässigkeit eines<br />
Mediums) durch die Außenhülle und aus Lüftung sowie die Technikverluste, z. B. Wärmeverluste<br />
der Rohre und Speicher im Keller oder des Kessels zum Schornstein hinaus.<br />
Nutzenergie<br />
Als Nutzenergie bezeichnet man, vereinfacht ausgedrückt, die <strong>Energie</strong>menge, die zur Beheizung<br />
eines Gebäudes sowie zur Erstellung des Warmwassers unter Berücksichtigung definierter<br />
Vorgaben erforderlich ist. Die Nutzenergie ist die Summe von Transmissionswärmeverlusten,<br />
Lüftungswärmeverlusten und Warmwasserbedarf abzüglich der nutzbaren solaren und inneren<br />
Wärmegewinne und des Trinkwasserbedarfs.<br />
Endenergie<br />
Die Endenergie umfasst die vorgenannte Nutzenergie und die Anlagenverluste (einschließlich<br />
Hilfsenergie). Der Endenergieverbrauch entspricht der eingekauften <strong>Energie</strong> des Gebäudenutzers.<br />
Primärenergie<br />
Die Primärenergie ist die Gesamtheit des <strong>Energie</strong>stroms einschließlich außerhalb des Gebäudes<br />
benötigter <strong>Energie</strong> (Endenergie und Umwandlung).<br />
Verbrauch und Bedarf<br />
Mit "Verbrauch" werden die gemessenen <strong>Energie</strong>mengen bezeichnet. Beim "Bedarf" handelt es<br />
sich um gerechnete Werte. Für alle Einsparungen, die sich aus einer künftigen <strong>Energie</strong>einsparmaßnahme<br />
ergeben, muss immer ein <strong>Energie</strong>bedarf gerechnet werden.<br />
U-Wert<br />
Die Wärmeübertragung eines Bauteils (z. B. der Außenwand) wird definiert durch den Wärmedurchgangskoeffizienten<br />
oder U-Wert. Er zeigt an, wie viel Wärme durch das Bauteil nach außen<br />
fließt. Je kleiner der Wert, umso besser das Bauteil und geringer die Verluste.<br />
CO2-Äquivalent<br />
Das CO2-Äquivalent ist ein Maß für die Umweltwirksamkeit des <strong>Energie</strong>bezugs. Für jede<br />
Kilowattstunde eines <strong>Energie</strong>trägers (Gas, Öl, Strom, Holz, usw.) wurde in wissenschaftlichen<br />
Studien berechnet, wie viel umweltschädliche Stoffe (CODE2 und andere Stoffe werden gewichtet,<br />
daher "Äquivalent") entstehen, wenn diese Kilowattstunde verbraucht wird.<br />
Gesamtkostenrechnung<br />
Diese Art der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt zum einen Kapitalkosten (Zins und<br />
Tilgung für die Investition), die <strong>Energie</strong>kosten (mit <strong>Energie</strong>preissteigerung) und zusätzliche<br />
Wartungs- und Unterhaltskosten (z. B. für wartungsintensive Techniken) über einen längeren<br />
Zeitraum.<br />
Transmission<br />
Als Transmissionswärmeverluste bezeichnet man die Wärmeverluste, die durch Wärmeleitung<br />
(Transmission) der Wärme abgebenden Gebäudehülle entstehen. Die Größe dieser Verluste ist<br />
direkt abhängig von der Dämmwirkung der Bauteile und wird durch den U-Wert angegeben.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 11
Jährlicher Transmissionswärmeverlust, Quelle: Gebäudeenergieberater<br />
10/2010<br />
Lüftung<br />
Lüftungswärmeverluste entstehen durch Öffnen von Fenstern und Türen, aber auch durch<br />
Undichtigkeiten der Gebäudehülle. Die Undichtigkeit kann bei Altbauten insbesondere bei sehr<br />
undichten Fenstern, Außentüren und in unsachgemäß ausgebauten Dachräumen zu erheblichen<br />
Wärmeverlusten sowie zu bauphysikalischen Schäden führen.<br />
Anlagenverluste<br />
Die Anlagenverluste umfassen die Verluste bei der Erzeugung (Abgasverlust), ggf. Speicherung<br />
(Abgabe von Wärme durch einen Speicher), Verteilung (Leitungsverlust durch ungedämmte bzw.<br />
schlecht gedämmte Leitungen) und Abgabe (Verluste durch mangelnde Regelung) bei der<br />
Wärmeerzeugung.<br />
Wärme übertragende Fläche<br />
Fläche des Gebäudes, über die eine Wärmetransmission stattfindet. Diese Fläche wird auch als<br />
äußere Gebäudehülle bezeichnet.<br />
zu dämmende Fläche<br />
Hierbei handelt es sich um die tatsächlich zu dämmende Fläche. Diese kann von der Wärme<br />
übertragenden Fläche abweichen. Zum Beispiel gehört der Giebel eines unbeheizten Spitzbodens<br />
nicht zur Wärme übertragenden Fläche jedoch zur zu dämmenden Fläche. Die zu dämmende<br />
Fläche wird auch als Investitionsfläche bezeichnet.<br />
<strong>Energie</strong>kennzahl<br />
Ähnlich wie der Benzinverbrauch in Liter pro 100 km für Autos angeben wird, kann bei Gebäuden<br />
der jährliche Brennstoffverbrauch (Endenergie) im Verhältnis zur beheizten Wohn- oder Nutzfläche<br />
gesetzt werden.<br />
Wenn man z. B. eine 100 m2 Wohnung mit jährlich 1.000 m3 Erdgas beheizt, hat man (bei einem<br />
Heizwert von ca. 10 kWh pro m3 Erdgas) eine spezifische <strong>Energie</strong>kennzahl von 1.000 m3 x 10<br />
kWh/m3 : 100 m2 = 100 kWh/m2a.<br />
<strong>Energie</strong>kennzahlen dienen vorrangig zum Vergleich mit anderen Gebäuden gleicher Art und<br />
Nutzung. Beachten Sie jedoch: Bei Kennzahlvergleichen (und auch bei der Erstellung eines<br />
<strong>Energie</strong>ausweises) wird der Jahres-Heizwärmebedarfs unter einheitlichen Randbedingungen<br />
ermittelt. Ein direkter Vergleich mit Gebäuden aus anderen Klimazonen oder mit abweichenden<br />
Nutzungen wäre somit irreführend.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 12
3 Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des<br />
Gebäudes<br />
Im nachfolgenden Abschnitt wird das untersuchte Gebäude näher vorgestellt - hinsichtlich des<br />
Baukörpers, der Anlagentechnik und Nutzung, der <strong>Energie</strong>bilanz mit Schwachstellen und der<br />
Verbrauchsdaten.<br />
3.1 Grunddaten<br />
10/2010<br />
Hier geben Sie Besonderheiten Ihres Gebäudes ein, wie: Schimmelbildung, Fußkälte, Zugigkeit,<br />
Undichtigkeit, Konstruktion, Baumängel ...<br />
Gebäudedaten<br />
Gebäudetyp: Einfamilienhaus<br />
Baujahr: 1963<br />
Gebäudelage: innerorts<br />
Exposition: gegliedert<br />
äußeres beheiztes Gebäudevolumen: 308 m³<br />
Wärmeübertragende Umfassungsfläche A: 279 m² (Brutto)<br />
Wohneinheiten: 1<br />
beheizte Wohnfläche: 90 m2<br />
Nutzfläche AN (lt. EnEV)1) 98 m2<br />
Belegung: Das Haus wird von 3 Personen bewohnt.<br />
Raumtemperatur: ca. 20,0 °C im Durchschnitt<br />
1) nach EnEV ermittelte Nutzfläche, welche aus dem beheizten Volumen berechnet wird und von der Wohnfläche abweicht<br />
Gebäudeansichten<br />
Ansicht: Nord-Ost<br />
Ansicht: Süd-Ost<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 13
Ansicht: Süd<br />
Ansicht: Süd-West<br />
Lüftung<br />
Die Lüftung erfolgt natürlich über Fenster (Kipp- und Stoßlüftung).<br />
10/2010<br />
Keller/untere Gebäudeabgrenzung<br />
Die Abgrenzung der thermischen Hülle bildet die Kellerdecke. Der Keller ist unbeheizt. Er ist daher<br />
in die thermische Hülle des Gebäudes nicht mit einbezogen.<br />
Dach/obere Gebäudeabgrenzung<br />
Die Abgrenzung der thermischen Hülle nach oben bilden die oberste Geschossdecke sowie das<br />
Dach. Der Dachraum ist beheizt. Er ist daher in die thermische Hülle des Gebäudes mit einbezogen.<br />
Wände<br />
Bei den Außenwänden handelt es sich um die Originalwände aus dem Jahr 1963. Hier wurden<br />
bisher keine dämmtechnischen Maßnahmen vorgenommen.<br />
Zustand der Fenster und Außentüren<br />
Zur seitlichen Abgrenzung der thermischen Hülle gehören die Fenster. Diese wurden im Jahre<br />
1978 ausgetauscht. Sie sind in mäßigem Zustand und schließen nicht dicht.<br />
Zustand der Anlage<br />
Die Anlage weist Schwächen in den Einstellungen auf (Pumpe zu hoch eingestellt). Die Armaturen<br />
sind ungedämmt. Unter der Zuleitung am Brenner befindet sich ein kleiner Ölfleck.<br />
Umgebung<br />
Die meteorologischen Umgebungsparameter, wie die durchschnittliche Außentemperatur im<br />
Winter, die Dauer der Heizperiode und die absolut tiefste Temperatur (Zweitagesmittel) wurden aus<br />
der Wetterdatenbank für den Bezugsort Jena entnommen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 14
meteorologische Daten<br />
niedrigste Außentemperatur: -15,0 °C<br />
durchschnittliche winterliche Außentemperatur: 4,0 °C<br />
Heizperiode: 230 Tage<br />
Die durchschnittliche Raumtemperatur aller zum Objekt gehörenden Räume beträgt 20,0 °C.<br />
Hierbei wird berücksichtigt, dass evtl. einige Räume wenig beheizt werden. Regelungsbedingt<br />
wurde eine tatsächliche durchschnittliche Innentemperatur von 19,8 °C angenommen.<br />
3.2 Nutzerverhalten<br />
10/2010<br />
Der tatsächliche <strong>Energie</strong>verbrauch eines Gebäudes ist sehr stark vom Nutzerverhalten der<br />
Bewohner abhängig. So haben die Nutzungsdauer, das Lüftungsverhalten, die Raumtemperaturen<br />
und Anzahl/Größe der beheizten Räume wesentlichen Einfluss.<br />
Bei der Bilanzerstellung sind wir von typischen Randbedingungen in der vorliegenden Gebäudekategorie<br />
sowie von Ihren Angaben ausgegangen.<br />
Das Nutzerverhalten geht insbesondere in die zugrunde gelegte mittlere Raumtemperatur und die<br />
Lüftungsintensität ein. Im Rahmen einer Nutzerbefragung wurden folgende Angaben erhoben:<br />
z.B. Abwesenheitszeiten, regelmäßiger Winterurlaub, Wochenendpendler, Nachtabsenkung,<br />
niedrig beheizte/wenig genutzte Räume, Lüftungsverhalten im Winter<br />
3.3 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle<br />
Für die Außenbauteile wurden die Flächen und Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte)<br />
berechnet. Gebäudeenergetisch nicht relevante Bauteile wie z.B. Tapeten wurden vernachlässigt.<br />
Teilflächen sind sinnvoll zusammengefasst und U-Werte gemittelt.<br />
Bauteil Fläche U-Wert*1 EnEV*2 P-Haus*3 Note*4<br />
Wände m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />
Außenwände 122,50 0,90 0,24*2 0,10 5<br />
Abseitenwand 12,80 2,13 0,24*2 0,10 6<br />
Gaubenwand 1,56 0,45 0,24*2 0,10 4<br />
Keller m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />
Kellerdecke 56,00 0,90 0,24/0,3*2 0,10 5<br />
Dach m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />
Dachschräge 45,50 1,17 0,2/0,24*2 0,10 5<br />
Decke DG - Spitzboden 12,10 0,75 0,2/0,24*2 0,10 5<br />
Decke DG - Drempel 12,10 2,11 0,2/0,24*2 0,10 6<br />
Fenster m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />
Südfenster Süd 3,60 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />
West/Ostfenster Ost 5,56 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />
Nordfenster Nord 3,00 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />
Balkontür Süd 2,00 3,50 / normal 1,1/1,4*2 0,80 4<br />
Eingangstür Nord 2,00 3,50 / normal 1,1/1,4*2 0,80 4<br />
*1 Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert<br />
*2 abhängig von der Konstruktion des Bauteils (gilt für Wohngebäude)<br />
*3 U-Werte eines Passivhauses<br />
*4 Kriterien zur Bewertung siehe Anhang<br />
Den Aufbau der Strukturen finden Sie ggf. im Anhang.<br />
Keller/untere Gebäudeabgrenzung<br />
Die Abgrenzung der thermischen Hülle bildet die Kellerdecke. Der Keller ist unbeheizt. Er ist daher<br />
in die thermische Hülle des Gebäudes nicht mit einbezogen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 15
10/2010<br />
Dach/obere Gebäudeabgrenzung<br />
Die Abgrenzung der thermischen Hülle nach oben bilden die oberste Geschossdecke sowie das<br />
Dach. Der Dachraum ist beheizt. Er ist daher in die thermische Hülle des Gebäudes mit einbezogen.<br />
Wände<br />
Bei den Außenwänden handelt es sich um die Originalwände aus dem Jahr 1963. Hier wurden<br />
bisher keine dämmtechnischen Maßnahmen vorgenommen.<br />
Zustand der Fenster und Außentüren<br />
Zur seitlichen Abgrenzung der thermischen Hülle gehören die Fenster. Diese wurden im Jahre<br />
1978 ausgetauscht. Sie sind in mäßigem Zustand und schließen nicht dicht.<br />
Südfenster:<br />
Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />
West/Ostfenster:<br />
Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />
Nordfenster:<br />
Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />
3.4 Transmissionen durch Wärmebrücken<br />
Wärmebrücken sind Punkte, Winkel und Flächen der Gebäudehülle, an denen gegenüber den<br />
übrigen Bauteilen erhöhte Transmissionen stattfinden. Man unterscheidet geometrische und<br />
konstruktive, lineare und flächenhafte Wärmebrücken. Im Folgenden werden - falls vorhanden -<br />
solche Wärmebrücken betrachtet, die nicht bereits in die Kalkulation der Bauteil-Transmissionen<br />
eingegangen sind.<br />
Im Normalfall werden Wärmebrücken mit einem Pauschalwert berücksichtigt.<br />
Weitere Erläuterungen finden Sie ggf. im Anhang.<br />
Bei der Berechnung nach <strong>Energie</strong>-Einsparverordnung (EnEV) wurde ein pauschaler Aufschlag für<br />
die Wärmebrücken von 0,1 W/m²K auf die U-Werte der Gebäudehülle verwendet.<br />
3.5 Thermografische Untersuchung des Gebäudes<br />
Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das Temperaturverteilungen sichtbar macht. Mit Hilfe<br />
einer Spezialkamera werden Aufnahmen des Gebäudes gemacht, um die Temperatur der<br />
Gebäudehülle an der Außenfläche zu erfassen. Hier werden anhand von Farbverläufen die<br />
Temperatur an der Oberfläche des Gebäudes sichtbar.<br />
"Warme" Flächen zeigen die besonders hohen Verluste der Wärme durch die Gebäudehülle an.<br />
Hier sind also Dämmung bzw. Fenstererneuerung sinnvoll. "Kalte" Flächen zeigen einen guten<br />
Dämmzustand an.<br />
Solche Aufnahmen können nur sinnvoll bei großen Temperaturunterschieden zwischen innen<br />
(Gebäude-Inneres) und außen (Umfeld) gemacht werden (10°C bis 15°C Temperaturunterschied).<br />
D.h. das Gebäude muss zum Zeitpunkt der Aufnahme beheizt sein und die Außentemperatur muss<br />
niedrig sein (Morgenstunden in kalter Jahreszeit). Außerdem sollte das Gebäude zum Zeitpunkt<br />
der Aufnahme (und ein paar Stunden vorher) nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt<br />
gewesen sein.<br />
Die folgenden Aufnahmen stellen Ansichten des Objektes sowohl in Fehl- als auch in Echtfarben<br />
gegenüber.<br />
***Bitte fügen Sie hier Fotos bzw. Thermografien des Gebäudes ein.****Bitte beschreiben Sie hier<br />
die in den Thermografieaufnahmen verwendeten Farbverläufe.****Bitte beschreiben Sie hier die<br />
erkannten Schwachstellen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 16
3.6 Beschreibung und Bewertung der Lüftung<br />
10/2010<br />
Lüftung findet in jedem Gebäude zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt.<br />
Unkontrollierte Lüftungswärmeverluste finden im Wesentlichen durch Fenster- und Türfugen bzw. -<br />
Schwellen statt. Aber auch Mauerwerk, Maueranschlüsse, Trockenbaufugen etc. können zu hohen<br />
Lüftungswärmeverlusten führen. Im vorliegenden Bericht wurde dies berücksichtigt durch<br />
Einschätzung der Fugendichtigkeit.<br />
Ein gewisses Maß an Lüftung ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig, da Menschen und<br />
Pflanzen atmen und dazu Sauerstoff benötigen (siehe dazu ggf. Anmerkungen im Anhang).<br />
Feuchtigkeit muss abgeführt werden, um Schimmelbildung abzuwehren. Vermehrt in modernen<br />
Baustoffen, Kunststoffen, Belägen, Fasern etc. auftretende Schadstoffe müssen ebenso abgeführt<br />
werden. Notwendig ist daher eine Mindest-Luftwechselrate von 0,3 (Austausch der gesamten Luft<br />
in 3,3 Stunden). Ist eine Lüftungsanlage (mechanische Lüftung) vorhanden, so wird die Rate exakt<br />
dimensioniert und hier so berücksichtigt. Im Falle der manuellen Lüftung wurde auch dieser Wert<br />
aufgrund Ihrer Angaben eingeschätzt. Mündlich wurden dazu ergänzende Hinweise gegeben.<br />
Die Lüftung erfolgt natürlich über Fenster (Kipp- und Stoßlüftung).<br />
Die Lüftung erfolgt im gesamten Objekt natürlich über Kipp- und Stoßlüftung der Fenster. Dabei<br />
wurde mit einem Luftwechsel von 0,10 pro Stunde gerechnet.<br />
3.7 Luftdichtigkeitsprüfung des Gebäudes<br />
Erläuterung:<br />
Mit dem Differenzdruck-Messverfahren (auch: Blower-Door-Test) wird die Luftdichtheit eines<br />
Gebäudes gemessen. Das Verfahren dient dazu, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren und<br />
die Luftwechselrate zu bestimmen. Durch die Druckdifferenzen wird eine konstante Windlast auf<br />
das zu messende Gebäude simuliert.<br />
Bei der Messung geht es um zwei Ziele. Erstens darf die Luftmenge, die der Ventilator fördert und<br />
die durch unvermeidliche Fugen usw. entweicht, höchstens 3,0 mal in der Stunde die Luft im<br />
Gebäude austauschen (Vorgabe durch die deutsche <strong>Energie</strong>einsparverordnung, bei Gebäuden mit<br />
Lüftungsanlagen höchstens 1,5 mal) und zweitens sollen bei der Messung auch die Fehlstellen<br />
lokalisiert und dokumentiert werden, damit diese beseitigt werden können. Es nützt also nichts,<br />
einen Blower-Door-Test durchzuführen, dann festzustellen, dass die Norm nicht eingehalten wird<br />
(keine Erstellung des Zertifikates möglich) ohne eine genaue Ortung der Leckstellen vorzunehmen.<br />
Die letzte Forderung ist nicht direkt Gesetz, sondern gehört zu den allgemeinen anerkannten<br />
Regeln der Technik, auf deren Einhaltung der Bauherr auch ohne besondere Vereinbarung<br />
Anspruch hat.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 17
10/2010<br />
Deshalb müssen Fehlstellen rechtzeitig erkannt und beseitigt werden.<br />
Der Blower-Door-Test wurde in drei Schritten durchgeführt:<br />
Im ersten Schritt wurde ein konstanter Unterdruck von 50 Pa erzeugt und aufrecht erhalten.<br />
Währenddessen wurde die Gebäudehüllfläche nach Leckagen (undichte Stellen) abgesucht, an<br />
denen Luft unerwünscht herein strömt. Bei der Nutzung des Gebäudes sind die Leckagen Stellen,<br />
an denen Luft und damit Wärme entweicht.<br />
Im zweiten Schritt wurde ein Unterdruck aufgebaut, wobei mit kleinen Drücken (20 Pa) begonnen<br />
wurde und schrittweise bis auf den Enddruck von 100 Pa erhöht wurde. Bei jedem Schritt wurde<br />
der jeweilige Luftvolumenstrom in Abhängigkeit von dem Gebäudedruck gemessen und protokolliert.<br />
Im letzten Schritt wurde ein Überdruck erzeugt und die Messung wurde analog zur Unterdruckmessung<br />
wiederholt.<br />
Aus den gesamten Ergebnissen des Über- und Unterdruckes des Gebäudes ergibt sich eine<br />
mittlere Luftwechselrate (n50-Wert) von 0,0 1/h. Dieser gibt an, wie oft sich die Luft in dem<br />
gemessenen Gebäude durch Luftleckagen bei einem Referenzdruck von 50 Pa erneuert. Ein n50-<br />
Wert = 0,0 bedeutet, dass die Luft in dem Gebäude bei einer Druckdifferenz von 50 Pa in einer<br />
Stunde 0,0 mal durch Luftundichtigkeiten austauscht wird. Der genaue Ablauf der Messung ist in<br />
DIN EN 13829 geregelt.<br />
3.8 Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage<br />
1. Heizsystem Wärmeversorgung mit einer Deckung von 100 %, 1 Einheit(en)<br />
Angaben zur Wärmeabgabe<br />
Regelung: Thermostat mit 2° Schaltdifferenz<br />
Heizkreistemperatur: 70/55 °C<br />
Nachtabsenkung um: 2,0 °C über 7,0 Stunden<br />
Hydraulischer Abgleich: ja/nein: N<br />
Angaben zur Verteilung (je Einh.) Länge Dämmung<br />
Leitung zwischen Erzeuger und beheizt: 0,0 m teilweise<br />
Steigleitung<br />
unbeheizt: 20,0 m<br />
Steigleitung: 12,4 m mäßig<br />
Anbindungen: 91,3 m mäßig<br />
Pumpe: geregelt (Ja/Nein): N mit 50 Watt<br />
1. Erzeuger: Zentralheizung mit einer Deckung von 100 %<br />
Dieser Erzeuger gehört zu dem Heizungsstrang: Wärmeversorgung<br />
Angaben zum Erzeuger<br />
Art: Zentralheizung<br />
Technik: Standard-Kessel<br />
Baujahr: 1975<br />
<strong>Energie</strong>träger: Heizöl_EL in l<br />
Leistung: 20,0 kW<br />
Kesseldämmung: mittel<br />
Einschaltdauer: 5.520 Stunden<br />
Abgasverluste: 12,0 %<br />
rel. Bereitschaftsverluste: 0,8 %<br />
zusätzlicher Stromverbrauch: 33 W<br />
Jahresnutzungsgrad: 80,8 %<br />
Dimensionierung: 123,5 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 18
10/2010<br />
In dem betrachteten Gebäude gibt es eine Zentralheizung, die im Keller aufgestellt ist. Als<br />
ausschlaggebende Faktoren spielen hier die Leistung (Dimensionierung), die genutzte Technik, die<br />
Jahreslaufzeit, der Brennstoff und das Alter eine große Rolle. In einem 20 kW-Kessel von 1975<br />
wird Heizöl_EL verheizt. Es wird ein Kessel (Vorlauftemp.
Daten der Photovoltaik-Anlage<br />
Fläche m² 10,0<br />
Neigung ° 30,0<br />
Orientierung Süd<br />
Gebäudeintegration Aufdach<br />
Module monokristallines Silicium<br />
Spitzenleistung kWpeak 1,20<br />
Ergebnisse [kWh]<br />
Januar 34<br />
Februar 71<br />
März 104<br />
April 153<br />
Mai 191<br />
Juni 178<br />
Juli 194<br />
August 179<br />
September 130<br />
Oktober 87<br />
November 45<br />
Dezember 24<br />
Summe 1.390<br />
Vergütung<br />
Jahr der Inbetriebnahme 2010<br />
Einspeisevergütung €/kWh 0,39<br />
Vergütung selbst genutzter Strom €/kWh 0,23<br />
Erlöse ca. €/Jahr 544<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Ertragsdaten der Photovoltaik-Anlage:<br />
10/2010<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 20
3.11 Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude<br />
10/2010<br />
Insbesondere bei Altbauten sind im Laufe der Jahrzehnte meist zahlreiche Umbaumaßnahmen am<br />
Gebäude oder der Anlagentechnik vorgenommen worden, die aus den vorhandenen Plänen oder<br />
bei einer Vor-Ort-Begehung nicht unmittelbar hervorgehen.<br />
3.12 <strong>Energie</strong>bilanz im Ist-Zustand<br />
Die <strong>Energie</strong>bilanz eines Gebäudes ergibt sich aus den <strong>Energie</strong>strömen in das Gebäude und aus<br />
ihm heraus (Zufluss, Gewinne und Abfluss, Verluste). Erläuterungen zur <strong>Energie</strong>bilanz finden Sie<br />
im Abschnitt "Allgemeines".<br />
Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich wie<br />
folgt:<br />
Nachfolgend zeigen wir Ihnen die <strong>Energie</strong>ströme im Einzelnen:<br />
<strong>Energie</strong>zufuhr<br />
Sonne [kWh/a] %<br />
von Norden 153 0,4<br />
von Süden 661 1,5<br />
von Westen 0 0,0<br />
von Osten 415 1,0<br />
Summe 1.229 2,9<br />
Abwärme<br />
Personen 662 1,5<br />
Geräte 926 2,2<br />
Summe 1.589 3,7<br />
Heizung<br />
Heizenergie 40.158 93,4<br />
Summe 42.975 100,0<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 21
<strong>Energie</strong>abfluss<br />
Transmission: [kWh/a] %<br />
Dach 7.210 16,8<br />
Keller 3.145 7,3<br />
Außenwände 12.306 28,6<br />
Fenster 5.037 11,7<br />
Wärmebrücken 2.433 5,8<br />
Summe 30.181 70,2<br />
Lüftung<br />
Fensterfugen 2.409 5,6<br />
Bewohner 687 1,6<br />
Summe 3.096 7,2<br />
Wasser<br />
Kaltwasserabfluss 520 1,2<br />
Warmwasserabfluss 588 1,4<br />
Summe 1.108 2,6<br />
Heizung<br />
Leitungsverluste WW 2.011 4,7<br />
Speicherverluste 165 0,4<br />
Betriebsverluste 4.279 10,0<br />
Bereitschaftsverluste 616 1,4<br />
Verteilungsverluste 2.451 5,7<br />
Sonstige Verluste -932 -2,2<br />
Summe 8.590 20,0<br />
Summe 42.975 100,0<br />
10/2010<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 22
Gesamt-<strong>Energie</strong>einsatz und <strong>Energie</strong>kennzahl<br />
10/2010<br />
Der vorgefundene energetische Zustand des Gebäudes wird bemessen nach dem Gesamtenergiebedarf<br />
und in Beziehung zu vergleichbaren Gebäuden durch die <strong>Energie</strong>kennzahl gesetzt. Die<br />
<strong>Energie</strong>kennzahl ist die <strong>Energie</strong>menge, die im Laufe eines Jahres für die Beheizung eines<br />
Quadratmeters Wohnfläche (o.a. Bürofläche etc.) aufgewendet werden soll. Ausgangspunkt für die<br />
Berechnung der <strong>Energie</strong>kennzahl sind bestimmte Randbedingungen, wie Innentemperatur,<br />
Außentemperatur etc. Der tatsächliche Heizenergie-Verbrauch kann von der berechneten<br />
<strong>Energie</strong>kennzahl abweichen und ist vom Nutzerverhalten der Bewohner abhängig (tatsächliche<br />
Innentemperatur, Lüftungsverhalten, jährliches Klima etc.).<br />
Aus dem <strong>Energie</strong>bedarf resultiert die Emission des Luftschadstoffes Kohlendioxid (CO2), der für<br />
die Klimaveränderungen verantwortlich ist.<br />
Ein weiterer Kennwert des Gebäudes ist der mittlere U-Wert der Gebäudehülle, der sich hier auf<br />
1,20 W/m²K beläuft.<br />
Die folgende Tabelle zeigt den berechneten <strong>Energie</strong>trägerbedarf für Heizung und Warmwasser:<br />
<strong>Energie</strong>träger(e) Menge in kWh Menge Einheit Preis € Kosten €<br />
Heizöl_EL 38.326 3.833 l 0,56 2.146<br />
Strom 1.831 1.831 kWh 0,07 129<br />
Preis: durchschnittlicher Preis pro Einheit<br />
Der berechnete <strong>Energie</strong>einsatz beläuft sich auf 40.158 kWh<br />
Die <strong>Energie</strong>kennzahl ist 446 kWh/m²a<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einstufung des Gebäudes entsprechend der ermittelten<br />
<strong>Energie</strong>kennzahl.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 23
Das folgende Bild zeigt Ihnen die <strong>Energie</strong>ströme im Ist-Zustand<br />
<strong>Energie</strong>verbrauch der letzten Jahre<br />
Der <strong>Energie</strong>verbrauch der letzten Jahre geht aus den Verbrauchsabrechnungen hervor.<br />
10/2010<br />
In der folgenden Tabelle werden die angegebenen Verbrauchsdaten der letzten Jahre ausgegeben.<br />
<strong>Energie</strong>träger Verbrauchsperiode Menge Einheit Heizwert<br />
Heizöl_EL 01.01.2003 bis 31.12.2003 2.800,0 l 28.000,0 kWh<br />
Heizöl_EL 01.01.2004 bis 31.12.2004 2.900,0 l 29.000,0 kWh<br />
Heizöl_EL 01.01.2005 bis 31.12.2005 2.900,0 l 29.000,0 kWh<br />
Heizöl_EL 01.01.2006 bis 31.12.2006 2.800,0 l 28.000,0 kWh<br />
Strom 01.01.2003 bis 31.12.2003 1.200,0 kWh 1.200,0 kWh<br />
Strom 01.01.2004 bis 31.12.2004 1.150,0 kWh 1.150,0 kWh<br />
Strom 01.01.2005 bis 31.12.2005 1.100,0 kWh 1.100,0 kWh<br />
Der tatsächlich beobachtete <strong>Energie</strong>einsatz belief sich in den letzten Jahren auf ca. 29.650 kWh<br />
pro Jahr.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 24
3.13 Beurteilung des Gebäudes nach der <strong>Energie</strong>einsparverordnung<br />
10/2010<br />
Mit dem Inkrafttreten der EnEV 2002 wurden die Wärmeschutzverordnung 1995 und die<br />
Heizungsanlagen-Verordnung 1998 ersetzt. Inzwischen wurde die EnEV MEHRFACH novelliert.<br />
Das Zusammenfassen bzw. Zusammenwirken der baulichen sowie heizungs- und anlagentechnischen<br />
Anforderungen bildet den zentralen Ansatzpunkt der EnEV und dient zur weiteren<br />
Absenkung des Heizenergiebedarfs.<br />
Im Nachweis wird der Primärenergiebedarf nachgewiesen. Dieser setzt sich aus dem Heizenergiebedarf,<br />
dem <strong>Energie</strong>bedarf für die Warmwassererzeugung, -speicherung und -verteilung und aller<br />
benötigten Hilfsenergien zusammen. Weiterhin berücksichtigt das Berechnungsverfahren den<br />
Einfluss von Luftdichtheit und Wärmebrücken.<br />
Im Rahmen dieses Berichtes werden die Berechnungen des öffentlich-rechtlichen <strong>Energie</strong>einsparungsnachweises<br />
durchgeführt, der im Wesentlichen durch folgende Vorgaben gekennzeichnet ist:<br />
- unabhängig vom regionalen Standort des Gebäudes. Innerhalb Deutschlands wird ein<br />
einheitliches Klima (Normklima) vorgegeben<br />
- "Nutzer-Normverhalten", z.B. 19 °C Raumtemperatur, 12,5 kWh/m²AN Warmwasserbedarf<br />
- für das Monatsbilanzverfahren werden zulässige Vereinfachungen und Anwendungsgrenzen<br />
festgelegt<br />
Es wird daraus ersichtlich, dass der nach EnEV ermittelte Primärenergiebedarf mit dem zu<br />
erwartenden Primärenergieverbrauch nicht übereinstimmen kann. In diesem Bericht verwenden<br />
wir dafür ein alternatives Berechnungsverfahren (LEG), welches dem zu tatsächlichen <strong>Energie</strong>verbrauch<br />
sehr nahe kommt.<br />
Weitere, nicht kalkulierbare Unsicherheitsfaktoren stellen die stark vom Nutzerverhalten<br />
abhängigen Lüftungswärmeverluste und der Warmwasserverbrauch dar. Das Nutzerverhalten kann<br />
in solchen Berechnungsverfahren nur durch Pauschalwerte bzw. gar nicht berücksichtigt werden.<br />
Folgende Tabelle zeigt Ihnen die Berechnungsergebnisse nach EnEV:<br />
Berechnungsergebnis ermittelt Anforderung(Bestand)<br />
Transmissionswärmeverluste 1,22 0,56 W/Km²<br />
Primärenergiebedarf 613,4*) 149,5 kWh/m²a<br />
*)Hinweis: Die Ausgabe des Primärenergiebedarfs ist ohne Gewähr. Diese Angabe kann nach EnEV unter bestimmten<br />
Bedingungen nicht berechnet werden (z.B. bei einer Anlage, die nicht nach DIN gerechnet werden kann).<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 25
3.14 Schwachstellen des Gebäudes<br />
10/2010<br />
Energetische Schwachstellen am Gebäude anhand der Berechnungsergebnisse für den Ist-<br />
Zustand sind:<br />
- Heizungsanlage<br />
- Außenwände<br />
- Dach<br />
Die Heizungsanlage verursacht ca. 9500 kWh Verluste. Hier sollten die Leitungen gedämmt, die<br />
Anlage getauscht und ein hydraulischer Abgleich vorgenommen werden.<br />
Über die Außenwände sind ca. 11.200 kWh als Transmissionsverluste zu verzeichnen. Eine<br />
Außenwanddämmung wird hier also angeraten.<br />
Einen weiteren hohen Verlust verursachen das Dach und die Fenster. Die Fenster sollten im Zuge<br />
der Außenwanddämmung gegen hochwertige Fenster ausgetauscht werden.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 26
4 Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude<br />
10/2010<br />
Das Umweltbundesamt (UBA) Das Umweltbundesamt (UBA) hat errechnet, dass ein Haushalt bis<br />
zu 30 Prozent <strong>Energie</strong> und somit mindestens hundert Euro im Jahr durch einen bewussten<br />
Umgang mit Strom einsparen kann - bei gleichem Komfort. Dazu gehören auch einfache<br />
Maßnahmen.<br />
Die folgende Grafik gibt Ihnen ein Beispiel, wie Strom gespart werden kann:<br />
Erläuterungen zum Stromsparen finden Sie auch im Internet unter www.stromeffizienz.de.<br />
Während der Analyse des betrachteten Gebäudes wurden auch die Ausstattung und der Einsatz<br />
von Stromverbrauchern untersucht. Der Haushalt ist überdurchschnittlich mit Geräten ausgestattet.<br />
Diese weisen eine mittlere <strong>Energie</strong>effizienz auf bzw. werden normal eingesetzt. Es gibt ein großes<br />
Einsparpotenzial.<br />
Für das Gebäude/den Haushalt wurden folgende Daten ermittelt:<br />
Strombedarf aktuell 3.994 kWh/a<br />
Strombedarf im Durchschnitt 3.039 kWh/a<br />
Strombedarf effizient 1.362 kWh/a<br />
Bei der Ermittlung des durchschnittlichen und effizienten Strombedarfs wurden die Wohnfläche und<br />
die Personenzahl zu Grunde gelegt.<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen den anteilmäßigen Strombedarf im betrachteten Gebäude/Haushalt:<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 27
10/2010<br />
Strompreisentwicklung der letzten Jahre<br />
Seit 2000 sind die Strompreise um circa 50 Prozent gestiegen. So beliefen sich die Stromkosten<br />
für einen Drei-Personen-Haushalt im Jahr 2000 bei einem jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh<br />
(ohne Nachttarif-Anteil) auf monatlich 40,66 €. Im April 2007 musste eine Familie hierfür 60,22 €<br />
zahlen. Seither sind die Kosten weiter gestiegen.<br />
Der Anteil der staatlich verursachten Belastungen des Strompreises hat sich von 38 Prozent im<br />
Jahr 2000 auf lediglich rund 40 Prozent im Jahr 2007 erhöht (Stromsteuer, Erneuerbare-<strong>Energie</strong>n-<br />
Gesetz – EEG, Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz – KWKG, Mehrwertsteuererhöhung). Die<br />
Strombeschaffungspreise sind in gleichem Zeitraum um fast 100 Prozent von 2,5 auf 5 Cent pro<br />
Kilowattstunde gestiegen.<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Strompreisentwicklung von 2000 bis 2010 für einen Drei-<br />
Personen-Musterhaushalt im Monat in Euro:<br />
Quelle: Bundesverband der <strong>Energie</strong>- und Wasserwirtschaft (BDEW); für 2010 wurde eine Prognose angegeben<br />
Konkret würde die Beherzigung folgender Einspartipps den Stromverbrauch im betrachteten<br />
Gebäude reduzieren. Weitere allgemeine Erläuterungen und Möglichkeiten finden Sie im Anhang.<br />
Folgende Maßnahmen lassen sich direkt und ohne Kosten umsetzen:<br />
- Viele elektrische oder elektronische Geräte - vor allem auch die aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik<br />
- schalten sich nicht vollständig ab, sondern schalten in den Stand-By-Modus,<br />
einen Betriebszustand, in dem weiterhin einige Watt Strom aufgenommen wird. Schalten Sie<br />
Ihre Geräte daher vollständig ab. Fünf bis zehn Prozent Strom spart ein, wer zum Beispiel<br />
Geräte völlig vom Strom trennt, statt sie im Stand-by-Betrieb "schlummern" zu lassen. Dabei<br />
helfen so genannte Powersafer. Der Powersafer trennt alle nachgeschalteten Geräte bei<br />
Nichtbenutzung komplett vom Netz, die Re-Aktivierung erfolgt über die Infrarot-Fernbedienung<br />
des Geräts. Dadurch wird der stromfressende "Stand-by"-Zustand verhindert und man spart<br />
jährlich rund 50 Euro Stromkosten. Steckdosenleisten mit Schalter dienen dem gleichen Zweck.<br />
- Beladen Sie Ihre Waschmaschine immer vollständig. Damit nutzen Sie Wasser und Strom<br />
besser aus. Wenn Sie die Wäsche zuvor nach Temperatur sortieren (Buntwäsche 30°), Weißwäsche<br />
30-60° - "Kochwäsche" gibt es heute gar nicht mehr - sparen Sie viel Strom und<br />
schonen überdies die Wäsche.<br />
- Schließen Sie Ihre Waschmaschine an das Warmwasser an. Dazu bieten viele Hersteller<br />
Vorschaltgeräte an, die einen Schutz der Wäsche vor zu hohen Temperaturen bieten. Voraussetzung<br />
ist eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder eine moderne Zentralheizung. Im<br />
Gegensatz zum Heizstab der Waschmaschine wird das Warmwasser viel umweltfreundlicher<br />
und preiswerter bereitet. Die Ersparnis je Haushalt und Maschine liegt zwischen 50 und 90%.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 28
10/2010<br />
- Beladen Sie den Geschirrspüler effektiv und reinigen Sie den Filter häufig. Sie betreiben so die<br />
Maschine seltener und mit besserem Ergebnis.<br />
- Schließen Sie Ihren Geschirrspüler wenn möglich an das Warmwasser an. Voraussetzung ist<br />
eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder eine moderne Zentralheizung. Im Gegensatz<br />
zum Heizstab der Spülmaschine wird das Warmwasser viel umweltfreundlicher und preiswerter<br />
bereitet. Die Leitung sollte allerdings nicht zu lang sein.<br />
- Schalten Sie nicht verwendete Lampen aus. Beim Verlassen des Raumes sollte die Lampe<br />
abgeschaltet werden. Auch <strong>Energie</strong>sparlampen und Halogenlampen schadet das Ausschalten -<br />
entgegen landläufiger Meinung - nicht.<br />
- Der Einsatz zusätzlicher Heizgeräte lässt sich oft vermeiden. Gänzlich verzichtet werden sollte<br />
auf das Heizen im Freien ("Heizpilze" etc.). Sie kosten enorme <strong>Energie</strong>mengen und sind<br />
vergleichsweise wirkungslos.<br />
- Überprüfen Sie den Einsatz stromintensiver Geräte: wie oft, wie lange verwenden Sie sie? Ist<br />
der Einsatz nötig? So kann z.B. auf das Warmhalten oft verzichtet werden (Thermoskanne<br />
besser als Kaffeemaschine mit Warmhalteplatte).<br />
- Verzichten Sie auf indirekte Deckenfluter. Gemessen an der Stromaufnahme (oft 300 W!) ist die<br />
Lichtausbeute vergleichsweise gering. Indirektes Licht sollte allenfalls zur Hintergrundaufhellung<br />
verwendet werden, zur Beleuchtung immer direktes Licht.<br />
- Achten Sie beim Einkauf von Geräten auf <strong>Energie</strong>effizienz. Dies gilt in besonderem Maße für<br />
Großgeräte (Kühlschrank...) aber auch Kleingeräte wie Wecker, Faxgeräte, Router, Telefone<br />
haben über die Laufzeit (ständige Betriebsbereitschaft) einen hohen Verbrauch.<br />
- Mit der sachgerechten Nutzung der Kühlgeräte können Sie Strom und damit Geld sparen: legen<br />
Sie niemals warme Speisen in die Geräte, lassen Sie sie zuvor erst vollständig abkühlen.<br />
Beachten Sie, dass die größte Kälte unten liegt und pegeln Sie die Temperatur ausreichend,<br />
aber nicht zu tief ein.<br />
Folgende Maßnahmen kosten nur wenig Geld:<br />
- Setzen Sie - wo immer möglich - schaltbare Steckerleisten ein. So können Sie bequem mit<br />
einem Klick alle angeschlossenen Geräte (z.B. Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Stereo-<br />
Anlage, PC) vom Netz nehmen. Sie vermeiden so unnötigen Stand-By-Stromverbrauch.<br />
- Verwenden Sie statt Kochtopf einen separaten Wasserkocher. Dieser erhitzt das Wasser direkt<br />
und ist daher effektiver. Auf keinen Fall sollten Sie ohne Deckel kochen. Viele Gerichte lassen<br />
sich mit einem Dampfdrucktopf schnell, schonend und energieeffizient kochen.<br />
- Setzen Sie überall <strong>Energie</strong>sparlampen ein. Bei der jetzigen Generation von Lampen gibt es<br />
keinerlei Einsatzeinschränkungen mehr. Verwenden Sie hier eine hohe Qualität und Sie haben<br />
praktisch unbegrenzt Freude daran.<br />
- Eine Zeitschaltuhr kann bestimmte Prozesse abkürzen und damit <strong>Energie</strong> sparen. Beispielsweise<br />
ist damit ein Außenlicht nicht länger im Betrieb als notwendig.<br />
- Durch Präsenzmelder (Bewegungsmelder) stellen Sie die Anwesenheit von Personen fest. So<br />
kann man z.B. steuern, dass Licht nur dann eingeschaltet wird, wenn Personen das Licht auch<br />
nutzen. Dies wird obendrein als sehr komfortabel empfunden.<br />
- Auf einen Wäschetrockner kann man fast immer verzichten. Der geringe Mehraufwand beim<br />
Aufhängen an der freien Luft, auf dem Dachboden oder im Keller wird Ihnen gedankt durch<br />
frische, geschonte Wäsche und eine geringere Stromrechnung.<br />
Folgende Maßnahmen sind kostenintensiv, aber lohnend:<br />
Schließlich empfehlen wir auch Maßnahmen, die zwar Geld kosten, aber sehr lohnend sein<br />
können. In manchen Fällen werden Sie erst eine Gelegenheit abwarten, z.B. wenn das Gerät seine<br />
Lebensdauer erreicht hat.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 29
10/2010<br />
- Die Heizungspumpe ist ein oft unterschätzter Stromfresser. Abhängig von der Steuerung der<br />
Heizung läuft diese Pumpe oft auf voller Drehzahl die gesamte Heizperiode hindurch. Sie<br />
verursacht dabei mitunter den größten Teil an der Stromrechnung. Untersuchungen haben klar<br />
ergeben, dass sich der Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe in jedem Fall lohnt (oft schon<br />
nach Monaten), und nicht erst, wenn sie ausfällt.<br />
- Eine lange laufende Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung verursacht hohe<br />
<strong>Energie</strong>verluste. Ist die Zirkulation überhaupt nötig (nur bei langen Leitungswegen), so sollte sie<br />
nur in der unbedingt nötigen Zeit laufen. Dies kann durch intelligente Regelungen (Präsenzmeldung)<br />
sichergestellt werden.<br />
- Kaufen Sie Kühlgeräte nur von der höchsten <strong>Energie</strong>effizienzklasse. Dies ist heute die Klasse<br />
A++. Da diese Geräte ständig laufen, lassen sich die Mehrkosten schnell erwirtschaften. Eine<br />
alte <strong>Energie</strong>schleuder sollte sofort ersetzt werden (sie kann dann ja im Keller noch bei Partys ein<br />
Gnadenbrot fristen).<br />
- Setzen Sie bei Überhitzung der Wohnung keine aktive Kühlung ein. Durch effektiven (außenliegenden)<br />
Sonnenschutz, Nachtlüftung und andere Maßnahmen lässt sich hier unter Umständen<br />
viel Strom einsparen.<br />
- Interessant ist die Möglichkeit, mit Lichtlenkung die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung zu<br />
reduzieren. Durch Lichtlenkung kann Tageslicht blendfrei in die Tiefe des Raumes transportiert<br />
werden.<br />
- Im Außenbereich lassen sich fertige Module zur Versorgung mit Solarstrom verwenden. Dies<br />
bietet sich für alle Arten von Außenbeleuchtung, aber auch z.B. für Teichpumpen/Springbrunnen<br />
an.<br />
Bemerkungen zum Stromverbrauch<br />
Stromanbieter und regenerativer Strom<br />
Eine Kosteneinsparung lässt sich eventuell durch einen Stromanbieterwechsel erreichen.<br />
Beobachten Sie daher den Markt, seien Sie dabei kritisch und achten Sie darauf, dass Ihr Anbieter<br />
ganz oder weitestgehend zertifizierten Ökostrom (aus regenerativen <strong>Energie</strong>quellen) liefert.<br />
Vielleicht möchten Sie ja auch selbst Strom produzieren: wir haben Sie über die Möglichkeiten<br />
einer PV-Anlage und über Kraft-Wärmekopplung (Blockheizkraftwerk) informiert. Ist so etwas in<br />
Ihrem Haus nicht möglich, so bietet sich vielleicht auch die Beteiligung an einem solchen Projekt<br />
an.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 30
5 Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparvarianten<br />
10/2010<br />
Aus der Analyse der einzelnen Bauteile sowie der Heizungs- und Warmwasseranlage werden die<br />
folgenden <strong>Energie</strong>sparmaßnahmen abgeleitet und deren Wirtschaftlichkeit berechnet.<br />
Schwerpunkt ist die Erarbeitung einer baulich und anlagentechnisch optimalen und wirtschaftlichen<br />
Lösung für das Objekt, wobei neben der Einhaltung von Normen und Richtlinien, die Umsetzbarkeit,<br />
der zu erwartende <strong>Energie</strong>verbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen bewertet<br />
werden sollen.<br />
Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Variante sollte allerdings nicht allein den Ausschlag für<br />
eine Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme geben. Vielmehr sollen auch andere, hier nicht<br />
näher untersuchte (weil nicht quantifizierbar und nur subjektiv zu beurteilen) Kriterien eine Rolle<br />
spielen. Genannt seien hierbei Aspekte des höheren Komforts (z.B. Raumklima), der Wertsteigerung,<br />
der Ästhetik und des sozialen Umfeldes.<br />
Rechtliche Hinweise<br />
Besonderheiten hinsichtlich Denkmalschutz, Brandschutzbestimmungen, Abstand zu Nachbargebäuden,<br />
ggf. erforderliche Baulasteintragung ins Grundbuch, usw. die bei den empfohlenen<br />
Maßnahmen evtl. zu berücksichtigen sind.<br />
Nachfolgend werden die betrachteten Varianten zur <strong>Energie</strong>einsparung aufgeführt.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 31
5.1 Variante: Sanierung Gebäudehülle<br />
5.1.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />
Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />
energetisch<br />
Endenergiebedarf 40.158 10.867 [kWh/a] 72,9 %<br />
Endenergie (EKZ)<br />
wirtschaftlich<br />
446,2 121,0 [kWh/m²a] 72,9 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten 2.275 635 [€/a] 72,1 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 7,06 [€/m²a] 72,1 %<br />
Gesamtinvestition 21.222 [€]<br />
_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />
_Förderung 0 [€]<br />
Investition 21.222 [€]<br />
Investition /m² 235,8 [€/m²]<br />
Amortisation 12 [Jahre]<br />
Kapitalwert<br />
Emissionen<br />
54.472 [€]<br />
CO2-Emissionen 146,3 45,1 [kg/m²a] 69,2 %<br />
SO2-Emissionen 167,7 47,3 [g/m²a] 71,8 %<br />
NOx-Emissionen 125,2 37,3<br />
Staub 5,3 2,0<br />
10/2010<br />
[g/m²a] 70,2 %<br />
[g/m²a] 61,7 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 32
10/2010<br />
Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />
wie folgt:<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />
Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />
handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 33
5.1.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Gebäudehülle<br />
10/2010<br />
Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />
Schrägdach, Untersparrendämmung 45,00 €/m² 2.048 €<br />
Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal 0,00 € 0 €<br />
Deckendämmung einblasen, begehbar 30,00 €/m² 726 €<br />
Kellerdeckendämmung abgehängt 30,00 €/m² 1.680 €<br />
Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 65,00 €/m² 8.064 €<br />
Innendämmung, Kalzium Silikatplatten 80,00 €/m² 125 €<br />
Fensteraustausch, Passivhausqualität 500,00 €/m² 8.080 €<br />
Blower-Door-Test 500,00 € 500 €<br />
Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />
Schrägdach, Untersparrendämmung<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 25,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 45,50 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Dachschräge 45,50 m² 2.047,50 € 1,17 / 0,12 W/m²K<br />
Summe 45,50 m² 2.047,50 € entspricht 45,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal<br />
Die Wärmebrücken werden pauschal auf den Faktor 0,05 verbessert.<br />
Deckendämmung einblasen, begehbar<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 25,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 24,20 m²<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Decke DG - Spitzboden 12,10 m² 363,00 € 0,75 / 0,11 W/m²K<br />
Decke DG - Drempel 12,10 m² 363,00 € 2,11 / 0,13 W/m²K<br />
Summe 24,20 m² 726,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Kellerdeckendämmung abgehängt<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 12,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 56,00 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Kellerdecke 56,00 m² 1.680,00 € 0,90 / 0,22 W/m²K<br />
Summe 56,00 m² 1.680,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 34
Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem<br />
10/2010<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 18,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 124,06 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Außenwände 122,50 m² 7.962,50 € 0,90 / 0,16 W/m²K<br />
Gaubenwand 1,60 m² 101,40 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />
Summe 124,06 m² 8.063,90 € entspricht 65,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Innendämmung, Kalzium Silikatplatten<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 12,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,040 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 1,56 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Gaubenwand 1,60 m² 124,80 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />
Summe 1,56 m² 124,80 € entspricht 80,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Fensteraustausch, Passivhausqualität<br />
Daten der Fenster<br />
Fenster-Uw-Wert 0,80 W/m²K<br />
g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) 0,70<br />
Nutzungsdauer 25 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche Kosten U-Wert alt / neu1)<br />
Südfenster 3,60 m² 1.800,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
West/Ostfenster 5,60 m² 2.780,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Nordfenster 3,00 m² 1.500,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Balkontür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Eingangstür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Summe 16,16 m² 8.080,00 € entspricht 500,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um den Uw-Wert (Gesamtkonstruktion)<br />
Blower-Door-Test<br />
Es wird ein Blower-Door-Test durchgeführt. Diese Maßnahme ermöglicht eine Prüfung der<br />
Dichtheit des Gebäudes und wird in der EnEV-Berechnung berücksichtigt.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 35
5.2 Variante: Sanierung Anlage<br />
5.2.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />
Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />
energetisch<br />
Endenergiebedarf 40.158 36.054 [kWh/a] 10,2 %<br />
Endenergie (EKZ)<br />
wirtschaftlich<br />
446,2 401,0 [kWh/m²a] 10,1 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten 2.275 1.135 [€/a] 50,1 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 12,61 [€/m²a] 50,1 %<br />
Gesamtinvestition 10.699 [€]<br />
_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />
_Förderung 0 [€]<br />
Investition 10.699 [€]<br />
Investition /m² 118,9 [€/m²]<br />
Amortisation 9 [Jahre]<br />
Kapitalwert<br />
Emissionen<br />
18.842 [€]<br />
CO2-Emissionen 146,3 8,7 [kg/m²a] 94,0 %<br />
SO2-Emissionen 167,7 -6,0 [g/m²a] 103,6 %<br />
NOx-Emissionen 125,2 282,8<br />
Staub 5,3 147,9<br />
10/2010<br />
[g/m²a] -126,0 %<br />
[g/m²a] -2.702,7 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 36
10/2010<br />
Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />
wie folgt:<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />
Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />
handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 37
5.2.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage<br />
10/2010<br />
Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />
Pelletheizkessel 8250,00 € 8.250 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter 550,00 € 550 €<br />
TWW-Speicher klein - (150 l) 500,00 € 500 €<br />
Heizleitungen alle dämmen 7,00 € 866 €<br />
TWW Leitungen dämmen 7,00 €/m 183 €<br />
Elektronisch geregelte Heizungspumpe 350,00 € 350 €<br />
Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />
Pelletheizkessel<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Typ Zentralheizung<br />
genutzte Technik Niedertemperatur-Kessel<br />
Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />
<strong>Energie</strong>träger Holz Pellets<br />
Leistung 18 kW<br />
Abgasverlust 4,0 %<br />
Bereitschaftsverlust 2,0 %<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 8.250,00 €<br />
Summe 8.250,00 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Art der Bereitung mit Heizung (Kombi)<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Deckung 40,0 %<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 550,00 €<br />
Summe 550,00 €<br />
TWW-Speicher klein - (150 l)<br />
Daten des Warmwasserspeichers<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Volumen des Speichers 200 Liter<br />
U-Wert der Speicherhülle 0,20 W/m²K<br />
Temperatur Aufstellraum 15,0 °C<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten des Speichers 500,00 €<br />
Summe 500,00 €<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 38
5.3 Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
5.3.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />
Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />
energetisch<br />
Endenergiebedarf 40.158 36.163 [kWh/a] 9,9 %<br />
Endenergie (EKZ)<br />
wirtschaftlich<br />
446,2 402,0 [kWh/m²a] 9,9 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten 2.275 1.176 [€/a] 48,3 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 13,07 [€/m²a] 48,3 %<br />
Gesamtinvestition 20.138 [€]<br />
_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />
_Förderung 0 [€]<br />
Investition 20.138 [€]<br />
Investition /m² 223,8 [€/m²]<br />
Amortisation 17 [Jahre]<br />
Kapitalwert<br />
Emissionen<br />
8.350 [€]<br />
CO2-Emissionen 146,3 10,2 [kg/m²a] 93,0 %<br />
SO2-Emissionen 167,7 -4,9 [g/m²a] 102,9 %<br />
NOx-Emissionen 125,2 284,1<br />
Staub 5,3 148,1<br />
10/2010<br />
[g/m²a] -127,0 %<br />
[g/m²a] -2.706,9 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 39
10/2010<br />
Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />
wie folgt:<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />
Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />
handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 40
5.3.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
10/2010<br />
Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />
Pelletheizkessel 8250,00 € 8.250 €<br />
Elektronisch geregelte Heizungspumpe 350,00 € 350 €<br />
Heizleitungen alle dämmen 7,00 € 866 €<br />
TWW Leitungen dämmen 7,00 €/m 183 €<br />
Brauchwasser-Solarkollektor 350,00 € 2.339 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter 550,00 € 550 €<br />
Pufferspeicher - (1000l) 1200,00 € 1.200 €<br />
TWW-Speicher klein - (150 l) 500,00 € 500 €<br />
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 5900,00 € 5.900 €<br />
Lüftungskonzept erstellen 0,00 € 0 €<br />
Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />
Pelletheizkessel<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Typ Zentralheizung<br />
genutzte Technik Niedertemperatur-Kessel<br />
Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />
<strong>Energie</strong>träger Holz Pellets<br />
Leistung 18 kW<br />
Abgasverlust 4,0 %<br />
Bereitschaftsverlust 2,0 %<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 8.250,00 €<br />
Summe 8.250,00 €<br />
Brauchwasser-Solarkollektor<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Art der Bereitung Solaranlage<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Leistung 10,0 kW<br />
Deckung 60,0 %<br />
Arbeitszahl 40,0<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 3,54 m² 350,00 € /m²<br />
zusätzliche Kosten einmalig 1.100,00 €<br />
Summe 2.339,00 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Art der Bereitung mit Heizung (Kombi)<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Deckung 40,0 %<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 550,00 €<br />
Summe 550,00 €<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 41
Pufferspeicher - (1000l)<br />
10/2010<br />
Daten des Pufferspeichers<br />
Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />
Aufstellung im Beheizten<br />
Volumen des Speichers 1.000 l<br />
Nennleistung der Ladepumpe 20 W<br />
Bereitschaftswärmeverlust 3,70 kWh/d<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten des Pufferspeichers 1.200,00 €<br />
Summe 1.200,00 €<br />
TWW-Speicher klein - (150 l)<br />
Daten des Warmwasserspeichers<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Volumen des Speichers 200 Liter<br />
U-Wert der Speicherhülle 0,20 W/m²K<br />
Temperatur Aufstellraum 15,0 °C<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten des Speichers 500,00 €<br />
Summe 500,00 €<br />
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung<br />
Daten der Lüftungsanlage<br />
Art Lüftung mit WRG (o.WP)<br />
Lüftungsbereich Lüftung<br />
Anteil der Luftversorgung 100 %<br />
Luftwechsel 0,25 h-1<br />
Wärmerückgewinnung 75 %<br />
Arbeitszahl 30,0<br />
Nutzungsdauer 25 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 5.900,00 €<br />
Summe 5.900,00 €<br />
Lüftungskonzept erstellen<br />
Nutzungsdauer 15 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Maßnahme 0,00 €<br />
Summe 0,00 €<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 42
5.4 Variante: Sanierung Hülle und Anlage<br />
5.4.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />
Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />
energetisch<br />
Endenergiebedarf 40.158 8.965 [kWh/a] 77,7 %<br />
Endenergie (EKZ)<br />
wirtschaftlich<br />
446,2 100,0 [kWh/m²a] 77,6 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten 2.275 -6 [€/a] 100,3 %<br />
<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 -0,07 [€/m²a] 100,3 %<br />
Gesamtinvestition 40.860 [€]<br />
_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />
_Förderung 12.292 [€]<br />
Investition 28.568 [€]<br />
Investition /m² 317,4 [€/m²]<br />
Amortisation 12 [Jahre]<br />
Kapitalwert<br />
Emissionen<br />
52.836 [€]<br />
CO2-Emissionen 146,3 -2,2 [kg/m²a] 101,5 %<br />
SO2-Emissionen 167,7 -4,9 [g/m²a] 102,9 %<br />
NOx-Emissionen 125,2 72,5<br />
Staub 5,3 39,4<br />
10/2010<br />
[g/m²a] 42,0 %<br />
[g/m²a] -645,7 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 43
10/2010<br />
Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />
wie folgt:<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />
Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />
handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 44
5.4.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Hülle und Anlage<br />
10/2010<br />
Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />
Schrägdach, Untersparrendämmung 45,00 €/m² 2.048 €<br />
Innendämmung, Kalzium Silikatplatten 80,00 €/m² 125 €<br />
Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 65,00 €/m² 8.064 €<br />
Kellerdeckendämmung abgehängt 30,00 €/m² 1.680 €<br />
Deckendämmung einblasen, begehbar 30,00 €/m² 726 €<br />
Fensteraustausch, Passivhausqualität 500,00 €/m² 8.080 €<br />
Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal 0,00 € 0 €<br />
Pelletheizkessel 8250,00 € 8.250 €<br />
Heizleitungen alle dämmen 7,00 € 866 €<br />
Elektronisch geregelte Heizungspumpe 350,00 € 350 €<br />
TWW Leitungen dämmen 7,00 €/m 183 €<br />
Brauchwasser-Solarkollektor 350,00 € 2.339 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter 550,00 € 550 €<br />
Pufferspeicher - (1000l) 1200,00 € 1.200 €<br />
TWW-Speicher klein - (150 l) 500,00 € 500 €<br />
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 5900,00 € 5.900 €<br />
Lüftungskonzept erstellen 0,00 € 0 €<br />
Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />
Schrägdach, Untersparrendämmung<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 25,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 45,50 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Dachschräge 45,50 m² 2.047,50 € 1,17 / 0,12 W/m²K<br />
Summe 45,50 m² 2.047,50 € entspricht 45,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Innendämmung, Kalzium Silikatplatten<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 12,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,040 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 1,56 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Gaubenwand 1,60 m² 124,80 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />
Summe 1,56 m² 124,80 € entspricht 80,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 45
Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem<br />
10/2010<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 18,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 124,06 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Außenwände 122,50 m² 7.962,50 € 0,90 / 0,16 W/m²K<br />
Gaubenwand 1,60 m² 101,40 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />
Summe 124,06 m² 8.063,90 € entspricht 65,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Kellerdeckendämmung abgehängt<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 12,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 56,00 m²<br />
Nutzungsdauer 40 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Kellerdecke 56,00 m² 1.680,00 € 0,90 / 0,22 W/m²K<br />
Summe 56,00 m² 1.680,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Deckendämmung einblasen, begehbar<br />
Daten der Dämmung<br />
Materialdicke 25,00 cm<br />
Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />
Wärme übertragende Fläche 24,20 m²<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />
Decke DG - Spitzboden 12,10 m² 363,00 € 0,75 / 0,11 W/m²K<br />
Decke DG - Drempel 12,10 m² 363,00 € 2,11 / 0,13 W/m²K<br />
Summe 24,20 m² 726,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />
Fensteraustausch, Passivhausqualität<br />
Daten der Fenster<br />
Fenster-Uw-Wert 0,80 W/m²K<br />
g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) 0,70<br />
Nutzungsdauer 25 Jahre<br />
angewendet auf folgende Bauteile: Fläche Kosten U-Wert alt / neu1)<br />
Südfenster 3,60 m² 1.800,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
West/Ostfenster 5,60 m² 2.780,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Nordfenster 3,00 m² 1.500,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Balkontür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Eingangstür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />
Summe 16,16 m² 8.080,00 € entspricht 500,00 €/m²<br />
1) hierbei handelt es sich um den Uw-Wert (Gesamtkonstruktion)<br />
Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal<br />
Die Wärmebrücken werden pauschal auf den Faktor 0,05 verbessert.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 46
Pelletheizkessel<br />
10/2010<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Typ Zentralheizung<br />
genutzte Technik Niedertemperatur-Kessel<br />
Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />
<strong>Energie</strong>träger Holz Pellets<br />
Leistung 18 kW<br />
Abgasverlust 4,0 %<br />
Bereitschaftsverlust 2,0 %<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 8.250,00 €<br />
Summe 8.250,00 €<br />
Brauchwasser-Solarkollektor<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Art der Bereitung Solaranlage<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Leistung 10,0 kW<br />
Deckung 60,0 %<br />
Arbeitszahl 40,0<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 3,54 m² 350,00 € /m²<br />
zusätzliche Kosten einmalig 1.100,00 €<br />
Summe 2.339,00 €<br />
Anschluss an Heizwärmebereiter<br />
Daten der neuen Anlage<br />
Art der Bereitung mit Heizung (Kombi)<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Deckung 40,0 %<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 550,00 €<br />
Summe 550,00 €<br />
Pufferspeicher - (1000l)<br />
Daten des Pufferspeichers<br />
Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />
Aufstellung im Beheizten<br />
Volumen des Speichers 1.000 l<br />
Nennleistung der Ladepumpe 20 W<br />
Bereitschaftswärmeverlust 3,70 kWh/d<br />
Nutzungsdauer 20 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten des Pufferspeichers 1.200,00 €<br />
Summe 1.200,00 €<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 47
TWW-Speicher klein - (150 l)<br />
10/2010<br />
Daten des Warmwasserspeichers<br />
Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />
Volumen des Speichers 200 Liter<br />
U-Wert der Speicherhülle 0,20 W/m²K<br />
Temperatur Aufstellraum 15,0 °C<br />
Nutzungsdauer 30 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten des Speichers 500,00 €<br />
Summe 500,00 €<br />
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung<br />
Daten der Lüftungsanlage<br />
Art Lüftung mit WRG (o.WP)<br />
Lüftungsbereich Lüftung<br />
Anteil der Luftversorgung 100 %<br />
Luftwechsel 0,25 h-1<br />
Wärmerückgewinnung 75 %<br />
Arbeitszahl 30,0<br />
Nutzungsdauer 25 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Anlage 5.900,00 €<br />
Summe 5.900,00 €<br />
Lüftungskonzept erstellen<br />
Nutzungsdauer 15 Jahre<br />
Kosten<br />
Kosten der Maßnahme 0,00 €<br />
Summe 0,00 €<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 48
5.5 Maßnahmenbeschreibung<br />
5.5.1 Schrägdach, Untersparrendämmung<br />
10/2010<br />
Hierbei handelt es sich um eine Wärmedämmung geneigter Dächer unterhalb der Dachsparren. In<br />
der Regel wird die Dämmebene zusätzlich zu einer vorhandenen, jedoch nicht ausreichenden,<br />
Zwischensparrendämmung montiert wird. Die Wärmedämmung unterhalb der Sparren hat den<br />
Vorteil, dass die Wärmebrückenwirkung der Sparren unterbunden wird.<br />
Als Material kommen feste Dämmplatten, Faserdämmmatten als Bahnenware oder Flockendämmstoffe<br />
(z.B. Zellulose) zum Einblasen in Frage.<br />
Bauphysik: Dämmstoffe mit einer vergleichsweise größeren Wärmespeicherkapazität wie z.B.<br />
Holzweichfaser, Zellulose bieten gegenüber Mineral- und Steinwolle einen besseren sommerlichen<br />
Wärmeschutz und eignen sich daher vorzugsweise für sommerlich voll genutzte Dachräume. Die<br />
Dämmung sollte unterseitig durch eine Dampfsperre vor Feuchtigkeit geschützt werden. Wenn die<br />
Maßnahme zusätzlich zu einer bereits vorhandenen Dämmung durchgeführt wird, sollte vor.<br />
Ausführung eine Taupunktberechnung nach DIN 4108 erfolgen.<br />
Kostenkalkulation: Dämmstoff inkl. Montage ohne erforderliche Vorarbeiten und Plattenbekleidungen.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 2.048 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 40 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.2 Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 0 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.3 Deckendämmung einblasen, begehbar<br />
Auf dem Dachboden kann eine Dämmung eingeblasen werden. Als Einblasdämmstoffe kommen<br />
Steinwolleflocken, Zellulosedämmstoff und Perlite-Granulat in Frage. Bei zusätzlicher Verlegung<br />
von Last verteilenden Belagsplatten auf eine Unterkonstruktion wird die Fläche begehbar. An der<br />
Giebelseite sollte die Dämmung innenseitig ca. 1 m hochgezogen werden.<br />
Bodenluken können durch aufmontierte Dämmplatten und Einfräsen einer umlaufenden Lippendichtung<br />
in die Leiterklappe wärmetechnisch verbessert werden. Die Maßname sollte von<br />
Fachpersonal durchgeführt werden.<br />
Bauphysik: Transmissionswärmeverluste und sommerliche Wärmebelastungen der Innenräume<br />
unter der Decke werden spürbar reduziert. Die Konstruktion ist tauwasserfrei nach DIN 4108 bei<br />
Wahl eines diffusionsoffenen Aufbaus.<br />
Bei den Kosten wurden die Unterkonstruktion, Dämmung und ein einfaches begehbares<br />
Belagsmaterial berücksichtigt. Da die Kosten des Dämmstoffs einen untergeordneten Anteil an den<br />
Gesamtkosten ausmachen, sind hohe Dämmstärken zu empfehlen (mindestens 20 cm).<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 726 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.4 Kellerdeckendämmung abgehängt<br />
Ist die lichte Raumhöhe ausreichend, eignet sich zur wärmetechnischen Ertüchtigung eine<br />
Deckenabhängung, z.B. mit Gipskartonplatten und einem entsprechenden Montagesystem. In den<br />
Zwischenraum kann die Dämmung eingebracht werden (Faserdämmmatten oder loser Dämmstoff<br />
zum Einblasen). Die Maßnahme eignet sich auch für gewölbte Decken.<br />
Bauphysik: Die Innenoberflächentemperatur des Erdgeschossbodens wird spürbar angehoben, mit<br />
entsprechend positiven Auswirkungen auf das Raumklima. Fußkälte und <strong>Energie</strong>bedarf wird<br />
verringert.<br />
Ausführungshinweise: Auf eine fugen- und damit wärmebrückenfreie Verarbeitung ist zu achten.<br />
Die Einbauhinweise der Hersteller müssen berücksichtigt werden.<br />
Kostenkalkulation inkl. Dämmung und Montage malerfertig.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 1.680 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 40 Jahren ausgegangen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 49
5.5.5 Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem<br />
10/2010<br />
Wärmedämmverbund-System: Die erste Schicht eines Verbundsystems bildet der Wärmedämmstoff.<br />
Er wird auf dem Außenmauerwerk oder auf den Außenputz, dessen Zustand und Tragfähigkeit<br />
überprüft werden muss, verklebt und ggf. mit Dübeln zusätzlich verankert. Darüber wird ein<br />
Armierungsputz aufgezogen und Glasfasergewebe eingelegt. Als Endbeschichtung wird<br />
Fassadenputz aufgebracht. Der Dämmstoff kann aus Hartschaum, Holzweichfaserplatten oder<br />
Mineralfaserplatten bestehen. Er muss den Anforderungen der Wärmeleitfähigkeit, Verhalten<br />
gegen Feuchtigkeit, Druck- und Zugfestigkeit sowie dem Brandverhalten genügen.<br />
Es sollten nur von der Bauaufsichtsbehörde zugelassene WDV-Systeme mit aufeinander<br />
abgestimmten Materialien zur Anwendung kommen. Eine sorgfältige Ausführung ist unerlässlich<br />
und sollte von Fachbetrieben vorgenommen werden.<br />
Kostenkalkulation: ohne Gerüstarbeiten und ggf. erforderliche Vorarbeiten am Untergrund (z.B.<br />
Abschlagen von losem Altputz).<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 8.064 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 40 Jahren ausgegangen.<br />
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
5.5.6 Innendämmung, Kalzium Silikatplatten<br />
Als Material kommen Verbundplatten aus einer Dämmstoffschicht und einer Bauplatte (z.B.<br />
Faserzement oder Gipskarton) mit einer Dampfsperre in Betracht. Die Verbundplatten werden<br />
innen befestigt und gespachtelt.<br />
Bauphysik: Die Innendämmung verstärkt die Wärmebrückenwirkung von Geschossdecken und<br />
einbindenden Wänden. Die Außenwand trägt nicht mehr zur Wärmespeicherung bei.<br />
Feuchtigkeits- und Frostschäden können verstärkt auftreten. Ob eine Dampfsperre anzubringen ist,<br />
sollte mit einer Berechnung der Dampfdiffusion ermittelt werden.<br />
Innendämmungen eignen sich vorzugsweise für Räume, die selten genutzt werden, schnell<br />
aufgeheizt werden sollen sowie für Gebäude, an denen eine Außendämmung nicht möglich ist.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 125 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 40 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.7 Fensteraustausch, Passivhausqualität<br />
Die vorhandenen Fenster haben ein hohes Alter und weisen Undichtigkeiten auf. Sie sollten durch<br />
neue Fenster mit sehr guter Wärmeschutzverglasung (U-Wert der Verglasung < 0,8 W/(m2K)<br />
ersetzt werden. Die höchsten Wärmeverluste treten durch die Rahmen auf. Es sind jedoch auch<br />
gedämmte Fensterrahmen erhältlich.<br />
Fenstermodernisierungen sollten möglichst mit der Verbesserung des Außenwand- Wärmedämmstandards<br />
einhergehen. Sonst besteht die Gefahr des Kondensatniederschlags an Innenflächen<br />
der Außenwand und unter Umständen (z.B. ungünstige Lüftungsbedingungen) Schimmelbildung<br />
und Bauschäden.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 50
10/2010<br />
Wird die Fassade gedämmt, so sollten die Blendrahmen weitest möglich überdämmt werden oder<br />
in der Dämmebene montiert sein.<br />
Ebenso muss auf Luftdichtigkeit der Rahmenanschlüsse zur Außenwand geachtet werden.<br />
Hinweis: Über dem Fenster eingebaute Rollladenkästen gelten als Schwachstellen, wenn sie nicht<br />
wärmegedämmt sind.<br />
Kostenkalkulation: Zweiflügeliges Fenster ca. 1,5m² ohne Sprossen.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 8.080 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 25 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.8 Blower-Door-Test<br />
Erläuterung:<br />
Mit dem Differenzdruck-Messverfahren (auch: Blower-Door-Test) wird die Luftdichtheit eines<br />
Gebäudes gemessen. Das Verfahren dient dazu, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren und<br />
die Luftwechselrate zu bestimmen. Durch die Druckdifferenzen wird eine konstante Windlast auf<br />
das zu messende Gebäude simuliert. Bei der Messung geht es um zwei Ziele. Erstens darf die<br />
Luftmenge, die der Ventilator fördert und die durch unvermeidliche Fugen usw. entweicht,<br />
höchstens 3,0 mal in der Stunde die Luft im Gebäude austauschen (Vorgabe durch die deutsche<br />
<strong>Energie</strong>einsparverordnung, bei Gebäuden mit Lüftungsanlagen höchstens 1,5 mal) und zweitens<br />
sollen bei der Messung auch die Fehlstellen lokalisiert und dokumentiert werden, damit diese<br />
beseitigt werden können. Es nützt also nichts, einen Blower-Door-Test durchzuführen, dann<br />
festzustellen, dass die Norm nicht eingehalten wird (keine Erstellung des Zertifikates möglich) ohne<br />
eine genaue Ortung der Leckstellen vorzunehmen. Die letzte Forderung ist nicht direkt Gesetz,<br />
sondern gehört zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik, auf deren Einhaltung der<br />
Bauherr auch ohne besondere Vereinbarung Anspruch hat.<br />
Deshalb müssen Fehlstellen rechtzeitig erkannt und beseitigt werden.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 500 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
5.5.9 Pelletheizkessel<br />
Hierbei handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel, der mit Holzpellets als Brennstoff<br />
betrieben wird (CO2-neutral weil regenerativ). Dieser Festbrennstoffkessel wird über ein<br />
automatisches Fördersystem mit Pellets aus einem Vorratsbehälter beschickt. Häufig können alte<br />
Heizöl- oder Kohlelagerräume als Pelletlager dienen. Die Kosten beziehen sich auf einen<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 51
10/2010<br />
Heizkessel, Fördertechnik, Standardsteuerung; ohne Speicher , Anschluß an Abgasanlage und<br />
Pelletlager.<br />
Einige kleine Pelletöfen eignen sich als Primärofen auch zur Aufstellung in Wohnräumen.<br />
Preise einzelner Produkte siehe auch Marktübersicht des Biomasse-Info-Zentrums (BIZ,<br />
www.fnr.de).<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 8.250 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 20 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.10 Anschluss an Heizwärmebereiter<br />
Hierbei handelt es sich um die unmittelbare Verbindung zwischen Wärmeerzeuger und Warmwasserspeicher.<br />
Die Trinkwassererwärmung erfolgt also über den Heiz-Wärmeerzeuger und somit fallen also nur<br />
die Kosten für die zusätzlichen Leitungen an.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 550 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.11 TWW-Speicher klein - (150 l)<br />
Hierbei handelt es sich um einen TWW-Speicher zur Kopplung mit dem vorhandenen Heiz-<br />
Wärmeerzeuger. Es werden nur geringe Anforderung an die Pufferkapazität oder Schichtung<br />
gestellt.<br />
Dieser TWW-Speicher kann als separater oder als Kombi-Speicher ausgeführt werden.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 500 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.12 Heizleitungen alle dämmen<br />
Bei dieser Maßnahme wird vorgesehen, die Heizwärme verteilenden Rohre zu dämmen. Schlecht<br />
oder gar nicht wärmegedämmte Heizungsrohre strahlen viel Wärme ab, auch wenn die Heizungsvorlauftemperatur<br />
niedrig eingestellt ist. Auch Rohre, welche im beheizten Volumen verlegt sind,<br />
haben unkontrollierte Verluste. Die Rohrleitungsverluste lassen sich deutlich verringern, wenn eine<br />
Wärmedämmung entsprechend den Vorschriften der EnEV oder besser ausgeführt wird. Auch für<br />
Pumpen, Absperrventile usw. gibt es Formstücke zur Wärmedämmung. Heizungsrohre sind nach<br />
EnEV zu dämmen. Die Mindestdicke der Dämmstoffschicht entspricht etwa der Nennweite bei<br />
einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK). Ein Rohr mit 2 cm Durchmesser muss demnach mit<br />
einer 2<br />
cm dicken Dämmung ummantelt sein. Dies betrifft auch die Befestigungspunkte, Wand- und<br />
Deckendurchführungen.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 866 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 52
5.5.13 TWW Leitungen dämmen<br />
10/2010<br />
Große Verluste bei zentralen Warmwassererwärmungsanlagen können bei der Verteilung<br />
entstehen. Diese Wärmeverluste können über das Jahr eine Größenordnung von 20 % bis zu 30 %<br />
des eigentlichen Wärmebedarfs für die Warmwasserbereitung erreichen. Warmwasserleitungen<br />
sind mindestens gemäß EnEV zu dämmen (Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK). Ein<br />
Rohr mit 2 cm Durchmesser muss mit einer 2 cm dicken Dämmung ummantelt sein. Dies betrifft<br />
auch die Befestigungspunkte, Wand- und Deckendurchführungen. Auch für Pumpen, Absperrventile<br />
usw. sind Formstücke zur Wärmedämmung erhältlich.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 183 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 30 Jahren ausgegangen.<br />
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
5.5.14 Elektronisch geregelte Heizungspumpe<br />
Montage einer elektronisch geregelten Pumpe mit geringer Leistungsaufnahme.<br />
Da Umwälzpumpen sehr lange Laufzeiten aufweisen, sind vergleichsweise hohe Einsparpotenziale<br />
und eine schnelle Amortisation erreichbar.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 350 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 15 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.15 Brauchwasser-Solarkollektor<br />
Hierbei handelt es sich um eine Brauchwasser-Solaranlage zur Erwärmung von Trinkwasser. Sie<br />
muss mit einem bivalenten Warmwasserspeicher verbunden werden. Der mögliche Deckungsbeitrag<br />
hängt von Dachneigung, -orientierung, Fläche und Bauart des Kollektors, Speichergröße und -<br />
bauart und weiteren Randbedingungen ab.<br />
In der Kostenkalkulation sind 5 m2 Kollektoren, Anlagensteuerung, Solarpumpe, Leitungen und<br />
Montage enthalten. Solarspeicher müssen gesondert berücksichtigt werden.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 2.339 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 20 Jahren ausgegangen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 53
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
5.5.16 Pufferspeicher - (1000l)<br />
10/2010<br />
Pufferspeicher sind beim Einsatz von regenerativen <strong>Energie</strong>n für die Heizungsanlage bei fast allen<br />
Arten erforderlich. Der Einsatz von Pufferspeichern ermöglicht die Wärme zwischen zu speichern<br />
und bei Bedarf wieder in die Heizungsanlage einzuspeisen. Dies erhöht nur nicht den Komfort der<br />
Anlage, sondern lässt auch eine besonders effiziente <strong>Energie</strong>ausnutzung zu.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 1.200 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 20 Jahren ausgegangen.<br />
5.5.17 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung<br />
Es handelt sich hierbei um ein zentral aufgestelltes Be- und Entlüftungsgerät und zugehörigem<br />
Kanalsystem sowie Zu- und Abluftöffnungen in den Räumen. Mit diesen Anlagen ist eine definierte<br />
Dosierung der Luftmenge möglich. Die verbrauchte Luft wird in so genannten Ablufträumen<br />
(Küche, Sanitärräume) abgesaugt und über einen Wärmetauscher nach außen geleitet. Der Abluft<br />
wird im<br />
Wärmetauscher die enthaltene Wärme entzogen und der frischen Zuluft zugeführt, ohne dass es<br />
dabei zur Vermengung von Frischluft und Abluft kommt.<br />
Die Zuluft kann nach dem Austritt aus dem Wärmetauscher zusätzlich mit einem nachgeschalteten<br />
Lufterhitzer auf die gewünschte Zulufttemperatur nachgeheizt werden. Weiterhin wird die Zuluft<br />
gefiltert und gereinigt (ein Vorteil für Allergiker). In den Aufenthaltsräumen wird die so erwärmte<br />
Zuluft mittels (Weitwurf-) Düsen frei von Zugluft eingebracht. Durch den Einbau von<br />
Telefonie-Schalldämpfern ist mit Geräuschproblemen nicht zu rechnen.<br />
Die Planung einer solchen Anlage muss durch Fachleute erfolgen. Das Gebäude sollte sehr<br />
luftdicht sein, damit die Anlage effizient arbeiten kann.<br />
Die Kostenkalkulation berücksichtigt die Planung, das Zentralgerät, die Leitungen, Strom sparende<br />
Gleichstromventilatoren, Filter, und Düsen für eine Nutzungseinheit mit bis zu 8 Räumen.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 5.900 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 25 Jahren ausgegangen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 54
Das folgende Bild soll Ihnen die Maßnahme verdeutlichen:<br />
5.5.18 Lüftungskonzept erstellen<br />
10/2010<br />
Bei Maßnahmen, welche die Dichtigkeit des Gebäudes verbessern (Abdichten von Fenstern und<br />
Türen, Erneuerung von Fenstern und Türen etc.), ist ein entsprechendes Nutzerverhalten<br />
notwendig.<br />
Bei alten Fenstern ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein größerer Lüftungswärmeverlust<br />
als erforderlich. Bei alten Fenstern stellt sich der aus hygienischen und feuchtbedingten<br />
Notwendigkeiten erforderliche Luftwechsel durch die vorhandenen Undichtigkeiten der Fugen<br />
in der Regel von selbst ein. Damit ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein<br />
größerer Lüftungswärmeverlust als erforderlich. Bei<br />
abgedichteten bzw. modernen Fenstern reduzieren sich die Fugenverluste so, dass der erforderliche<br />
Luftwechsel durch ein angepasstes Nutzerverhalten erreicht werden muss. Entscheidend für<br />
die Begrenzung der Lüftungsverluste ist richtiges Lüften, da die Verluste durch zu lange oder<br />
ständig geöffnete oder gekippte Fenster beachtlich sind.<br />
Erfolgt kein Austausch der feuchten Raumluft, so kann es durch Kondensation der Feuchtigkeit an<br />
den Wänden zu Feuchtschäden bis hin zu Schimmelpilzbildung kommen. Tag für Tag müssen in<br />
einer Wohnung etwa 10-15 Liter Wasser weggelüftet werden, beim Wäschetrocknen und bei vielen<br />
Zimmerpflanzen noch mehr! Ein Mindestmaß an Lüftung ist zudem für die Gesundheit und das<br />
Wohlbefinden der Bewohner erforderlich<br />
(Ausdünstungen aus Möbeln und Textilien).<br />
Ein maschinelles, mechanisches und damit kontrollierbares Be- bzw. Entlüften mit Lüftungsanlage<br />
setzt beim Gebäude hohe Anforderungen an.<br />
Bei Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, die die Dichtigkeit der Gebäude verbessern,<br />
muss das richtige Be- und Entlüften durch ein angepasstes Nutzerverhalten erreicht werden.<br />
Als Regel gilt:<br />
Besser häufiger kurz lüften (Stoßlüftung) als Dauerkippstellung der Fenster!<br />
Ferner sollten folgende Regeln beachtet werden:<br />
- in den Wintermonaten wird eine mehrmalige tägliche Stoßlüftung von 4-6 Minuten empfohlen,<br />
in den Übergangszeiten 10-15 Minuten.<br />
- Feuchtigkeit sollte dort durch die Fenster abgeführt werden, wo sie entsteht (Bad, Küche,<br />
...)<br />
- Warme (feuchte) Luft nicht in kalte bzw. ungeheizte Räume leiten.<br />
- Während des Lüftens sind die Thermostatventile an den Heizkörpern zuzudrehen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 55
10/2010<br />
- Türen zwischen Räumen mit mehr als 4° Temperaturunterschied geschlossen halten.<br />
- Kellerräume eher im Winter lüften, nur dann kann einströmende Luft Feuchtigkeit aufnehmen.<br />
- Langes Dauerlüften vermeiden (Oberflächen kühlen aus).<br />
- Schlafzimmer mehrmals täglich kurz lüften, Textilien u. Möbel nehmen Wasser auf (es fällt<br />
ca. 400g pro Person und Nacht an).<br />
Zur Vermeidung von Schimmel trägt auch bei<br />
- Keine Schränke und große Bilder an ungedämmte Außenwände stellen/hängen.<br />
Bei Neubau oder Sanierung der Gebäudehülle im Bestand ist vom Architekten eine Lüftungsanleitung<br />
an den Bauherrn zu übergeben. Diese Anleitung muss die Kategorien Leerstandslüftung<br />
(dauerhaft, Feuchteabfuhr), Abwesenheitslüftung (Urlaub, WE), Grundlüftung (Mindestaußenluftwechsel)<br />
und Belastungslüftung (Party) enthalten.<br />
Mechanische Lüftung ohne Wärmerückgewinnung<br />
Die mechanische Bedarfslüftung stellt eine hygienisch einwandfreie Lösung zur Sicherung der<br />
Raumluftqualität unabhängig von Witterungseinflüssen dar.<br />
Eine hohe Luftdichtigkeit der Bauhülle gekoppelt mit einer richtig projektierten Lüftungsanlage<br />
garantiert hierbei nicht nur weniger <strong>Energie</strong>verluste, sondern vermindert auch das Risiko von<br />
Bauschäden.<br />
Der Schallschutz gegen Außengeräusche ist gegenüber Fensterlüftung deutlich verbessert.<br />
Die Frischluft strömt in die Zuluftzonen, den Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen über regulierbare<br />
Zuluftöffnungen ein. Der Überströmbereich umfasst z.B. Flure und das Treppenhaus. Der<br />
Abluftzone<br />
sind alle Feuchträume und besonders belastete Zimmer zugeordnet. Alle Räume der Zu- und<br />
Abluftzone müssen ausreichend dimensionierte Überströmöffnungen haben, so dass eine<br />
ungehinderte<br />
Luftströmung auch bei geschlossenen Innentüren möglich ist. In dieser Anordnung stellt sich ein<br />
gerichteter Luftstrom von den Zulufträumen über die Überströmzone in die Ablufträume ein. In der<br />
Abluftzone stellt sich durch die kleineren Raumvolumina im Vergleich zur Zuluftzone automatisch<br />
ein höherer Luftwechsel ein.<br />
Heizanlagen und andere Feuerstätten, die innerhalb des mechanisch entlüfteten Volumens<br />
aufgestellt werden, müssen zu- und abluftseitig raumluftunabhängig betrieben werden.<br />
Die Kosten dieser Maßnahme werden auf 0 € veranschlagt. Es wird von einer Mindestnutzungsdauer<br />
von 15 Jahren ausgegangen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 56
5.6 Vergleich der Varianten<br />
10/2010<br />
Nachfolgend werden die vorgeschlagenen <strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen (Varianten) nach<br />
verschiedenen Gesichtspunkten untereinander verglichen. Detaillierte Angaben dazu finden Sie<br />
zusätzlich im Anhang.<br />
5.6.1 Vergleich der technischen Verbesserung der Gebäudehülle<br />
mittlere U-Werte nach Bauteilkategorie<br />
Variante Keller Dach Außenwand Fenster<br />
[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]<br />
vor der Maßnahme (Ist) 0,90 1,26 1,01 3,50<br />
<strong>Energie</strong>einsparverordnung 0,24/0,3* 0,2/0,24* 0,24* 1,1/1,4*<br />
Stand der Technik (PH**) 0,10 0,10 0,10 0,80<br />
Sanierung Gebäudehülle 0,22 0,12 0,34 0,80<br />
Sanierung Anlage 0,90 1,26 1,01 3,50<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage 0,90 1,26 1,01 3,50<br />
Sanierung Hülle und Anlage 0,22 0,12 0,34 0,80<br />
* abhängig von Konstruktion des Bauteils und/oder Maßnahme<br />
** PH = Passivhaus<br />
Vergleich der Hüllflächen-U-Werte<br />
Einige Varianten enthalten Dämm-Maßnahmen. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die U-Werte nach<br />
Durchführung der Maßnahmen. Die einzelnen Werte finden Sie im Anhang.<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die U-Werte in einer Grafik<br />
5.6.2 Vergleich der <strong>Energie</strong>kennzahlen<br />
Die <strong>Energie</strong>kennzahlen dienen vorrangig zum Vergleich mit anderen Gebäuden gleicher Nutzung.<br />
Erläuterungen zur <strong>Energie</strong>kennzahl finden Sie im Abschnitt "Allgemeines".<br />
Nachfolgend ist eine Liste der <strong>Energie</strong>kennzahlen der einzelnen Varianten aufgeführt.<br />
Zustand <strong>Energie</strong>kennzahl<br />
Vor der Maßnahme 446 kWh/m2Jahr<br />
Neubau-Standard 90 kWh/m2Jahr<br />
Niedrigenergiehaus 50 kWh/m2Jahr<br />
Sanierung Gebäudehülle 121 kWh/m2Jahr<br />
Sanierung Anlage 401 kWh/m2Jahr<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage 402 kWh/m2Jahr<br />
Sanierung Hülle und Anlage 100 kWh/m2Jahr<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 57
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Kennzahlen in einer Grafik:<br />
5.6.3 Umweltwirkung<br />
10/2010<br />
Der Schadstoffausstoß von CO2, NOx, SO2 und Staub belastet unsere Umwelt (siehe auch<br />
Abschnitt "Allgemeines"). In der folgenden Tabelle sehen Sie den Schadstoffausstoß im Ist-<br />
Zustand des Gebäudes und für jede vorgeschlagene Variante. Zusätzlich wird die CO2-Einsparung<br />
für jede Variante ausgegeben.<br />
Variante CO2 SO2 NOX Staub CO2-Einsp. CO2-<br />
Einsp.<br />
[kg/a] [g/a] [g/a] [g/a] [kg/m2<br />
Nutzfl.]<br />
in %<br />
Ist-Zustand 13.170 15.096 11.264 475 --- ---<br />
Sanierung Gebäudehülle 4.061 4.259 3.355 182 93 69,2<br />
Sanierung Anlage 786 -539 25.453 13.313 126 94,0<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
917 -444 25.568 13.333 125 93,0<br />
Sanierung Hülle und Anlage -198 -444 6.529 3.542 136 101,5<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 58
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Emissionen in einer Grafik<br />
5.6.4 Vergleich der Primärenergie der Varianten<br />
Bei der Herstellung, der Umwandlung und dem Transport der <strong>Energie</strong> treten Verluste auf, die<br />
bisher nicht betrachtet wurden. Erläuterungen zur Primärenergie finden Sie im Abschnitt<br />
"Allgemeines".<br />
10/2010<br />
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen den Primärenergiebedarf im Ist-Zustand sowie für jede Variante<br />
(Berechnung nach EnEV) und den Primärenergieverbrauch im Ist-Zustand und für jede Variante in<br />
diesem Fall auch bezogen auf die Gebäudenutzfläche (Berechnung nach LEG).<br />
Variante Primärenergiebedarf Primärenergieverbrauch<br />
(EnEV) in kWh/m2a (LEG/IWU)*) in kWh/m2a<br />
Ist (vorher) 613 477<br />
Sanierung Gebäudehülle 338 149<br />
Sanierung Anlage 98 24<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage 94 29<br />
Sanierung Hülle und Anlage 43 -9<br />
*) inklusive Nutzung<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 59
Das folgende Bild zeigt Ihnen den Primärenergieverbrauch der Varianten in einer Grafik<br />
5.6.5 Wirtschaftlichkeit der Varianten<br />
10/2010<br />
Bei der Ausarbeitung der Vorschläge wurden verschiedene Ansätze der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
angewendet.<br />
Die Amortisation beziffert die Zeit, in der das eingesetzte Investitionskapital durch die erzielten<br />
Einsparungen wieder zurückgeflossen ist. Diese Zeit sagt nichts aus über das Maß der Einsparung<br />
und über den evtl. erzielten Überschuss über die Nutzungsdauer der Maßnahme.<br />
Eine Maßnahme ist wirtschaftlich, wenn die Amortisationszeit der Investitionen kürzer ist, als die<br />
Nutzungsdauer der sanierten oder erneuerten Bauteile.<br />
Zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit einzelner Varianten setzen wir die Kapitalwertmethode<br />
ein, um zu einer vergleichbaren Größe zu kommen. Hierbei wird jede Zahlung (Investition,<br />
Unterhaltung) und Einnahme (Einsparung) mit dem Kapitalzins (Sparzins) zurückgezinst auf den<br />
Anfangszeitpunkt. Der Kapitalwert ist dabei die Summe aller dieser "Barwerte". Eine Maßnahme ist<br />
dann absolut vorteilhaft, wenn der Kapitalwert größer oder gleich Null ist. Die vorteilhafteste<br />
Variante ist damit die mit dem größten Kapitalwert.<br />
Die Kapitalwertmethode wurde auch angewendet zur Ermittlung der wirtschaftlich optimalen<br />
Dämmstoffstärke.<br />
Zur Bestimmung der wirtschaftlichen Amortisation wurden folgende Kriterien angenommen:<br />
Fördergelder werden berücksichtigt<br />
- Effektiver Zinssatz 3,0 %<br />
- Teuerungsrate für fossile Brennstoffe per anno 5,0 %<br />
- allgemeine Preissteigerung 1,0 %<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 60
10/2010<br />
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Investition, die angenommene Förderung,<br />
die jährliche Einsparung, die Amortisationszeit und den Kapitelwert jeder Variante.<br />
Variante Gesamt Netto Sowieso- Förde- jährliche AmorKapitalInvestitiInvestitiInvestitirung Einspar. tis.wertononon [€] zeit<br />
[€]*) [€]**) [€] [€]<br />
[Jahre] [€]<br />
Sanierung<br />
Gebäudehülle<br />
21.222 21.222 0 0 1.640 12 54.472<br />
Sanierung Anlage 10.699 10.699 0 0 1.140 9 18.842<br />
Sanierung Anlage<br />
mit Solaranlage<br />
20.138 20.138 0 0 1.099 17 8.350<br />
Sanierung Hülle<br />
und Anlage<br />
40.860 28.568 0 12.292 2.282 12 52.836<br />
*) inkl. ohnehin notwendiger Investitionen<br />
**) abzgl. ohnehin notwendiger Investitionen und abzüglich evtl. Förderung<br />
Die Amortisation wird entsprechend der VDI 2067 iterativ wie im Anhang dargestellt berechnet.<br />
Hinweis: Ersatzinvestitionen werden nicht berücksichtigt.<br />
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Amortisationszeiten in einer Grafik:<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 61
10/2010<br />
In dem folgenden Bild wird Ihnen die Entwicklung der <strong>Energie</strong>kosten der Varianten gezeigt:<br />
Hierbei wurden folgende Entwicklungs-Trends zugrunde gelegt:<br />
<strong>Energie</strong>preiserhöhungen 5,0 %<br />
allg. Preissteigerung 1,0 %<br />
Guthaben-Zinssatz 3,0 %<br />
Kredit-Zinssatz 4,5 %<br />
Annahmen für die Finanzierung der Varianten:<br />
Variante Sanierung Gebäudehülle: über Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren<br />
Variante Sanierung Anlage: über Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren<br />
Variante Sanierung Anlage mit Solaranlage: über Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren<br />
Variante Sanierung Hülle und Anlage: über Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren<br />
Die Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien können Sie dem Anhang entnehmen.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 62
5.7 Ergänzende Angaben zum Vergleich der Varianten<br />
In diesem Abschnitt finden Sie Ergänzungen zum Vergleich der Varianten.<br />
5.7.1 Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien<br />
Kapitalzins Kapitalzins Kreditzins Kreditzins<br />
Zinssatz 3,0 [%] 3,0 [%] 4,5 [%] 4,5 [%]<br />
<strong>Energie</strong>preise 4,0 [%] 5,0 [%] 4,0 [%] 5,0 [%]<br />
Variante [€] [€] [€] [€]<br />
Sanierung Gebäudehülle<br />
Investition 21.222 21.222 21.222 21.222<br />
Barwert eingesparte <strong>Energie</strong> 77.555 95.203 57.381 69.160<br />
Kapitalwert 56.333 73.981 36.159 47.937<br />
Kapitalwert annuitätisch 2.874 3.774 2.220 2.943<br />
Sanierung Anlage<br />
Investition 10.699 10.699 10.699 10.699<br />
Barwert eingesparte <strong>Energie</strong> 38.398 44.574 30.605 35.162<br />
Kapitalwert 27.700 33.875 19.906 24.464<br />
Kapitalwert annuitätisch 1.413 1.728 1.222 1.502<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
Investition 20.138 20.138 20.138 20.138<br />
Barwert eingesparte <strong>Energie</strong> 37.024 42.978 29.510 33.904<br />
Kapitalwert 16.886 22.841 9.372 13.766<br />
Kapitalwert annuitätisch 862 1.165 575 845<br />
Sanierung Hülle und Anlage<br />
Investition 28.568 28.568 28.568 28.568<br />
Barwert eingesparte <strong>Energie</strong> 107.881 132.430 79.818 96.203<br />
Kapitalwert 79.313 103.862 51.251 67.635<br />
Kapitalwert annuitätisch 4.047 5.299 3.146 4.152<br />
Hinweis: Ein negativer Kapitalwert bedeutet, dass sich die Maßnahme rein ökonomisch nicht<br />
innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert. Der annuitätische Kapitalwert beziffert den jährlichen<br />
Zuschuss (negativer Wert) bzw. den jährlichen Reingewinn aus der Variante.<br />
5.7.2 Amortisationszeiten der Maßnahmepakete in verschiedenen Szenarien<br />
Kapitalzins Kapitalzins Kreditzins Kreditzins<br />
Zinssatz 3,0 [%] 3,0 [%] 4,5 [%] 4,5 [%]<br />
<strong>Energie</strong>preise 4,0 [%] 5,0 [%] 4,0 [%] 5,0 [%]<br />
Variante, Invest.u.Ersparnis [Jahre] [Jahre] [Jahre] [Jahre]<br />
Sanierung Gebäudehülle<br />
21.222 / 1.640 12,6 12,0 13,9 13,1<br />
Sanierung Anlage<br />
10.699 / 1.140 9,3 8,9 10,0 9,6<br />
Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />
20.138 / 1.099 17,4 16,2 20,0 18,3<br />
Sanierung Hülle und Anlage<br />
28.568 / 2.282 12,2 11,6 13,5 12,7<br />
bei mit ---- oder 0 gekennzeichneten Werten findet keine Amortisation statt.<br />
10/2010<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 63
Berechnungswege:<br />
Bw = KEin * (1 - (me / Z)n) / (Z - me)<br />
K = Bw - I<br />
Ka = K * a<br />
a = Z / (1-(1+Z)-n)<br />
Bw = Barwert der eingesparten <strong>Energie</strong><br />
KEin = Ersparnis<br />
me = mittl. <strong>Energie</strong>preissteigerungsindex (z.B. 1,04)<br />
Z = Zinsfaktor (z.B. 1,03)<br />
I = Investition<br />
K = Kapitalwert<br />
Ka = annuitätischer Kapitalwert<br />
a = Annuitätsfaktor<br />
n = Laufzeit/Nutzungsdauer<br />
A = ln(1 - ((I / KEin) * (Z - me))) / ln(me / Z), wobei A = Amortisationsdauer<br />
10/2010<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 64
6 Anhang: Ergänzende Angaben<br />
In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Angaben sowie Berechnungsergebnisse zu<br />
dem vorliegenden Objekt Herr Mustermann.<br />
6.1 Empfehlungen zum <strong>Energie</strong>sparen und gesunden Wohnen<br />
6.1.1 Anmerkungen zur Behaglichkeit<br />
10/2010<br />
Behaglich fühlt sich der Mensch bei angenehmer Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Am angenehmsten<br />
werden bei Temperaturen von 20-22°C Luftfeuchtigkeiten zwischen 40 und 70 % empfunden<br />
(siehe auch die Anmerkungen zur Lüftung). Wegen der Temperaturstrahlung hängt das Temperaturempfinden<br />
nicht nur von der Temperatur der Raumluft, sondern auch von der Temperatur der<br />
Umgrenzungsflächen ab.<br />
Durch Wärmedämmmaßnahmen erhöht sich die Behaglichkeit und damit der Wohnkomfort in<br />
einem Gebäude oft erheblich, weil die Flächen nicht mehr kalt wirken. Umgekehrt kommt es in<br />
schlecht gedämmten Objekten auch zu großen Temperaturunterschieden und Zugerscheinungen.<br />
Vor allem die niedrigen Oberflächentemperaturen führen zum Unbehaglichkeitsempfinden. Die<br />
kalte Wand strahlt Kühle aus, so dass der Mensch auch bei normalen oder erhöhten Raumtemperaturen<br />
friert.<br />
Umgekehrt fühlt sich ein Mensch auch bei normalen oder abgesenkten Raumtemperaturen wohl,<br />
wenn die Wand "warm" ist. Günstig sind daher auch Flächenheizungen (Wand- und Fußbodenheizung),<br />
da hier ein großer Teil der Hülle Wärme abstrahlt. Eine gut gedämmte Gebäudehülle erhöht<br />
die Oberflächentemperatur der Bauteile erheblich. Nach der Dämmung kann man also nicht nur mit<br />
deutlich verringerten Transmissionswärmeverlusten rechnen, sondern die Raumtemperatur etwas<br />
herunternehmen. Ein Grad geringere Raumtemperatur bedeutet rund 6 % <strong>Energie</strong>einsparung!<br />
6.1.2 Allgemeine <strong>Energie</strong>spartipps<br />
- In Wohn- und Arbeitsräumen reicht eine Temperatur von 20° Celsius aus. Nachts und in<br />
ungenutzten Räumen sollte die Temperatur auf etwa 15° Celsius gesenkt werden.<br />
- Die Senkung der Raumtemperatur durchschnittlich nur um 1°C senkt, spart rund 6 %<br />
Heizkosten.<br />
- Ökonomisch und günstig ist kurzes kräftiges Stoßlüften etwa 3 bis 4 mal täglich in Abhängigkeit<br />
von der Außentemperatur jeweils 2-7 Minuten. Bei Durchzug wird die verbrauchte<br />
Raumluft schneller ersetzt. Kein Dauerlüften durch das Kippen eines oder mehrerer Fenster!<br />
Das ist für den erforderlichen Luftaustausch nahezu nutzlos und verschwendet unnötig<br />
<strong>Energie</strong>. Beim Lüften sollten die Heizkörperventile immer geschlossen sein.<br />
- Heizkörper sollten nicht durch Möbel oder ähnliches verstellt werden, da die erwärmte Luft<br />
sonst nicht zirkulieren kann.<br />
- Verwenden Sie möglichst Lampen mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Lichtausbeute und<br />
langer Lebensdauer.<br />
- Bei Duschen können Durchflussbegrenzer angebracht werden sowie Perlatoren an den<br />
Zapfstellen (z.B. Waschbecken im Gäste-WC). Wassereinsparung bis 50 %.<br />
6.1.3 Hinweise zur Luftfeuchte<br />
Wussten Sie, dass ein Vier-Personen-Haushalt am Tag ca. 10 Liter Wasser erzeugt (atmen,<br />
waschen, putzen, kochen etc.) und an die Raumluft abgibt? Diese Feuchte muss abgeführt bzw.<br />
zwischen gespeichert werden! Moderne Innenräume sind jedoch aufgrund neuartiger Baustoffe<br />
und Techniken immer luftdichter geworden und werden immer besser gedämmt - mit allen daraus<br />
resultierenden innenräumlichen Feuchtproblemen.<br />
Kalk- und Lehmputze sind in hohem Maße diffusionsoffen (sofern sie eine diffusionsoffene<br />
Oberflächengestaltung erhalten!). Das heißt, dass Luftfeuchte in großen Mengen aufgenommen,<br />
gespeichert und bei zu geringer Luftfeuchte wieder abgeben werden kann. Somit pendelt sich<br />
immer eine ideale Luftfeuchte ein, was dem Raumklima und somit der Gesundheit der Bewohner<br />
zu Gute kommt (z.B. weniger Erkältungskrankheiten in den Wintermonaten!). Eine 10 mm starke<br />
Kalkputz-Schicht nimmt in einem ca. 24 m² großen Wohnraum ca. 17 Liter Wasser auf. Diese<br />
Menge wird bei zu trockener Luft (z.B. nach dem winterlichen Lüften) wieder abgegeben. Dieser<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 65
10/2010<br />
Austausch funktioniert wie eine natürliche Klimaanlage - ohne Strom und technischen Aufwand!<br />
Kalkputz hat zudem eine hohe Alkalität - natürlicher Schutz vor der Besiedlung von Mikroorganismen!<br />
Lehm bindet Schadstoffe und ist geruchsabsorbierend!<br />
6.1.4 Hinweise zum richtigen Lüften<br />
Bei Maßnahmen, welche die Dichtigkeit des Gebäudes verbessern (Abdichten von Fenstern und<br />
Türen, Erneuerung von Fenstern und Türen etc.), ist ein entsprechendes Nutzerverhalten<br />
notwendig.<br />
Bei alten Fenstern ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein größerer Lüftungswärmeverlust<br />
als erforderlich. Bei alten Fenstern stellt sich der aus hygienischen und feuchtbedingten<br />
Notwendigkeiten erforderliche Luftwechsel durch die vorhandenen Undichtigkeiten der Fugen<br />
in der Regel von selbst ein. Damit ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein<br />
größerer Lüftungswärmeverlust als erforderlich. Bei abgedichteten bzw. modernen Fenstern<br />
reduzieren sich die Fugenverluste so, dass der erforderliche Luftwechsel durch ein angepasstes<br />
Nutzerverhalten erreicht werden muss. Entscheidend für die Begrenzung der Lüftungsverluste ist<br />
richtiges Lüften, da die Verluste durch zu lange oder ständig geöffnete oder gekippte Fenster<br />
beachtlich sind.<br />
Erfolgt kein Austausch der feuchten Raumluft, so kann es durch Kondensation der Feuchtigkeit an<br />
den Wänden zu Feuchtschäden bis hin zu Schimmelpilzbildung kommen. Tag für Tag müssen in<br />
einer Wohnung etwa 10-15 Liter Wasser weggelüftet werden, beim Wäschetrocknen und bei vielen<br />
Zimmerpflanzen noch mehr! Ein Mindestmaß an Lüftung ist zudem für die Gesundheit und das<br />
Wohlbefinden der Bewohner erforderlich (Ausdünstungen aus Möbeln und Textilien).<br />
Ein maschinelles, mechanisches und damit kontrollierbares Be- bzw. Entlüften mit Lüftungsanlage<br />
setzt beim Gebäude hohe Anforderungen an.<br />
Bei Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, die die Dichtigkeit der Gebäude verbessern,<br />
muss das richtige Be- und Entlüften durch ein angepasstes Nutzerverhalten erreicht werden.<br />
Als Regel gilt:<br />
Besser häufiger kurz lüften (Stoßlüftung) als Dauerkippstellung der Fenster!<br />
Ferner sollten folgende Regeln beachtet werden:<br />
- in den Wintermonaten wird eine mehrmalige tägliche Stoßlüftung von 4-6 Minuten empfohlen,<br />
in den Übergangszeiten 10-15 Minuten.<br />
- Feuchtigkeit sollte dort durch die Fenster abgeführt werden, wo sie entsteht (Bad, Küche,<br />
...)<br />
- Warme (feuchte) Luft nicht in kalte bzw. ungeheizte Räume leiten.<br />
- Während des Lüftens sind die Thermostatventile an den Heizkörpern zuzudrehen.<br />
- Türen zwischen Räumen mit mehr als 4° Temperaturunterschied geschlossen halten.<br />
- Kellerräume eher im Winter lüften, nur dann kann einströmende Luft Feuchtigkeit aufnehmen.<br />
- Langes Dauerlüften vermeiden (Oberflächen kühlen aus).<br />
- Schlafzimmer mehrmals täglich kurz lüften, Textilien u. Möbel nehmen Wasser auf (es fällt<br />
ca. 400g pro Person und Nacht an).<br />
Zur Vermeidung von Schimmel trägt auch bei<br />
- Keine Schränke und große Bilder an ungedämmte Außenwände stellen/hängen.<br />
Bei Neubau oder Sanierung der Gebäudehülle im Bestand ist vom Architekten eine Lüftungsanleitung<br />
an den Bauherrn zu übergeben. Diese Anleitung muss die Kategorien Leerstandslüftung<br />
(dauerhaft, Feuchteabfuhr), Abwesenheitslüftung (Urlaub, WE), Grundlüftung (Mindestaußenluftwechsel)<br />
und Belastungslüftung (Party) enthalten.<br />
Mechanische Lüftung ohne Wärmerückgewinnung<br />
Die mechanische Bedarfslüftung stellt eine hygienisch einwandfreie Lösung zur Sicherung der<br />
Raumluftqualität unabhängig von Witterungseinflüssen dar.<br />
Eine hohe Luftdichtigkeit der Bauhülle gekoppelt mit einer richtig projektierten Lüftungsanlage<br />
garantiert hierbei nicht nur weniger <strong>Energie</strong>verluste, sondern vermindert auch das Risiko von<br />
Bauschäden.<br />
Der Schallschutz gegen Außengeräusche ist gegenüber Fensterlüftung deutlich verbessert.<br />
Die Frischluft strömt in die Zuluftzonen, den Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen über regulierbare<br />
Zuluftöffnungen ein. Der Überströmbereich umfasst z.B. Flure und das Treppenhaus. Der<br />
Abluftzone sind alle Feuchträume und besonders belastete Zimmer zugeordnet. Alle Räume der<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 66
10/2010<br />
Zu- und Abluftzone müssen ausreichend dimensionierte Überströmöffnungen haben, so dass eine<br />
ungehinderte Luftströmung auch bei geschlossenen Innentüren möglich ist. In dieser Anordnung<br />
stellt sich ein gerichteter Luftstrom von den Zulufträumen über die Überströmzone in die<br />
Ablufträume ein. In der Abluftzone stellt sich durch die kleineren Raumvolumina im Vergleich zur<br />
Zuluftzone automatisch ein höherer Luftwechsel ein.<br />
Heizanlagen und andere Feuerstätten, die innerhalb des mechanisch entlüfteten Volumens<br />
aufgestellt werden, müssen zu- und abluftseitig raumluftunabhängig betrieben werden.<br />
6.1.5 Hinweise zum Stromsparen<br />
Rechnerisch erfasst und berechnet wird in diesem Gutachten der Wärmeaspekt. Dieser kann hier<br />
mit hinreichend großer Genauigkeit ermittelt werden und Schlussfolgerungen in Bezug auf<br />
<strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen gezogen werden. Nicht berücksichtigt wird der Aspekt des Elektroenergieverbrauches,<br />
sofern er nichts mit Raumwärme oder Warmwasserbereitung zu tun hat.<br />
Dennoch ist dieser Bereich sehr wichtig und zum Teil erhebliche Einsparungen sind auch hier<br />
möglich. Daher wollen wir in einem kleinen Exkurs hierauf eingehen und Ihnen Hilfestellungen<br />
anbieten, auch hier erfolgreich <strong>Energie</strong> einzusparen.<br />
Strom-Info<br />
Stromenergie ist für den Verbraucher eine sehr komfortable und saubere <strong>Energie</strong>. "Stecker in die<br />
Steckdose oder Lichtschalter an" - wenige machen sich darüber Gedanken, was hinter diesem<br />
Komfort steckt:<br />
In herkömmlichen Kraftwerken müssen 3 kWh Primärenergie aufgewendet werden, um 1 kWh<br />
Strom zu erzeugen. 2 kWh gehen als Abwärme verloren!<br />
Stein-, Braunkohle und Gaskraftwerke verursachen somit zusammen 350 Mio. t CO2, das sind<br />
40% der CO2-Gesamtemissionen in Deutschland.<br />
Hinzu kommen das hohe Gefahrenpotential der Kernenergie und deren ungelöstes Endlagerungsproblem.<br />
Aus dieser Problematik lassen sich 4 Ziele ableiten:<br />
1.) Strom einsparen (was ohne Komfortverlust möglich ist!)<br />
2.) Einsatz effizienter Techniken (sparsame Geräte und Beleuchtung, etc.)<br />
3.) Einsatz regenerativer <strong>Energie</strong>n (z.B. Sonne, Wind- und Wasserkraft)<br />
4.) Ausbau der Strom- (und Wärme-) Erzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerken (aus<br />
der eingesetzten Primärenergie wird 1/3 Strom und 2/3 Wärme erzeugt/genutzt)<br />
Einige Stromspar-Tipps für den häuslichen Alltag:<br />
- Ersetzen Sie Glühlampen durch Kompaktleuchtstofflampen! Diese sind fast überall<br />
sinnvoll einzusetzen. Eine Ausnahme bilden Bereiche, in denen die Lampen nur sehr kurz<br />
brennen. Kompaktleuchtstofflampen sind heute in allen Formen und Größen erhältlich;<br />
auch die Leuchtfarben reichen vom warmen gelb bis zum weißen Bürolicht. Sie sind preiswert<br />
geworden und sparen je nach Leistung zwischen 20 und 80 € pro Lampe in deren Lebensdauer.<br />
- Schalten Sie Geräte richtig aus! Viele elektrische Geräte (Fernseher, Musikanlage...)<br />
bieten einen Stand-By-Betrieb an, der energetisch unsinnig ist. Auch wenn dieser Stromfluss<br />
zunächst vernachlässigbar klein anmutet, so haben Messungen doch erschreckend<br />
hohen Stand-By-Verbrauch zutage gefördert. Zusammengenommen ließe sich bundesweit<br />
ein Kernkraftwerk komplett einsparen, wenn Geräte richtig ausgeschaltet würden.<br />
Auch ohne Stand-By verbrauchen viele Geräte (Computer, Monitore, Drucker und viele<br />
andere) in ausgeschaltetem Zustand (!) Strom. Nutzen Sie daher Steckerleisten mit separatem<br />
Schalter, an dem Sie die Stromzufuhr komplett abschalten.<br />
- Wählen Sie bei Neuanschaffungen das sparsamste Gerät! Das wesentliche Kriterium<br />
zur Auswahl bei der Anschaffung eines neuen Gerätes sollte neben der Qualität der<br />
Verbrauch an Strom und Wasser sein. "Weiße Ware" (Spül-, Waschmaschinen, Trockner,<br />
Kühlschränke etc.) tragen einen entsprechenden Aufkleber, an dem Sie die wichtigsten<br />
Kennwerte (typischer Strom- und Wasserverbrauch) erkennen können. Eine Vergleichsliste<br />
erhalten Sie vom Bund der <strong>Energie</strong>verbraucher, von Stiftung Warentest oder Ihrem <strong>Energie</strong>versorger.<br />
Die Mehrkosten amortisieren sich praktisch in jedem Fall. Einige Geräte<br />
(Wasch- Spülmaschinen) können Warm- und Kaltwasser getrennt aufnehmen. Das bietet<br />
den Vorteil, dass das Wasser nicht elektrisch aufgeheizt werden muss, sondern über das<br />
wesentlich sparsamere Gasgerät oder besser die Solaranlage. Ältere Maschinen können<br />
mit einem Vorschaltgerät nachgerüstet werden.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 67
10/2010<br />
- Kontrollieren Sie und analysieren Sie Ihren Stromverbrauch! Im Handel, über den<br />
<strong>Energie</strong>berater und vom Bund der <strong>Energie</strong>verbraucher werden Messgeräte angeboten, mit<br />
denen Sie <strong>Energie</strong>lecks auffinden können. Vergleichen Sie auch den <strong>Energie</strong>verbrauch Ihrer<br />
Geräte mit Richtwerten (ebenfalls beim Bund der <strong>Energie</strong>verbraucher zu beziehen).<br />
- Vermeiden Sie Lastspitzen! Kraftwerke halten Kapazitäten für den größten Lastfall vor;<br />
d.h. Sie helfen Kraftwerke einzusparen, in dem Sie Strom dann beziehen, wenn andere ihn<br />
nicht brauchen. Größte Lastspitzen sind erfahrungsgemäß Spätvormittags im Winter.<br />
Schalten Sie daher Wasch- und Spülmaschinen z.B. am späten Nachmittag ein (oder gar<br />
nachts). Nebenbei: fast alle deutschen Haushalte stellen ihre Waschmaschine montags<br />
früh an, was unter anderem die Kläranlagen vor große Probleme stellt.<br />
- Überprüfen Sie Ihre Heizungspumpe und regeln Sie Ihre Heizung optimal! Vielfach<br />
laufen die Pumpen permanent, so dass sich eine falsche Einstellung stark im Stromverbrauch<br />
bemerkbar macht. Bitten Sie Ihren Installateur bei der Wartung, die Pumpe<br />
genau dem Bedarf anzupassen bzw. eine elektronisch gesteuerte Pumpe einzubauen.<br />
Lassen Sie die Heizkurven, die Nacht- und Wochenendabsenkung und die Umstellung<br />
von Sommer- auf Winterbetrieb überprüfen.<br />
- Beziehen Sie Öko-Strom! Der Umstieg ist ganz einfach! Einige Ökostromanbieter haben<br />
sogar günstigere Tarife als Ihr örtlicher Lieferant. Kontaktadressen (kein Anspruch auf Vollständigkeit!):<br />
EWS Schönau (www.ews-schoenau.de), Greenpeace energy<br />
(www.greenpeace-energy.de), Lichtblick (www.lichtblick.de), Naturstrom AG<br />
(www.naturstrom.de), etc.<br />
- Setzen Sie Photovoltaik ein! Zurzeit sind die Rahmenbedingungen für den Einsatz bzw.<br />
die Installation von Photovoltaik zur Stromerzeugung interessant: Die Abnahme des Stromes<br />
zum festgelegten kWh-Preis (2004: 57,4 Cent) ist für 20 Jahre garantiert. Informieren<br />
Sie sich gründlich!<br />
Viele weitere nützliche Stromspartipps und Informationen stehen in den Broschüren:<br />
- "<strong>Energie</strong>sparen leicht gemacht, Schönauer Stromspartipps" (zu beziehen über "Bund der<br />
<strong>Energie</strong>verbraucher", Tel. 02224 / 92 27 0, Internet: www.energienetz.de)<br />
- Broschüre des Umwelt Bundesamtes: "Ihr Verlustgeschäft - <strong>Energie</strong>räuber im Haushalt"<br />
(Tel. 030/8903-0, Internet: www.umweltbundesamt.de)<br />
6.1.6 Heizungsmodernisierung<br />
Die Heizungsanlage sollte zusätzlich mit einer modernen Steuerung adaptiert werden, welche in<br />
der Lage ist, als Steuergröße die Rücklauftemperatur in die Regelung einzubeziehen. Hierdurch<br />
verringert sich die Betriebszeit des Kessels insbesondere den Teillastbetrieb in den Übergangszeiten<br />
enorm. Vor Inbetriebnahme des Steuermoduls muss ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage<br />
erfolgen.<br />
Die Umwälzpumpe sollte elektronisch drehzahl- oder druckdifferenzgeregelt ihre Leistung<br />
anpassen können (s.o.). Die Heiz- und Warmwasserleitungen müssen zur Vermeidung von<br />
Wärmeverlusten gut gedämmt werden.<br />
In Zusammenhang mit einer Heizungsmodernisierung bzw. bei Austausch der Heizkörper bzw.<br />
Ersatz von Einzelfeuerstätten sollten Sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen, Wandflächenheizungen<br />
einzubauen.<br />
Im Gegensatz zu normalen Heizkörpern (Erwärmung durch die Luft) bieten Wandflächenheizungen<br />
angenehme Strahlungswärme (vergleiche Sonne, Kachel-/Grundofen!), die tief in den Körper<br />
eindringt und folgende Vorteile bietet: keine Luftumwälzung im Raum und damit weniger<br />
Staubaufkommen, optimale Behaglichkeit und <strong>Energie</strong>ersparnis (Raumumfassungsflächen sind<br />
wärmer, entziehen dem Körper damit weniger Wärme und erlauben somit bei gleicher Behaglichkeit<br />
niedrigere Raumtemperaturen (Bei 1°C weniger Raumtemperatur werden 6% <strong>Energie</strong><br />
eingespart!).<br />
Allerdings muss die Möblierung vorab genauer geplant werden. Bilder können aber mit Hilfe von<br />
Bildleisten bzw. Wärmefolien zur Ortung der Heizrohre aufgehängt werden!<br />
Außerdem sollten Außenwandflächen, auf denen Wandheizungen montiert werden, einen Mindest-<br />
U-Wert von 0,35 W/m²K aufweisen.<br />
Wandflächenheizungen bieten die baubiologisch besten Wärmeübertragungsflächen. "Es fühlt sich<br />
an, als hätte man in jedem Raum einen Kachelofen!" Im Idealfall werden die Heizregister mit Lehm<br />
verputzt, dann ist ein optimales Wohlfühlklima (Raumluftfeuchte, Strahlungs- und Temperaturverhalten)<br />
gegeben.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 68
10/2010<br />
Außer den verputzen Rohschlangen gibt es auch Plattensysteme, bei denen die Heizrohre in<br />
Gipsfaser- oder Lehmbauplatten bereits integriert sind. Diese eigenen sich z.B. auch zur<br />
Anbringung der Wandheizflächen in Dachschrägen!<br />
6.1.7 Thermische Solaranlage zur Warmwasser-Bereitung<br />
Bei der Möglichkeit zur Installation von Solarkollektoren auf nach Süden ausgerichteten Dachflächen<br />
oder mit entsprechenden Untergestellen auf ebenen Flächen kann ein großer Teil der für die<br />
Brauchwassererwärmung erforderlichen <strong>Energie</strong> solar erzeugt werden.<br />
Faustregel ein zur Dimensionierung von Solaranlagen: Kollektorfläche pro Person: Ca. 1,5 m² mit<br />
Flachkollektoren, ca. 1,0 m² mit Vakuumröhrenkollektoren.<br />
Der <strong>Energie</strong>bedarf für die Warmwasserbereitung von zwei Personen kann bei einer zu erwartenden<br />
65 % solaren Deckung von ca. 1.500 kWh/a auf etwa 600 kWh/a reduziert werden.<br />
Die thermische Solaranlage lässt sich mit der Heizungsanlage kombinieren, so dass bei anhaltend<br />
geringer Solareinstrahlung der Heizkessel die Brauchwassererwärmung unterstützt.<br />
Der Wirkungsgrad der Anlage erhöht sich bei Verwendung eines Solar- Schichtenspeichers und<br />
der low flow Beladungstechnik.<br />
6.1.8 Regenwassernutzung<br />
In Deutschland fallen im Durchschnitt 700 Liter je m² Grundfläche pro Jahr. Wird das Wasser eines<br />
150 m² großen Dachs gesammelt, kann damit eine vierköpfige Familie zu über 75 % mit Wasser<br />
versorgt- und dabei mehr als 100.000 Liter Trinkwasser jährlich eingespart werden. Weiterhin ist es<br />
für Gartenbewässerung und Haushaltsreinigung geeignet. Durch die geringe Härte eignet sich<br />
Regenwasser auch sehr gut zum Waschen.<br />
Das qualitativ beste Regenwasser liefern geneigte Dächer mit harter Dachhaut aus Ziegel,<br />
Dachsteinen, Schiefer, Zink- oder Edelstahlblech. Regenwasser von Bitumendächern ist oft stark<br />
gelblich verfärbt und für Wäschewaschen ungeeignet; Asbestzementdächer sind wegen der<br />
Faserfreisetzung ungeeignet und zu sanieren; Gründächer vermindern den Wasserertrag stark und<br />
färben das Wasser häufig bräunlich ein.<br />
Das Regenwasser sollte möglichst dunkel und kühl gelagert werden. Erdspeicher (z.B. monolithische<br />
Betonzisternen) sind hier im Vorteil. Innenspeicher sollten nur gewählt werden, wenn<br />
Erdspeicherung nicht möglich ist. Überschlägig können bei Wohnnutzung je Bewohner 800 Liter<br />
Tankvolumen angenommen werden.<br />
Überschüssiges Regenwasser kann einer Versickerungsanlage zugeführt werden.<br />
Den Wasserversorgern ist der Bau einer Regenwasseranlage vor Inbetriebnahme anzuzeigen.<br />
Regenwasserleitungen und Entnahmestellen müssen daher deutlich unterscheidbar von<br />
Trinkwasserleitungen und Entnahmestellen kenntlich gemacht werden.<br />
6.1.9 Photovoltaik-Anlage<br />
Die auf eine ebene Fläche auftreffende Sonnenenergie beträgt in Deutschland im Mittel pro Tag<br />
etwa 2,9 kWh/m², d.h. im Jahr 1.045 kWh/m². Der Wert optimal zur Sonne ausgerichteter Flächen<br />
beträgt im Mittel 1.180 kWh/m² und variiert je nach Region um etwa 10 %.<br />
Ein durchschnittlicher 4- Personen- Haushalt verbraucht jährlich etwa 5.000 kWh elektrischer<br />
<strong>Energie</strong>. Zur Gewinnung der erforderlichen Haushaltsstrom- <strong>Energie</strong> eines 4- Personen- Haushalts<br />
würde man für eine netzautarke Versorgung bei derzeitigen PV- Wirkungsgrad eine Modulfläche<br />
von ca. 65 m² (bei solarer Normeinstrahlung Deutschland) benötigen.<br />
Idealerweise werden die Module mit einer Neigung von 30° - 40° und Südausrichtung montiert.<br />
Die Anlagen können über elektronische Wechselrichter an das öffentliche Stromnetz angeschlossen<br />
werden. Dadurch kann die aufwändige Speicherung überschüssigen Stroms in Akkumulatoren<br />
entfallen. Bei geringer PV- Anlagenleistung wird der Bedarf über das öffentliche Netz gedeckt.<br />
Die Herstellungskosten photovoltaisch erzeugten Stroms liegen noch immer deutlich über dem<br />
konventionell erzeugten Strom.<br />
Durch die, in Deutschland gesetzlich garantierte, Mindesteinspeisevergütung rentiert sich die<br />
Errichtung einer PV Anlage auch ohne Eigennutzung. Diese ist alternativ zur Einspeisung auch<br />
möglich und wird gefördert.<br />
Die Rahmenbedingungen für den Einsatz bzw. die Installation von Photovoltaik zur Stromerzeugung<br />
sind zurzeit äußerst günstig. Die Kosten für Anlagen sind deutlich gesunken, die Einspeisevergütung<br />
auf 20 Jahre garantiert.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 69
10/2010<br />
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der Einspeisevergütung der<br />
kommenden Jahre (Alle Angaben in Cent/kWh):<br />
01.07.201<br />
0<br />
01.10.201<br />
0<br />
01.01.2011<br />
1)<br />
01.01.2012<br />
1)<br />
01.01.2013<br />
1)<br />
01.01.2014<br />
1)<br />
Dach/Fassade<br />
bis 30 kWh 34,05 33,03 30,06 27,35 24,89 22,65<br />
ab 30 kWh 32,39 31,42 28,59 26,02 23,68 21,55<br />
ab 100 kWh 30,65 29,73 27,05 24,62 22,40 20,39<br />
ab 1000 kWh 25,55 24,79 22,55 20,53 18,68 17,00<br />
Freiflächenanlagen<br />
25,02 24,26 22,07 20,09 18,28 16,64<br />
KonversionsflächenEigenverbrauch2)<br />
26,15 25,37 23,08 21,00 19,12 17,40<br />
bis 30 kWh 17,67 16,65 15,15 (13,79) (12,55) (11,42)<br />
ab 30%<br />
Eigennutzung<br />
22,05 21,03 19,13 (17,41) (15,85) (14,42)<br />
ab 30 kWh 16,01 15,04 13,69 (12,45) (11,33) (10,31)<br />
ab 30%<br />
Eigennutzung<br />
20,39 19,42 17,67 (16,08) (14,63) (13,31)<br />
100 bis 500 kWh 14,27 13,35 12,14 (11,05) (10,06) ( 9,15)<br />
ab 30%<br />
Eigennutzung<br />
18,65 17,73 16,13 (14,68) (13,36) (12,16)<br />
1) Vergütung bei einer Degression von 9% ab 01.01.2011<br />
2) Für den Eigenverbrauch gibt es zwei Vergütungstarife: Werden bis 30% des Solarstroms selbst genutzt, so gilt<br />
der niedrigere Tarif. Nur für den darüber hinaus gehenden Anteil wird der höhere Tarif gezahlt.<br />
Die Daten finden Sie auch im Internet unter www.solaraccess.de. Pro Jahr wird eine Kostendegression<br />
von derzeit 5 % für neue Anlagen gerechnet. Durch diese Vergütungen arbeiten diese<br />
Anlagen bei entsprechenden Rahmenbedingungen gewinnbringend.<br />
6.1.10 Allgemeine Anmerkungen zu Wärmedämmverbund-System (WDVS)<br />
Zum WDVS aus Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz sollen folgende Anmerkungen gemacht<br />
werden:<br />
- Es sollten nur komplette Systeme von einem Hersteller verwendet werden.<br />
- Es sollte auf Alu-Sockelschienen (Montagehilfen) verzichtet werden, da diese eine kritische<br />
lineare Wärmebrücke darstellen. Alternativ kann z.B. Edelstahl oder ein bereits vorhandener<br />
(vorstehender) Sockel eingesetzt werden. Bei einem Einfamilienhaus verschlechtern Alu-<br />
Schienen die Dämmwirkung des Systems um 25% gegenüber Edelstahlschienen!<br />
- Bei Grenzbebauung muss die Aufbringung eines WDVS mit der Baubehörde bzw. dem<br />
Nachbarn abgeklärt werden.<br />
- Achten Sie an den sorgfältigen Anschluss des Dämmmaterials an die Fensterlaibungen (und<br />
den Sturz): mindestens ca. 2 - 4 cm starke Dämmplatten um die Laibungsecke herumführen<br />
oder die neuen Fenster mit der Außenkante auf die Außenkante der vorhandenen Wand setzten,<br />
damit der Dämmstoff einige cm über den Blendrahmen geführt werden kann.<br />
- In der Regel werden durch den verbreiterten Wandaufbau neue Außenfensterbänke notwendig.<br />
Auch diese sollten unterseitig eine Dämmlage erhalten, damit ähnlich wie bei den Fensterlaibungen<br />
keine Wärmebrücken entstehen können.<br />
- Die Dämmplatten sollten umseitig am Rand verklebt werden (keine Klebebatzen), damit eine<br />
homogene Verbindung ohne Luftkanäle zwischen Bestandswand und Dämmplatte hergestellt<br />
wird.<br />
- Beim Anbringen eines WDVS müssen die Regenfallrohre vorverlegt werden.<br />
- Unter Umständen kann auch die Verbreiterung des Dachüberstandes notwendig werden (wird<br />
das Dach sowieso neu eingedeckt, ist diese Verbreiterung relativ einfach herzustellen).<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 70
10/2010<br />
- In stoßgefährdeten Bereichen (z.B. Sockel) kann das Anbringen eines Panzergewebes sinnvoll<br />
sein.<br />
- Entscheiden Sie sich rechtzeitig für eine Fassadenfarbe, der Putz kann dann ggf. eingefärbt<br />
werden. Dunkle Farben sind bei WDVS ungünstig und müssen vorher mit dem Systemhersteller<br />
geklärt werden.<br />
- Dämmstoffwahl: Für die Außenwanddämmung mit Putzschicht sind folgende (ökologische)<br />
Materialien verwendbar: Holzweichfaserplatten, Zellulose, Schilfrohrmatten, Kalziumsilikatplatten,<br />
Mineraldämmplatten und Kork. Diese Materialien sind diffusionsfähig, hygroskopisch, bilden<br />
im Brandfall keine giftigen Gase, haben kein Treibhauspotential und sind problemlos zu entsorgen.<br />
- Konventionelle Produkte sind Systeme mit Mineralfaser oder Hartschaumprodukte*.<br />
*Hinweise zu Hart- und Montageschaumprodukten:<br />
Nachdem seit 1995 FCKW als Treibmittel in Dämmstoffen verboten wurde, kommt in vielen<br />
Produkten (z.B. PUR-Hartschaum und XPS Extruderschaum einzelner Hersteller) HFCKW als<br />
Treibmittel zum Einsatz. Auch dieses Treibmittel hat ein hohes Treibhauspotential und ist langfristig<br />
keine Alternative (leider offiziell noch bis 2015 in Deutschland erlaubt)!<br />
Treibmittel im Vergleich:<br />
CO2 Treibhauspotential: 1<br />
HFCKW 22 Treibhauspotential: 4.100<br />
HFCKW 141b Treibhauspotential: 1.500<br />
Fragen Sie bei der Produktwahl genau nach und lassen Sie sich schriftlich bestätigen, welches<br />
Treibmittel benutzt wurde!<br />
Sollten Sie sich dennoch für Polystyrol-Dämmstoffe entscheiden, achten Sie darauf, dass die<br />
Platten mind. ½ Jahr abgelagert wurden, da sie schwinden.<br />
Bei den Kosten ist zu beachten, dass bei einer Putzausbesserung mit neuem Anstrich "Sowieso-<br />
Kosten" für Gerüst und Anstrich anfallen, die in der Gesamt-Bilanz von diesen Kosten abzuziehen<br />
sind.<br />
Der finanzielle Aufwand, den man für Außenputzarbeiten und Malerarbeiten aufbringen muss,<br />
beträgt ca. 50,- Euro/m2. Die Mehrkosten für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems<br />
betragen bei konventionellen Systemen etwa 35%.<br />
6.2 Erläuterungen zu Wärmebrücken<br />
Wärmebrücken sind Punkte, Winkel und Flächen der Gebäudehülle, an denen gegenüber den<br />
übrigen Bauteilen erhöhte Transmissionen stattfinden. Mit dem Begriff Wärmebrücken werden alle<br />
Bauteile oder Bauteilzonen bezeichnet, durch die die Wärme stärker, bzw. schneller fließt als durch<br />
die benachbarten Bauteile / Bauteilzonen. Wenn durch eine solche "Störung" in der Wärme<br />
übertragenden Gebäudehülle an einem "Punkt" die Wärme schneller vom Innenraum nach außen<br />
fließen kann als durch die umgebenen Bauteile, besteht die Gefahr von Tauwasserbildung. Dieses<br />
kann zur Schädigung dieses Bauteiles oder zur Schimmelbildung führen.<br />
Man unterscheidet geometrische und konstruktive, lineare und flächenhafte Wärmebrücken.<br />
Es werden grundsätzlich vier Arten von Wärmebrücken unterschieden:<br />
- Materialbedingte Wärmebrücken sind aus Materialien, deren Wärmeleitfähigkeit größer<br />
ist als die der umgebenden Bauteile.<br />
- Geometrisch bedingte Wärmebrücken entstehen immer, wenn die Wärme abgebende<br />
Oberfläche eines Bauteils größer ist als die Wärme aufnehmende Fläche z.B. Gebäudeecken.<br />
- Konstruktionsbedingte Wärmebrücken treten immer dann auf, wenn die Wärme<br />
übertragende Gebäudehülle bei bestimmten Bauteilen geschwächt ist z.B. Heizkörpernischen,<br />
Auflager für Bodenplatten, Schlitze für Installationsleitungen, usw.<br />
- Lüftungsbedingte Wärmebrücken haben grundsätzlich als Ursache konvektive Luftströme<br />
durch Fugen und andere Gebäudeundichtigkeiten. Diese Gebäudeundichtigkeiten lassen<br />
sich mittels einer Blower-Door-Messung feststellen.<br />
Im Folgenden werden solche Wärmebrücken betrachtet, die nicht bereits in die Kalkulation der<br />
Bauteil-Transmissionen eingegangen sind.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 71
10/2010<br />
Sowohl geometrische als auch konstruktive Wärmebrücken werden durch die Berechnungsmethode<br />
der Bauteile berücksichtigt. Bei deren Flächen werden die Außenmaße eingesetzt, d.h. das alle<br />
Wand- und Deckenanschlüsse mit abgedeckt werden.<br />
In unbeheizten Räumen verlaufende Rohrleitungen (Wasser- und Heizungsrohre) sollten gedämmt<br />
werden.<br />
Vorhandene Heizkörpernischen sollten ausgemauert werden.<br />
Neu zu errichtende Installationsschächte sollten nach Möglichkeit nicht in der Gebäudeaußenhülle<br />
erstellt werden.<br />
Im Normalfall werden Wärmebrücken mit einem Pauschalwert berücksichtigt.<br />
Bei der Berechnung nach <strong>Energie</strong>-Einsparverordnung (EnEV) wurde ein pauschaler Aufschlag für<br />
die Wärmebrücken von 0,1 W/m2K auf die U-Werte der Gebäudehülle verwendet.<br />
6.3 Entsorgungskonzept<br />
Bei der Gebäudesanierung fallen Abfallstoffe an, welche fachgerecht entsorgt werden müssen.<br />
Bei der Auswahl der einzusetzenden Baustoffe für die Sanierung sollte eine spätere Entsorgung in<br />
jedem Fall berücksichtigt werden.<br />
Baumaterialien und -konstruktionen haben höchst unterschiedliche Eigenschaften, was die spätere<br />
Entsorgung (nach Ihrer Nutzungszeit) angeht. Im Rahmen einer Modernisierungsmaßnahme<br />
werden Bauteile oder Komponenten entfernt und neue eingebaut. Beim Ausbau tritt das Problem<br />
der Entsorgung direkt auf, aber auch die neu einzubauenden Komponenten und Materialien<br />
müssen irgendwann entsorgt werden.<br />
Eine wesentliche Rolle bei der Entsorgung spielt natürlich das eingesetzte Material (Holz,<br />
Kunststoff, Metall) und deren Kombination (Verbundmaterialien). In jedem Fall müssen Sie diese<br />
Materialien soweit möglich trennen und der jeweiligen Entsorgungsart zuführen. Unkritisch zu<br />
entsorgen sind unbehandelte Hölzer und andere Naturmaterialien. Diese können direkt verwertet<br />
werden, als Rohstoff für eine weitere Nutzung dienen oder thermisch verwertet werden (Verbrennung).<br />
Auch Metalle, wenn Sie sauber getrennt werden, sind als Wertstoffe Rohstoffe für eine<br />
hochwertige Wiederverwendung.<br />
Wesentlich problematischer sind Kunststoffe, Lacke und Verbundwerkstoffe. Hierbei müssen die<br />
besonderen Entsorgungs-Vorschriften jedes Stoffes beachtet werden. Zuweilen sind Bauteile bei<br />
der Entsorgung sogar sehr gefährlich (Asbest), bei anderen Stoffen kann unsachgemäße<br />
Entsorgung gesundheitsgefährdend sein (Verbrennung von Polystyrol). Fragen Sie hier im<br />
Einzelfall nach.<br />
Während Sie die ausgebauten Stoffe sachgerecht entsorgen müssen, können Sie bei der<br />
Entscheidung für neu einzubauende Materialien schon Einfluss nehmen auf den Aufwand späterer<br />
Entsorgung. Unbedenklich, nachhaltig und hochwertig sind meist ökologische Bau- und Dämmstoffe,<br />
die zudem bei der Herstellung nicht viel <strong>Energie</strong> benötigen. Sie finden sie im entsprechenden<br />
Fachhandel. Verwenden Sie zurückhaltend Kunststoffe, Verbundstoffe. PVC und andere<br />
Problemstoffe können heute gänzlich vermieden werden.<br />
Die Demontage des Öltanks sollte zweckmäßigerweise durch eine Fachfirma erfolgen. Die<br />
Sicherheitsvorschriften sind dabei einzuhalten.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 72
6.4 Bewertungsschemata<br />
Bewertung der U-Werte von Bauteilen<br />
10/2010<br />
Bauteil U-Wert (W/m2K) Bemerkung Note<br />
Außenwände < 0,15 Passivhaus 1 (sehr gut)<br />
0,15 - 0,2 Niedrigenergiehaus 2 (gut)<br />
0,24 - 0,35 EnEV 2009 3 (befriedigend)<br />
0,45 - 0,6 WSchVO 1984 4 (ausreichend)<br />
0,6 - 1,5 Gebäudebestand 5 (mangelhaft)<br />
> 1,5 6 (ungenügend)<br />
Dach < 0,1 Passivhaus 1<br />
0,1 - 0,15 Niedrigenergiehaus 2<br />
0,2 - 0,24 EnEV 2009 3<br />
0,3 - 0,4 WSchVO 1984 4<br />
0,4 - 1,5 Gebäudebestand 5<br />
> 1,5 6<br />
Boden < 0,2 Passivhaus 1<br />
0,2 - 0,3 Niedrigenergiehaus 2<br />
0,24 - 0,5 EnEV 2009 3<br />
0,4 - 1,0 WSchVO 1984 4<br />
1,0 - 1,8 Gebäudebestand 5<br />
> 1,8 6<br />
Fenster < 0,7 3-Scheiben-<br />
Isolierverglasung<br />
1<br />
0,7 - 1,5 Wärmeschutzverglasung 2<br />
1,5 - 3,0 Standard ISO 3<br />
3,0 - 4,0 Gebäudebestand 4<br />
4,0 - 5,0 5<br />
Fugen ohne Dichtung oder ungenügende Metallrahmen ergeben eine Abstufung um eine Note!<br />
Bewertung der <strong>Energie</strong>kennzahlen<br />
spezifischer Heizenergieverbrauch<br />
(kWh/m2a)<br />
Bemerkung Note<br />
0 - 70 Passivhaus/Niedrigenergiehaus 1<br />
70 - 120 EnEV 2<br />
120 - 160 Wärmeschutzverordnung 1995 3<br />
160 - 220 Bestand 4<br />
220 - 300 Bestand 5<br />
> 300 Bestand 6<br />
Bewertung der Heizungsanlage und der Warmwasseranlage<br />
Jahresnutzungsgrad der Heizung/WW Heizsystem Note<br />
> 95 % (> 90%) Brennwertkessel Fern-/Nahwärmeanschluss 1<br />
85 - 95 % (70-90%) moderner Niedertemperaturkessel (Öl/Gas) 2<br />
80 - 85 % (50-70%) Standardkessel 5 - 10 Jahre alt 3<br />
75 - 80 % (30-50%) Standardkessel 10 - 15 Jahre als 4<br />
70 - 75 % (< 30%) > 15 Jahre, stark überdimensionierter Kessel 5<br />
< 70 % (-) > 20 Jahre, stark überdimensionierter Kessel 6<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 73
Bewertung Stromverbrauch<br />
Haushaltsgröße<br />
Stromverbrauch*)<br />
kWh/a<br />
(Durchschnitt)<br />
10/2010<br />
Verbrauch<br />
sehr gut gut befriedigend unbefriedigend schlecht<br />
1 Person 1.600 900 1.350 1.600 2.250 2.700<br />
2 Personen 2.800 1.450 2.180 2.800 3.630 4.350<br />
3 Personen 3.900 1.900 2.850 3.900 4.750 5.700<br />
*) Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen VEW, Ergebnisse der Haushaltskundenbefragung 1991<br />
6.5 Anhang: Berechnung der Transmissionen durch die Bauteile<br />
In der folgenden Tabelle der Wärmeverluste durch die Bauteile (Transmissionen) werden lokale<br />
Randbedingungen zugrunde gelegt. Diese gehen in die Temperaturdifferenz ein, in den Faktor die<br />
Heizperiode, die Lage und Exposition des Gebäudes und des Bauteils. Die errechneten Werte<br />
entsprechen also nicht den normierten (Deutschland gemittelten) Werten der DIN4108-6, können<br />
also nicht zum Bauteilnachweis gem. EnEV herangezogen werden.<br />
Grenzfläche nach unten U-Wert Fläche T.Diff. Transmis. Faktor bereinigt<br />
Bauteile [W/m2K] [m2] [°C] [kWh/a] [kWh/a]<br />
Kellerdecke 0,90 56,0 15,8 4.401 0,70 3.145<br />
Summe 0,90 56,0 3.145<br />
Grenzfläche nach oben U-Wert Fläche T.Diff. Transmis. Faktor bereinigt<br />
Bauteile [W/m2K] [m2] [°C] [kWh/a] [kWh/a]<br />
Dachschräge 1,17 45,5 15,8 4.651 1,00 4.749<br />
Decke DG - Spitzboden 0,75 12,1 15,8 789 0,80 645<br />
Decke DG - Drempel 2,11 12,1 15,8 2.224 0,80 1.816<br />
Summe 1,26 69,7 7.210<br />
seitl. Grenzflächen U-Wert Fläche T.Diff. Transmis. Faktor bereinigt<br />
Bauteile [W/m2K] [m2] [°C] [kWh/a] [kWh/a]<br />
Außenwände 0,90 122,5 15,8 9.616 1,00 9.818<br />
Abseitenwand 2,13 12,8 15,8 2.376 1,00 2.426<br />
Gaubenwand 0,45 1,6 15,8 61 1,00 63<br />
Summe 1,01 136,9 12.306<br />
Fenster U-Wert Fläche T.Diff. Transmis. Faktor bereinigt<br />
(ohne Strahlungsgewinne) [W/m2K] [m2] [°C] [kWh/a] [kWh/a]<br />
Südfenster 3,50 3,6 15,8 1.099 1,00 1.122<br />
West/Ostfenster 3,50 5,6 15,8 1.697 1,00 1.733<br />
Nordfenster 3,50 3,0 15,8 916 1,00 935<br />
Balkontür 3,50 2,0 15,8 611 1,00 623<br />
Eingangstür 3,50 2,0 15,8 611 1,00 623<br />
Summe 3,50 16,2 5.037<br />
Gesamtwerte 1,20 279 29.050 30.181<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 74
6.6 Bauteilnachweis nach EnEV<br />
Nachfolgend wird der Bauteilnachweis für die Bauteile im Ist-Zustand ausgegeben.<br />
6.6.1 Bauteile mit Abgrenzung nach oben<br />
6.6.1.1 Wärmeschutz zu: Dachschräge<br />
10/2010<br />
Dachschräge, U-Wert: 1,172 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 45,5<br />
Dicke in cm: 21,5<br />
Rahmenanteil in %: 20,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Fach<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Tondachziegel 2.080 2,00 41,60 1,200 0,02<br />
Luftschicht 0 4,00 0,00 0,400 0,16<br />
Naturbims 400 14,00 56,00 0,250 0,56<br />
Kalkgipsmörtel 1.400 1,50 21,00 0,700 0,02<br />
Summe: 21,50 118,60 0,70<br />
Rahmen (Rahmenanteil 20%)<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Rinnen: 0,10<br />
Raußen: 0,10<br />
Rgesamt: 0,90<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Tondachziegel 2.080 2,00 41,60 1,200 0,02<br />
Holz 600 18,00 108,00 0,135 1,33<br />
Kalkgipsmörtel 1.400 1,50 21,00 0,700 0,02<br />
Summe: 21,50 170,60 1,37<br />
Rinnen: 0,10<br />
Raußen: 0,10<br />
Rgesamt: 1,57<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 75
6.6.1.2 Wärmeschutz zu: Decke DG - Spitzboden<br />
10/2010<br />
Decke DG - Spitzboden, U-Wert: 0,748 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 12,1<br />
Dicke in cm: 20,9<br />
Rahmenanteil in %: 20,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 0,8<br />
Fach<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Holzdielen 800 2,40 19,20 0,200 0,12<br />
Lehm, leicht 700 12,00 84,00 0,160 0,75<br />
Luftschicht 0 5,00 0,00 0,400 0,16<br />
Gipskartonplatten<br />
900 1,50 13,50 0,210 0,07<br />
Summe: 20,90 116,70 1,07<br />
Rahmen (Rahmenanteil 20%)<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Rinnen: 0,10<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 1,21<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Holzdielen 800 2,40 19,20 0,200 0,12<br />
Holz 600 17,00 102,00 0,130 1,31<br />
Gipskartonplatten<br />
900 1,50 13,50 0,210 0,07<br />
Summe: 20,90 134,70 1,50<br />
Rinnen: 0,10<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 1,64<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 76
6.6.1.3 Wärmeschutz zu: Decke DG - Drempel<br />
10/2010<br />
Decke DG - Drempel, U-Wert: 2,107 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 12,1<br />
Dicke in cm: 23,5<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 0,8<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Zementestrich 2.000 2,00 40,00 1,400 0,01<br />
Betondecke 2.300 20,00 460,00 0,920 0,22<br />
Gipsputz 1.200 1,50 18,00 0,350 0,04<br />
Summe: 23,50 518,00 0,27<br />
Rinnen: 0,10<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 0,41<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 77
6.6.2 Bauteile mit Abgrenzung nach unten<br />
6.6.2.1 Wärmeschutz zu: Kellerdecke<br />
10/2010<br />
Kellerdecke, U-Wert: 0,901 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 56,0<br />
Dicke in cm: 25,5<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 0,7<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Gipsputz 1.200 1,50 18,00 0,350 0,04<br />
Betondecke 2.300 20,00 460,00 0,760 0,26<br />
Mineralwolle 377 2,00 7,54 0,045 0,44<br />
Zementestrich 2.000 2,00 40,00 1,000 0,02<br />
Summe: 25,50 525,54 0,77<br />
Rinnen: 0,17<br />
Raußen: 0,17<br />
Rgesamt: 1,11<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 78
6.6.3 Bauteile mit seitlicher Abgrenzung<br />
6.6.3.1 Wärmeschutz zu: Außenwände<br />
10/2010<br />
Außenwände, U-Wert: 0,900 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 122,5<br />
Dicke in cm: 37,5<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Keramikklinker 1.200 11,50 138,00 0,570 0,20<br />
Luftschicht 0 0,50 0,00 0,400 0,11<br />
Vollloch,<br />
Hochlochziegel<br />
730 24,00 175,20 0,408 0,59<br />
Gipsputz 1.200 1,50 18,00 0,360 0,04<br />
Summe: 37,50 331,20 0,84<br />
Rinnen: 0,13<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 1,01<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 79
6.6.3.2 Wärmeschutz zu: Abseitenwand<br />
10/2010<br />
Abseitenwand, U-Wert: 2,128 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 12,8<br />
Dicke in cm: 6,5<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Gasbeton 800 5,00 40,00 0,290 0,17<br />
Gipsputz 1.000 1,50 15,00 0,400 0,04<br />
Summe: 6,50 55,00 0,21<br />
Rinnen: 0,13<br />
Raußen: 0,13<br />
Rgesamt: 0,47<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 80
6.6.3.3 Wärmeschutz zu: Gaubenwand<br />
10/2010<br />
Gaubenwand, U-Wert: 0,450 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 0,240 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 1,6<br />
Dicke in cm: 18,8<br />
Rahmenanteil in %: 20,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Fach<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Holzschalung 400 2,30 9,20 0,050 0,46<br />
Luftschicht 0 5,00 0,00 2,940 0,02<br />
Mineralwolle 377 8,00 30,16 0,045 1,78<br />
Luftschicht 0 2,00 0,00 0,140 0,18<br />
Gipskartonplatten<br />
900 1,50 13,50 0,210 0,07<br />
Summe: 18,80 52,86 2,47<br />
Rahmen (Rahmenanteil 20%)<br />
Bauteilschicht Rohdichte<br />
[kg/m³]<br />
Schichtdicke<br />
[cm]<br />
Flächengewicht<br />
[kg/m²]<br />
Rinnen: 0,13<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 2,64<br />
Wärmeleitfähigkeit<br />
[W/mK]<br />
R2) [m²K/W]<br />
Holzschalung 400 2,30 9,20 0,050 0,46<br />
Luftschicht 0 5,00 0,00 2,940 0,02<br />
Holz 400 8,00 32,00 0,140 0,57<br />
Luftschicht 0 2,00 0,00 0,140 0,18<br />
Gipskartonplatten<br />
900 1,50 13,50 0,210 0,07<br />
Summe: 18,80 54,70 1,26<br />
Rinnen: 0,13<br />
Raußen: 0,04<br />
Rgesamt: 1,43<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 81
6.6.4 Fensterbauteile<br />
6.6.4.1 Wärmeschutz zu: Südfenster<br />
10/2010<br />
Südfenster, U-Wert: 3,500 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 1,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 3,6<br />
Neigung: vertikal<br />
Verschattung in %: 10,0<br />
g-Wert: 0,65<br />
Rahmenanteil in %: 40,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Für dieses Bauteil liegt kein detaillierter Schichtaufbau vor.<br />
6.6.4.2 Wärmeschutz zu: West/Ostfenster<br />
West/Ostfenster, U-Wert: 3,500 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 1,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 5,6<br />
Neigung: vertikal<br />
Verschattung in %: 20,0<br />
g-Wert: 0,65<br />
Rahmenanteil in %: 40,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Für dieses Bauteil liegt kein detaillierter Schichtaufbau vor.<br />
6.6.4.3 Wärmeschutz zu: Nordfenster<br />
Nordfenster, U-Wert: 3,500 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 1,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 3,0<br />
Neigung: vertikal<br />
Verschattung in %: 10,0<br />
g-Wert: 0,65<br />
Rahmenanteil in %: 40,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 82
Für dieses Bauteil liegt kein detaillierter Schichtaufbau vor.<br />
6.6.4.4 Wärmeschutz zu: Balkontür<br />
10/2010<br />
Balkontür, U-Wert: 3,500 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 1,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 2,0<br />
Neigung: vertikal<br />
Verschattung in %: 0,0<br />
g-Wert: 0,65<br />
Rahmenanteil in %: 60,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Für dieses Bauteil liegt kein detaillierter Schichtaufbau vor.<br />
6.6.4.5 Wärmeschutz zu: Eingangstür<br />
Eingangstür, U-Wert: 3,500 W/m²K EnEV2009-Anforderung1): 1,300 W/m²K erfüllt: nein<br />
Fläche in m²: 2,0<br />
Neigung: vertikal<br />
Verschattung in %: 0,0<br />
g-Wert: 0,00<br />
Rahmenanteil in %: 100,0<br />
Innentemperatur in °C: 20,0<br />
Temperatur-<br />
Korrekturfaktor Fx: 1,0<br />
Für dieses Bauteil liegt kein detaillierter Schichtaufbau vor.<br />
1) Anforderung nach EnEV 2009, Anlage 3, Tabelle 1<br />
2) Wärmedurchlasswiderstand<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 83
6.7 Förderungen<br />
10/2010<br />
Modernisierungsmaßnahmen für Wohngebäude, technische Maßnahmen zur <strong>Energie</strong>einsparung und<br />
Schonung der Ressourcen werden von öffentlicher Hand gefördert.<br />
Diese Förderungen (ca. 4000 Förderprogramme) können aus Zuschüssen oder zinsvergünstigten Krediten<br />
bestehen und werden bereitgestellt von:<br />
- Bund und Ländern (ca. 100 Förderprogramme)<br />
- Landkreisen, Städten, Gemeinden und<br />
- <strong>Energie</strong>versorgern<br />
Die Fördermittel sind i.a. nicht unbegrenzt vorhanden. Die Programme der Kommunen und Länder haben<br />
häufig geringe Laufzeiten, oft durch die geringen Budgets bedingt.<br />
Adressen<br />
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA, Referat 414 / 415, Tel.: 06196 / 908-625<br />
Datenbanken<br />
Kreditanstalt für Wiederaufbau www.kfw.de<br />
Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft www.solarfoerderung.de<br />
Der Solarserver www.solarserver.de/geld.htm<br />
<strong>Energie</strong>förderung BINE www.energiefoerderung.info<br />
Fördermitteldatenbank www.foerderdata.de<br />
6.8 Internetadressen<br />
Deutsche <strong>Energie</strong>-Agentur (dena) www.zukunft-haus.info<br />
Deutsches <strong>Energie</strong>berater-Netzwerk e.V. www.deutsches-energieberaternetzwerk.de<br />
<strong>Energie</strong>projekte BINE www.energie-projekte.de<br />
Bund der <strong>Energie</strong>verbraucher www.energienetz.de<br />
Gebäudeenergieberater im Handwerk Bundeslandverband<br />
www.gih-bv.de<br />
Bundesverband für Umweltberatung e.V. (bfub) www.umweltberatung.org<br />
Bau Ingenieure Architekten Gutachter - Sachverständigengemeinschaft<br />
www.biag-sv.de<br />
ENVISYS energy consulting www.envisys.de<br />
Gerätelisten www.spargeraete.de und www.energiesparendegeraete.de<br />
6.9 Glossar<br />
<strong>Energie</strong>umsatz pro Zeiteinheit = Watt (W) (1 kW = 1.000 W)<br />
Einheit für <strong>Energie</strong>verbrauch/-leistung pro Jahr = kWh/a<br />
Flächenspezifischer, jährlicher <strong>Energie</strong>verbrauch = kWh/m2a<br />
Abgasverluste<br />
- Wärme, die mit dem Abgas der Heizanlage verloren geht. Lässt sich durch Brennertechnik reduzieren<br />
(siehe Brennwertkessel). Bei niedrigen Abgasverlusten allerdings Gefahr der Schornsteinversottung.<br />
Amortisation<br />
- Deckung der aufgewendeten Investitionskosten für ein Maßnahmepaket durch deren Einsparung.<br />
Sollte unter Berücksichtigung der Preissteigerung und der Kapitalverzinsung errechnet werden.<br />
Beleuchtungsbedarf<br />
- siehe Nutzenergiebedarf Beleuchtung<br />
Bereitschaftsverlust<br />
- Beim Aufheizen eines kalten und beim Abkühlen eines Kessels auftretende Verluste. Reduzierbar<br />
durch hohe Brennerlaufzeiten. Einfluss auf die Verluste hat auch die Bauart (relative Bereitschaftsverluste).<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 84
10/2010<br />
Bilanzinnentemperatur<br />
- mittlere Innentemperatur eines Gebäudes bzw. einer Zone unter Berücksichtigung von räumlich oder<br />
zeitlich eingeschränktem Heizbetrieb und im Falle der Kühlbedarfsermittlung unter Berücksichtigung<br />
von zugelassenen Temperaturschwankungen, die der Ermittlung des Heizwärme- und Kühlbedarfs<br />
zugrunde gelegt wird<br />
- In der Regel werden unterschiedliche Werte für den Heiz- und den Kühlbetrieb angesetzt.<br />
Brennwertkessel<br />
- Durch einen zweiten Wärmetauscher entzieht ein Brennwertkessel dem wasserdampfhaltigen Abgas<br />
durch Kondensation Wärme. Dadurch wird über den Heizwert eines Brennstoffes hinausgehende <strong>Energie</strong><br />
genutzt und die Abgase auf niedrige Temperaturen gebracht. Diese Technik stellt besondere<br />
Ansprüche an den Schornstein. Gegebenenfalls ist eine Neutralisation des Kondensats erforderlich.<br />
Bruttovolumen; Ve<br />
- externes Volumen; von Außenmaßen ermitteltes Volumen eines Gebäudes oder einer Gebäudezone,<br />
welches konditioniert wird<br />
Dämmung<br />
- Wichtigste Methode der <strong>Energie</strong>einsparung. Durch Dämmung wird die Transmission (Wärmeverlust<br />
durch Bauteile) herabgesetzt. Bei der Bauteildämmung genutzte Dämmstoffe werden nach ihrem<br />
Dämmwert, nach den Kosten, nach dem <strong>Energie</strong>aufwand bei der Herstellung und unter ökologischen<br />
Kriterien beurteilt bzw. unterschieden. Konventionelle Dämmstoffe sind Polystyrol, Mineralwolle<br />
(Stein- oder Glaswolle) und Polyurethanschäume. Alternative Dämmstoffe sind Holzfaserplatten Kork,<br />
Zellulosefasern, Hanf, Flachs, Mineraldämmplatten u.v.m. Besonders im Bereich der Dachdämmung<br />
sollten neben ökologischen Gesichtspunkten aus Gründen der Behaglichkeit (sommerlicher Wärmeschutz!)<br />
auf Holzfaser- und/oder Zellulosedämmstoffe zurückgegriffen werden.<br />
Deckung in %<br />
- Die Deckung bezeichnet den Anteil des jeweiligen Heizungssystems am Gesamtaufkommen des<br />
Heizwärmebedarfs einschließlich des Warmwasserbedarfs, wenn dieser mit der Heizung ganz oder<br />
teilweise erzeugt wird. Die Deckung des Warmwasserbereiters bezieht sich auf den Warmwasserbedarf,<br />
der über die Warmwasseranlagen erzeugt wird.<br />
Emissionen<br />
- Bei der Verbrennung fossiler <strong>Energie</strong>träger entstehende Schadstoffe und -gase, die durch Schornsteine<br />
und Abgasrohre an die Außenluft abgegeben werden und die Luft verunreinigen. Beim Hausbrand<br />
sind dies im Wesentlichen CO2, SO2, NOX und Stäube.<br />
Endenergiebedarf<br />
- berechnete <strong>Energie</strong>menge der Anlagentechnik zur Aufrechterhaltung der festgelegten Konditionen;<br />
hier sind die Hilfsenergien (wie Stromverbrauch der Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Ventilatoren<br />
etc.) und Verluste durch die Bereitstellung, Speicherung, Verteilung und Übergabe der <strong>Energie</strong> eingeschlossen<br />
- <strong>Energie</strong>menge, die der Verbraucher für eine bestimmungsgemäße Nutzung benötigt (kaufen muss)<br />
<strong>Energie</strong>kennzahl<br />
- Vergleichsgröße zur Bezifferung des <strong>Energie</strong>verbrauchs bei Gebäuden. Hierunter wird die <strong>Energie</strong>menge<br />
verstanden, die im Laufe eines Jahres für die Beheizung eines Quadratmeters Wohnfläche<br />
verbraucht wird. Bei Einfamilienhäusern liegt die <strong>Energie</strong>kennzahl zwischen 100 und 300 KWh/m²,<br />
möglich sind Werte um 50 KWh/m² (Niedrigenergiehaus). Bei Mehrfamilienhäusern sind die Werte<br />
wegen günstigerem Volumen/Hüllflächen-Verhältnis um etwa 40 % niedriger.<br />
<strong>Energie</strong>träger<br />
- zur Erzeugung von mechanischer Arbeit, Strahlung oder Wärme oder zum Ablauf chemischer bzw.<br />
physikalischer Prozesse verwendete Substanz oder verwendetes Phänomen<br />
Heizkörperthermostat<br />
- Regelungseinrichtung am Heizkörper. Das Ventil wird nur dann geöffnet, wenn eine eingestellte Soll-<br />
Temperatur unterschritten wird. Heute bei Wohngebäuden Pflicht.<br />
Heizwärmebedarf<br />
- siehe Nutzwärmebedarf<br />
Hilfsenergie<br />
- <strong>Energie</strong>, die von Heizungs-, Kühl-, Trinkwarmwasser-, Raumluft- (einschließlich Lüftungs-) und<br />
Beleuchtungssystemen verwendet wird, um die zugeführte <strong>Energie</strong> und Nutzenergie umzuwandeln<br />
- Dies schließt <strong>Energie</strong> für Pumpen, Ventilatoren, Regelung, Elektronik usw., nicht aber die umgewandelte<br />
<strong>Energie</strong>, ein.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 85
10/2010<br />
Hüllfläche bzw. wärmeübertragende Umfassungsfläche<br />
- äußere Begrenzung jeder Zone<br />
- Die Hüllfläche bzw. wärmeübertragende Umfassungsfläche ist die Grenze zwischen konditionierten<br />
Räumen und der Außenluft, dem Erdreich oder nicht konditionierten Räumen. Über diese Fläche verliert<br />
oder gewinnt der gekühlte/beheizte Raum Wärme, daher auch „wärmeübertragende Umfassungsfläche“.<br />
Auch nicht beheizte/gekühlte, sondern anderweitig konditionierte Zonen (beleuchtet,<br />
belüftet) weisen Hüllflächen auf, bei denen jedoch keine Wärmeübertragung erfolgt. Vereinfachend<br />
werden die Benennungen „Hüllfläche“ und „wärmeübertragende Umfassungsfläche“ parallel verwendet.<br />
- Die Hüllfläche bzw. wärmeübertragende Umfassungsfläche wird durch eine stoffliche Grenze<br />
gebildet, üblicherweise durch Außenfassade, Innenflächen, Kellerdecke, oberste Geschossdecke oder<br />
Dach.<br />
Hydraulischer Abgleich<br />
- Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder<br />
Heizkörper oder Heizkreis einer Flächenheizung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage<br />
genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die benötigt wird, um die für die einzelnen<br />
Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies wird mit genauer Planung, Überprüfung und<br />
Einstellung bei der Inbetriebnahme der Anlage erreicht. Auch ein nachträglicher hydraulischer Abgleich<br />
ist möglich, wenn die dafür erforderlichen Armaturen im Rohrnetz vorhanden sind (z.B. voreinstellbare<br />
Thermostatventile oder Strangdifferenzdruckregler).Ist eine Anlage abgeglichen, ergeben<br />
sich mehrere Vorteile: Die Anlage kann mit einem optimalen Anlagendruck und damit mit einer optimal<br />
niedrigen Volumenmenge betrieben werden. Daraus resultieren niedrige Anschaffungskosten der<br />
Umwälzpumpe und niedrige <strong>Energie</strong>- und Betriebskosten während des Betriebes.<br />
Heizkreis ohne hydraulischen Abgleich, Quelle: DEKRA Industrial GmbH<br />
Jahresnutzungsgrad<br />
- Er sagt aus, wie stark die Heizanlage ausgelastet ist. Ein gut ausgelastetes System arbeitet<br />
wesentlich wirtschaftlicher. Schlechte Nutzungsgrade kommen durch Überdimensionierung<br />
zustande.<br />
Kapitalwert<br />
- Angenommener Geldwert, der zu Beginn der Maßnahme aufzuwenden wäre, um die<br />
Maßnahme abzüglich der <strong>Energie</strong>einsparung unter Berücksichtigung der Zinsen durchzuführen.<br />
Ein positiver Kapitalwert entspricht einem finanziellen Gewinn über die Nutzungszeit.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 86
10/2010<br />
Klimaschutz<br />
- Bei der Verbrennung von Kohle, Gas oder Öl wird das Treibhausgas CO2 freigesetzt.<br />
Dieses Gas wird für die klimatischen Veränderungen mit verantwortlich gemacht. Ziel ist es<br />
deshalb diesen Ausstoß zu verringern.<br />
konditionierter Raum<br />
- Raum und/oder Raumgruppe, die auf eine bestimmte Solltemperatur beheizt und/oder<br />
gekühlt und/oder be- und entlüftet und/oder befeuchtet und/oder beleuchtet und/oder mit<br />
Trinkwarmwasser versorgt werden<br />
- Zonen sind konditionierte Räume und weisen mindestens eine Art der Konditionierung auf.<br />
Räume ohne Konditionierung werden als „nicht konditionierte Räume“ bezeichnet.<br />
Konditionierung<br />
- Ausbildung bestimmter Bedingungen in Räumen durch Heizung, Kühlung, Be- und<br />
Entlüftung, Befeuchtung, Beleuchtung und Trinkwarmwasserversorgung um<br />
- bestimmte Nutzungsanforderungen an Innentemperatur, Frischluft, Licht, Luftfeuchte<br />
und/oder Trinkwarmwasser zu erfüllen<br />
Kühlbedarf<br />
- siehe Nutzkältebedarf<br />
kWh<br />
- KiloWattStunde, Einheit für <strong>Energie</strong>, Umrechnungsfaktoren:<br />
- 1 Liter Heizöl = 10 kWh<br />
- 1 m3 Erdgas = 8 bis 10 kWh<br />
- 1 Liter Flüssiggas = 6 bis 7 kWh<br />
- 1 kg Holzpellets = 5 kWh<br />
Nettogrundfläche, <strong>Energie</strong>bezugsfläche; ANGF<br />
- nutzbare Fläche im konditionierten Raum<br />
Nettoraumvolumen, Luftvolumen; V<br />
- Volumen einer konditionierten Zone bzw. eines gesamten Gebäudes, das dem Luftaustausch<br />
unterliegt<br />
- Das Nettoraumvolumen bestimmt sich anhand der inneren Abmessungen und schließt so<br />
das Volumen der Gebäudekonstruktion aus.<br />
- Das Nettoraumvolumen wird aus der entsprechenden Nettogrundfläche durch Multiplikation<br />
mit der lichten Raumhöhe ermittelt. Die lichte Geschosshöhe ist die Höhendifferenz zwischen<br />
der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Geschossdecke bzw. einer<br />
abgehängten Decke. Vereinfacht, d. h., wenn z. B. kein inneres Aufmaß gemacht wird, wird<br />
es aus dem Bruttovolumen (externes Volumen) mit V = 0,8 Ve bestimmt.<br />
Nutzenergiebedarf<br />
- rechnerisch ermittelter Bedarf zur Aufrechterhaltung der festgelegten Konditionen (Heizung,<br />
Kühlung, Be- und Entlüftung, Befeuchtung, Beleuchtung und Trinkwarmwasserversorgung)<br />
Nutzenergiebedarf Beleuchtung<br />
- rechnerisch ermittelter <strong>Energie</strong>bedarf, der sich ergibt, wenn die Gebäudezone mit der im<br />
Nutzungsprofil festgelegten Beleuchtungsqualität beleuchtet wird<br />
Nutzenergiebedarf Trinkwarmwasser<br />
- rechnerisch ermittelter <strong>Energie</strong>bedarf für die festgelegte Trinkwarmwassermenge mit<br />
entsprechender Zulauftemperatur<br />
Nutzungsdauer<br />
- Angenommene Lebensdauer einer technischen Anlage oder einer Dämmung, während der<br />
sie die geplanten Aufgaben rentabel erfüllen kann. Durch diese Angabe werden verschiedene<br />
Maßnahmen wirtschaftlich vergleichbar.<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 87
10/2010<br />
Nutzkältebedarf<br />
- rechnerisch ermittelter Kühlbedarf, der zur Aufrechterhaltung der festgelegten thermischen<br />
Raumkonditionen innerhalb einer Gebäudezone benötigt wird in Zeiten, in denen die Wärmequellen<br />
eine höhere <strong>Energie</strong>menge anbieten als benötigt wird<br />
Nutzwärmebedarf<br />
- Als Nutzwärmebedarf bezeichnet man, vereinfacht ausgedrückt, die <strong>Energie</strong>menge, die zur<br />
thermischen Konditionierung eines Gebäudes unter Berücksichtigung definierter Vorgaben<br />
erforderlich ist. Der Nutzwärmebedarf ist die Summe von Wärmesenken (Transmissionswärmeverluste,<br />
Lüftungswärmeverluste etc.) abzüglich der Wärmequellen (nutzbare solare<br />
Gewinne, Gewinne durch Geräte, Personen etc.).<br />
Primärenergieaufwandszahl<br />
- Diese Zahl beschreibt die Qualität des Heizsystems als Verhältnis zwischen zugeführter<br />
Primärenergie und tatsächlich genutzter <strong>Energie</strong> für Heizung und Warmwasser (kWhPrimär/kWhNutz).<br />
Je kleiner die Primärenergieaufwandszahl ist, desto besser ist die Bewertung.<br />
Primärenergiebedarf<br />
- Produkt aus Endenergie und Primärenergiefaktor des eingesetzten Brennstoffes (<strong>Energie</strong>trägers).<br />
Der Primärenergiebedarf beziffert zusätzlich zum Endenergiebedarf die Herstellung<br />
und den Transport der verwendeten <strong>Energie</strong>.<br />
Raum-Solltemperatur<br />
- je nach Nutzungsprofil vorgegebene empfundene Temperatur im Innern eines Gebäudes<br />
bzw. einer Zone, die den Sollwert der Raumtemperatur bei Heiz- bzw. Kühlbetrieb repräsentiert<br />
- In der Regel sind unterschiedliche Werte für den Heiz- und den Kühlbetrieb vorgesehen.<br />
Regelung<br />
- Heizenergieverluste können durch optimale Regelung weitgehend minimiert werden.<br />
Wichtige Ansatzpunkte: Wärme soll nur dahin gelangen, wo sie zur Zeit auch benötigt wird<br />
(Heizkörper- und Raumthermostate); die Vorlauftemperatur soll nur so hoch sein, wie sie<br />
zur Erfüllung des Heizzweckes unbedingt erforderlich ist (Nachtabsenkung, Außenthermostat).<br />
Die Flammengröße des Brenners soll so eingestellt werden, dass unnötige Stillstandsverluste<br />
vermieden werden.<br />
Regenerative <strong>Energie</strong>n<br />
- Erneuerbare <strong>Energie</strong>n benutzen die in der Umwelt vorhandenen und sich durch natürliche<br />
Vorgänge erneuernden <strong>Energie</strong>formen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Umweltwärme<br />
(Wärmepumpen), Sonnenenergie (Kollektoren), Erdwärme (aus tiefen Erdschichten),<br />
Wasserkraft (Wasserkraftwerke), Wellenenergie.<br />
Systemnutzungsgrad in %:<br />
- Dieser umfasst den Nutzungsgrad der Heizungsanlage einschließlich der Wärmeverteilung<br />
(Leitungen) im Gebäude. Je höher dieser Nutzungsgrad ist, desto effektiver ist die Heizungsanlage.<br />
Beim Einsatz von Solarkollektoren und Wärmepumpen liegt der Nutzungsgrad<br />
zwischen 100 und 300 %. Alte Heizungsanlagen weisen dagegen einen Nutzungsgrad<br />
< 70 % aus.<br />
Taupunkt<br />
- Taupunkt bezeichnen den Zustand des Wassers in seinem Phasendiagramm, bei dem es<br />
zur Kondensation (zum Beispiel Taubildung) von Wasserdampf kommt. Es handelt sich also<br />
um den Kondensationspunkt des Wassers.<br />
Transmission<br />
- Wärmedurchgang durch ein Bauteil, durch Strahlung und durch Konvektion an den<br />
Oberflächen. Wird errechnet aus dem U-Wert, der Fläche des Bauteils.<br />
Trinkwarmwasserbedarf<br />
- siehe Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 88
10/2010<br />
U-Wert<br />
- Wärmedurchgangskoeffizient, Größe für die Transmission durch ein Bauteil. Er beziffert die<br />
Wärmemenge (in KWh), die bei einem Grad Temperaturunterschied durch einen Quadratmeter<br />
des Bauteils entweicht. Folglich sollte ein U-Wert möglichst gering sein. Wird bestimmt<br />
durch die Dicke des Bauteils und den Lambda-Wert (Dämmwert) des Baustoffes.<br />
Verluste<br />
- Verluste der Anlagentechnik (Wärmeabgabe, Kälteabgabe) bei der Übergabe, Verteilung,<br />
Speicherung und Erzeugung<br />
Versorgungsbereich<br />
- Bereich des Gebäudes, das von der gleichen Technik versorgt wird<br />
- ein Versorgungsbereich (Heizung, Warmwasser, Lüftung, Kühlung etc.) kann sich über<br />
mehrere Zonen erstrecken<br />
Wärmebrücken<br />
- Als Wärmebrücken werden örtlich begrenzte Stellen bezeichnet, die im Vergleich zu den<br />
angrenzenden Bauteilbereichen eine höhere Wärmestromdichte aufweisen. Daraus ergeben<br />
sich zusätzliche Wärmeverluste sowie eine reduzierte Oberflächentemperatur des Bauteils<br />
in dem betreffenden Bereich. Wird die Oberflächentemperatur durch eine vorhandene<br />
Wärmebrücke abgesenkt, kann es an dieser Stelle bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur<br />
der Raumluft, zu Kondensatbildung auf der Bauteiloberfläche mit den bekannten<br />
Folgeerscheinungen, wie z.B. Schimmelpilzbefall kommen. Typische Wärmebrücken sind<br />
z.B. Balkonplatten. Attiken, Betonstützen im Bereich eines Luftgeschosses, Fensteranschlüsse<br />
an Laibungen.<br />
Wärmequelle<br />
- Wärmemengen mit Temperaturen über der Innentemperatur, die der Gebäudezone<br />
zugeführt werden oder innerhalb der Gebäudezone entstehen<br />
- Nicht einbezogen sind die Wärmeeinträge, die geregelt über die Anlage (Heizung, Lüftung)<br />
zugeführt werden, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten.<br />
Wärmesenke<br />
- Wärmemenge, die der Gebäudezone entzogen wird<br />
- Nicht einbezogen ist die Abfuhr von Wärme über das Kühlsystem.<br />
Zone, auch Gebäudezone, Nutzungszone<br />
- grundlegende räumliche Berechnungseinheit für die <strong>Energie</strong>bilanzierung<br />
- Grundflächenanteil bzw. Bereich eines Gebäudes mit gleichen Nutzungsrandbedingungen<br />
- keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der Konditionierung<br />
Musterbericht: Einfamilienhaus 89