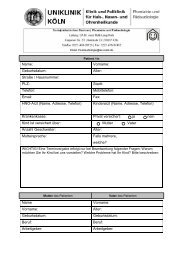Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln
Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln
Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>HNO</strong> 2011 · 59:980–987<br />
DOI 10.1007/s00106-011-2402-0<br />
Online publiziert: 28. September 2011<br />
© Springer-Verlag 2011<br />
Bei gering- und mittelgradigen<br />
sensorineuralen und kombinierten<br />
Schwerhörigkeiten gelten <strong>der</strong>zeit<br />
konventionelle, externe <strong>Hörgeräte</strong><br />
neben <strong>der</strong> hörverbessernden Mittelohrchirurgie<br />
als St<strong>an</strong>dardversorgung.<br />
Unterschiedliche Probleme bei <strong>der</strong><br />
Verwendung konventioneller <strong>Hörgeräte</strong><br />
haben zur Entwicklung impl<strong>an</strong>tierbarer<br />
Hörsysteme geführt, die ein<br />
akustisches Signal in eine direkte mech<strong>an</strong>ische<br />
Stimulation <strong>der</strong> Ossikelkette<br />
o<strong>der</strong> des Innenohrs umw<strong>an</strong>deln.<br />
Nachteile konventioneller<br />
<strong>Hörgeräte</strong><br />
Die bisweilen niedrige Akzept<strong>an</strong>z und geringe<br />
tägliche Nutzungsdauer konventioneller<br />
<strong>Hörgeräte</strong> k<strong>an</strong>n auf unterschiedliche<br />
Faktoren zurückgeführt werden. So ist<br />
das konventionelle Hörgerät als Zeichen<br />
einer Behin<strong>der</strong>ung äußerlich sichtbar und<br />
stellt für m<strong>an</strong>che Menschen eine Stigmatisierung<br />
sowie eine Beeinflussung des persönlichen<br />
äußeren Erscheinungsbildes<br />
dar. Durch die Okklusion des Gehörg<strong>an</strong>gs<br />
durch das Ohrpassstück resultiert bisweilen<br />
ein niedriger Tragekomfort, was sich<br />
jedoch durch die Entwicklung von individuell<br />
<strong>an</strong>passbaren Silikonschalen in Verbindung<br />
mit einer „offenen Versorgung“<br />
heutzutage gebessert hat. Die notwendige<br />
enge räumliche Nähe von Mikrofon und<br />
Lautsprecher ist oft ein Grund für akustisch<br />
störende Rückkopplungseffekte, was<br />
nicht selten zur Folge hat, dass <strong>Hörgeräte</strong>nutzer<br />
ihr Gerät auf einen suboptimalen<br />
Level herunterschalten. Derart entstehen<br />
Unterschiede zwischen <strong>der</strong> technisch<br />
möglichen Leistung eines Hörgeräts und<br />
dem tatsächlich vorh<strong>an</strong>denen praktischen<br />
Nutzen für den <strong>Hörgeräte</strong>träger.<br />
Der Wunsch nach einem unsichtbaren<br />
Hörgerät führte zur Entwicklung von In-<br />
980 | <strong>HNO</strong> 10 · 2011<br />
Leitthema<br />
J.C. Luers · D. Beutner · K.-B. Hüttenbrink<br />
<strong>HNO</strong>-<strong>Klinik</strong>, Universitätsklinik <strong>Köln</strong><br />
<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> <strong>Hörgeräte</strong><br />
dem-Ohr-<strong>Hörgeräte</strong>n (IdO-HG) im Vergleich<br />
zur klassischen Vari<strong>an</strong>te <strong>der</strong> Hinter-dem-Ohr-<strong>Hörgeräte</strong><br />
(HdO-HG), wobei<br />
Erstere durch die Bauart bedingt wie<strong>der</strong>um<br />
eine stärkere akustische Rückkopplung<br />
und Einbußen beim Kl<strong>an</strong>g bedeuten.<br />
Die zunehmende Miniatisierung<br />
von HdO-<strong>Hörgeräte</strong>n hat den Nachteil,<br />
dass gerade die große Zielgruppe <strong>der</strong> älteren<br />
Personen nur schwer mit den m<strong>an</strong>chmal<br />
kaum mehr sichtbaren und bedienbaren<br />
Schiebeschaltern zur m<strong>an</strong>uellen<br />
Steuerung ihres Hörgeräts zurechtkommt.<br />
Durch die Entwicklung digitaler <strong>Hörgeräte</strong>,<br />
welche über Funksignale steuerbar<br />
sind, konnte diese Problematik teilweise<br />
behoben werden. Der größte Nachteil<br />
konventioneller <strong>Hörgeräte</strong> liegt jedoch<br />
nach wie vor im limitierten Hörgewinn,<br />
welcher maximal etwa 30 dB beträgt, sowie<br />
in <strong>der</strong> nicht immer optimalen Kl<strong>an</strong>gqualität<br />
bei limitierter Frequenzb<strong>an</strong>dbreite<br />
beson<strong>der</strong>s in hohen Frequenzen.<br />
Die vorgen<strong>an</strong>nten Probleme haben dazu<br />
geführt, neue Wege bei <strong>der</strong> technischen<br />
Hörrehabilitation von schwerhörigen Patienten<br />
zu beschreiten. Dies hat die Entwicklung<br />
von impl<strong>an</strong>tierbaren <strong>Hörgeräte</strong>n<br />
entscheidend mit beeinflusst. Ein offensichtlicher<br />
Nachteil impl<strong>an</strong>tierbarer<br />
<strong>Hörgeräte</strong> liegt in <strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>der</strong><br />
chirurgischen Impl<strong>an</strong>tation mit allen assoziierten<br />
operativen Risiken. Bei impl<strong>an</strong>tierbaren<br />
<strong>Hörgeräte</strong>n müssen daher Hör-<br />
gewinn und Zufriedenheit des Patienten<br />
die Nachteile <strong>der</strong> aufwendigeren und risikoreicheren<br />
Anpassung aufwiegen. Wesentliche<br />
Vorteile impl<strong>an</strong>tierbarer <strong>Hörgeräte</strong>n<br />
liegen im Wegfall von Okklusionseffekten<br />
und Stigmatisierung. Vollimpl<strong>an</strong>tierbare<br />
<strong>Hörgeräte</strong> können sogar beim Baden<br />
o<strong>der</strong> Schwimmen getragen werden.<br />
Da impl<strong>an</strong>tierbare <strong>Hörgeräte</strong> durch die<br />
zugrunde liegende Technik insbeson<strong>der</strong>e<br />
Vorteile für die Versorgung hochtonbetonter<br />
Schwerhörigkeiten ab 3–5 kHz<br />
haben, wird für sie auch eine verbesserte<br />
Kl<strong>an</strong>gqualität und frequenzspezifische<br />
Hörrehabilitation proklamiert [1, 2, 3].<br />
<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme<br />
Klassifikation und Aufbau<br />
<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme im weiteren<br />
Sinne bezeichnen sämtliche Systeme, die<br />
teilweise o<strong>der</strong> vollständig in den Körper<br />
impl<strong>an</strong>tiert werden und eine Hörrehabilitation<br />
zum Ziel haben. Systeme, die die<br />
Funktion <strong>der</strong> Hörschnecke o<strong>der</strong> des Hörnervs<br />
ersetzen, sind als Cochleaimpl<strong>an</strong>tate<br />
o<strong>der</strong> als Hirnstammimpl<strong>an</strong>tate zu bezeichnen.<br />
<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme im<br />
engeren Sinne, auf die <strong>der</strong> vorliegende<br />
Übersichtsartikel fokussiert, sind alle apparativen<br />
(technischen) Hörsysteme, bei<br />
denen das für den Schwerhörigen aufbereitete<br />
akustische Signal nicht über den<br />
Tab. 1 Übersicht über die impl<strong>an</strong>tierbaren Hörsysteme, geglie<strong>der</strong>t in das zugrunde<br />
liegende W<strong>an</strong>dlerprinzip und Teil- bzw. Vollimpl<strong>an</strong>tation<br />
Vollimpl<strong>an</strong>tierbar Teilimpl<strong>an</strong>tierbar<br />
Piezoelektrischer W<strong>an</strong>dler Esteem<br />
TICA<br />
RDE (RION)<br />
Elektromagnetischer W<strong>an</strong>dler Carina Vibr<strong>an</strong>t Soundbridge<br />
DACS<br />
DDHS<br />
TICA „totally impl<strong>an</strong>table cochlear amplifier“, RDE „rion device E-type“, DACS „direct acoustic cochlear stimulation“,<br />
DDHS „direct drive hearing system“.