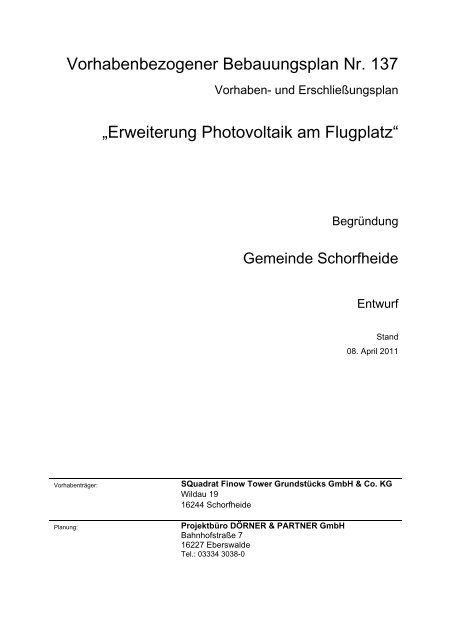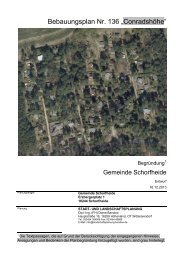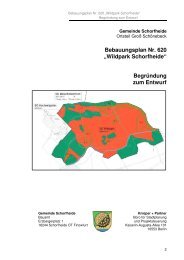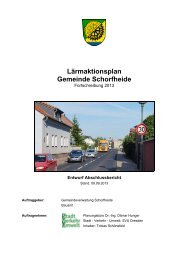DR.-ING.FRANK DRÖSCHER TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ
DR.-ING.FRANK DRÖSCHER TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ
DR.-ING.FRANK DRÖSCHER TECHNISCHER UMWELTSCHUTZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137<br />
Vorhabenträger:<br />
Planung:<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
„Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Begründung<br />
Gemeinde Schorfheide<br />
Entwurf<br />
Stand<br />
08. April 2011<br />
SQuadrat Finow Tower Grundstücks GmbH & Co. KG<br />
Wildau 19<br />
16244 Schorfheide<br />
Projektbüro DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
Bahnhofstraße 7<br />
16227 Eberswalde<br />
Tel.: 03334 3038-0
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Inhalt<br />
1. EINFÜHRUNG .....................................................................................................................4<br />
1.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes ................................................................4<br />
1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung .............................................................4<br />
2. AUSGANGSSITUATION......................................................................................................5<br />
2.1 Räumliche Einbindung....................................................................................................5<br />
2.2 Bebauung und Nutzung ..................................................................................................6<br />
2.3 Erschließung...................................................................................................................6<br />
2.4 Ver- und Entsorgung.......................................................................................................6<br />
2.5 Natur, Landschaft, Umwelt .............................................................................................6<br />
2.5.1 Altlasten ...................................................................................................................6<br />
2.5.2 Kampfmittelbelastung...............................................................................................7<br />
2.5.3. Luftfahrtverkehrsrechtliche Bestimmungen.............................................................7<br />
2.6 Eigentumsverhältnisse....................................................................................................8<br />
3. PLANUNGSBINDUNGEN ....................................................................................................8<br />
3.1 Landes- und Regionalplanung........................................................................................8<br />
3.2 Flächennutzungsplanung................................................................................................8<br />
3.3 Landschaftsplanung........................................................................................................9<br />
3.4 Fachplanungen ...............................................................................................................9<br />
4. PLANUNGSKONZEPT.......................................................................................................10<br />
4.1 Ziele und Zwecke der Planung .....................................................................................10<br />
4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan.................................................................11<br />
5. PLANINHALT (ABWÄGUNG UND BEGRÜNDUNG).........................................................11<br />
5.1 Nutzung der Baugrundstücke .......................................................................................11<br />
5.1.1 Art der Nutzung ......................................................................................................12<br />
5. 1. 2. Maß der baulichen Nutzung ................................................................................13<br />
5.1.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen.................................................................13<br />
5.1.4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von<br />
Boden, Natur und Landschaft .........................................................................................13<br />
5.2 Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte........................................................14<br />
5.3 Ausgleichsmaßnahmen ................................................................................................15<br />
5.4 Gestaltungsregelungen.................................................................................................16<br />
5.5 Kennzeichnungen .........................................................................................................16<br />
5.6 Nachrichtliche Übernahmen .........................................................................................17<br />
5.7 Hinweise .......................................................................................................................17<br />
6. UMWELTBERICHT ............................................................................................................17<br />
7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG...................................................................................18<br />
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen .....................................................................18<br />
7.2 Verkehr .........................................................................................................................18<br />
7.3 Natur, Landschaft, Umwelt ...........................................................................................18<br />
7.4 Kosten und Finanzierung des Vorhabens.....................................................................19<br />
8. VERFAHREN .....................................................................................................................19<br />
9. RECHTSGRUNDLAGEN ...................................................................................................21<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
vBP vorhabenbezogener Bebauungsplan<br />
VEP Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
UP Umweltprüfung<br />
UWB Umweltbericht<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
2
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
UVS Umweltverträglichkeitsstudie<br />
FNP Flächennutzungsplan<br />
B-Plan Bebauungsplan<br />
LEP B-B Landesentwicklungsplan Berlin – Brandenburg<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
3
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
1. EINFÜHRUNG<br />
1.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes<br />
Das zu beplanende Gebiet befindet sich südlich der Ortslage Finowfurt auf dem<br />
Flugplatzgelände. Im Westen tangiert das Planareal die Autobahn A11. Im Osten begrenzt<br />
die Landesstraße 293 (Biesenthaler Straße Eberswalde Finow L 293)) sowie die<br />
Gemarkungsgrenze der Stadt Eberswalde das Plangebiet des aufgestellten vBP.<br />
Es grenzt im Süden an die errichtete Photovoltaikanlage des VBP Nr. 135 „Photovoltaik am<br />
Flugplatz“.<br />
Zum Plangebiet gehören folgende Flurstücke<br />
Gemarkung Finowfurt Flur 10, Flurstück 774, Flur 12, Flurstücke 108, 110, 109 teilweise, 114<br />
teilweise, 3/2 teilweise, sowie Flur 13, Flurstücke 336, 337, 340, 540, 542, 544, 546, 548,<br />
350, 351, 354, 361, 367, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 und 525.<br />
Die Abgrenzung des Plangebietes entspricht bis auf einige Teilflächen der im<br />
Flächennutzungsplan der Gemeinde Schorfheide dargestellten Flugbetriebsfläche<br />
einschließlich der im Norden angrenzenden gewerblichen Bauflächen.<br />
Der gesamte vorhabenbezogenen Bebauungsplan gliedert sich in 6 Teilgebiete, die als<br />
sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit Zweckbestimmung Photovoltaik unterteilt<br />
sind:<br />
• Teilgebiet A welches einer Flächengröße von rund 12 ha Fläche entspricht und sich<br />
zwischen der Finowfurter Biesenthaler Straße und der Autobahn A 11 befindet.<br />
• Teilgebiet B umfasst mit etwa 94 ha die größte Fläche des vBP und erstreckt sich<br />
von der Finowfurter Biesenthaler Straße im Westen bis an die Nord-Süd<br />
ausgerichtete Rollbahn im östlichen Bereich des Plangebietes.<br />
• Teilgebiet C ist 36,26 ha groß. Der überwiegend nördliche Bereich ist im FNP als<br />
Gewerbefläche dargestellt.<br />
• Teilgebiet D mit rund 0,824 ha, Teilgebiet E mit ca. 3,303 ha und Teilgebiet F mit<br />
5,75 ha befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Eberswalder Biesenthaler Straße<br />
(L293).<br />
Im westlichen Bereich wurde des Weiteren eine sonstiges Sondergebiet gemäß § 11<br />
BauNVO mit Zweckbestimmung Museumsveranstaltungen mit eine Flächengröße von etwa<br />
9,2 ha ausgewiesen.<br />
1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung<br />
Mit dem LEP BB vom 31.03.2009 wurden die im LEP GR vom 20.07.2004 für den<br />
Verkehrslandeplatz Eberswalde Finow (VLP) vorgegebenen Zielstellungen geändert.<br />
Der ursprünglichen Entwicklungszielstellung „Regionalflughafen“ wurde die wirtschaftliche<br />
Basis entzogen, denn ein Linienverkehr bis 14 t MTOM (maximale Startmasse) ist nicht<br />
durchführbar.<br />
Die Unterhaltung eines Verkehrs- und Landeplatzes in dieser Größenordnung ist aus Sicht<br />
des Flugplatzbetreibers über lange Sicht finanziell nicht tragbar. Die Flugbetriebsfläche soll<br />
auf Grund dessen entsprechend den abzuschätzenden zukünftigen Nutzungen verkleinert<br />
werden. Die Start- und Landebahn soll auf eine Länge von 1.285 m mit erforderlichen<br />
Streifenbereichen verringert werden. Die 3 luftfahrtaffinen Gewerbestantorte bleiben mit den<br />
vorhandenen Sheltern durch Rollwege an die Landebahn angeschlossen.<br />
Mit Verkleinerung der Flugbetriebsfläche entfällt ein großer Teil der Flächen, die bislang an<br />
den Flugbetrieb gebunden waren, zurück in die Hoheit der kommunalen Planung. Der<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
4
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Gemeinde obliegt nunmehr die Definierung der weiteren Entwicklung dieser Flächen und<br />
deren Darstellung im Flächennutzungsplan sowie in weiterer Instanz die Aufstellung von<br />
verbindlichen Bauleitplänen.<br />
Im Mai 2008 hat die Landesregierung Brandenburg die „Energiestrategie 2020 des Landes<br />
Brandenburg“ beschlossen. Ziel sind eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung zur<br />
Senkung der CO2-Emissionen sowie ein Beitrag zum Wirtschaftwachstum im Land<br />
Brandenburg. Das Land Brandenburg hat damit eine eigene, die europäische und nationale<br />
Strategie unterstützende integrierte Energie- und Klimaschutzpolitik entwickelt. Der Anteil der<br />
erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch soll bis 2020 auf 20 % steigen.<br />
Darüber hinaus existieren auch auf regionaler Ebene ernsthafte Bestrebungen, den<br />
Stellenwert erneuerbarer Energien nachhaltig zu verbessern. So hat der Kreistag des<br />
Landkreises Barnim folgerichtig mit dem Beschluss zur Integrierten<br />
Wirtschaftsentwicklungsstrategie das Projekt „BARUM Energie “ als Schwerpunktprojekt der<br />
kreislichen Entwicklung definiert. Damit wurde der für eine zukunftsfähige Klimaschutzpolitik<br />
erforderlichen Strukturpolitik und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
höchste Priorität eingeräumt. Der Landkreis will die Chancen, die mit der Initiative „BARUM<br />
Energie “ verbunden sind, nutzen und hat sich dazu entschlossen, eine Nullemissionsstrategie<br />
als Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung des Landkreises Barnim umzusetzen.<br />
Das geplante Vorhaben kann in diesem Zusammenhang durch die Nutzung lokaler<br />
Energieträger, hier der Sonneneinstrahlung, einen Beitrag zur Wertschöpfung in der Region<br />
durch die Bindung von Arbeitsplätzen und Know-how leisten und nicht unerheblich zur<br />
Steigerung des Einsatzes lokaler, regenerativer Ressourcen beitragen.<br />
Davon unabhängig ist das Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst sicheren, jedoch<br />
auch umweltverträglichen Energieversorgung ein besonders wichtiges öffentliches Interesse.<br />
Dies hat der Gesetzgeber in § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ausdrücklich<br />
festgehalten.<br />
Im Hinblick auf dieses Entwicklungsziel hat sich die Gemeinde Schorfheide entschieden dem<br />
Antrag des Vorhabenträgers statt zu geben und ihn bei der Umsetzung seines Projektes<br />
durch die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu unterstützen.<br />
Der Vorhabenträger des geplanten Unternehmens, die SQuadrat Finow Tower Grundstücks<br />
GmbH & Co KG mit Sitz in 16244 Schorfheide, Wildau 19, beabsichtigt die unter Punkt 1.1<br />
beschriebenen Grundstücke über einen befristeten Zeitraum, der sich an der Laufzeit der<br />
Vergütung für bemisst, für die Aufstellung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur<br />
Gewinnung solarer Energie zu nutzen.<br />
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ergibt sich aus dem EEG,<br />
welches u. a. festlegt, dass eine Vergütungspflicht für den in das Netz eingespeisten Strom<br />
nur dann besteht, wenn die Anlage zur Gewinnung aus solarer Energie innerhalb eines<br />
Bebauungsplanes errichtet wird.<br />
Auf Grund dessen hat die Gemeindevertretung am 29.09.2010 einen Aufstellungsbeschluss<br />
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst.<br />
2. AUSGANGSSITUATION<br />
2.1 Räumliche Einbindung<br />
Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortslage Finowfurt und nimmt einen sehr großen<br />
Teil des Flugplatzgeländes ein. Auf der westlichen Seite nördlich des Plangebietes befindet<br />
sich das Gelände des gemeinnützigen Vereins „Luftfahrthistorische Sammlung Finowfurt“<br />
(LHS), welches über die Museumsstraße von der Finowfurter Biesenthaler Straße zu<br />
erreichen ist.<br />
5<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Im Süden schließt sich das Solarfeld des umgesetzten vorhabenbezogenen<br />
Bebauungsplanes Nr. 135 „Photovoltaik am Flugplatz“ sowie weitrechende Waldflächen an.<br />
2.2 Bebauung und Nutzung<br />
Der überwiegende Teil der überplanten Fläche gehört zur Flugbetriebsfläche, die in ihrer<br />
Ausdehnung erheblich verkleinert werden. Diese Fläche setzen sich mehrheitlich aus<br />
unbebauten Freiflächen zusammen, die keiner direkten Nutzung unterliegen. Sie gehören zu<br />
den flugsicherheitstechnischen Abstandsflächen der Start- und Landebahn.<br />
Als bebaut kann nur die Fläche der Start- und Landebahn sowie das nördlich liegende<br />
Rollfeld bezeichnet werden.<br />
2.3 Erschließung<br />
Eine Erschließung des beplanten Gebietes liegt derzeit nicht vor bzw. sind die Flächen nur<br />
über die Flugbetriebsfläche zu erreichen. Die Flächen sind weitestgehend eingezäunt. Die<br />
verkehrstechnische Erschließung ist im Planverfahren des vorhabenbezogenen<br />
Bebauungsplanes zu klären. Siehe hierzu Punkt 5.2 und 7.2. der Begründung.<br />
2.4 Ver- und Entsorgung<br />
Erschließungsanlagen die der Ver- und Entsorgung mit Trinkwasser dienen sind auf dem<br />
Gelände nicht vorhanden. Ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung und<br />
Schmutzwasserentsorgung ist für die im nördlichen Gebiet angrenzende Betriebsfläche<br />
notwendig. Hier soll ein Betriebsgebäude entstehen, für die Anlagen der Ver- und<br />
Entsorgung notwendig werden. Entsprechende Anträge beim Versorger sind zu stellen. Die<br />
geplante Ausbaubreite von 4,75 m der Erschließungsstraße lässt die Abfallentsorgung<br />
mittels 3-achsiger Entsorgungsfahrzeuge zu.<br />
Inwieweit elektrische Anlagen (unterirdische Leitungen) auf dem Plangebiet anliegen ist zum<br />
derzeitigen Planungszeitpunkt nicht bekannt.<br />
2.5 Natur, Landschaft, Umwelt<br />
Hinsichtlich des Bestandes der Natur, Umwelt und Landschaft sowie deren Bewertung wird<br />
ausführlich im Umweltbericht eingegangen.<br />
2.5.1 Altlasten<br />
Das geplante Vorhaben befindet sich auf den ehemaligen Gebieten der Westgruppe der<br />
sowjetischen Truppen (WGT) „02 Fran 081B — Flugplatz Eberswalde Finow " und „02 FRAN<br />
088 — Eberswalde-Finow, Funktechnische Station Finowfurt". Aufgrund der historischen<br />
Nutzungen ist von Vorbelastungen auszugehen. Infolgedessen werden beide<br />
Liegenschaften, zu denen jeweils mehrere Altlastverdachtsflächen gehören, im<br />
Altlastenkataster des Landkreises Barnim geführt (§ 29 Abs. 3 BbgAbfBodG, § 2<br />
BBodSchG).<br />
Im Zuge der Ermittlung des Gefahrenpotentials und der damit verbundenen Einleitung von<br />
Dekontaminations- bzw. Gefahrenabwehrmaßnahmen wurden im Areal des ehemaligen<br />
Tanklagers Nord, des angrenzenden technischen Bereiches und Teilen des benachbarten<br />
Reservetanklagers, die nach derzeitigem Erkenntnistand als Schwerpunktbereich der<br />
Kontaminationen auf dem Flugplatz Eberswalde-Finow gelten, umfangreiche Gutachten<br />
erstellt. Es wurden massive Boden- und Grundwasserkontaminationen durch Mffl, BTEX und<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
PAK ermittelt. Zudem wurden auf dem Grundwasser aufschwimmende Kerosinphasen<br />
nachgewiesen.<br />
Verunreinigungen der zu bebauenden Fläche, insbesondere in Form lokal begrenzter<br />
Eintragsstellen fester oder flüssiger Schadstoffe, können nicht ausgeschlossen werden.<br />
Es ist daher ein Sachverständiger, der die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit<br />
besitzt sowie über die notwendige gerätetechnische Ausstattung verfügt (§§ 9 Abs. 2, 15<br />
Abs. 2, 18 BBodSchG i.V.m. § 34 BbgAbfBodG), mit der Erstellung einer<br />
Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Mensch (§ 9 Abs. 2 BBodSchG) für<br />
die vorgenannten Flächen zu beauftragen.<br />
Im Vorhabensbereich „02 Fran 081B — Flugplatz Eberswalde Finow "wird 2 mal jährlich ein<br />
qualifiziertes Grundwassermonitoring durchgeführt. Hierzu gibt es einen öffentlich-<br />
rechtlichen Vertrag zwischen der BBG mbH und dem Landkreis Barnim.<br />
Es ist in geeigneter Art und Weise sicherzustellen, dass durch das o.g. Vorhaben das GW-<br />
Monitoring nicht behindert oder gefährdet wird, mögliche Migrationen von Schadstoffen, z.B.<br />
durch Eingriffe in den Bodenkörper, müssen ausgeschlossen werden (§ 4 Abs. 3<br />
BBodSchG).<br />
Sämtliche im Vorhabensgebiet vorhandenen Grundwassermessstellen sind nach § 15 Abs. 2<br />
BBodSchG zu erhalten und durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Bei eventueller<br />
Beschädigung durch die Baumaßnahmen ist ihre Funktionstüchtigkeit umgehend wieder<br />
herzustellen.<br />
Sollten sich im Verlauf des geplanten Vorhabens umweltrelevante, organoleptische<br />
Auffälligkeiten hinsichtlich vorhandener Schadstoffe in Boden oder Grundwasser zeigen, so<br />
ist umgehend und unaufgefordert die UB zu informieren (§ 31 Abs. 1 BbgAbfBodG). 1<br />
2.5.2 Kampfmittelbelastung<br />
Eine Belastung der Fläche mit Kampfmitteln liegt vor. Dies wird durch den<br />
Kampfmittelbeseitigungsdienst in der Stellungnahme zum Vorhaben bestätigt.<br />
Die Beräumung der beplanten Fläche von im Boden liegender Munition wurde bereits im<br />
Sommer vergangenen Jahres begonnen und ist nahezu abgeschlossen. Es liegt somit eine<br />
annähernd flächendeckende Kampfmittelfreiheit für das zu beplanende Gebiet vor.<br />
2.5.3. Luftfahrtverkehrsrechtliche Bestimmungen<br />
Derzeit verfügt der Verkehrslandeplatz noch über einen Baubeschränkungsbereich der<br />
Klasse A. Die Höhe des Flugplatzbezugspunktes beträgt 37 m ü.NN.<br />
Nach abgeschlossenem Herabstufungsverfahren in die Kategorie Code-Zahl 2 wird davon<br />
ausgegangen, dass ein Baubeschränkungsbereich nicht mehr notwendig ist.<br />
Um die Auswirkungen von Reflexionen oder Spiegelungen, verursacht durch die<br />
Solarmodule, auf den Flugbetrieb beurteilen zu können wurde ein Gutachten zur Beurteilung<br />
der möglichen Blendwirkung eines Solarparks und dessen thermischen Effekte am<br />
Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow erstellt. Das Gutachten liegt der Planbegründung als<br />
Anlage bei.<br />
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass bei Einsatz von Antireflextionsglas, welches<br />
für einen effektiven Wirkungsgrad der Module Voraussetzung ist, eine den Flugbetrieb<br />
behindernde Blendwirkung ausgeschlossen wird.<br />
Eine erhebliche Veränderung der bestehenden meteorologischen Bedingungen in Hinblick<br />
auf fliegerisch relevante Auf- und Fallwinde ist ebenfalls nicht zu erwarten. 2<br />
1<br />
Stellungnahme des LK_Barnim Untere Bodenschutzbehörde<br />
2<br />
Siehe Gutachten Anlage<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
7
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
2.6 Eigentumsverhältnisse<br />
Die beplanten Flächen befinden sich derzeit im Eigentum des Wirtschafts- und<br />
Verkehrszentrum Finow und werden an den Vorhabenträger verkauft.<br />
3. PLANUNGSBINDUNGEN<br />
3.1 Landes- und Regionalplanung<br />
In der Festlegungskarte 1 zum LEP B-B wurde für einen Teil des Planungsstandort des<br />
Bebauungsplanes das Symbol mit Kennzeichnung von Flächen für großflächige gewerblich-<br />
industrielle Vorhaben vergeben. Diese sollen vorgehalten und von einer kleinteiligen<br />
gewerblichen Nutzung freigehalten werden.<br />
Als Begründung für die Auswahl dieses und anderer Standorte wird ausgeführt:<br />
“Entsprechend den infrastrukturellen und naturräumlichen Gegebenheiten sowie begünstigt<br />
durch eine gute Erreichbarkeit mit überregionalen Verkehrsanbindungen sind an diesen<br />
ausgewählten Standorten in Berlin bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole Berlin<br />
sowie zu Zentralen Orten und regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg<br />
besonders günstige Voraussetzungen für die Ansiedlungen gegeben. Daher liegt es im<br />
landesplanerischen Interesse, solche Standorte aus Gründen langfristiger Vorsorge<br />
freizuhalten.“<br />
Die Anfrage nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wurde mit dem<br />
Schreiben vom 3.02.2011 an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) und die<br />
Regionale Planungsabteilung gestellt.<br />
Laut dem Schreiben der GL Berlin-Brandenburg vom 28.02.2011 wurde mitgeteilt, dass die<br />
dargelegte Planungsabsicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Widerspruch zu den Zielen<br />
der Raumordnung erkennen lässt. Die Grundsätze der Raumordnung insbesondere 4.6, 6.9,<br />
4.4 Abs. 2, 6.8 Abs. 2 und Grundsatz 5.1 des LEP B-B sind zu beachten.<br />
Das Antragsverfahren zur Herabstufung des Verkehrslandeplatzes zu einem<br />
Sondernutzungslandeplatz wurde geändert und in einen Antrag zur Einstufung eines<br />
Verkehrslandeplatzes der Einstufung in den Code 2B geführt.<br />
Es verbleibt ein Verkehrslandeplatz mit einer Start- und Landebahn von 1480 m, die einen<br />
Start und Landung von Flugzeugen bis zu einer Abflugmasse von 14 MTOM gestattet. Es<br />
ergeben sich für den Vorsorgestandort für großflächige gewerblich-industrielle Vorhaben<br />
keine Nachteile.<br />
Der Grundsatz 6.9 beinhaltet die Gewinnung und Nutzung einheimischer Bodenschätze und<br />
Energieträger soll als wichtiges wirtschaftliches Entwicklungspotenzial räumlich gesichert<br />
werden. Hinsichtlich der Minimierung von Nutzungskonflikten wurde eine Umweltprüfung<br />
zum Vorhaben durchgeführt, die die wahrscheinlich zu erwartenden Konflikte darlegt, im<br />
Umweltbericht dokumentiert und Vermeidungsmaßnahmen bestimmt und festlegt wurden.<br />
So wurden z.B. innerhalb der Plangebietsfläche besonders schützenswerte<br />
Trockenrasenbereiche aus der Überplanung mit Photovoltaikmodulen ausgespart als auch<br />
einzuhaltende Abstände zu den im und angrenzend an das Plangebiet liegenden<br />
Kleingewässern festgelegt.<br />
3.2 Flächennutzungsplanung<br />
Seit Februar 2009 liegt der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schorfheide vor.<br />
Die geplanten Nutzungen widersprechen den Darstellungen des FNP. Der<br />
Flächennutzungsplan muss auf Grund dessen über ein paralleles Planverfahren an die<br />
8<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
vorliegenden Planungsziele angepasst werden. Das Änderungsverfahren wurde mit dem<br />
Beschluss der Gemeindevertretung am 29.09.2010 eingeleitet.<br />
3.3 Landschaftsplanung<br />
Der Landschaftsplan für die Alt-Gemeinde Finowfurt sieht für den überwiegenden<br />
Flächenanteil der Flugbetriebsfläche die Aufwertung des Landschaftsbildes und der<br />
Biotopqualität durch die Pflege der Offenlandbereiche mittels Beweidung und der Aufwertung<br />
der vorhandenen Stillgewässer mit ihren Übergangsbiotopen vor. Trockenbiotope sollen<br />
freigehalten werden. (KNIEPER & PARTNER FNP 2009)<br />
3.4 Fachplanungen<br />
Seit 1997 liegt für den Landkreis Barnim ein Landschaftsrahmenplan vor. Die vorliegende<br />
Planung widerspricht teilweise den dort festgelegten Zielvorstellungen hinsichtlich der<br />
Sicherung der trockenen und nährstoffarmen Standorte. Zu beachten ist dennoch, dass die<br />
tatsächliche ermittelte Neuersiegelungsrate bei Solarfreiflächenanlagen, auf Grund der<br />
ausgewählten Ständerkonstruktion unter 1 % liegt. Nährstoffeinträge in das Plangebiet<br />
können weitestgehend ausgeschlossen werden.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
9
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
4. PLANUNGSKONZEPT<br />
4.1 Ziele und Zwecke der Planung<br />
Auf den zu entwickelnden Bauflächen ist geplant Solarmodule die auf feststehenden<br />
Metallelementen installiert werden zu errichten. Die geplante Anlage wird, in etwa 75 MWpeak<br />
Leistung erbringen, so dass zusammen mit der bereits installierten Anlage eine Leistung von<br />
100 MW peak erzielt wird.<br />
Beispielfoto: Tischgestell mit installierten Solarmodultafeln<br />
Photovoltaikanlagen dienen der Erzeugung elektrischer Energie und werden vorzugsweise<br />
zu deren Einspeisung ins öffentliche Stromnetz errichtet. Als Technologie der<br />
Energiegewinnung kommen kristalline Module zur Anwendung. Module auf Basis von<br />
Kadmium – Tellurid (CdT) (Dünnschichtmodule) werden nicht verwendet.<br />
Im Allgemeinen können in etwa 30% der zulässig überbaubaren Fläche mit Anlagen bebaut<br />
werden, da technologisch bedingte Verschattungsabstände der Module untereinander zu<br />
berücksichtigen sind. Entsprechend den Anlagetypen ergeben sich somit einzuhaltende<br />
Reihenabstände, die einer optimalen Effizienz der Anlage zu Grunde liegen.<br />
Der Gesetzgeber hat zur Förderung regenerativer Energien das Erneuerbare-Energien-<br />
Gesetz (EEG) erlassen. Dieses ermöglicht den Anlagenbetreibern den subventionierten<br />
Verkauf der durch die Photovoltaikanlage erzeugten elektrischen Energie.<br />
Als Konversionsfläche ist die ausgewählte Fläche prädestiniert für PV-Anlagen und unterliegt<br />
der Förderung entsprechend der Bestimmungen des EEG (Erneuerbarer-Energien-Gesetz).<br />
Die einzelnen Modultafeln mit einer Abmessung von etwa 1,64 m Höhe und ca. 1 m Breite<br />
werden mit einer Neigung von 20° bis 25° doppelreihig oder 4-reihig (Querlage) auf die<br />
Modultischen installiert. Bei einer 4-reihigen Querlage der Module ist eine bessere Wasser-<br />
und Lichtverteilung unter den Modulen gegeben. Die Frontalabdeckung der Module besteht<br />
aus hoch lichtdurchlässigem gehärtetem Antireflex-Glas. Die Befestigung der Modultische im<br />
Boden erfolgt mittels Stahlprofile, die in den Boden gerammt werden. An diesen Profilen wird<br />
die Tragkonstruktion für die Modultafeln aus Aluminium mittels Schraubverbindungen<br />
befestigt. Auf befestigten Flächen können die Modultische je nach Stabilität der Befestigung<br />
auch aufgedübelt werden.<br />
Der Abstand der Modultische in der Reihe ergibt sich konstruktionsbedingt aus dem<br />
Verschattungsabstand der Modulreihen untereinander und hängt vom Neigungswinkel der<br />
Modultafeln ab. Je geringer die Neigung der Module umso dichter der Reihenabstand. Eine<br />
Modulreihe nimmt in zentraler Projektion zur Oberkante Gelände in etwa ein 1/3 einer<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
10
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Gesamtreihe ein. Es folgen in etwa 2/3 unbebauter Fläche bis zum Beginn der nächsten<br />
Reihe.<br />
Der Abstand der Modulunterkante zur Oberfläche Gelände beträgt in etwa 0,80 m bis 1,0 m.<br />
Der Abstand der Modultafeloberkante zur Oberkante Gelände beträgt in etwa 2,50 m. Alle<br />
neu geplanten baulichen Anlagen innerhalb des Plangebietes überschreiten im Regelfall<br />
nicht eine Höhe von 3,50 m über Oberkante Gelände.<br />
Errichtet wird die Anlage nach logistischem Ablaufplan in Bauabschnitten. Zuerst werden die<br />
Metallpfähle (verzinkter Stahl) maschinell in den Boden gerammt. Darauf erfolgt die Montage<br />
des Aluminiumgestells für die Module. Auf dem Aluminiumgestell werden die Modulplatten<br />
befestigt und danach miteinander verkabelt.<br />
Die Verkabelung der Module untereinander wird unter den Modultafeln befestigt und über<br />
Sammelleitungen im Erdreich über Kabelgräben zu den Wechselrichtern geführt. Die<br />
Wechselrichter wandeln den Gleichstrom in Wechselstrom. Die Einspeisung des<br />
gewonnenen und umgewandelten Stroms erfolgt über eine entsprechend dimensionierte<br />
Sammelleitung in das Stromnetz. Am Einspeisepunkt wird ein Umspannwerk errichtet bzw.<br />
es wird das bereits vorhandene, im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens zum vBP Nr.<br />
135 errichtete genutzt. Der Einspeisepunkt sowie Umspannwerk liegt außerhalb des<br />
Plangebietes und ist nicht Bestandteil dieser Planung.<br />
Die Genehmigung der Errichtung des Umspannwerkes obliegt der<br />
Baugenehmigungsbehörde. Entsprechend der Aussage des Vorhabenträgers ist die<br />
Aufstockung des bereits errichteten Umspannwerkes im Zuge des Baus der südlichen<br />
Photovoltaikanlage auf 50 MW denkbar. Diese Möglichkeit wird zur Zeit geprüft. Dennoch<br />
wird ein zweites Umspannwerk notwendig sein, das aus technischen Gründen<br />
(Stromeinspeisung ins Netz nicht am gleichen Einspeisepunkt errichtet werden kann. Nach<br />
bisher vorliegenden Aussagen kann aber die gleiche Kabel-Schneise wie für das 1.<br />
Umspannwerk genutzt werden<br />
Die Laufzeit der Anlage richtet sich nach den Förderrichtlinien des EEG und wird mindestens<br />
20 Jahre betragen.<br />
Der fertig gestellte Solarpark ist ein Energie-Kraftwerk, welches aus sicherheitstechnischen<br />
Gründen eingezäunt wird.<br />
Die Verpflichtung des Rückbaus der gesamten Anlage einschließlich der verlegten Kabel<br />
wird im Durchführungsvertrag zwischen Kommune und Vorhabenträger geregelt.<br />
4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan<br />
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde sind die überplanten Flächen<br />
überwiegend als Flugbetriebs- Gewerbeflächen dargestellt. Der FNP muss diesbezüglich an<br />
die neue Entwicklungsrichtung angepasst und parallel zum Bebauungsplanverfahren<br />
geändert werden. Eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan ist somit erst gegeben,<br />
wenn der geänderte FNP genehmigt und wirksam wird.<br />
5. PLANINHALT (ABWÄGUNG UND BEGRÜNDUNG)<br />
5.1 Nutzung der Baugrundstücke<br />
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist mit dem<br />
Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes deckungsgleich. Es werden keine<br />
Flächen außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 Abs. 4 BauGB in den<br />
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
11
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Die zukünftige Nutzung der beplanten Grundstücke besteht hauptsächlich in der Erzeugung<br />
von Strom aus solarer Energie.<br />
Um die bisherige Museumsnutzung (Durchführung von Großveranstaltungen wie road-runner<br />
oder CCC-Computer-Chaos-Club) weiterhin absichern zu können sollen planungsrechtlich<br />
auch nach Eigentumsübergang Veranstaltungsflächen in geeigneter Größenordnung<br />
gesichert werden. Hierzu werden 2 Flächen ausgewiesen, die durch einen Weg miteinander<br />
verbunden sind. Zum einen wird der Rollweg westlich der Ramp 3 in einer Länge von 350 m<br />
und die nördlich des Rollweges bis zum Museum liegende Fläche nicht mit PV- Modulen<br />
überbaut.<br />
Des Weiteren wird an der südlichen Grenze der Liegenschaft (auf dem Flurstück 521) im<br />
Bereich der westlichen Einflugschneise des Flugplatzes ein Streifen von ca. 60 m von der<br />
Überbauung mit PV- Modulen freigehalten, so dass diese Fläche für die Besucher der<br />
Museumsveranstaltungen als temporärer Zeltplatz genutzt werden kann. Als Verbindung<br />
zum Museum wird ein ca. 5,0 m breiter Fahrstreifen ebenfalls von der Überbauung mit<br />
Solarmodulen freigehalten.<br />
5.1.1 Art der Nutzung<br />
1.1 Sondergebietsfläche mit Zweckbestimmung Photovoltaik<br />
Innerhalb der Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen sind<br />
bauliche Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie und deren Nebenanlagen wie<br />
Wechselrichter, Trafo sowie ähnliche technische Ausrüstungen und Zuwegungen zulässig.<br />
Die Art dieser Nutzung leitet sich aus dem Planungsziel der Errichtung einer<br />
Photovoltaikfreiflächenanlage ab.<br />
Auf der Fläche mit der Bezeichnung SO B (Betriebsflächen) sind bauliche Anlage wie<br />
Bürogebäude, Lagerhallen und Stellflächen zulässig, die im Zusammenhang mit der<br />
Betriebsführung und Verwaltung von Solaranlagen stehen.<br />
Es ist beabsichtigt einen Betriebssitz auf dieser Fläche errichten zu können. Exakte<br />
Größenvorstellungen bzw. konkrete zum Aussehen der dort zu errichtenden Gebäude liegen<br />
bislang nicht vor. Es soll die Option offen gehalten werden Einzelunternehmen oder<br />
Unternehmensgruppen anzusiedeln die zentrale Steuerungsfunktionen und Entwicklungen<br />
erneuerbarer Energien übernehmen. Dies steht im engen Zusammenhang mit der<br />
Planzielstellung der Errichtung einer 100 MW peak _Solaranlage auf dem Flugplatzgelände<br />
Finow/Finowfurt.<br />
Weiterhin sollen die vorgesehenen Gebäude der Unterbringung des Wartungsdienstes für<br />
die Solaranlage dienen.<br />
1.2 Sondergebietsfläche mit Zweckbestimmung Museumsveranstaltungen<br />
Auf der Sondergebietsfläche mit Zweckbestimmung Museumsveranstaltungen sind nur auf<br />
der Fläche SO MV1 Ausstellungen und Veranstaltungen mit musealen-kulturellen,<br />
musikalisch-kulturellen, touristischen, bildungsfördernden und sportiven Charakter zulässig.<br />
Auf der Fläche SO MV2 ist das temporäre Aufstellen von Zelten und Campingwagen nur in<br />
Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen auf dem Gelände des<br />
Erlebnisparks Luftfahrt und Technik (wie z.B. Chaos Computer Club oder road-runner)<br />
zulässig.<br />
Die getroffenen Festlegungen knüpfen an die zulässigen Nutzungen des Bebauungsplanes<br />
Nr. 34 Erlebnispark Luftfahrt und Technik an. Jährlich finden auf dem privat betriebenen<br />
Gelände des Museums der Luftfahrthistorischen Sammlung Veranstaltungen statt, die eine<br />
Vielzahl von Besuchern anzieht. Das Museumsgelände reichte für die Aufnahme der Gäste<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
12
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
nicht aus und so wurde auf die Flächen des Flugplatzgeländes mit Zustimmung des<br />
Flugplatzbetreibers ausgewichen. Diese zusätzlichen Flächen entfallen bei Überplanung mit<br />
Photovoltaikmodulen. Auf Grund dessen sollen deshalb für die zukünftigen Veranstaltungen<br />
Ausweichflächen gesichert werden<br />
Zwischen dem Museumsverein und dem zukünftigen Eigentümer sind hierzu vertragliche<br />
Regelungen zu treffen.<br />
1.3 Einfriedungen<br />
Einfriedungen zur Eingrenzung des Baugrundstückes sowie die Verlegung von Erdkabeln<br />
und Leitungen sind im gesamten Plangebiet zulässig.<br />
5. 1. 2. Maß der baulichen Nutzung<br />
Überbaubare Fläche<br />
Maßgebend für die Überbauung, ist die durch die Photovoltaikanlagen übertraufte Fläche in<br />
senkrechter Projektion auf die Geländeoberfläche bzw. für die Nebenanlagen und Wege die<br />
tatsächlich überbaute Grundfläche.<br />
Die zulässige Überbauung mit baulichen Anlagen auf der Betriebsfläche SO B ist auf 2.500<br />
m² begrenzt.<br />
Baugrenzen<br />
Ausnahmsweise dürfen die Baugrenzen im Teilgebiet E und F durch Photovoltaik-<br />
Modultische und Baustraßen überschritten werden.<br />
Die Modultische werden bautechnisch nicht als Hochbauten verstanden. Es wird daher nicht<br />
von baulichen Konflikten hinsichtlich der Begrenzung zur Landesstraße ausgegangen.<br />
Nicht überbaubare Flächen<br />
Auf der Fläche im Teilgebiet A sind im Abstand von 40 m zur äußeren befestigten<br />
Fahrbahnkante der Bundesautobahn (A) 11 keine hochbaulichen Anlagen zulässig.<br />
Höhe baulicher Anlagen<br />
Die Traufhöhe der baulichen Anlagen innerhalb der Betriebsflächen SO B ist auf 12 m,<br />
gemessen zur Geländeoberfläche begrenzt. Die Bezugshöhe wurde mit 34,00 NHN<br />
festgelegt. Die Höhe orientiert sich an den vorhandenen Geländegegebenheiten.<br />
5.1.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen<br />
Gestaltung der Einfriedungen<br />
Die Einfriedungen sind so zu gestalten, dass in Bodennähe eine Durchlässigkeit für Kleinund<br />
Mittelsäuger gegeben ist.<br />
Die Festlegung leitet sich aus dem Umweltbericht ab und soll der Zerschneidungswirkung<br />
der Zaunanlage für Kleintierarten entgegenwirken<br />
5.1.4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von<br />
Boden, Natur und Landschaft<br />
Erhalt wertvoller Biotope<br />
Die Maßnahmeflächen M11 bis M15 sind als Trockenrasen-Heideflächen zu erhalten und<br />
dürfen nicht überbaut werden. Ausnahmsweise darf die Fläche mit der Bezeichnung M12<br />
einmalig durch die Verlegung einer horizontal (in etwa Ost-West-Richtung) angelegten<br />
Baustraße unterbrochen werden. Die maximale Breite der Unterbrechung (Schneise<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
13
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Baustraße) darf 6 m nicht überschreiten. Baustraßen-Befestigungen über 4 m sind nach<br />
Beendigung der Bauphase wieder zurückzubauen.<br />
Abstand zur Gewässerkante<br />
In einem Abstand von 15 m zur Gewässerkante (gleich Uferkante) ist die Errichtung<br />
baulicher Anlagen sowie die Befahrung mit Fahrzeugen nicht zulässig.<br />
Habitatverbessernde Maßnahmen<br />
Im gesamten Plangebiet verteilt sind in den unverschatteten Bereichen zwischen den Reihen<br />
der Modultische und an den Rändern der Anlage mindestens 50 Stein- und Reisighaufen<br />
(je Haufen 0,3 bis 0,5 m³) einzurichten.<br />
Befestigungen<br />
Die neu zu errichtenden Verkehrsflächen und Zuwegungen sind wasserdurchlässig zu<br />
befestigen. Die Zuwegungen und Anschlusswege zwischen den Modulreihen sind<br />
unbefestigt zu halten.<br />
Die Festlegungen leiten sich aus den vorgesehenen Vermeidungs- und<br />
Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht ab. Konflikte sollen möglichst vermieden werden,<br />
dies schließt eine praktikable Bauumsetzung jedoch nicht aus.<br />
5.2 Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte<br />
Die Hauptzufahrt für die Erschließung des Plangebietes erfolgt aus nördlicher Richtung. Es<br />
ist geplant somit eine direkte Anbindung an die B 167 zu errichten. Die Planung dieser<br />
Straße ist nicht Bestandteil des vBP und ist über ein gesondertes Verfahren zu realisieren.<br />
Die Planung der Erschließungsstraße basiert auf einer Planung, die bereits im Jahr 2001<br />
begonnen wurde. Zur damaliger Zeit noch mit dem Hintergrund der Entwicklung eines<br />
Regionalflughafens.<br />
Die Verbindungsstraße führt beginnend an der Straße am REAL-Einkaufsmarkt durch Wald-<br />
und Wiesengelände. Dann wird ein auf einem Damm liegendes stillgelegtes Bahngleis<br />
gequert. Vor dem Bauende verläuft die Straße im Bereich einer alten vorhandenen<br />
Betonstraße. Zur gefahrlosen Unterquerung der Fahrbahn für Amphibien wird ein Durchlass<br />
mit einer Länge von 12,0 m, einer lichten Breite von 1,00 m und einer lichten Höhe von 0,60<br />
m vorgesehen. Die Ausbaulänge der Straße beträgt 823 m.<br />
Die Fahrbahn wird in einer Breite von 4,75 m befestigt. Das entspricht dem Begegnungsfall<br />
LkW / PkW bei verminderter Geschwindigkeit (v ≤ 40 km/h).<br />
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt durch das Längs- und Quergefälle<br />
über die Bankette in seitlich angeordnete Sickermulden. Die Errichtung der Straße erfolgt in<br />
2 Ausbaustufen. Der Unterbau der Straße (Schotter) wird als Baustraße während des<br />
Baustellenbetriebes der Solaranlage genutzt. Nach Fertigstellung der Solaranlage erhält die<br />
Erschließungsstraße einen Vollausbau aus Asphaltbeton. 3<br />
Mit einem geplanten Baubeginn der Solaranlage zum 1. Juni muss die Straße in der 1.<br />
Ausbaustufe bis zum 30. Mai passierbar sein.<br />
Die ausgewiesene Verkehrsfläche innerhalb des Plangebietes verbleibt als teilbefestigte<br />
Baustraße, Befestigungsmaterial soll unbelasteter Betonrecycling sein.<br />
Zu diesem Zweck soll der vorhandene Weg etwas verbreitert werden und für die zu<br />
erwartende Tonnage hergerichtet werden.<br />
Für die Zuwegung zum Flurstück 366, welches nicht durch den vorhabenbezogenen<br />
Bebauungsplan überplant wird, jedoch durch dessen Planflächen eingeschlossen wird, ist<br />
3 IBE, Brunnenstr. 4, 16225 Eberswalde, Entwurfsplanung: Anbindestraße vom Flugplatz zur B 167 (Fachmarktzentrum),<br />
Erläuterung<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
14
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
eine vertragliche Regelung zu treffen, die dem Eigentümer der Fläche (bisher unauffindbar)<br />
ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht eingeräumt.<br />
In der Planzeichnung ist das Flurstück über den Weg zu erreichen, welcher das<br />
Sondergebiet MV2 (Flurstück 521) von der öffentlichen Museumsstraße erschließt.<br />
Gleiches gilt für die Erreichbarkeit der südlichen Sondergebietsfläche mit Zweckbestimmung<br />
für Museumsveranstaltungen deren konkrete Nutzung nur für temporäres Zelten festgesetzt<br />
ist. Vertraglich ist ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten dieser Fläche einzuräumen.<br />
5.3 Ausgleichsmaßnahmen<br />
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden im Umweltbericht als Ausgleich für die<br />
unvermeidbaren Beeinträchtigungen nachstehende Maßnahmen herausgearbeitet. Die<br />
inhaltlichen Angaben sind dem Umweltbericht zu entnehmen<br />
A1 Entwicklung und Pflege eines naturnahen Bewuchses unter und zwischen den<br />
Modultischen und in den von Gehölzbewuchs freizuhaltenden Randbereichen der<br />
Modultische.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A2 Barrierefreie Gestaltung der Einzäunung der Anlage.<br />
(Als textliche Festsetzung in der Planzeichnung aufgenommen)<br />
A3 Entsiegelung von Flächen.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A4 Schaffung von neuen Trockenstandorten auf versiegelten Flächen.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A5 Durchführung vorgezogener (CEF-) Maßnahmen: Zauneidechsen.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A6 Durchführung vorgezogener (CEF-) Maßnahmen: Fledermäuse.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A7 Schaffung von Habitat verbessernden Maßnahmen für die Zauneidechse und Vögel<br />
innerhalb des Plangebietes<br />
(Als textliche Festsetzung in der Planzeichnung aufgenommen)<br />
A8 Ökologisch / naturschutzfachliche Baubegleitung.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
A9 Monitoring.<br />
(Rechtliche Sicherung mittels Aufnahme in den Durchführungsvertrag)<br />
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiete (Ersatzmaßnahmen)<br />
Biotopschutz<br />
Entsprechend der Ermittlung im Umweltbericht wurde herausgestellt, dass 35,79 ha<br />
Sandtrockenrasen für die Errichtung des Solarparks in Anspruch genommen werden.<br />
Sandtrockenrasen stellen gemäß § 30 BNatschG i.V.m. § 32 BbgNatSchG geschützte<br />
Biotope dar. Durch die Gemeinde ist ein Befreiungsantrag an die zuständige Behörde (UNB<br />
Landkreis Barnim) zustellen. Zusammen mit dem Antrag sind Maßnahmen zu beschreiben<br />
und rechtlich zu sichern, die als Ausgleich für die Beanspruchung der geschützten Biotope<br />
zu realisieren sind<br />
Vorschlag Maßnahmen:<br />
1. FFH-Gebiet Pimpinellenberg (bei Oderberg)<br />
Größe der Fläche: 5-6 ha.<br />
2. FFH-Gebiet Trampe (TÜP Trampe)<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
15
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Größe der Flächen: ca. 15 ha.<br />
3. Bereich östlich der Flugplatzliegenschaft, östlich angrenzend an die Biesenthaler Straße<br />
(Finow)<br />
Gemarkung Finow, Flur 18, Flurstück 155 (teilweise)<br />
Größe der Fläche: ca. 12 ha.<br />
4. Zwischen- und Niedermoor am Großen Samithsee<br />
Lage innerhalb des FFH-Gebiets und NSG Nonnenfließ-Schwärzetal, ca. 2,2 km südlich des<br />
Plange-biets. Das Zwischenmoor befindet sich nördlich / nordwestlich des Sees (Größe ca.<br />
10-15 ha), die Niedermoorfläche südlich des Sees (ca. 5 ha groß).<br />
Waldflächen<br />
Ersatzbedarf Waldflächen: Der Ersatzbedarf besteht wie folgt: Überplanung von 23,62 ha<br />
Waldflächen im Plangebiet, Ausgleichsbedarf 1:1.<br />
Vorschlag Ersatzflächen:<br />
Im Bereich der Oberförsterei Schwedt bestehen im Landkreis Uckermark folgende<br />
Möglichkeiten der Erstaufforstung auf bisher unbewaldeten Standorten:<br />
1. Gemarkung Hohenfelde (Stadt Schwedt / Oder): Flur 1, Flurstücke 126, 128, 137, 159,<br />
161 (zu-sammen ca. 5,33 ha, Eigentümer Hafengesellschaft Stadt Schwedt).<br />
2. Gemarkung Hohenreinkendorf (Stadt Gartz (Oder)): Flur 6, Flurstück 246 (ca. 4,5 ha,<br />
Eigentümer privat).<br />
3. Gemeinden Kummerow (Stadt Schwedt / Oder) und Jamikow (Gemeinde Passow): ca. 7,5<br />
ha (Eigentümer Kirchengemeinde Kummerow bzw. Jamikow).<br />
4. Hohenselchow-Groß Pinnow (Landkreis Uckermark):<br />
1. Teilprojekt: Gemarkung Groß Pinnow, Flur 6, Flurstücke 123-143 (ca. 66.790 m²)<br />
2. Teilprojekt: Gemarkung Groß Pinnow, Flur 6, Flurstücke 163, 400, 434, 436-442 (ca.<br />
36.401 m²)<br />
5.4 Gestaltungsregelungen<br />
Festlegungen die örtlichen Bauschriften gemäß § 81 BbgBO zu Grunde liegen wurden für die<br />
Gestaltung der Einfriedungen aufgenommen. Die Zaunanlage die aus Sicherheitsgründen<br />
um das Solarkraftwerk zu errichten sein wird, ist so zu gestalten, dass sie in Bodennähe für<br />
Klein- und Mittelsäuger durchgängig bleibt.<br />
Diese Festlegung wurde aus dem Umweltbericht abgeleitet. Um diese Durchgängigkeit zu<br />
gewährleisten ist entweder die untere Zaunkante zum Boden in einem Abstand von mind.<br />
10-20 cm zur Bodenoberfläche zu montieren oder es sind in einem Abstand von mind. 20 m<br />
Schlupflöcher im Boden vorzusehen, die mind. 30 cm breit und 20 cm hoch sind.<br />
5.5 Kennzeichnungen<br />
In der Planzeichnung wurde die Grenze der noch gültigen Flugbetriebsfläche<br />
gekennzeichnet.<br />
Die Reduzierung der Flugbetriebsflächen ist die Grundvoraussetzung für die Überplanung<br />
der Flächen im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens.<br />
Der positive Abschluss des luftrechtlichen Verfahrens - hier insbesondere die Entlassung der<br />
für das Planverfahren erforderlichen Flächen aus der luftrechtlichen Fachplanung - ist<br />
Voraussetzung für rechtsmäßige Entscheidungen im Planungsverfahren und darüber hinaus<br />
für die Erteilung von Baugenehmigungen.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
16
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
5.6 Nachrichtliche Übernahmen<br />
Nachrichtliche Übernahme des Verlaufes der Biesenthaler Straße<br />
Der reale Verlauf der Biesenthaler Str. in Finowfurt hat sich durch die Vermessung ergeben<br />
und wird im Zuge des Planverfahrens durch Flurstückstausch geregelt. Die<br />
Plangebietsgrenzen und Bauflächen werden dementsprechend angepasst.<br />
Westlich der Teilgebietsfläche C und östlich der als Wald ausgewiesenen Fläche befindet<br />
sich die Flugbetriebsfläche mit überwiegend luftfahrtafinen Gewerbeansiedlungen. Nördlich<br />
dieser Flugbetriebsfläche befindet sich die ausgewiesene Verkehrsfläche, die das innere<br />
Plangebiet und die östlichen Museumsflächen verkehrstechnisch erschließen soll. Mit<br />
vorliegender topographischer Vermessung befindet sich die ausgewiesene Fläche nicht auf<br />
dem dort vorhandenen Weg.<br />
Der Weg wurde als nachrichtliche Übernahme in die Planzeichnung übernommen. Der<br />
Geltungsbereich und die Verkehrsfläche sind dem vorhandenen Wegverlauf anzupassen.<br />
Die Fläche zwischen der Verkehrsfläche und dem nördlichen Geltungsbereich verbleit als<br />
ausgewiesene Waldfläche.<br />
Durch die Anpassung der Planung an den nachrichtlich übernommenen vorhandenen Weg<br />
können Eingriffe vermieden werden.<br />
Da sich dadurch die Flugbetriebsfläche verkleinert ist eine Abstimmung mit der zuständigen<br />
Luftfahrtbehörde notwendig.<br />
Des Weiteren wurden die Grundwasser-Pegelmessstellen nachrichtlich in die Planzeichnung<br />
übernommen. Die Messstellen sind funktionsfähig zu erhalten. Die Hinweisen der Unteren<br />
Bodenschutzbehörde des LK_ Barnim sind zu beachten.<br />
5.7 Hinweise<br />
In die Planzeichnung wurde der Hinweis aufgenommen, dass sich das Plangebiet auf<br />
ehemals militärisch genutztem Gelände befindet und in entsprechender Zuordnung im<br />
Altlastenkataster des LK Barnim geführt wird. Weiterhin wird auf die Kampfmittelbelastung<br />
aufmerksam gemacht.<br />
6. UMWELTBERICHT<br />
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a ist eine Umweltprüfung<br />
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt<br />
werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.<br />
Die Gemeinde legt dazu für den Bebauungsplan fest, in welchem Umfang und<br />
Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist.<br />
Hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden dazu die Träger öffentlicher<br />
Belange und sonstiger Behörden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung um eine<br />
Aussage gebeten, um dem naturschutzfachlichen Belangen gerecht zu werden.<br />
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und<br />
allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des<br />
Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung<br />
ist in der Abwägung zu berücksichtigen.<br />
Der Umweltbericht ist ein in sich geschlossener Rapport, der als Anlage zur Planbegründung<br />
des vBP gehört.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
17
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG<br />
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen<br />
Durch die Entwidmung von Teilen der Flugbetriebsfläche ergeben sich völlig andere<br />
Nutzungsformen mit unterschiedlichen Auswirkungen, die sehr wahrscheinlich hauptsächlich<br />
im Bereich des Naturhaushaltes zu verzeichnen sein werden.<br />
7.2 Verkehr<br />
Eine direkte Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Anbindung an die B 167. Die<br />
Planung und Realisierung der Straße bis zum Geltungsbereich des Vorhabens ist in einem<br />
gesonderten Verfahren zu regeln und nicht Bestandteil des vBP. Die zu errichtende Straße<br />
wird innerhalb des Bebauungsplanes als Verkehrsfläche ausgewiesen. Sie dient der<br />
Erschließung des Plangebietes, der Anbindung der Gewerbetreibenden auf der<br />
Flugbetriebsfläche sowie der Anbindung der Museumsfläche an die Flugbetriebsfläche.<br />
Durch diese Haupterschließungsstraße für das Vorhaben wird das Teilgebiet B und C<br />
erschlossen. Das Teilgebiet A ist zu erschließen über das Teilgebiet B mit Querung der<br />
Biesenthaler Straße. Die Teilgebiete D, E und F werden direkt über die L293 (Eberswalder<br />
Biesenthaler Straße) erschlossen.<br />
Mit Errichtung und Ausbau einer Erschließungsstraße mit direktem Anschluss an die B 167<br />
ist gewährleistet, dass der zu erwartende Baustellenverkehr weder über die Biesenthaler<br />
Straße in Eberswalde, noch über die Biesenthaler Straße in Finowfurt abgewickelt werden<br />
muss. Beides sind zwar öffentliche Straßen, jedoch sind beide zum Teil in einem schlechten<br />
Ausbauzustand. Eventuell zu vermutende Lärmbelästigungen für die Anwohner beider<br />
Straßen kann somit vermieden werden.<br />
Mit der Verkehrsanbindung des Plangebietes an die B167 und der Erweiterung der<br />
nördlichen ausgewiesenen Verkehrsfläche in komfortabler Baustellenqualität wird das<br />
Museumsgelände im Osten des Plangebietes ebenfalls direkt an die B 167 angeschlossen.<br />
Eine Nutzung dieser Straße soll hauptsächlich als Entlastungsweg bei Großveranstaltungen<br />
zur Anwendung kommen, da das Museumsgelände über die neu errichtete Museumsstraße<br />
bereits eine Verkehrsanbindung besitzt.<br />
7.3 Natur, Landschaft, Umwelt<br />
Der Mensch wird vom Vorhaben nur geringfügig betroffen, da die Liegenschaft des<br />
Flugplatzes für die öffentliche Nutzung gegenwärtig und künftig nicht zugänglich ist. Eine<br />
erhebliche Aufwertung der Wohn- und Erholungsfunktionen erfolgt mit der Verringerung der<br />
Flugbewegungen und der damit verbundenen Lärmminderung für die Anwohner in der<br />
Umgebung.<br />
Für das Schutzgut Boden erfolgen planbedingte Auswirkungen durch die Baumaßnahmen,<br />
die mit der Einrichtung von Baustraßen und mit Erdarbeiten für Kabelgräben und für die<br />
Geländemodulierungen verbunden sind. Insbesondere durch die auf der Liegenschaft in den<br />
letzten Jahren vorgenommenen Entsiegelungen kann der Eingriff ausgeglichen werden.<br />
Entsiegelungspotenziale sind weiterhin im nördlichen Teil des Teilgebiets C vorhanden.<br />
Dies trifft auch für das Schutzgut Wasser zu. Die zusätzlichen Versiegelungen durch<br />
Gebäude, Transformatorstationen, Wechselrichter und Baustraßen können mit den bereits<br />
getätigten Entsiegelungen ausgeglichen werden. Offene Wasserflächen sind vom Vorhaben<br />
nicht betroffen und bleiben erhalten.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
18
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Das Schutzgut Klima ist durch die genehmigungsabhängige Rodung von Waldflächen im<br />
Plangebiet betroffen. Dies kann durch Ersatzaufforstungen an anderer Stelle ausgeglichen<br />
werden. Überregional trägt die Photovoltaikanlage zur Erhöhung des Anteils<br />
umweltfreundlicher und klimaneutraler Energie bei und verringert die Stromproduktion durch<br />
klimaschädliche Fossilbrennstoffe.<br />
Das Landschaftsbild, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nicht wesentlich betroffen.<br />
Die größten Auswirkungen hat das Planvorhaben für die Pflanzen und Tiere im Gebiet, nicht<br />
zuletzt, weil die Baumaßnahmen im Sommer diesen Jahres durchgeführt werden. Die<br />
Liegenschaft ist durch großflächige gesetzlich geschützte Trockenrasen unterschiedlichen<br />
Alters und Ausbildung geprägt. Mit der Planung werden sie zum Teil durch die Modultische<br />
überdeckt und beschattet, eine Veränderung der Artenzusammensetzung und damit der<br />
Lebensräume der an diese Standorte gebundenen Tierarten ist zu befürchten.<br />
Verminderungen erfolgen mit dem Erhalt von Flächen und der Schaffung von neuen<br />
Trockenstandorten. Da die Überplanung einem Genehmigungsvorbehalt unterliegt, sind<br />
mehrere Ersatzmaßnahmen in Form von Pflegemaßnahmen außerhalb des Plangebiets<br />
vorgesehen.<br />
Bei der Tierwelt sind vor allem die flächig auftretende Zauneidechse sowie baubedingt auch<br />
die Brutvögel betroffen. Es tritt teilweise der Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG ein,<br />
insbesondere die Störung von Arten. Die Auswirkungen für diese und die übrige gesetzlich<br />
geschützte Fauna werden im Artenschutzbeitrag benannt und bewertet. Maßnahmen sind<br />
vor allem baubegleitend, indem durch eine naturschutzfachliche Baubegleitung die<br />
betroffenen Bauabschnitte geprüft, Zauneidechsen bei Bedarf umgesetzt und brütende Vögel<br />
geschützt werden. Anschließend erfolgen Habitataufwertungen im Gebiet. 4<br />
7.4 Kosten und Finanzierung des Vorhabens<br />
Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang<br />
stehende Aufwendungen werden vom Vorhabensträger, der SQuadrat Finow Tower<br />
Grundstücks GmbH & Co KG übernommen.<br />
Weitere Regelungen wie Durchführung des Vorhabens sowie die daran gebundenen<br />
Vermeidungs- Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen inner- und außerhalb des<br />
Plangebietes und Rückbauregelungen sind im Durchführungsvertrag zu regeln. Dieser muss<br />
vor dem Satzungsbeschluss unterschrieben vorliegen.<br />
8. VERFAHREN<br />
Am 29.09.2010 wurde von der Gemeindevertretung Schorfheide der Aufstellungsbeschluss<br />
unter der Beschlussnummer BA/0205/10 gefasst. Der Beschluss wurde im Amtsblatt Nr.<br />
09/2010 der Gemeinde Schorfheide am 19.11.2010 bekannt gemacht.<br />
Parallel zur Aufstellung des vBP läuft das 2. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan.<br />
Mit dem Schreiben vom 3.02.2011 wurden im Rahmen des vorhabenbezogenen<br />
Bebauungsplanverfahren Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“ die Beteiligung<br />
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. (1) BauGB<br />
durchgeführt. Es wurden insgesamt 34 Behörden und Träger öffentlicher Belange<br />
(einschließlich Nachbargemeinden) über das Planvorhaben unterrichtet und zur Äußerung<br />
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung<br />
nach § 2 Abs. 4 aufgefordert.<br />
4 Trautmann � Goetz � Landschaftsarchitekten � Berlin Umweltbericht S. 35 Zusammenfassung<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
19
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
Insgesamt äußerten sich 26 Behörden und Träger öffentlicher Belange und. Davon hatten<br />
keine Anregungen, Hinweise bzw. waren in ihren Belangen nicht betroffen:<br />
Am 23.02.2011 um 13.00 Uhr wurden die Träger öffentlicher Belange zu einer<br />
Ämterkonferenz eingeladen, um das Planvorhaben nochmals vorzustellen und auftretende<br />
Probleme hinsichtlich der planerischen Umsetzung des Vorhabens mit dem Investor, den<br />
Planern, den zuständigen Mitarbeitern der Gemeinde Schorfheide und den Behörden und<br />
Ämtern zu diskutieren.<br />
Am 8.03. 2011 um 17.00 Uhr wurden die Bürger zu einer Bürgerversammlung in den<br />
Beratungsraum der Gemeinde Schorfheide, Erzbergerplatz 1 im Rahmen der frühzeitigen<br />
Bürgerbeteiligung zum Vorhaben eingeladen. Es nahmen 3 Bürger daran teil, die zum<br />
Vorhaben der Errichtung einer weiteren Solaranlage keine Bedenken, Anregungen oder<br />
Hinweise hatten. Im Fordergrund stand für die Bürger die Nachfrage zur Ursache der<br />
großflächigen Holzeinschlägen um den Flugplatz und dem zukünftig zu erwartenden<br />
Flugbetrieb.<br />
Am 30.03.2011 wurden die schriftlich eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher<br />
Belange durch die Gemeindevertretung abgewogen. Insbesondere wurden Bedenken zu<br />
natur- und artenschutzfachlichen Belangen vorgebracht, die bereits teilweise auf der<br />
Ämterkonferenz angesprochen wurden.<br />
Der überwiegende Teil der vorgebrachten Bedenken wurde berücksichtigt und fanden<br />
Niederschlag im überarbeiteten und ergänzten Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag<br />
sowie in den Festsetzungen des vBP.<br />
In der Planzeichnung wurden Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur<br />
und Landschaft aufgenommen, die einen Großteil der wertvollen Trockenrasen- und<br />
Heidkrautbestände ausmachen.<br />
Im Wesentlichen nicht gefolgt werden konnte den Ausführungen der Forstbehörde die eine<br />
Umwandlung von Waldflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen ablehnt.<br />
Begründet wird dies damit, dass aus Sicht der Forstbehörde für große Teile der<br />
umzuwandelnden Waldfläche keine wirkenden Konversionstatbestände vorliegen. Diese<br />
Auffassung der Forstbehörde wurde zunächst von der Gemeindevertretung zur Kenntnis<br />
genommen. Eine Klärung des Sachverhaltes mit der Forstbehörde ist zwingend erforderlich<br />
für die Umsetzung und Erreichung des Planungsziels. Aus Sicht der Gemeinde liegt der<br />
Konversionstatbestand schon allein deshalb vor, weil das Gebiet immer noch auf großen<br />
Flächen mit Altlasten und vor allen Dingen mit Kampfmitteln belastet ist, was zum einen<br />
durch die Stellungnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und der<br />
Bodenschutzbehörde des Landkreises Barnim vor allen Dingen aber durch die bereits<br />
geborgene Munition belegt werden kann.<br />
Nicht berücksichtigt wurde im Wesentlichsten die Forderung seitens des Landesamtes für<br />
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und der anerkannten Naturschutzverbände<br />
nach erneuten Kartierungen und Bestandserhebungen der Tierarten auf der Fläche.<br />
Das Planungsziel einer Bebauung in diesem Jahr könnte nicht durchgeführt werden. Das<br />
Vorhaben wäre somit entsprechend den wirtschaftlich zu bewertenden Faktoren nicht<br />
realisierbar. Das Plangebiet wurde in vergangenen Zeiträumen bereits mehrfach kartiert. Von<br />
weiteren Kartierungen und Bestandserfassungen wird abgesehen, da keine neuen<br />
Erkenntnisse zum Zustand der Fläche zu erwarten sind.<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
20
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
9. RECHTSGRUNDLAGEN<br />
Für die Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden nachstehende<br />
Rechtsgrundlagen zu Grunde gelegt:<br />
RECHTSGRUNDLAGEN<br />
-Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004<br />
S.2414, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009<br />
S.2585)<br />
-Baunutzungsverordnung (Bau NVO) in der Fassung vom 23.01.1990,<br />
zuletzt geändert durch Art.3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionenund der<br />
Ausweitung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 BGBl.I S. 466)<br />
-Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S.58)<br />
-Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 16.07.2003 (GVBl. I/03, [Nr. 12], S. 210),<br />
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 07.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 12] , S.262,<br />
268)<br />
-Landeswaldgesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 2 des<br />
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (GVBl. I S. 367)<br />
-Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) i.V.m.<br />
Brandenburgischem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BbgNatSchG) i.d.F.<br />
der Bekanntmachung vom 26.05.2004 (GVBl. I S. 350) zuletzt geändert durch Artikel 1 des<br />
Gesetzes vom 29.7.2009 I 2542<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
21
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“<br />
Vorhaben- und Erschließungsplan<br />
Entwurf Stand -8. April 2011 -<br />
ANLAGEN<br />
- Umweltbericht<br />
- Gutachten zurBeurteilung der möglichen Blendwirkung eines Solarparks und dessen thermischer<br />
Effekte<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
PROJEKTBÜRO DÖRNER & PARTNER GmbH<br />
22
Projekt: 1254<br />
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen<br />
Blendwirkung<br />
eines Solarparks und<br />
dessen thermischen Effekte<br />
am<br />
Verkehrslandeplatz<br />
Eberswalde-Finow<br />
Dieser Bericht umfasst 34 Textblätter<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
� Umweltgutachten<br />
� Genehmigungen<br />
� Betrieblicher<br />
Umweltschutz<br />
Ingenieurbüro für<br />
Technischen Umweltschutz<br />
Dr.-Ing. Frank Dröscher<br />
Lustnauer Straße 11<br />
72074 Tübingen<br />
Ruf 07071 / 889 - 28 -0<br />
Fax 07071 / 889 - 28 -7<br />
Buero@Dr-Droescher.de<br />
März 2011
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
1 Aufgabenstellung 3<br />
2 Vorhaben und Lage des Standortes 4<br />
3 Beschreibung der Photovoltaikanlagen 9<br />
4 Blendwirkung 13<br />
4.1 Allgemeines zu Licht und Blendung 13<br />
4.2 Methodik und Modellbeschreibung 15<br />
4.3 Beurteilungskriterien 17<br />
4.4 Blendwirkung für Flugsicherungspersonal im Kontrollturm 18<br />
4.5 Blendwirkung für Flugzeugführer 21<br />
4.5.1 Start nach Westen (Start 10) und nach Osten (Start 28) 21<br />
4.5.2 Anflug/Landung aus Osten (Landung 28) 21<br />
4.5.3 Anflug/Landung aus Westen (Landung 10) 24<br />
4.5.4 Queranflug aus der Platzrunde (Landung 28) 26<br />
5 Thermische Effekte 28<br />
6 Zusammenfassende Bewertung 33<br />
6.1 Blendwirkung 33<br />
6.2 Thermische Auswirkungen 33<br />
7 Quellenverzeichnis 34<br />
Blatt 2
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
1 Aufgabenstellung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
In Ergänzung des bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 135 „Photovoltaik<br />
am Flugplatz“ wird die planungsrechtliche Zulassung weiterer Photovoltaikanlagen im Bereich<br />
des Verkehrslandeplatzes Eberswalde-Finow angestrebt.<br />
Zur Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftfahrt sollen die Lichtreflexionen<br />
an den Solarmodulen insbesondere in Bezug auf eine mögliche Blendwirkung gutachtlich untersucht<br />
und bewertet werden.<br />
Weiterhin sollen die Auswirkungen der veränderten Bodennutzung in Bezug auf thermische<br />
Effekte, dabei insbesondere in Bezug auf fliegerisch relevante Auf- oder Fallwinde, untersucht<br />
und bewertet werden.<br />
Die vorliegende Untersuchung zur möglichen Blendwirkung des Solarparks und dessen thermischer<br />
Effekte im Auftrag der Tower Finow GmbH umfasst im Einzelnen:<br />
Technische Beschreibung der geplanten Photovoltaik-Anlage in Bezug auf die Lichtreflektion<br />
und Thermische Effekte<br />
Analyse der Lageverhältnisse und der Flugbahnen<br />
Erstellen eines geometrischen Modells zur Ermittlung der Zeitabschnitte, in denen mit einer<br />
Lichtreflexion in das Sichtfeld der Kanzel des Kontrollturms sowie in das Sichtfeld von<br />
Fluggeräteführern bei Start oder Landung zu rechnen ist<br />
Qualitative Beschreibung des von einer Lichtreflektion betroffenen Luftraums und Bewertung<br />
der Blendwirkung anhand ausgewählter Beobachtungspunkte und der Bewegungsrichtung<br />
(Sichtfeld) mit Bewertung der möglichen Blendwirkung<br />
Blatt 3
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
2 Vorhaben und Lage des Standortes<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Der Flugplatz Finow befindet sich 40 km nordöstlich von Berlin an der Autobahn A11 Berlin-<br />
Szczecin. Im Osten befindet sich die Biesenthaler Straße (L 293), im Süden ausgedehnte<br />
Waldflächen und im Westen Wald- und offene Freiflächen.<br />
Auf Flächen südlich des Geländes des Flugplatzes Finow besteht bereits seit 2009 ein Solarpark<br />
mit einer Fläche von ca. 75 ha.<br />
Nunmehr ist beabsichtigt, die Flächen für Solartechnik auf dem bestehenden Flugplatzgelände<br />
zu erweitern. Da der Flugplatz Finow auch künftig für den Luftverkehr zugänglich bleiben soll,<br />
wird die derzeitige Flächennutzung auf dem Flughafen umstrukturiert. Dabei soll die Start- und<br />
Landebahn mit einer Länge von bisher 2520 m auf 1480 m verkürzt werden sowie umfänglich<br />
bisher für den Flugbetrieb genutzte Flächen und sonstige Flächen (überwiegend Wiesenflächen)<br />
für Photovoltaikanlagen genutzt werden.<br />
Die planungsrechtlichen Grundlagen sollen durch einen Vorhabensbezogenen Bebauungsplan<br />
(Nr. 137) der Gemeinde Schorfheide „Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“ Vorhabens- und<br />
Erschließungsplan geschaffen werden.<br />
Der Bebauungsplan sieht als Festsetzung für verschiedene Flächen des bisherigen Umgriffs<br />
des Flughafengeländes „sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen<br />
(nach § 11 BauNVO)“ sowie „sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Museumsveranstaltungen<br />
(nach § 11 BauNVO)“ vor.<br />
Der Umfang der Flächen mit Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen beträgt ca. 163 ha. Die<br />
für den Flugbetrieb verbleibende Fläche beträgt ca. 63,0 ha.<br />
Innerhalb der Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlagen sind bauliche<br />
Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie und deren Nebenanlagen wie Wechselrichter,<br />
Trafo sowie ähnliche technische Ausrüstungen und Zuwegungen zulässig. Einfriedungen<br />
zur Eingrenzung des Baugrundstücks sowie die Verlegung von Erdkabeln sind im gesamten<br />
Plangebiet zulässig.<br />
Auf der Sondergebietsfläche mit Zweckbestimmung Museumsveranstaltung ist eine temporäre<br />
Zeltplatznutzung zulässig.<br />
Die Lage des Flugplatzes und der Flächen für Photovoltaik sind der nachfolgenden Abbildung<br />
1 zu entnehmen.<br />
Blatt 4
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Abbildung 1: Lageplan des Flugplatzes und Lage der Flächen für Photovoltaik<br />
In Hinblick auf den Flugbetrieb verfügt der Flugplatz künftig nach Umwidmung der Flächen<br />
über eine Start- und Landebahn mit einer Länge von 1480 m bei einer Breite von 50 m. Die<br />
Ausrichtung der Bahn ist 10/28.<br />
Für den Flugplatz sind derzeit 2 Platzrunden, eine Platzrunde für Motorsegler und eine Platzrunde<br />
für größere Fluggeräte, ausgewiesen. Aufgrund der Verkürzung der Start und Landebahn<br />
ist anzunehmen, dass die äußere Platzrunde im Westen entsprechend gekürzt wird, so<br />
dass für den Endanflug aus Westen 1500 m zur Verfügung stehen.<br />
Die Anflugrouten nach Sichtflugregeln (Visual Flight Rules) sind nachfolgender Übersichtsskizze<br />
zu entnehmen. In der Skizze ist auch orientierend die gegenüber der im Luftfahrthandbuch<br />
(AIP) veröffentlichten Platzrunde im Westen verkürzte Platzrunde dargestellt.<br />
Blatt 5
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Abbildung 2: Sichtflug-Routen, verändert nach /5/<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Der Flugplatz ist im Bestand und auch künftig für Flugzeuge bis 14000 kg MTOW (maximum<br />
take off weight - Höchstabfluggewicht) sowie Helikopter, Motorsegler, Ballons, Ultraleicht-<br />
Flugzeuge und Luftschiffe (im Sichtflugbetrieb) zugelassen.<br />
Die Betriebszeiten sind:<br />
Sommer:<br />
Montag bis Freitag:<br />
0800 LT bis SS + 30 min (spätestens 2000 LT)<br />
Blatt 6
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Samstag, Sonntag, Feiertage:<br />
0900 LT bis SS + 30 min (spätestens 2000 LT)<br />
Winter:<br />
täglich 0900 LT bis SS + 30 min (spätestens 1900 LT)<br />
andere Zeiten: 2 h PPR<br />
Der Tower des Flugplatzes befindet<br />
sich nördlich der Start- und<br />
Landebahn im Nordosten des<br />
Flugplatzgeländes. Die Beobachtungshöhe<br />
über Grund beträgt<br />
8 m.<br />
Der Tower ist in nachfolgendem<br />
Foto dargestellt.<br />
Abbildung 3: Foto des Towers<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die Sonnenstandsdaten für den Vorhabensstandort sind dem nachfolgenden Diagramm in<br />
Abbildung 4 zu entnehmen.<br />
Blatt 7
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Abbildung 4: Sonnenstands-Diagramm für den Standort (stereografische Darstellung)<br />
Blatt 8
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
3 Beschreibung der Photovoltaikanlagen<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Solar-Module sind speziell entworfen, um möglichst viel einfallende solare Energie zu absorbieren,<br />
anstatt es als reflektiertes Licht mit dem Verlust von Energie abzugeben. Die Module<br />
sind von dunkler Farbe und verfügen nach dem Stand der Technik über Antireflex-<br />
Beschichtungen /5/.<br />
Laut einer aktuellen Studie des US-PV-Modulherstellers SunPower Corporation sind Blendung<br />
und Reflexion aus PV-Anlagen erheblich niedriger als Blendung und Reflexion durch normales<br />
Glas und andere reflektierende Flächen, die sich in der Regel in der Umgebung der PV-<br />
Anlage befinden.<br />
Im geplanten Solarpark sollen zur Energiegewinnung polykristalline Module zum Einsatz<br />
kommen. Die Module werden fest installiert.<br />
Die Frontalabdeckung der Module besteht aus hochlichtdurchlässigem gehärtetem Antireflex-<br />
Glas. Das Freiflächensystem wird mit einem Untergestell aus Stahl versehen und die Unterkonstruktion<br />
wird in das Erdreich gerammt. Die Modulfixierung erfolgt ausschließlich in Aluminium.<br />
Wechselrichter wandeln den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom.<br />
Mit Rücksicht auf die Verschattung beträgt der Abstand der einzelnen Modultische zueinander<br />
4,10 m (Abstand Moduloberkante zur nächsten Reihe Modulunterkante).<br />
Die auf den Ständern installierten polykristallinen Module sind mit einem Winkel von 30° ausgerichtet.<br />
Der Abstand der Modulunterkante zur Oberfläche Gelände beträgt in etwa 0,80 m.<br />
Der Abstand der Oberkante des Moduls zur Oberfläche Gelände beträgt ca. 1,82 m.<br />
Abbildung 5: Schnitt durch die Photovoltaikmodule (polykristallinen Module)<br />
Blatt 9
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die Modultischreihen ruhen auf Standpfählen, die in einem Abstand von 2,00 m in den Erdboden<br />
gerammt sind. Jeweils mehrere Modulreihen sind zu Modulfeldern zusammengefasst.<br />
Zwischen den Modultischfeldern sind Abstände von 3 bis 6 m als Fahrtrasse für Wartungsfahrzeuge<br />
vorgesehen.<br />
Die Modultische werden in Ost-West Richtung aufgestellt, so dass die Solarmodule genau<br />
nach Süden ausgerichtet sind.<br />
Physikalische/optische Parameter<br />
Grundsätzlich bestehen Photovoltaikmodule aus miteinander verschalteten mono- oder poly-<br />
kristallinen Solarzellen (bzw. einer homogenen Dünnschicht).<br />
Die PV-Module sind in der Regel durch eine entspiegelte und bruchfeste Glasscheibe vor<br />
Umwelteinflüssen geschützt, die notwendige Verwindungsteifigkeit verleiht in der Regel ein<br />
hochwertiger Aluminium-Rahmen.<br />
Je nach Kristallart unterscheidet man drei Zelltypen: monokristalline, polykristalline und amorphe<br />
Zellen.<br />
Zur Herstellung von monokristallinen Siliziumzellen wird hochreines Halbleitermaterial benötigt.<br />
Aus einer Siliziumschmelze werden monokristalline Stäbe gezogen und anschließend in<br />
dünne Scheiben gesägt. Dieses Herstellungsverfahren garantiert relativ hohe Wirkungsgrade.<br />
Kostengünstiger ist die Herstellung von polykristallinen Zellen. Dabei wird flüssiges Silizium in<br />
Blöcke gegossen, die anschließend in Scheiben gesägt werden. Bei der Erstarrung des Materials<br />
bilden sich unterschiedlich große Kristallstrukturen aus, an deren Grenzen Defekte auftreten.<br />
Diese Kristalldefekte haben einen geringeren Wirkungsgrad der Solarzelle zur Folge.<br />
Wird auf Glas oder anderes Substratmaterial eine Siliziumschicht abgeschieden, spricht man<br />
von amorphen- oder Dünnschichtzellen. Die Schichtdicken betragen weniger als 1 µm, so<br />
dass die Produktionskosten allein wegen der geringeren Materialkosten niedriger sind. Die<br />
Wirkungsgrade amorpher Zellen liegen allerdings noch weit unter denen der anderen beiden<br />
Zelltypen. Anwendung finden sie vor allem im Kleinleistungsbereich (Uhren, Taschenrechner)<br />
oder als Fassadenelemente.<br />
In der Anlage am Flugplatz Finow kommen ausschließlich polykristalline Module zum Einsatz.<br />
Solar-Module besitzen eine hohe Absorption. Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt den Anteil<br />
reflektierter Strahlungsenergie einiger gebräuchlicher Fassadenbaustoffe und Wasser.<br />
Die Reflexion von Solarmodulen hängt sehr stark vom Einfallswinkel der solaren Einstrahlung<br />
ab. In nachfolgender Abbildung 6 ist die Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel<br />
solarer Einstrahlung dargestellt.<br />
Anzumerken ist, dass der Anteil reflektierter Energie von Solarglas weit<br />
unter dem des herkömmlichen Fensterglases ist und vergleichbar mit der Reflexion von glatten<br />
Wasseroberflächen.<br />
Blatt 10
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Abbildung 6: Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel<br />
solarer Einstrahlung /5/<br />
Solarmodule weisen bei flachen Einfallswinkeln sehr geringe Reflexionsanteile des einfallenden<br />
Lichtes auf.<br />
Der Anteil der Reflexion aller in Abbildung 6 dargestellten Oberflächen nimmt zwischen 20 und<br />
30 Grad Abweichung vom senkrechten Einfall deutlich zu. Dieser Anstieg ist für Solarglas jedoch<br />
deutlich geringer als für die weiteren in Abbildung 6 dargestellten Oberflächen.<br />
Die US-Dünnschicht-PV-Modulhersteller First Solar Hit zieht in Hinblick auf die Reflexionen<br />
von Solarglas und die damit verbundene potentielle Gefahr für den Flugverkehr den Schluss,<br />
dass "PV-Module in der Nähe von Flughäfen derzeit keine größere Gefährdung durch reflektiertes<br />
Sonnenlicht darstellen als mit Kraftfahrzeugen belegte Parkplätze“ /5/.<br />
Spiegelungen auf glatten Flächen können sich im Allgemeinen ergeben, wenn der Brechungsindex<br />
von dem der Luft abweicht. Die Intensität der Reflexion hängt ab vom Winkel zwischen<br />
Sonne und dem Solarmodul sowie dem Brechungsindex der Platte.<br />
Der Brechungsindex von Luft ist 1, von unbehandelten Kalk-Natron-Glas ~ 1,5. Bei senkrechtem<br />
Lichteinfall spiegeln handelsübliche Solarmodule etwa 4 % des einfallenden Lichts nach<br />
der sog. Fresnel-Gleichung. Im Unterschied dazu reflektieren Autoscheiben mehrfach zwischen<br />
beiden Glasoberflächen. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung des reflektierten Anteils<br />
auf ca. 8 % (bei senkrechtem Lichteinfall) /5/.<br />
Blatt 11
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nasse PV-Oberflächen deutlich veränderte Reflexionseigenschaften<br />
aufweisen. Allerdings führt die Neigung der Oberfläche der Module zu einem<br />
raschen Ablaufen des Wassers, so dass nach einem Regenereignis keine erhebliche Beeinträchtigung<br />
zu erwarten ist.<br />
Die Entwicklung bei Solarmodulen zielte in der Vergangenheit unter anderem auf eine weitestgehende<br />
Minimierung der Strahlungsverluste durch Reflexionen ab. Hierzu sind Solarmodule<br />
nach dem Stand der Technik mit Antireflexausrüstungen durch Oberflächenstrukturierungen<br />
(mikrotexturierte Oberflächen) und weitere Entspiegelungstechniken<br />
ausgestattet.<br />
Die Reflexionen werden dabei weitestgehend minimiert. Diese Konstruktion führt zu einer erheblichen<br />
Aufweitung des reflektierten Strahls. Fokussierte, gebündelte Blendstrahlen können<br />
hierdurch nicht entstehen, es kommt allenfalls zu einem flächenhaften Lichteindruck, ähnlich<br />
Gewässerflächen.<br />
Bei Verschmutzungen der Anlagen entstehen vermehrt diffuse Rückstreuungen, die zu einer<br />
Reduzierung des Wirkungsgrades führen.<br />
Blatt 12
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
4 Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die Beurteilung der Blendwirkung basiert auf einer technischen Beschreibung der geplanten<br />
Photovoltaik-Anlage in Bezug auf die Lichtreflektion (siehe Abschnitt 3). Darüber hinaus werden<br />
die Lageverhältnisse und die Flugbahnen-Geometrien einer Analyse unterzogen. Die Ermittlung<br />
der Reflexionen erfolgt mit einem geometrischen Modell zur Ermittlung der Zeitabschnitte,<br />
in denen mit einer Lichtreflexion in die Kanzel des Kontrollturms zu rechnen ist.<br />
Über eine Abschätzung der Strahlungsintensität des reflektierten Sonnenlichtes werden die<br />
betreffenden Zeiträume, in denen Reflexionen zu erwarten sind, in Hinblick auf eine Gefährdung<br />
des Flugbetriebes bewertet.<br />
4.1 Allgemeines zu Licht und Blendung<br />
Licht stellt den Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums dar, in dem wir sehen.<br />
Nach /1/ setzt Blendung voraus, dass Photonen die Sehzellen in der Netzhaut erreichen. Dies<br />
ist nur möglich, wenn die Augenmedien für die entsprechende Strahlung durchlässig sind und<br />
außerdem eine Umwandlung empfangener optischer Strahlungsenergie in elektrische Impulse<br />
auf biochemischem Wege erfolgt. Das menschliche Auge ist im Wellenlängenbereich von etwa<br />
380 nm bis 1 400 nm mehr oder weniger transparent. Dabei „sehen“ wir aber nur solche Photonen,<br />
die aus dem Bereich von etwa 380 nm bis 780 nm stammen. Dieser Bereich wird oft<br />
auch als Licht oder sichtbare Strahlung bezeichnet.<br />
Optische Strahlung mit Wellenlängen unterhalb von 300 nm wird durch die Hornhaut zurückgehalten,<br />
während die Augenlinse Strahlung im Bereich von 300 nm bis 400 nm weitgehend<br />
blockiert.<br />
Das menschliche Auge verfügt über die Fähigkeit der Adaptation, d. h. sich an die momentane<br />
Umgebung im Hinblick auf die Beleuchtungsverhältnisse anzupassen. Die Adaptationsfähigkeit<br />
äußert sich dabei sowohl in der Anpassung an steigende als auch an sinkende Lichtintensität.<br />
Wenn von Blendung gesprochen wird, dann handelt es sich meist um eine Situation, bei der<br />
die Augen plötzlich einer deutlich größeren Lichtmenge ausgesetzt werden, sodass sie dies in<br />
der momentanen Adaptation nicht mehr ausreichend ausgleichen können.<br />
Die Sehaufgaben werden insbesondere dadurch erfüllt, dass die Sehobjekte Unterschiede in<br />
der Leuchtdichte, in den Kontrasten und Farben aufweisen. Dabei spielt die jeweilige momentane<br />
Anpassung der Augen eine wichtige Rolle und ergibt sich vorwiegend aus der Umgebungsleuchtdichte<br />
ergibt.<br />
Blendung stellt einen Sehzustand dar, der entweder aufgrund zu großer absoluter Leuchtdichte,<br />
zu großer Leuchtdichteunterschiede oder aufgrund einer ungünstigen Leuchtdichteverteilung<br />
im Gesichtsfeld als unangenehm empfunden wird oder zu einer Herabsetzung der Sehleistung<br />
führt.<br />
Blatt 13
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Zusätzlich sind die scheinbare Größe der Blendlichtquelle bzw. deren Raumwinkel von Bedeutung<br />
sowie der Projektionsort der jeweiligen Blendlichtquelle auf der Netzhaut, also der Winkel<br />
zwischen Blendlichtquelle und Blickrichtung. Die Augen wenden sich häufig unwillkürlich direkt<br />
zur Blendlichtquelle hin, wenn eine solche seitlich auf die Netzhaut abgebildet wurde, wo sich<br />
die besonders blendungsempfindlichen Stäbchen befinden.<br />
Begrifflich wird Blendung auf verschiedene Weise beschrieben, dabei werden die Begriffspaare<br />
Simultan- und Sukzessivblendung, Direkt- und Indirektblendung, Infeld- und Umfeldblendung<br />
sowie Adaptations- und Absolutblendung unterschieden.<br />
Adaptationsblendung wird nach /1/ als vorübergehende Blendung durch Leuchtdichten, an<br />
die Adaptation möglich ist, definiert. Somit kann jede über ein gewisses Maß hinausgehende<br />
Störung des örtlichen oder zeitlichen Adaptationszustandes der Augen als Adaptationsblendung<br />
bezeichnet werden. Die Adaptationsblendung ist eher ein Adaptationsproblem der Augen<br />
als ein Blendereignis. Beispiele für diese Art der Blendung sind das Heraustreten aus einem<br />
relativ dunklen Raum in das Sonnenlicht im Freien oder das Herausfahren aus einem wenig<br />
beleuchteten Tunnel in das Tageslicht.<br />
Zur Relativblendung kommt es nach /1/, wenn auf der Netzhaut durch zu große Leuchtdichteunterschiede<br />
im Gesichtsfeld eine lokale Störung des Adaptationszustandes auftritt, die im<br />
betroffenen Gebiet zu Veränderungen sowohl der Unterschiedsempfindlichkeit, der Sehschärfe<br />
als auch des Farbensehens führt. Durch Lokaladaptation, bei der nur ein Teil der Fotorezeptoren<br />
der Netzhaut beteiligt ist, kann die Relativblendung erst nach einer relativ langen Zeit<br />
ausgeglichen werden. Bei der Relativblendung kann es außer zu einer Ablenkung der Aufmerksamkeit<br />
von eigentlichen Sehaufgaben zu einer Verzögerung bzw. Behinderung des<br />
Sehvermögens kommen. Zum anderen werden die Seheigenschaften durch die adaptive Einstellung<br />
auf ein zu hohes und damit ungünstiges Leuchtdichteniveau nachteilig beeinflusst.<br />
Zur Absolutblendung kommt es, wenn im Gesichtsfeld so hohe Leuchtdichten auftreten,<br />
dass eine Adaptation des Auges nicht mehr möglich ist. Erfolgt die Blendung durch so hohe<br />
Leuchtdichten, dass keine Adaptation möglich ist, setzen Schutzreaktionen ein, wie das Zukneifen<br />
der Augenlider, Kopfbewegungen, und es kann eventuell Tränenfluss einsetzen.<br />
Die örtliche Ausdehnung der Absolutblendung kann von einzelnen Bereichen des Gesichtsfeldes,<br />
also einer lokalen Blendung, bis hin zur Blendung im gesamten Gesichtsfeld reichen.<br />
Zu einer Absolutblendung kann es z. B. beim Blick auf von der Sonne beschienene Schnee-<br />
und Wasserflächen und manchmal auch bei besonders heller Tagesbeleuchtung kommen.<br />
Beim Auftreten hoher bis sehr hoher Leuchtdichten kommt es im Allgemeinen zu Schutzreflexen,<br />
wie dem unwillkürlichen Schließen der Augenlider oder Kopfbewegungen.<br />
Für die Risikobeurteilung ist auch die Zeitdauer von besonderem Interesse, während der die<br />
Sehleistung nach einer Blendung eingeschränkt ist, auch wenn diese nur durch einen kurzzeitigen<br />
Lichtreiz aufgetreten ist, weil während dieser Zeit Objekte übersehen werden können,<br />
deren Helligkeit sich nicht ausreichend von der durch Blendung bzw. Adaptationsstörung veränderten<br />
Wahrnehmbarkeitsschwelle abhebt. Infolgedessen können Sehobjekte, deren Kontrast<br />
nicht ausreichend von der Schwelle entfernt liegt, kurzzeitig unsichtbar bleiben.<br />
Blatt 14
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Im Zusammenhang mit Blendung sind noch weitere Begriffe üblich, und zwar direkte und indirekte<br />
Blendung sowie Infeld- und Umfeldblendung.<br />
Diese Begriffe sind mit der Blendquelle, deren Lage im Gesichtsfeld und dem zeitlichen Geschehen<br />
bei der Blendung verknüpft.<br />
Eine Direktblendung liegt dann vor, wenn eine Blendung unmittelbar (direkt) durch die leuchtende<br />
Fläche einer Lichtquelle selbst hervorgerufen wird, d. h. wenn die Blendlichtquelle direkt<br />
im Gesichtsfeld liegt, während die Indirektblendung ihre Ursache im Reflexionsbild der blendenden<br />
Lichtquelle an spiegelnden Oberflächen hat, also die Blendung mittelbar (indirekt) erfolgt.<br />
In diesem Fall können Objekte auch ohne eigentliche Blendung bereits durch Herabsetzung<br />
des Leuchtdichteunterschiedes bei der Überlagerung mit dem Reflexbild unsichtbar werden.<br />
Man spricht daher auch von Reflexblendung, da es sich um Spiegelung, d. h. einen Reflex<br />
hoher Leuchtdichten meist durch glänzende Oberflächen handelt.<br />
Liegt die blendende Lichtquelle in der eigenen Blickrichtung bzw. in deren Nähe (Infeld, d. h.<br />
im zentralen Bereich des Gesichtsfeldes), wird die Blendung Infeldblendung genannt, während<br />
bei deren Lage in der Peripherie (Umfeld) des Gesichtsfeldes diese als Umfeldblendung bezeichnet<br />
wird.<br />
4.2 Methodik und Modellbeschreibung<br />
Die Entwicklung bei Solarmodulen zielte in der Vergangenheit unter anderem auch auf eine<br />
weitestgehende Minimierung der Strahlungsverluste durch Reflexionen ab. Hierzu sind Solarmodule<br />
mit Antireflexausrüstungen durch Oberflächenstrukturierungen (mikrotexturierte Oberflächen)<br />
und weitere Entspiegelungstechniken ausgestattet. Die Reflexionen werden dabei<br />
weitestgehend minimiert.<br />
In konservativer Herangehensweise werden unter Vernachlässigung dieser Eigenschaften der<br />
Solarmodule die physikalisch für eine vollspiegelnde Fläche möglichen Reflexionen auf Basis<br />
eines Simulationsmodelles ermittelt.<br />
Hierdurch können Vorgaben abgeleitet werden, in welchen Modulfeldern besonderes Augenmerk<br />
auf die Entspiegelung nach dem Stand der Technik gelegt werden muss.<br />
Die Ermittlung der Zeitabschnitte, in denen Lichtreflexionen durch die Photovoltaikmodule entstehen<br />
können, erfolgte mit Hilfe eines geometrischen Modells.<br />
Dabei wurde dar Solarpark in mehrere Modulfelder (A, B1-B6, C1-C2 und D in Abb. 6) untergliedert,<br />
die jeweils getrennt und für mehrere Nachweisorte (Queranflug, Endanflug West und<br />
Ost und Tower, markiert als in Abbildung 7) in Hinblick auf Häufigkeit und Lage der<br />
Lichtreflexionen untersucht wurden.<br />
Die Modulfelder sind in nachfolgender Abbildung 7 dargestellt. Für die Spiegelneigung gegen<br />
den Horizont wurde von 30° ausgegangen, für die horizontale Ausrichtung gegen Nord von<br />
180° (Süd). Als Spiegelhöhe wurden 2 m über Grund angesetzt.<br />
Blatt 15
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die Modulfelder wurden zur geometrischen Vereinfachung als Rechtecke abgegrenzt. Daher<br />
stimmen die gebildeten Modulfelder teilweise nicht flächendeckend mit den tatsächlichen<br />
Grenzen des Solarparks überein.<br />
Die Koordinaten der Beobachtungspunkte sowie Beobachtungshöhe und Sichtfeldbegrenzungen<br />
sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.<br />
Tabelle 1: Beobachtungspunkte der Modelluntersuchungen<br />
Name Hochwert Rechtswert Höhe BlickfeldBlinkfeldgrenze links grenze<br />
m<br />
m m ü. G.<br />
rechts<br />
°gg Nord °gg Nord<br />
Tower 5853887 3413098 8 71 311<br />
Endanflug 10 1000 m vor<br />
Schwelle<br />
5854073 3410826 70 71 131<br />
Anflug 1 in Platzrunde ca.<br />
2000 m vor Schwelle<br />
5853922 3409777 120 311 71<br />
Endanflug 28, 500 m vor<br />
Schwelle<br />
5853514 3413711 25 251 311<br />
Die Prüfung erfolgt im 15 Minuten Takt für den Sonnenverlauf für die Stichtage<br />
21. Dezember,<br />
13. Januar,<br />
05. Februar,<br />
28. Februar,<br />
21. März,<br />
14. April,<br />
07. Mai,<br />
30. Mai und<br />
21. Juni.<br />
Blatt 16
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
A<br />
B1<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
A, B1-B6, C1-C2 und D: Modulfelder des Solarparks für die modelltechnische Untersuchung<br />
: Nachweisorte mit Blickrichtung und Öffnungswinkel<br />
Abbildung 7: Modulfelder des Solarparks zur Modellierung der<br />
Reflexionszeitverläufe<br />
4.3 Beurteilungskriterien<br />
B2<br />
B3<br />
B5<br />
Verbindliche Erhebungs- und Beurteilungskriterien für die Bewertung der Lichtreflexionen, insbesondere<br />
die Blendwirkung an Flughäfen bestehen derzeit nicht. So verweist die Planungshilfe<br />
der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA /9/ auf das Erfordernis von Einzelfalluntersuchungen<br />
für den Aufstellungsort und das geplante Photovoltaiksystem und gibt keine konkreten<br />
Beurteilungskriterien an.<br />
Als geeignete Untersuchungsmethode wird eine geometrische Analyse des Strahlengangs des<br />
reflektierten Sonnenlichts in Abhängigkeit des Sonnenstands am Tag und im Jahresgang benannt.<br />
Dabei soll insbesondere eine mögliche Blendwirkung in Bezug auf das Personal der<br />
Flugsicherung auf dem Kontrollturm untersucht werden.<br />
C1<br />
B6<br />
C2<br />
B4<br />
D<br />
F<br />
E<br />
Blatt 17
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die Blendwirkung in Bezug auf Piloten wird demgegenüber weniger kritisch eingeschätzt, da<br />
ein Lichtreflex einen Pilot bei seiner Flugbewegung in der Regel nur sehr kurz betreffen und<br />
demzufolge in seiner Orientierung nur sehr kurze Zeit beeinträchtigen kann.<br />
Die Blendwirkung von reflektiertem Licht ist im Vergleich zu natürlicher unreflektierter Sonneneinstrahlung<br />
und dem Sichtfeld von Betroffenen zu bewerten. Dementsprechend geht die Untersuchung<br />
einer möglichen Blendwirkung vor allem auf den Kontrollturm ein und behandelt<br />
die Flugbewegungsbahnen nur soweit erforderlich<br />
In /5/ wurden die Untersuchungsergebnisse zu Blendwirkungen auf die Flugsicherheit an einer<br />
großen US-amerikanischen PV-Anlage auf dem Gelände des US Militärflughafens in Nellis<br />
(Nevada), wo sich die Solarmodule südlich von in Betrieb befindlichen Start-/Landebahnen befindet,<br />
dargestellt. Die Studie beinhaltete experimentelle Untersuchungen zu Blendungen<br />
durch flache Solarmodule.<br />
Die Studie beinhaltet ein worst-case-Szenario für direkt in die Augen des Piloten reflektierte<br />
solare Strahlung und Blendungs-Berechnungen. In Vergleichsbetrachtungen wurden Blendungswirkungen<br />
der vorgesehenen Module mit den Wirkungen anderer im Umfeld von Flughäfen<br />
üblicher Oberflächen durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass unter worst-case-Bedingungen bei direktem solarem<br />
Reflexionseinfall in die Augen des Piloten ein leichtes Potenzial für eine sogenannte Flash-<br />
Blendung besteht. Diese Flash-Blendung ist vergleichbar mit dem Potenzial für Flash-<br />
Blendungen durch Wasser und geringer als das Potenzial für verwitterten, weißen Beton und<br />
Schnee.<br />
In solchen worst-case-Situationen ist zu erwarten, dass die Piloten typischerweise bereits vor<br />
dem Anflug Blendschutz und Sonnenbrille verwenden. Hierdurch würde die Strahlung um etwa<br />
80 % reduziert und erhebliche Auswirkungen sind dann gänzlich auszuschließen /5/.<br />
4.4 Blendwirkung für Flugsicherungspersonal im Kontrollturm<br />
Für die Prüfung der Blendwirkung für das Flugsicherungspersonal im Kontrollturm wurde von<br />
einer Tower–Sichtfeldhöhe von 8 m ausgegangen.<br />
Des Weiteren wurde für das Sichtfeld des Towerpersonals eine Blickrichtung senkrecht zur<br />
Bahn in 191° + 120° also 71° - 311° geprüft.<br />
Die Prüfung erfolgt im 15 Minuten Takt für den Sonnenverlauf für die Stichtage 21. Dezember,<br />
13. Januar, 05. Februar, 28. Februar, 21. März, 14. April, 07. Mai, 30. Mai und 21. Juni.<br />
Die sich aus diesen Vorgaben ergebenden aufsummierten Reflexionsbeziehungen für die<br />
Stichtage sind in der Abbildung 8 dargestellt.<br />
Wie die Ergebnisse zeigen sind Lichtreflexionen von vollspiegelnden Flächen insbesondere<br />
aus den nördlichen Modulfeldern nur kurz vor Sonnenuntergang zu erwarten.<br />
Die zeitliche Verteilung der Reflexionen geht aus der nachfolgenden Abbildung 8 hervor.<br />
Blatt 18
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Abbildung 8: Zeitverlauf der Reflexionen für die Gesamtanlage vom<br />
Beobachtungspunkt Tower<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Lediglich in den Winter- und Frühjahrsmonaten Februar bis Mai sind Lichtreflexe aus dem Solarpark<br />
am Tower im Zeitfenster vor 18 Uhr und dabei lediglich ab 17:30 Uhr möglich.<br />
Die Reflexionen resultieren dabei aus sehr tiefen abendlichen Sonnenständen.<br />
Darüber hinaus wurden bei der modelltechnischen Ermittlung der Reflexionen die Auswirkungen<br />
des Waldes westlich der Autobahn BAB A11 nicht berücksichtigt. Der bestehende Wald<br />
führt zu einer Horizontüberhöhung, die dazu führt, dass die spätabendlichen Reflexionen bei<br />
sehr niedrigem Sonnenstand in den Winter- und Frühjahrsmonaten insbesondere der westlichen<br />
Modulfeldern des Solarparks deutlich seltener auftreten, als sie auf Basis des völlig ebenen<br />
Modellgebiets prognostisch ausgewiesen wurden.<br />
Im Sommer sind Reflexionen einer vollspiegelnden Fläche erst nach 18:00 Uhr zu erwarten.<br />
Dabei sind die Einfallswinkel der solaren Strahlung sehr flach, die damit verbundenen Lichtintensitäten<br />
sehr gering.<br />
Blatt 19
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Tower Finow GmbH – Erweiterung des Solarparks - Analyse der Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Szenario: Viewpoint Tower Flughafen – Räumliche Verteilung der Reflexionsereignisse an den 9 Stichtagen (15 Minuten-Taktung)<br />
Anzahl der Reflexionsereignisse<br />
je Modul<br />
an den 9 Stichtagen<br />
(15 Minuten-Taktung)<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
1<br />
Blatt 20
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Grundsätzlich ist bei den ausgewiesenen Reflexionen für das Towerpersonal sowohl für<br />
den gesamten Tag als auch für die Betriebszeiten zu beachten, dass die Reflexionen<br />
stets aus nahezu der gleichen Richtung kommen wie die solare Direkteinstrahlung. Daher<br />
blickt der Beobachter bereits in die tief stehende Sonne, die zusätzlichen peripheren<br />
Störwirkung durch die flachwinkligen Reflexionen sind allenfalls als sehr gering zu<br />
bewerten.<br />
Die Lichtintensität der tiefstehenden Sonne ist stark vermindert. Erhebliche Auswirkungen<br />
auf die Sehleistung des Towerpersonals und damit auf die Flugsicherheit sind<br />
daher nicht zu erwarten.<br />
4.5 Blendwirkung für Flugzeugführer<br />
In Hinblick auf die Blendwirkungen für Flugzeugführer sind die unterschiedlichen tageszeitlichen<br />
Auswirkungen auf Start und Landung, jeweils nach bzw. aus Westen und Osten sowie<br />
den Queranflug aus der Platzrunde zu differenzieren.<br />
4.5.1 Start nach Westen (Start 10) und nach Osten (Start 28)<br />
Beim Start nach Westen ergeben sich aufgrund der Geometrien (Lagebeziehung Cockpit –<br />
Reflexionshöhen Photovoltaikmodule) keine erheblichen Reflexionen.<br />
Die Module sind gegenüber den Sichtfeldern der Beobachtungspunkten Start-Anrollpunkte 10<br />
und 28 um 30° geneigt und die Module sind zudem aufgeständert. Erhebliche Reflexionen an<br />
diesen bodennahen Beobachtungspunkten sind nicht zu erwarten.<br />
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Reflexionen in Richtung der Start-Anrollpunkte lediglich<br />
bei Starts gegen die tief stehende Sonne zu erwarten sind. Die Sehleistung ist bei diesen<br />
Starts bereits adaptiert.<br />
Die zusätzlichen Lichtreflexe von geringer Lichtintensität im peripheren rechten (nördlichen)<br />
Sehfeld führen daher nicht zu erheblichen Irritationen. Selbst in höheren Cockpitlagen an den<br />
Start-Anrollpunkten, deren Sichtfeld die Reflexionen umfasst, ist - ungeachtet der Frage, ob<br />
derartige Flugzeuge überhaupt am Flughafen eingesetzt werden - daher bei Start nicht von einer<br />
Beeinträchtigung durch die Reflexionen auszugehen. In der anschließenden Steigphase<br />
ist der Blick des Piloten nicht auf den Boden gerichtet.<br />
4.5.2 Anflug/Landung aus Osten (Landung 28)<br />
Bei Anflügen aus Osten (Landung 28) können sich Blendungsereignisse erst am späten<br />
Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang ergeben. Die Mehrzahl der zu erwartenden Lichtreflexe<br />
wird in den Zeiten nach 18 Uhr bei tief stehender Sonne verzeichnet.<br />
Die zeitliche Verteilung der Reflexionen geht aus der nachfolgenden Abbildung 11 hervor.<br />
Blatt 21
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Abbildung 10: Zeitverlauf der Reflexionen für die Gesamtanlage vom Beobachtungspunkt<br />
Endanflug Ost (Landung 28)<br />
Der Anflug aus Osten erfolgt in den betreffenden Zeiten bereits gegen die tief stehende blendende<br />
Sonne. Die Sehleistung ist bei diesen Anflügen bereits adaptiert. Die zusätzlichen Lichtreflexe<br />
von geringer Lichtintensität im peripheren rechten (nördlichen) Sehfeld führen daher<br />
nicht zu erheblichen Irritationen. Es ist daher nicht von einer Beeinträchtigung durch die Reflexionen<br />
auszugehen.<br />
Darüber hinaus wird beim Anflug aus Osten der Solarpark nicht überflogen. Die Reflexionen<br />
sind daher nur von entfernt liegenden Modulfeldern zu erwarten, die sich zum Teil selbst verschatten.<br />
Blatt 22
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Tower Finow GmbH – Erweiterung des Solarparks - Analyse der Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Szenario: Viewpoint Endanflug OST 500 m vor Schwelle – Anzahl der Reflexionsereignisse je Modul an den 9 Stichtagen (15 Minuten-<br />
Taktung)<br />
Anzahl der Reflexionsereignisse<br />
je Modul an den 9<br />
Stichtagen<br />
(15 Minute- Taktung)<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
1<br />
Blatt 23
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
4.5.3 Anflug/Landung aus Westen (Landung 10)<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Beim Anflug aus Westen ergeben sich Reflexionen lediglich in den Morgenstunden ab<br />
05:15 Uhr bis 06:30 Uhr in den Frühsommer- und Sommermonaten bzw. ab 07:15 bis<br />
09:15 Uhr in den Wintermonaten.<br />
Die im Sichtfeld des Anflug-Beobachtungspunktes liegenden Module befinden sich dabei bei<br />
einem Großteil der Modulfelder des Solarparks in seitlicher bis rückwärtiger Ansicht. Reflexionen<br />
sind von diesen Modulen nicht zu erwarten.<br />
Die zeitliche Verteilung der Reflexionen geht aus der nachfolgenden Abbildung 12 hervor.<br />
Abbildung 12: Zeitverlauf der Reflexionen für die Gesamtanlage vom<br />
Beobachtungspunkt Endanflug West (Landung 10)<br />
Wahrnehmbare Reflexionen entstammen im Wesentlichen von nördlich der Anfluggrundlinie<br />
liegenden Modulen (Modulfelder B1 und B2 sowie C2).<br />
Der Anflug aus Westen erfolgt in den betreffenden Zeiten bereits gegen die tief stehende<br />
blendende Sonne. Die Sehleistung ist bei diesen Anflügen bereits adaptiert. Die zusätzlichen<br />
Lichtreflexe von geringer Lichtintensität im peripheren rechten (nördlichen) Sehfeld führen daher<br />
nicht zu erheblichen Irritationen. Es ist daher nicht von einer Beeinträchtigung durch die<br />
Reflexionen auszugehen.<br />
Blatt 24
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Tower Finow GmbH – Erweiterung des Solarparks - Analyse der Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Szenario: Viewpoint Endanflug West 1000 m vor Schwelle – Anzahl der Reflexionsereignisse je Modul an den 9 Stichtagen (15 Minuten-<br />
Taktung)<br />
Anzahl der Reflexionsereignisse<br />
je Modul an den 9<br />
Stichtagen<br />
(15 Minuten-Taktung)<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
1<br />
Blatt 25
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Die Betriebszeiten des Flughafens sind:<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Sommer: Montag bis Freitag: 0800 LT bis SS + 30 min (spätestens 2000 LT)<br />
Samstag, Sonntag, Feiertage: 0900 LT bis SS + 30 min (spätestens 2000 LT)<br />
Winter: täglich 0900 LT bis SS + 30 min (spätestens 1900 LT)<br />
Der zeitliche Betriebsschwerpunkt liegt jedoch in den Betriebszeiten des Flughafens. Daher<br />
wurde ergänzend zu den Untersuchungen für den Gesamtzeitraum auch eine Bewertung der<br />
Auswirkungen auf die ausgewiesenen Betriebszeiten durchgeführt.<br />
Die Abbildung 14 verdeutlicht, dass innerhalb der Betriebszeiten des Flughafens keine Reflexionen<br />
zu erwarten sind.<br />
4.5.4 Queranflug aus der Platzrunde (Landung 28)<br />
Die Reflexionen während des Queranfluges sind aus allen betrachteten Szenarien die einzigen,<br />
in denen der Beobachter im Anflug nicht bereits in die tief stehende Sonne blickt. Daher<br />
ist in diesen Zeiten das Auge an Lichtreflexe nur schlecht adaptiert.<br />
Beim Queranflug aus der Platzrunde ergeben sich Reflexionen jedoch lediglich in den frühen<br />
Morgenstunden ab 05:30 Uhr bis 06:15 Uhr und am Rande des Sichtfeldes.<br />
Innerhalb der Betriebszeiten des Flughafens sind beim Queranflug nahezu keine Reflexionen<br />
zu erwarten.<br />
Die zeitliche Verteilung der Reflexionen geht aus der nachfolgenden Abbildung 14 hervor.<br />
Abbildung 14: Zeitverlauf der Reflexionen für die Gesamtanlage vom<br />
Beobachtungspunkt Queranflug West (Landung 10)<br />
Blatt 26
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Tower Finow GmbH – Erweiterung des Solarparks - Analyse der Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Szenario: Viewpoint Queranflug Platzrunde 2000 m vor Schwelle – Anzahl der Reflexionsereignisse je Modul an den 9 Stichtagen (15 Minuten-<br />
Taktung)<br />
Anzahl der Reflexionsereignisse<br />
je Modul an den 9<br />
Stichtagen<br />
(15 Minuten Taktung)<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
1<br />
Blatt 27
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
5 Thermische Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Vertikal bewegte Luft kühlt sich beim Aufsteigen ab und erwärmt sich beim Absinken durch<br />
Druckänderung adiabatisch. Aus diesem Grunde ist die Troposphäre durch eine nach oben<br />
abnehmende Temperatur gekennzeichnet: Besonders an Tagen mit starker vertikaler Durchmischung<br />
ist die vertikale Temperaturabnahme gleich derjenigen von vertikal bewegter Luft.<br />
Diese vertikale Temperaturabnahme heißt daher neutrale Temperaturabnahme oder neutrale<br />
Schichtung.<br />
Ist die Temperaturabnahme mit der Höhe geringer als neutral, ist die Schichtung stabil. Aufsteigende<br />
Luft kühlt stärker ab als die Umgebung, ihre Dichte ist dann größer als in der Umgebung<br />
und die Luft wird daher wieder absinken. Umgekehrtes gilt für absinkende Luft. I. A. ist<br />
die Luft in der Troposphäre leicht stabil geschichtet. Besonders an ruhigen Tagen bilden sich<br />
nachts auch Inversionen mit nach oben zunehmender Temperatur also sehr stabil geschichtet.<br />
Ist die Temperaturabnahme mit der Höhe stärker als neutral, heißt die Schichtung labil. Eine<br />
labile Temperaturschichtung ist Voraussetzung für die Ausbildung der Thermik ist der Luft. Ein<br />
infolge Überhitzung am Boden aufsteigendes Luftpaket ist in jeder Höhe wärmer und leichter<br />
(geringere Dichte) als die Umgebungsluft, so dass es ständig weiter zu steigen bestrebt ist.<br />
Diese Bewegung heißt Konvektion. Durch die Abkühlung des aufsteigenden Astes kann es zu<br />
Kondensation und Wolkenbildung kommen. Die Kondensation setzt latente Wärme frei, wodurch<br />
die Konvektion verstärkt wird. Die Wolken über dem Thermikschlauch oder Bart sind<br />
Cumuli ("Blumenkohlwolken").<br />
Die besten Bedingungen für die Entwicklung von thermischen Aufwinden sind an Strahlungstagen<br />
um die Mittagszeit und über Gebieten, deren Oberfläche sich sehr stark erwärmt (Sand,<br />
trockene Erde, Getreidefelder, Felsen, Häuser). Die als Ausgleich erforderlichen Abwinde treten<br />
in der Nachbarschaft (Wiesen, Wälder, Gewässer) auf. Grundsätzlich ist eine klare Atmosphäre<br />
von Vorteil. Diese ist nicht in der Lage, Energie aus der Sonnenstrahlung aufzunehmen.<br />
Dagegen kann verschmutzte Luft einen Teil der Einstrahlung reflektieren und sich durch<br />
Absorption direkt erwärmen. So erreicht weniger Strahlungsenergie den Boden, und mögliche<br />
Temperaturgegensätze werden vermindert.<br />
Der Erdboden absorbiert die Sonnenstrahlung teilweise und wandelt sie in Wärme um. Der<br />
Absorptionsanteil verschiedener Oberflächen unterscheidet sich stark und hängt wesentlich<br />
von der Albedo ab. Die Albedo ist ein Maß für das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden,<br />
also nicht selbst leuchtenden Oberflächen. Sie wird bestimmt durch den Quotienten aus<br />
reflektierter zu einfallender Lichtmenge und liegt zwischen 0 und 1. Null bedeutet, dass kein<br />
Licht reflektiert wird. Eins bedeutet, dass alles Licht reflektiert wird. Die Albedo ermöglicht<br />
Aussagen, wie stark sich Luft über verschiedenen Oberflächen erwärmt.<br />
Je dunkler eine Oberfläche ist, desto größer ist der Anteil der aufgenommenen und in Wärme<br />
umwandelten Strahlung. Helle Körper dagegen reflektieren das meiste der Strahlung direkt<br />
wieder.<br />
Blatt 28
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Bei labiler Schichtung löst sich überhitzte Luft in Form großer Warmluftblasen ("Thermikblasen")<br />
von bis zu 200 bis 500 m Durchmesser vom Boden ab und steigt auf, wobei sie sich<br />
ausdehnt und abkühlt.<br />
Außer von der Helligkeit, der Neigung und der Feuchtigkeit hängt es noch vom Vegetationstyp<br />
ab, wie stark sich die bodennahe Luft erwärmen kann. Über einer asphaltierten Straße z.B.<br />
erwärmt sich eine dünne Luftschicht sehr schnell und steigt unmittelbar danach auf. Bei einem<br />
Acker mit hohem Bewuchs dagegen erwärmt sich eine mächtigere Luftschicht zwischen den<br />
Pflanzen. Hier dauert es folglich länger, bis sich Thermikblasen lösen. Diese sind dann aber<br />
auch stärker.<br />
Warmluftblasen steigen nicht immer dort auf, wo sie entstehen. Der Aufstieg einer Luftblase<br />
erfordert einen Impuls. Diesen Anstoß bekommt die Luftblase zum Beispiel, wenn sie gegen<br />
ein Hindernis treibt, an welchem sie nach oben gedrückt wird.<br />
Auslösepunkte sind Waldränder, Kornfelder, fahrende Eisenbahnen, im Gebirge Hangkanten<br />
oder Bergkämme oder auch Temperaturgegensätze. Ist die Temperaturdifferenz zwischen<br />
zwei Feldern groß genug, wirkt die kältere Luft wie ein Hindernis, auf das die Warmluft bei geringer<br />
Windbewegung angehoben wird.<br />
Nachfolgend ist in Tabelle 2 die Albedo für unterschiedliche Oberflächenmaterialien, soweit relevant,<br />
unter unterschiedlichen solaren Einstrahlungsbedingungen zusammengestellt.<br />
Die Albedo von Photovoltaikmodulen liegt im Mittel unterhalb derer von Glasfenstern (siehe<br />
hierzu auch Kapitel 3) und damit im Bereich der Werte von Asphalt, Beton, unterschiedlichen<br />
Bedachungsmaterialien, aber auch Wald und Wasser. Damit ergeben sich auch in den Tagesstunden<br />
mit hohem solarem Einstrahlungswinkel keine anderen Verhältnisse in Hinblick auf<br />
die Albedo, als bei den angeführten Materialien.<br />
Lediglich in den Tagesrandstunden bei tief stehender Sonne ergibt sich eine gegenüber der<br />
Umgebungsbebauung deutlich höhere Albedo mit den entsprechenden Auswirkungen auf die<br />
Thermik. Diese ist jedoch zeitlich und räumlich eng begrenzt und fällt in Tageszeiten mit geringer<br />
Strahlungsenergie und damit nur geringer Thermik.<br />
Blatt 29
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Tabelle 2: Kurz- und langwellige Albedo von verschiedenen Oberflächenarten /10/<br />
In Hinblick auf die damit verbundenen Oberflächentemperaturen, die als thermischer Antrieb<br />
dienen, ergeben sich für verschiedene Oberflächenarten die in nachfolgender Abbildung dargestellten<br />
Temperaturen.<br />
Die besten Bedingungen für die Entwicklung von thermischen Aufwinden sind an Strahlungstagen<br />
um die Mittagszeit und über Gebieten, deren Oberfläche sich sehr stark erwärmt (Sand,<br />
trockene Erde, Getreidefelder, Felsen, Häuser).<br />
Blatt 30
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
Abbildung 16 : Spezifische Tagesgänge der Oberflächentemperatur /12/<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
In nachfolgender Abbildung 17 ist die Erwärmung eines monokristallinen Photovoltaikmoduls<br />
an einem Sommertag dargestellt. Die Erwärmung polykristalliner Module ist mit diesem Temperaturgang<br />
vergleichbar.<br />
Abbildung 17 : Erwärmung eines Photovoltaikmoduls an einem Sommertag /11/<br />
Blatt 31
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Wie die Darstellung zeigt, weisen Photovoltaikmodule einen vergleichsweise starken Temperaturgang<br />
auf. Die aus dieser Erwärmung hervorgehenden thermischen Effekte sind annähernd<br />
mit den Effekten von Asphalt oder Beton vergleichbar. Da die Photovoltaik-Module jedoch<br />
nur einen Teil des Bodens bedecken und zwischen den Reihen und Feldern größerer<br />
Abstand besteht ist die Temperaturübertragung nur zum Teil wirksam.<br />
Zwar ist die Erwärmung der Solarmodule aus Betreibersicht nicht erwünscht, da mit steigender<br />
Modultemperatur die abgegebene Leistung deutlich zurück geht. Effektive Kühlsysteme sind<br />
jedoch technisch sehr aufwändig und daher auch am geplanten Solarpark nicht vorgesehen.<br />
Eine Kühlung führt theoretisch in Hinblick auf die thermischen Eigenschaften zu einer Annäherung<br />
an die Parameter von Gras/Wiesenflächen.<br />
Aufgrund der physikalischen Rahmenparameter, insbesondere der Albedo sowie der resultierenden<br />
Tagesgänge der Oberflächentemperatur von Photovoltaikmodule unterscheiden sich<br />
die Module nicht erheblich von anderen, im Umfeld von Flughäfen vorkommenden Oberflächenstrukturen.<br />
Daher ist zu erwarten, dass sich auch die Auswirkungen der Oberflächen auf<br />
die Thermik nicht erheblich von den thermischen Auswirkungen anderer Oberflächenstrukturen,<br />
wie z.B. Asphalt, Gras oder Beton unterscheidet.<br />
Eine erhebliche Veränderung der bestehenden meteorologischen Bedingungen in Hinblick<br />
auf fliegerisch relevante Auf- und Fallwinde ist nicht zu erwarten.<br />
Blatt 32
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
6 Zusammenfassende Bewertung<br />
6.1 Blendwirkung<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
Die geometrischen Untersuchungen zeigen auf, dass in Hinblick auf die Flugsicherheit in allen<br />
betrachteten Modulfeldern mit Ausnahme des südlichsten Modulfeld B6 eine Entspiegelung<br />
der Module nach dem Stand der Technik erforderlich ist.<br />
Aufgrund der sehr geringe Reflexionsanteile des einfallenden Lichtes an Solarmodulen, die<br />
dem Stand der Technik der Entspiegelung entsprechen (Antireflexausrüstungen durch Oberflächenstrukturierungen<br />
(mikrotexturierte Oberflächen) und weitere Entspiegelungstechniken)<br />
ist bei derartigen Modulen nur mit geringen Reflexionen zu rechnen.<br />
Bei Einsatz von Antireflextionsglas, welches für einen effektiven Wirkungsgrad der Module<br />
Voraussetzung ist, wird eine den Flugbetrieb behindernde Blendwirkung ausgeschlossen.<br />
6.2 Thermische Auswirkungen<br />
Aufgrund der physikalischen Rahmenparameter, insbesondere der Albedo sowie der resultierenden<br />
Tagesgänge der Oberflächentemperatur von Photovoltaikmodulen unterscheiden sich<br />
die Module nicht erheblich von anderen, im Umfeld von Flughäfen vorkommenden Oberflächenstrukturen.<br />
Daher ist zu erwarten, dass sich auch die Auswirkungen der Oberflächen auf<br />
die Thermik nicht erheblich von den thermischen Auswirkungen anderer Oberflächenstrukturen,<br />
wie z.B. Asphalt, Gras der Beton unterscheidet.<br />
Eine erhebliche Veränderung der bestehenden meteorologischen Bedingungen in Hinblick<br />
auf fliegerisch relevante Auf- und Fallwinde ist nicht zu erwarten.<br />
Ingenieurbüro Dr. Dröscher<br />
Dr.-Ing. Frank Dröscher<br />
Blatt 33
Tower Finow GmbH<br />
Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines<br />
Solarparks und dessen thermischer Effekte<br />
7 Quellenverzeichnis<br />
<strong>DR</strong>.-<strong>ING</strong>. <strong>FRANK</strong> <strong>DR</strong>ÖSCHER<br />
TECHNISCH ER <strong>UMWELTSCHUTZ</strong><br />
/1/ Projektbüro Dörner und Partner GmbH: Vorhabensbezogener Bebauungsplan Nr. 137:<br />
„Erweiterung Photovoltaik am Flugplatz“. Im Auftrag der SQuadrat Finow Tower Grundstücks<br />
GmbH, Brilon. Stand: Januar 2011.<br />
/2/ Federal Aviation Administration, Office of Airports: Technical Guidance for Evaluating<br />
Selected Solar Technologies on Airports. Washington, November 2010.<br />
/3/ SSK Strahlenschutzkommission: Blendung durch natürliche und neue künstliche Lichtquellen<br />
und ihre Gefahren – Empfehlungen der Strahlenschutzkommission. Bonn 2006.<br />
/4/ Baua – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, H.-D. Reidenbach, K. Dollinger,<br />
G. Ott, M. Janßen, M. Brose: Blendung durch optische Strahlungsquellen. Dortmund/Berlin/Dresden<br />
2008.<br />
/5/ Deutsche Flugsicherung (DFS): Aeronautical Information Publication - Luftfahrthandbuch<br />
AIP VFR.<br />
/6/ GL Gerrard Hassan: Caddington PV Solar Farm Review of the PV reflection studies in<br />
the public domain. December 2010.<br />
/7/ Power Engineers Inc.: SOLARGEN Energy: Panoche Valley Solar Farm Project - Glint<br />
and Glare Study. 2010.<br />
/8/ ARGE Monitoring PV-Anlagen: Leitfasen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei<br />
der Planung von PV-Freiflächenanlagen. Hannover 2007.<br />
/9/ Technical Guidance for Evaluating Selected Solar Technologies on Airports Federal Aviation<br />
Administration Office of Airports Office of Airport Planning and Programming Airport<br />
Planning and Environmental Division (APP-400) 800 Independence Avenue, SW<br />
Washington, DC 20591 November 2010.<br />
/10/ Matzarakis, Andreas: Die thermische Komponente des Stadtklimas, Habilitation. In: Berichte<br />
des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg Nr. 6. Freiburg, Juli 2006.<br />
/11/ TEC-Institut für technische Innovationen, Dipl.-Ing.(FH) Eberhard Zentgraf: Experimente<br />
mit verschiedenen Kühlungsvarianten an monokristallinen Standard-PV-Modulen.<br />
Waldaschaff, Juli 2009.<br />
/12/ FEZER F.: Lokalklimatische Interpretation von Thermalbildern. - Bildmessung und Luftbildwesen<br />
43, 152. 1975.<br />
Blatt 34