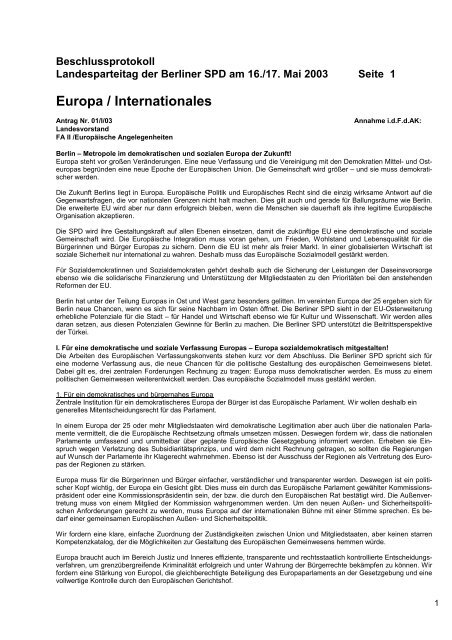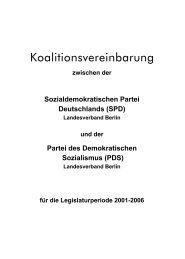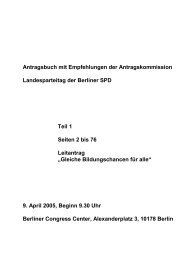Europa / Internationales - Archiv - SPD Berlin
Europa / Internationales - Archiv - SPD Berlin
Europa / Internationales - Archiv - SPD Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 1<br />
<strong>Europa</strong> / <strong>Internationales</strong><br />
Antrag Nr. 01/I/03<br />
Landesvorstand<br />
FA II /Europäische Angelegenheiten<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
<strong>Berlin</strong> – Metropole im demokratischen und sozialen <strong>Europa</strong> der Zukunft!<br />
<strong>Europa</strong> steht vor großen Veränderungen. Eine neue Verfassung und die Vereinigung mit den Demokratien Mittel- und Osteuropas<br />
begründen eine neue Epoche der Europäischen Union. Die Gemeinschaft wird größer – und sie muss demokratischer<br />
werden.<br />
Die Zukunft <strong>Berlin</strong>s liegt in <strong>Europa</strong>. Europäische Politik und Europäisches Recht sind die einzig wirksame Antwort auf die<br />
Gegenwartsfragen, die vor nationalen Grenzen nicht halt machen. Dies gilt auch und gerade für Ballungsräume wie <strong>Berlin</strong>.<br />
Die erweiterte EU wird aber nur dann erfolgreich bleiben, wenn die Menschen sie dauerhaft als ihre legitime Europäische<br />
Organisation akzeptieren.<br />
Die <strong>SPD</strong> wird ihre Gestaltungskraft auf allen Ebenen einsetzen, damit die zukünftige EU eine demokratische und soziale<br />
Gemeinschaft wird. Die Europäische Integration muss voran gehen, um Frieden, Wohlstand und Lebensqualität für die<br />
Bürgerinnen und Bürger <strong>Europa</strong>s zu sichern. Denn die EU ist mehr als freier Markt. In einer globalisierten Wirtschaft ist<br />
soziale Sicherheit nur international zu wahren. Deshalb muss das Europäische Sozialmodell gestärkt werden.<br />
Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gehört deshalb auch die Sicherung der Leistungen der Daseinsvorsorge<br />
ebenso wie die solidarische Finanzierung und Unterstützung der Mitgliedstaaten zu den Prioritäten bei den anstehenden<br />
Reformen der EU.<br />
<strong>Berlin</strong> hat unter der Teilung <strong>Europa</strong>s in Ost und West ganz besonders gelitten. Im vereinten <strong>Europa</strong> der 25 ergeben sich für<br />
<strong>Berlin</strong> neue Chancen, wenn es sich für seine Nachbarn im Osten öffnet. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> sieht in der EU-Osterweiterung<br />
erhebliche Potenziale für die Stadt – für Handel und Wirtschaft ebenso wie für Kultur und Wissenschaft. Wir werden alles<br />
daran setzen, aus diesen Potenzialen Gewinne für <strong>Berlin</strong> zu machen. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> unterstützt die Beitrittsperspektive<br />
der Türkei.<br />
I. Für eine demokratische und soziale Verfassung <strong>Europa</strong>s – <strong>Europa</strong> sozialdemokratisch mitgestalten!<br />
Die Arbeiten des Europäischen Verfassungskonvents stehen kurz vor dem Abschluss. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> spricht sich für<br />
eine moderne Verfassung aus, die neue Chancen für die politische Gestaltung des europäischen Gemeinwesens bietet.<br />
Dabei gilt es, drei zentralen Forderungen Rechnung zu tragen: <strong>Europa</strong> muss demokratischer werden. Es muss zu einem<br />
politischen Gemeinwesen weiterentwickelt werden. Das europäische Sozialmodell muss gestärkt werden.<br />
1. Für ein demokratisches und bürgernahes <strong>Europa</strong><br />
Zentrale Institution für ein demokratischeres <strong>Europa</strong> der Bürger ist das Europäische Parlament. Wir wollen deshalb ein<br />
generelles Mitentscheidungsrecht für das Parlament.<br />
In einem <strong>Europa</strong> der 25 oder mehr Mitgliedstaaten wird demokratische Legitimation aber auch über die nationalen Parlamente<br />
vermittelt, die die Europäische Rechtsetzung oftmals umsetzen müssen. Deswegen fordern wir, dass die nationalen<br />
Parlamente umfassend und unmittelbar über geplante Europäische Gesetzgebung informiert werden. Erheben sie Einspruch<br />
wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips, und wird dem nicht Rechnung getragen, so sollten die Regierungen<br />
auf Wunsch der Parlamente ihr Klagerecht wahrnehmen. Ebenso ist der Ausschuss der Regionen als Vertretung des <strong>Europa</strong>s<br />
der Regionen zu stärken.<br />
<strong>Europa</strong> muss für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, verständlicher und transparenter werden. Deswegen ist ein politischer<br />
Kopf wichtig, der <strong>Europa</strong> ein Gesicht gibt. Dies muss ein durch das Europäische Parlament gewählter Kommissionspräsident<br />
oder eine Kommissionspräsidentin sein, der bzw. die durch den Europäischen Rat bestätigt wird. Die Außenvertretung<br />
muss von einem Mitglied der Kommission wahrgenommen werden. Um den neuen Außen- und Sicherheitspolitischen<br />
Anforderungen gerecht zu werden, muss <strong>Europa</strong> auf der internationalen Bühne mit einer Stimme sprechen. Es bedarf<br />
einer gemeinsamen Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.<br />
Wir fordern eine klare, einfache Zuordnung der Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten, aber keinen starren<br />
Kompetenzkatalog, der die Möglichkeiten zur Gestaltung des Europäischen Gemeinwesens hemmen würde.<br />
<strong>Europa</strong> braucht auch im Bereich Justiz und Inneres effiziente, transparente und rechtsstaatlich kontrollierte Entscheidungsverfahren,<br />
um grenzübergreifende Kriminalität erfolgreich und unter Wahrung der Bürgerrechte bekämpfen zu können. Wir<br />
fordern eine Stärkung von Europol, die gleichberechtigte Beteiligung des <strong>Europa</strong>parlaments an der Gesetzgebung und eine<br />
vollwertige Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof.<br />
1
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 2<br />
2. Für ein politisches <strong>Europa</strong> der Menschen<br />
<strong>Europa</strong> ist mehr als ein großer Markt. Es ist Zeit, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Um den Anspruch einer Europäischen<br />
Wertegemeinschaft zu unterstreichen, ist die verbindliche Einbeziehung der in Nizza bislang lediglich feierlich<br />
proklamierten Grundrechts-Charta in die Verfassung von zentraler Bedeutung. Wir fordern dass das Dokument an prominenter<br />
Stelle in die Verfassung integriert wird.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> fordert, dass die zukünftige Europäische Verfassung Gestaltungsspielräume eröffnet, die es erlauben,<br />
den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger besser und schneller Rechung zu tragen. Von großer Wichtigkeit ist die Zweiteilung<br />
der Verfassung. In den ersten Teil sollen die Grundrechtecharta, die Unionsziele, die Grundwerte, die Grundzüge des<br />
Institutionengefüges und des Wettbewerbsrechts, die Entscheidungsverfahren und eine – teilweise noch zu schaffende –<br />
Finanzverfassung aufgenommen werden. Der zweite Teil soll Bestimmungen über die konkrete Gestaltung der Politikfelder<br />
zu den im ersten Teil genannten Grundsätzen enthalten. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern, dass<br />
dieser zweite Teil im Gegensatz zum ersten Teil leichter abgeändert werden kann. Wir fordern die nationalen und europäischen<br />
Vertreterinnen und Vertreter unserer Partei auf, sich dieser Herausforderung zu stellen und eine politische Vision für<br />
das demokratische <strong>Europa</strong> der Zukunft zu entwerfen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass die neue Verfassung zu keiner Reduzierung des erreichten Integrationsstandes führt. Insbesondere<br />
der Ökologie- und Sozialbereich ist zu stärken.<br />
3. Für eine Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells<br />
<strong>Europa</strong> ist ein wichtiger Akteur in einer globalisierten Welt. Wir glauben, <strong>Europa</strong> muss seiner sozialen Verantwortung innerhalb<br />
und außerhalb <strong>Europa</strong>s gerecht werden. Wir fordern die Aufnahme eines Bekenntnisses zum Ziel der Vollbeschäftigung,<br />
zum Ziel eines hohen sozialen Schutzes für die Menschen, der Solidarität sowie zum Schutz der Umwelt. Ebenso<br />
muss die mitgliedstaatliche Erbringung der Leistungen der Daseinsvorsorge weiter möglich sein. Markt und Wettbewerb<br />
sind kein Selbstzweck. Sie sind für die Menschen da.<br />
Die europäische Verfassung, das Wettbewerbs- und Beihilfenrecht und die Wirtschaftspolitik müssen der besonderen Bedeutung<br />
des europäischen Sozialmodells Rechung tragen.<br />
4. Für ein <strong>Europa</strong> der kulturellen Vielfalt<br />
Grundlegendes Element einer zu schaffenden europäischen Identität ist die Kultur. Kultur in <strong>Europa</strong> zeichnet sich durch<br />
Einheit in der Vielfalt, durch Eigenes und Gemeinsames aus. Dies gilt es in einer globalisierten Welt zu erhalten und zu<br />
fördern.<br />
Die Entfaltung der regionalen und nationalen Kultur wie die Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes und der<br />
gemeinsamen geistigen Wurzeln bleiben Verpflichtung der europäischen Gemeinschaft.<br />
Es ist das Zusammentreffen der Unterschiede, das ein europäisches Bewusstsein schafft. Deshalb wird der kulturelle Austausch<br />
und die kulturelle Zusammenarbeit für die Integration und den Zusammenhalt <strong>Europa</strong>s immer wichtiger; <strong>Berlin</strong> hat<br />
die große Chance, dazu seinen spezifischen Beitrag zu leisten. Die Wahrung der kulturellen Vielfalt – aber auch der Medienvielfalt<br />
– muss in der EU-Verfassung ebenso verankert sein wie die künstlerische Freiheit und das Recht auf Teilhabe<br />
an Kultur.<br />
II. Die EU-Osterweiterung –aktiv gestalten!<br />
Im Frühjahr 2004 wird die Europäische Union neben Malta und Zypern auch acht mittel- und osteuropäische Staaten aufnehmen.<br />
Für <strong>Berlin</strong> entsteht damit ein qualitativ neues politisches, wirtschaftliches und soziales Umfeld. Auf diese Herausforderung<br />
ist das Land bis heute nicht ausreichend vorbereitet.<br />
Die <strong>SPD</strong> erkennt und begrüßt die Chancen, die sich aus der Aufnahme unserer östlichen Nachbarn in die EU ergeben und<br />
wird aktiv dazu beitragen, sie für <strong>Berlin</strong> zu nutzen und gemeinsam mit unseren Nachbarn das größere <strong>Europa</strong> sozial und<br />
demokratisch zu gestalten.<br />
Die <strong>SPD</strong> nimmt aber zugleich die Befürchtungen ernst, die in der Bevölkerung noch immer vorhanden sind. Um dieser<br />
doppelten Verantwortung gerecht zu werden, wird die <strong>SPD</strong> ihre Mittel- und Osteuropakompetenz bündeln und die EU-<br />
Osterweiterung innerhalb wie außerhalb der Partei durch einen intensiven Dialog begleiten.<br />
1. <strong>Berlin</strong> muss die EU-Osterweiterung aktiv begleiten<br />
<strong>Berlin</strong> muss seine Chancen im neuen, größeren Umfeld der Europäischen Union erkennen und aktiv nutzen. Bald wird für<br />
Waren und Dienstleistungen und nach einer Übergangsfrist auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Grenze<br />
zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn keine Bedeutung mehr haben. Das bedeutet neue Möglichkeiten<br />
und neue Geschäftsfelder für die <strong>Berlin</strong>er Wirtschaft und auch eine neue, noch ungewohnte Bewegungsfreiheit für alle<br />
<strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er. Das bedeutet aber auch Konkurrenz durch Unternehmen aus den Beitrittsstaaten, die sich nach<br />
Deutschland orientieren und hier ihre Chancen suchen.<br />
Die <strong>SPD</strong> begrüßt deshalb ausdrücklich die MOE-Initiative des <strong>Berlin</strong>er Senats, mit der die Aktivitäten <strong>Berlin</strong>s auf allen Ebenen<br />
und in allen Fachbereichen koordiniert und öffentlich dargestellt werden sollen. Die Datenbank MOEPlus, die einen<br />
2
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 3<br />
Überblick über die zahlreichen Akteure und ihre Aktivitäten bietet ist dazu ein wichtiger erster Schritt.<br />
Die Anstrengungen des Senats zur Unterstützung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Wahrnehmung<br />
der neuen Möglichkeiten und der Vorbereitung auf die neue Konkurrenzsituation müssen weiter intensiviert werden.<br />
Auch die <strong>Berlin</strong>er Wirtschaft und ihre Verbände stehen nicht zuletzt gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern<br />
in der Verantwortung, mit konkreten Aktionen dazu beizutragen, dass die sich bietenden neuen Chancen rechtzeitig und<br />
konsequent genutzt werden.<br />
2. Die Mittel- und Osteuropakompetenz in <strong>Berlin</strong> und in der <strong>SPD</strong> erkennen und nutzen<br />
Keine andere Stadt in Deutschland hat so viel Mittel- und Osteuropakompetenz wie <strong>Berlin</strong>. In den Bereichen Wirtschaft,<br />
Wissenschaft, Politik, Kultur und Medien konzentrieren sich in <strong>Berlin</strong> mehr einschlägig engagierte Institutionen als irgendwo<br />
sonst. In den letzten Jahren ist der Standort <strong>Berlin</strong> durch den Umzug von Bundestag, Bundesregierung sowie zahlreicher<br />
Verbände und Institutionen in seiner MOE-Kompetenz weiter gestärkt worden. Zusätzlich leben in <strong>Berlin</strong> tausende von<br />
Menschen aus mittel- und osteuropäischen Ländern, die durch ihre Sprachkenntnisse eine Brücke zu unseren östlichen<br />
Nachbarstaaten bilden können.<br />
Um ihrer Verantwortung für die politische und gesellschaftliche Begleitung des Prozesses der EU-Osterweiterung gerecht<br />
zu werden wird die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> die MOE-Kompetenz in ihren eigenen Reihen aktiv vernetzen und bündeln. Die Vernetzung<br />
hat auch das Ziel, noch bestehenden politischen Handlungsbedarf zu erfragen und zu erkennen und die entsprechenden<br />
Akteure in Abgeordnetenhaus, Verwaltung und Senat zum Handeln aufzufordern.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss aber auch regionalpolitisch handeln und die Grenzregionen Brandenburgs in ihre Überlegungen<br />
und Handlungen einbeziehen.<br />
3. Für einen offenen Dialog über die EU-Osterweiterung<br />
Der <strong>Europa</strong>wahlkampf im Juni 2004 fällt in die Phase des EU-Beitritts der zehn Bewerberstaaten. Dies ist die Chance für<br />
die Metropole <strong>Berlin</strong> und die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>, den Wahlkampf aktiv zum Aufklären, Informieren, Vertrauen schaffen und einen<br />
offenen Dialog über die EU-Osterweiterung zu nutzen. Der Metropole <strong>Berlin</strong> kommt – insbesondere durch seine geographische<br />
Nähe zu den neuen Nachbarn – hier eine besondere Rolle bei der Stimmungs- und Meinungsfindung zu.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird dafür sorgen, dass den eigenen GenossInnen in Vorbereitung auf den <strong>Europa</strong>wahlkampf hinreichend<br />
Schulungs- und Diskussionsmöglichkeiten angeboten werden. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird Wahlkampfmaterial und Aktionen<br />
schwerpunktmäßig auf die EU-Erweiterung abstimmen.<br />
Darüber hinaus wird die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> ihren Teil zur öffentlichen Debatte der Folgen der über die EU-Osterweiterung beitragen.<br />
Neben den Kampagnen des Bundes und des Landes <strong>Berlin</strong> wird sich auch die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> sich öffentlich und klar<br />
zur Vereinigung <strong>Europa</strong>s bekennen und auf die historische Verantwortung und die historischen Chancen Deutschlands und<br />
<strong>Berlin</strong>s dabei hinweisen.<br />
Dabei sollen gemeinsam mit dem <strong>Berlin</strong>er Senat, Verbänden, Institutionen und Gewerkschaften Veranstaltungen organisiert<br />
werden, die Raum für das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den vielen Menschen aus Mittel- und<br />
Osteuropa bieten, die schon heute in <strong>Berlin</strong> leben und arbeiten.<br />
Der Landesvorstand wird dem Landesparteitag im Herbst über den Stand der Vorbereitungen der Kampagne zur EU-<br />
Osterweiterung innerhalb und außerhalb der Partei Bericht erstatten.<br />
4. Für neue Verbindungen <strong>Berlin</strong>s nach Mittel- und Osteuropa<br />
In den nächsten Jahren wird auf <strong>Berlin</strong> verstärkt die Aufgabe zukommen, neben den Partnerschaften mit mehreren Metropolen<br />
Mittel- und Osteuropas neue Verbindungen insbesondere zu den nahe gelegenen Städten und Regionen in Westpolen<br />
aufzubauen. Die Menschen in Wrocław, Szczecin und Poznań orientieren sich nach <strong>Berlin</strong>. Umgekehrt sollten die Verbindungen<br />
<strong>Berlin</strong>s in diese Regionen verstärkt und zum Teil neu aufgebaut werden. Dabei geht es um eine kulturelle, politische<br />
und wirtschaftliche Zusammenarbeit, an der nicht nur das Land <strong>Berlin</strong>, sondern die ganze Gesellschaft beteiligt sein<br />
muss. Diesen Prozess sollte <strong>Berlin</strong> nicht isoliert beginnen, sondern sich eng mit Brandenburg abstimmen, wo durch die<br />
gemeinsame Grenze mit Polen schon viele Verbindungen geknüpft wurden.<br />
5. <strong>Berlin</strong>s Verkehrsanbindung fit für die Erweiterung machen!<br />
<strong>Berlin</strong> wird nach der Erweiterung Metropole im Zentrum <strong>Europa</strong>s sein. Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch die Qualität<br />
der Infrastruktur und das Angebot an Verkehrsleistungen der Bahn dieser Tatsache Rechnung trägt. Vorrang hat dabei<br />
die Vernetzung der benachbarten Großstädte <strong>Berlin</strong>, Stettin, Posen und Breslau.<br />
Insbesondere der Bund und die EU sind hier aufgefordert, den notwendigen Ausbau von Schienen- und Straßennetz voranzutreiben.<br />
Vorrang hat dabei die umweltfreundliche Schiene im Personen- und Güterverkehr. Eine Verbesserung der<br />
Verkehrsinfrastruktur setzt aber zwingend voraus, dass die deutsche und die polnische Seite die gleichen Prioritäten und<br />
Ziele verfolgen und sich die verkehrspolitische Zusammenarbeit in der Verkehrpolitik zwischen Deutschland und Polen auf<br />
politischer Ebene und Verwaltungsebene verbessert. Unser polnischer Nachbar benötigt von <strong>Europa</strong> dringend Unterstüt-<br />
3
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 4<br />
zung zur Sanierung der stark vernachlässigten Infrastruktur sowie zur Entwicklung von nachhaltigen Finanzierungskonzepte,<br />
die eine zukünftige Instandhaltung des Bestandes und eine Qualitätsverbesserung erst ermöglichen.<br />
Wir werden uns für die Bestellung von schnellen und umsteigefreien Regional-Express-Verbindungen in die polnischen<br />
Nachbarregionen (insbesondere in die benachbarte Großstadt Stettin) einsetzen.<br />
Die deutschen Normaltarife im Eisenbahnverkehr sind insbesondere für polnische Jugendliche unbezahlbar. Nach dem<br />
Vorbild der Zusammenarbeit der Länder Bayern und Sachsen mit Tschechien im Egerland-Dreieck sind zur Belebung des<br />
gegenseitigen Kennenlernens der Völker attraktive Tarifangebote (z.B. „Freundschaftickets“, Ausdehnung des Schönen<br />
Wochenende Ticket auf die polnischen Nachregionen usw.) zu schaffen.<br />
Wir fordern den Senat auf, anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der Verbindung <strong>Berlin</strong>-Szczecin am 15.08.2003 seine<br />
diesbezüglichen verkehrspolitischen Vorstellungen der Öffentlichkeit vorzustellen.<br />
III. Für eine zukunftsfähige solidarische Finanzierung des <strong>Europa</strong>s der Städte und Regionen!<br />
Die Europäische Gemeinschaft hat nur eine Zukunft als solidarische Gemeinschaft, die annähernd gleiche Lebensbedingungen<br />
anstrebt. Dies gilt auch nach der Erweiterung.<br />
Die Strukturfonds bilden den zentralen Bestandteil der europäischen Förderung zur Schaffung struktureller, wirtschaftlicher<br />
und sozialer Kohäsion in <strong>Europa</strong>.<br />
In der Vergangenheit hat <strong>Berlin</strong> von der europäischen Förderung profitiert und konnte so viele Projekte im Bereich der<br />
Stadtentwicklung, Arbeitsmarktpolitik und Strukturentwicklung realisieren.<br />
Trotz der erreichten Erfolge benötigt <strong>Berlin</strong> jedoch auch weiterhin Förderung aus den europäischen Strukturfonds. Zum<br />
einen, um den spezifischen Problemen urbaner Zentren begegnen zu können und zum anderen, um bei einer fortgesetzten<br />
Förderung der neuen Bundesländer die bisher erreichten Erfolge nicht zu gefährden. Davon unabhängig bleibt die Notwendigkeit<br />
einer zusätzlichen bzw. gegebenenfalls kompensierenden Förderung aus Bundesmitteln.<br />
Mit der bevorstehenden Erweiterung in Richtung Osteuropa werden bald neue Partner in die EU aufgenommen, deren<br />
Wohlstand weit unter dem der jetzigen Mitgliedstaaten liegt und die deshalb besonderer Unterstützung bedürfen. Dies darf<br />
aber nicht dazu führen, dass notwendige Förderung auf Grund statistischer Effekte unterbleibt. Für die nächste Förderperiode<br />
ab 2007 steht deshalb eine Reform der Strukturfondsförderung an, die sowohl den Belangen der alten als auch der<br />
neuen Mitgliedstaaten hinreichend gerecht werden muss.<br />
Bei dieser Reform muss sichergestellt werden, dass<br />
• sich die Förderung auf die bedürftigsten Regionen und die dringendsten Probleme der erweiterten EU konzentriert,<br />
• die Verwaltung der Mittel aus den Strukturfonds vereinfacht wird und<br />
• die Reform die erreichten Aufholprozesse in den bisherigen Förderregionen nicht gefährdet.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> setzt sich daher im Rahmen der Verhandlungen um die Neustrukturierung der europäischen Förderpolitik<br />
für folgende zentrale Punkte ein:<br />
1. Metropolenförderung<br />
Die Fonds sollten unter einheitlicher Verwaltung zusammengelegt werden. Wir fordern für <strong>Berlin</strong>, dass neben den bereits<br />
durch die EU geförderten wirtschaftlich begünstigten Regionen auch die Metropolräume Berücksichtigung finden. Wir sind<br />
uns bewusst, dass die notwendige Ko-Finanzierung von den Förderregionen einschließlich <strong>Berlin</strong>s sicherzustellen ist.<br />
Städte sind der Motor der Region, da die dort gewonnenen Erkenntnisse und Leistungen dem Umland zur Verfügung stehen<br />
und zu seiner wirtschaftlichen Weiterentwicklung beitragen. Der europäische Mehrwert, der eine solche Förderung<br />
rechtfertigt, ist dann gegeben, wenn im Rahmen der europäischen Regionalpolitik die Probleme urbaner Zentren bekämpft<br />
werden, die eine europäische Dimension erreicht haben (d.h. in allen Mitgliedstaaten manifest sind).<br />
Eine Förderung von Maßnahmen sollte in Metropolenräumen mit mindestens 500.000 Einwohnern möglich sein, deren<br />
Arbeitslosenquote höher als 125% des EU-Durchschnitts ist. Wir fordern, dass insbesondere soziale, ökologische und<br />
Maßnahmen der regionalen Struktursicherung förderungsfähig sein müssen.<br />
2. Vereinfachung der Verwaltung<br />
Die Gestaltungsfreiheit der Regionen bei der Verwendung der Fördergelder sollte vergrößert werden. Des Weiteren müssen<br />
die Verfahren zur Genehmigung von Programmentwürfen vereinfacht werden<br />
Ein einheitliches Finanzkontrollverfahren auf regionaler und europäischer Ebene sollte dazu beitragen, Doppelarbeit zu<br />
vermeiden.<br />
4
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 5<br />
IV. Leistungen von öffentlichem Interesse sichern!<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> setzt sich für die Absicherung der Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge im europäischen Binnenmarkt<br />
ein. Die Daseinsvorsorge in den Ländern und Kommunen ist wesentlich für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.<br />
Soziale und kulturelle Einrichtungen, Wasser- und Energieversorgung, ÖPNV, öffentlicher Rundfunk, Abfallbeseitigung,<br />
Flughäfen, Einrichtungen im Bildungs- und Gesundheitswesen u.ä. sind Voraussetzungen für ein funktionierendes<br />
Gemeinwesen und eine soziale Stadt, in der sich alle Menschen frei entfalten können. Es gilt daher insbesondere auf Folgendes<br />
hinzuwirken:<br />
Das Recht der EU-Mitgliedstaaten, der Länder (Regionen) und Kommunen, Leistungen als Leistungen der Daseinsvorsorge<br />
zu definieren, und folglich h öffentliche oder private Einrichtungen mit der Erbringung dieser Leistungen b zu betrauen,<br />
muss im künftigen Verfassungsvertrag und in der europäischen Gesetzgebung deutlich verankert werden.<br />
Das heißt: Die Metropole <strong>Berlin</strong> muss auch in Zukunft das Recht haben, eigenständig aus politischen Erwägungen entscheiden<br />
zu können, welche Leistungen von „allgemeinen Interesse“ sind und daher öffentlich angeboten werden sollen.<br />
Die Anwendung des europäischen Wettbewerbs-, insbesondere des Beihilfenrechts, und der Marktfreiheiten darf nicht zu<br />
einer Gefährdung der Leistungen der Daseinsvorsorge führen und muss im Zweifel hinter die jeweils in den Mitgliedstaaten<br />
verfolgten Allgemeininteressen zurücktreten. Dies muss auch in der zukünftigen Europäischen Verfassung deutlich zum<br />
Ausdruck kommen. Hier gilt es, mehr politischen Freiraum für den europäischen Gesetzgeber zur Gestaltung des Verhältnisses<br />
von Daseinsvorsorge und Wettbewerbsrecht zu schaffen.<br />
Was vor Ort von allgemeinem Interesse ist, kann und darf nicht zentral auf der europäischen Ebene bestimmt werden. Es<br />
darf auf Gemeinschaftsebene nur eine Kontrolle zur Verhütung evidenten Missbrauchs geben.<br />
Die Doha-Verhandlungsrunde der Welthandelsorganisation WTO zur Revision des multilateralen Dienstleistungs-<br />
Handelsabkommens GATS (General Agreement on Trade in Services) mit dem erklärten Ziel einer weitgehenden Liberalisierung<br />
des Dienstleistungssektors stellt die Öffentliche Daseinsvorsorge als „Kern des europäischen Gesellschaftsmodells“<br />
(so die EU-Kommission 1999) massiv in Frage. Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> teilt die grundsätzliche Kritik der Bundesministerin<br />
Wieczorek-Zeul an der unzureichenden Information von Öffentlichkeit und Parlament. Bereits jetzt liegen Forderungen an<br />
die EU vor, den Gesundheits- und Bildungsbereich zu öffnen. Die EU hat ihrerseits von 72 Entwicklungs- und Schwellenländern<br />
die Liberalisierung ihrer Trinkwassermärkte gefordert. Staatliche Regulierungen wertet das GATS explizit als Handelshemmnis.<br />
Daher resultiert aus dem GATS steigender Privatisierungsdruck. Die GATS-Liberalisierung ergänzt und verstärkt<br />
die Deregulierungsprozesse die auf nationaler und EU-Ebene bereits vorangetrieben wurden. Entsprechend steigt<br />
der Anteil flexibilisierter Erwerbsformen.<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> begrüßt den Beschluss des Deutschen Bundestages, in der EU darauf hinzuwirken, dass keine weiteren<br />
Zugeständnisse in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheitsdienstleistungen und der Liberalisierung der Wasserversorgung<br />
gemacht werden. Solange die Öffentliche Daseinsvorsorge auf EU-Ebene nicht genau definiert und grundsätzlich<br />
rechtlich gesichert ist, sind die GATS-Verhandlungen sofort zu stoppen. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der innerhalb<br />
der EU andauernden Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zum Stellenwert der Daseinsvorsorge und des<br />
damit einhergehenden umfassenden Konzepts zur Rechts- und Planungssicherheit für die Kommunen. Eine Weiterführung<br />
der GATS-Verhandlungen birgt die Gefahr der Präjudizierung eines weitgehenden und gefährlichen Liberalisierungsansatzes.<br />
<strong>Berlin</strong>, öffentliche und betraute private Unternehmen sowie freie Träger brauchen auf europäischer Ebene in der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge, insbesondere im Beihilfenrecht, mehr Rechtssicherheit. Es muss vorhersehbar sein, welche Aufgaben<br />
unter das EU-Wettbewerbsrecht fallen und wie die Voraussetzungen zur Befreiung von dessen Verpflichtungen erfüllt<br />
werden können. Der europäische Gesetzgeber ist aufgerufen, durch Freistellungsverordnungen und andere verbindliche,<br />
präzisierende Maßnahmen z. B. eine Rahmenrichtlinie zur Daseinsvorsorge tätig zu werden. Das Europäische Parlament<br />
muss an diesem Prozess, der bereits im Gang ist, voll beteiligt werden - gegebenenfalls unter Änderung der Verträge.<br />
Für eigenbestimmte Vergabeentscheidungen unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien!<br />
Die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungen im Wege eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen Bietern ist in vielen<br />
Fällen begrüßenswert. Dabei darf nicht verkannt werden, dass die Vergabe an Dritte ebenfalls häufig komplexe Formen<br />
von Regulierung erfordert. Ausschreibungswettbewerb muss immer die Folge einer politischen Entscheidung auf der hierfür<br />
zuständigen, d.h. ggf. auch der europäischen Ebene unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips sein. Es darf keinen europarechtlichen<br />
Automatismus für die verpflichtende Ausschreibung in allen Bereichen der Daseinsvorsorge geben. Die Möglichkeit<br />
der öffentlichen Hand, gegebenenfalls selbst oder durch effektiv kontrollierte öffentliche Unternehmen steuernd in<br />
den Markt einzugreifen, muss grundsätzlich erhalten bleiben. Auch die besondere Rolle nicht gewinnorientierter, gemeinnütziger<br />
Einrichtungen muss voll anerkannt werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass dort, wo Ausschreibungswettbewerb stattfindet, die Vergabeentscheidungen nach hohen sozialen,<br />
ökologischen und qualitativen Standards getroffen werden können. Tariftreue bei der Ausführung des zugeschlagenen<br />
Auftrags, die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und die Durchführung von Gleichstellungsmaßnahmen müssen<br />
in die Entscheidung miteinbezogen werden können. Hierauf ist in den laufenden europäischen Gesetzgebungsverfahren<br />
hinzuwirken.<br />
5
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 6<br />
Deshalb:<br />
An den Beispielen zukünftige Verfassung, Osterweiterung, Zukunft der solidarischen Finanzierung und Sicherung der öffentlichen<br />
Dienstleistungen zeigt sich: „<strong>Europa</strong>“ hat konkrete Bedeutung auch in <strong>Berlin</strong>! Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird dies in ihrer<br />
Arbeit berücksichtigen und dem Thema einen gebührenden Stellenwert in ihrer Politik einräumen. Denn nur ein starkes<br />
soziales und demokratisches <strong>Europa</strong> sichert nationale und lokale polische Handlungsspielräume.<br />
6
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 7<br />
Antrag Nr. 02/I/03<br />
Erledigt bei Annahme 1/I/03 (K)<br />
KDV Mitte<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong>-Mitte fordert die Bundesregierung, die Bundestagsfraktion und den <strong>SPD</strong>-Parteivorstand auf, sich bei den<br />
Beratungen des Europäischen Konvents zur Gestaltung einer Europäischen Verfassung nachdrücklich dafür einzusetzen,<br />
dass in der Europäischen Union ein deutlicher Akzent auf die Sozialpolitik gesetzt wird.<br />
Antrag Nr. 3/I/030<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Annahme<br />
<strong>Europa</strong> für Frauen - Frauen für <strong>Europa</strong><br />
Die Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe von Frauen in allen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen<br />
muss sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union endlich verwirklicht werden.<br />
Dafür ist erforderlich, dass die Europäische Union mehr Kompetenzen auf den Gebieten Sozial- und Frauenpolitik erhält<br />
und zu einer sozialen und politischen Union ausgebaut wird. Notwendig ist eine verstärkte Koordinierung der Frauenpolitik<br />
der Mitgliedstaaten sowie eine konsequente europäische Frauen- und Gleichstellungspolitik. Deshalb bedarf es einer klaren<br />
vertraglichen Kompetenz der Europäischen Union zur Entwicklung einer umfassenden und eigenständigen Frauenpolitik<br />
auf europäischer Ebene, die nicht auf wirtschafts- oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beschränkt ist. Dies ist -<br />
zusätzlich zur Berücksichtigung differenzierter Lebenslagen gemäß des Prinzips Gender Mainstreaming - am besten durch<br />
ein eigenständiges Gleichstellungskapitel in der neuen Verfassung der Europäischen Union zu gewährleisten.<br />
Sämtliche Initiativen der Europäischen Union müssen zukünftig mehr sein als Selbstverpflichtungserklärungen und formale<br />
Gleichstellungspostulate der politisch Verantwortlichen. Deshalb müssen Maßnahmen und Sanktionen entwickelt werden,<br />
die die Gleichberechtigung von Frauen zur verbindlichen Aufgabe machen und umfassender Kontrolle unterliegen.<br />
Des Weiteren sollen die Mitgliedstaaten noch stärker befähigt werden, voneinander zu lernen, damit auf europäischer Ebene<br />
die sozialen Standards nach und nach auf möglichst hohem Niveau angeglichen werden können. Gute Ansätze etwa bei<br />
der staatlichen und betrieblichen Frauenförderung, in der eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen und bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten<br />
müssen ausgebaut und europaweit verwirklicht werden.<br />
Um das alles erreichen zu können, ist eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in allen Institutionen und Gremien der<br />
Europäischen Union erforderlich und unerlässlich. Dafür müssen die bereits formulierten Programme und verbindlichen<br />
Vorgaben zur Förderung der politischen Partizipation von Frauen auf europäischer Ebene konsequent durchgesetzt werden.<br />
Antrag Nr. 04/I/03<br />
KDV Mitte<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Erledigt bei Annahme 3/I/03<br />
<strong>Europa</strong> für Frauen - Frauen für <strong>Europa</strong><br />
Die Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe von Frauen in allen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen<br />
muss sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union endlich verwirklicht werden.<br />
Dafür ist erforderlich, dass die Europäische Union mehr Kompetenzen auf den Gebieten Sozial- und Frauenpolitik erhält<br />
und zu einer sozialen und politischen Union ausgebaut wird. Notwendig ist eine verstärkte Koordinierung der Frauenpolitik<br />
der Mitgliedstaaten sowie eine konsequente europäische Frauen- und Gleichstellungspolitik. Deshalb bedarf es einer klaren<br />
vertraglichen Kompetenz der Europäischen Union zur Entwicklung einer umfassenden und eigenständigen Frauenpolitik<br />
auf europäischer Ebene, die nicht auf wirtschafts- oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beschränkt ist. Dies ist am<br />
besten durch ein eigenständiges Gleichstellungskapitel im neuen Vertrag der Europäischen Union zu gewährleisten.<br />
Sämtliche Initiativen der Europäischen Union müssen zukünftig mehr sein als Selbstverpflichtungserklärungen und formale<br />
Gleichstellungspostulate der politisch Verantwortlichen. Deshalb sollten Maßnahmen und Sanktionen entwickelt werden,<br />
die die Gleichberechtigung von Frauen zur verbindlichen Aufgabe machen und umfassender Kontrolle unterliegen.<br />
Des Weiteren sollten die Mitgliedstaaten noch stärker voneinander lernen, damit auf europäischer Ebene die sozialen<br />
Standards nach und nach auf möglichst hohem Niveau angeglichen werden können. Gute Ansätze etwa bei der staatlichen<br />
und betrieblichen Frauenförderung, in der eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen und bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten<br />
müssen ausgebaut und europaweit verwirklicht werden.<br />
Um das alles erreichen zu können, ist eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in allen Institutionen und Gremien der<br />
7
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 8<br />
Europäischen Union erforderlich und unerlässlich. Dafür müssen die bereits formulierten Programme und verbindlichen<br />
Vorgaben zur Förderung der politischen Partizipation von Frauen auf europäischer Ebene konsequent durchgesetzt werden.<br />
Antrag Nr. 05/I/03<br />
Annahme<br />
KDV Mitte<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> fordert die Bundesregierung auf, umgehend einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien<br />
sowie der Gleichbehandlungsrichtlinie vorzulegen. Weiterhin wird die Bundesregierung aufgefordert, die Sozialpartner,<br />
die betroffenen Verbände und Interessenvertretungen frühzeitig in den Diskussionsprozess mit einzubeziehen, um so einen<br />
breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen.<br />
Antrag Nr. 06/I/03<br />
Erledigt bei Annahme 1/I/03<br />
KDV Mitte<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Folgende Grundsätze werden bei der Erarbeitung einer europäischen Verfassung berücksichtigt.<br />
Für eine demokratische und soziale Verfassung <strong>Europa</strong>s – <strong>Europa</strong> sozialdemokratisch mitgestalten!<br />
Die Arbeiten des Europäischen Verfassungskonvents stehen kurz vor dem Abschluss. Die <strong>SPD</strong> spricht sich für eine moderne<br />
Verfassung aus, die neue Chancen für die politische Gestaltung des europäischen Gemeinwesens bietet. Dabei gilt<br />
es, drei zentralen Forderungen Rechnung zu tragen: <strong>Europa</strong> muss demokratischer werden. Es muss zu einem politischen<br />
Gemeinwesen weiterentwickelt werden. Das europäische Sozialmodell muss gestärkt werden.<br />
1. Für ein demokratisches und bürgernahes <strong>Europa</strong><br />
Zentrale Institution für ein demokratischeres <strong>Europa</strong> der Bürger ist das Europäische Parlament. Wir wollen deshalb ein<br />
generelles Mitentscheidungsrecht für das Parlament. In einem <strong>Europa</strong> der 25 oder mehr Mitgliedstaaten wird demokratische<br />
Legitimation aber auch über die nationalen Parlamente vermittelt, die die Europäische Rechtsetzung oftmals umsetzen<br />
müssen. Deswegen fordern wir, dass die nationalen Parlamente (und nicht nur die Regierungen) umfassend und unmittelbar<br />
über geplante Europäische Gesetzgebung informiert werden. Der Ausschuss der Regionen als Vertretung des<br />
<strong>Europa</strong>s der Regionen ist zu stärken.<br />
<strong>Europa</strong> muss für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, verständlicher und transparenter werden. Deswegen ist ein politischer<br />
Kopf wichtig, der <strong>Europa</strong> ein Gesicht gibt. Dies muss ein durch das Europäische Parlament gewählter Kommissionspräsident<br />
sein, der durch den Rat bestätigt wird. Die Vertretung nach Außen muss bei einem bei der Kommission angesiedelten<br />
Vertreter liegen, und nicht bei einem Präsidenten des Europäischen Rates – dies würde unnötige Kompetenzkonflikte<br />
zwischen Kommissions- und Ratspräsidenten hervorrufen.<br />
Wir fordern eine klare, einfache Zuordnung der Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten, aber keinen starren<br />
Kompetenzkatalog, der die Möglichkeiten zur Gestaltung des Europäischen Gemeinwesens hemmen würde.<br />
2. Für ein politisches <strong>Europa</strong> der Menschen<br />
<strong>Europa</strong> ist mehr als ein großer Markt. Es ist Zeit, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Um den Anspruch einer Europäischen<br />
Wertegemeinschaft zu unterstreichen, ist die verbindliche Einbeziehung der in Nizza bislang lediglich feierlich<br />
proklamierten Grundrechts-Charta in die Verfassung von zentraler Bedeutung. Es ist sicherzustellen, dass das Dokument<br />
der Verfassung vorangestellt wird und nicht lediglich ein Verweis erfolgt. Dies ist für die Verständlichkeit sowie als klares<br />
Bekenntnis zu gemeinsamen Werten unabdinglich.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> fordert, dass die zukünftige Europäische Verfassung Gestaltungsspielräume eröffnet, die es erlaubt, den<br />
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger besser und schneller Rechung zu tragen. Von großer Wichtigkeit ist die Zweiteilung<br />
der Verfassung. In den ersten Teil sollen die Unionsziele, die Grundwerte, die Grundrechte Charta, die Grundzüge des<br />
Institutionsgefüges, die Entscheidungsverfahren und eine – teilweise noch zu schaffende – Finanzverfassung aufgenommen<br />
werden. Der zweite Teil soll Bestimmungen über die konkrete Gestaltung der Politikbereiche zu den im ersten Teil<br />
genannten Grundsätzen enthalten. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern, dass dieser zweite Teil im<br />
Gegensatz zum ersten Teil leichter abgeändert werden kann, da wir glauben, dass <strong>Europa</strong> dadurch politisch gestaltbarer<br />
wird. Wir fordern die nationalen und europäischen Vertreterinnen und Vertreter unsrer Partei auf, sich dieser Herausforderung<br />
zu stellen und eine politische Vision für das demokratische <strong>Europa</strong> der Zukunft zu entwerfen.<br />
3. Für eine Weiterentwicklung des Europäischen Sozialmodells.<br />
<strong>Europa</strong> ist ein wichtiger Akteur in einer globalisierten Welt. Wir glauben, <strong>Europa</strong> muss seiner sozialen Verantwortung innerhalb<br />
und außerhalb <strong>Europa</strong>s gerecht werden. Wir fordern die Aufnahme eines Bekenntnisses zum Ziel der Vollbeschäftigung,<br />
zum Ziel eines hohen sozialen Schutzes für die Menschen sowie zum Schutz der Umwelt. Markt und Wettbewerb<br />
sind kein Selbstzweck. Sie sind für die Menschen da.<br />
8
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 9<br />
Von besonderer Wichtigkeit für das europäische Sozialmodell ist der Erhalt öffentlicher Leistungen der Daseinsvorsorge,<br />
die für alle Bürgerinnen und Bürgern kontinuierlich zugänglich und erschwinglich sind. Das Recht der Mitgliedstaaten sowie<br />
der Länder und Kommunen, solche Leistungen zu organisieren und an gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen, muss<br />
erhalten bleiben. Eine europäische Verfassung und insbesondere das Wettbewerbs- und Beihilfenrecht muss der besonderen<br />
Bedeutung dieser Leistungen Rechung tragen.<br />
4. Für eine Weiterentwicklung der Europäischen Kriminalitätsbekämpfung.<br />
Zu den grundlegenden Bedürfnissen der Europäischen Bürgerinnen und Bürger gehört das Bedürfnis nach Sicherheit.<br />
<strong>Europa</strong> braucht auch im Bereich Justiz und Inneres effiziente, transparente und rechtsstaatlich kontrollierte Entscheidungsverfahren,<br />
um Grenzübergreifende Kriminalität erfolgreich und unter Wahrung der Bürgerrechte bekämpfen zu können. Wir<br />
fordern in diesem Bereich eine Stärkung von Europol, die volle Beteiligung des <strong>Europa</strong>parlaments an der Gesetzgebung<br />
und eine vollwertige Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof.<br />
Antrag Nr. 07/I/03<br />
Erledigt bei Annahme 1/I/03<br />
KDV Mitte<br />
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats, die <strong>SPD</strong>-Fraktion im Abgeordnetenhaus, die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>-<br />
Mitglieder des Deutschen Bundestages und im Europäischen Parlament auf, sich dafür einzusetzen, dass es in den neuen<br />
Strukturfonds ein Ziel „Metropolen“ geben muss.<br />
Antrag Nr. 08/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Der Bundesparteitag begrüßt und unterstützt die Initiative der Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und fordert die<br />
<strong>SPD</strong>-Mitglieder der Bundesregierung auf, auf europäischer Ebene die Einführung von Maßnahmen zu forcieren, die dem<br />
internationalen Stabilitätsrisiko von kurzfristigen Geldanlagen entgegen wirken. Eine dieser Maßnahmen ist die so genannte<br />
Tobin-Tex auf Devisengeschäfte.<br />
Der Bundesparteitag fordert die <strong>SPD</strong>-Mitglieder der Bundesregierung auf, die Einführung dieser Abgabe in Abstimmung mit<br />
den EU-Partnern zügig umzusetzen. Die Einnahmen aus den steuerlichen Maßnahmen sollen über einen internationalen<br />
Fond abgesichert und für entwicklungspolitische, ökologische und soziale Zwecke verwendet werden.<br />
Antrag Nr. 09/I/03<br />
Überweisung an Fachausschuss I / Internationale Politik<br />
KDV StegZehl<br />
und Landesvorstand zur Überarbeitung zusammen mit Antragsteller.<br />
Mit tiefer Sorge betrachtet die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> die derzeitige Weltsituation, in der in der internationalen Gemeinschaft zwei<br />
sich einander ausschließende friedens- und sicherheitspolitische Grundhaltungen zu Tage treten. Das Recht des Stärkeren<br />
steht gegen die Stärke des (Völker-)Rechts, das in Jahrzehnten durch internationale Verträge und Organisationen aufgebaut<br />
und weiterentwickelt wurde.<br />
Seit Beginn dieses Jahres hat sich gezeigt, dass die rot-grüne Bundesregierung mit ihrer Kritik an dem militärischen Eingreifen<br />
gegen den Irak offensichtlich mit der Mehrheit des UN-Sicherheitsrates und mit der großen Mehrheit der UN-<br />
Staatengemeinschaft konform geht. Viele der Gruppen und Organisationen in den USA, die sich gegen die Politik ihrer<br />
derzeitigen Regierung stellen, verstehen sich als direkte Nachfolger der Amerikaner, die nach dem zweiten Weltkrieg die<br />
Versöhnung mit Deutschland begrüßt und den Wiederaufbau unseres Landes aktiv unterstützt haben, nicht zuletzt materiell.<br />
Ihre Zukunftsvision war und ist eine Welt, in der Konflikte gewaltfrei gelöst werden. Wir teilen diese Vision und unterstützen<br />
daher nachdrücklich alle Bemühungen der Bundesregierung, die auf die Stärkung und Weiterentwicklung des internationalen<br />
Rechts, auf den Einsatz von Mitteln der Konfliktprävention und zivilen Konfliktlösung, auf die Stärkung zivilgesellschaftlicher<br />
Gruppierungen als Mittel zum Aufbau demokratischer Strukturen, auf den Abbau von Armut und den Einsatz<br />
wirtschaftlicher Anreize als indirekt friedensfördernde Maßnahmen setzen.<br />
Antrag Nr. 10/I/03<br />
Überweisung an den Landesvorstand und FA I mit der Auflage,<br />
FA I / Internationale Politik noch vor Antragsschluss (LPT 13.09.03)<br />
eine überarbeitete Fassung vorzulegen.<br />
Internationale Rolle <strong>Berlin</strong>s gestalten, Landesentwicklungspolitik erhalten!<br />
<strong>Berlin</strong> – politisches Zentrum einer Mittelmacht mit globaler Verantwortung<br />
Mit der deutschen Vereinigung und der Aufhebung des Vier-Mächte-Status hat <strong>Berlin</strong> seine Rolle als herausgehobener<br />
Akteur und als besonderes Objekt der internationalen Politik verloren.<br />
Im Gegenzug ist der Stadt mit der Funktion der Hauptstadt und des Regierungssitzes des vereinigten Deutschlands eine<br />
9
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 10<br />
neue Verantwortung für die Mitgestaltung der zunehmenden internationalen Verantwortung Deutschlands zugewachsen.<br />
Die Konzentration von Entscheidungsträgern in Regierung und Parlament, von diplomatischen Vertretungen, wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen, von staatlichen und nichtstaatlichen Durchführungsorganisationen und von Nichtregierungsorganisationen<br />
im Bereich der Außen- und Entwicklungspolitik geben dem Land <strong>Berlin</strong> und der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> auch die Chance, den<br />
außen- und entwicklungspolitischen Diskurs in der Hauptstadt Deutschlands in einem angemessenen Rahmen mit zu gestalten.<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> unterstützt gemeinsam mit der Mehrheit der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien und der großen<br />
Mehrheit der Bevölkerung die in der Koalitionsvereinbarung von <strong>SPD</strong> und Bündnis 90/Die Grünen festgelegten Schwerpunkte<br />
der Außen-, Sicherheits- und Nord-Süd-Politik der Bundesregierung unter den Stichworten:<br />
Stärkung und Reform der Vereinten Nationen und multilateraler Strukturen.<br />
Festigung der transatlantischen Beziehungen.<br />
Nutzung der Chancen der EU-Erweiterung.<br />
Stärkung der zivilen Krisenprävention und der Menschenrechte in der internationalen Politik.<br />
Solidarität mit den Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus.<br />
Einschränkung der Möglichkeiten kriegerischer und terroristischer Gewalt durch die Stärkung der Abwehrmittel des<br />
Völkerrechts (Konventionen gegen die Produktion und Verbreitung von Biowaffen, gegen die Finanzierung des Terrorismus,<br />
gegen Landminen.<br />
Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofs).<br />
Stärkung der Anstrengungen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle.<br />
Politische Gestaltung der Globalisierung und Stärkung des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells.<br />
Stärkung der Entwicklungspolitik als politische Querschnittsaufgabe, als Strategie der globalen Friedens- und Strukturpolitik<br />
und als eigenständiger Teil der gemeinsamen deutschen Außenpolitik.<br />
Bekämpfung von Armut, Hunger, Umweltzerstörung, wirtschaftlichen Ungleichgleichgewichten und fehlendem Respekt<br />
vor anderen Kulturen als Hindernisse der Entwicklung der Menschheit und Nährboden für den weltweiten Terrorismus.<br />
Verstärkung des deutschen Beitrags zu einer Lösung des Palästina-Konflikts in Rahmen des Nahost-Quartetts aus UN,<br />
EU, USA und Russland auf der Basis der wechselseitigen Anerkennung eines in sicheren Grenzen lebensfähigen und<br />
souveränen israelischen und palästinensischen Staates.<br />
<strong>Berlin</strong> – Stadt des Friedens<br />
Mit den alle Erwartungen übertreffenden Großdemonstrationen gegen den drohenden Irak-Krieg am 15. Februar und am<br />
15. März dieses Jahres, die mit einer kontinuierlichen Kette von Protestaktionen fortgesetzt worden sind, hat <strong>Berlin</strong> seinen<br />
Ruf als Stadt des Friedens gefestigt. Dieser Ruf wurde begründet in den Jahrzehnten der Entmilitarisierung während des<br />
Vier-Mächte-Status, in den Demonstrationen gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in den 80er Jahren, insbesondere<br />
aber auch in der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR, die zum Sturz des SED-Regimes und zum Fall der<br />
Mauer im November 1989 führte.<br />
Das Ende des Ost-West-Konflikts und der Wandel von der „Front-Stadt“ der westlichen Welt einerseits und der Hauptstadt<br />
der DDR zum gemeinsamen politischen Zentrum des vereinigten Deutschlands erfordern aber auch einen Wandel von<br />
einem eher gesinnungsethischen und von einem prinzipiellen Pazifismus bestimmten Einsatz für den Weltfrieden zu einem<br />
verantwortungsethischen Engagement für die Schaffung und Festigung friedensfördernder Strukturen im globalen Maßstab,<br />
in dem auch die Bundeswehr und deutsche Polizeikräfte wichtige Funktionen wahrnehmen.<br />
Eintreten für den Frieden in globaler Verantwortung<br />
Der LPT begrüßt in diesem Zusammenhang die Beteiligung des Regierenden Bürgermeisters an dem Appell europäischer<br />
Bürgermeister gegen einen Krieg im Irak, der auf eine Initiative des Bürgermeisters von Rom, Walter Veltroni zurück geht,<br />
sowie die Aufrufe des Landesvorstands zur Beteiligung an den großen Friedensdemonstrationen der letzten Wochen als<br />
wichtige Unterstützung der Irak-Politik der Bundesregierung und als eigenständige Beiträge zur Sicherung des Friedens. Er<br />
lehnt weiterhin eine aktive Beteiligung Deutschlands an militärischen Maßnahmen im Irak ab.<br />
Er lehnt aber auch Forderungen ab, die auf die Verweigerung der politisch abdingbaren Erfüllung von Bündnisverpflichtungen<br />
hinaus laufen und die Fähigkeit Deutschlands beeinträchtigen, auch nach Ausbruch der Kampfhandlungen den Vorrang<br />
politischer Mittel zur Bewältigung des Irak-Konflikts und die Verantwortung der Vereinten Nationen für die Sicherung<br />
des Weltfriedens wiederherzustellen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, während der Dauer des Krieges alles ihr<br />
Mögliche zu tun, um eine von den Interessen der Kriegsparteien unabhängige humanitäre Unterstützung der leidenden<br />
Bevölkerung im Irak sicher zu stellen. Für die Gestaltung der Nachkriegsordnung des Irak kommt den Vereinten Nationen<br />
die entscheidende Verantwortung zu. Sie müssen dem irakischen Volk eine Perspektive eröffnen auf der Grundlage des<br />
wechselseitigen Respekts der verschiedenen nationalen und religiösen Gruppen und des Minderheitenschutzes seine<br />
politische Zukunft selbst zu bestimmen. Für die Beseitigung der unmittelbaren Kriegsschäden müssen die Krieg führenden<br />
Mächte maßgebliche Verantwortung übernehmen, für die durch die UN-Sanktionen verursachten Schäden und Entwicklungsrückstände<br />
muss aber die internationale Gemeinschaft als ganze aufkommen. In diesem Sinne muss auch Deutschland<br />
einen angemessenen Anteil am Wiederaufbau und an der Entwicklung des Irak übernehmen.<br />
Stärkung von Friedensforschung und Menschenrechts-Monitoring in <strong>Berlin</strong><br />
Neben den politikwissenschaftlichen Instituten der <strong>Berlin</strong>er Hochschulen und den in <strong>Berlin</strong> ansässigen bzw. vertretenen<br />
politischen Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung) tragen außeruniversitäre öffentlich finanzierte Institu-<br />
10
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 11<br />
te wie die Stiftung Wissenschaft und Politik und das Deutsche Institut für Menschenrechte sowie völlig unabhängige, nur<br />
durch Spenden finanzierte Einrichtungen wie das <strong>Berlin</strong>er Institut für Transatlantische Sicherheit (BITS) wesentlich dazu<br />
bei, die veränderten Rahmenbedingungen für einer globalen Friedens- und Sicherheitspolitik zu erforschen bzw. auch im<br />
Dialog mit Beteiligten und Betroffenen auszuloten. Der LPT fordert die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats und die Aha-Fraktion<br />
auf, zur Schärfung des friedenspolitischen Profils der Stadt in der Hochschulpolitik und Wissenschaftsfinanzierung einen<br />
noch stärkeren Schwerpunkt zugunsten der Friedensforschung zu setzen.<br />
Der kürzlich erfolgte Rücktritt des Leiters des erst im letzten Jahr gegründeten Deutschen Instituts für Menschenrechte,<br />
Percy McLean, gibt dem LPT Anlass, bei der Bundesregierung die Respektierung der Unabhängigkeit dieses Instituts einzufordern.<br />
Das Institut kann seine Wächterfunktion im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen in aller Welt nur glaubwürdig<br />
wahrnehmen, wenn es sich mit der gleichen Objektivität und Souveränität mit Menschenrechtsproblemen in<br />
Deutschland, etwa der Rechtsstellung von älteren und behinderten Menschen, Flüchtlingen in Abschiebehaft usw. beschäftigen<br />
kann.<br />
Reform der Bundeswehr – Bedingung effektiver Friedenssicherung<br />
Die Entscheidung für die Priorität nichtmilitärischer Mittel der Friedenssicherung und für die Begrenzung des Verteidigungshaushalt<br />
auf ein Volumen, das etwa die Hälfte des Haushaltsanteils der 50er und 60er Jahre ausmacht, entbindet die<br />
deutsche Politik nicht von der Aufgabe der Neubestimmung des Auftrags der Streitkräfte und einer Neubewertung des<br />
militärischen Faktors in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Gerade das Scheitern des wohlbegründeten Versuchs<br />
der Bundesregierung, gemeinsam mit Frankreich, Russland und China, eine Entwaffnung des Irak mit friedlichen<br />
Mitteln durchzusetzen und die Uneinigkeit der Mitglieder der EU einschließlich der Beitrittskandidaten in der Irak-Frage<br />
setzen die Weiterentwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einschließlich der Aufstellung gemeinsamer<br />
Einsatzverbände für größere friedenssichernde Einsätze in Krisengebieten, die bisher nur unter Beteiligung der<br />
USA durchgeführt werden konnten, zwingend auf die Tagesordnung. Eine Diskussion über eine Erhöhung der Ausgaben<br />
für die Verteidigung bis zu einer Erhöhung des Prozentanteils am Gesamthaushalt findet erst dann eine Begründung, wenn<br />
die Struktur der Bundeswehr den neuen Aufgaben der Friedenssicherung voll gerecht wird. Es ist nicht einzusehen, dass<br />
weiterhin knappe Ressourcen für einen überholten Verteidigungsauftrag, für nicht mehr benötigte und zudem unzureichend<br />
ausgestattete Hauptverteidigungskräfte ausgegeben werden und nicht genügend Krisenreaktionskräfte für friedenssichernde<br />
Einsätze in Krisengebieten zur Verfügung stehen.<br />
<strong>Berlin</strong> – Stadt des Weltkulturerbes, Stadt der Kulturen der Welt<br />
<strong>Berlin</strong>s Anteil am Weltkulturerbe, exemplarisch verkörpert in dem einzigartigen Ensemble der Museumsinsel, ist zweifellos<br />
einer der wichtigsten „weichen“ Standortfaktoren der Stadt. Vergleichbar wichtig für die Entfaltungschancen <strong>Berlin</strong>s ist aber<br />
die Internationalität der Stadt, die ihre Bewohner, wissenschaftlichen Einrichtungen, ihr kulturelles, politisches und soziales<br />
Leben kennzeichnet. Die zahlreichen und sehr unterschiedlichen Migrantengruppen bilden nicht nur eine wesentliche Faktor<br />
des sozialen Problemgeflechts der Stadt, vor allem im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen, sie erzeugen auch<br />
kulturelle Vielfalt und bereichern die Stadtpolitik mit einer internationalen Dimension sowohl in Gestalt der Beeinflussung<br />
der hiesigen Politik wie der Politik der Heimatländer.<br />
Von besonderer Bedeutung für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort <strong>Berlin</strong> sind Student/Innen, Wissenschaftler/Innen<br />
und Fachkräfte aus den Ländern des Südens. Absolvent/Innen der <strong>Berlin</strong>er Hochschulen kehren in ihre Heimatländer<br />
zurück als die denkbar besten Botschafter deutscher Produkte, Produktionsverfahren und deutschen Knowhows.<br />
Migrant/Innen bringen aber auch Kenntnisse und Erfahrungen mit, mit denen Probleme der Stadtentwicklung <strong>Berlin</strong>s besser<br />
gelöst werden können.<br />
<strong>Berlin</strong> – Stadt der nachhaltigen Entwicklung<br />
Die Koalitionsvereinbarung zwischen <strong>SPD</strong> und PDS in <strong>Berlin</strong> enthält das Bekenntnis zum globalen Leitbild der nachhaltigen<br />
Entwicklung und zur Umsetzung der Vorschläge der Enquetekommission Zukunftsfähiges <strong>Berlin</strong> I und II. Der vom Agenda-<br />
Forum <strong>Berlin</strong>/Brandenburg ausgearbeitet Entwurf einer „Lokalen Agenda 21 <strong>Berlin</strong>“ ist mit dem Zwischenbericht des Senats<br />
vom 11. 2. 2003 Teil der Regierungspolitik des Landes <strong>Berlin</strong> geworden. Der Entwurf sieht neben stärker innen- und stadtpolitischen<br />
Akzentsetzungen in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz, Zukunft der Arbeit, Bildung und Partizipation auch<br />
einen Schwerpunkt „<strong>Berlin</strong> in der Einen Welt: Nord-Süd/Ost-West-Partnerschaften“ vor.<br />
Die umwelt- und entwicklungspolitische Ausgestaltung der Städtepartnerschaften <strong>Berlin</strong>s muss stärker als Instrument zur<br />
Ausfüllung der internationalen Dimension des Leitbilds einer „nachhaltigen Metropole“ genutzt werden. Sieben von 17 Städtepartnerschaften<br />
<strong>Berlin</strong>s bestehen mit Hauptstädten in Entwicklungsländern. Die projektbezogene Zusammenarbeit findet<br />
zu über 60 % mit Städten aus dem Süden statt. Die Städtepartnerschaften der Bezirke, modellhaft die Partnerschaft Köpenick<br />
– Cajamarca (Peru) tragen entscheidend dazu bei, die im gesamten Agenda-Prozess noch unzureichende Verknüpfung<br />
von Umwelt und Entwicklung im Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort zu verankern.<br />
<strong>Berlin</strong> – Brennspiegel, Marktplatz und Labor der Nord-Süd-Beziehungen<br />
Angesichts der zügig voran schreitenden Osterweiterung der EU besinnt sich <strong>Berlin</strong> zu Recht auf seine Tradition und seine<br />
Stärken als Mittlerin zwischen Ost und West. Bei aller Berechtigung dieser Prioritätensetzung dürfen aber die Stärken des<br />
Nord-Süd-Standorts <strong>Berlin</strong> und ihre Bedeutung für die Zukunft <strong>Berlin</strong>s nicht vernachlässigt werden. Der Aderlass des Weg-<br />
11
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 12<br />
zugs von drei zentralen entwicklungspolitischen Institutionen (Deutscher Entwicklungsdienst, Deutsche Stiftung für Internationale<br />
Entwicklung und Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) als Konsequenz des Hauptstadtbeschlusses des Bundestags<br />
und der Entscheidungen der Föderalismus-Kommission dürfen auch angesichts der Haushaltsnotlage <strong>Berlin</strong>s nicht<br />
zu Resignation und Untätigkeit führen, sondern müssen Anreiz sein zur Aktivierung und Entfaltung des verbleibenden entwicklungspolitischen<br />
Potentials der Stadt.<br />
<strong>Berlin</strong> weist bundesweit nach wie vor mit 250 Nichtregierungsorganisationen die größte Zahl an entwicklungspolitischen<br />
NRO auf. Im Westen waren und sind diese Initiativgruppen Teil der breit gefächerten Alternativbewegung, die mit ihren<br />
Zweigen der Friedens-, Frauen und ökologischen Bewegung die Zivilgesellschaft der Stadt immer noch oder wieder maßgeblich<br />
prägt. Im Osten der Stadt führen entwicklungspolitische Organisationen oft die Arbeit der Freundschaftsvereine aus<br />
der DDR-Zeit oder Aktivitäten der Bürgerbewegung fort.<br />
Nord-Süd-Initiativen können der Stadtpolitik <strong>Berlin</strong>s wesentliche Impulse geben. So könnte das Projekt der etwa in Brasilien<br />
erprobten Bürgerhaushalte (Mitentscheidung breiter Gruppen von Bürgern über die Verteilung knapper öffentlicher Mittel<br />
und Prioritätensetzung auf Grund der an der Basis wahrgenommenen Bedürfnisse) zu einer größeren Akzeptanz der notwendigen<br />
Maßnahmen zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt führen.<br />
Landesentwicklungspolitik – unverzichtbares Element eines zukunftsfähigen <strong>Berlin</strong><br />
Seit der Regierungszeit des letzten CDU/FDP-Senats taucht in diversen Papieren zur Aufgabenkritik und zur Haushaltssanierung<br />
des Landes <strong>Berlin</strong> (Beispiele: Bericht der Scholz-Kommission, Streichliste des ehemaligen Finanzsenator Kurth)<br />
der Vorschlag auf, die Landesentwicklungspolitik aus dem Aufgabenfeld des Landes <strong>Berlin</strong> vollständig zu streichen.<br />
Es bedurfte schon in der Vergangenheit immer wieder der Mobilisierung des parteiübergreifenden Sachverstands der im<br />
AH vertretenen Parteien über die jeweilige Regierungskoalition und der betroffenen entwicklungspolitischen Szene in <strong>Berlin</strong>,<br />
um dieses für das Leitbild der Nachhaltigkeit und Internationalität der Stadt unverzichtbare Politikfeld lebendig zu erhalten.<br />
Die Befürworter solcher Streichpläne argumentieren regelmäßig damit, dass Hilfsprojekte für Länder der Dritten Welt<br />
nicht Aufgabe des Landes <strong>Berlin</strong> seien, sondern genuiner Teil der Außenpolitik und damit allein Bundesaufgabe.<br />
Es geht bei der Landesentwicklungspolitik aber, wie die erst im Jahre 2001 in überarbeiteter Form beschlossenen „Entwicklungspolitischen<br />
Leitlinien“ des Senats ausweisen, nicht um „Entwicklungshilfe“, sondern um gleichberechtigte Kooperationsbeziehungen<br />
zwischen dem Land <strong>Berlin</strong> und den Partnerländern, deren Durchführung allein den Durchführungsorganisationen<br />
bestimmter Projekte, vor allem einer großen Zahl von Nichtregierungsorganisationen obliegt. Vorrangige Ziele<br />
sind das Lernen voneinander, die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf beiden Seiten, des Weiteren aber – über<br />
das Instrument der Public-Private-Partnership, der Zusammenarbeit von öffentlichen Trägern und der Privatwirtschaft, vor<br />
allem kleinen und mittleren Unternehmen- auch der Ausbau der internationalen Wirtschaftsbeziehungen des Landes <strong>Berlin</strong><br />
und des wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs.<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> fördert nur Projekte, die einen deutlichen Inlands- und <strong>Berlin</strong>-Bezug haben, die insbesondere einen Beitrag<br />
zur entwicklungspolitischen Bildung in der Stadt leisten.<br />
Entwicklungspolitik als Landesaufgabe<br />
Der Beschluss der Ministerpräsidenten von 1988 legt fest, dass die Länder „im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeiten<br />
und Möglichkeiten“ und „in Abstimmung mit der Bundesregierung ihren Beitrag zur Lösung aktueller Probleme<br />
des Nord-Süd-Verhältnisses leisten“. In einem Beschluss aus dem Jahre 1994 sehen die Ministerpräsidenten in der<br />
Entwicklungspolitik der Länder ein wesentliches Mittel zur Gestaltung des Rio-Folge-Prozesses.<br />
Als zeitgemäße Vorgaben für die Umsetzung dieser Aufgabenstellung fordert der LPT die <strong>SPD</strong>-Mitglieder im Senat und die<br />
AH-Fraktion auf, folgende Kernbereiche der Landesentwicklungspolitik zu erhalten, mit einer Zukunftsperspektive auszustatten<br />
und finanziell abzusichern:<br />
Sicherung des Kernbereichs der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit durch weitere Finanzierung<br />
des EPIZ auf der Basis des Haushaltsansatzes von 2002, weitere Unterstützung der schulischen Bildungsarbeit des<br />
DED und Erhaltung des Ansatzes für Projektmittel auf dem derzeitigen Niveau.<br />
Aufrechterhaltung von Kernbereichen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit durch Konzentration der Städtepartnerschaften<br />
der Bezirke und des Landes <strong>Berlin</strong> auf den Bereich Umwelt und Entwicklung.<br />
Sicherung und Ausbau der Angebote des Wissenschaftsstandorts <strong>Berlin</strong> durch weitere Förderung des internationalen<br />
Alumniprogramms der TU und Fortsetzung der institutionellen Förderung des Seminars für ländliche Entwicklung an der<br />
HU.<br />
Weitere Förderung des ASA-Programms von InWEnt (bisher Carl-Duisberg-Gesellschaft).<br />
Weiterverfolgung der Pläne zur mittelfristigen finanziellen Sicherung der NRO-Förderung mit Hilfe einer <strong>Berlin</strong>er Stiftung<br />
Entwicklung.<br />
Einrichtung eines Hauses oder Büros für internationale Zusammenarbeit als Zentrum der entwicklungspolitischen Lobbyarbeit,<br />
Kontaktpflege, des Austausches mit internationalen Gästen der Stadt und der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
12
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 13<br />
Antrag Nr. 11/I/03<br />
Annahme<br />
LDK Frauen<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der SPE-Fraktion im Europäischen Parlament werden aufgefordert, sich aktiv für die weitere Verankerung<br />
und Fortentwicklung des Gender-Mainstreaming, ins. der finanzpolitischen Instrumente (Gender-Budgeting) in den Vorgaben<br />
und Dokumenten für die Strukturfondsförderung nach 2006 einzusetzen. Durch die Vergabe von Gutachten und die<br />
Durchführung von Veranstaltungen ist ins. für diesen Bereich die bestehende Daten- und Wissensgrundlage kontinuierlich<br />
zu erweitern.<br />
Dabei ist ein besonderer Focus auf die Implementation von Gender-Budgeting in alle Ebenen der haushaltsrechtlichen<br />
Regelungen und Verfahren zu legen. Bei den im Jahr 2003 geplanten Anhörungen und Veranstaltungen auf europäischer<br />
Ebene zur Vorbereitung des 2. Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission ist sicherzustellen, dass sowohl Frauen-<br />
NGO als auch Länder und Kommunen mit besonderen Erfahrungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Gender-<br />
Budgeting beteiligt werden.<br />
13
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 14<br />
Leitantrag Kommunalpolitik<br />
Antrag Nr. 12/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.LPT:<br />
Landesvorstand<br />
<strong>Berlin</strong> erneuern<br />
Politische Herausforderungen am Anfang des 21. Jahrhunderts<br />
Sozialdemokratische Kommunalpolitik steht angesichts der schwierigen ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme<br />
unserer Zeit vor einer ernsten Bewährungsprobe. Mit dem Ausfall von Steuereinnahmen durch die ungünstige wirtschaftliche<br />
Entwicklung steigen die Ansprüche gegenüber der öffentlichen Hand. Die Kennzeichen der gegenwärtigen Situation sind:<br />
sinkende Steuereinnahmen durch hohe Arbeitslosigkeit, sinkendes Gewerbesteueraufkommen und die gleichzeitige Stagnation<br />
der Bevölkerungszahlen. Dagegen sind steigende Ausgaben für soziale Leistungen und zur Unterhaltung der technischen<br />
und sozialen Infrastruktur zu erbringen.<br />
Bei allen Reformanstrengungen, die jetzt unternommen werden müssen, bleibt das Interesse der <strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er<br />
an einem solidarischen Gemeinwesen der unverzichtbare Leitgedanke. Vor allem die lang andauernde Massenarbeitslosigkeit<br />
hat fatale Folgen für die Städte, dies zeigt sich besonders deutlich in <strong>Berlin</strong> mit einer Arbeitslosenquote von über 18 %.<br />
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in einer konzertierten Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte ist daher die erste<br />
Notwendigkeit für eine Bewältigung der Krise.<br />
Neue Politik für <strong>Berlin</strong><br />
Der Senat unter der Führung von Klaus Wowereit und die Koalitionsfraktionen haben einen deutlichen Mentalitätswechsel in<br />
der Stadt eingeleitet. Trotz ökonomischer und finanzieller Krisen wächst der Wille, die Zukunft der Stadt zu gestalten Die<br />
Menschen wissen, dass es grundlegende Veränderungen geben muss und dass dieser Senat bereit ist, schwierige Entscheidungen<br />
im Interesse der Stadt zu treffen. Wir halten an dem Ziel fest, die Finanzen <strong>Berlin</strong>s in Ordnung zu bringen. Der Konsolidierungskurs<br />
wird von Senat und Abgeordnetenhaus konsequent weiter verfolgt.<br />
<strong>Berlin</strong> hat bei all seinen Schwierigkeiten auch Potenzial:<br />
Mit seinem Metropolenraum von gut 4 Mio. Einwohnern,<br />
durch seine kreative Wissenschafts-, Forschungs- und Kulturlandschaft,<br />
durch ein großes Flächen- und Immobilienpotenzial für unterschiedliche Nutzungen,<br />
sowie eine funktionierende Stadtökologie und seine im Vergleich mit anderen Metropolen günstigen Lebenshaltungskosten.<br />
Durch die Erweiterung der Europäischen Union kann <strong>Berlin</strong> zukünftig eine Schlüsselposition in Mitteleuropa bekommen.<br />
Wir sind stolz auf die Fortschritte beim Zusammenwachsen der Stadt, aber es hat nach der Wende auch Fehleinschätzungen<br />
und Fehlentscheidungen gegeben. Die Stadt leidet weiterhin unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Teilung.<br />
Zusätzlich haben überdimensionierte Großprojekte in der Boom-Stimmung nach der Wiedervereinigung sowie die Krise der<br />
Bankgesellschaft die ohnehin dramatische Situation der Stadt zusätzlich verschärft.<br />
In der <strong>Berlin</strong>er Politik ist die Bereitschaft gewachsen die Probleme klarer zu benennen und aus eigener Kraft die notwendigen<br />
Entscheidungen zu treffen.<br />
<strong>Berlin</strong> muss sich auch als Teil der Entwicklung der Bundesrepublik begreifen. Neben hausgemachten und <strong>Berlin</strong> spezifischen<br />
Problemen muss unsere Politik mehr als früher die Situation der Bundesrepublik in Analysen und Programme einbeziehen.<br />
<strong>Berlin</strong> ist noch für einige Zeit auf die Solidarität des Bundes und der Länder angewiesen. Doch die frühere Sonderrolle <strong>Berlin</strong>s<br />
in Ost und West ist vorbei. Deshalb gilt für <strong>Berlin</strong>, was für die Bundesrepublik insgesamt zu erkennen ist. <strong>Berlin</strong> muss sich als<br />
Teil der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik begreifen:<br />
Die Bundesrepublik Deutschland hat in den gut fünfzig Jahren seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine positive Entwicklung<br />
genommen. Sicherung der Demokratie, äußere und innere Stabilität, wirtschaftliche Entwicklung, Ausbau der Sozialsysteme,<br />
Verbesserung des Bildungsangebots und eine funktionierende Verwaltung ermöglichten die Steigerung des Lebensstandards<br />
aller. Der demokratische Rechtsstaat, die soziale Marktwirtschaft, das föderale System der Bundesrepublik und die starke<br />
Stellung der Gemeinden waren Garanten dieser Entwicklung.<br />
Die Gemeinden als Orte, an denen die Bürgerinnen und Bürger Politik und staatliches Handeln am unmittelbarsten erfahren<br />
und mitgestalten können, werden heute jedoch finanziell ausgeblutet und fremdbestimmt mit Auf- und Ausgaben überlastet.<br />
Dabei müssen gerade sie schnell handeln, um die Infrastruktur den geänderten Strukturen anzupassen.<br />
Die Politik reagiert oft nicht schnell und entschieden genug auf gesellschaftliche Veränderungen. Die organisatorischen<br />
Strukturen machen das Verwaltungshandeln zunehmend ineffizient. Die Entscheidungsstrukturen in unserem System sind<br />
häufig kompliziert und erzeugen Ergebnisse, die eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners bedeuten.<br />
14
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 15<br />
Wir sichern einen handlungsfähigen Staat.<br />
Sozialdemokratie bedeutet 140 Jahre Kampf für eine solidarische Gesellschaft.<br />
In unserer Gesellschaft sind die ökonomischen und kulturellen Chancen immer noch ungleich verteilt. Teilhabe ist nach unserem<br />
Verständnis weit mehr als nur dabei sein. Zu unserem Gesellschaftsbild gehört die Teilhabe aller an den staatlichen<br />
Entscheidungen und dem wirtschaftlichen Erfolg. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit herzustellen und die zu schützen,<br />
die auf sich allein gestellt nicht zu Recht kommen, sind die zentralen Aufgaben eines handlungsfähigen Staates.<br />
Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bedeutet der Begriff Freiheit immer „Möglichst viele Möglichkeiten zu haben“.<br />
Es geht also darum, die Bedingungen für jeden zu schaffen, alle Möglichkeiten tatsächlich ausschöpfen zu können. Dies ist<br />
nur in einer solidarischen Gesellschaft möglich. Die Aufgabe des Staates besteht in der Vermittlung von Solidarität und damit<br />
in der Organisation von Partizipation.<br />
Zahlreiche Bürgerinitiativen und Emanzipationsbewegungen zeigen den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach mehr<br />
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Die Differenzierung der Lebensstile und Lebensverhältnisse führt darüber hinaus<br />
zu geänderten Ansprüchen an staatliches Handeln, von der Forderung nach mehr individueller Freiheit bis zur Forderung<br />
nach mehr sozialem Schutz.<br />
Die Krise der öffentlichen Haushalte, die sich bei den Kommunen als dem letzten Glied der Kette am besonders zugespitzt<br />
hat, setzt den Sozialstaat von zwei Seiten unter Druck. Einerseits werden Verteilungsspielräume enger. Andererseits verliert<br />
ein schwächer werdender und immer weniger als helfend wahrgenommener Staat an Akzeptanz. Wer den Sozialstaat lediglich<br />
als Abzugsposten auf der Lohnabrechnung wahrnimmt, wird für die neoliberale Deregulierungslogik grundsätzlich empfänglich<br />
sein.<br />
Dabei gilt die Aussage, „einen schwachen Sozialstaat können sich nur die Reichen leisten“. Die durch die wirtschaftliche<br />
Stagnation erzeugte soziale Unsicherheit hat mittlerweile längst gut ausgebildete Berufsgruppen erreicht. Hier spielt nicht nur<br />
die reale oder drohende materielle Not eine Rolle, sondern die Angst vor Verlust an gesellschaftlicher Teilhabe und Entwertung<br />
des Arbeitsvermögens. Auf den Sozialstaat angewiesen sind also nicht nur die Ärmsten, sondern bereits die Mitte der<br />
Gesellschaft. Gleichzeitig führen gewollte oder erzwungene Lebensstilveränderungen zu neuen Bedürfnissen nach sozialer<br />
Sicherheit. Öffentliches Handeln muss sich darauf konzentrieren, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.<br />
Nur wenn es gelingt, möglichst viele für ihre eigenen Angelegenheiten zu aktivieren und für sich und andere selbst Verantwortung<br />
zu übernehmen, werden wir den Staat leistungs- und handlungsfähig erhalten und das Bewusstsein für das Gemeinwesen<br />
stärken. Auch von der Wirtschaft erwarten wir, dass sie ihre Verantwortung für das Gemeinwesen sieht und trotz<br />
aller Zwänge, die sich aus dem internationalen Wettbewerb in einer globalisierten Welt ergeben, danach handelt.<br />
Mehr bürgerschaftliches Engagement bedeutet auch mehr Freiheit und Partizipation an Entscheidungen. Wir werden die<br />
Voraussetzungen schaffen, dass die Betroffenen selbst mitentscheiden und Verantwortung übernehmen können. Bürgerrechte<br />
dürfen nicht nur Abwehrrechte, sondern müssen Gestaltungsrechte sein. Bürgerschaftliches Engagement braucht dezentrale<br />
und vernetzte Strukturen, in denen Aufgaben- und Ausgabenverantwortung wahrgenommen werden.<br />
Dort wo Raum für privates Engagement entsteht, bleibt der Staat in der sozialen Verantwortung. Gerade die sozial Schwachen<br />
brauchen ein handlungsfähiges Gemeinwesen. Und wir wissen: Eigeninitiative und Bürgersinn gedeihen nur in einer<br />
Gesellschaft, die soziale Rücksichtnahme, solidarisches Handeln und eine gemeinsame Zukunftsperspektive verbindet.<br />
Das Ziel unserer Politik muss sein:<br />
die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten,<br />
die Voraussetzungen für weitere wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen,<br />
Raum für ziviles Engagement zu geben,<br />
ein solidarisches Gemeinwesen zu fördern,<br />
gleiche Chancen für alle zu eröffnen,<br />
und Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit herzustellen.<br />
Neue Strukturen in <strong>Berlin</strong> schaffen.<br />
In <strong>Berlin</strong> haben sich durch die historische Entwicklung vor dem Mauerfall besonders staatsorientierte und ineffektive Strukturen<br />
in Ost und West herausgebildet. Die Stadt sorgte für Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor (Verwaltung und öffentliche<br />
Betriebe) um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Das können wir so nicht fortführen<br />
Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass in <strong>Berlin</strong> wieder mehr Arbeitsplätze durch wirtschaftliche Dynamik entstehen<br />
und Wachstum in sozialer Ausgewogenheit möglich ist.<br />
Industrie und produzierendes Gewerbe haben in <strong>Berlin</strong> an Bedeutung verloren. In der Zukunft werden handelbare Informatio-<br />
15
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 16<br />
nen, Wissen und Kultur an Bedeutung gewinnen. Sie stellen wichtige Entwicklungspotenziale <strong>Berlin</strong>s dar, die zu einer neuen<br />
ökonomischen Basis führen können. <strong>Berlin</strong> verfügt über hervorragende Potenziale im Wissensmanagement, in der wissenschaftlichen<br />
Ausbildung und in den staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Diese gilt es trotz der Haushaltskrise<br />
zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wir bekräftigen unsere Zielsetzung, Wissen als Schlüsselressource zu begreifen<br />
und den Wissenschaftsstandort <strong>Berlin</strong> zu entwickeln.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er Wirtschaft muss ein Spezialisierungsprofil herausbilden. Nur ein solches Profil kann zum Entstehen qualitativ<br />
hochwertiger Arbeitsplätze führen. Die Stärkung der wirtschaftlichen Basis ist auch eine notwendige Voraussetzung für die<br />
Konsolidierung des Landeshaushalts.<br />
Unter moderner Wirtschaftsförderung verstehen wir die Gewährleistung optimaler Entfaltungsmöglichkeiten für Branchen mit<br />
Wachstumspotenzial. Dazu gehört in <strong>Berlin</strong> unbedingt auch die Entwicklung des Fremdenverkehrs. . Um die Konkurrenzfähigkeit<br />
und die Attraktivität <strong>Berlin</strong>s gegenüber anderen europäischen Metropolen zu erhöhen, wollen wir für <strong>Berlin</strong> den gesetzlich<br />
geregelten Ladenschluss abschaffen. Damit wird der Sonntag durch die Feiertagsgesetzgebung wirksam geschützt,<br />
während insbesondere die touristisch attraktiven Zonen der Innenstadt montags bis Samstags ihr Angebot optimieren können.<br />
Wir stellen fest, dass einige der bisherigen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen nicht dazu beigetragen haben, ein Spezialisierungsprofil<br />
zu entwickeln: Die einzelbetriebliche Wirtschaftsförderung hat in den ersten Jahren nach der Vereinigung Sinn<br />
gemacht, um die unmittelbare Transformation zu bewältigen. Nun aber mehren sich die Anzeichen, dass in einigen Fällen<br />
dauerhafte Abhängigkeiten von Subventionen entstehen. Deren Finanzierung kann sich <strong>Berlin</strong> aber weder leisten noch ist sie<br />
wünschenswert.<br />
Zielrichtung der Wirtschaftspolitik muss es auch sein, durch Wachstum der bestehenden Unternehmen und Neugründungen<br />
wirtschaftliche Felder zu entwickeln, in denen regionale Netzwerke Produkte für den deutschen und internationalen Markt<br />
herstellen. Besonders das Wachstum im Bereich der Neuen Technologien, das durch eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik<br />
angeregt worden ist, muss durch eine hocheffiziente Begleitung von Seiten der Verwaltung gesichert und befördert werden.<br />
Mit der Gründung einer One-Stop-Agency werden die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Wirtschaftsförderung geschaffen.<br />
Für jedes Investitionsvorhaben wird dem Investor ein Ansprechpartner zugeordnet, der das Management der behördlichen<br />
Vorgänge übernimmt und den Investor bis zum Abschluss des Investitionsvorhabens begleitet. Aber erst wenn die interessierten<br />
Investoren sich auch örtlich an eine Adresse wenden können, ist das Prinzip der One-Stop-Agency verwirklicht.<br />
Die Wirtschaftspolitik sollte in erster Linie zwischenbetriebliche Kooperationen/Netzwerke und Existenzgründer fördern.<br />
Auch die Wirtschaft muss endlich ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl gerecht werden. Bei knappen Kassen können die<br />
Unternehmen nicht länger Steuergeschenke und immer neues Entgegenkommen bei Standortentscheidungen erwarten,<br />
ohne ihrerseits Verpflichtungen einzugehen, Arbeitsplätze zu schaffen und junge Menschen auszubilden.<br />
Sollte die Ausbildungsplatzmisere nicht behoben werden, treten wir für die Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe ein.<br />
<strong>Berlin</strong> wird der privaten Initiative Raum geben. Wir werden unsere Landesgesetze und andere Regelungen entschlacken.<br />
Verordnungen und Regelungen haben einen Umfang erreicht, der sich teilweise zu staatlicher Bevormundung entwickelt. Im<br />
Zweifel muss etwas erlaubt und nicht verboten sein. Wir werden privates Engagement unterstützen und dezentrale, bürgerfreundliche<br />
Strukturen fördern.<br />
Wir werden den Ausbau wie auch die vorhandene Infrastruktur insgesamt auf den Prüfstand stellen. Nicht alles, was wünschenswert<br />
wäre, ist heute noch finanzierbar. Zudem stellt sich vor dem Hintergrund zurückgehender Bevölkerungsprognosen<br />
die Frage nach einer ausreichenden Nutzung. Die Praxis, in Infrastrukturmaßnahmen zu investieren, ohne die Folgekosten<br />
seriös zu kalkulieren, wird beendet. Das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche - von den bezirklichen Einrichtungen bin<br />
zu den großen Verkehrsprojekten.<br />
Sozialdemokratische Stadtpolitik verfolgt das Ziel, eine sozialorientierte Stadtentwicklung als Markenzeichen moderner Urbanität<br />
zu etablieren. Heute haben wir erstmals in der Geschichte der Stadt keine Wohnungsnot. Ein von Sozialdemokraten<br />
geschaffenes soziales Mietrecht bietet soziale Sicherheit. Daher war der Ausstieg aus der staatlichen Wohnungsbauförderung<br />
folgerichtig und ein Schritt zur Konsolidierung des Landeshaushalts und zur Normalisierung des Wohnungsmarktes.<br />
Aktuell besteht weniger die Gefahr einer neuen Wohnungsnot, als einer sich verstärkenden sozial-räumlichen Polarisierung in<br />
der Stadt.<br />
Sozialdemokratische Stadtpolitik muss dieser Polarisierung durch ein Wohn- und Mietenkonzept entgegenwirken und Haushalten<br />
mit niedrigen Einkommen angemessene Wohnmöglichkeiten garantieren. Notwendig ist daher weiterhin die Verfügbarkeit<br />
von Wohnraum auch in öffentlichem und genossenschaftlichem Eigentum als Korrektiv zu einem überwiegend marktförmig<br />
verfassten Wohnungsmarkt. Daneben stellt die Subjektförderung ein wichtiges Element des Mietenkonzepts dar.<br />
16
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 17<br />
Wir wollen die Bedingungen für Familien mit Kindern so ausgestalten, dass es gerade auch für junge Menschen attraktiv ist,<br />
nach <strong>Berlin</strong> zu kommen und hier Familien zu gründen. Die Integration von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft<br />
und besonders die Förderung ihrer Sprachkompetenz ist dabei für <strong>Berlin</strong> eine zentrale Aufgabe.<br />
Wir haben heute im Bundesvergleich eine sehr gute Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Ziel der Bundesregierung,<br />
jedem Kind im Alter zwischen drei und sechs Jahren einen Kindergartenplatz zu garantieren, ist in <strong>Berlin</strong> erreicht und<br />
wird auch zukünftig gewährleistet. Die Kindergartenbetreuung für Kinder von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt wird<br />
künftig als Bestandteil der Leistung von den Zahlungen abgezogen. Zusätzlich wird ein Programm „Kinder lernen spielend<br />
deutsch“ in den sozialen und ethnischen Brennpunktgebieten der Stadt aufgelegt.<br />
Wir streben mittelfristig eine flächendeckende Ganztagsschulversorgung an und fordern den Senat auf, einen Entwicklungsplan<br />
zur Einrichtung von Ganztagsschulen vorzulegen. Mütter und Väter sollen in <strong>Berlin</strong> Beruf und Familie gut miteinander<br />
vereinbaren können. Eine moderne Gesellschaft ist auf die Fähigkeiten der Frauen angewiesen.<br />
Wir sehen den Schwerpunkt unserer Politik im Ausbau eines leistungs- und wettbewerbsfähigen, öffentlichen Bildungssystems,<br />
das allen Zukunftschancen eröffnet. Und wir wissen, dass die Basis für die Erreichung dieser Ziele die Konsolidierung<br />
der Finanzen ist, denn auch folgende Generationen haben Anspruch auf einen handlungsfähigen Staat.<br />
<strong>Berlin</strong> ist eine Stadt, die die Gleichberechtigung der Geschlechter ernst nimmt und die Entfaltung individueller Lebensstile<br />
und -entwürfe ermöglicht. Wir wollen diese Stärke <strong>Berlin</strong>s weiter entwickeln und dabei die Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft<br />
stärken. Dazu ist es notwendig, gerade vor dem Hintergrund der schwierigen ökonomischen Entwicklung die Chancen<br />
für Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.<br />
Unsere Gesellschaft wird älter. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Angebote für Senioren ausbauen. Dazu gehören alle<br />
Formen des Lebens im Alter wie Betreutes Wohnen, Versorgung von Senioren in ihrer eigenen Wohnung bis hin zur stationären<br />
Altenpflege. Auch ihre Teilhabe an Politik und dem gesellschaftlichen Leben muss gewährleistet werden.<br />
Zu den unverzichtbaren Elementen eines solidarischen Gemeinwesens gehört das Ziel möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse<br />
in der ganzen Stadt. Mentalitätswechsel bedeutet für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht die<br />
Anwaltschaft für die sozial Schwachen abzustreifen. Unsere Politik ist weiterhin darauf gerichtet allen eine gleichberechtigte<br />
Teilhabe am Bildungs- und Gesundheitssystem sowie am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und<br />
eine weitestgehende Chancengleichheit herzustellen. Insbesondere in den Bezirken mit hohem Anteil von Immigrantinnen<br />
und Immigranten sowie Spätaussiedlern an ihrer Bevölkerung muss der Besorgnis erregende Prozess der Segregation gestoppt<br />
werden. Den Bezirken, die die Hauptlast der Integration zu tragen haben und deren Erfolg entscheidend für den Erhalt<br />
des inneren Friedens und die Bewahrung des sozialen Gleichgewichts der Stadt ist, werden wir durch finanzpolitische<br />
Schwerpunktsetzungen Handlungsspielräume eröffnen. Ein weiterer Schlüssel für diese Aufgabe ist die Verbesserung des<br />
Quartiersmanagements. Wir werden daher die erfolgreichen Instrumente des Quartiersmanagements weiterentwickeln. Wir<br />
wollen, dass die Menschen die Gestaltung ihres Wohn- und Lebensumfeldes selbst in die Hand nehmen.<br />
<strong>Berlin</strong> hat in den letzten Jahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Reihe öffentlicher Unternehmen verkauft. In<br />
vielen Bereichen öffentlicher Dienstleistungen werden die Ausgliederung der Leistungserbringung aus den bestehenden<br />
Verwaltungsstrukturen und ihre Übertragung an freie Träger forciert. Auch hier bestimmen meist fiskalische Zwänge das<br />
Handeln auf gesamtstädtischer und bezirklicher Ebene.<br />
Alle diese Prozesse finden unter dem Schlagwort „Privatisierung” statt, sie sind jedoch inhaltlich höchst unterschiedlich zu<br />
bewerten. Grundsätzlich gilt, dass die Eigentümerstellung der öffentlichen Hand und die eigene Aufgabenwahrnehmung nur<br />
eine Möglichkeit darstellt, die Qualität der Leistung und die Orientierung an Gemeinwohlzielen bei der Erstellung öffentlicher<br />
Dienstleistungen zu sichern. Alternative Steuerungsinstrumente wie gesetzliche oder vertragliche Regelungen können an<br />
deren Stelle treten.<br />
Dabei teilen wir die Auffassung des deutschen Städtetages, dass bei der Übertragung bislang öffentlicher Aufgaben an Dritte<br />
grundsätzlich zu prüfen ist, ob sich eine Übertragung unter Berücksichtigung aller anfallenden Kosten, der Sicherung der<br />
definierten Qualitätsstandards und der sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen als günstiger erweist.<br />
Wir wollen im Bereich sozialer und kultureller Dienstleistungen die Kooperation der öffentlichen Hand mit freien Trägern verstärken.<br />
Der Bereich der Jugendhilfe, in dem das schon heute stark ausgeprägt ist, kann beispielgebend sein. Dies dient der<br />
Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Das bedeutet keinen „Rückzug“ des Staates. Voraussetzung ist, dass die verbleibenden<br />
Steuerungsmittel der öffentlichen Hand wie z.B. die Gestaltung von Ausschreibungen und ein Vertragsmanagement<br />
kompetent genutzt werden.<br />
Deshalb muss dort eine weitere Privatisierung öffentlicher Unternehmen unterbleiben, wo die Gefahr besteht, dass die Gemeinwohlziele<br />
des Landes <strong>Berlin</strong> nicht mehr gegenüber den Renditeerwartungen privater Investoren durchgesetzt werden<br />
können. Für diese Unternehmen muss die Ausrichtung auf die vorgegebenen Gemeinwohlziele bei stetiger Verbesserung von<br />
Effizienz und Wirtschaftlichkeit das prägende Merkmal sein. Die in der Vergangenheit gehegte Vorstellung, die landeseigenen<br />
Unternehmen zu „global players” zu machen, hat sich hingegen als kostspielige Illusion erwiesen. Der Verbleib in der<br />
17
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 18<br />
Eigentümerschaft des Landes <strong>Berlin</strong> kann seine Rechtfertigung auch nicht in einem globalen Marktauftritt dieser Unternehmen<br />
finden. Im Gegenteil: Den <strong>Berlin</strong>er Steuerzahlern kann angesichts sinkender staatlicher Leistungen nicht zugemutet<br />
werden, die risikoreichen unternehmerischen Aktivitäten außerhalb der Stadt zu finanzieren. Öffentliche Unternehmen erhalten<br />
ihre Legitimation allein aus der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den sie für das Gemeinwesen erfüllen. Hierzu steht ihre<br />
Ausrichtung auf den internationalen Wettbewerb in einem Widerspruch. Dieser sollte dem privaten Sektor überlassen bleiben.<br />
Gerade weil der marktwirtschaftliche Wettbewerb für soziale, ökologische und kulturelle Gemeinwohlziele keinen Raum<br />
lässt, betrachten wir öffentliche Unternehmen mit einem klar definierten Gemeinwohlauftrag als das notwendige Korrektiv im<br />
Interesse der Menschen.<br />
Wir werden auch in anderen Bereichen größere Flexibilität bei gleichzeitiger Qualitätssicherung durch Wettbewerb erzeugen.<br />
Leistungen, die durch freie Träger im Sozial- und Jugendbereich erbracht werden, sollen ausgeschrieben und durch bessere<br />
Steuerung ziel- und wirkungsorientiert eingesetzt werden. Maßstab für die Finanzierung sind Leistung und Erfolg.<br />
Wir werden die Verwaltungsstrukturen so verändern, dass BürgerInnen für ihr Anliegen einen Ansprechpartner haben, der sie<br />
zudem auch als Partner behandelt. Die Einrichtung der Bürgerämter ist ein erster richtiger Schritt in diese Richtung. Die Anstrengungen<br />
Menschen mit Migrations-Hintergrund den Zugang zum öffentlichen Dienst zu erleichtern sind zu intensivieren.<br />
Durch die Beschlüsse zur Verwaltungsreform sind in vielen Bereichen Doppelstrukturen abgebaut worden. Dennoch gibt es<br />
noch immer zu viele konkurrierende Entscheidungsprinzipien und -strukturen. Daher werden wir in einem weiteren Reformschritt<br />
Zuständigkeiten eindeutig zuordnen und Verfahren übersichtlicher gestalten.<br />
Die Verwaltung darf nicht ressort-, sondern muss projektorientiert vorgehen. Komplexe und komplizierte Verwaltungsstrukturen<br />
sind weder bürger- noch investorenfreundlich. Die Kosten öffentlicher Leistungen müssen transparent gemacht werden.<br />
Wir brauchen ein zielorientiertes Controlling auf allen Ebenen.<br />
Wir werden flexiblere Strukturen schaffen. Im öffentlichen Dienst gibt es viele leistungsfähige und -willige Mitarbeiter. Das<br />
Dienstrecht und die Organisation setzen aber Rahmenbedingungen, die oft Leistung hindern und demotivierend wirken.<br />
Schlanke Strukturen und Delegation von Verantwortung sind nötig.<br />
Die Einrichtung bezirklicher Ordnungsämter wollen wir vorantreiben und durch die Erhöhung von Strafgebühren und die Bereitstellung<br />
zusätzlich benötigten Personals aus dem landesweiten Personalüberhang einen zusätzlichen Anreiz dazu schaffen.<br />
Wir werden Initiativen unterstützen, die Dienstrechtsstrukturen flexibler zu gestalten und eine leistungsgerechte Besoldung zu<br />
ermöglichen. Darüber hinaus ist es dringlich, den Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT) zu reformieren. Schon jetzt werden<br />
wir den Vorschlag umsetzen, den Beamtenstatus, soweit das bei der gegenwärtigen Rechtslage möglich ist, auf die Bereiche<br />
Polizei, Justiz und Finanzbehörden zu beschränken.<br />
Wir brauchen die Gewerkschaften als selbstbewusste Partner im Prozess der Erneuerung. Dabei erkennen wir ihre besondere<br />
Verantwortung für eine sozial gerechte Verteilung der Lasten im Interesse der Arbeitnehmerinnen.<br />
Zentral für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist eine professionelle Personalführung und ein Personalmanagement.<br />
Nicht nur Sachkenntnisse dürfen Voraussetzung für die Besetzung von leitenden Stellen sein, sondern ebenso Personalführungskompetenzen.<br />
Wir brauchen regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und<br />
flexiblere Aufstiegskanäle. Wir wollen weitere Arbeitszeitverkürzungen und ihre sinnvolle Verzahnung mit Weiterbildungsangeboten.<br />
So können Einspareffekte sozialverträglich bei gleichzeitigem Erhalt und Ausbau der vorhandenen Kompetenzen<br />
erreicht werden.<br />
Wir fordern Gewerkschaften und Senat auf, die Tarifverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.<br />
Im Interesse der Jugend dieser Stadt brauchen wir einen Solidarpakt im öffentlichen Dienst.<br />
Dezentralität heißt: Die Bezirke müssen mehr Verantwortung übernehmen.<br />
Die Millionenstadt <strong>Berlin</strong> ist Einheitsgemeinde mit politisch geführter Hauptverwaltung und politisch geführten Bezirksverwaltungen.<br />
Daran wollen wir auch nach der Fusion der Länder <strong>Berlin</strong>/Brandenburg festhalten. Wir Sozialdemokratinnen und<br />
Sozialdemokraten bekennen uns zum Erhalt und zur Stärkung dezentraler bezirklicher Strukturen in <strong>Berlin</strong>. In den Bezirken<br />
kann der Nachweis geführt werden, dass sozialstaatliche Absicherung der Bürgerinnen und Bürger und öffentliche Leistungen<br />
nicht gleichbedeutend sind mit Bevormundung und Entmündigung durch zentralistische bürokratische Institutionen. In<br />
den Bezirken bietet die Kommunalpolitik ein breites Spektrum von Möglichkeiten der Partizipation und Selbstbestimmung in<br />
einem sozialen Gemeinwesen.<br />
Kommunale Selbstverantwortung der Menschen setzt die Identifikation mit ihren jeweiligen Kiezen voraus. Diese sind in der<br />
Regel wesentlich kleinteiliger als die neuen fusionierten Bezirke. Hier gilt es vorhandene Ressourcen (öffentliche und private)<br />
zu bündeln. Die gegenwärtige Diskussion über Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe kann beispielgebend sein auch für<br />
andere Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Finanzierung der Jugendarbeit muss auch in den Zeiten des Haushaltsnotstandes<br />
gesichert werden. Wo durch Überschneidung von Kompetenzgrenzen Reibungsverluste entstehen, müssen<br />
18
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 19<br />
die Verantwortungsbereiche unterschiedlicher Behörden aufeinander abgebildet werden. Besonders in Problemgebieten<br />
kommt es darauf an, dass die Grenzen der Einzugsbereiche von Schulen, der Zuständigkeitsbereiche des Jugendamtes und<br />
des Sozialamts, der QM-Gebiete, der Polizeiabschnitte und der Zuständigkeitsbereiche der Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit<br />
in einem Schichttortenmodell zur Übereinstimmung gebracht werden, um Abstimmungsprozesse unter den<br />
entscheidenden Akteuren zu erleichtern.<br />
Durch die Bezirksgebietsreform sind leistungsfähige Verwaltungseinheiten geschaffen worden, ohne dass regionale Identität<br />
verloren ging. Damit haben wir Voraussetzungen für funktionsfähige, dezentrale und bürgerfreundliche Strukturen geschaffen.<br />
Aber die Realität zeigt, dass noch bei weitem nicht in allen Bereichen projekt- und Serviceorientiert gearbeitet wird. Viele, die<br />
in <strong>Berlin</strong> investieren wollen, fühlen sich bei den Behörden nicht willkommen. Zwischen Senat und Bezirken gibt es oft unproduktiven<br />
Streit.<br />
Grundlage einer gestaltungsstarken Stadtpolitik ist das gemeinsame Bewusstsein für gesamtstädtische Ziele und Aufgaben.<br />
Wir Sozialdemokraten auf Bezirks- und Senatsebene müssen begreifen, dass diese beiden Ebenen Teile eines Ganzen sind.<br />
Sie bilden eine Verantwortungsgemeinschaft, die auf klar zugewiesenen Kompetenzen und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten<br />
beruhen muss. So haben die Bezirke die Pflicht, bei lokalen Entscheidungen die gesamtstädtische Dimension mitzudenken.<br />
Zugleich muss die Landesebene erkennen, dass sie gesamtstädtische Belange nicht allein verwirklichen kann. Denn die<br />
Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen beruht auf Transparenz, Teilhabe und lokaler Eigenverantwortung. Jenseits<br />
einer ausreichend geregelten Grundgleichheit, müssen dabei Unterschiede im Vollzug und in der Ausstattung zugelassen<br />
werden. Nur so können Engagement und Kreativität geweckt und erhalten werden.<br />
Alle politische und Verwaltungserfahrung zeigt, dass dezentrale Strukturen effizienter sind, wenn Ausgaben- und Aufgabenverantwortung<br />
zusammengeführt werden. Allerdings muss es auch haushaltsbezogene Anreizsysteme geben, um politisch<br />
konfliktreiche Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, wenn dies für die Entwicklung des Standorts positiv ist.<br />
Wir wollen deshalb die dezentralen Strukturen beibehalten und eine starke kommunale Selbstverwaltung, weil die BürgerInnen<br />
vor Ort so Demokratie am unmittelbarsten erleben und die Probleme sachbezogen gelöst werden können.<br />
Auch wenn die Bezirke keine selbständigen Gebietskörperschaften sind, ist ihre politische Führung sinnvoll, weil sich auf<br />
diese Weise Demokratie von unten nach oben aufbaut. Kompetenz heißt aber auch Verantwortung. Wenn ein Bezirk diese<br />
nicht wahrnimmt, muss der Senat wie eine Kommunalaufsicht eingreifen können. Und da, wo Entscheidungen in ihren Wirkungen<br />
weit über die Bezirksgrenzen hinausgehen, muss der Senat selbst Entscheidungen treffen können. Die Stellung des<br />
Rates der Bürgermeister bei der Entscheidung über strittige Zuständigkeiten ist zu stärken. Die Strukturen in Senat und Bezirksämtern<br />
müssen weitgehend aneinander angepasst werden.<br />
Hohe Arbeitslosigkeit und in der Folge hohe Soziallasten haben die Gestaltungsmöglichkeiten der Bezirke eingeengt. Die<br />
Finanzkrise ist auch eine Krise der Bezirke. Viele Bezirke sehen sich angesichts der sinkenden Budgets nicht mehr in der<br />
Lage, ihre Aufgaben im derzeitigen Umfang angemessen zu erfüllen.<br />
Auch unter den Bedingungen der Haushaltsnotlage in <strong>Berlin</strong> ist funktionierende Kommunalpolitik nicht ohne Geld möglich.<br />
Dabei ist die Verlässlichkeit der Finanzausstattung ein zentrales Anliegen. Darüber hinaus sind aber auch verstärkt aufgabenund<br />
ausgabenkritische Betrachtungen auf Basis einheitlicher Landesnormen in den Bezirken notwendig. Eine weitere Zentralisierung<br />
kommunaler Aufgaben ist keine Lösung.<br />
Bei Aufgabenübertragungen vom Senat an die Bezirke sowie beim Abschluss von Verträgen des Senats mit Dritten zu Lasten<br />
der Bezirke werden vom Senat die zur Aufgabenwahrnehmung die erforderlichen finanziellen und personellen Mittel den<br />
Bezirken zur Verfügung gestellt.<br />
Die Finanzierung der Bezirke erfolgt durch Globalsummen, die das Abgeordnetenhaus ausgabenbezogen zuweist. Demnächst<br />
wird dieses Zuweisungssystem leistungsbezogen umgestellt. Wir fordern vom Senat, dass er in diesem Rahmen die<br />
politischen Entscheidungsmöglichkeiten über inhaltliche Prioritätensetzung und Umschichtungen zwischen den Produktbudgets<br />
den Bezirken überlässt.<br />
Angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeiten im Land <strong>Berlin</strong> werden die Bezirke auch in den kommenden Jahren sinkende<br />
Budgets haben. Um Strukturmaßnahmen vorantreiben zu können, bedarf es aber entsprechender Handlungsspielräume. Bei<br />
den konsumtiven Sachausgaben der Bezirke wird daher ein zweijähriges Moratorium für die Sparvorgaben erlassen. Wir<br />
erwarten allerdings von der anstehenden Reform der Kommunalfinanzverfassung eine Verstetigung der Gewerbesteuereinnahmen<br />
für <strong>Berlin</strong>. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> fordert eine Reform, die die Gewerbesteuer als Interessenklammer zwischen Wirtschaft<br />
und Kommune erhält, auf eine wesentlich breitere Basis stellt und konjunkturunabhängiger macht. Die Bezirke sind entscheidend,<br />
wenn es um Bestandspflege und Gewerbeansiedlung geht.<br />
Wir fordern auch deshalb ein Anreizsystem, damit die Bezirke bereit sind, die damit oft verbundenen politischen Konflikte<br />
produktiv auszutragen. Deshalb sollte geprüft werden, ob die Budgetierung um eine steuerbezogene Komponente ergänzt<br />
werden kann. Wenn die Bezirke dauerhaft an den Gewerbesteuereinnahmen, die auf ihrem Gebiet erzielt werden, beteiligt<br />
sind und ihre Gestaltungsmöglichkeiten damit unmittelbar von der Steigerung oder dem Absinken der Steuereinnahmen ab-<br />
19
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 20<br />
hängen, werden sie wirtschaftsfreundlicher agieren.<br />
Wir wollen die Fusion mit Brandenburg im Jahre 2009, um die Interessen und Entwicklungen in der Region besser aufeinander<br />
abzustimmen und als ein Land mit dann rd. sechs Millionen Einwohnern unsere Stimme im Bundesrat und in einem <strong>Europa</strong><br />
der Regionen mit entsprechendem Gewicht einbringen zu können.<br />
Im Zusammenhang mit der angestrebten Vereinigung von <strong>Berlin</strong> und Brandenburg wird der Landesvorstand aufgefordert, bis<br />
zum Jahresparteitag 2004 einen Gesamtvorschlag für die zukünftige Organisation der Bezirke und die Aufgabenverteilung<br />
zwischen Hauptverwaltung und Bezirksverwaltungen vorzulegen.<br />
In diesem Vorschlag sollen vor allem folgende Fragestellungen behandelt werden:<br />
Wie sollen die Bezirksämter zukünftig organisiert werden? (Wahlverfahren öffentlich, Wahlverfahren in der BVV, Politisches<br />
Bezirksamt, Direktwahl BezirksbürgermeisterIn, Zahl der BA-Mitglieder, Status der StadträtInnen, Ressortverteilung,<br />
usw.)<br />
Wie wird die Arbeit der BVV-Mitglieder optimiert<br />
Welche Verbesserungen in der Finanzausstattung der Bezirke werden angestrebt (Frage der eigenen Steuereinnahmen,<br />
wenn ja, mit welchem Verfahren)?<br />
Sollen zusätzliche Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten dezentral eingerichtet werden? Welche Verfahren würden dabei zum<br />
Zuge kommen? Wie kann die bürgernahe Verwaltung weiter entwickelt werden? (Wahlverfahren, Panaschieren, Kumulieren,<br />
Wahlkreise, Ausstattung, Zahl usw.)<br />
Wie wird die Aufgabenteilung zwischen Hauptverwaltung und Bezirksverwaltung eindeutiger geregelt?<br />
Welche unterscheidbaren kommunalen Kompetenzen werden Hauptverwaltung und Bezirke nach einer Fusion haben?<br />
Welche Funktion wird bestimmten Gremien zugeordnet (u.a. Rat der Bürgermeister)?<br />
Die Vorschläge sind im Vorfeld des Jahresparteitages 2004 in den Kreisen ausführlich zur Diskussion zu stellen.<br />
Wir wollen an der Entwicklung eines neuen sozialen Grundkonsenses in unserer Stadt mitwirken. Wir Sozialdemokraten<br />
stehen für eine vernünftige, soziale und menschengerechte Weiterentwicklung unserer Stadt und unserer Gesellschaft. Wir<br />
rufen alle Bürger auf, daran mitzuwirken. Wenn alle <strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er Verantwortung übernehmen, hat unsere Stadt<br />
eine Chance.<br />
Konflikte müssen mit friedlichen Mitteln gelöst werden, ob auf internationaler Bühne, im Bezirk oder im Quartier. Wir stehen<br />
für ein friedliches Zusammenleben, für einen handlungsfähigen Staat und für die Förderung einer Marktwirtschaft mit<br />
menschlichem Gesicht.<br />
So hat <strong>Berlin</strong> eine Zukunft.<br />
20
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 21<br />
Durch die Beschlussfassung des Leitantrages Kommunalpolitik sind folgende Anträge erledigt:<br />
13/I/03 KDV CharlWilm<br />
14/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
15/I/03 Abt. 6/FrhainKreuz<br />
16/I/03 KDV Reinickendorf<br />
17/I/03 KDV Spandau<br />
18/I/03 Abt. 6/StegZehl<br />
19/I/03 KDV TempSchön<br />
20/I/03 KVV TrepKöp<br />
21/I/03 Abt. 12 und KDV FrhainKreuz<br />
22/I/03 KDV CharlWilm<br />
23/I/03 KDV Spandau<br />
24/I/03 Abt. 04/Neukölln<br />
25/I/03 FA V Stadt des Wissens (Überweisung an die vom LV einzurichtende AG)<br />
26/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
27/I/03 AG 60 plus<br />
28/I/03 Abt. 11/Spandau<br />
29/I/03 FA II/EU-Angelegenheiten<br />
30/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
31/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
32/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
33/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
34/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
35/I/03 KDV FrhainKreuz<br />
36/I/03 KDV Mitte<br />
37/I/03 KVV MarzHell<br />
38/I/03 Abt. 05/Neukölln<br />
39/I/03 Abt. 01/Neukölln<br />
40/I/03 KDV Pankow<br />
41/I/03 Abt. 05/FrhainKreuz<br />
42/I/03 KVV TrepKöp<br />
21
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 22<br />
Weitere Anträge Kommunalpolitik<br />
Antrag Nr. 25/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
FA V / Stadt des Wissens<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
In den Kommunalpolitischen Leitantrag ist an geeigneter Stelle in Kapitel 4 oder 5 einzufügen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er Bezirke sollen die bildungspolitischen Zuständigkeiten haben, die von den Kommunen in allen Ländern<br />
der Bundesrepublik wahrgenommen werden.<br />
Integration und Chancengleichheit sind angesichts einer immer stärker werdenden Vielfalt und Differenzierung unserer<br />
Gesellschaft vorrangig Aufgaben kommunaler Politik, auch und vor allem in der Bildung.<br />
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist ein unabdingbares Instrument für ein gutes Zusammenleben in der Kommune.<br />
Die Bezirke erwarten vom Land, dass die Bedingungen für eine erfolgreiche Sprachvermittlung erfüllt werden,<br />
insbesondere soll "Deutsch als Zweitsprache" verpflichtendes Unterrichtsprinzip sein und ein Mindestwortschatz in der jeweiligen<br />
Fachsprache in allen Rahmenplänen enthalten sein.<br />
In den Kindertagesstätten stehen Bildung und Betreuung gleichrangig nebeneinander und dienen der Chancengleichheit.<br />
Wir streben einen vollständigen Besuch aller Kinder ab dem 3. Lebensjahr an. Vorschulerziehung findet nach<br />
verbindlichen Rahmenplänen statt und wird evaluiert.<br />
Die Grundschule beginnt mit einer jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe, die differenziertes und individuelles Lernen<br />
ermöglicht. Wir wollen die Grundschulen zunächst in sozialen Brennpunkten und mittelfristig flächendeckend als<br />
Ganztagsschulen einrichten.<br />
Die möglichst lange gemeinsame Bildung aller Kinder ist eine Konsequenz aus der PISA-Studie. Wir erwarten daher<br />
von der Schulpolitik des Landes die Stärkung integrativer Elemente in allen Schularten der Mittelstufe und den konsequenten<br />
Ausbau von Gesamtschulen. Es darf keine Restschulen mehr geben.<br />
Die bezirklich verantwortete Schule wird ihre Angelegenheiten weitgehend selbständig regeln. Die Schulen öffnen sich<br />
zunehmend dem städtischen Umfeld und werden mit weiteren Bildungsangeboten vernetzt. Sie sind Lebensraum für<br />
Kinder und Jugendliche und sozialer Treffpunkt im Stadtteil. Staatliche Jugendhilfe und die freien Träger der Jugendund<br />
Kulturarbeit sind Kooperationspartner der Bildungseinrichtungen im Bezirk.<br />
Die staatliche Verwaltung der Schule wird weiter dezentralisiert. Aufgabe der Schulaufsicht ist die pädagogische Beratung<br />
der Schulen und die Qualitätssicherung durch eigenverantwortete Evaluation. Die Bezirke übernehmen alle Aufgaben<br />
des kommunalen Schulträgers. Das Land hat diese Pflichtaufgabe der öffentliche Daseinsvorsorge ausreichend<br />
zu finanzieren.<br />
Antrag Nr. 43/I/03<br />
Ablehnung<br />
Abt. 12/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Erfolgreiche Kommunalpolitik setzt voraus, dass die landespolitischen Rahmenbedingungen stimmen. Das gilt vor allem für<br />
die finanziellen Möglichkeiten. Ein kommunalpolitischer Landesparteitag muss daher auch die Bedingungen beschreiben,<br />
unter denen Landespolitik betrieben wird.<br />
Die <strong>SPD</strong> hat durch die Beendigung der Großen Koalition die Konsequenz aus den Fehlentwicklungen der neunziger Jahre<br />
gezogen. Die Partei ist daher aufgerufen, eine Bilanz der Politik der letzten beiden Jahre zu ziehen und zu belegen, dass<br />
der von der <strong>SPD</strong> angekündigte Mentalitätswechsel umgesetzt wird.<br />
Die <strong>SPD</strong> kann diesen Wechsel belegen:<br />
• Wir haben aus dem Skandal um die Bankgesellschaft <strong>Berlin</strong> gelernt, gesellschaftsrechtliche Konstruktionen zu meiden,<br />
bei denen das Land für die Geschäfte haftet, auf die es praktisch keinen Einfluss nehmen kann. Bei der Gestaltung des<br />
Facility-Managements haben wir bewiesen, dass uns ein solcher Fehler nicht noch einmal unterlaufen wird.<br />
• Wir wissen heute, dass wir keine Rechtsformen für die wirtschaftliche Führung von Öffentlichen Aufgaben wählen dürfen,<br />
bei denen das Land die Handlungs- und Kontrollmöglichkeiten verliert und die Gewinne aus der Hand gegeben<br />
werden.<br />
• Deshalb haben wir für das Facility-Management die Rechtsform der GmbH & Co KG abgelehnt und die Gründung einer<br />
landeseigenen Gesellschaft beschlossen, die den Interessen der Einwohner und Einwohnerinnen <strong>Berlin</strong>s dient, die Gewinne<br />
nicht den Privaten überlässt und die Risiken auf das Gemeinwesen abwälzt.<br />
• Wir wissen aus Erfahrung, dass es nicht den Interessen der <strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er dient, Betriebe der Daseinsvorsorge<br />
zu verkaufen. In keinem Fall haben die in <strong>Berlin</strong> durchgeführten Privatisierungen die zuvor gemachten Verspre-<br />
22
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 23<br />
chen erfüllt. Die Leistungen von Bewag, Gasag und Wasserwerken wurden teurer, Instandhaltungen reduziert, Arbeitsplätze<br />
abgebaut und nur die Gewinne der Privaten erhöhten sich. Im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner <strong>Berlin</strong>s<br />
privatisieren wir deshalb unsere öffentlichen Unternehmen, die den Personennahverkehr und die Ver- und Entsorgung<br />
in <strong>Berlin</strong> sichern, nicht.<br />
• Wir wissen heute, dass es falsch ist, Wohnungen der städtischen Gesellschaften an Dritte zu veräußern. Wer den Verkauf<br />
von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften betreibt, dreht an einer gefährlichen Schraube. Das Mietniveau in<br />
<strong>Berlin</strong> wäre ohne die Wohnungsbaugesellschaften nicht so attraktiv, deshalb lassen wir ein weiteres Ausplündern der<br />
städtischen Wohnungsbaugesellschaften nicht zu. Wir befürworten den Verkauf von Wohnungen an darin lebende Mieterinnen<br />
und Mieter.<br />
• Wir wissen heute, dass das System der „Anschlussförderung“ im sozialen Wohnungsbau falsch war, weil durch dieses<br />
System massiv öffentliches Geld in die Hände einiger weniger privater Bauherren floss, die sich daran bereicherten.<br />
Deshalb haben wir mit dieser Politik Schluss gemacht und den Mentalitätswechsel eingeleitet. Wir werden auch in Zukunft<br />
darauf hinwirken, dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht.<br />
Wir wollen den Mentalitätswechsel greifbar machen. Damit die Einwohnerinnen und Einwohner <strong>Berlin</strong>s sich an der Entwicklung<br />
beteiligen, müssen ihre Partizipationsmöglichkeiten und die ihrer Bezirksverwaltungen gestärkt und erweitert werden.<br />
Wir wollen den Aufbruch und geben den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit,<br />
sich zu engagieren.<br />
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wollen wir die Kommunalpolitik gestalten:<br />
Die Millionenstadt <strong>Berlin</strong> ist Einheitsgemeinde mit politisch geführter Hauptverwaltung und politisch geführten Bezirksverwaltungen.<br />
Daran wollen wir festhalten. Durch die Bezirksgebietsreform sind leistungsfähige Verwaltungseinheiten geschaffen<br />
worden, ohne dass regionale Identität verloren ging. Damit haben wir Voraussetzungen für funktionsfähige, dezentrale<br />
und bürgerfreundliche Strukturen geschaffen. Aber die Realität zeigt, dass noch bei weitem nicht in allen Bereichen projektund<br />
serviceorientiert gearbeitet wird. Viele, die in <strong>Berlin</strong> investieren wollen, fühlen sich bei den Behörden nicht willkommen.<br />
Zwischen Senat und Bezirken gibt es oft unproduktiven Streit.<br />
Grundlage einer gestaltungsstarken Stadtpolitik ist das gemeinsame Bewusstsein für gesamtstädtische Ziele und Aufgaben.<br />
Wir Sozialdemokraten auf Bezirks- und Senatsebene müssen begreifen, dass diese beiden Ebenen Teile eines Ganzen<br />
sind. Sie bilden eine Verantwortungsgemeinschaft, die auf klar zugewiesenen Kompetenzen und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten<br />
beruhen muss. So haben die Bezirke die Pflicht, bei lokalen Entscheidungen die gesamtstädtische<br />
Dimension mitzudenken. Zugleich muss die Landesebene erkennen, dass sie gesamtstädtische Belange nicht allein verwirklichen<br />
kann. Denn die Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen beruht auf Transparenz, Teilhabe und lokaler Eigenverantwortung.<br />
Nur so können Engagement und Kreativität geweckt und erhalten werden.<br />
Alle politische und Verwaltungserfahrung zeigt, dass dezentrale Strukturen effizienter sind, wenn Ausgaben- und Aufgabenverantwortung<br />
zusammengeführt werden. Allerdings muss es auch Anreizsysteme geben, um politisch konfliktreiche Entscheidungen<br />
zu treffen und durchzusetzen, wenn dies für die Entwicklung des Standorts positiv ist. Wir wollen deshalb die<br />
dezentralen Strukturen beibehalten und eine starke kommunale Selbstverwaltung, weil die BürgerInnen vor Ort so Demokratie<br />
am unmittelbarsten erleben und die Probleme sachbezogen gelöst werden können. Auch wenn die Bezirke keine<br />
selbständigen Gebietskörperschaften sind, ist ihre politische Führung sinnvoll, weil sich auf diese Weise Demokratie von<br />
unten nach oben aufbaut. Kompetenz heißt aber auch Verantwortung. Wenn ein Bezirk diese nicht wahrnimmt, muss der<br />
Senat wie eine Kommunalaufsicht eingreifen können. Und da, wo Entscheidungen in ihren Wirkungen weit über die Bezirksgrenzen<br />
hinausgehen, muss der Senat selbst Entscheidungen treffen können. Die Stellung des Rates der Bürgermeister<br />
bei der Entscheidung über strittige Zuständigkeiten wird gestärkt.<br />
Die Strukturen in Senat und Bezirksämtern müssen weitgehend aneinander angepasst werden. Wir wollen die Zahl der<br />
Bezirksamtsmitglieder von derzeitig sechs auf fünf reduzieren.<br />
Hohe Arbeitslosigkeit und in deren Folge hohe Soziallasten haben die Gestaltungsmöglichkeiten der Bezirke eingeengt. Die<br />
Finanzkrise ist auch eine Krise der Bezirke. Viele Bezirke sehen sich angesichts der sinkenden Budgets nicht mehr in der<br />
Lage, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen. Hier sind verstärkt aufgaben- und ausgabenkritische Betrachtungen in den<br />
Bezirken notwendig. Eine weitere Zentralisierung kommunaler Aufgaben ist keine Lösung. Die Finanzierung der Bezirke<br />
erfolgt durch Globalsummen, die das Abgeordnetenhaus ausgabenbezogen zuweist. Demnächst wird dieses Zuweisungssystem<br />
leistungsbezogen umgestellt. Wir fordern vom Senat, dass er in diesem Rahmen die politischen Entscheidungsmöglichkeiten<br />
über inhaltliche Prioritätensetzung und Umschichtungen zwischen den Produktbudgets den Bezirken überlässt.<br />
Angesichts der Konsolidierungsnotwendigkeiten im Land <strong>Berlin</strong> werden die Bezirke auch in den kommenden Jahren<br />
sinkende Budgets haben. Wir erwarten allerdings von der anstehenden Reform der Kommunalfinanzverfassung eine Verstetigung<br />
der Gewerbesteuereinnahmen für <strong>Berlin</strong>. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> fordert eine Reform, die die Gewerbesteuer als Interessenklammer<br />
zwischen Wirtschaft und Kommune erhält, auf eine wesentlich breitere Basis stellt und konjunkturunabhängiger<br />
macht. Die Bezirke sind entscheidend, wenn es um Bestandspflege und Gewerbeansiedlung geht. Wir fordern auch<br />
deshalb ein Anreizsystem, damit die Bezirke bereit sind, die damit oft verbundenen politischen Konflikte produktiv auszutragen.<br />
23
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 24<br />
Wenn die Bezirke dauerhaft an den Gewerbesteuereinnahmen, die auf ihrem Gebiet erzielt werden, beteiligt sind und ihre<br />
Gestaltungsmöglichkeiten damit unmittelbar von der Steigerung oder dem Absinken der Steuereinnahmen abhängen, werden<br />
sie wirtschaftsfreundlicher agieren.<br />
Antrag Nr. 44/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
Abt. 12 und KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Städtische Wohnbaugesellschaften sind als Regulativ für den Wohnungsmarkt unabdingbar. Der Bestand des Landes<br />
<strong>Berlin</strong> an Wohnraum im städtischen Besitz muss deshalb in vollem Umfang erhalten bleiben. Der Verkauf von Wohnungen<br />
kommt allenfalls an die darin lebenden Mieter in Betracht.<br />
Antrag Nr. 45/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 12 und KDV FrhainKreuz<br />
Der <strong>SPD</strong>-Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Bezirke können ihre kommunalen Aufgaben nur bei angemessener finanzieller Ausstattung politisch umsetzen. Den<br />
Bezirken ist deshalb der mit Haushaltsplan errechnete und in Abstimmung mit dem Senat festgestellte Bedarf ungekürzt<br />
zuzuweisen.<br />
Antrag Nr. 46/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
Abt. 12 und KDV FrhainKreuz<br />
AfA-Landesarbeitnehmerkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Eine weitere Privatisierung der öffentlichen Unternehmen <strong>Berlin</strong>s, die Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen, lehnt die<br />
<strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> ab. Für diese Unternehmen muss die Ausrichtung auf die vorgegebenen Gemeinwohlziele bei stetiger Verbesserung<br />
von Effizienz und Wirtschaftlichkeit das prägende Merkmal sein. Die in der Vergangenheit gehegte Vorstellung,<br />
die landeseigenen Unternehmen zu „global playern“ zu machen, hat sich hingegen als kostspielige Illusion erwiesen. Der<br />
Verbleib in der Eigentümerschaft des Landes <strong>Berlin</strong> kann seine Rechtfertigung auch nicht in einem globalen Marktauftritt<br />
dieser Unternehmen finden. Öffentliche Unternehmen erhalten ihre Legitimation allein aus der Erfüllung des öffentlichen<br />
Zwecks, den sie für das Gemeinwesen erfüllen. Hierzu steht ihre Ausrichtung auf den internationalen Wettbewerb in einem<br />
Widerspruch. Gerade weil der marktwirtschaftliche Wettbewerb für soziale, ökologische und kulturelle Gemeinwohlziele<br />
keinen Raum lässt, betrachten wir öffentliche Unternehmen mit einem klar definierten Gemeinwohlauftrag als das notwendige<br />
Korrektiv im Interesse der Menschen.<br />
Antrag Nr. 47/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
Abt. 14/Pankow<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Landesparteitag fordert den Senat auf, im Zusammenwirken mit dem Landesjugendamt eine vergleichende wissenschaftliche<br />
Untersuchung über die verursachenden Faktoren bei der Kostenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung nach<br />
dem KJHG in Auftrag zu geben. Nur auf dieser Grundlage können Entscheidungen über Kostenfragen seriös begründet<br />
werden.<br />
Antrag Nr. 48/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
Abt. 14/Pankow<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Im Januar 2003 hat der Senator für Finanzen die Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit einer<br />
Haushaltssperre belegt.<br />
Seither können die Mittel nur in einem zeitaufwendigen bürokratischen Prozess bewilligt werden. Die Jugendämter sind<br />
gezwungen, Hilfebedürftigkeit besonders restriktiv einzuschätzen, wodurch das Gesetz ausgehöhlt wird. Davon betroffen<br />
sind ca. 22.000 Fälle, das sind 3,1% aller jungen Menschen unter 22 Jahren in <strong>Berlin</strong>.<br />
Der Landesparteitag fordert den Senat auf, gemeinsam mit den Jugendstadträten und dem Landesjugendamt ein Verfahren<br />
zu entwickeln, in dem notwendige Kontrollmechanismen nicht zu Lasten der Betroffenen gehen. Kinder und Jugendliche,<br />
die auf Hilfen zur Erziehung angewiesen sind, müssen sie schnell erhalten können. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die der §<br />
36 KJHG einräumt, dürfen nur im Rahmen sozialpädagogischer Fachkompetenz genutzt werden und nicht im Sinne haus-<br />
24
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 25<br />
hälterischer Vorgaben. Die durch das KJHG gegebenen Ressourcen zum Chancenausgleich und zur Kriminalitätsprävention<br />
dürfen nicht eingeschränkt werden.<br />
Antrag Nr. 49/I/03<br />
Annahme<br />
Abt. 2/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Sie sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, sich für die Schaffung<br />
einer dem von der Kommission der Bundesregierung entwickelten Corporate Governance Kodex vergleichbaren, verbindlichen<br />
Regelungen für landeseigene Unternehmen und für solche mit Beteiligung des Landes <strong>Berlin</strong> einzusetzen.<br />
Antrag Nr. 50/I/03<br />
Ablehnung<br />
Landesarbeitnehmerkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die AfA fordert die Mandatsträger der <strong>SPD</strong> in Senat, Abgeordnetenhaus und Landesvorstand und die Delegierten des Landesparteitages<br />
auf sich für eine Rückkehr des Landes <strong>Berlin</strong> in die Arbeitgeberverbände einzusetzen.<br />
Ein Austritt aus dem Arbeitgeberverband heißt, man will geltende und zu verhandelnde Tarifverträge nicht mehr anwenden.<br />
Das bedeutet Tarifflucht. Dieses Mittel des Verbandsaustritts ist in Ausnahmefällen aus der privaten Wirtschaft bekannt.<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> stellt damit den Flächentarifvertrag in Frage. Das kann und darf nicht Stossrichtung sozialdemokratischer<br />
Politik sein. Alle Vertrags- und Verhandlungspartner werden zur Vernunft und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen.<br />
Antrag Nr. 51/I/03<br />
Ablehnung<br />
AfA-Landesarbeitnehmerkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die AfA fordert die gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhaus, Mitglieder des Senats, des Deutschen Bundestages, die<br />
Delegierten des Landesparteitages und die Mitglieder des Landesvorstandes auf, die Initiative des Senates von <strong>Berlin</strong>, zur<br />
Ungleichbehandlung der <strong>Berlin</strong>er Beamten und zur Aufweichung der bundesweiten Standards zur Bezahlung abzulehnen<br />
und zu verhindern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt auch für Beamte. Sie dürfen in ihren fundamentalen Lebensverhältnissen<br />
nicht schlechter gestellt werden als andere Beschäftigte.<br />
Antrag Nr. 52/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion und FA VII Wirtschaft<br />
AfA- Landesarbeitnehmerkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Fraktion im Abgeordnetenhaus von <strong>Berlin</strong> und der Senat werden aufgefordert, die Messe als 100% landeseigenen<br />
Betrieb unter der wirtschaftlichen und stadtpolitischen Aufsicht und Kontrolle des Landes <strong>Berlin</strong> weiterzuführen.<br />
Antrag Nr. 54/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
FA IX Gesundheit und Soziales<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Senat und Abgeordnetenhausfraktion werden aufgefordert, in folgendem Sinne tätig zu werden:<br />
Die Heimaufsicht <strong>Berlin</strong> ist dahingehend auszustatten,<br />
• dass die bestehenden erheblichen Vollzugsdefizite beseitigt werden und die Behörde ihre gesetzlichen Aufgaben als<br />
„Qualitätssicherungsbehörde“ erfüllen kann,<br />
• dass die Heimaufsicht die Einrichtungen beraten wie überwachen und<br />
• dass sie die Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige etc. beraten und unterstützen kann.<br />
Gleichzeitig ist die Heimaufsicht organisatorisch wieder dem Senat (LAGeSo) zuzuordnen.<br />
Antrag Nr. 55/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Es wird sofort ein zweijähriges Moratorium bei den Sparvorgaben für die konsumtiven Sachausgaben der Bezirke erlassen.<br />
Bei der Finanzierung von Pflichtaufgaben sind die Vorlaufzeiten für Strukturmaßnahmen zu berücksichtigen. Kürzungen<br />
werden allein notwendig werden durch den Ausgleich der Vorjahresergebnisse.<br />
Die Bezirke sind in einer Großstadt von über 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ein unverzichtbarer Bestandteil der<br />
25
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 26<br />
Demokratie. Kommunalpolitik in den Bezirken braucht aber auch Handlungsspielräume! Das derzeitige System der Bezirksfinanzierung<br />
lässt diese Handlungsspielräume schwinden, ohne dass eine Perspektive für die Zukunft eröffnet wird.<br />
Um Handlungsspielräume wieder zu erlangen, werden die Abgeordneten, Bezirksverordneten und die Mitglieder der Bezirksämter<br />
und des Senats der <strong>SPD</strong> aufgefordert, ein Finanzierungs- und Politikkonzept für die Bezirke vorzulegen. Dazu<br />
bedarf es zum einen über die bisherigen Ansätze zur Verwaltungsreform hinaus einer kritischen Diskussion der öffentlichen<br />
und auf bezirklicher Ebene wahrzunehmenden Aufgaben. Zum anderen sind die Ausstattung und der Finanzierungsbedarf<br />
dieser Aufgaben entsprechend festzulegen.<br />
Zudem sind folgende Leitsätze zu beachten:<br />
1. Die Zuweisung an die Bezirke muss entsprechend der Kosten, die Berechnungen müssen transparent und nachvollziehbar<br />
erfolgen. Bisher wird auf Landesebene ein Bedarf für die Bezirke berechnet, von dem pauschal über 50% abgezogen<br />
werden. Betriebskosten für Gebäude werden zu 100% als Bedarf anerkannt, aber nur 48% davon kommen in den<br />
Bezirken an.<br />
2. Die Höhe der Zuweisung darf sich nicht allein nach „betriebswirtschaftlichen“ Kriterien richten, sondern muss Spielraum<br />
für politische Entscheidungen lassen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist in vielen Bereichen sinnvoll, muss aber die<br />
sozialen Bedingungen der Bezirke berücksichtigen. Ein alleiniges Schielen auf diese Zahlen führt aber dazu, dass besondere<br />
Angebote wegfallen, wie z.B. die Beratungsangebote des Gesundheitsamts für Prostituierte, weil hier die Kosten<br />
eines Gesprächs den Durchschnittswert für Beratungsgespräche weit übersteigen.<br />
3. Die Doppelverwaltung ist endlich nach dem Subsidiaritätsprinzip konsequent aufzubrechen. Noch immer wird auf Senatsebene<br />
der Bezirksebene nicht getraut. Es bestehen, gerade im Baubereich, weiter Doppelzuständigkeiten und Doppelprüfungen.<br />
4. Von Ressortdenken und Ressortegoismen muss endlich Abschied genommen werden. Mit dem Haushaltsbeschluss<br />
sind die Zahlen für die einzelnen Ressorts festgelegt. Bewegungen zwischen Abteilungen finden nicht statt. So haben<br />
die Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe und das Aussetzen der Zweckentfremdungsverbotsverordnung Personalressourcen<br />
freigesetzt, die in vielen Bezirken unzureichend genutzt wurden.<br />
5. Eine Vernetzung der Angebote ist umzusetzen. Schule und Jugendhilfe haben z.B. viele Anknüpfungspunkte. Die fehlende<br />
Autonomie der Schulen, das Zuständigkeitswirrwarr im Schulbereich und die Abgrenzung voneinander verhindern<br />
hier bisher kreative Lösungen.<br />
6. Die Eigenverantwortung der Bezirke muss ernst genommen werden. Die vom Abgeordnetenhaus 2002 angeordnete,<br />
eigentlich sinnvolle hundertprozentige Ausstattung der Schulen mit Lehrmitteln zwingt die Bezirke zu Kürzungen in anderen<br />
sensiblen Bereichen, da die Globalsumme nicht gleichzeitig erhöht wurde. Eine Rückkoppelung mit den Bezirken<br />
wäre sinnvoll und notwendig gewesen.<br />
7. Präventiven Leistungen muss der Vorrang gegeben werden.<br />
8. Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein bedarfsgerechter Einstellungskorridor vorzusehen; die Ausbildungsquote<br />
muss sichergestellt bleiben.<br />
9. Hilfesysteme sind zu überprüfen und qualitativ zu bewerten. Die Jugendberufshilfe kostet jedes Jahr Millionen Euro.<br />
Eine Kontrolle findet nicht im ausreichenden Maße statt. Sie ist aber dringend notwendig, da die Erfolgsquote gering ist<br />
und „Karteileichen“ gerne mitgeschleppt werden, da sie sich positiv für freie Träger und die Berufsschulen auswirken.<br />
• Für Fallmanager im Sozialhilfebereich sind entsprechende Personalmittel zur Verfügung zu stellen.<br />
• Um die Anzahl der Heimplätze zu reduzieren, müsste die Werbung für Pflegefamilien erhöht werden. Der Titel für die<br />
Werbung wurde aber kontinuierlich gekürzt, weil ein fiskalischer Zusammenhang nicht akzeptiert wird.<br />
10. Öffentliche Haushalte haben nicht nur die Aufgabe der reinen Daseinsvorsorge, sondern auch Verpflichtungen im Bereich<br />
der freiwilligen Leistungen. Dazu gehört die Förderung und Sicherung der bezirklichen Kulturarbeit, die als freiwillige<br />
Leistung des Bezirks eine wesentliche Komponente zur Gestaltung einer innovativen Gesellschaftspolitik ist und die<br />
mit ihrem identitätsstiftenden Ansatz maßgeblich zu einem lebenswerten Stadtteil beiträgt.<br />
11. Neue Formen der Bürgerbeteiligung und des -dialogs sind zu prüfen, wie z.B. die Möglichkeit eines Bürgerhaushalts.<br />
12. Kommunalpolitik darf nicht vollständig dem Primat der Finanzpolitik unterliegen. Es muss Platz für innovative Ansätze<br />
sein, wie z.B.<br />
• Aktive Wirtschaftspolitik auf Bezirksebene (Bezirkliche Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit).<br />
• Förderung von egalitären Besitzformen (z.B. Genossenschaftseigentum).<br />
• Förderung von nachhaltigen Produktions- und Lebensweisen.<br />
26
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 27<br />
• Realisierung des Prinzips Gender Mainstreaming (Alle Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen müssen in ihren<br />
Auswirkungen auf Männer und Frauen überprüft werden).<br />
Antrag Nr. 56/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der Fraktion der <strong>SPD</strong> im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen,<br />
dass sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich die Bildungs-, Kinder- und Jugendpolitik zum<br />
vorrangigen Ziel gesetzt haben. Kinder- und Jugendeinrichtungen sind unverzichtbar, haben eine Bildungsauftrag und sind<br />
von Kürzungen auszunehmen. Versäumnisse gerade in der Kinder- und Jugendzeit sind nur durch sehr kostenintensive<br />
Maßnahmen wieder aufzufangen. Deshalb werden die Abgeordneten im Abgeordnetenhaus aufgefordert, präventiv dafür<br />
Sorge zu tragen, dass analog unserer Wahlaussagen weitere Kürzungsmaßnahmen in diesen Bereichen nicht vorgenommen<br />
werden und gegebenenfalls zurückgenommen werden, damit Kinder- und Jugendeinrichtungen ihren Erziehungsauftrag<br />
wahrnehmen.<br />
Antrag Nr. 57/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
KDV CharlWilm<br />
Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der Fraktion der <strong>SPD</strong> im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, während der Haushaltsberatungen<br />
dafür Sorge zu tragen, dass die den Bezirken zugewiesene Globalsumme für die Erfüllung der bezirklichen Pflichtaufgaben<br />
ausreicht.<br />
Antrag Nr. 58/I/03<br />
Erledigt durch Beschlusslage<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Zu glauben, dass der <strong>Berlin</strong>er Haushalt allein durch die Ausgabenseite wieder ins Lot gebracht werden kann, ist eine Illusion.<br />
Die Armut der Kommunen in anderen Bundesländern, aber auch der Länder zeigt, dass es sich nicht um ein spezifisches<br />
<strong>Berlin</strong>er Problem handelt.<br />
Gleichzeitig zeigt sich, dass immer mehr Unternehmen wie die Deutsche Bank, trotz enormer Gewinne, keine bzw. weniger<br />
Steuern zahlen, im Gegenteil hohe Rückforderungen an die Gewerbe- und Körperschaftssteuer erheben. Deshalb ist es<br />
richtig, die Möglichkeit des Verlustvortrags zeitlich und auf die Hälfte der Gewinne zu begrenzen.<br />
Ohne die angemessene Beteiligung der Vermögenden und der Unternehmen an der Finanzierung der staatlichen Aufgaben<br />
kann kein Sozialstaat überleben. Deshalb ist die erneute Heranziehung der großen Vermögen und der Unternehmen an der<br />
Finanzierung der Staatsaufgaben und die Umkehr der Politik der Umverteilung von Unten nach Oben von größter Bedeutung<br />
und muss politische Praxis werden. Die Initiative der Ministerpräsidenten der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen<br />
und der Fraktionen von <strong>SPD</strong> und PDS im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus zur Vermögensteuer und einer Reform der<br />
Erbschaftsteuer wird von uns begrüßt.<br />
Antrag Nr. 59/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, in den Bund-Länder-Gremien eine Gesetzesinitiative zur<br />
Änderung des „Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“<br />
(GVFG) zu starten mit dem Ziel, dass die Länder die Einsatzmöglichkeiten dieser Zuwendungen flexibler handhaben können<br />
(z.B. für Grundsanierung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur).<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats von <strong>Berlin</strong> und die <strong>SPD</strong>-Fraktion im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus (hier insbesondere die<br />
Mitglieder des Hauptausschusses) werden weiterhin aufgefordert, die mitte- und langfristige Investitionsstrategie des Landes<br />
<strong>Berlin</strong> darauf zu orientieren, dass bis zum Abschluss der Haushaltskonsolidierung (voraussichtlich nach 2015) grundsätzlich<br />
auf alle neuen Netzerweiterungen der Verkehrsinfrastruktur (Straßenneubau und Schienennetze des ÖPNV) verzichtet<br />
wird, sofern das Land <strong>Berlin</strong> hierfür Komplementäranteile aus dem Landeshaushalt aufbringen muss. Von Kürzungen<br />
ausgenommen sind alle Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs sowie einige bereits in der Investitionsplanung<br />
befindliche Maßnahmen zur Erschließung des Zentralen Bereiches und des Parlamentsviertels (z.B. die Straßenbahnanbindung<br />
des neuen Lehrter Bahnhofs von der Bernauer Straße). Sofern der Bund die Komplementäranteile <strong>Berlin</strong>s<br />
für den Weiterbau der U-Bahn-Linie 5 nicht übernimmt, ist die Umsetzung der U5 bis zum Ende der Haushaltskonsolidierung<br />
völlig einzustellen.<br />
Die frei werdenden Mittel sind zugunsten der Beseitigung des Instandsetzungsrückstandes im Straßennetz und im BVG-<br />
27
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 28<br />
Schienennetz einzusetzen und sollen direkt und indirekt auch der Haushaltskonsolidierung zu gute kommen. Das Grundsanierungsprogramm<br />
aller Verkehrsnetze ist mit Lärmsanierung, der Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Behinderte,<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (z.B. Zebrastreifen) und Maßnahmen zur intelligenten Vernetzung<br />
und Telematik (Fahrgastinformationssysteme) zu verknüpfen.<br />
Aus dem Entwurf der Senatsvorlage zum Stadtentwicklungsplan Verkehr sind entsprechend des Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung<br />
nur Maßnahmen zur Netzerweiterung aber keine weichen Maßnahmen („Soft Policies“, z.B. Parkraumbewirtschaftung,<br />
ÖPNV-Beschleunigung und Attraktivierung, Förderung des Fahrradsverkehrs usw.) zu streichen.<br />
Antrag Nr. 60/I/03<br />
Annahme<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, eine nachhaltige Strategie „Sparen und Gestalten“ und<br />
einen dazugehörigen Maßnahmekatalog zur Haushaltskonsolidierung im Dialog mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppen<br />
der Stadt (z.B. IHK, Lokale Agenda 21, Kirchen, Gewerkschaften, Universitäten, Sozialverbände) an einem Runden Tisch<br />
zu entwickeln und diesen Prozess von einem wissenschaftlichen Beirat (von Experten der Finanz- und Wirtschaftspolitik)<br />
begleiten zu lassen.<br />
Runder Tisch und wissenschaftlicher Beirat sind umgehend einzusetzen. Für eine stadtweite Einbindung aller <strong>Berlin</strong>erinnen<br />
und <strong>Berlin</strong>er in die Sparmaßnahmen sind eine Kommunikationsstrategie und eine Kampagne zu entwickeln.<br />
Antrag Nr. 61/I/03<br />
Überweisung an FA V / AG Schule<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Haushaltsmittel für Bildung im Kita-, Grundschul- und Hauptschulbereich sollen der Förderung der gymnasialen Oberstufe<br />
angenähert werden. Fördermittel des Bundes im Rahmen der Bildungsoffensive sind vorrangig im Kita- und Grundschulbereich<br />
einzusetzen.<br />
Antrag Nr. 62/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, durch geeignete Initiativen Sorge zu tragen, dass ein bundesweiter<br />
Risikoausgleich im Bereich der Sozialhilfe möglich wird. Weiterhin soll die ehemals vom Bundesland Niedersachsen<br />
vorgebrachte Initiative zur ganz oder teilweisen Übernahme der Kosten durch den Bund für die „Hilfe zum Lebensunterhalt“,<br />
allgemein Sozialhilfe genannt, wieder aufgenommen und durch das Land <strong>Berlin</strong> mittels einer Bundesratsinitiative<br />
umgesetzt werden.<br />
Antrag Nr. 63/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats und die Abgeordnetenhausfraktion werden aufgefordert, die Erhöhung des Schlüssels in<br />
öffentlichen und öffentlich geförderten Horten (Schülerläden) von 16 auf 22 pro Erzieher zurückzunehmen.<br />
Antrag Nr. 64/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
KDV Neukölln<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Fraktion des Abgeordnetenhauses, die <strong>SPD</strong>-Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen und die sozialdemokratischen<br />
Bezirksamtsmitglieder werden aufgefordert, sich für ein neues politisches Herangehen in den Bereichen<br />
Soziales, Jugend, Familie, Gesundheit und Schule einzusetzen. Ziel soll es sein, den sozialen Sektor so zu reformieren,<br />
dass er zielgerichtet seine Aufgaben erfüllen kann, Doppel- und Mehrfachbetreuung durch verschiedene Ämter abgebaut<br />
und Kosten gesenkt werden können.<br />
Nicht die Frage, wer eine soziale Aufgabe erfüllt, ist entscheidend, sondern die Frage, wie, mit welcher Qualität und Wirkung<br />
für die Hilfebedürftigen sowie zu welchem Preis.<br />
Für die Neuausrichtung sollten folgenden Grundprinzipen gelten:<br />
1. Die Bezirksämter sollen sich vorrangig darauf konzentrieren, eine steuernde, gewährleistende und Qualität sichernde<br />
28
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 29<br />
Verwaltung zu sein.<br />
2. Analog zu den Bürgerämtern sollen gleich gelagerte Aufgaben der Bereiche Jugend, Schule, Soziales und Gesundheit<br />
zukünftig aus einer Hand angeboten und möglichst kein Bürger von mehreren Ämtern gleichzeitig betreut werden.<br />
3. Die Durchführung sozialer Aufgaben wird – soweit sinnvoll und wirtschaftlicher – auf freie Träger übertragen.<br />
4. Als Konsequenz soll die Jugendhilfeplanung mit einer Sozialplanung verbunden und die für die Betreuungsaufgaben<br />
vorhandenen Haushaltsmittel zusammengefasst werden.<br />
5. Die sozialen Aufgaben sollen nach festgelegten und vereinbarten Qualitätsstandards erfüllt werden. Soweit Dritte sie im<br />
Auftrag <strong>Berlin</strong>s erfüllen, müssen sie eine eigenständige Qualitätssicherung vorhalten, die sich an gängigen Normen und<br />
Prozessen orientiert.<br />
Antrag Nr. 65/I/03<br />
Überweisung an die vom LV einzurichtende AG<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die zwölf Außenstellen der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport (ehemals Außenstellen des Landesschulamts)<br />
werden in Ihrer jetzigen Struktur aufgelöst und in die Zuständigkeit der Bezirksämter überführt.<br />
Antrag Nr. 66/I/03<br />
Erledigt durch Annahme 67/I/03<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Das Fehlen gesetzlicher Grundlagen für die Kulturarbeit und die Finanzmisere des Kommunen, insbesondere <strong>Berlin</strong>s, machen<br />
eine Verständigung über kulturpolitische Zielstellungen in den Bezirken immer dringender.<br />
Wir fordern Rahmenrichtlinien für die Kultur in den Bezirken, die die in den Bezirken zu leistenden Aufgaben auf dem Gebiet<br />
der Kultur als soziale Daseinsvorsorge definieren und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel sicherstellen. Wir fordern<br />
den Senator für Kultur und Wissenschaft und den Senator für Finanzen auf in diesem Sinne tätig zu werden.<br />
Antrag Nr. 67/I/03<br />
Annahme<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir fordern Kultur als Element der Allgemeinbildung zu stärken und bereits in den Kitas mit einer qualifizierten Kreativitätserziehung<br />
zu beginnen sowie das Angebot an kultureller Bildung in den allgemein bildenden Schulen – Kultur – und Jugend<br />
zu organisieren, um eine Verknüpfung der Schulen mit kulturellen Einrichtungen, Kulturinitiativen, Institutionen und Künstlern<br />
zu erreichen. Besonders vor dem Hintergrund der Einrichtung von Ganztagsschulen ist es erforderlich, dass sowohl auf<br />
Landes- als auch auf Bezirksebene Fachkonferenzen „Kinder – und Jugendkultur“ der genannten drei Berieche unter der<br />
Verantwortung des Senators für Bildung, Jugend und Sport durchgeführt werden mit dem Ziel im Interesse der Aufgaben<br />
Ressourcen effektiver zu nutzen, eine weitgehende Vernetzung sowie Kooperation der Kulturanbieter zu erreichen und<br />
sowohl Künstlern als auch ehrenamtlichen Kräften Betätigungsfelder zu eröffnen.<br />
Antrag Nr. 68/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> führt das aktive Wahlrecht zu den Bezirksparlamenten für alle Einwohnern ab dem 16. Lebensjahr ein.<br />
Antrag Nr. 69/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird die Bezirksstadträte als politische Beamte abschaffen und durch Fachqualifizierte Mitarbeiter der Verwaltung<br />
ersetzen. Diese werden von einem direkt zu wählendem Bürgermeister vorgeschlagen und von den Bezirksparlamenten<br />
bestätigt und kontrolliert.<br />
Antrag Nr. 70/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird die Volksinitiative einführen. Den Bürgern wird Antragsrecht in den Bezirksparlamenten eingeräumt, wenn sie<br />
für ihren Antrag die Unterschriften von 2% der Wahlberechtigten des Bezirkes gewinnen können. Analog wird dies für ein<br />
zukünftiges <strong>Berlin</strong>er Stadtparlament eingeführt.<br />
29
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 30<br />
Antrag Nr. 71/I/03<br />
Erledigt durch tätiges Handeln<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> strebt an, innerhalb der Bezirke Einwohnerversammlungen einzuführen. Diese sollen Antragsrecht in der BVV<br />
erhalten. Sie dienen dem direkten Kontakt der fachinteressierten Bürger mit den bezirklichen Parlamentariern und Verwaltungsorganen,<br />
diese sollen dort über die Diskussions- und Entscheidungsvorgänge innerhalb der BVV berichten. Sie sollen<br />
viertel- oder halbjährlich stattfinden und vom Bezirksamt einberufen werden.<br />
Antrag Nr. 72/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird sich dafür einsetzen, dass die Haushalte der Bezirke und der <strong>Berlin</strong>er Haushalt, analog dem Projekt "Kommunaler<br />
Bürgerhaushalt" in NRW, transparent und für den Bürger verständlich publiziert und diskutiert werden. Im Falle<br />
einer Fusion der Bundesländer <strong>Berlin</strong> und Brandenburg wird die <strong>SPD</strong> sich dafür einsetzen, dass auch die kommunalen<br />
Haushalte Brandenburgs nach diesem Prinzip veröffentlicht werden.<br />
Antrag Nr. 73/I/03 Erledigt durch Annahme Änderung 89<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird das strikte Konnexitätsprinzp in die Landesverfassung von <strong>Berlin</strong> und zukünftig von Brandenburg einführen.<br />
Antrag Nr. 74/I/03<br />
Ablehnung<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird Sozialbezirke errichten, die über die derzeitigen bezirklichen Strukturen hinaus für die Themenbereiche Jugend,<br />
Soziales und Arbeit zu ständig sind.<br />
Antrag Nr. 75/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird die vorangetriebene Privatisierung im Bereich der Jugendhilfe ausweiten. Die <strong>SPD</strong> wird bestehende und zukünftige<br />
Aufgabenübergaben an Träger mittels eines inhaltlichen Controllings überwachen.<br />
Antrag Nr. 76/I/03<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird in Zukunft keine Cross-Border Leasing Projekte unterstützen.<br />
Annahme<br />
Antrag Nr. 77/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
KDV Reinickendorf<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir fordern die Mitglieder der <strong>SPD</strong>-Abgeordnetenhausfraktion und die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des <strong>Berlin</strong>er Senats dazu auf für die<br />
Umsetzung folgender Punkte zu sorgen:<br />
Eine verstärkte Zusammenarbeit der Fachausschüsse beider Länderparlamente.<br />
Ein verbindliches Gesetzgebungsprogramm zur Vereinheitlichung des Landesrechts von <strong>Berlin</strong> und Brandenburg.<br />
Im Zuge der Fusion darf es nicht zu einer Schwächung der Bezirksverwaltungen kommen.<br />
Die Standortsuche und Zusammenlegung der Behörden beider Länder, die nach einer Fusion nur einmal benötigt werden<br />
verbunden mit einem regelmäßigen Personalaustausch der Mitarbeiter des Landes <strong>Berlin</strong>s und des Landes Brandenburgs<br />
innerhalb dieses gemeinsamen Standortes.<br />
Die Einführung eines gemeinsamen Personalmanagements des Öffentlichen Dienstes beider Länder.<br />
Einführung kompatibler Bürgerinformationssysteme (z.B. Internetplattformen).<br />
Das Einrichten eines jährlichen Berichtes zur Kooperation beider Länder, die den Fortschritt der Zusammenarbeit und<br />
die messbaren finanziellen und wirtschaftlichen Erfolge beider Länder zeigt.<br />
30
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 31<br />
Ziel dieser und ähnlicher Punkte soll es sein die Fusion soweit voran zu treiben, dass die juristische Zusammenlegung nur<br />
noch ein formaler Akt wird.<br />
Antrag Nr. 78/I/03<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
<strong>Berlin</strong> und Brandenburg zusammenführen - dezentrale Strukturen entwickeln!<br />
1. Einleitung<br />
Kommunale Selbstverwaltung hat die Aktivierung der Beteiligten für ihre eigenen Angelegenheiten zum Ziel.<br />
Dies war bereits das Anliegen des Gesetzes über die Bildung der neuen Stadtgemeinde <strong>Berlin</strong> vom 1. Oktober 1920. Mit<br />
der Bildung der Einheitsgemeinde wurde deutlich, dass eine Millionenstadt der Zweistufigkeit bedarf, um Partizipationsformen<br />
für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen und damit die Akzeptanz für das neu entstehende ”Groß-<strong>Berlin</strong>” zu erhöhen.<br />
Vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen im Rahmen der dringend notwendigen Fusion der Länder <strong>Berlin</strong> und<br />
Brandenburg steht die Frage der Akzeptanz und der Aktivierung der Beteiligten und damit die Frage nach der künftigen<br />
Struktur der Bezirke im Zentrum unserer Überlegungen.<br />
<strong>Berlin</strong> wird eine kreisfreie Stadt in einem Land Brandenburg sein, mit einer Stadtverwaltung, die nur noch einen Teil der<br />
bisherigen Aufgaben hat, weil alle ministeriellen Aufgaben in der Landeshauptstadt Potsdam erledigt werden. Dem entsprechend<br />
wird auch die künftige Stadtverordnetenversammlung einen anderen Aufgabenkatalog haben als das Landesparlament.<br />
In dieser neuen Situation muss die Balance zwischen der Partizipation der Basis und der gesamtstädtischen Steuerung<br />
gefunden werden. Die Länderfusion ist somit eine Chance zur Fortentwicklung der dezentralen Strukturen <strong>Berlin</strong>s.<br />
2. Vorteile der dezentralen Verantwortung – und ihre Probleme<br />
Um die Begriffe Bürgerorientierung und Bürgerfreundlichkeit mit Leben zu erfüllen, bedarf es entsprechender Strukturen,<br />
die den Menschen die Gelegenheit geben, ihre eigenen Angelegenheiten weitgehend selbst zu regeln, sich bei der Vertretung<br />
ihrer Interessen aktiv einzuschalten und Strategien zur Problemlösung zu entwickeln.<br />
Die Erfahrungen vieler deutscher Großstädte machen deutlich, dass für eine vernünftige und bürgernahe Verwaltungsdienstleistung<br />
und eine angemessene Bürgerpartizipation zweistufige Strukturen erforderlich sind. In einer Millionenstadt<br />
wie <strong>Berlin</strong> ist dies demzufolge erst recht unverzichtbar.<br />
Je kleiner das Gebiet ist, für das die örtliche Verwaltungsebene zuständig ist, desto größer sind die Chancen einer bürgerorientierten<br />
Verwaltung, die situationsadäquat und nach den Regeln der Partizipation agiert, die Bürger berät und die Probleme<br />
löst und Bürokratisierung und hierarchische Strukturen weitgehend vermeidet. Entsprechendes gilt für die Politik und<br />
für die Politiker: Verständigungs- und Aushandlungsprozesse mit den Bürgern können vor Ort besser organisiert werden.<br />
Ortsnahe politische und verwaltungsmäßige Zuständigkeiten erhöhen auch die Motivation der Bürger an Entscheidungsprozessen<br />
mitwirken zu wollen. Je kleiner die politische Einheit ist, desto höher ist der erkennbare Einfluss der Mitwirkung des<br />
Einzelnen auf die zu treffenden Entscheidungen. Das wirkt sich positiv auf die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit<br />
der dezentralen Organisationseinheit aus und fördert das Engagement für die kommunalen Belange.<br />
Durch eine lokale Verankerung wird der Stadt wesentlich gestärkt und von den Bürgern akzeptiert.<br />
Dies bedeutet aber nicht, dass alles beim Alten bleiben soll. Der Weg muss heißen: Verschlankung der Verwaltung und<br />
punktgenaue Trennung der Aufgaben von bezirklicher und gesamtstädtischer Relevanz. Es muss eine klare Unterscheidung<br />
der Aufgabenbereiche von Stadt und Bezirk vorgenommen werden. Auf der jetzigen Senatsebene ist schon jetzt darauf<br />
zu achten, dass ministerielle und kommunale Aufgaben getrennt organisiert sind, damit eine reibungslose Überführung<br />
der ministeriellen Aufgaben in die künftigen Landesministerien erfolgen kann. Alle Versuche, die Bezirke bei der Wirtschaftsförderung<br />
gegeneinander auszuspielen, werden abgelehnt.<br />
In der Vergangenheit fehlten vielfach einheitliche Organisationsstrukturen und bestanden Doppelzuständigkeiten. Die notwendigen<br />
Abstimmungsprozesse waren dadurch kompliziert und wurden teilweise sogar behindert. Bürgerinnen und Bürger,<br />
aber auch die an den Entscheidungsprozessen beteiligten Personen und die handelnden Verwaltungsmitarbeiterinnen<br />
und -mitarbeiter müssen sowohl auf der zentralen als auch auf der dezentralen Ebene einheitliche Strukturen und Organisationseinheiten<br />
vorfinden, damit der ”organisierten Unverantwortlichkeit” entgegengewirkt wird.<br />
3. Maßnahmen vor der Länderfusion<br />
Von der Länderfusion unberührt und auch vorher zu beantworten sind einige Fragen zur Anpassung der Bezirksstrukturen,<br />
31
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 32<br />
die oben bereits angesprochen wurden. Um Beiträge zur Haushaltskonsolidierung zu leisten und den Koordinations- und<br />
Kommunikationsaufwand zwischen den verschiedenen Stellen auf Bezirks- und Landesebene zu reduzieren, sind folgende<br />
Maßnahmen durchzuführen:<br />
Reduzierung der Anzahl der Bezirksamtsmitglieder.<br />
Verkleinerung der Bezirksverordnetenversammlungen.<br />
Einheitliche Organisationsstruktur in den Bezirken.<br />
Klare Aufgabentrennung und Verzicht auf Doppelzuständigkeiten.<br />
Verzicht auf die Einführung des politischen Bezirksamtes vor der Länderfusion.<br />
Schaffung basisdemokratischer Elemente auf Bezirksebene wie von der Koalition bereits vorgesehen.<br />
4. Grundlagen einer neuen Struktur<br />
Auf der Basis der vorgenannten Überlegungen ist eine dreistufige Struktur im Land <strong>Berlin</strong>-Brandenburg anzustreben: Die<br />
staatlichen Angelegenheiten werden in Potsdam von Landesregierung und –parlament wahrgenommen. Die nächste ist die<br />
kommunale Ebene: <strong>Berlin</strong> wird kreisfreie Stadt mit Organisationsfreiheit im Inneren. Dabei sind ein Magistrat mit einem<br />
Oberbürgermeister an der Spitze sowie eine Stadtverordnetenversammlung für die gesamtstädtischen Aufgabenbereiche<br />
zuständig.<br />
Es ist ein Organisationsmodell zu entwickeln, das dem Aufgabenspektrum der Bezirke als leistungsfähige bürgernahe Einheiten<br />
im gesamtstädtischen Bezug gerecht wird. Die Fusion der beiden Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg- und damit die<br />
Aufgabe der ministeriellen Ebene an die neue Landesregierung- darf nicht dazu führen, dass in den Bezirken lokale Demokratie<br />
nicht mehr stattfindet. Zum Entwickeln dieses Modells ist eine Arbeitsgruppe einzurichten, in der die Bezirke in angemessener<br />
Weise vertreten sind.<br />
In der Arbeitsgruppe sollte u.a. erörtert werden der Erhalt eigener Gestaltungsmöglichkeiten der Bezirke durch Zielvereinbarungen<br />
mit dem Magistrat, die Möglichkeit der Direktwahl der Bezirksbürgermeister/innen und die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit<br />
sowie Stärkung der Bezirksverordneten, die im Sinne von Ortsbeiräten als Mittler zwischen der Verwaltung<br />
und den Bürgerinnen und Bürgern fungieren und wesentliche Aufgaben des Controlling wahrnehmen.<br />
Antrag Nr. 79/I/03<br />
Annahme<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Als Schlussfolgerung aus der Sozialberichterstattung der letzten Jahre (<strong>Berlin</strong>er Armutsbericht, Gesundheits- und Sozialberichte<br />
der Bezirke), aus der sich eine Verstärkung der sozialen Ungleichheit im Lande <strong>Berlin</strong> ergibt, fordert die <strong>SPD</strong> den<br />
Senat und die Abgeordnetenhausfraktion auf, sich für folgende Ziele einzusetzen:<br />
<br />
<br />
Bei der mittel- und langfristigen Finanzplanung <strong>Berlin</strong>s wird die Ausstattung der durch sozial besonders belastete Quartiere<br />
betroffenen Innenstadtbezirke auf einem Niveau gesichert, das sie in die Lage versetzt diese Quartiere zu stabilisieren.<br />
Die auf Grund der unterschiedlichen Förderkulissen der EU vorhandene Benachteiligung von Projekten im Rahmen der<br />
„sozialen Stadt“ im ehemaligen Westteil <strong>Berlin</strong>s ist durch entsprechende Schwerpunktsetzung bei der Verteilung der<br />
Landesmittel auszugleichen.<br />
Antrag Nr. 80/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, dafür Sorge<br />
zu tragen, dass die Überschreitungen der Z- und T-Teile in den Bezirkshaushalten 2002/2003 zu 90 % abgefedert werden.<br />
Antrag Nr. 81/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir bitten die Abgeordnetenhausfraktion der <strong>SPD</strong>, zu prüfen, ob ein sozialverträglicher Personalabbau im Öffentlichen<br />
Dienst <strong>Berlin</strong> über die Altersfluktuation erreicht werden kann.<br />
Antrag Nr. 82/I/03<br />
Erledigt durch Härtefallregelung<br />
KDV TempSchön<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert sicherzustellen,<br />
dass die erhöhten Sozialhilfe- und Wohngeldaufwendungen der Bezirke, die durch die Kürzungen der Wohnungsbau-<br />
32
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 33<br />
förderung und anderer mietsteigernder Senatsentscheidungen entstehen, durch den Landeshaushalt vollständig im Wege<br />
einer Aufstockung der Globalsumme (bzw. einer Basiskorrektur für 2003) zu übernehmen.<br />
Antrag Nr. 83/I/03<br />
Annahme<br />
KDV TempSchön<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Senat und die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert:<br />
den Bezirken die Einstellung der letzten beiden Prüfungsjahrgängen der Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen<br />
nichttechnischen Dienst der allgemeinen <strong>Berlin</strong>er Verwaltung zu ermöglichen.<br />
die vom Senator für Finanzen verhängte Mittelkürzung bei den Bezirken, die Nachwuchskräfte im Herbst 2002 übernommen<br />
haben, unverzüglich rückgängig zu machen.<br />
Antrag Nr. 84/I/03<br />
Annahme<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats, die sozialdemokratischen Jugendstadträte und die <strong>SPD</strong>-<br />
Abgeordnetenhausfraktion werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die finanziellen Einsparungen bei der Übertragung<br />
von Kitas in freie Trägerschaft bzw. Vorschulen transparent und nachvollziehbar gemacht werden.<br />
Antrag Nr. 85/I/03<br />
Annahme<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Beschluss zahlreicher Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung und dem damit einhergehenden, unvermeidbaren<br />
Stellenabbau im öffentlichen Dienst <strong>Berlin</strong> hat auf der Grundlage einer gender-sensiblen Analyse zu erfolgen. Auch Maßnahmen<br />
dieser Art dürfen sich einer geschlechterdifferenzierten Bewertung nicht entziehen.<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senates werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass durch das „Gesetz zur<br />
Errichtung eines zentralen Personalüberhangmanagements“ das Landesgleichstellungsgesetz nicht unterlaufen wird. Die<br />
im Landesgleichstellungsgesetz verankerten gleichstellungsrechtlichen Standards müssen für alle Beschäftigten des Landes<br />
<strong>Berlin</strong> gleichermaßen gelten.<br />
Antrag Nr. 86/I/03<br />
Annahme<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mandatsträger/innen der <strong>SPD</strong> werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass in der Diskussion um moderne Staatskonzepte<br />
und um Reformprozesse in der Verwaltung<br />
1. die Tatsache Rechnung getragen wird, dass der Öffentliche Dienst in seiner Doppelfunktion als Arbeitgeber und als<br />
Leistungsanbieter entscheidende Bedeutung für Frauen hat.<br />
Konsequenterweise muss der Gender Mainstreaming-Ansatz als integraler Bestandteil der Modernisierungsprozesse<br />
einbezogen werden. Die landesgesetzlichen Grundlagen des Reformprozesses (<strong>Berlin</strong>: VGG- Verwaltungsreform-<br />
Grundsätze-Gesetz) sind entsprechend zu spezifizieren.<br />
2. diese nicht allein auf wirtschaftliche Effizienzgesichtspunkte und das Leitbild des „Unternehmens Staat“ reduziert wird.<br />
Ein modernes Gemeinwesen lässt sich nicht allein über Kosten-Leistungsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen<br />
steuern, sondern muss Steuerungsinstrumente einsetzen, die in der Lage sind, die tatsächliche Wirksamkeit des<br />
Verwaltungshandeln hinsichtlich seiner gesellschaftspolitischen Zielsetzungen abzubilden (ziel-wirkungsorientiertes<br />
Controlling).<br />
3. die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern als eine der zentralen Zielsetzungen staatlichen Handelns begriffen<br />
wird. Das bedeutet u.a., dass die zur Verfügung stehenden Informations- und Steuerungssysteme in der Lage sein<br />
müssen, erzielte Gleichstellungsfortschritte (und auch -defizite) sichtbar zu machen und Handlungsbedarfe aufzuzeigen<br />
(Gendercontrolling).<br />
Antrag Nr. 87/I/03<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
33
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 34<br />
Nur durch einen breiten Konsens in und mit der Bevölkerung lässt sich die notwendige Bereitschaft zu gesellschaftspolitischen<br />
Reformmaßnahmen demokratisch durch- und umsetzen. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten laden die<br />
<strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er daher ein, notwendige Veränderungen mitzugestalten und die uns alle herausfordernden Aufgaben<br />
positiv zu meistern.<br />
Zum Leitbild des aktivierenden Staates gehört eine neue Balance zwischen staatlicher, gesellschaftlicher und individueller<br />
Verantwortung. Mit einer neuen Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft wollen wir die Qualität und Passgenauigkeit<br />
sozialstaatlicher Leistungsangebote erhöhen, die gesellschaftliche Integration und Beteiligung aller sichern. Wir<br />
nehmen die Menschen als ExpertInnen ihrer eigenen Lebensgestaltung ernst und fördern daher beteiligungsfreundliche<br />
Strukturen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.<br />
Wir stärken die Zivilgesellschaft aber nicht deshalb, damit sich der Staat aus seinen originären Aufgaben zurückziehen<br />
kann, denn wir brauchen weniger Bürokratie und weniger Obrigkeitsdenken, aber nicht unbedingt weniger Staat. Der aktivierende<br />
Staat ist kein schwacher Staat: gestärkt wird eine gleichberechtigte Wechselbeziehung zwischen einem Teilhabechancen<br />
ermöglichendem Staat und einer aktiven und Verantwortung übernehmenden Bürgerinnen- und Bürgergesellschaft.<br />
Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gilt: Das Fördern steht vor dem Fordern!<br />
Die Überwindung einer traditionellen Geschlechterordnung ist konstitutive Voraussetzung zur Demokratisierung und Modernisierung<br />
von Staat und Gesellschaft. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit<br />
in allen Politikfeldern und auf allen Ebenen verpflichtet und ermutigen alle Engagierten und Organisationen,<br />
Geschlechterrollen und -grenzen konsequent aufzubrechen, z.B. durch konsequente Umsetzung der Doppelstrategie Frauenförderung<br />
und Gender Mainstreaming. Geschlechtsspezifische Partizipationsbarrieren müssen abgebaut werden. Frauen<br />
und Männer soll in allen bürgergesellschaftlichen Aktivitätsfeldern in allen Positionen und auf allen Ebenen tätig sein.<br />
Eine weitere wesentliche Voraussetzung einer chancen- und geschlechtergerechten Bürgerinnen- und Bürgergesellschaft<br />
im Sinne von „Demokratie von unten“ ist die Veränderung der gesellschaftliche Arbeitsteilung von Frauen und Männern<br />
sowie der damit verbundenen Zeitstrukturen für Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftliches Engagement. Engagementbereitschaft<br />
und -neigung von Menschen hängt davon ab, dass die Zeitstrukturen für Erwerbsarbeit, Familie und bürgerschaftliches<br />
Engagement zueinander passen. Passende Zeitstrukturen bedeuten für Männer und Frauen aktuell aber nicht<br />
noch dasselbe: Zentraler Ansatzpunkt für eine geschlechtergerechte Engagementpolitik ist daher die Vereinbarkeit von<br />
Beruf, Familie und Engagement, dazu gehören nicht nur engagementfreundliche Arbeitsbedingungen und Zeitsouveränität<br />
am Arbeitsplatz, sondern auch die geschlechtergerechte Verteilung der Familienarbeit. Laut Freiwilligensurvey liegt die<br />
Engagementquote bei den Männern bei 38 %; der Anteil unter den Frauen beträgt 30 %. Frauen leisten zwar den Löwenanteil<br />
der unbezahlten Arbeit in Haus und Familie, in der Freiwilligenarbeit aber überwiegen sie nicht. Im Gegenteil: Ihr Zeitbudget<br />
lässt ihnen oft keinen Raum für bürgerschaftliches Engagement. Für Männer gilt: je mehr Erwerbsarbeitszeit (inklusive<br />
Überstunden) sie leisten, desto eher sind sie auch bürgerschaftlich engagiert. Für Frauen gilt genau der umgekehrte<br />
Trend: Je weniger Erwerbsarbeitszeit, umso mehr Engagement. Wir wollen durch geeignete Maßnahmen die Engagementquote<br />
allgemein und insbesondere die von Frauen fördern.<br />
Die kommunale Ebene bildet den Grundstein des demokratischen Staatsaufbaus, gleichzeitig ist sie der wesentliche Bezugspunkt<br />
für die Ausprägung lokaler Identifikation und bürgerschaftlichen Engagements. Aus Sicht der Bürgerinnen und<br />
Bürger ist die politische und finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen Prüfstein für ein demokratisch legitimiertes und<br />
solidarisch agierendes Gemeinwesen. Die kommunale Ebene ist erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger - dieses gilt<br />
zunehmend mehr angesichts der bereits vollzogenen bzw. in Aussicht gestellten Reformen in den Sozialen Sicherungssysteme.<br />
Sozialdemokratische Kommunalpolitik erkennt daher insbesondere Handlungsbedarfe in folgenden Bereichen:<br />
Ausbau einer Verwaltungspraxis, die Bürgerschaftliches Engagement fördert.<br />
Stärkung der politischen Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern.<br />
Gezielter Abbau von bürokratischen Hemmnissen, die Bürgerschaftliches Engagement behindern.<br />
Wir stärken „Demokratie von unten“:<br />
Wir werden in <strong>Berlin</strong> die demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger verbessern, indem wir die demokratischen<br />
Mitbestimmungsverfahren wie Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide vereinfachen, die direkten<br />
Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten auf Bezirksebene erweitern und die bezirkliche Selbstverwaltung als Politisches Bezirksamt<br />
sichern sowie die Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger durch ein geändertes Bezirksverwaltungsgesetz<br />
stärken.<br />
Wir orientieren uns dabei am Leitbild der „ganzen Demokratie“ und werden stärker als bisher aktiv dafür sorgen, dass Frauen<br />
in politischen Funktionen gleichberechtigt analog ihres Bevölkerungsanteils vertreten sind.<br />
Wir stärken „Engagement“ von unten:<br />
Auch bei der Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements brauchen wir Geschlechtergerechtigkeit: Derzeit hat die „Bürger“gesellschaft<br />
jedoch noch eine unsichtbare Geschlechterordnung, die häufig die traditionellen Geschlechterrollen bestä-<br />
34
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 35<br />
tigt, immer noch wirkt das Geschlecht des bzw. der Engagierten als Platzanweiser auch im Bereich von Freiwilligenarbeit,<br />
Ehrenamt, Selbsthilfe und politischer Partizipation. So engagieren sich Frauen vor allem im sozialen Bereich - in diesen<br />
Aktivitätsfeldern sind zwei Drittel der Engagierten weiblichen Geschlechts. Männer hingegen betätigen sich typischerweise<br />
im Sport, in der Feuerwehr und bei den Rettungsdiensten. Auch in der politischen Arbeit dominieren immer noch die Männer,<br />
Frauen sind hier nach wie vor unterrepräsentiert. Nicht zuletzt sind Frauen deutlich weniger ämterorientiert - sie engagieren<br />
sich stärker in informellen Zusammenhängen. Für Männer hingegen bedeutet bürgerschaftliches Engagement institutionelle<br />
Einbindung und Funktionärstätigkeit. Auch für das bürgerschaftliche Engagement gilt also: "Frauen sorgen (unten),<br />
Männer managen oben".<br />
Wir werden durch eine fördernde Infrastruktur und entsprechende Maßnahmen diesem Trend begegnen und bei unserer<br />
Förderpolitik auf die konsequente Umsetzung der Doppelstrategie Frauenförderung und Gender Mainstreaming achten.<br />
Antrag Nr. 88/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der <strong>SPD</strong>-Landesvorstand wird aufgefordert, eine Kommission einzurichten, die prüfen soll, wie der Personenkreis der Bezirksverordneten<br />
erweitert werden kann auf Eltern, (Klein-)UnternehmerInnen, ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft<br />
usw., zur Förderung eines breiteren bürgerschaftlichen Engagements auf Bezirksebene. Entsprechende Regelungen in<br />
anderen Bundesländern, z.B. in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, sind zu prüfen.<br />
Die Kommission soll rechtzeitig vor Abschluss der Diskussion zur Neufassung des Bezirksverwaltungsgesetzes und vor<br />
einem möglichen LPT zur „Parteireform“ bzw. zu diesem Thema dem <strong>SPD</strong>-Landesvorstand eine Konzeption vorlegen, die<br />
auf dem folgenden LPT dann diskutiert wird.<br />
Antrag Nr. 89/I/03<br />
Überweisung an die sozialdemokratischen Bezirksamtsmitglieder<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
und die BVV-Fraktionen<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats, des Abgeordnetenhauses, der Bezirksämter und<br />
der Bezirksverordnetenversammlungen auf, für die Kultur in den Bezirken Rahmenrichtlinien zu entwickeln, die die Aufgaben<br />
der Bezirke für die Kultur definieren, unter Einbeziehung folgender Bereiche entsprechend der Anlage zum Senatsbeschluss<br />
Nr. 4757/94 vom 17.5.1994:<br />
Präsentation eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten;<br />
besondere Berücksichtigung von Bevölkerungsgruppen, die stärker als andere an den Lebensraum des Bezirks gebunden<br />
sind oder die nicht die Möglichkeit haben, ein selbstbewusstes, durch eigene Initiative bestimmtes Verhältnis zur<br />
Kultur zu entwickeln;<br />
generationenübergreifende, themen- und zielgruppenorientierte Kulturarbeit;<br />
Stadtteilgeschichtsarbeit;<br />
Stadtteilbibliotheken<br />
Schaffung von Infrastruktur, u.a. Räume für Kultur und Kunst;<br />
Beratungs- und Informationsfunktion für BürgerInnen, insbesondere für KünstlerInnen im Bezirk;<br />
Kulturaustausch im Rahmen von Städtepartnerschaft;<br />
Mitarbeit bei "Kunst am Bau"/ "Kunst im Stadtraum";<br />
KünstlerInnenförderung;<br />
Förderung der freien Kulturszene;<br />
Koordination und Vernetzung der kulturellen Aktivitäten im Bezirk als wesentliche Querschnittsaufgabe.<br />
Alle Bereiche sind unter gendersensiblen Gesichtspunkten zu betrachten. Die dafür erforderlichen Mittel sind sicherzustellen.<br />
Antrag Nr. 90/I/03<br />
Erledigt durch Annahme 67/I/03<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der <strong>SPD</strong>-Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der <strong>SPD</strong>-Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Wir fordern Kultur als Element der Allgemeinbildung zu stärken und bereits in den Kindertagesstätten mit einer qualifizierten<br />
Kreativitätserziehung zu beginnen sowie das Angebot an kultureller Bildung in den allgemeinbildenden Schulen auszubauen.<br />
Dazu ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit der Bereiche Schule - Kultur - und Jugend zu organisieren, um eine<br />
35
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 36<br />
Verknüpfung der Schulen mit kulturellen Einrichtungen, Kulturinitiativen, Institutionen und Künstlerinnen und Künstlern zu<br />
erreichen.<br />
Wir fordern, dass insbesondere vor dem Hintergrund der Etablierung von Ganztagsschulen sowohl auf Landes- als auch<br />
auf Bezirksebene Fachkonferenzen „Kinder- und Jugendkultur“ der genannten drei Bereiche unter der Verantwortung des<br />
Senators für Bildung, Jugend und Sport durchgeführt werden mit dem Ziel:<br />
Im Interesse der Aufgaben, die vorhandenen Ressourcen effektiver zu nutzen, eine weitgehende Vernetzung sowie Kooperation<br />
der KulturanbieterInnen zu erreichen und sowohl Künstlerinnen und Künstlern als auch ehrenamtlichen Kräften Betätigungsfelder<br />
zu eröffnen.<br />
Antrag Nr.91/I/03<br />
Annahme<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die ASF <strong>Berlin</strong> fordert die sozialdemokratischen EntscheidungsträgerInnen in der Partei - insbesondere den <strong>SPD</strong>-<br />
Landesvorstand - auf, hilfsweise im Rahmen eines eigenen Antrages, auch dazu zu äußern, welche Auswirkungen aufgrund<br />
der zahlreichen Veränderungen in den Sozialen Sicherungssystemen für die kommunale und bezirkliche Ebene zu<br />
erwarten sind.<br />
Bei der Darstellung der politischen und finanziellen Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene sind die erwartbaren geschlechtsdifferenzierten<br />
Auswirkungen als auch entsprechende Instrumente zur Bekämpfung von Benachteiligungen für<br />
spezifische Zielgruppen aufzuzeigen.<br />
Antrag Nr. 92/I/03<br />
Nichtbefassung wegen laufender Verhandlungen<br />
Abt. 04/Neukölln<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Beschäftigten des Landes <strong>Berlin</strong> und der <strong>Berlin</strong>er Senat müssen in der Frage der Personalkostenreduzierung und Beschäftigungssicherung<br />
weiter miteinander verhandeln. Die <strong>Berlin</strong>er Verwaltung hat zehntausende engagierte und kompetente<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch die bislang unnachgiebigen Positionen des Senats und der Gewerkschaften<br />
demotiviert werden. Ziel der Verhandlungsparteien sollte es sein, endlich die Ungleichbehandlung der Beschäftigtengruppen<br />
in der Stadt zu beenden. So arbeiten derzeit die Beamtinnen und Beamten in Ost und West 42 Stunden in der<br />
Woche, während die Angestellten und Arbeiter im Westteil der Stadt nur 38,5 Std. und im Ostteil 40 Std. pro Woche arbeiten<br />
müssen. Dabei sind die Gehälter bei Angestellten und Arbeitern in West und Ost gleich hoch, während die Beamten im<br />
Ostteil noch immer nur etwa 90% des Einkommens ihrer Westkollegen erzielen. Das Ziel der Verhandlungspartner muss<br />
eine Angleichung der Beschäftigungsverhältnisse sein. Das Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" muss endlich durchgesetzt<br />
werden; gerade Sozialdemokraten und Gewerkschafter sollten sich hier besonders engagieren.<br />
Gleichzeitig muss der besonderen finanziellen Situation <strong>Berlin</strong>s Rechnung getragen werden. Deshalb führt an Kürzungen<br />
im Personalbereich kein Weg vorbei. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Beschäftigungssicherung höchste Priorität<br />
erhält. Kürzungen beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind akzeptabel, wenn alle Beschäftigten hierzu einen auch unter<br />
sozialen Aspekten angemessenen Beitrag leisten.<br />
Die Abschaffung des Urlaubsgeldes für alle Beschäftigtengruppen sowie die Reduzierung der jährlichen Sonderzuwendung<br />
(13. Monatsgehalt) bei Angestellten, Beamten und Versorgungsempfängern werden eine deutliche Personalkosteneinsparung<br />
bringen. Zur Vermeidung sozialer Härten müssen Reduzierungen bei der jährlichen Sonderzuwendung abgestuft erfolgen.<br />
Dabei sollten sowohl die Höhe der Vergütung als auch die Unterhaltsverpflichtungen des Beschäftigten berücksichtigt<br />
werden. Insbesondere bei den Beamten aus dem Beitrittsgebiet, die bislang nur 90% des Westgehalts erhalten, sollten<br />
geringere Abschläge beim Weihnachtsgeld vorgesehen werden, so dass im Ergebnis auch für die <strong>Berlin</strong>er Beamten ein<br />
gleiches Lohnniveau erzielt wird. Auf die bundesweiten Tarifsteigerungen wird für alle Beschäftigtengruppen verzichtet.<br />
Im Gegenzug wird die wöchentliche Arbeitszeit für alle Beschäftigtengruppen ohne zusätzliche Gehaltsabschläge auf einheitlich<br />
38,5 Stunden festgesetzt. Für die Angestellten und Lohnempfänger wird darüber hinaus eine Beschäftigungssicherung<br />
vereinbart. Ein professionelles Personalmanagement wird für alle Beschäftigten (auch im Personalüberhang) eingeführt.<br />
Der Senat garantiert einen Einstellungskorridor für Auszubildende in der allgemeinen Verwaltung für die Laufzeit der<br />
Vereinbarung sowie eine Anschlussbeschäftigung von mindestens einem Jahr für die jetzt in Ausbildung befindlichen.<br />
Die Vereinbarung sollte zunächst für vier Jahre abgeschlossen werden, um den Vertragsparteien hinreichende Planungssicherheit<br />
für die nächsten Jahre zu geben.<br />
Antrag Nr. 93/I/03<br />
KDV Spandau<br />
Erledigt durch Annahme 49/I/03<br />
36
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 37<br />
Der Landesparteitag beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, sich für die Schaffung<br />
einer dem von der Kommission der Bundesregierung entwickelten Corporate Governance Kodex vergleichbaren verbindlichen<br />
Regelung für landeseigene Unternehmen und für solche mit Beteiligung des Landes <strong>Berlin</strong> einzusetzen.<br />
Antrag Nr. 94/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die bisherige Praxis, dass die Zahlung von Pflegegeldern von dem Bezirksamt zu leisten ist, in dessen Bereich die Pflegefamilie<br />
wohnhaft ist, soll aufgegeben werden. Sie soll ersetzt werden durch die Zahlungsverpflichtung des Bezirksamtes,<br />
aus dessen Zuständigkeitsbereich heraus das Kind vermittelt wird.<br />
Antrag Nr. 95/I/03<br />
Erledigt durch Überweisung an die vom<br />
KDV Spandau<br />
Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> setzt sich dafür ein, das aktive Wahlrecht zu den Bezirksparlamenten für alle Einwohner ab dem 16. Lebensjahr,<br />
die mindestens 5 Jahre hier ihren Wohnsitz haben, einzuführen.<br />
Antrag Nr. 96/I/03<br />
Erledigt durch Überweisung an die vom<br />
KDV Spandau<br />
Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Der Landsparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und im Senat werden aufgefordert, sich für die Einführung einer<br />
Volkinitiative einzusetzen. Den Bürgern soll Antragsrecht in den Bezirksparlamenten eingeräumt werden, wenn sie für ihren<br />
Antrag die Unterschriften von 2% der Wahlberechtigten des Bezirkes gewinnen können. Analog soll dies für ein zukünftiges<br />
<strong>Berlin</strong>er Stadtparlament gelten.<br />
Antrag Nr. 97/I/03<br />
Erledigt durch Überweisung an die vom<br />
KDV Spandau<br />
Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> wird sich dafür einsetzen, dass die Haushalte der Bezirke und der <strong>Berlin</strong>er Haushalt, analog dem Projekt "Kommunaler<br />
Bürgerhaushalt" in NRW, transparent und für den Bürger verständlich publiziert und diskutiert werden. Im Falle<br />
einer Fusion der Bundesländer <strong>Berlin</strong> und Brandenburg wird die <strong>SPD</strong> sich dafür einsetzen, dass auch die kommunalen<br />
Haushalte Brandenburgs nach diesem Prinzip veröffentlicht werden.<br />
Antrag Nr. 98/I/03<br />
Erledigt durch Überweisung an die vom<br />
KDV Spandau<br />
Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir unterstützen die Initiative der <strong>Berlin</strong>er Regierungskoalition, das Bezirksverwaltungsgesetz noch in diesem Jahr dahingehend<br />
zu ändern, dass Bürgerfragestunden und -anhörungen in den Bezirksverordnetenversammlungen ermöglicht werden.<br />
Die Spandauer <strong>SPD</strong> wird sich dafür einsetzen, dass solche Tagesordnungspunkte in der Spandauer BVV frühestmöglich<br />
probeweise eingeführt werden.<br />
Antrag Nr. 99/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und im Senat werden aufgefordert, sich für die Einführung des<br />
strikten Konnexitätsprinzips in die Landesverfassung von <strong>Berlin</strong> und zukünftig von Brandenburg einzusetzen.<br />
Antrag Nr. 100/I/03<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird in Zukunft keine Cross-Border Leasing Projekte unterstützen.<br />
Erledigt durch Annahme 76/I/03<br />
37
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 38<br />
Antrag Nr. 101/I/03<br />
Erledigt durch Neufassung Leitantrag<br />
Abt. 10/TrepKöp<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Förderung der Zivilgesellschaft ist ein wesentlicher Faktor der Erneuerung <strong>Berlin</strong>s. Die Zivilgesellschaft (Non- Profit-<br />
Sektor) umfasst alle formellen und informellen Ziele und Aktivitäten des sozialen und kulturellen Lebens der Gesellschaft.<br />
Hier knüpfen die Menschen den Verbund der Gemeinschaft und festigen ihre Identität.<br />
Die Förderung der Zivilgesellschaft heißt:<br />
Investitionen in einen Wachstumsmarkt, der dauerhaft zusätzliche Arbeitsplätze schafft, während die traditionellen Wirtschaftszweige<br />
zunehmend Arbeitsplätze abbauen.<br />
Stärkung der Rechte der Zivilgesellschaft und damit weitere Demokratisierung der Gesellschaft durch Einführung des<br />
Rechtes auf Volksabstimmung und Bürgerbegehren auf Landes- bzw. Bezirksebene.<br />
Wir setzen uns für Strukturen ein, die professionelle und ehrenamtliche Arbeit sinnvoll kombinieren, die professionelle Unterstützung<br />
für ehrenamtliche Arbeit bieten (z.B. Kiezzentren, Stadtteilzentren).<br />
Wir wollen keine Kürzungen á la Rasenmähermethode mehr, die ein langsames Sterben zur Folge haben, sondern Evaluierung<br />
und Neustrukturierung unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger, eben die Kommunikation mit den Betroffenen. So<br />
kann erreicht werden, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für ihre Lebensumwelt auch verantwortlich fühlen. Wer die<br />
Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger einfordert, muss die mündige Bürgerin, den mündigen Bürger auch fördern<br />
und fordern und wollen.<br />
Wir brauchen allerdings den effizienten Umgang mit Immobilien und Materialien etc. und damit ein Ressourcen orientiertes<br />
und Ressort übergreifendes Arbeiten. Controlling und Evaluierung sollen sichergestellt sein. Entscheidungen müssen jederzeit<br />
transparent sein, im Bedarfsfall müssen Ressorts zusammengefasst werden und durch Bündelung auch neue Organisationsformen<br />
gefunden werden.<br />
Antrag Nr. 102/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Senat wird aufgefordert, die Musikschulen der Bezirke des Landes <strong>Berlin</strong>s durch ein Musikschulgesetz in ihrer erfolgreichen<br />
und gesellschaftlich notwendigen Arbeit abzusichern.<br />
Antrag Nr. 103/I/03<br />
Erledigt durch tätiges Handeln<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Das am 14. Oktober 2002 vorgestellte Gutachten der Expertenkommission zur Hochschulmedizin wird als zukunftweisend<br />
begrüßt. Der Senat wird aufgefordert, den dortigen Vorschlägen zur Neustrukturierung der <strong>Berlin</strong>er Hochschulmedizin -<br />
unter besonderer Beachtung der Standortempfehlungen – zu folgen und eine zügige Umsetzung sicherzustellen.<br />
Bei der Umsetzung des Expertengutachtens ist insbesondere durch eine Zusammenfassung der beiden medizinischen<br />
Fakultäten eine gemeinsame neue Fakultät mit den vorgeschlagenen neuen Leitungsgremien zu schaffen. Dabei darf die<br />
Zahl von 600 Medizinstudienplätzen nicht unterschritten werden.<br />
Die zu diesem Thema gefassten Beschlüsse des Landesparteitages vom 11. Januar 2002 sind damit überholt.<br />
Antrag Nr. 104/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Bei allen Formen der „Private-Public-Partnership“, wenn sie seitens öffentlicher Gelder ein jährliches Volumen von<br />
100.000,- Euro übersteigt, ist vor der Vertragsschließung eine Risikobewertung durch den Landesrechnungshof einzuholen<br />
und bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen.<br />
Begründung: Es soll systematischer als bisher vermieden werden, dass Risiken einseitig zu Lasten der öffentlichen Hand<br />
gehen, wie dies in größtem Umfang bei der <strong>Berlin</strong>er Bankgesellschaft geschehen ist.<br />
Antrag Nr. 105/I/03<br />
Abt. 10/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Annahme<br />
38
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 39<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Die Sozialdemokratische Partei Deutschland unterstützt alle Bemühungen zur Errichtung eines Bundesseniorengesetzes in<br />
dem die Teilhabechancen der älteren Generation gestärkt werden und durch die Errichtung eines Bundesseniorenrates ein<br />
aktives Steuerungsinstrument von Senioren- und Generationenpolitik entwickelt wird. Auch auf der kommunalen Ebene<br />
müssen die Rechte der Seniorenvertretungen weiterentwickelt und verfassungsrechtlich verankert werden.<br />
Antrag Nr. 106/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 10/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Vor dem Hintergrund, dass:<br />
• die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass die EinwohnerInnen <strong>Berlin</strong>s sich zunehmend nicht mehr als Teil<br />
sondern als Gegenüber von Staat und Verwaltung begreifen;<br />
• das Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 ohne weiteres den geeigneten verfassungsrechtlichen<br />
Rahmen bietet, dieser Tendenz entgegenzuwirken;<br />
• zugleich jedoch <strong>Berlin</strong> als Einheitsgemeinde angesichts seiner Größe diese verfassungsrechtlich-demokratische Kernaufgabe<br />
einer Kommune nicht erfüllen kann;<br />
• die aktuelle Struktur deshalb mit dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 GG als nicht vereinbar<br />
betrachtet werden muss und;<br />
• parallel in den kommenden Jahren eine unabdingbare Debatte um eine mögliche Fusion der Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg<br />
einerseits und die Frage der finanzielle Ausstattung der Bezirke andererseits auf uns zukommt, die selbstverständlich<br />
die Auseinandersetzung um die künftigen kommunalen Struktur <strong>Berlin</strong>s und seiner Bezirke umfassen muss;<br />
wird der Landesvorstand aufgefordert, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, deren Ziel es ist, die Eckdaten einer Strukturreform<br />
zu formulieren und auf dem ersten ordentlichen Parteitag des kommenden Jahres in Form eines schriftlichen Berichtes zu<br />
präsentieren.<br />
Antrag Nr. 107/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
KDV Reinickendorf<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Fusion von <strong>Berlin</strong> und Brandenburg<br />
Wir fordern die Mitglieder der <strong>SPD</strong>-Abgeordnetenhausfraktion und die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des <strong>Berlin</strong>er Senats dazu auf, für die<br />
Umsetzung folgender Punkte zu sorgen:<br />
Eine verstärkte Zusammenarbeit der Fachausschüsse beider Länderparlamente.<br />
Ein verbindliches Gesetzgebungsprogramm zur Vereinheitlichung des Landesrechts von <strong>Berlin</strong> und Brandenburg.<br />
Im Zuge der Fusion darf es nicht zu einer Schwächung der Bezirksverwaltungen kommen.<br />
Die Standortsuche und Zusammenlegung der Behörden beider Länder, die nach einer Fusion nur einmal benötigt werden<br />
verbunden mit einem regelmäßigen Personalaustausch der Mitarbeiter des Landes <strong>Berlin</strong>s und des Landes Brandenburgs<br />
innerhalb dieses gemeinsamen Standortes.<br />
Die Einführung eines gemeinsamen Personalmanagements des Öffentlichen Dienstes beider Länder.<br />
Einführung kompatibler Bürgerinformationssysteme (z.B. Internetplattformen).<br />
Das Einrichten eines jährlichen Berichtes zur Kooperation beider Länder, die den Fortschritt der Zusammenarbeit und<br />
die messbaren finanziellen und wirtschaftlichen Erfolge beider Länder zeigt.<br />
Ziel dieser und ähnlicher Punkte soll es sein die Fusion soweit voran zu treiben, dass die juristische Zusammenlegung nur<br />
noch ein formaler Akt wird.<br />
Antrag Nr. 108/I/03<br />
Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
Abt. 13 und 14/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir wollen den Wandel in <strong>Berlin</strong>. Deshalb fordern wir bis zur Volksabstimmung über eine Fusion der Länder <strong>Berlin</strong> und<br />
Brandenburg, dass<br />
bis zum Zeitpunkt der Fusion beider Bundesländer ein einheitliches Tarif- und Besoldungssystem auf dem Niveau der<br />
alten Bundesländer in Kraft tritt.<br />
die Verfassung von <strong>Berlin</strong> mit den Stadtverfassungen der kreisfreien Städte des Landes Brandenburg abgeglichen und<br />
als Entwurf einer Stadtverfassung von <strong>Berlin</strong> erarbeitet wird.<br />
die Wahlordnung für die BVV von <strong>Berlin</strong> mit der Wahlordnung für die Landkreise des Landes Brandenburg abgeglichen,<br />
einheitlich gestaltet und in die Stadtverfassung von <strong>Berlin</strong> aufgenommen wird.<br />
die Kompetenzen eines Oberbürgermeisters der Stadt <strong>Berlin</strong> und seiner Verwaltung sowie die Wahlordnung des politischen<br />
Kontrollgremiums und der Wahlmodus der politischen Führung der Stadt <strong>Berlin</strong> in der Stadtverfassung von <strong>Berlin</strong><br />
verankert ist.<br />
39
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 40<br />
das AZG modifiziert und das BezVG mit den äquivalenten Gesetzen des Landes Brandenburg abgeglichen und als<br />
Hinweis oder Anhang in der Stadtverfassung von <strong>Berlin</strong> verankert wird.<br />
Der LPT beauftragt den GLV, bis zum 01.09.03 dem LV einen mit dem Landesverband der <strong>SPD</strong> Brandenburg abgestimmten<br />
Vorschlag zu unterbreiten, wie auf allen Parteiebenen ein intensiver Gedankenaustausch zwischen den GenossInnen<br />
aus <strong>Berlin</strong> und Brandenburg organisiert werden kann, um Konsens in den Fusionsfragen zu erreichen. Dafür sind u.a. Partnerschaften<br />
zwischen den Kreisverbänden von Landkreisen und kreisfreien Städten und <strong>Berlin</strong>er Kreisen vorzubereiten.<br />
Antrag Nr. 109/I/03<br />
Annahme<br />
KVV TrepKöp<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Im Vorfeld der Fusionsvorbereitungen der Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg soll eine verstärkte Abstimmung der Bildungspolitik<br />
in beiden Ländern, die Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre zu verkürzen, stattfinden, um nach der Fusion die Harmonisierung<br />
der Bildungssysteme zu erreichen.<br />
Antrag Nr. 110/I/03<br />
Punkt1: Überweisung an die vom Landesvorstand einzurichtende AG<br />
KVV TrepKöp<br />
Punkt 2: Erledigt durch Neufassung Leitantrag (K)<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Punkt 3: dto.<br />
1. <strong>Berlin</strong> im vereinigten Bundesland <strong>Berlin</strong>-Brandenburg<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird alles politisch Mögliche tun, um die Fusion der Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg im Jahr 2009 zu erreichen.<br />
Dazu sind die Bürger in beiden Ländern im Hinblick auf die erneute Volksabstimmung im Jahr 2006 von der unveränderten<br />
Notwendigkeit der Fusion zu überzeugen.<br />
<strong>Berlin</strong> wird mit der Fusion kreisfreie Großstadt im vereinigten Bundesland. Die Ministerien und das Landesparlament werden<br />
die ministeriellen und zentralen Aufgaben für die über 6 Millionen Bürger des Bundeslandes von Potsdam aus wahrnehmen.<br />
<strong>Berlin</strong> wird sich als Einheitsgemeinde mit zweistufiger Verwaltung vorrangig auf seine kommunalen Aufgaben<br />
konzentrieren.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er Stadtverwaltung und die Stadtverordnetenversammlung sowie die Bezirksverwaltungen und die Bezirksverordnetenversammlungen<br />
werden die gesamtstädtischen bzw. bezirklichen Aufgaben wahrnehmen. In dieser Situation muss die<br />
Balance zwischen der gesamtstädtischen Steuerung und der kommunalen Selbstverwaltung neu definiert werden.<br />
2. Die dezentrale Verantwortung der Bezirke stärken<br />
Die kommunale Selbstverwaltung hat die Aktivierung und Beteiligung der Bürger bei der Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten<br />
zum Ziel. Die Erfahrungen anderer deutscher Großstädte machen deutlich, dass für eine bürgernahe Verwaltungsdienstleistung<br />
und eine angemessene Bürgerbeteiligung zweistufige Strukturen erforderlich sind. In der Millionenstadt<br />
<strong>Berlin</strong> ist dies unverzichtbar.<br />
Ortsnahe politische und verwaltungsmäßige Zuständigkeiten stärken die Identifikation der Bürger mit der dezentralen Organisationseinheit.<br />
Der erkennbare Einfluss des Einzelnen und seiner örtlichen politischen Vertreter auf die zu treffenden<br />
Entscheidungen erhöht die Motivation der Bürger, an kommunalen Entscheidungsprozessen mitwirken zu wollen.<br />
Das politische Bezirksamt, basisdemokratische Elemente mit angemessenen Quoten auf Bezirksebene und sind geeignet,<br />
das kommunalpolitische Interesse der Bürger zu steigern.<br />
Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort ist eine Voraussetzung, angesichts der finanziellen und demographischen<br />
Entwicklung unserer Stadt auch in Zukunft die kommunalen Aufgaben im bisherigen Umfang wahrnehmen zu<br />
können.<br />
Unser Leitbild ist eine moderne Zivilgesellschaft mit Chancengleichheit und Selbstverantwortung des Einzelnen sowie sozialem<br />
Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Solidarität. Die Verwirklichung dieses Leitbildes erfordert einen handlungsfähigen<br />
Staat mit funktionierenden Steuerungsmöglichkeiten, der die vom Bürger zu Recht erwarteten Angebote und Leistungen der<br />
Daseinsvorsorge gewährleistet.<br />
3. Die Effektivität der Arbeit der Bezirke stärken<br />
Die Verwaltungsreform muss mit dem Ziel weitergeführt werden, die Verwaltung zu verschlanken und Aufgaben von bezirklicher<br />
bzw. gesamtstädtischer Bedeutung punktgenau zu ordnen. Der konsequente Abbau von Doppelzuständigkeiten<br />
und der Aufbau einheitlicher Organisationsstrukturen in den Bezirken ist die Voraussetzung für eine effektivere, dem<br />
Dienstleistungsgedanken verpflichtete kommunale Selbstverwaltung. Die neu eingerichteten bezirklichen Bürgerämter sind<br />
ein Beispiel dafür.<br />
40
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 41<br />
Die Bezirke müssen maßgeblich an der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen<br />
Infrastruktur beteiligt sein. Allerdings ist von den Bezirken zu verlangen, dass bei den lokalen Entscheidungen stets die<br />
gesamtstädtische Dimension mitgedacht wird und auch die notwendige Berücksichtigung findet. Die Zentralisierung kommunaler<br />
Aufgaben stellt keine Verbesserung im Sinne höherer Flexibilität, geringerer Kosten und weniger bürokratischen<br />
Aufwands dar.<br />
Die finanzielle Ausstattung der Bezirke ist ihren Aufgaben entsprechend vorzunehmen. Fortgesetzte pauschale Absenkungen<br />
der Globalzuweisungen an die Bezirke stellen die Selbständigkeit der Bezirke, die Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben<br />
und die Gewährleistung einer vergleichbaren Infrastruktur in Frage. Bei einer verminderten Finanzierung der Pflichtaufgaben<br />
sind die Vorlaufzeiten für die Strukturmaßnahmen in den Bezirken zu berücksichtigen.<br />
Die Bezirke sind an den von ihnen erhobenen Gebühren bzw. an ihren sonstigen Einnahmen angemessen zu beteiligen.<br />
Darüber hinaus sollten die Bezirke im Rahmen der Reform der Kommunalfinanzverfassung an den Gewerbesteuereinnahmen<br />
beteiligt werden.<br />
Es wird vorgeschlagen, zu den Wahlen für die Bezirksverordnetenversammlung die Persönlichkeitswahl einzuführen.<br />
Antrag Nr. 111/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der <strong>SPD</strong>-Fraktion des Abgeordnetenhauses <strong>Berlin</strong> und die sozialdemokratischen Mitglieder des <strong>Berlin</strong>er<br />
Senats werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Planmengenverfahren aufgehoben wird, weil es ab 2004<br />
eine stete Verringerung des Unterrichtsangebotes der Volkshochschulen und Musikschulen in ganz <strong>Berlin</strong> zur Folge haben<br />
würde und damit zugleich zu Mindereinnahmen des Staates und zu mehr arbeitslosen LehrerInnen führen würde.<br />
Antrag Nr. 112/I/03<br />
KDV Pankow<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Überweisung an die von LV einzuberufende AG<br />
<strong>Berlin</strong> stärken.<br />
1. Für eine Verantwortungsgemeinschaft aus Land und Bezirken<br />
Die dramatische Haushaltslage in <strong>Berlin</strong> und die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern tief greifende<br />
Reformen. Nur so kann die Stadt ihre Handlungsfähigkeit bewahren und einen sozialen Ausgleich gewährleisten. Schwerpunkte<br />
einer nachhaltigen Stadtpolitik sind die Sanierung der öffentlichen Finanzen, der Erhalt wirtschaftlicher Strukturen<br />
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Sicherung sozialer Standards und eine ausgewogene Stadtentwicklung.<br />
Hinzu tritt die Reform der staatlichen Organisation. Gerade in der Krise sind die Anforderungen an das Personal, die Organisation<br />
und die Abläufe von Politik und Verwaltung besonders hoch. Ihre Aufgabe ist es, Reformen schnell, effizient und im<br />
Einklang mit den Interessen der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Trotz der seit 1990 unternommenen Anstrengungen<br />
sind hier nach wie vor erhebliche Defizite vorhanden. Umso mehr müssen diese jetzt behoben werden, um <strong>Berlin</strong> zu einer<br />
effektiven und sozial ausgewogenen Reformpolitik zu befähigen.<br />
Eine Debatte über die Staatsorganisation und Verwaltung in <strong>Berlin</strong> ist keineswegs unzeitgemäß. Vielmehr schafft sie die<br />
Grundlage für die Lösung der anstehenden Probleme. Eine solche Initiative ist Kernanliegen sozialdemokratischer Politik.<br />
Wir wollen wohlfahrtstaatliche Errungenschaften und öffentliche Gestaltungsmöglichkeiten auch in schwieriger Zeit erhalten<br />
und verbessern. Neuen Verteilungsentscheidungen muss daher immer die Steigerung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
vorausgehen. Denn nur wenn die von uns Sozialdemokraten erkämpften Sicherungssysteme sparsam arbeiten, werden<br />
sie dauerhaft akzeptiert. Es ist unsere Aufgabe, den Nachweis zu erbringen, dass Fürsorge und staatliches Handeln effizient<br />
funktionieren.<br />
Unverzichtbar für eine gestaltungsstarke Stadtpolitik ist das gemeinsame Bewusstsein für gesamtstädtische Ziele und Aufgaben.<br />
Bezirke und Hauptverwaltung müssen begreifen, dass sie zwei Teile eines Ganzen sind. Sie bilden eine Verantwortungsgemeinschaft,<br />
die auf klar zugewiesenen Kompetenzen und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten beruht. So haben die<br />
Bezirke die Pflicht, bei lokalen Entscheidungen die gesamtstädtische Dimension mitzudenken. Zugleich muss die Landesebene<br />
erkennen, dass sie gesamtstädtische Belange nicht alleine verwirklichen kann. Denn die Zufriedenheit mit politischen<br />
Entscheidungen beruht auf Transparenz, Teilhabe und lokaler Eigenverantwortung. Auf Basis einer ausreichenden<br />
Grundgleichheit müssen dabei Unterschiede im Vollzug und in der Ausstattung zugelassen werden. Nur so können Engagement<br />
und Kreativität geweckt und erhalten werden.<br />
41
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 42<br />
Eigene Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungskompetenzen der Bezirke sind unverzichtbar. Dagegen widerspräche<br />
eine Verlagerung der kommunalen Kompetenzen auf die gesamtstädtische Ebene, z. B. durch die Auflösung von Bezirksverordnetenversammlungen<br />
und politischen Bezirksämtern, nicht nur dem Ziel der Bürgernähe. Stattdessen würde eine<br />
solche Zentralisierung die gesamtstädtische Ebene überfordern und dadurch in zusätzliche Kritik bringen. Eine zukunftsfähige<br />
Stadtpolitik braucht handlungsfähige und gestaltungsstarke Bezirke, nicht als Gegengewicht, sondern als notwendiges<br />
Fundament.<br />
Mit der Länderfusion wird <strong>Berlin</strong> seinen Status als Bundesland verlieren und sich auf die Rolle einer Metropole und Kommune<br />
konzentrieren. Bei einer Größeordnung von über 3 Mio. Einwohnern und Bezirken mit jeweils etwa 300.000 Einwohnern<br />
ist diese Aufgabe nach wie vor nicht von einem zentral geführten Gemeinwesen zu erfüllen. Stattdessen muss sich<br />
<strong>Berlin</strong> eine dezentral verfasste Gestalt geben. Nur so bleibt die Stadt nach innen wie nach außen handlungs- und kooperationsfähig.<br />
2. Örtliche Aufgaben im Bezirk wahrnehmen<br />
Lokal gewählte Amts- und Mandatsträger haben die Aufgabe, Verwaltungshandeln anzuregen und zu kontrollieren. Ermessens-<br />
und Gestaltungsspielräume der kommunalen Verwaltung sind dabei zugunsten der Bürgerinnen und Bürger zu erkennen<br />
und auszuschöpfen. Deshalb sind sowohl die Bezirksämter als auch die Bezirksverordnetenversammlungen unverzichtbar.<br />
Ihre Stellung und Entscheidungsvollmachten müssen gestärkt werden.<br />
Um zu vermeiden, dass das Eingriffsargument der gesamtstädtischen Bedeutung fall- und interessengeleitet interpretiert<br />
wird, muss es durch eine klare Aufgabenteilung ergänzt werden und bezirkliche Interessen berücksichtigen.<br />
Grundsätzlich gilt daher, dass eine abschließende Kompetenzzuordnung festlegen muss, was von gesamtstädtischem<br />
Belang ist. Diese Aufgaben werden vom Abgeordnetenhaus entschieden und durch die Hauptverwaltung erledigt. Alle<br />
verbleibenden Regelungs- und Vollzugsangelegenheiten sollen dem Wirkungskreis der Bezirke angehören. Sie unterliegen<br />
der rechtlichen und nur im begründeten Einzelfall auch der fachlichen Aufsicht der Hauptverwaltung.<br />
Zur Verantwortungsteilung tritt die Abschaffung von Schnittstellen und die Zusammenlegung doppelter Zuständigkeiten. Ziel<br />
muss es sein, öffentliche Aufgaben so ortsnah wie möglich zu erledigen. Im Bildungswesen ist dieser Ort die Schule, in der<br />
allgemeinen Ordnungs- und Leistungsverwaltung der Bezirk, im Baubereich, je nach Bedeutung, der Bezirk oder das Land.<br />
Die Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihren Anliegen an einer Stelle Auskunft, Gehör und Bescheid erhalten. Sie sollen<br />
möglichst viele Belange an einem Ort in ihrer Nähe regeln können. In diesem Zusammenhang kommt den Bezirken eine<br />
herausgehobene Bedeutung zu. Sie sind in <strong>Berlin</strong> die ortsnächste Verwaltung und die einzigen Behörden, die verschiedene<br />
Zuständigkeiten und Bürgerbelange bündeln können. Diese Funktion werden die Bezirke aber nur dann effektiv wahrnehmen,<br />
wenn die Abstimmungspflichten mit anderen Landesbehörden und deren Eingriffsmöglichkeiten auf ein absolut unverzichtbares<br />
Maß reduziert werden. Auf diese Weise kann sich die Hauptverwaltung auf ihre Kernaufgabe der gesamtstädtischen<br />
Steuerung konzentrieren. Diese Fähigkeit wird in dem Maße erhöht, wie Senat und Landesbehörden auf örtliche<br />
Vollzugsaufgaben verzichten. Zusammen genommen stärkt das die Vor-Ort-Kompetenz der gesamten <strong>Berlin</strong>er Verwaltung<br />
im Interesse der Bürgerfreundlichkeit<br />
In Umsetzung dieser Leitgedanken fordern wir:<br />
Es wird eine klare und sachgemäße Aufgabenteilung zwischen der Hauptverwaltung und den örtlichen Behörden und Einrichtungen<br />
verwirklicht. Dabei ist vor Ort die aufgabennotwendige Verantwortung für Mittel und Personal zu konzentrieren.<br />
Dieses Prinzip muss auch innerhalb der Bezirksverwaltungen verwirklicht werden. Die Bezirke sollen ihr Handeln auf das<br />
sog. „Auftraggeber-Auftragnehmer-Modell“ abstellen: Intern und gegenüber anderen Trägern soll die Erbringung öffentlicher<br />
Leistungen durch Zielvereinbarungen und Leistungsverträge geregelt und kontrolliert werden. Eingriffe und Einzelfallsentscheidungen<br />
sind grundsätzlich zu verringern. Sie sollen sich auf Fälle offenkundiger Leistungsmängel konzentrieren.<br />
Der Senat soll von seinem Eingriffsrecht in das Handeln der Bezirke nur im begründeten Ausnahmefall Gebrauch machen.<br />
Eigene Gestaltungsmöglichkeiten unterscheiden Bezirke von anderen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen. Deshalb<br />
darf ihre eingeschränkte Finanzhoheit nicht dazu missbraucht werden, um sie de facto zu entmachten. Vielmehr müssen<br />
die Bezirke neue finanzielle Spielräume erhalten. Zugleich sind realistische Mindeststandards staatlicher Kernaufgaben<br />
von Bezirks- und Landesebene gemeinsam zu definieren und umzusetzen. Auf diese Weise wird die Aufgabenwahrnehmung<br />
der Bezirksverwaltungen gesichert.<br />
Eine Zentralisierung der Kindertagesstätten auf einen bezirks-unabhängigen, landesweit organisierten Träger wird derzeit<br />
abgelehnt. Stattdessen müssen die Kompetenzen der einzelnen Kitas erweitert und zusätzliche Kitas auf freie Träger verlagert<br />
werden. Ferner sollen Einrichtungen im Rahmen eines bezirksunmittelbaren Trägers zusammengefasst werden können.<br />
Dies erfordert neben der bestehenden Rechtsform des Eigenbetriebs die Verfügbarkeit von rechtsfähigen Einrichtungen,<br />
die von mehreren Bezirken getragen werden.<br />
42
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 43<br />
Die Autonomie der einzelnen Schule ist weiter zu stärken. Neben der Auswahl der Lehrer bekommt jede Schule einen eigenen<br />
Etat zugewiesen, der ihr weitgehende Entscheidungsfreiheit lässt, eigene Schwerpunkte zu setzen. Der Etat setzt sich<br />
aus den Titeln für Lehr- und Lernmitteln, Honorare, Sachmittel und Mitteln für den kleinen baulichen Unterhalt zusammen.<br />
Zur Abwicklung der zusätzlichen Verwaltungsarbeiten ist dem Schulleiter eine Sachbearbeitung zur Seite zu stellen. Über<br />
die Frage der Schulträgerschaft wird entschieden, wenn das Autonomiemodell ausreichend erprobt ist.<br />
Die Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde werden den Bezirken übertragen. Mit der Verlagerung erhalten die Bezirke<br />
diejenigen Personal- und Sachmittel, die für diesen Bereich bei fortdauernder Zuständigkeit der Hauptverwaltung verausgabt<br />
worden wären.<br />
Im Flächennutzungsplan werden gesamtstädtische Planungszonen ausgewiesen. Für diese Gebiete liegen alle hoheitlichen<br />
Aufgaben der Bauleitplanung beim Land, also beim Abgeordnetenhaus und bei der Senatsbauverwaltung. Alle nicht auf<br />
diese Weise gekennzeichneten Gebiete fallen in die Planungskompetenz der Bezirke. Innerhalb der Bezirke fassen künftig<br />
die Bezirksverordnetenversammlungen die Aufstellungs-, die Billigungs- und Auslegungs- sowie die Festsetzungsbeschlüsse<br />
von Bebauungsplänen.<br />
Den Bezirken ist eine eigenständige Wirtschaftsförderung zu ermöglichen. Aufgrund des Rückgangs von Betriebsverlagerungen<br />
und größeren Neugründungen liegen die eigentlichen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten im örtlichen Bestand.<br />
Diese Bestandspflege zählt zu den Kernkompetenzen bezirklicher Wirtschaftspolitik. Die Bezirke besitzen detaillierte<br />
Kenntnis über die Wirtschaftsstruktur vor Ort, die Situation der Einzelbetriebe und etwaige Nutzungskonflikte. Ihre Aufgaben<br />
sind die Unterstützung von kleineren Existenzgründungen durch Beratung und Information, die Mitwirkung bei der Flächenvorsorge<br />
und der Bereitstellung unternehmensorientierter Infrastruktur sowie die Förderung der Einzelhandelsentwicklung.<br />
Demgegenüber ist die Wirtschaftsförderung auf Landesebene Ansprechpartner für Unternehmen ab einer bestimmten Bedeutung<br />
und Größenordnung sein (Stichwort One-Stop-Agency). Ansiedlungerfolge aus jüngster Zeit (Universal Music,<br />
MTV, Coca-Cola) bestätigen das.<br />
Die vielseitigen und reichhaltigen Kulturangebote in <strong>Berlin</strong> sind die wesentlichen Standortvorteile der Hauptstadt. Sie begründen<br />
ihre Attraktivität für BürgerInnen und Unternehmen. Angesichts der <strong>Berlin</strong>er Haushaltskrise können jedoch auch im<br />
Kulturbereich die alten Strukturen nicht ohne kritische Prüfung fortbestehen. Dies gilt für die Landes- wie die Bezirksebene.<br />
So sollen in den Bezirken vor allem diejenigen Angebote vorgehalten werden, die auf gesamtstädtischer Ebene nicht bestehen.<br />
Sie müssen in einer gemeinsamen Aufgabenkritik von Land und Bezirken identifiziert werden. Hierzu soll eine gemeinsame<br />
Kommission aus Vertretern des Kultursenats, des Abgeordnetenhauses, der Bezirke und freier Träger gebildet werden. Die<br />
finanzielle Absicherung der definierten Standards muss im Rahmen der Zuweisungen an die Bezirke gewährleistet sein.<br />
Alle anderen bezirklichen Aktivitäten müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dabei sind Bildungsangebote reinen<br />
Freizeitnutzungen vorzuziehen. Außerdem muss der Anteil befristeter und flexibler Förderung erhöht und die dauerhafte<br />
Unterhaltung und Förderung fester Einrichtungen verringert werden.<br />
3. Selbstverwaltung in den Bezirken gestaltungsfähig machen<br />
Eine sachgemäße und örtlich gestaltende Verwaltung muss politische Prioritäten setzen und diese ressortübergreifend<br />
verwirklichen. Hierfür benötigen die Bezirke und ihre gewählten Organe eine breitere Legitimation, eine erweiterte Organisationskompetenz<br />
und die Stärkung der politischen Verwaltungsspitze. Zugleich muss die Bezirksverordnetenversammlung<br />
als formaler Teil der Verwaltung in ihren Rechten gegenüber dem Bezirksamt aufgewertet werden.<br />
In Umsetzung dieser Leitgedanken fordern wir:<br />
Das politische Bezirksamt wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingeführt. Der Bezirksbürgermeister erhält innerhalb des<br />
Bezirksamtes die Richtlinienkompetenz.<br />
Der Wettbewerb um das Amt eines Bezirksamtsmitgliedes soll durch bundesweite öffentliche Ausschreibungen für die einzelnen<br />
Geschäftsbereiche erhöht werden. Die Wahl eines Kandidaten soll jeweils für einen bestimmten Geschäftsbereich<br />
erfolgen. Das Vorschlagsrecht der Bezirksverordnetenversammlung bleibt davon unberührt.<br />
Die Stellung der Bezirksverordneten wird durch ein verändertes Wahlrecht gestärkt. Ein zu bestimmender Anteil der Bezirksverordneten<br />
soll direkt in den zu bildenden BVV-Wahlkreisen, der verbleibende Teil (wie bisher) über die Bezirksliste<br />
einer Partei gewählt werden. Bei der Listenwahl hat jeder Wähler so viele Stimmen, wie Vertreter zu wählen sind. Er kann<br />
diese Stimmen die Bewerber eines Wahlvorschlages oder unterschiedliche Wahlvorschläge verteilen (panaschieren). Einem<br />
Bewerber kann er jeweils bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).Bezirksverordnete erhalten das Recht des freiwilligen<br />
Fraktionszusammenschlusses.<br />
Der Erwerb und die Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken aus dem Finanz- und Fachvermögen der Bezirke sowie<br />
die Meldung von Liegenschaften an den Liegenschaftsfonds bedürfen der Beschlussfassung durch die Bezirksverordnetenversammlung.<br />
43
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 44<br />
Vergabeentscheidungen der Bezirke bedürfen ab einer bestimmten Summe der Zustimmung durch den Finanzausschuss<br />
der Bezirksverordnetenversammlungen. Die Bestimmungen der VOB bzw. VOL bleiben davon unberührt.<br />
Im Sinne einer effizienteren Arbeit sowie zur Sicherung vergleichbarer Standards und Verwaltungsabläufe soll der Zuschnitt<br />
der Geschäftsbereiche der Bezirksverwaltungen untereinander und möglichst auch mit dem der Senatverwaltung übereinstimmen.<br />
Die Bezirke erhalten untereinander erweiterte Kooperationsmöglichkeiten. Hierzu soll insbesondere das Eigenbetriebsgesetz<br />
genutzt werden, wobei die Zustimmung des Landes zur Neubildung eines überbezirklichen Eigenbetriebs auf eine<br />
Rechtmäßigkeitsprüfung und Genehmigung durch die Senatsinnenbehörde zu reduzieren ist.<br />
Die Bezirke erhalten alleine und in Form einer überbezirklichen Vereinbarung die Möglichkeit zur Errichtung von bezirksunmittelbaren<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie von gGmbHs und GmbHs. Sie benötigen hierzu die<br />
Zustimmung der zuständigen Senatsbehörden und des Hauptausschusses.<br />
Es werden alle finanziellen und organisatorischen Parallelstrukturen auf der Ortsebene aufgelöst und in die Bezirksverwaltungen<br />
und die Bezirkshaushalte überführt. Projekte wie das Quartiersmanagement sollen als zweckgebundene Sonderprogramme<br />
an die Bezirke weitergegeben werden, müssen aber in der Organisations- und Finanzhoheit des Bezirks vollzogen<br />
werden.<br />
Der Rat der Bürgermeister erhält ein Initiativrecht im Abgeordnetenhaus. Ein entsprechender Antrag muss mit der absoluten<br />
Mehrheit der gewählten Bezirksbürgermeister beschlossen werden. Über einen solchen Antrag muss das Abgeordnetenhaus<br />
in angemessener Frist, spätestens jedoch acht Wochen nach Antragstellung befinden.<br />
Der Rat der Bürgermeister erhält ein Initiativrecht im Abgeordnetenhaus. Ein entsprechender Antrag muss mit der absoluten<br />
Mehrheit der gewählten Bezirksbürgermeister beschlossen werden. Über einen solchen Antrag muss das Abgeordnetenhaus<br />
in angemessener Frist, spätestens jedoch acht Wochen nach Antragstellung befinden.<br />
4. Mitbestimmung und Teilhabe fördern<br />
Eine lebendige und durch die BürgerInnen getragene Demokratie muss die Kommunikation zwischen Politik und Wählern<br />
sowie die Teilhabe der BürgerInnen gewährleisten. Diese Grundprinzipien finden in der bisherigen <strong>Berlin</strong>er Verfassung und<br />
den Landesgesetzen keine ausreichende Beachtung. Wir begrüßen daher nachdrücklich den gemeinsamen Antrag der<br />
Fraktionen der <strong>SPD</strong> und PDS im Abgeordnetenhaus über „Mehr Demokratie für <strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er“. Wir unterstützen<br />
insbesondere die Einrichtung von Bürgerentscheiden, ausgelöst durch Bürgerbegehren und durch Beschluss der Bezirksverordnetenversammlungen.<br />
In Ergänzung zu den im o. g. Antrag enthaltenen Regelungen fordern wir:<br />
Für Bürgerentscheide, die durch ein Bürgerbegehren ausgelöst worden sind, kann die Bezirksverordnetenversammlung mit<br />
der Mehrheit ihrer Mitglieder einen sachbezogenen Alternativvorschlag einbringen. Auf den Stimmzetteln des Entscheids<br />
sind beide Vorschläge, der des Bürgerbegehrens und der aus den Reihen der BVV, zur Abstimmung zu stellen. Eine entsprechende<br />
Regelung soll auch für Bürgerentscheide auf Landesebene vorgesehen werden.<br />
Das Quorum für Einwohneranträge an die Bezirksverordnetenversammlung ist in dem o. g. Antrag auf 0,1% der Wahlberechtigten<br />
zu senken.<br />
Ein Bürgerentscheid soll bereits dann durch das Bezirksamt auf seine Rechtmäßigkeit geprüft und durchgeführt werden,<br />
wenn 1 vom Hundert der im Bezirk Wahlberechtigten das Bürgerbegehren unterschrieben haben (zweistufiges Verfahren).<br />
Ein Bürgerentscheid ist dann erfolgreich, wenn mindestens 25% der Wahlberechtigten daran teilnehmen und sich eine<br />
Mehrheit für den zur Abstimmung gestellten Gegenstand entscheiden.<br />
Neben dem Bürgerentscheid sind weitere Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Auch<br />
Kindern und Jugendlichen sind ihrem Alter entsprechend geeignete Beteiligungsmethoden anzubieten (z.B. Kinder- und<br />
Jugendforen, Projektarbeit, Politikersprechstunden). Eine wichtige Handlungsebene stellt dabei das direkte Wohn- und<br />
Lebensumfeld dar. In <strong>Berlin</strong> sind das die Kieze in den Innenstadtbereichen oder die einzelnen Ortsteile in den Randbereichen.<br />
Politische Entscheidungen, die auf dieser Ebene getroffen werden, sind für den Bürger am ehesten sichtbar. Umso<br />
wichtiger ist es, den Bürgern größere Einflussmöglichkeiten auf diese Entscheidungsprozesse zu geben. Ein Anfang hierfür<br />
ist eine breit getragene Leitbildentwicklung für die einzelnen Ortsteile.<br />
In Umsetzung dieser Leitgedanken fordern wir:<br />
Die Bezirke initiieren auf Ortsteil- und Quartiersebene dezentrale Leitbildprozesse. Hieran werden alle relevanten Akteure<br />
vor Ort beteiligt (Einwohner, Einzelhandel, Kitas, Schulen, soziale Einrichtungen usw.)<br />
Es ist dabei insbesondere auf altersgerechte Beteiligungsmethoden zu achten. Jedem Bürger ist die Möglichkeit einzuräu-<br />
44
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 45<br />
men, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Er soll in angemessener Weise über das Ergebnis informiert zu werden. In dem<br />
Leitbild werden Prioritäten für die Entwicklung des Quartiers gesetzt. In diesem Zusammenhang sind die Lebenswelten von<br />
allen Altersgruppen zu berücksichtigen. Das Leitbild stellt die Grundlage politischer Entscheidungen dar. Ziel ist es, die<br />
Entwicklung der Quartiere als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe zu betrachten. Nicht die vorhandenen Mittel stehen<br />
im Vordergrund einer Entscheidung, sondern das Ziel und die gemeinsame Überlegung, wie dieses Ziel erreicht werden<br />
kann.<br />
Die Leitbilder der Ortsteile sind in den ebenfalls demokratisch entwickelten Leitbildern der Bezirke zu berücksichtigen. Eine<br />
Leitbildentwicklung sollte auch am Anfang eines vom Bezirk verantworteten Quartiersmanagements stehen, um so eine<br />
größere demokratische Legitimation der Maßnahmen zu schaffen.<br />
5. Planungssicherheit und Mitverantwortung<br />
Angesichts der <strong>Berlin</strong>er Haushaltslage ist die Notwendigkeit einer sparsamen Haushaltswirtschaft unumgänglich. Allerdings<br />
ist der <strong>Berlin</strong>er Haushaltsnotstand in erster Linie auf das Auslaufen der <strong>Berlin</strong>-Förderung und auf Entscheidungen zurückzuführen,<br />
die auf Senats- und Abgeordnetenhausebene getroffen wurden (Bankgesellschaft, Wohnungsbauförderung, Entwicklungsgebiete<br />
und Personalwirtschaft). Während die Bezirke schon seit Jahren mit enormen Sparauflagen belegt werden,<br />
hat man auf der Ebene der Hauptverwaltung nur unzureichende Anpassungen vorgenommen.<br />
Es ist deshalb künftig darauf hinzuwirken, dass die Einsparungen im gleichen Maße in den Hauptverwaltungen und in den<br />
Bezirken erbracht werden.<br />
Unverzüglich muss daher auch die Hauptverwaltung über Globalsummen finanziert werden und auch dort das Zuweisungsprinzip<br />
leistungsbezogen erfolgen. Somit werden auch die Hauptverwaltungen mit sinkenden Budgets arbeiten müssen. Die<br />
Kosten öffentlicher Leistungen müssen transparent gemacht werden. Wir brauchen ein zielorientiertes Controlling auf allen<br />
Ebenen. Dies gilt insbesondere für die Hauptverwaltungen, die die langjährigen Erfahrungen der Bezirke nutzen können.<br />
Wir erkennen an, dass es auf der Bezirksebene weiterhin Einsparpotenziale gibt und die Bezirke im Sinne ihrer gesamtstädtischen<br />
Verantwortung zu einer sparsamen Haushaltswirtschaft verpflichtet sind. Die Bezirke sind jedoch nur in der<br />
Lage, diese Einsparpotentiale zu realisieren, wenn sich die inhaltlichen Vorgaben seitens des Landes ändern (z.B. Hilfen<br />
zur Erziehung) und eine zumindest vorübergehende Entlastung im Personalbereich erreicht wird.<br />
Im Interesse einer gesicherten und effizienten Aufgabenerfüllung halten wir es daher für unverzichtbar, dass neue Aufgaben<br />
auskömmlich finanziert werden, Standards überprüft werden, Sparvorgaben realistisch bemessen werden und Mittel für<br />
investive Sparmaßnahmen bereit gestellt werden.<br />
In Umsetzung dieser Leitgedanken fordern wir:<br />
Die vom Land beschlossenen Mindeststandards und Qualitätsanforderungen in der Versorgungs- und Leistungsverwaltung<br />
werden im Rahmen gemeinsamer, nach Fachbereichen unterteilter Qualitätszirkel überprüft und permanent evaluiert. Zusätzliche<br />
Einsparvorgaben im Bereich der steuerbaren und nicht steuerbaren Pflichtaufgaben werden nur umgesetzt, wenn<br />
zugleich eine deutliche Reduzierung der Standards erfolgt.<br />
In der <strong>Berlin</strong>er Verfassung und dem Bezirksverwaltungsgesetz wird verankert, dass die Übertragung von Aufgaben auf die<br />
Bezirke mit der Übertragung der dafür erforderlichen Mittel zu verbinden ist (Konnexitätsprinzip).<br />
Es werden im Landeshaushalt Mittel für sog. „Investitionsdarlehen“ eingestellt. Die Bezirke können solche Darlehen durch<br />
Vorlage eines Finanzierungsplans für Investitionen beantragen, die eine mittelfristige Einsparung zum Ziel haben. Der Finanzierungsplan<br />
muss dabei eine Übersicht über die für die nachfolgenden Jahre kalkulierte Mittelausgabe und die dadurch<br />
beabsichtigte Einsparung enthalten. Maßgabe ist, dass sich die Investitionen in einem angemessenen Zeitraum amortisieren.<br />
Die somit erzielten Einsparungen werden dem Bezirk gemäß seinem Finanzierungsplan anteilig bei den nachfolgenden<br />
Budgetzuweisungen gutgeschrieben.<br />
Ab 2004 beschließt das Abgeordnetenhaus eine mittelfristige Finanzplanung für die Zuweisungen an die Bezirke. Hierbei ist<br />
im Rahmen des Gesamtvolumens des Landes- bzw. Stadthaushaltes ein Prozentsatz für die Zuweisung an die Gesamtheit<br />
der Bezirke festzusetzen.<br />
Die Bezirke sollen an den im Bezirk erzielten öffentlichen Einnahmen teilhaben. Mittelfristig werden deshalb die Zuweisungen<br />
an die einzelnen Bezirke zu einem festzulegenden Prozentsatz an die Veränderungen der örtlichen Real- und Einkommenssteuererträge<br />
gekoppelt. Strukturelle Nachteile müssen auch weiterhin durch einen bezirklichen Finanzausgleich abgeschwächt<br />
werden.<br />
Das bisherige Zumessungssystem ist um ein ergänzendes Budgetierungsmodell zu erweitern, das Anreize zu wirtschaftlichem<br />
Verwaltungshandeln in den Bezirken sicherstellt. Eigenverantwortlich erwirtschaftete Mehreinnahmen sind den Bezirken<br />
zumindest zu einem gewissen Prozentsatz zur eigenen Verwendung zur Verfügung zu stellen. Dabei sind wettbewerbsbedingte<br />
Unterschiede zwischen den Bezirken ausdrücklich erwünscht und nicht im Rahmen <strong>Berlin</strong>weiter Haushaltsglättungen<br />
auszugleichen.<br />
45
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 46<br />
Das Land stellt zweckgebundene Zuweisungen an die Bezirke zur Verfügung, die für einen Einstellungskorridor verwandt<br />
werden müssen. Die Verausgabung dieser Mittel bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses.<br />
Eine auf das Wesentliche konzentrierte Information über den Stand der Infrastruktur, der selbst oder durch Dritte angebotenen<br />
Dienstleistungen und des erforderlichen finanziellen Aufwands ist von den Bezirken in einer Bezirksbilanz darzustellen.<br />
Diese Bilanz soll einen Vergleich der Bezirke untereinander ermöglichen. Dafür müssen Daten (aus gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Statistiken oder verwaltungsintern geführten Geschäftsstatistiken) zusammengeführt und in den Vergleich gestellt<br />
werden. Die Erhebung neuer Daten ist regelmäßig nicht erforderlich. Mit einer derartigen Bilanz werden Strukturprobleme<br />
für die Bezirke und für die Landespolitik stärker als bisher ersichtlich.<br />
6. Länderfusion als Chance und Maßstab<br />
Die angestrebte Fusion der Länder <strong>Berlin</strong> und Brandenburg wird eine neue politische Ebene einführen. Die Aufgaben der<br />
Senatsverwaltungen müssen daher in landes- und gesamtstädtische Aufgaben aufgeteilt werden. Die landespolitischen<br />
Aufgaben fallen der neuen Landesregierung zu. Die gesamtstädtischen Aufgaben werden von der neu zu schaffenden<br />
Stadtverwaltung wahrgenommen. Für die Aufgaben der Bezirke muss es aufgrund der Länderfusion keine Veränderungen<br />
geben. Vielmehr werden sie im Verhältnis zu den Gemeinden und Kreisen des Umlandes als Kooperationspartner in gestärkter<br />
Form benötigt. Ihre Aufgaben und Kompetenzen müssen daher entsprechend ausgestaltet werden. Die Möglichkeiten<br />
und Rechtspositionen zur interkommunalen Zusammenarbeit mit den angrenzenden Gemeinden und Landkreisen sollten<br />
bereits im Vorfeld der Fusion ausgeweitet werden.<br />
46
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 47<br />
Sonstige Anträge<br />
Arbeit / Wirtschaft<br />
Antrag Nr. 113/I/03<br />
Annahme<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und der Bezirksämter werden aufgefordert, ihren Einfluss in den Verwaltungsausschüssen<br />
der Arbeitsämter, gegenüber dem Landesarbeitsamt, den sozialdemokratischen Abgeordneten des Bundestages<br />
und der Bundesregierung einzusetzen, damit die Bundesanstalt für Arbeit und ihre Arbeitsämter zu einer Politik der<br />
Integration statt Ausgrenzung in den nachfolgenden vier Punkten zurückfindet:<br />
1. Die derzeitige Politik der Arbeitsämter hat zur Konsequenz, dass lediglich Arbeitslosengeldempfänger in den Genuss von<br />
Vermittlungsbemühungen der Arbeitsämter gelangen. Der Ausgrenzung von Arbeitslosenhilfeempfängern, Frauen,<br />
Migranten und benachteiligten Jugendlichen aus der Arbeitsmarktpolitik und ihrem Abdrängen in die Sozialhilfe ist entschieden<br />
entgegenzuwirken.<br />
2. Die Modernisierung der Bundesanstalt für Arbeit darf nicht zu Lasten der Arbeitsmarktpolitik gehen. Die radikalen Kürzungen<br />
bei Bildungsmaßnahmen um derzeit ca. zwei Drittel der bisher zur Verfügung stehenden Mittel sind unverzüglich<br />
rückgängig zu machen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, zur außer- und überbetrieblichen<br />
Ausbildung und zur beruflichen Weiterbildung dürfen nicht eingeschränkt werden.<br />
3. Die öffentliche Förderung von Arbeitslosen beim Aufbau eines eigenen Unternehmens ist richtig, um Arbeitslosigkeit zu<br />
bekämpfen. Um die Chancen der Integration der Unternehmensgründungen wirtschaftlich und sozial benachteiligter Menschen<br />
in den Markt zu erhöhen, sind flankierende Angebote an Qualifizierung und Beratung vor, während und nach der<br />
Gründung notwendig. Für diesen Personenkreis ist ein gemeinsam von Bund und Länder finanziertes Förderprogramm zu<br />
entwickeln.<br />
4. Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen ermöglichen nicht nur vielen Menschen vorübergehen aus der<br />
Arbeitslosigkeit auszubrechen, sich zu qualifizieren und persönliche Kompetenzen zu erlangen. Sie erfüllen mit ihren Arbeiten<br />
auch gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten, die sonst nicht erfüllt würden. In diesem Sinne ist eine pauschale Kürzung<br />
von SAM und ABM auf 6 Monate kontraproduktiv.<br />
5. Die Länge der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Zuweisungsdauer der Beschäftigten zur Fortsetzung der Beständigkeit<br />
und Qualitätssicherung der inhaltlichen Arbeit in den Maßnahmen sowie zur Schaffung der Sicherheit einer langfristigen<br />
Planung durch die Beschäftigungsträgerist zu überprüfen.<br />
6. Bei der Finanzierung von Bildung und Qualifizierung sollten insbesondere auch alleinerziehende Frauen mit kleinen Kindern<br />
bedacht werden, die aufgrund der häuslichen Situation kein Arbeitslosengeld beziehen, um ihnen die Möglichkeit zur<br />
Erreichung eines Berufsabschlusses sowie zum Weidereinstieg in das Berufsleben zu geben.<br />
7. Zur Sicherung einer erfolgreichen Überführung von Teilnehmern an Qualifizierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt ist<br />
eine Evaluierung der Bildungsträger und eine inhaltliche Überprüfung der Maßnahmen kurzfristig vorzunehmen.<br />
47
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 48<br />
Bildung<br />
Antrag Nr. 114/I/03<br />
Nichtbefassung<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der Fraktion der <strong>SPD</strong> im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus und im Senat von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, sich dafür<br />
einzusetzen, dass die deutsch-polnische <strong>Europa</strong>schule in der Sekundarstufe I und II an der Robert-Jungk-Oberschule fortgeführt<br />
und hierfür die erforderliche gymnasiale Oberstufe eingerichtet wird.<br />
Antrag Nr. 115/I/03<br />
Annahme<br />
KVV TrepKöp<br />
Der LPT möge beschließen:<br />
Der Senator für Bildung, Jugend und Sport wird gebeten, die Rahmenlehrpläne auf zeitgemäße Fachinhalte und Fachmethoden<br />
zu überprüfen. Überflüssige Wiederholungen in den Klassenstufen sollten vermieden und abgebaut werden. Durch das<br />
Aufgreifen aktueller Themen sollte der Unterricht lebensnaher und interessanter gestaltet werden. Bei der Überarbeitung der<br />
Rahmenpläne ist die angestrebte Länderfusion zwischen Brandenburg und <strong>Berlin</strong> durch entsprechende Abstimmung schon<br />
zu berücksichtigen.<br />
Antrag Nr. 116/I/03<br />
Annahme i.d.f.d.LPT:<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Wir lehnen Studiengebühren für das Erststudium gemäß Bundeshochschulrahmengesetz weiterhin strikt ab und fordern alle<br />
sozialdemokratischen Politikerinnen und Politiker in Bund und Ländern dazu auf, die Einführung von Studiengebühren zu<br />
verhindern.<br />
Antrag Nr. 117/I/03<br />
Erledigt durch Annahme 116/I/03<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
In den letzten Jahren wird in der bildungspolitischen Debatte zunehmend der Ruf nach Studiengebühren laut, um staatliche<br />
Ausgaben zu reduzieren, aber auch um Studierende für eine angebliche Dienstleistung bezahlen zu lassen, die ihnen einen<br />
von der Gesellschaft subventionierten individuellen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt verschaffe. Diese Argumentation<br />
liegt zwar voll im neoliberalen Politiktrend, der auch weite Teile der Sozialdemokratie infiziert hat, aber auch an der gesellschaftlichen<br />
Realität weit vorbei, da schon die Grundannahmen auf tönernen Füßen stehen. So wird in der Debatte zumeist<br />
die Tatsache ausgeblendet, dass die Ausgaben für die Hochschulen in den letzten 30 Jahren real fast um die Hälfte zurückgegangen<br />
sind. Sinkende Bildungsausgaben führten bei gleichzeitig steigenden Studierendenzahlen zu einer chronischen<br />
Unterfinanzierung der Hochschulen. Bildungsausgaben kapp verdoppeln müsste, um das Niveau der skandinavischen Länder<br />
zu erreichen, deren Bildungssystem in <strong>Europa</strong> führend ist, was nicht nur die PISA-Studie eindrucksvoll belegt hat. Dabei<br />
verfügen diese Länder nicht nur über höhere Studienzahlen, sonder auch über den stabilen gesellschaftlichen Konsens der<br />
Studiengebührenfreiheit.<br />
Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass die Erhebung von Studiengebühren bei gleichzeitig sinkenden staatlichen Mitteln zu<br />
einem zerstörerischen Wettbewerb zwischen den Hochschulen geführt hat. Dies geht sogar so weit, dass britische Spitzenhochschulen<br />
ihre Anstrengungen in Forschung und Lehre verringern mussten, um nicht zahlungsunfähig zu werden.<br />
Die Orientierung an kurzfristiger Marktlogik ruiniert so die Substanz des Bildungswesens und führt langfristig zu sinkender<br />
Qualität, was unter den Bedingungen des Wandels zur Wissensgesellschaft fatale Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft mit<br />
sich bringt. Studiengebühren erzeugen aber auch immense individuelle Probleme, da für sie häufig Darlehen aufgenommen<br />
werden müssen, was für sozial Schwache eine zusätzliche Hürde auf dem Weg zu einem Hochschulstudium bedeutet, da nur<br />
wenige Studierende in den Genuss von Stipendien kommen können.<br />
Der Vorschlag zur Einführung allgemeiner Studiengebühren wird häufig mit der Forderung zur Einführung eines Stipendiensystems<br />
verbunden, um sozial Schwachen ein Hochschulstudium zu ermöglichen. Dies ist in Deutschland mittelfristig aber<br />
nicht realisierbar, da zur Zeit nur rund 2 % der Studierenden ein Stipendium erhalten, dessen Mittel in erster Linie aus öffentlichen<br />
Töpfen stammen, und unklar bleibt, wie die notwendigen Mittel akquiriert werden sollen. Darüber hinaus sind Stipendien<br />
an die individuelle Leistungsfähigkeit der Menschen gekoppelt und für so genannte Hochbegabte vorbehalten. Dieser<br />
Weg bedeutet somit den endgültigen Abschied von Verständnis von Bildung als individuellem Recht, das eine der Wurzeln<br />
der Sozialdemokratie darstellt.<br />
Auch die Unterstellung, dass Studierende auf Kosten der Allgemeinheit einen strategischen Wettbewerbsvorteil erreichen<br />
würden, greift viel zu kurz, da zu einen Studierende schon heute die Kosten ihres Studium in erheblichem Umfang selbst<br />
48
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 49<br />
tragen und während ihres Studiums kein regelmäßiges Erwerbseinkommen erhalten und zum anderen AkademikerInnen zu<br />
Recht wegen tendenziell höherer Einkommen in der Regel einen höheren Beitrag zum Steueraufkommen leisten.<br />
Studiengebühren als Reaktion auf neoliberalen Deregulierungswahn und knappe öffentliche Kassen bedeuten eine weitere<br />
Verschärfung der Chancenungleichheit und langfristig erhebliche Nachteile im Strukturwandel zur Wissensgesellschaft. Wir<br />
lehnen deshalb Studiengebühren als Beitrag zur Individualisierung von Risiken weiterhin strikt ab und fordern alle sozialdemokratischen<br />
PoltikerInnen in Bund und Ländern dazu auf, die Einführung von Studiengebühren zu verhindern.<br />
Antrag Nr. 118/I/03<br />
Vom Antragsteller zurückgezogen<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats und die <strong>SPD</strong>-Abgeordneten des <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, von der<br />
Abschaffung der Lernmittelfreiheit abzusehen und den Landesparteitagsbeschluss des <strong>SPD</strong>-Bildungsparteitages am<br />
7.04.2001 zu respektieren:<br />
“Chancengleichheit ist wirksam nur zu sichern, wenn die Finanzierung von Bildung in staatlicher Verantwortung<br />
bleibt, Schulgeld-, Lernmittelfreiheit und Gebührenfreiheit für Schüler/innen, Auszubildende und Studierende gewährleistet<br />
sind und für die Bildung notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.”<br />
Jeder Versuch des <strong>SPD</strong>/PDS- Senats, der zur Aufhebung der Lernmittelfreiheit führt, ist zurückzuweisen.<br />
Antrag Nr. 119/I/03<br />
Ablehnung<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats und die <strong>SPD</strong>-Abgeordneten des <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhauses werden aufgefordert, von der<br />
Abschaffung der Lernmittelfreiheit abzusehen und den Landesparteitagsbeschluß des Bildungsparteitages am 07.04.2001 zu<br />
respektieren:<br />
"Chancengleichheit ist wirksam nur zu sichern, wenn die Finanzierung von Bildung in staatlicher Verantwortung bleibt, Schulgeld-,<br />
Lernmittelfreiheit und Gebührenfreiheit für Schüler/innen, Auszubildende und Studierende gewährleistet sind und für<br />
die Bildung notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden."<br />
Jeder Versuch des <strong>SPD</strong>/PDS-Senats, der zur Aufhebung der Lernmittelfreiheit führt, ist zurückzuweisen. Die Landesparteitagsdelegierten<br />
werden außerdem aufgefordert, den o.g. Beschluss zur Lernmittelfreiheit auf dem <strong>SPD</strong>-Landesparteitag am<br />
17.05.03 zu bekräftigen und so jeden möglichen Bestrebungen des <strong>SPD</strong>/PDS-Senats, die Lernmittelfreiheit abzuschaffen,<br />
eine klare Absage zu erteilen.<br />
Antrag Nr. 120/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
KDV Reinickendorf<br />
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder im Abgeordnetenhaus und im Senat auf dafür Sorge zu tragen, dass trotz der<br />
schwierigen Haushaltslage in <strong>Berlin</strong> weiterhin mit Priorität in die Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen investiert<br />
wird.<br />
Antrag Nr. 121/I/03<br />
Annahme<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Senator für Bildung, Jugend und Sport und die <strong>SPD</strong>-Fraktion werden aufgefordert:<br />
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird zum verpflichtenden Unterrichtsprinzip in der <strong>Berlin</strong>er Schule und der vorschulischen<br />
Erziehung erhoben.<br />
In alle zur zurzeit neu entstehenden Rahmenpläne der Grundschule und der Sekundarstufe I ist DaZ verbindlich einzubeziehen.<br />
In allen Lernbereichen und Fächern sind Fachsprache-Standards verbindlich zu beschreiben.<br />
DaZ ist als verpflichtendes Modul in die Lehrerbildung und die Ausbildung der ErzieherInnen aufzunehmen.<br />
Für die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Bereich DaZ sind verpflichtende Fortbildungskurse für alle LehrerInnen<br />
(Grundstufe, Sekundarstufe I) und ErzieherInnen anzubieten.<br />
Integrierte Ganztagstagsgrundschulen mit dem Bildungsschwerpunkt „erfolgreicher Spracherwerb in allen Fächern“ und<br />
Ressortübergreifenden Angeboten ( im Sinne von Service- und Kompetenzzentren für den Stadtteil ) sind mit Dringlichkeit<br />
in sozialen Brennpunktgebieten einzurichten.<br />
49
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 50<br />
Antrag Nr. 122/I/03<br />
Überweisung AH-Fraktion<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Senator für Bildung, Jugend und Sport und die Abgeordnetenhausfraktion der <strong>SPD</strong> werden aufgefordert, den "Entwurf<br />
für ein neues Schulgesetz für das Land <strong>Berlin</strong>" (zitiert in der Fassung vom 10.12.02, Homepage SenBJS) in Bezug auf die<br />
folgenden Punkte zu überarbeiten:<br />
1. Die Vorschule an den Grundschulen muss als bewährtes Instrument vorschulischer Erziehung und Bildung erhalten bleiben.<br />
2. Es ist weiterhin sicherzustellen, dass GrundschülerInnen in der Regel von der 1. bis 6. Klasse in einem durchgehenden<br />
Klassenverband verbleiben können. Die Kombination aus vorverlegter Einschulung (§ 42 – Stichtag 31.12. statt 30.6.), ersatzloser<br />
Streichung der Überprüfung der Schulreife durch Schulärztlichen Dienst und Kindergarten bzw. Vorschule sowie<br />
jahrgangsübergreifender "Schulanfangsphase" wird daher abgelehnt (§ 20), wenn nicht die notwendige personelle, finanzielle<br />
und konzeptionelle Absicherung erfolgt (z.B. ErzieherIn und LehrerIn in der Eingangsstufe bei einer Klassenfrequenz<br />
von maximal 25 Kindern).<br />
3. Die Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 69) sind auch in Zukunft so auszugestalten, dass sie realistischer<br />
Weise von einem Menschen bewältigt werden können. Es ist eine entsprechend qualifizierte Unterstützung der Schulleitung<br />
insbesondere in Bezug auf die neu hinzukommenden organisatorisch haushaltstechnischen Aufgaben (§ 69 (3)) im<br />
Gesetz zu entwickeln.<br />
Antrag Nr. 123/I/03<br />
Erledigt durch Ablehnung 119/I/03<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie der sozialdemokratisch geführte Senat werden aufgefordert,<br />
den Paragraphen 50 des neuen Schulgesetzes in der Form des Referentenentwurfes vom 10. Dezember 2002 zu<br />
belassen und somit nicht von der Lehr- und Lernmittelfreiheit an allgemein bildenden Schulen abzurücken.<br />
Antrag Nr. 124/I/03<br />
Nichtbefassung<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der sozialdemokratisch geführte Senat wird aufgefordert, die Entscheidung, die Grundschule Maselake-Nord nicht zu errichten,<br />
erneut zu prüfen, um dann anhand dieser Fakten seine Entscheidung zu revidieren und die Schule am vom Bezirk geplanten<br />
Standort zu errichten.<br />
50
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 51<br />
Frauen<br />
Antrag Nr. 125/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
ASF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Getreu dem Grundsatz: „Nach der Wahl ist vor der Wahl!“ wollen wir unseren eigenen Versprechen und dem Verlangen der<br />
Bürgerinnen und Bürger gleichstellungspolitische Taten folgen lassen:<br />
Wir fordern<br />
1. die konsequente Übernahme von Verantwortung aller Parteiführungsgremien für die Umsetzung und die Entwicklung<br />
entsprechender Evaluierungsinstrumente,<br />
die konsequente Umsetzung entsprechender Parteitagsbeschlüsse zur Umsetzung der Doppelstrategie Gender<br />
Mainstreaming und Frauenfördermaßnahmen: so hat die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> bereits im April 2001 einen einstimmigen Beschluss<br />
zur Weiterbildung der FunktionärInnen bezüglich Gender Mainstreaming gefasst, es gilt diesen Beschluss auch<br />
zu realisieren!<br />
2. ausreichende Ressourcen und die Einbeziehung von ExpertInnen zur Entwicklung und Implementierung einer Organisations-<br />
und Personalentwicklung mit konkreten Ziel- und Zeitvorgaben zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung für<br />
alle zukünftig anstehenden Personalwahlen (Funktionärinnen bzw. Mandatsträgerinnen)<br />
3. bereits jetzt die konsequente Umsetzung struktureller Reformen mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit vor allem in<br />
der AG „Modernisierung der Parteistrukturen“<br />
4. die Entwicklung und Umsetzung einer Kampagne zur gezielten Gewinnung und Aktivierung von Frauen, die gleichzeitig<br />
auch auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenspläne der Frauen Bezug nimmt<br />
5. den Beginn einer politischen Diskussion zu einem „modernen Männerbild“ für die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>.<br />
Antrag Nr. 126/I/03<br />
Annahme<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der ASF-Bundesvorstand, die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Minister für Wirtschaft und Arbeit<br />
sowie die Ministerin für Justiz werden aufgefordert, gemeinsam mit dem Werberat zu prüfen, ob die zur Verfügung stehenden<br />
Instrumente ausreichen, um frauendiskriminierende Werbung wirksam zu sanktionieren, und ggf. entsprechende Instrumente<br />
zu schaffen.<br />
Resolution<br />
Erledigt durch tätiges Handeln<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
In der gesamten Bundesrepublik gibt es im Rundfunkbereich keine Intendantin. Wir fordern, bei der Fusion von ORB und<br />
SFB die IntendantInnenposition mit einer Frau zu besetzen.<br />
51
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 52<br />
Gesundheit<br />
Antrag Nr. 127/I/03<br />
Überweisung an AH- und BVV-Fraktionen<br />
Abt. 9/Neukölln<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Angesichts der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 1997 festgestellt hat, dass „Rauchen<br />
in Deutschland mehr Menschen, als Verkehrsunfälle, Aids, Alkohol, illegale Drogen, Morde und Selbstmorde zusammen<br />
tötet“, fordert der Landesparteitag die Mitglieder der <strong>SPD</strong>-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die sozialdemokratischen<br />
Mitglieder des Senats auf, ein umfassendes Programm zur Bekämpfung des Tabakkonsums als Volksdroge<br />
Nr. 1 vorzulegen und durchzusetzen.<br />
Ziel dieses Programms soll es sein, den Tabakkonsum in unserer Stadt einzuschränken und die <strong>Berlin</strong>er Bürgerinnen<br />
und Bürger rechtlich ausreichend vor Tabakrauchbelästigung zu schützen. In das Programm gehören insbesondere<br />
folgende Bereiche:<br />
1. Kindergärten<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> untersagt zum Wohle der Kinder grundsätzlich das Rauchen in städtischen Kindergärten. Bei der<br />
Einstellung von Erzieherinnen und Erziehern ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das Rauchen mit ihrer Erziehungsaufgabe<br />
nicht zu vereinbaren ist.<br />
Die Werbung für Tabakprodukte sollte im Umfeld von Kindergärten verboten werden.<br />
2. Schulen<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> ergreift in städtischen Schulen folgende Maßnahmen:<br />
• Das Rauchen in den Schulen wird nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Lehrkräften<br />
untersagt.<br />
• Bei der Einstellung werden die Lehrkräfte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Rauchen mit ihrer<br />
Erziehungsaufgabe nicht zu vereinbaren ist.<br />
• Die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter werden verpflichtet, die Aufgaben einer Drogenkontakt-Lehrkraft nur<br />
Nichtraucherinnen bzw. Nichtrauchern zu übertragen.<br />
• Die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter werden angewiesen, die Information der Schülerinnen und Schüler über die<br />
Gefahren des Rauchens deutlich mehr als bisher zu fördern. Dazu wird auf die verschiedenen Altersstufen<br />
abgestimmtes Informationsmaterial zum Thema Rauchen und Passivrauchen bereitgestellt.<br />
• Die Werbung für Tabakprodukte sollte im Umfeld von Schulen verboten werden.<br />
3. Jugendeinrichtungen<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> untersagt zum Wohle von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich das Rauchen in städtischen<br />
Jugendeinrichtungen. Bei der Einstellung von Betreuerinnen und Betreuern, Erzieherinnen und Erziehern und Sozialarbeiterinnen<br />
bzw. Sozialarbeitern ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das Rauchen mit ihrer Erziehungsaufgabe<br />
nicht zu vereinbaren ist.<br />
Die Werbung für Tabakprodukte sollte im Umfeld von Jugendeinrichtungen verboten werden.<br />
4. Krankenhäuser, Kliniken, Alten- und Pflegeheime<br />
Da Rauchen den Heilungsprozess verlangsamt oder gar verhindert und Raucherinnen bzw. Raucher keinen positiven<br />
Einfluss auf diesen Prozess ausüben, untersagt das Land <strong>Berlin</strong> zum Wohle der Patientinnen und Patienten in städtischen<br />
Krankenhäusern und Kliniken generell das Rauchen.<br />
Das gilt auch für Alten- und Pflegeheime, da deren Bewohnerinnen bzw. Bewohner häufig mehr Hemmungen haben,<br />
ihren Schutz einzufordern.<br />
52
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 53<br />
5. U- und S-Bahnhöfe<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> nimmt seinen Einfluss auf die BVG und die S-Bahn-GmbH wahr, um in den unterirdischen U- und S-<br />
Bahnhöfen die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:<br />
• An allen Eingängen zu unterirdischen U- und S-Bahnhöfen werden deutlich sichtbare Rauchverbotshinweise<br />
angebracht.<br />
• In den unterirdischen U- und S-Bahnhöfen wird durch regelmäßige Durchsagen auf das Rauchverbot<br />
hingewiesen.<br />
• Das Rauchverbot in den unterirdischen U- und S-Bahnhöfen wird öfters kontrolliert und bei Verstößen auch die<br />
Mittel des Ordnungsrechts angewandt. Dazu gehört das generelle Erteilen von Hausverboten ebenso wie die<br />
Verhängung von Strafen wegen Verschmutzung.<br />
• Alle Bediensteten der U- und der S-Bahn und die dort eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sowie die privaten<br />
Sicherheitskräfte erhalten die Befugnis, in diesem Sinne handeln zu können.<br />
6. Öffentliche Gebäude<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> verpflichtet seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsrechtlich dazu, nur noch in hierfür besonders<br />
vorgesehenen Räumen zu rauchen. Näheres ist in entsprechenden Dienstvereinbarungen mit den behördlichen<br />
Mitbestimmungsgremien zu regeln.<br />
In den allgemein zugänglichen Teilen öffentlicher Gebäude, wie Treppenhäusern, Fluren und Wartezonen ist das<br />
Rauchen generell zu verbieten und entsprechend darauf hinzuweisen.<br />
7. Gastronomie<br />
Zum Schutze der <strong>Berlin</strong>erinnen und <strong>Berlin</strong>er und ihrer Gäste werden folgende Maßnahmen ergriffen:<br />
• Das Land <strong>Berlin</strong> appelliert in geeigneter Weise an alle gastronomischen Betriebe im Stadtgebiet, ihren Gästen<br />
rauchfreies Speisen und Trinken in geschützten Nichtraucherbereichen zu ermöglichen.<br />
• Nichtraucherfreundliche Gastronomiebetriebe werden in besonderer Weise hervorgehoben, z.B. durch ein<br />
allgemein zugängliches und mehrsprachiges Verzeichnis der entsprechenden Betriebe.<br />
8. Kulturelle Veranstaltungen<br />
Um Nichtrauchende Besucherinnen und Besucher in Theatern, bei Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen<br />
zu schützen, ergreift das Land <strong>Berlin</strong> folgende Maßnahmen:<br />
• An alle Veranstalter im Stadtgebiet wird appelliert, bei jeder Veranstaltung einen Nichtraucherbereich während<br />
der gesamten Veranstaltung zur Verfügung zu stellen und diesen entsprechend zu schützen.<br />
• An mindestens einem Tag in der Woche sind gänzlich rauchfreie Veranstaltungen anzubieten.<br />
• In Kinos ist bei Vorführungen von Filmen, die für Personen unter 18 Jahren freigegeben sind, die Werbung für<br />
Tabakprodukte verboten.<br />
• Bei allen Veranstaltungen ist die Abgabe von Probepackungen von Tabakprodukten an Personen unter 18 Jahren<br />
zu untersagen.<br />
9. Ombudsfrau bzw. Ombudsmann für den Nichtraucherschutz<br />
Das Land <strong>Berlin</strong> ernennt zum Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger eine Ombudsfrau bzw. einen Ombudsmann für<br />
Nichtraucherschutz. Diese bzw. dieser hat die Aufgabe, Beschwerden und Anregungen zum Nichtraucherschutz<br />
entgegenzunehmen und diese an die jeweils zuständigen Stellen des Landes <strong>Berlin</strong> weiterzuleiten. Auch soll sie<br />
bzw. er Vorschläge zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes entwickeln und politische Initiativen ergreifen und<br />
begleiten.<br />
53
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 54<br />
10. Raucherinnen- und Raucherentwöhnung<br />
Da es aufgrund der Suchtwirkung des im Tabak enthaltenen Nikotins vielen Betroffenen oftmals sehr schwer fällt,<br />
mit dem Rauchen aufzuhören, unterstützt und fördert das Land <strong>Berlin</strong> die Volkshochschulen, Gesundheitsorganisationen<br />
und -einrichtungen bei deren Vorstößen und Programmen zur Raucherentwöhnung in besonderem Maße<br />
durch Sachmittel und logistische Unterstützung.<br />
54
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 55<br />
Innere Sicherheit<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
Antrag Nr. 128/I/03<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Fraktion der <strong>SPD</strong> im Abgeordnetenhaus sowie die sozialdemokratischen Mitglieder des Senates werden aufgefordert, die<br />
in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und -beamten umgehend und ausnahmslos<br />
umzusetzen. Über den bislang erzielten Fortschritt ist zu berichten.<br />
Justiz<br />
Ablehnung<br />
Antrag Nr. 129/I/03<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> – Fraktion des Abgeordnetenhauses ist zu beauftragen, sich für die Erweiterung der Klagebefugnisse vor<br />
dem Verfassungsgericht einzusetzen, damit der Senat von <strong>Berlin</strong> und die <strong>Berlin</strong>er Bezirke Rechtsstreitigkeiten gerichtlich<br />
klären können.<br />
Soziales<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
Antrag Nr. 130/I/03<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> unterstützt nachdrücklich die Forderungen nach einer konsequenten politischen und gesetzgeberischen<br />
Umsetzung der Doppelstrategie Frauenförderung und Gender-Mainstreaming in den Politikfeldern Gesundheit und Soziale<br />
Sicherung. Sie fordert alle sozialdemokratischen Funktions-, Amts- und MandatsträgerInnen in Partei, Regierung und Fraktion<br />
auf allen Ebenen hierzu auf. Geschlechtergerechtigkeit ist originärer Bestandteil unseres Grundwertes „soziale Gerechtigkeit“<br />
und gleichzeitig sichtbarer Ausdruck einer modernen Ausgestaltung von Chancengleichheit.<br />
Die grundlegende Forderung nach einer eigenständigen Existenzsicherung ist heute kein Männerprivileg mehr, sondern Anspruch<br />
beider Geschlechter. Wir werden die Reform der sozialen Sicherungssysteme geschlechtergerecht gestalten und bei<br />
der notwendigen Veränderung der Leistungskataloge der Sozialsysteme eine überproportionale Belastung von Frauen verhindern.<br />
Antragstext ab Zeile 54, Seite 196 (Wir fordern…) bis Ende Antragstext<br />
Material an die <strong>Berlin</strong>er MdB’s zur Einbringung in die Gesetzgebungsdebatte<br />
Antrag Nr.131/I/03<br />
Vom Antragsteller zurückgezogen<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Die ASF <strong>Berlin</strong> fordert alle sozialdemokratischen EntscheidungsträgerInnen in Regierungs- und Fraktionsverantwortung bei<br />
der Reform der Arbeitsförderung eindringlich auf, sich am Postulat der Gleichstellung und dem Ziel der eigenständigen und<br />
existenzsichernden Sicherung für Frauen und Männer zu orientieren.<br />
Hierzu gehört die tatsächliche Umsetzung der in der Präambel „Die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem<br />
Arbeitsmarkt beachten und fördern“ des Endberichtes „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ festgelegten Aufgaben für<br />
Gesetzgebungs- und Regierungshandeln:<br />
„Aktivierende Arbeitsmarktpolitik hat hier eine besondere Aufgabe, indem sie nicht nur unterschiedlich hohe Risiken, arbeitslos<br />
zu werden oder zu bleiben, begegnet. Sie befähigt zum anpassen an den Strukturwandel, fördert variable Arbeitsverhältnisse<br />
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sichert die Übergänge zwischen Familien- und Erwerbsphasen ab und<br />
ermöglicht Frauen wie Männern eine eigenständige Existenzsicherung.<br />
Dies ist bei der anschließenden Umsetzung der vorliegenden Vorschläge zu beachten. Alle weiteren Schritte zur Konkretisierung<br />
müssen vor diesem Hintergrund detailliert überprüft werden, inwieweit sie dem Postulat der Gleichstellung Rechnung<br />
55
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 56<br />
tragen bzw. direkt oder indirekt Benachteiligungen fortschreiben oder neue entstehen lassen.“<br />
Antrag Nr. 132/I/03<br />
Erledigt durch Annahme 113/I/03<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Bundesanstalt für Arbeit ist anzuweisen, ihre sozialpolitischen Aufgaben solange in vollem Umfang wahrzunehmen, bis<br />
sie von einer anderen Behörde übernommen werden können. Dies gilt insbesondere für alle Maßnahmen zur beruflichen<br />
Förderung von jungen Menschen.<br />
Der Bundesanstalt für Arbeit sind die dafür notwendigen Mittel umgehend zur Verfügung zu stellen.<br />
Steuern<br />
Antrag Nr. 133/I/03<br />
Überweisung an die Landesgruppe der MdB’s<br />
KDV Reinickendorf<br />
Der Landesparteitag möge beschließen,<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen.<br />
Die Bundestagsfraktion der <strong>SPD</strong> wird aufgefordert, bei der Änderung des EigZulG die Kinderzulage derart zu gestalten, dass<br />
bei Beibehaltung der Objektbeschränkung der Begünstigungszeitraum für die Kinderzulage grundsätzlich bei Nutzung zu<br />
eigenen Wohnzwecken des begünstigten Objektes 8 Jahre beträgt.<br />
Umwelt/Energie<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
Antrag Nr. 134/I/03<br />
KDV CharlWilm<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats und die Abgeordnetenhausfraktion werden angesichts der sich auch regional auswirkenden<br />
Folgen der Klimaerwärmung aufgefordert, zu gewährleisten, dass das Land <strong>Berlin</strong> seine internationalen Verpflichtungen zur<br />
Senkung des Klimagases Kohlendioxid um 25% bis zum Jahr 2010 einhält.<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats werden deshalb aufgefordert, den Entwurf zum Stadtentwicklungsplan Verkehr im Senat solange<br />
nicht zu beschließen, bis der Maßnahmekatalog entsprechend den klimapolitischen Verpflichtungen nachgebessert<br />
worden ist. Entsprechende ergänzende Maßnahmepakete (z.B. eine noch massivere Förderung des Umweltverbundes) sind<br />
im Stadtentwicklungsplan Verkehr von der Senatsverkehrs- und -umweltverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt<br />
und den Experten des „Wissenschaftlichen Beirates zum Stadtentwicklungsplan Verkehr“ zu ergänzen, nachzubessern<br />
und umzusetzen.<br />
Verkehr<br />
Antrag Nr. 135/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
Abt. 02 und KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus von <strong>Berlin</strong> werden aufgefordert, sich für die Einhaltung<br />
des geltenden, absoluten Nachtflugverbotes zwischen 23.00 und 06.00 Uhr für den Flughafen Tegel einzusetzen.<br />
Antrag Nr. 136/I/03<br />
Annahme<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats werden aufgefordert, sich in den Bund-Länder-Gremien (z.B. der Umweltministerkonferenz,<br />
der Verkehrsministerkonferenz, dem Bund-Länder-Arbeitskreis Bundesverkehrswegeplan usw.) dafür einzusetzen, dass alle<br />
Bundeswasserstraßenprojekte (insbesondere das Verkehrsprojekt 17 [Havelausbau] und der Elbe-Ausbau) einer (erneuten)<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen und ggf. gestrichen werden. In einem gemeinsamen Programm zwischen Bund<br />
und Ländern sind frühere Begradigungen von Flussläufen zu renaturieren und Versiegelungen in Flussgebieten rückgängig<br />
zu machen. Diesem Programm ist Vorrang vor weiteren Ausbaumaßnahmen der Wasserstraßen einzuräumen. Der Bundesverkehrswegeplan<br />
ist entsprechend zu überarbeiten. Dem Landesparteitag ist Bericht zu erstatten.<br />
56
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 57<br />
Antrag Nr. 137/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
Abt. 6-7/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Verkehrspolitik des Senats von <strong>Berlin</strong> orientiert sich an folgenden Grundsätzen:<br />
Sparsame Haushaltsführung,<br />
Abkehr von den übertriebenen Verkehrsprognosen der frühen Neunziger Jahre,<br />
Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Stadtentwicklung durch zielgerichtete Anpassung der Infrastruktur.<br />
Wichtig ist insbesondere die Verknüpfung der noch immer weitgehend auf die östliche Stadthälfte beschränkten Straßenbahn<br />
mit den in die westlichen Bezirke weiterführenden S- und U-Bahn-Linien. Die Wiedervereinigung der Stadt darf den öffentlichen<br />
Nahverkehr nicht ausklammern!<br />
Eine maßgeschneiderte Erweiterung des <strong>Berlin</strong>er Straßenbahnnetzes ist daher weiterhin sinnvoll und notwendig. Erst so<br />
können sich die in den letzten Jahren vorgenommenen Investitionen in die Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen und<br />
barrierefreie Zugänge an Haltestellen und in Fahrzeugen wirklich auszahlen. Der Ausbau der Straßenbahn ist dabei so zu<br />
gestalten, dass öffentliche Mittel dort eingesetzt werden, wo der höchste Nutzen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung<br />
der Stadt erzielt wird.<br />
Oberste Priorität hat die Fertigstellung der bereits mit Leitungsverlegungen und Straßenbaumaßnahmen begonnenen Verbindung<br />
von der Prenzlauer Allee (Ecke Mollstr.) über die Karl-Liebknecht-Str. zum Alexanderplatz. Die Wirtschaftlichkeit des<br />
Straßenbahnbetriebs insgesamt wird durch die entstehende Direktverbindung zum Alexanderplatz mit Anschluss an U-, S-<br />
und Regionalbahn erheblich gesteigert, die schon abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen im Zuge der Prenzlauer Allee entfalten<br />
so erst ihren vollen Nutzen.<br />
Genauso wichtig ist der Anschluss des neuen Hauptbahnhofs (Lehrter Bahnhof) über die Invaliden- und Bernauer Str. an die<br />
vorhandene Strecke in der Eberswalder Str. rechtzeitig zu Eröffnung des Fernbahnhofs. Die erhebliche Investition in die<br />
Eisenbahnanlagen im Zentralen Bereich (Hauptbahnhof) ist relativ sinnlos, wenn die Anbindung an die Wohn- und Dienstleistungsschwerpunkte<br />
der Umgebung unterbleibt.<br />
Weitere Neubaustrecken wie die Straßenbahntrasse im Zuge der Gertrauden- und Leipziger Str. vom Alexanderplatz zum<br />
Kulturforum, die Anbindung der Wissenschaftsstadt Adlershof und die Verbindung von der Landsberger Allee über den Ostbahnhof<br />
bis nach Kreuzberg sind jeweils im Gleichklang mit ist der städtebaulichen Entwicklung zu realisieren.<br />
Die Schaffung leistungsfähiger Achsen des Öffentlichen Nahverkehrs ist sowohl Katalysator für eine positive Standortentwicklung<br />
als auch ein Beitrag zur Erreichung des angestrebten Modal-Split von 80:20 im Verhältnis Öffentlicher Verkehr zu Individualverkehr<br />
Gerade in Zeiten stagnierender Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sind Investitionen in die Infrastruktur essentiell,<br />
um die Attraktivität der Innenstadtlagen gegenüber neu erschlossenen Wohn- und Gewerbegebieten im Umland zu erhalten.<br />
Antrag Nr. 138//I03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag unterstützt den Senat von <strong>Berlin</strong>, am Bau des Flughafens BBI - notfalls auch mit öffentlichen Mitteln -<br />
festzuhalten und die innerstädtischen Flughäfen Tempelhof und Tegel wie geplant zu schließen.<br />
Antrag Nr. 139/I/03<br />
Ablehnung<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-Mitglieder des Senats sowie die <strong>SPD</strong>-Fraktion im <strong>Berlin</strong>er Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen,<br />
dass für das <strong>Berlin</strong>er Tarifgebiet AB Tarifanträge auf Erhöhungen seitens der Verkehrsunternehmen nicht stattgegeben<br />
werden.<br />
Ferner ist darauf zu drängen, dass die BVG eine Erneuerung ihrer Organisationsstruktur sowie eine Serviceverbesserung<br />
vornimmt.<br />
57
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 58<br />
Organisation<br />
Antrag Nr. 140/I/03<br />
Nichtbefassung<br />
Abt. 9/Reinickendorf<br />
Der <strong>Berlin</strong>er Landesparteitag möge beschließen:<br />
1. Abteilungsfusionen dürfen nur mit Zustimmung der jeweils betroffenen Abteilungen durchgeführt werden.<br />
2. Diese Zustimmung ist durch Mitgliederabstimmungen einzuholen. Das Ergebnis von Mitgliederabstimmungen ist<br />
unbedingt als demokratische Entscheidung zu respektieren. An die Ergebnisse haben sich Abteilungsvorstand und<br />
Kreisvorstand zu halten.<br />
3. Kreisvorstände, die eine Abteilungsfusion vorschlagen, haben diese ausführlich und nachvollziehbar zu begründen und<br />
gleiche Kriterien für Fusionen oder die Beibehaltung von kleinen Abteilungen im ganzen Kreis zu benennen.<br />
4. Abteilungsfusionen müssen sachlich begründet sein, sie sind kein Kampfmittel zur „Liquidierung“ unliebsamer Vorstände<br />
oder einzelner Genossinnen und Genossen.<br />
5. Abteilungsfusionen dürfen nur im Turnus der allgemeinen Parteiwahlen, also nach Ablauf der satzungsmäßigen Amtszeit<br />
der Vorstände der jeweiligen Abteilungen erfolgen.<br />
6. Nicht die Abteilungsgröße ist das entscheidende Kriterium für die Auflösung von Abteilungen, sondern ob es sich um<br />
„lebendige“ oder „tote“ Abteilungen handelt.<br />
Antrag Nr. 141/I/03<br />
Überweisung an Landesvorstand<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der GLV wird aufgefordert zu veranlassen, dass auf dem Landesparteitag am 17.05.03 ein schriftlicher Bericht über den<br />
Arbeitsstand der Verfassungskommission <strong>Berlin</strong>-Brandenburg, in welcher die <strong>Berlin</strong>er Bezirke [noch] nicht vertreten sind,<br />
gegeben wird .<br />
Antrag Nr. 142/I/03<br />
Erledigt<br />
KDV FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Mit der Erklärung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder am 14. März 2003 wurden den Bürgerinnen und Bürgern weitreichende<br />
politische Entscheidungen mitgeteilt, die wesentliche Einschnitte in die Sozialsysteme der Bundesrepublik vorsehen.<br />
Diese tiefen Einschnitte in das soziale Netz, die Konflikte mit der bisherigen Beschlusslage und die damit unweigerlich verbundene<br />
Konfrontation mit den Gewerkschaften erfordern eine qualifizierte Diskussion auf einem außerordentlichen Bundesparteitag.<br />
Antrag Nr. 143/I/03<br />
Ablehnung, da Angelegenheit der Kreise<br />
KDV Reinickendorf<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Aufteilung der Finanzen innerhalb der <strong>Berlin</strong>er Partei ist derart neu zu regeln, dass den Abteilungen und Kreisen als Anteil<br />
an den Mitgliedsbeiträgen ein Mindestanteil zugesichert wird, der so beschaffen sein muss, dass jedem Mitglied monatlich<br />
ein mit normalem Briefporto ausgestatteter Brief zugesandt werden kann.<br />
Hilfsweise hat unter Beibehaltung der bisherigen Regelung zur finanziellen Ausstattung der Kreise und Ortsvereine der Landesverband<br />
diese Kosten zu tragen.<br />
Antrag Nr. 144/I/03<br />
Annahme<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> möge beschließen:<br />
Der Landesvorstand der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird aufgefordert in künftigen Leitanträgen und programmatischen Dokumenten auf<br />
eine auch für Nicht-Parteimitglieder verständliche Sprache und Struktur zu achten. Die Aufgabenstellungen Analyse, Bilanz,<br />
Zielformulierung und Umsetzungsvorschläge sollten dazu klar voneinander unterschieden werden.<br />
Antrag Nr. 145/I/03<br />
Vom Antragsteller zurückgesogen<br />
KDV Mitte<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> stellt eine adäquate Finanzierung der Arbeit der Jusos <strong>Berlin</strong> angesichts der wegfallenden öffentlichen Mittel<br />
sicher.<br />
58
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 59<br />
Antrag Nr. 146/I/03<br />
Erledigt durch Votum 147/I/03<br />
KDV TempSchön<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> unterstreicht die wichtige Bedeutung der JungsozialistInnen (Jusos) für die Nachwuchsarbeit in unserer Partei<br />
du für die Wirkung der <strong>SPD</strong> in die Jugend.<br />
Der Landesverband wird aufgefordert, die durch die Streichungen der öffentlichen Hand entstehenden Finanzierungslücken<br />
der Jusos <strong>Berlin</strong> in vollem Umfang auszugleichen und damit langfristig die wichtige Arbeit der Jusos <strong>Berlin</strong> zu sichern.<br />
Antrag Nr. 147/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.LPT:<br />
KDV CharlWilm<br />
KDV FrhainKreuz<br />
KDV Pankow<br />
KDV Reinickendorf<br />
KDV StegZehl<br />
KDV Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> <strong>Berlin</strong> stellt angesichts der wegfallenden öffentlichen Mittel eine adäquate Finanzierung der Arbeit der <strong>Berlin</strong>er Jusos<br />
sicher.<br />
Antrag Nr. 148/I/03<br />
Erledigt<br />
AsF-Landesfrauenkonferenz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird aufgefordert, auf einem <strong>Berlin</strong>er Landesparteitag die “Agenda 2010” rechtzeitig zur Vorbereitung des<br />
Bundesparteitages am 17. - 19. November 2003 zu beraten.<br />
Antrag Nr. 149/I/03<br />
Überweisung an die Projektgruppe „Integration von Zuwanderern“ des LV<br />
Abt. 06/FrhainKreuz<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der folgende Text ist wird als Grundlage für eine innerparteiliche Diskussion zur Integrationspolitik in die Gliederungen der<br />
Partei gegeben und auf dem nächstfolgenden Landesparteitag behandelt. Ergänzungen und Änderungen aus fachlicher Sicht<br />
vor allem in den "unterbelichteten" Bereichen des Teils 4 sowie alternative Beiträge zu den grundsätzlichen Positionen sind<br />
ausdrücklich erwünscht.<br />
Für eine zukunftsfähige Integrationspolitik!<br />
Migration ist zu einer globalen Bewegung geworden. Krieg, politische Verfolgung und wirtschaftlich bedingte Migration, aber<br />
auch die Anwerbung von qualifizierten Fachkräften führen zu immer neuen und umfangreicheren internationalen Wanderungsbewegungen.<br />
Diese Wanderungsbewegungen bedürfen der Verständigung auf internationaler Ebene, um Menschen zu<br />
helfen, um nationale Interessen auszugleichen und um regionale Konfliktlagen zu überwinden. Sie bedürfen aber auch strategischer<br />
und umfassender politischer Maßnahmen vor Ort.<br />
Auf den anderen Seite wird Zuwanderung vor dem Hintergrund der zurückgehenden Bevölkerungszahlen in den ehemaligen<br />
Industriestaaten des Westens zu einer wichtigen Frage für den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme.<br />
Im Unterschied zu den längerfristigen Einwanderungswellen unter dem Einfluss kolonialer Abhängigkeiten sind die heutigen<br />
Migrationsbewegungen kurzfristig und schnelllebig. Darüber hinaus ist die Überwindung großer Entfernungen für die meisten<br />
Zuwanderergruppen heute kein Hinderungsgrund mehr. Das führt auch zu einer stärkeren Differenzierung der Einwanderergruppen.<br />
Vor diesem Hintergrund ergibt sich heute die Forderung an einen Grundkonsens über den Weg, den eine Integrationspolitik<br />
gehen muss. Bei der Formulierung dieses gesellschaftlichen Grundkonsenses trägt die <strong>SPD</strong> eine besondere Verantwortung:<br />
Für die <strong>SPD</strong> als Teil der internationalen Sozialdemokratie sind Fragen der Migration immer auch soziale Fragen, die unter<br />
dem Blickwinkel der sozialen Gerechtigkeit betrachtet werden müssen.<br />
Migration und Integration sind nicht zu trennen. Fehlende Integration birgt in sich die Gefahr gesellschaftlicher Polarisierung<br />
und fördert demokratiefeindliche politische Gruppen.<br />
Die <strong>SPD</strong> hat durch ihre Geschichte und Erfahrung eine historische Verantwortung, Flüchtlingen und Verfolgten Hilfe zu<br />
gewähren.<br />
59
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 60<br />
1. Was bedeutet Integration?<br />
Integrationspolitik ist die systematische Eingliederung von Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft. Integration ist ein<br />
langwieriger und wechselseitiger Prozess. Die Migrantinnen und Migranten müssen an der Entwicklung gemeinsamer gesellschaftlicher<br />
Standards beteiligt werden und ihre berechtigten Interessen einbringen können, um andererseits in der Lage zu<br />
sein, gesellschaftliche Übereinkünfte mittragen zu können.<br />
Integration vollzieht sich in der Überwindung von Fremdheit. Eine Gesellschaft, die Integration will, verpflichtet sich wie auch<br />
die Migrantinnen und Migranten zu Zugeständnissen. Integration bedeutet nicht die ausschließliche Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft.<br />
Die „neue“ Gesellschaft muss den Zugewanderten eine Heimat geben, in der sie ihre vertrauten kulturellen<br />
Traditionen bewahren können. Gleichzeitig müssen die Zugewanderten die gesellschaftlichen Paradigmen ihrer neuen Heimat<br />
erlernen.<br />
Durch staatliche Maßnahmen kann Integration nicht verordnet werden. Wohl aber muss der Staat Rahmenbedingungen<br />
schaffen, innerhalb derer sich die zugewanderten Menschen zu Recht finden und in die Gesellschaft einbringen können.<br />
2. Von der Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz<br />
Die Bundesrepublik Deutschland hat aus ihrer geschichtlichen Verantwortung heraus in der Vergangenheit vor allem die<br />
Aufnahme von Asylsuchenden praktiziert. Die Zahl der aufgenommenen Asylbewerber fiel aber lange Zeit nicht ins Gewicht.<br />
Darüber hinaus wurden seit Mitte der 50er Jahre „Gastarbeiter“ angeworben, zunächst vor allem aus Italien und Spanien,<br />
später auch aus der Türkei und aus Jugoslawien. Sie wurden gebraucht als billige Arbeitskräfte und später, um den Mangel<br />
an Facharbeitern auszugleichen.<br />
Die anfänglichen Annahmen, die "Gastarbeiter" würden sich nur temporär in der Bundesrepublik aufhalten, haben sich als<br />
falsch herausgestellt. Die meisten der angeworbenen Arbeitskräfte blieben auch entgegen ihren eigenen ursprünglichen<br />
Intentionen auf Dauer. Aus den "Gastarbeitern" der ersten Generation wurden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Teil der<br />
deutschen Gesellschaft geworden sind.<br />
Das Interesse der Bundesrepublik hat sich im Laufe der Jahre unter dem Einfluss vielfältiger gesellschaftlicher Entwicklungen<br />
mehrfach gewandelt. Nach der Phase der Anwerbung führten ökonomische Probleme Anfang der 70er Jahre zum Anwerbestopp<br />
und zu einer im Laufe der Jahre immer restriktiveren Politik gegenüber der zunehmenden Migration. Im Zuge der Vereinheitlichung<br />
der europäischen Rechtsnormen entstand zudem eine Zwei-Klassen-Zuwanderung. Bürger aus der Europäischen<br />
Gemeinschaft hatten vertraglich gesicherte Freizügigkeitsrechte, Bürger aus anderen Ländern nicht. Hinzu kam eine<br />
Quasi-Zuwanderung von Aussiedlern aus Osteuropa, die als im rechtlichen Sinne deutsche Staatsbürger von Beginn an den<br />
Status der Bundesbürger in Anspruch nehmen konnten.<br />
Die Politik der Bundesrepublik beschränkte sich in der Vergangenheit vorwiegend darauf, durch die rechtliche Beschränkung<br />
des Zuzugs die Zahl der Migranten gering zu halten. Der Mangel an grundsätzlicher Bereitschaft zu einer ernsthaften Integrationspolitik<br />
hat den Status der Migranten bis heute zu einem gesellschaftlich brisanten Konfliktthema gemacht und Gegner<br />
der Integration zu ausländerfeindlichen Kampagnen ermutigt. Nur eine Politik, die über die Regularien der Zuwanderung im<br />
engeren Sinne hinaus das Leben der Migranten in der Bundesrepublik dauerhaft sichert, kann erreichen, dass Zuwanderer<br />
nicht als Aggressionsobjekt für Fragen herhalten müssen, die eigentlich sozialen Ursprungs sind.<br />
2.1 Wiedervereinigung und neue Zuwanderungspolitik<br />
Mit der Wiedervereinigung ist die Bundesrepublik und vor allem <strong>Berlin</strong> aus einer Randlage in eine zentrale Position in Mitteleuropa<br />
gerückt. Die Nähe zu den zukünftigen Mitgliedsländern der EU - Polen, Tschechien, Ungarn, die baltischen Staaten -<br />
stellen historische Bezüge wieder her, die durch die Teilung <strong>Europa</strong>s nach dem Zweiten Weltkrieg verschüttet waren.<br />
Eine verstärkte Zuwanderung aus den mittel- und osteuropäischen Ländern ist aus Sicht der Bundesrepublik und vor allem<br />
<strong>Berlin</strong> von Bedeutung. Nach der Wiedervereinigung bietet sich für Deutschland die Chance, die kulturelle und ökonomische<br />
Vernetzung zwischen den ehemaligen westlichen und östlichen Staaten voranzubringen. Eine Zuwanderung aus diesen Ländern<br />
ist ein Beitrag zur Festigung der Beziehungen zu den neuen Partnern in Osten.<br />
Gleichzeitig müssen Anstrengungen unternommen werden, den bereits hier lebenden Migranten mehr Chancen zur Teilhabe<br />
an der Gesellschaft zu ermöglichen, vor allem, was ihre berufliche Qualifizierung und ihre ökonomische Funktion angeht.<br />
Dieses liegt sowohl im Interesse der Migranten selbst als auch im gesellschaftlichen Gesamtinteresse. Neue Zuwanderung<br />
kann nicht erfolgreich sein, wenn es nicht gelingt, Menschen zu integrieren, die seit 40 Jahren bzw. seit 3 Generationen in<br />
Deutschland leben.<br />
3. Grundsätze einer sozialdemokratischen Integrationspolitik<br />
3.1 Der Auftrag des Grundgesetzes<br />
Das Grundgesetz ist die Grundlage für alle Menschen in Deutschland und bietet den Rahmen für das Zusammenleben verschiedener<br />
Kulturen. Wesentliche Elemente sind:<br />
das Diskriminierungsverbot,<br />
60
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 61<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
die Glaubensfreiheit,<br />
die Meinungsfreiheit,<br />
der Schutz der Familie,<br />
die Freizügigkeit,<br />
Rechtsstaatlichkeit sowie<br />
das Sozialstaatsgebot.<br />
Jeder Versuch, ethnische, religiöse oder kulturelle Bevölkerungsgruppen auszugrenzen ist gegen das Grundgesetz gerichtet.<br />
Staat und Gesellschaft haben dafür zu sorgen, dass Diskriminierungen gegenüber Mitbürgerinnen und Mitbürgern nichtdeutscher<br />
Herkunft geahndet werden und sich ein Klima der gegenseitigen Achtung und Verständigung entwickelt.<br />
Auf der anderen Seite leiten sich aus dem Grundrechtskatalog Normen ab, die den Zugewanderten abverlangen, sich an die<br />
gesellschaftlichen Übereinkünfte in der Bundesrepublik anzupassen. Das gilt vor allem für den Spracherwerb, für die Fragen<br />
von Schule und Erziehung sowie für die allgemeinen Gepflogenheiten des Zusammenlebens.<br />
3.2 Sprach- und Kulturkompetenz als Voraussetzung zur Integration<br />
Integrationschancen hängen von der Sprachbeherrschung und dem kulturellen Verständnis der hiesigen Gesellschaft ab.<br />
In diesem Zusammenhang ist die Schule der wichtigste Ort für eine erfolgreiche Integration. Durch die lokale Konzentration<br />
von Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Herkunft ist die Frage der Sprachbeherrschung von einem Minderheitenproblem<br />
zu einem Mehrheitsproblem geworden. Bei deutschen Kindern in Schulen mit hohem Anteil von MitschülerInnen nichtdeutscher<br />
Herkunft zeigen sich inzwischen ebenfalls Schwierigkeiten bei der Sprachbeherrschung ab.<br />
Die lokale Konzentration von Kindern nichtdeutscher Herkunft ist eine Herausforderung an das Bildungssystem. Bisher sind<br />
Schule und Kindergarten dieser Aufgabe weitgehend nicht gewachsen. Aus diesem Grund und wegen der konstituierenden<br />
Rolle von Sprache für die Teilhabe an der Gesellschaft ist der Erwerb der deutschen Sprache und die Sprachbeherrschung<br />
das eigentliche Ziel von Schulreform im Sinne der Integration.<br />
3.3 Integration und Arbeitsmarkt<br />
Migrantinnen und Migranten sind von Arbeitslosigkeit besonders betroffen. Die Möglichkeiten der Berufsausübung sind im<br />
Vergleich zu derjenigen der meisten Deutschen in vielen Bereichen begrenzt, die sprachlichen Barrieren stellen ein zusätzliches<br />
Hindernis dar.<br />
Die hohe Arbeitslosigkeit von Migranten hat in mehrfacher Hinsicht negative gesellschaftliche Konsequenzen: Die Chancen<br />
der Migranten auf gesellschaftliche Anerkennung sind gering. Der Staat muss erhöhte Leistungen erbringen. Die wirtschaftliche<br />
Desintegration gerade der jüngeren Menschen mit Migrationshintergrund verringert die Motivation zur Spracherlernung<br />
und kultureller Integration spürbar und führt in einen Teufelskreis.<br />
Aus diesem Grund ist eine Arbeitsförderung, die sich auf die besondere Situation von Arbeitssuchenden nichtdeutscher Herkunft<br />
bezieht vordringlich. Darüber hinaus muss der Arbeitsmarkt für die in den Herkunftsländern erreichten Qualifikationen<br />
geöffnet werden. Wenn Migranten vor allem in den Bereichen des Handwerks mit ihren Qualifikationen in der Lage sind,<br />
Gewerbebetriebe zu führen, sind deutliche Effekte für die Beschäftigung von nichtdeutschen Arbeitssuchenden zu erwarten.<br />
3.4 Integration und Gleichberechtigung der Geschlechter<br />
Die Individualisierung in den westlichen Gesellschaften und die damit einhergehende Emanzipationsbewegung haben ein<br />
Spannungsverhältnis zu Migrantengruppen erzeugt. Patriarchalische Gesellschaftsmuster und die Rollenteilung der Geschlechter<br />
sind vor allem ein Entwicklungshindernis für Mädchen und junge Frauen. Dadurch entsteht für sie ein Konflikt, sich<br />
zwischen der deutschen Gesellschaft und ihrem angestammten Familienzusammenhang zu entscheiden. Hohe Arbeitslosigkeit<br />
und schlechte Vermittlungschancen außerhalb der eigenen Community verstärken diesen Druck zusätzlich.<br />
Es gibt für die Bewältigung dieser Konfliktanordnung kein staatlich zu verordnendes Rezept. Allerdings muss der Staat Angebote<br />
- wie zum Beispiel die Förderung von Selbsthilfe- und Beratungsorganisationen - zur Verfügung stellen, die von den<br />
betroffenen Frauen in Anspruch genommen werden können.<br />
Die Schulstatistik der letzten Jahre zeigt, dass Mädchen (deutscher und nichtdeutscher Herkunft) generell bessere Leistungen<br />
bringen als die Jungen. Wenn man hier dieselben Kriterien anwendet, wie sonst auch, kommt man zu dem zwingenden<br />
Schluss, dass gerade Jungen besonderer Förderung bedürfen.<br />
3.5 Integration, Religiosität und Extremismus<br />
Gerade nach dem 11. September 2001 hat eine Diskussion um das "Extremistische Potenzial" vor allem unter den Migranten<br />
aus Ländern mit hohem islamisch-gläubigem Bevölkerungsanteil um sich gegriffen. Diese Diskussion ist brisant, weil hier<br />
mehrere Ebenen der Vorbehalte gegenüber Fremdem zusammen kommen:<br />
Die Assoziation von "orientalisch = islamistisch = terroristisch";<br />
61
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 62<br />
<br />
<br />
die pauschale Ablehnung des Islam als Religion;<br />
eine fremdenfeindliche Stimmung insgesamt.<br />
Die Religionsfreiheit ist in der Bundesrepublik grundgesetzlich verankert. Gerade gegenüber der islamischen Religionsausübung<br />
gibt es dennoch Vorbehalte, die sich vor allem gegen den politisch verstandenen "Islamismus" wenden.<br />
Um die politische Frage von der Frage der Religionsausübung lösen zu können, muss ein deutliches Entgegenkommen in<br />
Bezug auf die islamische Religionsausübung gezeigt werden.<br />
Es ist im Ergebnis davon auszugehen, dass durch eine gesellschaftliche Akzeptanz der Religionsausübung die Integrationskräfte<br />
gestärkt werden. Nur dort, wo Religionsausübung gegen die rechtsstaatliche Ordnung praktiziert wird, muss der Staat<br />
eingreifen.<br />
4. Forderungen an eine sozialdemokratische Integrationspolitik<br />
Im Entwurf der Fraktionen <strong>SPD</strong> und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung<br />
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) werden<br />
lediglich die Bedingungen der Zuwanderung geregelt. Allein im Kapitel 3 (Förderung der Integration) ist die Einrichtung<br />
von Integrationskursen und -programmen vorgesehen.<br />
Darüber hinaus kündigt die Bundesregierung im § 43, Abs. 5 des Gesetzentwurfes ein "bundesweites Integrationsprogramm"<br />
an, " in dem insbesondere die bestehenden Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern für<br />
Ausländer und Spätaussiedler festgestellt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des bundesweiten Integrationsangebote<br />
vorgelegt werden."<br />
Senat und Fraktion im Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, die Initiative zur Umsetzung der Vorstellungen zu ergreifen.<br />
Der Landesvorstand wird aufgefordert, im Bundesverband eine Diskussion über ein Gesamtkonzept zur Integration von Zuwanderern<br />
zu beginnen.<br />
4.1 Gesetzliche Grundlagen der Integration schaffen.<br />
Nachdem durch das neue Zuwanderungsgesetz den rechtlichen Rahmen für die Bundesrepublik als Einwanderungsland<br />
definiert ist, gilt es jetzt, rechtliche Bestimmungen zu schaffen, die sich aus einem Gesamtkonzept zur Integration von Zuwanderern<br />
ergibt.<br />
Daher wird die Partei mit der Diskussion über die Inhalte der Integrationspolitik die Eckwerte für eine rechtliche Absicherung<br />
eines Integrationsprogramms setzen, die von der Bundesregierung und Bundestag sowie von der Landesparlamenten umgesetzt<br />
werden.<br />
Sprachliche und schulische Integration:<br />
Der Sprachstandstest muss für alle <strong>Berlin</strong>er Schüler ein Jahr vor der Einschulung verpflichtend sein. Für die Kinder, bei<br />
denen ein hoher Förderbedarf festgestellt wird, muss ein Kitabesuch mit besonderer Sprachförderung vorgeschrieben<br />
werden. Entsprechende Sprachförderklassen sind in den Kitas einzurichten.<br />
Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Grundschullehrerinnen und Lehrern muss in <strong>Berlin</strong> schwerpunktmäßig<br />
Sprachförderung enthalten<br />
Die DaZ-Lernwerkstatt (Deutsch als Zweitsprache) hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Sie soll erhalten und<br />
ausgebaut werden. Ihre Aufgaben sind:<br />
Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern,<br />
Konzept- und Materialentwicklung,<br />
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis.<br />
Begrüßenswert wäre es, die DaZ-Lernwerkstatt dem LISUM (<strong>Berlin</strong>er Landesinstitut für Schule und Medien) anzugliedern und<br />
in den Bezirken Anlaufstellen für Lehrerinnen und Lehrer zu schaffen.<br />
Ein Gesamtkonzept Sprachförderung muss für den Kita- und Grundschulbereich entworfen werden. Es soll alle Fächer<br />
umfassen und die Sprachfähigkeit durch ein aufeinander aufbauendes Konzept fördern helfen. Nur so ist auch eine einheitliche<br />
und sinnvolle Materialentwicklung möglich.<br />
Die 1000 Lehrerstellen, die in <strong>Berlin</strong> der Sprachförderung zur Verfügung stehen, müssen qualifiziert gegeben, und dürfen<br />
nicht für Vertretungsstunden oder andere Zwecke verwendet werden. Die Senatsverwaltung für Schule muss hier für eine<br />
Evaluation z. B. durch einen weiteren Sprachstandstest im drittem Schuljahr sorgen.<br />
Der Anteil von Lehrern und Erziehern mit Migrationshintergrund muss durch eine Förderung bei Studieneintritt und Anstellung<br />
erhöht werden.<br />
Ganztagsschulen sollen zukünftig im Grundschulbereich und vor allem in sozialen Brennpunkten mit hohem Migrantenanteil<br />
eingerichtet werden, um eine soziale Förderung zu bewirken.<br />
Der Senat wird aufgefordert, im Sinne der hier aufgeführten Punkte ein Umsetzungskonzept vorzulegen. Ein integriertes Konzept<br />
muss darüber hinaus auch andere Bildungsbereiche in den Blick nehmen. Vor allem der Übergang Schule/Beruf ist zu<br />
beachten.<br />
62
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 63<br />
Beseitigung beruflicher Diskriminierungen:<br />
Wesentliche Integrationshemmnisse stellen die nach wie vor die in der Bundesrepublik bestehenden Vorschriften zur Berufsund<br />
Gewerbeausübung dar. Eine wirkliche Integration und eine Chancengleichheit für Berufsanwärter Nichtdeutscher Herkunft<br />
kann nur erreicht werden, wenn die Vielzahl deutscher Sondervorschriften vor allem im Bereich der Handwerksberufe<br />
zugunsten allgemeiner Zugangs- und Qualifikationsvoraussetzungen ersetzt werden.<br />
Die <strong>SPD</strong>-Faktion im Abgeordnetenhaus wird aufgefordert, Gesetzes- und Bundesratsinitiativen zur Beseitigung diskriminierender<br />
Vorschriften zu entwickeln und einzubringen.<br />
Integration und soziale Stadt:<br />
Die Stadtentwicklungspolitik ist ein wichtiger Bestandteil der Integrationspolitik. Ein Ziel ist, einer Ghettobildung und damit der<br />
Entwicklung von Parallelgesellschaften entgegenzuwirken.<br />
Durch eine Fortführung und Weiterentwicklung der Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt" und eine verstärkte Einbeziehung<br />
von MigrantInnen in das Quartiersmanagement soll die Teilhabe von MigrantInnen an der Entwicklung der Quartiere<br />
gefördert werden. Ein Weg dorthin ist, Migrantinnen und Migranten stärker in die Steuerungsgruppen für das Quartiermanagement<br />
einzubeziehen.<br />
Politische Integration:<br />
Die politische Teilhabe ist zu intensivieren, bis hin zu verbindlichen Quoten. Die positive Entwicklung der Frauenbeteiligung<br />
kann hier als Beispiel dienen.<br />
Austauschprogramme für Jugendliche:<br />
Um das Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern, werden für Schüler und Jugendliche Begegnungsreisen in die Herkunftsländer<br />
der MigrantInnen organisiert und angeboten. Dabei sind solche Reisen auch für Jugendliche nichtdeutscher<br />
Herkunft selbst von hohem Wert, da sie häufig die Lebenswirklichkeit der Heimat ihrer Familien nicht mehr persönlich kennen.<br />
Die organisierte Begegnung deutscher bzw. westeuropäischer Jugendlichen mit Gleichaltrigen aus den Beitrittsländern Mittelund<br />
Osteuropas ist eine vordringliche Aufgabe der Europäischen Einigung. Nach dem Vorbild des "Deutsch-Französischen-<br />
Jugendwerks", das in den 60er Jahren zur Überwindung der "Erbfeindschaft" zwischen den beiden Ländern gegründet wurde,<br />
soll eine umfassende Begegnung organisiert werden, bei der gesellschaftliche, kulturelle und sprachliche Kenntnisse über<br />
persönliches Kennen lernen vermittelt werden.<br />
Antrag Nr. 150/I/03<br />
Überweisung an die AG Parteireform<br />
KVV TrepKöp<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>SPD</strong> ist auf dem Weg zur Hauptstadtpartei. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> vertritt die Interessen der Menschen der gesamten Stadt.<br />
Trotz enger finanzieller Spielräume kämpft die <strong>SPD</strong> erfolgreich für soziale Gerechtigkeit, solide Finanzen und die Stärkung<br />
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit <strong>Berlin</strong>s.<br />
Es ist die <strong>SPD</strong>, die in ihrer Regierungsverantwortung die innere Einheit der Stadt mit ihrer Politik maßgeblich gestaltet und<br />
voran bringt. Das deutliche Engagement der <strong>SPD</strong> zur Herstellung einheitlicher Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse in ganz<br />
<strong>Berlin</strong> schafft zunehmendes Vertrauen bei den Menschen. Auch zukünftig wird das Zusammenwachsen der Stadt ein Hauptanliegen<br />
sozialdemokratischer Politik für <strong>Berlin</strong> sein.<br />
Die <strong>SPD</strong> war bei den letzten Bundestagswahlen nicht nur die mit Abstand stärkste politische Kraft in <strong>Berlin</strong>, sondern als einzige<br />
Partei nahezu gleich stark in beiden Stadthälften. An diesen gemeinsamen Erfolg wollen wir anknüpfen.<br />
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen unsere Position als führende politische Kraft in <strong>Berlin</strong> festigen und<br />
weiter ausbauen. Dazu ist es nötig, unsere organisatorischen Strukturen grundlegend zu erneuern.<br />
Die <strong>SPD</strong>-Kreisbüros haben eine wichtige Scharnierfunktion in der politischen Arbeit der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>, die erhalten blieben<br />
muss. Das betrifft zum einen die Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der Partei. Zum anderen<br />
garantieren nur Kreisbüros in der Fläche eine ausreichende Bürgernähe der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>. Parteibüros müssen auch in naher<br />
Zukunft wichtige Anlaufstellen für Mitglieder und Bürger sein.<br />
In den Ostbezirken, wo die <strong>SPD</strong> bei den jüngsten Bundestagswahlen gute Ergebnisse erzielte, gibt es auf Landesebene ein<br />
noch großes Potential von Wählerinnen und Wähler, welches sozialdemokratischen Politikinhalten sehr offen gegenüber<br />
steht. Dieses Menschen wollen wir in Zukunft verstärkt ansprechen und für uns gewinnen.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss in den nächsten Jahren ihre Mitgliederbasis verbreitern. Dies gilt in besonderem Maß für die Ostbe-<br />
63
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 64<br />
zirke. Hier gestalten wenige Mitglieder ein hohes Maß an ehrenamtlicher Arbeit. Dabei gilt es auch vermehrt Angehörige der<br />
Freien Berufe und Selbständige für eine Mitarbeit in der <strong>SPD</strong> zu gewinnen.<br />
Nur mit aktiven und neuen Mitgliedern ist ein verstärkter Dialog der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> mit den Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen<br />
Gruppen der Stadt möglich.<br />
Wir brauchen in der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> eine verstärkte Einbeziehung junger Frauen und Männer in die politische Arbeit der <strong>Berlin</strong>er<br />
<strong>SPD</strong>. Hoffnungsvolle Ansätze sind die Jungen Wahlkampfteams und Projekte wie der Jugendaktionswettbewerb Alex. Hier<br />
sollte die <strong>SPD</strong> ihre erfolgreichen Bemühungen unvermindert fortsetzen.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss Ihre Nachwuchsarbeit bei ihren Kommunalpolitiker/innen intensivieren. Gerade die vielen jungen<br />
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die bei den letzten Wahlen in den Bezirksparlamenten Verantwortung für die<br />
<strong>SPD</strong> übernommen haben, müssen stärker von der Parteispitze gefördert werden.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss mit ihrer Politik verstärkt wieder im unmittelbaren Wohnumfeld der Menschen wahrgenommen werden.<br />
Gerade das große Engagement der <strong>SPD</strong> in den Kiezen unserer Stadt wird noch viel zu oft nicht in voller Intensität von<br />
den Menschen wahrgenommen. Der Landesvorstand muss die Außendarstellung seiner Untergliederungen verbessern helfen<br />
und die Kommunikationskompetenz aller Parteigliederungen erhöhen.<br />
Als führende politische Kraft in <strong>Berlin</strong> muss die <strong>SPD</strong> ihr programmatisches Profil weiter schärfen. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss<br />
politische Fragen lebendiger und offener diskutieren, ohne ein Bild innerer Zerrissenheit in der Öffentlichkeit abzugeben.<br />
Gerade im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen für die Stadt muss die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> verstärkt den Dialog mit den Menschen<br />
suchen. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss der Ort sein, in der und mit der die spannenden Zukunftsfragen der Metropole <strong>Berlin</strong> diskutiert<br />
werden.<br />
Der Landesvorstand wird die interne Kommunikation der Partei mittels moderner Kommunikation- und Informationsmedien<br />
und –techniken weiter verstärken. Der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> muss zur ersten wirklichen Online-Partei der Stadt werden.<br />
Die Arbeit der Parteispitze muss strukturell verstärkt werden. Mit der Schaffung des Amtes einer Generalsekretärin/eines<br />
Generalsekretärs wird die <strong>SPD</strong> schlagkräftiger werden und insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem politischen<br />
Gegner zusätzlich an Profil gewinnen. Die oder der Generalsekretär/in sollte nicht gleichzeitig ein öffentliches Amt im Senat<br />
bekleiden.<br />
Der Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird zum nächsten ordentlichen Parteitag die Position einer Generalsekretärin/eines Generalsekretärs einrichten.<br />
Der Vorstand wird beauftragt, eine dementsprechende Satzungsänderung vorzubereiten.<br />
Der Landesvorstand der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird eine Mitgliederwerbekampagne initiieren. Dabei werden die Ostbezirke einen<br />
wichtigen Schwerpunkt bilden. Ziel sollte es sein, die Mitgliederzahl der Partei wieder deutlich über 20.000 Personen zu vergrößern.<br />
Zur Professionalisierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ehrenamtlichen wird der Landesverband zukünftig verstärkt<br />
regelmäßig Trainingsprogramme für die in den Abteilungen, Kreisverbänden und Arbeitsgemeinschaften Verantwortlichen<br />
anbieten.<br />
Der Landesverband wird seine Anstrengungen im Bereich der Kommunikationsmedien verstärken und die Vernetzung aller<br />
Parteigliederungen und Parteigremien forcieren. Ziel sollte es sein, dass im Jahr 2005 alle Funktionsträger und 75 Prozent<br />
der Mitglieder der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> mittels E-Mail erreichbar sind.<br />
Der Landesvorstand wird die direkte Präsenz der Kreisgeschäftsführer(innen) /Angestellten des Landesverbandes in den<br />
Kreisbüros auch in den nächsten Jahren sicher stellen. Eine Ausnahme bilden landesweite Kampagnen der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong>. Bei<br />
Ihnen kann der Landesvorstand, in Abstimmung mit den betroffenen Kreisvorständen, für einen vorher vereinbarten Zeitrahmen<br />
Hauptamtliche der Kreisgeschäftsstellen für Aufgaben in der Landesgeschäftsstelle befristet einsetzen. Die Arbeitsfähigkeit<br />
der Kreisbüros darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.<br />
Der Landesverband richtet eine regelmäßige öffentliche Veranstaltungsreihe ein, die zu den wichtigen Themen der Metropole<br />
<strong>Berlin</strong> den Dialog mit den Multiplikatoren und Bürgern dieser Stadt sucht. Die Veranstaltungsreihe sollte einen festen Namen<br />
bekommen und abwechselnd in den Bezirken durchgeführt werden.<br />
Der Landesvorstand wird zur Professionalisierung der eigenen Personalentwicklung ein Mentoring-Programm für die jungen<br />
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kommunalpolitiker/innen der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> einrichten. Dabei sollten die Förderung und<br />
Qualifizierung des kommunalpolitischen Nachwuchses ein zentraler Schwerpunkt sein. Die SGK <strong>Berlin</strong> und das Forum Junge<br />
Kommunalpolitik der <strong>Berlin</strong>er Jusos werden beim Mentoring-Programm einbezogen.<br />
Bei den vorgeschlagenen organisatorischen Veränderungen sind die personellen und finanziellen Möglichkeiten der <strong>Berlin</strong>er<br />
<strong>SPD</strong> zu berücksichtigen.<br />
64
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 65<br />
65
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 66<br />
Verschiedenes<br />
Antrag Nr. 151/I/03<br />
Nichtbefassung<br />
Abt. 03/Spandau<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> wird in Zukunft mit EINER Stimme ihre "nachhaltigen" Stellungnahmen der Öffentlichkeit unterbreiten.<br />
Antrag Nr. 152/I/03<br />
Überweisung an FA I/Internationale Politik<br />
KDV CharlWilm<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
1. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich dafür ein – so weit fair gehandelte, mit Transfair-Siegeln versehene<br />
Produkte aus der „Dritten Welt“ angeboten werden (Insbesondere Kaffee, Tee, Schokolade, Honig usw.) diese vorrangig<br />
zu kaufen.<br />
2. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich dafür ein, dass in allen Verwaltungs-, Gewerkschafts- und Betriebskantinen<br />
fair gehandelter Kaffee und Tee ausgeschenkt und Schokolade angeboten wird.<br />
3. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich dafür ein, dass bei allen Parteiversammlungen, Tagungen und<br />
Festveranstaltungen (z.B. Partei-, Gewerkschafts-, Straßen-, Sport-, Kleingarten- und Schulfesten) fair gehandelter Kaffee,<br />
Tee und Orangensaft ausgeschenkt wird.<br />
4. So weit möglich, sollen sozialdemokratische Werbeartikel (Angebote der sozialdemokratischen Image GmbH) fair gehandelte<br />
Produkte sein (z.B. Kaffee, Tee, Süßwaren, Fußbälle).<br />
5. Es soll ein Angebot an fair gehandelten Produkten, wie z.B. Kaffee, Tee, Honig und Schokolade mit <strong>SPD</strong>-Design in den<br />
Image-Shops und im Versand eingeführt werden.<br />
6. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich dafür ein, dass in Sportvereinen, Schulen und Jugendverbänden<br />
mit Bällen gespielt wird, die ohne Kinderarbeit hergestellt wurden.<br />
7. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich in ihren Ortsvereinen (Abteilungen) und Unterbezirken (Kreisen)<br />
für Partnerschaften mit Produzenten in der „Dritten Welt“ ein.<br />
8. Der Beschluss soll in allen <strong>SPD</strong>-Mitteilungs- und Presseorganen sowie in Presseerklärungen mit Hinweisen auf örtliche<br />
Bezugsquellen veröffentlicht werden.<br />
9. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit wird aufgefordert, sich für die von der Hilfsorganisation Oxfam<br />
vorgeschlagene internationale Kaffeekonferenz einzusetzen, auf der Lösungen für die Kaffeekrise erarbeitet werden sollen.<br />
Antrag Nr. 153/I/03<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
KDV Reinickendorf<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Wir fordern unsere Mitglieder im Abgeordnetenhaus und im Senat auf, dafür Sorge zu tragen, dass<br />
1. die Öffentlichkeit, im rechtlich möglichen Rahmen, über die bisherigen Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zur<br />
<strong>Berlin</strong>er Bankenaffäre informiert wird;<br />
2. die verantwortlichen Akteure, ggf. auch die beteiligten Wirtschaftsprüfer, zur Rechenschaft herangezogen werden;<br />
3. gegen die Mitverantwortlichen Schadensersatzklagen eingeleitet werden.<br />
Antrag Nr. 154/I/03<br />
Annahme<br />
KDV StegZehl<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Für Aussagen vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist eine der Kronzeugenregelung analoge Regelung einzuführen.<br />
Antrag Nr. 155/I/03<br />
Beschluss siehe Ende Antragstext<br />
AGS<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Angesichts des Verkaufsflächenüberhanges in <strong>Berlin</strong> von fast 500.000 qm Fläche werden Baugenehmigungen für Einzelhandelsansiedlungen<br />
von mehr als 1.200 qm Bruttogeschossfläche nicht mehr erteilt. Seit 1990 ist die Verkaufsfläche im engeren<br />
Verflechtungsraum von <strong>Berlin</strong>/Brandenburg um mehr als 3,1 Millionen qm gewachsen. Mit heute 5,6 Millionen qm Verkaufsfläche<br />
wurde eine Flächenausstattung erreicht, die für unsere Region einer Kaufkraft entspricht, die bei Optimismus erst<br />
weit nach dem Jahr 2010 erwartet werden kann. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit in der Region ist in naher Zeit keine Besserung<br />
an Kaufkraft zu erwarten. Neue Verkaufsflächen bedeuten deshalb immer Arbeitsplatzabbau und Verdrängung im<br />
klassischen <strong>Berlin</strong>er Einzelhandel.<br />
Die Einzelhandelsverbände müssen besser als bisher in die Genehmigungsverfahren zur Schaffung neuer Einzelhandelsflä-<br />
66
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 67<br />
chen in <strong>Berlin</strong> und Brandenburg einbezogen werden, um sachkundig bei der Standortsteuerung mitzuwirken. Die einem Einzelhandelserlass<br />
entsprechende Rechtsvorschrift des Landes <strong>Berlin</strong> ist konsequent umzusetzen.<br />
Diese Forderung gilt ausdrücklich auch für die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterstützte Bebauung der<br />
Banane (Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz). Die dort angedachten Einzelhandelsflächen von ca. 80.000 qm, die die Wohnungsbaugesellschaft<br />
Degewo entwickeln will, sind für die derzeitige Situation <strong>Berlin</strong>s völlig überdimensioniert. Dies gilt auch<br />
dann, wenn die landeseigene Gesellschaft hier Gewinn einplant. Größenwahnprojekte und Pleiten hatte <strong>Berlin</strong> genug.<br />
Überweisung des ersten Absatzes an FA VIII / AG Bauen/Wohnen/Stadtentwicklung mit der Maßgabe einer grundsätzlichen<br />
Diskussion zusammen mit der AGS. (K)<br />
Antrag Nr. 156/I/03<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
ASG<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Die Mitglieder der Abgeordnetenhausfraktion der <strong>SPD</strong> und des Senats werden aufgefordert, ein Gesetzgebungsverfahren<br />
einzuleiten, um ein Konzept bezirklicher Gesundheitskonferenzen zu gewährleisten.<br />
Rest Überweisung als Material an AH-Fraktion:<br />
Ausgangslage und Problemstellung<br />
Es mangelt an Angeboten zur Verringerung der gesundheitlichen Risiken in der Lebenslage gesellschaftlicher Gruppen. Mortalität<br />
und Morbidität unterscheiden sich in <strong>Berlin</strong> nach Wohnbezirk, sozialer Lage und Staatsangehörigkeit.<br />
Das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung (Ernährung, Bewegung, Suchtverhalten etc.) lässt sich nur durch zielgruppenbezogene<br />
Aktionen im Rahmen öffentlicher Maßnahmen verbessern. Umwelthygienische Probleme sowie andere Fragen des<br />
Gesundheitsschutzes werden vom Sozialversicherungssystem nur selektiv wahrgenommen.<br />
Die Kontinuität in der Behandlung kranker Menschen, insbesondere chronisch Kranker, lässt sich nur durch ein bedarfsspezifisches<br />
und umfassendes Dienstleistungsangebot sichern. Die Versorgung durch die GKV erbringt nicht im erforderlichen<br />
Maße die hierzu nötigen Koordinationsleistungen. Ein Forum der kooperierenden und konkurrierenden Anbieter einer Region,<br />
das diese Funktion erfüllen könnte, fehlt.<br />
Die Anforderungen von Patienten an Information über Einrichtungen, Behandlungen und deren Ergebnisse an mehr Patientenschutz<br />
und Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen steigen.<br />
Damit entfallen Steuerungsmöglichkeiten zur Bedarfs- und Qualitätssicherung und zur Etablierung integrierter Gesundheitsleistungen.<br />
Demgegenüber steht die traditionelle Unterfinanzierung des öGD trotz wachsender Aufgaben.<br />
Im Zuge der Bezirksreform ist eine weitere Entkommunalisierung des öGD absehbar. Bereits die Krankenhausreform führte<br />
mit dem Wegfall der Krankenhauskonferenzen zu einer Entkommunalisierung der Krankenhäuser.<br />
Vor diesem Hintergrund ist Reform des öGD in dem Sinne anzustreben, die den skizzierten Handlungsbedarf berücksichtigt.<br />
Ohnehin ist eine Novelle des öGD-Gesetzes vorgesehen, die im Zuge des Ausbaus der gemeindenahen Psychiatrie notwendig<br />
wird.<br />
Lösungsansätze<br />
Bezirkliche Gesundheitskonferenzen<br />
Bezirkliche Gesundheitskonferenzen können in der gegenwärtigen Fassung des GDG eingerichtet werden, dies ist in eine<br />
Muss-Regelung umzuformulieren.<br />
Eine bezirkliche Gesundheitskonferenz soll bestehen aus Vertretern der Bereiche Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz<br />
und Gesundheitsversorgung inklusive der Pflegekräfte, Selbsthilfegruppen und Einrichtungen für Gesundheitsvorsorge und<br />
Patientenschutz. Mitglieder des Gesundheitssausschusses der BVV gehören der bezirklichen Gesundheitskonferenz an. Die<br />
Einberufung erfolgt durch die BVVen. Die Leitung sollte durch die Gesundheitsstadträte der Bezirke erfolgen:<br />
Bezirkliche Plan- und Leitstellen<br />
Als Büro der Gesundheitskonferenz fungiert die bezirkliche Plan- und Leitstelle.<br />
Bezirkliche Gesundheitskonferenzen<br />
Kompetenzen<br />
Beratung gemeinsam interessierender Fragen der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene.<br />
Koordinierung der gesundheitlichen Versorgung auf örtlicher Ebene.<br />
Umsetzung unter Selbstverpflichtung der Beteiligten. Für die Kontrolle der Umsetzung sind die Plan- und Leitstellen und die<br />
67
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 68<br />
Gesundheitsstadträte verantwortlich.<br />
Entgegennahme und Beratung des bezirklichen Gesundheitsberichts, der von der Plan- und Leitstelle nach einem landeseinheitlichen<br />
Muster erstellt wird.<br />
Weiterleitung des bezirklichen Gesundheitsberichts an die BVVen und die Senatsgesundheitsverwaltung gemeinsam mit den<br />
Handlungsempfehlungen und Stellungnahmen der bezirklichen Gesundheitskonferenz.<br />
Weiterleitung von Initiativen mit überörtlicher Bedeutung an die Landesgesundheitskonferenz.<br />
Zur themenzentrierten Arbeit können die Gesundheitskonferenzen Arbeitsgruppen bilden. Psychiatrie- und Pflegekonferenzen<br />
sind in die bezirklichen Gesundheitskonferenzen als Arbeitsgruppen zu integrieren.<br />
Themen:<br />
Im Sinne einer nicht abschließenden Aufzählung kommt die Bearbeitung folgender Themengebiete in Frage: Gesundheitsförderung,<br />
Gesundheitsberichterstattung, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Geriatrie, Pflege,<br />
Drogen/Sucht und Gesundheitsplanung. Als Maßnahmen kommen infrage: Maßnahmen zur Verbesserung der Daten- und<br />
Planungsgrundlagen wie die Erstellung von Gesundheitsberichten oder von Spezialberichten zu besonderen gesundheitlichen<br />
Problemen. Maßnahmen zur Verbesserung der Information und des Wissens von Bürgern und Anbietern. Maßnahmen<br />
zur Schließung identifizierter Versorgungslücken und damit einer Erweiterung der bestehenden Versorgungsstruktur. Maßnahmen<br />
zur Entwicklung und Etablierung von spezifischen Koordinierungsinstrumenten (z.B. Plfegeüberleitungsbögen, Koordinationsstellen).<br />
Maßnahmen, die eine Umstrukturierung der Versorgungsstruktur zum Ziel haben (bspw. Optimierung der<br />
Notfallversorgung psychisch Kranker).<br />
In <strong>Berlin</strong> erscheint die Bearbeitung folgender Themen vordringlich: gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen und<br />
von Migranten, Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Geriatrie, Sucht und Brustkrebs.<br />
Bei der Themenauswahl sollte darauf geachtet werden, dass diese koordiniert erfolgt, denn nicht alle Bezirke müssen alles<br />
bearbeiten und die Bezirke können von den Erfahrungen anderer Bezirke lernen.<br />
Plan- und Leitstellen<br />
Kompetenzen<br />
Neben der Geschäftsführung der bezirklichen Gesundheitskonferenz erarbeiten die Plan- und Leitstellen nach einheitlichen<br />
Kriterien bezirkliche Gesundheitsberichte und wirken an der Erstellung des Landesgesundheitsberichts mit. Die Gesundheitsberichterstattung<br />
ist problemorientiert zu gestalten und dient als Grundlage der Gesundheitsplanung und Koordinierung der<br />
gesundheitlichen und sozialen Versorgung. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist zu überprüfen.<br />
Landesgesundheitskonferenz<br />
Struktur<br />
Die Landesgesundheitskonferenz wird von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung einberufen. Der Vorsitz wird<br />
von der zuständigen SenatorIn geführt. Mindestens einmal jährlich finden Sitzungen statt. Die Landesgesundheitskonferenz<br />
besteht aus Vertretern der Sozialversicherungsträger, der verfassten Ärzte- und Zahnärzteschaft, der Apotheker, der Krankenhausgesellschaft,<br />
der freien Wohlfahrtsverbände, Vertretern der Pflegeberufe, der gesundheitlichen Selbsthilfe, der Einrichtungen<br />
für Gesundheitsvorsorge und Patientenschutz, der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie den Leitern<br />
der bezirklichen Gesundheitskonferenzen.<br />
Aufgaben<br />
Die Landesgesundheitskonferenz berät gesundheitspolitische Fragen von grundsätzlicher und von landesweiter Bedeutung<br />
mit dem Ziel der Koordinierung und gibt bei Bedarf Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt unter Selbstverpflichtung der Beteiligten.<br />
Die Landesgesundheitskonferenz ist zuständig für die überbezirkliche Abstimmung von Kampagnen und die hierzu nötige<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Sie koordiniert die Aktivitäten und die Themenbearbeitung der bezirklichen Gesundheitskonferenzen.<br />
Es ist insbesondere Aufgabe der Landesgesundheitskonferenz, prioritäre Gesundheitsziele für <strong>Berlin</strong> und Maßnahmen zu<br />
deren Umsetzung zu beraten. Für die Umsetzung der Beschlüsse ist die zuständige SenatorIn verantwortlich.<br />
Geschäftsordnungen<br />
Die bezirkliche und die Landesgesundheitskonferenz geben sich eine Geschäftsordnung.<br />
Darin sind insbesondere Abstimmungsverfahren zu regeln.<br />
In der Geschäftsordnung ist überdies zu verankern, wie das Prinzip der Öffentlichkeit der Beratungen und der Ergebnisse<br />
sichergestellt wird.<br />
Finanzierung<br />
Ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf sollte vermieden werden. Hierzu sollten alle Möglichkeiten einer Finanzierung nach § 20<br />
SGB V und aus WHO- und EU-Programmen ausgeschöpft werden.<br />
Antrag Nr. 157/I/03<br />
ASG<br />
Annahme i.d.F.d.AK:<br />
1. Absatz: Überweisung an AH-Fraktion<br />
68
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 69<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
2. Absatz: Annahme<br />
Der Landesparteitag möge die <strong>SPD</strong>-Fraktion im Abgeordnetenhaus auffordern, ein öffentliches Hearing zum Status Quo und<br />
zur Fortentwicklung von sowohl Patienten- als auch Pflegebedürftigenrechten 2003 durchzuführen. Relevante Themenkomplexe<br />
können sich aus den Diskussionen und der Auswertung oben genannter Auftaktveranstaltung ergeben. Die ASG erklärt<br />
sich bereit, dabei die inhaltliche Konzeption zu unterstützen. Anlässlich des Hearings sollte insbesondere geprüft werden,<br />
inwiefern es sinnvoll ist, den Senat aufzufordern, eine entsprechende senatsverwaltungsübergreifende Arbeitsgruppe unter<br />
Hinzuziehung von Experten und Patienten der relevanten gesellschaftlichen Akteure einzusetzen, um einen Bericht des Status<br />
Quo in <strong>Berlin</strong> mit Vorschlägen zur Fortentwicklung auszuarbeiten. Auch die ASG-Forderung zur Einsetzung eines/einer<br />
Pflege- und Patientenschutzbeauftragte/n in <strong>Berlin</strong> mit dem Ziel, einen jährlichen Patientenschutzbericht herauszugeben,<br />
Modellprojekte fortzuentwickeln und Rechte der Pflegebedürftigen und Patienten fortzuentwickeln sollte erörtert werden.<br />
Der Landesparteitag möge die sozialdemokratischen Senatsverwaltung auffordern, im Bundesrat einen Beschluss zur Einsetzung<br />
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu initiieren, mit dem Ziel eine „Charta der Pflegebedürftigenrechte“ zu erarbeiten.<br />
69
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 70<br />
Resolution des Landesparteitages der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> vom 16./17.05.2003 zur Agenda 2010<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Wir unterstützen den vom Parteivorsitzenden Gerhard Schröder vorgelegten Leitantrag "Mut zur Veränderung" zur Sicherung<br />
der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Wir wissen aber auch um die Sorgen und Ängste bei vielen Menschen, weil die<br />
notwendigen Reformen auch harte Einschnitte erfordern. Deshalb muss klar sein, die <strong>SPD</strong> ist und bleibt die Partei der sozialen<br />
Gerechtigkeit. Allerdings sind Veränderungen unseres Sozialstaates nötig, wenn er erhalten bleiben soll.<br />
Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in den vergangenen fünfzig Jahren grundlegend verändert, das deutsche Sozialsystem<br />
dagegen ist von seiner Struktur her nahezu unverändert geblieben.<br />
Deutschland muss diese Veränderungen nun in wirtschaftlich schweren Zeiten angehen. Wir schaffen die Voraussetzungen<br />
für mehr Arbeit, bewahren soziale Sicherheit und sichern Wohlstand für die ganze Gesellschaft. Am Prinzip, dass denen,<br />
die einer Unterstützung bedürfen unter die Arme gegriffen werden muss, wollen und werden wir festhalten.<br />
Die Sozialdemokratie ist sich dieser Herausforderung bewusst und stellt sich ihrer Verantwortung. Bei den notwendigen<br />
Veränderungen orientieren wir uns an den Leitlinien und Prinzipien sozialdemokratischer Politik wie Chancengleichheit,<br />
Gerechtigkeit und Solidarität.<br />
1. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind große und solidarische Gemeinschaftsanstrengungen nötig, zu<br />
denen alle Kräfte der Gesellschaft ihre Beiträge leisten müssen. Das Projekt einer Steuersenkung für Spitzenverdiener<br />
und Spitzenverdienerinnen durch die angedachte Zinsabgeltungssteuer ist unter den heute gegebenen Bedingungen<br />
nicht zielführend und sollte nicht weiterverfolgt werden. Statt der erwarteten Mehreinnahmen wird sie bei<br />
Bund, Ländern und Gemeinden zu dauerhaften Einnahmeausfällen. Dagegen sollte das Projekt der Besteuerung<br />
von Aktien- und Spekulationsgewinnen weiterverfolgt werden. Auf eine Absenkung des Spitzensteuersatzes im Zuge<br />
der Steuerreformstufe 2005 ist zu verzichten.<br />
2. Das Ziel einer angemessenen Belastung der großen Vermögensbesitzer durch die Weiterentwicklung der Vermögens-<br />
und Erbschaftssteuer muss weiter verfolgt werden. Auch wenn dieses Projekt derzeit keine Mehrheit im Bundesrat<br />
hat, wird die Zielrichtung von uns weiter vertreten. Es bleibt dabei: Breite Schultern müssen auch mehr Lasten<br />
tragen, damit es auch zu einer solidarischen Gemeinschaftsanstrengung kommt.<br />
3. Die <strong>SPD</strong> fordert ihre Mitglieder und insbesondere ihre Funktions- und Mandatsträger auf allen politischen Ebenen<br />
auf, die notwendigen Diskussionen über die Zukunft des Standortes Deutschland und über die Zukunft der sozialen<br />
Sicherungssysteme auch weiterhin zu führen.<br />
Wie in vielen anderen Ländern <strong>Europa</strong>s auch führt mittelfristig kein Weg an einer Verbreiterung der solidarischen<br />
Basis zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorbei. Deshalb benötigen wir die Einbeziehung aller<br />
Personengruppen (Beamte/Beamtinnen, Selbständige, Politikerinnen und Politiker) ebenso wie die Heranziehung aller<br />
Einkommensarten. Darüber hinaus sind versicherungsfremde Leistungen (z.T. Folgekosten der Deutschen Einheit)<br />
stärker steuerfinanziert zu erbringen.<br />
Ostdeutschland ist noch immer weit entfernt von einer selbsttragenden wirtschaftlichen Entwicklung. Die Agenda<br />
2010 muss deshalb die besonderen Bedingungen Ostdeutschlands einbeziehen. Zur Umsetzung der Agenda 2010<br />
sind daher folgende Punkte zu berücksichtigen: Besonders die Menschen in den strukturschwachen Regionen, von<br />
denen die meisten in Ostdeutschland liegen, brauchen weiterhin einen besonderen, öffentlich geförderten Arbeitsmarkt.<br />
Dieser muss vor dem Hintergrund der sich aus dem Hartz-Konzept ergebenden Grundlinien neu konzipiert<br />
werden. Nach der Grundsatzentscheidung, ob die Bundesanstalt für Arbeit in Zukunft die Zuständigkeit für diese<br />
Strukturmaßnahmen behalten soll, müssen diese Maßnahmen auf eine steuer- oder beitragsfinanzierte Grundlage<br />
gestellt werden. Bis zu einer deutlichen Annäherung an die wirtschaftlich stärkeren Regionen müssen diese Maßnahmen<br />
auf dem Niveau des Jahres 2002 fortgeführt werden, wobei sie mit zunehmender Annäherung degressiv<br />
auslaufen sollen.<br />
4. Angesichts des hohen Anteils älterer Arbeitsloser in Ostdeutschland halten wir ein Sonderprogramm „Aktiv zur Rente“<br />
für Ältere für erforderlich. Mit diesem Programm soll nach der Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes<br />
älteren Arbeitslosen ein Übergang bis zur Rente in Arbeit ermöglicht werden. Bei dem Programm kann auf Erfahrungen<br />
mit SAM, aber auch auf Landesprogramme z.B. aus Sachsen-Anhalt zurückgegriffen werden.<br />
Das Arbeitslosengeld soll es auch weiterhin als beitragsbezogene Versicherungsleistung geben. Wer länger einzahlt,<br />
soll auch länger Leistung beziehen. Die Frühverrentungspraxis der Unternehmen muss auf den Prüfstand. Eine<br />
generelle Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
ist dabei nicht der richtige Weg.<br />
5. An der Ausbildung Jugendlicher müssen sich die Unternehmen, die in erster Linie von gut qualifizierten Mitabeitern<br />
profitieren, beteiligen und Ausbildungsplätze anbieten. Deshalb ist Ausbildung ihre Pflicht. Sollten freiwillige Verein-<br />
70
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 71<br />
barungen mit der Wirtschaft, Ausbildungsplätze bereitzustellen, nicht greifen, muss diese Frage gesetzlich geregelt<br />
werden. Angesichts der in diesem Jahr fehlenden 140.000 Ausbildungsplätze unterstützen wir die Ausbildungsumlagefinanzierung<br />
als ein geeignetes Instrument, die gesellschaftliche Ausbildungsverpflichtung der Unternehmen einzufordern.<br />
Um eine verstärkte Abwanderung junger Menschen aus Ostdeutschland zu vermeiden, ist ein besonderes öffentliches<br />
Engagement für Ausbildung und Arbeit junger Menschen in Ostdeutschland erforderlich. Wir begrüßen deshalb,<br />
dass das Ausbildungsprogramm für Ostdeutschland verstetigt wird. Diese Anstrengungen müssen aufrechterhalten<br />
werden, bis die geburtenschwachen Jahrgänge im Ausbildungsalter sind. Ergänzend halten wir ein Programm<br />
für die Bewältigung der zweiten Schwelle, z. B. in Form von Lohnkostenzuschüssen für Betriebe, die Azubis übernehmen,<br />
für notwendig.<br />
6. Die Gemeindefinanzreform muss zum 1. Januar 2004 in Kraft treten. Die Reform muss den Gemeinden zusätzliche<br />
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Damit gewinnen die Kommunen neue Gestaltungsspielräume für eine zukunftsorientierte<br />
Entwicklung. Die Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für erwerbsfähige Bedürftige<br />
soll nicht nur die Betroffenen aktivieren, sondern muss die Kommunen entlasten.<br />
7. Um die kommunale Investitionstätigkeit wieder zu beleben, sind verstärkte Anstrengungen notwendig. Das von der<br />
Bundesregierung initiierte Kreditprogramm (KfW-Programm) muss deshalb durch eine kommunale Investitionspauschale<br />
ergänzt werden. Diese Pauschale mit einem Volumen von mindestens 1 Mrd. EURO jährlich sollte bereits in<br />
2003 ausgezahlt und auch in 2004 bereitgestellt werden. Zur Finanzierung in Ostdeutschland ist ein Vorziehen von<br />
Geldern aus dem Solidarpakt II zu prüfen. Die Pauschale soll ausschließlich Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit zu<br />
Gute kommen.<br />
8. Nach dem erfolgreichen Ausbau der Infrastruktur – wenn auch noch lange nicht abgeschlossen - in den vergangenen<br />
Jahren, ist die Fortführung des Aufbaues Ost mit zusätzlichen Investitionen in die Wissenschafts- und Forschungslandschaft<br />
in Ostdeutschland notwendig. Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, die Finanzierung<br />
der großen Forschungseinrichtungen zu entflechten. Dies soll für eine Gründungsoffensive bei den Forschungszentren<br />
genutzt werden. Bei Entscheidungen über neu einzurichtende Forschungszentren müssen die ostdeutschen<br />
Länder grundsätzlich Vorrang haben. Darüber hinaus soll der von der Bundesregierung angekündigte weitere Aufwuchs<br />
bei den Forschungsorganisationen primär den Aufbau der Forschung im Osten ermöglichen.<br />
9. Bei der Gesundheitsreform sollten die ostdeutschen Erfahrungen (z. B. Polikliniken, Ambulanzen) ausgewertet und<br />
ggf. aufgenommen werden.<br />
10. Notwendiger Bestandteil der Agenda 2010 sind gesetzliche Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter in allen<br />
Bereichen. Dazu gehört vor allem auch ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, das gleichen Lohn für gleiche<br />
Leistung schafft. Unsere Initiativen zur Verbesserung von Familie und Beruf müssen weitergeführt und verstärkt<br />
werden. Der Umbau der sozialen Sicherungssysteme darf nicht einseitig zu Lasten der Frauen gehen.<br />
71
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 72<br />
Beschluss des Landesparteitages der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> vom16./17.05.2003<br />
(Initiativantrag Nr. 4)<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Der Parteivorstand wird aufgefordert, alle Maßnahmen der Agenda 2010 einer Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung zu<br />
unterziehen.<br />
72
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 73<br />
Initiativantrag Nr. 1<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Annahme i.d.F.d.LPT:<br />
Resolution des Landesvorstandes zur Agenda 2010<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Wir unterstützen den vom Parteivorsitzenden Gerhard Schröder vorgelegten Leitantrag "Mut zur Veränderung" zur Sicherung<br />
der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Wir wissen aber auch um die Sorgen und Ängste bei vielen Menschen, weil die notwendigen<br />
Reformen auch harte Einschnitte erfordern. Deshalb muss klar sein, die <strong>SPD</strong> ist und bleibt die Partei der sozialen Gerechtigkeit.<br />
Allerdings sind Veränderungen unseres Sozialstaates nötig, wenn er erhalten bleiben soll.<br />
Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in den vergangenen fünfzig Jahren grundlegend verändert, das deutsche Sozialsystem<br />
dagegen ist von seiner Struktur her nahezu unverändert geblieben.<br />
Deutschland muss diese Veränderungen nun in wirtschaftlich schweren Zeiten angehen. Wir schaffen die Voraussetzungen<br />
für mehr Arbeit, bewahren soziale Sicherheit und sichern Wohlstand für die ganze Gesellschaft. Am Prinzip, dass denen, die<br />
einer Unterstützung bedürfen unter die Arme gegriffen werden muss, wollen und werden wir festhalten.<br />
Die Sozialdemokratie ist sich dieser Herausforderung bewusst und stellt sich ihrer Verantwortung. Bei den notwendigen Veränderungen<br />
orientieren wir uns an den Leitlinien und Prinzipien sozialdemokratischer Politik wie Chancengleichheit, Gerechtigkeit<br />
und Solidarität.<br />
1. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind große und solidarische Gemeinschaftsanstrengungen nötig, zu denen<br />
alle Kräfte der Gesellschaft ihre Beiträge leisten müssen. Das Projekt einer Steuersenkung für Spitzenverdiener und<br />
Spitzenverdienerinnen durch die angedachte Zinsabgeltungssteuer ist unter den heute gegebenen Bedingungen nicht<br />
zielführend und sollte nicht weiterverfolgt werden. Statt der erwarteten Mehreinnahmen wird sie bei Bund, Ländern und<br />
Gemeinden zu dauerhaften Einnahmeausfällen. Dagegen sollte das Projekt der Besteuerung von Aktien- und Spekulationsgewinnen<br />
weiterverfolgt werden. Auf eine Absenkung des Spitzensteuersatzes im Zuge der Steuerreformstufe<br />
2005 ist zu verzichten.<br />
2. Das Ziel einer angemessenen Belastung der großen Vermögensbesitzer durch die Weiterentwicklung der Vermögensund<br />
Erbschaftssteuer muss weiter verfolgt werden. Auch wenn dieses Projekt derzeit keine Mehrheit im Bundesrat hat,<br />
wird die Zielrichtung von uns weiter vertreten. Es bleibt dabei: Breite Schultern müssen auch mehr Lasten tragen, damit<br />
es auch zu einer solidarischen Gemeinschaftsanstrengung kommt.<br />
3. Die <strong>SPD</strong> fordert ihre Mitglieder und insbesondere ihre Funktions- und Mandatsträger auf allen politischen Ebenen auf,<br />
die notwendigen Diskussionen über die Zukunft des Standortes Deutschland und über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme<br />
auch weiterhin zu führen.<br />
Wie in vielen anderen Ländern <strong>Europa</strong>s auch führt mittelfristig kein Weg an einer Verbreiterung der solidarischen<br />
Basis zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorbei. Deshalb benötigen wir die Einbeziehung aller<br />
Personengruppen (Beamte/Beamtinnen, Selbständige, Politikerinnen und Politiker) ebenso wie die Heranziehung aller<br />
Einkommensarten. Darüber hinaus sind versicherungsfremde Leistungen (z.T. Folgekosten der Deutschen Einheit)<br />
stärker steuerfinanziert zu erbringen.<br />
Ostdeutschland ist noch immer weit entfernt von einer selbsttragenden wirtschaftlichen Entwicklung. Die Agenda 2010<br />
muss deshalb die besonderen Bedingungen Ostdeutschlands einbeziehen. Zur Umsetzung der Agenda 2010 sind daher<br />
folgende Punkte zu berücksichtigen: Besonders die Menschen in den strukturschwachen Regionen, von denen die<br />
meisten in Ostdeutschland liegen, brauchen weiterhin einen besonderen, öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Dieser<br />
muss vor dem Hintergrund der sich aus dem Hartz-Konzept ergebenden Grundlinien neu konzipiert werden. Nach der<br />
Grundsatzentscheidung, ob die Bundesanstalt für Arbeit in Zukunft die Zuständigkeit für diese Strukturmaßnahmen<br />
behalten soll, müssen diese Maßnahmen auf eine steuer- oder beitragsfinanzierte Grundlage gestellt werden. Bis zu<br />
einer deutlichen Annäherung an die wirtschaftlich stärkeren Regionen müssen diese Maßnahmen auf dem Niveau des<br />
Jahres 2002 fortgeführt werden, wobei sie mit zunehmender Annäherung degressiv auslaufen sollen.<br />
4. Angesichts des hohen Anteils älterer Arbeitsloser in Ostdeutschland halten wir ein Sonderprogramm „Aktiv zur Rente“<br />
für Ältere für erforderlich. Mit diesem Programm soll nach der Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes älteren<br />
Arbeitslosen ein Übergang bis zur Rente in Arbeit ermöglicht werden. Bei dem Programm kann auf Erfahrungen<br />
mit SAM, aber auch auf Landesprogramme z.B. aus Sachsen-Anhalt zurückgegriffen werden.<br />
Das Arbeitslosengeld soll es auch weiterhin als beitragsbezogene Versicherungsleistung geben. Wer länger einzahlt,<br />
soll auch länger Leistung beziehen. Die Frühverrentungspraxis der Unternehmen muss auf den Prüfstand. Eine generelle<br />
Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist dabei<br />
nicht der richtige Weg.<br />
73
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 74<br />
5. An der Ausbildung Jugendlicher müssen sich die Unternehmen, die in erster Linie von gut qualifizierten Mitabeitern<br />
profitieren, beteiligen und Ausbildungsplätze anbieten. Deshalb ist Ausbildung ihre Pflicht. Sollten freiwillige Vereinbarungen<br />
mit der Wirtschaft, Ausbildungsplätze bereitzustellen, nicht greifen, muss diese Frage gesetzlich geregelt werden.<br />
Angesichts der in diesem Jahr fehlenden 140.000 Ausbildungsplätze unterstützen wir die Ausbildungsumlagefinanzierung<br />
als ein geeignetes Instrument, die gesellschaftliche Ausbildungsverpflichtung der Unternehmen einzufordern.<br />
Um eine verstärkte Abwanderung junger Menschen aus Ostdeutschland zu vermeiden, ist ein besonderes öffentliches<br />
Engagement für Ausbildung und Arbeit junger Menschen in Ostdeutschland erforderlich. Wir begrüßen deshalb, dass<br />
das Ausbildungsprogramm für Ostdeutschland verstetigt wird. Diese Anstrengungen müssen aufrechterhalten werden,<br />
bis die geburtenschwachen Jahrgänge im Ausbildungsalter sind. Ergänzend halten wir ein Programm für die Bewältigung<br />
der zweiten Schwelle, z. B. in Form von Lohnkostenzuschüssen für Betriebe, die Azubis übernehmen, für notwendig.<br />
6. Die Gemeindefinanzreform muss zum 1. Januar 2004 in Kraft treten. Die Reform muss den Gemeinden zusätzliche<br />
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Damit gewinnen die Kommunen neue Gestaltungsspielräume für eine zukunftsorientierte<br />
Entwicklung. Die Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für erwerbsfähige Bedürftige<br />
soll nicht nur die Betroffenen aktivieren, sondern muss die Kommunen entlasten.<br />
7. Um die kommunale Investitionstätigkeit wieder zu beleben, sind verstärkte Anstrengungen notwendig. Das von der<br />
Bundesregierung initiierte Kreditprogramm (KfW-Programm) muss deshalb durch eine kommunale Investitionspauschale<br />
ergänzt werden. Diese Pauschale mit einem Volumen von mindestens 1 Mrd. EURO jährlich sollte bereits in<br />
2003 ausgezahlt und auch in 2004 bereitgestellt werden. Zur Finanzierung in Ostdeutschland ist ein Vorziehen von<br />
Geldern aus dem Solidarpakt II zu prüfen. Die Pauschale soll ausschließlich Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit zu<br />
Gute kommen.<br />
8. Nach dem erfolgreichen Ausbau der Infrastruktur – wenn auch noch lange nicht abgeschlossen - in den vergangenen<br />
Jahren, ist die Fortführung des Aufbaues Ost mit zusätzlichen Investitionen in die Wissenschafts- und Forschungslandschaft<br />
in Ostdeutschland notwendig. Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, die Finanzierung der großen<br />
Forschungseinrichtungen zu entflechten. Dies soll für eine Gründungsoffensive bei den Forschungszentren genutzt<br />
werden. Bei Entscheidungen über neu einzurichtende Forschungszentren müssen die ostdeutschen Länder grundsätzlich<br />
Vorrang haben. Darüber hinaus soll der von der Bundesregierung angekündigte weitere Aufwuchs bei den<br />
Forschungsorganisationen primär den Aufbau der Forschung im Osten ermöglichen.<br />
9. Bei der Gesundheitsreform sollten die ostdeutschen Erfahrungen (z. B. Polikliniken, Ambulanzen) ausgewertet und<br />
ggf. aufgenommen werden.<br />
10. Notwendiger Bestandteil der Agenda 2010 sind gesetzliche Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter in allen<br />
Bereichen. Dazu gehört vor allem auch ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, das gleichen Lohn für gleiche<br />
Leistung schafft. Unsere Initiativen zur Verbesserung von Familie und Beruf müssen weitergeführt und verstärkt<br />
werden. Der Umbau der sozialen Sicherungssysteme darf nicht einseitig zu Lasten der Frauen gehen.<br />
74
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 75<br />
Initiativantrag Nr. 2<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Erledigt durch Annahme Resolution des Landesvorstandes<br />
Für einen gerechten Umbau des Sozialstaates<br />
Resolution zur Agenda 2010<br />
1.<br />
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind Grundwerte der Sozialdemokratie. Die <strong>SPD</strong> steht für Freiheit, für Chancengleichheit<br />
bei der sozialen und politischen Teilhabe und für Solidarität mit jenen, die nicht aus eigener Kraft und in eigener Verantwortung<br />
ein menschenwürdiges Dasein führen können.<br />
Diese Ziele müssen wir unter den Bedingungen einer veränderten gesellschaftlichen Realität mit neuen Mitteln verwirklichen.<br />
Reformen sind unumgänglich. Über 4,6 Millionen registrierte Arbeitslose, eine halbe Million junge Menschen ohne Job<br />
und 140.000 fehlende Ausbildungsplätze allein in diesem Jahr müssen alle wachrütteln.<br />
Angesichts dieser dramatischen Entwicklung ist es das wichtigste Ziel unserer Politik, neue existenzsichernde Jobs zu<br />
schaffen. Denn nur wenn mehr Menschen in Arbeit kommen, können wir Erreichtes sichern und die Grundlage für einen<br />
gerechten Umbau des Sozialstaats schaffen.<br />
2.<br />
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen geht es darum, die Lasten gleichmäßig zu verteilen. Das Prinzip „Fordern und<br />
Fördern“ muss deshalb für alle gelten: Für Arbeitnehmer, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Rentner ebenso wie für Unternehmen,<br />
Kapitalbesitzer oder Manager, für Patienten genauso wie für Ärzte, Apotheken oder die Pharmaindustrie.<br />
3.<br />
Mit der Agenda 2010 wollen wir gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West schaffen und eine Bildungs- und Qualifizierungsoffensive<br />
beginnen. Wir bekennen uns zur sozialen Marktwirtschaft und ihren gestaltenden Elementen Mitbestimmung,<br />
Tarifautonomie und ein zeitgemäßes System der Flächentarifverträge. Wir wollen einen europäischen Sozialstaat als Gegenmodell<br />
zu einer nur über Marktgesetze gesteuerten Gesellschaft. Wir unterstützen Maßnahmen, die zu mehr Wachstum<br />
führen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen.<br />
4.<br />
Der Leitantrag des <strong>SPD</strong>-Bundesvorstands zur Reformagenda 2010 bekennt sich nur in der Einleitung zur Belastung aller.<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen orientieren sich an den Interessen der Wirtschaft und sind sozial völlig unausgewogen.<br />
Opfer werden allein Arbeitnehmern, Arbeitslosen und anderen sozial Schwachen auferlegt.<br />
5.<br />
Diese ungerechte Verteilung der Lasten hat viele Ursachen:<br />
Mangelndes gesellschaftliches Bewusstsein, mangelnde Bodenhaftung und den naiven Glauben, man könne sich die Sympathie<br />
des Kapitals erkaufen.<br />
5.1<br />
Seit Ludwig Ehrhardt leben viele Deutsche in der Illusion, dass alles, was dem Kapital dient, auch zu Arbeitsplätzen führt -<br />
und damit der Allgemeinheit nützt. Selbst Politiker mit hoher Verantwortung meinen, dass der gesellschaftliche Gegensatz<br />
heute nicht mehr zwischen Kapital und Arbeit, sondern zwischen Arbeitslosen und Arbeitsplatzinhabern bestehe.<br />
5.2<br />
In <strong>Berlin</strong> hat das Kapital Milliardengeschenke der öffentlichen Hand entgegengenommen. Die Antworten waren dramatischer<br />
Arbeitsplatzabbau und Gebührenerhöhungen:<br />
Der Verkauf der Bewag brachte z.B. dem US-Konzern Mirant einen Gewinn von 3,55 Milliarden DM und der Arbeitnehmerschaft<br />
bislang einen Verlust von 4550 Arbeitsplätzen; bis 2005 werden sogar 5617 der früher 9591 Arbeitsplätze<br />
abgebaut sein.<br />
Der Verkauf der Gasag brachte den Erwerbern einen Gewinn von 2,21 Milliarden DM, die Zahl der Mitarbeiter wurde<br />
halbiert – von 2450 auf 1015 Beschäftigte. Die Preise wurden um 30% erhöht, neue Preissteigerungen sind angekündigt.<br />
<br />
Der Verkauf der Wasserwerke erbrachte den Erwerbern überhöhte, staatlich garantierte Gewinne – die durch Bilanzfälschung<br />
weiter aufgebläht wurden. Mehr als 10.000 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz, die Allgemeinheit wird in kurzer<br />
Schrittfolge mit 30 % höheren Kosten für den Bezug von Wasser belastet.<br />
Wer noch immer den elementaren Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit verkennt, ist politikunfähig.<br />
5.3<br />
Aber auch die gewaltige Umverteilung des Vermögens, die unter Kohl stattfand, wurde von der Sozialdemokratie fortgesetzt.<br />
Das hat zu Milliardenausfällen bei den Staatseinnahmen geführt, ohne dass auch nur ein Arbeitsplatz geschaffen wurde.<br />
<br />
<br />
So wurde unter <strong>SPD</strong>-Regierung die steuerfreie Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften eingeführt. Dies<br />
brachte dramatische Ausfälle bei der Körperschaftssteuer. Auch in <strong>Berlin</strong> wurde 2001 keine Körperschaftssteuer mehr<br />
gezahlt – im Gegenteil: 345,7 Millionen € (700 Millionen DM) mussten aus dem Haushalt an die Konzerne ausgezahlt<br />
werden.<br />
<strong>Berlin</strong>er denken weiter an die Verlustzuweisungen. Ohne sie wären die von der Bankgesellschaft <strong>Berlin</strong> aufgelegten<br />
Fonds nicht möglich gewesen. Die Zeichner dieser Fonds erhielten teilweise vom Staat mehr Geld geschenkt als sie<br />
selbst eingesetzt hatten – und das ohne Risiko. Den <strong>Berlin</strong>er Haushalt hat das bereits mehr als 4 Milliarden DM gekostet<br />
– und kostet jährlich weitere 600 Millionen DM.<br />
75
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 76<br />
<br />
Noch deutlicher waren die Verluste im Haushalt des Bundes. Die Geldelite der Bundesrepublik Deutschland zahlte und<br />
zahlt noch immer keine Steuern, während auch die arbeitende untere Mittelschicht an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit<br />
gedrückt ist.<br />
Dass diese Zustände nicht zu einem Aufschrei zumindest bei Gewerkschaften und bei der <strong>SPD</strong> geführt haben und Stillschweigen<br />
geübt wird, ist nur dadurch zu erklären, dass auch führende Funktionäre beider Institutionen diese Möglichkeiten<br />
selbst nutzen und keine Steuern zahlen. Das weiß auch die Bevölkerung!<br />
6.<br />
Es bestehen erhebliche Zweifel, dass durch die in der<br />
Agenda 2010 vorgeschlagenen Maßnahmen Arbeitsplätze mit existenzsicherndem Einkommen geschaffen werden. Eher<br />
liegt die Vermutung nahe, dass die Unternehmer die gleiche Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nur zu für<br />
sie günstigeren Bedingungen – beschäftigen werden.<br />
Deshalb erwarten wir, dass<br />
- künftig auch Unternehmen in angemessener Weise an der Finanzierung des Staatshaushaltes beteiligt werden. Die<br />
Körperschaftssteuer darf nicht länger eine Subvention sein, sie muss wieder eine Steuer werden. Verlustzuweisungen<br />
müssen drastisch begrenzt werden, damit Unternehmen überhaupt wieder Steuern zahlen.<br />
- große Vermögen sowie Aktien- und Spekulationsgewinne künftig besteuert werden.<br />
- die Erbschaftssteuer weiterentwickelt wird.<br />
- die Gewerbesteuer den Gemeinden dauerhafte und verlässliche Einnahmen garantiert.<br />
- wenn Arbeitlosen- und Sozialhilfe zusammengelegt werden, eine Absicherung gewährleistet sein muss, die höher<br />
ist als die heute gezahlte Sozialhilfe. Altersversorgung und Vermögen sollen – wie bei der heutigen Arbeitslosenhilfe<br />
– nur begrenzt angerechnet werden.<br />
- die Sozialversicherungssysteme auf eine breitere Basis gestellt werden. Ziel muss es sein, dass alle Bürger und<br />
Bürgerinnen, auch Selbständige, künftig einzahlen und damit versichert sind. Die Sozialversicherungssysteme dürfen<br />
nicht länger nur vom Faktor „Normalarbeit“ finanziert werden, während Minijobs und andere neue Formen der<br />
Erwerbstätigkeit und Einkommensarten außen vor bleiben und im Alter oder in Lebenskrisen die Sozialhilfe weiter<br />
belasten,<br />
- das Krankengeld im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt und paritätisch finanziert wird,<br />
- eine Ausbildungsplatzabgabe eingeführt wird, falls die Arbeitgeber erneut ihr Versprechen brechen und nicht allen<br />
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anbieten.<br />
7.<br />
Die Agenda 2010 zielt auf einen Mentalitätswechsel in Deutschland. Diese Zielsetzung unterstützen wir. Es ist erforderlich,<br />
dass wieder ein Bewusstsein der Verantwortung für die Gesellschaft entsteht. Der Staat darf nicht zum Objekt der Ausbeutung<br />
für private Zwecke werden.<br />
Die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen erfordern, dass jeder seinen Beitrag zur Umgestaltung leisten muss. So<br />
kann der Staat mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe organisatorische Probleme lösen und erhebliche<br />
finanzielle Mittel vor allem bei den Kommunen einsparen. Wenn die Gemeinden das Geld tatsächlich behalten dürfen, kann<br />
das die Not lindern, von der die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betroffen sind.<br />
Die Sicherung der stark erschütterten Solidarsysteme ist erforderlich. Auch hier müssen die Betroffenen Opfer bringen. Allerdings<br />
wird die gesellschaftliche Solidarität nicht dadurch gestärkt, dass man Solidarsysteme schwächt oder abschafft. Das<br />
Gegenteil ist richtig.<br />
8.<br />
Die Agenda 2010 ist abzulehnen, wenn man sie isoliert betrachtet oder gar als Beginn eines systematischen Abbaus<br />
sozialer Rechte. Das soziale Ungleichgewicht ihrer konkreten Vorschläge macht sie unter diesen Voraussetzungen unvereinbar<br />
mit sozialdemokratischen Prinzipien.<br />
Wir betrachten die Agenda als die – einseitige – Vorleistung der abhängig Beschäftigten, der Arbeitslosen und sozial<br />
Schwachen. Sie muss umgehend fortgeschrieben werden und gleiche Opfer für solidarische Leistungen den wirtschaftlich<br />
Starken abfordern.<br />
9.<br />
Ob diese Ergänzung gelingt oder die Agenda 2010 in ihrer sozialen Ungerechtigkeit stecken bleibt, ist eine Machtfrage.<br />
Diese müssen wir beantworten.<br />
Dabei geht es nicht allein um Mehrheiten in der Partei. Die Zeiten starrer Gruppierungen ist ohnehin vorbei. Was zählt ist der<br />
Kampf um die Köpfe in und außerhalb der Partei. Er ist nur zu gewinnen, wenn den Menschen ihre Interessen deutlich vor<br />
Augen geführt werden.<br />
Ohne Verbündete ist dieser Kampf, der zudem gegen einen Teil der Medien geführt werden muss, nicht zu gewinnen.<br />
10.1<br />
Schon aus diesem Grund ist es töricht, wenn sich Gewerkschaften und Sozialdemokratie entzweien. Die Interessen beider<br />
Organisationen sind noch immer in den Grundlagen gleich. Der Konflikt mit den Gewerkschaften muss daher, soweit er nicht<br />
durch inhaltliche Diskussionen das gesellschaftliche Bewusstsein erweitert, so schnell wie möglich beendet werden.<br />
10.2<br />
Die <strong>SPD</strong> verkennt – wie die Öffentlichkeit und die Betroffenen – dass weite Teile der (kleinen) Selbständigen oft in sozial<br />
ungesichertere Situationen gestellt sind als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen vollen Arbeitsplatz besitzen. Sie<br />
sind von der Not, die sich auf schwindende Kaufkraft gründet, unmittelbar betroffen. Steigende Gebühren schlagen sich bei<br />
76
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 77<br />
ihnen besonders heftig nieder und schmälern den ohnehin geringen Gewinn. Gesellschaftliche Solidarität – etwa Arbeitslosengeld<br />
– können sie nicht beanspruchen. Vorsorge für Krankheit und Alter können sich viele nicht leisten. Umgekehrt sind<br />
die kleinen mittelständischen Betriebe, die massenweise Pleite gehen, noch immer diejenigen, die die meisten Arbeitsplätze<br />
bereitstellen.<br />
Wenn Kapital und Arbeit noch in einem positiven Abhängigkeitsverhältnis stehen, dann in diesem Bereich. Die Konzerne<br />
dagegen berufen sich zu Unrecht darauf.<br />
10.3<br />
Natürlich geht es auch darum, die Mitglieder der <strong>SPD</strong> zu erreichen. Deren gesellschaftliches Bewusstsein beginnt zu<br />
verblassen, teilweise wurde es nicht erworben. Das gesellschaftliche Problem der Arbeitslosigkeit und Armut wird zu einem<br />
persönlichen Versagen des Einzelnen heruntergestuft. Daraus rechtfertigt sich dann, mit Druckmitteln zu reagieren. Erfolgreich,<br />
tüchtig und intelligent werden ebenso gleichgesetzt wie erfolglos, dumm und faul.<br />
Aus dieser Zuordnung vieler Menschen erwachsen keine gesellschaftlichen Kräfte, allenfalls Frust und Zerstörung.<br />
Erst wenn die <strong>SPD</strong> die in ihrem Grundsatzprogramm aufgezeigten gesellschaftlichen Gegensätze wieder offensiv benennt,<br />
vertritt und damit sichtbar macht, sind die Menschen bereit mit ihr in einen solidarischen Kampf für eine gerechte Gesellschaft<br />
einzutreten.<br />
11.<br />
Damit vertrösten wir niemanden auf „spätere Zeiten“. Die Menschen erkennen ihre Interessen, wenn man sie ihnen vor Augen<br />
führt. So hat die Basis der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> mit ihrer klaren Ablehnung neo-liberaler Politik bewiesen, dass sie die Fehler<br />
der Vergangenheit erkannt hat und umsteuern möchte. Das ist eine Folge der Aufklärung durch die Linke.<br />
Hier muss energisch weiter gearbeitet werden.<br />
12.<br />
Erfolgreich kann linke Politik nur in der Regierungsverantwortung umgesetzt werden. Eine <strong>SPD</strong>, die sich als nicht regierungsfähig<br />
erweist, hat für viele Jahre nicht nur den unmittelbaren, sondern auch den indirekten Einfluss verloren, den eine<br />
Opposition sonst ausübt. Eine Partei, die bewiesen hat, dass sie nicht regieren kann, ist auch nicht oppositionsfähig.<br />
Daher muss ein ehrlicher Kompromiss gefunden werden, der die Zustimmung zur Agenda 2010 ermöglicht.<br />
Das bedeutet aber keineswegs, dass man sich mit der Einseitigkeit der Agenda abfindet. Vielmehr muss eine Fortschreibung<br />
erfolgen. Diejenigen, die jenseits jeder gesellschaftlichen Solidarität unproduktives Vermögen anhäuften, das - immer<br />
auf der Suche nach dem maximalen Profit - als gewaltige Geldblase um den Globus rast, müssen endlich zur Teilhabe an<br />
der gesellschaftlichen Solidarität geführt werden.<br />
Wir verstehen unsere Zustimmung zu einer - veränderten - Agenda 2010 nicht als Niederlage linker Politik.<br />
Ihre einseitige Ausrichtung ist uns Motivation und Verpflichtung, für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit zu kämpfen.<br />
Am Ende dieses Kampfes um die Köpfe müssen andere Mehrheiten stehen.<br />
77
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 78<br />
Initiativantrag Nr. 3<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Erledigt durch Annahme Resolution des Landesvorstandes<br />
Für einen gerechten Umbau des Sozialstaates<br />
1.<br />
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die <strong>SPD</strong> steht für<br />
die Freiheit des Einzelnen, für Chancengleichheit bei der sozialen und politischen Teilhabe und für die Solidarität mit jenen,<br />
die nicht aus eigener Kraft und in eigener Verantwortung ein menschenwürdiges Dasein führen können. Ohne Solidarität<br />
gibt es keine menschliche Gesellschaft.<br />
Getragen von diesen Grundwerten begleitet die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> aktiv die Reformdebatte in Deutschland. Wir wissen, dass<br />
Reformen unumgänglich sind. Weit über 4 Millionen registrierte Arbeitslose, eine halbe Million junge Menschen ohne Job<br />
und 140.000 fehlende Ausbildungsplätze allein in diesem Jahr müssen alle wachrütteln.<br />
Ziel jeglicher Reformen muss es angesichts der dramatischen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sein, neue existenzsichernde<br />
Jobs zu schaffen. Dies muss Richtschnur allen Handelns werden. Denn nur wenn mehr Menschen in Arbeit kommen,<br />
können wir das Erreichte wirklich sichern und die Grundlage für einen gerechten Umbau des Sozialstaats zu schaffen.<br />
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen geht es darum, die Lasten in schwieriger Zeit gleichmäßig auf alle Schultern zu<br />
verteilen. Das Prinzip „Fordern und Fördern“ muss deshalb künftig für alle gelten, für Arbeitnehmer, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger,<br />
Rentner ebenso wie für Unternehmen, Kapitalbesitzer oder Manager, für Patienten genauso wie für Ärzte, Apotheken<br />
oder Pharmaindustrie.<br />
2.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> unterstützt die in der Agenda 2010 festgeschriebenen Grundsätze zur Schaffung gleicher Lebensverhältnisse<br />
in Ost und West, zur Bildungs- und Qualifizierungsoffensive, das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, zur Mitbestimmung,<br />
Tarifautonomie und den Flächentarifverträgen, zum europäischen Sozialstaat als Gegenmodell zu einer nur über<br />
Marktgesetze gesteuerten Gesellschaft und zu allen Maßnahmen, die tatsächlich zu mehr Wachstum und der Schaffung<br />
neuer Arbeitsplätze beitragen.<br />
Dazu gehört unter anderem der Plan, öffentliche Investitionen anzuregen, den Mittelstand zu unterstützen und die Handwerksordnung<br />
zu novellieren. Daneben begrüßt die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> alle Versuche, finanzielle Spielräume im Gesundheitswesen<br />
durch mehr Wettbewerb der Anbieter zu schaffen.<br />
3.<br />
Der Leitantrag des <strong>SPD</strong>-Bundesvorstands zur Reformagenda 2010 bekennt sich nur im Prolog zur Belastung aller. Tatsächlich<br />
aber soll die Wirtschaft gefördert werden (zum Beispiel mit der Mittelstandsbank oder dem Small-Business-Act, also der<br />
Steuerbefreiung für Kleinstunternehmen), während die Arbeitnehmer und Arbeitslosen gefordert werden. Deshalb erwarten<br />
wir, dass<br />
- auch Unternehmen künftig in angemessener Weise an der Finanzierung des Staatshaushaltes beteiligt werden. Die<br />
Körperschaftssteuer darf nicht länger eine Subvention sein, sie muss wieder eine Steuer werden.<br />
- große Vermögen sowie Aktien- und Spekulationsgewinne künftig besteuert werden,<br />
- die Gewerbesteuer den Gemeinden dauerhafte und verlässliche Einnahmen garantiert,<br />
- die Sozialversicherungssysteme auf eine breitere Basis gestellt werden. Ziel muss es sein, dass alle Bürger und<br />
Bürgerinnen, auch Selbständige, künftig einzahlen und damit versichert sind. Die Sozialversicherungssysteme dürfen<br />
nicht länger nur vom Faktor „Normalarbeit“ finanziert werden, während Minijobs und andere neue Formen der<br />
Erwerbstätigkeit außen vor bleiben und im Alter oder in Lebenskrisen die Sozialhilfe weiter belasten und dass<br />
- eine Ausbildungsplatzabgabe eingeführt wird, falls die Arbeitgeber erneut ihr Versprechen brechen und nicht allen<br />
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anbieten.<br />
4.<br />
Hauptursache der Wachstumsschwäche in Deutschland im Frühsommer 2003 ist die lahmende Binnenkonjunktur. Die <strong>Berlin</strong>er<br />
<strong>SPD</strong> erkennt an, dass der Staat mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe organisatorische Probleme<br />
lösen und erhebliche finanzielle Mittel vor allem bei den Kommunen einsparen kann – wenn die Gemeinden das Geld tatsächlich<br />
behalten dürfen. Sie bezweifelt aber, dass mit der Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau die Binnenkonjunktur<br />
gestärkt oder Arbeitsplätze geschaffen werden können.<br />
5.<br />
Es ist richtig, dass Unternehmen in der Vergangenheit ältere Beschäftigte auf Kosten der Sozialkassen aus dem Betrieb<br />
gedrängt haben. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Andererseits muss sichergestellt werden, dass auch Menschen<br />
über 55 Jahren noch Beschäftigungschancen erhalten und nicht im Fall von Arbeitslosigkeit schon nach wenigen<br />
78
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 79<br />
Monaten in die Sozialhilfe fallen.<br />
In der Diskussion über die Verringerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes geht es deshalb auch um Vertrauensschutz<br />
für all jene, die lange Jahre eingezahlt haben und im Fall der Not nun nicht mehr länger als 12 bzw. 18 Monate auf<br />
die Leistung bauen können.<br />
6.<br />
Die <strong>SPD</strong> hat im Wahlkampf des Jahres 2002 erfolgreich damit geworben, dass sie den Kündigungsschutz nicht antasten<br />
wird. Eine Verschlechterung dieser Absicherung senkt angesichts von rund 3,5 Millionen Kündigungen pro Jahr keinesfalls<br />
die Arbeitslosigkeit, wohl aber das Vertrauen, das die Menschen in Wahlversprechen der <strong>SPD</strong> haben. Deshalb lehnt die<br />
<strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> diesen Vorschlag ab.<br />
7.<br />
Ziel der Privatisierung des Krankengeldes ist es angeblich, die Lohnnebenkosten zu senken. Tatsächlich aber werden die<br />
Lohnnebenkosten nicht gesenkt, sondern einseitig auf die Arbeitnehmer abgewälzt, während die Arbeitgeber einseitig entlastet<br />
werden. Auch dies wird die Kaufkraft und damit die wirtschaftliche Dynamik weiter schwächen. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> fordert,<br />
dass die Leistung Krankengeld auch weiterhin paritätisch und solidarisch finanziert wird.<br />
8.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> begrüßt die Entscheidung des <strong>SPD</strong>-Bundesvorstands, fünf Arbeitsgruppen einzusetzen, die Details der<br />
Reformagenda klären sollen. Wir bedauern allerdings, dass diese notwendige und sachliche Diskussion überschattet wird<br />
von dem Versuch, die Partei mit Macht und Rücktrittsdrohung in eine neue Richtung zu zwingen. Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> erwartet,<br />
dass sich alle Beteiligten an der Suche nach sachlich gebotenen Lösungen beteiligen.<br />
79
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 80<br />
Initiativantrag Nr. 4<br />
(LPT 16./17.05.2003)<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Annahme i.d.F.d.AK: siehe Textende<br />
Soziale und geschlechtsspezifische Differenzierungen in den Politiken der „Agenda 2010“ stärker berücksichtigen<br />
Mit der Diskussion zur Agenda 2010 hat ein intensiver Diskussionsprozess in Partei und Gesellschaft zur Ausgestaltung des<br />
Sozialstaates und der Sozialen Sicherungssysteme begonnen. Bürgerinnen und Bürger, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten<br />
zeigen – nicht nur wegen der stagnierenden Wirtschaft sondern auch wegen sich wandelnder Lebensstile –<br />
durchaus eine Veränderungsbereitschaft zu nachhaltigen Modernisierungen von Staat und Gesellschaft. In Abhängigkeit von<br />
der privaten ökonomischen Lage akzeptieren viele Leistungskürzungen bzw. –einschränkungen auch für sich selbst: Bürgerinnen<br />
und Bürger mit einem niedrigen Einkommen – hierzu gehören überproportional viele Menschen aus Ostdeutschland<br />
als auch viele Frauen – können Kürzungen aber einfach weniger akzeptieren als diejenigen mit einem hohem Einkommen.<br />
Es ist aber nicht verwunderlich, dass es gravierende Unterschiede in der Einschätzung zur Frage „Geht dieses Reformprogramm<br />
(Begrenzung Arbeitslosengeld, Veränderung Kündigungsschutz, Reform Gesundheitswesen, etc.) insgesamt Ihrer<br />
Meinung nach eher in die richtige oder eher in die Falsche Richtung?“ gibt: Im Westen sind 48% der Menschen der Überzeugung,<br />
es geht in die richtige Richtung, im Osten aber nur 30%; sind hinsichtlich der Kürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes<br />
zur Anreizerhöhung einer Jobannahme 60% im Westen aber nur 37% im Osten, bei der Kürzung der Arbeitslosenhilfe<br />
49% im Westen aber nur 25% im Osten, beim Krankengeld als private Zusatzversicherung 23% im Westen und nur<br />
17% im Osten von der richtigen Richtung überzeugt.<br />
Diese Unterschiede verweisen auf sehr verschiedene soziale und geschlechtsspezifische Lebenslagen, die unsere Politik<br />
nicht einfach ausblenden darf, vielmehr muss sie diese Komponenten bei der Ausgestaltung ihrer Vorhaben stärker berücksichtigen!<br />
Die <strong>SPD</strong> steht für eine sozial differenzierte Politik.<br />
Die <strong>SPD</strong> steht für eine Politik, in der Geschlechtergerechtigkeit originärer Bestandteil unseres Grundwertes „soziale Gerechtigkeit“<br />
und gleichzeitig sichtbarer Ausdruck einer modernen Ausgestaltung von Chancengleichheit ist.<br />
Die <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> unterstützt konsequent das Ziel der eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Männer, welches sich<br />
nicht am männlichen Ernäherund<br />
am weiblichen Zuverdiener-Modell orientiert. Wir fordern daher nachdrücklich eine auch in Partei und Öffentlichkeit erkennbare<br />
soziale und geschlechtsspezifische Differenzierung in allen Politikfeldern.<br />
Wir erwarten vom <strong>SPD</strong>-Parteivorstand, von den Mitgliedern der Antragskommission, etc. entsprechende Differenzierungen in<br />
den Politiken, wie sie der Leitantrag „Mut zur Veränderung“ formuliert hat. Wir erwarten auch eine Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
der vom <strong>SPD</strong>-PV eingesetzten fünf Arbeitsgruppen, die auch eine Analyse anhand sozialer und geschlechtsspezifischer<br />
Indikatoren erhält.<br />
Wir fordern von allen MinisterInnen, insbesondere von den Verantwortlichen für Finanzen, für Wirtschaft und Arbeit, für Gesundheit<br />
und soziale Sicherung in Kürze eine öffentliche Präsentation, aus der deutlich wird, wo und wie bei den aktuellen<br />
politischen Entscheidungen und den gesetzgebungsvorbereitenden Maßnahmen das Prinzip der Doppelstrategie Frauenförderung<br />
und Gender-Mainstreaming in alle Politikfelder eingeflossen ist. Gleiches erwarten wir vom <strong>SPD</strong>-Fraktionsvorstand.<br />
Beschluss: Annahme i.d.F.d.AK:<br />
Der Bundesparteitag möge beschließen:<br />
Der Parteivorstand wird aufgefordert, alle Maßnahmen der Agenda 2010 einer Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung zu unterziehen.<br />
80
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 81<br />
Initiativantrag Nr. 5<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Überweisung an AH-Fraktion<br />
Antrag zur schnelleren Einbürgerung in <strong>Berlin</strong><br />
Die AG-Migration Friedrichshain-Kreuzberg bringt einen Initiativantrag mit dem Ziel schnellerer Einbürgerungsverfahren in<br />
<strong>Berlin</strong> ein. Der Initiativantrag wurde notwendig, nachdem eine Senatsstudie zu dem Thema erst nach dem Ende der offiziellen<br />
Antragsfrist vor fünf Wochen vorlag und erst danach entsprechende Anhörungen im Abgeordnetenhaus stattfanden. Die<br />
Dringlichkeit ist gegeben, da es voraussichtlich noch vor den Sommerferien zu einer Beschlussfassung in dieser Sache<br />
kommt.<br />
Der Initiativantrag besteht aus fünf Einzelanträgen. Wir bitten die Landesparteitagsdelegierten, den Gesamtantrag auf der<br />
beiliegenden Liste zu unterstützen, damit er auf dem Parteitag zur Vorlage (unter: Weitere Antrage zur Kommunalpolitik)<br />
gebracht werden kann.<br />
Ziel des Initiativantrages: Die Einbürgerungsverfahren müssen wesentlich beschleunigt und bürgernah ausgeführt werden.<br />
Dieser Antrag orientiert sich damit an der Koalitionsvereinbarung, in der es heißt<br />
„Die Koalitionsparteien wollen, dass in <strong>Berlin</strong> Einbürgerungen weiter erleichtert werden. Die Wartezeiten bei der Einbürgerung<br />
sind in vielen Bezirken unzumutbar lang und wirken kontraproduktiv. Wir werden die Verwaltungsvorschriften mit dem Ziel der<br />
Beschleunigung und Vereinfachung – auch einer weiteren Abschichtung von Kompetenzen auf die bezirklichen Einbürgerungsstellen<br />
– überprüfen“<br />
Antrag 1: Verlagerung der Entscheidungskompetenzen auf eine Verwaltungsebene<br />
Bisher entscheiden die Sachbearbeiter/Gruppenleiter in den Bezirken die Anspruchseinbürgerungen nach § 85 (1), die Senatsverwaltung<br />
entscheidet bei den Miteinbürgerungen (Familiennachzug) und den Einbürgerungen nach § 8,9 StAG (Ermessenseinbürgerung)<br />
in einem kombinierten Verfahren (nach Vorbereitung der Bezirke).<br />
Entscheidungskompetenzen und Ermessensspielräume sollen nun bei allen drei Einbürgerungskategorien so schnell wie<br />
möglich auf eine Verwaltungsebene verlagert werden.<br />
Antrag 2: Bündelung der Entscheidungskompetenzen auf der Bezirksebene<br />
Ermessenspielräume und Entscheidungskompetenzen sollen in allen drei Einbürgerungskategorien auf die Bezirksebene<br />
verlagert werden.<br />
Antrag 3: Großzügige Auslegung der Verwaltungsvorschriften<br />
Die Interpretation der Bundesrichtlinien seitens der Senatsverwaltung und der Dienstvorschriften seitens der Bezirksverwaltungen<br />
ist bei Sozialprognose und wirtschaftlichen Voraussetzungen, Sprachnachweis, Verfassungsschutzanfrage und Anrechnungszeiten<br />
möglichst großzügig zu gestalten, so dass Einbürgerungen erleichtert, nicht erschwert werden. Die Auslegungen<br />
sollen sich dabei an der liberalsten Verfahrenspraxis in anderen Bundesländern orientieren.<br />
Antrag 4: Personalumschichtung<br />
Es ist zu prüfen, ob durch verwaltungsinterne Umverlagerungen nichtplanmäßiges Personal für die Einbürgerungsbehörden<br />
zeitweilig eingesetzt werden kann, damit kurzfristig der Antragsstau abgebaut wird. Ein Abbau von Planstellen und von nichtplanmäßigen<br />
Mitarbeitern ist auf jeden Fall bis zum kompletten Abbau unerledigter Anträge aus den Vorjahren zu verhindern.<br />
Antrag 5: Evaluation<br />
Einbürgerungsverfahren in <strong>Berlin</strong> sollen eine durchschnittliche Dauer von sechs Monaten bis zur Einbürgerungszusicherung<br />
oder –ablehnung nicht überschreiten. Spätestens drei Jahre nach der Verwaltungsumstellung ist vom Innensenator und den<br />
Bezirksbürgermeistern zu prüfen, ob eine entsprechende Verfahrensbeschleunigung erzielt wurde.<br />
81
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 82<br />
Initiativantrag Nr. 6<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Annahme<br />
Die Ergebnisse der vom Landesvorstand einzurichtenden Arbeitsgruppe werden in einem gesonderten kommunalpolitischen<br />
Parteitag bis zum Frühjahr 2004 behandelt.<br />
82
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 83<br />
Initiativantrag Nr. 7<br />
LPT 16./17.05.2003<br />
Der Landesparteitag möge beschließen:<br />
Rücküberweisung an Antragsteller<br />
und FA V, AG Hochschule/Forschung<br />
Unsere Agenda für <strong>Berlin</strong>s Hochschulen –<br />
7 Alternativen zu Studiengebühren und Kürzungen<br />
Absichern statt abkassieren – Studiengebühren bedeuten soziale Selektion!<br />
Nach Angaben des Deutschen Studentenwerks liegt das rechnerische Durchschnittseinkommen von Studierenden in<br />
Deutschland bei rund 700 € pro Monat, das sind rund 8.400 € im Jahr. Dieses Einkommen wird zu mehr als 75% privat erbracht,<br />
durch Unterhaltsleistungen der Eltern und Erwerbsarbeit der Studierenden. Staatliche Transferleistungen wie das<br />
BAföG erhalten weniger als 20% der Studierenden. Schon jetzt arbeiten rund zwei Drittel der Studierenden, teilweise sicherlich,<br />
um Erfahrungen zu sammeln, die Mehrheit ist allerdings auf das Jobben angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten<br />
zu können. Die Einführung von Studiengebühren in der diskutierten Höhe von 1.000 € pro Jahr würde zusätzliche Kosten für<br />
die Studierenden bedeuten, die rund 12%, also jeden 8. Euro ihres Budgets betreffen. Dies bedeutet für die Studierenden<br />
einen weiter erhöhten Zwang zu arbeiten, in der Folge noch längere Studienzeiten und noch höhere Abbrecherquoten. Dies<br />
kann nicht im Interesse unserer Gesellschaft liegen, die ihre im internationalen Vergleich weiterhin niedrigen Studierendenquoten<br />
dringend steigern muß, um ihre Zukunftsfähigkeit nicht zu verspielen. Um Studienzeiten und Abbrecherquoten mittelfristig<br />
zu senken, ist eine deutliche Verbesserung der finanziellen und sozialen Situation der Studierenden nötig. Ein wichtiges<br />
Instrument ist seit langem bekannt: Das „Drei-Körbe-Modell“, das eine elternunabhängige Basisfinanzierung mit einem bedarfsabhängigen<br />
zweiten Korb und einer Abschlußförderung verbindet. Zur Gegenfinanzierung würden Kindergeld und Steuerfreibeträge<br />
zusammengefaßt<br />
Alle müssen können dürfen – Mehr soziale Gerechtigkeit an den Hochschulen!<br />
In der öffentlichen Debatte wird häufig argumentiert, Studiengebühren seien sozial gerecht, da „Arbeiterkinder“ trotz Gebührenfreiheit<br />
nicht an den Hochschulen zu finden seien und die Gesellschaft durch die Gebührenfreiheit vor allem „Akademikerkinder“<br />
subventioniere. Die Einführung von Gebühren bitte so endlich die Reichen zur Kasse. Diese Argumentation ist empirisch<br />
nicht haltbar. Zum einen werden mit der Einführung von Gebühren sicherlich nicht mehr „Arbeiterkinder“ an die Hochschulen<br />
kommen, zum anderen geht der Rückgang des Anteils dieser Gruppe mit einem massiven Rückgang der BAföG-<br />
Gefördertenquote einher. Das Entscheidende für soziale Gerechtigkeit an den Hochschulen ist also die finanzielle und soziale<br />
Absicherung der Studierenden. Um die Potentiale der Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Schichten für wirtschaftlichen<br />
und gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen, sollte der Senat die Einrichtung eines Stipendienfonds zur gezielten<br />
Förderung von „Arbeiterkindern“ prüfen, an der auch die lokale und regionale Wirtschaft beteiligt sein sollte. Es muss Ziel<br />
sozialdemokratischer Politik sein, allen Bevölkerungsschichten den Zugang zum Hochschulstudium nicht nur formal, sondern<br />
auch materiell zu ermöglichen. Die gegenwärtige Ungleichheit hinzunehmen, wäre für eine sozialdemokratisch geführte Regierung<br />
eine Bankrotterklärung.<br />
Zukunft gestalten statt Vergangenheit bewahren – Ein Zukunftsfonds für die Bildung!<br />
Investitionen in die Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Nur mit Hilfe<br />
der Schulen, Ausbildungsinstitutionen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen können wir den Strukturwandel zu Informationsgesellschaft<br />
gestalten und dauerhaft die wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschrittsfähigkeit <strong>Berlin</strong>s und<br />
Deutschlands sichern. Die öffentlichen Kassen sind seit Jahren chronisch leer, die Bildungsinstitutionen seit Jahren chronisch<br />
unterfinanziert. Weitere Kürzungen greifen tief in die Substanz. Deshalb ist es endlich an der Zeit, neue Finanzierungsquellen<br />
zu erschließen. Wir schlagen dazu die Gründung eines Zukunftsfonds für die Bildung vor, zu dem Staat, Wirtschaft und Gesellschaft<br />
ihren Beitrag leisten. Aus unserer Sicht sollte der Fonds mittelfristig durch die Beiträge der Unternehmen zur Ausbildungsumlage<br />
und eine modifizierte Ausgestaltung der Vermögens- und Erbschaftssteuern gegenfinanziert werden. Die<br />
sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefordert, im Bundesrat entsprechende Initiativen starten und in einem<br />
ersten Schritt einen freiwilligen Fonds einrichten, in den Unternehmen einzahlen. Aus dem Fonds sollen alle Bildungseinrichtungen<br />
<strong>Berlin</strong>s unterstützt werden, neben den Hochschulen auch die Schulen, die Ausbildungsinstitutionen und die<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
Studieninhalte zukunftsfest machen – Für eine qualitative Studienreform!<br />
Die Realität der Hochschullehre wird in vielen Fällen den veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, häufig aber<br />
auch den wissenschaftlichen, Notwendigkeiten nicht mehr gerecht. Hier gilt es umzusteuern und durch erneuerte Curricula<br />
sowie eine gezielte Förderung der Hochschuldidaktik zu einer qualitativen Studienreform beizutragen. Studienreform darf<br />
aber nicht den Fehler machen, durch die unreflektierte Übernahme von Studiensystemen ganz anderer Tradition das Studium<br />
zu verschulen, Prüfungsleistungen zu verschärfen und beim Übergang zwischen neu eingerichteten Bachelor- und Masterstudiengängen<br />
neue Hürden aufzubauen. Eine qualitative Studienreform ist nur durch eine integrierte Vermittlung von<br />
Schlüsselkompetenzen im Rahmen des Fachstudiums, einen kritischen Praxisbezug, der über die reine Erhöhung der Beschäftigbarkeit<br />
weit hinaus geht, und die Etablierung neuer Lehr- und Lernformen an den Hochschulen möglich.<br />
Beraten statt bestrafen – Berufsorientierung und Studienberatung stärken!<br />
Studienfachwechsel und Studienabbruch sind an den Hochschulen eher die Regel als die Ausnahme. Wenn jeder dritte Stu-<br />
83
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 84<br />
dierende das Fach wechselt und jeder vierte Studierende das Studium endgültig abbricht, verlängern sich Studienzeiten,<br />
verschlechtern sich Zukunftschancen und bringt der Einsatz ohnehin knapper Mittel suboptimale Ergebnisse. Die Einführung<br />
der Möglichkeit zur Zwangsexmatrikulation als Reaktion ist hier kein taugliches Instrument. Häufig geben Studienfachwechsler<br />
und Studienabbrecher als Grund eine falsche Vorstellung von den Studieninhalten an. Hier gilt es anzusetzen und schon<br />
in der Schule die Beratung und Betreuung deutlich zu verbessern. Die Schüler müssen die Möglichkeit haben, selbständig<br />
eine Berufsorientierung zu entwickeln und so ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. An den Hochschulen muß insbesondere<br />
die Studieneingangsphase umgestaltet werden, um frühzeitig falsche Entscheidungen zu verhindern oder wenigstens<br />
zu korrigieren. Dazu ist eine Evaluation der Beratungsangebote in <strong>Berlin</strong>s Schulen, Hochschulen und Beratungsinstitutionen<br />
und eine aufeinander abgestimmte qualitative Erneuerung nötig. Hier steht der Senat in der Verantwortung.<br />
Halten statt vertreiben – Studierende sind wichtig für <strong>Berlin</strong>s Zukunft!<br />
In <strong>Berlin</strong> ist der Anteil Studierender an der Gesamtbevölkerung deutlich höher als in allen Flächenländern. Der gleiche Trend<br />
ist für Hamburg und Bremen zu beobachten. Dies zeigt die Attraktivität für gut ausgebildete junge Menschen, die mittel- und<br />
langfristig eine wichtige Rolle für die Zukunftsfähigkeit <strong>Berlin</strong>s spielen können, da vor allem im Bereich der wissensintensiven<br />
Dienstleistungen noch ungenutzte Beschäftigungspotentiale liegen. Dazu müssen wir ihnen attraktive Anreize bieten, sich<br />
langfristig in <strong>Berlin</strong> niederzulassen. Fakt ist natürlich auch, daß <strong>Berlin</strong> für weite Teile Ostdeutschlands, aber auch für viele<br />
Studierende aus Nord- und Westdeutschland die wissenschaftliche Bildung bereit stellt. Ein gerechtes Instrument zum Ausgleich<br />
dieser Mehrkosten wäre mittelfristig durch einen Hochschulfinanzausgleich zwischen den „alten“ Heimatländern und<br />
der neuen Heimat <strong>Berlin</strong> zu erreichen.<br />
Gestalten statt verwalten – Öffentliche Mittel effizient nutzen!<br />
Bei den tertiären Bildungsausgaben liegt <strong>Berlin</strong> bundesweit im Mittelfeld, wie die Angaben des BMBF regelmäßig zeigen. Mit<br />
Ausnahme von Brandenburg liegen die Ausgaben pro Studierendem in allen ostdeutschen Bundesländern teilweise deutlich<br />
über den <strong>Berlin</strong>er Ausgaben. Im Vergleich ist aber auch festzustellen, daß die anderen Stadtstaaten, Hamburg und Bremen,<br />
deutlich unter den <strong>Berlin</strong>er Ausgaben liegen. Da dort aber auch die Betreuungsrelation, also das Verhältnis von Professoren<br />
zu Studierenden deutlich besser ist, während dort deutlich mehr Studierende auf eine Verwaltungsstelle kommen, werden die<br />
sozialdemokratischen Mitglieder des Senats aufgefordert, zu prüfen, ob weitere Effizienzpotentiale in der Hochschulverwaltung<br />
realisiert werden können, die langfristig zu einer Erhöhung der Professorenstellen sowie einer Verbesserung der Betreuung<br />
der Studierenden und der Ausstattung der Bibliotheken genutzt werden können.<br />
84
Beschlussprotokoll<br />
Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> am 16./17. Mai 2003 Seite 85<br />
Der Landesparteitag der <strong>Berlin</strong>er <strong>SPD</strong> hat am 16. Mai 2003 folgende Nominierungen für das Europäische Parlament<br />
ausgesprochen<br />
Platz 1<br />
Es kandidiert Dagmar Roth-Behrendt<br />
Abgegebene Stimmen 237<br />
Davon gültig 237<br />
Ja 225<br />
Nein 7<br />
Enthaltungen 5<br />
Nachrücker Platz 1<br />
Es kandidiert Mark Rackles<br />
Abgegebene Stimmen 233<br />
Davon gültig 233<br />
Ja 158<br />
Nein 64<br />
Enthaltungen 11<br />
Platz 2<br />
Es kandidieren Hans Misselwitz und Nicole Rosin<br />
Abgegebene Stimmen 240<br />
Davon gültig 237<br />
Enthaltungen 5<br />
Auf die Kandidaten entfielen:<br />
Hans Misselwitz 103<br />
Nicole Rosin 129<br />
Nachrücker Platz 2 per Akklamation<br />
Hans Misselwitz wird einstimmig nominiert.<br />
<strong>Berlin</strong>, den 20.05.2003/MW<br />
85