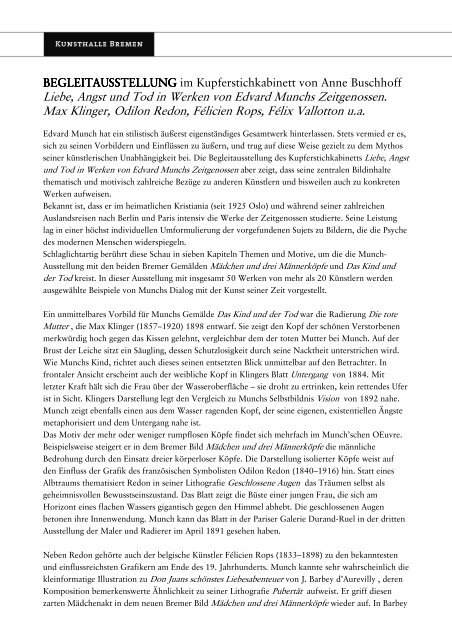Liebe, Angst und Tod in Werken von Edvard Munchs Zeitgenossen ...
Liebe, Angst und Tod in Werken von Edvard Munchs Zeitgenossen ...
Liebe, Angst und Tod in Werken von Edvard Munchs Zeitgenossen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BEGLEITAUSSTELLUNG BEGLEITAUSSTELLUNG im Kupferstichkab<strong>in</strong>ett <strong>von</strong> Anne Buschhoff<br />
<strong>Liebe</strong>, <strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> <strong>Werken</strong> <strong>von</strong> <strong>Edvard</strong> <strong>Munchs</strong> <strong>Zeitgenossen</strong>.<br />
Max Kl<strong>in</strong>ger, Odilon Redon, Félicien Rops, Félix Vallotton u.a.<br />
<strong>Edvard</strong> Munch hat e<strong>in</strong> stilistisch äußerst eigenständiges Gesamtwerk h<strong>in</strong>terlassen. Stets vermied er es,<br />
sich zu se<strong>in</strong>en Vorbildern <strong>und</strong> E<strong>in</strong>flüssen zu äußern, <strong>und</strong> trug auf diese Weise gezielt zu dem Mythos<br />
se<strong>in</strong>er künstlerischen Unabhängigkeit bei. Die Begleitausstellung des Kupferstichkab<strong>in</strong>etts <strong>Liebe</strong>, <strong>Angst</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Tod</strong> <strong>in</strong> <strong>Werken</strong> <strong>von</strong> <strong>Edvard</strong> <strong>Munchs</strong> <strong>Zeitgenossen</strong> aber zeigt, dass se<strong>in</strong>e zentralen Bild<strong>in</strong>halte<br />
thematisch <strong>und</strong> motivisch zahlreiche Bezüge zu anderen Künstlern <strong>und</strong> bisweilen auch zu konkreten<br />
<strong>Werken</strong> aufweisen.<br />
Bekannt ist, dass er im heimatlichen Kristiania (seit 1925 Oslo) <strong>und</strong> während se<strong>in</strong>er zahlreichen<br />
Auslandsreisen nach Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Paris <strong>in</strong>tensiv die Werke der <strong>Zeitgenossen</strong> studierte. Se<strong>in</strong>e Leistung<br />
lag <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er höchst <strong>in</strong>dividuellen Umformulierung der vorgef<strong>und</strong>enen Sujets zu Bildern, die die Psyche<br />
des modernen Menschen widerspiegeln.<br />
Schlaglichtartig berührt diese Schau <strong>in</strong> sieben Kapiteln Themen <strong>und</strong> Motive, um die die Munch-<br />
Ausstellung mit den beiden Bremer Gemälden Mädchen <strong>und</strong> drei Männerköpfe <strong>und</strong> Das K<strong>in</strong>d <strong>und</strong><br />
der <strong>Tod</strong> kreist. In dieser Ausstellung mit <strong>in</strong>sgesamt 50 <strong>Werken</strong> <strong>von</strong> mehr als 20 Künstlern werden<br />
ausgewählte Beispiele <strong>von</strong> <strong>Munchs</strong> Dialog mit der Kunst se<strong>in</strong>er Zeit vorgestellt.<br />
E<strong>in</strong> unmittelbares Vorbild für <strong>Munchs</strong> Gemälde Das K<strong>in</strong>d <strong>und</strong> der <strong>Tod</strong> war die Radierung Die tote<br />
Mutter , die Max Kl<strong>in</strong>ger (1857–1920) 1898 entwarf. Sie zeigt den Kopf der schönen Verstorbenen<br />
merkwürdig hoch gegen das Kissen gelehnt, vergleichbar dem der toten Mutter bei Munch. Auf der<br />
Brust der Leiche sitzt e<strong>in</strong> Säugl<strong>in</strong>g, dessen Schutzlosigkeit durch se<strong>in</strong>e Nacktheit unterstrichen wird.<br />
Wie <strong>Munchs</strong> K<strong>in</strong>d, richtet auch dieses se<strong>in</strong>en entsetzten Blick unmittelbar auf den Betrachter. In<br />
frontaler Ansicht ersche<strong>in</strong>t auch der weibliche Kopf <strong>in</strong> Kl<strong>in</strong>gers Blatt Untergang <strong>von</strong> 1884. Mit<br />
letzter Kraft hält sich die Frau über der Wasseroberfläche – sie droht zu ertr<strong>in</strong>ken, ke<strong>in</strong> rettendes Ufer<br />
ist <strong>in</strong> Sicht. Kl<strong>in</strong>gers Darstellung legt den Vergleich zu <strong>Munchs</strong> Selbstbildnis Vision <strong>von</strong> 1892 nahe.<br />
Munch zeigt ebenfalls e<strong>in</strong>en aus dem Wasser ragenden Kopf, der se<strong>in</strong>e eigenen, existentiellen Ängste<br />
metaphorisiert <strong>und</strong> dem Untergang nahe ist.<br />
Das Motiv der mehr oder weniger rumpflosen Köpfe f<strong>in</strong>det sich mehrfach im Munch’schen OEuvre.<br />
Beispielsweise steigert er <strong>in</strong> dem Bremer Bild Mädchen <strong>und</strong> drei Männerköpfe die männliche<br />
Bedrohung durch den E<strong>in</strong>satz dreier körperloser Köpfe. Die Darstellung isolierter Köpfe weist auf<br />
den E<strong>in</strong>fluss der Grafik des französischen Symbolisten Odilon Redon (1840–1916) h<strong>in</strong>. Statt e<strong>in</strong>es<br />
Albtraums thematisiert Redon <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Lithografie Geschlossene Augen das Träumen selbst als<br />
geheimnisvollen Bewusstse<strong>in</strong>szustand. Das Blatt zeigt die Büste e<strong>in</strong>er jungen Frau, die sich am<br />
Horizont e<strong>in</strong>es flachen Wassers gigantisch gegen den Himmel abhebt. Die geschlossenen Augen<br />
betonen ihre Innenwendung. Munch kann das Blatt <strong>in</strong> der Pariser Galerie Durand-Ruel <strong>in</strong> der dritten<br />
Ausstellung der Maler <strong>und</strong> Radierer im April 1891 gesehen haben.<br />
Neben Redon gehörte auch der belgische Künstler Félicien Rops (1833–1898) zu den bekanntesten<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>flussreichsten Grafikern am Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts. Munch kannte sehr wahrsche<strong>in</strong>lich die<br />
kle<strong>in</strong>formatige Illustration zu Don Juans schönstes <strong>Liebe</strong>sabenteuer <strong>von</strong> J. Barbey d’Aurevilly , deren<br />
Komposition bemerkenswerte Ähnlichkeit zu se<strong>in</strong>er Lithografie Pubertät aufweist. Er griff diesen<br />
zarten Mädchenakt <strong>in</strong> dem neuen Bremer Bild Mädchen <strong>und</strong> drei Männerköpfe wieder auf. In Barbey
d’Aurevillys Erzählung berichtet der Graf de Ravila <strong>von</strong> der Tochter e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>stigen Geliebten, die ihn<br />
mit sexueller Neugier beäugte <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es Tages gr<strong>und</strong>los fürchtete, <strong>von</strong> ihm schwanger zu se<strong>in</strong>,<br />
nachdem sie nach ihm auf demselben Fauteuil gesessen hatte. Rops zeigt die junge Frau im Akt,<br />
schattengleich h<strong>in</strong>terfangen <strong>von</strong> der Mantelfigur des Grafen. Der Mädchenakt <strong>in</strong> <strong>Munchs</strong> Pubertät<br />
sitzt erstarrt auf dem Bettrand, die Hände verschämt im Schoß haltend, während sich h<strong>in</strong>ter ihm e<strong>in</strong><br />
übermächtiger Schatten bedrohlich aufbäumt.<br />
<strong>Munchs</strong> Darstellungen der <strong>Liebe</strong>sschicksale s<strong>in</strong>d jedoch weit weniger erzählerisch ausgebreitet als bei<br />
se<strong>in</strong>en <strong>Zeitgenossen</strong>. Für das ambivalente Mite<strong>in</strong>ander der Geschlechter fand er seit den frühen<br />
1890er Jahren mit se<strong>in</strong>en zahlreichen Variationen des Kuss-Themas zu über<strong>in</strong>dividuellen S<strong>in</strong>nbildern.<br />
Die Gesichter <strong>von</strong> Mann <strong>und</strong> Frau s<strong>in</strong>d auf dem Gemälde Der Kuss <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander verschmolzen <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
ihrer Individualität aufgelöst. Die E<strong>in</strong>heit im <strong>Liebe</strong>sakt bekommt etwas Beklemmendes.<br />
In Nachfolge <strong>von</strong> Auguste Rod<strong>in</strong>s berühmter Skulptur <strong>von</strong> 1886 thematisierte auch der zu der<br />
Gruppe der Nabis gehörige Grafiker <strong>und</strong> Maler Félix Vallotton (1865–1925) die unglückliche Seite<br />
der <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> das trügerische Moment der körperlichen Verschmelzung. <strong>Munchs</strong> Kuss-Darstellung<br />
dürfte Vallotton bekannt gewesen se<strong>in</strong>, denn beide Künstler waren mit Julius Meier-Graefe<br />
befre<strong>und</strong>et – Meier-Graefe hatte 1894 se<strong>in</strong>e erste kunstkritische Arbeit über Munch verfasst <strong>und</strong> auch<br />
über Vallotton 1898 e<strong>in</strong>e Monografie geschrieben. Vallottons Darstellung zeigt e<strong>in</strong> eng<br />
umschlungenes, junges Paar im zärtlichen Mite<strong>in</strong>ander. Doch die Idylle täuscht <strong>und</strong> entpuppt sich als<br />
moralisch doppelbödig, wie der Titel dieses Blattes – Die Lüge – offenbart. Vallotton entwarf e<strong>in</strong>en<br />
ironischen Sittenspiegel des bürgerlichen Ehelebens. In dessen Mittelpunkt steht die Verführungskunst<br />
der Frau, die den materiellen Vorteil im Blick hat, den der Mann mit sich br<strong>in</strong>gt. Nach Erreichen<br />
ihres Ziels aber amüsiert sie sich anderweitig.<br />
Die vorgestellten Beispiele zeigen, wie stark <strong>Edvard</strong> Munch aus dem symbolistischen Bildrepertoire<br />
se<strong>in</strong>er Zeit schöpfte. Se<strong>in</strong>e Kunst entstand <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em komplizierten <strong>in</strong>tellektuellen Prozess, bei dem er<br />
<strong>von</strong> persönlichen Erlebnissen ausg<strong>in</strong>g, diese aber unter E<strong>in</strong>beziehung der zeitgenössischen Bildsprache<br />
zu über<strong>in</strong>dividuellen, dichten Bildern <strong>von</strong> elementaren Lebenskonflikten komprimierte. Munch schuf<br />
so e<strong>in</strong>en existentiellen Symbolismus. In ihrem s<strong>in</strong>nbildlichen Charakter ist se<strong>in</strong>e Kunst im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert verankert, <strong>in</strong> ihrer Motivation subjektiver Entäußerung bereitet sie den Weg <strong>in</strong> das 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Text: Anne Buschhoff/Kathar<strong>in</strong>a Groth<br />
Weitere Weitere Informationen:<br />
Informationen:<br />
Ansprechpartner<strong>in</strong> Ansprechpartner<strong>in</strong> für für kunsthistorische kunsthistorische Informationen<br />
Informationen<br />
Dr. Anne Buschhoff, Kurator<strong>in</strong> der Ausstellung<br />
Kunsthalle Bremen – T 0421-32908-270, buschhoff@kunsthalle-bremen.de<br />
Ansprechpartner<strong>in</strong> Ansprechpartner<strong>in</strong> für für Presse Presse- Presse <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Rebekka Maiwald, Leiter<strong>in</strong> Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Kunsthalle Bremen – T 0421-32908-380, presse@kunsthalle-bremen.de<br />
Text Text- Text <strong>und</strong> Bildmaterial<br />
Bildmaterial:<br />
Bildmaterial<br />
Texte <strong>und</strong> hochaufgelöstes Bildmaterial f<strong>in</strong>den Sie <strong>in</strong> unserem Presse-Downloadbereich unter<br />
www.kunsthalle-bremen.de/<strong>in</strong>formationen/presse/<br />
Benutzername: presse, Kennwort: Rutenberg