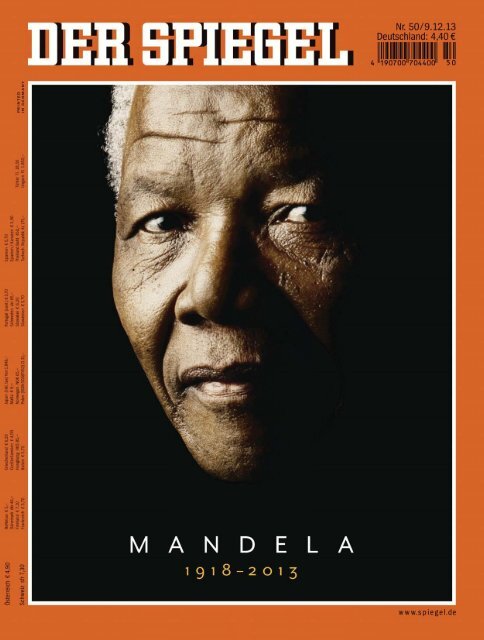Deutschland - Quick-Talk.com
Deutschland - Quick-Talk.com
Deutschland - Quick-Talk.com
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ANDREW LOUWRENS<br />
Hausmitteilung<br />
9. Dezember 2013 Betr.: Titel, FDP, „Dein SPIEGEL“<br />
Mitunter kommt es vor, dass Journalisten Politikern begegnen, die sie tief<br />
und nachhaltig beeindrucken: als Gesprächspartner – und als Mensch. Für<br />
Bartholomäus Grill, der Anfang 1993 als Korrespondent nach Johannesburg ging,<br />
um über den Umbruch in Südafrika zu berichten, war Nelson Mandela ein solcher<br />
Politiker. In den Wendejahren, als das Unrechtsregime der Apartheid unterging<br />
und die Demokratie geboren wurde, hat Grill den am vergangenen Donnerstag<br />
verstorbenen Mandela gleich mehrmals getroffen: bei dessen Auftritten als Friedens -<br />
stifter in gewaltgeplagten Town -<br />
ships, im Wahlkampf, im Parlament;<br />
bei Mandelas Geburtstagsparty.<br />
Höhepunkt war ein<br />
Interview mit Mandela, das<br />
Grill im September 1995 in<br />
Genadendal, Mandelas Residenz<br />
in Kapstadt, führte, damals<br />
noch für die Wochen -<br />
Grill, Mandela 1995 in Kapstadt<br />
zeitung „Die Zeit“. Mandela<br />
wollte gleich zu Beginn wissen,<br />
wie alt denn Adenauer gewesen<br />
sei, als er Kanzler wurde;<br />
es gab Skeptiker, die der Meinung waren, der damals 77-Jährige sei zu alt für das<br />
Amt des Staatspräsidenten. Er kenne niemanden, der dem Charme Mandelas nicht<br />
erlegen wäre, sagt Grill. „So einem Menschen zu begegnen ist ein großes Geschenk,<br />
das größte, das ich als Korrespondent erhalten habe“ (Seite 84).<br />
Weil sie nicht wusste, was sie bei der Bundestagswahl wählen sollte, befragte<br />
SPIEGEL-Redakteurin Barbara Hardinghaus im September den Wahl-O-Mat,<br />
eine Internet-Entscheidungshilfe für Unschlüssige. Eindeutige Antwort: die FDP. Harding -<br />
haus dachte an das Führungspersonal der FDP und beschloss, das Ergebnis zu ignorie -<br />
ren. Offenbar ging es anderen ähnlich, denn nach 64 Jahren flog die FDP erstmals aus<br />
dem Bundestag. Für den Wahltag hatte Hardinghaus sich mit dem bildungspolitischen<br />
Sprecher der FDP, Patrick Meinhardt, verabredet, sie wollte wissen, wie ein Leben<br />
aussieht, das nur aus Politik besteht. Das Wahlergebnis machte die geplante Recherche<br />
noch interessanter: Wie verkraften Politiker eine solche Niederlage? Hardinghaus<br />
hatte Glück. Meinhardt gab ihr die Gelegenheit, ihn in den folgenden Wochen zu<br />
begleiten, auch bei der Rückkehr in die badische Provinz. Sie erlebte einen leidenschaftlichen<br />
Politiker, der sich an ein Leben mit wenig Schlaf gewöhnt hatte, der<br />
beinahe täglich zwischen Baden-Württemberg und Berlin pendelte, der viele Ämter<br />
innehatte, der aber am Ende vor allem eines blieb: Berufspolitiker (Seite 54).<br />
Das Römische Reich erstreckte sich in seiner Blütezeit<br />
vom heutigen Irak bis zur schottischen Grenze, die<br />
alten Römer kannten bereits die Bratwurst, die Fuß boden -<br />
heizung und die Dusche. „Dein SPIEGEL“, das Nachrichten-Magazin<br />
für Kinder, beschreibt in der Titel geschichte<br />
den Glanz und die Macht des antiken Reiches – aber auch<br />
seinen Niedergang und das Leben der ganz normalen<br />
Bürger. Weiteres Thema im Heft: Wer plant Sendungen<br />
wie „Supertalent“ oder „DSDS“ – und weshalb machen<br />
die Leute, die dort gewinnen, fast nie Karriere? „Dein<br />
SPIEGEL“ erscheint an diesem Dienstag.<br />
Im Internet: www.spiegel.de<br />
DER SPIEGEL 50/2013 5
In diesem Heft<br />
Titel<br />
Nelson Mandela – eine Huldigung ................. 84<br />
Wie der ANC das Vermächtnis seines<br />
übergroßen Gründers ruiniert ........................ 90<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
Panorama: Olympische Spiele ohne Gauck /<br />
CDU-Politiker fordern mehr Basisbeteiligung /<br />
Marine hat Nachwuchssorgen ......................... 17<br />
Europa: Wie Kanzlerin Angela Merkel<br />
Oppositionspolitiker Vitali Klitschko zum<br />
starken Mann der Ukraine machen will ......... 22<br />
CSU: Im SPIEGEL-Gespräch beklagt Bayerns<br />
Ministerpräsident Horst Seehofer das schlechte<br />
Verhältnis von Politik und Medien ................. 26<br />
Verteidigung: Durch den Egoismus der<br />
Nationalstaaten gehen in der europäischen<br />
Rüstungspolitik Milliarden verloren ............... 30<br />
Union: Die Wandlung des hessischen<br />
Ministerpräsidenten Volker Bouffier .............. 34<br />
Stuttgart 21: E-Mails von Stefan Mappus<br />
geben Einblick in die Vorgeschichte des<br />
brutalen Schlossgarten-Einsatzes ................... 36<br />
Karrieren: Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel<br />
liebäugelt mit der Euro-kritischen Partei AfD ... 37<br />
Organvergabe: Im Prozess gegen einen<br />
Transplanteur sagt eine Patientin aus, deren<br />
Laborwerte der Arzt manipuliert haben soll ... 38<br />
Kommentar: Steht der Prozess gegen<br />
Christian Wulff kurz vor dem Ende? .............. 42<br />
Flüchtlinge: Ein neues Abkommen erlaubt<br />
es der EU, Asylbewerber aus<br />
aller Welt in die Türkei zu schicken ............... 43<br />
Arbeitsrecht: Ein Arbeitgeber hält<br />
eine Bewerberin für zu dick – steht ihr<br />
eine Entschädigung zu? .................................. 44<br />
Bildung: Der Lehrerprüfer Wulf Homeier<br />
über den Sinn von Leistungstests ................... 46<br />
Justiz: Personeller Notstand an den Gerichten 47<br />
Familien: Verliert ein Tönnies-Erbe wegen einer<br />
plagiierten Diplomarbeit seine Firmenanteile? 48<br />
Arbeitsmarkt: <strong>Deutschland</strong> scheitert beim<br />
Werben um gutausgebildete Migranten .......... 49<br />
Gesellschaft<br />
Szene: Maßanzüge für frierende Hühner / Wie<br />
Obdachlose das Adventsgeschäft nutzen ........ 52<br />
Eine Meldung und ihre Geschichte – eine Frau<br />
aus Stuttgart heiratet einen Unbekannten ...... 53<br />
Neuanfänge: Ein früherer FDP-Bundestags -<br />
abgeordneter versucht ein neues Leben ......... 54<br />
Ortstermin: In Altenburg tagt das<br />
Internationale Skatgericht .............................. 62<br />
Wirtschaft<br />
Trends: Investoren verkaufen Karstadt-Häuser /<br />
Lufthansa-Aufsichtsräte kritisieren Vorstand ... 64<br />
Finanzmärkte: Die Macht der Mega-Banken ... 66<br />
Regierungsberater Daniel Zimmer fordert<br />
schärferes Vorgehen gegen Finanzkartelle ..... 68<br />
Lobbyisten: Finanzaffäre beim<br />
CDU-nahen Wirtschaftsrat ............................. 72<br />
Autoindustrie: US-Geschäft von VW schwächelt 74<br />
Konsum: Renaissance der deutschen<br />
Luxus-Manufakturen ...................................... 76<br />
Finanzen: Die Schuldenallianz<br />
der Ministerpräsidenten ................................. 78<br />
Stadtplanung: Technologiekonzerne<br />
propagieren die voll vernetzte Metropole ...... 80<br />
Internet: Unternehmeraufstand gegen das<br />
Bewertungsportal Yelp ................................... 81<br />
Ausland<br />
Panorama: Großbritanniens Premier Cameron<br />
buckelt vor den Chinesen / Mexikos Drogenkartelle<br />
investieren in Geschäfte mit Erz ........... 82<br />
8<br />
ANDREW KRAVCHENKO / DPA<br />
Unter Kartellbrüdern Seite 66<br />
Ein Dutzend Investmentbanken manipuliert die Preise an den glo balen<br />
Finanzmärkten, Aufseher in den USA und Europa verhängen hohe Strafen.<br />
Für die Deutsche Bank und ihre Führung könnte sich das bitter rächen.<br />
DIETER MAYR / DER SPIEGEL<br />
Klitschko, Westerwelle<br />
Kampf um die Ukraine Seite 22<br />
Die letzte Runde im Ringen um Einflusszonen in Osteuropa hat Moskau<br />
gewonnen: Die Ukraine will sich vorerst der EU nicht annähern. Doch<br />
Angela Merkel gibt den Machtkampf nicht verloren. Mit deutscher Hilfe<br />
soll der Boxer Vitali Klitschko das Land Richtung Westen führen ................. 22<br />
Wie bei der Revolution 2004 protestieren wieder Hunderttausende<br />
in Kiew. Sie fordern Neuwahlen und einen Westkurs. Doch die Regierung<br />
bleibt hart – und droht mit Gewalt ............................................................... 94<br />
Polens Ex-Präsident Aleksander Kwaśniewski hat im Auftrag der EU<br />
mit der Ukraine über eine Assoziierung verhandelt. Im SPIEGEL-Gespräch<br />
kritisiert er, Brüssel habe Russlands Widerstand unterschätzt ........................ 96<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Der große<br />
Stille Seite 154<br />
Der Schauspieler Matthias<br />
Brandt ist ein Spätzünder.<br />
Als ihn das Fernsehen entdeckte,<br />
war er bereits Anfang<br />
vierzig. Zum TV-Star<br />
wurde Brandt als Kommissar<br />
im „Polizeiruf 110“, wo er<br />
durch sein minimalistisches<br />
Spiel beeindruckt. Im SPIE-<br />
GEL-Gespräch erzählt er<br />
von seinem Blick fürs Skurrile<br />
und erklärt, warum ihm<br />
Verlierer schon immer näher<br />
waren als Gewinner.
Die späten Mütter Seite 148<br />
Frauen versuchen, ihre biologische Uhr zurückzudrehen, indem sie Eizellen<br />
für eine spätere künstliche Befruchtung einfrieren lassen. Doch<br />
bis zu welchem Alter ist eine Schwangerschaft medizinisch vertretbar?<br />
Hans Küng und der Papst Seite 120<br />
Er kämpfte lange gegen den Reformstau im Vatikan und verlor seine Lehr -<br />
erlaubnis. Hans Küng spürt jedoch einen „katholischen Frühling“, seit<br />
Franziskus herrscht. Der Papst habe einen „Paradigmenwechsel“ vollzogen.<br />
Das Projekt<br />
Rache Seite 116<br />
Die brutale Vergewaltigung<br />
einer jungen Frau in einem<br />
Bus in Delhi vor einem<br />
Jahr zeigte der Welt: Frauen<br />
in Indien sind besonders<br />
oft der Gewalt und der Verachtung<br />
von Männern<br />
aus gesetzt. Ein indischer<br />
Filmproduzent bringt jetzt<br />
einen Film ins Kino, der<br />
das Land aufrütteln soll.<br />
Sein Titel: „Kill the Rapist?“<br />
Soll man Vergewaltiger<br />
töten?<br />
Trauerplakat in Südafrika<br />
Ein großes Leben Seite 84<br />
Weltweit trauern Bewunderer um Nelson Mandela, der einst die Apartheid<br />
besiegte und das moderne Südafrika schuf. Der Mann, den sie daheim<br />
„Madiba“ nannten, hatte ein großes Leben – mit Triumphen und Tragödien.<br />
IROCK<br />
FOTO24 / GETTY IMAGES<br />
Ukraine: Machtprobe in Kiew ......................... 94<br />
SPIEGEL-Gespräch mit Polens Ex-Präsident<br />
Aleksander Kwaśniewski über die Entfremdung<br />
zwischen der Ukraine und der EU ................. 96<br />
Thailand: Kampf um die Zukunft des Landes 100<br />
USA: New York plant für den Klimawandel,<br />
North Carolina ignoriert ihn per Gesetz ....... 104<br />
Global Village: Warum Radio Vatikan mit<br />
Papst Franziskus mehr Arbeit hat ................. 110<br />
Kultur<br />
Szene: „Liebes Leben“ – der neue Erzählband<br />
von Nobelpreisträgerin Alice Munro / Das<br />
Lebenswerk von Liedermacher Reinhard Mey<br />
wird mit einer üppigen CD-Box gefeiert ....... 114<br />
Kino: Ein Film über Vergewaltiger<br />
soll Indien aufrütteln .................................... 116<br />
Religion: SPIEGEL-Gespräch mit dem<br />
Theologen Hans Küng über die Revolution<br />
im Vatikan und sein eigenes nahes Ende ...... 120<br />
Bestseller ..................................................... 124<br />
Essay: Warum die Große Koalition so<br />
gut zu <strong>Deutschland</strong> passt – und trotzdem<br />
problematisch ist ........................................... 126<br />
Theater: David Grossmans bewegende<br />
Totenklage „Aus der Zeit fallen“ in Berlin ... 130<br />
Pop-Kritik: Das großartige Debüt des<br />
Berliner Rappers Grim104 ............................ 132<br />
Sport<br />
Szene: Kameruns Nationalcoach Volker Finke<br />
über die WM-Auslosung ............................... 135<br />
Olympia: Der schwule Eissprinter Blake<br />
Skjellerup will bei den Winterspielen in Sotschi<br />
die russische Regierung provozieren ............ 136<br />
Fußball: Pep Guardiola verändert das deutsche<br />
Verständnis vom Spiel .................................. 138<br />
Wissenschaft · Technik<br />
Prisma: E-Zigaretten verstärken Nikotinsucht /<br />
Forscher unterstützen Geschlechterklischees 140<br />
Fischerei: Warum es Scholle, Dorsch und<br />
Hering wieder überraschend gutgeht ............ 142<br />
Ernährung: Jodsalz macht intelligent ............ 146<br />
Medizin: Ist es vertretbar, Eizellen für eine<br />
späte Schwangerschaft einfrieren zu lassen? 148<br />
Bestattungstechnik: Kampf der Krematorien 151<br />
Medien<br />
Trends: Stefan Aust wird „Welt“-Herausgeber /<br />
TV-Produzenten fordern Gebührenanteil ..... 153<br />
Schauspieler: SPIEGEL-Gespräch mit Matthias<br />
Brandt über die Kunst des Scheiterns ........... 154<br />
Presse: Fragwürdige Ermittlungen<br />
gegen Münchner TV-Redakteur .................... 157<br />
Briefe .............................................................. 10<br />
Impressum, Leserservice .............................. 158<br />
Register ........................................................ 160<br />
Personalien ................................................... 162<br />
Hohlspiegel / Rückspiegel ............................. 164<br />
Titelbild: Foto Greg Bartley/Camera Press /Picture Press<br />
Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/briefkasten<br />
Absolute Spitze<br />
<strong>Deutschland</strong>s Studenten<br />
haben hervorragende<br />
Zukunftschancen – und<br />
sind trotzdem unentspannt.<br />
Außerdem im<br />
UniSPIEGEL: der harte<br />
Kampf um die Master-<br />
Plätze.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
9
SPIEGEL-Titel 49/2013<br />
Nr. 49/2013, Das Superhirn – Neuro-<br />
Ingenieure wollen das Denken optimieren<br />
Das Ende der Freiheit<br />
Auch wenn ich als jemand, der Neuro -<br />
Engineering macht, die Notwendigkeit<br />
sehe, das Thema stark aufzubereiten –<br />
es hätte der Sache sicherlich gedient,<br />
auch die niederen Realitäten auf dem<br />
Weg zum Patienten zu erwähnen. Denn<br />
wie Edison zugeschrieben wird: „Eine<br />
Erfindung braucht 10 Prozent Inspiration<br />
und 90 Prozent Transpiration.“ Also sind<br />
Visionäre aus dem US-System sicher<br />
wichtig – die wahre Arbeit wird aber gerade<br />
auch hier gemacht, zum Beispiel an<br />
unserem Exzellenz-Cluster BrainLinks-<br />
BrainTools.<br />
PROF. ULRICH HOFMANN, FREIBURG IM BREISGAU<br />
UNIVERSITÄT FREIBURG<br />
Die Evolution ermöglichte durch zufällige<br />
genetische Veränderung die Entwicklung<br />
von intelligenten, weitgehend selbständig<br />
und freilebenden Lebewesen, den Menschen.<br />
Selbst der liebe Gott lässt den Menschen<br />
die Freiheit, sich gegen seine Ziele<br />
zu entscheiden. Jetzt streben die Hirn -<br />
ingenieure die vollkommene Steuerung,<br />
Vereinheitlichung und damit Überwachung<br />
aller intelligenten Lebewesen an.<br />
Das Ende der Freiheit ist erreicht. Kein<br />
Wunder, dass die USA ein so großes Interesse<br />
an der Vermessung des Gehirns<br />
haben.<br />
MARTIN WILMS, HAMBURG<br />
Ihr Artikel ruft nicht nur ein gefühlsmäßiges<br />
Unbehagen bei mir hervor, sondern<br />
entbehrt zudem auch nicht einer gewissen<br />
Ambivalenz. Sollte die Hirnforschung<br />
sich so rasant weiterentwickeln, wie das<br />
gegenwärtig der Fall zu sein scheint, würde<br />
die inflationäre Flut neuer TV-Quizsendungen<br />
wohl gestoppt werden können.<br />
Andererseits könnte ein Gehirn, das<br />
vor seiner Zerstörung so brillant funktioniert<br />
hat wie das von John F. Kennedy,<br />
repariert und vielleicht sogar noch etwas<br />
aufpoliert werden.<br />
REINHARD METZGER, ROTTENBURG AM NECKAR<br />
Briefe<br />
„Man fragt sich unwillkürlich, ob bei den<br />
vorgestellten Forschern überhaupt<br />
ein Bewusstsein herrscht, welche Zukunft<br />
sie gestalten: eine Realität von<br />
Huxleys schöner neuer Welt, so grau,<br />
gesichtslos und kollektiv, dass den<br />
unabhängigen Menschen das Grauen ereilt.“<br />
NATHALIE REPENNING, SCHENEFELD (SCHL.-HOLST.)<br />
Dereinst, davon gibt sich Miguel Nicolelis<br />
überzeugt, würden die Gehirne zu einem<br />
mit Bewusstsein begabten Netz zusammenwachsen.<br />
Dieses Metabewusstsein<br />
der Menschheit, das Nicolelis über Technik<br />
erreichen will, existiert doch längst.<br />
Wir nennen es Kultur. Allerdings bietet<br />
diese auch einen Filter, der durch den<br />
Lauf der Zeit und die Fähigkeit von Individuen,<br />
unabhängig zu denken, Sinn von<br />
Unsinn zu trennen vermag. Wir behalten,<br />
was sich für uns als wichtig erwiesen hat,<br />
und der Rest versinkt – zu Recht – in<br />
entropischem Rauschen.<br />
TITUS EICHENBERGER, BEINWIL AM SEE (SCHWEIZ)<br />
Aufnahme einer Hirndurchleuchtung<br />
Das wirklich Besorgniserregende ist weniger<br />
das keck hingemalte Szenarium als<br />
vielmehr das Maß an Naivität, mit der es<br />
von den Prothesengöttern vorgetragen<br />
wird. Doch auch diese können kaum so<br />
dumm sein, um ihren Heilsverkündungen<br />
die finsteren Kehrseiten abzusprechen:<br />
Manipulation und Überwachung.<br />
ALFRED PASCHEK, KIEL<br />
Auch wenn die Gesamtarchitektur des<br />
menschlichen Gehirns noch weitgehend<br />
eine Terra incognita ist, so dürfte es doch<br />
inzwischen als hinreichend bewiesen gelten,<br />
dass für die Funktion der Neuronen<br />
und ihrer Logik eine unsterbliche Seele<br />
als geistiger Träger absolut entbehrlich ist.<br />
Sollten die Religionen nicht allmählich<br />
daraus die Konsequenzen ziehen?<br />
KLAUS FISCHER, DITZINGEN (BAD.-WÜRTT.)<br />
UGR<br />
Nr. 48/2013, Bernhard Schlink, Bestsellerautor<br />
und SPD-Mitglied, warnt seine<br />
Partei vor der Koalition mit der Union<br />
Empfehlung zum Selbstmord<br />
Schlink irrt in seiner Annahme, es gebe<br />
eine linke Mehrheit. Es gibt sie nicht in<br />
der Bevölkerung, bei der Wahl kamen<br />
allein Union, FDP und AfD auf klar über<br />
50 Prozent der Stimmen. Es gibt sie auch<br />
nicht im Bundestag, denn aufgrund des<br />
knappen Vorsprungs an Mandaten müssten<br />
sich stramme Antikapitalisten der<br />
Linken mit Seeheimern der SPD und<br />
bürgerlichen Grünen verständigen. Diese<br />
Distanz ist ungleich größer als diejenige<br />
zwischen den Polen von Union und SPD.<br />
MALTE GYLLENSVÄRD, HAMBURG<br />
Eine überzeugende Analyse – aber leider<br />
nur bis zur Beantwortung der entscheidenden<br />
Frage. Mit einer dünnen Mehrheit und<br />
den bekannten Akteuren in der Linkspartei<br />
ist eine rot-rot-grüne Koalition heute<br />
eben doch ausgeschlossen. Da fehlt Schlink<br />
wohl die praktische Politikerfahrung.<br />
HARALD RENTSCH, LÜBECK<br />
Schlink empfiehlt meiner SPD den Selbstmord.<br />
Ein aus dem Hut zu zaubernder rotrot-grüner<br />
Kanzlerkandidat würde in den<br />
geheimen Wahlgängen scheitern.<br />
ANDREAS KNIPPING, EICHENAU (BAYERN)<br />
Wer hier einem Irrtum unterliegt, ist<br />
Schlink. Große Aufgaben wie Energiewende,<br />
soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn<br />
und mehr erfordern die Zusammenarbeit<br />
der beiden Volksparteien.<br />
NIKOLAUS KOLLIN, MÜNCHEN<br />
Wenn die Führungen beider großer Fraktionen<br />
bereits auf dem Weg sind, im Interesse<br />
<strong>Deutschland</strong>s einen annehmbaren<br />
Kompromiss zu vereinbaren, können Sie<br />
doch nicht solch einem Querulanten die<br />
politische Bühne bereiten!<br />
HEIKO SCHILLING, HALLE (SACHS.-ANH.)<br />
Lieber Genosse Schlink, dein Plädoyer für<br />
eine rot-rot-grüne-Koalition ist wenig<br />
überzeugend. Einmal davon abgesehen,<br />
dass wir – völlig zu Recht – diese Koalition<br />
vor der Wahl ausgeschlossen haben, würde<br />
es beim besten Willen inhaltlich nicht<br />
reichen. Vom Rückhalt in der Bevölkerung<br />
ganz zu schweigen. Völlig unlogisch erscheint<br />
mir dein Einwand, dass wir bei<br />
Eintritt in eine GroKo bei der nächsten<br />
Bundestagswahl geradezu zwangsläufig<br />
mit einer Niederlage zu rechnen hätten.<br />
Das gilt doch nur für den Fall, dass „unsere<br />
Minister“ und „wir“ es nicht können. Wie<br />
wir es uns dann allerdings zutrauen sollten,<br />
einen bunten Haufen von Dunkelrot bis<br />
Hellgrün zu vernünftigem Regierungshandeln<br />
zu führen, bleibt dein Geheimnis.<br />
WOLFGANG ROSE, WEISSACH (BAD.-WÜRTT.)<br />
10<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Briefe<br />
Grundschülerin bei Schreibübung<br />
Nr. 48/2013, Warum viele Lehrer Grundschülern<br />
die Orthografie nicht mehr beibringen<br />
„Bund sind schon die Wälder“<br />
Was die Rechtschreibleistungen der angehenden<br />
Lehrer betrifft, bin auch ich<br />
manchmal entsetzt. Aber dies vor allem<br />
auf die verteufelte Methode zurückzuführen,<br />
halte ich für grob fahrlässig. Als Lehrerin<br />
weiß ich: Seit Jahren schon verliert<br />
die Rechtschreibung in den Lehrplänen<br />
an Bedeutung. Als Lehrbeauftragte an der<br />
Uni habe ich den Eindruck: Immer mehr<br />
Lehramtsstudenten sind dafür nicht geeignet.<br />
Das beginnt bei der unzureichenden<br />
Rechtschreibung und Zeichensetzung und<br />
endet auch bei den mangelnden sozialen<br />
und kommunikativen Fähigkeiten noch<br />
nicht. Es sind eben oft nicht die Besten,<br />
die in der Schule landen. Wir müssen dafür<br />
werben, dass sich das ändert.<br />
KARIN HEYMANN, WERTHER (NRW)<br />
Über Jahre habe ich beobachtet, wie viel<br />
Freude, Motivation und Kreativität durch<br />
die Methode „Lesen durch Schreiben“ gefördert<br />
werden kann. Und der individuelle<br />
Lernprozess, auf dessen Notwendigkeit<br />
heute mehr denn je hingewiesen wird,<br />
steht dabei im Zentrum. Dass die „Erwachsenensprache“<br />
beim Lesen der „Kindersprache“<br />
vorzuziehen ist, erkennen<br />
die Kleinen schnell, und sie sind umso<br />
mehr motiviert, Erstere zu lernen.<br />
SIGRID ARNDT, BERLIN<br />
Als Hausmeister einer Grundschule fand<br />
ich die Tafelnotiz einer Junglehrerin: „Zu<br />
Freitag Herbstlied üben: ,Bund sind schon<br />
die Wälder.‘“ Vor Entsetzen wäre mir bald<br />
mein Schlüsselbunt runtergefallen!<br />
GEORG MALKOWSKY, BOCKENEM (NIEDERS.)<br />
Wir Schul- und Lernpsychologen warnen<br />
schon lange vor den Folgen. Als ich einst<br />
den Autor der unseligen Mode, Herrn<br />
Reichen, auf einer Fortbildung fragte, wie<br />
er denn Kindern die Rechtschreibung der<br />
nichtlautgetreuen Worte (über 50 Prozent)<br />
vermitteln würde, sagte er tatsächlich,<br />
dass er sich damit nicht unbeliebt<br />
machen möchte. Die Kinder sollten dann<br />
halt mit einem Rechtschreibprogramm<br />
auf dem PC üben. So kann doch Chancen -<br />
gleichheit nicht hergestellt werden!<br />
DR. BRIGITTE THEWALT, ULM<br />
UTE GRABOWSKY<br />
Nr. 48/2013, Unfallursache Handy<br />
am Steuer<br />
Augen verbinden!<br />
Zehn Minuten an einer vielbefahrenen<br />
Straße reichen aus, um zu sehen, dass in<br />
sechs von zehn Autos der Fahrer ein<br />
Smartphone benutzt. Jedes Fahrzeug<br />
müsste so ausgestattet sein, dass Telefonate<br />
und andere Online-Verbindungen<br />
bei laufendem Motor nicht möglich sind.<br />
FRIEDHELM NEYER, SALACH (BAD.-WÜRTT.)<br />
Der Artikel hat mir die Augen geöffnet.<br />
Das Display bleibt ab sofort dunkel und<br />
der Blick auf den Verkehr gerichtet. Vielleicht<br />
sollte jeder, der sein Handy während<br />
der Fahrt benutzt, einen Test machen:<br />
Augen verbinden und dann zwei<br />
Sekunden fahren.<br />
DETLEF GARBERS, SINSHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />
Als Motorradfahrer graust es mir vor Leuten,<br />
die ihre Aufmerksamkeit dem Smart -<br />
phone widmen und nicht in der Lage sind,<br />
dieses auch mal zu ignorieren. Nach dem<br />
Lesen dieses Artikels werde ich das Motor -<br />
radfahren wohl einstellen.<br />
MICHAEL OWART, SALZHAUSEN (NIEDERS.)<br />
Nr. 48/2013, Über den schönen Traum von<br />
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
Vor die Wand gefahren<br />
Sie bezeichnen Hausarbeiten als „sinnlose<br />
Tätigkeiten“. Eine Gesellschaft, die<br />
Nachhaltigkeit fordert, muss Hausarbeiten<br />
deutlich aufwerten – und sie zeitlich<br />
und finanziell auch angemessen ins Leben<br />
einplanen. Sonst verwahrlost sie endgültig<br />
unter einem Berg an Papptellern,<br />
Fast Food und Einwegunterhosen.<br />
DR. GABRIELA GÖTZ, NÜRNBERG<br />
Trotz guter Kinderbetreuung und Netzwerk<br />
hatte ich als berufstätige Mutter ein<br />
Burnout. Jeden Freiraum wollte ich mit<br />
Projekten füllen. Berauscht vom eigenen<br />
Ego und der Bewunderung anderer bin ich<br />
voll vor die Wand gefahren. Die Politik<br />
soll nicht aus ihrer Verantwortung ent -<br />
lassen werden, aber sie ist nur ein Teil der<br />
Lösung. Ein anderer ist, sich auf das<br />
Wesentliche zu konzentrieren.<br />
KATHRIN RITTER, SCHÖNEICHE (BRANDENB.)<br />
Ein Tipp: Ansprüche runterfahren, nicht<br />
perfekt sein und auch Dienstleister nutzen.<br />
Man muss vieles nicht; nicht täglich putzen,<br />
Kinder überbehüten et cetera. Dann<br />
fällt es auch leichter, den Dingen Priorität<br />
zu geben, die wirklich wichtig sind.<br />
CARLA GROSS, LEIPZIG<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />
Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />
zu veröffentlichen. Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />
DER SPIEGEL 50/2013 13
Panorama<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
CDU<br />
Breitere Basis<br />
Als Reaktion auf den Mitgliederentscheid<br />
der SPD zum Koalitionsvertrag<br />
drängen nun auch führende<br />
CDU-Politiker darauf, die eigene<br />
Parteibasis künftig stärker einzubinden.<br />
EU-Kommissar Günther<br />
Oettinger, der auch im CDU-Präsidium<br />
sitzt, bringt sogar einen Mitgliederentscheid<br />
ins Gespräch, sollte<br />
die Union einmal ein Bündnis<br />
mit den Grünen im Bund eingehen<br />
wollen. Zwar könne man beim Koalitionsvertrag<br />
mit der SPD auf ein<br />
Basisvotum verzichten, da ein solches<br />
Bündnis den CDU-Mitgliedern<br />
vertraut sei. „Womöglich ist das<br />
anders, wenn es einmal um eine<br />
schwarz-grüne Koalition geht“, so<br />
Oettinger. Der stellvertretende Parteichef<br />
Thomas Strobl empfahl,<br />
über das nächste Wahlprogramm<br />
auf einem Parteitag abzustimmen.<br />
„Ich bin der Meinung, dass wir das<br />
auf eine breitere Basis stellen sollten“,<br />
sagte er. Unterstützung erhält<br />
er vom Chef der Unions-Mittelstandsvereinigung,<br />
Carsten Linnemann:<br />
„Wir halten jedes Jahr Bundesparteitage<br />
ab, doch ausgerechnet<br />
im Wahljahr haben wir darauf<br />
verzichtet. Damit haben wir es versäumt,<br />
die konkreten Inhalte unseres<br />
Wahlprogramms gemeinsam mit<br />
der breiten Parteibasis abzustimmen.“<br />
Die CDU-Führung will den<br />
Koalitionsvertrag am Montag auf<br />
einem kleinen Parteitag absegnen<br />
lassen.<br />
MIS / IMAGO<br />
Gauck (M., 3. v. r.) bei den Olympischen Sommerspielen in London 2012<br />
Oettinger<br />
JULIEN WARNAND / DPA<br />
OLYMPISCHE SPIELE<br />
Gauck boykottiert Sotschi<br />
Bundespräsident Joachim Gauck wird<br />
nicht zu den Olympischen Winterspielen<br />
nach Sotschi reisen. Dies teilte das<br />
Bundespräsidialamt der russischen Regierung<br />
in der vergangenen Woche mit.<br />
Die Absage ist als Kritik an den Menschenrechtsverletzungen<br />
und der<br />
Drangsalierung der Opposition in Russland<br />
zu verstehen. Die Olympischen<br />
Spiele und die Paralympics in London<br />
im Sommer 2012 hatte Gauck besucht.<br />
Vor den Winterspielen in Sotschi, die<br />
im Februar 2014 stattfinden, protestieren<br />
zahlreiche Sportler gegen ein Gesetz,<br />
das die Duma im Juni verabschiedet<br />
hatte. Es stellt die „Propaganda“ für<br />
Homosexualität gegenüber Minder -<br />
jährigen unter Strafe. Gauck ist daran<br />
gelegen, dass seine Absage nicht als<br />
Geringschätzung der Athleten gedeutet<br />
werden kann: Er will die deutschen<br />
Olympia-Teilnehmer am 24. Februar bei<br />
ihrer Rückkehr in München empfangen.<br />
Der Bundespräsident hat Russland seit<br />
seinem Amtsantritt im März 2012 noch<br />
keinen offiziellen Besuch abgestattet;<br />
mehrmals kritisierte er rechtsstaatliche<br />
Defizite sowie eine Behinderung kritischer<br />
Medien in dem Land. Ein für Juni<br />
2012 geplantes Treffen mit Gauck ließ<br />
Präsident Wladimir Putin platzen, angeblich<br />
aus Termingründen.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 17
KOALITIONSVERTRAG<br />
Mindestlohn – für fast alle<br />
Auszubildende in Leipzig<br />
Die Einigung der angehenden Koali -<br />
tion auf einen flächendeckenden Mindestlohn<br />
verunsichert die Wirtschaft.<br />
So wollen Verbandsvertreter geklärt<br />
wissen, ob die geplante Lohnuntergrenze<br />
von 8,50 Euro auch für Auszubildende<br />
gilt. Union und SPD hatten<br />
sich in der zuständigen Arbeitsgruppe<br />
ursprünglich auf einen Passus verständigt,<br />
nach dem der Mindestlohn nicht<br />
an Lehrlinge gezahlt werden soll.<br />
Diesen Absatz hatten sie aber aus<br />
der letzten Fassung des Koali -<br />
tionsvertrages gestrichen. „Die<br />
Unternehmen planen derzeit<br />
schon das nächste Ausbildungsjahr<br />
und brauchen deshalb schnell<br />
entsprechende Rechtssicherheit“,<br />
sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer<br />
des Handelsverbandes<br />
HDE. Bislang können sich die<br />
Unternehmen nur auf die Aussage<br />
einzelner Abgeordneter von Union<br />
und SPD berufen. Nach deren<br />
Interpretation sollten Lehrlinge<br />
von der Regelung ausgenommen<br />
werden. Umstritten ist in der<br />
Koali tion, ob es weitere Ausnahmen<br />
für Jugendliche geben wird.<br />
„Es ist beispielsweise eine Überlegung<br />
wert, ob der Mindestlohn<br />
auch für unter 25-Jährige gelten soll“,<br />
sagt Peter Weiß, der Vorsitzende der<br />
Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-<br />
Fraktion. „Alle Ausnahmen, die der<br />
Mindestlohn nötig macht, müssen wir<br />
im Gesetzgebungsverfahren klären.“<br />
Daher schreibe der Koalitionsvertrag<br />
fest, dass das Gesetz gemeinsam mit<br />
Arbeitgebern und Gewerkschaften erarbeitet<br />
werden und mögliche Probleme<br />
berücksichtigen soll.<br />
SEBASTIAN WILLNOW / DPA<br />
In der vergangenen Woche erhielten widerspenstige Sozialdemokraten<br />
Anrufe von einer Nummer der Berliner<br />
Parteizentrale. Sie wurden aufgefordert, ihren Widerstand<br />
gegen die Große Koalition aufzugeben und einfach<br />
mal beherzt ja zu sagen – und sei’s zum ersten Mal. Andernfalls,<br />
drohte der Anrufer, werde es nichts mit einer Karriere<br />
in der SPD. Offenbar ist die SPD-Führung in diesem Falle<br />
unschuldig. Nachdem sich ein angerufener<br />
Genosse beschwert und Generalsekretärin<br />
Andrea Nahles die Polizei eingeschaltet<br />
hatte, übernahm ein gewisses „Kommando<br />
Gerhard Schröder“ in einem Bekennerschreiben<br />
die Verantwortung für die Aktion.<br />
Das macht die Sache interessant.<br />
Natürlich ist die Idee von „Kommandos“<br />
in der deutschen Geschichte mit den Jahren<br />
ein wenig in Verruf geraten, und natürlich<br />
klingt es erst mal fies, wenn idealistische<br />
Jusos oder andere von inneren Überzeugungen<br />
gehemmte Sozialdemokraten telefonisch<br />
unter Druck gesetzt werden. Die<br />
Grundidee aber hat Charme. Beherzt fortgeführt,<br />
könnte sie helfen, dieser aufmüpfigen<br />
Vereinigung nach 150 Jahren innerparteilicher<br />
Meinungsfreiheit endlich so etwas wie Disziplin zu<br />
verpassen. Es kann ja nicht angehen, dass Parteimitglieder<br />
ihrer Führung ständig die Gefolgschaft verweigern, nur weil<br />
sie eine andere Meinung haben. Die Mitglieder von CDU<br />
und CSU haben das längst begriffen und verzichten auf solchen<br />
Mumpitz. Der deutsche Wähler weiß das zu schätzen.<br />
Das „Kommando Gerhard Schröder“ könnte ein Anfang<br />
TREIBHAUS BERLIN<br />
Kommando<br />
Müntefering<br />
sein. Der Name ist jedenfalls gut gewählt. Kaum jemand hat<br />
unter der Widerspenstigkeit des gemeinen Genossen stärker<br />
gelitten als der frühere Kanzler, dessen Agenda-Reformen<br />
viele Sozialdemokraten bis heute die Gefolgschaft verweigern.<br />
Das Kommando kämpft somit auch für die Befreiung<br />
der SPD von ihrem schlechten Gewissen, was ebenfalls verdienstvoll<br />
ist, denn ohne Gewissen lebt es sich leichter.<br />
Vermutlich aber ist ein einzelnes Kommando<br />
zu wenig, um echte Genossen endlich<br />
zu Vernunft, Disziplin und marktkonformen<br />
Überzeugungen zu verleiten. Es<br />
brauchte mehr Drohanrufe, es brauchte<br />
beherzte Nachahmer. Denkbar wäre ein<br />
„Kommando Wolfgang Clement“ mit der<br />
Forderung, endlich den Widerstand gegen<br />
prekäre Beschäftigungsverhältnisse aufzugeben,<br />
getreu dem alten Clement-Motto:<br />
Mehr Bangladesch wagen! Am Ende des<br />
Telefonats dürfte der Hinweis nicht fehlen,<br />
dass Clement jederzeit wieder in die SPD<br />
eintreten könne.<br />
Hilfreich wäre zudem ein „Kommando<br />
Franz Müntefering“ mit dem Auftrag, den<br />
Widerstand gegen eine demografiekonforme<br />
Rentenpolitik zu brechen und die Rente mit 76 salonfähig<br />
zu machen. Das Bekennerschreiben ließe sich stilecht mit<br />
dem Modell von Münteferings alter Reiseschreibmaschine<br />
tippen. Als letzte Eskalationsstufe könnte dann das „Kommando<br />
Peer Steinbrück“ aktiv werden. Dessen Drohung würde<br />
jeden Genossen zur Räson bringen: eine erneute Kanzlerkandidatur<br />
des Namensgebers. Markus Feldenkirchen<br />
18<br />
DER SPIEGEL 50/2013
VERTEIDIGUNG<br />
Marine fehlt Nachwuchs<br />
Die Seestreitkräfte der Bundeswehr<br />
müssen auch in den kommenden Jahren<br />
mit Nachwuchsproblemen rechnen.<br />
„Die Personallage der Marine<br />
wird auch in der mittelfristigen Perspektive<br />
(bis 2017) voraussichtlich<br />
durch eine Unterdeckung bestimmt<br />
bleiben“, so ein Sprecher der Marine.<br />
Im Jahr 2013 fehlen rund 1000 bis 1500<br />
Soldaten. Besonders groß sei der Mangel<br />
bei den Fachunteroffizieren, speziell<br />
in den technisch orientierten<br />
Verwendungen. Damit setzt sich das<br />
Problem der letzten Jahre fort. In der<br />
Vergangenheit habe die Marine „zwischen<br />
75 und 90 Prozent“ des Bedarfs<br />
decken können, so der Sprecher. Der<br />
Marine-Inspekteur Axel Schimpf hatte<br />
vorige Woche auf einem Sicherheitskongress<br />
in Berlin von seinen ernst -<br />
haften Sorgen berichtet. Die Lage sei<br />
so schlecht, dass es bei weitem nicht<br />
mehr ausreiche, in den nördlichen<br />
Bundesländern nach Personal zu<br />
suchen. Besserung soll die „Personal -<br />
offensive Marine“ bringen, die in diesem<br />
Jahr gestartet wurde.<br />
Nachbarländern*<br />
* OECD-Durchschnitt: ca. 500<br />
2003 2006 2009 2012<br />
538<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
Ergebnis der Pisa-Studie<br />
im Fach Mathematik<br />
in <strong>Deutschland</strong> und den<br />
529<br />
527<br />
516<br />
514<br />
511<br />
506<br />
503<br />
493<br />
490<br />
keine<br />
Angabe<br />
531<br />
523<br />
518<br />
515<br />
514<br />
Schweiz<br />
Niederlande<br />
Polen<br />
Belgien<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
506 Österreich<br />
500<br />
499<br />
495<br />
Quelle: OECD<br />
Dänemark<br />
Tschechien<br />
Frankreich<br />
490 Luxemburg<br />
Matrosen auf dem Marine-Schulschiff „Gorch Fock“<br />
MAURIZIO GAMBARINI / DPA<br />
PISA<br />
Abgucken, aber richtig<br />
Man kennt das aus der Schule: Wenn’s<br />
nicht klappt mit der Mathe-Aufgabe,<br />
kann ein schneller Blick zum Nachbarn<br />
helfen – vielleicht weiß der ja<br />
mehr. Von wem aber kann das deutsche<br />
Schulsystem lernen, wer ist der<br />
Streber unter den neun Nachbarstaaten?<br />
Die jüngste Pisa-Studie, die wie<br />
immer 15-jährige Schüler in den Blick<br />
nahm, lieferte vorige Woche neue Erkenntnisse.<br />
Der Schwerpunkt lag auf<br />
Mathematik, und die deutschen Schüler<br />
haben sich innerhalb eines knappen<br />
Jahrzehnts verbessert. Polen ist<br />
aufgestiegen, die Niederlande sind zurückgefallen,<br />
Klassenprimus ist die<br />
Schweiz. Wie es in <strong>Deutschland</strong> weiter<br />
vorwärtsgehen könnte, erklärt in dieser<br />
Ausgabe Wulf Homeier, der erste<br />
Deutsche an der Spitze der Vereinigung<br />
europäischer Schulinspektorate<br />
(siehe Interview Seite 46).<br />
KRIMINALITÄT<br />
Bombenleger verhaftet?<br />
Der mutmaßliche Bombenleger vom<br />
Ammersee ist gefasst: Die Staats -<br />
anwaltschaft Traunstein ließ einen<br />
51-jährigen Österreicher mit Wohnsitz<br />
in <strong>Deutschland</strong> verhaften. Er soll im<br />
März den Anschlag auf eine Angehörige<br />
eines angeblichen Anlagebetrügers<br />
in Herrsching am Ammersee verübt<br />
haben. Unter dem Auto der Frau waren<br />
ein Brandsatz und eine Bombe<br />
deponiert worden; zur Explosion kam<br />
es nicht. Der Brand wurde schnell entdeckt<br />
und gelöscht. Die Aktion wird<br />
als Einschüchterungsversuch gegen<br />
Christian H. gewertet, der mit der Firma<br />
APL Tausende Anleger um insgesamt<br />
rund 138 Millionen Euro gebracht<br />
haben soll. Spanische Ermittler hatten<br />
die Rockertruppe Hells Angels der Tat<br />
verdächtigt. Der nun verhaftete Österreicher<br />
hat allerdings laut Staatsanwalt<br />
Andreas Miller „rein gar nichts“ mit<br />
den Rockern zu tun. Der Verdächtige<br />
habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen<br />
geäußert.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 19
<strong>Deutschland</strong><br />
Papst Franziskus (l.), Tebartz-van Elst (r.)<br />
KATHOLIKEN<br />
Limburger Bischof muss warten<br />
Franz-Peter Tebartz-van Elst, Bischof von Limburg, lebt derzeit bekanntlich außerhalb<br />
seines Bistums. „In Erwartung der Ergebnisse“ einer Untersuchungskommission<br />
zu dem umstrittenen Bauvorhaben in Limburg hatte ihn der Papst im Oktober<br />
vorübergehend ins Exil geschickt. Das könnte länger dauern als gedacht: Die<br />
Kommission wird ihren Abschlussbericht doch nicht bereits im Januar 2014 vorlegen.<br />
Kommissionsmitglieder rechnen mit einem Ergebnis frühestens zu Ostern,<br />
womöglich erst zum Sommerbeginn. Die Verzögerung ist auf eine unerwartet große<br />
Zahl von Rechnungen und Unterlagen zurückzuführen, die zu prüfen sind.<br />
Tebartz-van Elst war wegen des auf mindestens 31 Millionen Euro veranschlagten<br />
Baus heftig kritisiert worden. Die Verwaltung des Bistums wurde im Oktober auf<br />
den Generalvikar übertragen; der Bischof hält sich in einem bayerischen Kloster<br />
auf. Die Kommission wurde von der Deutschen Bischofskonferenz eingesetzt und<br />
steht unter der Leitung des Paderborner Weihbischofs Manfred Grothe. Sie soll<br />
nicht nur die Kosten begutachten, sondern auch untersuchen, wer für die Entscheidungen<br />
verantwortlich war.<br />
OSSERVATORE ROMANO / KNA<br />
Panorama<br />
LOBBYISMUS<br />
Merkwürdige Spende<br />
Zuerst die Spende an die Partei, dann<br />
die Rede des Staatsministers – ein Auftritt<br />
von Eckart von Klaeden wirft Fragen<br />
auf. Die Berenberg Bank zahlte<br />
im August 15 000 Euro an den CDU-<br />
Kreisverband Hildesheim, dem Klaeden<br />
angehört. Wenige Wochen später<br />
reiste Klaeden in seiner damaligen<br />
Funktion als Staatsminister zu einem<br />
Kongress der Hamburger Privatbank<br />
nach München und hielt eine Rede.<br />
Anschließend besuchte er auf Einladung<br />
der Bank das Oktoberfest und<br />
übernachtete in einem Hotel in Unterschleißheim.<br />
Das Kanzleramt erklärte,<br />
Klaeden habe die Rede „unentgeltlich<br />
gehalten“. Die Reisekosten seien über<br />
das Kanzleramt abgerechnet worden.<br />
Da jedoch nur wenige Wochen zwischen<br />
der Spende und dem Auftritt liegen,<br />
drängt sich der Verdacht auf, dass<br />
Klaedens Engagement als Gegenleistung<br />
erfolgte. Klaeden bestreitet diesen<br />
Vorwurf energisch. Über seinen<br />
Anwalt lässt er ausrichten, dass die<br />
Rede auf der Investorenkonferenz „in<br />
keinerlei Zusammenhang mit einer<br />
Spende“ gestanden habe. Klaeden arbeitet<br />
inzwischen als Lobbyist für<br />
Daimler. Zum Zeitpunkt der Spende<br />
war die CDU in seinem Heimatwahlkreis<br />
dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen.<br />
Neben dem kostspieligen<br />
Bundestagswahlkampf musste die Partei<br />
die Kampagne für einen parteilosen<br />
Oberbürgermeisterkandidaten mitfinanzieren.<br />
Zudem stand Klaeden in<br />
seinem Landesverband unter Druck.<br />
Parteifreunde machten den damaligen<br />
CDU-Kreisvorsitzenden für den Verlust<br />
eines wichtigen Wahlkreises bei<br />
der Landtagswahl verantwortlich.<br />
JEMEN<br />
Zwei Morde, eine Waffe<br />
Das Bundeskriminalamt (BKA) geht<br />
dem Verdacht nach, dass ein Qaida-<br />
Kommando im Jemen Jagd auf Ausländer<br />
macht. Hintergrund sind mehrere<br />
Morde und Entführungsversuche.<br />
BKA-Ermittler reisten nach Sanaa, um<br />
unter anderem neue Hinweise im<br />
Mordfall des deutschen Personenschützers<br />
Mirko K. zu prüfen. Sie sichteten<br />
Videoaufnahmen aus dem Supermarkt,<br />
in dem der Bundespolizist am 6. Ok -<br />
tober zusammen mit einem Kollegen<br />
20<br />
eingekauft hatte, bevor er von Unbekannten<br />
erschossen wurde. Inzwischen<br />
gehen die Fahnder davon aus,<br />
dass der 39-Jährige entführt werden<br />
sollte und versuchte zu fliehen. Auf<br />
dem Parkplatz vor dem Geschäft traf<br />
ihn eine Kugel von hinten in den Kopf.<br />
Die bei dem Angriff verwendete Waffe<br />
wurde vermutlich auch bei einem<br />
Anschlag auf zwei Militärexperten aus<br />
Weißrussland eingesetzt. Ein Schütze<br />
auf einem Motorrad erschoss einen<br />
der Männer vor deren Hotel in Sanaa.<br />
Der zweite wurde verletzt. Es gebe Indizien<br />
dafür, dass es sich in beiden Fällen<br />
um dieselbe Tatwaffe handle, erklärte<br />
ein hochrangiger Ermittler. Das<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
BKA prüft zudem, ob zwei Entführungsversuche<br />
von saudi-arabischen<br />
und katarischen Diplomaten auf das<br />
Konto der Angreifer gehen. Die Bundesregierung<br />
hat alle Entwicklungshelfer<br />
aus dem Jemen abgezogen. Auch<br />
die Bundespolizei will ihre Beamten<br />
zurückholen, doch das Auswärtige<br />
Amt lehnt eine Schließung der Botschaft<br />
bislang ab. Bei einem Angriff<br />
auf das jemenitische Verteidigungsministerium<br />
waren am vorigen Donnerstag<br />
mindestens 52 Menschen ums Leben<br />
gekommen, darunter zwei deutsche<br />
Mitarbeiter der Gesellschaft für<br />
Internationale Zusammenarbeit und<br />
deren einheimischer Fahrer.
<strong>Deutschland</strong><br />
Ukrainischer Präsident Janukowitsch (2. v. l.), Kanzlerin Merkel (2. v. r.)*: Kampf um Einflusszonen in Osteuropa<br />
EUROPA<br />
Ein Profi für Runde zwei<br />
Der Kampf um die Ukraine ist einer zwischen dem russischen Präsidenten und der<br />
deutschen Kanzlerin. Die erste Runde ging an Putin. Aber Merkel und die<br />
Europäer bauen den Profiboxer Vitali Klitschko zu ihrem neuen starken Mann auf.<br />
22<br />
Dass Angela Merkel und Wiktor Janukowitsch<br />
in diesem Leben keine<br />
Freunde mehr werden, stand<br />
am Donnerstag vor acht Tagen auch dem<br />
Letzten vor Augen. Da saßen die beiden<br />
zusammen mit Staats- und Regierungschefs<br />
der Europäischen Union und Osteuropas<br />
im ehemaligen Palast des Großfürsten<br />
von Litauen an einer festlichen<br />
Tafel, mitten im vorweihnachtlich geschmückten<br />
Vilnius. Man war noch nicht<br />
* Mit ihren Delegationen am 29. November bei einem<br />
Treffen in Vilnius.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
bei der getrüffelten Pastete angekommen,<br />
da startete der ukrainische Präsident in<br />
einen kurvenreichen Monolog über die<br />
schwierigen Beziehungen seines Landes<br />
zu Europa einerseits und Russland andererseits.<br />
Doch irgendwo im Andererseits<br />
ging die Kanzlerin dazwischen. Man kön-
ne das hier auch abkürzen, lieber Herr<br />
Janukowitsch, sagte die Kanzlerin, und<br />
der armenische Staatschef neben ihr<br />
schaute überrascht hoch. „Sie unterschreiben<br />
ja doch nicht.“<br />
Vor zehn Tagen hat die Europäische<br />
Union die jüngste Runde im Kampf um<br />
die Ukraine gegen Russland verloren. Zugespitzt:<br />
Kanzlerin Merkel hat sie gegen<br />
den russischen Präsidenten Wladimir Putin<br />
verloren, der Russe hat gegen die<br />
Deutsche durch technischen K.o. gesiegt.<br />
Mit einer Mischung aus unverhohlenem<br />
Druck und süßen Versprechungen hatte<br />
Putin den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch<br />
innerhalb weniger Wochen auf<br />
Linie gebracht: Beim EU-Osteuropa-Gipfel<br />
in Litauens Hauptstadt Vilnius unterschrieb<br />
Janukowitsch das lange verhandelte<br />
Assoziierungsabkommen mit der<br />
EU nicht. Sein Land ist bis auf weiteres<br />
Teil jenes Blocks russischer Anrainerstaaten,<br />
die Putin zu einer Art russischem Imperium<br />
zusammenfügen will – von Wladiwostok<br />
bis an die Ostgrenze der EU.<br />
„Die Tür für die Ukraine bleibt offen“,<br />
betonte Merkel nach der Pleite mehrfach.<br />
Man sei weiterhin gesprächsbereit. Das<br />
klang nach mühsamer Gesichtswahrung,<br />
wie sie nach Niederlagen üblich ist. Aber<br />
es heißt auch: Die Geschichte ist noch<br />
nicht zu Ende. Und die Kanzlerin will<br />
vor der nächsten Runde eine neue Figur<br />
ins Spiel bringen: Vitali Klitschko. Der<br />
zwei Meter große Profiboxer soll zum<br />
proeuropäischen Gegner des russland -<br />
orientierten Janukowitsch aufgebaut werden<br />
– und am Ende das Abkommen mit<br />
den Europäern doch noch unterschreiben.<br />
„Regime Change“ wäre als Begriff wohl<br />
zu hoch gegriffen, aber ein bisschen geht<br />
es doch darum: Merkels CDU und die europäische<br />
konservative Parteienfamilie<br />
EVP haben Klitschko auserkoren, das<br />
ukrainische Nein von innen aufzuweichen.<br />
Er soll die Opposition einen und<br />
IMAGO<br />
anführen, auf der Straße, im Parlament<br />
und schließlich bei der Präsidentenwahl<br />
2015. „Klitschko ist unser Mann“, heißt<br />
es in hohen EVP-Kreisen. „Der hat eine<br />
klar europäische Agenda“ – und Merkel<br />
noch eine Rechnung offen mit Putin.<br />
Hinter den Kulissen läuft die Arbeit.<br />
Klitschkos junge Partei „Udar“ ist seit<br />
kurzem beobachtendes Mitglied der konservativen<br />
EVP-Parteienfamilie. EVP-Büros<br />
in Brüssel und Budapest schulen Udar-<br />
Personal für die parlamentarische Arbeit,<br />
unterstützen beim Aufbau einer landesweiten<br />
Parteistruktur. Eine wichtige Rolle<br />
spielt auch die Konrad-Adenauer-Stiftung<br />
der CDU, um ihre Hilfe hat Klitschko Vertraute<br />
der Kanzlerin ausdrücklich gebeten.<br />
In der vorvergangenen Woche waren<br />
vier Udar-Abgeordnete in Berlin zu Gast.<br />
Die Parlamentarier trafen unter anderem<br />
mit Bundestagsabgeordneten der Union<br />
und Beamten aus dem Arbeits- und dem<br />
Justizministerium zusammen. Die CDUnahe<br />
Parteistiftung bereitet seit einiger<br />
Zeit ukrainische Oppositionspolitiker im<br />
Rahmen eines „Dialog-Programms“ auf<br />
die Übernahme von Verantwortung vor.<br />
Im Zentrum steht aber Klitschko selbst.<br />
Seit einiger Zeit schon trifft sich der<br />
Ukrainer mit Kanzleramtsminister Ronald<br />
Pofalla, der sich seit vielen Jahren<br />
um osteuropäische Oppositionelle kümmert,<br />
besonders im autoritär geführten<br />
Weißrussland. Aus zahllosen Gesprächen<br />
weiß Pofalla, wie dortige Regime Oppositionelle<br />
kleinkriegen, wenn die zu prominent<br />
oder einflussreich werden: Diffamierung,<br />
Schikanen im Alltag, wahllose<br />
Verhaftung, Schauprozesse und Trennung<br />
von der eigenen Familie. Pofalla hat im<br />
Laufe der Zeit verfolgt, wie auf diese Art<br />
kritische Geister in osteuropäischen Staaten<br />
gebrochen wurden. Er hat Klitschko<br />
manchen Tipp gegeben, und der Polit-<br />
Laie Klitschko hat Pofalla um Rat gefragt:<br />
Wie soll er beispielsweise mit Gerüchten<br />
über „Frauengeschichten“ umgehen, die<br />
offenbar von der ukrainischen Regierung<br />
gestreut werden, um ihn im Land unmöglich<br />
zu machen?<br />
Auf die diskrete Hilfe Pofallas und der<br />
Bundesregierung kann Klitschko auch<br />
hoffen, wenn es um die Präsidentenwahl<br />
2015 geht. Seiner Kandidatur steht ein<br />
mutmaßlich eigens auf ihn zugeschnittenes<br />
Gesetz entgegen, wonach ein Bürger<br />
mit einer Aufenthaltserlaubnis in anderen<br />
Ländern nicht als Bewohner der Ukraine<br />
gilt. Damit kann Klitschko nicht nachweisen,<br />
vor der Wahl zehn Jahre in der<br />
Ukraine gelebt zu haben, was nach der<br />
Verfassung Voraussetzung für eine Kandidatur<br />
wäre. Er darf sich aber sicher sein,<br />
dass sich die Kanzlerin bei Präsident Janukowitsch<br />
dafür einsetzen will, an diesem<br />
Gesetz Klitschkos Kandidatur nicht<br />
scheitern zu lassen.<br />
Dazu muss man den Profiboxer aber<br />
vor aller Augen, in der Ukraine wie im<br />
DER SPIEGEL 50/2013 23
<strong>Deutschland</strong><br />
Ausland, als ernstzunehmenden Politiker<br />
aufbauen. Und genau das geschieht.<br />
Außenminister Guido Westerwelle<br />
zeigte sich Mitte der Woche demonstrativ<br />
mit Klitschko vor der Menge der Demon -<br />
stranten in Kiew. Er kennt den Boxer von<br />
verschiedenen Galaveranstaltungen in<br />
<strong>Deutschland</strong>, hat seinen Besuch mit zahlreichen<br />
Telefonaten vorbereitet und bei<br />
EU-Amtskollegen abgesichert. Trotzdem<br />
ist der Gang auf dem Unabhängigkeitsplatz<br />
ein heikler Moment. Die Menge will<br />
inzwischen den Sturz Janukowitschs,<br />
aber dazu kann Westerwelle als westlicher<br />
Politiker nicht aufrufen. Er belässt<br />
es bei allgemeinen Appellen zur europäischen<br />
Zukunft des Landes – und etlichen<br />
Fotos an der Seite Klitschkos.<br />
Beim Vortreffen der konservativen<br />
Staats- und Regierungschefs in Vilnius<br />
vor zehn Tagen war Klitschko dabei, er<br />
diskutierte bis spät abends mit wichtigen<br />
Abgeordneten des Europäischen Parlaments.<br />
Einen Termin direkt mit Merkel<br />
bekam er da noch nicht, sie schickte ihren<br />
außenpolitischen Berater Christoph Heusgen<br />
für eine spontanes Gespräch mit<br />
Klitschko vor.<br />
Aber beim nächsten EU-Gipfel Mitte<br />
Dezember will Merkel am EVP-Vortreffen<br />
teilnehmen – und nach jetziger Planung<br />
wird Klitschko wieder eingeladen<br />
sein. Dieses Mal soll es für ihn offizielle<br />
Fotos mit den Regierungschefs geben,<br />
auch ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin.<br />
Politisch würde das eine große Aufwertung<br />
für Klitschko und eine wichtige<br />
Festlegung für Angela Merkel bedeuten.<br />
Sie hat sich offenkundig beeindrucken<br />
lassen von den Berichten ihrer Vertrauten,<br />
unter anderen Pofalla, Heusgen und<br />
der langjährige Außenpolitiker im Europäischen<br />
Parlament, Elmar Brok (CDU).<br />
Sie schildern Vitali Klitschko unisono als<br />
eine Art Gegenentwurf zu den„typischen“<br />
ukrainischen Politikern, die sich<br />
im Parlament von Kiew mehrfach in der<br />
Vergangenheit zu handfesten Raufereien<br />
hinreißen ließen. Klitschko äußere sich<br />
stets entschlossen, aber besonnen, so das<br />
Fazit. Die politische Lage in seinem Land<br />
stelle er sehr differenziert dar, „sehr europäisch“<br />
– und verzichte auf alle großspurigen<br />
Töne. Klitschko gilt als integer<br />
und allem Anschein nach frei von Korruption.<br />
Besonders hoch wird dem Zweimetermann<br />
sein couragiertes Auftreten bei einer<br />
Demonstration am vorvergangenen<br />
Sonntag angerechnet, die in Kiew aus<br />
dem Ruder zu laufen drohte. Aus den<br />
Reihen der Demonstranten wurde die<br />
aufmarschierende Polizei attackiert und<br />
bedrängt. Da griff sich Klitschko ein<br />
Megafon und rief: „Seid ihr irre, das<br />
sind doch bestellte Provokateure.“ Dar -<br />
aufhin verzogen sich die Krawallmacher.<br />
„Da hat er persönlich sehr viel riskiert“,<br />
heißt es in Berliner Regierungskreisen<br />
24<br />
anerkennend. „Er hatte die Menge schnell<br />
im Griff.“<br />
Aber kann Klitschko auch die notorisch<br />
zerstrittene Opposition einen, die vor<br />
allem aus seiner eigenen Udar-Partei besteht,<br />
der Vaterlandspartei der inhaftierten<br />
Julija Timoschenko und der rechts -<br />
nationalen Freiheitspartei? Die Klitschko-<br />
Unterstützer in EVP und Bundesregierung<br />
hoffen darauf, dass spätestens 2015<br />
bei der Präsidentenwahl nur ein gemeinsamer<br />
Kandidat gegen Amtsinhaber Janukowitsch<br />
antritt – und gewinnt. Dann<br />
hätte Kanzlerin Merkel ihr Etappenziel<br />
erreicht: eine proeuropäische Führung<br />
Staatschef Putin<br />
Träume von einem großen Russland<br />
der Ukraine. Das eigentliche Rückspiel<br />
könnte beginnen, das um eine Neuordnung<br />
der Beziehungen der Europäischen<br />
Union mit Osteuropa. Das gegen Wladimir<br />
Putin.<br />
Der erste große Anlauf zu dieser neuen<br />
„Östlichen Partnerschaft“ war vor zehn<br />
Tagen in Vilnius krachend gescheitert. Putin<br />
hatte sich vor dem EU-Gipfel mehrere<br />
Male mit Janukowitsch getroffen. Was er<br />
ihm ganz genau anbot, ist nicht bekannt.<br />
Die Rede ist von Krediten und Preisnachlässen<br />
bei Gas in Milliardenhöhe. Außerdem<br />
hatte Russland die Handelsbeziehungen<br />
zur Ukraine schon im Sommer eingeschränkt,<br />
was für das Land massive<br />
wirtschaftliche Verluste bedeutete – besonders<br />
im russisch geprägten Osten des<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
IMAGO<br />
Landes, wo Janukowitsch seine Wählerbastionen<br />
hat. Vor allem dürfte aber die<br />
Drohung, die Gaslieferungen zu drosseln,<br />
gewirkt haben. Der Staatschef eines anderen<br />
Nachbarlandes der Russen ließ<br />
Kanzlerin Merkel beim Abendessen in<br />
Vilnius wissen, dass man in so einer Lage<br />
nur noch eines entscheiden könne: Entweder<br />
etliche Millionen der eigenen Bürger<br />
verbringen den Winter in kalten,<br />
dunklen Wohnungen – oder man tue, was<br />
der Kreml möchte.<br />
Dagegen konnte – und wollte – die EU<br />
nicht an. Das Assoziierungsabkommen<br />
mit der Ukraine hätte dem Land nach<br />
Brüsseler Schätzung zwar zusätzliches<br />
Wirtschaftswachstum bescheren können,<br />
aber nicht von einem Tag auf den anderen.<br />
Frische Kredite an die Ukraine konnte<br />
die EU nicht ohne weiteres garantieren,<br />
schon gar nicht solche des Internationalen<br />
Währungsfonds, wie sie Janukowitsch<br />
sich so dringend wünscht. Außerdem sei<br />
der Vorschlag inakzeptabel gewesen,<br />
Russland bei weiteren Verhandlungen mit<br />
an den Tisch zu holen. „Dreier-Gespräche<br />
lehnen wir ab“, wird Merkel aus kleinem<br />
Kreis zitiert.<br />
Ergebnis: Der ukrainische Präsident<br />
sah sich in eine „Entweder-oder-Lage“<br />
manövriert, entweder Russland oder die<br />
EU. Und entschied sich vorerst für Wladimir<br />
Putin.<br />
<strong>Deutschland</strong> und andere große EU-<br />
Staaten hatten zuletzt zwar versucht, diesen<br />
Showdown zu vermeiden. Das Assoziierungsabkommen<br />
enthielt ausdrücklich<br />
keine sogenannte Beitrittsperspektive für<br />
die Ukraine – auch um Russland nicht unnötig<br />
zu provozieren. Man hoffte, dass<br />
Moskau gegen losere Formen der Partnerschaft<br />
von EU und Ukraine keine Einwände<br />
haben würde.<br />
Doch Wladimir Putin hatte einen Strich<br />
durch diese Rechnung gemacht. Und den<br />
Europäern fiel es zu spät auf.<br />
Schon im Oktober 2011 schlug Putin<br />
eine „Eurasische Union“ aus Ländern auf<br />
dem Gebiet der früheren Sowjetunion<br />
vor. Als Vorstufe gibt es bereits eine eurasische<br />
Zollunion, der nach dem Willen<br />
Putins auch die Ukraine beitreten soll.<br />
Die Ukraine reagierte zunächst wenig begeistert,<br />
aber von diesem Moment an war<br />
klar, dass Kiew nicht gleichzeitig in einer<br />
Zollunion mit Russland und einer Freihandelszone<br />
mit der EU würde Mitglied<br />
sein können. Die Konsequenzen dieser<br />
Frage für die Haltung Kiews wurde in<br />
Brüssel wohl unterschätzt.<br />
Dabei geht es im Kampf um Kiew um<br />
viel mehr als freien Warenaustausch am<br />
östlichen Rand der Europäischen Union.<br />
Fast 25 Jahre nach dem Ende des Kalten<br />
Kriegs geht es darum, wer es schafft, die<br />
früheren Sowjetrepubliken der Region in<br />
seinen Einflussbereich zu ziehen. Es geht<br />
um Geopolitik, um das „Grand Design“,<br />
wie es die Experten gern nennen. Und
es geht – ob die Kanzlerin nun will oder<br />
nicht – um Angela Merkel und Wladimir<br />
Putin ganz persönlich.<br />
Über kaum einen internationalen Politiker<br />
kann die Kanzlerin so ausführlich<br />
rätseln und räsonieren. Ob Putin mit<br />
nacktem Oberkörper für Fotografen posie -<br />
re, Nachbarstaaten mit russischen Rohstofflieferungen<br />
erpresse oder wie jetzt<br />
an einem großrussischen Wirtschaftsraum<br />
arbeite – stets sei der Antrieb der gleiche:<br />
eine Mischung aus Selbstzweifel, Sehnsucht<br />
nach gewesener Größe und verletztem<br />
Stolz. Merkel sieht in ihrem Gegenüber<br />
einen ebenso entschlossenen wie<br />
komplexbeladenen Politiker: den Staatschef<br />
eines Landes, das erkennbar vom<br />
Tempo der Globalisierung überfordert ist<br />
und seinen Platz in der Weltordnung verloren<br />
hat, weil die Weltordnung längst<br />
eine andere, kompliziertere ist. Ohne<br />
straff und zentral kommandierte Blöcke,<br />
ohne Atomwaffen als die zentrale Währung<br />
von Einfluss und Macht.<br />
Merkels Vorgänger Gerhard Schröder<br />
wollte in Putin einen „lupenreinen Demokraten“<br />
erkennen. Und anfangs sah<br />
es die Kanzlerin gar nicht viel anders, nur<br />
skeptischer. Putin müsse geholfen werden,<br />
sein Land zu modernisieren und zu demokratisieren,<br />
Schritt für Schritt – und<br />
nicht immer zu messen an westeuropäischen<br />
Standards. Das war vor acht Jahren<br />
ihre Losung, heute ist Merkel davon weit<br />
entfernt. Sie scheint die Hoffnung aufgegeben<br />
zu haben, dass Putin Demokratie<br />
und Marktwirtschaft wirklich will – und<br />
nicht längst die Wiederherstellung einer<br />
straff aus dem Kreml geführten russischen<br />
Einflusszone, mit der sich demokratischer<br />
Pluralismus nicht verträgt.<br />
In diesem „Grand Design“ des Kreml-<br />
Chefs aber ist die Ukraine der zentrale<br />
Baustein. Ohne das Land hätte Moskau<br />
keinen Arm, der nach Mitteleuropa reicht.<br />
Mit der Ukraine dagegen könnte Putin<br />
weiter davon träumen, den ehemaligen<br />
Weltmachtstatus Moskaus zumindest teilweise<br />
wiederherzustellen.<br />
Und sosehr es typisch für Angela Merkel<br />
wäre, die „Entweder-oder“-Zwickmühle<br />
für die Ukraine aufzulösen, um einen<br />
gangbaren Weg mit Russland zu finden,<br />
ahnt sie dennoch: Solange Wiktor<br />
Janukowitsch an der Spitze der Ukraine<br />
steht, wird daraus nichts. Und wenn er<br />
eines Tages abgelöst ist, wartet da ja noch<br />
Wladimir Putin. Der träumt von einem<br />
großen Russland und würde den Ausgang<br />
des Kalten Kriegs, den Zerfall der So -<br />
wjetunion, am liebsten rückgängig machen.<br />
NIKOLAUS BLOME, MATTHIAS GEBAUER,<br />
RALF NEUKIRCH<br />
Lesen Sie weiter zum Thema:<br />
Seite 94: Die Wütenden von Kiew.<br />
Seite 96: Polens Ex-Präsident Kwaśniewski kritisiert<br />
im SPIEGEL-Gespräch die Fehler der EU und<br />
den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch.<br />
26<br />
PETER ROGGENTHIN / DER SPIEGEL<br />
SPIEGEL-GESPRÄCH<br />
„Halt den Mund“<br />
Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, 64 (CSU),<br />
über das raue Verhältnis zwischen Politik und Medien und<br />
die Frage, warum er seine Parteikollegen öffentlich maßregelt<br />
SPIEGEL: Herr Seehofer, der SPD-Kanzlerkandidat<br />
Peer Steinbrück hat, nachdem<br />
er im Wahlkampf sehr hart kritisiert wurde,<br />
den Journalisten öffentlich den Stinkefinger<br />
gezeigt. Können Sie ihn ver -<br />
stehen?<br />
Seehofer: Nicht den Stinkefinger. Aber<br />
die Kritik an Journalisten schon.<br />
SPIEGEL: Momentan klagen viele Politiker<br />
darüber, dass sie von den Medien schlecht<br />
behandelt würden. Sie sind seit mehr als<br />
drei Jahrzehnten im Geschäft. Was hat<br />
sich zwischen Politikern und Journalisten<br />
verändert?<br />
Seehofer: Es gibt einen Qualitätsverlust in<br />
manchen Medien. Und die Herabsetzung<br />
von Politikern und Parteien nimmt zu.<br />
Macht braucht Kontrolle, aber der Umgang<br />
sollte immer respektvoll bleiben.<br />
SPIEGEL: Wodurch fühlen Sie sich persönlich<br />
beleidigt?<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Seehofer: Es gibt immer wieder Artikel,<br />
da werde ich nicht nach Inhalten bewertet,<br />
sondern persönlich herabgewürdigt.<br />
Eine Zeitung hat mich zum Beispiel<br />
„Crazy Horst“ genannt. Für mich ist da<br />
eine Grenze überschritten. Ich empfehle<br />
allen Politikern, so etwas nicht hinzu -<br />
nehmen.<br />
SPIEGEL: Wenn Politiker andere Politiker<br />
beleidigen, ist das aber okay? Sie selbst<br />
haben Karl-Theodor zu Guttenberg öffentlich<br />
als „Glühwürmchen“ bezeichnet.<br />
Seehofer: So nennt man es doch, wenn jemand<br />
von Journalisten erst hoch- und<br />
dann niedergeschrieben wurde.<br />
SPIEGEL: Ihr Generalsekretär Alexander<br />
Dobrindt sagte über Sigmar Gabriel, dieser<br />
sei „übergewichtig und unterbegabt“.<br />
Auch keine Beleidigung?<br />
Seehofer: Ein Generalsekretär ist für eine<br />
Partei Hauptakteur im politischen Mei-
<strong>Deutschland</strong><br />
nungskampf. Ein Journalist sollte etwas<br />
ganz anderes sein, nämlich Beobachter<br />
und Bewerter dieses Meinungskampfes.<br />
Das sollte man nicht verwechseln und jedes<br />
Wort auf die Goldwaage legen.<br />
SPIEGEL: Das tun Sie doch!<br />
Seehofer: Sigmar Gabriel wurde vergangene<br />
Woche mit dem Spruch meines Generalsekretärs<br />
konfrontiert – und er hat<br />
sehr souverän reagiert. Er sagte: „Ich<br />
habe schon manches harte Wort im Wahlkampf<br />
gesagt: Sei’s drum!“<br />
SPIEGEL: Der Ausfall gegen Gabriel war<br />
nicht Dobrindts einziger: Er nannte EZB-<br />
Chef Mario Draghi einen „Falschmünzer“,<br />
den Grünen Daniel Cohn-Bendit einen<br />
„widerwärtigen Pädophilen“ und die<br />
FDP eine „Gurkentruppe“. Sollten Sie<br />
nicht erst einmal die Umgangsformen der<br />
CSU verbessern, bevor Sie die Medien<br />
maßregeln?<br />
Seehofer: Ich kann Ihnen gerne eine Zitatensammlung<br />
vorlegen, was über mich alles<br />
geschrieben wurde. Die Sache mit<br />
Draghi ist längst bereinigt. Er war bei mir<br />
in der Staatskanzlei, aber das habe ich<br />
bisher niemandem erzählt. Wir haben die<br />
Sache geklärt.<br />
SPIEGEL: Warum sollte das nur unter Politikern<br />
und nicht zwischen Politikern und<br />
Journalisten möglich sein? Warum können<br />
sich Sigmar Gabriel und Marietta<br />
Slomka beim ersten Wiedersehen nach<br />
ihrem Interview im „heute journal“ nicht<br />
auch einfach die Hand geben? Stattdessen<br />
haben Sie noch Öl ins Feuer gegossen.<br />
Seehofer: Sigmar Gabriel musste sich minutenlang<br />
für den SPD-Mitgliederentscheid<br />
rechtfertigen. Mir will es nicht in<br />
den Kopf, wenn man sich in einer Demokratie<br />
für mehr Demokratie rechtfertigen<br />
muss.<br />
SPIEGEL: Sie haben das Interview mit<br />
Gabriel nicht nur öffentlich kritisiert, sondern<br />
gleich noch einen Beschwerdebrief<br />
an den ZDF-Intendanten Thomas Bellut<br />
geschrieben. Wundert es Sie, wenn da<br />
der Eindruck entsteht, Sie wollten die Berichterstattung<br />
des ZDF beeinflussen?<br />
Seehofer: Ich habe Herrn Bellut am Freitag<br />
vor zwei Wochen zunächst eine SMS<br />
mit folgendem Text geschrieben: „Lieber<br />
Herr Bellut, für Auftritt von Frau Slomka<br />
gegenüber Gabriel kann man sich nur<br />
wundern. Wir entscheiden als CSU heute<br />
Nachmittag mit ca. 100 Leuten über<br />
Koa litionsvertrag. Verfassungswidrig? Ihr<br />
HS aus Bayern.“ Am Montag habe ich<br />
die SMS noch einmal in Briefform aufgesetzt<br />
und dazugeschrieben: „Nachdem<br />
diese normale Bewertung zwischenzeitlich<br />
vom ZDF wieder zu einer Grundsatzfrage<br />
der Pressefreiheit stilisiert wurde,<br />
erwarte ich auch keine Antwort.“ Herr<br />
Bellut hat trotzdem geantwortet. Aber<br />
weil sein Brief so interessant ist, veröffentliche<br />
ich ihn nicht. Der kommt in meinen<br />
Safe. Ich war jedenfalls mit dem Inhalt<br />
zufrieden.<br />
SPIEGEL: Sie haben es mit dem Brief aber<br />
nicht bewenden lassen, sondern später<br />
auch noch einen Auftritt im Jahresrückblick<br />
des ZDF abgesagt. Das wirkte beleidigt.<br />
Seehofer: Ich sollte in dieser Sendung interviewt<br />
werden, weil das Jahr für mich<br />
politisch erfolgreich war. Ich will aber<br />
nicht, dass irgendwer übers ZDF sagen<br />
kann: Schauen Sie, der Markus Lanz hat<br />
ihm zehn Minuten lang lauter nette Fragen<br />
gestellt, als wenn nichts gewesen<br />
wäre. Ich habe doch in diesem Jahr mit<br />
den Wahlerfolgen nur meine Pflicht erfüllt.<br />
Deshalb brauche ich dazu keinen<br />
öffentlichen Auftritt.<br />
SPIEGEL: Vielleicht ist es ein Ausweis von<br />
gutem und kritischem Journalismus,<br />
wenn sich Politiker wie Sie über Sendungen<br />
aufregen.<br />
Seehofer: Ich habe nichts gegen kritischen<br />
Journalismus, aber gegen Manipulation.<br />
Das ZDF hat im vergangenen Mai über<br />
einen Konvent der CSU in München berichtet.<br />
Ich habe noch selten eine solch<br />
Interviewpartner Gabriel, Slomka<br />
„Da kann man sich nur wundern“<br />
bizarre journalistische Leistung erlebt.<br />
Der CSU-Generalsekretär hielt gerade<br />
erst die Eröffnungsrede, während beim<br />
ZDF bereits der Schlusskommentar über<br />
die ganze Veranstaltung fabriziert wurde.<br />
Es spricht für den „heute journal“-Moderator<br />
Claus Kleber, dass er sich mit dem<br />
Satz entschuldigte: „Normalerweise arbeiten<br />
wir sorgfältiger.“<br />
SPIEGEL: Im vergangenen Jahr hat das ZDF<br />
einen Anruf Ihres Sprechers Hans Michael<br />
Strepp öffentlich gemacht. Er soll dar -<br />
auf hingewirkt haben, dass das ZDF auf<br />
einen Bericht über den Parteitag der Bayern-SPD<br />
verzichtet. Kann es sein, dass<br />
Sie deshalb ständig auf dem ZDF herumhacken?<br />
Seehofer: Die ganze Geschichte war eine<br />
Petitesse, die vom ZDF groß aufgebauscht<br />
wurde. Außerdem glaube ich<br />
Herrn Strepp, wenn er sagt, er habe das<br />
ZDF-Programm nicht beeinflussen wollen.<br />
SPIEGEL: Finden Sie, dass Herr Strepp ungerecht<br />
behandelt wurde?<br />
Seehofer: Eindeutig. Deshalb läuft sein Arbeitsverhältnis<br />
ja auch weiter, wenn auch<br />
nicht als Pressesprecher. Er war ein führender<br />
strategischer Kopf unseres Wahlkampfs.<br />
ZDF / DPA<br />
SPIEGEL: Funktioniert denn wenigstens Ihr<br />
Zugriff auf die Spitze des Bayerischen<br />
Rundfunks noch so gut wie früher?<br />
Seehofer: Ich nehme auf keinen Sender<br />
Einfluss, auch nicht auf den BR.<br />
SPIEGEL: Am Abend der bayerischen Landtagswahl<br />
würgte BR-Chefredakteur Sigmund<br />
Gottlieb ein kritisches Live-Statement<br />
von Sigmar Gabriel gegen Sie mit<br />
den Worten ab, dessen Äußerungen seien<br />
„doch alle sehr erwartbar“. Dann lächelte<br />
er und kündigte ein Porträt über den<br />
Mann an, der der „CSU ihren Stolz“ wiedergegeben<br />
habe. Es war ein Porträt über<br />
Sie. Der Mitschnitt hat unter dem Titel<br />
„Sigmund Gottlieb sorgt für Abwechslung“<br />
im Internet Kultstatus erreicht. Ist<br />
Ihnen solche Gefälligkeitsberichterstattung<br />
nicht selbst unangenehm?<br />
Seehofer: Ich mache mal den Versuch einer<br />
Interpretation. Die CSU hat schwere<br />
Jahre hinter sich, 2008 der Verlust der absoluten<br />
Mehrheit. Dann fünf Jahre Seehofer<br />
unter schwierigen Bedingungen,<br />
denken Sie nur an die Krise der Landesbank<br />
und die Verwandtenaffäre. Wenn<br />
man nach so einer Zeit die absolute Mehrheit<br />
holt, darf doch auch ein Journalist<br />
sagen, dass der Mythos CSU lebt.<br />
SPIEGEL: Sie sind also zufrieden mit Ihrem<br />
Chefredakteur Gottlieb?<br />
Seehofer: Das ist so wenig meiner wie Ihrer.<br />
SPIEGEL: Ulrich Wilhelm war zunächst<br />
Sprecher von Edmund Stoiber, später von<br />
Angela Merkel. Jetzt ist er Intendant des<br />
Bayerischen Rundfunks. Aus Sicht der<br />
Union ist das wohl die optimale Verwertungskette.<br />
Seehofer: Wenn Sie Herrn Wilhelm kennen,<br />
werden Sie bestätigen, dass er ein<br />
exzellenter Fachmann ist.<br />
SPIEGEL: Wir ziehen nicht seine Fähigkeiten<br />
in Zweifel. Die Frage ist aber, ob man<br />
noch unabhängiger Journalist sein kann,<br />
wenn man so lange für Spitzenpolitiker<br />
der Union gearbeitet hat.<br />
Seehofer: Diese sind oft die kritischsten.<br />
Warum soll ein Journalist nicht mal einer<br />
Regierung dienen?<br />
SPIEGEL: Der neue WDR-Intendant Tom<br />
Buhrow zum Beispiel hat vorher nicht<br />
für SPD-Politiker gearbeitet. Anders gefragt:<br />
Ist es denkbar, dass ein Sprecher<br />
der Bayern-SPD mal BR-Intendant wird?<br />
Seehofer: Wenn er gut ist: warum nicht?<br />
SPIEGEL: Halten denn Politiker genügend<br />
Distanz zu Journalisten?<br />
Seehofer: Es gibt immer Kollegen, die sagen:<br />
Halt lieber den Mund, mach’s harmonisch,<br />
spiel das Spiel mit. Aber das<br />
will ich nicht. Ich bin unabhängig, ich<br />
habe nie ein Netzwerk gepflegt. Ich habe<br />
auch nie zu einem Journalisten eine besondere<br />
Nähe gepflegt – und schon gar<br />
nicht mit der Erwartung, besonders behandelt<br />
zu werden.<br />
SPIEGEL: Wenn Sie, was Sie nicht haben,<br />
einen Wunsch an uns Journalisten frei<br />
hätten: Was wäre das?<br />
DER SPIEGEL 50/2013 27
Der digitale<br />
SPIEGEL<br />
In dieser Ausgabe:<br />
Der Jahrhundertpolitiker<br />
Video über das Leben von Nelson Mandela<br />
Die Abgewählten<br />
Animation über die lange Geschichte<br />
der FDP<br />
Die Wütenden<br />
Video-Reportage über die Proteste<br />
in der Ukraine<br />
Die neue Art zu lesen.<br />
Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.<br />
Mit exklusiv produzierten Videos.<br />
Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven<br />
Grafiken und 3-D-Modellen.<br />
Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!<br />
DER SPIEGEL<br />
Einfach scannen (z.B.<br />
mit der kostenlosen<br />
App DER SPIEGEL) und<br />
mehr erfahren – über<br />
den digitalen SPIEGEL und<br />
über unser Testangebot.<br />
SD13-114<br />
Seehofer: Etwas mehr Selbstkritik! Wenn<br />
Politiker es wagen, einen Journalisten zu<br />
kritisieren, gibt es zwei beliebte Fluchtwege.<br />
Erstens: Es wird behauptet, die<br />
Pressefreiheit sei gefährdet. Dann springen<br />
alle Journalisten dem armen Kollegen<br />
bei, und der unvermeidliche Journalistenverband<br />
hebt warnend den Finger. Am<br />
Ende sind dann alle stolz, dass sie das<br />
Grundrecht auf das freie Wort verteidigt<br />
haben. Wenn man nicht zu diesem Totschlaghammer<br />
greift, wird einem stattdessen<br />
Weinerlichkeit und Dünnhäutigkeit<br />
vorgeworfen. Das sind die beiden Klassiker.<br />
Beides ist falsch.<br />
SPIEGEL: FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle<br />
geriet Anfang des Jahres als Schürzenjäger<br />
in die Schlagzeilen. War es<br />
klug von ihm, sich nicht öffentlich zu<br />
wehren?<br />
Seehofer: Ja, das war richtig. Wenn zur<br />
Jagd geblasen wird, haben Sie als einzelne<br />
Person keine Chance, sich dagegen zu<br />
wehren. Ich habe das am eigenen Leib<br />
erlebt.<br />
SPIEGEL: Sie spielen auf das Jahr 2007 an,<br />
als Sie wegen einer außerehelichen Affäre<br />
in die Schlagzeilen gerieten.<br />
Seehofer: Ich habe damals einfach nein<br />
gesagt.<br />
SPIEGEL: Was meinen Sie damit?<br />
Seehofer: Nichts hören, nichts sehen,<br />
nichts lesen. Ich habe die Berichterstattung<br />
einfach ignoriert. Für 2007 wurde<br />
mir später eine Presseschau zusammengestellt.<br />
Vielleicht werde ich mir die in<br />
20 Jahren mal durchlesen.<br />
SPIEGEL: Aber Sie hatten doch eine Ahnung,<br />
was über Sie berichtet wird?<br />
Seehofer: Der Chefredakteur der „Bild“-<br />
Zeitung hat mich einen Tag vorher<br />
an gerufen. Ich sagte ihm: „Tun Sie,<br />
was Sie für richtig halten.“ Ich muss als<br />
öffent liche Person akzeptieren, dass<br />
sich die Menschen für mein Leben inter -<br />
essieren.<br />
SPIEGEL: Damals waren Sie nicht so gelassen.<br />
Sie sprachen von der „schlimmsten<br />
Medienkampagne seit 1949“. Was hat Sie<br />
so getroffen?<br />
Seehofer: Die ganze Begleitmusik. Dutzende<br />
von Fotografen standen vor meinem<br />
Haus. Die schrillen Medienberichte<br />
hatten Auswirkungen auf Freunde, Bekannte,<br />
meine Familie. Das war schon<br />
heftig.<br />
SPIEGEL: War es ein Fehler, Homestorys<br />
zu machen, obwohl Sie doch wussten,<br />
dass Ihr Privatleben nicht dem Familienbild<br />
des CSU-Grundsatzprogramms entspricht?<br />
Seehofer: Ich bleibe dabei, dass ich dazu<br />
nichts sage.<br />
SPIEGEL: Viele Bürger hatten während der<br />
Affäre Wulff den Eindruck, der Bundespräsident<br />
werde von manchen Medien<br />
* Mit den Redakteuren René Pfister und Markus Felden -<br />
kirchen am vergangenen Donnerstag in Nürnberg.<br />
28<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
aus dem Amt geschrieben. Hatten Sie<br />
Mitleid mit ihm?<br />
Seehofer: Ich glaube, dass die Vorwürfe<br />
gegen ihn maßlos übertrieben wurden.<br />
SPIEGEL: War Karl-Theodor zu Guttenberg<br />
auch ein Opfer der Medien?<br />
Seehofer: Ich habe nie an Übermenschen<br />
geglaubt, die medial gezeichnet werden.<br />
Die Medien schaffen Wundermenschen,<br />
Menschen mit Idealwerten. Ich bin diesen<br />
Menschen im echten Leben nie begegnet.<br />
Diese Scheinwelt fällt früher oder später<br />
in sich zusammen. Und das liegt nicht in<br />
erster Linie an den Betroffenen.<br />
SPIEGEL: Vergangenes Jahr gab es ein legendäres<br />
Weihnachtsessen mit Journalisten<br />
in München. Da kritisierten Sie Ihr<br />
Personal und forderten die Journalisten<br />
dazu auf, das aufzuschreiben. Was war<br />
Ihr Hintergedanke?<br />
Seehofer beim SPIEGEL-Gespräch*<br />
„Etwas mehr Selbstkritik!“<br />
Seehofer: Ich hatte mir das Ganze vorher<br />
genau überlegt. Der Erfolg hat mir recht<br />
gegeben. Die CSU ist einig, geschlossen<br />
und motiviert in den Wahlkampf ge -<br />
zogen.<br />
SPIEGEL: Warum war es für den Erfolg<br />
wichtig, Ihren Bundesverkehrsminister<br />
Ramsauer als „Zar Peter“ zu verulken?<br />
Seehofer: „Zar Peter“, das ist doch was<br />
Nettes. Manche Medien sagen ja auch zu<br />
mir „König Horst“. Ich habe dies nie als<br />
Verulkung gesehen.<br />
SPIEGEL: Am schlimmsten traf es Finanzminister<br />
Markus Söder: Er sei von Ehrgeiz<br />
zerfressen und arbeite in der Politik<br />
zu oft mit „Schmutzeleien“. Inwiefern<br />
hat das zum Erfolg beigetragen?<br />
Seehofer: Ich hatte meine Gründe. Markus<br />
Söder ist wieder Finanzminister in meinem<br />
Kabinett und leistet gute Arbeit für<br />
Bayern.<br />
SPIEGEL: Sie sind im Laufe Ihrer Karriere<br />
bekannt geworden für Wortkreationen:<br />
Dazu gehören nicht nur die „Schmutzeleien“,<br />
sondern auch Begriffe wie „Ichlinge“.<br />
Wären Sie selbst gern Journalist<br />
geworden?<br />
Seehofer: Ja. Am Anfang meiner politischen<br />
Tätigkeit habe ich oft gedacht: Ich<br />
würde gern auf der Seite der Journalisten<br />
sitzen. Die haben ein schönes Leben.<br />
SPIEGEL: Herr Seehofer, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
PETER ROGGENTHIN / DER SPIEGEL
EADS-Manager Enders, Kanzlerin<br />
Merkel auf Luftfahrtmesse in Berlin<br />
GETTY IMAGES<br />
Im Februar 2010 stiegen „Eurofighter“<br />
der deutschen Luftwaffe in den Himmel<br />
und flogen gen Osten. Ein Tankflugzeug<br />
begleitete sie, ferner eine Frachtund<br />
eine Transportmaschine mit Tech -<br />
nikern. Das Angriffsziel der Deutschen<br />
lautete: Indien. Dort galt es, zugunsten<br />
des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS,<br />
eines Herstellers des „Eurofighters“, einen<br />
Deal zu erstreiten. 126 Kampfflugzeuge<br />
wollte die Regierung in Neu-Delhi<br />
kaufen, eine indische Zeitung nannte es<br />
die „Mutter aller Rüstungsgeschäfte“, Gesamtwert:<br />
bis zu 14 Milliarden Euro.<br />
Der Gegenangriff kam nicht nur aus<br />
den USA, sondern von den lieben Partnern<br />
aus der Europäischen Union: Die<br />
Franzosen starteten einen eigenen Werbefeldzug<br />
für ihren nationalen Prestigejet<br />
„Rafale“. Und auch die Schweden priesen<br />
ihren Jet „Gripen“ aus dem Hause Saab.<br />
Tagelang donnerten die deutschen Luftwaffenpiloten<br />
über den indischen Subkontinent.<br />
Rund 20 Millionen Euro kostete<br />
der Feldzug, doch er blieb erfolglos<br />
– am Ende erhielt Frankreich den Vorzug.<br />
30<br />
VERTEIDIGUNG<br />
Brennende Unterhosen<br />
Kanzlerin Merkel predigt den EU-Partnern gern wirtschaftliche<br />
Vernunft. Diese fehlt aber in der Rüstungspolitik. Europas Bürger<br />
zahlen die Quittung: mindestens 26 Milliarden Euro pro Jahr.<br />
So geht es in Europas Rüstungsindu -<br />
strie zu: Winkt irgendwo auf der Welt ein<br />
Großauftrag, dann ziehen die europäischen<br />
Nationen gegeneinander ins Feld.<br />
Wollen sie hingegen selbst militärische<br />
Ausrüstung anschaffen, schotten sie sich<br />
ab, schalten alle Regeln der Vernunft und<br />
des Marktes aus, oft genug, um die heimische<br />
Rüstungsindustrie zu schützen.<br />
Zu viel Wettbewerb nach außen, kein<br />
funktionierender Binnenmarkt innerhalb<br />
der EU, so betreiben die nationalen Regierungen<br />
in der Praxis das, was sie auf<br />
dem Papier eine „Gemeinsame Sicherheits-<br />
und Verteidigungspolitik“ nennen.<br />
„Die Fragmentierung des europäischen<br />
Rüstungsmarktes ist ein großes Problem“,<br />
sagt der Chef des EU-Militärstabs, der<br />
österreichische General Wolfgang Wosolsobe.<br />
„Wenn wir nicht umsteuern, stellt<br />
sich langfristig die Frage, ob wir als EU<br />
unsere Autonomie in der Verteidigungspolitik<br />
wahren können.“<br />
Die Verlierer dieser verfehlten Politik<br />
sind vor allem die europäischen Steuerzahler.<br />
Hohe Milliardenbeträge werden<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Jahr für Jahr verschwendet, weil die EU-<br />
Regierungen nationale Eigenheiten pflegen,<br />
statt Systeme anzuschaffen, die bereits<br />
existieren oder gemeinsam günstiger<br />
zu produzieren wären.<br />
Das Durcheinander schadet auch den<br />
Rüstungskonzernen. „Wir haben die EU<br />
nicht geschaffen, um einheitliche Glühbirnen,<br />
Toilettenspülungen oder Bananengrößen<br />
zu bekommen“, zürnt EADS-Vorstandschef<br />
Tom Enders. „Wir haben die<br />
EU geschaffen, um die großen Schicksalsfragen<br />
gemeinsam zu lösen und Europa<br />
eine angemessene Rolle in der Welt zwischen<br />
Amerika und Asien zu geben.“<br />
Die Realität sieht anders aus. Ohne die<br />
USA wäre Europa militärpolitisch ein<br />
Zwerg. Im Libyen-Krieg ging Franzosen<br />
und Briten bald die Munition aus, schnelle<br />
Krisenreaktion bleibt der Initiative einzelner<br />
Hauptstädte überlassen. Selbst die<br />
EU-Battlegroups, eigentlich innerhalb weniger<br />
Tage einsatzbereit, durften seit ihrer<br />
Gründung 2003 noch nie die Kasernen<br />
verlassen, weil vor allem eines fehlt: ein<br />
politischer Wille aller Europäer.<br />
Eigentlich wollten die EU-Staats- und<br />
Regierungschefs auf ihrem Gipfel Ende<br />
kommender Woche in Brüssel die Verteidigungspolitik<br />
zur Chefsache erklären.<br />
Aber die Tagesordnung des Gipfels ist<br />
mittlerweile so dichtgedrängt, dass die<br />
Chefs, wenn es gut läuft, über Sicherheitspolitik<br />
noch kurz beim Abschlussmittag -<br />
essen reden können. Mehr als ein paar<br />
Absichtserklärungen werden nicht erwartet,<br />
aber einige wenigstens in die richtige<br />
Richtung: mehr Markt, mehr Wettbewerb.
<strong>Deutschland</strong><br />
EADS-Chef Enders warnt: „Wenn jetzt<br />
nicht den Worten auch Taten folgen, dann<br />
ist der Abstieg in die dritte Liga nicht<br />
mehr aufzuhalten.“<br />
Es besteht Handlungsbedarf. Die nationalen<br />
Wehretats in Europa sind in den<br />
vergangenen zwölf Jahren in der Summe<br />
deutlich gesunken. Die Euro-Schuldenkrise<br />
hat bei den Verteidigungsministern<br />
jede Hoffnung begraben, dass sich dieser<br />
Trend in den nächsten Jahren umkehren<br />
könnte. Gaben die EU-Mitgliedsländer<br />
2001 insgesamt noch 251 Milliarden Euro<br />
für Verteidigung aus, belief sich das<br />
Budget aller Europäer 2012 auf nur<br />
190 Mil liarden. Zwar gibt die EU immer<br />
noch mehr für Verteidigung aus als China,<br />
Russland und Japan zusammen, aber<br />
das meiste Geld geht für Personal drauf.<br />
Ausrüstung und Forschung kommen zu<br />
kurz.<br />
Als Ausweg galt in der EU wie auch in<br />
der Nato lange eine Zauberformel, die<br />
im Militärjargon „Pooling & Sharing“<br />
heißt: Einzelne Länder sollen sich auf<br />
bestimmte militärische Fähigkeiten spezialisieren<br />
und sie dann anderen zur Ver -<br />
fügung stellen. Doch das vielgepriesene<br />
Konzept steckt noch immer in den Kinderschuhen.<br />
Auf 300 Millionen Euro belaufen<br />
sich bislang die Einsparungen<br />
durch „Pooling & Sharing“. In derselben<br />
Zeit wurden die Verteidigungsbudgets jedoch<br />
um 30 Milliarden Euro gekürzt, hundertmal<br />
so viel.<br />
Die größte Verschwendung entstehe,<br />
weil der Binnenmarkt im Rüstungssektor<br />
praktisch außer Kraft gesetzt sei, schreibt<br />
der Wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments<br />
in einer aktuellen Studie. Die<br />
Analyse mit dem Titel „Die Kosten von<br />
Nicht-Europa“ zählt auf 88 Seiten schonungslos<br />
die Missstände der europäischen<br />
Verteidigungspolitik auf: „Verschwenderische<br />
Überkapazitäten, Duplikationen,<br />
fragmentierte Industrien und Märkte“<br />
werden vorrangig genannt. 73 Prozent<br />
der Beschaffungsvorhaben würden bis<br />
heute nicht europaweit ausgeschrieben.<br />
„Zusammenarbeit bleibt die Ausnahme“,<br />
so die Experten.<br />
Die Mehrkosten, die deswegen entstehen,<br />
belaufen sich, konservativ gerechnet,<br />
auf mindestens 26 Milliarden Euro pro<br />
Jahr. Maximal könnten sich die verschwendeten<br />
Steuergelder auf bis zu 130<br />
Milliarden Euro summieren. Allein bei<br />
der Munition für ihre Armeen könnten<br />
Europas Klein-Klein Entwicklungskosten und Anzahl produzierter Kampfjets<br />
Eurofighter<br />
<strong>Deutschland</strong>, Großbritannien,<br />
Italien, Spanien<br />
Gripen<br />
Schweden<br />
Rafale Frankreich<br />
Joint Strike Fighter USA<br />
DEFENSEIMAGERIE E. VIKNE GONZALO FUENTES / REUTERS<br />
US-NAVY<br />
die EU-Länder zwei Milliarden Euro im<br />
Jahr sparen, wenn sie wirklich europäisch<br />
handelten. Rechtlich ist das schon lange<br />
möglich. Doch meist berufen sich die Regierungen<br />
auf eine Ausnahmeklausel des<br />
EU-Vertrags, die Einschränkungen des<br />
Wettbewerbs zulässt, wenn die „nationale<br />
Sicherheit“ eines Landes berührt ist – in<br />
Zeiten einer gemeinsamen Verteidigungspolitik<br />
ein Anachronismus.<br />
Die Amerikaner machen vor, wie man<br />
den Verteidigungsetat effizienter einsetzt.<br />
Das illustriert ein Blick auf die Luftfahrtindustrie.<br />
Zusammen kostet die Entwicklung<br />
der europäischen Kampfflugzeuge<br />
„Eurofighter“, „Rafale“ und „Gripen“<br />
10,23 Milliarden Euro mehr als beim amerikanischen<br />
Joint Strike Fighter. Auch produzieren<br />
die Amerikaner mit geringeren<br />
Entwicklungskosten höhere Stückzahlen.<br />
Die Hersteller der drei europäischen Flugzeuge<br />
bauen 1205 Jets, 1800 weniger als<br />
die Amerikaner.<br />
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis europäischer<br />
Verteidigungspolitik ist entsprechend<br />
miserabel. In der EU gibt es 16 große<br />
Werften für Kriegsschiffe, in den USA<br />
ganze 2. Zudem existieren in Europa 16<br />
verschiedene Fregattenklassen, obwohl<br />
nur noch 2 überhaupt hergestellt werden.<br />
Auch <strong>Deutschland</strong>, das anderen EU-Partnern<br />
wirtschaftliche Vernunft predigt,<br />
trägt mit Projekten für die Bundeswehr<br />
seit Jahren dazu bei, dass Europas Steuerzahler<br />
für ineffiziente Rüstungsprojekte<br />
mehr Geld ausgeben als nötig.<br />
Beim europäischen Großprojekt „Eurofighter“<br />
etwa haben die vier Herstellerstaaten<br />
<strong>Deutschland</strong>, Großbritannien,<br />
Italien und Spanien von Beginn an statt<br />
effizienter Gemeinschaftsproduktion vor<br />
allem die Interessen der eigenen Industrie<br />
im Blick gehabt. Die Folge sind zum Teil<br />
haarsträubende Reibungsverluste.<br />
So wird die Produktion des zweistrahligen<br />
Jagdflugzeugs seit Beginn nahezu<br />
unabhängig von wirtschaftlichen Kriterien<br />
auf die Partnerländer aufgeteilt.<br />
Selbst für die Endmontage des „Eurofighters“<br />
wurden vier verschiedene Produktionsstätten<br />
in den Ländern aufgebaut.<br />
Allein dadurch ging ein dreistelliger<br />
Millionenbetrag verloren.<br />
Da in allen vier Ländern Begehrlichkeiten<br />
bestehen, sich auch an den Entscheidungsprozessen<br />
rund um den „Euro -<br />
fighter“ zu beteiligen, entstehen zudem<br />
hohe Verwaltungskosten. Beim „Eurofighter“<br />
beraten Dutzende Ausschüsse<br />
wesentliche strategische Fragen, die Entscheidungen<br />
müssen einstimmig getroffen<br />
werden. Zum Teil vergehen Stunden,<br />
Tage und Wochen für einfache Entscheidungen,<br />
weil noch nicht jeder Partner<br />
alles abgenickt hat.<br />
Schaut man sich in der europäischen<br />
Rüstungsindustrie um, finden sich etliche<br />
Beispiele, bei denen die Staaten konkurrieren,<br />
statt zu kooperieren. Ob Kampf-<br />
Entwicklungskosten<br />
in Mrd. €<br />
19,5<br />
1,5<br />
8,6<br />
19,3<br />
Gebaute<br />
Einheiten<br />
707<br />
204<br />
Quelle: European Parliament Research Service<br />
294<br />
3003<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
31
<strong>Deutschland</strong><br />
panzer, Fregatten oder Cruise Missiles –<br />
überall könnten durch sinnvollere Absprachen<br />
Milliarden gespart werden. Allein<br />
für Schützenpanzer existierten vor wenigen<br />
Jahren 16 verschiedene Beschaffungsprogramme<br />
in Europa. Doch weil jeder<br />
nur die eigenen Interessen im Auge hat,<br />
bessert sich kaum etwas.<br />
Die Waffenschmieden kämpfen ohnehin<br />
schon mit schrumpfenden Rüstungsbudgets<br />
in Europa. Die Analysten von<br />
AlixPartners erwarten in absehbarer Zukunft<br />
keine größeren Rüstungsprojekte<br />
mehr in Europa und warnen davor, dass<br />
die Industrie an Innovationspotential verliere.<br />
Es trifft auch jenen Konzern, der<br />
einst von überzeugten Europapolitikern<br />
gegründet wurde: EADS. Dort erwartet<br />
man in den kommenden vier Jahren einen<br />
Einbruch im Auftragsbestand von<br />
heute 48 auf 31 Milliarden Euro. Das deutsche<br />
Verteidigungsministerium habe allein<br />
4 Milliarden Euro an festem Auftragsbestand<br />
wieder gestrichen.<br />
Es häufen sich demütigende Niederlagen<br />
bei großen internationalen Rüstungsvorhaben:<br />
Das Nato-Land Türkei droht,<br />
sein Luftverteidigungssystem lieber in China<br />
zu kaufen, Südkorea verschmäht den<br />
„Eurofighter“, Brasilien verprellt EADS<br />
in einem Sechs-Milliarden-Deal.<br />
In dieser Woche schreibt die unrühm -<br />
liche Geschichte der europäischen Rüstungsindustrie<br />
ein weiteres Kapitel: Tom<br />
Enders, der Chef des Rüstungsgiganten<br />
Es häufen sich demütigende<br />
Niederlagen bei<br />
großen internationalen<br />
Rüstungsvorhaben.<br />
EADS, verkündet den kompletten Umbau<br />
seiner Verteidigungssparte. Die wird<br />
nur noch ein Anhängsel der zivilen Luftfahrttochter<br />
Airbus sein. Und um die stolzen<br />
Ingenieure noch mehr zu demütigen,<br />
wird er auch den neuen Namenszug offiziell<br />
enthüllen: Airbus Defence & Space.<br />
Wie üblich bei solchen Aktionen werden<br />
auch hier Arbeitsplätze gestrichen<br />
und ganze Standorte geschlossen. Einer<br />
befindet sich in Unterschleißheim. In<br />
Manching, wo der „Eurofighter“ gebaut<br />
wird, zittert die Belegschaft ebenfalls. Die<br />
Zukunft ihrer Arbeitsplätze, so heißt es<br />
bei EADS, hänge direkt an der Frage, ob<br />
die Bundesrepublik weitere „Eurofighter“<br />
der neuesten Tranche 3b kauft.<br />
Das Großreinemachen bei EADS gilt<br />
als eine Reaktion darauf, dass die Bundesregierung<br />
vor gut einem Jahr einen<br />
Zusammenschluss zwischen EADS und<br />
dem Rüstungskonzern BAE Systems vereitelt<br />
hat. Die Kanzlerin persönlich hatte<br />
interveniert. Sie fürchtete, dass ihr Land<br />
Einfluss auf den strategisch so wichtigen<br />
34<br />
Konzern verlöre. Besonders im Blick hatte<br />
die Regierungschefin die Arbeitsplätze<br />
bei der Konzerntochter Airbus.<br />
Bei EADS hat man der Regierung immer<br />
noch nicht verziehen, dass sie den<br />
Deal verhindert hat. „Das ist jetzt die<br />
Quittung“, heißt es dort hinter vorgehaltener<br />
Hand zu den Stellenstreichungen.<br />
„Überall treffen wachsende Herausforderungen<br />
auf sinkende Budgets“, erklärt<br />
Enders. „Es liegt auf der Hand, dass wir<br />
die Sicherheit und Verteidigung Europas<br />
nur gemeinsam gewährleisten können.“<br />
Ein Lehrstück darüber, wie gemeinsame<br />
europäische Rüstungsprojekte straucheln,<br />
bietet das Transportflugzeug A400M. Neuerdings<br />
hakt es dort auch bei grundsätzlichen<br />
Fragen: Es fehlen für eine gemeinsame<br />
europäische Zulassung die notwendigen<br />
rechtlichen Grundlagen. Dafür hätten<br />
das europäische Parlament und die Kommission<br />
die notwendigen rechtlichen Vor -<br />
aussetzungen schaffen müssen. Doch das<br />
scheitert seit Jahr und Tag daran, dass kein<br />
Land seine hoheitlichen Rechte abtreten<br />
will. Jetzt spitzt sich die Lage zu: <strong>Deutschland</strong><br />
soll in 2014 seine erste A400M bekommen.<br />
Im Verteidigungsministerium<br />
jagt eine Krisensitzung die andere, weil<br />
das Zulassungsverfahren unklar ist.<br />
Mit absurder Folge: Das Ministerium<br />
schafft derzeit ein Luftfahrtamt der Bundeswehr,<br />
eine neue Behörde mit über 400<br />
Mitarbeitern, deren vornehmste Aufgabe<br />
es sein wird, Zulassungsrichtlinien für die<br />
A400M zu entwickeln. Keine europäischen<br />
wohlgemerkt, sondern zunächst<br />
mal deutsche. Immerhin: Das Problem<br />
der europaweiten Zulassung haben sich<br />
die Staats- und Regierungschefs für ihren<br />
Gipfel in die Papiere schreiben lassen. Der<br />
EU-Ministerrat forderte Ende November<br />
„greifbare Maßnahmen für Standards und<br />
Zertifizierung“, um „Kosten zu senken“.<br />
In der Praxis stoßen solche Vorsätze<br />
jedoch wiederholt auf große Vorbehalte,<br />
selbst bei simpelsten Produkten.<br />
So wurde auch im Verteidigungsministerium<br />
schon erwogen, ob etwa Unterhemden<br />
und -hosen nicht in größeren<br />
Stückzahlen viel billiger sein könnten,<br />
wenn ein Modell für alle Soldaten der<br />
EU-Staaten beschafft würde. Doch dann<br />
stellte sich heraus, dass Standards der<br />
Bundeswehr detailliert vorschreiben, bis<br />
zu welcher Gradzahl die Unterhosen<br />
nicht in Flammen aufgehen sollen. Ob<br />
das im Notfall, wenn etwa ein Panzer in<br />
Brand gerät, wirklich schon das Leben<br />
eines Soldaten gerettet hat, ist unklar. Andere<br />
Länder zumindest haben diese Vorgabe<br />
nicht, trotzdem will die Bundeswehr<br />
dabei bleiben.<br />
Aber wenn selbst Unterhosen eine Frage<br />
der nationalen Sicherheit sind, dann<br />
steht es wirklich schlecht um die gemeinsame<br />
europäische Verteidigungspolitik.<br />
GORDON REPINSKI, CHRISTOPH SCHULT,<br />
GERALD TRAUFETTER<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
FREDRIK VON ERICHSEN / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
CDU-Politiker Bouffier, Computergrafik des dritten<br />
UNION<br />
Revolution ohne<br />
Pathos<br />
Für Hessens Regierungschef Bouffier<br />
ist Schwarz-Grün kein Pro -<br />
jekt. Er will pragmatisch Probleme<br />
lösen. Das könnte für den Flug -<br />
hafen Frankfurt gefährlich werden.<br />
Am Ende bricht es doch aus Volker<br />
Bouffier heraus, nun blitzt auch<br />
das typische schiefe Bouffier-Grinsen<br />
auf. Der hessische Regierungschef<br />
sitzt in einem breiten Ledersessel im Empfangssaal<br />
seiner Staatskanzlei in Wiesbaden,<br />
einem ehemaligen Kurhotel. An den<br />
Wänden glitzern Spiegel, auf einem Tischchen<br />
steht eine Etagere mit Plätzchen.<br />
Eine Servierdame schenkt Kaffee ein.<br />
Es geht um die Frage, ob er jetzt mit<br />
Schwarz-Grün in Hessen Geschichte für<br />
die ganze Republik schreibt. Bouffier hat<br />
über eine Stunde lang alles versucht, die<br />
hessische Revolution kleinzureden. „Ich<br />
will hier nichts überhöhen“, sagt er und<br />
tut es schließlich doch. „Wenn wir hier<br />
fünf Jahre lang stabil und erfolgreich regieren,<br />
hat das natürlich Signalwirkung<br />
über Hessen hinaus.“<br />
Mit Schwarz-Grün tritt Bouffier aus<br />
dem Schatten seines Vorgängers Roland<br />
Koch. Bislang war er wenig mehr als der<br />
Nachlassverwalter seines polemischen<br />
und zupackenden Vorgängers. Jetzt könnte<br />
der kumpelhafte Ministerpräsident,<br />
den sie in Hessen immer nur „Bouffi“<br />
nennen, zum Trendsetter für die Bundes-<br />
CDU werden. Ausgerechnet der einstige<br />
Prinz Charles von Wiesbaden, der jahrelang<br />
auf seinen Aufstieg zum Landesvater<br />
warten musste, bereitet den Weg für die<br />
erste schwarz-grüne Regierung in einem
Terminals am Frankfurter Flughafen: Auf einmal keine Priorität mehr<br />
großen Flächenland. Kanzlerin Angela<br />
Merkel richtet ihr Augenmerk auf das hessische<br />
Experiment. Seit die FDP aus dem<br />
Bundestag flog, ist Merkels Partei auf der<br />
Suche nach neuen Bündnispartnern für<br />
die Zukunft.<br />
Es ist ein später und unerwarteter Frühling<br />
für Bouffier. Und langsam wird deutlich,<br />
wie hoch der Preis ist, den die Union<br />
für Schwarz-Grün zu zahlen bereit ist.<br />
Der Ausbau des Frankfurter Flughafens,<br />
den die Hessen-CDU in den vergangenen<br />
Jahrzehnten so vehement verteidigt hat<br />
wie ihr Nein zum Doppelpass, hat plötzlich<br />
kaum noch Priorität. Und die Nachtruhe<br />
der Bürger zwischen Flörsheim und<br />
Frankfurt-Süd ist auf einmal auch für die<br />
Union ein drängendes Anliegen, wichtiger<br />
jedenfalls, als den wichtigsten Arbeitgeber<br />
der Region zum globalen Drehkreuz<br />
auszubauen.<br />
Wie schnell man in der Politik neue<br />
Freunde gewinnt, durfte Bouffier am Freitag<br />
vor einer Woche beim Bundespresseball<br />
erleben. Kurz nachdem er den Saal<br />
betreten hatte, hielt ihn Grünen-Chef<br />
Cem Özdemir auf, und auch Claudia<br />
Roth scheute Bouffiers Nähe nicht.<br />
Hauptstadtjournalisten suchten das Gespräch<br />
mit ihrem neuen Helden. Toll, wie<br />
er das mit den Grünen mache, klopfte<br />
ihm einer auf die Schulter. Was in Hessen<br />
passiere, sei nicht weniger als die Aussöhnung<br />
der Schwarzen mit den 68ern.<br />
„Kann sein“, sagt Bouffier wenige Tage<br />
später in Wiesbaden und schüttelt skeptisch<br />
den Kopf. Ihm geht es nicht um Aussöhnung,<br />
er will das Fundament für eine<br />
stabile Regierung mauern.<br />
Wie immer wirkt er ein bisschen aus<br />
der Zeit gefallen mit seinem akkuraten<br />
Scheitel, dem weiten Jackett und der<br />
breitgestreifen Krawatte. Politische Avantgarde<br />
sähe anders aus. Aber Schwarz-<br />
Grün ist für ihn auch kein gesellschaftspolitisches<br />
Projekt. Bouffier sieht das<br />
ganz pragmatisch. Ihm geht es um die<br />
Probleme, die Schwarz-Grün am besten<br />
lösen könne.<br />
Zum Beispiel, dass ältere Bürger, die<br />
in immer dünner besiedelten Gegenden<br />
auf dem Land wohnen, auch künftig den<br />
Arzt in der Kreisstadt besuchen können.<br />
„Da helfen keine großen Masterpläne, da<br />
hilft nur ein Sammeltaxi“, sagt er. Angesichts<br />
der Mythen, die Schwarz-Grün seit<br />
Jahren umgeben, wirkt Bouffiers Bodenständigkeit<br />
fast wie Hohn. Aber Bouffier<br />
ist überzeugt, dass Schwarz-Grün als<br />
Vision der politischen Elite keine Chance<br />
hat. Die schwarz-grüne Revolution müsse<br />
von unten kommen.<br />
Das Wurzelwerk in Hessen reicht ja<br />
schon tief. In Darmstadt etwa und vor<br />
allem in Frankfurt arbeiten Schwarze und<br />
Grüne vertrauensvoll zusammen. Dieses<br />
lokale Geflecht bietet Bouffier die Gewissheit,<br />
dass es auch im Landtag klappen<br />
könnte. Pathos schadet da nur.<br />
Bouffier redet von der Schulpolitik,<br />
über den unvermeidbaren Abbau von Beamtenstellen<br />
und von soliden Finanzen.<br />
„Natürlich hat Schwarz-Grün eine gewisse<br />
Exotik“, sagt er. „Aber es gibt gerade<br />
in der Landespolitik eine Reihe von Themen,<br />
wo wir mit den Grünen näher beisammen<br />
sind als mit der SPD.“<br />
Nicht wenige in der einst männer -<br />
bündisch organisierten Hessen-CDU sehen<br />
diese Entwicklung mit Sorge. Zwar<br />
sagt Bouffier, dass seine CDU ihre Grundüberzeugungen<br />
bei den Verhandlungen<br />
mit den Grünen nicht preisgeben will.<br />
„Die Hessen-CDU ist keine Palme im<br />
Wind.“ Doch vor allem beim hessischen<br />
Dauerstreitthema Flughafen ist Bouffier<br />
zu bedeutenden Zugeständnissen bereit.<br />
Bislang galten die Wettbewerbsfähigkeit<br />
und die wirtschaftliche Entwicklung<br />
des größten deutschen Flughafens für<br />
eine Regierung unter Führung der Union<br />
als nicht verhandelbar. Doch jetzt zeigt<br />
sich Bouffier erstaunlich biegsam. Jahrelang<br />
hatte sich die CDU dafür stark -<br />
gemacht, das Nachtflugverbot in engen<br />
Grenzen zu halten, damit der Frankfurter<br />
Airport im Wettbewerb mit anderen<br />
Drehkreuzen wie Dubai konkurrenzfähig<br />
FRAPORT / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
bleibt. Mit ihm werde „dieser Flughafen<br />
nicht kleingemacht“, sagte Bouffier bis<br />
vor kurzem.<br />
Jetzt kann sich der Ministerpräsident<br />
auf einmal mit längeren „Lärmpausen“<br />
anfreunden. Seine Fachpolitiker knobeln<br />
mit den Grünen an Modellen, jeweils<br />
zwei der insgesamt vier Start- und Lande -<br />
bahnen abwechselnd mal morgens und<br />
mal abends je eine Stunde länger zu<br />
schließen. Selbst der Neubau des dritten<br />
Terminals hat auf einmal keine Priorität<br />
mehr. Der Baubeginn könnte bis nach<br />
der nächsten Landtagswahl im Jahr 2018<br />
verschoben werden, heißt es nun.<br />
Vor allem aber ist Bouffier bereit, den<br />
Grünen das schärfste Schwert in die Hand<br />
zu geben, die Fraport und die Flug -<br />
gesellschaften weiter zu gängeln und zu<br />
kostspieligen Zugeständnissen zu zwingen.<br />
Hessens Grünen-Chef Tarek Al-<br />
Wazir soll in Bouffiers Kabinett neuer<br />
Verkehrsminister werden und hätte damit<br />
direkten Zugriff auf wichtige Abläufe am<br />
Flughafen. Als zuständiger Minister könnte<br />
er beispielsweise die bestehenden Ausnahmeregelungen<br />
für das Nachtflugverbot<br />
verschärfen – oder zumindest damit<br />
drohen, um den Einsatz leiserer Flug -<br />
zeuge am späten Abend durchzusetzen.<br />
Der Fraport und ihrem Hauptkunden,<br />
der Lufthansa, bereitet die neue Beweglichkeit<br />
der Hessen-CDU keine Freude.<br />
Als erste Gerüchte über eine Ausweitung<br />
des Nachtflugverbots aufkamen, schrieb<br />
der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Chris -<br />
toph Franz gemeinsam mit Flughafen-<br />
Chef Stefan Schulte und den Bossen von<br />
Chartergesellschaften wie TUIfly und<br />
Condor am 26. November einen Brandbrief<br />
an Bouffier. Ihre Unternehmen trügen<br />
schon jetzt „erhebliche Kosten“ für<br />
den Schallschutz, heißt es darin. Betriebsbeschränkungen<br />
dürften „nur als letztes<br />
Mittel“ ergriffen werden, schließlich sei<br />
Frankfurt „unter den weltweit zehn größten<br />
Airports der einzige mit striktem<br />
Nachtflugverbot“.<br />
Auf Bouffiers Schreibtisch stapeln sich<br />
derzeit eine ganze Menge solcher Briefe,<br />
es ist der anschwellende Widerstand der<br />
Wirtschaft gegen Schwarz-Grün. Auch<br />
die Kanzlerin hatte sich anfangs skep -<br />
tisch gezeigt. Aber aus anderem Grund:<br />
Schwarz-Rot in Hessen hätte die Dinge<br />
für Merkels Regierung leichter gemacht,<br />
vor allem im Bundesrat wäre eine<br />
schwarz-rote Mehrheit dann in Sichtweite<br />
gewesen. Trotzdem akzeptierte sie Bouffiers<br />
Willen. „Das müsst ihr entscheiden“,<br />
sagte sie ihm.<br />
Als er sich verabschiedet, stellt sich<br />
Bouffier vor eine Spiegelwand und rückt<br />
Krawatte und Scheitel zurecht. Dann öffnet<br />
er die Tür und geht davon. Wochenlang<br />
hat er verhandelt, heute hat er einen<br />
Bürotag. Die Beschwerdebriefe der Wirtschaft<br />
warten.<br />
MATTHIAS BARTSCH,<br />
DINAH DECKSTEIN, PETER MÜLLER<br />
DER SPIEGEL 50/2013 35
STUTTGART 21<br />
Privater Natur<br />
Stefan Mappus glaubte, seine<br />
Dienst-Mails gelöscht zu haben. Nun<br />
sind einige wieder da – und<br />
verraten die Umstände des brutalen<br />
Polizeieinsatzes von 2010.<br />
Die Besprechung im baden-württembergischen<br />
Verkehrsministerium<br />
kreiste um ein heikles Thema:<br />
Stuttgart 21, die dramatischen Bürgerproteste<br />
rund um den Bahnhofsneubau, die<br />
anstehende Rodung im Schlossgarten.<br />
Entgegen allen Gepflogenheiten wurde<br />
kein Protokoll der Sitzung erstellt.<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
Wasserwerfereinsatz in Stuttgart 2010: „Nicht wegducken, sondern kämpfen“<br />
36<br />
Was beschlossen wurde an diesem Montag,<br />
dem 20. September 2010, ist aus einer<br />
anderen Quelle zu erfahren. Denn am<br />
nächsten Tag um 16.33 Uhr brachte Verkehrsministerin<br />
Tanja Gönner Ministerpräsident<br />
Stefan Mappus auf den neuesten<br />
Stand: „Es wurde gestern vereinbart, dass<br />
die Bäume ab dem 1.10. gefällt werden.<br />
Ziel ist, dass bis zu deiner Regierungserklärung<br />
alles mit den Bäumen erledigt ist!“<br />
Mappus, der Gönner zu seinen engsten<br />
Vertrauten zählte, quittierte die E-Mail<br />
mit den Worten: „Super, vielen Dank.“<br />
Die elektronische Post, die jetzt aufgetaucht<br />
ist, gibt einen Eindruck von den<br />
Prioritäten, die die Landesregierung im<br />
Umgang mit dem demonstrierenden Volk<br />
setzte. Nach der Besprechung im Ministerium<br />
war klar: Am 30. September wird<br />
der von Tausenden Protestlern besetzte<br />
Schlossgarten geräumt, am 1. Oktober<br />
werden die Bäume gefällt. Denn eine Woche<br />
später soll Mappus in seiner Regierungserklärung,<br />
mit der Attitude des Machers,<br />
die Stuttgart-21-Problematik für erledigt<br />
erklären können.<br />
In den vergangenen drei Jahren wurde<br />
viel darüber spekuliert, warum es am<br />
30. September bei der Räumung des Parks<br />
durch die Polizei zur Eskalation kam, zu<br />
furchterregenden Bildern, die um die Welt<br />
gingen; zu jenem „schwarzen Donnerstag“,<br />
bei dem 130 Demonstranten und<br />
6 Ordnungshüter verletzt wurden. Vor<br />
dem folgenden Untersuchungsausschuss<br />
wies Mappus jeden Zusammenhang zwischen<br />
dem Polizeieinsatz und seiner<br />
Regierungserklärung zurück: Seine Rede<br />
im Landtag habe für den Termin der Fällaktion<br />
„keine Rolle gespielt“.<br />
Nun könnte Mappus’ Zeugenaussage<br />
von Ende 2010 ein Nachspiel haben. Ein<br />
ganzer Schwung von E-Mails aus jener<br />
Zeit nährt Zweifel an der von ihm verbreiteten<br />
Version der Ereignisse. Denn<br />
ähnlich und am selben Tag wie Gönner<br />
informierte Abteilungsleiter Michael<br />
Kleiner den Chef der Staatskanzlei, Hubert<br />
Wicker. In einer Mail heißt es unter<br />
Punkt 7: „Ziel: MP muss im Landtag sagen<br />
können, dass – im Schlossgarten –<br />
zunächst (in dieser Fällperiode) keine<br />
weiteren Bäume gefällt werden.“<br />
Die Quellen sind denkbar hochwertig.<br />
Die E-Mails stammen unter anderem aus<br />
Mappus’ Account im Staatsministerium.<br />
Und dass es sie überhaupt noch gibt,<br />
kommt einem Wunder gleich.<br />
Denn eigentlich hatte Stefan Mappus<br />
die Daten gelöscht. Nach seiner Abwahl<br />
und vor dem Auszug aus der Staatskanzlei<br />
hatte er sicherheitshalber sogar seine<br />
Festplatte ausbauen und zerstören lassen.<br />
Was der Christdemokrat indes nicht<br />
ahnte: Weil ihn im heißen Herbst 2010<br />
Probleme mit seinem elektronischen Kalender<br />
plagten, hatte eine externe Firma<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
MARIJAN MURAT / DPA<br />
Sicherheitskopien erstellt. Und als im<br />
Sommer 2012 die Staatsanwaltschaft<br />
Stuttgart im Zuge ihrer Ermittlungen wegen<br />
des umstrittenen EnBW-Milliarden-<br />
Deals Mappus’ Eigenheim sowie die<br />
Staatskanzlei durchsuchte, fanden sich<br />
besagte Kopien.<br />
Monatelang kämpften Mappus’ Anwälte<br />
dafür, dass das Material von der aktuellen<br />
grün-roten Landesregierung nicht<br />
ausgewertet werden dürfe – aus „Datenschutzgründen“,<br />
die E-Mails seien „privater<br />
Natur“.<br />
In Wahrheit illustrieren sie nicht nur<br />
den Zeitdruck, unter dem alle standen.<br />
Sie werfen auch ein Schlaglicht auf den<br />
Umgang der CDU-Regierung mit dem U-<br />
Ausschuss. In einer Nachricht vom 4. November<br />
2010 unterrichtet Michael Pope,<br />
damals Referatsleiter Innenpolitik und<br />
Verkehr, das Büro Mappus und weitere<br />
Beamte über die Aktenweitergabe an den<br />
Ausschuss. „Die Aktenlage ist z. T. noch<br />
immer unübersichtlich. Frühestens ab<br />
dem 8.11. kann übersehen werden, wie<br />
lange wir für eine widerspruchsfreie Aufarbeitung<br />
der Akten benötigen, um spätere<br />
,Überraschungen‘ in Form von neuen<br />
Schriftstücken zu vermeiden.“<br />
Wurden die Akten also so lange bearbeitet,<br />
bis sie keine Gefahr für Mappus<br />
darstellten? Und wurden alle Unterlagen<br />
übergeben?<br />
Früh äußerte die Opposition im Landtag<br />
den Verdacht, dass ihr Dokumente<br />
vorenthalten wurden; belegen konnte sie<br />
ihn aber nicht. Auf Nachfrage erklärt das<br />
Staatsministerium, dass weder die nun<br />
aufgetauchte Mail von Gönner noch jene<br />
von Kleiner in dem Ordner zu finden seien,<br />
der 2010 dem Ausschuss übergeben<br />
worden war.<br />
Auch über die Marschrichtung der Regierung<br />
gegenüber den wütenden Bahnhofsgegnern<br />
findet sich in den E-Mails<br />
manch Erhellendes. So empfahl Dirk<br />
Metz, einst Roland Kochs Sprecher in<br />
Hessen und späterer Mappus-Berater, bereits<br />
im Sommer 2010 für den Umgang<br />
mit den S21-Protesten: „Nicht wegducken,<br />
sondern kämpfen.“ Mappus solle<br />
das Bild eines „entschlossenen MP, der<br />
nicht zurückweicht“, verkörpern.<br />
Diese und andere E-Mails – ausgedruckt<br />
füllen sie drei Ordner – sind Bestandteil<br />
der Ermittlungsakten in einem der letzten<br />
Verfahren, die zum Wasserwerfereinsatz<br />
noch anhängig sind. Beschuldigt sind zwei<br />
leitende Polizeibeamte, Anfang 2014 soll<br />
ihnen der Prozess gemacht werden.<br />
Mappus scheint angesichts des Gerichtsverfahrens<br />
weitere Überraschungen<br />
aus seinem E-Mail-Verkehr zu fürchten.<br />
Seine Anwälte beantragten Akteneinsicht<br />
beim Landgericht Stuttgart. Das Gesuch<br />
wurde jedoch im Oktober abgewiesen.<br />
Schließlich sei Mappus kein Verfahrensbeteiligter,<br />
befand das Gericht lapidar.<br />
SIMONE SALDEN
KARRIEREN<br />
Rette mich,<br />
wer kann<br />
Hans-Olaf Henkel soll für<br />
die AfD bei der Europawahl<br />
kandidieren. Der Ex-BDI-<br />
Chef bekommt so eine neue<br />
Bühne für seine steilen Thesen.<br />
Marktwirtschaft bedeutet für Hans-<br />
Olaf Henkel, auf die Erfolgreichen<br />
zu setzen. Im Jahr 2011 tingelte<br />
der Ex-BDI-Chef über die Veranstaltungen<br />
der Freien Wähler. Sie waren<br />
damals eine steigende Aktie, er pries die<br />
Minipartei als „Plattform für meine liberalen<br />
Ideale“ und verkündete, er sei „per<br />
Handschlag“ Mitglied geworden. Sogar<br />
eine Kandidatur zum Bundestag schloss<br />
er nicht aus, „wenn ich überzeugt bin,<br />
dass in der Partei Not am Mann ist“.<br />
Dann aber sank der Stern der Freien<br />
Wähler – und so auch Henkels Interesse<br />
an der Partei. Der Hans-Olaf Henkel von<br />
heute unterstützt nun die Alternative für<br />
<strong>Deutschland</strong> (AfD). Jetzt lobt er diese als<br />
„einzige Partei, die sich in Europa für<br />
Wettbewerb und Eigenverantwortung einsetzt“,<br />
was auch daran liegen könnte,<br />
dass die AfD ganz gute Chancen hat, im<br />
Mai in das Europaparlament einzuziehen.<br />
Henkel kann sich eine Kandidatur vorstellen:<br />
„Wenn ich überzeugt bin, dass<br />
man mich wirklich braucht.“<br />
Provokateur Henkel*: Einst Inventar der <strong>Talk</strong>shows<br />
Was anderen als Opportunismus ausgelegt<br />
würde, sieht Henkel offenbar als<br />
Chancenoptimierung. Hubert Aiwanger,<br />
Chef der Freien Wähler, ist seinem ehemaligen<br />
Aktivisten aber deshalb nicht<br />
gram. „Er denkt halt immer a bissl betriebswirtschaftlicher,<br />
auch in der Politik.“<br />
Nach Kosten und Nutzen eben.<br />
Schwer zu sagen, wer von der Kandidatur<br />
mehr profitieren würde. Der ewige<br />
Ex-Funktionär Henkel? Oder die Euro-<br />
* Mit Ehefrau Bettina Hannover und deren Schwester<br />
Almut beim Bundespresseball in Berlin.<br />
Gegner, die sich gerade für den Europawahlkampf<br />
rüsten? Zwar muss die AfD<br />
bei der Europawahl nur die Hürde von<br />
drei Prozent überspringen, das macht den<br />
Einzug sehr wahrscheinlich. Andererseits<br />
werden viele AfD-Landesverbände von<br />
Grabenkämpfen geplagt. Davon würde<br />
man gern mit einer hübschen Personalie<br />
ablenken. „Hans-Olaf Henkel wäre das<br />
ideale Aushängeschild für uns, kompetent<br />
und prominent“, sagt Günter Brinker,<br />
Chef der Berliner AfD, auf deren Ticket<br />
Henkel nach Brüssel reisen könnte.<br />
Schon bei der Bundestagswahl habe<br />
man mit ihm als Spitzenmann gelieb -<br />
äugelt, sagt Brinker. Letztlich stellten die<br />
Berliner aber den Ökonomen Joachim<br />
Starbatty auf. „Professor Starbatty ist aber<br />
auch schon 73 Jahre alt“, gibt Brinker zu<br />
bedenken. Nun wird Henkel im März 74,<br />
aber wenn es darum geht, mit Worten die<br />
Welt zu ändern, ist er frisch wie eh und<br />
je. „Wenn ich für die AfD antrete, dann,<br />
um Europa vor dem Euro zu retten, politisch<br />
wie ökonomisch“, sagt Henkel.<br />
Vergangenen Samstag wollte er die<br />
Eröffnungsrede zum europapolitischen<br />
Konvent der Berliner AfD halten. Presse -<br />
einladungen hatte die Partei reichlich verschickt.<br />
Henkel selbst auch. Noch ziert<br />
er sich aber vor der Kandidatur, und die<br />
AfD gönnt ihm viel Bedenkzeit. Theoretisch<br />
müsste Henkel sich erst auf dem<br />
Bundesparteitag in Aschaffenburg am<br />
25. Januar erklären, wo die AfD ihre Bundesliste<br />
zur Europawahl aufstellen wird.<br />
Finanziell hätte Henkel das Abenteuer<br />
Europa nicht nötig, auch nicht in Zeiten<br />
von Niedrigzinsen. Er sitzt in diversen<br />
Aufsichtsräten, und der Weltkonzern IBM<br />
dürfte bei der Rente früherer Top-Kräfte<br />
nicht knausern. Dagegen sind die<br />
Diäten eines EU-Abgeordneten<br />
Peanuts. Dafür würde sich das<br />
Mandat in politischer Aufmerksamkeit<br />
auszahlen, die Henkel seit<br />
einigen Jahren vermissen muss.<br />
Was hilft es, wenn er Finanz -<br />
minister Wolfgang Schäuble in seinem<br />
Buch „Profi der Täuschung“<br />
nennt und Angela Merkel „Kanzlerin<br />
Gespaltene Zunge“? Es hört<br />
keiner zu. Für unbequeme Wahrheiten<br />
werde man in <strong>Deutschland</strong><br />
„zur Sau gemacht“, sagte Henkel<br />
einst. Dass ihn seit Jahren kein relevanter<br />
Politiker mehr zur Sau machte, muss den<br />
Mann betrüben, der einst zum Inventar<br />
der <strong>Talk</strong>show-Republik zählte.<br />
Die relevanten Leute hören eben schon<br />
kaum hin, wenn ein CSU-Generalsekretär<br />
den EZB-Präsidenten beleidigt. War -<br />
um sollten sie also horchen, wenn ein<br />
Ex-Irgendwas über einen Minister lästert?<br />
Eigentlich könnte Hans-Olaf Henkel so<br />
ziemlich alles sagen, was ihm einfällt.<br />
Aber Narrenfreiheit zu genießen heißt ja<br />
irgendwie auch, ein Narr zu sein.<br />
MELANIE AMANN<br />
BABIRADPICTURE / ABP<br />
DER SPIEGEL 50/2013 37
<strong>Deutschland</strong><br />
ORGANVERGABE<br />
Die Welt des Dr. O.<br />
Seit August steht der Göttinger Transplanteur Aiman O. wegen Totschlags vor Gericht.<br />
In dieser Woche sagt erstmals eine Patientin aus, deren Krankendaten er manipuliert<br />
haben soll. Wird der Richter den Haftbefehl gegen den Arzt außer Vollzug setzen?<br />
Nachts wirken die beiden Bettenhäuser<br />
der Uni-Klinik Göttingen<br />
wie Festungen, die nichts erschüttern<br />
kann. Dabei spielen sich darin während<br />
der scheinbar stillen Stunden oft<br />
Szenen ab, die demütig machen. Weil sie<br />
zeigen, wie fragil das Leben ist, wie<br />
schmal der Grat zum Tod.<br />
In den frühen Morgenstunden des<br />
17. August 2010 ging es um das Leben von<br />
Marietta P., 48 Jahre alt. Narkotisiert und<br />
beatmet lag die Lehrerin im Operationssaal.<br />
Am Tisch stand Aiman O., ihr Arzt. Es<br />
gibt Chirurgen, die sagen, seine Fähigkeiten<br />
suchten ihresgleichen in <strong>Deutschland</strong>.<br />
Auch deshalb hatte sich Marietta P. ihm<br />
anvertraut. Ihre Leber war durch eine Hepatitis<br />
schwer geschädigt. Nun sollte sie<br />
eine neue bekommen.<br />
Gewöhnlich reicht der erste Hautschnitt<br />
bei einer Lebertransplantation<br />
vom unteren Brustbein bis zum Nabel.<br />
Dann arbeiten sich die Chirurgen mit einem<br />
Elektromesser durch Fettschicht, Bindegewebe<br />
und Bauchfell, bis die kranke<br />
Leber vor ihnen liegt. Die Arterie, Pfortader<br />
und Gallengang werden durchtrennt,<br />
die Lebervenen abgeklemmt, das Organ<br />
wird herausgeschnitten. Die neue Leber<br />
wird in umgekehrter Reihenfolge eingepflanzt.<br />
Eine Lebertransplantation kann Leben<br />
schenken, zugleich ist sie ein lebensbedrohlicher<br />
Eingriff. Die Patienten wählen<br />
einen Arzt aus, von dem sie glauben, dass<br />
er sie nach bestem Wissen und Gewissen<br />
behandelt. „Ich hätte nie für möglich gehalten,<br />
dass ich ihm mal in einem Gerichtssaal<br />
gegenübertreten müsste“, sagt<br />
Marietta P. über Aiman O.<br />
Doch genau dazu soll es an diesem<br />
Dienstag kommen. Marietta P. ist als Zeugin<br />
vor dem Landgericht Göttingen geladen.<br />
Sie ist die erste Patientin, die berichten<br />
wird, wie sie O. als Arzt, aber auch<br />
als Mensch erlebt hat. Und sie wird einen<br />
Satz von O. wiederholen, dessen Bedeutung<br />
sie so verkannt hat, damals.<br />
Seit einem Vierteljahr steht der 46-jährige<br />
Chirurg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft<br />
Braunschweig hat ihn wegen<br />
Körperverletzung mit Todesfolge in drei<br />
Fällen und wegen versuchten Totschlags<br />
STEFAN RAMPFEL / DER SPIEGEL (O.); STEFAN RAMPFEL / DPA (U.)<br />
Uni-Klinik Göttingen, Angeklagter O. (2. v. r.) Anwälte: „Der versteht davon doch gar nichts“<br />
38<br />
DER SPIEGEL 50/2013
in elf Fällen angeklagt. Er habe seine Patienten<br />
auf dem Papier kränker gemacht,<br />
um ihnen Lebern zuzuschustern. Angesichts<br />
des Organmangels in <strong>Deutschland</strong><br />
habe er in Kauf genommen, dass andere<br />
Patienten sterben könnten, weil sie nicht<br />
rechtzeitig ein rettendes Organ bekommen.<br />
O. ist nur wegen jener Fälle angeklagt,<br />
die die Ermittler belegt sehen. In Wahrheit<br />
haben interne wie externe Prüfer<br />
während seiner Zeit an der Uni-Klinik<br />
weitaus mehr Richtlinienverstöße identifiziert.<br />
Eine interne Kommission wertete<br />
61 von 85 geprüften Fällen als auffällig.<br />
Bei 27 Patienten war eine Lebertransplantation<br />
medizinisch nicht indiziert, in<br />
34 Fällen wurden Patientendaten gefälscht,<br />
indem Blutwerte manipuliert<br />
oder nichterfolgte Dialysen angegeben<br />
wurden. Oder indem behauptet wurde,<br />
alkoholkranke Patienten seien gemäß der<br />
Vorschriften abstinent. O. bestreitet bis<br />
heute jede Form der Manipulation.<br />
Auch eine detaillierte Stellungnahme<br />
der Bundesärztekammer vom November,<br />
die dem SPIEGEL vorliegt, listet jene Fälle<br />
auf, die die Staatsanwälte nicht zur Anklage<br />
brachten. Danach wurden nicht nur<br />
Patienten transplantiert, die nicht so<br />
schwer krank waren, sondern auch solche,<br />
die bereits viel zu krank waren: Ein<br />
Patient etwa hätte eigentlich in Jena eine<br />
Leber bekommen sollen. Doch als die<br />
Chirurgen dort den Bauchraum öffneten,<br />
sahen sie, dass die Leber mit Tumorknoten<br />
übersät war, und brachen die Operation<br />
ab. Bei O. erhielt der Patient später<br />
eine Leber. Andere Patienten kamen direkt<br />
aus einer Entzugsklinik auf den Tisch<br />
von O.<br />
Selbst ohne diese Fälle ist der Göttinger<br />
Prozess ein Mammutverfahren. Mehr als<br />
40 Tage sind angesetzt, an 20 Terminen<br />
wurde bereits verhandelt. Doch trotz<br />
Zehntausender Aktenseiten wird es<br />
schwer, die konkreten Taten zu belegen.<br />
Und selbst wenn es gelänge: Wären die<br />
Verstöße dann überhaupt strafrechtlich<br />
relevant? Juristen sprechen von „Neuland“.<br />
Immerhin ist klargeworden, dass viele<br />
vom zweifelhaften Gebaren des Göt -<br />
tinger Transplanteurs wussten – doch niemand<br />
stoppte ihn. Nicht die Kollegen,<br />
nicht die Vorgesetzten, keine Staats -<br />
anwaltschaft oder die Bundesärzte -<br />
kammer.<br />
Marietta P. hat sich Notizen über ihren<br />
Krankheitsverlauf gemacht. Die heute 51-<br />
Jährige, eine schmale Frau in Jeans und<br />
blauem Pulli, sitzt auf einer Couch in ihrer<br />
Wohnung in der Nähe von Aachen.<br />
Sie hat sich für das Wiedersehen mit ihrem<br />
Arzt vorgenommen, niemanden anzuklagen<br />
und niemanden zu schonen.<br />
„So dankbar ich ihm bin, dass ich lebe,<br />
es entschuldigt nicht sein Fehlverhalten“,<br />
sagt sie.<br />
Seit zehn Jahren weiß die Deutschlehrerin,<br />
dass sie Hepatitis C hat. Vor vier<br />
Jahren diagnostizierten die Ärzte Leberzirrhose.<br />
Bald darauf juckte ihr ganzer<br />
Körper, sie bekam Ausschlag im Gesicht,<br />
und auch ihr Geist litt: Manchmal fielen<br />
ihr selbst einfache Wörter nicht mehr ein.<br />
Sie brauche eine neue Leber, sagten<br />
Ärzte. Irgendwann, je früher, desto besser.<br />
Da ihr Meld-Score, der für den Erhalt<br />
einer Spenderleber entscheidend ist, nur<br />
bei 9 lag, machten sie ihr aber wenig Hoffnung.<br />
Mit diesem Wert stand Marietta P.<br />
auf der Warteliste weit hinten. Die meisten<br />
Organe werden ab einem Meld-Score<br />
über 30 vergeben. Der Bruder der Lehrerin<br />
erklärte sich deshalb zu einer Lebendspende<br />
eines Teils seiner Leber bereit. Im<br />
März 2010 hatten die Geschwister ihren<br />
ersten Termin in der Uni-Klinik Göttingen.<br />
Als „kompetent“ und „extrem selbstbewusst“<br />
habe sie O. beim ersten Treffen<br />
empfunden, erzählt Marietta P., er habe<br />
sich selber eine „medizinische Koryphäe“<br />
genannt. Ihren Ängsten sei er mit Worten<br />
wie diesen begegnet: „Vertrauen sie mir,<br />
ich mache das schon.“<br />
Die Lebendspende sollte im November<br />
2010 stattfinden. Eine Ethikkommission<br />
hatte bereits zugestimmt. Sie sei die ideale<br />
Patientin für eine Lebendspende, habe<br />
O. gesagt: relativ jung, relativ gesund, das<br />
verspreche langfristigen Erfolg.<br />
Umso irritierter war Marietta P., als sie<br />
später erfuhr, dass sie auch auf der klinikinternen<br />
Liste für Organempfänger<br />
oben stand. „Warum man mich darauf gesetzt<br />
hat, weiß ich bis heute nicht“, sagt<br />
sie.<br />
Nur fünf Monate nach dem ersten Termin<br />
bei O. klingelte nachts um zwei das<br />
Telefon von Marietta P.: Es gebe eine Leber,<br />
aber sie müsse sich schnell entscheiden.<br />
Was die Patientin nicht wusste: Die<br />
Leber war ein sogenanntes Zentrums -<br />
angebot – das sind Organe, die nicht mehr<br />
über die zentrale Vergabestelle Eurotransplant<br />
(ET) im holländischen Leiden<br />
„Wir haben das für einen Irrtum gehalten. Ich hab<br />
noch zu ihm gesagt: Du bist doch topfit.“<br />
zugeteilt werden, weil sie von minderer<br />
Qualität sind.<br />
Im Göttinger Landgericht wird meist<br />
dienstags und donnerstags verhandelt. O.<br />
erscheint stets tadellos gekleidet, Sakko,<br />
Hemd, Krawatte, Manschettenknöpfe. Sein<br />
weißes Haar ist schütterer geworden in elf<br />
Monaten Untersuchungshaft. Zurückhaltung<br />
oder gar Scham scheinen ihm fremd:<br />
Er scherzt mit seinen Anwälten, zwinkert<br />
durch seine randlose Brille Menschen im<br />
Zuschauerraum zu . Immer wieder streckt<br />
er grinsend einen Daumen hoch, selbst an<br />
Tagen, an denen Angehörige von verstorbenen<br />
Patienten weinend im Saal sitzen.<br />
Richter, Staatsanwälte, Verteidigung<br />
und Nebenklage müssen sich durch komplizierte<br />
medizinische Sachverhalte rackern.<br />
Cholangiosepsis, Aszitis, Tipss-Anlage<br />
– nicht selten erläutert dann der Angeklagte<br />
dem Gericht Begriffe, eine<br />
merkwürdige Rollenverteilung.<br />
Bis vergangene Woche wurden die sogenannten<br />
Indikationsfälle verhandelt.<br />
O. soll drei Patienten Lebern verpflanzt<br />
haben, ohne dass eine medizinische Indikation<br />
bestanden habe. Der Bäcker Jürgen<br />
D., die Frührentnerin Margitta M.<br />
und der Elektriker Karl-Heinz T. starben.<br />
Jürgen D., 60, litt unter Leberzirrhose.<br />
Am 6. Oktober 2008 wurde er auf die<br />
Warteliste aufgenommen. Zu diesem<br />
Zeitpunkt hatte er einen Meld-Score von<br />
8. Erst ab einem Wert von 14 profitieren<br />
Patienten von einer Lebertransplantation.<br />
Sechs Tage später bekam D. ein Organ.<br />
Sein Körper stieß es ab. Er verstarb vier<br />
Monate nach einer zweiten Transplantation.<br />
Die Gutachter meinen, der Bäcker<br />
hätte anders behandelt werden müssen.<br />
Zudem trank D. zwar nicht mehr, war<br />
aber von einem Entzugsmittel abhängig.<br />
O. sieht sein Handeln bis heute als vertretbar<br />
an.<br />
Im Fall Margitta M. werfen ihm die<br />
Gutachter vor, er habe deren Erkrankung<br />
verkannt. Die gelernte Köchin war wenige<br />
Tage nach ihrer Transplantation im<br />
April 2011 im Alter von 55 Jahren verstorben.<br />
Sie habe eine chronische Entzündung<br />
der Bauchspeicheldrüse gehabt,<br />
erklärt ein Sachverständiger, keine Zirrhose.<br />
Er sagt, die Patientin hätte „mit<br />
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“<br />
ohne den Eingriff länger gelebt.<br />
Auch ein anderer Gutachter kann die<br />
Entscheidung zur Transplantation nicht<br />
nachvollziehen. „Der versteht davon gar<br />
nichts“, ruft O. in den Saal.<br />
Zuvor war er aufgestanden und hatte<br />
„den verehrten Vorsitzenden“ mit Power-<br />
Point die Gründe für seine medizinischen<br />
Entscheidungen präsentiert. Die Patientin<br />
habe heftige Blutungen gehabt, in immer<br />
kürzeren Abständen. Diese sind in den<br />
Akten aber nicht vermerkt.<br />
Der Patient Karl-Heinz T., 55, wurde<br />
mit einem Meld-Wert von 9 transplantiert,<br />
obwohl er in den anderthalb Jahren<br />
vor der Transplantation voll arbeitsfähig<br />
gewesen war und als Starkstromelektriker<br />
sogar Nachtschichten absolvierte.<br />
Der schicksalhafte Anruf kam für T.<br />
am 30. September 2010. Es gebe eine<br />
Leber für ihn. „Wir haben das für einen<br />
Irrtum gehalten“, berichtet seine Witwe,<br />
eine kleine Frau mit kurzen, braunen<br />
Haaren, dem Gericht. „Wir sind kurz<br />
zuvor noch im Urlaub im Elbsandstein-<br />
DER SPIEGEL 50/2013 39
<strong>Deutschland</strong><br />
gebirge rumgekraxelt. Ich hab<br />
noch zu ihm gesagt: Du bist<br />
doch topfit.“<br />
Warum sie die Leber dann<br />
angenommen hätten, provoziert<br />
der Vorsitzende Richter<br />
Ralf Günther. „Wir haben gedacht,<br />
dies Organ sei die passende<br />
Leber für meinen Mann.<br />
Ein Geschenk.“ Dann leiser:<br />
„Wir haben dem System, den<br />
Spezialisten vertraut.“<br />
Dass dieses Organ minderwertig<br />
war und deshalb direkt<br />
vergeben werden konnte, habe<br />
sie erst aus der Ermittlungsakte<br />
erfahren. Karl-Heinz T. verstarb<br />
ein Jahr nach der Operation.<br />
Zuvor hatte er noch eine zweite<br />
Leber bekommen.<br />
Der renommierte Göttinger<br />
Opferanwalt Steffen Hörning,<br />
der die Familie als Nebenkläger<br />
vertritt, fragte einen der Gutachter:<br />
„Würde Herr T. heute<br />
noch leben?“<br />
„Höchstwahrscheinlich ja.“<br />
Auch Marietta P. ging es<br />
schon kurz nach ihrer Transplantation<br />
schlecht. Ihr Körper<br />
stieß das fremde Organ ab: Sie<br />
wurde zitronengelb im Gesicht,<br />
der Abfluss der Galle funktionierte<br />
nicht, sie lagerte Wasser<br />
ein. Sie litt mehr als vor dem<br />
Eingriff.<br />
Im Februar 2011 hatte Marietta<br />
P. dann einen Termin bei O.<br />
Sie war mit dem Chirurgen allein<br />
im Raum. Und dann berichtet<br />
sie von diesem Moment, diesem Satz,<br />
der sie bis heute verfolgt. O. habe einen<br />
Blick in ihre Krankenakte geworfen und<br />
gesagt: „Dann setzen wir Sie jetzt hoch.“<br />
Wenn ein junges Organ komme, werde<br />
sie nochmals transplantiert.<br />
Nie wäre sie auf die Idee gekommen,<br />
dass O. ihre Daten manipulieren würde,<br />
um eine Leber für sie zu bekommen, sagt<br />
P. „Wenn ich in sein Vorgehen eingeweiht<br />
worden wäre, hätte ich dem niemals zugestimmt.“<br />
Kurz danach hatte sie auf dem Papier<br />
einen Meld-Score von 40. Sie galt als sterbenskrank,<br />
stand jetzt auf der Warteliste<br />
ganz oben. Am 11. Mai 2011 setzte ihr O.<br />
eine neue, diesmal wesentlich bessere Leber<br />
ein.<br />
Von ihrem Chirurgen, von dem sie sich<br />
immer gut betreut gefühlt hatte, hörte sie<br />
erst wieder, als sie Ende Juli 2012 im<br />
SPIEGEL einen Bericht über dessen angebliche<br />
Manipulationen las. Am selben<br />
Tag hatte sie zufällig einen Termin in der<br />
40<br />
Patientin P.: „Ich bin nie dialysiert worden“<br />
Vor Gericht wertete O. seinen Bonus als „unethisch“.<br />
Dagegen geht aus Briefen hervor, dass er mehr Geld verlangte.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
UTA WAGNER / DER SPIEGEL<br />
Uni-Klinik. „Überall, wo ich nachfragte,<br />
was mit mir passiert sei, wurde ich abgebügelt.“<br />
Nur ein Arzt habe später lapidar<br />
geantwortet: „Bei der ersten Leber hat<br />
er mit Ihrem Leben gespielt, bei der zweiten<br />
wollte er Ihnen etwas Gutes tun.“<br />
Kurz darauf meldete sich die Kripo bei<br />
ihr. In ihrer Krankenakte sei eine Dialyse<br />
vermerkt. In diesem Fall schnellt ein leberkranker<br />
Patient auf der Warteliste<br />
nach oben. „Ich bin nie dialysiert worden“,<br />
antwortete Marietta P.<br />
Viele hätten gewusst, was da ablaufe,<br />
gab eine Assistenzärztin vor Gericht zu<br />
Protokoll. Es war eine mutige Aussage,<br />
einige ihrer Kollegen hatten sich zuvor<br />
gewunden. Nicht nur Assistenz-, auch<br />
Oberärzte haben heutzutage oft befristete<br />
Verträge.<br />
Außerdem wähnten etliche Mediziner<br />
den Klinikvorstand auf O.s Seite. Angeblich<br />
war es am Ende eine Krankenschwester,<br />
die im Juli 2011 mit einem anonymen<br />
Hinweis bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation<br />
(DSO) den<br />
Stein ins Rollen brachte. Klinikintern<br />
gab es damals noch kein<br />
anonymes Fehlermeldesystem.<br />
Die DSO, verantwortlich für<br />
die Logistik der Organspende,<br />
hätte jedoch schon vorher stutzig<br />
werden können. Schließlich<br />
wurden nach O.s Dienstantritt<br />
plötzlich mehr als doppelt so<br />
viele Organe nach Göttingen<br />
gebracht. Und warum schöpfte<br />
in der Vergabestelle Eurotransplant<br />
wegen widersprüchlicher<br />
Laborwerte niemand Verdacht?<br />
Die Bundesärztekammer<br />
(BÄK) hätte O. schon 2006 aus<br />
dem Verkehr ziehen können.<br />
Damals arbeitete er an der Uni-<br />
Klinik Regensburg. Ein Jahr zuvor<br />
hatte er in Jordanien einer<br />
Frau eine Spenderleber aus<br />
Wien verpflanzt, die niemals<br />
Europa hätte verlassen dürfen.<br />
Daraufhin musste sich O. gegenüber<br />
der BÄK rechtfertigen.<br />
In Gesprächen soll er sich völlig<br />
unkritisch gezeigt haben, was<br />
das eigene Handeln betrifft. Er<br />
habe nur helfen wollen, sagte O.<br />
Die Standesvertretung verfasste<br />
einen Bericht, der in der<br />
Schublade verschwand, die<br />
Staatsanwaltschaft Regensburg<br />
legte den Fall zu den Akten.<br />
Zwei Jahre später, im Frühjahr<br />
2008, sprach ihn der Vorstand<br />
der Uni-Klinik Göttingen<br />
an. Sie suchten einen Chirurgen,<br />
der die Transplantationszahlen<br />
steigern sollte. O. bekam eine Stelle<br />
als leitender Oberarzt und neben einem<br />
Fixum einen Bonus: 1500 Euro pro<br />
Fall ab der 21. bis zur 60. Transplantation.<br />
Vor Gericht behauptete O., er habe sich<br />
gegen diesen „unethischen“ Bonus gewehrt.<br />
Dagegen geht aus Briefen hervor,<br />
dass er mehr Geld verlangte.<br />
Im Krankenhausalltag hatte seine Patientin<br />
Marietta P. den Eindruck, dass „jeder<br />
das gemacht hat, was O. wollte. Er<br />
war eine Art Herrscher“. Ein Arzt sagte<br />
vor Gericht, O. habe die Abteilung wie<br />
ein „Königreich“ geführt.<br />
Bestens zu verstehen schien sich O. nur<br />
mit dem ehemaligen Leiter der Gastroenterologie,<br />
gegen den die Staatsanwaltschaft<br />
in einem getrennten Verfahren ermittelt.<br />
Assistenzärzte des Klinikums hatten<br />
ausgesagt, dieser habe sie aufgefordert,<br />
Blutproben zu manipulieren.<br />
Die beide Ärzte scheinen eine unheilvolle<br />
Allianz gebildet zu haben. Sie hielten<br />
die wöchentlichen Konferenzen, in<br />
denen unter anderem besprochen wurde,<br />
wer auf die Warteliste kam, in der Regel<br />
ohne Psychiater und ohne Anästhesisten<br />
ab. Die Transplantationskoordinatoren<br />
schlossen sie davon aus. Entscheidungen
wurden nicht dokumentiert oder protokolliert.<br />
Sie schalteten und walteten in einer<br />
Welt, die sie sich selbst geschaffen<br />
hatten.<br />
Der Nachfolger von O. sagte, nach seinem<br />
Dienstantritt habe er 130 Namen auf<br />
der Warteliste für eine Leber gefunden.<br />
Darunter Patienten, die gar nicht im Bilde<br />
darüber gewesen seien, dass sie transplantiert<br />
werden sollten. Auf die Frage, wie<br />
er sich das erklären könne, antwortete<br />
der Arzt: „Die Fallzahl spielt eine Rolle<br />
fürs Renommee.“ O. rief: „Da wird man<br />
wahnsinnig bei solchen Aussagen.“ Sie<br />
seien „boshaft und diffamierend“.<br />
Mal laut, mal leise steht O. in diesen<br />
Momenten sein Verteidiger zur Seite.<br />
Steffen Stern hält die Rechtsauffassung<br />
der Staatsanwaltschaft für „absurd“. Jeder<br />
Mediziner habe zunächst die Verpflichtung,<br />
das Leben und die Gesundheit<br />
seiner Patienten zu schützen.<br />
Zugleich lässt Stern nichts unversucht,<br />
das gesamte System der Organvergabe<br />
zu diskreditieren. Er hält es für verfassungswidrig,<br />
weil unter anderem ein privatrechtlicher<br />
Verein wie BÄK per Richtlinien<br />
Lebenschancen zuteile.<br />
Für seinen Anwalt Stern ist O. „der<br />
Watschenmann“. Schließlich wisse man<br />
inzwischen, dass in nahezu allen 24 Zentren<br />
gemauschelt worden sei, wenn auch<br />
unterschiedlich stark.<br />
Welche Haltung das Gericht letztlich<br />
einnehmen wird, ist bislang nicht zu erkennen.<br />
Richter Günther hat dem Angeklagten<br />
bislang kaum etwas kritisch vorgehalten.<br />
An diesem Donnerstag will er<br />
verkünden, ob er den Haftbefehl gegen<br />
O. außer Vollzug setzt. Es gebe eine Tendenz<br />
der Kammer, so Günther, bei den<br />
Taten nicht mehr von Vorsatz, sondern<br />
von Fahrlässigkeit auszugehen. Damit<br />
wäre das Strafmaß geringer und somit<br />
die Fluchtgefahr, wegen der O. inhaftiert<br />
ist, nicht mehr zu begründen.<br />
Die Staatsanwaltschaft sieht ihre Anklage<br />
im Ganzen weiterhin begründet.<br />
Doch sie muss O. unter anderem noch<br />
nachweisen, dass durch die Manipulationen<br />
andere Patienten verstorben sind.<br />
Und dass diese im Zweifel auch von dem<br />
jeweiligen Organ profitiert hätten.<br />
Das System der Organverteilung kann<br />
nur funktionieren, wenn die wenigen guten<br />
Organe gerecht vergeben werden.<br />
Marietta P. weiß, dass O. auch mit ihrem<br />
Fall „dieses System ad absurdum“ geführt<br />
hat. Ihre zweite Leber funktioniert bis<br />
heute einwandfrei, dennoch quälen sie<br />
an manchen Tagen die Gedanken. „Ich<br />
fühle mich dann schlecht, weil ich damals<br />
eigentlich noch nicht dran gewesen<br />
wäre“, sagt sie. „Aber ist es ja auch nicht<br />
so, dass ich diese Leber gar nicht gebraucht<br />
hätte.“<br />
Aiman O. hat seinen Patienten einiges<br />
aufgebürdet.<br />
UDO LUDWIG,<br />
ANTJE WINDMANN<br />
DER SPIEGEL 50/2013 41
<strong>Deutschland</strong><br />
KOMMENTAR<br />
Rohrkrepierer<br />
Von Gisela Friedrichsen<br />
Das Strafrecht gilt als die Ultima<br />
Ratio des Staates – das letzte<br />
Mittel, das schärfste Schwert,<br />
der letzte Lösungsweg – zur Herstellung<br />
des Rechtsfriedens. Nur schwere<br />
Verstöße gegen die Rechtsordnung<br />
sind damit zu ahnden. Bei Bagatelldelikten<br />
ist nach anderen Wegen zu<br />
suchen, um den Täter, wie es in der<br />
Rechtswissenschaft so schön<br />
heißt, am Begehen weiterer<br />
Straftaten zu hindern.<br />
Gegen Christian Wulff und<br />
David Groenewold hat die Hannoveraner<br />
Staatsanwaltschaft<br />
das maximale Geschütz aufgefahren<br />
und wegen Bestechlichkeit<br />
und Bestechung angeklagt,<br />
obwohl es um lumpige 753,90<br />
Euro geht, für die sich der damalige<br />
niedersächsische Mi -<br />
nisterpräsident angeblich von<br />
dem mit ihm eng befreundeten<br />
Filmmanager hatte kaufen lassen.<br />
„Ehrabschneidend“ nannte<br />
Wulff diese Unterstellung in seiner<br />
Erklärung vor Gericht.<br />
Die Richter hatten zwar den<br />
Furor der Strafverfolger gedämpft,<br />
indem sie die Vorwürfe<br />
auf Vorteilsannahme und -gewährung<br />
herunterschraubten.<br />
Aber immerhin ließen sie die<br />
Anklage zur Hauptverhandlung<br />
zu. Dass sich weder Wulff noch<br />
Groenewold auf den Kuhhandel<br />
einer von der Staatsanwaltschaft<br />
angebotenen Verfahrenseinstellung<br />
gegen Zahlung von Geldauflagen<br />
einließen, versteht sich<br />
angesichts der unverhältnismäßig<br />
hohen Summen von 20000<br />
und 30000 Euro fast von selbst.<br />
Es gibt Fälle, in denen erst ein öffentlicher<br />
Prozess Klarheit schafft<br />
und den Angeklagten aus dem Zwielicht<br />
ungerechtfertigter Anschuldigungen<br />
herausholt, ihn vor den Augen<br />
der Öffentlichkeit rehabilitiert und<br />
ihm seine Ehre wiedergibt. In anderen<br />
Fällen aber beschädigen bereits<br />
Ermittlungen den Betreffenden so,<br />
dass er sich davon nicht mehr erholt.<br />
Kommt es überdies zu einer Hauptverhandlung,<br />
beseitigen weder eine<br />
Einstellung des Verfahrens noch ein<br />
Kaum ein Zeuge erinnert<br />
sich noch an das<br />
Wiesn-Wochenende 2008.<br />
Angeklagter Wulff<br />
Freispruch den Fleck auf der Weste.<br />
Im öffentlichen Gedächtnis wird<br />
Wulff jener Bundespräsident bleiben,<br />
der wegen Korruption vor Gericht gestanden<br />
hat.<br />
Was ist nach fünf Verhandlungstagen<br />
von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft<br />
geblieben? Nichts. Null.<br />
Welchen Sinn hatte es, Rezeptionistinnen<br />
des Hotels „Bayerischer Hof“<br />
in München als Zeugen vor Gericht<br />
zu zitieren, Empfangsdamen, Hausdiener,<br />
Kindermädchen für den damals<br />
vier Monate alten Sohn der<br />
Wulffs, Leibwächter, Fahrer, Sekretärinnen?<br />
Kaum jemand erinnerte sich<br />
an das eine Oktoberfest-Wochenende<br />
im Jahr 2008.<br />
Im „Bayerischen Hof“ geht es fast<br />
immer, aber besonders zur Wiesn-Zeit<br />
zu wie in einem Taubenschlag. Prominenz<br />
aller Schattierungen gibt sich<br />
die Klinke in die Hand. Mag die Hannoveraner<br />
Justiz auch einen niedersächsischen<br />
Ministerpräsidenten samt<br />
Gattin und Kind für eine unvergessliche<br />
Ausnahmeerscheinung halten, an<br />
deren Besuch man sich auch fünf Jahre<br />
später noch im Detail erinnert – für<br />
die Münchner Hotellerie gilt das noch<br />
lange nicht.<br />
Wulff hat teuer bezahlt für<br />
Fehler, die er als Politiker beging:<br />
Gratis-Urlaube, unklare<br />
Kredite, der Drohanruf bei<br />
„Bild“ und vieles mehr. Dafür<br />
geriet er in den Medien unter<br />
Druck, auch bei den Parteifreunden.<br />
Als erster Mann im Staat,<br />
der eine Vorbildfunktion hat,<br />
musste er zurücktreten. Er verlor<br />
sein Amt, seine Reputation.<br />
Dass er überdies privat in schweres<br />
Wasser geriet, hat er sich<br />
ebenfalls selbst zuzuschreiben.<br />
Doch diese Fehler sind nicht<br />
justitiabel. „Täter“, die mit dem<br />
schärfsten Schwert des Staates<br />
von der Begehung weiterer<br />
Straftaten abgehalten werden<br />
müssen, sind Wulff und Groenewold<br />
nicht.<br />
Der Begriff Ultima Ratio<br />
stammt aus dem Dreißigjährigen<br />
Krieg. Kardinal Richelieu<br />
ließ die französischen Kanonenrohre<br />
mit den Worten „ultima<br />
ratio regum“ (das letzte Mittel<br />
der Könige) zieren. Friedrich II.<br />
versah die preußischen mit der<br />
Inschrift „ultima ratio regis“<br />
(des Königs).<br />
Die Hannoveraner Kanoniere<br />
aber haben ihre Geschütze gegen<br />
Spatzen in Stellung gebracht<br />
und verharren dahinter reglos.<br />
Wo bleibt die Verteidigung ihrer Anklage?<br />
Also auf zum letzten Gefecht:<br />
Am 12. Dezember muss Bettina Wulff<br />
als Zeugin vor Gericht erscheinen.<br />
Der kluge Vorsitzende Frank Rosenow<br />
will am 19. Dezember mitteilen,<br />
„wie das Verfahren weitergehen sollte“.<br />
Denn: „Vor Weihnachten werden<br />
wir den Komplex der Vorteilsgewährung<br />
und bewussten Entgegennahme<br />
ja durchhaben.“ Mit einem Rohrkrepierer?<br />
JULIAN STRATENSCHULTE / DPA<br />
42<br />
DER SPIEGEL 50/2013
SAKIS MITROLIDIS / AFP<br />
Türkischer Posten an der EU-Grenze zu Griechenland: Vom Staat kaum etwas zu erwarten<br />
FLÜCHTLINGE<br />
Emotionaler<br />
Kurzschluss<br />
Zwei Monate nach der Katastrophe<br />
vor Lampedusa macht Europa<br />
weiter wie bisher: Die EU will nun<br />
abgelehnte Asylbewerber aus<br />
aller Welt in die Türkei schicken.<br />
BULGARIEN<br />
für aber Staaten wie Italien oder Bulgarien<br />
an der EU- Außengrenze.<br />
Zwei Monate später ist nun klar: Auch<br />
die Hoffnung ist gestorben. Das Wort<br />
Dublin taucht im Koalitionspapier von<br />
Union und SPD nicht einmal auf. Es gibt<br />
also keinen Vorstoß, daran etwas zu ändern.<br />
Und nun hat auch noch die EU einen<br />
Deal gemacht, der die Methode<br />
„Dublin“ auf die Spitze treibt – die Methode,<br />
das Asylproblem möglichst an die<br />
Ränder Europas zu verschieben.<br />
Dabei stellt Brüssel der Türkei in Aussicht,<br />
dass ihr alter Wunsch in Erfüllung<br />
gehen könnte: die visafreie Einreise für<br />
ihre Bürger nach Europa. Im Gegenzug<br />
erklärt sich die Türkei bereit, abgelehnte<br />
Asylbewerber zurückzunehmen, die auf<br />
einer Schleuser-Route über die Türkei in<br />
der EU gelandet sind. Mit dem Abkommen,<br />
das die EU in einer Woche unterzeichnen<br />
will, wird die Türkei, obwohl<br />
nicht EU-Mitglied, zu einer Art Außenposten<br />
des Dublin-Systems. Für die Türkei<br />
mag das ein guter Deal sein, für<br />
Flüchtlinge ist das dagegen eine schlechte<br />
Nachricht.<br />
„Das Rücknahmeabkommen ist eine<br />
Katastrophe“, sagt Piril Erçoban von der<br />
türkischen Flüchtlingsorganisation Mülteci-Der.<br />
„Niemand hier weiß, wohin mit<br />
Schwarzes<br />
Meer<br />
Istanbul<br />
TÜRKEI<br />
200 km<br />
den Flüchtlingen“, die<br />
Türkei sei schon jetzt<br />
völlig überfordert. Das<br />
liegt auch dar an, dass<br />
die Türkei, anders als<br />
<strong>Deutschland</strong>, über kein<br />
Asylsystem verfügt, das<br />
diesen Namen verdient.<br />
Zwar hat die Regierung<br />
die Genfer Flüchtlingskonvention<br />
unterzeichnet<br />
und sich damit ver-<br />
Was kann es schon Tröstliches geben<br />
an einem Tag, an dem mehr<br />
als 300 Menschen ertrinken? Als<br />
aber Anfang Oktober so viele Flüchtlinge<br />
im Meer vor Lampedusa starben, wurde<br />
zu mindest eine Hoffnung geboren: dass die<br />
Europäer ihre Asylpolitik in Frage stellen.<br />
Von einer „Schande“ sprach Papst Franziskus,<br />
von einer „Schande“ redete auch<br />
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz,<br />
und Bundespräsident Joachim Gauck<br />
fragte, ob „unser Engagement der Bedeutung<br />
unseres Landes entspricht“.<br />
Auch ein Dogma der europäischen<br />
Asylpolitik schien sich bei so viel Erschütterung<br />
erschüttern zu<br />
lassen: die Dublin-Verordnung.<br />
Jene Regelung,<br />
wonach ein Asylbewerber<br />
in das EU-Land zu-<br />
EU-Außengrenze<br />
rückgeschickt wird, in<br />
dem er zuerst den Boden<br />
der Gemeinschaft GRIECHENLAND<br />
betreten hat. Das nützt<br />
Ländern in der Mitte<br />
Europas, vor allem<br />
<strong>Deutschland</strong>, belastet da-<br />
Mittelmeer<br />
pflichtet, Menschen auf der Flucht Schutz<br />
zu bieten. Allerdings lässt die Türkei das<br />
grundsätzlich nur bei Flüchtlingen aus<br />
Europa gelten. Daran ändert auch ein<br />
neues Gesetz nichts, das leichte Verbesserungen<br />
für Flüchtlinge bringen soll.<br />
Eine Ausnahme von seinem harten<br />
Kurs macht das Land bei den rund<br />
600 000 Syrern, die seit Ausbruch des<br />
Bürgerkriegs über die Grenze geflohen<br />
sind. Für sie hat Ministerpräsident Recep<br />
Tayyip Erdogan eine Mindestversorgung<br />
angeordnet. Wer aber aus Asien oder<br />
Afrika stammt, etwa aus Iran, Afghani -<br />
stan oder Somalia, hat vom türkischen<br />
Staat kaum etwas zu erwarten.<br />
Die Menschen kommen trotzdem. Viele<br />
leben unter katastrophalen Bedingungen,<br />
finden keine reguläre Arbeit, sind<br />
auf sich selbst gestellt. Ohne Unterkunft,<br />
ohne Geld. Nur wenige ergattern einen<br />
Platz im Umsiedlungs-Programm des<br />
UNHCR. In diesem Jahr will das Uno-<br />
Hilfswerk gerade mal 6000 Flüchtlinge<br />
aus der Türkei ins Ausland vermitteln.<br />
Wem dieser Weg versperrt bleibt, der<br />
nimmt einen anderen: illegal in die EU.<br />
Häufig werden die Flüchtlinge aber bereits<br />
an der Grenze von den Griechen zurückgeschickt,<br />
bevor sie überhaupt um<br />
Asyl bitten können. Der Europäische<br />
Menschenrechtsgerichtshof hat diese sogenannten<br />
Pushbacks für rechtswidrig erklärt.<br />
Glaubt man Amnesty International,<br />
kommt es dennoch immer wieder dazu.<br />
Die Menschenrechtsaktivistin Erçoban<br />
fürchtet, dass die Zahl der Pushbacks<br />
mit dem Abkommen zwischen der EU<br />
und der Türkei noch wächst. Zwar muss<br />
die Türkei nur Flüchtlinge zurücknehmen,<br />
die über das Land in die EU gereist<br />
und später in einem ordentlichen Asyl -<br />
ver fahren durchgefallen sind. Doch „kein<br />
türkisches Gericht wird prüfen, ob so<br />
ein Verfahren in einem EU-Staat unfair<br />
oder gar nicht gelaufen ist“, prophezeit<br />
Erçoban.<br />
Das alles wird wohl kein Hindernis für<br />
das Abkommen sein. Da spielt es auch<br />
keine Rolle, dass die EU-Staaten keine<br />
Asylbewerber mehr nach Griechenland<br />
zurückschicken, weil dort das Asylsystem<br />
zusammengebrochen ist. Die Türkei hat<br />
kein geordnetes Asylsystem, das zusammenbrechen<br />
könnte.<br />
Verhandelt hat das Abkommen übrigens<br />
die EU-Innenkommissarin Cecilia<br />
Malmström. Kurz nach der Katastrophe<br />
von Lampedusa hatte sie noch gesagt, sie<br />
sei „entsetzt über die Tragödie“. Malmström<br />
forderte ein Umdenken in der europäischen<br />
Einwanderungspolitik. Aber<br />
was sich nach energischem Kurswechsel<br />
anhörte, war offenbar nur ein emotionaler<br />
Kurzschluss. Der dürfte inzwischen<br />
behoben sein: Europas Flüchtlingspolitik<br />
nach Lampedusa ist Europas Flüchtlingspolitik<br />
vor Lampedusa.<br />
JÜRGEN DAHLKAMP, MAXIMILIAN POPP<br />
DER SPIEGEL 50/2013 43
Ein hübsches Gesicht blickt den Betrachter<br />
vom Foto des Bewerbungsschreibens<br />
an: blonde Haare, große<br />
Augen, ein sympathisches Lächeln – trotz<br />
oder gerade wegen der vollen Wangen.<br />
Der erste Eindruck, den der Vorstand<br />
des „Borreliose und FSME Bund <strong>Deutschland</strong>“<br />
von Angela Müller* hatte, muss positiv<br />
gewesen sein. Jedenfalls trafen sich<br />
der Vereinsvorsitzende und seine Stellvertreterin<br />
mit der Bewerberin Ende August<br />
2012 zu einem Vorstellungsgespräch.<br />
„Erst da haben wir gesehen, was darunter<br />
war“, sagt die Pressesprecherin und damalige<br />
stellvertretende Vorsitzende des<br />
Vereins, Ute Fischer: ein fülliger Körper,<br />
den Müller selbst als „vollschlank“ beschreibt,<br />
aber „nicht adipös“.<br />
Dabei galt Müller offenbar als Favoritin<br />
für die Stelle als Geschäftsführerin, in der<br />
folgenden Woche sollte ein Gespräch mit<br />
dem gesamten Vorstand stattfinden. Dazu<br />
kam es nicht mehr. Der Grund: eine E-<br />
* Name von der Redaktion geändert.<br />
44<br />
Übergrößen-Models<br />
ARBEITSRECHT<br />
Figurmäßig entgleist<br />
Ein Arbeitgeber hält einer Bewerberin vor, dass sie<br />
zu dick ist. Ein Gericht muss nun<br />
klären, ob der Frau eine Entschädigung zusteht.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
CTK PHOTO / IMAGO<br />
Mail an Müller, zwei Tage vor dem zweiten<br />
Termin, in der Fischer wissen wollte,<br />
„was dazu geführt hat, dass Sie kein Normalgewicht<br />
haben“. Denn: „Im jetzigen<br />
Zustand wären Sie natürlich kein vorzeigbares<br />
Beispiel und würden unsere Empfehlungen<br />
für Ernährung und Sport konterkarieren.“<br />
Und: „Vielleicht haben Sie<br />
ja auch einen plausiblen Grund, der in<br />
den Griff zu bekommen ist.“<br />
An diesem Donnerstag werden sich<br />
Müller und Fischer wiedersehen: vor einer<br />
Kammer des Arbeitsgerichts Darmstadt.<br />
In dem Verfahren geht es um die<br />
Frage, ob ein Arbeitgeber einen Bewerber<br />
ablehnen darf, weil dieser ihm zu<br />
dick erscheint – oder ob dies eine verbotene<br />
Diskriminierung darstellt und überdies<br />
eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts.<br />
Seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz<br />
(AGG) in Kraft getreten<br />
ist, gelten für Arbeitgeber besonders<br />
strenge Bedingungen. Wer einen Bewerber<br />
etwa wegen dessen Herkunft, Geschlecht,<br />
Alter oder wegen einer Behinderung<br />
zurückweist, kann zu empfindlichen<br />
Entschädigungszahlungen verurteilt<br />
werden. Dafür genügt schon ein begründeter<br />
Verdacht, etwa durch eine ungeschickt<br />
formulierte Stellenanzeige. Wegen<br />
besonderer Beweislastregeln muss<br />
der Arbeitgeber dann einen solchen Vorwurf<br />
widerlegen; gelingt ihm dies nicht,<br />
verliert er vor Gericht.<br />
Auf dieser Grundlage erwirkte der<br />
Bonner AGG-Spezialist Klaus Michael<br />
Alenfelder, der auch Müller vertritt, für<br />
einen Rechtsanwaltsfachangestellten 14,5<br />
Monatsgehälter als Entschädigung. Der<br />
Mann hatte sich erfolglos auf eine Anzeige<br />
gemeldet, mit der eine Immobilienfirma<br />
nach einer „Sekretärin“ gesucht hatte<br />
– und nicht auch nach einem „Sekretär“.<br />
Und ein Chemiker aus den neuen<br />
Bundesländern erhielt per Vergleich<br />
26600 Euro Schmerzensgeld – die Prokuristin<br />
der Firma hatte als Reaktion auf<br />
dessen Bewerbungs-Mail geschrieben:<br />
„Gleich absagen“, der Bewerber sei Jahrgang<br />
1949, und sie habe keine Lust auf einen<br />
„Ossi Dr.“. Die Antwort ging „an<br />
alle“ – auch den Bewerber.<br />
Müller besitzt einen Abschluss in Germanistik<br />
und Medienwissenschaften, sie<br />
hat auch einige Semester an der Fern-Uni<br />
Hagen Recht und BWL studiert. Nach<br />
einer ersten Stelle in einer PR-Agentur<br />
war sie als Werberin sowie als Pressesprecherin<br />
für ein Fachärztezentrum tätig,<br />
schließlich als Geschäftsführerin von Ärzte-Organisationen.<br />
Auf die Stelle beim<br />
Borreliose-Bund bewarb sie sich auch deshalb,<br />
weil sie gern von Köln nach Hessen<br />
wechseln wollte, wo ihre Familie lebt.<br />
„Im Grunde hat alles gepasst“, schildert<br />
Müller ihren Eindruck vom Gespräch<br />
im Privathaus von Fischer: „Wir hatten<br />
ein schönes, tolles, fruchtbares, intensi -<br />
ves, familiäres Vorstellungs gespräch.“<br />
Müller trug einen schwarzen Hosenanzug<br />
und eine weiße Bluse, „businessmäßig<br />
halt“. Das Gespräch dauerte mehrere<br />
Stunden. Dann lud Fischer alle zum Mittagessen<br />
ein, ihr Mann kochte Spaghetti<br />
mit Pesto.<br />
Als Müller weg war, wurde im Vorstand<br />
diskutiert. Man habe sich durch<br />
das Bewerbungsfoto „getäuscht“ gesehen<br />
dar über, „welches enorme Übergewicht<br />
sie mit sich trägt“, erklärte Fischer spä -<br />
ter schriftlich. Es „irritierte uns“, dass<br />
„eine gutaussehende junge Frau“ mit tollen<br />
Fähigkeiten und Ideen „dermaßen figurmäßig<br />
entgleist“. Der Vorsitzende<br />
habe dann gesagt, ergänzt Fischer heute:<br />
„Versuch mal, mit ihr ein Gespräch zu<br />
führen.“<br />
So kam es zu der umstrittenen E-Mail<br />
am Sonntagabend, kurz vor halb zehn.<br />
„Das kam für mich aus heiterem Himmel“,<br />
sagt Müller: „Ich habe die E-Mail<br />
auf meinem Smartphone gelesen und angefangen<br />
zu heulen.“ Sie habe sich „zu-
<strong>Deutschland</strong><br />
tiefst gedemütigt“ gefühlt –<br />
immerhin passe ihr Konfektionsgröße<br />
42, und schließlich<br />
habe sie sich ja „nicht bei<br />
,Germa ny’s Next Topmodel‘<br />
beworben“.<br />
Fischer hingegen sagt: Es sei<br />
um „ein privates Gespräch“ gegangen,<br />
„von einer ehemals dicken<br />
Frau zu einer anderen<br />
dicken Frau“. Müller hätte unabhängig<br />
davon die Stelle bekommen.<br />
Doch wenn man die<br />
Mail liest, kann man leicht den<br />
Eindruck gewinnen, das „vorweg“<br />
erbetene, klärende Gespräch<br />
stehe durchaus im Zusammenhang<br />
mit der Stellenvergabe.<br />
Wie auch immer: Das klärende Gespräch<br />
fand nicht statt. Müller war nicht<br />
bereit, sich für ihren Körper zu rechtfertigen,<br />
nicht mal, Fischer das persönlich zu<br />
sagen. Stattdessen rief ihr Mann dort an.<br />
Fischer habe nochmals klar gesagt: Wenn<br />
Müller nicht über die Gründe für ihre Körperfülle<br />
reden wolle, brauche sie gar nicht<br />
mehr zu kommen. Und: Wer undiszipliniert<br />
sei beim Essen, sei auch undiszipliniert<br />
beim Arbeiten. Fischer bestreitet diese<br />
Aus sagen. Müller und ihr Mann hätten<br />
alles „aufgebauscht“. Schließlich habe sich<br />
der gesamte Vorstand zum zweiten Termin<br />
eingefunden – nur Müller kam nicht.<br />
Gesetzestext: Beweislast beim Arbeitgeber<br />
Stattdessen erhielt der Verein per Anwaltsschreiben<br />
die Aufforderung, 30 000<br />
Euro als Entschädigung zu zahlen. Ein<br />
erster Gütetermin scheiterte im Sommer.<br />
Der Verein bot 3000 Euro, Müller wollte<br />
nicht unter 15 000 gehen. Rechtlich<br />
kommt es vor allem darauf an, ob der<br />
Fall nur als Persönlichkeitsrechtsverletzung<br />
oder auch als Diskriminierung nach<br />
dem AGG zu qualifizieren ist – im zweiten<br />
Fall sind neben den Beweiserleichterungen<br />
wesentlich höhere Entschädigungen<br />
vorgesehen.<br />
Das AGG führt zwar das Aussehen als<br />
solches nicht als verbotenen Diskriminierungsgrund<br />
auf; anders als ähnliche Gesetze<br />
in Frankreich und Belgien, die allgemein<br />
das „äußere Erscheinungsbild“<br />
erfassen. Doch Anwalt<br />
Alenfelder stützt seine<br />
Klage darauf, dass Fettleibigkeit<br />
eine Behinderung darstelle.<br />
Die ist auch nach deutschem<br />
Recht ein verbotenes<br />
Kriterium. „Übergewicht, jedenfalls<br />
starkes Übergewicht,<br />
ist eine Behinderung“, argumentiert<br />
der Anwalt. Der potentielle<br />
Arbeitgeber sei „von<br />
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung“<br />
in diesem Sinne<br />
ausgegangen. Darum liege<br />
zumindest eine „Benachteiligung<br />
wegen einer vermeintlichen Behinderung“<br />
vor.<br />
Der mit Spendengeldern, Mitgliedsbeiträgen<br />
und von den Krankenkassen finanzierte<br />
Verein aber will schon deshalb<br />
nicht zahlen, weil „wir dann viele Dinge,<br />
die für unsere Patienten wichtig sind, einstellen<br />
müssten“, sagt Fischer. Anwalt<br />
Alenfelder hält dagegen: Die Zahlung<br />
müsse „abschreckend“ sein. Und auch<br />
Müller will nicht zurückstecken. Ihre<br />
Rechtsschutzversicherung hält den Prozess<br />
für aussichtsreich, nach anfänglichem<br />
Zögern erteilte sie eine Deckungszusage.<br />
Ein Sendungsbewusstsein hat Müller<br />
nicht. „Das“, sagt sie, „ziehe ich für mich<br />
alleine durch.“<br />
DIETMAR HIPP
Homeier, 61, wurde vor kurzem<br />
als erster Deutscher zum Präsidenten<br />
der Vereinigung europäischer<br />
Schulinspektorate gewählt. Der<br />
ehemalige Mathematik- und Physiklehrer<br />
leitet das Niedersächsische<br />
Landesinstitut für schulische<br />
Qualitätsentwicklung.<br />
SPIEGEL: In der neuen Pisa-Studie mit dem<br />
Schwerpunkt Mathematik hat die Bundesrepublik<br />
gut abgeschnitten. Sind die<br />
deutschen Schulen besser geworden?<br />
Homeier: Pisa liefert nur grobe Hinweise<br />
und Durchschnittswerte. Um die Qualität<br />
von Schulen zu beurteilen, bedarf es des<br />
genauen Hinsehens, zum Beispiel durch<br />
die Schulinspektion.<br />
SPIEGEL: Alle drei Jahre stehen die 15-Jährigen<br />
auf dem Pisa-Prüfstand, dazu kommen<br />
diverse andere Vergleichstests. Wie<br />
häufig müssen Schulleiter und Lehrer<br />
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen?<br />
Homeier: Im Rahmen einer Schulinspek -<br />
tion ungefähr alle vier Jahre. Dieser Takt<br />
hat sich in Niedersachsen eingependelt,<br />
und die meisten anderen Bundesländer<br />
halten das ähnlich. Die Inspektoren kommen<br />
von außen und prüfen etwa die<br />
Ausstattung, das Führungsverhalten der<br />
Schulleitung und die Qualität des Un -<br />
terrichts. Allerdings bewerten wir nicht<br />
den einzelnen Lehrer und verlassen ei -<br />
ne Unterrichtsstunde nach 20 Minuten<br />
wieder.<br />
SPIEGEL: Ein Lehrer kann also jahrelang<br />
unbeaufsichtigt unterrichten, wenn nicht<br />
46<br />
BILDUNG<br />
„Luft nach oben“<br />
Der Lehrerprüfer Wulf Homeier über den Sinn<br />
von Leistungstests, das Ansehen<br />
von Pädagogen und Anzeichen für gute Schulen<br />
zufällig die Inspektion für 20 Minuten<br />
vorbeischaut?<br />
Homeier: Nur dann, wenn die<br />
Schulleitung ihn lässt, sie ist dafür<br />
verantwortlich, den einzelnen Lehrer<br />
im Unterricht zu besuchen und<br />
zu beraten. Schottland beispielsweise<br />
hat ein anderes System:<br />
Dort bekommen Lehrer gezieltes<br />
Coaching, die Schulinspektoren analysieren<br />
mit ihnen den eigenen Fachunterricht.<br />
Aber ich kann Sie beruhigen: Der Lehrerberuf<br />
ist sehr öffentlich, da sitzen 30<br />
kleine Beobachter, und die erzählen zu<br />
Hause, was sie gesehen haben.<br />
SPIEGEL: Wie gut sind die deutschen Lehrer<br />
nach Maßstäben von professionellen<br />
Prüfern?<br />
Homeier: Pauschal kann man wohl sagen:<br />
Bei der Qualität des Unterrichts ist noch<br />
Luft nach oben, das gilt in vielen europäischen<br />
Ländern. Viele Lehrkräfte tun<br />
sich im Unterricht schwer zu differenzieren,<br />
also den Leistungsstarken wie den<br />
Lernschwachen zugleich gerecht zu werden.<br />
Häufig sind auch die Redeanteile<br />
des Lehrers innerhalb einer Schulstunde<br />
zu hoch. Vom Fachwissen her sind die<br />
meisten Lehrer hierzulande hochprofessionell,<br />
gerade an den Gymnasien, und<br />
arbeiten mit hohem pädagogischem Engagement.<br />
Wir können zufrieden sein.<br />
SPIEGEL: Die Lehrer sind besser als ihr<br />
Ruf?<br />
Homeier: Die Deutschen reden nicht nett<br />
über Lehrer. Wenn immer nur über<br />
schlechte Einzelbeispiele gesprochen<br />
FISCHER / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Schüler,<br />
Lehrerin in<br />
Bocholt<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
UTE GRABOWSKY / PHOTOTHEK.NET<br />
wird, kann man kaum erwarten, dass Kinder<br />
eine positive Einstellung entwickeln.<br />
In Norwegen etwa ist das Lehrer ansehen<br />
sehr viel höher, auch weil der Staat streng<br />
auswählt.<br />
SPIEGEL: Würde die Akzeptanz des Berufs<br />
steigen, wenn sich die Lehrer mehr auf<br />
die Finger schauen ließen?<br />
Homeier: In einem Betrieb jubelt der Facharbeiter<br />
auch nicht gerade, wenn die Qualitätsprüfer<br />
in der Halle stehen. Auch der<br />
Lehrer ist fixiert auf die Arbeit mit seiner<br />
Klasse, und plötzlich will jemand zusehen,<br />
das ist ungewohnt. Außerdem gibt<br />
es Schulinspektionen erst seit ein paar<br />
Jahren.<br />
SPIEGEL: Braucht <strong>Deutschland</strong> einen Schul-<br />
TÜV?<br />
Homeier: Ich mag den Begriff nicht, denn<br />
der TÜV stellt lediglich Mängel fest: Die<br />
Reifen haben nur anderthalb Millimeter<br />
Profil, also müssen sie für die Plakette<br />
ausgetauscht werden. Wir benennen auch<br />
die Stärken von Schulen. Davon gibt es<br />
eine ganze Reihe, wie auch die Befragungen<br />
von Eltern zeigen: Die sind nämlich<br />
mit dem Klima an der Schule ihrer Kinder<br />
und dem Einsatz der Lehrer meist sehr<br />
zufrieden.<br />
SPIEGEL: Woher kommt dann das Gefühl,<br />
dass die deutschen Schulen permanent in<br />
der Krise stecken?<br />
Homeier: Tja, vielleicht transportiert sich<br />
Krisengerede im deutschen Bildungssystem<br />
besser als das Positive. Während der<br />
Inspektionen können wir nichts von einer<br />
allgemeinen Krise feststellen, es geht dar -<br />
um, die wichtigsten Stellschrauben für behutsame<br />
Verbesserungen zu finden.<br />
SPIEGEL: Woran liegt es dann, dass die Leistungsunterschiede<br />
zwischen Schulen und<br />
Bundesländern so groß sind?<br />
Homeier: Da können die Schulen nicht unbedingt<br />
etwas dafür. Die Sozialstruktur<br />
schlägt sich in den Leistungen nieder: ob<br />
etwa eine Schule auf dem Land in Bayern<br />
angesiedelt ist oder im Ruhrgebiet, wie<br />
hoch der Anteil von Migrantenfamilien ist.<br />
Daher kann es sein, dass eine Schule, die<br />
in einem Vergleichstest schwach abschneidet,<br />
super Arbeit leistet, weil die Schülerschaft<br />
eigentlich noch viel schlechtere Ergebnisse<br />
nahelegt. Schulqualität ist etwas<br />
sehr Komplexes.<br />
SPIEGEL: Welche Indizien für eine gute<br />
Schule können Eltern leicht er kennen?<br />
Homeier: Zu einer guten Schule gehören<br />
viele einzelne Bausteine. Etwa, dass sich<br />
die Schüler bemühen, etwas zu leisten.<br />
Dass sie nicht grußlos aneinander und am<br />
Lehrer vorbeilaufen. Dass die Rechner<br />
im Computerraum nicht von 1990 stammen.<br />
Qualität speist sich auch aus der<br />
Lernumgebung, und es ist erstaunlich,<br />
was wir bisweilen unseren Kindern zumuten.<br />
Wenn Eltern genauer über eine<br />
Schule Bescheid wissen möchten, müssen<br />
sie dort nach dem Inspektionsbericht fragen.<br />
INTERVIEW: JAN FRIEDMANN
<strong>Deutschland</strong><br />
JUSTIZ<br />
Klagende<br />
Richter<br />
In einer Umfrage zeigen sich<br />
deutsche Staatsanwälte<br />
und Richter überlastet und unter<br />
Druck. Sie warnen vor<br />
den Folgen für den Rechtsstaat.<br />
Die Stuttgarter Staatsanwälte suchten<br />
eigentlich Beweise für eine<br />
Steuerhinterziehung. Aber viel<br />
spannender fanden die Ermittler eine<br />
Liste, die ihnen im Büro des schwäbischen<br />
Unternehmers in die Hände fiel.<br />
Dort hatten dessen Anwälte 17 Tricks aufgezählt,<br />
wie man lästige Staatsanwälte<br />
lahmlegt.<br />
Schwarz auf weiß lasen die Fahnder all<br />
die Schikanen, die sie aus ihrem Büroalltag<br />
gut kannten. „Ersticken mit Papier“<br />
lautete der wichtigste Tipp der Advokaten<br />
– mit Paletten von Aktenkartons, daumendicken<br />
Schriftsätzen und sinnlosen<br />
Anträgen. Auch empfehlenswert: gekaufte<br />
Gutachten von Professoren und gezielte<br />
Desinformation der Medien.<br />
„Dank dieser Liste haben wir erstmals<br />
gesehen, dass hinter dem Wahnsinn eine<br />
Strategie steckt“, erinnert sich Oberstaatsanwalt<br />
Andreas Thul-Epperlein. „Das<br />
Ziel ist, uns komplett zu blockieren.“<br />
Der Rechtsstaat verspricht jedem Angeklagten<br />
eine Verteidigung und Waffengleichheit<br />
gegenüber dem Staat. Aber<br />
längst fühlen sich <strong>Deutschland</strong>s Staats -<br />
anwälte der Phalanx hochversierter Profi-Verteidiger<br />
hoffnungslos unterlegen.<br />
Das zeigt auch eine noch unveröffentlichte<br />
Umfrage des Instituts für Demoskopie<br />
Allensbach. Im Auftrag der Roland<br />
Rechtsschutzversicherung wurden 1770<br />
Staatsanwälte und Richter über den Zustand<br />
des deutschen Rechtssystems befragt<br />
– mit aufschreckenden Ergebnissen.<br />
Nur jeder vierte Staatsanwalt fühlt sich<br />
demnach den Wirtschaftsanwälten ebenbürtig.<br />
Auch die große Mehrheit der Richter<br />
bezweifelt, dass die Fahnder den Verteidigern<br />
auf Augenhöhe begegnen.<br />
Und beunruhigend ist das Bild, das die<br />
Befragten vom Rechtssystem an sich<br />
zeichnen. 72 Prozent der Richter und<br />
Staatsanwälte sind der Meinung, dass sich<br />
die Bedingungen für eine gute Rechtsprechung<br />
in den letzten Jahren verschlechtert<br />
haben.<br />
85 Prozent der Befragten finden die<br />
personelle Ausstattung der Gerichte<br />
„schlecht“. Vier von fünf Staatsanwälten<br />
klagen, sie hätten nicht genug Zeit für<br />
die Bearbeitung ihrer Fälle. Und neun<br />
von zehn Befragten halten es für „dringend<br />
erforderlich“, dass ihre Dienstherren<br />
neue Kollegen einstellen.<br />
„Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend“,<br />
gesteht Baden-Württembergs<br />
Justizminister Rainer Stickelberger (SPD).<br />
Weniger Verständnis hat sein Düsseldorfer<br />
Kollege Thomas Kutschaty (SPD): „In<br />
allen Bereichen der Gesellschaft hat in<br />
letzter Zeit eine Arbeitsverdichtung stattgefunden,<br />
auch in der Justiz.“<br />
Eigentlich dürften die Richter auch gar<br />
nicht überfordert sein. Seit rund zehn Jahren<br />
planen die Länder den Personalbedarf<br />
ihrer Justizbehörden<br />
nach einem von Wirtschaftsprüfern<br />
entwickelten<br />
komplizierten Zahlenwerk. In<br />
Anlehnung an eine Limonadenmarke<br />
wird das Modell nur<br />
„Pebb§y“ genannt. Für jeden<br />
erdenklichen Arbeitsschritt der<br />
Richter und Staatsanwälte,<br />
vom Aktenstudium bis zum<br />
Versäumnis urteil, wurden minutengenaue<br />
Durchschnittszeiten<br />
errechnet.<br />
So kann jedes Justizministerium<br />
kalkulieren, wie viele Juristen<br />
für welche und wie viele<br />
Fälle gebraucht werden. Kaum ein anderes<br />
Ressort kann seine Personalkosten inzwischen<br />
so präzise berechnen wie die<br />
Justizministerien.<br />
Doch das gilt nur in der Theorie. In<br />
der Praxis halten sich die wenigsten Länder<br />
an die mühsam errechneten Zahlenwerke.<br />
Das beweist eine vertrauliche Liste,<br />
in der die Justizministerien – mit Ausnahme<br />
Hamburgs, Bremens und Schleswig-Holsteins<br />
– einander berichten, ob<br />
und wie sie die Pebb§y-Quoten erfüllen.<br />
Strafrichter am Landgericht Kaiserslautern<br />
73<br />
Prozent der<br />
Staatsanwälte in<br />
Wirtschaftsstrafverfahren<br />
fühlen sich<br />
den Anwälten<br />
unterlegen.<br />
Die Liste, die dem SPIEGEL vorliegt,<br />
zeigt, dass nur Sachsen-Anhalt sich mehr<br />
Zivil- und Strafrichter gönnt als rechnerisch<br />
notwendig. Die anderen Länder liegen<br />
unter dem Soll. Während die ostdeutsche<br />
Justiz dank der Wendezeit vergleichsweise<br />
gut ausgestattet ist, ist die<br />
westdeutsche teils drastisch unterbesetzt.<br />
Niedersachsen, Bayern und Hessen liegen<br />
klar unter dem Soll.<br />
Aber der größte Mangel herrscht in<br />
Nordrhein-Westfalen. Hier wurden die<br />
Ziele für Straf- und Zivilrichter laut Stand<br />
von Dezember 2012 um 13 Prozent<br />
unterschritten, die für<br />
Staatsanwälte um 16 Prozent.<br />
Nach einer Rechnung des Richterbundes<br />
müsste Minister Kutschaty<br />
700 Richter und Staatsanwälte<br />
einstellen, um im Plan<br />
zu liegen.<br />
Sein Ministerium dagegen<br />
wiegelt ab: Seit 2008 schließe<br />
sich die Personallücke kontinuierlich.<br />
Außerdem sei der rechnerische<br />
Personalbedarf allein<br />
wenig aussagekräftig. Man müsse<br />
auch wechselnde Fallzahlen<br />
berücksichtigen oder regionale<br />
Unterschiede.<br />
Doch der Richterbund rügt schon die<br />
geltenden Bedarfszahlen als zu knapp<br />
und zu veraltet. Im kommenden Jahr werden<br />
die Wirtschaftsprüfer neue Zielwerte<br />
errechnen. „Wir haben uns daran gewöhnt,<br />
dass die Arbeit der Justiz wie eine<br />
Ware kalkuliert wird“, sagt Christoph<br />
Frank, Chef des Deutschen Richterbundes.<br />
„Aber dann sollen die Länder wenigstens<br />
den korrekten Preis zahlen.“<br />
MELANIE AMANN,<br />
SIMONE SALDEN, GERALD TRAUFETTER<br />
PIOTR MALECKI / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 50/2013 47
BERND THISSEN / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Fleisch-Tycoon Clemens Tönnies: Alphatiere, erfüllt von gegenseitiger Abneigung<br />
FAMILIEN<br />
Wurf mit dem<br />
Knochen<br />
Clemens Tönnies und sein Neffe<br />
Robert streiten um die Macht im<br />
Fleischkonzern. Verliert der<br />
Junior wegen einer plagiierten<br />
Diplomarbeit seine Anteile?<br />
Der hochgewachsene Mann wandte<br />
sich mit Tremolo in der Stimme<br />
an den Richter. „Diese Familie hat<br />
zusammengehalten wie Pech und Schwefel“,<br />
sagte Clemens Tönnies, <strong>Deutschland</strong>s<br />
erfolgreichster Fleischproduzent und Aufsichtsratschef<br />
von Schalke 04, vor einigen<br />
Wochen vor dem Landgericht Bielefeld.<br />
Doch das ist vorbei. Im Hause Tönnies<br />
kämpfen zwei Männer um Macht, Geld<br />
und die Vorherrschaft in einem Milliardenkonzern.<br />
Seit rund zwei Jahren liefern<br />
sie sich einen erbitterten Clinch, der<br />
inzwischen vor Gericht ausgetragen wird.<br />
Auf der einen Seite: Clemens Tönnies,<br />
57, genannt C.T., gelernter Schlachter,<br />
der Mann, der das Unternehmen groß<br />
machte, erfolgreich in einer Branche, in<br />
der mit harten Bandagen und auch schon<br />
mal am Rande der Legalität gekämpft<br />
wird. Er hält die Hälfte der Firmenanteile.<br />
Auf der anderen sein Neffe Robert Tönnies,<br />
35, ebenfalls gelernter Metzger und<br />
Diplom-Betriebswirt. Er hält die andere<br />
Hälfte.<br />
Zwei Alphatiere, die erfüllt sind von<br />
gegenseitiger Abneigung. Beide sind<br />
überzeugt, es besser zu können. Keiner<br />
48<br />
ist bereit, auch nur einen Fußbreit nachzugeben.<br />
Vor Gericht streiten sie über<br />
Stimmrechte und Schenkungen, aber im<br />
Kern geht es immer um die Frage: Wer<br />
hat das Sagen bei Tönnies Lebensmittel?<br />
Jetzt könnte ein 13-seitiges Gutachten<br />
dem Streit eine neue Wendung geben; bestellt<br />
wurde es aus C.T.s Umgebung. Es<br />
geht um Robert Tönnies’ Diplomarbeit,<br />
die er 2004 an der Fachhochschule Hannover<br />
einreichte. Sie trägt den Titel „Zerlegeoptimierung<br />
in einem industriellen<br />
Schweinezerlegebetrieb“. Roberts Vater<br />
Bernd Tönnies, Gründer des Schlachtkonzerns,<br />
hatte in seinem Testament verfügt,<br />
dass seine zwei Söhne nur dann Firmenanteile<br />
bekommen, wenn sie sowohl eine<br />
handwerkliche Ausbildung als auch einen<br />
kaufmännischen Abschluss nachweisen.<br />
Das BWL-Diplom aus Hannover ist Robert<br />
Tönnies’ kaufmännischer Abschluss.<br />
Doch nun kommt ein Gutachten zu dem<br />
Schluss, Tönnies habe „in erheblichem<br />
Umfang“ Quellen benutzt, die er nicht<br />
benannt habe. Er habe sich die geistigen<br />
Leistungen anderer Autoren „weithin<br />
wortwörtlich zu eigen gemacht“ und auch<br />
zahlreiche Abbildungen anderer „als eigene<br />
Leistung ausgegeben“. Manche Kapitel<br />
in der 80-seitigen Diplomarbeit<br />
wurden bis auf wenige Wörter komplett<br />
übernommen, inklusive eines fehlenden<br />
Kommas. Der mit der Plagiatsüberprüfung<br />
befasste Professor<br />
Norbert Drees von<br />
der Fachhochschule Erfurt<br />
kommt zu dem Urteil: „Damit<br />
hat der Autor in seiner<br />
Arbeit die Prüfer zweifellos<br />
vorsätzlich getäuscht.“<br />
Der Anwalt von Robert<br />
Tönnies, Mark Binz, entgegnet:<br />
„Nach unserem Gutachten<br />
handelte es sich um ir -<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Erbe Robert Tönnies<br />
„Vorsätzlich getäuscht“<br />
OLIVER KRATO / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
relevante Zitierfehler in der Arbeit.“ Fünf<br />
Jahre nach Ausstellung könne ein Diplom<br />
ohnehin nicht mehr aberkannt werden.<br />
Außerdem werde das Testament „fehlinterpretiert“.<br />
Bernd Tönnies habe in jedem<br />
Fall gewollt, dass seine Söhne erben.<br />
Um zu verstehen, wie es zu dem Streit<br />
kam, muss man in die Historie der Metzger-Dynastie<br />
eintauchen. 1971 gründete<br />
Schlachtersohn Bernd Tönnies sein erstes<br />
Fleischwerk in Ostwestfalen, 1982 beteiligte<br />
sich sein jüngerer Bruder Clemens mit<br />
40 Prozent an dem expandierenden Unternehmen.<br />
1994 starb Bernd Tönnies und<br />
hinterließ seinen Söhnen Clemens junior<br />
und Robert 60 Prozent des Unternehmens.<br />
Das Unternehmen machte damals 500<br />
Millionen Euro Umsatz im Jahr, hatte<br />
Schulden, das Eigenkapital war fast aufgezehrt.<br />
2012 erzielte die Tönnies-Gruppe<br />
einen Umsatz von fünf Milliarden Euro,<br />
die Eigenkapitalquote stieg auf 60 Prozent.<br />
Clemens Tönnies reklamiert das als<br />
seinen Erfolg, für den er in 80-Stunden-<br />
Wochen schufte.<br />
Den beiden Neffen war das lange recht.<br />
Clemens junior, 38, soll kein großes In -<br />
ter esse am Fleischgewerbe haben. Vor<br />
fünf Jahren machten die beiden Brüder<br />
ihrem erfolgreichen Onkel ein großzügiges<br />
Geschenk, jeweils fünf Prozent ihrer<br />
Firmenanteile.<br />
Anfang 2012 war der Frieden vorbei.<br />
Clemens junior übertrug seinem Bruder<br />
seine Beteiligung. Robert hielt dann genauso<br />
viele Anteile wie C.T., außerdem<br />
wollte Robert die Schenkung an seinen<br />
Onkel rückgängig machen – wegen „groben<br />
Undanks“. Er begründete dies damit,<br />
dass sich Clemens Tönnies ohne Wissen<br />
der Neffen mehrere Unternehmen gekauft<br />
hatte, die seiner Meinung nach Konkurrenten<br />
der Tönnies-Gruppe sind.<br />
Zudem forderte der Neffe, dass der Onkel<br />
das Unternehmen nicht mehr allein<br />
führen dürfe und von einem Aufsichtsrat<br />
kontrolliert werden müsse. Dies erläuterte<br />
er 2012 den mehreren tausend Mitarbeitern<br />
in einem offenen Brief. Für den Alleinherrscher<br />
C.T. war das eine Kampfansage.<br />
Der Betriebsrat in Rheda schrieb dar -<br />
aufhin an Robert Tönnies: Man sei „sehr<br />
verwundert, dass Sie … zum wiederhol -<br />
ten Male den sozialen Frieden in der Belegschaft<br />
auf das empfindlichste stören.“<br />
Die „Nordwest-Zeitung“ erfuhr von angeblichen<br />
„Ausrastern“ des Neffen: Einem<br />
Mitarbeiter habe er einen<br />
Schinkenknochen hinterhergeworfen<br />
und in einem Wutanfall<br />
gegen einen Schreibtisch<br />
getreten – so dass ihn<br />
angeblich ein Tischler befreien<br />
musste.<br />
C.T. will sich zu der Angelegenheit<br />
nicht äußern. Der<br />
nächste Gerichtstermin ist<br />
für den 10. Januar angesetzt.<br />
BARBARA SCHMID
<strong>Deutschland</strong><br />
ARBEITSMARKT<br />
Herzlich, äh, willkommen<br />
<strong>Deutschland</strong> wird zum Einwanderungsland: Gutausgebildete Migranten<br />
sollen den Wohlstand hierzulande sichern. Doch die<br />
Bundesrepublik ist im Werben um Talente aus aller Welt nicht konkurrenzfähig.<br />
Es schien nicht allzu kompliziert zu<br />
sein, nach <strong>Deutschland</strong> einzuwandern:<br />
Als Enio Alburez, Ingenieur<br />
aus Guatemala, im Frühjahr davon hörte,<br />
dass er ein Visum bekommen könne, um<br />
in <strong>Deutschland</strong> einen Job zu suchen,<br />
buchte er einen Flug nach Berlin und ging<br />
zur deutschen Botschaft in Guatemala-<br />
Stadt.<br />
Alburez fragte nach dem Papier – aber<br />
die Mitarbeiter zuckten mit den Schultern.<br />
Sie hatten von dem „Jobseeker-Visum“<br />
noch nichts gehört, das es seit August 2012<br />
für Nicht-EU-Bürger gibt, versprachen jedoch,<br />
den Fall zu prüfen. Es verstrich eine<br />
Woche, eine zweite, sechs Wochen lang<br />
wartete Alburez vergebens auf eine Nachricht<br />
aus der Botschaft. Dann reiste der<br />
25-Jährige, der in seiner Heimat an der<br />
Österreichischen Schule Deutsch gelernt<br />
hatte, als Tourist nach <strong>Deutschland</strong>; der<br />
Flug war schließlich gebucht.<br />
Als er in Berlin angekommen war,<br />
meldete sich die Botschaft aus Guatemala<br />
bei ihm: Das Jobseeker-Visum sei nun<br />
genehmigt. Leider müsse Alburez nach<br />
Guatemala fliegen, um es in den Pass<br />
kleben zu lassen. Ansonsten bekomme<br />
er in <strong>Deutschland</strong> weder eine Aufenthalts-<br />
noch eine Arbeitsgenehmigung.<br />
„Es war schon verrückt, dass ich den<br />
Botschaftsleuten erklären musste, welche<br />
Möglichkeiten es in <strong>Deutschland</strong> gibt“,<br />
sagt Alburez. Er flog also nach Guate -<br />
mala-Stadt, nahm an der Botschaft das<br />
Jobseeker-Visum entgegen und kehrte<br />
nach Berlin zurück. Er bewarb sich bei<br />
verschiedenen Unternehmen, vom Autozulieferer<br />
Continental in Hannover bekam<br />
er eine Zusage. Er suchte sich eine<br />
Wohnung und tauschte das Visum gegen<br />
eine langfristige Aufenthaltserlaubnis ein.<br />
<strong>Deutschland</strong> hat gerade erst begonnen,<br />
ein Einwanderungsland zu werden. Nach<br />
und nach bauen Politiker die Hürden für<br />
Neuankömmlinge ab. Mit dem Jobseeker-<br />
Visum können ausländische Hochschulabsolventen<br />
in <strong>Deutschland</strong> auf Arbeitssuche<br />
gehen, ein halbes Jahr lang; wer<br />
eine Stelle mit einem Bruttojahresgehalt<br />
von mehr als 46000 Euro vorweisen kann,<br />
darf bleiben. Die Bundesregierung aus<br />
Union und FDP senkte die Grenze, die<br />
Dumpinglöhne verhindern soll, im Jahr<br />
Ingenieur Alburez: Zurück nach Guatemala wegen eines Aufklebers<br />
CHRISTIAN BURKERT / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 50/2013 49
Adidas-Personalmanagerin Anders: Kampf mit den Formularen<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
2012 um 20000 Euro. Sie erließ zudem<br />
eine neue „Beschäftigungsverordnung“,<br />
die auch ausländischen Nichtakademikern<br />
das Arbeiten in <strong>Deutschland</strong> erleichtert.<br />
Schwarz-Rot will diesen Kurs fortsetzen:<br />
Der Koalitionsvertrag verspricht<br />
weitere Angebote an Einwanderer. Insbesondere<br />
die Beratung in den Behörden<br />
soll verbessert werden.<br />
Laut OECD hat <strong>Deutschland</strong> mittlerweile<br />
eines der liberalsten Zuwanderungsgesetze<br />
für hochqualifizierte Migranten.<br />
Und dennoch gelingt es selten, Talente<br />
wie Enio Alburez aus Guatemala hierherzulocken.<br />
Zwar zogen 2012 mehr als eine Million<br />
Menschen nach <strong>Deutschland</strong>, so viele wie<br />
lange nicht mehr. Doch knapp zwei Drittel<br />
der Migranten kommen aus EU-Staaten.<br />
Viele fliehen vor der Wirtschaftskrise<br />
in ihrer Heimat. Fachleute gehen davon<br />
aus, dass der Zuzug erlahmen wird, sobald<br />
sich die Lage in Südeuropa entspannt.<br />
Die gegenwärtige Migration europäischer<br />
Krisenflüchtlinge sei nicht von<br />
Dauer, sagt der Migrationsforscher Klaus<br />
Bade. Sie täusche darüber hinweg, dass<br />
<strong>Deutschland</strong> dringend mehr Einwanderer<br />
aus Nicht-EU-Staaten gewinnen müsse.<br />
2012 waren 155000 Stellen für hoch -<br />
qualifizierte Arbeitskräfte wie Techniker,<br />
Ingenieure oder Informatiker unbesetzt.<br />
Nach Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt-<br />
und Berufsforschung (IAB)<br />
aus dem Jahr 2010 wird das Potential an<br />
erwerbsfähigen Menschen in <strong>Deutschland</strong><br />
bis 2025 um 6,5 Millionen sinken.<br />
Bevölkerungswissenschaftler schätzen:<br />
Nur wenn jedes Jahr 400000 Menschen<br />
mehr zu- als abwandern, kann <strong>Deutschland</strong><br />
seine Wirtschaftskraft erhalten. Zwischen<br />
August 2012 und Juni 2013 sind allerdings<br />
lediglich 2500 Hochqualifizierte<br />
aus dem nichteuropäischen Ausland gekommen<br />
– mit Hilfe der Blauen Karte<br />
EU. Insgesamt lassen sich pro Jahr lediglich<br />
25000 Arbeitsmigranten aus Nicht-<br />
EU-Staaten in <strong>Deutschland</strong> nieder. In<br />
Kanada und Neuseeland ist der Wert, gemessen<br />
an der Einwohnerzahl, etwa zehnmal<br />
so hoch.<br />
„Wir müssen uns von der Vorstellung<br />
verabschieden, Scharen von Hochqualifizierten<br />
warteten nur auf eine Einwanderungschance<br />
nach <strong>Deutschland</strong>“, mahnte<br />
der frühere Integrationsminister Nordrhein-Westfalens,<br />
Armin Laschet (CDU),<br />
bereits vor zwei Jahren. <strong>Deutschland</strong> sei,<br />
trotz der hohen Wirtschaftskraft und des<br />
Lebensstandards, beim Werben um Talente<br />
aus aller Welt nicht hinreichend<br />
wettbewerbsfähig, urteilt die OECD. Und<br />
das hat nach der Ansicht von Experten<br />
vor allem vier Gründe:<br />
Es gibt etwas, was Yvonne Anders nicht<br />
mag: „Deutsche Formulare!“ Angaben<br />
über dies, das und jenes, viele Seiten, zusätzliche<br />
Dokumente, mal sind Übersetzungen<br />
gewünscht, mal nicht – ohne einen<br />
Experten schickt sie die Papiere nicht<br />
mehr ab. Anders arbeitet als Personal -<br />
managerin für Adidas. Sie sucht nach<br />
Fachkräften in Europa, im Mittleren Osten<br />
und in Afrika. Selbst ein Konzern wie<br />
Blaue Karte EU<br />
WER HAT ANSPRUCH?<br />
Hochschulabsolventen * in einem Arbeitsverhältnis<br />
mit einem Bruttojahresgehalt von mindestens 46 400 €<br />
Hochqualifizierte aus Mangelberufen (Ingenieure,<br />
Ärzte, IT-Fachkräfte) in einem Arbeitsverhältnis mit<br />
einem Bruttojahresgehalt von mindestens 36200 €<br />
GÜLTIGKEIT<br />
zunächst max. vier Jahre, nach drei Jahren Niederlassungserlaubnis,<br />
wenn das Arbeitsverhältnis fortbesteht<br />
* oder vierjährige Berufserfahrung, die mit einem Hochschulabschluss<br />
vergleichbar ist; Quelle: www.bluecard-eu.de<br />
50 DER SPIEGEL 50/2013<br />
PETER SCHINZLER / DER SPIEGEL<br />
Adidas findet neue Mitarbeiter nur noch<br />
selten in <strong>Deutschland</strong>, vor allem IT-Experten<br />
und Designer.<br />
Interessiert sich Adidas für ein Talent,<br />
beginnt für Yvonne Anders der Kampf<br />
mit der Bürokratie: Jobseeker-Visum, Entsendestatus,<br />
befristete Aufenthaltserlaubnis,<br />
Niederlassungserlaubnis, Anerkennungsverfahren<br />
– selbst sie hat Probleme,<br />
die Bestimmungen noch auseinanderzuhalten.<br />
„Wenn das für uns schon komplex<br />
ist, wie sollen es dann Menschen aus China,<br />
Russland oder Serbien können?“<br />
Viele große Unternehmen beauftragen<br />
spezialisierte Agenturen damit, für ihre<br />
ausländischen Mitarbeiter den rechtlichen<br />
und bürokratischen Aufwand zu erle -<br />
digen – weil es sie mehr Geld und Zeit<br />
kosten würde, sich über die neuesten<br />
Gesetze und Verordnungen zu informieren<br />
und Kontakt zu den Behörden zu<br />
halten.<br />
Oliver Clapham betreibt schon seit<br />
Jahren in der Nähe von Frankfurt am<br />
Main eine sogenannte Relocation-Agentur.<br />
Er kümmert sich für seine Kunden<br />
um alles, vom Visum bis zur Wohnung.<br />
Aber auch er verzweifelt manchmal: Die<br />
Ausländerbehörden und Arbeitsagenturen<br />
seien unterbesetzt, so dass seine Anträge<br />
nur stark verzögert bearbeitet werden.<br />
„Oft warte ich monatelang, nur um<br />
einen Termin zu bekommen, bei dem<br />
eine Aufenthalts erlaubnis ausgestellt<br />
werden soll.“ Manchmal mussten Be -<br />
werber dann vorläufig als Touristen einreisen<br />
– oder sie entschieden sich für ein<br />
anderes Land.<br />
Die OECD fordert die Bundesregierung<br />
auf, Arbeitsmigration zu fördern. Manche<br />
Experten plädieren für ein Punktesystem,<br />
das die Zuwanderung steuert, so wie in<br />
Kanada oder Australien. Es würde internationalen<br />
Studenten und potentiellen<br />
Einwanderern gleichermaßen transparent<br />
machen, welche Kriterien erwünscht sind,<br />
etwa auf einer zentralen Website. Punkte<br />
könnte es für eine bestimmte Berufsqualifikation<br />
geben, für einen Studienabschluss<br />
oder für Sprachkenntnisse – und<br />
wer ausreichend viele Punkte gesammelt<br />
hat, kann einwandern.<br />
Das im April 2012 in Kraft getretene<br />
Anerkennungsgesetz<br />
sollte ein transparentes Verfahren<br />
für die Bewertung ausländischer<br />
Berufsausbildungen garantieren.<br />
Rund 30 000 Menschen<br />
haben im ersten Jahr<br />
einen Antrag auf Überprüfung<br />
ihres Abschlusses gestellt. Dabei<br />
könnten zehnmal so viele<br />
von der Regelung profitieren.<br />
Bundesbildungsministerin Johanna<br />
Wanka (CDU) spricht
dennoch von einem „wichtigen Beitrag<br />
zur Fachkräftesicherung“.<br />
Die Augsburger Integrationsexpertin<br />
Bettina Englmann sieht das anders: „Die<br />
Bundesregierung hat viel versprochen,<br />
aber das Ergebnis ist enttäuschend“, sagt<br />
sie. Englmann hatte 2007 mit ihrer Studie<br />
„Brain Waste“ den Anstoß für eine neue<br />
Regelung gegeben. Sie kritisiert, das Gesetz<br />
gelte bei weitem nicht für alle Berufe<br />
und nicht in ganz <strong>Deutschland</strong> einheitlich.<br />
Für Ausbildungsberufe, etwa in Industrie<br />
und Handel, ist der Bund zuständig. Für<br />
Lehrer, Ingenieure, Erzieher sind dagegen<br />
die Bundesländer verantwortlich. Das<br />
Chaos sei weiterhin groß.<br />
Und auch dort, wo das Gesetz greife,<br />
zum Beispiel bei den Gesundheitsberufen,<br />
fehle es an klaren Leitlinien dafür, wie<br />
Abschlüsse in <strong>Deutschland</strong> anerkannt<br />
werden könnten, be anstandet der Sachverständigenrat<br />
für Integration und Migration<br />
in einem Gutachten. Der Verwaltung<br />
fehle Personal. „Für Außenstehende“<br />
sei das System bei den Heilberufen „praktisch<br />
undurchschaubar“. Auch Union und<br />
SPD sehen Handlungsbedarf: Das Potential<br />
von Zuwanderern liege „noch zu oft<br />
brach“, heißt es im Koali tionsvertrag.<br />
Die „Willkommenskultur“, von der Bundesarbeitsministerin<br />
Ursula von der Leyen<br />
(CDU) gern spricht, ist in vielen Ämtern<br />
noch nicht etabliert. Häufig beherrscht<br />
dort kaum jemand gut Englisch<br />
oder eine andere Fremdsprache. Einwanderer<br />
werden wie Bittsteller behandelt.<br />
Vergangenen Juni trat der damalige<br />
bayerische Wirtschaftsminister Martin<br />
Zeil (FDP) auf einer Podiumsdiskussion<br />
der Universität Passau auf: „Study and<br />
stay in Bavaria“. Er warb für den exzellenten<br />
Hochschulstandort Bayern, die<br />
herausragenden Bedingungen für Studenten<br />
aus dem Ausland. Nach Zeils Rede<br />
stand Carlos García, 27, auf, ein Gaststudent<br />
aus Venezuela. Seine Hand zitterte,<br />
als er zum Mikrofon griff. Die Behörden<br />
hätten ihn wie einen Ein dringling behandelt,<br />
erzählte er. Sie hätten alles unternommen,<br />
um ihn loszuwerden.<br />
García war vor zehn Jahren als Austauschschüler<br />
nach Passau gekommen. Er<br />
leistete ein Freiwilliges Soziales Jahr, besuchte<br />
das Studienkolleg in München und<br />
begann, in Passau Wirtschaft zu studieren.<br />
Er fühlte sich wohl in Bayern, fand<br />
Freunde.<br />
Die Schikane in den Ämtern jedoch,<br />
sagt García, habe ihn „zermürbt“. Er bekam<br />
seine Aufenthaltserlaubnis jeweils<br />
nur für wenige Monate verlängert. Andernfalls,<br />
hieß es, könne er die deutsche<br />
Großzügigkeit ausnutzen und versuchen,<br />
in der Bundesrepublik zu arbeiten. Wenn<br />
er sich um die Genehmigung für ein Praktikum<br />
bewarb, sagte man ihm, er sei hier,<br />
um zu studieren.<br />
García schickte einen Brief an den Passauer<br />
Oberbürgermeister. Er schrieb, dass<br />
er davon träume, eingebürgert zu werden<br />
und eine Firma zu gründen: „Für mich<br />
ist die Zukunft hier. Ich möchte mich frei<br />
bewegen und mehr für mein Dasein leisten<br />
dürfen.“ Der SPD-Mann antwortete,<br />
dass er leider nichts für García tun könne.<br />
Für Studenten wie ihn sei die Rückkehr<br />
ins Heimatland vorgesehen.<br />
Laut einer Studie der OECD hatten zwischen<br />
Juli 2010 und Juli 2011 neun von<br />
zehn deutschen Unternehmen offene<br />
Stellen, doch nur jedes vierte machte sich<br />
auch außerhalb <strong>Deutschland</strong>s auf die<br />
Suche. Bei Klein- und Mittelständlern zogen<br />
dies gerade mal ein bis zwei von zehn<br />
in Betracht. Viele Unternehmen fürchten,<br />
dass es schwierig, unsicher und teuer sei,<br />
Personal aus dem Ausland anzuwerben.<br />
„Kleine und mittelständische Firmen<br />
können sich diesen Aufwand nicht leisten“,<br />
sagt Volker Steinmaier vom Arbeitgeberverband<br />
Südwestmetall. Er vertritt<br />
Unternehmen, die momentan große Probleme<br />
haben, ihre freien Stellen mit Fachkräften<br />
zu besetzen: Produktionsbetriebe,<br />
Tüftlerfirmen. Im Ausland zu suchen sei<br />
viel zu aufwendig, sagt Steinmaier. Jobmessen<br />
im Ausland, Netzwerke zu ausländischen<br />
Hochschulen, Kontakte zu ausländischen<br />
Arbeitsverwaltungen: „Das<br />
kann kaum ein Betrieb leisten.“<br />
Konzerne wie die Allianz tun sich leichter.<br />
Das Unternehmen organisiert in seiner<br />
Münchner Zentrale „Wel<strong>com</strong>e Days“.<br />
Neuen Mitarbeitern werden sogenannte<br />
Buddys an die Seite gestellt, die bei der<br />
Orientierung helfen sollen. „Unternehmen<br />
wie Politik müssen die Rahmenbedingungen<br />
für diejenigen verbessern, die<br />
mit ihrem Wissen und ihrer Expertise zu<br />
<strong>Deutschland</strong>s Wettbewerbsfähigkeit beitragen<br />
können“, sagt Werner Zedelius,<br />
Vorstandsmitglied der Allianz.<br />
<strong>Deutschland</strong> muss lernen, Einwanderer<br />
zu umwerben. Dies bedeutet nicht weniger,<br />
als eine neue Kultur in der Gesellschaft<br />
zu verankern – in Ämtern, unter<br />
Politikern und Personalchefs.<br />
Dazu zählt für Allianz-Vorstand Zedelius,<br />
die Vorteile <strong>Deutschland</strong>s zu vermarkten.<br />
Das habe man „vielleicht bisher<br />
noch nicht richtig“ getan. „Die Bundesregierung<br />
verhält sich viel zu defensiv“,<br />
sagt auch Christine Langenfeld, die Vorsitzende<br />
des Sachverständigenrats für Integration<br />
und Migration. Es fehle ein modernes<br />
„Zuwanderungsmarketing“. Erleichterungen<br />
wie die Blaue Karte seien<br />
im Ausland viel zu wenig bekanntgemacht<br />
worden. „Die Reformen gehören<br />
ins Schaufenster“, fordert Langenfeld,<br />
„und nicht unter den Ladentisch.“<br />
MAXIMILIAN POPP, JANKO TIETZ<br />
DER SPIEGEL 50/2013 51
Szene<br />
Was war da los,<br />
Frau Old?<br />
Samantha Old, 42, Schneiderin aus<br />
Bournemouth, über ungewöhnliche<br />
Kundschaft: „Ich habe zwei Hühnern<br />
Jacken aus Fleece geschneidert. Ein<br />
Ehepaar aus Bournemouth hat die beiden<br />
Tiere aus einer Legebatterie gerettet.<br />
Sie haben sie Margot und Valerie<br />
getauft. Der Besitzer rief an und<br />
sagte, er habe Angst, dass es im Winter<br />
zu kalt für die Tiere werden würde,<br />
schließlich haben sie vorher nur in<br />
engen Käfigen gelebt, waren nie draußen.<br />
Wenn man Tiere liebt, so wie<br />
ich, tut man alles für sie. Ich habe die<br />
Hühner genau vermessen und zwei<br />
verschiedene Jacken geschneidert, da -<br />
mit man die Tiere auseinan der -<br />
halten kann. Außerdem war<br />
es wichtig, dass der Stoff nicht<br />
zu schwer ist, warm hält und<br />
leicht zu reinigen ist. Margot<br />
und Valerie verhalten sich mit<br />
dem neuen Outfit ganz normal.<br />
Sie scheinen es zu mögen.“<br />
Wie bettelt man im Advent, Herr Mariček?<br />
FOTOS: BOURNEMOUTH NEWS / REX FEATURES / HGM<br />
Václav Mariček, 64, lebt seit über<br />
20 Jahren als Obdachloser auf der Stra -<br />
ße, seit vier Jahren in Hamburg. Der<br />
Dezember ist für ihn der beste Monat.<br />
SPIEGEL: Herr Mariček, was ändert sich<br />
für Sie in der Vorweihnachtszeit?<br />
Mariček: Sobald die ganzen Weihnachtsmärkte<br />
öffnen, ist mehr los auf<br />
der Straße. Die Leute sind fröhlich,<br />
der Geldbeutel sitzt lockerer. Es liegt<br />
auch mal ein Fünf- oder ein Zehn-<br />
Euro-Schein im Becher. An einem guten<br />
Adventstag kommen 30 bis 50<br />
Euro zusammen.<br />
SPIEGEL: Worauf achten Sie auf der<br />
Straße? Gibt es Tricks?<br />
Mariček: Entscheidend ist der Standort.<br />
Mein Platz ist seit Jahren die Spitalerstraße<br />
in der Hamburger Innenstadt.<br />
Mal sitze ich vor der Deutschen Bank,<br />
mal vor einem Spielwarengeschäft.<br />
Man muss freundlich gucken. Den<br />
Kindern zuwinken hilft auch. Und<br />
bloß keinen Alkohol vor Kinderaugen –<br />
vor dem Spielzeugladen trinke ich<br />
nie was. Manchmal sitze ich mit einem<br />
52<br />
Kumpel und seinem Hund zusammen.<br />
Wenn Leute dem Hund etwas bringen,<br />
gibt es meist auch was für uns.<br />
SPIEGEL: Betteln Sie auch auf den<br />
Weihnachtsmärkten?<br />
Mariček: Nein, das finde ich belei -<br />
digend. Die Leute wollen ihre Ruhe<br />
haben, etwas essen, Spaß haben.<br />
SPIEGEL: Warum sind Sie auf der Straße<br />
gelandet?<br />
Mariček: Meine Frau ist 1986 an einem<br />
Hirntumor gestorben. Damit bin ich<br />
Mariček<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
JÖRG MÜLLER / AG. FOCUS / DER SPIEGEL<br />
nicht klargekommen. Ich habe angefangen<br />
zu trinken, einen schweren<br />
Autounfall gebaut. Und ich fing an,<br />
durch <strong>Deutschland</strong> zu streifen.<br />
SPIEGEL: Wie überleben Sie im Winter?<br />
Mariček: Die Hauptsache ist, dass<br />
man einen Schlafsack und eine Iso -<br />
matte hat. Mit der Kälte habe ich kein<br />
Problem mehr. Es gibt auch Vorteile.<br />
Man bekommt schneller mal etwas<br />
Warmes zu essen geschenkt.<br />
SPIEGEL: Gibt es jetzt viel Konkurrenz<br />
auf der Straße?<br />
Mariček: Auf jeden Fall. Viele versuchen,<br />
Mitleid zu erregen. Sie laufen mit<br />
Krücken umher oder knien sich mitten<br />
auf den Gehsteig. Ich mach so was<br />
nicht. Und ich sage ihnen, 80 Prozent<br />
von denen sind gar nicht krank.<br />
SPIEGEL: Wie verbringen Sie Weih -<br />
nachten?<br />
Mariček: Ich bin jedes Jahr über Weihnachten<br />
und Silvester bei meiner<br />
Cousine in Hannover. Das ist schön, es<br />
gibt viel zu essen. Aber nach ein<br />
paar Tagen reicht es mir, und es zieht<br />
mich wieder auf die Straße.
Gesellschaft<br />
Gefühle, amtlich geprüft<br />
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum eine Stuttgarterin einen Unbekannten heiratete<br />
Abends, wenn es dunkel wird, setzt<br />
sich Ulrike Shigjeqi manchmal auf<br />
ihr Sofa und schaut sich Fotos an,<br />
die Bilder ihrer Liebe. Mittlerweile füllen<br />
sie ein dickes Album.<br />
Sie und er im Freibad.<br />
Sie und er vor einem Schloss.<br />
Sie und er an einer Imbissbude.<br />
Die Fotos sind kurz nach ihrer Hochzeit<br />
im Kosovo entstanden, das war vor<br />
zweieinhalb Jahren. Ulrike legt den Arm<br />
um Naim, sie sieht glücklich aus. Sie wollten<br />
sich in <strong>Deutschland</strong> ein gemeinsames<br />
Leben aufbauen,<br />
das war damals der Plan.<br />
Drei Monate nach der<br />
Hochzeit erhielt Ulrike Post<br />
von der Ausländerbehörde in<br />
Stuttgart. Das Amt lud sie und<br />
ihren Mann, der noch in seiner<br />
Heimat Kosovo lebte, zu<br />
einer Befragung ein. Das Amt<br />
unterstellte ihnen, dass ihre<br />
Liebe nicht echt sei.<br />
Ulrike Shigjeqi, die den Namen<br />
ihres Mannes trägt, dachte<br />
an das Fotoalbum, an Naim,<br />
an ihre Hochzeit. Dem Amt<br />
das Gegenteil zu beweisen,<br />
dachte sie, sei kein Problem.<br />
Ulrike Shigjeqi ist 28 Jahre<br />
alt und wohnt in einer Kleinstadt<br />
nahe Stuttgart. Ihre Kindheit<br />
sei nicht schön gewesen,<br />
sagt sie, Vater und Mutter stritten<br />
sich oft, Ulrike verbrachte<br />
viel Zeit im Reitstall. Nach der<br />
Schule machte sie eine Ausbildung<br />
zur Landwirtin.<br />
Ab und an lernte sie Männer<br />
kennen. Sie ging mit ihnen<br />
zum Fußball oder in ein Eiscafé, sie<br />
versuchte herauszufinden, ob der jeweilige<br />
Mann sich Kinder wünschte, ob er<br />
sich vorstellen könnte, mit ihr ein Heim<br />
zu gründen. Die meisten interessierte das<br />
nicht.<br />
An einem Nachmittag im August besuchte<br />
Ulrike Shigjeqi ein Fußballspiel in<br />
Bietigheim-Bissingen. Ein Freund stellte<br />
ihr seinen Cousin Naim vor, der zu Besuch<br />
in <strong>Deutschland</strong> war. Naim war damals<br />
25 Jahre alt, er sagte, er beliefere<br />
Restaurants mit Mineralwasser. Er habe<br />
gut ausgesehen, sagt Shigjeqi; an der Art,<br />
wie er aufs Tor zielte, habe sie erkennen<br />
können, dass er ehrgeizig sei. Sie wurden<br />
Freunde auf Facebook, das war 2009.<br />
Während der folgenden zwei Jahre<br />
schrieben sie sich Nachrichten und trafen<br />
sich beim Skype-Videochat. Sie unterhielten<br />
sich über das Wetter und über Fußball.<br />
Weil sie keine gemeinsame Sprache hatten,<br />
nutzten sie einen Übersetzungsdienst<br />
im Internet. Manchmal setzten sie sich<br />
auch einfach so vor den Bildschirm und<br />
lächelten sich an.<br />
Naim erzählte nicht viel, erinnert sich<br />
Ulrike. Häufig fiel während der Unterhaltung<br />
auch der Strom bei ihm aus. Aber<br />
Ulrike Shigjeqi<br />
Aus der Online-Ausgabe der „Stuttgarter Zeitung“<br />
er begann, einen Deutschkurs zu machen,<br />
und als er eines Tages fragte, ob sie ihn<br />
heiraten wolle, sagte sie ja.<br />
Im Juni 2011 kaufte Ulrike Shigjeqi ein<br />
Flugticket nach Priština. Naim kam zu<br />
spät, um sie abzuholen, aber als er sie<br />
umarmte, fühlte sie sich glücklich.<br />
Ihre Hochzeit feierten sie mit einem<br />
großen Fest. Verwandte waren gekommen,<br />
aus dem ganzen Land, sie stellten<br />
ihr Fragen über <strong>Deutschland</strong>. Ein Onkel<br />
traute das Paar. Danach gab es Čevap -<br />
čići und Pommes. Am Nachmittag musste<br />
Naim zum Deutschkurs, Ulrike ging<br />
allein ins Freibad. Nach fünf Tagen<br />
flog sie zurück. Sie freute sich auf die<br />
Zukunft.<br />
Wenige Wochen nach der Hochzeit beantragte<br />
Naim bei der deutschen Botschaft<br />
in Priština ein „Visum zur Familien -<br />
zusammenführung“, das es ihm erlauben<br />
würde, zu seiner Frau zu ziehen.<br />
Jedes Jahr decken die Behörden rund<br />
800 Scheinehen auf, der Kosovo steht auf<br />
der Liste der verdächtigen Herkunftsländer<br />
auf Platz fünf. Die Behörden in Priština<br />
und Stuttgart luden Ulrike und Naim<br />
zeitgleich zur Befragung ein, sie stellten<br />
ihnen 50 Fragen über ihr Leben.<br />
„Auf welcher Etage wohnen<br />
Sie?“<br />
„Wer hat den Heiratsantrag<br />
gemacht?“<br />
„Wer zahlte die Eheringe?“<br />
„Welche Hobbys hat Ihr<br />
Ehepartner?“<br />
„Ist Ihr Ehepartner Linksoder<br />
Rechtshänder?“<br />
„Ist Ihr Ehepartner Raucher<br />
oder Nichtraucher? Sie selbst?<br />
(Bitte Zigarettenmarke angeben).“<br />
Die Behörde geht davon aus,<br />
CIRA MORO / DER SPIEGEL<br />
dass Liebe auch auf der Kenntnis<br />
von Fakten beruht. Es ist<br />
eine eher bürokratische Vorstellung<br />
von Ehe, sie deckt sich<br />
nicht hundertprozentig mit der<br />
Vorstellung von Liebe und Romantik,<br />
die Ulrike Shigjeqi hat.<br />
Bei der Befragung sei sie<br />
aufgeregt gewesen, sagt sie.<br />
So konnte sie sich nicht an die<br />
Namen all seiner Verwandten<br />
erinnern. Naim gab an, dass<br />
Ulrike mit links schreibe, dabei<br />
ist sie Rechtshänderin; er<br />
wusste nicht, dass sie reitet.<br />
Sie klagten gegen den Entscheid. Das Verwaltungsgericht<br />
Berlin kommt in seinem<br />
Urteil zu dem Schluss, dass Ulrike und Naim<br />
Shigjeqi eine Scheinehe eingegangen seien,<br />
um ihm ein Daueraufenthaltsrecht zu sichern.<br />
Aus den Antworten könne man auf<br />
„mangelnde wechselseitige Vertrautheit“<br />
schließen. Die Klage wurde abgewiesen.<br />
Ulrike Shigjeqi hat seit sieben Monaten<br />
nichts mehr von ihrem Mann gehört.<br />
Doch sie hat sich entschlossen, für ihre<br />
Liebe zu kämpfen. Ihr Anwalt hat gegen<br />
das Urteil Berufung eingelegt, sie erzählte<br />
die Geschichte ihrer Lokalzeitung.<br />
Sie findet, dass sie ein Anrecht auf Liebe<br />
hat. Und dass Gefühle nicht durch Fakten<br />
gedeckt sein müssen. KATRIN KUNTZ<br />
DER SPIEGEL 50/2013 53
Gesellschaft<br />
NEUANFÄNGE<br />
Herr Meinhardt ist frei<br />
Politiker der FDP hatten immer einen warmen Platz, ihre Partei war Inventar des<br />
Bundestags. Nun sind sie dem Markt ausgesetzt. Das Beispiel des Abgeordneten<br />
Patrick Meinhardt zeigt, wie mühsam das sein kann. Von Barbara Hardinghaus<br />
Es ist seine eigene Wahlparty, auf<br />
der das Leben von Patrick Meinhardt<br />
für drei Sekunden zum Stillstand<br />
kommt. Er steht mit verschränkten<br />
Armen in einem Hotel in Karlsruhe und<br />
wartet zusammen mit seinen Gästen aus<br />
der Partei auf die erste Hochrechnung.<br />
„4,5 Prozent für die FDP“, sagt die Moderation<br />
vom ZDF. Meinhardt weiß, dass<br />
das der Moment ist, in dem alles aus dem<br />
Gleis springt.<br />
Er ist bildungspolitischer Sprecher der<br />
FDP und seit acht Jahren Mitglied des<br />
Bundestags. Auf der Landesliste Baden-<br />
Württemberg steht er auf Platz neun.<br />
7,2 Prozent hätte seine Partei für ihn erreichen<br />
müssen. Sein Kopf ist rot, er<br />
schwitzt, niemand im Raum rührt sich,<br />
bis einer sagt: „Mein lieber Gott!“ Meinhardt<br />
sucht die Blicke der anderen.<br />
54<br />
Abgeordneter Meinhardt<br />
Er packt beim Aufräumen mit an<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
HC PLAMBECK / DER SPIEGEL<br />
Fünf Kilo hat er im Wahlkampf gelassen,<br />
seit Juni ist er pausenlos unterwegs<br />
gewesen, 22 000 Kilometer durch seinen<br />
Wahlkreis Karlsruhe-Land gefahren, alles<br />
mit Bus und Bahn, denn er hat keinen<br />
Führerschein. 22 000 Kilometer ist einmal<br />
um die halbe Welt. 11 500 Postkarten hat<br />
er verschickt, noch am Vortag stand er<br />
an den FDP-Ständen von sechs Städten<br />
und verteilte 300 Bananen mit den Worten:<br />
„Darf ich Ihnen ein bisschen Energie<br />
geben?“, immer getragen von der Hoffnung,<br />
er könne es noch schaffen.<br />
An diesem Abend versteht er, dass niemand<br />
mehr seine Energie haben möchte.<br />
In einigen Tagen wird er 47 Jahre alt und<br />
in vier Wochen arbeitslos.<br />
In das Hotel in Karlsruhe kommt jetzt,<br />
etwas verspätet, ein Konditor aus der Gegend<br />
und bringt eine riesige Torte mit ei-
MICHAEL GOTTSCHALK / DAPD<br />
nem Foto von Meinhardt, das ihn fröhlich<br />
zeigt. Der Konditor zerschneidet die Torte,<br />
reicht Meinhardt ein Stück, der jetzt an einem<br />
der Bistrotische an der Seite steht und<br />
sein eigenes Lächeln vom Teller löffelt.<br />
„Was wir brauchen, ist eine wirkliche<br />
Erneuerung!“, sagt er, als eine Reporterin<br />
vom Fernsehen ihn interviewt. Als die<br />
meisten seiner Gäste gegangen sind, sitzt<br />
er im Hotelgarten unter Geranien, drückt<br />
sich ein Taschentuch über seine Tränen<br />
und sagt: „Ich mache natürlich weiter!“<br />
Er entschuldigt sich, verschwindet kurz<br />
auf dem Klo, kehrt zurück in den Raum,<br />
in dem seine Party zu Ende geht. Er packt<br />
jetzt beim Aufräumen mit an. Von weitem<br />
hört man ihn noch lange reden, mit<br />
kräftiger Stimme, als ginge es morgen<br />
früh weiter wie immer. Als hätte es diesen<br />
Abend gar nicht gegeben, an dem die<br />
FDP nach 64 Jahren aus dem Deutschen<br />
Bundestag geflogen ist.<br />
Was lernt man daraus als Mann von<br />
der FDP? Was bedeutet so ein Ergebnis<br />
für einen, der dafür mitverantwortlich<br />
ist? Was ändert es an einem Leben, das<br />
von Politik geleitet war?<br />
Patrick Meinhardt sitzt am Morgen<br />
nach der Wahl schon früh in einer Air-<br />
Berlin-Maschine, die ihn von Karlsruhe<br />
in die Hauptstadt fliegen wird, zu den anderen.<br />
Vormittags tagt der Vorstand der<br />
FDP-Fraktion im Bundestag, mittags die<br />
gesamte Fraktion. Auf dem Weg vom einen<br />
in den anderen Raum sind die Kameras<br />
auf die Gesichter von Verlierern gerichtet,<br />
Philipp Rösler, Rainer Brüderle.<br />
Meinhardt verschwindet hinter ihnen<br />
im Großen Sitzungssaal, er begrüßt Parteikollegen<br />
mit einem Schlag auf die<br />
Schulter. Er sagt: „2017 sind wir spätestens<br />
wieder da!“<br />
Am Nachmittag bespricht er mit seinen<br />
Mitarbeitern den Auszug aus dem Ab -<br />
geordnetenbüro. Er muss seine Wohnung<br />
in Prenzlauer Berg kündigen und sein<br />
Bürgerbüro räumen, in Bretten bei Baden-Baden,<br />
seiner Heimat.<br />
Drei Tage später kommt er in dieses<br />
Büro, eine Mitarbeiterin packt erste Kartons.<br />
Das Büro liegt direkt am Marktplatz<br />
von Bretten, in den großen Fenstern kleben<br />
Plakate von Patrick Meinhardt und<br />
seine Telefonnummer in großen Ziffern,<br />
damit sie jeder leicht erkennen und<br />
wählen kann. Die Nähe zum Bürger war<br />
Meinhardt schon immer wichtig.<br />
Es ist eigentlich ein trauriger Tag heute,<br />
aber man merkt ihm das nicht an, denn<br />
für den Abend erwartet er schon wieder<br />
DER SPIEGEL 50/2013 55
FDP-Ikone Genscher auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag 1989: „Brutal gut“<br />
56<br />
die nächsten Bürger, Mitglieder der Initia -<br />
tive Baden-Baden Stadt. Sie treffen sich<br />
zum Oktoberfest in der „Alten Turnhalle“.<br />
Sie unternehmen auch Wanderungen,<br />
suchen Ostereier oder feiern Fasching.<br />
Meinhardt ist ihr Vorsitzender, seit 20 Jahren.<br />
Seit er 27 Jahre alt ist.<br />
Meinhardt bewegt sich durch die Halle,<br />
wie Dieter Thomas Heck durch die Hitparade<br />
raste. Meinhardt rennt, redet,<br />
trinkt einen mit, überreicht Blumensträuße<br />
an Jubilare, er macht diese Menschen<br />
glücklich. Er ist ein guter Gastgeber.<br />
Ein Lokalreporter, der Meinhardt während<br />
dessen Wahlkampf des Öfteren traf,<br />
sagt, dass Meinhardt sich verändert habe<br />
in dieser Zeit. Meinhardts Stimme sei<br />
noch lauter geworden und auch sein Lachen.<br />
Er habe gekämpft, bis zuletzt.<br />
Man könnte sich jetzt fragen, was die<br />
Menschen heute von Politikern erwarten,<br />
außer dass sie kämpfen und fröhlich sind.<br />
Das Allensbach-Institut stellt „im Ansehen<br />
der Politiker einen historischen Tiefstand“<br />
fest. Die FDP befindet sich demnach auf<br />
dem tiefsten Punkt des Tiefstands.<br />
Wenn man Meinhardt fragt, was er geleistet<br />
habe in seinen acht Jahren Bundestag,<br />
als Vorsitzender des Arbeitskreises<br />
Innovation, Gesellschaft und Kultur der<br />
FDP-Bundestagsfraktion, als Vorsitzender<br />
der Parlamentariergruppe Östliches Afrika,<br />
als Vorsitzender des FDP-Bundesfachausschusses<br />
Bildung, Wissenschaft, Forschung<br />
und Technologie, sagt er, er sei<br />
einer von denen gewesen, die die Gruppe<br />
der „Christen in der FDP-Bundestagsfraktion“<br />
gegründet haben, ein wöchentliches<br />
Gebetsfrühstück mit Andacht.<br />
Das ist vielleicht das Überraschendste<br />
an Patrick Meinhardt: das Gebetsfrühstück.<br />
Man traut einem Politiker der FDP<br />
nichts zu, was sich in einer Partei des wirtschaftsliberalen<br />
Starrsinns Aufmerksamkeit<br />
verschaffen könnte, nichts Über natür -<br />
liches, nichts, was mit einem Gemeinschaftsgefühl<br />
verbunden werden könnte.<br />
Wie die meisten Politiker seiner Generation<br />
hat Meinhardt keine große Idee, an<br />
die er glauben könnte, schon gar keine<br />
Vision, in ihm lodert auch keine politische<br />
Leidenschaft. Er hat das Gebetsfrühstück<br />
eingerichtet, so wie andere Menschen einen<br />
Adventsbasar einrichten. Es macht<br />
ihm Spaß, aber es ist nicht Teil einer poli -<br />
tischen Strategie. Meinhardt ist einer dieser<br />
vielen Abgeordneten, die ihr Thema<br />
nicht mit in den Bundestag bringen, sondern<br />
sich so lange treiben lassen, bis sie<br />
auf ein Thema stoßen, von dem sie irgendwann<br />
verkünden: Das Thema ist meines.<br />
Man kann dieses Zufallsprinzip für<br />
unpolitisch halten, man kann aber auch<br />
sagen: Die Generation Meinhardt passt<br />
Politik ihren Lebensgewohnheiten an.<br />
Wie viele Politiker seiner<br />
Generation hat Meinhardt<br />
keine große Idee,<br />
an die er glauben könnte.<br />
Man muss Politik nicht so fundamental<br />
verstehen wie Herbert Wehner, um sie<br />
attraktiv zu finden.<br />
Dann zählt Meinhardt noch folgende<br />
Punkte auf: Er habe das Konzept „Bildungssparen“<br />
mit auf den Weg gebracht,<br />
eine Art Bausparmodell fürs Studieren.<br />
Er habe das „<strong>Deutschland</strong>stipendium“ zusammen<br />
mit anderen erfunden, 14 000 zusätzliche<br />
Universitätsstipendien. Und für<br />
die 7,5 Millionen Analphabeten im Land<br />
habe seine Arbeitsgruppe ein Konzept<br />
für einen Masterplan entwickelt.<br />
Was er im Bundestag gern noch getan<br />
hätte? Das <strong>Deutschland</strong>stipendium aus -<br />
bauen, den Masterplan für die Analphabeten<br />
schreiben. Er sagt, er wäre an diesen<br />
Themen gern noch länger drangeblieben.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
DPA<br />
Gesellschaft<br />
Meinhardt wurde 1966 als uneheliches<br />
Kind geboren, er wuchs bei seiner Oma<br />
auf, in einer billigen Wohnung, an einer<br />
der teuersten Straßen von Baden-Baden.<br />
Und während die anderen Jungs zum Spielen<br />
gingen, erledigte er für seine Oma den<br />
Einkauf oder die Gänge zum Sozialamt.<br />
Eines Tages klingelte die Diakonin der<br />
Gemeinde an der Haustür. Sie fragte, ob<br />
Patrick mit zum Kindergottesdienst kommen<br />
wolle. Und weil Meinhardt kein anderes<br />
Leben kannte als das der Aufgaben,<br />
wurde er mit elf Jahren Leiter der Kinderkirchengruppe.<br />
Er las den Vier- bis<br />
Elfjährigen jeden Sonntagvormittag aus<br />
der Bibel vor oder erzählte ihnen die Geschichte<br />
von Jona und dem Fisch.<br />
Das habe ihm, so beschreibt er es, „unendlich<br />
viel innere Freude bereitet“. Er<br />
konnte das gut, vor anderen reden. Er<br />
mochte es, wenn man ihm zuhörte.<br />
Mit 21 wurde er Kreisvorsitzender der<br />
Jungen Liberalen in Baden-Baden. Er erfuhr<br />
damals, dass es Streit gab zwischen<br />
den Bürgern und einem Künstler, der für<br />
1,6 Millionen Mark einen Brunnen auf<br />
den Leopoldsplatz stellen ließ und dafür<br />
jetzt auch noch drei Kugelbäume fällen<br />
wollte. Zusammen mit seinen vier Kollegen<br />
informierte er die Presse, stellte einen<br />
Tapeziertisch in die Fußgängerzone und<br />
sammelte Unterschriften gegen das Fällen<br />
ein, 3000 Stück. Danach kannten alle die<br />
Jungen Liberalen in Baden-Baden. Zwei<br />
Monate später gehörte Meinhardt zum<br />
Landesvorstand der FDP und besuchte<br />
Veranstaltungen in ganz <strong>Deutschland</strong>.<br />
Wieso die FDP?<br />
„Aus einem liberalen Grundempfinden“,<br />
sagt er und schließt kurz die Augen.<br />
Außerdem habe ihn dieses eine Bild beeindruckt,<br />
Hans-Dietrich Genscher auf<br />
dem Balkon der deutschen Botschaft in<br />
Prag im Herbst ’89. Das war „gigantisch“,<br />
sagt er. Er mag diese starken Wörter, „gigantisch“,<br />
„grandios“, „brutal gut“, er setzt<br />
auch ein kurzes Lachen hinter jeden seiner<br />
Sätze, als brauchte er ständig Verstärker.<br />
Erst später beschäftigte sich Meinhardt<br />
mit politischen Inhalten, er las Max<br />
Weber, Theodor Heuss, Karl-Hermann<br />
Flach, Reinhold Maier. Ihm gefiel die Idee<br />
der Graswurzeldemokratie. Er versuchte,<br />
das auch in seinem Bürgerbüro in Bretten<br />
zu leben. Also baute Meinhardt eine gemütliche<br />
Sitzecke in sein Büro.<br />
„Das Schönste waren hier eigentlich<br />
immer die Bürgerempfänge!“, sagt er. Bei<br />
den Empfängen hatte er den Laden voll<br />
mit 40, 50 oder 60 Bürgern. Meinhardt<br />
brauchte immer die Bürger, um sich wohl<br />
zu fühlen.<br />
Die Themen, für die Meinhardt sich<br />
einsetzt, sind die, in denen es vor allem<br />
um Chancengleichheit geht. Er selbst hat<br />
in seinem Leben davon profitiert, dass es<br />
Menschen gab, die ihm die gleichen Chancen<br />
gaben wie anderen. Einer seiner<br />
Lehrer half ihm, weil es bei Meinhardt zu
Arbeitsloser Politiker Meinhardt: Ein Leben aus Ehrenämtern<br />
Hause einen Fernseher gab, aber kein<br />
Geld für Bücher. In der Oberstufe sammelte<br />
ein anderer Lehrer Geld, damit<br />
Meinhardt mit auf die Rom-Fahrt konnte.<br />
In der Wahrnehmung der Bürger ist die<br />
einst liberale FDP zu einer Wirtschaftspartei<br />
geworden, die sich vor allem um<br />
die Interessen einer einzelnen Gruppe<br />
kümmerte, die des Mittelstands. Mit Meinhardts<br />
Vorstellungen von Chancengleichheit<br />
hat diese FDP nichts zu tun. In den<br />
Augen vieler Bürger ist es die Partei, die<br />
arbeitslosen Schlecker-Angestellten riet,<br />
schnellstmöglich und aus eigener Kraft<br />
und ohne staatliche Hilfe eine „Anschlussverwendung“<br />
zu finden. Es sieht so aus,<br />
als hätte sie das Gefühl für die Gesamtheit<br />
der Menschen verloren, als verfügte sie<br />
nur noch über einzelne Inselbegabungen,<br />
was sie für den Alltag untauglich macht.<br />
Wer nicht weiß, wozu die FDP gut sein<br />
könnte, der weiß auch nicht, warum er<br />
den FDP-Abgeordneten Meinhardt wählen<br />
sollte. Die FDP war mal die Partei<br />
der Bürgerrechte, die Partei der begründeten<br />
Skepsis gegenüber der herrschenden<br />
Meinung, die Partei der Argumentierer,<br />
hin und wieder auch die Partei der<br />
Querulanten. Sie war nicht pausenlos allein<br />
die Partei des Machtkalküls und des<br />
politischen Opportunismus. Sie galt als<br />
Funktionspartei, weil sie eine Funktion<br />
hatte, im Zweifel die des Züngleins an<br />
der Waage. Welche Funktion könnte sie<br />
heute noch haben?<br />
Von einem Politiker wie Meinhardt, der<br />
als persönliche Bilanz nicht mehr zu bieten<br />
hat als ein Gebetsfrühstück, ist keine<br />
überzeugende Antwort zu erwarten. Seine<br />
Kollegen im Parteivorstand müssten eine<br />
Antwort haben, aber sie reden sich nur<br />
darauf heraus, dass die Große Koalition<br />
riesige Pannen verursachen werde. Sie hoffen<br />
auf Fehler der beiden Volksparteien,<br />
die noch gar keine Koalition gebildet und<br />
folglich noch gar keine Fehler begangen<br />
58<br />
Für die FDP geht es<br />
jetzt nur noch um<br />
ihre eigene „Anschlussverwendung“.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
CIRA MORO / DER SPIEGEL<br />
Gesellschaft<br />
haben. Das ist eine erschreckend dürftige<br />
Hoffnung für einen Neuanfang der FDP.<br />
Für die FDP selbst geht es jetzt bloß<br />
noch um ihre eigene „Anschlussverwendung“.<br />
Welche wird Meinhardt finden?<br />
An einem Montag Mitte Oktober läuft<br />
Meinhardt leger, in Jeans, Sakko und offenem<br />
Hemd, über die Flure des Abgeordnetenhauses<br />
in Berlin. Er zeigt sich<br />
wieder gutgelaunt, obwohl ihm über das<br />
Wochenende ein Herpes an der Oberlippe<br />
gewachsen ist und er in den Tagen zuvor<br />
mit seinem Blutdruck zu tun hatte.<br />
Der ist zu hoch, obwohl er eigentlich immer<br />
zu niedrig war. Jetzt suchen die Ärzte<br />
nach einer Ursache, aber finden sie nicht.<br />
Er solle sich schonen, haben sie gesagt.<br />
Aber Meinhardt hat zu tun. Für den<br />
Nachmittag erwartet er schon wieder Gäste<br />
in seinem Abgeordnetenbüro. Auch in<br />
Berlin hat er immer gern Feste gegeben,<br />
zu Weihnachten oder zum Saint Patrick’s<br />
Day. Er schüttet Wasabi-Nüsse auf ein<br />
Tablett. Nur noch bis Mitternacht wird er<br />
Abgeordneter sein.<br />
Seine Mitarbeiter haben, während er<br />
sich mit seinem Blutdruck herumschlug,<br />
sein Büro verpackt. Möbelpacker brachten<br />
seinen schweren Eichenschreibtisch<br />
nach Baden-Baden, über das Kreuz, das<br />
immer über seiner Tür hing, sagte er: Das<br />
Kreuz verlässt als Letztes den Raum. Seine<br />
Akten und Papiere liegen in hohen<br />
Kartons gestapelt.<br />
Um die Rechner sind Folien gespannt,<br />
die Kabel aufgerollt. Die SPD zieht ein.<br />
Meinhardt musste schon seinen Abgeordnetenausweis<br />
abgeben, seine Mailadresse,<br />
die Telefonnummer.<br />
Er sucht jetzt einen Korkenzieher.<br />
Er läuft über den Flur Richtung Küche.<br />
Vor dem Büro von Stefan Ruppert, der<br />
noch wenige Stunden lang Parlamen -<br />
tarischer Geschäftsführer der FDP ist,<br />
steht ein Karton mit der Aufschrift „Bücher<br />
zum Mitnehmen“. Er trifft Birgit<br />
Homburger, die in Wollpullover und<br />
Turnschuhen Sektgläser in Papier wickelt<br />
und blaue Müllsäcke befüllt. Er<br />
begrüßt Pascal Kober, der sagt: „Und?<br />
Jetzt die Schlüssel abgeben? Na ja, toi,<br />
toi, toi.“<br />
Mit Meinhardt werden an diesem Tag<br />
92 weitere Bundestagsabgeordnete arbeitslos.<br />
Auch 700 Partei- und Fraktionsmitarbeiter<br />
verlieren ihre Stelle. Das Jobcenter<br />
von Berlin-Mitte hat ein „Notfall-<br />
Büro“ im Haus eingerichtet. Die FDP<br />
glaubte immer daran, dass der Markt solche<br />
Situationen schon regle. Sie kann<br />
jetzt ausprobieren, wie sich das in der<br />
Wirklichkeit verhält.<br />
Zu Meinhardts Berliner Büro gehören<br />
fünf Mitarbeiter, junge Männer mit weichem<br />
Gesicht und sanfter Stimme. Meinhardt<br />
hat in den vergangenen Tagen viel<br />
Zeit darauf verwendet, sie in neue Jobs<br />
zu telefonieren. Zu seinen guten Eigenschaften<br />
gehört auch, dass er sich kümmert.<br />
Seine Mitarbeiter bleiben weitgehend<br />
in anderen Fraktionen, unter dem<br />
regenfesten Dach der Politik.<br />
Meinhardt ist mit dem Korkenzieher<br />
zurück, er erwartet Kollegen, Mitarbeiter<br />
aus dem Fraktionsbüro und aus der Arbeitsgruppe.<br />
Am Wochenende musste er<br />
ihre Namen, Adressen und Geburtsdaten<br />
in eine Liste eintragen und sie an den<br />
Empfang schicken, damit sie überhaupt<br />
noch reinkommen.<br />
Der erste Gast an diesem Tag ist ein<br />
Bildungsreferent aus der Arbeitsgruppe.<br />
Er ist 13 Minuten zu früh. Er hat jetzt<br />
Zeit. An einen leeren Schrank gelehnt<br />
stehen drei Sekretärinnen. Eine von ihnen<br />
ist 38 Jahre alt, seit 14 Jahren in der<br />
Fraktion, sie arbeitete schon im Vorzimmer<br />
von Wolfgang Gerhardt. Sie sagt, sie<br />
gehe zurück in die Bundestagsverwaltung,<br />
aber ihre beiden Kolleginnen seien noch<br />
auf der Suche.<br />
„Am schwersten haben es die Referenten<br />
und die älteren Sekretärinnen“, sagt<br />
sie. „Die jungen Mädels sind alle untergebracht.“<br />
Das Problem sei, dass viele von ihnen<br />
kaum Englisch sprechen würden und auch<br />
am Computer nicht so fix seien. „Wenn<br />
man hier arbeitet und dann in die freie<br />
Wirtschaft geht, ist das etwas ganz, ganz<br />
anderes“, sagt sie. Es sieht so aus, als<br />
würde der Markt für sie erst mal nichts<br />
regeln.<br />
Und die anderen?<br />
„Über weitere Pläne lässt sich derzeit<br />
nichts sagen“, heißt es aus der Pressestelle
Gesellschaft<br />
von Philipp Rösler. Rösler war früher in<br />
der Augenheilkunde tätig.<br />
„Leider werden wir Ihre Frage nicht beantworten<br />
können“, schreibt jemand aus<br />
der Pressestelle von Rainer Brüderle. Er<br />
ist 68 und will vielleicht mal in Rente.<br />
„Über weitere Pläne ist noch nichts entschieden“,<br />
übermitteln die Presseleute<br />
von Dirk Niebel. Der arbeitete früher im<br />
Arbeitsamt.<br />
Guido Westerwelle ist Anwalt mit Zulassung.<br />
Meinhardt sagt, er werde Westerwelle<br />
demnächst einen Brief schreiben. Er<br />
möchte ihn motivieren, Spitzenkandidat<br />
der FDP bei der Europawahl zu werden.<br />
Und Meinhardt selbst?<br />
Er begann nach dem Abitur ein<br />
Theologiestudium, er brach es ab,<br />
weil er seine Oma pflegte, bis sie<br />
1994 starb. Er verdiente sein Geld<br />
als Nachhilfelehrer. Er ist ohne<br />
Ausbildung und ohne Beruf. Für<br />
jedes Abgeordnetenjahr bekommt<br />
er, sofern er keine anderen Einkünfte<br />
hat, einen Monat Gehalt,<br />
also achtmal 8000 Euro. Im Sommer<br />
ist Schluss.<br />
Bis dahin hat er Zeit. Seine Idee<br />
ist, sich wieder selbständig zu machen,<br />
mit einem Büro für „Politische<br />
Beratung“, das den Namen<br />
„Carpe Diem“ tragen soll.<br />
In seinem Büro in Berlin erhebt<br />
er jetzt das Glas Sekt. „Das soll<br />
kein Abschiedsempfang sein, nur<br />
ein Zwischenempfang, bis wir uns<br />
spätestens in vier Jahren hier wiedersehen<br />
werden“, sagt er.<br />
Das Wort „spätestens“ dehnt er<br />
über mehrere Sekunden. Er bittet<br />
alle, ihre Mail-Adressen aufzuschreiben,<br />
er wolle Kontakt halten.<br />
Für einen Berufspolitiker, wie<br />
Meinhardt einer ist, ist die Zeit<br />
nach der Wahl die Zeit vor der<br />
Wahl. Er schreibt Leserbriefe, Pressemitteilungen,<br />
Facebook-Einträge.<br />
Ein Politiker, der die Bürger<br />
braucht. Nicht Bürger, die Politik<br />
brauchen. Vielleicht liegt darin das<br />
große Missverständnis von Patrick<br />
Meinhardt.<br />
Zehn Tage später, am 31. Oktober, ist<br />
auch Meinhardts Brettener Büro ausgeräumt.<br />
Der Mietvertrag läuft in der Nacht<br />
aus. Meinhardt nutzt die Gelegenheit,<br />
um sich den Bürger noch einmal ins Haus<br />
zu holen. Er hat Schnittchen vorbereiten<br />
lassen.<br />
Am Abend besucht er den Gottesdienst<br />
in Bretten zum Reformationstag. „Ständig<br />
ist Erneuerung“, sagt der Pastor der<br />
Gemeinde. In dunklem Mantel steht<br />
Meinhardt in der Bank, senkt den Kopf.<br />
Er betet. In zwei Tagen will er sich auf<br />
dem FDP-Landesparteitag zum Generalsekretär<br />
wählen lassen.<br />
Das Amt eines Generalsekretärs bedeutet<br />
vor allem: viel Arbeit und kein Geld,<br />
60<br />
es ist ein Ehrenamt. Meinhardt hat schon<br />
neun Ehrenämter. Im Grunde bestand<br />
sein Leben aus Ehrenämtern, seit er losgelaufen<br />
war als Kind und anfing mit<br />
Jona und dem Fisch.<br />
Mit dem Amt des Generalsekretärs<br />
würde er wenigstens noch vorkommen.<br />
Er könnte Pressemitteilungen schreiben.<br />
Die Zeitungen würden berichten. Das<br />
Amt würde ihn am Leben halten.<br />
Vielleicht merkt der Bürger ja, wenn<br />
Politiker auf seine Kosten leben, und vielleicht<br />
muss Meinhardt nur noch merken,<br />
dass der Bürger es gemerkt hat.<br />
Am Morgen des Landesparteitags stößt<br />
Patrick Meinhardt zu Fuß aus dem Nebel<br />
Abtransport von FDP-Wahlplakaten: „Carpe Diem“<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
an die Veranstaltungshalle in Filderstadt.<br />
Er ist wie immer mit der Bahn gekommen.<br />
Er sagt, er habe die vergangenen<br />
48 Stunden nur telefoniert, er sei um<br />
3.30 Uhr aufgestanden.<br />
Er begrüßt einige seiner Parteifreunde,<br />
er geht mit hektischen Schritten auf sie<br />
zu, und schon eine Stunde später, um<br />
9.45 Uhr, liegt sein Haar verschwitzt im<br />
Nacken. An diesem Tag geht es für einige<br />
der Delegierten um die letzten Ämter<br />
und Ehrenämter in der baden-württembergischen<br />
FDP, sie suchen sie, wie Hungernde<br />
Nahrung suchen.<br />
Meinhardt muss bis zum Nachmittag<br />
warten, bis er erfährt, ob Michael Theurer<br />
ihn rettet. Theurer will sich zum Landeschef<br />
wählen lassen, und wenn das so<br />
kommt, zieht er Meinhardt mit.<br />
Vorher spricht die bisherige Landesvorsitzende<br />
Birgit Homburger, die 2009<br />
FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag<br />
wurde und nach knapp 19 Monaten von<br />
ihrer Partei entmachtet worden ist. Sie<br />
kennt den Schmerz, den der Verlust von<br />
politischen Ämtern verursachen kann. In<br />
ihrer Rede sagt sie, sie blicke auch auf<br />
schwere Zeiten zurück. Sie erinnert die<br />
anderen daran, dass auch für sie die wirklich<br />
schweren Tage noch kommen werden,<br />
dann, wenn keiner von ihnen hier<br />
im Saal mehr eine Rolle spielen werde.<br />
Es gibt andere, die politische Niederlagen<br />
schlechter verkraftet haben als<br />
Homburger. Die Bündnisgrüne<br />
Andrea Fischer wurde 1998 Gesundheitsministerin,<br />
drei Jahre<br />
später schickten ihre eigenen<br />
Leute sie nach Hause. Sie wurde<br />
depressiv.<br />
Gegen Nachmittag tritt Michael<br />
Theurer zu seiner Rede an. Meinhardt<br />
wirkt unruhig, sein Blutdruck<br />
presst ihm dunkelrote Flecken<br />
ins Gesicht, er beklatscht<br />
seinen Freund Theurer nach jeder<br />
Pointe. Kurz nach 16 Uhr gewinnt<br />
Theurer im zweiten Wahlgang die<br />
Wahl. Die Delegierten bestätigen<br />
Patrick Meinhardt als General -<br />
sekretär mit 72,05 Prozent der<br />
Stimmen. „Knapp drei Viertel“, er<br />
wirkt sehr zufrieden. Sein Leben<br />
ist zurück ins Gleis gesprungen. Er<br />
hofft jetzt darauf, dass er Beisitzer<br />
im Bundesvorstand wird.<br />
Generalsekretär in Baden-Württemberg,<br />
Beisitzer im Bundesvorstand.<br />
Patrick Meinhardt baut sich<br />
ein neues Leben zusammen. Ein<br />
Parteiposten-Leben. Der Freiheit<br />
des Marktes, dem Evangelium seiner<br />
Partei, hat er sich gar nicht erst<br />
ausgesetzt. Er musste keinen Wirklichkeitstest<br />
bestehen. Im politischen<br />
Apparat haben sich Plätzchen<br />
gefunden, die Meinhardt<br />
warm halten.<br />
Wie geht es ihm damit?<br />
Er antwortet auf diese Frage am Tag<br />
nach seiner Ernennung zum General -<br />
sekretär in einer SMS. Er schreibt:<br />
„Ich war gestern und heute von einer<br />
ausgesprochenen inneren Ruhe getragen.<br />
Ich habe mich sehr gefreut – und seither<br />
so viele Gespräche mit Delegierten geführt,<br />
dass ich sie schon nicht mehr zählen<br />
kann… Theodor Heuss hat gesagt: ,Ich ha -<br />
be nicht das Talent, faul zu sein!‘ Das passt<br />
auch ziemlich gut zu mir. Herzlichst, schon<br />
wieder aus Berlin. Ihr Patrick Meinhardt.“<br />
FOTOS: ROLAND WEIHRAUCH / DPA<br />
Animation:<br />
Die lange Geschichte der FDP<br />
spiegel.de/app502013fdp<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Gesellschaft<br />
ALTENBURG<br />
Pik ohne zwei<br />
ORTSTERMIN: In Altenburg tagt das Internationale Skatgericht –<br />
das Spiel ist in schweres Fahrwasser geraten.<br />
62<br />
Die Skatrichter werden in den kommenden<br />
zehn Stunden Apfelsaft<br />
trinken und Entscheidungen fällen.<br />
Die Diskussion wird manchmal laut<br />
werden, aber immer präzise bleiben. Die<br />
Skatrichter tragen weiße Hemden, der<br />
oberste Knopf ist geschlossen. In den Kragen<br />
sind die Zeichen der Zunft gestickt:<br />
Karo, Herz, Pik, Kreuz. Auf der Brust ist<br />
ein Mann mit Richterhut zu erkennen,<br />
der mit ausgestrecktem Zeigefinger auf<br />
den Betrachter zielt. Es geht um Schuld,<br />
es geht auch um Verantwortung.<br />
Die Skatrichter sitzen im<br />
Bräu-Stübel der Altenburger<br />
Gaststätte „Am Rossplan“,<br />
sie ziehen schwere Ordner<br />
aus ihren Aktentaschen und<br />
legen sie auf den Holztisch,<br />
daneben Rotstifte und die<br />
Skatordnung. In den Ordnern<br />
sind die Skatgerichtsanfragen.<br />
Streitfälle, bei denen<br />
Spieler allein nicht mehr<br />
weiterkommen. Sie werden<br />
nun 78 Anfragen behandeln,<br />
SkGE 265-13 bis 342-13.<br />
Etwa 400 Anfragen erreichen<br />
das Gericht jedes Jahr.<br />
Ein Skatrichter gewinnt<br />
Einblick in den Charakter<br />
der Menschen. „Für 30<br />
Punkte“, sagt einer von ihnen,<br />
„würden manche Leute<br />
ihre Seele verkaufen.“<br />
Was darf ein Skatspieler? Was passiert<br />
ihm, wenn er jemanden anders ins Blatt<br />
greift? Darf ich meinen Sohn nach einer<br />
Spielkarte benennen? Darf ein ein -<br />
armiger Mitspieler eine Kartenmisch -<br />
maschine benutzen? Was ist Gerechtigkeit?<br />
Mischmaschinen mischen anders,<br />
gründlicher als Hände. Gerecht wäre es,<br />
wenn entweder immer eine Mischmaschine<br />
verwendet würde oder nie. Die Skatrichter<br />
sind dafür, dass einer der Mit -<br />
spieler für den Einarmigen mischt. Es<br />
sei denn, alle am Tisch sind für die Maschine.<br />
Jedes Land hat sein Spiel. Jedes Spiel<br />
braucht seine Ordnung. <strong>Deutschland</strong> hat<br />
Skat, erfunden vor 200 Jahren, unter anderem<br />
von einem Regierungsrat, einem<br />
Gymnasialprofessor und einem Notar;<br />
in einer Oper gewürdigt von Richard<br />
Strauss, verbreitet in den Schützengräben<br />
zweier Weltkriege. Heute liegt es an Skatgerichtspräsident<br />
Peter Luczak und seinen<br />
Leuten, die Ordnung des Spiels zu<br />
hüten. Sie sind das höchste Gremium im<br />
Skat, die letzte Instanz, unanfechtbar, für<br />
alle verbindlich. Es ist nicht einfacher<br />
geworden mit den Jahren.<br />
Tagesordnungspunkt 7 behandelt offene<br />
Spiele, also Skatspiele, bei denen der<br />
Spieler alle Karten auf den Tisch legt, anstatt<br />
sie verdeckt zu halten. So steht es in<br />
der Skatordnung, Punkt 2.2.5.: Die Karten<br />
auf dem Tisch müssen deutlich sichtbar<br />
geordnet sein. Nur: Was heißt „deutlich<br />
sichtbar“?<br />
Skatrichter Rehmke, Luczak, Kraft: Letzte Instanz<br />
Skatgerichtspräsident Luczak schlägt<br />
vor, mindestens 50 Prozent der Oberfläche<br />
der Spielkarten zeigen zu müssen. Skatrichter<br />
Bock sagt, die Karten müssten in<br />
der ganzen Größe aufgelegt werden. Skatrichter<br />
Kraft sieht keinen Änderungsbedarf.<br />
Der bisher meist schweigsame norddeutsche<br />
Skatrichter Rehmke wirft ein,<br />
es gebe Lichtreflexe, die selbst völlig freie<br />
Spielkarten nur für manche erkennbar<br />
sein lassen. Er habe das selbst so erlebt,<br />
in einer Tennishalle bei Kirchheim. Die<br />
hatte Oberlicht. Die Runde nickt. Nach<br />
30 Minuten Diskussion einigt man sich<br />
darauf, das „deutlich sichtbar“ in der<br />
Skatordnung zu unterstreichen und fett<br />
zu drucken. Alles Weitere wird bei der<br />
nächsten Tagung besprochen.<br />
Mittagspause. Die Skatgerichtsmitglieder<br />
schauen sich den Weihnachtsmarkt<br />
an. Skatgerichtspräsident Luczak bleibt<br />
am Tagungsort, er hält Wache. Er hat in<br />
der Nacht schlecht geschlafen. Manchmal<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
rufen ihn Skatrunden noch um drei Uhr<br />
in der Früh an und wollen eine Antwort.<br />
Er ist jetzt 66 Jahre alt, das Haar ist grau<br />
geworden mit der Zeit. Er ist auch dünnhäutiger<br />
geworden, sagt er. Manche Diskussionen<br />
hat er schon zu oft geführt.<br />
Skatspieler seit 54 Jahren, seit 24 Jahren<br />
beim Skatgericht, 6000 Skatgerichtsan -<br />
fragen hat er in dieser Zeit beantwortet.<br />
Alles ehrenamtlich. „Die kompetenteste<br />
Person weltweit in Sachen Skatregeln“,<br />
sagen Bekannte. Er ist Goldnadelträger<br />
des Deutschen Skatverbands. Aber sei -<br />
ne Verdienste seien nicht<br />
wichtig, sagt er, er sei nicht<br />
wichtig. Ein Funktionär müs -<br />
se funktionieren. Auch in<br />
schwierigen Zeiten.<br />
Früher spielte jeder Student<br />
Skat, in jedem Schulbus,<br />
jeder Schulpause wurden<br />
Karten ausgespielt. Lu -<br />
czak hat mit fünf Jahren bei<br />
seinem Großvater gelernt,<br />
was ein Skatblatt ist. Seine<br />
Enkel spielen kein Skat. Er<br />
hat versucht, es ihnen beizu -<br />
bringen, aber sie spielen auf<br />
Besuch immer nur mit ihrem<br />
Mobiltelefon. Es scheint<br />
so, als verliere <strong>Deutschland</strong><br />
langsam das Interesse an seinem<br />
eigenen Spiel.<br />
Am Abend, während die<br />
Skatrichter einen Preisskat<br />
spielen, steht Luczak draußen, eine rauchen.<br />
Er schaut nach oben, keine Sterne<br />
stehen am Himmel. Es soll kalt werden.<br />
Er schaut in Richtung Skatbrunnen, an<br />
dem manche in Altenburg ihre Karten<br />
taufen. Auf einmal erinnert er sich an ein<br />
Spiel, 22 Jahre ist es her, ein schweres<br />
Spiel, Pik ohne zwei, wenig Trümpfe, nur<br />
Mist im Skat.<br />
Luczak weiß noch die genaue Verteilung<br />
aller 32 Karten. Sein Mund öffnet<br />
sich leicht, seine Augen schauen in die<br />
Ferne. In Gedanken sitzt er wieder am<br />
Spieltisch, während er Stich für Stich seine<br />
Gegner in die Knie zwingt.<br />
Die besten Spiele, sagt er, sind nicht<br />
die einfachen, die mit den guten Karten.<br />
Sondern die aussichtslosen, bei denen<br />
man bis zum Ende kämpfen muss. Er<br />
drückt die Zigarette aus und geht hinein.<br />
Seine Mitspieler warten auf ihn. Es gibt<br />
noch ein Spiel zu gewinnen.<br />
JONATHAN STOCK<br />
SVEN DOERING / AG FOCUS / DER SPIEGEL
Trends<br />
LUKAS BARTH / DDP IMAGES<br />
Karstadt-Filiale<br />
Benko mit Ehefrau<br />
STARPIX / PICTUREDESK.COM / ACTION PRESS<br />
HANDEL<br />
Investoren verkaufen weitere<br />
Karstadt-Häuser<br />
Sie waren der Hauptvermieter der Karstadt-Immobilien,<br />
jetzt aber verkaufen<br />
sie Haus für Haus: Das Highstreet<br />
Konsortium, zu dem neben Goldman<br />
Sachs auch die Deutsche Bank und die<br />
italienische Borletti Group gehören,<br />
will sich bis zum Ende des Jahres von<br />
weiteren 25 Karstadt-Immobilien trennen.<br />
Fünf davon gehen an den österreichischen<br />
Immobilienunternehmer<br />
René Benko, der bereits etliche<br />
Karstadt-Häuser besitzt. Das geht aus<br />
einem Kaufvertrag vom Dezember<br />
vergangenen Jahres hervor. Damals<br />
hatte der österreichische Immobilienunternehmer<br />
insgesamt 17 Häuser<br />
erworben, die letzten 5 sollen nun<br />
binnen Jahresfrist übertragen werden.<br />
Dabei handelt es sich um die Karstadt-<br />
Standorte am Münchner Bahnhofsplatz,<br />
in Nürnberg, Offenburg, Celle<br />
und am Hamburger Schloßmühlendamm.<br />
Insgesamt soll Benko 1,1 Mil -<br />
liarden Euro für die Häuser bezahlt<br />
haben. High street hatte ab 2006 vom<br />
damaligen Karstadt-Konzern insgesamt<br />
85 Karstadt-Häuser erworben<br />
und dafür rund 4,5 Milliarden Euro<br />
bezahlt. Im Zuge der Kaufhauspleite<br />
musste das Konsortium in der Vergangenheit<br />
deutliche Abstriche bei den<br />
Mieteinnahmen machen. Bis zum<br />
Ende des Jahres sollen nun weitere<br />
20 Häuser verkauft werden. Offenbar<br />
dieses Mal nicht an Benko, sondern<br />
an einen Finanzinvestor.<br />
Über die Zukunftsaussichten der Deutschen<br />
Lufthansa gibt es in der Chef -<br />
etage des Konzerns offenbar unterschiedliche<br />
Auffassungen. Das zeigte<br />
sich auf der jüngsten Aufsichtsrats -<br />
sitzung am Mittwoch vergangener Woche.<br />
Anstatt sich mit der Frage zu beschäftigen,<br />
wer Lufthansa-Chef Christoph<br />
Franz nachfolgen soll, wenn der<br />
Anfang Juni zum Schweizer Pharmakonzern<br />
Roche wechselt, übten zwei<br />
prominente Kapitalvertreter massive<br />
Kritik am derzeit amtierenden Vorstand.<br />
Ihm gehören neben Franz und<br />
Passagechef Carsten Spohr noch drei<br />
weitere Mitglieder an, sie amtieren allerdings<br />
erst seit kurzer Zeit. Die Top-<br />
64<br />
LUFTHANSA<br />
Aufsichtsräte kanzeln Vorstand ab<br />
Franz<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
MAURIZIO GAMBARINI / DPA<br />
Manager, wurde moniert, hätten den<br />
Wettbewerb durch arabische Airlines<br />
wie Emirates, Etihad oder Qatar unterschätzt<br />
und es bislang versäumt, Politik<br />
und Öffentlichkeit den Ernst der<br />
Lage ausreichend klarzumachen. Tatsächlich<br />
hatten die aufstrebenden Golf-<br />
Carrier kürzlich fast 400 neue Jets im<br />
Wert von knapp 200 Milliarden Dollar<br />
bestellt. Als Folge, so die besorgten<br />
Aufsichtsräte, drohten bei deutschen<br />
Airlines und Flughäfen empfindliche<br />
Jobverluste. Franz und seine Kollegen<br />
sollen nun, so der Arbeitsauftrag, ein<br />
Konzept gegen die Angreifer aus den<br />
Emiraten erarbeiten, obwohl der Vorstandschef<br />
selbst den Abflug plant.
Wirtschaft<br />
ENERGIE<br />
Millionenschwere<br />
Rückforderung<br />
Die energieintensiven Unternehmen<br />
in <strong>Deutschland</strong> müssen sich auf erhebliche<br />
Belastungen durch die EU einstellen.<br />
Darauf hat die NRW-Landes -<br />
regierung große Chemie- und Metallverarbeitungskonzerne<br />
des Landes in<br />
den vergangenen Tagen telefonisch<br />
vorbereitet. Danach plant EU-Wettbewerbskommissar<br />
Joaquín Almunia die<br />
weitreichenden Befreiungen deutscher<br />
Unternehmen von der EEG-Umlage<br />
offenbar nicht nur für die Zukunft zu<br />
verbieten. Der EU-Kommissar, so die<br />
Warnung, könnte auch die bereits genehmigten<br />
Ausnahmeregelungen als<br />
Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht<br />
einstufen und eine Rückzahlung<br />
für die vergangenen zwei bis<br />
drei Jahre fordern. Auf die energie -<br />
intensiven Unternehmen in der Zement-Chemie-<br />
oder Stahlindustrie<br />
kämen damit millionenschwere Belastungen<br />
zu. Der ohnehin schon schwer<br />
angeschlagene Stahlkocher Thyssen-<br />
Krupp etwa müsste in seiner Bilanz<br />
Rückstellungen von mehr als hundert<br />
Millionen Euro bilden. Für kleinere<br />
Aluminiumhütten im Ruhrgebiet könnte<br />
eine solche EU-Attacke sogar das<br />
endgültige Aus bedeuten. Unternehmen<br />
mit sehr großem Energiebedarf<br />
sind in <strong>Deutschland</strong> teilweise von den<br />
hohen Kosten der Energiewende befreit.<br />
Die Bundesregierung will so erreichen,<br />
dass die Firmen im internationalen<br />
Wettbewerb konkurrenzfähig<br />
bleiben. Die EU-Kommission hatte bereits<br />
vor Monaten angekündigt, dass<br />
sie diese Befreiung zumindest in Teilbereichen<br />
als „unzulässige Beihilfe“<br />
einstuft und noch vor Ende des Jahres<br />
ein entsprechendes Wettbewerbsverfahren<br />
einleiten will.<br />
Mähdrescher bei der Ernte<br />
ROHSTOFFE<br />
Hunger durch Biosprit?<br />
FRANK RUMPENHORST / DPA<br />
Umwelt- und Verbraucherorganisationen<br />
warnen vor einer Ausweitung der<br />
Biosprit-Förderung, die die EU-Energieminister<br />
am Donnerstag dieser<br />
Woche beschließen wollen. Von den<br />
Rohstoffen, die künftig zusätzlich gebraucht<br />
werden, um den Anteil von<br />
Biosprit in Benzin und Diesel von fünf<br />
auf sieben Prozent zu erhöhen, könnten<br />
68 Millionen Menschen ernährt<br />
werden, hat die britische Menschenrechtsorganisation<br />
ActionAid errechnet.<br />
Würde die EU ganz auf die Bei -<br />
mischung von Agrosprit verzichten,<br />
könnten mehr als 120 Millionen Menschen<br />
ernährt werden, so das Ergebnis<br />
des Demokratienetzwerks Campact.<br />
Bis 2020 will die Europäische Union<br />
den Anteil erneuerbarer Energien im<br />
Verkehr auf zehn Prozent steigern.<br />
Die Bundesregierung hatte bis vor<br />
kurzem eine Obergrenze von fünf<br />
Prozent Biosprit-Anteil unterstützt,<br />
scheint aber unter dem Druck der<br />
Agrarlobby eingeknickt zu sein. Interne<br />
Dokumente deuten darauf hin, dass<br />
<strong>Deutschland</strong> den Fünfprozentdeckel<br />
aufgibt und die Förderung bis 2030<br />
ausweiten will. <strong>Deutschland</strong> ist der<br />
größte Biosprit-Erzeuger der EU. Galt<br />
Biosprit bis vor ein paar Jahren noch<br />
als erstrebenswerte Alternative zu fossilen<br />
Energieträgern wie Erdöl, wird<br />
seine Herstellung und Verwendung<br />
inzwischen sehr kritisch gesehen. Für<br />
den Anbau der Pflanzen wird groß -<br />
flächig Regenwald abgeholzt, was dem<br />
Klima schadet. Außerdem geht in großem<br />
Stil Ackerboden für den Anbau<br />
von Nahrungsmitteln verloren, oder<br />
diese werden direkt zu Kraftstoffen<br />
statt zu Lebensmitteln verarbeitet.<br />
Schon jetzt wird ein wachsender Anteil<br />
der weltweiten Zuckerrohr- oder<br />
Ölpflanzenproduktion zur Herstellung<br />
von Biokraftstoffen benötigt.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 65
Wirtschaft<br />
FINANZMÄRKTE<br />
Das Kartell<br />
Weltweit gehen die Behörden gegen fragwürdige Absprachen und Manipulationen<br />
großer Geldhäuser vor, doch die Macht der Institute wächst. Im Visier<br />
der Fahnder steht besonders die Deutsche Bank mit ihrem Co-Chef Anshu Jain.<br />
Die bislang brutalste Lektion für<br />
einen deutschen Banker erteilt<br />
Wolfgang Schäuble scheinbar<br />
nebenbei. Es ist Donnerstagnachmittag<br />
vergangener Woche, der Bundesfinanzminister<br />
hält mal wieder eines seiner berüchtigten<br />
Grundsatzreferate über solide<br />
Haushaltspolitik in Zeiten der Krise.<br />
Doch dann kommt sie endlich, die<br />
Chance, seinen Frust über die lernun -<br />
fähige Banker-Kaste loszuwerden. Was<br />
er denn zu den Äußerungen von Deutsche-Bank-Chef<br />
Jürgen Fitschen sage,<br />
lautet die Frage. Fitschen hat Schäuble<br />
am Vortag Verantwortungslosigkeit und<br />
Populismus vorgeworfen, weil der Ressortchef<br />
den Banken unterstellt hatte, sie<br />
umgingen noch immer die Regeln.<br />
„Ich weiß nicht, ob Herr Fitschen verstanden<br />
hat, was ich sagen will“, antwortet<br />
Schäuble süffisant. Er habe dem Manager<br />
erst vor kurzem erneut erklärt, dass die Finanzkrise<br />
nicht von der Politik verursacht<br />
wurde. Und als wäre einer der wichtigsten<br />
Banker der Republik damit nicht schon<br />
genug abgewatscht, legt Schäuble nach.<br />
„Wenn Herr Fitschen sich seine Erklärung<br />
noch einmal genau durchliest, wird er sicher<br />
zu der Erkenntnis kommen, dass er<br />
in der Sache nicht recht hat.“ Und im Ton<br />
habe Fitschen sich ganz sicher vergriffen.<br />
Der Chef der altehrwürdigen Deutschen<br />
Bank, gemaßregelt wie ein Schuljunge?<br />
Das sitzt.<br />
Schäubles Ohrfeige ist ein Warnsignal<br />
an die Deutsche Bank. Der Minister ist<br />
zugleich Dienstherr der Finanzaufsicht<br />
BaFin. In der Bonner Behörde laufen so<br />
viele Untersuchungen gegen das größte<br />
deutsche Geldhaus wie selten zuvor. Welche<br />
Folgen sie haben, für die Bank und<br />
ihre Co-Chefs Fitschen und Anshu Jain,<br />
ist nicht zuletzt eine politische Frage.<br />
Im zweiten Jahr des neuen Führungsduos<br />
schien es lange, als hätten sie die<br />
Bank und ihr Umfeld befriedet. Jetzt aber<br />
geht es in <strong>Deutschland</strong>, ja in ganz Europa<br />
und den USA erneut um die großen<br />
Fragen der Bankenregulierung: Hat die<br />
Finanzwirtschaft aus der Krise gelernt?<br />
Wurden die Verantwortlichen zur Rechenschaft<br />
gezogen? Ist das Finanzsystem stabiler<br />
geworden?<br />
Weltweit gehen Behörden aggressiv gegen<br />
die Geldbranche vor. In London ermitteln<br />
sie gegen Banken, die den Goldpreis<br />
manipuliert haben sollen. In Brüssel<br />
verhängte die EU-Kommission milliardenschwere<br />
Bußgelder gegen Geldhäuser, die<br />
sich über wichtige Zinssätze abgesprochen<br />
hatten.<br />
Eindrücklich wie nie zuvor lenkte das<br />
Vorgehen den Blick auf eine Frage, die<br />
in der bisherigen Aufarbeitung der Finanzkrise<br />
eine erstaunlich kleine Rolle<br />
spielte: Wie gefährlich ist die Marktmacht<br />
der führenden Investmentbanken?<br />
Eine Handvoll Finanzkonzerne dominiert<br />
den Handel mit Währungen, Rohstoffen<br />
und Zinsprodukten. Zwar beteiligen<br />
sich Millionen Investoren und Firmen<br />
an diesen Geschäften, kaufen und<br />
verkaufen, sichern sich ab oder speku -<br />
lieren.<br />
Abgewickelt aber werden die Geschäfte<br />
über einen exklusiven Kreis globaler<br />
Institute: die Deutsche Bank, J.P. Morgan<br />
oder Goldman Sachs. Diese Geldgiganten<br />
sind es auch, die Referenzkurse ermitteln,<br />
an denen sich billionenschwere Geschäfte<br />
orientieren.<br />
Die Hauptprofiteure des Handels verfassen<br />
wichtige Spielregeln selbst. Und<br />
in diesen Wochen zeigt sich, dass sie dabei<br />
ihre Macht nicht selten missbrauchen.<br />
Ein Weckruf für die Branche und ihre<br />
Aufseher könnte sein, was Joaquín Al -<br />
munia vergangenen Mittwoch verkündete.<br />
Der EU-Wettbewerbskommissar verhängte<br />
gegen acht Finanzkonzerne Geldbußen in<br />
Höhe von 1,7 Milliarden Euro, weil sie Teil<br />
von Kartellen waren, die Geldmarktzinsen<br />
wie den Libor manipuliert haben. Die<br />
Deutsche Bank zahlt allein 725 Millionen<br />
Euro, die mit Abstand größte Summe.<br />
Weitere Strafen von internationalen<br />
Behörden stehen bevor, und meist gehört<br />
der Frankfurter Konzern zu den Beschuldigten.<br />
Die EU-Kommission hat den Verdacht,<br />
dass Banken sich im Geschäft mit<br />
Kreditausfallversicherungen (CDS) abgesprochen<br />
haben – darunter die Deutsche<br />
Bank. Londoner Ermittler und die BaFin<br />
prüfen, ob Finanzinstitute am Gold- und<br />
Silberpreis herumgefingert haben – mit<br />
von der Partie: die Deutsche Bank.<br />
Den größten Sprengstoff könnten<br />
Untersuchungen im täglich 5,3 Billionen<br />
ĴŅćō<br />
ťųŋŋğ<br />
DĴŅŅĴćšĚğōųšœ<br />
>ĴĒœš^łćōĚćŅ 2012 zahlt die Bank fast<br />
1,2 Mrd. € Strafe in den USA, Großbritannien und<br />
der Schweiz; 2013 wird ihr dank der Kronzeugenregelung<br />
eine EU-Buße von 2,5 Mrd. € erlassen. <br />
^ĴĒœš^łćōĚćŅ Die US-Bank muss 70 Mio. €<br />
Geldbuße zahlen; weitere 55 Mio. € werden ihr von<br />
der EU durch die Kronzeugenregelung erlassen.<br />
ğžĴťğōıćōĚğŅ Die US-Zentralbank (Fed)<br />
ermittelt wegen Manipulation. ^ĴĒœš^łćōĚćŅ2012 wird der Bank von britischen<br />
und US-Behörden eine Strafe von 450 Mio. $<br />
auferlegt; 2013 entgeht Barclays durch die Kronzeugenregelung<br />
einer EU-Geldbuße von 690 Mio. €. <br />
ğžĴťğōıćōĚğŅ Die Fed ermittelt. ^
Deutsche-Bank-Chefs Fitschen und Jain<br />
BORIS ROESSLER / DPA<br />
Dollar schweren Währungsmarkt bergen.<br />
Die Bankexperten des britischen Analyse -<br />
hauses KBW schätzen, die mutmaßliche<br />
Manipulation von Devisenkursen könne<br />
die Investmentbanken mit 26 Milliarden<br />
Dollar belasten. Allein die Deutsche<br />
Bank müsse sich auf Zahlungen in Höhe<br />
von 3,4 Milliarden Dollar einstellen.<br />
In fast all diesen Verfahren tauchen<br />
die Namen derselben großen Banken auf.<br />
Zufall ist das nicht, ziehen doch diese<br />
Finanzjongleure immer mehr Handels -<br />
volumen auf sich. Am Devisenmarkt<br />
machten in <strong>Deutschland</strong> 1998 neun Banken<br />
drei Viertel des Handels unter sich<br />
aus, heute sind es nur noch fünf. Über<br />
alle Währungen und Länder hinweg<br />
wickeln die vier führenden Banken die<br />
Hälfte des Handels ab: die Deutsche<br />
Bank, die Citigroup, Barclays und die<br />
UBS.<br />
Solche Dominanz lädt zur Absprache<br />
förmlich ein. „Je kleiner die Zahl der<br />
Marktteilnehmer, desto einfacher ist es,<br />
das Verhalten zu koordinieren“, sagt Daniel<br />
Zimmer, Chef der deutschen Monopolkommission<br />
(siehe Interview Seite 68).<br />
Und je größer die umgesetzten Summen,<br />
desto lohnender ist es, den Devisenkurs<br />
selbst noch an der dritten Stelle<br />
hinter dem Komma zu beeinflussen. Am<br />
Devisenmarkt wird einmal am Tag, beim<br />
sogenannten Londoner Nachmittagsfixing<br />
um 16 Uhr, für wichtige Währungspaare<br />
wie Euro/Dollar der Kurs eingefroren.<br />
An dieser Zahl orientieren sich zahllose<br />
weitere Finanzgeschäfte von Unternehmen<br />
und Investoren weltweit.<br />
Das Fixing ergibt sich aus den Währungsgeschäften,<br />
die in der Minute rund<br />
um den 16-Uhr-Termin abgewickelt werden.<br />
Weil die Handelsaufträge dafür aber<br />
meist über die großen Investmentbanken<br />
gehen, können diese wittern, in welche<br />
Richtung sich der Kurs zum Fixing hin<br />
bewegt. Sie könnten daraus für eigene<br />
Geschäfte Kapital schlagen und sich mit<br />
ihren Wettbewerbern absprechen – diesen<br />
Verdacht jedenfalls haben Ermittler<br />
in New York, London und Frankfurt.<br />
Deshalb bekam Robert Wallden vor<br />
ein paar Wochen Besuch von der amerikanischen<br />
Ermittlungsbehörde FBI. Sie<br />
hielt dem New Yorker Devisenhändler<br />
der Deutschen Bank Chat-Protokolle aus<br />
dem Internet unter die Nase. Sie sollen<br />
dokumentiert haben, wie sich Wallden<br />
damit brüstete, Währungskurse zu manipulieren.<br />
Die Deutsche Bank kommentiert<br />
den Vorgang nicht, im Umfeld heißt<br />
es, Wallden habe Scherze gemacht.<br />
Ein Insider aus der Bank sagt: „Was da<br />
gesprochen wird, sollte man nicht für bare<br />
Münze nehmen, jeder weiß mittlerweile,<br />
dass die Chats aufgezeichnet werden.“ Wer<br />
manipulieren wolle, nutze andere Wege.<br />
Trotzdem hat die Deutsche Bank ihren<br />
Händlern mittlerweile verboten, sich bei<br />
der Arbeit an Online-Chats zu beteiligen.<br />
An den dramatischen Folgen, die das Gebaren<br />
ihrer Händler haben könnte, ändert<br />
das nichts. Britische Ermittler untersuchen<br />
schon seit dem Frühsommer den Devisenhandel<br />
auf Manipulation, ein Dutzend<br />
Banken haben sie im Visier.<br />
Seit dem Sommer hat sich auch die<br />
BaFin der Sache angenommen. Hinweise,<br />
dass die Deutsche Bank beteiligt war,<br />
habe sie bislang nicht, erklärt die Aufsicht.<br />
Bisher aber hat die Behörde nur<br />
ein Auskunftsersuchen gestellt. Im Klar-<br />
ǾDĴŅŅĴćšĚğōųšœ<br />
ǾǿǽDĴŅŅĴćšĚğōųšœ<br />
ǿǽǾDĴŅŅĴćšĚğōųšœ<br />
Stand: 3. Quartal<br />
Quelle: Bloomberg<br />
>ĴĒœš^łćōĚćŅ Die EU verhängt 2013 ein Bußgeld<br />
in Höhe von 725 Mio. €; aufgrund der Kronzeugenregelung<br />
bleibt der Bank ein höherer Betrag<br />
erspart. ^ĴĒœš^łćōĚćŅ Die EU-Kommission verhängt<br />
ein Bußgeld in Höhe von 80 Mio. € und ermittelt in<br />
einem weiteren Fall. ^ĴĒœš^łćōĚćŅ Die EU-Kommission ermittelt<br />
weiterhin gegen das britische Geldhaus, das sich<br />
einem Vergleich verweigert hatte. <br />
^
Wirtschaft<br />
„Drakonische Strafen“<br />
Daniel Zimmer, Chef der Monopolkommission, über das Libor-<br />
Kartell, die Macht der Banken und darüber, wie sie zu begrenzen ist<br />
Zimmer, 54, ist Professor an der Universität<br />
Bonn und seit Juli 2012 Chef<br />
der Monopolkommission. Der Jurist<br />
berät die Bundesregierung auch in<br />
Bankenfragen.<br />
SPIEGEL: Herr Zimmer, die EU-Kommission<br />
hat gegen Banken, die an der<br />
Libor-Manipulation beteiligt waren,<br />
Bußgelder von 1,7 Milliarden Euro<br />
verhängt. Ist die Strafe angemessen?<br />
Zimmer: Die Bußen bemessen sich nach<br />
der Schwere und der Dauer des begangenen<br />
Unrechts. Sie können bis zu<br />
zehn Prozent des Umsatzes der Unternehmen<br />
erreichen. Davon ist man hier<br />
noch weit entfernt, insofern<br />
erscheinen die Strafen<br />
auf den ersten Blick nicht<br />
außergewöhnlich hoch.<br />
SPIEGEL: Überrascht es Sie,<br />
dass Banken die Zinsen<br />
manipuliert haben?<br />
Zimmer: Im Rückblick: nein.<br />
Die Manipulation wurde<br />
den Bankmitarbeitern<br />
leichtgemacht, es gab keine<br />
hoheitliche Kontrolle über<br />
die Festsetzung der Zinsen.<br />
Schockiert hat mich dennoch<br />
das Ausmaß: Eine<br />
Vielzahl von Instituten hat<br />
offenbar in verschiedenen<br />
Märkten manipuliert.<br />
Zimmer<br />
MARIUS BECKER / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
SPIEGEL: Eine kleine Gruppe von Banken<br />
dominiert Märkte wie den Devisenhandel<br />
oder Zinsgeschäfte. Sind<br />
die großen internationalen Institute<br />
einfach zu mächtig?<br />
Zimmer: Je kleiner die Zahl der Marktteilnehmer,<br />
desto einfacher ist es, das<br />
Verhalten zu koordinieren. Aber solange<br />
sich die Banken nicht absprechen,<br />
ist ihre schiere Größe nicht entscheidend.<br />
SPIEGEL: Was dann?<br />
Zimmer: Das Problem liegt zunächst<br />
im Verhalten der Personen. Deshalb<br />
brauchen wir eine strengere Aufsicht<br />
über Handelsgeschäfte der Banken<br />
und eine bessere rechtliche Grundlage<br />
für scharfe Sanktionen. Die Libor-Manipulation<br />
etwa lässt sich mit dem Kapitalmarktrecht<br />
bisher nicht befriedigend<br />
bestrafen. Auch das Kartellrecht<br />
lässt sich nur auf einen Teil der Manipulationshandlungen<br />
anwenden: Es<br />
greift nur, soweit Banken ihre künftige<br />
Zinssetzung abstimmen. Wenn sie<br />
durch Absprachen lediglich die Abrechnungsgrundlage<br />
für bereits abgeschlossene<br />
Derivategeschäfte manipulieren,<br />
läuft das Kartellrecht leer. Die<br />
hier bestehenden Schlupflöcher sollten<br />
durch eine Nachrüstung des Kapitalmarktrechts<br />
geschlossen werden.<br />
SPIEGEL: Sie weisen die Schuld einzelnen<br />
Bankern zu. Sind es nicht auch<br />
die Geldhäuser als Institutionen, die<br />
Fehler machen?<br />
Zimmer: Personen und Institutionen<br />
kann man nicht trennen. Für mich ist<br />
bisher nicht geklärt, ob Leitungsgremien<br />
der beteiligten Banken bei der<br />
Kontrolle der Zinssetzung<br />
und der Handelsgeschäfte<br />
versagt haben und welche<br />
Konsequenzen das haben<br />
sollte.<br />
SPIEGEL: Gilt das auch für<br />
den Vorstand der Deutschen<br />
Bank?<br />
Zimmer: Ich will mich zu<br />
einzelnen Instituten nicht<br />
äußern. Aber grundsätzlich<br />
muss die Frage nach<br />
der Verantwortung der<br />
Leitung eines Instituts gestellt<br />
werden.<br />
SPIEGEL: Sollte man Banken<br />
aufspalten, um die<br />
Machtkonzentration zu<br />
verringern und den Wettbewerb zu<br />
fördern?<br />
Zimmer: Mit hoheitlichen Eingriffen in<br />
die Märkte wäre ich sehr vorsichtig.<br />
Eine Entflechtung von Großbanken<br />
erscheint mir nicht als das richtige Mittel,<br />
um Manipulation zu erschweren.<br />
Man sollte eher an eine verschärfte<br />
Aufsicht und drakonische Strafen<br />
auch für die handelnden Personen<br />
denken.<br />
SPIEGEL: Könnten die verschärften Regeln<br />
für die Finanzmärkte dazu führen,<br />
dass sich das Geschäft noch stärker<br />
auf wenige Anbieter konzentriert?<br />
Zimmer: Wenn die kleinen Banken zu<br />
stark belastet werden, könnte dies<br />
eine Konzentration begünstigen, die<br />
wir uns nicht wünschen. Schließlich<br />
wollten wir keine Banken mehr haben,<br />
die so groß sind, dass man sie<br />
nicht ohne Gefahr für das Finanz -<br />
system fallenlassen kann.<br />
INTERVIEW: MARTIN HESSE<br />
text heißt das: Die Bank ermittelt intern,<br />
die BaFin wird erst selbst aktiv, wenn sie<br />
nicht zufrieden damit ist, was die Konzernjuristen<br />
liefern.<br />
Der Fall Libor dürfte die BaFin eher<br />
misstrauisch gemacht haben. Schließlich<br />
stellte der Aufsichtsratschef der Deutschen<br />
Bank, Paul Achleitner, dem Vorstand<br />
inklusive Anshu Jain nach einer<br />
internen Untersuchung schon im Sommer<br />
2012 eine Art Persilschein aus, sie hätten<br />
sich in der Angelegenheit nichts zuschulden<br />
kommen lassen.<br />
Die BaFin hat bis heute Zweifel, ob<br />
Jain und andere Top-Manager ihre Hände<br />
in Unschuld waschen können. Sie treibt<br />
eine kriminalistische Untersuchung voran,<br />
um zu ergründen, wer bis hoch zum Vorstand<br />
von der Manipulation gewusst hat.<br />
Deshalb ist es noch immer möglich, dass<br />
Jain über den Libor-Skandal fällt.<br />
Oder über den Devisenskandal, wenn<br />
aus dem Verdacht, dem die Ermittler<br />
nachgehen, Gewissheit werden sollte.<br />
Wurden die Wechselkurse manipuliert,<br />
so ist kaum vorstellbar, dass die Deutsche<br />
Bank nicht dabei war, so heißt es in Bankenkreisen<br />
immer wieder. Warum? Weil<br />
sie in dem Geschäft mit einem Marktanteil<br />
von 15 Prozent fast ununterbrochen<br />
die Nummer eins ist – seit 13 Jahren.<br />
Vor genau derselben Zeit übernahm<br />
Jain bei der Deutschen Bank den Handel<br />
mit Rohstoffen und Devisen, später auch<br />
die Zinsprodukte. Er machte diese Geschäfte<br />
binnen weniger Jahre zur wichtigsten<br />
Ertragsquelle der Deutschen Bank.<br />
Später stieg Jain zum Chef des gesamten<br />
Investmentbankings auf, das Zins- und<br />
Währungsgeschäft führte sein Vertrauter<br />
Alan Cloete weiter. Jain belohnte ihn später<br />
mit der Berufung in den erweiterten<br />
Vorstand, der Libor-Skandal entfaltete<br />
bald darauf seine ganze Wucht.<br />
Zur Strategie Jains und Cloetes gehörte<br />
es – so erzählen es Händler, die für die<br />
beiden gearbeitet haben –, die verschiedenen<br />
Handelsbereiche eng miteinander<br />
zu verzahnen.<br />
Die Verzahnung ging allerdings so weit,<br />
dass teilweise ein und dieselbe Person zugleich<br />
Händler und für die Ermittlung des<br />
Libor-Zinses zuständig war. Ein institutionalisierter<br />
Interessenkonflikt, so hat es<br />
die Frankfurter Arbeitsrichterin Annika<br />
Gey in einem Urteil festgehalten.<br />
Doch die Deutsche Bank vertritt eisern<br />
die These, die fragwürdige Kurspflege sei<br />
das Werk von Einzeltätern gewesen.<br />
Selbst nach der Kartellentscheidung der<br />
EU sprach sie noch mutig von „Verhaltensweisen<br />
von einzelnen Mitarbeitern<br />
in der Vergangenheit“. Kommissar Al -<br />
munia hält die Theorie für Humbug. „Wir<br />
ermitteln nicht gegen Individuen, sondern<br />
gegen Kartelle von Institutionen“,<br />
sagte er bei der Verkündung der Strafen.<br />
Der Druck auf die Führung der Bank<br />
wächst. Er wird sichtbar in Schäubles Rüf-<br />
68 DER SPIEGEL 50/2013
Londoner Finanzdistrikt Canary Wharf: „Bankvorstände zur Rechenschaft ziehen“<br />
fel gegen Fitschen, er wird spürbar durch<br />
das Bohren der Aufseher.<br />
Und selbst aus dem Kreis angelsäch -<br />
sischer Investoren kommt mittlerweile<br />
unverhohlene Kritik. „Wir wollen, dass<br />
die Aufsichtsräte Bankvorstände für die<br />
Risikokontrolle zur Rechenschaft ziehen<br />
und nicht nur am finanziellen Erfolg<br />
messen“, sagte Colin McLean, Chef der<br />
schottischen SVM Asset Management,<br />
der Nachrichtenagentur Bloomberg.<br />
Das hält auch Anat Admati, Professorin<br />
an der Stanford-Universität, für das<br />
entscheidende Problem beim Kampf gegen<br />
Betrug auf großen Finanzmärkten.<br />
„Bei all diesen Vergleichen“, sagt sie über<br />
die Strafen, die derzeit über die Industrie<br />
verhängt werden, „werden die Leute, die<br />
verantwortlich waren, selten belangt.“ So<br />
werde der Anreiz für bessere Risiko -<br />
kontrolle kaum erhöht.<br />
Gut möglich, dass die Kritik der Investoren<br />
auch die Gesetzgeber ermutigt, härter<br />
gegen die Banken vorzugehen. Der<br />
für die Finanzmarktregulierung zuständige<br />
EU-Kommissar Michel Barnier legt einen<br />
Gesetzesvorschlag nach dem anderen<br />
vor, um dem unkontrollierten Treiben<br />
ein Ende zu bereiten.<br />
Doch der Widerstand der Finanzindu -<br />
strie ist zäh. Die Konzerne setzen darauf,<br />
dass viele Regulierungsvorschläge vor<br />
dem Ende der bis zum Herbst laufenden<br />
Amtsperiode der jetzigen EU-Kommis -<br />
sion nicht mehr verabschiedet werden.<br />
Die Banken sollen gezwungen werden,<br />
ihre riskanten Geschäftszweige wie den<br />
Eigenhandel mit Wertpapieren und die<br />
Finanzierung von Hedgefonds organisatorisch<br />
abzuspalten. Doch Barniers Entwurf<br />
für ein sogenanntes Trennbanken-<br />
Gesetz hat sich immer wieder verzögert,<br />
obwohl ihm eine Kommission unter Führung<br />
des finnischen Zentralbankers Erkki<br />
Liikanen schon vor über einem Jahr konkrete<br />
Vorschläge unterbreitet hatte. Nun<br />
Die größten Banken im Devisenhandel<br />
Deutsche Bank<br />
15,2<br />
Sonstige 31,0<br />
Marktanteile<br />
weltweit<br />
14,9 Citigroup<br />
2013,<br />
in Prozent<br />
5,6<br />
10,2 Barclays<br />
RBS<br />
6,1<br />
6,9 10,1<br />
J. P. Morgan<br />
Quelle:<br />
HSBC UBS<br />
Euromoney<br />
CHARLES BOWMAN / DESIGN PICS<br />
heißt es intern, dass der Entwurf „in den<br />
nächsten Wochen“ komme, in deutlich<br />
abgespeckter Form. Die Chance, dass das<br />
Gesetz noch kommendes Jahr in Kraft<br />
tritt, geht damit gegen null.<br />
Der Franzose will erst einmal abwarten,<br />
wie weit die Amerikaner gehen.<br />
In den USA basteln die Aufseher seit<br />
drei Jahren an einer Gesetzesvorlage her -<br />
um, die die übermäßige Macht der Banken<br />
eindämmen soll: Diese Woche nun<br />
soll das Regelwerk, das unter dem Namen<br />
des früheren Notenbank-Chefs Paul Volcker<br />
firmiert, abgesegnet werden. Doch<br />
die großen Finanzkonzerne, so sagen Experten<br />
voraus, werden weiterwachsen.<br />
Die Banken seien im Laufe der vergangenen<br />
fünf Jahre immer mächtiger geworden,<br />
„und auch die Volcker Rule wird das<br />
Problem nicht lösen“, sagt Andrew Lo,<br />
Finanzprofessor am Massachusetts Institute<br />
of Technology (MIT).<br />
Denn Größe bedeutet für Bankchefs<br />
wie Jamie Dimon von J.P. Morgan oder<br />
Anshu Jain vor allem: geringere Kosten<br />
und bessere Chancen, die Verluste des einen<br />
Geschäftsfelds mit Gewinnen des anderen<br />
aufzuwiegen.<br />
Jeder Bankchef, der nur halbwegs bei<br />
Sinnen sei, werde deshalb versuchen, weiterzuwachsen,<br />
sagt Finanzmarktexperte<br />
Lo: „Die neuen Regeln haben die Motivation,<br />
zu groß zu sein, um zu scheitern,<br />
sogar noch vergrößert. Es ist schwieriger<br />
geworden für kleine Banken.“ Denn um<br />
mit den Bergen an Papier und den<br />
komplexen neuen Vorschriften fertigzuwerden,<br />
müssen die Institute Heere von<br />
Anwälten beschäftigen. So werden viele<br />
Geschäfte für kleinere Häuser zu teuer.<br />
„Es ist ganz klar so, dass die Kapitalmarktgeschäfte<br />
sich auf immer weniger<br />
Player konzentrieren“, glaubt Christoph<br />
Kaserer von der Technischen Universität<br />
München. „Das bedeutet, dass wenige<br />
Personen Entscheidungen von enormer<br />
materieller Bedeutung treffen.“ Darin liege<br />
ein großer Anreiz zu betrügen.<br />
Die hohen Bußgelder und Vergleichssummen,<br />
die viele Banken derzeit zahlen<br />
müssen, werden daran wenig ändern.<br />
„Die Strafen gleichen oft nicht einmal<br />
die Gewinne aus, die tatsächlich erzielt<br />
wurden“, sagt Mario Mariniello, Wettbewerbsforscher<br />
der Brüsseler Denkfabrik<br />
Bruegel. Zudem sei die Chance, bei den<br />
Absprachen erwischt zu werden, gerade<br />
im Finanzsektor sehr niedrig gewesen.<br />
Welche Lektion zieht ein Bankchef aus<br />
den jüngsten Ereignissen?, fragt Bankenforscher<br />
Lo – und liefert die Antwort<br />
gleich mit: „Du bist besser zu groß, um<br />
unterzugehen, denn sonst kannst du eine<br />
Summe von 13 Milliarden Dollar, wie sie<br />
jetzt J.P. Morgan in den USA bezahlen<br />
muss, gar nicht tragen.“<br />
So sieht das offenbar auch Deutsche-<br />
Bank-Chef Fitschen. Statt den „Unsinn“<br />
des „too big to fail“ ständig zu wieder -<br />
holen, könne man doch auch mal fragen,<br />
ob es nicht besser ist, wenn Banken „too<br />
strong to fail“ sind, zu stark, um zu fallen.<br />
Ein Lob der unkaputtbaren Megabank.<br />
Um die Börsengänge, Unternehmensfusionen<br />
oder Schuldschein-Emissionen<br />
globaler Industrieriesen begleiten zu<br />
können, bedürfe es großer Universalbanken,<br />
argumentieren die Spitzen der Geld -<br />
häuser gern. Die Frage ist aber, ob ein<br />
Haus wie J.P. Morgan dafür wirklich eine<br />
Bilanzsumme von 2,5 Billionen Dollar<br />
braucht oder ob ein paar hundert Milliarden<br />
auch reichen.<br />
Der Staat müsse das Wachstum der<br />
Banken begrenzen, sagt Lo – und fordert<br />
die Regierungen zugleich auf, global<br />
vorzugehen. Nationale Regeln führten<br />
schlicht dazu, „dass Banken anderswo<br />
weiterwachsen“.<br />
Doch solange vorwiegend nationale<br />
Aufsichtsbehörden für die Überwachung<br />
zuständig sind, bleiben solche Vorschläge<br />
Ideen ohne Aussicht auf Umsetzung. Nationale<br />
Aufseher sind oft überfordert und<br />
ihre Regierungen wollen die eigenen Institute<br />
letztlich im weltweiten Wettbewerb<br />
vorne sehen. Da sind sich Jürgen<br />
Fitschen und Wolfgang Schäuble dann<br />
wieder einig – allen verbalen Scharmützeln<br />
zum Trotz. SVEN BÖLL, MARTIN HESSE,<br />
CHRISTOPH PAULY, ANNE SEITH<br />
70<br />
DER SPIEGEL 50/2013
LOBBYISTEN<br />
Betteln beim<br />
Klassenfeind<br />
Der Wirtschaftsrat der CDU<br />
spricht gern über solide Finanz -<br />
politik, nun könnte er selbst<br />
bittere Verluste erleiden: Dem Verein<br />
droht eine Millionenklage.<br />
Wenn sich die Mitglieder des Wirtschaftsrats<br />
der CDU an die sem<br />
Montag in der noblen Ver tre -<br />
tung der Deutschen Bank in Berlin treffen,<br />
gehen die Honoratioren der Beschäftigung<br />
nach, von der sie am meisten<br />
verstehen – sie feiern sich selbst. Der<br />
Wirtschaftsrat wird 50, und als Festred -<br />
ner hat sich EU-Kommissar Günther<br />
Oettinger angemeldet.<br />
Gewöhnlich beschwört der Verein bei<br />
solchen Jubiläen kaufmännische Tugenden<br />
und belehrt Kanzlerin Angela Merkel<br />
(CDU) in Sachen Ordnungspolitik. „Wir<br />
wollen Kurs halten“, tönt Präsident Kurt<br />
Lauk gern, „wir bleiben beim Erfolgsmodell<br />
Soziale Marktwirtschaft.“<br />
Dumm nur, dass Anspruch und Wirklichkeit<br />
auseinanderklaffen. Denn aus -<br />
gerechnet der Wirtschaftsrat scheint<br />
selbst kein leuchtendes Vorbild für solides<br />
Wirtschaften zu sein. Im Gegenteil:<br />
Der Verein, dessen Mitgliederverzeichnis<br />
sich einst wie ein Who’s who der deutschen<br />
Unternehmerschaft las, ist überaltert,<br />
seine politische Durchschlagskraft<br />
gering.<br />
* Am 25. Juni in Berlin.<br />
Wirtschaft<br />
Vor allem aber macht dem noblen Altherrenclub<br />
eine langjährige Geschäftsbeziehung<br />
zu schaffen. Um Mitglieder zu<br />
werben, hatte der Wirtschaftsrat die Firma<br />
WR Marketing beauftragt. Obwohl<br />
sich bald herausstellte, dass die von ihr<br />
akquirierten Unternehmer in großer Zahl<br />
nicht lange beim Wirtschaftsrat blieben,<br />
beschäftigte der Verein die Firma über<br />
sechs Jahre weiter – gegen Honorare von<br />
bis zu einer Million Euro im Jahr.<br />
Inzwischen beschäftigt der Fall die<br />
Gerichte. Dem Rat drohen Forderungen<br />
in Höhe von mehreren hunderttausend<br />
Euro, es könnten aber auch mehr als eine<br />
Million werden. Die dafür bisher gebildeten<br />
Rücklagen in der Vereinskasse werden<br />
womöglich nicht ausreichen.<br />
Damit droht der Verein in eine ähnliche<br />
Finanzkrise abzurutschen wie schon einmal<br />
am Ende der sozial-liberalen Regierung<br />
unter Helmut Schmidt. Besonders<br />
prekär: Die juristische Ausein andersetzung<br />
bedroht die zentrale Geldquelle des Rats –<br />
die Jahresbeiträge. Denn der Verein finanziert<br />
sich weit gehend über seine rund 11000<br />
Kanzlerin Merkel, Verbandspräsident Lauk*: Belehrende Worte zum Jubiläum<br />
72<br />
Mitglieder. Die streng vertraulich behandelten<br />
Zahlungen belaufen sich auf bis zu<br />
25000 Euro pro Unternehmen. Namhafte<br />
Konzerne wie die Allianz (25000 Euro), Dr.<br />
Oetker (18000 Euro) oder Gazprom Germa -<br />
nia (10000 Euro) überweisen diese Summen<br />
gern, damit der Verein die hohen Kosten<br />
für seinen Apparat und aufwendige Kongresse<br />
in First-Class-Hotels decken kann.<br />
Bis vor wenigen Jahren brachte auch<br />
die Mitgliederwerbung Geld ein. Zwischen<br />
2006 und 2008 waren laut einer internen<br />
Erhebung fast drei Viertel aller Neumitglieder<br />
den Werbern von WR Marketing<br />
zu verdanken, 2009 und 2010 waren es immer<br />
noch zwei Drittel. Auch für WR Marketing<br />
war es ein einträgliches Geschäft.<br />
Knapp jeder dritte eingeworbene Euro soll<br />
als Provision in ihre Kassen geflossen sein.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
TIM BRAKEMEIER / DPA<br />
Solange die Zahlen stimmten, sah der<br />
noble Wirtschaftsclub nur zu gern dar -<br />
über hinweg, dass die Akquiseprofis offen -<br />
bar recht unkonventionell arbeiteten. Fest<br />
steht: Viele Neumitglieder kehrten dem<br />
Wirtschaftsrat schnell wieder den Rücken.<br />
Der Vereinsspitze blieb dies nicht ver -<br />
bor gen. Bereits im Mai 2006, so ist in einem<br />
Wirtschaftsratsprotokoll festgehalten,<br />
klagte die Vertriebschefin, dass „die<br />
durch die WR Marketing GmbH gewonnenen<br />
Mitglieder die niedrigste Verweildauer<br />
aufweisen“.<br />
Kein Wunder, denn die Werbeleute<br />
waren bei ihrer Ansprache potentieller<br />
Mitglieder nicht gerade wählerisch. So versuchten<br />
sie, ausgerechnet die Geschäftsführerin<br />
des altlinken und stramm antikapitalistischen<br />
Konkret-Verlags in Hamburg<br />
für den CDU-nahen Lobbyverein zu werben<br />
– eine Bettelaktion beim Klassenfeind,<br />
die allerdings vergeblich blieb.<br />
Trotz solcher Pannen dauerte es noch<br />
Jahre, bis sich der Wirtschaftsrat von seinem<br />
Marketingunternehmen trennte.<br />
Zwar betont der Wirtschaftsrat, die Verträge<br />
seien „kontinuierlich überprüft“<br />
worden. Doch erst im Juni 2012 feuerte<br />
der Verein seinen Dienstleister.<br />
Anlass dafür war, dass die Profiwerber<br />
ihr Know-how nicht nur für den Wirtschaftsrat<br />
eingesetzt hatten, sondern auch<br />
für den Familienunternehmerverband<br />
ASU, der nahezu dieselbe Klientel umwirbt.<br />
Dies stelle „einen groben Vertragsund<br />
Vertrauensverstoß“ dar, heißt es im<br />
Bericht des Vereinsschatzmeisters.<br />
Wirtschaftsrat und WR Marketing bestätigen<br />
den Rechtsstreit, wollten zu Details<br />
allerdings nicht Stellung nehmen.<br />
Die Folgen des Streits waren fatal, wie<br />
eine interne Erhebung belegt. Allein bis<br />
zum 15. September dieses Jahres wurden<br />
Mitgliedsbeiträge in Höhe von mehr als<br />
einer Million Euro gekündigt. Noch 2013,<br />
so zeigen interne Unterlagen, stammen<br />
über 60 Prozent der Kündigungen von<br />
Mitgliedern, die ursprünglich von WR<br />
Marketing geworben worden waren.<br />
Geschwunden ist auch der politische<br />
Einfluss des Verbands, so klagen CDUnahe<br />
Unternehmer. Generalsekretär<br />
Wolfgang Steiger brüstet sich zwar gern<br />
seiner guten Kontakte. Doch in Wahrheit<br />
ist er noch nicht einmal in seinem CDU-<br />
Landesverband Hessen eine große Nummer.<br />
Gleiches gilt für Verbandspräsident<br />
Lauk. Der ist zwar im Ausland bestens<br />
vernetzt, hat es in der Heimat aber nur<br />
als beratendes Mitglied in den CDU-Bundesvorstand<br />
geschafft, ein Gremium, in<br />
dem sich über 50 Leute drängeln.<br />
Auswirkungen auf die Gehälter der festangestellten<br />
Mitarbeiter hat der Bedeutungsverlust<br />
aber nicht. Sein Personal lässt<br />
sich der Verein in diesem Jahr 5,3 Mil -<br />
lionen Euro kosten, rund die Hälfte des<br />
Etats.<br />
PETER MÜLLER,<br />
ANDREAS WASSERMANN
VW-Produktion in Chattanooga<br />
74<br />
AUTOINDUSTRIE<br />
Fremde DNA<br />
Wieder einmal haben die Manager des Volkswagen-Konzerns<br />
den US-Markt falsch eingeschätzt. Nun<br />
sind die ehrgeizigen Ziele der Wolfsburger in Gefahr.<br />
Für die Führung des VW-Konzerns ist<br />
diese Zahl ein Schock. Minus 16,3<br />
Prozent. So stark brach der Absatz<br />
der Marke Volkswagen im November auf<br />
dem amerikanischen Markt ein. Dabei<br />
wächst der Autoverkauf dort insgesamt um<br />
knapp neun Prozent. Die Konkurrenten<br />
Ford, GM, Toyota, aber auch Mercedes-<br />
Benz und BMW verkaufen mehr Autos.<br />
„Wir kriegen Gegenwind“, hatte VW-<br />
Chef Martin Winterkorn noch vor wenigen<br />
Wochen gesagt. Mittlerweile ist klar:<br />
Damit hatte er noch untertrieben. Der<br />
Einbruch in den USA kann sogar sein großes<br />
Ziel gefährden, den VW-Konzern bis<br />
2018 zum größten Autohersteller der Welt<br />
zu machen.<br />
Nordamerika soll neben China einen<br />
großen Beitrag dazu leisten. Bislang ist<br />
Volkswagen in den USA ein Exot mit<br />
einem Marktanteil von 2,6 Prozent. VW<br />
liegt dort auf einem Niveau mit Subaru<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
GETTY IMAGES<br />
und deutlich hinter dem koreanischen<br />
Hersteller Kia.<br />
Das ist kein Platz, auf dem Winterkorn<br />
sich wohl fühlt. Der Wolfsburger Konzern<br />
investierte deshalb mehr als eine Mil -<br />
liarde Euro in den Bau einer Fabrik in<br />
Chatta nooga und die Entwicklung eines<br />
eigenen Modells für den US-Markt. Und<br />
die Rechnung schien aufzugehen. Von<br />
2009 bis 2012 verdoppelte Volkswagen<br />
seinen Absatz in den USA. So sollte es<br />
weitergehen. Doch jetzt kommt das böse<br />
Erwachen, und in Wolfsburg fragen sich<br />
viele, was in den USA schiefgelaufen ist.<br />
Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch sagt:<br />
„Wir verstehen Europa, wir verstehen<br />
China, und wir verstehen Brasilien, aber<br />
wir verstehen die USA bislang nur in<br />
einem begrenzten Maße.“<br />
Das ist der Kern. Volkswagen betrachtet<br />
die USA durch eine Wolfsburger Brille.<br />
Winterkorn sagt: „Das größte Problem<br />
von uns Deutschen ist, wir glauben zu<br />
wissen, was die Amerikaner von uns haben<br />
wollen.“<br />
Beim Angriff auf den US-Markt wollte<br />
der VW-Chef es besser machen. VW<br />
befragte US-Händler, wie ein Modell aus -<br />
sehen müsste, das den amerikanischen<br />
Geschmack trifft, und konstruierte eine<br />
eigene Variante des Passat. Das Modell<br />
wurde geräumiger, das Fahrwerk weicher<br />
abgestimmt und der Preis gesenkt. VW-<br />
Entwickler kostete es schon Überwindung,<br />
ein Modell mit solchen Fahreigenschaften<br />
zu konstruieren. Aber es war,<br />
wie sich nun zeigt, nur ein halber Schritt.<br />
Jim Ellis, VW-Händler in Atlanta, sagt,<br />
seine Kundschaft wolle alle zwei Jahre<br />
ein neues Modell. Es soll neu aussehen.<br />
Dafür genügen mitunter optische Retuschen,<br />
ein neuer Kühlergrill, ein paar Zierleisten.<br />
Volkswagen aber gönnt seinen<br />
Modellen frühestens nach vier Jahren ein<br />
Facelift.<br />
Der US-Passat, 2011 eingeführt, wirkt<br />
schon alt. Doch VW-Vertriebschef Christian<br />
Klingler schlug nicht Alarm. Er plante<br />
weiter mit Rekordverkäufen. VW stellte<br />
500 Zeitarbeiter für eine dritte Schicht<br />
ein, die das Unternehmen nach kurzer<br />
Zeit nicht mehr beschäftigen konnte.<br />
Deutlich bremsen dürfte den Verkauf<br />
auch, dass der Marke Volkswagen in den<br />
USA ein schlechtes Qualitätsimage bescheinigt<br />
wird. In der Statistik der Marktforscher<br />
von J.D. Power rangiert sie auf<br />
dem 28. von 32 Plätzen. Dafür werden<br />
Kunden, die ein drei Jahre altes Fahrzeug<br />
haben, nach Problemen in den vergangenen<br />
zwölf Monaten gefragt.<br />
Für viele Manager in Wolfsburg ist<br />
dieses Ergebnis ein Rätsel. Das Werk in<br />
Chattanooga muss Fahrzeuge in der<br />
gleichen Qualität produzieren wie die Fabriken<br />
in Wolfsburg oder Emden. Schon<br />
auf dem Weg zur Arbeit werden den 3200<br />
Beschäftigten in Chattanooga Qualitätskennziffern<br />
vorgehalten. Monitore zei-
Wirtschaft<br />
gen, dass die Lackiererei mit „Team Red“,<br />
der Spätschicht, eine Note von 1,0 erreicht<br />
hat. Das ist gut. Ab einem Wert<br />
von 1,8 könnten die Kunden Mängel erkennen,<br />
kleine Schlieren beispielsweise.<br />
Und auch für die Spaltmaße,<br />
die Fugen zwischen<br />
Tür und Rahmen, Motorhaube<br />
und Kotflügel, gelten<br />
dieselben Vorgaben<br />
wie in deutschen Werken:<br />
Sie sollen 3,5 Millimeter betragen,<br />
zulässig ist eine Abweichung<br />
von maximal 0,5<br />
Millimetern. „Das ist einfach<br />
unsere DNA“, sagt ein<br />
Qualitätsexperte von VW.<br />
Die amerikanische Kundschaft<br />
hat eine eigene DNA.<br />
Sie hat ein anderes Qua -<br />
litätsverständnis, wie VW-<br />
Manager feststellten, als<br />
ein Zulieferer mit seinem<br />
Toyota zur Besichtigung<br />
des VW-Werks anreiste.<br />
Volkswagen in den USA<br />
Veränderung des Pkw-Absatzes<br />
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum,<br />
in Prozent<br />
20,3<br />
26,3<br />
Bei dem Toyota hatte das Weiß des<br />
Stoßfängers einen anderen Farbton als<br />
das Weiß der Karosserie. Ein solches<br />
Auto dürfte die VW-Fabrik nie verlassen.<br />
Als Volkswagen-Mitarbeiter den Lieferanten<br />
darauf ansprachen, sagte er nur:<br />
„Ach das, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.“<br />
35,1<br />
2010 2011 2012 2013 *<br />
* Januar bis November<br />
–5,2<br />
Wichtiger als Lack und Spaltmaß ist<br />
etwa, dass das Auto über das neueste Navigationssystem<br />
verfügt und der Tempomat<br />
dort sitzt, wo die Fahrer es von ihren<br />
früheren Autos gewohnt sind. Zwei Punkte,<br />
bei denen der Passat<br />
Schwächen zeigte, die ihn<br />
in den Umfragen von J.D.<br />
Power zurückfallen ließen.<br />
Zu schaffen macht dem<br />
US-Passat auch, dass die<br />
Konkurrenten auf dessen<br />
anfänglichen Erfolg reagiert<br />
haben. Ford, Toyota<br />
und Co. haben ihre Modelle<br />
mit besserer Ausstattung<br />
versehen und die Preise<br />
gesenkt. Das Fahrzeug -<br />
segment, in dem der Passat<br />
antritt, ist in den USA heftig<br />
umkämpft. Deshalb ist<br />
nicht zu erwarten, dass der<br />
Absatz wieder anzieht.<br />
Im Nachhinein zeigt<br />
sich, dass die Entscheidung,<br />
ein Mittelklassemodell in der neuen<br />
Fabrik zu produzieren, falsch war. Mercedes-Benz<br />
und BMW stellen in ihren US-<br />
Fabriken Geländewagen her. Nordamerika<br />
ist der größte Markt für diese Fahrzeuggattung,<br />
und er wächst noch immer.<br />
Die deutschen Konkurrenten haben keine<br />
Probleme, ihre Werke auszulasten.<br />
Für VW dagegen wird die Fabrik in<br />
Chattanooga zum Problem. 200 000 Autos<br />
könnten dort produziert werden. In<br />
diesem Jahr dürften es noch nicht einmal<br />
140 000 werden. Um das Werk auszulasten,<br />
muss dort ein zweites Modell montiert<br />
werden. Der VW-Vorstand hat bereits<br />
entschieden, einen großen Geländewagen<br />
für den US-Markt zu entwickeln.<br />
Bis zu dessen Produktionsstart aber dürften<br />
noch zwei Jahre vergehen. Winterkorns<br />
Ziel, den Absatz in den USA von<br />
438 000 (2012) auf 800 000 (2018) fast zu<br />
verdoppeln, ist nach Ansicht hochrangiger<br />
VW-Manager nicht mehr zu erreichen.<br />
Die neuen Schwierigkeiten in den USA<br />
sind zwar harmlos im Vergleich zu den<br />
Problemen, denen der VW-Konzern dort<br />
vor einiger Zeit noch gegenüberstand.<br />
Das Nordamerika-Geschäft brachte dem<br />
Konzern mitunter eine Milliarde Euro<br />
Verlust im Jahr ein. Nun ist es profitabel.<br />
Dennoch ärgern die schlechten Nachrichten<br />
aus den USA den VW-Boss gewaltig.<br />
Um kaum ein Projekt hat er sich<br />
persönlich so intensiv gekümmert. Er ist<br />
immer wieder in die USA geflogen, um<br />
den Bau des Werks zu kontrollieren. „Die<br />
USA-Strategie“, hatte er schon vor dem<br />
Produktionsstart in Chattanooga erkannt,<br />
„ist unsere Achillesferse.“<br />
DIETMAR HAWRANEK
Wirtschaft<br />
Ulla Herz und Hannes Kuhn sitzen<br />
in ihrer Goldschmiede in der historischen<br />
Lübecker Altstadt und<br />
gruseln sich. Gerade hat ihnen ein be -<br />
geisterter Kunde geraten, ihren Schmuck<br />
doch in Zürich anzubieten, dort würde<br />
das gesamte Sortiment an einem einzigen<br />
Tag weggekauft. „Schauderhaft“, sagt<br />
Ulla Herz. „Ein Alptraum“, sagt Hannes<br />
Kuhn. Undenkbar ist es für die beiden,<br />
sich auf eine derart profane Art von ihren<br />
Schätzen zu trennen.<br />
Denn das, was sie seit 1986 in ihrer<br />
Galerie Nimbus herstellen, ist mehr als<br />
Schmuck. Ihr Herzblut hängt an den jahrtausendealten<br />
Perlen, Steinen und Münzen,<br />
die sie über Jahrzehnte in aller Welt<br />
zusammengesammelt haben, um daraus<br />
Schmuck zu machen. Sie kennen ihre Provenienz,<br />
ihren Werdegang, ihren Wert.<br />
Sie fassen sie täglich an und brauchen<br />
Monate, manchmal Jahre, bis sie das perfekte<br />
Design für diese Materialien finden,<br />
die passenden Fassungen, die stimmige<br />
Form.<br />
Wer ahnt schon, dass die Granitperlen<br />
aus der Steinzeit stammen? Dass die Bergkristalle,<br />
die verschwenderisch zu einer<br />
armdicken Kette verschlungen sind, 2000<br />
vor Christus aus indischem Fels geschlagen<br />
wurden? Wer sieht den afghanischen<br />
Bronzeperlen an, dass sie über 5000 Jahre<br />
alt und ein Vermögen wert sind?<br />
Nur der Besitzer des erlesenen Unikats<br />
weiß, welche einzigartige Kostbarkeit er<br />
am Leib trägt. Und es liegt an ihm, ob er<br />
dieses Vergnügen still genießt oder anderen<br />
verrät, dass der in Feingold gebettete<br />
Lapislazuli möglicherweise mal an Kleopatras<br />
Hof getragen wurde. Es ist eine<br />
ganz eigene Aura, die von den handgemachten<br />
Objekten ausgeht, als wären sie<br />
durch den Prozess irgendwie beseelt und<br />
aufgeladen worden – ganz anders als industriell<br />
gefertigte Produkte.<br />
Der jüngste Schrei im Geschäft mit Luxusprodukten<br />
ist der Luxus der Namenlosigkeit.<br />
Uhren, Handtaschen, Schmuck:<br />
Verbraucher, die über das nötige Kleingeld<br />
verfügen, kaufen ihre edelsten<br />
Stücke neuerdings nicht mehr in den<br />
Großstadtfilialen weltbekannter Markenhersteller,<br />
sondern in kleinen Spezial -<br />
manufakturen abseits der City-Lagen, die<br />
sich der Qualität verschrieben haben: Nur<br />
handgemacht ist gut gemacht.<br />
76<br />
KONSUM<br />
Perlrochen aus Parchim<br />
Wer Luxus liebt, kauft Uhren oder Schuhe nicht mehr im Markengeschäft,<br />
sondern im extravaganten Handwerksbetrieb.<br />
<strong>Deutschland</strong>s Spezialmanufakturen erleben eine Renaissance.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Dagegen hat der traditionelle Markenluxus<br />
viel von seinem Glanz eingebüßt.<br />
Im Massenmarkt angekommen, taugen<br />
Taschen von Louis Vuitton oder rotbesohlte<br />
High Heels von Christian Louboutin<br />
kaum noch als Unterscheidungsmerkmal.<br />
Und warum soll man 40 000 Euro<br />
für eine Rolex-Uhr ausgeben, wenn jeder<br />
zweite Golfkumpel eine trägt?<br />
Die Neureichen aus Osteuropa oder<br />
China haben in den vergangenen Jahren<br />
zwar für zweistellige Wachstumsraten im<br />
Luxussegment gesorgt, doch gleichzeitig<br />
wurden die Marken schleichend abgewirtschaftet.<br />
In diesem Jahr legt die Branche<br />
voraussichtlich nur noch zwei Prozent zu.<br />
Konsumenten, die den Luxus lieben,<br />
haben es satt, ein berühmtes Logo spazieren<br />
zu tragen, als wären sie eine Litfaßsäule.<br />
Und manche Kunden fragen<br />
sich, warum sie ein halbes Vermögen für<br />
Designerklamotten ausgeben sollen, die<br />
ähnlich produziert werden wie der Billigfummel<br />
von C&A. In der Liste der wertvollsten<br />
Marken der Welt, die von der<br />
Agentur Millward Brown durch Verbraucherbefragung<br />
ermittelt wird, rangiert die<br />
Einkaufszonen-Kette Zara vor Hermes<br />
und H&M vor Prada. Das ist ernüchternd.<br />
So wird der Markenkonsum von der<br />
neuen Luxusgeneration zunehmend als<br />
ordinär empfunden. Was heute zählt, ist<br />
Einzigartigkeit, Qualität und feines Handwerk.<br />
Man möchte wieder etwas haben<br />
für sein Geld.<br />
Das freut viele kleine Edelmanufakturen,<br />
die in <strong>Deutschland</strong> eine Renaissance<br />
erleben. „Die Kunden suchen wieder<br />
nach echten Werten“, sagt Axel Kmo -<br />
nitzek, Geschäftsführer des Hamburger<br />
Uhrenherstellers Fischer&Cie. In dem<br />
eleganten Verkaufsraum in der Hamburger<br />
HafenCity stellt das Unternehmen<br />
hochwertige Unikate nach den Wünschen<br />
der Kundschaft her.<br />
Schon in ihrer Schulzeit waren Kmonitzek<br />
und sein Kompagnon Christopher<br />
Graf verrückt nach Uhren, tauschten die<br />
einschlägigen Magazine unter der Schulbank.<br />
Jahre später trafen sich die beiden<br />
wieder, im Hamburger Laden „Männerträume“,<br />
einem Spielwarengeschäft für<br />
Herren. Der eine war mittlerweile Volkswirt,<br />
der andere Grafikdesigner. Immer<br />
noch uhrenfanatisch, gründeten sie ein<br />
Unternehmen, das noch keiner zu gründen<br />
gewagt hatte: Sie würden personalisierte<br />
Uhren herstellen.<br />
Seit 2009 gibt es ihre Firma, pro Jahr<br />
entwerfen sie etwa hundert Uhren nach<br />
den Wünschen ihrer Kunden. Manche<br />
lassen sich Initialen, Geburtstage oder<br />
Jubiläumsdaten aufs Zifferblatt drucken,<br />
andere das durch ein Glas sichtbare Laufwerk<br />
vergolden, gravieren oder mit filigransten<br />
Mustern verzieren.<br />
Einige Uhren sind den Tachos von<br />
Oldtimern nachempfunden, viele tragen<br />
Stadt- oder Familienwappen. Ein Kunde<br />
bekam den Frosch, den sein Kind gezeichnet<br />
hatte, als Motiv. Nur jener Kunde, der<br />
Nazi-Symbole haben wollte, wurde abgewiesen.<br />
„Die Kunden lieben es, Zeit bei uns zu<br />
verbringen und stundenlang am Design<br />
zu basteln“, sagt Graf. 2500 Euro kostet<br />
ein personalisiertes Basismodell, je nach<br />
Extras kann eine Fischer&Cie aber auch<br />
mehrere zehntausend kosten. Nur ganz<br />
klein steht das Firmenlogo auf der Uhr.<br />
Der Kunde soll hier keine Marke kaufen,<br />
sondern Exklusivität. „Bei uns ist der<br />
Kunde die Marke“, sagt Kmonitzek.<br />
Eine Erkenntnis, die langsam auch in<br />
der Industrie ankommt.<br />
Bei den Herbst-Modeschauen in Paris<br />
überraschte Louis Vuitton mit einer Kollektion<br />
ganz ohne Markennamen. Keine<br />
Spur war zu sehen vom berühmte Logo<br />
und dem typischen Damierstoff. Auch<br />
der deutsche Kamerahersteller Leica verkauft<br />
seine Digitalkamera Monochrom M<br />
erstmals ohne den typischen roten Punkt<br />
auf dem Gehäuse.<br />
Das Londoner Nobelkaufhaus Selfridges<br />
folgte dem Trend und richtete eilig<br />
eine ganze Abteilung ein, in der Luxusprodukte<br />
ohne Namen angeboten werden.<br />
Andere Markenproduktler versuchen den<br />
Kompromiss: Bei der Mode marke Bur -<br />
berry dürfen die Kunden Stoffe, Futter<br />
und Knöpfe selbst wählen und so ihr ganz<br />
eigenes Modell kreieren.<br />
Ob der Spagat gelingt, darf bezweifelt<br />
werden. Die Mischung aus Schrulligkeit,<br />
Qualität und Kundennähe, die kleine<br />
Manufakturen ausstrahlen, können Groß -<br />
unternehmen nicht kopieren. In Selfridges<br />
logofreiem „Quiet Shop“ einzukaufen<br />
ist nicht annähernd so einmalig, wie auf<br />
dem Marktplatz der Mecklenburger<br />
Kleinstadt Parchim zu stehen, vor Kay<br />
Gundlacks Maßschuh-Manufaktur.<br />
15 Jahre lang war der gelernte Schuhmacher<br />
als Hersteller orthopädischen<br />
Schuhwerks weit entfernt von Krokodilleder<br />
und Perlrochenhaut. Doch mit 32<br />
wechselte der Handwerker, der sich schon<br />
als Kind in der unaufgeräumten Werkstatt<br />
des örtlichen Schusters am wohlsten fühlte,<br />
ins Luxussegment: Er mietete den kleinen<br />
Laden neben dem Pizzaservice, legte<br />
im Januar 2006 los – und hatte Glück. Eine<br />
Journalistin des NDR entdeckte den Laden<br />
in der Pampa und berichtete davon.
Maßschuster Gundlack, rahmengenähte Herrenschuhe: Machen, was man liebt<br />
FOTOS: CHRISTIAN O. BRUCH / LAIF / DER SPIEGEL<br />
Halskette aus Millefiori-Glasperlen, Goldschmiedin Herz: „Der kaufmännische Aspekt ist für uns drittrangig“<br />
Plötzlich kamen Kunden aus Hamburg<br />
und Berlin, Gundlack wurde eingeladen<br />
und freundete sich mit dem Berliner Universal-Musikmanager<br />
Sven Kilthau-Lander<br />
an. Kurz darauf vermaß er die Füße<br />
von „Teufelsgeiger“ David Garrett und<br />
entwarf Stiefel für Ryan Tedder, den<br />
Leadsänger der US-Band OneRepublic.<br />
Beide sind nun seine Freunde.<br />
Wie im Schleudersitz wurde der Kleinstädter<br />
in die Lady-Gaga-Welt katapultiert.<br />
Kürzlich bekam er einen Anruf, er<br />
solle sofort nach Monaco kommen, einen<br />
Schuh anmessen. Er wäre fast in Ohnmacht<br />
gefallen, als die Kundin auf ihn zukam:<br />
ein Supermodel.<br />
Warum er trotzdem die Bodenhaftung<br />
nicht verliert, weiß er selbst nicht so genau.<br />
Vielleicht hilft Parchim, und dass er<br />
für seine Parchimer immer noch Absätze<br />
für acht Euro repariert, wenn er nicht<br />
gerade Maßschuhe aus Kaiman-, Pferdeoder<br />
Lachsleder schustert. Vielleicht aber<br />
auch ist es das Glück, endlich das machen<br />
zu können, was er liebt.<br />
Besonders stolz ist er auf die Schuhe<br />
aus Elefantenleder, die er gerade fertiggestellt<br />
hat. Über 3000 Euro kostet das<br />
Paar, andächtig hebt Gundlack sie aus<br />
dem extra gepolsterten Karton und wickelt<br />
sie aus dem Seidenpapier. Beim Elefanten,<br />
sagt er, habe er emotionale Probleme,<br />
ins Leder zu schneiden. Und nein,<br />
er selbst könnte sich diesen Luxus nicht<br />
erlauben.<br />
1400 Euro zahlt ein Kunde normalerweise<br />
für ein Paar maßgeschneiderte<br />
Gundlack-Unikate, auf die man fünf bis<br />
sieben Monate warten muss. Doch nicht<br />
jeder, der will, bekommt auch welche.<br />
Dreimal hat er Kunden weggeschickt.<br />
„Ich mag es nicht, wenn man mir erklären<br />
will, wie man Schuhe macht“, sagt er. Einem<br />
besonders Großmäuligen erklärte er:<br />
„Wissen Sie, für mich ist jeder Auftrag<br />
eine Wertschätzung meiner Arbeit. Die<br />
kann ich bei Ihnen nicht erkennen.“<br />
Unliebsame Kundschaft einfach abzulehnen,<br />
das ist der Luxus, den Edelhandwerker<br />
sich leisten.<br />
„Der kaufmännische Aspekt ist für uns<br />
drittrangig“, sagt auch Nimbus-Inhaber<br />
Kuhn. Mit Hingabe legen die beiden<br />
Goldschmiede ihren Kunden Ohrringe,<br />
Ketten oder Armreife an, lassen stundenlang<br />
alles probieren, bis das eine, das passende<br />
Stück zum Menschen gefunden<br />
wird. Doch manche Entwürfe, jene, die<br />
ihnen besonders am Herzen liegen, schaffen<br />
es nicht in die Verkaufsvitrine.<br />
Und so ist die kunstvolle Millefiori-<br />
Perlenkette aus uraltem antiken Glas,<br />
die sie kürzlich fertiggestellt haben, auch<br />
absolut unverkäuflich. „Das“, sagt Ulla<br />
Herz, „ist unser ganz privater Luxus.“<br />
MICHAELA SCHIESSL<br />
DER SPIEGEL 50/2013 77
Finanzminister Schäuble, Walter-Borjans: Finstere Befürchtungen bestätigt<br />
FINANZEN<br />
Ausgebremst<br />
Trotz bester Voraussetzungen<br />
bringt Bremen seinen<br />
maroden Haushalt nicht in<br />
Ordnung. Die anderen<br />
Länder lassen Milde walten.<br />
Als Rheinländer ist Nordrhein-Westfalens<br />
Finanzminister Norbert<br />
Walter-Borjans (SPD) nicht gezwungen,<br />
alles immer ganz genau zu nehmen.<br />
„Leben und leben lassen“, das Motto<br />
seiner Heimat, gilt für ihn nicht nur<br />
zum Karneval, sondern auch im Advent.<br />
Am vergangenen Donnerstag brachte<br />
er es zur praktischen Anwendung. Als<br />
Mitglied des Stabilitätsrats, jener Versammlung<br />
von Finanzministern aus Bund<br />
und Ländern, die über die Staatsfinanzen<br />
wacht, sorgte er dafür, dass seiner Bremer<br />
Kollegin Karoline Linnert (Grüne) eine<br />
offizielle Rüge erspart blieb.<br />
So viel Milde könnte Folgen haben.<br />
Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit<br />
der Schuldenbremse, also des Regelwerks,<br />
das Bund und Länder verpflichtet, bis<br />
2020 ihre Haushalte zu sanieren und weitgehend<br />
ohne neue Kredite auszukommen.<br />
Den Hüter über die finanzpolitische<br />
Tugend gibt der Stabilitätsrat.<br />
Die Runde darf ein Land förmlich ermahnen,<br />
wenn es sich nicht an Sparzusagen<br />
hält und seine Finanzen nicht im Griff<br />
hat. Beides ist in Bremen der Fall, und<br />
dennoch konnten sich die Minister nicht<br />
durchringen, die volle Strenge des Gesetzes<br />
zur Geltung zu bringen. Damit hat<br />
die Runde finstere Befürchtungen bestätigt:<br />
Die Schuldenbremse greift nicht automatisch,<br />
im Zweifel dominieren Willkür<br />
und politische Opportunität.<br />
Schließlich richten über den Sünder<br />
von heute potentielle Missetäter von mor-<br />
78<br />
gen. Wer sich jetzt großzügig zeigt, darf<br />
künftig auf Entgegenkommen hoffen.<br />
Zwar tröstet sich die Mehrheit der Teilnehmer<br />
damit, dass noch nie ein Land so<br />
schonungslos an den Pranger gestellt wurde.<br />
„Immerhin haben wir einen blauen<br />
Brief verschickt, auch wenn er in einem<br />
weißen Umschlag steckt“, sagt ein Beteiligter.<br />
Aber in dem Schreiben wird Linnert<br />
lediglich gebeten, ihren Konsolidierungskurs<br />
zu verstärken. „Natürlich hätte<br />
sie in der Vergangenheit bereits mehr machen<br />
müssen“, sagt ein Kollege. Und ob<br />
Linnert dem Anliegen tatsächlich nachkommt,<br />
ist ungewiss. Denn ihr Unrechtsbewusstsein<br />
ist übersichtlich.<br />
Dabei wäre jetzt die beste Gelegenheit,<br />
die traditionell maroden Finanzen Bremens<br />
endlich in Ordnung zu bringen: Gegenüber<br />
früheren Planungen wird der<br />
Haushalt um insgesamt 230 Millionen Euro<br />
entlastet – niedrigeren Zinsen, höheren<br />
Steuereinnahmen und der Übernahme von<br />
Sozialleistungen durch den Bund sei Dank.<br />
Doch was an zusätzlichem Geld reinkommt,<br />
bringt Linnert wieder unters Bremer<br />
Volk. In den kommenden Jahren will<br />
sie jeweils über 150 Millionen Euro mehr<br />
ausgeben als noch im Herbst 2012 geplant.<br />
Schulden je Einwohner in Euro * , 2012<br />
Bremen<br />
Berlin<br />
Saarland<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Hamburg<br />
Schleswig-Holstein<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Hessen<br />
Brandenburg<br />
Niedersachsen<br />
Thüringen<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Baden-Württemberg<br />
Bayern<br />
Sachsen<br />
7591<br />
6537<br />
3384<br />
2302<br />
30155<br />
18213<br />
16077<br />
14699<br />
14273<br />
11444<br />
11164<br />
10556<br />
9834<br />
8877<br />
8813<br />
8498<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
*inkl.<br />
Gemeinden;<br />
Quelle:<br />
Statistisches<br />
Bundesamt<br />
MAJA HITIJ / DAPD<br />
Besonders problematisch ist, dass die<br />
Mehrausgaben durch zusätzliche Schulden<br />
finanziert werden sollen. Das bringt<br />
Bremen gefährlich nah an die Neuverschuldungsobergrenze,<br />
zu deren Ein -<br />
haltung sich der Stadtstaat verpflichten<br />
musste, als er 2011 unter eine Art föderalen<br />
Rettungsschirm schlüpfte. Für 2016<br />
liegt sie bei 270 Millionen Euro. Ursprünglich<br />
sollten die neuen Kredite dann<br />
bei 70 Millionen Euro liegen, das hätte<br />
einen Sicherheitspuffer von gut 200 Millionen<br />
Euro bedeutet. So wäre Bremen<br />
gegen einen drohenden Konjunktureinbruch<br />
und andere Unbill gewappnet. Tatsächlich<br />
ist dieser Puffer nun auf weniger<br />
als ein Viertel zusammengeschnurrt. „So<br />
kann man bei maroden Finanzen einen<br />
Haushalt nicht planen“, sagt ein Teilnehmer<br />
der Sitzung.<br />
Und dennoch wollten einige Länder<br />
nicht ganz so hart sein. Man solle nicht<br />
rein formal argumentieren, hieß es hin -<br />
ter verschlossenen Türen. Thüringens<br />
Finanzminister Wolfgang Voß (CDU) dagegen<br />
warnte eindringlich: „Wenn wir<br />
gleich bei der ersten Bewährungsprobe<br />
einknicken, hat das schlimme Folgen.“<br />
In der hitzigen Diskussion blieb kaum<br />
ein historischer Vergleich aus. Die Aushebelung<br />
des europäischen Stabilitätspakts<br />
durch <strong>Deutschland</strong> und Frankreich<br />
im Jahr 2003 wurde genauso bemüht wie<br />
die spitze Bemerkung, die Bremer Argumentation,<br />
es werde schon irgendwie passen,<br />
ähnele verdächtig der griechischen.<br />
Schließlich schlug NRW-Finanzminister<br />
Walter-Borjans den Kompromiss vor. Gegen<br />
die Aufweichung votierten am Ende<br />
nur Bayern und Hessen, Bundesfinanzminister<br />
Wolfgang Schäuble stimmte zu.<br />
„Bayern hätte Bremen gern mit offiziellem<br />
Siegel aufgefordert, stärker zu sparen“,<br />
sagt der bayerische Finanzminister<br />
Markus Söder. „Wir können es uns nicht<br />
leisten, die Anstrengungen im eigenen<br />
Land nicht konsequent anzugehen.“<br />
Doch der Ärger über die Bremer ist<br />
weit verbreitet, gerade in Ländern, die<br />
selbst Schwierigkeiten mit ihrem Haushalt<br />
haben und sich mühen, die Schuldenbremse<br />
einzuhalten. Sachsen-Anhalts<br />
Amtschef Jens Bullerjahn (SPD) beklagte<br />
intern, er habe seinen Sparkurs gegen<br />
Widerstände stets mit dem Argument<br />
durchgesetzt, es gebe keine andere Wahl.<br />
Mittlerweile erwirtschaftet er in seinem<br />
Etat Überschüsse – so wie sein Berliner<br />
Kollege Ulrich Nußbaum (parteilos).<br />
„Auf EU-Ebene haben wir gesehen, was<br />
passieren kann, wenn man die selbstgesetzten<br />
Stabilitätskriterien schleifen lässt.<br />
Ich hoffe, wir machen es in der Bundesrepublik<br />
besser“, warnt der Finanzsena -<br />
tor der Hauptstadt. „Der Stabilitätsrat<br />
soll Bund und Länder dazu bringen, sich<br />
ehrlich zu machen. Politischen Kuhhandel<br />
darf es dort nicht geben.“ SVEN BÖLL,<br />
CHRISTIAN REIERMANN
Wirtschaft<br />
STADTPLANUNG<br />
Schlauer parken<br />
Deutsche Metropolen wollen sich<br />
in hocheffiziente „Smart Citys“<br />
verwandeln. Technologiekonzerne<br />
wittern ein Milliardengeschäft.<br />
Eigentlich war für diese Woche in<br />
Hamburg der nationale IT-Gipfel<br />
angesetzt mit Kanzlerin Angela<br />
Merkel als prominentem Gast. Doch in<br />
Berlin zieht sich die Regierungsbildung<br />
hin – und so wurde das Hightech-Treffen<br />
kurzfristig verschoben.<br />
Da nun aber Fachleute aus aller Welt<br />
den Termin schon geblockt hatten, gaben<br />
die Hanseaten der Veranstaltung kurzerhand<br />
einen neuen Namen. Hamburgs Erster<br />
Bürgermeister Olaf Scholz lädt nunmehr<br />
zu einem „Smart City Summit“ ein,<br />
so der griffige Titel, um eines seiner Lieblingsthemen<br />
voranzubringen: die intelligente<br />
Stadt von morgen.<br />
Am Dienstag dieser Woche kommt ein<br />
Kreis von etwa 40 Experten im Rathaus<br />
zusammen: Stadtplaner, Zukunftsforscher<br />
und Manager von Technologiekonzernen<br />
wie SAP, Cisco, IBM und der Telekom.<br />
Sie treibt die Idee einer Stadt um, in der<br />
Smarter Alltag Beispiele für intelligente Technik im Haus und auf der Straße<br />
2 Wärme<br />
Die intelligente<br />
Heizung hat deshalb<br />
das Bad ebenfalls<br />
früher erwärmt.<br />
3 Navigation<br />
Das Fahrzeug findet<br />
den schnellsten Weg<br />
zum Ziel und zu einem<br />
freien Parkplatz.<br />
1 Terminplanung<br />
Der intelligente Wecker<br />
weiß vom Stau auf dem<br />
Weg zur Arbeit und<br />
klingelt früher.<br />
4 Beleuchtung<br />
Das Licht der Laterne wird<br />
heller, wenn sich der Wagen<br />
seinem Parkplatz nähert.<br />
5 Abrechnung<br />
Sensoren messen<br />
die Parkdauer. Die<br />
Gebühr wird automatisch<br />
abgebucht.<br />
alles miteinander vernetzt ist: Autos, Ampeln,<br />
Parkplätze, Mülleimer, Lampen –<br />
jeder Gegenstand in der Smart City ist<br />
elektronisch identifizierbar.<br />
Der Sensor misst, der Rechner denkt,<br />
und der Mensch lässt sein Verhalten davon<br />
leiten: Zeichnet sich auf dem Arbeitsweg<br />
ein Stau ab, klingelt morgens der<br />
Wecker früher (siehe Grafik). Oder umgekehrt,<br />
die Technik stellt sich auf das<br />
Verhalten der Nutzer ein. Das Thermostat<br />
„Nest“, das Ex-Apple-Entwickler<br />
konstruiert haben, merkt sich, wann die<br />
Bewohner üblicherweise zu Hause sind,<br />
und steuert entsprechend die Heizung.<br />
Die digitale Verheißung elektrisiert derzeit<br />
Politiker in vielen Metropolen. Sie<br />
sind fasziniert von der Aussicht, städtische<br />
Dienstleistungen effizienter zu machen<br />
und die Lebensqualität der Bürger<br />
zu verbessern, so jedenfalls versprechen<br />
es ihnen die IT-Konzerne.<br />
General Electric nennt das Ganze „Industrial<br />
Internet“, Cisco spricht vom „Internet<br />
der Dinge“, IBM sogar vom „Smarter<br />
Planet“. Die Begriffe sind austauschbar,<br />
hinter ihnen steht die Hoffnung auf<br />
ein Megageschäft: Die Marktforschungsfirma<br />
IDC rechnet für 2014 mit einem Volumen<br />
von weltweit 44 Milliarden Euro.<br />
Besonderes Augenmerk richten die<br />
Konzerne auf den deutschen Markt. Er<br />
ist kaum erschlossen, die Städte haben<br />
wenig in eine smarte Infrastruktur investiert.<br />
Bislang beschränkt sich ihre Aktivität<br />
auf eine Vielzahl kleiner Pilotprojekte.<br />
In Köln experimentiert der Versorger<br />
RheinEnergie in einem Straßenabschnitt,<br />
wie der Verbrauch von Strom, Heizenergie<br />
und Beleuchtung zu steuern ist. In Dresden<br />
existiert seit vorigem Sommer ein<br />
Informationssystem, das Pendler je nach<br />
Verkehrslage über die Elbbrücken lotst.<br />
Und in Hamburg werden derzeit 40<br />
Lkw-Parkplätze im Hafen mit Sensoren<br />
ausgestattet; sie sehen aus wie Eishockeypucks<br />
und sind in den Asphalt eingelassen.<br />
Mit ihrer Hilfe sollen Trucker leichter<br />
einen Stellplatz finden, ihr Navigationsgerät<br />
führt sie direkt zum Ziel.<br />
Gerade das leidige Thema Parken demonstriert<br />
die Potentiale intelligenter Vernetzung.<br />
Die Suche nach freien Flächen<br />
macht rund ein Drittel des innerstädtischen<br />
Verkehrsaufkommens aus, eine<br />
schlaue Steuerung könnte Staus und<br />
Emissionen verringern helfen. Zugleich<br />
nimmt die Kommune mehr Geld ein:<br />
Dank automatischer Abrechnung geht ihr<br />
kein Falschparker mehr durch die Lappen.<br />
In Teilen San Franciscos ist ein solches<br />
System bereits im Einsatz, mehr als 8000<br />
Parkplätze hat die Stadt mit Sensoren<br />
ausgestattet. Die Gebühren sind variabel,<br />
sie sinken und steigen mit der Nachfrage.<br />
Andere Metropolen gehen noch viel<br />
weiter, sie bauen regelrechte digitale Nervensysteme<br />
auf. In New Songdo, einer<br />
südkoreanischen Retortenstadt, können<br />
alle Gebäude per Videokonferenz mitein -<br />
ander verbunden werden: Wohnungen,<br />
Büros, Kliniken, Geschäfte. Und in Rio<br />
de Janeiro hat die Stadt zusammen mit<br />
IBM ein Kontrollzentrum mit meterhohen<br />
Bildschirmwänden installiert. Darauf können<br />
die Mitarbeiter jeden Bus, jede Polizei -<br />
streife, jeden Müllwagen verfolgen.<br />
Spätestens hier ist für Urbanitätsforscher<br />
wie Anthony Townsend eine Grenze<br />
überschritten. Zwar sei angesichts von<br />
Klimawandel und Verstädterung jeder<br />
Effizienzgewinn zu begrüßen, so der New<br />
Yorker Wissenschaftler. Was aber fehle,<br />
sei eine ernsthafte Debatte der Risiken.<br />
Townsend sieht eine Gefahr darin, dass<br />
Städte die Sammlung von Big Data und,<br />
noch wichtiger, ihre Auswertung an private<br />
Unternehmen übertrügen; damit<br />
machten sie sich abhängig. Problematisch<br />
findet er auch, wenn die Stadt die Konzepte<br />
dem Bürger aufzwänge. Die Systeme<br />
würden starr und anfällig: für Fehler, für<br />
Sabotage und für unbefugten Zugriff.<br />
Am Ende aber dürfte entscheidend für<br />
Erfolg oder Misserfolg sein, ob die Dienste<br />
einer Smart City ihren Bewohnern<br />
spürbaren Nutzen bringen. Oder ob sie<br />
bloß ein Gimmick sind wie der vernetzte<br />
Kühlschrank, der selbständig Milch bestellt,<br />
wenn der Vorrat zur Neige geht.<br />
Seit Jahren ist er auf Messen zu bestaunen<br />
– aber niemand braucht ihn.<br />
ALEXANDER JUNG<br />
80<br />
DER SPIEGEL 50/2013
JÖRG MÜLLER / AGENTUR FOCUS / DER SPIEGEL (L.); SPENCER PLATT / AFP (R.)<br />
Physiotherapeutin Herbst, Yelp-Büro in New York: „Kontrolle über ihr Image im Internet verloren“<br />
INTERNET<br />
Krieg der<br />
Sterne<br />
Viele Unternehmer sind verärgert<br />
über die Bewertungsplattform<br />
Yelp. Seitdem die Seite<br />
einen neuen Eigentümer<br />
hat, werden sie schlechter benotet.<br />
Wenn die Hamburger Physio -<br />
therapeutin Kathrin Herbst in<br />
diesen Tagen im Internet surft,<br />
fühlt sie sich wie eine Schülerin, die<br />
immer gut in Mathe war, aber plötzlich<br />
nur noch Vieren bekommt. Und keine<br />
Ahnung hat, warum.<br />
Vor ein paar Wochen gehörte Herbsts<br />
Praxis auf dem Online-Bewertungsportal<br />
Yelp zu den besten unter den Hambur -<br />
ger Physiotherapeuten. Patienten hatten<br />
die Praxis auf der Vorgängerseite Qype<br />
überwiegend gelobt und sie durchschnittlich<br />
mit viereinhalb von fünf Sternen<br />
bewertet. Nachdem Yelp den deutschen<br />
Konkurrenten Qype gekauft und stillgelegt<br />
hatte, war die Praxis zwischenzeitlich<br />
auf zwei Sterne abgestürzt; aber nicht,<br />
weil die Patienten plötzlich unzufrieden<br />
waren. Stattdessen hat der Dienst einen<br />
Großteil der alten Bewertungen aussortiert<br />
– ohne erkennbaren Grund, wie<br />
Herbst sagt.<br />
Seit aus Qype Ende Oktober Yelp wurde,<br />
klagen Cafébetreiber, Ärzte oder Friseure<br />
über das undurchsichtige System<br />
des US-Unternehmens. Sie werfen Yelp<br />
vor, sie grundlos herabzustufen. Manche<br />
sehen ihr Geschäft bedroht, weil Kunden<br />
von den miesen Zensuren abgeschreckt<br />
würden.<br />
Die Betreiber hatten versprochen, dass<br />
alle Bewertungen von Qype auf das neue<br />
Portal übernommen werden. Tatsächlich<br />
ist nach dem Umzug eine Vielzahl der<br />
alten Kundenurteile verschwunden, zumindest<br />
auf den ersten Blick.<br />
Anders als die Vorgängerseite lässt<br />
Yelp alle Bewertungen von einer Software<br />
prüfen. Der Algorithmus siebt nicht<br />
nur offensichtlich gekaufte Kritiken aus,<br />
sondern auch solche, die Yelp für „nicht<br />
hilfreich“ hält. Die ausgemusterten Kundenurteile<br />
fließen nicht in die Bewertung<br />
ein und erscheinen nur versteckt auf dem<br />
Portal. Wie der Algorithmus funktioniert,<br />
beantwortet Yelp nur vage. „Qualität“<br />
und „Vertrauenswürdigkeit“ eines Urteils<br />
seien entscheidend, nur rund ein Viertel<br />
der Kritiken falle durchs Raster.<br />
Doch auf der deutschen Yelp-Seite bleiben<br />
derzeit in vielen Fällen erheblich<br />
mehr Voten unberücksichtigt. 70 Beiträge<br />
über die Leistungen des Berliner Friseurs<br />
Peter Arnheim hat der Service beispielsweise<br />
aktuell aussortiert. Übrig geblieben<br />
sind 12; der Salon ist im Gesamturteil von<br />
fünf auf dreieinhalb Sterne abgefallen.<br />
„Wenn man auf Qype nach ,Friseur in<br />
Berlin‘ gesucht hat, waren wir unter den<br />
ersten 20“, sagt Arnheim. „Jetzt erscheinen<br />
wir auf Seite elf. So weit klickt niemand.“<br />
Seit dem Wechsel habe sich die<br />
Zahl der Neukunden spürbar verringert.<br />
Die Lücke, die sich nun in seinem Terminkalender<br />
auftue, umfasse pro Woche<br />
10 bis 15 Stunden, schätzt er.<br />
Arnheim ist verärgert, dass unter den<br />
ausrangierten Urteilen überdurchschnittlich<br />
viele gute sind. Zwar sind nicht bei<br />
allen Geschäften und Dienstleistern nur<br />
die schlechten Bewertungen übrig geblieben,<br />
aber bei so vielen, dass es auffällt.<br />
Yelp verweist darauf, dass es oft genau<br />
umgekehrt sei und Unternehmen nun<br />
besser dastünden. „Die Geschäfte sind<br />
sauer, weil sie die Kontrolle über ihr<br />
Image im Internet verloren haben. Jetzt<br />
können sie ihre Kunden nicht mehr einfach<br />
um eine positive Bewertung bitten“,<br />
sagt Elliot Adams, Europa-Chef der PR-<br />
Abteilung.<br />
Im Netz, wo sich der Zorn der Betroffenen<br />
Bahn bricht, werden die schlechten<br />
Beurteilungen dagegen mitunter so erklärt:<br />
Yelp bevorzuge Unternehmen, die<br />
dem Portal monatlich Geld für Anzeigen<br />
zahlten. Auch in den USA haben Gastronomen<br />
oder Anwälte wiederholt diesen<br />
Vorwurf erhoben. Yelp weist ihn zurück.<br />
Unbestritten ist, dass Yelp derzeit sehr<br />
um neue Anzeigenkunden aus <strong>Deutschland</strong><br />
wirbt. Mitarbeiter verschicken E-Mails<br />
an potentielle Geschäftspartner, in denen<br />
sie auf „eine Studie der Boston Consulting<br />
Group über Umsatzsteigerung durch<br />
Yelp“ hinweisen. 200 bis 800 Euro kostet<br />
ein Anzeigenpaket pro Monat.<br />
Auf Beschwerden reagiert Yelp dagegen<br />
kurz angebunden, mit einer Standard-E-Mail,<br />
versendet aus San Francisco.<br />
„Yelp hat sich bislang nicht besonders<br />
interessiert gezeigt an den Bedürfnissen<br />
der Nutzer und Unternehmer aus<br />
<strong>Deutschland</strong>“, sagt Stephan Uhrenbacher,<br />
Gründer von Qype. Die Beschwerden<br />
über die US-Site hält er für „vollkommen<br />
berechtigt“. Uhrenbacher ist bei Qype als<br />
Geschäftsführer ausgeschieden, bevor der<br />
US-Wettbewerber die deutsche Plattform<br />
vor einem Jahr gekauft hat. Heute sagt<br />
er: „Das Filtersystem von Yelp ist in der<br />
jetzigen Form nicht mit den Prinzipien<br />
von Qype vereinbar.“<br />
Dass die Methoden von Yelp zumindest<br />
willkürlich sind, hat nun auch ein<br />
deutsches Gericht festgestellt. Das Landgericht<br />
Hamburg erließ kürzlich eine<br />
einstweilige Verfügung gegen Yelp. Das<br />
Portal darf nun nicht länger die Bewertungen<br />
einer Hamburger Zahnarztpraxis<br />
nur unvollständig anzeigen. Das Filtersystem<br />
sei unzulässig, weil ihm keine objektiven<br />
Kriterien zugrunde lägen, sagt<br />
Hendrik Sievers, Anwalt des Klägers.<br />
Ob Yelp das Profil des Zahnarztes nun<br />
löschen oder den Filter ausschalten muss,<br />
lässt der Gerichtsbeschluss offen. Andere<br />
Unternehmer wollen jetzt ebenfalls juristisch<br />
gegen Yelp vorgehen.<br />
Die Entscheidung des Hamburger<br />
Gerichts will Yelp mit Berufung auf das<br />
laufende Verfahren nicht kommentieren.<br />
Und auch die Funktion des Algorithmus<br />
mag PR-Mann Adams nicht näher erklären:<br />
„Coca-Cola verrät ja auch nicht sein<br />
Rezept.“<br />
ANN-KATHRIN NEZIK<br />
DER SPIEGEL 50/2013 81
Panorama<br />
NORDKOREA<br />
Geschwächter Diktator<br />
MEXIKO<br />
Erz statt Kokain<br />
Drogenkartelle des Landes haben ein<br />
neues Geschäftsfeld entdeckt: Sie exportieren<br />
Eisenerz und andere Rohstoffe.<br />
Im Bundesstaat Michoacán an<br />
der Pazifikküste kontrolliert vor allem<br />
die Rauschgiftmafia der „Tempelritter“<br />
die Ausfuhr von Mineralien, die<br />
Gangster haben sich großer Teile des<br />
Bergbaus bemächtigt. Bewohner von<br />
Michoacán berichten, dass die Verbrecherorganisationen<br />
auch am Abbau<br />
der Rohstoffe beteiligt seien. Allein im<br />
Jahr 2010 haben Drogenkartelle nach<br />
Schätzungen der Staatsanwaltschaft<br />
1,1 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert.<br />
Anfang November besetzte das<br />
Militär den Hafen von Lázaro Cárdenas,<br />
einen der wichtigsten Umschlagplätze.<br />
Die Stadt war praktisch in der<br />
Hand der „Tempelritter“. Die Drogenhändler<br />
unterwandern die Wirtschaft,<br />
um sich gegen Schwankungen in<br />
ihrem traditionellen Gewerbe abzu -<br />
sichern. Und sie stecken ihr Geld in legale<br />
Unternehmen, um es zu waschen.<br />
Das Wirtschaftsministerium hat im<br />
vergangenen Jahr diversen Firmen Exportlizenzen<br />
verweigert, weil sie nicht<br />
nachweisen konnten, dass die Mine -<br />
ralien aus sauberen Quellen stammten.<br />
Kim Jong Un (r.), General Chang Song Taek<br />
Die Entmachtung seines Onkels als<br />
Vizechef der Nationalen Verteidigungskommission<br />
markiert wohl eine<br />
Niederlage für Diktator Kim Jong<br />
Un – und nicht, wie viele Beobachter<br />
spekulieren, einen Sieg. Der Sturz von<br />
General Chang Song Taek, 67, belege<br />
das vorläufige Ende eines Machtkampfes<br />
im Sicherheitsapparat, sagt auf<br />
jeden Fall der vor neun Jahren aus<br />
Nordkorea geflohene Ex-Geheimdienstmann<br />
Jang Jin Sung, der bis heute<br />
gute Beziehungen zu Regime-Leuten<br />
unterhält. Die Anhänger des verstorbenen<br />
Vaters von Kim im Ministerium<br />
für Staatssicherheit hätten sich<br />
gegen den Onkel durchgesetzt, der das<br />
Ministerium für Volkssicherheit dominierte.<br />
Der Onkel galt als der wichtigste<br />
Berater des erst 30-jährigen Kim. Er<br />
stand für eine vorsichtige ökonomische<br />
Öffnung des totalitären Regimes,<br />
für die Reform der Landwirtschaft und<br />
die Verbesserung der schwierigen Beziehungen<br />
zu China. Das Staatssicherheitsministerium<br />
dagegen setzt eher<br />
auf militärische Stärke und höhere Investitionen<br />
ins Atomprogramm. Anders<br />
als zwei Vertraute aus seiner unmittelbaren<br />
Umgebung, die Mitte November<br />
hingerichtet wurden, habe der<br />
entmachtete Onkel nicht den Tod zu<br />
fürchten, so der ehemalige Geheimdienstler<br />
Jang Jin Sung. Die Herrscherfamilie<br />
stehe unter besonderem<br />
Schutz. „Letztlich ist Kim Jong Un ein<br />
Opfer.“ Zu erwarten sei nun „mehr<br />
Politik mit militärischen Mitteln und<br />
eine Beschleunigung des Nuklearprogramms“.<br />
82<br />
KYODO / REUTERS<br />
Palästinensische Familie im Gaza-Streifen<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
NAHOST<br />
Verheerende Isolation<br />
Nachdem die ägyptische Armee seit<br />
Juli nahezu alle Schmugglertunnel in<br />
den Gaza-Streifen zerstört hat, verschlechtern<br />
sich die Lebensverhältnisse<br />
der 1,7 Millionen Einwohner dort<br />
dramatisch. Ein normaler Haushalt hat<br />
nur noch zwei Stunden Strom am Tag,<br />
die Wasserversorgung ist noch schwieriger<br />
geworden. Wegen der Stromknappheit<br />
funktionieren die Klärwerke<br />
nicht mehr, manche Straßen sind<br />
regelrecht mit Abwässern geflutet. Es<br />
fehlt mittlerweile an allem: an Baumaterialien,<br />
deren Einfuhr auf regulärem<br />
Weg Israel nahezu völlig unterbindet,<br />
an Medikamenten und Treibstoff.<br />
Auch die Preise für Lebensmittel sind<br />
stark gestiegen. Zugleich dürfen weniger<br />
Menschen denn je Gaza verlassen.<br />
Das Gebiet werde langsam unbewohnbar,<br />
sagt der Generalkommissar des<br />
Uno-Flüchtlingshilfswerks. Für die<br />
regierende radikalislamische Hamas<br />
geht es ums politische Überleben: Sie<br />
ist isoliert wie nie zuvor. Ihren Bündnispartner<br />
Iran hat sie verprellt, indem<br />
sie sich im Syrien-Krieg auf die Seite<br />
der Rebellen stellte. Die ägyptische<br />
Muslimbruderschaft kann der Hamas<br />
auch nicht mehr helfen. Aus Angst vor<br />
israelischen Reaktionen verhaften Hamas-Leute<br />
sogar Kämpfer, damit diese<br />
nicht Israel mit Raketen beschießen.<br />
Hinweise auf mögliche Unruhestifter<br />
stammen angeblich auch von israelischen<br />
Geheimdienstlern.<br />
MOHAMMED SALEM / REUTERS
Ausland<br />
NOORULLAH SHIRZADA / AFP<br />
Lernen unter freiem Himmel. Über eine halbe Million<br />
Afghanen sind in der ersten Jahreshälfte vor der Bedrohung<br />
durch die Taliban geflohen. Viele leben in Camps im eigenen<br />
Land. Afghanische Kinder, von denen 40 Prozent unterernährt<br />
sind, werden dort im Freien und nur bei gutem Wetter unterrichtet<br />
– wie hier in Jalalabad an der Grenze zu Paki stan. Die<br />
Schüler arbeiten in einer Ziegelfabrik. Afghanistan hat seit<br />
über 30 Jahren wenig Friedenszeiten erlebt. Schon nach der<br />
sowjetischen Invasion 1979, im Bürgerkrieg der neun ziger<br />
Jahre und während der Taliban-Herrschaft wurden Schulen<br />
geschlossen. Auch deshalb sind 57 Prozent der afgha nischen<br />
Männer und 87 Prozent der Frauen Analphabeten.<br />
DIPLOMATIE<br />
Camerons Erniedrigung<br />
Premier Cameron<br />
Mit seiner demütigen Haltung beim<br />
Staatsbesuch in China hat sich der britische<br />
Premier David Cameron nicht<br />
nur dem Spott seiner Gastgeber und<br />
Landsleute ausgesetzt, sondern auch<br />
noch seine europäischen Partner verärgert.<br />
Bevor er vorvergangenen Sonntag<br />
nach Peking aufbrach, hatten sich<br />
EU-Politiker über den plötzlichen<br />
Anfall europäischen Gemeinsinns der<br />
Briten gewundert. Ausgerechnet Camerons<br />
europaskeptische Regierung<br />
drängte darauf, dass Brüssel – und<br />
nicht London – Peking für die Einrichtung<br />
einer Luftverteidigungszone über<br />
dem Ostchinesischen Meer kritisieren<br />
solle. Cameron wollte in Peking für Interessen<br />
der britischen Industrie werben<br />
und vermied es so,<br />
sich während seines Besuchs<br />
selbst mit den Chinesen<br />
anlegen zu müssen.<br />
Viel brachte ihm das nicht:<br />
Die chinesische „Global<br />
Times“ begrüßte Cameron<br />
mit dem Vorschlag,<br />
Großbritannien möge anerkennen,<br />
dass es „in den<br />
Augen der Chinesen keine<br />
Großmacht“ sei. „Es ist<br />
bloß ein altes europäisches<br />
Land, das sich zum<br />
Reisen und Studieren eignet.“<br />
Unverdrossen versprach Cameron<br />
in Peking, sich mit seinem „vollen<br />
politischen Gewicht“ für eine euro -<br />
päisch-chinesische Freihandelszone<br />
einzusetzen – die freilich<br />
viele EU-Mitglieder nicht<br />
umsetzen wollen, solange<br />
China seine Investitionsbedingungen<br />
nicht verbessert.<br />
Man werde die<br />
Briten wissen lassen, so<br />
europäische Diplomaten<br />
in Peking, dass man vom<br />
Vorschlag ihres Premiers<br />
nichts halte. „Camerons<br />
politische Karriere“, kommentierte<br />
der „Guardian“<br />
aus diesem Anlass,<br />
„kommt an ihr Ende.“<br />
PETAR KUJUNDZIC / REUTERS<br />
DER SPIEGEL 50/2013 83
Titel<br />
Madibas Magie<br />
Er befreite die Schwarzen, einte sein Land, wurde zum Idol für Millionen in aller<br />
Welt, zu einem Superstar. Nelson Mandelas Tod erschüttert Afrika, sein<br />
Leben wird zu einer Legende – größer als der Mann selbst. Von Bartholomäus Grill<br />
84<br />
Genadendal, die Residenz des südafrikanischen<br />
Präsidenten in Kapstadt.<br />
Der Herr des Hauses betrat<br />
den Salon. Ging er nicht ein bisschen gebückter?<br />
Sah er nicht älter, grauer aus?<br />
Wirkte er nicht erschöpft? Er trug, leger<br />
wie meistens, eine weiße Leinenhose,<br />
dazu eines seiner Ethno-Hemden, erdnussbraun<br />
mit schwarzen Ornamenten.<br />
Ein fester Druck einer großen Maurerhand,<br />
ein hinreißendes Lächeln. Dann<br />
saß er im Sessel unter einem Gemälde,<br />
das indische Frauen im zinnoberroten<br />
Sari zeigt: Nelson Mandela, Präsident des<br />
neuen Südafrika, bereit zum Interview.<br />
Wir hatten uns schon früher getroffen.<br />
Aber diesmal war ich zunächst so befangen,<br />
dass mir die erste Frage nicht gleich<br />
einfiel. Also fragte Mandela:<br />
„Wie alt war eigentlich Adenauer, als<br />
er Bundeskanzler wurde?“<br />
„Ich glaube, er war über 70.“<br />
„Aha.“<br />
Mandela war damals, im September<br />
1995, 77 Jahre alt. Er suchte den Vergleich<br />
mit greisen Staatsmännern. Denn Skeptiker<br />
im Lande meinten, er sei zu alt für<br />
das kraftraubende Amt des Staatschefs.<br />
Er schaute versonnen durch die offene<br />
Flügeltür in den Garten, auf die Bougainvilleen,<br />
Frangipani und Flammenbäume,<br />
die in den prächtigsten Frühlingsfarben<br />
blühten. Eine seltsame Aura umgab diesen<br />
Menschen. Es war, als würde man ihn<br />
schon lange kennen, als wäre er einem<br />
nahe wie ein väterlicher Freund.<br />
Zugleich aber tat sich in diesem Kraftfeld<br />
eine ebenso merkwürdige Distanz<br />
auf, Mandela wirkte sternenfern und<br />
fremd. Ein Mythos, unwirklich, erstarrt<br />
zu einer Ikone der Geschichte.<br />
Nelson Rolihlahla Mandela, der erste<br />
schwarze Präsident Südafrikas, war in jenen<br />
Tagen auf dem Höhepunkt seiner<br />
Macht. Er wurde verehrt, ja vergöttert.<br />
Viele Landsleute nahmen ihn als Erlöser<br />
und Heilsbringer wahr, die Schwarzen,<br />
weil er sie aus der Knechtschaft in die<br />
Freiheit geführt hatte, die Weißen, weil<br />
er auf Rache verzichtete und ihnen die<br />
Hand zur Versöhnung reichte.<br />
Am Donnerstag vergangener Woche,<br />
kurz vor 21 Uhr Ortszeit, ist Nelson Mandela<br />
in seinem Haus im Johannesburger<br />
Viertel Houghton gestorben. Er wurde<br />
95 Jahre alt.<br />
Am Morgen danach strömten die Menschen<br />
in die St.-George’s-Kathedrale in<br />
Kapstadt. Jeden Freitag um sieben Uhr<br />
morgens findet hier die Frühmesse statt,<br />
normalerweise besuchen sie nur ein paar<br />
alte Leute. Doch diesmal war das Kirchenschiff<br />
voll, und den Gottesdienst<br />
zelebrierte der ehemalige Erzbischof<br />
Desmond Tutu persönlich.<br />
Die Gläubigen, Schwarze und Weiße<br />
bunt gemischt, repräsentierten einen<br />
Querschnitt der multiethnischen Regenbogennation,<br />
die sich Mandela immer erträumt<br />
hat. Sie beteten gemeinsam für<br />
ihren Ex-Präsidenten. Viele hatten Tränen<br />
in den Augen, als die Orgel die Natio -<br />
„Gut zu wissen, dass<br />
er auch nur ein Mensch<br />
ist“, sagte Erzbischof<br />
Desmond Tutu.<br />
nalhymne spielte: Nkosi sikelel’ iAfrika.<br />
Gott schütze Afrika.<br />
Die Südafrikaner hatten zwar täglich<br />
mit dem Tod Mandelas gerechnet, nachdem<br />
er im Sommer wochenlang im<br />
Krankenhaus gelegen und sich von einer<br />
schweren Lungenentzündung nie mehr<br />
richtig erholt hatte. Aber als sich die Nachricht<br />
von seinem endgültigen Abschied<br />
verbreitete, versank die Nation in Trauer.<br />
In den Postämtern, Banken, Behörden<br />
und Cafés der Kapstädter Innenstadt liefen<br />
ununterbrochen TV-Übertragungen,<br />
aus der ganzen Welt gingen Beileids -<br />
bekundungen ein, von Angela Merkel,<br />
Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon, Barack<br />
Obama. Der US-Präsident sagte:<br />
„Ich kann mir mein eigenes Leben ohne<br />
Mandelas Beispiel nicht vorstellen.“<br />
Die nationalen und internationalen<br />
Fernsehsender hatten sich seit Jahren auf<br />
den Tag X vorbereitet. Voraussichtlich<br />
werden an diesem Dienstag eine Milliarde<br />
Menschen rund um den Globus die Toten -<br />
feier verfolgen.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Mandela hatte in seinem Kampf gegen<br />
die Apartheid die größte Menschenrechtsbewegung<br />
aller Zeiten ausgelöst, die weltweite<br />
Kampagne gegen die Apartheid. Er<br />
beendete die Kolonialära in Afrika, indem<br />
er der schwarzen Bevölkerungsmehrheit<br />
ihre Bürgerrechte gab und zugleich<br />
das Land einte. Er war eine Projektionsfigur,<br />
in der viele Menschen ihre universellen<br />
Ideale erkannten, die Gleichheit<br />
aller, die Utopie von der Weltfamilie.<br />
Der Freiheitskämpfer wurde als archetypische<br />
Heldengestalt wahrgenommen,<br />
die das Böse bezwingt, noch klarer, noch<br />
reiner als die wenigen anderen Heroen<br />
der jüngeren Geschichte, John F. Kennedy<br />
etwa oder Che Guevara. Anthony<br />
Sampson, einer seiner Biografen, vergleicht<br />
ihn mit Odysseus: Mandela verkörpere<br />
den „universalen Mythos vom<br />
Triumph des menschlichen Willens“.<br />
Weltberühmt wurde Mandela am<br />
20. April 1964. Es war der Tag, an dem er<br />
eine fulminante Verteidigungsrede im<br />
Obersten Gerichtshof zu Pretoria hielt.<br />
Das weiße Regime hatte ihn und sieben<br />
Mitstreiter wegen Sabotage und Verschwörung<br />
angeklagt. Nach einem monate -<br />
langen Schauprozess drohte den Männern<br />
die Todesstrafe.<br />
Nelson Mandela war damals Staatsfeind<br />
Nummer eins. Er führte den Widerstand<br />
des African National Congress<br />
(ANC) gegen das weiße Rassenregime<br />
an, in dem Schwarze als Menschen zweiter<br />
Klasse unterdrückt und ausgebeutet<br />
wurden.<br />
Zunächst hatte sich die Befreiungsbewegung<br />
mit friedlichen Mitteln gewehrt.<br />
Mandela hatte sich intensiv mit „Satyagraha“<br />
beschäftigt, mit Mahatma Gandhis<br />
Prinzip des gewaltfreien Widerstands.<br />
Aber angesichts der Brutalität des Staatsapparats<br />
kam er bald zu der Überzeugung,<br />
dass Feuer nur mit Feuer bekämpft<br />
werden könne. „Sebatana ha se bokwe<br />
ka diatla“, lehrt ein Sprichwort seines Volkes,<br />
der Xhosa: Den Angriff eines Raubtieres<br />
kann man nicht mit bloßen Händen<br />
abwehren.<br />
Nach dem Massaker von Sharpeville<br />
im März 1960, bei dem die Polizei 69 Menschen<br />
erschossen hatte, die meisten von
ANNIE LEIBOVITZ / CONTACT PRESS IMAGES / AGENTUR FOCUS<br />
Volksheld Mandela 1990: „Ich habe das Ideal einer freien Gesellschaft hochgehalten – ich bin bereit, für dieses Ideal zu sterben“<br />
DER SPIEGEL 50/2013 85
86<br />
Titel<br />
Er zog die Mauer, die das<br />
weiße Regime um ihn<br />
errichtet hatte, unsichtbar<br />
immer höher.<br />
hinten, hatte der ANC einen militärischen<br />
Flügel, den „Speer der Nation“, gegründet.<br />
Und um dessen Anschläge ging es nun.<br />
Im Gerichtssaal wurde es stiller und stiller,<br />
je länger der Hauptangeklagte redete.<br />
Am Ende seiner vierstündigen Ausführungen<br />
legte Nelson Mandela das Manuskript<br />
zur Seite, fixierte den Richter und<br />
sprach die letzten Sätze frei.<br />
„Ich habe mein ganzes Leben dem<br />
Kampf des afrikanischen Volkes geweiht …<br />
Ich habe das Ideal einer demokratischen<br />
und freien Gesellschaft hochgehalten, in<br />
der alle Menschen friedlich und mit<br />
gleichen Möglichkeiten zusammenleben.<br />
Wenn es sein muss, Euer Ehren, bin ich<br />
auch bereit, für dieses Ideal zu sterben.“<br />
Der Richter sprach sieben der acht Angeklagten<br />
schuldig und verurteilte sie zu<br />
lebenslanger Kerkerhaft. Beamte führten<br />
Mandela ab. Er sollte erst zweieinhalb<br />
Jahrzehnte später wieder freikommen.<br />
Das Burenregime ließ ihn wegsperren<br />
auf Robben Island, einer Insel im Atlantik,<br />
auf die früher Leprakranke verbannt<br />
worden waren. Er war wie ein Aussätziger,<br />
den die Welt vergessen sollte. Selbst<br />
die Veröffentlichung von Fotos des „Terroristen“<br />
stand unter Strafe. Doch gerade<br />
dieses archaische Bilderverbot stärkte<br />
den Mythos Mandela. Er sollte zum berühmtesten<br />
Gefangenen des 20. Jahrhunderts<br />
werden.<br />
Am 11. Februar 1990, nach 10 000 Hafttagen,<br />
beugte sich das Apartheid-Regime<br />
internationalem Druck und ließ Mandela<br />
frei. „Ich hatte trotz meiner 71 Jahre das<br />
Gefühl, ein neues Leben zu beginnen.“<br />
In seiner ersten Ansprache vor 100000 Anhängern<br />
in Kapstadt versuchte er, sich<br />
selbst zu entmystifizieren: „Ich sprach<br />
von Herzen. Zuerst wollte ich den Leuten<br />
sagen, dass ich kein Messias war.“<br />
Südafrika stand nun ein Umbruch bevor,<br />
in dem beinahe ein Bürgerkrieg zwischen<br />
den Kräften der alten Ordnung und<br />
radikalen Schwarzen ausgebrochen wäre.<br />
In dieser kritischen Phase traf ich Nelson<br />
Mandela zum ersten Mal.<br />
In KwaXimba, einem armseligen Nest<br />
im Zululand, waren im März 1993 sechs<br />
Schulkinder massakriert worden, Opfer<br />
der Kämpfe zwischen Anhängern und<br />
Gegnern des ANC. Mandela fuhr in das<br />
abgelegene Dorf, um die Rachsüchtigen<br />
zu zügeln. Er kam ohne Leibgarde.<br />
Die dunkelblaue Limousine hielt auf<br />
einem Feld am Ortsrand. Ein hochgewachsener,<br />
kräftiger Mann stieg aus,<br />
strahlte und ging mit lockerem Schritt auf<br />
die wartende Menge zu. Ganz vorn stand<br />
ein kleiner Junge, der gerade ein Eis<br />
lutschte. Mandela nahm ihn lachend auf<br />
den Arm, der Knirps schaute den Fremden<br />
unverwandt an. Ein magischer Augenblick.<br />
Rundherum begannen Tausende Menschen<br />
zu tanzen: Toyi-toyi, den Stampftanz<br />
des Widerstands. Als Mandela die<br />
Faust hochreckte, schwoll der Jubel zum<br />
Orkan an.<br />
Erst dann begrüßte er die Lokalhonoratioren<br />
und Parteifreunde. Als er mir<br />
mit den Worten „How are you today,<br />
Sir?“ die Hand gab, hatte ich den Eindruck,<br />
dass mir für wenige Sekunden seine<br />
ganze Aufmerksamkeit zuteilwurde.<br />
Der Wahlkampf im April 1994 bot des<br />
Öfteren Gelegenheit, den ANC-Spitzenkandidaten<br />
in die hintersten Winkel der<br />
Republik zu begleiten. Die Stimmung<br />
war manchmal ausgelassen wie auf einer<br />
Klassenfahrt. Zur Begrüßung sagte Mandela:<br />
„Willkommen, ich frage mich, ob<br />
Sie wissen, wer ich bin.“ Oder: „Ich<br />
fürchte, Sie werden sich nicht an mich<br />
erinnern.“ Er kokettierte gern mit seinem<br />
Ruhm.<br />
Wo immer er hinkam, glühten die Menschen<br />
vor Glück. Wenn er durch eine<br />
Menge schritt, öffneten sich Schneisen.<br />
Manchmal trat Mandela betont aristokratisch<br />
auf, er war an einem traditionellen<br />
Königshof erzogen worden. Aber schon<br />
im nächsten Moment wirkte er wieder<br />
volksnah, ein Held zum Anfassen. In den<br />
Townships, den Ghettos der Schwarzen,<br />
wurde er nur Madiba gerufen, das ist der<br />
Name seines adligen Clans.<br />
Queen Elizabeth II., Bill Clinton, Michael<br />
Jackson, die mächtigsten Politiker<br />
und berühmtesten Künstler suchten Kontakt,<br />
um in Mandelas Glanz zu schillern.<br />
Man sprach von Madiba Magic, von seinem<br />
unwiderstehlichen Zauber.<br />
Gestalt und Gangart. Mienenspiel, Gestik<br />
und Redeweise. Die Augen. Die Falten<br />
und Fäuste. Das heitere, weise Lächeln.<br />
Immer wieder wurde Nelson Mandela beschrieben,<br />
dennoch weiß man über seine<br />
Persönlichkeit recht wenig.<br />
Was machte diesen Mann so furchtlos<br />
und unbeugsam? Woher nahm er die<br />
Zuversicht? Woher die Kraft zur Ver -<br />
söhnung? Warum haben ihn nicht Hass<br />
und Rachsucht zerfressen?<br />
Der Schlüssel zu seinem Charakter<br />
liegt auf Robben Island, in einer kahlen<br />
Zelle, zwei mal zwei Meter eng, mintgrün<br />
gestrichene Betonwände, Lüftungsschlitz,<br />
Fäkalienkübel, Holzschemel, dünne Filzmatte.<br />
Durch das vergitterte Fenster fällt<br />
der Blick auf den Vorplatz, wo die Gefangenen<br />
Steine klopfen mussten. Ein<br />
trostloser Ort, auch heute noch.<br />
Zwei einsame Fotos schmückten damals<br />
den Raum: ein Porträt seiner Frau<br />
Winnie und die Abbildung einer nackten<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
schwarzen Schönheit von den Andamanen-Inseln,<br />
die Mandela aus einem Magazin<br />
gerissen hatte. Die Liebe und die<br />
Lust, zwei Sehnsuchtsbilder.<br />
18 Jahre verbrachte er in dieser Zelle.<br />
Und dabei zog er die Mauer, die das weiße<br />
Regime um ihn errichtet hatte, unsichtbar<br />
immer höher. An ihr prallten alle Erniedrigungen<br />
und Beleidigungen ab. Die<br />
Mauer wuchs so hoch, dass niemand<br />
mehr darüberschauen konnte. In seiner<br />
Autobiografie „Der lange Weg zur Freiheit“<br />
deutet Mandela an, dass das, was<br />
dort zu sehen wäre, nicht so wichtig sei.<br />
Er trat hinter die Sache zurück, für die er<br />
sein Leben lang kämpfte: die Überwindung<br />
der Apartheid.<br />
„Ich tat es einfach, weil ich nicht anders<br />
konnte“, schreibt er in seinen Erinnerungen.<br />
„Es war diese Sehnsucht nach der<br />
Freiheit meines Volkes, in Würde und<br />
Selbstachtung zu leben, die mein Leben<br />
beseelte.“<br />
Mandela empfand den Rassismus der<br />
weißen Herrenmenschen als schwere<br />
Kränkung. Er demonstrierte selbst in<br />
brenzligen Situationen seinen unerschütterlichen<br />
Stolz. Bei einer Straßenkontrolle<br />
brüllte ihn ein hellhäutiger Polizist in<br />
Afrikaans an, der Sprache der Buren:<br />
„Kaffer, jy sal kak vandag – Nigger, heute<br />
wirst du scheißen!“ Mandela konterte<br />
kaltschnäuzig: „Ich brauche keinen Polizisten,<br />
der mir sagt, wann ich scheiße!“<br />
Der Häftling Nr. 466/64, mit 45 Jahren<br />
eingeliefert, mit 71 Jahren entlassen, überstand<br />
die Kerkerzeit, weil er nie an sich<br />
und seiner Mission zweifelte: „Wir betrachteten<br />
den Kampf im Gefängnis als<br />
Mikrokosmos des Kampfes insgesamt.“<br />
„Er war der Inbegriff unseres Widerstands“,<br />
erzählte mir Indres Naidoo einmal,<br />
der als Häftling Nr. 885/63 zehn Jahre<br />
auf der Insel verbrachte. „Wir haben<br />
uns an Madiba aufgerichtet.“ Er sei eine<br />
natürliche Autorität gewesen, bewundert,<br />
aber wegen seiner moralischen Unerbittlichkeit<br />
auch gefürchtet. Und dennoch<br />
reinigte er wie jeder andere Insasse die<br />
Nachttöpfe von Wärtern und Häftlingen,<br />
wenn er dran war.<br />
Das Gefängnisregime wandte alle Schikanen<br />
an, um ihn körperlich und seelisch<br />
zu brechen und, so Mandela, „jenen Funken<br />
auszutreten, der uns zu Menschen<br />
macht“. Als die Regierung erkannte, dass<br />
man diesen Baum nicht biegen kann, beschloss<br />
sie, ihn zu fällen. Ein Geheimagent<br />
sollte einen Ausbruch inszenieren,<br />
bei dem die Wachmänner den Flüchtigen<br />
hätten erschießen können. Die Gefangenen<br />
aber durchschauten den Plan.<br />
James Gregory, ein Wächter, der Mandelas<br />
Briefe zensierte, erinnert sich, dass<br />
der Gefangene niemals Schwäche gezeigt<br />
und mit stoischer Selbstdisziplin Trauer,<br />
Schmerz, Zorn, Angst oder Bitterkeit verborgen<br />
habe. Die seelische Panzerung<br />
war seine Überlebensstrategie. Eines
1 2 3<br />
V.L.: LEON MULLER / SIPA PRESS; THEMBA HADEBE / AP; WOLF P. PRANGE<br />
1 Mandela mit Pop-Idol Michael Jackson<br />
1999<br />
2 Bei einem Treffen 2008 überreicht<br />
Fifa-Präsident Sepp Blatter ihm ein<br />
Replikat der Weltmeister-Trophäe<br />
3 Willy Brandt trifft Mandela 1990<br />
bei dessen Besuch in Bonn<br />
10<br />
9<br />
FELIBERTO CARRIE / RAPHO / GAMMA / GETTY IMAGES (U.); GUIDO BERGMANN / BUNDESREGIERUNG / REUTERS (O.)<br />
4 Bischof Desmond Tutu überreicht<br />
ihm 1998 den Abschlussbericht der<br />
Wahrheitskommission<br />
5 Mandela empfängt Rockstar Bono<br />
2002 in seinem Haus in Johannesburg<br />
6 Amerikas First Lady Michelle Obama<br />
besucht 2011 den Greis<br />
7 Südafrikas Präsident Jacob Zuma<br />
holt sich 2010 Rat bei seinem Amtsvorgänger<br />
8 Mit Queen Elizabeth 1996 in<br />
London<br />
9 Kuba besucht der Freiheitskämpfer<br />
1991. Dort empfängt ihn der „Máximo<br />
Líder“ Fidel Castro<br />
10 Bundeskanzlerin Angela Merkel<br />
trifft Mandela 2007 in Johannesburg<br />
4<br />
5<br />
JUDA NGWENYA / AFP (U.); WALTER DHLADHLA / AFP (O.)<br />
8<br />
7<br />
6<br />
V.L.: PHOTOSHOT / PICTURE-ALLIANCE / DPA; PICTURE-ALLIANCE / DPA;<br />
ABACA / FACE TO FACE<br />
DER SPIEGEL 50/2013 87
Tages aber schaute er in den Abgrund<br />
der Verzweiflung: Im Juli 1969, er trauerte<br />
noch um seine verstorbene Mutter, kam<br />
sein erster Sohn Madiba Thembekile bei<br />
einem Verkehrsunfall ums Leben. Mandela<br />
durfte natürlich nicht zur Beerdigung.<br />
In der Rückschau auf sein Leben<br />
klagt er: „In meinem Herzen blieb eine<br />
innere Leere zurück, die sich nie mehr<br />
ausfüllen lässt.“<br />
Im Widerstand hatte Mandela gelernt,<br />
in militärischen Kategorien zu denken.<br />
Er studierte Schriften, die mit Revolution<br />
und Kriegsführung zu tun hatten: Clause -<br />
witz, Mao, Che Guevara. Eines seiner<br />
Lieblingsbücher war „Die Kunst des Krieges“<br />
des chinesischen Feldherrn Sun Tzi.<br />
Darin findet sich einer seiner Leitgedanken:<br />
„Wenn du den Feind und dich selbst<br />
kennst, brauchst du das Ergebnis von hundert<br />
Schlachten nicht zu fürchten.“<br />
Mandela kannte seine Feinde genau.<br />
Er versetzte sich in sie hinein, er analysierte<br />
ihre Mentalität, ihre Sitten, und er<br />
lernte Afrikaans, die Sprache der Unterdrücker.<br />
Du musst deinen Gegner genau<br />
lesen – diesen taktischen Grundsatz hatte<br />
er bereits als junger Amateurboxer in Soweto<br />
verinnerlicht.<br />
Seine ärgsten Widersacher, die maßgeblichen<br />
Politiker und Generäle der<br />
Apartheid, kapitulierten schließlich vor<br />
diesem Zeitgenossen, der ihnen so kenntnisreich<br />
und hoheitsvoll, ja gebieterisch<br />
entgegentrat und dennoch eine entwaffnende<br />
Menschlichkeit ausstrahlte.<br />
Schon als kleiner Junge habe er beim<br />
Stockkampf gelernt, seine Gegner zu bezwingen,<br />
ohne sie zu entehren, schreibt<br />
Mandela in seinen Memoiren. Er wurde<br />
1918 im Gebiet Transkei geboren, man<br />
gab ihm den Namen Rolihlahla. Das bedeutet<br />
wörtlich „der, der am Zweig eines<br />
Baumes reißt“ und im übertragenen Sinn<br />
„Unruhestifter“.<br />
Die Erziehung an einem traditionellen<br />
Königshof prägte sein aristokratisches<br />
Selbstwertgefühl, er fühlt sich schon früh<br />
zum Herrscher geboren. Das spürten<br />
auch die weißen Gefängniswärter, die ihn<br />
anfänglich als „Kaffer“ beschimpft hatten.<br />
Am Ende redeten sie ihn mit „Mister<br />
Mandela“ an. Selbst Piet Badenhorst, der<br />
brutale Kommandant der Haftanstalt,<br />
streckte vor ihm die Waffen. „Er benahm<br />
sich wie eine Bestie, weil er für bestia -<br />
Titel<br />
lisches Verhalten belohnt wurde“, so Mandela.<br />
Auch Badenhorst habe einen „anständigen<br />
Kern“ gehabt. Mandela sprach<br />
vom „Schimmer der Humanität“ in jedem<br />
Menschen.<br />
Er sah auch die Weißen, die Rassisten,<br />
die Ausbeuter, die Folterknechte als Opfer<br />
einer verblendeten Ideologie: „Der<br />
Unterdrücker und der Unterdrückte sind<br />
gleichermaßen ihrer Freiheit beraubt.“<br />
Irgendwann in den Kerkerjahren führten<br />
die Gefangenen die „Antigone“ des<br />
Sophokles auf, ein Lehrstück über den<br />
Aufstand des Individuums gegen den ungerechten<br />
Staat: Der weise König Kreon<br />
wird im Ringen um Thebens Thron zum<br />
Tyrannen. Antigone lehnt sich gegen den<br />
Herrscher auf.<br />
„Antigone widersetzt sich, weil es ein<br />
höheres Gesetz als das des Staates gibt“,<br />
„Der Sport hat die Kraft,<br />
die Welt zu<br />
verändern. Er ist mächtiger<br />
als Regierungen.“<br />
schrieb Mandela, „sie war das Symbol<br />
für unseren Kampf.“ Die ungebildeten<br />
Wärter auf Robben Island begriffen nicht,<br />
dass die Häftlinge hinter dem Paravent<br />
der griechischen Tragödie über das System<br />
der Apartheid richteten. Mandela<br />
spielte den Kreon – eine Rolle über die<br />
Fehlbarkeit der Macht.<br />
Im wirklichen Staat erprobte er sich<br />
erstmals Ostern 1993. Nach der Ermordung<br />
des Kommunistenführers Chris<br />
Hani durch einen rechtsextremen Weißen<br />
waren in den Townships Unruhen ausgebrochen.<br />
Hunderttausende Schwarze riefen<br />
nach Rache, die ersten Weißen wurden<br />
gelyncht. Frederik Willem de Klerk,<br />
der letzte weiße Präsident Südafrikas,<br />
wirkte konfus und ratlos.<br />
Am Abend trat ANC-Chef Mandela im<br />
Fernsehen vor die Nation. „Heute spreche<br />
ich aus tiefstem Herzen zu jedem einzelnen<br />
Südafrikaner, schwarzen und weißen“,<br />
sagte er. Die Zeit sei gekommen,<br />
um zusammenzuhalten gegen die Kräfte,<br />
die die Freiheit zerstören wollen.<br />
Es war eine der eindringlichsten Reden,<br />
die Mandela je gehalten hat. Es gelang<br />
ihm, den drohenden Rassenkrieg abzuwenden.<br />
An diesem Abend wurde er zum<br />
wahren Präsidenten des neuen Südafrika,<br />
noch ehe ein einziger Wähler für ihn gestimmt<br />
hatte.<br />
Im April 1994, in der Endphase des<br />
Wahlkampfs, hatte Mandela seinen letzten<br />
großen Auftritt in KwaMashu, einer<br />
gewaltgeplagten Township bei Durban.<br />
Auf dem Weg dorthin geriet ich in eine<br />
Radarfalle.<br />
„Wohin so eilig?“, fragte der Polizist,<br />
ein Bure.<br />
„Zu Präsident Mandela“, sagte ich.<br />
„Was sagen Sie da? Mandela? Präsident?“<br />
Dann öffnete er ganz langsam sein<br />
Halfter, zog die Dienstpistole – und reichte<br />
sie mir durch das Autofenster. „Hier.<br />
Nehmen Sie die Waffe. Erledigen Sie die<br />
Sache für mich!“<br />
Das Ergebnis der ersten freien Wahlen<br />
in der Geschichte des Landes, an denen<br />
alle Bürger teilnehmen durften, stand von<br />
vornherein fest: Am 27. April 1994 bescherte<br />
die schwarze Bevölkerungsmehrheit<br />
Nelson Mandela einen überwältigenden<br />
Sieg. Die letzte Bastion der Kolo -<br />
nialherrschaft in Afrika war gefallen.<br />
Nelson Mandela vermied es aber, als<br />
Triumphator aufzutreten. Er beschwor<br />
vielmehr den Traum von der Regen -<br />
bogennation, von einer multiethnischen<br />
Gesellschaft, in der niemand mehr diskriminiert<br />
werden dürfe. Auch nicht die Weißen.<br />
Dennoch blieben viele Weiße zunächst<br />
argwöhnisch.<br />
Schon bald aber merkten sie, dass die<br />
neue Regierung sogar ihren im Unrechtssystem<br />
angehäuften Wohlstand und ihre<br />
Privilegien unangetastet ließ. Und weil<br />
ihnen die Versöhnungspolitik des Präsidenten<br />
auch noch das Gefühl der Schuld<br />
abnahm, betrachteten ihn viele Weiße<br />
bald gar als eine Art Schutzpatron.<br />
„Wat is verby, is verby“, sagte Mandela<br />
am Tage seiner Amtseinführung in Afrikaans:<br />
Vorbei ist vorbei.<br />
Schließlich konnte er sogar viele jener<br />
Weißen für sich einnehmen, die in Südafrika<br />
„verkrampt“ genannt werden:<br />
Ewiggestrige, die davon überzeugt waren,<br />
dass ihr schönes Land untergehen<br />
werde, sobald die Schwarzen die Macht<br />
übernehmen würden. Wieder schlug er<br />
den ehemaligen Feind mit den eigenen<br />
Nelson Mandela<br />
1939/1940<br />
18. Juli 1918<br />
Mandela wird<br />
in der südafrikanischen<br />
Kap-Provinz<br />
geboren.<br />
Anwalt<br />
Mandela<br />
Jurastudium<br />
an der Universität<br />
in Fort Hare<br />
Mai 1948<br />
Knapper Wahlsieg der<br />
Nationalen Partei.<br />
Beginn der Apartheid-<br />
Politik<br />
1944<br />
Beitritt zum Afrikanischen<br />
Nationalkongress (ANC)<br />
1952<br />
Mandela und<br />
Oliver Tambo eröffnen<br />
als erste<br />
Schwarze in<br />
Johannesburg<br />
eine Anwaltskanzlei.<br />
1956<br />
Prozessbeginn<br />
gegen Mandela<br />
und weitere 155<br />
Angeklagte wegen<br />
Hochverrats – alle<br />
werden 1961 freigesprochen.<br />
21. März 1960<br />
Beim Sharpeville-Massaker<br />
werden 69 Demonstranten<br />
erschossen.<br />
Anschließendes<br />
ANC-Verbot<br />
88<br />
1920<br />
AP<br />
1940<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Hobby-Boxer Mandela (l.) 1957<br />
BOB GOSANI / BAILEY'S<br />
31. Mai 1961<br />
Die südafrikanische<br />
Republik<br />
wird ausgerufen.<br />
Juni 1964<br />
Mandela wird im sogenannten<br />
Rivonia-Prozess<br />
zu lebenslanger Haft auf<br />
Robben Island verurteilt.<br />
Februar 1990<br />
Haftentlassung nach mehr<br />
als 27 Jahren<br />
A. TANNENBAUM<br />
1993<br />
Eine Übergangsverfassung wird verabschiedet;<br />
Mandela und Präsident<br />
Frederik Willem de Klerk erhalten<br />
gemeinsam den Friedensnobelpreis.<br />
1994 bis 1999<br />
Nach klarem Wahlsieg des ANC<br />
wird Nelson Mandela erster<br />
Präsident des neuen Südafrika.<br />
1970 Mit Ehefrau Winnie<br />
2000<br />
AP<br />
Mit Staatspräsident de Klerk<br />
2004<br />
Rückzug aus<br />
dem öffentlichen<br />
Leben<br />
5. Dezember<br />
2013<br />
Mandela stirbt<br />
im Alter von<br />
95 Jahren.<br />
89
Titel<br />
Am Ende des Regenbogens<br />
Wie der Afrikanische Nationalkongress das Erbe Nelson Mandelas ruiniert<br />
Schon als Säugling sollen den kleinen<br />
Siener van Rensburg seltsame<br />
Träume heimgesucht haben, Träume<br />
von der Zukunft seines Volkes. 1864<br />
in der heutigen Nordwest-Provinz als<br />
Sohn von Buren geboren, sah van Rensburg<br />
angeblich Katastrophen und Glücksfälle<br />
voraus – er wurde ein afrikanischer<br />
Nostradamus.<br />
Noch heute hat van Rensburg Anhänger,<br />
die aus seinen rund 700 überlieferten<br />
Visionen Erstaunliches meinen her -<br />
auslesen zu können: So soll er 1920 für<br />
die Zeit nach dem Tod Nelson Mandelas<br />
eine „Nag van die lang messe“ vorhergesagt<br />
haben, eine Nacht der langen<br />
Messer, in der die Schwarzen die Buren<br />
auslöschen würden.<br />
Eine solche Racheaktion hatten viele<br />
Weiße schon gleich nach dem Ende der<br />
Apartheid befürchtet. Heute glauben<br />
nur noch ausgesprochene Rassisten an<br />
so etwas, schreibt der Publizist und<br />
weiße Anti-Apartheid-Kämpfer Max du<br />
Preez. Außerdem: „Längst haben Klassen-Ressentiments<br />
die Rassen-Ressen -<br />
timents abgelöst.“<br />
Fast 20 Jahre nachdem Nelson Mandelas<br />
Afrikanischer Nationalkongress<br />
ANC die Vorherrschaft der Weißen gebrochen<br />
hat, kämpft das Land mit enormen<br />
wirtschaftlichen Problemen, verstärkt<br />
durch Korruption und Machtmissbrauch.<br />
Der Abstand zwischen den<br />
Ärmsten und den Reichsten in Süd -<br />
afrika ist extrem geworden, Dritte Welt<br />
und Erste existieren hier Tür an Tür.<br />
Experten schätzen die Arbeitslosigkeit<br />
auf mehr als 40 Prozent, Tendenz<br />
steigend. Und Schuld trägt vor allem<br />
der Nationalkongress, er regiert noch<br />
immer unangefochten, ist aber auf<br />
dem besten Weg, das politische Erbe<br />
seines berühmtesten Mitglieds zu verspielen.<br />
Die Partei Mandelas ist moralisch am<br />
Ende. Wie tief gespalten ihr Land mittlerweile<br />
ist, zeigte sich am deutlichsten,<br />
als im August 2012 schwarze Polizisten<br />
protestierende schwarze Arbeiter in<br />
der Marikana-Mine zusammenschossen.<br />
Das Gemetzel mit 36 Toten weckte Erinnerungen<br />
an die Massaker des Apartheid-Regimes.<br />
Bis jetzt hat die von der<br />
Regierung eingesetzte Untersuchungskommission<br />
nicht geklärt, wie es zu dem<br />
Blutvergießen kommen konnte.<br />
„Längst haben Klassen-<br />
Ressentiments<br />
die Rassen-Ressentiments<br />
abgelöst.“<br />
Heute gilt das Kürzel ANC als Syn -<br />
onym für schlechte Amtsführung, für<br />
Vetternwirtschaft, Inkompetenz, Bestechlichkeit.<br />
Besonders innerhalb der<br />
„born free“-Generation – unter jenen<br />
jungen Menschen also, die die Zeit der<br />
Rassentrennung nicht miterlebt haben –<br />
verblasst der historische Nimbus des<br />
Sieges über die weißen Buren.<br />
Mandelas Nachfolger als Präsident,<br />
Jacob Zuma, steht wie kaum ein anderer<br />
für das neue, schlechte Image des<br />
ANC: Seine Privatvilla ließ er mit Hubschrauberlandeplatz,<br />
Tennis-Courts und<br />
anderem Luxus ausstatten, für umgerechnet<br />
bis zu 25 Millionen Euro aus<br />
Steuer geldern.<br />
Schon vor seinem Amtsantritt stand<br />
Zuma, der einst mit Mandela auf Robben<br />
Island in Haft gesessen hatte, wegen<br />
Vergewaltigung vor Gericht. Ein<br />
Korruptionsverfahren wurde gerade<br />
noch rechtzeitig vor der Wahl eingestellt.<br />
Schlagzeilen machte auch Zumas<br />
Empfehlung, dass man nach dem Geschlechtsverkehr<br />
nur heiß duschen<br />
müsse, um einer HIV-Infektion vorzubeugen.<br />
Trotz allem wählte der ANC Zuma<br />
vor einem Jahr mit großer Mehrheit<br />
wieder zum Vorsitzenden. Damit ist ihm<br />
eine zweite Amtszeit auch als Präsident<br />
des Landes praktisch sicher. Innerparteiliche<br />
Gegner wie den Vizepräsidenten<br />
Kgalema Motlanthe hat Zuma kaltgestellt,<br />
seine Gefolgsleute beherrschen<br />
den Sicherheitsapparat und wichtige<br />
Stellen in der Justiz.<br />
Bis heute hat der Nationalkongress<br />
den Sprung in die moderne Demokratie<br />
nicht geschafft, er agiert immer noch<br />
wie eine konspirative Kampforganisa -<br />
tion: Nach außen demonstriert er Einheit,<br />
im Innern kennt die Partei keinen<br />
offenen Wettstreit der Argumente. Wer<br />
auf Wahllisten landet, wer ein lukratives<br />
Amt erhält – all das kungeln die Parteioberen<br />
aus.<br />
ANC-Leute haben sich Schlüssel -<br />
positionen im Staatsapparat und vor<br />
allem in der Wirtschaft gesichert. Das<br />
ANC-Programm des „Black Economic<br />
Empowerment“ war einst dafür gedacht,<br />
den Schwarzen Teilhabe am nationalen<br />
Reichtum zu sichern. Wo immer beispielsweise<br />
Schürflizenzen oder öffentliche<br />
Aufträge zu vergeben waren, sollten<br />
Firmen von Schwarzen bevorzugt<br />
werden. Doch in Wirklichkeit wurde dadurch<br />
eine kleine Schicht treuer Parteigänger<br />
unermesslich reich. In manchen<br />
Provinzen würden mehr als 70 Prozent<br />
der öffentlichen Aufträge von ANC-Poli -<br />
tikern an Verwandte oder Freunde vergeben,<br />
schätzen Experten.<br />
Immer wieder decken Zeitungen neue<br />
Skandale auf. Deshalb brachte der ANC<br />
unlängst ein Gesetz „zum Schutz staatlicher<br />
Informationen“ durch das Parlament.<br />
Dessen Paragrafen sind so elastisch gestaltet,<br />
dass kritische Berichterstattung<br />
damit unmöglich gemacht werden kann.<br />
Aus Protest erschienen Zeitungen wie<br />
der eigentlich loyale „Sowetan“ mit geschwärzten<br />
Seiten. Das Gesetz wurde dar -<br />
aufhin wenigstens teilweise entschärft.<br />
Eine Schmach wurde der Regierungspartei<br />
im März in der Zentralafrikanischen<br />
Republik beigebracht, als Rebellen<br />
dort den korrupten Präsidenten<br />
François Bozizé stürzten: Auf dem Weg<br />
zu dessen Palast töteten sie 13 südafrikanische<br />
Soldaten. Eine Tragödie, aber<br />
auch ein Skandal – denn was hatten<br />
Südafrikas Kämpfer dort zu suchen?<br />
Die Soldaten seien auf einer Ausbildungsmission<br />
gewesen, hieß es offiziell<br />
vom ANC. Im Übrigen solle es die Presse<br />
unterlassen, „auf die Gräber der toten<br />
Soldaten zu urinieren“ – etwa indem<br />
sie spekuliere, ob der ANC die Männer<br />
nicht doch eher entsandt haben könnte,<br />
um die Geschäftsinteressen einiger<br />
schwarzer Unternehmer in dem rohstoffreichen<br />
Land zu sichern.<br />
Noch gewinnt der ANC trotz solcher<br />
Vorwürfe landesweite Wahlen, doch<br />
kann er sich seiner Mehrheiten immer<br />
weniger sicher sein: Die Demokratische<br />
Allianz unter Führung der Weißen<br />
Helen Zille hat ihm die Provinz um<br />
Kapstadt bereits abgejagt.<br />
Mamphela Ramphele, eine populäre<br />
Armenärztin, hat angekündigt, 2014 mit<br />
der neuen Formation Agang – „Wir bau-<br />
GAMMA / STUDIO X (O.); ALON SKUY / POLARIS / LAIF (U.)<br />
90<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Polizeieinsatz gegen Schwarze in Johannesburg 1984: Rassistische Diktatur<br />
Massaker in der Marikana-Mine 2012: Ein tiefgespaltenes Land<br />
en auf“ – gegen den ANC antreten zu<br />
wollen. Die 65-Jährige war einst die<br />
Freundin des Anti-Apartheid-Aktivisten<br />
Steve Biko. 1977 hatten Polizisten Biko<br />
totgeprü gelt – und damit die ganze Welt<br />
gegen die rassistische Diktatur Südafrikas<br />
aufgebracht.<br />
„Die Großartigkeit unserer Gesellschaft<br />
wird von massivem Regierungsversagen<br />
untergraben“, sagt Ramphele:<br />
„Unser Land hat die moralische Autorität<br />
und den internationalen Respekt<br />
verloren, den es genoss, als es eine Demokratie<br />
wurde.“<br />
Im Mai wandte sich noch ein weiterer<br />
Weggefährte Mandelas von der<br />
Partei ab – und das schmerzt beson -<br />
ders, denn der Mann ist selbst eine<br />
Legende, eine Autorität. „Ich werde<br />
den ANC nicht wiederwählen“, sagte<br />
Desmond Tutu, Südafrikas schwarzer<br />
Erzbischof.<br />
JAN PUHL<br />
Waffen. Er gewann die Schlacht auf dem<br />
Rugbyfeld, beim Weltcup in Südafrika.<br />
„Der Sport hat die Kraft, die Welt zu<br />
verändern … Er ist mächtiger als Regierungen,<br />
wenn es darum geht, Rassenschranken<br />
niederzureißen“, erklärte Mandela.<br />
Er hatte sich auf das Endspiel gegen<br />
Neuseeland am 24. Juni 1995 vorbereitet,<br />
denn er wusste, dass ihm an diesem Tag<br />
die Herzen aller Landsleute zufliegen<br />
könnten. So kam es dann auch.<br />
Das Rugby-Team von Südafrika wurde<br />
Weltmeister. In den Townships jubelten<br />
Millionen Schwarze den einst so verhassten<br />
weißen Nationalspielern zu – und die<br />
Weißen im Stadion feierten zum ersten<br />
Mal frenetisch ihren Präsidenten, der im<br />
gold-grünen Trikot der Nationalmannschaft<br />
die Trophäe überreichte.<br />
Mandelas Nachsicht mit Tätern der<br />
Apartheid verstörte allerdings seine radikalen<br />
Weggefährten, und sein Schmusekurs<br />
nach dem Machtwechsel ging auch<br />
gemäßigten Freunden manchmal zu weit.<br />
Er lud sogar Percy Yutar zum Essen ein,<br />
den Staatsanwalt, der 1964 seinen Tod<br />
durch den Strang gefordert hatte.<br />
Mandela sagte mir bei unserem Gespräch<br />
in Genadendal: „Wir brauchen die<br />
Weißen für den Wiederaufbau und wollen<br />
ihnen die Unsicherheit nehmen.“ Er<br />
machte deutlich, wie prekär die Lage vor<br />
der Wende war. „Wir mussten unbedingt<br />
verhindern, dass die rechten Weißen einen<br />
Bürgerkrieg entfachen. Es ist daher<br />
von höchster Wichtigkeit, die Frage der<br />
Versöhnung immer wieder zu betonen.“<br />
Vermutlich gibt es nur einen Menschen,<br />
dem der alte Mann nicht verzeihen konnte<br />
– es war ausgerechnet jener Mensch,<br />
den er einst abgöttisch geliebt hatte: seine<br />
Ehefrau Winnie Madikizela-Mandela. Im<br />
Allmachtswahn hatte sie in der blutigsten<br />
Phase des Widerstandskampfs zur Lynchjustiz<br />
aufgerufen und eine Schlägerbande<br />
um sich geschart.<br />
Mandela warf Winnie „mangelhafte<br />
Urteilskraft“ vor, hielt aber an ihrer Unschuld<br />
fest. Erst beim Scheidungsprozess<br />
im März 1996 bekannte er: „Selbst wenn<br />
das gesamte Universum versuchen würde,<br />
mich zu überreden, mich mit der Beklagten<br />
zu versöhnen, ich würde es nicht.“<br />
War die größte Liebe seines Lebens am<br />
Ende die bitterste Enttäuschung? Winnie<br />
Mandela hatte einige Affären, als ihr<br />
Mann im Gefängnis saß. Nach seiner Freilassung<br />
schliefen sie in getrennten Betten,<br />
hieß es. Mandela hat nicht mehr über dieses<br />
Thema geredet, auch in seiner Autobiografie<br />
schweigt er darüber. Beim Begräbnis<br />
seines Freundes Oliver Tambo<br />
machte er eine Andeutung über seinen<br />
Gram. „Wir bluten aus unsichtbaren Wunden,<br />
die so schwer zu heilen sind.“ Bei<br />
solchen Gelegenheiten wirkte sein Lächeln<br />
wie eine Maske.<br />
Bis heute gibt es keinen kritischen<br />
Rückblick auf das Leben Mandelas, die<br />
DER SPIEGEL 50/2013 91
Titel<br />
BEN CURTIS / AP / DPA<br />
Mandela-Anhänger am vergangenen Freitag in Soweto: Er wollte begraben werden in dem Dorf seiner Ahnen<br />
meisten Biografen bewunderten ihn.<br />
Aber der Heilige, Unfehlbare, den manche<br />
aus ihm machten, war Mandela nie.<br />
Er konnte dickköpfig, selbstgerecht<br />
und uneinsichtig sein, auch von Wutausbrüchen<br />
berichten Mitarbeiter. Mandela<br />
war in jungen Jahren ein Feuerkopf, aufbrausend,<br />
wildentschlossen, kompromisslos,<br />
gelegentlich brachen diese Charakterzüge<br />
noch im alten Mann durch.<br />
Unvergesslich, wie er tobte, als Präsident<br />
de Klerk die Demokratieverhandlungen<br />
beinahe zum Scheitern brachte. Mandela<br />
konnte den kantigen Buren ohnehin<br />
nie leiden und empfand es offenbar als<br />
Zumutung, dass er den Friedensnobelpreis<br />
1993 mit ihm teilen musste.<br />
Mandela ließ zudem Leute kalt fallen,<br />
die nicht seine Ansichten goutierten. Er<br />
sprach gern von kollektiver Führung, regierte<br />
aber eigensinnig. Seine Genossen<br />
haben oft kritisiert, dass er etwa die Aufnahme<br />
von Geheimverhandlungen mit<br />
dem Apartheid-Regime im Juli 1986 ohne<br />
Absprache mit der ANC-Führung beschlossen<br />
hatte.<br />
Mandela verwendete dann gern das<br />
Sinnbild vom guten Hirten: „Es gibt<br />
Zeiten, in denen ein Führer der Herde<br />
vor angehen muss.“<br />
Manchmal zweifelte er sogar an den<br />
Fähigkeiten der Afrikaner: Als er in ein<br />
92<br />
Flugzeug der Ethiopian Air einsteigen<br />
sollte, das von einem schwarzen Piloten<br />
gesteuert wurde, überkam ihn ein Gefühl<br />
der Panik.<br />
Der Superstar war empfänglich für<br />
Schmeicheleien und liebte glamouröse<br />
Ereignisse, bei denen er im Mittelpunkt<br />
stand. „Es ist gut zu wissen, dass er auch<br />
nur ein Mensch ist“, sagte Erzbischof<br />
Tutu einmal.<br />
Am Ende seiner Amtszeit im Juni 1999<br />
setzte Präsident Mandela ein letztes politisches<br />
Zeichen gegen die autoritären<br />
Herrscher Afrikas, die üblicherweise bis<br />
zum Tod nicht von der Macht lassen: Er<br />
trat aus freien Stücken zurück.<br />
Am Abend seines Lebens wollte Nelson<br />
Mandela nur noch seine Ruhe haben.<br />
Die Massenhysterie, der Heiligenkult, es<br />
sei ihm alles zu viel geworden, sagen<br />
Vertraute. Er saß im Garten seiner Villa<br />
in Johannesburg, las, spielte mit den<br />
Enkelkindern und schaute den Luftballons<br />
nach, die sie in die Wolken steigen<br />
ließen.<br />
Oft zog es ihn in sein Heimatdorf in<br />
der Provinz Ostkap, nach Qunu: eine<br />
Streusiedlung, ringsum grüne Hügel – das<br />
alte Afrika, in dem es bis heute keine<br />
Zäune gibt.<br />
Beim Anblick dieser elegischen Landschaft<br />
ahnt man, wie frei er sich als Junge<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
gefühlt haben muss. Er hütete das Vieh,<br />
jagte Vögel mit der Steinschleuder, und<br />
da ist auch noch die spiegelglatte Rinne<br />
in einem Felsen, durch die er und seine<br />
Spielkameraden zu Tal rutschten.<br />
In Qunu beginnt und endet Nelson<br />
Mandelas Lebenskreis, hier wollte er<br />
begraben werden, in dem Dorf seiner<br />
Ahnen.<br />
Dieser Mann hat das Wunder vollbracht,<br />
sein hasszerfressenes Land gewaltfrei<br />
von der Apartheid in die Demokratie<br />
zu führen und den Rassenwahn zu<br />
überwinden. Er war für die Südafrikaner,<br />
was Simón Bolívar für die Latein -<br />
amerikaner, Mahatma Gandhi für die<br />
Inder oder Martin Luther King für die<br />
Afroamerikaner war – ein Freiheitskämpfer,<br />
der wie eine Lichtgestalt aus der<br />
Finsternis kam. Wie Barack Obama<br />
schenkte er den Schwarzen in aller Welt<br />
Selbstwertgefühl: Schaut her, wir können<br />
es auch.<br />
„Ich nähere mich meinem Ende“, sagte<br />
er vor Jahren schon, „ich möchte bis in<br />
alle Ewigkeit mit einem Lächeln auf meinem<br />
Gesicht schlafen.“<br />
Video: Eine Begegnung mit<br />
Nelson Mandela<br />
spiegel.de/app502013mandela<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Ausland<br />
UKRAINE<br />
Die Machtprobe<br />
Die Opposition mit dem Boxer Vitali Klitschko heizt den Aufstand gegen die Regierung an,<br />
hat aber keinen Plan dafür, wie es weitergehen soll.<br />
Die Führung in Kiew gibt sich siegesgewiss und verschärft den Ton.<br />
GENYA SAVILOV / AFP<br />
Demonstrantin am vorigen Montag auf<br />
dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew
Die Hilflosigkeit spricht aus jedem<br />
Satz, den Außenminister Guido<br />
Westerwelle in der Lobby des Kiewer<br />
Fünf-Sterne-Hotels Hyatt sagt. Dass<br />
die „Tür nach Europa“ für die Ukraine<br />
„offen steht“, dass es „gemeinsame europäische<br />
Werte“ gebe, dass die Ukraine<br />
„den Deutschen nicht gleichgültig“ sei, ja<br />
„kulturell und historisch“ zum alten Kontinent<br />
gehöre. Dann ruft er den Ukrainern<br />
ein „Thank you so much“ zu und<br />
geht auf die Straße.<br />
Es ist bereits dunkel, Westerwelle<br />
nimmt den Weg vom Michaels-Kloster<br />
hin unter in Richtung des Maidan, des Unabhängigkeitsplatzes.<br />
Rechts neben ihm<br />
geht Vitali Klitschko von der Oppositions -<br />
partei Udar, links Arsenij Jazenjuk, einst<br />
ebenfalls Außenminister, jetzt amtierender<br />
Vorsitzender der Vaterlandspartei – am -<br />
tierend deshalb, weil Parteichefin Julija<br />
Timoschenko im Gefängnis sitzt. Der<br />
Bruder Wladimir Klitschko ist auch dabei.<br />
„Es war ein gutes Gespräch mit Westerwelle“,<br />
sagt er. „Aber was soll dabei<br />
her auskommen?“<br />
„Klitschko, Klitschko“, rufen die Leute<br />
auf dem Bürgersteig den beiden Boxer-<br />
Riesen zu, aber den kleinen Mann daneben,<br />
der die Hände in den Taschen seines<br />
schwarzen Mantels vergraben hat, kennen<br />
sie nicht. „Ich war jüngst erst hier, da<br />
schien alles noch gut“, sagt Westerwelle<br />
zu Vitali Klitschko. „Jetzt sind wir überrascht.“<br />
Mehr Ehrlichkeit ist kaum möglich.<br />
In dem Moment schieben Leibwächter<br />
und Fotografen den Minister in das Gedränge<br />
auf dem Platz im Zentrum Kiews,<br />
auf dem in diesen Tagen wieder einmal<br />
Geschichte geschrieben wird.<br />
Es ist der fünfte Tag des Aufstands gegen<br />
Präsident Wiktor Janukowitsch. Er begann,<br />
als der Staatschef vom EU-Gipfel<br />
aus Vilnius zurückkam, ohne den fertig<br />
ausgearbeiteten Assoziierungsvertrag mit<br />
der EU unterschrieben zu haben. Die<br />
Ukraine wolle sich wieder Russland zuwenden,<br />
kündigte Janukowitsch an. Gleich<br />
danach zogen die ersten Demon stranten,<br />
die sich nun um ihre Zukunft betrogen<br />
fühlen, auf den Maidan; sie nennen den<br />
Platz jetzt „Euro-Maidan“.<br />
Fünf Tage, das reicht selbst für eine<br />
spontane Revolution, um sich einzurichten.<br />
Vor der besetzten Stadtverwaltung<br />
stehen Toilettenhäuschen in Reih und<br />
Glied, Barrikaden sind aufgeschichtet, in<br />
Zelten empfangen Parlamentarier der<br />
Opposition das Volk zum Gespräch, auf<br />
Unterschriftenlisten wird der Rücktritt<br />
Janukowitschs und seiner Regierung gefordert.<br />
An die 20000 Protestler sind es jetzt,<br />
nicht mehr Hunderttausende, es ist ein<br />
Werktag. Sie haben die blau-gelbe Staatsflagge<br />
um ihre Schultern gewickelt; es ist<br />
kalt, in den Krankenwagen am Rande des<br />
Platzes werden bereits erfrorene Zehen<br />
behandelt. Ein Mann aus dem westukrainischen<br />
Lemberg bietet aus Kartons her -<br />
aus indischen Hustensaft an: „Ich hab das<br />
privat bezahlt“, sagt er, „wir müssen ja<br />
durchhalten.“ Über dem Platz liegt<br />
der beißende Rauch der Holzfeuer und<br />
Gulaschkanonen – der Geruch aller post -<br />
sowjetischen Revolutionen.<br />
Die Leute sind gutgelaunt, sie rufen<br />
„Ruhm der Ukraine“ und „Ohne Janukowitsch<br />
nach Europa!“. Aber bis nach<br />
Europa ist es für sie noch weit. Premierminister<br />
Nikolai Asarow hat gerade erklärt,<br />
dass er viele der Protestler auf dem<br />
Maidan für „Nazis, Extremisten und Kriminelle“<br />
hält.<br />
Der Ton der ukrainischen Führung hat<br />
sich verschärft – ein Zeichen dafür, dass<br />
sich Janukowitsch und seine Leute bereits<br />
als Sieger wähnen. Die Polizei hat erklärt,<br />
sie gebe den Demonstranten noch bis<br />
Dienstag Zeit, um die Blockade der Regierungsgebäude<br />
zu beenden. „Wir sind<br />
stark genug, um uns zu wehren“, bekräftigt<br />
der Premier.<br />
Asarow macht im Moment die<br />
Schmutzarbeit, Staatschef Janukowitsch<br />
ist in China unterwegs. Der Premier droht<br />
und blufft, gerade erst hat er die ausländischen<br />
Botschafter belogen. Kiews Polizeichef<br />
sei wegen der gewaltsamen Räumung<br />
des Maidan am vorvorigen Wochenende<br />
entlassen worden, hat er ihnen<br />
bei einem Treffen gesagt. Das Innen -<br />
ministerium dementierte.<br />
Janukowitsch hat den brutalen Polizeieinsatz<br />
verurteilt, bei dem die Spezial -<br />
einheit „Berkut“ am frühen Samstag -<br />
morgen die auf dem Platz verbliebenen<br />
Demonstranten zusammenknüppelte. Aber<br />
Verantwortung übernommen oder sich<br />
gar entschuldigt hat er nicht. Er fühlt sich<br />
wieder sicherer als in den Tagen zuvor.<br />
Denn für kurze Zeit war im Regierungslager<br />
Panik ausgebrochen. Dass 200000<br />
Menschen wegen der Absage an die EU<br />
auf die Straße gehen würden, das hatte<br />
dort niemand erwartet. Der Kanzleichef<br />
des Präsidenten reichte den Rücktritt ein.<br />
Und in Janukowitschs Partei waberten<br />
Gerüchte, 20 Abgeordnete wollten zur<br />
Opposition überlaufen. Es kam aber anders<br />
– weil die Machthaber schnell die<br />
Schwächen der Opposition erkannten<br />
und nutzten.<br />
„Zu versuchen, die Regierung mit Hilfe<br />
eines Misstrauensantrags im Parlament<br />
zu stürzen – das war ein Fehler“, sagt<br />
Mustafa Nayem. „In diesem Moment verstand<br />
die andere Seite: Die Leute um<br />
Klitschko und Jazenjuk wollen keinen<br />
Krieg. So haben sie ihre eigene Partei<br />
schnell wieder in den Griff bekommen.“<br />
Die Opposition erreichte nicht mal die<br />
erwarteten 195 Stimmen.<br />
Dass 200 000 Menschen wegen der Absage an die EU<br />
auf die Straße gehen würden, hatte niemand erwartet.<br />
Nayem ist 32 Jahre alt, Ukrainer mit<br />
afghanischen Wurzeln und einer der bekanntesten<br />
Fernsehmoderatoren des Landes.<br />
Zusammen mit sieben prominenten<br />
Kollegen hat er Hromadske.tv gegründet,<br />
einen Internetsender, der nun auch live<br />
von den Schauplätzen der Unruhen berichtet.<br />
„Es ist das erste Mal, dass wir Ukrainer<br />
für etwas demonstrieren“, sagt Nayem:<br />
„Nämlich für die Annäherung an die EU,<br />
nicht gegen irgendetwas. Aber ich habe<br />
ein total ungutes Gefühl: Die Opposition<br />
hat die Planke extrem hoch gelegt, sie ist<br />
zur Geisel der Straße geworden.“<br />
Dann erzählt der Mann mit der Glatze<br />
und dem Kinnbart, wie sie neulich mit<br />
Klitschko und Jazenjuk zusammensaßen<br />
und die beiden selbst nicht dar an geglaubt<br />
hätten, dass nach der fehlgeschlagenen<br />
Orangen Revolution noch einmal<br />
Hunderttausende auf die Straße gehen<br />
würden. „Nun stehen sie da und haben<br />
Angst vor den Demonstranten, sie wollen<br />
keine Verantwortung übernehmen. Statt<br />
Wichtige Ereignisse in der Ukraine<br />
1991<br />
Unabhängigkeit<br />
In einem Referendum<br />
bestätigen<br />
92 Prozent der<br />
Wähler den Parlamentsentscheid<br />
zum Austritt aus<br />
der Sowjetunion.<br />
2004<br />
Orange Revolution<br />
Nach wochenlangen friedlichen<br />
Protesten gegen<br />
Wahlfälschung gewinnt<br />
Wiktor Juschtschenko<br />
die wiederholte Präsidentenwahl<br />
gegen den moskautreuen<br />
Wiktor Janukowitsch.<br />
2009<br />
Boykott<br />
Im Januar stoppt Moskau<br />
alle Gaslieferungen in die<br />
Ukraine.<br />
Östliche Partnerschaft<br />
Im Mai bietet die EU<br />
der Ukraine eine engere<br />
Zusammenarbeit an.<br />
2010<br />
Präsidentenwahl<br />
Wiktor Janukowitsch<br />
gewinnt<br />
in einer Stichwahl<br />
gegen<br />
die Ministerpräsidentin<br />
Julija<br />
Timoschenko.<br />
2011<br />
Timoschenko in Haft<br />
Ein Gericht verurteilt<br />
die Ex-Regierungschefin<br />
wegen Amtsmissbrauchs<br />
bei<br />
einem Gasgeschäft<br />
mit Russland zu<br />
sieben Jahren Haft.<br />
2013<br />
Großdemos<br />
Seit Ende November<br />
protestieren Hunderttausende<br />
gegen die<br />
Entscheidung der<br />
Regierung, das Assoziierungsabkommen<br />
mit der EU abzulehnen.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 95
alle Brücken hinter sich abzubrennen,<br />
sind sie ins Parlament gegangen.“ Das Janukowitsch-Lager<br />
habe schnell gemerkt,<br />
dass die Opposition keine Ahnung habe,<br />
wie sie weiter agieren solle. „Die alte Regierung<br />
mit legalen Mitteln abzulösen ist<br />
bis Februar nicht mehr möglich, erst dann<br />
könnte man das Misstrauensvotum wiederholen.<br />
Es bleibt also nur die Straße.“<br />
Nach außen hin lassen sich Klitschko<br />
und seine Mitstreiter nicht anmerken,<br />
dass sie in der neuen Schlacht um die<br />
Ukraine nach Punkten zurückliegen. Je<br />
lauter die Leute auf dem Maidan nach einem<br />
Plan für die nächsten Tage rufen,<br />
desto martialischer geben sich die Oppositionsführer.<br />
Im „Stab des nationalen Widerstands“<br />
im Gewerkschaftshaus kündigen<br />
sie an, den Aufstand auf den Osten<br />
und Süden der Ukraine auszuweiten, wo<br />
das Gros der Janukowitsch-Anhänger<br />
lebt. Sie wollen jetzt auch das Innen -<br />
ministerium, die Gerichte und den Sicherheitsrat<br />
blockieren. „Wir haben Janukowitsch<br />
noch zwei Tage gegeben. Tritt die<br />
Regierung dann immer noch nicht zurück,<br />
legen wir auch die letzten Staatsorgane<br />
lahm“, sagt ein Sprecher der Timoschenko-Partei.<br />
Die Frage ist nur, wie viele Leute in<br />
der zweiten Woche der Revolution noch<br />
auf dem Maidan sein werden. „Viele Forderungen<br />
der Opposition sind unrealistisch“,<br />
sagt Nayem. „Die Männer an ihrer<br />
Spitze haben keine politische Erfahrung,<br />
und sie misstrauen einander. Klitschko<br />
lebt nur von seiner Popularität und der<br />
Schlagkraft seiner Fäuste, ihm fehlen der<br />
Wille zur Macht und die Entschlossenheit<br />
einer Julija Timoschenko.“<br />
Am vergangenen Freitag, Staatschef<br />
Janukowitsch hat nach seiner China-Reise<br />
noch einen Abstecher zu Wladimir Putin<br />
in Sotschi gemacht, kommt auf dem<br />
Maidan Ratlosigkeit auf. Niemand weiß<br />
so richtig, wie es weitergehen soll. Es war<br />
ein Fehler, schreiben inzwischen selbst<br />
die mit der Opposition sympathisierenden<br />
Zeitungen, dass diese sich nicht von<br />
Beginn an auf einen einzigen Anführer<br />
einigte: Die Regierung behauptet nun,<br />
keinen Ansprechpartner zu haben. Sie<br />
wolle mit der Gegenseite auch nicht reden,<br />
solange diese Ultimaten stelle.<br />
So wird der Aufstand wohl mit einem<br />
Scheinkompromiss enden. Janukowitsch<br />
könnte zu einem Runden Tisch einladen,<br />
unter Vermittlung des Europarats. Er lässt<br />
aber schon jetzt ausrichten, dass er so etwas<br />
nur tun werde, wenn die Regierungsgebäude<br />
nicht mehr blockiert würden.<br />
Die Opposition müsste also alle ihre Anhänger<br />
nach Hause schicken – ihre einzige<br />
scharfe Waffe.<br />
CHRISTIAN NEEF<br />
96<br />
Video:<br />
Die Wütenden<br />
spiegel.de/app502013ukraine<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
PIOTR MALECKI / DER SPIEGEL<br />
Vermittler Kwaśniewski: „Der Westen unterschätzt Russlands Entschlossenheit“<br />
SPIEGEL-GESPRÄCH<br />
„Brüssel war naiv“<br />
Aleksander Kwaśniewski hat mit Kiew über die Assoziierung<br />
verhandelt. Jetzt kritisiert er die Fehler der EU – und<br />
Regierungschef Janukowitsch, der sein Volk ignorierte.<br />
Kwaśniewski, 59, empfängt in seinem Warschauer<br />
Büro, aber er ist auf dem Sprung<br />
nach Brüssel. Zehn Jahre lang – von 1995<br />
bis 2005 – war er Polens Präsident, er hat<br />
sein Land in die Nato und die EU geführt.<br />
Nun spricht er im Auftrag der EU mit der<br />
Ukraine; gemeinsam mit Pat Cox, dem<br />
früheren Präsidenten des Europäischen<br />
Parlaments, sollte Kwaś niewski helfen,<br />
das zweitgrößte Land des Kontinents auf<br />
eine Assoziierung mit der Union vor -<br />
zubereiten. Seit die ukrainische Führung<br />
das Abkommen Ende November platzen<br />
ließ, blockieren Hunderttausende das Zentrum<br />
Kiews. Man werde die Proeuropäer<br />
in der Ukraine nicht allein lassen, hat<br />
Kwaśniewski gesagt – und sich damit den<br />
Vorwurf aus Moskau eingehandelt, er rufe<br />
die Opposition zum Staatsstreich auf.<br />
SPIEGEL: Herr Kwaśniewski, wer in diesen<br />
Tagen nach Kiew kommt, erlebt ein Déjàvu:<br />
Wieder ist Dezember, wieder sind<br />
Zehntausende auf der Straße, wieder auf<br />
dem Maidan – wie 2004 bei der Orange<br />
Revolution. Warum kommt die Ukraine<br />
nicht voran?<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Kwaśniewski: Ich war 2004 auch in Kiew,<br />
und allein in den vergangenen Monaten<br />
27-mal. Ich erlebe ebenfalls ein Déjà-vu.<br />
Die Ukrainer haben in diesen neun Jahren<br />
viele Chancen verpasst. Statt Reformen<br />
durchzuführen und sich Europa anzunähern,<br />
haben der damalige Präsident Wiktor<br />
Juschtschenko und seine Regierungschefin<br />
Julija Timoschenko viel Energie in internen<br />
Kämpfen vergeudet. Dann kam Wiktor<br />
Janukowitsch an die Macht, und auch<br />
das schaffte keine grundsätzlichen Reformen<br />
in Richtung Demokratie und beim<br />
Umbau der Wirtschaft. Deswegen ist die<br />
Gesellschaft enttäuscht und tief gespalten.<br />
SPIEGEL: 2004 ging es um Wahlfälschung,<br />
mit deren Hilfe Janukowitsch ins Amt gehievt<br />
werden sollte. Diesmal dagegen<br />
geht es um Geopolitik: Der Assoziierungsvertrag<br />
mit der EU wurde von Moskau<br />
und Russlandtreuen in der Ukraine<br />
als Kriegserklärung verstanden.<br />
Kwaśniewski: Diesmal ist die Situation<br />
schwieriger als 2004. Jetzt hat Janukowitsch<br />
ein legales Mandat als Präsident<br />
und die Regierung eine gültige Parlamentsmehrheit.<br />
Doch die Frage, ob man
Ausland<br />
sich der EU annähern soll, spaltet die<br />
Ukrainer: Eine Mehrheit ist dafür, 15 bis<br />
20 Prozent sind für eine Union mit Russland,<br />
der Rest hat keine Meinung. Die Entscheidung,<br />
die Janukowitsch kurz vor<br />
dem EU-Gipfel in Vilnius fällte, nämlich<br />
Brüssel einen Korb zu geben, kam überraschend.<br />
Er hat sie seinem Volk nicht erklärt<br />
und offenbar geglaubt, die Leute<br />
würden das nicht so wichtig nehmen.<br />
SPIEGEL: Dabei ging es um nicht weniger<br />
als den künftigen Kurs der Ukraine.<br />
Kwaśniewski: Deswegen sind die Reaktionen<br />
jetzt so konträr. Die Leute in Sewa -<br />
stopol wollen, dass Russland militärisch<br />
eingreift, denn auf der Krim ist die Mehrheit<br />
der Bevölkerung russisch. Und dann<br />
gibt es Orte wie Lemberg, die proeuropäischste<br />
Stadt des Landes, wo der Bürgermeister<br />
sich nicht mehr der Zentralmacht<br />
unterordnen will. Nach 22 Jahren<br />
Unabhängigkeit, nach all den Frustrationen<br />
ist die Frage, ob Kiew sich Russland<br />
oder der EU zuwendet, alles andere als<br />
abstrakt, vor allem für junge Leute.<br />
SPIEGEL: Die Regierung unterstellt den proeuropäischen<br />
Demonstranten auf dem<br />
Maidan, sie würden einen Putsch vorbereiten.<br />
Da fehlt nicht viel zur Eskalation.<br />
Kwaśniewski: Nachdem der Misstrauensantrag<br />
gegen die Regierung gescheitert<br />
ist, könnte es passieren, dass die Protestler<br />
müde werden. Und das wiederum<br />
könnte das Signal für die Ordnungskräfte<br />
sein, Gewalt anzuwenden.<br />
SPIEGEL: Wie würde die EU reagieren?<br />
Kwaśniewski: Sie muss beide Seiten dazu<br />
bringen, auf Gewalt zu verzichten, und<br />
auf Gespräche zwischen Regierung und<br />
Opposition drängen. Sie muss sagen, dass<br />
die Tür zur EU offen bleibt, auch die Möglichkeit<br />
der Rückkehr an den Verhandlungstisch.<br />
Die Fachleute müssen sich dar -<br />
über unterhalten, wie der Ukraine finanziell<br />
zu helfen ist. Und nicht zu vergessen:<br />
Die EU muss klarstellen, dass russischer<br />
Druck wie zuletzt inakzeptabel ist.<br />
SPIEGEL: Hat man in Brüssel wirklich geglaubt,<br />
Russland werde stillhalten, wenn<br />
die EU mit der Ukraine ein als „historisch“<br />
bezeichnetes Abkommen schließt,<br />
das Kiew enger an den Westen bindet?<br />
Kwaśniewski: Ich erinnere mich noch an<br />
eine Parlamentsrede von Janukowitsch,<br />
in der er sagte, die Integration mit Europa<br />
habe Priorität, auch die Modernisierung<br />
der Wirtschaft sei nur in enger Abstimmung<br />
mit Europa möglich. Bis auf die<br />
Kommunisten haben das damals alle Parteien<br />
im Parlament unterstützt. Und es<br />
gab keinen Grund, diese Bekenntnisse<br />
nicht zu glauben. Aber dann kam es<br />
plötzlich zu einem Meinungsumschwung.<br />
SPIEGEL: Weil Russland den Knüppel aus<br />
dem Sack holte und ukrainische Waren<br />
nicht mehr ins Land ließ? Diese Reaktion<br />
hatte die EU offenbar nicht erwartet.<br />
Kwaśniewski: Ja, Brüssel war naiv. Aus Putins<br />
Blickwinkel ist die Ukraine ein wichtiger<br />
Faktor, vielleicht der wichtigste.<br />
Wenn es sein Ziel ist, eine eigene euroasiatische<br />
Union aufzubauen, kommt er<br />
nicht ohne die Ukraine aus. Der Westen<br />
unterschätzt die russische Entschlossenheit,<br />
er unterschätzt aber auch das, was<br />
sich jetzt in Kiew abspielt.<br />
SPIEGEL: Sie und Pat Cox haben in den vergangenen<br />
Wochen fast ununterbrochen mit<br />
Janukowitsch gesprochen. Wie war das?<br />
Kwaśniewski: Wir haben uns 20-mal mit<br />
dem Präsidenten getroffen, dazu immer<br />
auch mit Regierung und Opposition,<br />
selbst Julija Timoschenko haben wir besucht.<br />
Mindestens 50 Stunden lang haben<br />
wir mit Janukowitsch geredet. Wir haben<br />
auf die Liberalisierung des Wahlrechts,<br />
der Justiz und eine Reform der Staats -<br />
anwaltschaft gepocht, die nach sowjetischem<br />
Muster arbeitet. Und wir haben<br />
erreicht, dass drei der prominentesten<br />
poli tischen Häftlinge freigelassen wurden:<br />
die ehemaligen Minister für Verteidigung,<br />
Inneres und Umwelt.<br />
SPIEGEL: Das waren für Sie Zeichen, dass<br />
Janukowitsch es ernst meint mit der EU?<br />
Kwaśniewski: Er schien es wirklich ernst<br />
zu meinen. Aber im Sommer, als die Russen<br />
die ukrainischen Exporte zu blockieren<br />
begannen, änderte sich die Atmosphäre.<br />
Da verstärkte sich der Druck vieler<br />
Parlamentarier der Regierungspartei, die<br />
mit Firmen liiert sind. Sie produzieren<br />
Die ukrainische Führung denkt nur kurzfristig,<br />
um die nächsten Monate zu überleben.<br />
Protestführer Klitschko in Kiew: „Die Mehrheit ist für eine Annäherung an die EU“<br />
ALEXEY FURMAN / DPA<br />
für den russischen Markt – sie flehten:<br />
Rettet uns! Sie hatten kein Geld mehr,<br />
die Leute verloren ihre Arbeit. Damals<br />
begannen die Gespräche Putins mit Janukowitsch,<br />
die immer länger wurden.<br />
SPIEGEL: Was für ein Mann ist Janukowitsch?<br />
Viele sagen, intellektuell sei er<br />
eher schlicht.<br />
Kwaśniewski: Janukowitsch kennt die<br />
ukrainische Politik genau, im Guten wie<br />
im Schlechten. Er ist nach der Niederlage<br />
bei der Wahl 2004 nicht in Depressionen<br />
verfallen, sondern hat 2010 ein Comeback<br />
geschafft. Er ist ein harter Mann und ein<br />
harter Politiker. Seine Erfahrungen haben<br />
aus ihm einen misstrauischen Menschen<br />
gemacht. Kommunikation liegt ihm nicht,<br />
er ist eher ein Technokrat. Und seine Familie<br />
hat erheblich an Einfluss gewonnen.<br />
SPIEGEL: Hat er eine politische Vision?<br />
Kwaśniewski: Vor kurzem hätte ich noch<br />
gesagt: Ja. Aber in den letzten Tagen<br />
habe ich erkannt, dass die ukrainische<br />
Führung keine Strategie hat, nur kurzfristig<br />
denkt, um die nächsten Monate zu<br />
überleben. Deswegen hat sie die Reaktion<br />
der Öffentlichkeit nicht vorhergesehen.<br />
Sie glaubt, dass diese nicht spontan ist,<br />
sondern vom Ausland organisiert.<br />
SPIEGEL: Hat Janukowitsch die EU genutzt,<br />
um sich gegenüber Putin zu profilieren,<br />
von dem er so oft gedemütigt worden ist?<br />
Und um mehr Geld zu fordern?<br />
Kwaśniewski: Natürlich hat er versucht, unsere<br />
Gespräche zu instrumentalisieren, um<br />
mehr von Russland zu ergattern. Um den<br />
Russen zu sagen: Hört mal, Europa will<br />
uns, also müsst ihr noch was drauf legen.<br />
So denken ukrainische Politiker seit 22<br />
Jahren. Die Politik der Balance zwischen<br />
dem Westen und dem Osten hat ein Vakuum<br />
geschaffen. Deswegen steht die Wirtschaft<br />
so schlecht da, deswegen vertraut<br />
niemand dem Staat, deswegen wandern<br />
Millionen Menschen aus. Die Ukrainer hö-<br />
DER SPIEGEL 50/2013 97
Beschmiertes Janukowitsch-Plakat in Kiew: „Ein harter Mann, ein harter Politiker“<br />
ren das nicht gern, aber: Wir Polen sind<br />
ein gutes Beispiel dafür, dass sich der Weg<br />
nach Westen lohnt. Wir sind vor 20 Jahren<br />
mit etwa dem gleichen Pro-Kopf-Einkommen<br />
gestartet wie die Ukraine. Heute ist<br />
es dreimal so hoch.<br />
SPIEGEL: Hat die EU geglaubt, wenn sie<br />
Janukowitsch dazu brächte, ein paar libe -<br />
rale Gesetze umzusetzen, sei Kiew vom<br />
Westkurs nicht mehr abzubringen?<br />
Kwaśniewski: Die Ukraine ist kein ideales<br />
Land und wird das auch noch lange nicht<br />
sein. Aber wir haben die Chance, sie an<br />
unsere Standards heranzuführen. Wenn<br />
wir das nicht machen, wird Kiew dem<br />
russischen und dem weißrussischen Modell<br />
folgen. Die Ukraine stand Hunderte<br />
Jahre unter starkem Einfluss Russlands,<br />
die Menschen hier haben den Kommunismus<br />
in einer sehr brutalen Form erlebt.<br />
Und es gibt jede Menge historische und<br />
geopolitische Besonderheiten und Konflikte.<br />
Nur eine europäische Strategie hilft<br />
der Ukraine aus der Krise heraus. Zum<br />
Glück hat das Land eine sehr lebendige<br />
Zivilgesellschaft, die in die EU will.<br />
SPIEGEL: Im Umgang mit dem Osten wirkt<br />
die EU ziemlich weltfremd. In Russland<br />
hat der Westen an der neuen Verfassung<br />
mitgeschrieben – trotzdem werden Urteile<br />
weiter per Telefon gefällt. Und in Weißrussland<br />
hatte die EU sich 2010 mit Machthaber<br />
Lukaschenko auf eine halbwegs<br />
faire Präsidentenwahl geeinigt – und noch<br />
am Wahlabend wurden die Oppositionsführer<br />
verhaftet.<br />
Kwaśniewski: Wir haben eine unterschiedliche<br />
Mentalität. Im Westen ist Demokratie<br />
ein Wert an sich, im Osten ist der zentrale<br />
Wert die Macht. Dort sagen sich die<br />
Führer: Wenn Demokratie unserem Ziel<br />
dient, wenden wir sie an. Wenn nicht, bedienen<br />
wir uns anderer Verfahren.<br />
SPIEGEL: Warum hat die EU die Freilassung<br />
von Julija Timoschenko zur Bedingung<br />
gemacht?<br />
* Mit den Redakteuren Jan Puhl und Christian Neef.<br />
98<br />
Kwaśniewski: Cox und ich wurden gebeten,<br />
eine Lösung des Falls zu finden, damit<br />
der Assoziierungsvertrag unterschrieben<br />
werden kann. Das hätte auch eine teilweise<br />
Begnadigung sein können, eine<br />
Senkung der Haftzeit auf zwei Jahre. Janukowitsch<br />
selbst hat dann vorgeschlagen,<br />
sie zur Behandlung ausreisen zu lassen.<br />
Seine Anhänger möchten aber, dass<br />
sie die volle Strafe absitzt.<br />
SPIEGEL: War es ein Fehler, auf ihrer Freilassung<br />
zu bestehen? Für Janukowitsch<br />
bedeutete das einen Gesichtsverlust.<br />
Kwaśniewski: Aus heutiger Sicht vielleicht.<br />
Zu einem früheren Zeitpunkt wäre Timoschenkos<br />
Ausreise für eine Operation<br />
noch eher möglich gewesen. Janukowitsch<br />
hätte nicht das Gesicht verloren,<br />
aber damit unter Beweis gestellt, dass er<br />
zu einer humanitären Geste fähig ist. Es<br />
ging ja um eine medizinische Behandlung<br />
und eben nicht um eine Rehabilitierung<br />
Timoschenkos. Sie weiter gefangen zu<br />
halten ist politisch viel kostspieliger.<br />
SPIEGEL: Das andere Problem, das zum<br />
Schluss unlösbar schien, war das Geld.<br />
Die 610 Millionen Euro Hilfe, die die EU<br />
bot, waren lächerlich. Die Ukraine steckt<br />
in einer tiefen Zahlungskrise.<br />
Kwaśniewski beim SPIEGEL-Gespräch*<br />
„50 Stunden mit Janukowitsch geredet“<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
CARSTEN KOALL / GETTY IMAGES<br />
PIOTR MALECKI / DER SPIEGEL<br />
Kwaśniewski: Ja, die Ukraine braucht blitzschnelle<br />
Hilfe. Es gab Gespräche mit dem<br />
IWF, nur hat der sehr harte Bedingungen<br />
gestellt – die Ukraine sollte etwa die stark<br />
subventionierten Gaspreise heraufsetzen.<br />
Das ist kurz vor Wahlen politischer<br />
Selbstmord. Die EU hätte über kurz -<br />
fristige Hilfen nachdenken und sanftere<br />
Lösungen vom IWF fordern müssen. Das<br />
passiert leider erst jetzt.<br />
SPIEGEL: Inzwischen bietet Moskau den<br />
Ukrainern etliche Milliarden Euro an.<br />
Kwaśniewski: Dieses Versprechen liegt bislang<br />
nirgendwo konkret auf dem Tisch.<br />
Noch immer zahlt die Ukraine den höchsten<br />
Preis für russisches Gas in Europa.<br />
SPIEGEL: War die Drohung, Russland würde<br />
die Ukraine nach Unterzeichnung des<br />
Assoziierungsabkommens in den Staatsbankrott<br />
treiben, ein Bluff?<br />
Kwaśniewski: Ich fürchte, das war real.<br />
SPIEGEL: Dann hätte die EU konsequenter<br />
handeln müssen. Nahm sie das Assoziierungsabkommen<br />
selbst nicht so ernst?<br />
Kwaśniewski: Nein, das wollten wirklich<br />
alle. Die zentrale Schwäche dieses Dokuments<br />
ist: Wir reden mit keinem Wort<br />
von einer Mitgliedsperspektive, weil sich<br />
Europa da nicht einig ist.<br />
SPIEGEL: Wozu braucht die EU ein Land, das<br />
ein Flickenteppich mit riesigen sozialen Unterschieden<br />
ist, wo es kein einheitliches nationales<br />
Interesse gibt? Wir haben schon den<br />
Beitritt Rumäniens und Bulgariens bereut.<br />
Wir müssen eine gemeinsame Politik gegenüber<br />
Russland betreiben – die haben wir im Moment nicht.<br />
Kwaśniewski: Solidarität ist das Fundament<br />
Europas. Wenn wir das in Frage<br />
stellen, haben wir keine Chance. Wozu<br />
nationaler Egoismus führen kann, wissen<br />
wir in Europa nur zu gut. Wir sollten den<br />
Plan beibehalten, die östlichen Länder in<br />
den Orbit unserer Werte zu führen.<br />
SPIEGEL: Wladimir Putin feiert gegenüber<br />
dem Westen einen Triumph nach dem anderen<br />
– Snowden, Syrien, nun die Ukraine.<br />
Er hält den Westen für einen Papiertiger,<br />
die EU sowieso. Wie können wir je<br />
wieder einen normalen Dialog mit Russland<br />
hinbekommen?<br />
Kwaśniewski: Die Erfolge stärken auf kurze<br />
Sicht die Position Putins, bremsen<br />
aber die nötigen Reformen. Russland<br />
braucht eine Modernisierung, ökonomisch,<br />
gesellschaftlich, institutionell. Und<br />
die ist ohne den Westen kaum machbar.<br />
Aber Putin muss Europa als ernsthaften<br />
Partner empfinden, schließlich ist<br />
die EU keine historische Episode wie die<br />
Sowjetunion. Wir müssen unsere inneren<br />
Probleme lösen – und eine gemeinsame<br />
Politik gegenüber Russland betreiben.<br />
Die haben wir im Moment überhaupt<br />
nicht.<br />
SPIEGEL: Herr Kwaśniewski, wir danken<br />
Ihnen für dieses Gespräch.
Ausland<br />
Demonstrierende Regierungsgegner in Bangkok: „Ich repräsentiere das Volk, und das Volk erhebt sich“<br />
WILL BAXTER / DER SPIEGEL<br />
Allmählich werde er zu alt für diese<br />
Art von Spielchen, die tückisch<br />
sind und keineswegs ungefährlich,<br />
sagt Sunai Chulpongsatorn, er sagt es<br />
halb im Scherz, aber nur halb. Der Abgeordnete<br />
der Regierungspartei ist 62 Jahre<br />
alt, er ist erschöpft von den vergangenen<br />
Tagen und Wochen; er ist grau im Gesicht,<br />
seine Stimme ein Krächzen.<br />
Das Fernsehstudio liegt in der Innenstadt<br />
von Bangkok, und Sunai kommt<br />
gerade aus dem Aufnahmeraum 1, wo er<br />
seine Polit-Sendung eingespielt hat.<br />
„Asia Update“ heißt sie, eine Million Zuschauer<br />
sehen sie täglich, sagt er. Und<br />
nachdem er eben eine Stunde lang geredet<br />
hat, in den Tagen zuvor ununterbrochen<br />
debattiert, Parteimitgliedern gedroht<br />
und um ihre Hilfe gebettelt hat, ist<br />
jetzt seine Stimme weg. Er wankt in den<br />
Ruheraum neben dem Studio, lässt sich<br />
auf ein Sofa fallen. „Nur einen Schluck<br />
Wasser“, flüstert er, „dann erkläre ich,<br />
100<br />
THAILAND<br />
Revolte rückwärts<br />
Der Abgeordnete Sunai und der Protestführer Suthep<br />
stehen für die zwei Lager, die darum ringen, wer<br />
künftig das Sagen hat: gewählte Populisten oder Putschisten.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
was hier passiert, es ist leider alles etwas<br />
kompliziert.“<br />
Nein, er fühlt sich nicht zu alt für diese<br />
Spielchen, er liebt sie, je gefährlicher, desto<br />
besser – das findet Suthep Thaugsuban,<br />
64 Jahre alt. Er hat seinen Parlamentssitz<br />
und sein Amt als Vizechef der Demokratischen<br />
Partei aufgegeben; er setzt alles<br />
auf diese eine Karte, auf diese Bewegung,<br />
deren Tribun und Anführer er ist. Sein<br />
Ziel: die Regierung stürzen. Seine Mission:<br />
Thailand retten. So sieht er es jedenfalls.<br />
Am Tag zuvor erschien ein kritischer<br />
Artikel über ihn auf der Titelseite der<br />
„Bangkok Post“. Na und? Immerhin, die<br />
Titelseite! Er sitzt in einem Plastikstuhl<br />
und lächelt. „Es wird ein bisschen dauern“,<br />
sagt er, „aber wir sind auf bestem<br />
Wege, jeden Tag haben wir mehr Zulauf.“<br />
Sutheps Leute haben das Regierungsviertel<br />
besetzt, Tausende Menschen kampieren<br />
jetzt hier, hocken oder liegen auf<br />
Matten in den Fluren oder in der mit weißem<br />
Marmor ausgelegten Halle. Sie haben<br />
die wichtigsten Ministerien gekapert,<br />
dazu 19 Büros in der Provinz, die großen<br />
Zufahrtsstraßen um das Demokratie- und<br />
das Sieges-Monument. Ende Oktober, als<br />
er die Bewegung ins Leben rief, habe er<br />
nur 40000 Anhänger gehabt, sagt er. Jetzt<br />
seien es 2 Millionen.<br />
Suthep hat sein Hauptquartier im Keller<br />
von Gebäudekomplex B aufgeschlagen;<br />
Räume, Computer, Telefone hat ein<br />
Reisebüro zur Verfügung gestellt. Drei<br />
Reihen schwarzer Security-Leute schützen<br />
ihn, man wird nach Waffen durchsucht,<br />
bevor man zu Suthep gelangt, der<br />
behaglich auf seinem Stuhl sitzt, mit der<br />
Trillerpfeife spielt, die um seinen Hals<br />
hängt, und lächelt. „Das ist alles ganz einfach“,<br />
sagt er. „Ich repräsentiere das Volk,<br />
und das Volk erhebt sich.“<br />
Sunai und Suthep – zwei Männer, zwei<br />
Geschichten, zwei Ansichten dieses Aufstands.<br />
Sunai, der Abgeordnete, fühlt sich<br />
als Gejagter, obwohl seine von den Rothemden<br />
unterstützte Partei die Regierung<br />
stellt. Und Suthep, der Anführer der<br />
Gelbhemden, der, obwohl ohne Amt, mit<br />
Verve seine Rolle als Jäger spielt. Beide<br />
kennen einander seit Jahren, sie saßen<br />
Jahrzehnte zusammen im Parlament –<br />
und sie sind Todfeinde.<br />
Seit Wochen treiben Suthep, der Mann<br />
mit der Trillerpfeife, und sein Demokratisches<br />
Reformkomitee des Volkes die Regierungspartei<br />
„Für Thailand“ vor sich
102<br />
Ausland<br />
Kontrahenten Sunai, Suthep: Neuwahl? Oh, keinesfalls!<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
her. Der Versuch, ein Amnestiegesetz<br />
durchzusetzen, das Ex-Premier Thaksin<br />
Shinawatra die Rückkehr aus dem Exil<br />
ermöglicht sowie Straffreiheit garantiert<br />
hätte, war der willkommene Anlass für<br />
die Revolte.<br />
Die Gelbhemden haben Chaos geschürt,<br />
haben Straßenkämpfe mit Tränengas<br />
und Wasserwerfern provoziert und<br />
dafür gesorgt, dass in Bangkok etwa<br />
20000 Polizisten eingesetzt werden mussten.<br />
Mindestens vier Menschen wurden<br />
getötet, Hunderte verletzt. Dann aber<br />
kehrte vorige Woche plötzlich Waffen -<br />
ruhe ein, denn der greise König Bhumibol<br />
Adulyadej hatte Geburtstag. Und Thailand<br />
ging gehorsam über in den Happy-<br />
Birthday-Modus. Es ist der heiligste Tag<br />
des Jahres. Denn der „König der Könige“,<br />
angeblich einer der reichsten Monarchen<br />
der Welt, ist für die meisten Thais ein<br />
Übervater, beinahe ein Halbgott. Wer im<br />
Kino nicht aufsteht, auf der Straße nicht<br />
erstarrt, sobald die Hymne gespielt<br />
wird, bekommt Ärger. Thailänder<br />
sehen sich um, bevor sie<br />
ein viertelkritisches Wort über ihren<br />
König aussprechen.<br />
Undenkbar, die zeremoniellen<br />
Feiern durch Proteste oder Gewalt<br />
zu schänden. Es gab also<br />
eine Atempause – die der königstreue<br />
Aufrührer Suthep nutzte,<br />
um Drohungen auszustoßen. Sobald<br />
die Regierung entmachtet<br />
sei, kämen die nächsten Schritte:<br />
Ein Rat des Volkes würde gebildet,<br />
Gesetze würden verabschiedet,<br />
um die Polizei zu dezentra -<br />
lisieren, um angeblich korrupte<br />
Politiker zu bestrafen, um die<br />
Monarchie zu stärken.<br />
Wollen Sie keine Neuwahl abhalten,<br />
Mr. Suthep?<br />
Er wedelt mit dem Zeigefinger: „Oh,<br />
keinesfalls! Erst müssen wir das Wahlsystem<br />
reformieren und sicherstellen, dass<br />
keine Stimmen gekauft werden.“ Er senkt<br />
die Stimme und redet im Verschwörerton<br />
weiter. „Glauben Sie etwa, wir haben hier<br />
eine Demokratie? Ha!“<br />
Warum gibt es ausgerechnet in Thailand<br />
einen derart hässlichen Kampf, der<br />
die Gesellschaft zu zerlegen droht? Hier,<br />
im Sehnsuchtsland so vieler Touristen,<br />
wo es die schönsten Strände gibt, die besten<br />
Curry-Gerichte; wo auch die Wirtschaft<br />
floriert und 2012 um 6,5 Prozent<br />
wuchs, die Banken stabil sind und die<br />
Staatsschuldenquote bei 45 Prozent liegt,<br />
wovon europäische Finanzminister träumen.<br />
Wo man auf den Straßen wenige<br />
Bettler sieht und viele neue Autos. Woher<br />
also dieser Zorn?<br />
Vielleicht kommt er gerade daher: weil<br />
sich Thailand entwickelt.<br />
Einer der besten Landeskenner, der<br />
US-Professor Benedict Anderson, schrieb<br />
unlängst über den gesellschaftlichen Wandel<br />
in Thailand, er berief sich dabei auf<br />
den Denker Antonio Gramsci: Wenn das<br />
Alte sterbe und das Neue nicht geboren<br />
werden könne – dann entstünden, so Anderson,<br />
Monster. Die politische Krise in<br />
Thailand ist ein solches Monster.<br />
Im Nordosten, dem Isaan, lebt knapp<br />
ein Drittel der 69 Millionen Einwohner,<br />
sie sind die Armen, die Dummen, auf die<br />
man in Bangkok hinabschaut. In thailändischen<br />
Serien ist die Deppenrolle stets<br />
mit Isaan besetzt; die schönen Frauen und<br />
Helden sind aus Bangkok oder dem Süden,<br />
sie gehören zur reichen, mächtigen<br />
Oberschicht, mit Nähe zum Königshaus.<br />
So war es, so sollte es bleiben. Doch<br />
dann trat ein promovierter Kriminologe<br />
mit eckigem Schädel und Goldrandbrille<br />
auf den Plan – und änderte die Machtverhältnisse.<br />
Man wird Thaksin Shinawatra<br />
wohl nicht zu nahe treten, wenn man<br />
ihn als gerissen, skrupellos und machtgierig<br />
beschreibt. So sehen ihn viele Thailänder,<br />
selbst Sunai stimmt bekümmert<br />
zu. Als Thaksin damals antrat, schloss<br />
Sunai sich ihm an, er wurde einer seiner<br />
Vertrauten, noch heute telefonieren sie<br />
mehrmals die Woche.<br />
Geschäftemacherei und Staatsdienst<br />
waren im Thailand vor Thaksin säuberlich<br />
getrennt; Thaksin schloss diese Lücke.<br />
Sein erstes großes Geld verdiente er mit<br />
dem Auftrag, die Polizei mit Computern<br />
auszustatten. Dann bekam er eine von<br />
zwei Mobilfunklizenzen und wurde reich.<br />
Er ging in die Politik und erkannte, dass<br />
Demokratie eine schöne Idee war – vor<br />
allem um die Macht zu erringen. Und die<br />
Macht war ein Hebel, um mehr Geld zu<br />
verdienen.<br />
Thaksin verbesserte die Lage der Armen<br />
im Nordosten, das war seine Strategie,<br />
so fuhr seine Partei grandiose Wahlsiege<br />
ein – und er wurde Regierungschef.<br />
In den Kreisen der alten Oligarchie jedoch<br />
machte Thaksin sich keine Freunde,<br />
eher mächtige Feinde.<br />
Als er 2003 den „Krieg gegen Drogen“<br />
ausrief, wurden in einigen Monaten schätzungsweise<br />
mehr als 2000 Menschen getötet,<br />
ohne umständliche Gerichtsverfahren.<br />
Er ließ Gesetze schreiben, die ihm<br />
als Unternehmer nutzten, er erinnert damit<br />
an Silvio Berlusconi. Um Anteile der<br />
Telekommunikationsfirma Shin Corp<br />
steuerfrei verkaufen zu können, brachte<br />
er 2006 ein eigenes Gesetz auf den Weg.<br />
Kurz darauf wurde er vom Militär seines<br />
Amtes enthoben und später zu zwei Jahren<br />
Gefängnis verurteilt. Er floh ins Ausland<br />
und lebt nun abwechselnd in Dubai,<br />
Hongkong oder London.<br />
Seitdem befindet sich das Land in einer<br />
politischen Dauerkrise, denn aus dem<br />
Ausland zieht Thaksin weiter die Strippen,<br />
die virtuose Anwendung des thailändischen<br />
Schattentheaters auf die Politik.<br />
2007 gewann eine von ihm gesteuerte Partei<br />
die Wahlen, dagegen demonstrierten<br />
die Gelbhemden so lange, bis Ende 2008<br />
ein Premierminister der Anti-Thaksin-<br />
Kräfte vom Militär ernannt wurde. Dann<br />
demonstrierten wieder die Rothemden.<br />
Seit 2011 regiert seine Schwester<br />
Yingluck Shinawatra das Land.<br />
Thaksin nennt sie „mein anderes<br />
Ich“. Ihre oder eben seine Partei<br />
warb mit dem Slogan: Thaksin<br />
denkt, Yingluck führt aus. Seine<br />
Anhänger halten zu Thaksin, seine<br />
Entmachtung sehen sie als Versuch<br />
der alten Elite, das Rad zurückzudrehen.<br />
Zudem gilt er ihnen als<br />
der Einzige, der stark, reich und<br />
gerissen genug ist, all diesen Su -<br />
theps mit ihren Verbindungen<br />
zum Königshaus zu trotzen.<br />
Die zwei Männer, Sunai, der<br />
erschöpfte Thaksin-Anhänger,<br />
und Suthep, der Vertreter der alten<br />
Elite, stehen für diese sich bekämpfenden<br />
Systeme.<br />
Sunai stammt aus dem Norden; in den<br />
siebziger Jahren, als Thailand eine Militärdiktatur<br />
war, lebte er jahrelang im<br />
Dschungel und kämpfte auf Seiten der<br />
Kommunisten.<br />
Suthep hingegen ist ein Mann des begüterten<br />
Südens, er besitzt dort Plantagen<br />
und Shrimp-Farmen. „Nichts gegen diese<br />
Leute. Aber sie sind ungebildet und lassen<br />
sich ihre Stimmen abkaufen“, sagt<br />
Suthep abfällig über die Isaan. Die Polizei<br />
sucht ihn jetzt per Haftbefehl, der Vorwurf:<br />
Aufruhr gegen die Regierung. Zudem<br />
soll er als Vizepremier 2010 den<br />
Schießbefehl gegen Sunais Rothemden<br />
erteilt haben, 90 Menschen starben.<br />
Thaksins Gegner, unterstützt vom Militär,<br />
glauben, dass jetzt die Zeit reif ist<br />
für einen erneuten Umsturz – denn ist<br />
der alte König erst einmal tot, könnte<br />
das royale Machtvakuum die Gegner der<br />
Monarchie ermutigen. Und dem wollen<br />
Suthep und seine Aufständischen nun<br />
zuvorkommen, mit einer Wiederherstellung<br />
der alten Verhältnisse. Mit einer<br />
Revolte, die eine Rolle rückwärts ist.<br />
RALF HOPPE<br />
FOTOS: WILL BAXTER / DER SPIEGEL
GOOGLE EARTH<br />
USA<br />
Das Klima der anderen<br />
New York investiert Milliarden Dollar, um sich gegen Monsterstürme und den steigenden<br />
Meeresspiegel zu wappnen. North Carolina schreibt per Gesetz vor, den Klimawandel<br />
zu ignorieren. Wer setzt sich durch, in diesem Kulturkampf um das bessere Amerika?<br />
Es ist dasselbe Meer, das vor ihnen<br />
liegt, das Wasser, über das einst<br />
Christoph Kolumbus segelte. Aber<br />
wenn sie an der Küste stehen, 680 Kilometer<br />
voneinander entfernt, und über<br />
den Atlantik blicken, sehen sie unterschiedliche<br />
Dinge.<br />
Veronica White steht an der Strandpromenade<br />
in New York. Sie sagt: „Wir müssen<br />
die ganze Küste auf Katastrophen<br />
vorbereiten, auf Stürme und steigende<br />
Fluten.“<br />
Tom Thompson steht im Yachthafen<br />
von New Bern, North Carolina. Er sagt:<br />
„Ich wundere mich immer wieder über<br />
diese Klimapanik, aber die Menschen<br />
glauben an Horrorgeschichten.“<br />
Das Meer, das New York umspült, ist<br />
seit dem Jahr 1900 um gut 30 Zentimeter<br />
gestiegen. Vor New Bern, North Carolina,<br />
achteinhalb Autostunden südlich von<br />
New York an derselben Küste gelegen,<br />
104<br />
hob sich das Meer ebenfalls um rund 30<br />
Zentimeter.<br />
So weit die Fakten. Die Frage ist nun,<br />
was man daraus macht.<br />
In New York, so hat eine Gruppe von<br />
Klimaforschern im Auftrag der Stadt errechnet,<br />
könnte der Meeresspiegel bis<br />
2050 um mehr als einen Dreiviertelmeter<br />
steigen, 30 Jahre später sogar um anderthalb<br />
Meter. Bis zum Ende des Jahrhunderts,<br />
warnt das Expertengremium, könnte<br />
es in New York ähnlich warm sein wie<br />
heute in North Carolina.<br />
Auch in North Carolina, stellte das dortige<br />
Küstenamt fest, werde es Ende des<br />
Jahrhunderts wärmer sein als heute. Der<br />
Meeresspiegel könnte bis zum Ende des<br />
Jahrhunderts um mehr als einen Meter<br />
steigen. Ähnlich also wie in New York.<br />
Dann aber verpasste die Regierung von<br />
North Carolina ihrem Küstenamt einen<br />
Maulkorb. Die Prognosen wurden per<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Gesetz ignoriert. Das Gesetz besagt nun,<br />
dass der Meeresspiegel vor North Caro -<br />
lina nicht schneller steigen wird als in den<br />
vergangenen hundert Jahren.<br />
Beide Szenarien spielen in Amerika.<br />
Eine Küste, zwei Welten.<br />
In der einen Welt werden Klimapro -<br />
gnosen gelesen, in der anderen nicht. Die<br />
New Yorker glauben, dass sie etwas tun<br />
müssen gegen die Erwärmung der Erde,<br />
weil ihnen der Untergang droht. Die Menschen<br />
in New Bern vertrauen lieber auf<br />
die Schöpfung. Der Klimawandel ist hier<br />
eine Glaubensfrage, die den Kern der<br />
amerikanischen Identität berührt. An ihm<br />
entzündet sich ein Kulturkampf um das<br />
bessere Amerika.<br />
„Wenn der Meeresspiegel wirklich um<br />
einen Meter steigen würde“, sagt Tom<br />
Thompson am Hafen von New Bern,<br />
„wäre der größte Teil von New Bern unbewohnbar.“<br />
Man merkt ihm die 69 Jah-
Ausland<br />
New York<br />
Washington<br />
Atlantischer<br />
Ozean<br />
New<br />
Bern<br />
200 km<br />
Überflutete Gebiete Manhattans im<br />
Jahr 2050. Szenario nach Berechnungen<br />
des New Yorker Office of<br />
Long-Term Planning and Sustainability.<br />
re nicht an, trotz der weißen Haare. Er<br />
geht die Strandpromenade entlang, am<br />
neuen Strandpark vorbei, am Hilton-<br />
Hotel. All das ist sein Werk als Stadtentwickler;<br />
Thompson hat Firmen hierhergebracht,<br />
die Elektrogerätefabrik von<br />
Bosch- Siemens etwa, und er kennt jeden<br />
in North Carolina, der mit Wirtschaft zu<br />
tun hat.<br />
Er war gerade in Rente gegangen und<br />
stolz auf die Welt, die er geschaffen hatte.<br />
Doch dann kam diese Prognose des Küstenamtes,<br />
dass der Meeresspiegel in den<br />
nächsten hundert Jahren um rund einen<br />
Meter steigen und Gebäude, Straßen und<br />
Plätze verschlucken würde. Es war der<br />
gleiche Wert, auf den man auch in anderen<br />
Küstenstaaten gekommen war, denn<br />
er entspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen.<br />
Aber für Thompson war dieser<br />
Wert, dieser Meter, eine Kriegserklärung,<br />
ein Angriff auf sein Erbe.<br />
Kurz nachdem die Nachricht in der Zeitung<br />
gestanden hatte, zog Thompson in<br />
den Lagerraum des Geschäfts seiner Frau,<br />
eines Einrichtungsladens für allerhand<br />
Kitsch in der Main Street von New Bern.<br />
Da saß er in einer Nische zwischen zwei<br />
Kuckucksuhren und mobilisierte die alte<br />
Lobby, die er einst gegründet hatte, um<br />
die Wirtschaft vor zu viel Regulierung zu<br />
schützen.<br />
Er schlug sein Telefonbuch auf, darin<br />
standen die Nummern der Handelskammerchefs,<br />
die er mit Vornamen kannte,<br />
der Stadtentwickler und der Geschäftsführer<br />
der Firmen, die er nach North<br />
Carolina geholt hatte. Es war immer die<br />
gleiche Geschichte, die Thompson ihnen<br />
erzählte, seine Horrorgeschichte: Sie handelte<br />
von Landstraßen und Autobahnen,<br />
die wegen des prognostizierten Anstiegs<br />
des Meeresspiegels mindestens einen<br />
Meter höher gelegt werden müssten, von<br />
verschwindenden Strandpromenaden,<br />
von flüchtenden Unternehmen. Vor Milliardenkosten<br />
warnte er, die für Umbauten,<br />
Fluchtwege und Gebäudeversicherungen<br />
fällig würden. 5200 Quadratkilometer<br />
des Bundesstaates wären gefährdet.<br />
Und die Freunde und Geschäftsleute bekamen<br />
Angst. North Carolina, ein Milliar -<br />
dengrab?<br />
Tom Thompson erzählte seine Geschichte<br />
so lange, bis die republikanische<br />
Abgeordnete Pat McElraft einen Abschnitt<br />
gegen den Klimawandel in ein Gesetz<br />
schreiben ließ, HB 819.<br />
Im April 2013 legte das Ministerium für<br />
öffentliche Sicherheit in North Carolina<br />
einen offiziellen Bericht darüber vor, was<br />
es für den Bundesstaat heißen würde,<br />
wenn der Meeresspiegel wirklich um einen<br />
Meter stiege. Der wirtschaftliche<br />
Schaden wäre enorm: Auf dem betroffenen<br />
Gebiet stehen Wohnhäuser, Büro -<br />
DER SPIEGEL 50/2013 105
Küstenschützerin White: Ein Jahrhundertsturm wie „Sandy“ alle zwei Jahre?<br />
106<br />
Der Ort war überflutet,<br />
voller Sand, umgestürzter<br />
Bäume und Strom -<br />
masten mit losen Kabeln.<br />
gebäude und öffentliche Einrichtungen<br />
im Wert von 7,4 Milliarden Dollar. Sie<br />
müssten umgebaut werden, um den Fluten<br />
zu trotzen.<br />
Und warum? „Nur weil ein paar Wissen -<br />
schaftler behaupten, dass es so kommt“,<br />
sagt Thompson. „Aber sie haben keine<br />
Beweise. Wir sollen Geld für etwas ausgeben,<br />
das vielleicht gar nicht passiert.“<br />
Thompson ist ein Konservativer, er<br />
glaubt an Gott, und er bekämpft die wissenschaftliche<br />
Erkenntnis, dass es den Klimawandel<br />
gibt. Er sieht: zu viele Zahlen,<br />
zu viele Schätzungen, die sich scheinbar<br />
widersprechen. Für ihn wirkt das wie Lotterie,<br />
nicht wie Wissenschaft.<br />
Es ist früh am Morgen in Queens, New<br />
York, über dem Atlantik geht die Sonne<br />
auf. Das Wasser glitzert und schlägt sanfte<br />
Wellen. Veronica White, 54, eine zierliche<br />
Frau mit Schneewittchenhaut und<br />
Zopf, ist nicht ideal gekleidet für einen<br />
herbstlichen Strandspaziergang: Sie trägt<br />
ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten,<br />
ein Jäckchen, eine Perlenkette und<br />
Pumps, mit denen sie durch den feuchten<br />
Sand stapft. Abends ist sie zu einem<br />
Galadiner mit dem Bürgermeister eingeladen;<br />
sie hat Wichtigeres zu tun, als sich<br />
vorher extra umzuziehen.<br />
White leitet die städtische Behörde für<br />
Parkanlagen und Erholungsgebiete – ihr<br />
Job ist es, New York vor dem Klimawandel<br />
und den steigenden Meeresfluten zu<br />
schützen. Sie und ihre rund 6000 Mitarbeiter<br />
sind verantwortlich für die Strände<br />
und Küsten der Stadt, für Monumente<br />
wie die Freiheitsstatue, für den Central<br />
Park, die Highline und rund 1700 weitere<br />
Parkanlagen, 500 Gemeinschaftsgärten<br />
und 2500 Alleen. Doch warum New York<br />
den Klimawandel so fürchtet, kann White<br />
nirgendwo besser erklären als hier, am<br />
Rockaway Beach.<br />
Wenn man vom Ufer aus auf den Atlantik<br />
blickt, wirkt alles ganz idyllisch:<br />
ruhiges, blaues Wasser, ein paar fette Möwen.<br />
Doch man muss sich nur umdrehen,<br />
um die Verwüstung zu sehen: einen<br />
Strand, der diese Bezeichnung nicht mehr<br />
verdient.<br />
Denn Rockaway Beach wurde weg -<br />
gespült, verschlungen von einer wütenden<br />
Sturmflut im Oktober des vergangenen<br />
Jahres, als Hurrikan „Sandy“, der<br />
„Frankenstorm“, über die Ostküste der<br />
USA hinwegzog.<br />
Die Überreste des Strands liegen, von<br />
Sandsäcken gesäumt, mehrere Meter tiefer<br />
als die Küstenstraße. Die Promenade<br />
ist verschwunden. „Sie flog in die Luft<br />
und war hinterher im ganzen Ort verstreut“,<br />
erzählt White. Der Ort war überflutet,<br />
voller Sand, umgestürzter Bäume<br />
und Strommasten mit abgerissenen Kabeln;<br />
die Bewohner konnten sich kaum<br />
fortbewegen. „Wir haben monatelang nur<br />
aufgeräumt“, sagt White. „Gott, es war<br />
so entmutigend.“<br />
Schnellen Schrittes stöckelt sie über einen<br />
provisorischen Holzsteg und guckt<br />
zu der Baustelle am Strand herab, wo Arbeiter<br />
Bretter in den Sand schlagen. Das<br />
soll verhindern, dass Rockaway Beach<br />
vom nächsten Sturm gleich wieder weggefressen<br />
wird. 2,7 Millionen Kubikmeter<br />
Sand müssen die Ingenieure der US-Armee<br />
in den kommenden Monaten herankarren,<br />
aufschichten und befestigen, mit<br />
Hilfe von Schutzwänden, Geotextilien<br />
und Strandhafer, damit aus Rockaway<br />
Beach wieder ein richtiger Strand wird.<br />
Aber wird das genügen?<br />
Schon vor dem Sturm unterstützte die<br />
Mehrheit der New Yorker die Pläne ihres<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
KATJA HEINEMANN / DER SPIEGEL<br />
Ausland<br />
Bürgermeisters Michael Bloomberg, ihre<br />
Stadt der Superlative nun auch in die<br />
grünste Metropole der Welt zu verwandeln.<br />
„Aber ,Sandy‘ hat den Leuten auf<br />
drastische Weise vor Augen geführt, was<br />
Klimawandel wirklich bedeutet“, sagt<br />
White. „Genau wie 9/11 den New Yorkern<br />
gezeigt hat, was beim Krieg gegen den<br />
Terror auf dem Spiel steht.“<br />
White räumt ein, dass ein einzelner<br />
Sturm nicht direkt auf den Klimawandel<br />
zurückgeführt werden kann. Doch sie<br />
verweist auf die Modelle des New York<br />
City Panel on Climate Change (NPCC),<br />
die besagen, dass ein Sturm wie „Sandy“<br />
zum Ende des Jahrhunderts alle zwei Jahre<br />
zu erwarten sein wird. Allein in New<br />
York City tötete der Sturm 44 Menschen,<br />
er zerstörte Tausende Gebäude und Hunderttausende<br />
Autos – und richtete einen<br />
Schaden von 19 Milliarden Dollar an.<br />
Und je höher der Meeresspiegel steigt,<br />
desto weiter werden die Folgen jeder<br />
Sturmflut reichen – für eine wachsende<br />
Zahl von Menschen. Heute leben rund<br />
400000 New Yorker in flutgefährdeten<br />
Stadtgebieten. Das NPCC schätzt, dass<br />
es 2050 doppelt so viele sein werden.<br />
Auch in North Carolina hat „Sandy“<br />
Schaden angerichtet. Die Outer Banks, eine<br />
vorgelagerte Inselgruppe und eines der beliebtesten<br />
Urlaubsziele North Carolinas,<br />
waren zeitweise vom Festland abgeschnitten.<br />
Aber die Anwohner sind Sturmschäden<br />
gewohnt, sie haben sich darauf eingestellt,<br />
zerstörte Häuser wiederaufzubauen,<br />
statt viel Geld in Vorsorge zu investieren.<br />
Gottvertrauen nennen sie das in der<br />
Welt von Tom Thompson. Es ist eine<br />
Welt, in der ein Sozialstaat nicht als moralische<br />
Notwendigkeit gilt, sondern als<br />
unmoralische Versuchung, die aus fleißigen<br />
Menschen Faulenzer macht. In dieser<br />
Welt herrscht die Angst vor dem „nanny<br />
state“, dem Kindermädchen-Staat, der<br />
den Bürgern ihre Freiheit raubt.<br />
Es ist der Teil Amerikas, in dem noch<br />
ein Stück Glaube an den Wilden Westen<br />
geblieben ist, in dem Vorsorge etwas für<br />
Sozialisten oder Angsthasen ist. North<br />
Carolina hatte bis Anfang des Jahres eine<br />
demokratische Gouverneurin, eine Mehrheit<br />
hat 2008 für Barack Obama gestimmt,<br />
und doch ist hier noch das alte, konservative<br />
Amerika zu Hause: ein Staat, der<br />
seine laxen Waffengesetze verteidigt, der<br />
Abtreibungskliniken schließen lässt – und<br />
der eben auch nicht einsehen will, dass<br />
es den Klimawandel gibt.<br />
Und so macht North Carolina weiter<br />
wie bisher und schlägt die Warnungen<br />
der Wissenschaftler in den Wind. Als<br />
das Gesetz im Juli 2012 verabschiedet<br />
wurde, warnte die damalige Gouverneurin<br />
Bev Perdue lediglich: „Wir sollten das<br />
nicht ganz vergessen.“ Sie meinte den<br />
Klimawandel. Trotzdem ließ sie das Gesetz<br />
passieren, das dem Meer vorschreibt,<br />
wie hoch es vor North Carolina steigen
Lobbyist Thompson: „Die Menschen glauben an Horrorgeschichten“<br />
darf. Man solle es in vier Jahren nochmals<br />
überprüfen, sagte Perdue.<br />
„Wenn wir in zehn Jahren feststellen,<br />
dass der Meeresspiegel wirklich schneller<br />
steigt, können wir ja immer noch anfangen,<br />
Straßen höher zu bauen“, sagt<br />
Thompson. „Aber warum schon jetzt?“<br />
In New York regiert seit zwölf Jahren<br />
Michael Bloomberg, nur noch wenige Wochen<br />
sind es bis zum Ende dieses Jahres,<br />
dann läuft seine dritte Amtszeit aus. Bürgermeister<br />
Bloomberg hat die Klima -<br />
berichte schon immer ernst genommen.<br />
Dass New York den Klimawandel bekämpft,<br />
ist vor allem sein Verdienst – und<br />
sein Vermächtnis.<br />
„Gesucht: ein weiterer grüner Bürgermeister“,<br />
schrieb die „New York Times“<br />
und bemängelte, dass Bloombergs Nachfolger<br />
Bill de Blasio grüne Politik nicht<br />
zum Schwerpunkt seiner Wahlkampagne<br />
gemacht habe.<br />
Bloombergs Stellvertreter Caswell F.<br />
Holloway IV, 40, empfängt im prunkvollen<br />
Rathaus in Lower Manhattan und<br />
rühmt den angeblichen Pioniergeist seines<br />
Chefs. Er trägt eine orangeleuchtende<br />
Krawatte zum blauen Hemd, der Schädel<br />
ist rasiert, die Figur athletisch und das<br />
Auftreten so, dass es zu seiner Stadt passt.<br />
„Wenn New York etwas tut, schaut die<br />
Welt hin“, verkündet Holloway. New<br />
York könne globale Entwicklungen in<br />
Gang bringen, weil es eine „Welthauptstadt“<br />
sei.<br />
Als Beleg führt der Vizebürgermeister<br />
das Rauchverbot an: „Kalifornien hat das<br />
Verbot in den neunziger Jahren eingeführt“,<br />
sagt er, „aber es wurde dieser seltsame<br />
Ort, wo man nicht mehr hinwollte.“<br />
Dann habe New York das Rauchen in<br />
Bars und Restaurants untersagt – „und<br />
nun können Sie auch in den Bars und<br />
Restaurants von Paris und Hamburg nicht<br />
mehr rauchen!“.<br />
Für konservative Amerikaner ist<br />
Bloombergs New York ein „nanny state“.<br />
108<br />
Denn der Multimilliardär und seine Mitstreiter<br />
bekämpfen nicht nur den Klimawandel,<br />
sie versuchen auch, die Bürger<br />
gesünder zu machen: New Yorker sollen<br />
aufs Rauchen verzichten, sie sollen keine<br />
ungesunden Fette essen und weniger süße<br />
Limonade trinken. Und sie sollen sich<br />
mehr bewegen, zum Beispiel auf Leih -<br />
rädern. Die Mehrheit der New Yorker<br />
scheint sich daran nicht zu stören. Drei<br />
von vier sagen in Umfragen, dass sie die<br />
Klimapolitik ihrer Stadt gut finden.<br />
Also wird auch das störrische North<br />
Carolina demnächst einsehen, dass die<br />
Welthauptstadt recht hat – und anfangen,<br />
den Klimawandel zu bekämpfen? Holloway<br />
muss nun doch grinsen. Er schüttelt<br />
den Kopf. „Na ja, das hat nun mal eine<br />
New York und New Bern –<br />
zwei Pole in einem Land,<br />
das kaum einen gemeinsamen<br />
Nenner findet.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
JENNY WARBURG / DER SPIEGEL<br />
Ausland<br />
lange Tradition in diesem Land, diese wilden<br />
Unterschiede in der Politik.“<br />
Dann hebt der New Yorker zu einem<br />
Plädoyer an, als säße North Carolina persönlich<br />
vor ihm: „Die können glauben,<br />
was sie wollen, ob der Klimawandel nun<br />
menschengemacht ist oder nicht – aber es<br />
gibt eine Fülle von Daten, die alle in die<br />
gleiche Richtung zeigen.“ Der Weltklimarat<br />
sage voraus, doziert er, dass Phän o -<br />
mene wie der Monstersturm „Sandy“, die<br />
Hochwasser in Colorado oder die Buschbrände<br />
im Mittleren Westen sich wiederholen<br />
würden, und zwar öfter und schlimmer<br />
als früher, wenn die Menschen ihre<br />
Treibhausgasemissionen nicht reduzierten.<br />
Holloway beugt sich in seinem Sessel<br />
vor, sein Körper spannt sich an: „Wenn<br />
eine Regierung all diese Informationen<br />
hat und trotzdem nichts tut, ist das verantwortungslos.“<br />
Das Plädoyer ist beendet,<br />
der Vizebürgermeister lehnt sich zurück.<br />
New Yorks Leistung sei es, fährt er<br />
fort, dass man das alles schon 2007 erkannt<br />
habe. George W. Bush war damals<br />
noch Präsident und Klimawandel ein, vorsichtig<br />
ausgedrückt, exotisches Thema. In<br />
der Welthauptstadt aber lancierte der Bürgermeister<br />
einen Plan, wie man sich für<br />
den Klimawandel rüsten und zugleich<br />
grün und umweltfreundlich werden könne:<br />
„PlaNYC“. Das Ziel: Im Jahr 2030<br />
sollten 30 Prozent weniger Kohlendioxid<br />
ausgestoßen werden als 2005. 16 Prozent<br />
seien bereits geschafft, sagt Holloway.<br />
Natürlich wäre es einfacher, wenn es<br />
so etwas wie eine nationale Klimapolitik<br />
gäbe, an der man sich orientieren könnte.<br />
„Aber die Regierung in Washington tut<br />
ja bis heute nichts gegen den Klima -<br />
wandel.“<br />
So zeigt New York, wie es gehen könnte:<br />
Wolkenkratzer werden saniert, damit<br />
sie weniger Energie fressen. 76 Prozent<br />
aller New Yorker können aus ihrer Haustür<br />
treten und zu Fuß in zehn Minuten<br />
einen Park erreichen – 6 Prozent mehr<br />
als noch vor sechs Jahren. Eine Million<br />
neue Bäume versprach die Stadt -<br />
regierung, 800 000 wurden bis heute gepflanzt.<br />
Der Times Square wurde zur Fußgängerzone.<br />
1000 Kilometer Fahrradwege<br />
wurden durch die Stadt gezogen. Die<br />
New Yorker Luft ist heute so schadstoffarm<br />
wie seit 50 Jahren nicht.<br />
New York und New Bern – das sind<br />
zwei Pole in einem Land, das kaum mehr<br />
einen gemeinsamen Nenner findet.<br />
In Washington sieht sich der demokratische<br />
Präsident einem republikanisch<br />
kontrollierten Abgeordnetenhaus gegenüber,<br />
das von einer kleinen, radikalen<br />
Gruppe von Tea-Party-Abgeordneten beherrscht<br />
wird. Sie stellt sich jedem vernünftigen<br />
Kompromiss in den Weg, bei<br />
Waffengesetzen, bei der Krankenversicherung,<br />
beim Klimaschutz.<br />
Und in New York fragen sie sich nun,<br />
ob Bloombergs grünes Vermächtnis von<br />
Dauer sein wird. „Wir haben versucht,<br />
den Klimaschutz in die DNA dieser Stadt<br />
einzubauen, so dass er sich quasi von allein<br />
fortsetzt“, sagt Vizebürgermeister<br />
Holloway. Er zögert kurz. „Wir hoffen,<br />
dass uns das gelungen ist.“<br />
Veronica White weiß noch nicht, ob<br />
der neue Bürgermeister sie auf ihrem Posten<br />
lassen wird oder sie sich einen neuen<br />
Job suchen muss.<br />
In New Bern hat Tom Thompson seinen<br />
Ruhestand erst mal verschoben. Einer<br />
muss sich ja wehren gegen den Irrsinn.<br />
Er hat jetzt eine Sekretärin eingestellt.<br />
MARC HUJER, SAMIHA SHAFY<br />
Video: Mit Klimaskeptiker<br />
Tom Thompson am Hafen<br />
spiegel.de/app502013klima<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Ausland<br />
ROM<br />
Avanti tutti<br />
GLOBAL VILLAGE: Täglich übersetzt Radio Vatikan die Papstworte<br />
in 44 Sprachen – was unter Franziskus nicht immer leicht ist.<br />
Vieles ist anders, seit Franziskus<br />
Papst wurde. Das sieht man am<br />
besten am Mittwoch, dem Tag der<br />
Generalaudienz: Wie immer um 9.30 Uhr,<br />
eine Stunde früher als sein Vorgänger,<br />
fährt Franziskus im Papamobil über den<br />
Petersplatz. Es ist der inoffizielle Teil, der<br />
ihm und den Pilgern am meisten Spaß<br />
macht, das ist nicht zu übersehen.<br />
Ein Carabiniere wirft Franziskus eine<br />
Kusshand zu. Drei Schüler fangen seine<br />
weiße Kappe und setzen sie auf. Der<br />
Papst nimmt argentinische Fußballtrikots<br />
entgegen, küsst 14 Kinder<br />
und geht auf einen Mann zu,<br />
der keine Nase hat. Er legt<br />
seine Stirn an die Stirn des<br />
Mannes und sagt: „Bete für<br />
mich.“<br />
Keine 500 Meter entfernt<br />
sitzt Anne Preckel von Radio<br />
Vatikan in einem schmucklosen<br />
Gebäude vor dem Fernseher<br />
und verfolgt die Live-<br />
Übertragung. Die Westfälin,<br />
34 Jahre alt, ist an diesem<br />
Mittwoch für die tägliche Radiosendung<br />
verantwortlich.<br />
Seit fünf Jahren ist sie in<br />
Rom, eine kritische Katholikin,<br />
wie sie selbst sagt. Ihr<br />
Computer steht auf einem<br />
Stapel Bücher, das dickste<br />
heißt: „Die Kanzel in der<br />
DDR“. Die Predigt beginnt, der Papst<br />
spricht Italienisch, und Anne Preckel hört<br />
aufmerksam zu.<br />
Franziskus redet über die Bedeutung<br />
der Beichte; er sagt, dass selbst er beichte,<br />
denn auch er sei ein Sünder. Preckel<br />
kennt diese Sätze, Franziskus sagt sie oft,<br />
noch besteht kein Grund zur Unruhe.<br />
Dann blickt er auf, schaut in die Menge,<br />
seine Stimme ist tiefer, fester. Er stellt<br />
Fragen und improvisiert Dialoge, um seine<br />
Zuhörer zu fesseln. Diese Stellen sind<br />
gefährlich. Denn dieser Papst liebt die<br />
freie, spontane Rede. Es kommt jetzt auf<br />
jedes Wort an. Ein aus dem Zusammenhang<br />
gerissener Satz kann ungewollt fatale<br />
Wirkung entfalten, wie 2006, als<br />
Papst Benedikt XVI. sein vermeintlich islamkritisches<br />
Zitat in Regensburg sprach.<br />
Oder eine spontane Äußerung sorgt für<br />
Aufregung, wie im Juli, als Franziskus<br />
nach seiner Brasilienreise vor Preckels<br />
Kollegen über Schwule, Finanzen und<br />
Frauenämter in der Kirche redete.<br />
110<br />
Anne Preckel ist eine von 400 Angestellten<br />
aus 60 Ländern bei Radio Vatikan,<br />
einer Art Vereinte Nationen im Kirchenstaat.<br />
Täglich übersetzen sie hier die Worte<br />
des Papstes in 44 Sprachen und senden<br />
sie in 39 Radioprogrammen um den Globus.<br />
Kein leichter Job, vor allem, seit es<br />
diesen neuen, unberechenbaren Papst<br />
gibt, von dem niemand weiß, was er als<br />
Nächstes sagen wird.<br />
Anne Preckel hört jetzt, wie Franziskus<br />
sagt: „Schämt euch nicht, eure Sünden<br />
zu beichten. Besser einmal rot werden<br />
Radiojournalistin Preckel: Mehr Arbeit, aber lustiger<br />
als tausendmal gelb.“ Zum ersten Mal an<br />
diesem Morgen lacht sie. Ein typischer<br />
Franziskus-Satz ist das, scheinbar banal,<br />
doch sehr authentisch.<br />
„Dieser Papst spricht täglich seine Morgenandacht,<br />
er scherzt gern und hält nicht<br />
viel von Manuskripten, die vom Staatssekretariat<br />
geprüft wurden“, sagt Preckels<br />
Chef, Jesuitenpater Andrzej Koprowski.<br />
„Wir schwitzen hier manchmal, denn wir<br />
müssen überlegen: Ist der Witz auf Mandarin<br />
verständlich? Stimmt die Übersetzung<br />
auf Kisuaheli? Versteht man ihn im<br />
Senegal?“<br />
Koprowski ist der Programmdirektor<br />
von Radio Vatikan, ein feiner älterer Herr,<br />
er spricht Italienisch mit polnischem Akzent;<br />
Johannes Paul II. hat ihn 1983 nach<br />
Rom geholt. Er war damals so etwas wie<br />
ein Übersetzer des Umbruchs: Solidarność,<br />
Perestroika, Mauerfall in Berlin.<br />
Jetzt ist er voll beschäftigt mit Franziskus’<br />
Revolutionen. Dessen volksnaher Stil sei<br />
einigen zu oberflächlich, sagt Koprowski.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
„Sie vermissen das Barocke, das Schwe -<br />
re, das sie mit der Wichtigkeit des Papstamtes<br />
verbinden. Aber mir fehlt da<br />
nichts.“<br />
Franziskus ist ein Papst der starken Verben,<br />
fand eine Mailänder Zeitschrift her -<br />
aus, die seine Reden der ersten sieben Monate<br />
ausgewertet hat. Er spricht oft von<br />
„camminare“, gehen, von „ascoltare“, zuhören.<br />
Sagt oft „avanti“, vorwärts. Lenkt<br />
den Blick nach draußen, „fuori“, an die<br />
Ränder der Gesellschaft. Spitzenreiter unter<br />
den 106000 analysierten Papstwörtern<br />
sind „tutto“ und „tutti“, alles<br />
und alle. Kaum vor handen in<br />
seinem aktiven Wortschatz:<br />
Strafe, Disziplin, Macht.<br />
„Er macht uns mehr Arbeit<br />
als sein Vorgänger, aber<br />
er ist auch lustiger“, sagt<br />
Anne Preckel. Die Mitarbeiter<br />
von Radio Vatikan übersetzen<br />
nicht einfach nur den<br />
Papst. Sie müssen auch auswählen,<br />
einordnen und in -<br />
terpretieren, bei Franziskus<br />
mehr als bei Benedikt.<br />
Was aus den Papstworten<br />
wird und auf welchen We -<br />
gen sie die Gläubigen erreichen,<br />
könnte unterschied -<br />
licher nicht sein: In China<br />
lauschen verfolgte Christen<br />
heimlich; in afrikanischen<br />
Programmen spielen sie viel Musik. Als<br />
besonders liberal und anspruchsvoll gelten<br />
die Programme der Deutschen, Franzosen<br />
und Polen.<br />
An diesem Mittwoch dauert Franziskus’<br />
Audienz bis zur Mittagszeit. Er bestaunt<br />
jetzt die Bilder der Kinder, sie haben<br />
einen Mann in weißem Kleid gemalt.<br />
„Wer ist denn dieser hässliche Mann?“,<br />
fragt der Papst, und die Kinder kreischen:<br />
„Aber das bist doch du!“<br />
Auch das wird aufgezeichnet und archiviert,<br />
wie alles, was der Papst spricht. Die<br />
gesammelten Papstworte lagern in einem<br />
Geheimgang zwischen Engelsburg und Vatikan.<br />
Wenn dieser Papst weiterhin so viel<br />
redet, sagen sie bei Radio Vatikan, könnte<br />
es dort eines Tages eng werden.<br />
FIONA EHLERS<br />
MARCO DI LAURO / GETTY REPORTAGE / DER SPIEGEL<br />
Video: Anne Preckel<br />
bei der Arbeit<br />
spiegel.de/app502013vatikan<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Szene<br />
Wurster (l.) bei der Probe<br />
THEATER<br />
„Ein Husarenstück“<br />
Theaterregisseur Johann Jakob Wurster,<br />
51, über sein Willy-Brandt-Stück<br />
„Willy 100 – Im Zweifel für die Freiheit“,<br />
das an diesem Donnerstag im<br />
Neuen Stadthaus Berlin Premiere hat<br />
SPIEGEL: Ihr Stück spielt 1936, als Willy<br />
Brandt aus seinem norwegischen Exil<br />
nach Berlin zurückkehrte und dort wochenlang<br />
unter falschem Namen lebte.<br />
Warum erzählen Sie ausgerechnet diese<br />
Episode aus seinem<br />
Leben?<br />
Wurster: Weil sie<br />
ihn geprägt hat.<br />
Brandt war damals<br />
Anfang zwanzig,<br />
noch sehr naiv. Er<br />
kam mit einem norwegischen<br />
Pass<br />
nach Berlin, unter<br />
dem Namen Gunnar<br />
Gaasland, und<br />
dachte, er müsse<br />
die Menschen bloß<br />
mobilisieren, ein<br />
bisschen auf sie einreden,<br />
und schon<br />
beginne der Aufstand<br />
gegen Hitler.<br />
Doch er täuschte sich. Viele Deutsche<br />
hatten sich mit den Nazis arrangiert,<br />
es herrschte sogar eine Art Euphorie.<br />
SPIEGEL: Woran lag das?<br />
Wurster: Die Olympischen Spiele waren<br />
gerade erst vorbei, die Begeisterung<br />
über dieses große Fest war noch<br />
überall zu spüren. Der Afroamerikaner<br />
Jesse Owens hatte vier Goldmedaillen<br />
gewonnen, man konnte sich<br />
also einreden, man sei weltoffen.<br />
Doch Brandt spürte, dass dies trügerisch<br />
war.<br />
SPIEGEL: Er nahm schon damals erste<br />
Anzeichen wahr, dass <strong>Deutschland</strong> auf<br />
einen Krieg zusteuerte.<br />
Wurster: Ja, genau. Weil er von außen<br />
kam, hatte er einen klareren Blick auf<br />
<strong>Deutschland</strong> und konnte die Zeichen<br />
lesen. Einmal wurde er von der Polizei<br />
vernommen, der Pass wurde ihm abgenommen.<br />
Er erfuhr die Repressionen<br />
dieses Systems am eigenen Leib und<br />
entkam den Nazis mit knapper Not.<br />
SPIEGEL: Willy, der Thriller-Held?<br />
Wurster: In gewisser Weise schon.<br />
Wir machen uns den jugendlichen<br />
Übermut Brandts zunutze, um spannende<br />
oder auch aberwitzige Situa -<br />
tionen zu erzeugen. Wir zeigen ihn<br />
nicht als moralinsauren Widerstandskämpfer.<br />
Wir erzählen von einem<br />
Husarenstück als Beispiel für Mut und<br />
Zivilcourage.<br />
SPIEGEL: Verklären Sie ihn da nicht?<br />
Wurster: Wir zeigen auch seine düstere<br />
Seite, seine Neigung zum Rückzug, die<br />
spätere Depressionen erahnen lässt.<br />
Manchmal war er antriebslos, wollte<br />
einfach nur schlafen, um sich den Dingen<br />
nicht stellen zu müssen. Aus diesen<br />
Stimmungen musste er immer wieder<br />
herausgeholt werden.<br />
SPIEGEL: Warum hat Brandt über diese<br />
zwei Monate in Berlin in seiner Autobiografie<br />
so wenig geschrieben?<br />
Wurster: In den fünfziger und sechziger<br />
Jahren wurde er in <strong>Deutschland</strong> wegen<br />
seiner Zeit im Widerstand oft als<br />
Vaterlandsverräter beschimpft. Das<br />
hat ihn zutiefst verletzt.<br />
KINO IN KÜRZE<br />
„My Beautiful Country“ erzählt<br />
von einer Liebe zwischen den Fronten<br />
während des Kosovo-Krieges 1999. Der<br />
verletzte UĆK-Kämpfer Ramiz (Mišel Matičević)<br />
flüchtet in ein serbisches Dorf<br />
und beginnt eine Affäre mit der jungen<br />
Witwe Danica (Zrinka Cvitešić). Die in<br />
<strong>Deutschland</strong> geborene Regisseurin Michaela<br />
Kezele erzählt gefühlvoll von<br />
Menschen, die an Leib und Seele versehrt<br />
sind und sich deshalb aneinanderklammern.<br />
Doch statt sich auf das Paar<br />
zu konzentrieren, lässt sie sich oft von<br />
den vielen Figuren ablenken, die sie<br />
durch die Handlung treibt.<br />
Kühnert (l.) in „Die Frau, die sich traut“<br />
X-VERLEIH<br />
Darsteller Matičević, Cvitešić<br />
MOVIENE<br />
„Die Frau, die sich traut“, ist um die fünfzig und bereits Großmutter, als sie den<br />
Entschluss fasst, sich einen Jugendtraum zu erfüllen: Sie will den Ärmelkanal durchschwimmen.<br />
Die große deutsche Schauspielerin Steffi Kühnert, bekanntgeworden<br />
durch die Filme von Andreas Dresen, brilliert in der Titelrolle. Sie gibt ihrer Figur eine<br />
Mischung aus tiefer Verzweiflung, wilder Entschlossenheit und nagender<br />
Angst vor der eigenen Courage. Der von Marc Rensing inszenierte Film ist<br />
leider nicht ganz so sportlich wie seine Heldin. Er geht etwas in die Breite,<br />
weil er ein buntes Allerlei von Konflikten zwischen der Hauptfigur und<br />
ihren Liebsten anzettelt.<br />
114<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Kultur<br />
Mey Mitte der siebziger Jahre<br />
POP<br />
Unter den Wolken<br />
Es ist so einfach, sich über Reinhard Mey lustig zu machen. Dabei dürfte es niemanden<br />
geben, der das Lebensgefühl seiner Generation so genau vertont hat wie<br />
er. Mey, 70, war der gute Westdeutsche. Unideologisch, außer, wenn es gegen<br />
den Krieg ging. Beseelt von dem Glauben, dass viele kleine Schritte die Welt<br />
besser machen können. Weltoffen und frankophil. Selbstdiszipliniert und mit<br />
dem Herzen ein bisschen links. Verträumt und doch pragmatisch, mit Pilotenschein<br />
und der Sehnsucht nach der großen Freiheit – aber geprägt von dem Wissen<br />
des Nachkriegskindes, dass das echte Leben unter den Wolken stattfindet.<br />
All das lässt sich nun auf den vier CD-Boxen der „Jahreszeiten“-Edition nach -<br />
hören, die pünktlich zum Weihnachtsgeschäft noch einmal Meys 26 Studioalben<br />
präsentieren. Von „Ich wollte wie Orpheus singen“ (1967) bis zu „Dann mach’s<br />
gut“ (2013). Es ist die alte Bundesrepublik, der man hier zuhören kann, das<br />
Milieu derjenigen, die zusammen mit ihr groß geworden sind und die heute<br />
manchmal die Welt nicht mehr verstehen.<br />
T. SUCHEFORT / ACTION PRESS<br />
LITERATUR<br />
Schatten und Stille<br />
In dieser Woche wird Alice Munro der<br />
Literaturnobelpreis verliehen, und selten<br />
waren sich Leser und Kritiker so<br />
einig, dass die Auszeichnung die Richtige<br />
getroffen hat. Die Einstimmigkeit<br />
der Begeisterung ist fast schon ein wenig<br />
langweilig. Doch dann nimmt man<br />
Munros neues Buch zur Hand, den Erzählband<br />
„Liebes Leben“. Die darin<br />
versammelten 14 Geschichten handeln<br />
von der Vergänglichkeit des Lebens,<br />
und nach der Lektüre bleibt die hell<br />
leuchtende Überzeugung: wie gut,<br />
dass Munro für ihre hohe, aber stille<br />
Könnerschaft endlich angemessen gewürdigt<br />
wird. Seit je hat die kanadische<br />
Autorin die Lebensgeschichten<br />
von Frauen in den Mittelpunkt ihrer<br />
Kurzgeschichten gerückt und bereits<br />
früh davon erzählt, wie die Träume ihrer<br />
Protagonistinnen in Vergeblichkeit<br />
münden, weil das Leben seinen Lauf<br />
nimmt. Auf 20, 30<br />
Seiten entwickelt<br />
sie den Reichtum einer<br />
Biografie, als ob<br />
sie einen Roman geschrieben<br />
hätte. Die<br />
Ungewissheit, die<br />
ihre Figuren umgibt,<br />
macht ihre Erzählungen<br />
manchmal<br />
so spannend wie<br />
Krimis. In der Geschichte<br />
„Kies“<br />
etwa, in der ein kleines<br />
Mädchen mit<br />
Mutter und Schwester<br />
in einen Wohnwagen<br />
am Rand einer<br />
Kiesgrube zieht,<br />
rückt der Schatten,<br />
Alice Munro<br />
Liebes Leben<br />
Aus dem Englischen<br />
von Heidi<br />
Zerning. S. Fischer<br />
Verlag, Frankfurt<br />
am Main; 368 Seiten;<br />
21,99 Euro.<br />
der das Leben des Mädchens nie mehr<br />
verlassen wird, Seite für Seite näher,<br />
von Munro präzise und meisterlich<br />
beschrieben. Das Besondere an dem<br />
neuen Erzählband sind die letzten vier<br />
Geschichten, die, so die Autorin, „vom<br />
Gefühl her autobiografisch“ seien.<br />
Dem Leser wird nahegelegt, dass<br />
Munros Vater mit einer Farm für Pelztiere<br />
pleiteging, dass ihre Mutter eine<br />
gespreizte Person war, die später an<br />
Parkinson litt. Diese vier Erzählungen<br />
zeigen, dass die leicht anachronistische<br />
ländliche Welt ihrer Geschichten<br />
auch die Welt Alice Munros war. Und<br />
sie offenbaren, dass die 82-jährige<br />
Schriftstellerin ihr eigenes Leben mit<br />
jener liebevollen, aber unsentimentalen<br />
Schärfe betrachten kann, die ihr<br />
gesamtes Werk auszeichnet.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 115
Kultur<br />
KINO<br />
Der Rächer<br />
In Bollywood ist die Frau entweder Göttin oder<br />
Dienerin. In der Wirklichkeit erschüttern<br />
Vergewaltigungen das Land. Ein indischer Filmproduzent<br />
will beides nicht mehr hinnehmen. Von Hauke Goos<br />
Drei Tage bevor in Delhi das Urteil<br />
gegen vier der jungen Männer gesprochen<br />
wird, die im vergangenen<br />
Dezember eine junge Frau zu Tode<br />
vergewaltigten, steigt Siddhartha Jain die<br />
Treppe nach oben in den Schneideraum<br />
seiner Firma. Die Decke ist so niedrig,<br />
dass er leicht gebückt steht, die Jalousien<br />
sind heruntergelassen, vor dem Bildschirm<br />
sitzt der Cutter.<br />
Jain ist Filmproduzent, er trägt eine<br />
gelbe Brille und gelbe Schuhe, die im<br />
Halbdunkel aussehen, als würden sie<br />
leuchten. Er ist 39 Jahre alt und lebt in<br />
Mumbai, mit seiner Firma iRock hat er<br />
Filme produziert, die „Ragini MMS“ heißen<br />
oder „Disco Valley“. Low Budget,<br />
das aussehen soll wie großes Kino.<br />
Es ist das erste Mal, dass er jemandem<br />
den Rohschnitt zeigt, rund zweieinhalb<br />
Stunden Material; der Cutter soll das<br />
Ganze auf 90 Minuten kürzen. Das Filmplakat<br />
ist fertig, es hängt an der Wand.<br />
„Kill the Rapist“, schwarze Buchstaben<br />
auf blutrotem Grund, „Töte den Vergewaltiger“.<br />
„Feinsinnigkeit funktioniert in Indien<br />
nicht“, sagt Jain. „Vergewaltigung ist<br />
Produzent Jain: „Ich schäme mich, Inder zu sein“<br />
116<br />
nicht feinsinnig. Wenn es um Vergewaltigung<br />
geht, muss die Haltung unmissverständlich<br />
sein.“ Und dann sagt er: „Ich<br />
schäme mich, Inder zu sein. Es ist krank.<br />
Dieses Jahrzehnt wird als das schandvollste<br />
Jahrzehnt für indische Männer in die<br />
Geschichte eingehen. Wie können wir<br />
hinnehmen, was hier passiert?“<br />
Am 16. Dezember 2012 wurde in Delhi<br />
eine junge Frau in einem Bus überfallen,<br />
von sechs Männern. Sie vergewaltigten<br />
sie, bissen ihr in Brust und Genitalien,<br />
schließlich stießen sie der Frau eine Eisenstange<br />
in die Vagina. 13 Tage lang<br />
kämpften die Ärzte um ihr Leben, dann<br />
erlag sie ihren Verletzungen. Nach ihrem<br />
Tod gingen in ganz Indien die Menschen<br />
auf die Straße. „Das Land stand für zwei<br />
Tage still“, sagt Jain.<br />
Jains Film hat ein Budget von einer<br />
Million Dollar. Jeweils etwa 100000 Dollar<br />
gaben zwei Frauen, die anonym<br />
bleiben wollen, Jain nennt sie „passion<br />
investors“, Geldgeberinnen mit einer<br />
Mission; der Rest ist sein Erspartes.<br />
Der Film erzählt die Geschichte dreier<br />
junger Frauen, die zusammen in einem<br />
Häuschen wohnen: eine moderne Frau<br />
mit wechselnden Männer be -<br />
kanntschaften, die sich für<br />
Menschenrechte engagiert; ei -<br />
ne eher traditionelle Frau, verlobt,<br />
die in der Vergangenheit<br />
vergewaltigt wurde, was sie<br />
niemandem erzählt hat, nicht<br />
einmal ihren Eltern. Und die<br />
Hauptdarstellerin, die gerade<br />
Single ist. Zu Beginn des Films<br />
wird sie nachts in ihrem Auto<br />
von einem Mann überfallen.<br />
Sie kann sich befreien und<br />
fliehen, sie geht zur Polizei,<br />
aber die Polizisten unternehmen<br />
nichts, es sei schließlich<br />
nichts passiert, sagen sie.<br />
Der Cutter springt zur<br />
nächsten Szene. Die Hauptdarstellerin<br />
ist allein zu Haus,<br />
die Wohnungstür öffnet sich,<br />
der Mann aus dem Auto<br />
kommt rein, schwarzer Bart,<br />
TANVI MISHRA / AG. FOCUS/ DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
IROCK<br />
Szene aus „Kill the Rapist?“: Eine griechische<br />
das Hemd offen. Der Eindringling reißt<br />
das Telefonkabel raus, zertritt ihr Handy.<br />
Er packt sie, reißt an ihren Haaren, sie<br />
wehrt sich, er zieht ein Springmesser.<br />
„Sehen Sie“, ruft Jain, „wie er sich verändert?<br />
Er schmeichelt, er droht. Man<br />
spürt, dass er labil ist.“<br />
Auf dem Bildschirm schlägt der Mann<br />
der Frau hart ins Gesicht. „Sorry, sorry,<br />
sorry, sorry“, ruft er.<br />
„Sehen Sie, es macht ihm Spaß“, flüstert<br />
Jain. „Für ihn ist es ein Spiel.“<br />
Irgendwann erwischt die Frau eine Flasche<br />
mit Bienengift, sie sprüht dem Mann<br />
das Gift ins Gesicht, für einen Moment<br />
ist er nahezu blind. Sie stößt ihn in einen<br />
Schaukelstuhl und fesselt ihn.<br />
Das, sagt Jain feierlich, ist der Moment,<br />
in dem sich das Machtverhältnis umkehrt.<br />
Der Moment, in dem die Frauen sich ent-
Tragödie, übertragen in die indische Gegenwart<br />
scheiden müssen: Sollen sie den Mann<br />
laufen lassen? Sollen sie erneut zur Polizei<br />
gehen? Oder sollen sie ihn töten? Womöglich<br />
seine Geschlechtsteile abhacken?<br />
Lassen sie ihn laufen, wird er wiederkommen.<br />
Gehen sie zur Polizei, wird er sich<br />
rächen, sobald er wieder frei ist. Eine griechische<br />
Tragödie, übertragen in die indische<br />
Gegenwart. Ein Film, das hofft Jain,<br />
über den Indien diskutieren wird.<br />
Ein Wahnsinnsprojekt, einerseits: ein<br />
Riesenland wie Indien, rund 1,2 Milliarden<br />
Menschen, mit einem einzigen Film<br />
aufrütteln und ändern zu wollen.<br />
Andererseits: Das ist nötig, in diesem<br />
Jahr der Schande, in dem sich bereits die<br />
Nachrichten aus nur einer Woche lesen<br />
wie ein Bericht von einer Welt im Untergang:<br />
„Teenager wegen Vergewaltigung<br />
eines einjährigen Babys festgenommen“ –<br />
„21 Jahre alter Mann verhaftet, weil er<br />
taubstummes Mädchen vergewaltigte“ –<br />
„50 Jahre alte Frau vergewaltigt und ermordet“<br />
– „Mann bekommt 7 Jahre für<br />
Vergewaltigung Minderjähriger“ – „5 Jahre<br />
altes Mädchen von Mann in Park<br />
vergewaltigt“.<br />
Im März wurde eine Schweizer Touristin<br />
während einer Fahrradtour von sechs<br />
Männern vergewaltigt. Im Juli geschah es<br />
einer amerikanischen Fotografin in einer<br />
aufgelassenen Fabrik in Mumbai. Kürzlich<br />
veröffentlichte das National Crime Records<br />
Bureau in Delhi die Statistik für<br />
2012. Alle 21 Minuten wird in Indien eine<br />
Frau vergewaltigt, 24923 Fälle waren es<br />
insgesamt. Die Zahl der Fälle, die nicht<br />
angezeigt werden, ist 10- bis 100-mal so<br />
groß, je nachdem, wen man fragt. Entführungen<br />
von Frauen oder Mädchen:<br />
38262. Körperverletzung von Frauen:<br />
45351. Misshandlung von Frauen durch<br />
Ehemänner oder Verwandte: 106527.<br />
Bereits nach dem Tod der jungen Frau<br />
aus dem Bus in Delhi richtete Jain Ende<br />
Dezember eine Facebook-Seite ein, er<br />
nannte sie „Kill the Rapist“. Die Zahl der<br />
„Likes“ wuchs schnell auf mehr als<br />
30000, und viele schrieben dazu: Nicht<br />
einfach töten, das reicht nicht. Erst foltern,<br />
dann töten. Sechs Monate arbeiteten<br />
sie bei iRock an dem Script, im März begannen<br />
sie mit dem Casting. Während<br />
der Dreharbeiten war die Stimmung mitunter<br />
so angespannt, dass die Hauptdarstellerin<br />
vergaß, dass sie nur eine Rolle<br />
spielte, und hart zuschlug, wenn sie sich<br />
gegen den Hauptdarsteller wehren sollte.<br />
„Der Film muss unsere Art und Weise<br />
zu denken verändern, er muss etwas aus-<br />
DER SPIEGEL 50/2013 117
Filmschauspieler Ranjeet: Etwas mehr Haut, etwas mehr Dekolleté<br />
118<br />
lösen“, sagt Jain. „Ich habe eine Verantwortung,<br />
eine einmalige Gelegenheit. Ich<br />
darf sie nicht vorübergehen lassen.“<br />
Indien ist krank“, das sagt Dr. Harish<br />
Shetty, Psychiater am Hiranandani-<br />
Krankenhaus im Norden von Mumbai.<br />
„Indien leidet seit einigen Jahren an einem<br />
chronischen Katastrophensyndrom.<br />
Nach jeder Katastrophe, nach Erdbeben<br />
ebenso wie nach schweren Unruhen,<br />
kann man beobachten, dass ganz normale<br />
Menschen plötzlich plündern und vergewaltigen.<br />
Ich habe es selbst gesehen.“<br />
Shetty, ein kleiner, energischer Mann,<br />
arbeitet zwei Tage in der Woche im Krankenhaus,<br />
seine übrige Zeit widmet er<br />
NGOs. Ein ganzes Jahr lang arbeitete er<br />
mit Erdbebenopfern. Außerdem tritt Shetty<br />
als Gutachter bei Vergewaltigungsprozessen<br />
auf, er spricht mit Tätern ebenso<br />
wie mit Opfern.<br />
Gerade hat er den Fall eines Waisenhausgründers<br />
begutachtet. Der Mann hatte<br />
zusammen mit Angestellten 19 geistig<br />
zurückgebliebene Mädchen vergewaltigt<br />
und gequält. Für die Täter, sagt Shetty,<br />
seien das keine Verbrechen, es sei Spaß<br />
gewesen. Ein Spiel, nicht mehr.<br />
Der Anteil von Verurteilungen liegt bei<br />
Vergewaltigungsprozessen zwischen null<br />
und etwa 45 bis 50 Prozent, je nach Bundesstaat.<br />
Shetty sagt: „In der allgemeinen<br />
Anarchie Indiens haben die Menschen<br />
das Gefühl, dass Taten keinerlei Konsequenzen<br />
haben. Nichts passiert.“<br />
Für Heranwachsende sei das Leben wie<br />
ein Videospiel, mit sich selbst als Schauspieler;<br />
ein Effekt, der durch die Berichterstattung<br />
der Medien noch verstärkt werde.<br />
„Wenn Verbrecher von der Vergewaltigung<br />
in Delhi lesen, sagen sie sich: Lasst<br />
uns das übertreffen!“<br />
Vergewaltigung sei nur ein Teil des Problems,<br />
seit die Globalisierung das Land<br />
ins 21. Jahrhundert katapuliert habe, „beobachten<br />
wir eine Zunahme der Gewalt<br />
in allen Lebensbereichen“.<br />
Häufig sind es Frauen und Männer aus<br />
der Mittelschicht, die zu Shetty kommen.<br />
Die Frauen suchen Schutz vor ihren Männern,<br />
die Männer suchen Schutz vor sich<br />
selbst. Und dabei spiele auch, sagt Shetty,<br />
das indische Kino eine Rolle, das mit rund<br />
tausend Filmen pro Jahr die größte Filmindustrie<br />
der Welt ist.<br />
Shetty sagt: Drei Generationen indischer<br />
Filme haben von Frauen ein un -<br />
vorteilhaftes Bild gezeichnet. „In jedem<br />
Hindi-Film wird gesungen. In jedem Lied<br />
geht es darum, dass der Hauptdarsteller<br />
eine Frau umwirbt. Am Anfang neckt er<br />
Vergewaltigungsszenen sind<br />
im Kino Indiens so etwas<br />
wie das Erkennungszeichen<br />
für den Bösewicht.<br />
sie. Irgendwann wird sie böse und sagt:<br />
Son of a bitch! Aber schon am Ende des<br />
Songs lächelt sie zum ersten Mal. Die beiden<br />
kommen also zusammen. Das ist der<br />
Weg, eine Frau zu erobern. Es spielt keine<br />
Rolle, ob sie ja sagt oder nein. Das ist die<br />
subtile Botschaft: Tanz um die Frau her -<br />
um, berühr sie, versuch, sie zu umarmen,<br />
komm ihr so nah wie möglich. Erst wird<br />
sie ärgerlich werden, aber dann wird sie<br />
nachgeben.“ Alle Filme haben diese Botschaft<br />
transportiert, seit den Sechzigern.<br />
Frauen werden als Objekte präsentiert.<br />
Es geht nicht um Liebe, sondern um Beherrschung,<br />
um Macht.<br />
Nahezu alle Bollywood-Filme zeigen<br />
einen Mann, der unangemessen um eine<br />
Frau wirbt, sagt Shetty. „In einer Weise,<br />
die an sexuelle Belästigung grenzt. Und<br />
er kommt damit durch. Diese Filme zeigen<br />
den Mann als Raubtier.“<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
TANVI MISHRA / AG. FOCUS/ DER SPIEGEL<br />
Mit der Wirklichkeit hat das wenig zu<br />
tun. „Indische Frauen essen weniger als<br />
Männer, sie schlafen weniger, sie arbeiten<br />
mehr“, sagt Shetty. „Die indische Frau<br />
ist immer noch eine Märtyrerin. Eine Ikone<br />
der Opferbereitschaft.“<br />
Indien ist ein Land der Ambivalenz,<br />
verschiedene Kasten, verschiedene Ethnien,<br />
verschiedene Religionen, verschiedene<br />
Sprachen, Tausende Götter. Eine<br />
Wundertüte, ein Monstrum. Und das, was<br />
dieses Land beschäftigt, seine Konflikte,<br />
seine Wirklichkeiten, das, womit es sich<br />
beschäftigt, das alles zeigt Bollywood.<br />
Ranjeet wohnt im Stadtteil Juhu in Mumbai,<br />
er ist Schauspieler seit über 40 Jahren,<br />
der bekannteste Bösewicht Indiens.<br />
Sein Haus, dreigeschossig, unter alten<br />
Bäumen, kaum 150 Meter vom Ozean entfernt,<br />
steht in einer Privatstraße. Ein Lift<br />
mit Scherengitter geht hinauf in den<br />
dritten Stock, auf eine weitläufige Dach -<br />
terrasse mit Swimmingpool, Nischen und<br />
kleinen Treppen, Säulen und Palmen,<br />
dazu ein Springbrunnen.<br />
Ranjeet, eingehüllt in eine schwarze<br />
Choga, auf dem Kopf eine Art Piratentuch,<br />
groß, schlank, ist der schwarze Prinz<br />
des indischen Kinos. 1942 geboren, in der<br />
Nähe von Amritsar in Punjab, aufgewachsen<br />
in Delhi. Er war 19, als er das erste<br />
Mal ins Kino ging, er war 26, als er seinen<br />
ersten Film drehte, nach ein paar Jahren<br />
als Pilot bei der Luftwaffe.<br />
Die Vergewaltigungsszene, sagt Ranjeet,<br />
ist so etwas wie das Erkennungszeichen<br />
für den Bösewicht. Man kann zeigen,<br />
dass er trinkt, dass er raucht, dass er<br />
flucht, damit ihn das Publikum sofort als<br />
Bösen erkennt. Oder man lässt ihn eine<br />
Frau vergewaltigen.<br />
„Die Zuschauer lieben diese Szenen“,<br />
sagt Ranjeet. In der ersten Reihe im Kino<br />
sind die billigsten Plätze, dort sitzen Menschen<br />
aus den unteren Schichten, meistens<br />
Männer, viele von ihnen gehen allein<br />
ins Kino. „Sie lieben den Bösewicht. Er<br />
tut, was sie nicht tun können. Sie bewundern<br />
ihn dafür.“<br />
Irgendwann lud Ranjeet seine Eltern<br />
nach Delhi ein, zu einer Filmpremiere.<br />
Als die erste Vergewaltigungsszene auf<br />
der Leinwand zu sehen war, standen sie<br />
auf und verließen den Saal. Er zerre den<br />
Namen der Familie in den Schmutz, warf<br />
ihm seine Mutter hinterher vor. „Du solltest<br />
dich schämen.“<br />
Stimmt es, dass er in seiner Karriere<br />
über einhundert Vergewaltigungsszenen<br />
gespielt hat?<br />
Ranjeet schaut überrascht, dann sagt<br />
er: „Einhundert Vergewaltigungsszenen?<br />
Das kann unmöglich stimmen.“ Eine weitere<br />
Pause. „Ich habe etwa 500 Filme gedreht.<br />
Es müssen also mehr als 600 Vergewaltigungsszenen<br />
gewesen sein.“<br />
Ranjeet gibt zu, dass die Vergewaltigung<br />
in einem Film häufig die einzige Ge-
Kultur<br />
legenheit ist, etwas mehr Haut zu zeigen<br />
als üblich. Der Frau den Sari von den<br />
Schultern zu reißen, beispielsweise, oder<br />
ihre Arme zu entblößen oder das Dekolleté<br />
anzudeuten.<br />
Sind solche Szenen schuld an der Gewalt<br />
gegen Frauen?<br />
„Falsch“, sagt Ranjeet. „Ganz falsch.“<br />
„Wir zeigen die Vergewaltigung, aber wir<br />
zeigen gleichzeitig auch die Konsequenzen.<br />
Der Bösewicht wird am Ende verhaftet.<br />
Oder getötet. Nie verherrlichen<br />
wir das Verbrechen. Im Übrigen gab es<br />
schon Vergewaltigungen, als es noch keine<br />
Kinofilme gab.“<br />
Nebenbei bemerkt, sagt Ranjeet, 71 Jahre<br />
alt, mit der Erfahrung von mehr als<br />
600 Filmvergewaltigungen, sei das indische<br />
Kino heute brutaler als früher. Als<br />
er anfing, kämpfte meistens Mann gegen<br />
Mann. Heute sind ständig Explosionen<br />
zu sehen, bei denen Unschuldige sterben.<br />
Für Siddhartha Jain ist Ranjeet einer<br />
der Helden seiner Jugend. Jain glaub -<br />
te lange, dass Vergewaltigungen im Film<br />
Unterhaltung sind; dass die Zu schauer<br />
den Unterschied kennen zwischen Film<br />
und Leben, zwischen Spiel und Wirk -<br />
lichkeit. Bis jener 16. Dezember pas -<br />
sierte.<br />
Am 16. Dezember, ein Jahr nach dem<br />
brutalen Überfall auf die junge Frau in<br />
Delhi, wird „Kill the Rapist?“ Premiere<br />
haben. Jain hat sich entschlossen, hinter<br />
den Filmtitel ein Fragezeichen zu setzen,<br />
das macht seinen Film ambivalenter.<br />
„Ich weiß, dass Vergewaltiger sich meinen<br />
Film nicht anschauen werden“, sagt<br />
Jain. „Aber die Filmposter werden ihn<br />
daran erinnern, in den Tagen und Wochen,<br />
in denen mein Film läuft: Wenn du<br />
eine Frau vergewaltigst, kriegen wir dich.<br />
Das Gesetz wird hinter dir her sein, das<br />
Opfer wird keine Ruhe geben. Deine Aussichten,<br />
ohne Strafe davonzukommen,<br />
sind sehr, sehr klein. Ich will Vergewaltigern<br />
Angst machen.“<br />
Es sei, sagt Jain, ein Männerproblem:<br />
„Es ist die Denkart der Männer, die wir<br />
verändern müssen. Es sind Männer, die<br />
diese Verbrechen begehen. Es sind Männer,<br />
die Frauen verachten. Und es sind<br />
Männer, die dafür sorgen, dass die bestehenden<br />
Gesetze nicht angewandt werden.<br />
In Indien haben immer die Männer die<br />
Regeln bestimmt. Die Frauen haben damit<br />
nichts zu tun. Sie sind die Opfer. Wir<br />
müssen uns ändern.“<br />
Aus dem Gewinn, den Jain mit „Kill<br />
the Rapist?“ macht, will er eine Stiftung<br />
finanzieren: „i Stop Rape!“<br />
Schauspieler wie Ranjeet, sagt Jain, haben<br />
aus dem Vergewaltigen einen Beruf<br />
gemacht, eine Karriere. „Er wurde fürs<br />
Vergewaltigen bezahlt. Er ist Indiens Mr.<br />
Rape.“<br />
Jain will ihn bitten, seine Stiftung zu<br />
unterstützen.<br />
◆<br />
DER SPIEGEL 50/2013 119
Kultur<br />
RELIGION<br />
„Ich hänge nicht an diesem Leben“<br />
Im Vatikan findet zurzeit jene Revolution statt, für die Hans Küng ein Leben lang<br />
gekämpft hat. Doch der Theologe ist am Ende seiner Kräfte und kann nur noch zuschauen.<br />
Ein Gespräch über den katholischen Frühling und die Hölle auf Erden<br />
SPIEGEL: Professor Küng, kommen Sie in<br />
den Himmel?<br />
Küng: Das hoffe ich doch sehr.<br />
SPIEGEL: Für die Hölle spräche, dass Sie<br />
in den Augen der Kirche ein Ketzer sind.<br />
Küng: Ich bin kein Ketzer, sondern ein kritischer<br />
Reformtheologe, der allerdings im<br />
Unterschied zu vielen seiner Kritiker<br />
nicht mittelalterliche Theologie, Liturgie<br />
und Kirchenrecht als Maßstab hat, sondern<br />
das Evangelium.<br />
SPIEGEL: Gibt es die Hölle überhaupt?<br />
Küng: Die Rede von der Hölle ist eine<br />
Warnung, dass ein Mensch seinen Lebenssinn<br />
völlig verfehlen kann. An eine ewige<br />
Hölle glaube ich nicht.<br />
SPIEGEL: Wenn Hölle heißt, den Sinn im<br />
Leben zu verlieren, ist das aber eine ziemlich<br />
diesseitige Vorstellung.<br />
Küng: Sartre sagt, die Hölle, das sind die<br />
anderen. Die Menschen bereiten sich die<br />
Hölle selber, zum Beispiel in Kriegen wie<br />
in Syrien oder auch in einem hemmungslosen<br />
Kapitalismus.<br />
SPIEGEL: Thomas Mann hat in seinem<br />
„Fragment über das Religiöse“ zugegeben,<br />
dass er an fast jedem Tag seines Lebens<br />
an den Tod dachte. Sie auch?<br />
Küng: Ich habe eigentlich von früh an mit<br />
meinem Tod gerechnet, weil ich dachte,<br />
bei dem wilden Leben, das ich führe, erreiche<br />
ich mein 50. Lebensjahr nicht. Jetzt<br />
bin ich überrascht, dass ich 85 Jahre alt<br />
bin und immer noch lebe.<br />
SPIEGEL: Sie sind 2008 zum letzten Mal<br />
Ski gefahren. Wie ist das, wenn man<br />
weiß, das ist jetzt das letzte Mal?<br />
Küng: Das letzte Mal in Lech hoch oben<br />
am Arlberg gestanden zu haben stimmt<br />
mich natürlich schon etwas wehmütig. Ich<br />
liebe die klare, kalte Luft der Alpen, hier<br />
habe ich mein oft gequältes Gehirn durchlüftet.<br />
Aber ich hadere nicht. Ich freue<br />
mich eher, dass ich noch mit 80 Jahren<br />
Ski fahren konnte.<br />
SPIEGEL: Sie sind ein alter, kranker Mann.<br />
Sie leiden unter einem Hörsturz, haben<br />
Arthrose und eine Makuladegeneration,<br />
die dazu führt, dass Sie bald nicht mehr<br />
lesen können.<br />
Küng: Das wäre das Schlimmste, nicht<br />
mehr lesen zu können.<br />
Das Gespräch führte der Redakteur Markus Grill.<br />
120<br />
Hans Küng<br />
ist einer der bekanntesten Theologen<br />
der Welt. Er wurde 1960 Professor für<br />
Fundamentaltheologie an der Universität<br />
Tübingen und zwei Jahre später von<br />
Papst Johannes XXIII. zum Konzilsberater<br />
ernannt. 1979 entzog ihm der Vatikan<br />
die Lehrerlaubnis. 1995 gründete er die<br />
Stiftung Weltethos, um den Dialog zwischen<br />
den Religionen zu fördern. Dieses<br />
Jahr veröffentlichte Küng, 85, den letzten<br />
Band seiner dreiteiligen Autobiografie:<br />
„Erlebte Menschlichkeit“.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
CIRA MORO / DER SPIEGEL<br />
SPIEGEL: Vor einem Jahr hat Ihr Arzt Parkinson<br />
bei Ihnen festgestellt.<br />
Küng: Dennoch arbeite ich noch jeden Tag<br />
intensiv. Allerdings nehme ich all dies als<br />
mahnende Vorboten des Todes. Auch meine<br />
Schrift wird klein und oft unlesbar, sie<br />
scheint fast zu verschwinden. Meine Finger<br />
versagen. Dass sich mein Allgemeinzustand<br />
verschlechtert hat, ist ein Faktum,<br />
aber ich kämpfe auch dagegen an.<br />
SPIEGEL: Wie?<br />
Küng: Ich schwimme täglich eine Viertelstunde<br />
hier im Haus, mache physiotherapeutische<br />
Übungen auf dem Boden, dazu<br />
Stimmübungen, Fingerübungen, konzentriere<br />
mich auf neue Aufgaben. Außerdem<br />
nehme ich täglich zehn verschiedene<br />
Tabletten.<br />
SPIEGEL: Sie haben mehr als 60 Bücher geschrieben,<br />
waren immer ein leistungsstarker<br />
Mensch, der gern Auseinandersetzungen<br />
eingegangen ist. In Ihrer Biografie<br />
fragen Sie sich, ob Sie bald nur noch ein<br />
Schatten Ihrer selbst sein werden.<br />
Küng: Die Diagnosen und Prognosen von<br />
Ärzten sind ja naturgemäß ungenau. Die<br />
Verschlechterung meiner Augen zum Beispiel<br />
geht langsamer voran als vorhergesagt.<br />
Vor zwei Jahren meinte mein Arzt,<br />
ich könne nur noch zwei Jahre lang lesen.<br />
Ich kann es immer noch! Aber ich lebe<br />
auf Abruf und bin bereit, jederzeit Abschied<br />
zu nehmen.<br />
SPIEGEL: Ihre Parkinson-Erkrankung wird<br />
fortschreiten.<br />
Küng: Letztes Jahr war zur Eröffnung der<br />
Olympischen Spiele in London Muhammad<br />
Ali zu sehen, der ebenfalls unter Parkinson<br />
leidet. Er wurde der ganzen Welt<br />
vorgeführt, stier und stumm, es war zum<br />
Erbarmen. Für mich eine schreckliche<br />
Vorstellung.<br />
SPIEGEL: Ihr Freund Walter Jens fiel vor<br />
neun Jahren in eine sich rasch verschlimmernde<br />
Demenz. In diesem Juni starb er.<br />
Küng: Ich habe ihn immer wieder besucht,<br />
auch kurz vor seinem Tod noch. Bis vor<br />
einigen Jahren hat sein Gesicht noch aufgeleuchtet,<br />
wenn ich kam. Aber in den<br />
letzten Jahren wusste er schon nicht<br />
mehr, ob ich ihn gestern oder vor einem<br />
Monat das letzte Mal besucht hatte.<br />
Schließlich hat er mich nicht mehr erkannt.<br />
Das war deprimierend, wenn man<br />
bedenkt, dass Jens, einer der bedeutends -<br />
ten Intellektuellen der Nachkriegszeit, in<br />
eine Art Kindheit zurückgefallen ist.<br />
SPIEGEL: War die Demenz auch für Jens<br />
schlimm oder nur für seine Angehörigen<br />
und Freunde?<br />
Küng: Wenn man ihn am Anfang seiner<br />
Krankheit fragte, wie es ihm gehe, sagte<br />
er fast immer, „schrecklich“ und „schlecht“.<br />
Gleichzeitig entwickelte er eine Freude<br />
an kleinen Dingen, an Kindern, Tieren<br />
und Süßigkeiten. Ich brachte ihm immer<br />
Schokolade mit, anfangs nahm er sie<br />
selbst, später steckte ich sie ihm in den<br />
Mund. Was Jens letztlich erlebte, war uns<br />
verschlossen. Aber das kann man von<br />
mir nicht erwarten, dass ich so einen Zustand<br />
in Kauf nehme.<br />
SPIEGEL: Sie haben 1995 zusammen mit<br />
Jens das Buch „Menschenwürdig sterben“
Papst Franziskus: „Auf dem Umschlag stand als Absender einfach „F., Domus Sanctae Marthae, Vaticano“<br />
FRANCO ORIGLIA / GETTY IMAGES<br />
veröffentlicht. Darf man als Christ seinem<br />
Leben selbst ein Ende setzen?<br />
Küng: Für mich ist das Leben eine Gabe<br />
Gottes. Aber Gott hat diese Gabe in meine<br />
eigene Verantwortung gegeben. Das<br />
gilt auch für die letzte Phase des Lebens,<br />
das Sterben. Der Gott der Bibel ist ein<br />
Gott der Barmherzigkeit und nicht ein<br />
grausamer Despot, der den Menschen<br />
möglichst lang in der Hölle seiner Schmerzen<br />
sehen will. Sterbehilfe kann also die<br />
ultimative, letztmögliche Lebenshilfe sein.<br />
SPIEGEL: Für die katholische Kirche ist es<br />
eine Sünde, ein Eingriff in die Souveränität<br />
des Schöpfergottes.<br />
Küng: Ich habe es nicht geschätzt, dass<br />
der Sprecher des Bischofs von Rottenburg<br />
sofort erklärte, was ich geschrieben habe,<br />
sei die Lehre von Herrn Küng und nicht<br />
die Lehre der Kirche. Eine kirchliche<br />
Hier archie, die sich bei Empfängnisverhütung,<br />
Pille und künstlicher Befruchtung<br />
so sehr geirrt hat, sollte jetzt nicht die<br />
gleichen Fehler machen bei den Fragen<br />
am Ende des Lebens. Unsere Situation<br />
im 21. Jahrhundert hat sich doch grundlegend<br />
geändert. Vor hundert Jahren war<br />
die durchschnittliche Lebenserwartung 45<br />
Jahre, die meisten Leute starben eines<br />
frühen Todes. Ich bin jetzt 85 Jahre alt,<br />
aber das ist eine künstliche Verlängerung<br />
meiner Lebenszeit, dank der zehn Tablet -<br />
ten am Tag, dank der Fortschritte der<br />
Hygiene und der Medizin.<br />
SPIEGEL: Haben Sie Angst vor langem<br />
Siechtum?<br />
Küng: Ich habe jedenfalls eine präzis formulierte<br />
Patientenverfügung gemacht<br />
und bin seit kurzem Mitglied in einer Sterbehilfeorganisation.<br />
Das heißt nicht, dass<br />
ich den Freitod anstrebe. Aber ich möchte<br />
für den Fall, dass meine Krankheit sich<br />
zuspitzt, die Garantie haben, in menschenwürdiger<br />
Weise sterben zu können.<br />
Nirgendwo in der Bibel steht, dass ein<br />
Mensch bis zum verfügten Ende durchhalten<br />
muss. Was „verfügt“ ist, ist uns<br />
verborgen.<br />
SPIEGEL: Um Sterbehilfe in Anspruch zu<br />
nehmen, müssten Sie in ein anderes Land<br />
fahren.<br />
Küng: Ich bin Schweizer Staatsbürger.<br />
SPIEGEL: Wie läuft das technisch ab? Rufen<br />
Sie dort an und sagen, ich möchte jetzt<br />
kommen?<br />
Küng: Ich habe noch keinen Fahrplan.<br />
Aber meine persönliche Sterbeliturgie<br />
habe ich in meinem letzten Memoirenband<br />
genau niedergelegt.<br />
SPIEGEL: Ein Pfarrer darf Ihnen nicht die<br />
Letzte Ölung geben.<br />
Küng: Ich werde einen Freund, der Priester<br />
und einer meiner Schüler ist, dabeihaben.<br />
SPIEGEL: In Goethes „Die Leiden des<br />
jungen Werther“ tötet sich die Haupt -<br />
figur aus Liebeskummer. Das Buch en -<br />
det mit dem Satz: „Kein Geistlicher hat<br />
ihn begleitet.“ Das ist die Position der<br />
Kirche.<br />
Küng: Ich habe mich immer dagegen gewehrt,<br />
dass man meine Einstellung zum<br />
Sterben als Protest gegen die kirchliche<br />
Autorität sieht. Ich will keine allgemeine<br />
Regel geben, ich entscheide nur für mich.<br />
Es wäre doch lächerlich, seinen Tod zu inszenieren<br />
als Protest gegen die kirch liche<br />
Autorität. Ich will aber bewirken, dass man<br />
das Thema offen und freundlich erörtert.<br />
Seit den nationalsozialistischen Massentötungen<br />
von Behinderten ist das Thema „aktive<br />
Sterbehilfe“ in <strong>Deutschland</strong> tabuisiert.<br />
SPIEGEL: Wer will sich aber als unheilbar<br />
Kranker seinen Angehörigen noch zu -<br />
muten, wenn Sterbehilfe gesellschaftlich<br />
akzeptiert ist?<br />
Küng: Natürlich besteht die Gefahr, die<br />
Sie beschreiben. Aber heute findet Sterbe -<br />
hilfe in einer Grauzone statt, weil sie verboten<br />
ist. Viele Ärzte erhöhen die Morphiumdosis,<br />
wenn’s drauf ankommt, und<br />
laufen Gefahr, sich strafbar zu machen.<br />
Einzelne Patienten, die solche Ärzte nicht<br />
finden, stürzen sich in Kliniken aus dem<br />
Fenster. Das ist doch unerträglich! Wir<br />
können diese Fragen nicht in das Belieben<br />
jedes Arztes legen, wir brauchen eine<br />
gesetzliche Regelung, nicht zuletzt auch<br />
zum Schutz der Ärzte.<br />
SPIEGEL: Hängt man am Ende nicht sehr<br />
am Leben und verpasst dann den richtigen<br />
Moment?<br />
DER SPIEGEL 50/2013 121
Küng: Das ist natürlich möglich.<br />
SPIEGEL: Hängen Sie am Leben?<br />
Küng: Ich hänge nicht am irdischen Leben,<br />
weil ich an ein ewiges Leben glaube. Das<br />
macht den großen Unterschied zu einer<br />
rein säkularistischen Position.<br />
SPIEGEL: In Ihrer Autobiografie schreiben<br />
Sie: „Es wird mir weh ums Herz, wenn<br />
ich bedenke, dass ich das alles aufgeben<br />
soll.“<br />
Küng: Das stimmt schon, ich verabschiede<br />
mich ja nicht aus dem Leben, weil ich ein<br />
Menschenfeind wäre oder dieses Leben<br />
geringschätzte, sondern weil es aus anderen<br />
Gründen an der Zeit ist, langsam zu<br />
gehen. Ich bejahe mit Überzeugung ein<br />
Leben nach dem Tod, allerdings nicht in<br />
primitiver Weise verstanden, sondern als<br />
Eingang meiner ganzen endlichen<br />
Person in die Unendlichkeit Gottes.<br />
Als Übergang in eine andere<br />
Wirklichkeit jenseits der Dimension<br />
von Raum und Zeit, welche<br />
die reine Vernunft weder bejahen<br />
noch verneinen kann. Es ist eine<br />
Sache eines vernünftigen Vertrauens.<br />
Ich habe keine mathematischnaturwissenschaftlichen<br />
Beweise<br />
dafür, aber ich vertraue mit guten<br />
Gründen auf die Botschaft der<br />
Bibel und glaube an ein Aufgefangenwerden<br />
durch einen gnädigen<br />
Gott.<br />
1<br />
SPIEGEL: Haben Sie eine Vorstellung<br />
vom Himmel?<br />
Küng: Die meisten Redensarten<br />
über den Himmel sind reine Bilder,<br />
die man nicht wörtlich nehmen<br />
darf. Wir sind weit entfernt<br />
von den Himmelsvorstellungen<br />
der Zeit vor Kopernikus. Ich hoffe<br />
aber im Himmel auf die Lösung<br />
der großen Welträtsel, auf Fragen<br />
wie: Warum ist etwas und nicht<br />
nichts? Woher kommen der Urknall<br />
und die Naturkonstanten?<br />
Also jene Fragen, die die Astro-<br />
2<br />
physik so wenig klären kann wie<br />
die Philosophie. Es geht jedenfalls<br />
um einen Zustand ewigen Friedens<br />
und ewiger Glückseligkeit.<br />
SPIEGEL: Die Physik kann den dunklen<br />
Kosmos mit Milliarden Sternen heute viel<br />
besser erklären als früher. Hat das Ihren<br />
Glauben erschüttert?<br />
Küng: Wenn man bedenkt, wie riesig das<br />
Universum ist und wie dunkel, macht das<br />
den Glauben zumindest nicht leichter.<br />
Beethoven konnte in seiner 9. Sinfonie<br />
noch hoffen, „überm Sternenzelt muss<br />
ein lieber Vater wohnen“. Seit der Aufklärung<br />
funktioniert dieses Konzept<br />
nicht mehr. Wir müssen aber auch akzeptieren,<br />
wie wenig wir letztlich wissen.<br />
95 Prozent des Universums sind uns<br />
nicht bekannt, wir kennen weder die 27<br />
Prozent Dunkle Materie noch die 68 Prozent<br />
Dunkle Energie. Die Physik kommt<br />
zwar immer näher an den Ursprung ran,<br />
122<br />
PRIVATBESITZ HANS KÜNG PRIVATBESITZ HANS KÜNG<br />
Kultur<br />
1 Kirchenkritiker Küng bei seiner letzten Skiabfahrt 2008<br />
2 Bei einem Ausritt bei Rom in den fünfziger Jahren<br />
kann den Ursprung selber aber nicht erklären.<br />
SPIEGEL: Am Ende Ihrer Beerdigung wünschen<br />
Sie sich das Kirchenlied „Nun danket<br />
alle Gott“.<br />
Küng: Weil es ausdrückt, dass mein Leben<br />
nicht verendet, sondern vollendet ist. Dar -<br />
über kann man doch froh sein, oder?<br />
SPIEGEL: Im Vatikan findet derzeit genau<br />
das statt, wofür Sie ein Leben lang gekämpft<br />
haben, eine Öffnung und Reform<br />
der Kirche; ausgerechnet zu dem Zeitpunkt,<br />
an dem Sie alt und kraftlos werden.<br />
Eine Ironie der Geschichte?<br />
Küng: Die Ironie betrifft mehr meinen früheren<br />
Kollegen Ratzinger als mich. Ich<br />
habe nicht mehr damit gerechnet, eine<br />
Wende in der katholischen Kirche zu erleben.<br />
Ich bin immer davon ausgegangen<br />
und habe mich auch damit abgefunden:<br />
Küng geht, und Ratzinger bleibt. Deshalb<br />
war ich völlig überrascht, dass Benedikt<br />
geht und ausgerechnet an meinem Geburtstag<br />
und Ratzingers Namenstag, dem<br />
19. März 2013, Papst Franziskus sein Amt<br />
antritt.<br />
SPIEGEL: Wie konnte es geschehen, dass<br />
ein Kardinalskollegium aus konservativen<br />
und restaurativen Männern einen Revolutionär<br />
zum Papst wählt?<br />
Küng: Zunächst einmal wussten die gar<br />
nicht, wie revolutionär er ist. Aber abgesehen<br />
vom harten kurialen Kern war vielen<br />
Kardinälen klar, dass die Kirche in<br />
einer tiefen Krise steckt, wofür die Korruption<br />
im Vatikan, die Vertuschung der<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
JOSEF ALBERT SLOMINSKI<br />
MANFRED GROHE<br />
3<br />
4<br />
3 Mit Theologe Ratzinger (vorn l.) 1962<br />
4 Mit demenzerkranktem Freund Jens (l.) 2008<br />
Missbrauchsfälle und die Vatileaks-Affäre<br />
stehen. Die Kardinäle waren in ihrer Heimat<br />
oft mit der harten Kritik der Basis<br />
konfrontiert.<br />
SPIEGEL: Kann ein Einzelner überhaupt<br />
eine Institution wie die katholische Kirche<br />
revolutionieren?<br />
Küng: Ja, wenn er als Papst gut beraten<br />
wird und einen fähigen Stab hat. Juristisch<br />
gesehen hat der Papst eine größere<br />
Macht als der Präsident der Vereinigten<br />
Staaten.<br />
SPIEGEL: Aber nur innerhalb der Kirche,<br />
weil es zum Beispiel keinen Kongress<br />
gibt, der Entscheidungen absegnen muss.<br />
Küng: Es gibt auch keinen Obersten Gerichtshof.<br />
Der Papst könnte, wenn er will,<br />
von heute auf morgen das im 12. Jahrhundert<br />
eingeführte Zölibatsgesetz abschaffen.<br />
SPIEGEL: Kommt nach dem Arabischen<br />
jetzt ein katholischer Frühling?<br />
Küng: Er ist schon da, aber es besteht die<br />
gleiche Gefahr von Rückschlägen und<br />
einer Gegenbewegung wie beim Arabischen<br />
Frühling. Es gibt mächtige Gruppen<br />
in Vatikan und Weltkirche, die gerne das<br />
Rad zurückdrehen möchten. Die haben<br />
Angst um ihre Pfründen.<br />
SPIEGEL: Leiden Sie darunter, dass Sie<br />
nicht mehr mitmischen können?<br />
Küng: Das nehme ich gelassen. Mir ist wichtiger,<br />
dass der Papst das liest, was ich ihm<br />
schicke, als dass er mich nach Rom einlädt.<br />
SPIEGEL: Er hat Ihnen vor kurzem geschrieben,<br />
dass er die zwei Bücher, die
Sie ihm geschickt haben, gern lese und<br />
„zu Ihrer Verfügung bleibe“.<br />
Küng: Ich habe schon zwei handgeschriebene<br />
und sehr freundliche Briefe von ihm<br />
erhalten. Auf dem Umschlag stand als<br />
Absender einfach „F., Domus Sanctae<br />
Marthae, Vaticano“, unterzeichnet „mit<br />
brüderlichem Gruß“. Das ist schon ein<br />
neuer Stil. Johannes Paul II. hat mich 27<br />
Jahre lang keinerlei Antwort gewürdigt.<br />
SPIEGEL: Mit wem ist Franziskus zu vergleichen?<br />
Küng: Am ehesten mit Johannes XXIII.,<br />
aber er hat eine Schwäche von ihm nicht.<br />
Johannes XXIII. hat Reformen en passant<br />
gemacht, ohne Programm. Er hat große<br />
administrative Fehler begangen.<br />
SPIEGEL: Die Frage ist, ob Franziskus nur<br />
durch Gesten beeindruckt oder ob mehr<br />
dahintersteckt.<br />
Küng: Die Vereinfachung der Kleidung,<br />
die Veränderungen des Protokolls, die<br />
ganz andere Sprache, das sind nicht nur<br />
Äußerlichkeiten. Er hat einen Paradigmenwechsel<br />
eingeleitet. Man sieht bei diesem<br />
Papst wieder viel mehr den Dienstcharakter<br />
des Petrusamtes. Er fordert,<br />
dass man rausgeht aus der Kirche, dass<br />
man auf die Menschen zugeht. Dieser<br />
Tage hat er eine Umfrage an die Bischöfe<br />
gestartet, um die Ansichten auch der Laien<br />
zu Familienthemen zu erfahren. Seine<br />
erste Reise führte ihn zu den Flüchtlingen<br />
nach Lampedusa. Das alles ist ein Bruch<br />
mit der Art, wie Benedikt das Amt verstanden<br />
hat. Auch die Forderung nach einer<br />
armen Kirche führt zu einem anderen<br />
Denken. Unter Benedikt wäre der Protzbischof<br />
von Limburg vermutlich noch<br />
immer im Amt.<br />
SPIEGEL: Franziskus hat als Chef der Glaubenskongregation<br />
aber auch Erzbischof<br />
Gerhard Ludwig Müller bestätigt, einen<br />
Hardliner.<br />
Küng: Ich könnte mir vorstellen, dass Benedikt<br />
sich für den Verbleib Müllers starkgemacht<br />
hat. Die Bewährungsprobe wird<br />
aber sein, ob der neue Papst ihn weiter<br />
Glaubensaufseher und Großinquisitor<br />
spielen lässt.<br />
SPIEGEL: Franziskus hat die Heiligsprechung<br />
von Johannes Paul II. angekündigt,<br />
einem restaurativen Papst, der Gruppen<br />
wie Opus Dei und die Legionäre Christi<br />
stark gemacht hat.<br />
Küng: Ich kann nicht verstehen, dass dieser<br />
Papst heiliggesprochen werden soll.<br />
Er ist der widersprüchlichste Papst des<br />
20. Jahrhunderts. Er war ein Marienverehrer<br />
– und verweigerte Frauen Ämter<br />
in der Kirche. Er predigte gegen Massenarmut<br />
– und verbietet Empfängnisverhütung.<br />
Im letzten Band meiner Autobiografie<br />
habe ich elf solche massiven Widersprüche<br />
ausführlich behandelt. Er hat<br />
ständig anders geredet als gehandelt. Er<br />
hat zum Beispiel auch Pater Marcial Maciel,<br />
einen der schlimmsten Knabenschänder<br />
und Gründer der Legionäre Christi,<br />
DER SPIEGEL 50/2013 123
Kultur<br />
als seinen persönlichen Freund betrachtet<br />
und ihn gegen alle Kritik in Schutz genommen.<br />
SPIEGEL: Dennoch verzeihen Sie Franziskus<br />
diese Heiligsprechung?<br />
Küng: Die Heiligsprechung Wojtylas wurde<br />
von Benedikt forciert, unter Missachtung<br />
aller vorgeschriebenen Fristen. Dies<br />
nun einfach abzubrechen wäre nicht nur<br />
ein Affront gegen Benedikt, sondern auch<br />
gegen viele Polen. Ich kann verstehen,<br />
dass Franziskus das nicht will. Immerhin<br />
hat er gleichzeitig angekündigt, den Reformpapst<br />
Johannes XXIII. heiligzusprechen.<br />
Im Übrigen kann man sich fragen,<br />
ob Heiligsprechungen heute überhaupt<br />
noch Sinn machen, sie sind ja eine Erfindung<br />
des Mittelalters.<br />
SPIEGEL: Gibt es etwas in Ihrem Leben,<br />
das Sie gern rückgängig machen würden?<br />
Küng: Ich war manchmal zu polemisch<br />
und wäre froh, wenn ich manches nicht<br />
gesagt hätte. Aber das einschneidendste<br />
Erlebnis war für mich der Entzug der<br />
kirchlichen Lehrbefugnis im Jahr 1979,<br />
das hat mich schließlich psychisch und<br />
physisch umgehauen. Es gab einen Tag,<br />
da lag ich nur noch auf diesem gelben<br />
Sofa hier und konnte nicht in die angekündigte<br />
Fakultätssitzung zu meinem Fall<br />
gehen.<br />
SPIEGEL: Sie waren depressiv?<br />
Küng: Nicht depressiv, aber erschöpft. Ich<br />
habe mich natürlich gefragt, ob ich mich<br />
hätte beugen sollen. Man hat ja nur verlangt,<br />
dass ich ruhig sein soll. Was ich<br />
persönlich glaube, war denen in Rom<br />
egal, die haben gesagt: Sie können glauben,<br />
was Sie wollen. Manche sagen, wenn<br />
ich damals klein beigegeben hätte, wäre<br />
ich längst Kardinal. Aber gerade das war<br />
nicht mein Ziel.<br />
SPIEGEL: Sie haben sich in dieser Zeit<br />
danach gesehnt, einen Lehrstuhl in den<br />
USA zu bekommen. Wollten Sie <strong>Deutschland</strong><br />
verlassen?<br />
Küng: Ich war begeistert von Amerika.<br />
Ich kannte Präsident Kennedy, eine seiner<br />
Schwestern und andere Familienmitglieder,<br />
und ich wurde von vielen Universitäten<br />
in den USA zu Vorträgen<br />
eingeladen. Ja, das war ein Traum: ein<br />
Lehrstuhl etwa in Los Angeles, mit einem<br />
Haus am Pazifik. Aber es war unrea -<br />
listisch. Ich wollte Tübingen gar nie verlassen.<br />
SPIEGEL: Rechnen Sie damit, dass Sie noch<br />
zu Lebzeiten rehabilitiert werden?<br />
Küng: Nein. Die Deutsche Bischofskonferenz<br />
könnte zwar einen Anfang machen,<br />
Rom müsste dem nur zustimmen – aber<br />
ich rechne nicht mehr damit und erwarte<br />
es auch nicht. Papst Franziskus sollte<br />
nicht andere wichtige Aufgaben gefährden,<br />
indem er mich aufwertet und zu viel<br />
Nähe zu mir zeigt.<br />
SPIEGEL: Ihnen wurde ein Leben lang<br />
Eitelkeit vorgeworfen. In Ihrer Biografie<br />
gibt es dazu sogar ein ganzes Kapitel.<br />
Bestseller<br />
Belletristik<br />
1 (1) Jonas Jonasson<br />
Die Analphabetin, die rechnen<br />
konnte Carl’s Books; 19,99 Euro<br />
2 (2) Khaled Hosseini<br />
Traumsammler<br />
S. Fischer; 19,99 Euro<br />
3 (–) Robert Galbraith<br />
Der Ruf des<br />
Kuckucks<br />
Blanvalet; 22,99 Euro<br />
Ein Topmodel stürzt<br />
vom Balkon in den Tod:<br />
Unter Pseudonym<br />
hat Joanne K. Rowling<br />
einen soliden<br />
Krimi geschrieben<br />
4 (4) Elizabeth George<br />
Nur eine böse Tat<br />
Goldmann; 24,99 Euro<br />
5 (11) Suzanne Collins<br />
Die Tribute von Panem –<br />
Flammender Zorn Oetinger; 18,95 Euro<br />
6 (5) Jo Nesbø<br />
Koma<br />
Ullstein; 22,99 Euro<br />
7 (6) Jussi Adler-Olsen<br />
Erwartung<br />
dtv; 19,90 Euro<br />
8 (8) Stephen King<br />
Doctor Sleep<br />
Heyne; 22,99 Euro<br />
9 (7) Henning Mankell<br />
Mord im Herbst<br />
Zsolnay; 15,90 Euro<br />
10 (10) Timur Vermes<br />
Er ist wieder da<br />
Eichborn; 19,33 Euro<br />
11 (9) Horst Evers<br />
Wäre ich du, würde ich mich lieben<br />
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro<br />
12 (3) P. C. Cast/Kristin Cast<br />
Entfesselt – House of Night 11<br />
FJB; 16,99 Euro<br />
13 (–) Rachel Joyce<br />
Das Jahr, das zwei Sekunden<br />
brauchte Fischer Krüger; 18,99 Euro<br />
14 (18) Nicholas Sparks<br />
Kein Ort ohne dich<br />
Heyne; 19,99 Euro<br />
15 (12) Cecelia Ahern<br />
Die Liebe deines Lebens<br />
Fischer Krüger; 16,99 Euro<br />
16 (14) Rebecca Gablé<br />
Das Haupt der Welt<br />
Ehrenwirth; 26 Euro<br />
17 (13) Ferdinand von Schirach<br />
Tabu<br />
Piper; 17,99 Euro<br />
18 (15) Dan Brown<br />
Inferno<br />
Bastei; 26 Euro<br />
19 (20) Daniel Kehlmann<br />
F<br />
Rowohlt; 22,95 Euro<br />
20 (–) John Williams<br />
Stoner<br />
dtv; 19,90 Euro<br />
124<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom<br />
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -<br />
kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller<br />
Sachbücher<br />
1 (1) Guido Maria Kretschmer<br />
Anziehungskraft<br />
Edel Books; 17,95 Euro<br />
2 (3) Christopher Clark<br />
Die Schlafwandler<br />
DVA; 39,99 Euro<br />
3 (2) Christine Westermann<br />
Da geht noch was<br />
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro<br />
4 (5) Florian Illies<br />
1913 – Der Sommer des<br />
Jahrhunderts S. Fischer; 19,99 Euro<br />
5 (7) Rolf Dobelli<br />
Die Kunst des klaren Denkens<br />
Hanser; 14,90 Euro<br />
6 (4) Malala Yousafzai mit Christina Lamb<br />
Ich bin Malala<br />
Droemer; 19,99 Euro<br />
7 (6) Christiane zu Salm<br />
Dieser Mensch war ich<br />
Goldmann; 17,99 Euro<br />
8 (9) Rüdiger Safranski<br />
Goethe – Kunstwerk des Lebens<br />
Hanser; 27,90 Euro<br />
9 (8) Bronnie Ware<br />
5 Dinge, die Sterbende am meisten<br />
bereuen Arkana; 19,99 Euro<br />
10 (10) Iris Radisch<br />
Camus – Das Ideal der Einfachheit<br />
Rowohlt; 19,95 Euro<br />
11 (11) Meike Winnemuth<br />
Das große Los<br />
Knaus; 19,99 Euro<br />
12 (15) Dieter Hildebrandt/Peter Ensikat<br />
Wie haben wir gelacht<br />
Aufbau; 19,99 Euro<br />
13 (16) Jennifer Teege/Nikola Sellmair<br />
Amon<br />
Rowohlt; 19,95 Euro<br />
14 (12) Simon Singh<br />
Homers letzter Satz<br />
Hanser; 21,50 Euro<br />
15 (19) Jost Kaiser<br />
Typisch Helmut Schmidt<br />
Heyne; 12 Euro<br />
16 (13) Ruth Maria Kubitschek<br />
Anmutig älter werden<br />
Nymphenburger; 19,99 Euro<br />
17 (–) Umberto Eco<br />
Die Geschichte<br />
der legendären<br />
Länder und Städte<br />
Hanser; 39,90 Euro<br />
Atlantis, Liliput und<br />
Mittelerde: Der Universalgelehrte<br />
begibt<br />
sich auf eine Reise in<br />
phantastische Welten<br />
18 (18) Ronald Reng<br />
Spieltage<br />
Piper; 19,99 Euro<br />
19 (–) Stefan Lukschy<br />
Der Glückliche schlägt keine<br />
Hunde Aufbau; 19,99 Euro<br />
20 (14) Eben Alexander<br />
Blick in die Ewigkeit<br />
Ansata; 19,99 Euro<br />
Küng: Ich bin aber vermutlich nicht eitler<br />
als der Durchschnittsmensch.<br />
SPIEGEL: Sie schreiben, dass andere Theologen<br />
auf Sie neidisch waren, weil Sie öfter<br />
zu Fernsehsendungen eingeladen wurden,<br />
weil Sie auf einen sportlichen Körper<br />
und angemessene Kleidung Wert legen,<br />
einen Schlips tragen.<br />
Küng: Dort steht „bisweilen einen<br />
Schlips“.<br />
SPIEGEL: Noch ein Zitat: „Meine Fähigkeiten<br />
habe ich selten überschätzt.“<br />
Küng: Wenn Sie das so aus dem Zusammenhang<br />
reißen, klingt es tatsächlich<br />
eitel. Auf derselben Seite steht aber auch,<br />
dass ich eine Abneigung gegen illusio -<br />
nistisch überschätzte Eigenschaften habe.<br />
Ich kenne meine Grenzen. Ich verabscheue<br />
Pose, Wichtigtuerei. Aber wenn<br />
ich in der Auseinandersetzung mit Rom<br />
kein Selbstbewusstsein gehabt hätte, wäre<br />
ich untergegangen. Bis auf den heutigen<br />
Tag werden meine Bücher von der Hier -<br />
archie und der Schultheologie ignoriert.<br />
Vielleicht habe ich deshalb auch immer<br />
wieder erwähnt, wer mich in Wissenschaft,<br />
Politik und Medien anerkennend<br />
zitiert.<br />
SPIEGEL: Ihr Vater war Schuhhändler, Sie<br />
wurden mit 32 Jahren Professor für Theologie<br />
in Tübingen, mit 34 Jahren Berater<br />
beim Zweiten Vatikanischen Konzil – und<br />
dann 1979 der Hammer des Lehrverbots.<br />
Küng: Damals wurde eine publizistische<br />
Großaktion gegen mich durchgeführt und<br />
schließlich sogar in allen Kirchen der Bundesrepublik<br />
ein Hirtenwort gegen mich<br />
verlesen, das müssen Sie sich mal klarmachen.<br />
SPIEGEL: Beim Entzug der Lehrerlaubnis<br />
ging es auch darum, dass Sie die Ehe -<br />
losigkeit von Priestern in Frage gestellt<br />
haben. Glauben Sie, dass es unter Franziskus<br />
zu einer Reform beim Zölibat<br />
kommen wird?<br />
Küng: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen,<br />
dass diese Frage weiter aufgeschoben<br />
wird, weil täglich weniger Priester<br />
für die Gemeinden da sind. Ich weiß nicht,<br />
wie man in der nächsten Generation noch<br />
Seelsorge in <strong>Deutschland</strong> leisten kann.<br />
Die Frage ist schon längst reif, und das<br />
Kirchenvolk ist weithin bereit zu dieser<br />
Reform.<br />
SPIEGEL: Leben Sie selbst zölibatär?<br />
Küng: Ich bin nicht verheiratet, habe weder<br />
Frau noch Kinder.<br />
SPIEGEL: Im Buch gibt es eine Frau, die<br />
Sie „meine ideale Lebensbegleiterin“<br />
nennen.<br />
Küng: Ja, im Sinn einer vorbildlichen Wegkameradschaft:<br />
Wir haben getrenntes Eigentum,<br />
getrennte Stockwerke, getrennte<br />
Wohnungen. Das habe ich alles in meiner<br />
Autobiografie geschrieben, dazu stehe ich<br />
auch. Mehr habe ich darüber nicht zu<br />
sagen.<br />
SPIEGEL: Professor Küng, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
DER SPIEGEL 50/2013 125
Kultur<br />
ESSAY<br />
Republik Seelenruh<br />
Warum die Große Koalition so gut zu <strong>Deutschland</strong> passt und trotzdem problematisch ist<br />
Von Dirk Kurbjuweit<br />
Bundeskanzlerin Merkel<br />
STEFFI LOOS / DDP IMAGES<br />
126<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Ein gigantischer Tisch, 75 Männer und Frauen, einst Gegner,<br />
nun traut beisammen. Ist das nicht ein schöner Anblick?<br />
Wird einem bei diesem Foto nicht warm ums Herz?<br />
Die große Runde der Koalitionsverhandlungen, Konsens, Eintracht.<br />
So kann man es sehen. Das wäre der deutsche Blick.<br />
Es gibt einen anderen. Eine solch große Versammlung von<br />
Politikern wirkt ein bisschen unheimlich, erinnert an Sitzungen<br />
von den Zentralkomitees kommunistischer Parteien. Konsens,<br />
Eintracht, jedenfalls nach außen, aber zu Lasten der Gesellschaft.<br />
Eine Große Koalition ist noch nicht der erste Schritt in die<br />
Diktatur, aber so ganz lupenrein demokratisch ist sie auch<br />
nicht, schon gar nicht auf Dauer.<br />
Trotzdem wird wohl bald wieder ein Kartell der Volksparteien<br />
regieren, das zweite innerhalb von acht Jahren, und die<br />
Legislaturperiode dazwischen war auch von einer engen Kooperation<br />
zwischen Union und SPD geprägt. Hier wächst etwas<br />
zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. So wollen<br />
es Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Union. So will es<br />
die Spitze der SPD. So wollen es die Bürger, die das elefantöse<br />
Bündnis in Umfragen favorisieren. Fehlen nur noch die Mitglieder<br />
der SPD, die derzeit über den Koalitionsvertrag abstimmen.<br />
Wahrscheinlich werden sie ja sagen.<br />
Und wenn nicht? Halb so schlimm. Es ginge für eine Weile<br />
drunter und drüber, aber irgendwann gäbe es eine Regierung,<br />
und die brächte vielleicht mehr zustande als das, was nun im<br />
Koalitionsvertrag steht. Die Bundesrepublik muss demografischen<br />
Wandel, europäische Ungleichgewichte, Energiewende<br />
und Migrationsströme bewältigen, um hier nur die größeren<br />
Probleme zu nennen. Das Programm von Schwarz-Rot macht<br />
da wenig Hoffnung. Die vielen haben sich auf wenig geeinigt.<br />
Warum sind Große Koalitionen trotz ihrer großen Nachteile<br />
so beliebt bei so vielen Deutschen, vor allem bei Angela Merkel?<br />
Warum gilt <strong>Deutschland</strong> dem Politologen Manfred G.<br />
Schmidt als „grand coalition state“? Und welche Wirkungen<br />
haben diese Bündnisse? Bei den Antworten auf diese Fragen<br />
geht es vor allem um vier Begriffe: Schock, Schonung, Schein.<br />
Der vierte Begriff heißt Wagnis. Er kommt am Ende. Ohne<br />
Wagnis sind große Aufgaben nicht zu lösen. Kann Angela Merkel<br />
etwas wagen? Und wollten die Deutschen das überhaupt?<br />
Die Deutschen sind eine Nation der Schockierten. Das gilt<br />
für die Bürger insgesamt, das gilt insbesondere für Angela Merkel.<br />
Unsere Schocks und ihre Schocks fließen zusammen und<br />
bestimmen die deutsche Politik.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein wachsender Teil der<br />
Bevölkerung schockiert über sich selbst. Deutsche hatten ein<br />
unvergleichliches Blutbad angerichtet und in den Konzentra -<br />
tionslagern den Mord industrialisiert. Das bleibt der Ausgangspunkt.<br />
„Alle Geschichte von 1945 an ist Geschichte im Schatten<br />
und im Bewusstsein der einmal geschehenen Katastrophe“,<br />
schreibt der Politologe Peter Graf Kielmannsegg.<br />
Eine Folge war die Angst der Deutschen vor sich selbst. Eine<br />
solche Katastrophe durfte nicht noch einmal passieren. Also
egann die Zeit der Schonung. Die bundesdeutsche Politik<br />
sorgte dafür, dass es möglichst vielen Bürgern möglichst gut<br />
geht, vor allem über Umverteilung. Alle waren schon Verlierer<br />
gewesen, lebten in zertrümmerten Städten und, zum Teil, mit<br />
zertrümmerten Seelen. Die Politik wollte nicht Verlierer produzieren,<br />
und außerdem gab es einen Nachbarn, der sich auch<br />
schon als großer Kümmerer aufführte, die DDR.<br />
Eine andere Folge war, dass politischer Streit in Verruf geriet.<br />
Die Kämpfe der Parteien in der Weimarer Republik hatten den<br />
Aufstieg des Nationalsozialismus möglich gemacht. Auch demokratische<br />
Politiker hatten sich unversöhnlich gegenüber -<br />
gestanden. Die SPD ließ 1930 eine Regierung platzen, weil sie<br />
nicht zu einem Kompromiss bei der Arbeitslosenversorgung<br />
bereit war. Drei Jahre später war Hitler an der Macht.<br />
Den Deutschen fehlt daher das Urvertrauen in die guten<br />
Kräfte des Streits, wie es Amerikaner oder Briten haben. Ihre<br />
Demokratien sind alt, man hat oft gekämpft, man hat sich oft<br />
versöhnt, ohne dass es zu Katastrophen kam. Der Streit gilt<br />
dort als dynamischer Kern des politischen Systems.<br />
In der Bundesrepublik dagegen entwickelte sich ein System,<br />
das den Konsens anhimmelt, das die Kampfzone verengt. Schon<br />
17 Jahre nach der Staatsgründung gab es die erste Große<br />
Koalition, und die FDP war danach das Scharnier in der Mitte<br />
zwischen den Volksparteien. Bis 1998 blieb nach jeder Wahl<br />
mindestens eine Regierungspartei in der Regierung. Harte<br />
Wechsel gab es nicht, und über den Bundesrat wirkten ohnehin<br />
starke Einigungszwänge auf die Politik. Es gab Kämpfe, aber<br />
es gab auch einen Grundkonsens der Volksparteien: Größere<br />
soziale Einschnitte sind tabu. Die FDP trug das murrend mit.<br />
Doch zu Beginn des neuen Jahrtausends erlebte die Nation<br />
einen neuen Schock. Es war bei weitem nicht so schlimm wie<br />
1945, aber es war ein Schock für die<br />
Geschonten. Bundeskanzler Gerhard<br />
Schröder und seine rot-grüne<br />
Koalition verabschiedeten sich vom<br />
Grundkonsens. Die Agenda 2010<br />
beschnitt erstmals drastisch die soziale<br />
Sicherung, sie stürzte Politik<br />
und Gesellschaft in heftige Kämpfe und spaltete die SPD. Die<br />
Schonzeit war vorbei.<br />
Angela Merkel erlebte ihren persönlichen Schock am<br />
18. September 2005. Sie hatte sich vor dem Wahlkampf als neo -<br />
liberale Politikerin feiern lassen, hatte im Wahlkampf angekündigt,<br />
den Deutschen eine höhere Mehrwertsteuer zumuten<br />
zu wollen, und war damit beinahe baden gegangen. Als Favoritin<br />
konnte sie sich nur knapp in ihre erste Kanzlerschaft<br />
retten, an der Spitze einer Großen Koalition.<br />
Das war die Lage nach der Wahl 2005: Die schockierte Nation<br />
hatte einen neuerlichen Schock erlebt und wurde von einer<br />
geschockten Kanzlerin geführt. Es begann eine zweite Schonzeit,<br />
die, in der wir immer noch leben.<br />
Merkel hatte nun Angst vor den reformmüden Deutschen,<br />
und ihr Konzept hieß: Alles ist Sicherheits -<br />
politik. Die wieder schonungsbedürftigen Deutschen<br />
sollen sich sicher fühlen können, sozial, aber auch ansonsten.<br />
Nach der Rente mit 67, die Franz Müntefering noch mit<br />
schröderscher Verve durchgesetzt hatte, gab es fast nur noch<br />
Wohltaten, vor allem für Familien und Alte. Als 2008 die<br />
Finanzkrise ausbrach, wurde diese Sicherheitspolitik weiter<br />
forciert. Spargarantie, Abwrackprämie und erweiterte Kurzarbeiterregel<br />
schonten die Nerven der Bürger und halfen durch<br />
die Krise.<br />
Dieses Schonprogramm wurde sogar in der schwarz-gelben<br />
Koalition fortgesetzt, Betreuungsgeld, Atomausstieg, Abzug<br />
aus Afghanistan. Für das zentrale Thema, die Euro-Politik,<br />
schmiedete Merkel eine Riesenkoalition mit Union, FDP, SPD<br />
und Grünen. Eine hörbare Opposition gab es in dieser Frage<br />
praktisch nicht mehr. Die Kampfzone war nur noch ein Fleck.<br />
Kleiner Streitraum, große<br />
Kontrollzone: Das ist der<br />
politische Ansatz der Kanzlerin.<br />
Merkels ganze Art zielt darauf ab, den Streitraum klein zu<br />
halten. Leise Sohlen und Samthandschuhe, das ist ihre Grundausstattung<br />
für die Politik. Sie provoziert niemanden, sie hält<br />
sich bedeckt, sie kontrolliert streng ihre Worte und Gesten<br />
und will so möglichst auch die politische Debatte unter Kontrolle<br />
halten. Warum sie so ist? Eine mögliche Erklärung: In<br />
der DDR stand politischer Dissens unter Strafe. Merkel hat<br />
nicht die offene Aussprache gelernt, sondern Selbstkontrolle.<br />
Dazu kommt Ehrgeiz, den sie in der Bundesrepublik als Machtwillen<br />
auslebt. Da ist sie fast die Letzte.<br />
Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier winkten ab,<br />
als es um die Kanzlerkandidatur der SPD ging. Im entscheidenden<br />
Gespräch mit Parteichef Sigmar Gabriel fragte<br />
Peer Steinbrück verzagt, ob sie nicht doch noch einmal Steinmeier<br />
fragen sollten. Im Wahlkampf hatte er dann Beißhemmungen<br />
gegen Merkel, wie so viele andere Männer in der<br />
Politik. Es gibt keine starken, entschlossenen Gegner für sie.<br />
In der Großen Koalition hat Merkel nun wieder die Kontrolle<br />
über zwei Volksparteien.<br />
Es liegt nicht nur an ihr, aber es passt ins Bild, dass während<br />
ihrer Kanzlerschaft zwei von drei Grundströmungen demokratischer<br />
Politik verblasst sind. Das ist der Konservatismus, der<br />
in der Union keinen prominenten Anführer mehr hat. Und<br />
das ist der Liberalismus nach Art der FDP, der sich in der<br />
schwarz-gelben Koalition unmöglich und überflüssig gemacht<br />
hat. Wohl nicht zufällig sind dies die beiden Richtungen, die<br />
nicht für Sanftheit bekannt sind. Was bleibt, ist der Sozialismus<br />
in seiner sozialdemokratischen Ausprägung, dem sich auch die<br />
Bundeskanzlerin anverwandelt hat und der sich im Bundestag<br />
auf alle vier Parteien verteilt: Union, SPD, Linke und Grüne.<br />
Langsam gehen die Positionen aus,<br />
die in Streit geraten könnten.<br />
So ist es Merkel recht: Kleiner<br />
Streitraum, große Kontrollzone, das<br />
ist ihr politischer Ansatz. Sie ist die<br />
ideale Kanzlerin für den „grand co -<br />
alition state“, der allen die Ruhe lässt.<br />
Aber ist die Gesellschaft nicht trotzdem sehr lebendig und<br />
politisch engagiert? Auf lokaler Ebene trifft das durchaus zu.<br />
Die schwäbischen Wutbürger protestieren noch immer jeden<br />
Montag gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21, ein Bürgerentscheid<br />
in München und Umgebung hat gerade Olympische<br />
Spiele dort verhindert, und es ist kaum noch möglich, eine<br />
Landebahn, ein Kraftwerk, eine Straße oder einen Strommasten<br />
zu bauen, ohne dass sich Bürger heftig wehren.<br />
Dieser Protest hat auch verständliche Seiten, aber insgesamt<br />
geht es hier ebenfalls um Schonung, Eigenschonung. Ein Teil<br />
der Bevölkerung will sich nicht die Lasten von Baustress, Finanzierung,<br />
Lärm oder Hässlichkeit aufbürden lassen. Es gibt<br />
eine Schonungssymbiose in diesem Land. Merkel kümmert<br />
sich auf der Bundesebene darum, dass nichts die Ruhe stört,<br />
die Wutbürgerbewegung tut dies im Lokalen.<br />
„Alte Männer sind gefährlich, denn ihnen ist die Zukunft<br />
egal“, hat der Schriftsteller George Bernhard Shaw geschrieben.<br />
Bei Frauen ist das nicht anders. <strong>Deutschland</strong> ist inzwischen<br />
die älteste Gesellschaft in der Europäischen Union. Dazu passt,<br />
dass die Bundesrepublik eine der niedrigsten Investitionsquoten<br />
in Europa hat. Investitionen sind Ausgaben für eine gute Zukunft.<br />
In der Wutbürgerbewegung, die sich meist gegen solche<br />
Investitionen wehrt, finden sich „ganz besonders Vorruheständler,<br />
Rentner und Pensionäre“, schreibt der Politologe Franz<br />
Walter in der empirischen Studie „Die neue Macht der Bürger“.<br />
Wut für Ruhe, das ist einer der Leitsätze dieser Bewegung.<br />
Wut für eine bessere Zukunft? Gibt es kaum. In den jüngeren<br />
Generationen verbreitet sich das Liebsein. Das hat damit zu<br />
tun, dass klassisch männliche Verhaltensweisen, also Aggressivität<br />
oder Dominanzstreben, zunehmend verpönt sind und bekämpft<br />
werden, schon auf den Schulhöfen. Was eher klassisch<br />
DER SPIEGEL 50/2013 127
weiblich konnotiert ist, also Zurückhaltung in Gruppen und<br />
Teamfähigkeit, hat an Wert gewonnen. Mit einem Satz: Testosteron<br />
gilt als Gift.<br />
Schaut man sich die Leitfiguren der Gesellschaft an, wird<br />
diese Entwicklung sichtbar. Vor zehn Jahren dominierten die<br />
Krokodile Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Politik.<br />
In den favorisierten Sportarten der Deutschen, Fußball und<br />
Formel 1, herrschten die Wutathleten Michael Ballack und<br />
Oliver Kahn sowie Michael Schumacher. Ihre Nachfolger sind<br />
Angela Merkel, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und<br />
Sebastian Vettel, eine scheue Frau und drei Männer, die phänotypisch<br />
eher Jüngelchen sind. Testosteronbomben nerven,<br />
aber Aggressivität kann helfen, um große, schwierige Projekte<br />
durchzusetzen, zum Beispiel die Agenda 2010.<br />
Aber will die deutsche Gesellschaft noch einmal eine solche<br />
Anstrengung auf sich nehmen? Große, schwierige Politik?<br />
Stresst das nicht? Die Bürger sind mit anderen Dingen beschäftigt.<br />
Sie ökonomisieren sich mehr und mehr, nun verstärkt<br />
durch Internet und Smartphones, mit deren Hilfe jeder ständig<br />
konsumieren, die eigene Effizienz steigern und auf Facebook<br />
Eigen-PR betreiben kann. Der Mensch wird zum Betrieb. Und<br />
leider geht die Ökonomisierung mit<br />
einer Entpolitisierung einher.<br />
Ingolfur Blühdorn, Politologe an<br />
der University of Bath, hat dazu den<br />
schönen Gedanken von der „simulativen<br />
Politik“ herausgearbeitet. Der<br />
Bürger, der mit Kaufen und Selbstoptimierung<br />
ausgelastet ist, möchte<br />
nicht durch grundsätzliche Debatten<br />
belastet werden. Ihm genügen ein<br />
paar Rituale, also hin und wieder<br />
Wahlen und manchmal die <strong>Talk</strong>show<br />
von Günther Jauch, in der Politik für<br />
handliche 60 Minuten simuliert wird.<br />
Hier kommt das Wort Schein ins<br />
Spiel. Schein wird in der Regel produziert,<br />
um die Welt nicht ganz so<br />
ernst und bedrohlich wirken zu lassen,<br />
also in Unterhaltungsbetrieben.<br />
Ein großer und echter gesellschaft -<br />
licher Streit wie der um die Agenda<br />
2010 würde echt nur ablenken.<br />
Von der Großen Koalition ist ein solches Unterfangen<br />
kaum zu erwarten, und deshalb passt sie so gut zu diesem<br />
Land. Sie sucht den Konsens der vielen, und die<br />
Volksparteien müssen sich der wichtigsten Gruppe der Gesellschaft<br />
besonders verpflichtet fühlen, ansonsten wären sie keine.<br />
Das sind die Älteren, und die werden folgerichtig mit Sicherheitspolitik<br />
umsorgt.<br />
Die neue Regierung wird das bislang letzte Schockgesetz,<br />
die Rente mit 67, aufweichen, zudem wird die Mütterrente verbessert.<br />
Ein Essay des Rechtsphilosophen Uwe Volkmann über<br />
die Große Koalition in der „Frankfurter Allgemeinen“ war in<br />
der vergangenen Woche mit den Worten „Politik als Idyll“<br />
überschrieben. Niemand hat etwas zu befürchten, herrliche<br />
Zeiten für das Altersheim Seelenruh.<br />
Schaut man auf die Große Koalition von 2005 zurück, sieht<br />
man jedoch nicht nur idyllische Zustände. Sie hat in ihrem<br />
letzten Jahr gut funktioniert und eine ordentliche Krisenpolitik<br />
gemacht. Das bestätigt die These, dass Große Koalitionen in<br />
Ausnahmezeiten sinnvoll sind, sonst aber eher nicht. In den<br />
drei Jahren davor hatte die Regierung demonstriert, was die<br />
Nachteile solcher Bündnisse sind.<br />
Sie sind für die Gremien der Politik zu groß. Damit die Lage<br />
unter Kontrolle bleibt, schrumpft die Koalition der vielen in<br />
der Praxis auf die Dominanz der ganz wenigen. Die drei Parteiführer,<br />
Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer,<br />
128<br />
Kultur<br />
Große Runde der Koalitionsverhandlungen<br />
Eine Große Koalition ist noch<br />
keine Diktatur, sie ist eher<br />
eine Demokratieschleifmaschine.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
werden sich oft hinter verschlossenen Türen abstimmen und<br />
die Politik übermäßig zentralisieren. Alle anderen sind mehr<br />
oder weniger zur Scheinpolitik verdammt, auch das Parlament,<br />
theoretisch das wichtigste Gremium in der Demokratie.<br />
Das Idyll wirkt nicht friedlich. Eine Große Koalition ist<br />
im Prinzip eine wackelige Angelegenheit. Union und<br />
SPD verstehen sich immer noch als Antagonisten der<br />
Politik, sie paktieren nur aus Not mit dem Gegner. Beide Partner<br />
wollen dieses Bündnis überwinden, die SPD will unbedingt<br />
den nächsten Kanzler stellen. Deshalb wird permanent Wahlkampf<br />
geführt. Da die Minister in die Kabinettsdisziplin eingebunden<br />
sind, kommt die große Zeit der Politiker, die es nicht<br />
weit gebracht haben. Ein Hinterbänkler kann leicht zum Star<br />
für einen Tag werden, wenn er motzt und damit den Medien<br />
die begehrte Schlagzeile liefert: „Streit in der Koalition“.<br />
So ist also die Grundkonstellation: Die Hinterbank giftet,<br />
die Parteiführer suchen nach dem Kompromiss, der meist ein<br />
kleinstmöglicher ist und niemandem weh tut. Im Gegenteil,<br />
da die Große Koalition gegenüber den Parteianhängern ständig<br />
gerechtfertigt werden muss, verteilt man Geschenke.<br />
Die Opposition wird margina -<br />
lisiert. Linke und Grüne haben zusammen<br />
jämmerliche 17 Prozent der<br />
Stimmen hinter sich. Ihre Anliegen<br />
werden kaum durchdringen, sie können<br />
die Regierung nur schwach kontrollieren.<br />
Eine Opposition ist aber<br />
der edelste Teil der Demokratie, sie<br />
macht den Unterschied zur Diktatur<br />
aus. Widerspruch, und der Kopf<br />
bleibt dran, das ist die Freiheit des<br />
Demokraten. Der Widerspruch sollte<br />
aber auch gehört werden können<br />
MS-UNGER.DE<br />
und Bedeutung haben.<br />
Nun zum Wagnis. Ein Wagnis<br />
kommt selten vor in der Politik,<br />
verändert aber viel, wenn es<br />
gelingt. Willy Brandts Ostpolitik<br />
war ein Wagnis, Helmut Kohls<br />
Vereinigungspolitik, auch die Not -<br />
standsgesetz gebung der Großen<br />
Koalition von 1966. Aber all das<br />
richtete sich nicht gegen den deutschen<br />
Grundkonsens. Das hat nur Gerhard Schröder bei der<br />
Agenda 2010 gewagt, auch wenn er dabei Probleme der<br />
Renten- und Gesundheitsversicherung nicht konsequent angegangen<br />
ist.<br />
Beim Wagnis suchen die Politiker nicht nach dem breiten<br />
Konsens, sie suchen Streit. Sie wollen nicht schonen, sondern<br />
auch belasten, es soll Verlierer geben, damit am Ende die allermeisten<br />
gewinnen. Sie können auch die Kontrolle verlieren,<br />
und dann gehen Ämter flöten. So war es bei der Agenda 2010.<br />
Heute sind die meisten Experten der Ansicht, dass sie geholfen<br />
hat, <strong>Deutschland</strong> wieder zu einer wirtschaftlich erfolgreichen<br />
Nation zu machen.<br />
Demokratie insgesamt ist ein Wagnis. Sie traut den Bürgern<br />
zu, gesellschaftliche Spaltung auszuhalten, sie setzt auf die<br />
Dynamik des Streits, sie hofft auf zivilen Umgang in der Kampfzone<br />
und auf Versöhnlichkeit nach den Kämpfen. Eine Diktatur<br />
dagegen versucht, den gemeinsamen Willen einer Volksgemeinschaft<br />
zu konstruieren und in Politik zu verwandeln. Ähnlich<br />
macht das eine Große Koalition, die damit aber noch keine<br />
Diktatur ist, wie gesagt. Sie ist eher eine Demokratieschleifmaschine.<br />
Es gibt einen schönen Satz, der die Wörter Demokratie und<br />
Wagnis zusammenführt: Mehr Demokratie wagen. Für Mitglieder<br />
der SPD ist das ein ganz besonderer Satz, er stammt vom<br />
einstigen Vorsitzenden Willy Brandt.<br />
◆
Kultur<br />
Wie die Werke des Wandersmannes<br />
Peter Handke handeln die<br />
Bücher des israelischen Schriftstellers<br />
David Grossman von der Kunst,<br />
beim Gehen den Boden zu berühren.<br />
Jede Fortbewegung auf zwei Beinen, jedes<br />
Spazieren, Voranschreiten und Hasten<br />
sei ein Versuch, sich zu befreien, sagt<br />
Grossman, der für viele seiner Bücher zu<br />
Fuß unterwegs war. „Wer geht, der löst<br />
sich aus der Erstarrung. Er flieht davor,<br />
eingefroren zu werden in seinem Zorn<br />
oder in seinem Schmerz. Er verschafft<br />
sich Abstand. Er versichert sich des eigenen<br />
Körpers. Er lebt.“<br />
Im Berliner Deutschen Theater kann<br />
man von Freitag dieser Woche an acht<br />
Schauspielerinnen und Schauspielern dabei<br />
zusehen, wie sie sich unter einem von<br />
Sternen erhellten Nachthimmel fortbewegen<br />
– auf einem Kiesweg, der immer im<br />
Kreis führt. Ein Kerl in schwarzem Anzug<br />
taumelt auf nackten Füßen vorneweg,<br />
hinter ihm stiefelt ein junges Mädchen,<br />
schlurft ein alter Mann, flaniert ein einträchtig<br />
ineinander verschlungenes Pärchen,<br />
folgen diverse andere. „Warum seid<br />
ihr Tote geworden?“, rufen die Wandersleute<br />
im Chor, während sie in die Finsternis<br />
hinausstarren. „Warum seid ihr in den<br />
Krieg gezogen? Und warum ins Wasser?<br />
Warum zur scharfen Klinge?“<br />
Das Stück, das hier gezeigt wird, heißt<br />
„Aus der Zeit fallen“ und ist ein wütendes,<br />
poetisches Kindertotenlied. Es sind<br />
lauter Väter und Mütter, die auf der Bühne,<br />
einzeln und im Chor, eine große Klage<br />
anstimmen. Ihre Töchter und Söhne<br />
130<br />
THEATER<br />
Herr Hiob und seine Jünger<br />
In Berlin verwandelt ein deutscher Regisseur das Buch „Aus der<br />
Zeit fallen“, in dem der israelische Autor David Grossman<br />
vom Tod seines Sohnes erzählt, in drei spektakuläre Geisterstunden.<br />
Schriftsteller Grossman<br />
wurden bei Unfällen im Auto oder beim<br />
Schwimmen getötet, durch Messerstiche<br />
oder von Panzergeschossen im Krieg.<br />
„Es geht darum zu begreifen, dass man<br />
über den Tod eines geliebten Menschen<br />
nicht hinwegkommen kann“, sagt David<br />
Grossman über den Erkenntnisweg der<br />
Figuren auf der Bühne. „Dafür kann man<br />
lernen, mit der Trauer zu leben. Von einer<br />
Krankheit kann man sich erholen.<br />
Von der Trauer nicht.“<br />
Grossman spricht leise für einen Mann,<br />
der sich stets in kraftvollen, klug formulierten<br />
Sätzen ausdrückt, seine hellbraune<br />
Hornbrille lässt sein blasses Gesicht noch<br />
ein bisschen bleicher aussehen. Er lächelt,<br />
als er im Frühstückssaal seines Berliner<br />
Hotels von seinem Probenbesuch im<br />
Deutschen Theater und seinen Gesprächen<br />
mit den Schauspielern, der Dramaturgin<br />
und dem Regisseur<br />
erzählt. „Ich habe sie davor<br />
gewarnt, zu vorsichtig umzugehen<br />
mit meinem Text.<br />
Glauben Sie mir: Demut gegenüber<br />
dem, was ich geschrieben<br />
habe, ist nicht gut.<br />
Zu viel Treue schadet nur.“<br />
Der Schriftsteller Grossman<br />
ist 59 Jahre alt und seit<br />
vielen Jahren im Nahen Osten<br />
eine literarische und<br />
poli tische Instanz, weil er<br />
ein unerschrockener Patriot<br />
ist, trotzdem für die Aussöhnung<br />
zwischen Israelis und<br />
Palästinensern kämpft und<br />
außerdem schöne, manchmal<br />
märchenhaft verschlungene Bücher<br />
schreibt. In <strong>Deutschland</strong> ist er erst durch<br />
den monumentalen, mehr als 700 Seiten<br />
langen Roman „Eine Frau flieht vor einer<br />
Nachricht“ richtig bekannt geworden.<br />
Das Buch ist 2008 im Original und 2009<br />
auf Deutsch erschienen, es erzählt von<br />
der Angst einer Mutter, deren Sohn sich<br />
freiwillig zum Kriegseinsatz im Westjordanland<br />
gemeldet hat, von ihren Männergefährten<br />
und ihren Wanderungen und<br />
Irrfahrten durchs Land, von der Gegenwart<br />
des Todes, die die Politik und den<br />
Alltag im Nahen Osten vergiftet.<br />
„Eine Frau flieht vor einer Nachricht“<br />
berichtet eindringlich, ergreifend, ungeheuer<br />
peinigend von der Erwartung einer<br />
Katastrophe; und wurde auf schreckliche<br />
ARNO DECLAIR<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Weise beglaubigt durch das, was dem Autor<br />
widerfuhr. Als David Grossman das<br />
Buch längst begonnen hatte, starb sein<br />
zweitgeborener Sohn während des israelischen<br />
Krieges gegen die im Libanon stationierten<br />
Hisbollah-Milizen in einem Gefecht.<br />
Uri Grossman, der am 12. August<br />
2006 getötet wurde, wurde 20 Jahre alt.<br />
„Ich habe festgestellt, dass mir das<br />
Schreiben hilft“, sagt Grossman über die<br />
Zeit, in der er damals seinen Roman zu<br />
Ende brachte. Als „Eine Frau flieht vor<br />
einer Nachricht“ fertig war, sei er viel gereist.<br />
Er hat das Buch, das ein großer Erfolg<br />
wurde, in aller Welt vorgestellt.<br />
Grossman ist der Sohn eines polnischen<br />
Juden, der 1936, kurz vor dem Massenmord<br />
der Deutschen, nach Palästina<br />
auswanderte. Nach <strong>Deutschland</strong>, ins<br />
Land der Judenmörder, reiste David<br />
Grossman 1988 zum ersten Mal. Er war<br />
bereits ein geachteter Schriftsteller, sein<br />
Roman „Das Lächeln des Lammes“ kam<br />
damals auf Deutsch heraus. „Für mich<br />
war es wichtig, nicht als niemand nach<br />
<strong>Deutschland</strong> zu kommen“, sagt er. „Ich<br />
wollte einen Namen haben. Die Nationalsozialisten<br />
haben den Juden ihre Individualität<br />
genommen, ihnen die Haare<br />
geschoren, sie ihrer Kleidung beraubt, sie<br />
haben ihnen Nummern gegeben, um alle<br />
ihre Eigenheiten auszulöschen.“<br />
In den Jahren seit seinem ersten<br />
<strong>Deutschland</strong>besuch haben die Deutschen<br />
Grossman vielfach ausgezeichnet, so 2010<br />
mit dem Friedenspreis des Deutschen<br />
Buchhandels. „Und sie haben mich überzeugt“,<br />
sagt Grossman, „dass in ihrem<br />
Land zumindest die klügeren Menschen<br />
sich wirklich ernsthaft bemühen, das Versagen<br />
ihrer Vorfahren zu begreifen.“<br />
Nach dem Tod seines Sohnes und dem<br />
vorläufigen Befreiungsschlag mit „Eine<br />
Frau flieht vor einer Nachricht“ brauchte<br />
Grossman lange, um sein nächstes Werk<br />
in Angriff zu nehmen. „Aus der Zeit fallen“<br />
ist das Zeugnis einer Verzweiflung,<br />
einer „Verbannung“, wie der Schriftsteller<br />
es ausdrückt. „Einsamkeit ohnegleichen<br />
verhängt die Trauer über den Lebenden“,<br />
heißt es am Anfang des Textes, der auch<br />
davon handelt, wie sehr die Trauer um<br />
ein gestorbenes Kind den Zusammenhalt<br />
zwischen dessen Eltern zerrüttet.<br />
Es ist ein lyrischer, an antike Dramen<br />
erinnernder Ton, den Grossman anschlägt<br />
in diesem Werk, das er ein „Oratorium“<br />
und ein „Requiem“ nennt. „Lyrik ist<br />
das, was dem Schweigen am nächsten<br />
kommt“, behauptet Grossman, und nach<br />
einem Zögern: Das sei ein Lieblingssatz<br />
seiner Frau.<br />
Der Held in „Aus der Zeit fallen“ hat<br />
keinen Namen. Er heißt „Der gehende<br />
Mann“. Zunächst ohne Gefährten macht<br />
er sich auf die Reise an den Ort, wo die<br />
Toten sind; dorthin, wo er den verlorenen<br />
Sohn wiederzutreffen hofft. Dessen Mutter,<br />
die Frau des Helden also, bleibt zu-
Schauspieler Bernd Moss, Barbara Heynen in „Aus der Zeit fallen“ im Deutschen Theater<br />
rück, gefangen in der Trauer, „ein entlebter<br />
Mensch“, wie sie sagt. „Fünf Jahre<br />
nach dem Tod meines Sohnes zog sein<br />
Vater aus, ihn zu treffen. Ich bin nicht<br />
mit ihm gegangen. Bis ans Ende der Welt<br />
wär ich mit ihm. Aber nicht nach dort.“<br />
Der „gehende Mann“ aber findet Gefährtinnen<br />
und Gefährten, ähnlich Versehrte,<br />
nach Trost Suchende. Sie tragen<br />
Fantasy-Namen wie „Zentaur“ oder<br />
„Herzog“ und sind wie der Held selbst<br />
Hiob-Gestalten voller „Wut über all das,<br />
was man dir geraubt“. Nach und nach finden<br />
die Gehenden Worte, um ihren Verlust<br />
zu beschreiben und ihn von immer<br />
neuen Seiten aus zu betrachten. Und sie<br />
kapieren, warum sie auf die anderen, bislang<br />
verschonten Menschen einen frivolen<br />
Reiz ausstrahlen: „Was ist erregender<br />
als die Hölle anderer? Schmerz hat man<br />
doch lieber aus zweiter Hand.“<br />
Und natürlich blickt der Schriftsteller<br />
Grossman hier mit großer Nüchternheit<br />
und Brutalität auch darauf, wie es ihm<br />
selbst und seinem Werk ergangen ist in<br />
den vergangenen Jahren.<br />
Im Deutschen Theater wird der Regisseur<br />
Andreas Kriegenburg, soweit man<br />
das nach Ansicht der Proben in der vergangenen<br />
Woche beurteilen kann, aus<br />
Grossmans Langgedicht eine grandiose<br />
dreieinhalbstündige Totenbeschwörung<br />
machen. Grossmans Prozession der Ruhelosen,<br />
in der sich viele Anspielungen<br />
auf das Alte Testament und auf klassische<br />
Märchen finden, spielt in einer Zwi -<br />
ARNO DECLAIR<br />
schenwelt. Sie ist halb Hölle und halb<br />
Höhle, wie in einer entfernten Galaxis.<br />
In der ist es so zappenduster, als hätte<br />
der deutsche Dichter Heiner Müller sie<br />
entworfen, der in seinem Geisterstück<br />
„Germania 3 – Gespenster am toten<br />
Mann“ einmal den schönen Satz formuliert:<br />
„Dunkel, Genossen, ist der Weltraum.<br />
Sehr dunkel.“<br />
Auf einer Drehbühne stehen Würfelgerüste,<br />
die mit Plastikfolie umwickelt oder<br />
zu Türmen gestapelt sind und sich im<br />
Bühnenbild von Olga Ventosa Quintana<br />
in Gefängniszellen verwandeln, in die<br />
meist Menschen und mal ein Esel gesperrt<br />
sind. Männer und Frauen umarmen sich<br />
oder schlagen aufeinander ein, während<br />
Musik von Johann Sebastian Bach oder<br />
von zeitgenössischen Klezmer-Minimalisten<br />
erklingt. Meist aber herrscht eine verschwörerische<br />
Solidarität zwischen den<br />
Bewohnern des nie genannten Landes, in<br />
dem „Aus der Zeit fallen“ spielt. „Wir<br />
wollen zum Licht erwachen“, fordert der<br />
Chor der Wandernden einmal.<br />
„Für mich ist das Berührende an diesem<br />
Text, dass er nicht vom Sterben handelt,<br />
sondern davon, wie man nach einem Verlust<br />
zurückfindet ins Leben“, sagt Kriegenburg,<br />
der Regisseur. Ein modernes,<br />
politisches Stück wolle er zeigen, „in dem<br />
der Wahnsinn, der uns umgibt, genau beschrieben<br />
wird“. Kriegenburg legt Wert<br />
darauf, Grossmans Anrufungspoem nicht<br />
an einen Ort in Europa oder einen konkreten<br />
Kriegsschauplatz verpflanzen zu<br />
wollen, „damit der Text seine Fremdheit<br />
behält. David Grossman beschreibt Trauer<br />
als einen menschlichen Grundzustand,<br />
nicht als ein Unglück“.<br />
Ähnliches gilt für den Krieg. Der<br />
Schriftsteller Grossman kämpft für den<br />
Frieden, aber er ist kein Pazifist. Israel<br />
ist für ihn „ein politisches und mensch -<br />
liches Wunder“, aber der Staat der Juden<br />
müsse jederzeit imstande sein, sich mit<br />
militärischen Mitteln gegen seine Feinde<br />
zu verteidigen. Grossman hielt sogar jenen<br />
Libanon-Krieg im Jahr 2006, in dem<br />
sein Sohn getötet wurde, zunächst für<br />
legitim: wegen der Raketenangriffe auf<br />
Israel, die dem Krieg vorangingen. Er<br />
sieht heute weniger Chancen auf Frieden<br />
als je zuvor. „In Israel ist so viel Hass am<br />
Werk, dass ich kaum Hoffnung habe.“<br />
In Grossmans Text lässt er einen der<br />
Trauernden sagen, dass er nicht in der<br />
Lage sei, „etwas zu verstehen, bis ich es<br />
aufschreibe. Ich meine, wirklich verstehen,<br />
ganz genau! Diese verfickte Sache,<br />
die mir und meinem Sohn da passiert ist,<br />
ich muss sie in eine Geschichte einbauen.<br />
Anders geht es nicht. Alles muss rein in<br />
den brodelnden Kessel!“<br />
Es gebe Schriftsteller, sagt David Grossman,<br />
deren politisches Engagement ihrer<br />
literarischen Arbeit in die Quere komme.<br />
„Ich mache mir darüber keine Gedanken.<br />
Ich habe keine Wahl.“ WOLFGANG HÖBEL<br />
DER SPIEGEL 50/2013 131
Kultur<br />
Crystal Meth im Umland<br />
POP-KRITIK: Der Berliner Rapper Grim104 erzählt auf seinem großartigen<br />
Debütalbum von der Sehnsucht nach dem großen Knall, der niemals kommt.<br />
Angenommen, du bist 1988 auf die<br />
Welt gekommen. Die Mauer fiel,<br />
da warst du ein Jahr alt. Rot-Grün<br />
kam an die Macht, da warst du zehn.<br />
Nach den Anschlägen des 11. September<br />
hast du zum ersten Mal gekifft. Als<br />
Gerhard Schröder die Agenda 2010<br />
erfand, wurdest du zum Zeitungsleser.<br />
Das Abitur fiel in die Zeit des ersten<br />
Kabinetts von Angela Merkel. Und als<br />
die Bankenrettungen für „alternativlos“<br />
erklärt wurden, bist du nach Berlin<br />
gezogen.<br />
Jung zu sein und dagegen,<br />
das gehörte einst zusammen.<br />
Wie fühlt es sich<br />
heute an? Geht das noch?<br />
Im Zeitalter des totalen<br />
Pragmatismus, nach dem<br />
Ende der Utopien?<br />
Ein Berliner Rapper<br />
namens Grim104 hat eine<br />
Platte darüber gemacht.<br />
Wie man sie wahrscheinlich<br />
nur einspielen kann,<br />
wenn man unbekannt ist<br />
und noch keine Erwar -<br />
tungs haltung die aufgeblasenen<br />
Antworten diktiert,<br />
die den großen Fragen<br />
sonst so gern folgen. Eigentlich<br />
heißt er Moritz<br />
Wilken und ist 25 Jahre alt,<br />
„Grim104“ ist sein erstes<br />
Soloalbum, ein großar tiges<br />
Debüt.<br />
Wilken zu treffen ist gar nicht so<br />
einfach. Tagsüber hat er keine Zeit, weil<br />
er in die Berufsschule muss. Aufge -<br />
wachsen ist er in Friesland, eigentlich<br />
wäre er nach der Schule lieber nach<br />
Hamburg ge gangen, aber seine Freundin<br />
wollte nach Berlin. Mit der Hauptstadt<br />
der Hipster hat er wenig zu tun. Er hat in<br />
einer Krankenhauswäscherei gearbeitet,<br />
wohnt im Bezirk Wedding, nun macht<br />
er eine Ausbildung.<br />
Er ist groß und blond, redet viel und<br />
schnell. Manchmal macht er plötzlich<br />
eine Pause und sagt dann: „Das soll sich<br />
jetzt nicht komisch anhören.“ Als würde<br />
er sich beim Interview selbst beobachten,<br />
als käme ihm das alles noch nicht ganz<br />
wirklich vor.<br />
Der deutsche HipHop hat eine eigenartige<br />
Geschichte, die viel mit dem Klassenkampf<br />
zwischen Jugendlichen aus der<br />
Mittelschicht und der Unterschicht zu tun<br />
132<br />
hat. Die Musik stand lange im Schatten<br />
der amerikanischen Originale, erst die<br />
migrantischen Gangsta-Rapper gaben ihr<br />
den eigenen Ton, um die Jahrtausendwende<br />
herum.<br />
Die Straßenrapper wie der Offenbacher<br />
Haftbefehl oder der Berliner Bushido sind<br />
meist Kinder der migrantischen Unterschicht<br />
und setzen auf Härte und Stärke.<br />
Sie feiern ihren sozialen Aufstieg, wollen<br />
das Drama ihres Lebens, ihres Triumphs<br />
erzählen. Die Bürgerkinder wie der Ber -<br />
liner Rapper Casper leuchten eher ihre<br />
Rap-Musiker Bolz, Wilken: Kein Geld, aber Angst<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Innenwelten aus und können auch mal<br />
Schwäche zeigen. Man könnte sagen: Die<br />
Straßenrapper sind wie Comicfiguren, die<br />
Bürgerkinder versuchen, echte Menschen<br />
zu sein, Charaktere mit Widersprüchen.<br />
Grim104 lässt sich weder der einen<br />
noch der anderen Seite zuschlagen. Er ist<br />
sensibel und doch zugleich angezogen<br />
von der Härte und der Dunkelheit. Er<br />
kommt vom Dorf und ist den Dorfproblemen<br />
immer noch verbunden, seine Beobachtungsgabe<br />
hat er in der Provinz gelernt,<br />
seine Sprache aber ist die Sprache<br />
der Stadt und ihrer Straßen.<br />
Mit seinem Partner Hendrik Bolz alias<br />
Testo bildet er das Rap-Duo Zugezogen<br />
Maskulin; ein Szenescherz, zum einen<br />
hieß eine der Pioniergruppen des Straßenraps<br />
Westberlin Maskulin, zum anderen<br />
hatten die beiden Angst davor, vor<br />
genau solchen Jungs als Nicht-Berliner<br />
dumm dazustehen. Also lieber gleich sagen,<br />
was sich nicht verbergen lässt. Zugezogen<br />
Maskulin sind ziemlich lustig,<br />
wenn man grobe Späße mag.<br />
Grim104 ist eher nicht so lustig.<br />
Die acht Songs sind minimalistisch,<br />
dunkel und langsam, klingen wie ein<br />
Anfall von Sehnsucht. Immer wieder<br />
schimmert der Wunsch nach der radikalen<br />
Geste durch, die Hoffnung nach dem<br />
großen Knall – gefolgt von der Enttäuschung<br />
darüber, dass er nicht kommt. Die<br />
großen Gefühle von Heranwachsenden<br />
also, Funkmeldungen aus einer Lebensphase,<br />
in der man nirgends<br />
hingehört, kein Geld hat<br />
und keine Verantwortung,<br />
aber eine Menge Angst.<br />
Es geht um Verschwörungstheorien<br />
und um die<br />
Aussicht, trotz Ausbildung<br />
in der Warteschleife ewig<br />
befristeter Jobs kreisen zu<br />
müssen. Ein Stück heißt<br />
nach dem französischen<br />
Linksradikalenmanifest „Der<br />
kommende Aufstand“. Ein<br />
anderes spielt am „2. Mai“,<br />
dann, wenn alle Steine geschmissen<br />
sind und sich<br />
nichts geändert hat. Einmal<br />
reimt sich „Terror, Schleyer,<br />
Landshut“ auf „Lena Meyer-Landrut“.<br />
Das Berliner Umland, die<br />
Gegend, wo sich das neue<br />
Berliner Bürgertum seine<br />
Wochenendhäuser kauft, wird in dem Song<br />
„Crystal Meth in Brandenburg“ zu einer<br />
Horrorfilmlandschaft. Die Wälder, in denen<br />
Städter Ruhe und Erholung suchen,<br />
sind nun das Hinterland, durch das die<br />
Drogen nach Berlin einsickern. Das alles<br />
ist hingetuscht mit der Sicherheit eines<br />
Künstlers, der jahrelang Comics vor sich<br />
hin gekritzelt hat. Kein Strich ist zu viel,<br />
es sind Songs wie ausgefeilte Storyboards.<br />
In keinem Genre des Pop lässt sich so<br />
gut „ich“ sagen wie im HipHop. Grim104<br />
versucht es mit dem Gegenteil, er sagt:<br />
„ich nicht“. Mehr ist wahrscheinlich<br />
gerade nicht drin, wenn man Mitte zwanzig<br />
und nicht einverstanden ist.<br />
TOBIAS RAPP<br />
MARC CANTARELLAS-CALVÓ<br />
Video: Rapper Grim104 über<br />
„Crystal Meth in Brandenburg“<br />
spiegel.de/app502013rap<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Szene<br />
Sport<br />
WM-Auslosung in Costa do Sauípe<br />
MARCUS BRANDT / DPA<br />
Losglück? Diesmal eher nicht. In einer<br />
der anspruchsvollsten Gruppen bei<br />
der Fußball-Weltmeisterschaft trifft die<br />
deutsche Nationalmannschaft in der<br />
Vorrunde auf Portugal, die USA und<br />
Ghana. Dennoch sieht Manager<br />
Oliver Bierhoff den<br />
Sprung ins Achtelfinale als<br />
Pflichtaufgabe an: „Es ist<br />
klar, dass wir da Favorit<br />
sind.“ Genauso wichtig wie<br />
die Beschäftigung mit den<br />
ambitionierten Gegnern<br />
wird für Joachim Löws Betreuerstab<br />
die Vorbereitung<br />
auf die extremen Klima -<br />
verhältnisse im Gastgeberland<br />
Brasilien, dem fünftgrößten<br />
Staat der Erde. Vor<br />
dieser Herausforderung stehen<br />
auch die afrikanischen<br />
Mannschaften, wie Kameruns<br />
Nationaltrainer Volker<br />
Finke betont. „Es ist ein<br />
weitverbreiteter Irrtum zu<br />
glauben, dass Afrikaner<br />
von Geburt an in tropischen<br />
und schwülheißen<br />
Klimazonen besser zurechtkommen“,<br />
sagt Finke.<br />
FUSSBALL-WM<br />
„Heikle Sache“<br />
1<br />
2<br />
3<br />
„Die afrikanischen Profis, die in Euro -<br />
pa spielen, haben keinen Adaptions -<br />
vorsprung mehr, sie haben sich längst<br />
an das europäische Klima angepasst.“<br />
In Kameruns Team etwa, das sich erst<br />
Manaus<br />
31 83<br />
Die deutschen<br />
Gruppengegner:<br />
Portugal in Salvador<br />
am 16. Juni, 13 Uhr *<br />
Ghana in Fortaleza<br />
am 21. Juni, 16 Uhr *<br />
USA in Recife<br />
am 26. Juni, 13 Uhr *<br />
Q Durchschnittliche Höchsttemperatur<br />
im Juni (°C)<br />
Q Luftfeuchtigkeit im Juni (%)<br />
A m azonas<br />
Längste Luftlinie<br />
zwischen zwei Städten:<br />
3215 Kilometer<br />
Das entspricht etwa<br />
der Entfernung zwischen<br />
Berlin und Bagdad.<br />
Cuiabá<br />
31 72<br />
*Ortszeit; Deutsche<br />
Sommerzeit:<br />
– 5 Stunden<br />
São Paulo<br />
22 82<br />
Spielorte<br />
der Fußballweltmeisterschaft<br />
Fortaleza 2 30 80<br />
Belo Horizonte<br />
19 82<br />
Brasília<br />
25 61<br />
25 71<br />
20 81<br />
Rio de Janeiro<br />
Curitiba<br />
Porto Alegre<br />
Salvador<br />
25 74<br />
Mitte November nach zwei Relega -<br />
tionsspielen für die WM qualifizierte<br />
und das in der Gruppe A auf Gast -<br />
geber Brasilien trifft, findet sich kein<br />
Spieler, der in einem Heimatverein<br />
sein Geld verdient. Genauso ist es bei<br />
Ghana, dem deutschen Gruppengegner.<br />
Zu dessen Team gehören Stars wie der<br />
für Schalke 04 spielende Kevin-Prince<br />
Boateng, der Bruder des deutschen Nationalverteidigers<br />
Jérôme, und Michael<br />
Natal<br />
28 84<br />
3<br />
600 km<br />
29 85<br />
Recife<br />
1 27 82<br />
Essien vom Premier-League-Club<br />
FC Chelsea. Für<br />
alle Mann schaften dürften<br />
nun die Tage nach der<br />
WM-Auslosung mitentscheidend<br />
für den Turnierverlauf<br />
sein: Es geht dar -<br />
um, das passende Quartier<br />
zu finden, stra tegisch gut<br />
gelegen, um die Flugdistanzen<br />
so gering wie möglich<br />
und die Klimaextreme<br />
so erträglich wie möglich<br />
zu halten. Eine „heikle Sache“<br />
sei die Entscheidung<br />
für den geeigneten Standort,<br />
sagt Finke. „Denn<br />
wenn dann während des<br />
Turniers irgendwas mit der<br />
Logistik nicht funktioniert,<br />
wenn die Spieler unzu -<br />
frieden sind, dann hast du<br />
als Trainer damit zu leben,<br />
dann trägst du das ganz<br />
allein aus.“<br />
135
Sport<br />
OLYMPIA<br />
Der Coverboy<br />
Der schwule Eissprinter Blake Skjellerup posiert nackt für<br />
Szenemagazine. Bei den Winterspielen in Sotschi<br />
will der Provokateur für die Rechte Homosexueller kämpfen.<br />
Wenn sich Blake Skjellerup bei<br />
Starbucks einen Kaffee holt, begleiten<br />
ihn neuerdings TV-Kameras.<br />
Der amerikanische Fernsehsender<br />
CNN dreht eine Dokumentation über<br />
den Shorttracker, der im Februar bei den<br />
Olympischen Winterspielen in Sotschi<br />
starten wird.<br />
Dabei ist Skjellerup kein Champion in<br />
seinem Sport. Bei den vergangenen Weltcup-Rennen<br />
waren seine besten Platzierungen<br />
die Ränge 26 und 29. Er sei „oft<br />
pleite“, sagt Skjellerup. Er wohnt bei seinem<br />
Cousin in Calgary, weil er sich keine<br />
eigene Wohnung leisten kann, und fährt<br />
jeden Morgen mit dem Bus zum Training.<br />
Trotzdem ist er zurzeit ein gefragter<br />
Sportler.<br />
Blake Skjellerup, 28, ist schwul und<br />
kämpft seit Jahren für die Rechte Homosexueller.<br />
Es gibt nicht viele Sportler, die<br />
sich so stark politisch engagieren wie er.<br />
Weil in Russland im Juni ein umstrittenes<br />
Anti-Homosexuellen-Gesetz verabschiedet<br />
wurde, wollen jetzt alle von ihm wissen,<br />
wie er mit dem Thema bei Olympia<br />
umgeht.<br />
Männer, die Männer lieben, und Frauen,<br />
die Frauen lieben: Mit dem Thema<br />
hat sich der Sport stets schwergetan. Lesbische<br />
und schwule Spitzenathleten bekannten<br />
sich früher allenfalls nach dem<br />
Ende ihrer Karriere zu ihrer Neigung.<br />
Doch die Krusten brechen langsam auf.<br />
Inzwischen wagen auch aktive Profis ein<br />
Outing, wie zuletzt der Boxer Orlando<br />
Cruz aus Puerto Rico, der britische Turmspringer<br />
Tom Daley. Nie zuvor jedoch<br />
hat sich ein schwuler Sportler derart exponiert<br />
und seine Sexualität so zelebriert<br />
wie Skjellerup.<br />
Im Sommer, kurz nachdem in Russland<br />
das Anti-Homosexuellen-Gesetz erlassen<br />
worden war, ließ er sich für das britische<br />
Schwulenmagazin „Gay Times“ ablichten.<br />
Das Heft hob den „Skaterboy“ auf<br />
sein Cover, es zeigt Skjellerup mit geöffnetem<br />
Mund und nackt – nur mit einem<br />
Schlittschuh vor dem Schritt.<br />
Seither ist der Neuseeländer eine Ikone<br />
der Schwulenbewegung, er gilt als der<br />
Athlet, der bei Olympia gegen Putin aufstehen<br />
wird.<br />
136<br />
Das russische Gesetz gegen Homosexualität<br />
ist zum großen Thema vor den<br />
Winterspielen geworden. Es verbietet<br />
„Propaganda unter Minderjährigen für<br />
nichttraditionelle sexuelle Beziehungen“.<br />
Mit anderen Worten: Wer in Russland<br />
zeigt, dass er schwul ist, kann dafür bestraft<br />
werden.<br />
Athleten wie Skjellerup könnten den<br />
Mund halten, sich auf ihren Wettkampf<br />
konzentrieren und danach schnell wieder<br />
nach Hause fahren. Die lesbische Skispringerin<br />
Daniela Iraschko aus Österreich<br />
zum Beispiel, in Sotschi eine Favoritin<br />
auf die Goldmedaille, möchte sich<br />
lieber nicht zu den Verhältnissen in Russland<br />
äußern. Sie werde daran ohnehin<br />
nichts ändern können, sagt Iraschko.<br />
Skjellerup sieht das anders. Im November<br />
trat er beim Weltcup in Kolomna südöstlich<br />
von Moskau an. Aktivisten aus<br />
der lokalen Szene erzählten ihm, wie<br />
zwei Schwulenhasser vor einem Moskauer<br />
Homosexuellen-Club um sich geschossen<br />
hatten. Skjellerup war schockiert.<br />
Und er ist wütend. Er sagt: „Ich werde<br />
mich nicht verleugnen, nicht für irgendein<br />
falsches Gesetz und auch nicht für Olympia.“<br />
Er gehe in Sotschi nicht nur für sein<br />
Land an den Start, sondern „auch für alle<br />
HARRY ENGELS / GETTY IMAGES (R.)
Homosexuellen, für eine weltweite Gemeinschaft,<br />
die hart für ihre Rechte kämpfen<br />
muss“.<br />
Skjellerup stammt aus Christchurch, einer<br />
Stadt auf der Südinsel Neuseelands.<br />
Als Zehnjähriger begann er mit dem Eisschnelllaufen,<br />
mit 16 realisierte er, dass<br />
er wohl nicht auf Mädchen steht. Seine<br />
Mitschüler schikanierten ihn, beschimpften<br />
ihn als Schwuchtel. „Wenn sie mich<br />
verprügelt hätten, okay“, sagt Skjellerup,<br />
„aber die Sprüche waren die Hölle.“<br />
Abends im Bett habe er dafür gebetet,<br />
am nächsten Morgen als Hetero aufzuwachen.<br />
Er wollte, dass es aufhört, aber es<br />
hörte natürlich nicht auf.<br />
„Damals dachte ich, Schwulsein und<br />
die Olympischen Spiele, die beiden Dinge<br />
passen nicht zusammen“, sagt Skjellerup,<br />
„ich dachte, ein Schwuler kann kein Leistungssportler<br />
sein.“ Trotzdem trainierte<br />
er hart. Skjellerup wurde sechsmal neuseeländischer<br />
Shorttrack-Meister, startete<br />
im Weltcup, 2010 qualifizierte er sich erstmals<br />
für Olympia.<br />
Vor den Winterspielen in Vancouver<br />
klärte er seine Familie über seine Homosexualität<br />
auf. Sein damaliger Freund begleitete<br />
ihn zu den Wettkämpfen nach Kanada.<br />
Skjellerup belegte über 1000 Meter<br />
Platz 16. Nach Olympia outete er sich auch<br />
öffentlich, durch ein Interview in einem<br />
australischen Magazin. Inzwischen kennt<br />
fast jeder in seiner Heimat seine Geschichte.<br />
Skjellerup versteht sich als Aktivist. Er<br />
besuchte Highschools und erzählte den<br />
Schülern, wie er gemobbt wurde, von seiner<br />
Zerrissenheit, seinen Ängsten. Als Botschafter<br />
von „Athlete Ally“, einer Organisation,<br />
die Homophobie im Sport bekämpft,<br />
hält er Vorträge und beteiligt sich<br />
nun auch an einer Kampagne gegen das<br />
russische Anti-Homosexuellen-Gesetz.<br />
Shorttracker sind harte Kerle. Sie<br />
kämpfen bei den Rennen mit allen Tricks,<br />
manchmal auch mit den Ellenbogen. Die<br />
spektakulären Kurvenfahrten bei Tempo<br />
50 enden oft mit Massenstürzen.<br />
Skjellerup wird in Sotschi über 500 Meter<br />
starten. Er liebt die Sprintdistanz, man<br />
braucht eine gute Technik, Kraft, Mut.<br />
Aber seine Ambitionen als Sportler verschwinden<br />
hinter seinem politischen Auftrag,<br />
der immer größer wird.<br />
Vor eineinhalb Wochen trat er zum Tag<br />
der Menschenrechte als Gastdozent an<br />
der Universität in Calgary auf. Davor hatte<br />
sein Manager zu einem Pressetermin<br />
nach London eingeladen. Aus der ganzen<br />
Welt kamen Reporter und Fotografen,<br />
Skjellerup saß in einem Nebenraum eines<br />
Restaurants in der Nähe des Hyde Park.<br />
Niemand interessierte sich für seinen<br />
Sport, es ging nur um die Kampagne.<br />
Wie sein Protest in Sotschi aussehen<br />
werde, wurde er gefragt. Blake Skjellerup,<br />
gegelte Haare, gebleichte Zähne, lächelte.<br />
Ja, er habe einen Plan. Vor seinem<br />
Rennen werde er sich einen Pin in<br />
Regenbogenfarben anstecken, es ist das<br />
Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung.<br />
Über alles Weitere könne er nicht<br />
sprechen.<br />
Elf Schwulen- und Lesbenverbände unterstützen<br />
den Olympiaauftritt des Shorttrackers.<br />
Bei einer Spendenaktion für seine<br />
Mission Sotschi kamen 30000 Dollar<br />
zusammen. Die Erwartungen sind riesig.<br />
In der Schwulenszene wird Skjellerup<br />
mit Jesse Owens verglichen. Der farbige<br />
US-Leichtathlet gewann bei den Sommerspielen<br />
1936 in Berlin vor den Augen<br />
Adolf Hitlers vier Goldmedaillen. Nun<br />
soll Skjellerup aus Christchurch die russische<br />
Politik bloßstellen.<br />
In der Weltrangliste über 500 Meter<br />
liegt Skjellerup im Moment auf Platz 50,<br />
in dieser Form würde er in Sotschi wohl<br />
im Vorlauf ausscheiden, er müsste Olympia<br />
durch die Hintertür verlassen, die<br />
Kampagne würde untergehen.<br />
Er sagt, es sei höchste Zeit, mit der Vorbereitung<br />
zu beginnen. LUKAS EBERLE<br />
Shorttracker Skjellerup (l.)
Sport<br />
Bayern-Macher Hoeneß, Guardiola, Rummenigge<br />
FUSSBALL<br />
Jenseits von Toren<br />
Bei Pep Guardiola soll das Publikum<br />
immer ein Spektakel bekommen. Aber es muss lernen,<br />
richtig hinzuschauen. Von Jörg Kramer<br />
PIXATHLON<br />
Vergangene Woche war Pep Guardiola<br />
mit seiner Tochter im Zirkus.<br />
Der Bayern-Trainer fungierte als<br />
Stargast und Schirmherr einer Münchner<br />
Charity-Aufführung von Roncalli, alsbald<br />
griff er selbst ins Geschehen ein: Einem<br />
Jongleur warf er einen Ball zu.<br />
Keine große Aktion. Doch wenn man<br />
um sein Talent zur Perfektionierung von<br />
Showveranstaltungen weiß, kann man<br />
sich ausmalen, was in der Manege los<br />
138<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
wäre, ließe man ihm nur etwas mehr<br />
Spielraum. Guardiola käme womöglich<br />
auf die Idee, das Zirkuspferd ins Trapez<br />
zu setzen, den Clown zu longieren oder<br />
die Hochseilakrobaten ins Orchester einzuwechseln.<br />
Womöglich wäre am Ende<br />
alles noch bunter, auf eine Weise zumindest,<br />
über die man bisher noch nicht nachgedacht<br />
hat.<br />
Im deutschen Fußball ist der kreative<br />
Katalane gerade dabei, den Blick des Publikums<br />
auf das Spiel zu schulen. Und er<br />
hat längst das Verständnis von der Rolle<br />
eines Trainers verändert. Bei Bayern<br />
München sitzt er am Rand wie an einer<br />
Spielkonsole. Es ist ja nicht so, dass die<br />
Mannschaft auf seinen Fingerzeig hin<br />
bloß mal eben das System wechselt. Der<br />
Trainer ändert, indem er Figuren verschiebt<br />
oder Anweisungen gibt, mitunter<br />
das ganze Programm, schaltet um wie auf<br />
eine andere sportliche Disziplin.
Nie zuvor war ein Trainer so spielbestimmend.<br />
Vergangene Woche im DFB-<br />
Pokal, als das aggressive Pressing des FC<br />
Augsburg Probleme bereitete: Guardiola<br />
ließ Thiago und Javi Martínez die Positionen<br />
tauschen – und die Bayern hatten<br />
das Spiel im Griff. Oder kürzlich beim<br />
Rasenschach gegen Borussia Dortmund,<br />
als der Gegner seine typische Balleroberungswut<br />
auf tückische Weise zurückhielt:<br />
die ganz hohe Schule. Guardiola zieht<br />
den Kämpfer Martínez aus dem Mittelfeld,<br />
parkt ihn aber, den nächsten Zug<br />
mitdenkend, nur eine Weile in der Verteidigung.<br />
Später, als das Führungstor erzielt<br />
ist, braucht er ihn wieder als Stabilisator<br />
vor der Abwehr.<br />
Geht es um eine Machtdemonstration?<br />
Sind die emsigen Interventionen von der<br />
Seitenlinie ein Selbstzweck? Guardiola<br />
zielt auf den Beifall, und zwar für das<br />
Spiel. Wozu die ganze Akribie führen<br />
kann, wird wahrscheinlich an diesem<br />
Dienstag wieder zu beobachten sein – im<br />
Rückspiel gegen Manchester City in der<br />
Champions League, wenn eine etwa<br />
gleich stark besetzte Mannschaft die<br />
Münchner zur Höchstleistung zwingt.<br />
Vor zehn Wochen, beim Hinspiel in<br />
Manchester, kratzten Guardiolas Männer<br />
an der Perfektion. Es war der wohl<br />
schönste, künstlerisch wertvollste Fußballabend<br />
der Saison.<br />
Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz<br />
Rummenigge nannte das Spiel „eine Augenweide“.<br />
Die Münchner gewannen 3:1,<br />
aber das war es nicht. Selbst Präsident<br />
Uli Hoeneß, den normalerweise nur die<br />
Punkte und der Vorsprung in der Tabelle<br />
interessieren, schien ergriffen von der ästhetischen<br />
Dimension eines Fußballspiels.<br />
Er erteilte ein „summa cum laude“.<br />
Gemeint ist eine Qualität jenseits von<br />
Toren und Tabellen, wenn Pep Guardiola<br />
sagt, seine Mannschaft solle „gut“ spielen.<br />
„Für den einen ist es bedeutender zu gewinnen,<br />
für den anderen, dass seine<br />
Mannschaft gut spielt“, erklärte er neulich<br />
im ZDF. Es war die Frage aufgekommen,<br />
wie ein Trainer so missvergnügt wirken<br />
könne, dessen Mannschaft pausenlos<br />
neue Rekorde aufstellt. Dies sei noch<br />
nicht seine Mannschaft, hatte Guardiola<br />
bekannt, „ich fühle noch nicht das Spiel,<br />
wie ich es mag“.<br />
Es hat schon genügsamere Lehrer gegeben.<br />
Rund 40 Bundesligaspiele unbesiegt,<br />
zehn Siege in Folge in der Cham -<br />
pions League, das alles zählt nicht für den<br />
schmalen Mann im Maßanzug. „Wenn<br />
wir nicht die Fähigkeit behalten zu erkennen,<br />
dass wir noch nicht perfekt sind“,<br />
sagt er, dann werde man noch alles verspielen.<br />
Pep Guardiola ist davon überzeugt,<br />
dass ein Team nur dann dauerhaft<br />
Erfolg haben kann, wenn es gut spielt.<br />
Die Bestimmung „gut“ hat dabei durchaus<br />
eine ethische Konnotation. Guardiolas<br />
Elf soll anständig gewinnen, nicht die<br />
Punkte stehlen, indem sie sich vor dem<br />
Tor verschanzt und nur einmal einen Konter<br />
setzt. Auch nicht durch Betrug, also<br />
Schwalben, oder mit althergebrachter<br />
Bayern-München-Effizienz: durch einen<br />
wuchtigen Kopfball kurz vor Schluss.<br />
Guardiola-Mannschaften verdienen<br />
sich den Sieg. Mit hoher Laufintensität<br />
sollen sie immerfort Anspielstationen<br />
schaffen, die Voraussetzung für schnelles<br />
Passspiel. Damit dominieren sie, wenn alles<br />
klappt, ihren Gegner, entkräften ihn<br />
und rauben ihm den letzten Nerv. Guardiolas<br />
Lieblingstore fallen nicht, sie werden<br />
kreiert – mit Raffinesse, im Mittelfeld,<br />
stilvoll und irgendwie edel.<br />
Es gehe darum, eine gute Show hinzulegen,<br />
sagt der Meister. „Ich habe meine<br />
Spieler immer gebeten, alles zu geben,<br />
weil die Leute das merken.“ Er werde<br />
dulden, dass seine Spieler danebenschießen,<br />
„aber niemals, dass sie sich nicht anstrengen“.<br />
Ungeklärt bleibt vorerst, wie der Mann<br />
mit seinem Moral-Fußball eigentlich zum<br />
FC Bayern passt. Die Frage stellt sich<br />
nicht wegen der Affären der Bosse, Rummenigges<br />
Zollvergehen mit Rolex-Uhren<br />
oder Hoeneß’ Steuerangelegenheiten. Es<br />
„Ich habe meine Spieler<br />
immer gebeten,<br />
alles zu geben, weil die<br />
Leute das merken.“<br />
geht um das Spiel. Und das Spiel des Rekordmeisters<br />
fußt auf einer Tradition des<br />
zynischen Ergebnisfußballs. Bayern-Fans<br />
verabschieden sich nach dieser Tradition<br />
mit achselzuckender Ätsch-Haltung aus<br />
der Arena: So sind wir halt, mia san mia.<br />
Ein Trainer, der eine eigene Gesinnung<br />
pflegt, zu der auch noch Bescheidenheit<br />
gehört, will sich nur schwer ins Bayern-<br />
Weltbild fügen. Darin hatten Trainer<br />
zwar stets zu gewinnen, aber sonst nicht<br />
viel zu melden. Der Großteil des Ruhms<br />
war den Vereinsfunktionären vorbehalten,<br />
die dem Coach all die teuren Spieler<br />
beschafften, herausgekauft aus der Belegschaft<br />
der Konkurrenz.<br />
Guardiola bekam sogar das Ensemble<br />
eines Triple-Siegers zur Verfügung gestellt,<br />
ergänzt um die Stars Mario Götze<br />
und Thiago Alcántara. Und trotzdem erkennt<br />
jeder Fachmann, wer im Prozess<br />
der Verwandlung und Veredelung des<br />
Bayern-Stils die Hauptrolle spielt.<br />
Die Siege, die unterwegs eingefahren<br />
werden, sind jetzt nicht das Ziel, sondern<br />
der Weg – ein Mittel zum Zweck. Sie dienen<br />
Guardiola derzeit, da es im Zusammenspiel<br />
auch von Mannschaft und Trainer<br />
oft noch holpert, zur Ruhigstellung<br />
des Umfelds, Labsal für die Fans und auch<br />
für die Bosse.<br />
Die reden manchmal über ihn wie über<br />
einen Kauz, der schon irgendwann zur<br />
Vernunft kommt. „Pep ist noch in der Findungsphase“,<br />
so kommentierte Hoeneß<br />
die wechselnden Mannschaftsaufstellungen,<br />
als Philipp Lahm anfing, ab und zu<br />
im Mittelfeld aufzulaufen.<br />
Inzwischen ist die vermeintliche Probierphase<br />
ein Dauerzustand, personelle<br />
und taktische Umstellungen gehören da -<br />
zu wie Schienbeinschützer und Eckbälle.<br />
Die „Süddeutsche Zeitung“ nannte Guar -<br />
diolas Bayern-Mannschaft ein elfköpfiges<br />
Ungeheuer, das jederzeit seine Form ändern<br />
könne, unberechenbar für Freund<br />
und Feind.<br />
Schwer zu sagen, ob die Bayern das so<br />
geplant hatten, als sie den pausierenden<br />
Erfolgscoach aus Barcelona als Nachfolger<br />
von Jupp Heynckes aussuchten. Oder<br />
ob er einfach nur auf dem Markt war.<br />
Jedenfalls verstehen sie ihn nicht.<br />
Sportvorstand Matthias Sammer springt<br />
dem Trainer fröhlich in den Nacken,<br />
wenn ein Tor fällt. Wenn Guardiola dann<br />
erschrickt, sieht man ihm an, dass er diese<br />
Art Nähe nicht schätzt.<br />
Als Sammer nach einem Heimsieg gegen<br />
Hannover 96 den mal wieder grüblerischen<br />
Coach in seinem Anspruchsdenken<br />
bestärken wollte, redete er am Thema<br />
vorbei. Sammer kritisierte, das Team<br />
spiele lethargisch, ohne Emotionen. Guar -<br />
diola beanstandet aber nicht die Einstellung,<br />
sondern die Ausführung.<br />
Die Frage ist auch, ob er zu diesem<br />
Fußballland passt. In <strong>Deutschland</strong> wird<br />
die Arbeit von Torjägern höher geschätzt<br />
als die Kreativität der Passgeber. Und die<br />
hiesige Fußballleidenschaft bemisst sich<br />
an der hohen Zahl von Menschen, die<br />
samstags die Bundesliga live bei Sky<br />
schauen, in Gemeinschaft, in Kneipen –<br />
und auf dem Kanal „Konferenz“. Dort<br />
sieht man nicht die Spiele, sondern die<br />
Tore. Man wird hin- und hergeschickt und<br />
über die Zwischenstände informiert – die<br />
könnte man genauso gut im Internet verfolgen<br />
oder im Videotext.<br />
Viele Leute sind nicht an der Spielentwicklung<br />
interessiert, an Ästhetik oder<br />
Strategie, sondern schlicht an jener Dramatik,<br />
die in der Frage liegt, wer wohl<br />
gewinnt. Als Leser würden sie in Büchern<br />
die Landschaftsbeschreibungen überspringen,<br />
um schneller an die Auflösung des<br />
Kriminalfalls oder Beziehungsdramas zu<br />
gelangen. In Spanien gibt es keine Live-<br />
Konferenz, schon wegen der unterschiedlichen<br />
Anstoßzeiten.<br />
Dass im Fußball eine Schönheit abseits<br />
von Toren und Torraumszenen existiert,<br />
bringt Guardiola den Leuten vielleicht<br />
bei. Seine Schüler wissen es schon.<br />
Der Nationalspieler Thomas Müller<br />
zum Beispiel hat begriffen, was sein Trainer<br />
will. Nach der Vorführung gegen Manchester<br />
stellte er fest: Dies sei „Fußball,<br />
der glücklich macht“.<br />
◆<br />
DER SPIEGEL 50/2013 139
Prisma<br />
Gläubige beim Gebet<br />
MOBILFUNK<br />
Gebetshelfer für Muslime<br />
ARTENSCHUTZ<br />
Haushunde gegen Raubkatzen<br />
Geparden holen sich ihre Beute gern in<br />
Rinderfarmen. Die Viehbauern greifen<br />
dann häufig zur Waffe und machen<br />
Jagd auf die bedrohten Wildtiere. Britische<br />
Ökologen von der University of<br />
Kent empfehlen jetzt eine sanftere Methode,<br />
um die Raubkatzen abzuwehren:<br />
Geparden<br />
ALEXANDROS MICHAILIDIS<br />
Eine SIM-Karte für strenggläubige<br />
Muslime hat der griechische Elektroingenieur<br />
Yiannis Hatzopoulos<br />
entwickelt. Mit Hilfe der Islamic SIM<br />
im Handy sollen Gläubige überall auf<br />
der Welt die Gebetsrichtung nach<br />
Mekka bestimmen können. Bezogen<br />
auf den jeweiligen Aufenthaltsort erfahren<br />
sie die richtigen Zeiten für<br />
ihre täglichen Gebete per SMS. Während<br />
der religiösen Pflichten wird<br />
das Telefon automatisch auf stumm<br />
geschaltet, so dass keine Anrufe stören<br />
können. Diverse Apps mit Sonderfunktionen<br />
für Muslime sind zwar<br />
bereits auf dem Markt. Doch sie<br />
funktionieren nur auf modernen<br />
Smartphones. Der Chip des Griechen<br />
ist dagegen für ältere Billighandys gedacht,<br />
wie sie in asiatischen und afrikanischen<br />
Ländern noch immer weit<br />
verbreitet sind.<br />
Herdenschutzhunde. Bei Feldstudien in<br />
Südafrika stellten sie fest, dass es bei<br />
über 90 Prozent der Farmen nicht mehr<br />
zu Verlusten durch Raubkatzen kam,<br />
wenn Hunde die Herden bewachten.<br />
Die Viehhalter sparten dadurch jährlich<br />
umgerechnet mehrere hundert Euro.<br />
ROBERT HENNO / REPORTERS / LAIF<br />
KOMMENTAR<br />
Verschaltet<br />
Von Rafaela von Bredow<br />
Eine neue Hirnwindung beim<br />
Mann entdeckt? Pinkelt er deswegen<br />
im Stehen? Ein Neuronenhäufchen<br />
im Sprachzentrum der Frau?<br />
Erklärt das, warum sie so viel<br />
quasselt? Kaum je ist Wissenschaft<br />
beliebter, als wenn es um den kleinen<br />
Unterschied zwischen Mann<br />
und Weib geht. Dürstend nach Bestätigung<br />
alltäglicher Marsmann-<br />
Venusfrau-Beobachtungen, klickt<br />
und kommentiert sich das Publikum<br />
zahlreich und lustvoll durch<br />
jeden Bericht, der neue Entdeckungen<br />
präsentiert. Es ist nur bitter,<br />
wenn die Leute mehr Mario<br />
Barth bekommen als Wissenschaft.<br />
So geschehen vorige Woche, als<br />
eine Studie der University of<br />
Pennsylvania die Runde machte:<br />
Die Forscher hatten festgestellt,<br />
dass viele Nervenbahnen im Kopf<br />
weiblicher Probanden beide Hirnhälften<br />
verschalten, während die<br />
Leitungen der Männer innerhalb<br />
der jeweiligen Hemisphäre enger<br />
vernetzt sind. So weit, so seriös.<br />
Wegen dieser kurzen Wege,<br />
schlussfolgerten die Wissenschaftler,<br />
könne der Mann Wahrnehmung<br />
und Bewegung besser koordinieren,<br />
während die Frau im<br />
Kopf „fest verdrahtet“ dafür sei,<br />
Logik (links) und Intuition (rechts)<br />
zugleich spielen zu lassen.<br />
Mit dem gleichen Wahrheitsgehalt<br />
könnte man behaupten: Je zotteliger<br />
das Haar, desto verdrehter die<br />
Denke. Es ist schlicht nicht bekannt,<br />
wie sich die Verschaltung<br />
der Neuronen auf Kognition und<br />
Verhalten auswirkt. Wahrscheinlich<br />
hat sie mehr mit der Hirn -<br />
größe als mit dem Geschlecht zu<br />
tun. Und: „Fest verdrahtet“ klingt,<br />
als hätte die Biologie Mann und<br />
Weib programmiert wie Ratten<br />
oder Nacktmulle. Tatsächlich aber<br />
sortiert und formiert sich das<br />
menschliche Gehirn immerfort<br />
neu. Keine Rede davon bei den<br />
Forschern aus Pennsylvania. Nicht<br />
sexy genug als Botschaft? Die Intuition,<br />
fabulierte eine der Wissenschaftlerinnen<br />
lieber weiter,<br />
helfe Frauen womöglich dabei,<br />
„gute Mütter“ zu sein. Wo war da<br />
bei ihr die Verschaltung mit links?<br />
140 DER SPIEGEL 50/2013
Wissenschaft · Technik<br />
CARSTEN REHDER / DPA<br />
Die Schönheit des Sturms Mit kräftigen Böen peitschte<br />
der Orkan „Xaver“ am Donnerstag voriger Woche meterhohe<br />
Nordseewellen gegen den Fähranleger im nordfriesischen<br />
Dagebüll. Am Tag darauf gaben die Sturmflut-Lagezentren in<br />
Schleswig-Holstein Entwarnung: Überall an der Küste hatten<br />
die Deiche den Wassermassen standgehalten. Auch in Hamburg<br />
gingen die schweren Sturmfluten glimpflich aus. Der<br />
Deutsche Wetterdienst wertete „Xaver“ als „recht kräftigen<br />
Orkan“, der sich aber „nicht mit den großen Stürmen des<br />
vergangenen Jahrhunderts vergleichen“ lasse.<br />
RAUCHEN<br />
E-Zigaretten verstärken die Sucht<br />
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Elektrische Zigaretten (E-Zigaretten)<br />
helfen Jugendlichen offenbar nicht,<br />
vom Rauchen loszukommen – im Gegenteil.<br />
Zu diesem Ergebnis gelangen<br />
Mediziner und Suchtforscher von der<br />
University of California in San Francisco,<br />
die die Rauchgewohnheiten von<br />
über 75000 koreanischen Jugendlichen<br />
untersucht haben. In E-Zigaretten wird<br />
kein Tabak verbrannt, sondern nikotinhaltige<br />
Flüssigkeit verdampft und in -<br />
haliert. Bei der Studie zeigte sich, dass<br />
viele der Jugendlichen die E-Zigaretten<br />
als Entwöhnungshilfen eingesetzt<br />
hatten, um sich von der Tabaksucht zu<br />
befreien. Doch der Erfolg war bescheiden:<br />
Rund 80 Prozent der Befragten<br />
qualmten auch weiterhin normale<br />
Zigaretten, in vielen Fällen stieg der<br />
Konsum sogar deutlich an. „E-Zigaretten<br />
könnten zu einem neuen Pfad in<br />
die Nikotinabhängigkeit werden“,<br />
heißt es in der Studie. Sie machten es<br />
den Heranwachsenden häufig noch<br />
schwerer, auf herkömm liche Zigaretten<br />
zu verzichten. In den USA hat sich<br />
die Zahl der jugendlichen E-Zigaretten-Raucher<br />
von 2011 auf 2012 mehr<br />
als verdoppelt.<br />
Jugendliche mit E-Zigarette<br />
141
Wissenschaft<br />
FISCHEREI<br />
Trawler an<br />
der Kette<br />
Scholle, Dorsch und Hering der Ostsee geht es wieder<br />
erstaunlich gut. Auch in der Nordsee erholen sich<br />
manche Bestände. Sanfte Fischerei soll den Raubbau in<br />
den Meeren nun europaweit stoppen.<br />
Fischtrawler auf der Nordsee<br />
142<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Als die Männer das Netz über dem<br />
Schiffsdeck öffnen, klatschen fette<br />
Dorsche in die Fischkörbe aus<br />
Plastik. Glitschige Schollen und Flundern,<br />
rau wie Sandpapier, schnappen nach Luft.<br />
Steinbutte, so groß wie zwei kräftige Fischerhände,<br />
winden sich zwischen silbrigen<br />
Heringen und platten Klieschen.<br />
Gleich obenauf liegt ein besonders großer<br />
Dorsch mit weit aufgerissenem Maul.<br />
„Sicher über sechs Kilo schwer“, schätzt<br />
Martina Bleil und blickt hinunter auf das<br />
Flossentier, „der ist topfit.“ Etwa acht<br />
Jahre alt sei das Weibchen, sagt die Fischereibiologin,<br />
„das hätte bald wieder<br />
abgelaicht“.<br />
Bleil arbeitet am Thünen-Institut für<br />
Ostseefischerei (Thünen-OF) in Rostock,<br />
einer dem Landwirtschaftsministerium<br />
unterstellten Bundeseinrichtung. Reiche<br />
Beute haben die Forscherin und ihre Kollegen<br />
an diesem klaren Novembertag in<br />
der Mecklenburger Bucht gemacht. „Wir<br />
sind in der Ostsee mit den Fischbeständen<br />
auf einem sehr guten Weg“, sagt Bleil.<br />
„Wer Schollen oder Heringe isst, muss<br />
kein schlechtes Gewissen mehr haben.“<br />
In den Meeren vor den deutschen Küsten<br />
geschieht Verblüffendes. Lange galten<br />
die meisten Arten als überfischt. Nun erholen<br />
sich einige Bestände erstaunlich<br />
schnell. Teilweise in der Nordsee, vor allem<br />
aber in der Ostsee beobachten Experten<br />
einen deutlichen Aufwärtstrend.<br />
„Wir gehen davon aus, dass die Ostsee<br />
das erste europäische Meer sein wird, das<br />
vollständig nachhaltig befischt werden<br />
kann“, sagt Christopher Zimmermann,<br />
Leiter des Thünen-OF in Rostock, „das<br />
wäre ein Riesenerfolg.“<br />
In diesem Jahr hat die EU zudem eine<br />
Reform der „Gemeinsamen Fischereipolitik“<br />
auf den Weg gebracht, die „den positiven<br />
Trend noch beschleunigen wird“,<br />
prophezeit Zimmermann. Tatsächlich<br />
könnten die neuen Regeln eine Zeitenwende<br />
einläuten.<br />
„Bislang hat die Ministerrunde in einer<br />
Nacht-und-Nebel-Sitzung irgendwelche<br />
Quoten für die Fischerei festgelegt“, berichtet<br />
die schleswig-holsteinische EU-<br />
Parlamentarierin Ulrike Rodust (SPD),<br />
die in Brüssel die Reform federführend<br />
durchgeboxt hat. Mit einem solchen<br />
„Kuhhandel“ zwischen den Mitgliedstaaten,<br />
der die Fischbestände unzureichend<br />
schütze, sei nun Schluss.<br />
Rodust erwartet, dass striktere Höchstfangmengen<br />
europaweit die Trendwende<br />
bringen werden. Im Januar tritt die Verordnung<br />
in Kraft:<br />
‣ Künftig sollen die Fischereiquoten ausschließlich<br />
nach wissenschaftlichen Kriterien<br />
festgelegt werden. Spätestens<br />
2020 sollen alle Bestände nur noch bis<br />
zum „höchstmöglichen nachhaltigen<br />
Ertrag“ befischt werden.<br />
‣ Unerwünschter Beifang soll angelandet<br />
und auf die Quote angerechnet werden.<br />
Je mehr Beifang die Fischer machen,<br />
desto weniger vermarktbaren Fisch<br />
können sie dann also fangen. Die Regelung<br />
schafft einen Anreiz, selektivere<br />
Fangmethoden zu verwenden.<br />
‣ Subventionen für den Neubau von<br />
Trawlern werden gestrichen. Stattdessen<br />
steht mehr Geld für die Kontrolle<br />
der Fischer und die Erforschung der<br />
Bestände bereit.<br />
‣ Für EU-Fischer gelten die neuen Regeln<br />
auch außerhalb Europas. Europäische<br />
Trawler können dann etwa nicht<br />
mehr einfach das Meeresgetier vor den<br />
Küsten Afrikas abräumen.<br />
‣ Die Details der Fischfang-Regulierung<br />
werden regional verhandelt. In der<br />
Irischen See könnten bald andere<br />
Vorschriften gelten als vor Spaniens<br />
Küsten.<br />
In der Ostsee ist schon annähernd geschafft,<br />
was auch in anderen europäischen<br />
Seegebieten gelingen soll. Möglich<br />
sei der Erfolg durch die Einigkeit der Ostseeanrainer<br />
geworden, das Meer nur noch<br />
nachhaltig zu befischen, berichtet Zimmermann.<br />
Das war nicht immer so: Noch bis 2007<br />
zogen polnische Fischer rund hundert<br />
Prozent mehr Dorsch als von Brüssel zugebilligt<br />
aus dem Wasser. Erst die neue<br />
Regierung unter Donald Tusk legte „die<br />
Trawler an die Kette“, berichtet Fischereiforscher<br />
Zimmermann. „Inzwischen<br />
halten sich auch die Polen an die Regeln.“<br />
Der Erfolg der Ostsee-Fischereipolitik<br />
ist unübersehbar. Dem Dorsch in der östlichen<br />
Ostsee beispielsweise, 2005 noch<br />
stark überfischt, gehe es inzwischen „sehr<br />
gut“, berichtet Zimmermann. Die Schollenbestände<br />
seien „in wunderbarem Zustand“.<br />
Der Hering der östlichen Ostsee<br />
produziere wieder kräftig Nachwuchs (siehe<br />
Grafik).<br />
Und auch in der Nordsee geht es einigen<br />
Fischarten wieder besser. Forscher<br />
des Thünen-Instituts für Seefischerei in<br />
Hamburg untersuchten unlängst 43 Fischbestände<br />
und bescheinigten 27 davon einen<br />
„guten ökologischen Zustand“. Das<br />
Bundeslandwirtschaftsministerium wiederum<br />
lobt, dass „mehr als die Hälfte der<br />
Fischbestände in Nordsee und Nordostatlantik“<br />
schon heute „nachhaltig bewirtschaftet“<br />
werde.<br />
Insbesondere Hering und Scholle entwickelten<br />
sich in der Nordsee gut, bestätigt<br />
Zimmermann. Selbst der Nordsee -<br />
kabeljau, jahrelang Sorgenkind der Biologen,<br />
zeige endlich erste Anzeichen von<br />
Erholung.<br />
Zimmermann ist einer der Manager<br />
des Fischwunders. Er sitzt für <strong>Deutschland</strong><br />
im Forscherverbund International<br />
Council for the Exploration of the Sea<br />
(ICES), der die Empfehlungen für die EU-<br />
Fangquoten ausarbeitet. Für die Ostsee<br />
werden die Daten der Bestandsanalyse<br />
durch Einsatz von Forschungsschiffen wie<br />
der „Clupea“ gewonnen.<br />
Fischereibiologin Martina Bleil fährt regelmäßig<br />
hinaus aufs Meer. Zusammen<br />
Seelachs<br />
Mehr Fisch<br />
Trend für die Bestände ausgewählter Arten in Nord- und Ostsee<br />
positiv<br />
negativ<br />
SCHWEDEN<br />
Dorsch<br />
Östliche<br />
Ostsee<br />
Hering<br />
Hering<br />
Hering<br />
PEER BROCKHÖFER / ACTION PRESS<br />
Scholle<br />
Nordsee<br />
Kabeljau<br />
Aal<br />
DÄNEMARK<br />
DEUTSCHLAND<br />
Dorsch<br />
Scholle<br />
Sprotte<br />
Westliche<br />
Ostsee<br />
Kliesche<br />
Aal<br />
Quelle: Thünen-Institut für Ostseefischerei<br />
POLEN<br />
DER SPIEGEL 50/2013 143
Wissenschaft<br />
mit ihren Helfern zieht sie dann ein standardisiertes<br />
Forschungsnetz vom Typ<br />
TV3/520 durch die Fluten. Im Wasser öffnet<br />
das Netz seinen etwa 20 Meter breiten<br />
und 2 Meter hohen Schlund. Bei nur 22<br />
Millimeter Maschenweite entkommt<br />
kaum ein schwimmendes Meerestier dem<br />
Fangapparat.<br />
An diesem Novembertag steuert „Clupea“-Kapitän<br />
Rolf Singer zwei Entnahmestellen<br />
an. Ist der Fang an Bord gezogen,<br />
schnappt sich Bleil einen Dorsch<br />
nach dem anderen und wuchtet ihn auf<br />
einen nahen Tisch. Dann nimmt sie Maß.<br />
„84 Zentimeter Länge“, ruft sie den Helfern<br />
zu. Geübt schneidet sie die Tiere am<br />
Bauch mit einer Schere auf. Bleils Plastikhandschuhe<br />
sind rot verschmiert. Fischblut<br />
tropft auf das grüngestrichene Arbeitsdeck.<br />
„Weiblich“, ruft sie. „Magen:<br />
65 Gramm, Leber: 170 Gramm“ – so geht<br />
es in einem fort.<br />
Die Datensammelei ist Grundlage für<br />
die Empfehlungen des ICES. Die Höchstfangmengen<br />
für viele Fischbestände haben<br />
die Experten in den vergangenen Jahren<br />
deutlich nach unten korrigiert. Während<br />
die Bestände früher oftmals radikal<br />
überfischt wurden, gilt spätestens ab Januar<br />
das strikte Nachhaltigkeitsprinzip.<br />
Der Fischfang soll dabei so reguliert<br />
werden, dass sich der Bestand langfristig<br />
stabilisieren oder sogar vergrößern kann.<br />
Den Fischern solle es ermöglicht werden,<br />
„mit minimalem Aufwand den maximalen<br />
Ertrag“ (Zimmermann) zu ernten –<br />
und zwar dauerhaft.<br />
Geht es den Beständen gut, lässt sich<br />
mehr fangen; auf diese Weise sollen auch<br />
die Fischer von der Reform profitieren.<br />
Der überfischte Kabeljau-Bestand der<br />
Nordsee etwa liefert seit über zehn Jahren<br />
einen Ertrag von maximal 40000 Tonnen<br />
jährlich. Wäre er in gutem Zustand,<br />
erläutert Zimmermann, könnte leicht<br />
mehr als dreimal so viel Fisch gefangen<br />
werden.<br />
Für eine Reform der EU-Fischereipolitik<br />
gibt es daher gute Gründe – zumal<br />
die Fangmengen vielerorts bislang weit<br />
über den wissenschaftlichen Empfehlungen<br />
lagen. Zudem ist knapp ein Viertel<br />
der von der EU-Flotte gefangenen Fische<br />
Beifang und geht direkt zurück ins Wasser.<br />
Die wenigsten von ihnen überleben.<br />
„Der Raubbau muss ein Ende haben“,<br />
sagt Rodust. Die Politikerin ist zuversichtlich,<br />
dass dies auch gelingen kann. Möglichst<br />
bis 2015, spätestens jedoch bis 2020<br />
sollen alle EU-Fischbestände auf die neue,<br />
sanfte Art befischt werden. Die EU könne<br />
weltweit Vorbild sein, sagt Rodust: „Wir<br />
sind für die Reform international sehr<br />
gelobt worden.“<br />
Ganz so positiv mag das allerdings<br />
nicht jeder Fischereiexperte sehen. „Die<br />
Reform soll von denselben Leuten umgesetzt<br />
werden, die für die massive Über -<br />
fischung der letzten Jahrzehnte verantwortlich<br />
waren“, kritisiert etwa Rainer<br />
Froese vom Geomar Helmholtz-Zentrum<br />
für Ozeanforschung in Kiel.<br />
Weil künftig bindend sein soll, was die<br />
Wissenschaft empfiehlt, fürchtet Froese,<br />
dass die Fischereilobby nun versuchen<br />
könnte, die Wissenschaftler unter Druck<br />
zu setzen. Die Quotenempfehlungen des<br />
ICES könnten dann doch wieder zu hoch<br />
ausfallen.<br />
Erst müssten sich die Bestände erholen,<br />
dann könne man über eine nachhaltige<br />
Bewirtschaftung nachdenken, fordert<br />
Froese. Denn nicht mit allen Fischbeständen<br />
geht es bergauf.<br />
„Aal und Lachs werden in der Ostsee<br />
weiterhin stark überfischt“, kritisiert der<br />
Biologe. Während es dem Dorsch der östlichen<br />
Ostsee bessergehe, stehe das Tier<br />
westlich von Bornholm weiterhin unter<br />
zu starkem Druck. In der Nordsee wiederum<br />
hätten sich die Bestände von Kabeljau<br />
und Seelachs noch längst nicht erholt.<br />
Aal und Dornhai seien sogar „akut<br />
bedroht“.<br />
Und auch gegen die Subventionen wendet<br />
sich der Forscher: „Sie sind zwar neu<br />
geregelt, aber nicht verringert worden.“<br />
Zuschüsse für Schiffstreibstoff zum Beispiel<br />
erlaubten weiterhin den Einsatz massiven,<br />
schwer zu schleppenden Grundgeschirrs,<br />
das den Meeresboden aufreißt<br />
und umpflügt und auf diese Weise wichtigen<br />
Lebensraum für die Fischbrut zerstört.<br />
„Wir sind im Augenblick noch in der<br />
Hölle und marschieren auf das Tor zum<br />
Paradies zu“, konstatiert Froese. „Die<br />
Frage ist, ob wir auf der Schwelle stehen<br />
bleiben oder durchgehen.“<br />
Experte Zimmermann dagegen will lieber<br />
Optimismus verbreiten. „Die Nörgelei“,<br />
erklärt er, „führt in der Regel nur<br />
dazu, dass die Leute sagen: ,O Gott, Fisch<br />
lieber gar nicht mehr‘, und stattdessen<br />
Pute aus Intensivhaltung essen.“ Viele<br />
Meeresfische könnten wieder „mit gutem<br />
Gewissen und Genuss verzehrt werden“,<br />
so Zimmermann.<br />
In der Ostsee spricht der Biologe bei<br />
einzelnen Beständen sogar schon von<br />
„Unternutzung“. Der Dorschbestand im<br />
Osten zum Beispiel sei so stark angewachsen,<br />
dass die Tiere „anfangen, sich gegenseitig<br />
zu fressen und sich die Nahrung abzujagen“.<br />
Inzwischen sei jeder fünfte Dorsch im<br />
Bornholm-Becken so mager, dass er nicht<br />
mehr filetiert werden könne. „Dreikantfeilen“<br />
nennen die Fischer derlei Exemplare,<br />
weil sie so knochig sind. Verkaufen<br />
lassen sich die Tiere nicht mehr. Zimmermann:<br />
„Die wandern in die Fischmehlproduktion.“<br />
PHILIP BETHGE<br />
Video: Welchen Fisch darf<br />
man wieder essen?<br />
spiegel.de/app502013fisch<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
144<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Wissenschaft<br />
Jodversorgung weltweit, 2013<br />
starker<br />
Mangel<br />
geringer<br />
Mangel<br />
ausreichende<br />
Versorgung<br />
Jodüberschuss<br />
keine Daten<br />
146<br />
ERNÄHRUNG<br />
Würze für den Geist<br />
Die Werbekampagne pries ein wahres<br />
Wundermittel an. Das von<br />
„hohen medizinischen Autoritäten“<br />
empfohlene Produkt, so versprachen<br />
es Anzeigen in großen Tageszeitungen,<br />
werde zu „größeren und schwereren Kindern“<br />
sowie zu einer „überlegenen Entwicklung“<br />
führen.<br />
Die Kampagne war in den zwanziger<br />
Jahren ein voller Erfolg. Seither würzen<br />
Millionen Amerikaner ihre Speisen mit<br />
jodiertem Speisesalz. Bereits zehn Jahre<br />
nach Beginn der Kampagne gab es kaum<br />
noch Anzeichen für einen deutlichen Jodmangel.<br />
Nur noch wenige US-Bürger hatten<br />
auffallend große Kröpfe, die als sichtbarste<br />
Zeichen für eine Unterversorgung<br />
der Schilddrüse mit dem wichtigen Spuren -<br />
element gelten.<br />
Wie sich nun herausstellt, hatte das Jodsalz<br />
noch eine andere, verblüffende Nebenwirkung:<br />
Die Amerikaner sind intelligenter<br />
geworden.<br />
Bei einem Viertel der Bevölkerung in<br />
Jodmangelgebieten habe die Jodierung<br />
„den Intelligenzquotienten um rund 15<br />
Punkte erhöht“, schreiben Ökonomen<br />
um James Feyrer vom renommierten<br />
Dartmouth College in einer neuen Studie.<br />
Vor allem im pazifischen Nordwesten und<br />
an den Großen Seen im Nordosten der<br />
USA, von der Natur mit wenig Jod im<br />
Grundwasser bedacht, half das Spurenelement<br />
der Geisteskraft auf die Sprünge.<br />
Im Durchschnitt, so die Autoren, sei der<br />
IQ der Amerikaner wegen des Verzehrs<br />
von Jodsalz um über drei Punkte nach<br />
oben geschnellt.<br />
Quelle: ICCIDD<br />
Eine verblüffende Studie zeigt: Dank Jodsalz stieg der<br />
Intelligenzquotient der Amerikaner.<br />
Viele Deutsche hingegen leiden unter Jodmangel.<br />
Insbesondere in der Schwangerschaft<br />
fördert Jod die geistige Entwicklung der<br />
Kinder. Der Körper benötigt das Element<br />
unter anderem zum Aufbau des Gehirns<br />
und peripherer Nerven. Die Schilddrüse<br />
benötigt Jod zur Herstellung von Hormonen,<br />
die ihrerseits viele Stoffwechselvorgänge<br />
steuern. Bekommen Schwangere zu<br />
wenig Jod, tun sich ihre Kinder oft schwerer<br />
in der Schule; im schlimmsten Fall kommen<br />
sie sogar geistig behindert zur Welt.<br />
Rund 50 Millionen Menschen leben mit<br />
Hirnschäden als Folge von Jodmangel,<br />
US-amerikanische Werbung für Jodsalz, 1967<br />
IQ-Sprung um drei Punkte<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
schätzt die Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO. Allein 240 Millionen Schulkinder<br />
gelten noch immer als unterversorgt.<br />
Speisesalz mit Jod zu versetzen empfiehlt<br />
die WHO daher als eine der wichtigsten<br />
und günstigsten Entwicklungshilfemaßnahmen.<br />
Wie stark die Jodgabe offenbar die Intelligenz<br />
fördert, hat Feyrer mit zwei Kollegen<br />
durch Auswertung von fast zwei<br />
Millionen Rekrutenakten aus dem Zweiten<br />
Weltkrieg herausgefunden. Viele US-<br />
Soldaten, die in den Schlachten in Europa<br />
und im Pazifik kämpften, kamen zwischen<br />
1920 und 1927 zur Welt.<br />
Genau in jener Zeit, ab 1924, eroberte<br />
das Jodsalz den US-Markt. Auf die dama -<br />
ligen Geburtenjahrgänge, so vermutete<br />
der Wissenschaftler, müsste die Jodkampagne<br />
einen großen Einfluss gehabt haben.<br />
1941, als die USA in den Krieg eintraten,<br />
erschienen die ersten Jodjahrgänge zur<br />
Musterung. Alle diese jungen Männer absolvierten<br />
einen Intelligenztest, der dar -<br />
über entschied, welchen Job sie in der<br />
US-Armee bekamen. Nur wer überdurchschnittlich<br />
punktete, konnte Kampfpilot<br />
werden – die Luftwaffe wollte die intelligentesten<br />
Rekruten haben.<br />
Diese Auslese machten sich die Ökonomen<br />
bei ihrer Auswertung zunutze.<br />
Und tatsächlich kamen die nach 1924<br />
geborenen Männer aus den ehemaligen<br />
Jodmangelgebieten auffallend häufiger<br />
zur Luftwaffe als die etwas älteren. „Das<br />
war der erste Karrieresprung aufgrund<br />
von Jodsalz“, sagt Feyrer.<br />
Aber es gab auch Opfer. Das Jodsalz<br />
führte zum Tod von rund 10 000 vor<br />
allem älteren Amerikanern, deren Organismus<br />
sich an den Jodmangel angepasst<br />
hatte. Bei ihnen war die Schilddrüse vergrößert,<br />
um den Jodmangel zu kompensieren.<br />
Die plötzliche Überversorgung<br />
vergiftete sie.<br />
Chinesische Forscher hatten schon vor<br />
einigen Jahren behauptet, eine IQ-Steigerung<br />
bei Kindern durch Jodsalz gefunden<br />
zu haben. „Den Chinesen hat man<br />
das nicht so richtig geglaubt“, sagt Roland<br />
Gärtner vom Klinikum der Universität<br />
München. Der Endokrinologe hofft, dass<br />
die neue US-Studie auch in <strong>Deutschland</strong><br />
zu einem Umdenken führt.<br />
Denn Jodmangel wird in vielen Indu -<br />
strieländern erneut zum Problem. „Wir<br />
gehen wieder einem Jodmangel entgegen,<br />
der nicht sein müsste“, warnt Helmut<br />
Schatz von der Deutschen Gesellschaft<br />
für Endokrinologie (DGE).<br />
Jede dritte Schwangere in <strong>Deutschland</strong><br />
habe zumindest einen leichten Jodmangel,<br />
sagt Katharina Schwarz, Schilddrüsen -<br />
expertin vom Lukaskrankenhaus in Neuss.<br />
Der Grund für die schlechter werdende<br />
Versorgung: Seit einigen Jahren liegt natur -<br />
belassenes Salz im Trend, jodärmeres<br />
Meersalz wird als natürlicher und gesünder<br />
angepriesen. Zudem verwendet auch
die Lebensmittelindustrie überwiegend<br />
nichtjodiertes Salz. Wenn es bei dieser<br />
Entwicklung bleibt, dürfte die WHO<br />
<strong>Deutschland</strong> deshalb bald wieder als Jodmangelgebiet<br />
klassifizieren, auf einer Stufe<br />
mit Burundi und Haiti – ein peinlicher<br />
Rückfall.<br />
Bis in die achtziger Jahre verwendeten<br />
gerade mal fünf Prozent der Haushalte<br />
Jodsalz. Erst 2007 bescheinigten Experten<br />
<strong>Deutschland</strong> eine ausreichende Versorgung.<br />
Grundlage war seinerzeit eine Studie,<br />
die bei Kindern und Jugendlichen einen<br />
Mittelwert von 117 Mikrogramm Jod<br />
pro Liter Urin gemessen hatte – immer<br />
noch knapp an der Grenze zum Mangel,<br />
der laut WHO unterhalb von 100 Mikrogramm<br />
beginnt.<br />
Noch unveröffentlichte Daten des Berliner<br />
Robert Koch-Instituts (RKI) deuten<br />
darauf hin, dass der Wert zumindest bei<br />
Erwachsenen mittlerweile wieder deutlich<br />
darunter liegt. „Wir haben Hinweise,<br />
dass er sich verschlechtert hat“, erklärt<br />
RKI-Experte Michael Thamm. Nach Auswertung<br />
von über 4000 Proben wäre er<br />
„überrascht, wenn am Ende noch ein<br />
anderer Befund herauskäme“.<br />
Erschwert wird die Aufklärung der<br />
Mediziner durch den wachsenden Widerstand<br />
von Jodgegnern. Als Handlanger<br />
der Salzindustrie wird Thamm in Internetforen<br />
verunglimpft. Ein Anrufer beschimpfte<br />
ihn, Jod sei ein Gift, das der<br />
Staat über das Salz loswerden wolle.<br />
„Die Gegner der Jodprophylaxe bilden<br />
zwar nur eine kleine Gruppe, aber sie sind<br />
gut vernetzt und organisiert“, klagt<br />
Thamm. „Die Jodgegner sind noch schlim -<br />
mer als die Impfgegner“, sagt auch Endokrinologe<br />
Gärtner. „Sie stellen ihre Inter -<br />
essen über das Wohl der Allgemeinheit.“<br />
Die Sektierer kritisieren die Jodierung<br />
von Speisesalz als „Zwangsmedikation“<br />
der Bevölkerung, für die es keine medizinische<br />
und rechtliche Grundlage gebe.<br />
Alzheimer, Diabetes, Depression, Impotenz,<br />
Krebs, Tuberkulose – für rund 90<br />
Krankheitsbilder und Wehwehchen macht<br />
etwa die Autorin Dagmar Braunschweig-<br />
Pauli das Jodsalz verantwortlich. Sie<br />
spricht von rund 40 Millionen Jodgeschädigten<br />
in <strong>Deutschland</strong>, was Kosten von<br />
197 Milliarden Euro im Gesundheitssystem<br />
verursache.<br />
Die Jodkritik sei „in keiner Weise begründet“<br />
und „nur emotional nachvollziehbar“,<br />
ärgert sich Gärtner. Mediziner<br />
gehen zwar davon aus, dass eine Überdosis<br />
Jod, etwa durch zu viel Seefisch, den<br />
Stoffwechsel entgleisen lassen kann. „Im<br />
Einzelfall kann zu viel Jod negative Folgen<br />
haben“, sagt Markus Luster, Direktor<br />
der Marburger Universitätsklinik für Nuklearmedizin.<br />
Die positiven Effekte würden<br />
aber eindeutig überwiegen, betont<br />
Luster: „Millionen Menschen, Schwangere,<br />
Kinder, Erwachsene profitieren von<br />
der Jodierung.“ CHRISTOPH BEHRENS<br />
DER SPIEGEL 50/2013 147
JULIAN BAUMANN / DER SPIEGEL<br />
Künstliche Befruchtung einer Eizelle<br />
Wissenschaft<br />
MEDIZIN<br />
Die Fruchtbarkeitsreserve<br />
Frauen lassen ihre Eizellen einfrieren, um noch in späteren<br />
Jahren Kinder auf die Welt bringen zu können.<br />
Ist es tatsächlich möglich, die biologische Uhr zurückzudrehen?<br />
Die Frau wünscht sich ein Kind. Sie<br />
sagt, das sei ein Wunsch, um den<br />
sie sich nicht herumdrücken könne.<br />
Die Marketingleiterin aus München<br />
ist bereits 38 und will nicht den Nächstbesten<br />
nehmen. Deshalb hat sie einen<br />
Weg gesucht, sich um den Nächstbesten<br />
herumzudrücken.<br />
Vor einem Jahr ließ Sarah Voß* einige<br />
ihrer Eizellen einfrieren. Elf Stück lagern<br />
seither tiefgefroren im Flüssiggastank einer<br />
Kinderwunschpraxis, konstant gekühlt<br />
bei minus 196 Grad. Von diesen elf<br />
Eizellen könnten vielleicht drei bis vier<br />
befruchtet werden, woraus ein oder zwei<br />
Kinder heranwachsen könnten. Das ist<br />
die Hoffnung. Die statistische Chance,<br />
dass es so kommt, liegt bei etwa 25 Prozent.<br />
Das ist nicht viel.<br />
Die Statistik, sagt Voß, habe sie bei<br />
ihrer Entscheidung aber nicht wirklich<br />
interessiert. Sie habe ihre Entscheidung<br />
vor allem aus Wut getroffen. Aus Wut<br />
dar über, hilflos zusehen zu müssen, wie<br />
ihre biologische Uhr abläuft. Sie hätte<br />
noch mehr Eizellen einfrieren lassen können,<br />
die Statistik weiter verbessern.<br />
Doch bei 7000 Euro war Schluss. Sie ist<br />
gesund, beruflich erfolgreich, sie sieht<br />
gut aus. Wenig spricht dagegen, dass sie<br />
demnächst auf natürlichem Weg ein Kind<br />
bekommt.<br />
Hat die Medizin nun eine Methode gefunden,<br />
die Wut von Frauen wie Sarah<br />
Voß zu besänftigen? Oder nimmt sie ihnen<br />
auf dem Weg, ein Kind zu bekommen,<br />
nur eine Stange Geld ab? Lässt sich<br />
die Fruchtbarkeit durch das „Social Freezing“<br />
wirklich verlängern?<br />
Entwickelt wurde das Verfahren ursprünglich,<br />
um krebskranken Frauen, die<br />
vor einer Chemotherapie stehen, zu ermöglichen,<br />
anschließend noch Kinder zu<br />
bekommen. Die Eizellen könnten durch<br />
die Krebstherapie geschädigt werden.<br />
Eizellen, die man einer Frau in einer<br />
kleinen Operation entnimmt, werden dabei<br />
durch schnelle Kühlung konserviert.<br />
Dadurch können sie auch nach Jahren<br />
aufgetaut, befruchtet und der Frau in die<br />
Gebärmutter eingesetzt werden.<br />
Der Kreis der Experten ist klein. Die<br />
Mediziner streiten darüber, wie sie mit<br />
dem Social Freezing umgehen sollen.<br />
Jörg Puchta, 53, ist der Arzt, der Sarah<br />
Voß’ Eizellen konserviert hat. Zusammen<br />
mit Kollegen betreibt er das Kinderwunsch<br />
Zentrum an der Oper in München.<br />
Puchta sagt: „Mit Hilfe des Social<br />
Freezing sind Frauen in der Lage, ihre<br />
Fruchtbarkeit zu bewahren. Es wird ihnen<br />
der Druck genommen, den die biolo -<br />
gische Uhr auf sie ausübt.“ Seinen Pa -<br />
tientinnen rät er, bis zum 40. Geburtstag<br />
Eizellen eingefroren zu haben.<br />
Michael von Wolff, 47, ist Reproduk -<br />
tionsmediziner an der Uni-Klinik in Bern.<br />
* Name von der Redaktion geändert.<br />
148<br />
DER SPIEGEL 50/2013
Er hat vor sieben Jahren<br />
das Netzwerk „FertiProtekt“<br />
gegründet, dessen<br />
Mitglieder daran arbeiten,<br />
Frauen vor einer Chemotherapie<br />
zu helfen. Wolff<br />
sagt: „Social Freezing<br />
ist Lifestyle-Medizin. Für<br />
Frauen, die älter sind als<br />
35, ist das Einfrieren von Eizellen<br />
wenig sinnvoll.“<br />
Aber das Social Freezing wirft<br />
nicht nur medizinische Fragen auf.<br />
Es wird damit möglich, eine Frau<br />
weit jenseits der Wechseljahre zur<br />
Mutter zu machen. Mit Hormonen<br />
unterstützt, kann damit eine 50-<br />
oder 60-Jährige Kinder bekommen.<br />
In Italien, Spanien, Rumänien gibt<br />
es Mütter, die bei der Geburt ihres<br />
ersten Kindes auf die 70 zugingen.<br />
Rechtlich zulässig wäre dies auch<br />
hier. Fremde Eizellenspenden sind<br />
in <strong>Deutschland</strong> verboten, aber die<br />
eigenen Eizellen darf eine Frau verwenden.<br />
Wäre es der nächste Schritt auf<br />
dem Weg zur Gleichstellung der<br />
Frau? Nicht mehr an das biologische<br />
Alter gebunden zu sein?<br />
Schließlich können auch Männer<br />
noch in späten Jahren Vater werden.<br />
Oder hilft das Social Freezing<br />
zu weit über die natürlichen Grenzen<br />
hinweg?<br />
Auf dem Schreibtisch von Jörg<br />
Puchta in München stehen zwei<br />
Champagner flaschen. Daraufgeklebt<br />
sind Fotos von Zwillingen.<br />
„Zum Spaß vereinbare ich mit<br />
meinen Patienten: Für jedes<br />
Kind, das mit meiner Hilfe auf<br />
die Welt kommt, kriege ich eine<br />
Flasche“, sagt Puchta. Der Mediziner<br />
ist groß, gut gebräunt,<br />
trägt Weiß. Er sagt: „Mit Champagner<br />
kenne ich mich mittlerweile<br />
gut aus.“<br />
Jörg Puchta ist wahrscheinlich<br />
derjenige Arzt in <strong>Deutschland</strong>,<br />
der am offensivsten für<br />
das Einfrieren von Eizellen<br />
Baby<br />
rund<br />
500 000<br />
Eizellen<br />
wirbt. In einem Radiowerbespot, den seine<br />
Praxis geschaltet hat, sagt eine Frau:<br />
„Karriere oder Kinder – beides geht bei<br />
meinem Job nicht!“ Darauf antwortet ein<br />
Mann: „Du, ich hab da was gelesen von<br />
Social Freezing. Da friert man sozusagen<br />
deine Fruchtbarkeit ein. So dass du später<br />
noch unseren Sohn auf die Welt bringen<br />
kannst.“<br />
In einer Broschüre, die das Zentrum<br />
herausgibt, steht: „Legen Sie Ihre Familienplanung<br />
auf Eis: Sie erobern sich Zeit<br />
und Leichtigkeit zurück.“ Es klingt, als<br />
würde man sich bei einem Yogastudio anmelden.<br />
Anders als bei einer künstlichen Befruchtung<br />
(IVF) gibt es für das Social Freezing<br />
keinen medizinischen Grund. Zur<br />
IVF entschließen sich Frauen, die erfolglos<br />
versucht haben, schwanger zu werden.<br />
Ihre Kinderlosigkeit ist als Krankheit anerkannt,<br />
teilweise erstatten die Kranken -<br />
kassen die Behandlung. Zum Eizell-Einfrieren<br />
hingegen entschließen sich Frauen,<br />
die noch gar nicht versucht haben, auf<br />
natürliche Weise schwanger zu werden.<br />
Die Behandlung müssen sie selbst zahlen.<br />
Das Münchner Kinderwunschzentrum<br />
beziffert die Kosten auf 2000 Euro pro Zyklus,<br />
dazu kommen noch Medikamente<br />
von 500 bis 1000 Euro. Die Lagerung der<br />
Eizellen kostet 240 Euro pro Jahr. Später<br />
kommen dann die Kosten für eine IVF-<br />
Behandlung von mindestens 2000 Euro<br />
hinzu. Es wird teurer, je mehr Zyklen man<br />
braucht, um ausreichend Eizellen zu gewinnen.<br />
Puchta rät seinen Patientinnen,<br />
mindestens 20 Eizellen einzufrieren.<br />
Machen Sie Geld mit der Angst der<br />
Frauen, Herr Puchta?<br />
Der Arzt lehnt sich in seinem Sessel<br />
zurück. Er sagt, der Reproduktionsmedizin<br />
werfe man zu reflexhaft Geschäftemacherei<br />
vor. „Ich sehe hier viele Schicksale.<br />
Und wir können helfen.“ Als Frau<br />
könne man heute eine Versicherung gegen<br />
Kinderlosigkeit abschließen – eine<br />
Art Fruchtbarkeitsversicherung.<br />
Seit 2008 hat Puchta Eizellen von fast<br />
250 Patientinnen eingefroren. Zwölf von<br />
ihnen haben mittlerweile einen Teil davon<br />
befruchten lassen. Sieben sind gerade<br />
schwanger. Puchta geht davon aus, dass<br />
etwa 10 bis 15 Prozent seiner Patientinnen<br />
auf diese Fruchtbarkeitsreserve zurückgreifen<br />
müssten. Alle anderen bekämen<br />
höchstwahrscheinlich auf natürlichem<br />
Weg ein Kind.<br />
Statt von Angst spricht der Gynäkologe<br />
lieber von Sicherheit. Er wisse, was es<br />
für eine Frau bedeute, wenn sie erst mit<br />
42 Jahren den Mann zum Kinderkriegen<br />
finde und es dann auf natürliche Weise<br />
nicht mehr klappe. „Vermutlich würde sie<br />
über kurz oder lang eine IVF-Behandlung<br />
in Erwägung ziehen“, sagt Puchta.<br />
Doch unterlägen ihre – 42 Jahre alten –<br />
Eizellen dann den Hemmnissen dieses Alters:<br />
einem höheren Fehlbildungsrisiko,<br />
häufigeren Fehlgeburten. Bei einer Eizelle,<br />
die im Alter von 30 Jahren eingefroren<br />
wurde, sei diese Gefahr entsprechend geringer.<br />
Puchta sagt: „Das ist doch eine<br />
pragmatische, eine kluge Kalkulation.“<br />
Ob die Erfolgsraten einer künstlichen<br />
Befruchtung durch das Eizell-Einfrieren<br />
wirklich steigen, kann derzeit niemand<br />
wissen. Langzeitstudien fehlen, die Methode<br />
ist noch zu neu. Die wenigsten Ärzte<br />
haben Erfahrung mit dem langen Lagern<br />
von Eizellen.<br />
Doch das Einfrieren von Eizellen<br />
macht Schwangerschaften in einem Alter<br />
weit jenseits der natürlichen Fruchtbarkeitsgrenze<br />
möglich. Selbst nach ihren<br />
Wechseljahren kann eine Frau hormonell<br />
noch so stimuliert werden, dass sie befruchtete<br />
Eizellen austragen kann.<br />
Jörg Puchta würde diese Eizellen einer<br />
Frau auch noch spät einsetzen. Wie spät?<br />
Bis zum Alter von 55? 60? Er sagt: „So<br />
lange die Frau möchte. Und solange es<br />
medizinisch vertretbar ist. Ich richte nicht<br />
darüber, wie alt eine Mutter sein darf.“<br />
Im Inselspital in Bern in der Schweiz<br />
nimmt Michael von Wolff in seinem<br />
Sprechzimmer Platz. An der Wand hängt<br />
beruhigende Kunst, an einer Stehlampe<br />
baumelt ein Storch aus Holz. Wolff leitet<br />
die Abteilung für Reproduktionsmedizin.<br />
Ihn ärgert es, wenn Kollegen wie Puchta<br />
mit der Angst der Frauen Geschäfte<br />
machen. „Vielleicht klingt das jetzt unmodern“,<br />
sagt Wolff, „aber mir ist nicht<br />
Countdown für den Nachwuchs<br />
Schon bei der Geburt tragen Mädchen den gesamten Vorrat an<br />
Eizellen in sich. Im Laufe des Lebens verkümmert dieser allmählich.<br />
Von der Pubertät bis zur Menopause gelangen<br />
maximal 500 Zellen zum Eisprung.<br />
Eintritt in<br />
die Pubertät<br />
rund<br />
20 000 Eizellen<br />
ab 35 Jahren:<br />
signifikant erhöhtes<br />
Risiko von Fehlgeburten<br />
Geburt 10 Jahre 20 30 40 50<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Menopause<br />
rund<br />
1000<br />
Eizellen<br />
Gynäkologe Puchta<br />
„Mit Champagner kenne ich mich aus“<br />
149<br />
JULIAN BAUMANN / DER SPIEGEL
Wissenschaft<br />
Reproduktionsmediziner Wolff<br />
Einfrieren nur bedingt sinnvoll<br />
wohl dabei, wenn auf diese Art für<br />
eine medizinische Leistung geworben<br />
wird.“<br />
Aus seiner Zeit in <strong>Deutschland</strong><br />
kennt Wolff die Sätze, die Kinderwunsch-Ärzte<br />
sagen, um Patienten<br />
zu überzeugen. Einer lautet: „Ich<br />
kann Ihnen nicht garantieren, dass<br />
es funktioniert, aber Sie haben alles<br />
dafür getan. Dann müssen Sie sich<br />
hinterher keine Vorwürfe mehr machen.“<br />
Keine Vorwürfe.<br />
Friert Wolff die Zellen einer Frau<br />
ein, die Krebs hat, dann sei das ein<br />
Notfall. Auch für das Social Freezing<br />
habe er Verständnis, aber die meisten<br />
Frauen, die sich dafür interessierten<br />
und das nötige Geld hätten, seien<br />
schon weit über 35 Jahre alt – aus<br />
seiner Sicht zu alt für das Einfrieren<br />
von Eizellen. Er befürchtet, dass viele<br />
der Frauen, die sich mit dem Social<br />
Freezing absichern möchten, das<br />
zu sehr ungünstigen Konditionen<br />
tun.<br />
Seine Begründung: Vor allem von der<br />
Zahl der zur Verfügung stehenden Eizellen<br />
hängt es ab, ob später eine künstliche<br />
Befruchtung gelingt. Doch die Chance,<br />
genügend Eizellen zu gewinnen, nehme<br />
nach dem 35. Lebensjahr stark ab.<br />
Wolff rechnet vor: „Man geht davon<br />
aus, dass ein Hormonzyklus 10 bis 15 Eizellen<br />
ergibt. Doch je älter eine Frau<br />
ist, desto weniger sind es pro Behandlungszyklus.“<br />
Wolle man eine sinnvolle<br />
Anzahl an Eizellen gewinnen, dauere<br />
das wahrscheinlich ein halbes Jahr und<br />
koste mindestens 10 000 Euro. „Solche<br />
Details werden in einem Radiospot verschwiegen.“<br />
Ohnehin funktioniere die Natur stets<br />
besser als das Labor, sagt Wolff. Eine aus<br />
dem Eierstock entnommene, im Reagenzglas<br />
befruchtete Eizelle werde nie das gleiche<br />
Potential besitzen wie eine, die sich<br />
natürlich entwickelt hat.<br />
Wer unbedingt eine Fruchtbarkeitsversicherung<br />
abschließen wolle, der müsse<br />
das als junge Frau tun, am besten zwischen<br />
Mitte zwanzig und Anfang dreißig.<br />
Doch gerade bei Frauen, die sich so früh<br />
mit dem Thema auseinandersetzten, vermutet<br />
der Reproduktionsmediziner, werde<br />
ein Kinderwunsch nicht lange aufgeschoben.<br />
Folglich geht Wolff davon aus, dass die<br />
meisten der Frauen gar nicht auf ihre Eizell-Reserve<br />
zurückgreifen müssen. „Und<br />
um was“, fragt er, „wenn nicht vor allem<br />
ums Geldverdienen, geht es dann?“<br />
Der Mediziner ist auch dagegen, Frauen<br />
jenseits der Wechseljahre oder gar<br />
über 50 ihre konservierten Eizellen einzusetzen.<br />
Nicht, weil er einer älteren Frau<br />
HELMUT WACHTER / 13PHOTO / DER SPIEGEL<br />
keine Mutterschaft zutraue, „sondern<br />
weil ich befürchte, dass die Komplika -<br />
tionen bei einer späten Schwangerschaft<br />
zunehmen“.<br />
Die Medizin hat wenig Erfahrungen<br />
mit Schwangerschaften über fünfzig. Dafür<br />
treten sie viel zu selten auf. Vor einigen<br />
Jahren brachte die italienische Sängerin<br />
Gianna Nannini, damals 54, ihr erstes<br />
Kind auf die Welt. Sie verschwieg, wie<br />
genau es dazu kam.<br />
Claudia Wiesemann glaubt nicht daran,<br />
dass Social Freezing sich massenhaft<br />
durchsetzen wird, dazu sei die Methode<br />
zu teuer und zu aufwendig. Dennoch ist<br />
die Professorin für Medizinethik in Göttingen,<br />
Mitglied im Deutschen Ethikrat,<br />
dagegen, späte Mütter zu verdammen.<br />
Der Trend, dass Frauen erst in fortgeschritteneren<br />
Jahren ihre Kinder bekommen,<br />
sei nicht mehr umkehrbar.<br />
„Das zu dramatisieren, halte ich für<br />
falsch“, sagt Wiesemann. Eine späte<br />
Mutterschaft habe sogar Vorteile für das<br />
Kind.<br />
„Unser soziales Leben ist von großer<br />
Bedeutung für unsere Gesundheit. Wir<br />
wissen sehr gut: Armut und Stress machen<br />
krank“, sagt Wiesemann. Frauen,<br />
die eine gesicherte Lebenssituation haben,<br />
bevor sie ihre Kinder bekommen,<br />
sollten daher gefördert und nicht kritisiert<br />
werden. „Es ist eine altmodische Vorstellung,<br />
dass sich nur eine junge Frau gut<br />
um ein Kind kümmern kann.“<br />
Die Münchnerin Sarah Voß macht sich<br />
gleichwohl Gedanken darüber, wann sie<br />
selbst sich zu alt fühlen würde, auf ihren<br />
Vorrat an Eizellen zurückzugreifen. „Für<br />
mich persönlich liegt die Grenze dort“,<br />
sagt sie, „wo auch die Natur einen Schnitt<br />
macht.“ Mit den Wechseljahren wäre<br />
Schluss. „Schließlich“, sagt Voß, „will ich<br />
keine alte Mutter werden.“<br />
KERSTIN KULLMANN
BESTATTUNGSTECHNIK<br />
Finsteres<br />
Gewerbe<br />
Schon mehr als jeder zweite<br />
Verstorbene wird verbrannt. Der<br />
Trend zur Einäscherung<br />
führt zu einem Konkurrenzkampf<br />
der Krematorien.<br />
Einst war Frankfurt am Main Zentrum<br />
einer sonderbaren Bewegung.<br />
Im 19. Jahrhundert stritten Bürger<br />
der Stadt für das Recht, ihre Toten verbrennen<br />
zu dürfen. Erst nach jahrzehntelangem<br />
Kampf trotzte der Verein für<br />
Feuerbestattung dem Königreich Preußen<br />
die Genehmigung dazu ab: 1912 wurde<br />
das Krematorium Frankfurt eröffnet.<br />
Vor wenigen Wochen entschied sich<br />
der Frankfurter Magistrat zu einem recht<br />
unsentimentalen Umgang mit dem historischen<br />
Erbe. Aufgrund vermehrter technischer<br />
Probleme, teilte die zuständige<br />
Verwaltung den Bestattern der Stadt mit,<br />
werde der Betrieb des städtischen Krematoriums<br />
zum Jahresende eingestellt.<br />
Frankfurter müssen den Leichnam ihrer<br />
verstorbenen Angehörigen deshalb<br />
künftig zur Kremation in benachbarte<br />
Städte schaffen lassen. Die fünftgrößte<br />
Stadt <strong>Deutschland</strong>s steht somit ohne kommunale<br />
Einrichtung zur Einäscherung<br />
von Toten da.<br />
Dabei wünscht inzwischen die Mehrheit<br />
der Deutschen, nach dem Ableben<br />
verbrannt zu werden. Von etwa 860000<br />
Verstorbenen pro Jahr werden bereits<br />
mehr als die Hälfte der Leichname einer<br />
Feuerbestattung zugeführt.<br />
In der DDR war diese Form der Beisetzung<br />
immer schon beliebt. Im Westen<br />
dagegen verweigerte die katholische Kirche<br />
der Feuerbestattung lange Zeit ihren<br />
Segen. Erst 1996 gestattete der Bayerische<br />
Verfassungsgerichtshof den privaten Betrieb<br />
von Krematorien – ein wegweisender<br />
Beschluss, der die Branche tiefgreifend<br />
verändern sollte.<br />
Die Feuerbestattung sei „ein Markt der<br />
besonderen Gesetzmäßigkeiten“, sagt Oliver<br />
Wirthmann, Geschäftsführer des Kuratoriums<br />
Deutsche Bestattungskultur.<br />
Das Geschäft mit der Einäscherung gilt<br />
als einträglich; den Nachteil dieses Geschäftszweigs<br />
umreißt Wirthmann so:<br />
„Bedarf kann nicht geweckt werden.“<br />
Die Abwicklung des Frankfurter Krematoriums<br />
wirft ein Schlaglicht auf ein<br />
Metier, dessen Akteure wie andere Unternehmer<br />
auch Geld verdienen wollen,<br />
darüber aus Pietätsgründen aber zumeist<br />
lieber schweigen. Rund 160 Krematorien<br />
STEPHAN ELLERINGMANN / LAIF<br />
Feuerbestattung im Krematorium<br />
gibt es derzeit in <strong>Deutschland</strong>. Jede dritte<br />
Einäscherungshalle befindet sich bereits<br />
in Privatbesitz – und die kommerziell geführten<br />
Häuser treiben die kommunalen<br />
Einrichtungen vor sich her.<br />
Wiederholt schimpfen Bestatter über<br />
den mangelnden Willen zur modernen<br />
Dienstleistung. Etliche Häuser agierten<br />
noch immer im Geist einer wilhelmi -<br />
nischen Behörde, lautet eine häufige<br />
Kritik.<br />
Auch vergehen zwischen der Einlie -<br />
ferung des Sargs ins Krematorium und<br />
dem Erhalt der Urne samt der Asche<br />
des Verstorbenen mitunter mehrere<br />
Wochen. Angehörige beklagen, dass sie<br />
nicht ausreichend Ge legenheit erhielten,<br />
sich von den Heimgegangenen zu ver -<br />
abschieden.<br />
Vom finsteren Gewerbe der Einäscherung<br />
will sich die private Konkurrenz<br />
durch konsequente Kundenorientierung<br />
abheben. Wenn öffentliche Feuerbestatter<br />
mithalten wollen, müssen sie massiv<br />
in ihre teils bröselnden Gewölbe investieren<br />
– wie die Hamburger Krematorium<br />
GmbH, die im Stadtteil Ohlsdorf ein Bestattungsforum<br />
mit „Feierhallen und Gastronomie“<br />
geschaffen hat. Laut Eigenwerbung<br />
stellen die Hamburger Einäscherer<br />
„behaglich eingerichtete kleine Familienräume“<br />
bereit, „in die sich der engste Familienkreis<br />
zurückziehen kann“.<br />
Doch selbst wenn der Wille und das<br />
nötige Geld zur Veränderung vorhanden<br />
wären: Mitunter scheitert die bauliche<br />
Modernisierung an den örtlichen Beschränkungen.<br />
In einige der alten Steinkästen<br />
passen die modernen und wegen<br />
ihrer Effizienz geschätzten Etagenöfen<br />
gar nicht hinein. Gleichwohl sind die öffentlichen<br />
Häuser mancherorts vertrauenswürdiger<br />
als die private Konkurrenz.<br />
Silke Brodbeck, die als Amtsärztin Leichenschauen<br />
im Krematorium Frankfurt<br />
vornahm, beklagt ein unappetitliches<br />
„Geschäft mit dem Tod“.<br />
Ihre Kritik zielt auf eine halbseidene<br />
Praxis, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt<br />
ist: Betreiber privater Krematorien<br />
stehen im Verdacht, Bestatter durch die<br />
Zahlung einer Provision in ihre Anlagen<br />
zu locken.<br />
Diese bei Insidern als „Leichengeld“<br />
bekannte Vergütung beträgt nach Einschätzung<br />
von Alexander Helbach, Sprecher<br />
der Verbraucherinitiative Bestattungskultur<br />
„Aeternitas“, bis zu 80 Euro<br />
pro Leichnam. Bezahlen müssen diesen<br />
geheimen Zuschlag am Ende die Angehörigen<br />
– ohne davon je zu erfahren.<br />
Dem Bundesverband Deutscher Bestatter<br />
gilt dieses Handgeld als zumindest unmoralisch,<br />
wenn nicht gar als widerrechtlich.<br />
„So etwas darf nicht sein, wenn keine<br />
echte Vermittlungsleistung erfolgt“,<br />
kritisiert Wirthmann.<br />
Derweil tragen die Leichengelder weiter<br />
dazu bei, dass die privaten Einäscherer<br />
öffentlichen Häusern wie in Frankfurt<br />
das Wasser abgraben.<br />
In der Mainmetropole dümpelt der Betrieb<br />
in einem betagten Gebäude seinem<br />
Ende entgegen. Zuletzt funktionierte nur<br />
noch einer von ehemals vier Kremationsöfen.<br />
FRANK THADEUSZ<br />
DER SPIEGEL 50/2013 151
Trends<br />
Medien<br />
PRESSEFREIHEIT<br />
China straft<br />
US-Medien ab<br />
Trotz der prominenten Fürsprache ihres<br />
Vizepräsidenten Joe Biden droht 23<br />
amerikanischen Journalisten in China<br />
die Ausweisung. Keinem seiner Kollegen,<br />
so ein Korrespondent der „New<br />
York Times“, sei es bis Freitag voriger<br />
Woche gelungen, die Verlängerung seines<br />
Visums zu beantragen. Dasselbe<br />
gelte für die China-Büros des Wirtschaftsdiensts<br />
Bloomberg, das Außenministerium<br />
habe angeordnet, keine<br />
Anträge mehr anzunehmen. Die meisten<br />
anderen Korrespondenten, auch die<br />
des SPIEGEL, konnten dagegen ihre<br />
Pässe einreichen. Da ausländische Journalisten<br />
in China jedes Jahr eine neue<br />
Aufenthaltsbewilligung beantragen<br />
müssen, die Bearbeitung drei Wochen<br />
dauert und die aktuellen Visa in den<br />
kommenden Tagen enden, könnte es<br />
darauf hinauslaufen, dass „Times“ und<br />
Bloomberg ihre Büros zum Jahresende<br />
schließen müssen. Die Maßnahme steht<br />
Bloomberg-Reporter Rishaad Salamat<br />
offenbar in Zusammenhang mit der kritischen,<br />
preisgekrönten Berichterstattung<br />
der beiden US-Medien über Korruption<br />
in den Familien chinesischer<br />
Politiker, darunter die des ehemaligen<br />
Premierministers Wen Jiabao und die<br />
des im März angetretenen Staatspräsidenten<br />
Xi Jinping. Als US-Vizepräsident<br />
Biden während seines Peking-Besuchs<br />
vorige Woche Xi auf die Behandlung<br />
der Korrespondenten ansprach und mit<br />
Konsequenzen drohte, reagierte dieser<br />
Teilnehmern zufolge „ungerührt“. Die<br />
Websites der „New York Times“ und<br />
Bloombergs sind in China bereits seit<br />
über einem Jahr gesperrt. Sollte die Regierung<br />
ihre Haltung nicht ändern,<br />
könnte das diplomatische Folgen haben:<br />
Chinas Medien sind mit Hunderten<br />
von Korrespondenten in den USA<br />
vertreten; der Staatssender CCTV betreibt<br />
sogar ein eigenes Studio in Washington.<br />
Kritiker fordern bereits, im<br />
Gegenzug die Visa der chinesischen<br />
Korrespondenten auslaufen zu lassen.<br />
XINHUA / IMAGO<br />
BEITRAGSDEBATTE<br />
Mehreinnahmen<br />
ins Programm<br />
Der Miteigner des Nachrichtenkanals<br />
N24, Berater der Wochen -<br />
zeitung „Die Zeit“ und ehemalige<br />
Chefredakteur des SPIEGEL, Stefan<br />
Aust, 67, wird Herausgeber der<br />
„Welt“. Die Personalie soll Anfang<br />
dieser Woche verkündet werden.<br />
Springer und Aust wollten den Vor -<br />
gang aber weder bestätigen noch<br />
dementieren. Seit 2010 ist der Journalist<br />
Thomas Schmid, 68, Her -<br />
ausgeber der „Welt“-Gruppe, deren<br />
Chefredakteur er zuvor war.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Szene aus ZDF-Film „Unsere Mütter, unsere Väter“<br />
KARRIEREN<br />
Aust wird Herausgeber<br />
Aust<br />
Die prognostizierten Mehreinnahmen<br />
der öffentlichen-rechtlichen Sender<br />
durch den neuen Rundfunkbeitrag<br />
(SPIEGEL 46/2013) sorgen für erste Verteilungskämpfe.<br />
Die Ministerpräsidenten<br />
Stanislaw Tillich (CDU) und Malu<br />
Dreyer (SPD) haben eine Senkung des<br />
Beitrags von 50 Cent bis einem Euro<br />
pro Monat vorgeschlagen. Dagegen verlangten<br />
nun die Vertreter der selbständigen<br />
TV-Produzenten, das Geld lieber<br />
„in das Programm zu investieren“. So<br />
könne die „konkret drohende Verarmung<br />
des audiovisuellen Schaffens in<br />
<strong>Deutschland</strong>“ verhindert werden, heißt<br />
es in einer Erklärung der Produzentenallianz,<br />
des Lobbyverbands der Branche.<br />
„In der Konkurrenz um die Aufmerksamkeit<br />
und die Begeisterung des<br />
Publikums“ könnten deutsche Produzenten<br />
„gegen die in den letzten Jahren<br />
hochgelobten amerikanischen, englischen<br />
oder auch dänischen Serien<br />
kaum noch bestehen.“ Während diese<br />
Produktionen „mit realistischen Budgets“<br />
ausgestattet seien, würden in<br />
<strong>Deutschland</strong> selbst beim „Tatort“ die<br />
Preise fallen. „Schauspieler, Kreative<br />
und andere Filmschaffende“ lebten am<br />
Rand prekärer finanzieller Verhältnisse.<br />
Man solle die Mehreinnahmen als<br />
Chance verstehen, die Qualität des Programms<br />
bei ARD und ZDF zu steigern<br />
und „an frühere Qualitätsstandards der<br />
Produktionen anzuknüpfen“.<br />
153<br />
DAVID SLAMA / ZDF<br />
ARANKA SZABO / PICTURE ALLIANCE / DPA
Medien<br />
SPIEGEL-GESPRÄCH<br />
„Tragöde aus Versehen“<br />
Matthias Brandt ist auch deshalb ein so großer Schauspieler, weil er einen Blick für<br />
Skurriles hat. Er ist verliebt ins Scheitern, sein größter Held aber ist Günter Netzer.<br />
Brandt, Jahrgang 1961, ist der jüngste<br />
Sohn von Willy Brandt. Bekannt ist er<br />
als Kommissar Hanns von Meuffels in der<br />
Reihe „Polizeiruf 110“. 2003 spielte er in<br />
„Schatten der Macht“ den DDR-Spion<br />
Günter Guillaume.<br />
SPIEGEL: Sie sind ein merkwürdiger Star,<br />
Herr Brandt. Als Kommissar im „Polizeiruf<br />
110“ locken Sie acht Millionen Menschen<br />
vor den Bildschirm, vom Grimme-<br />
Preis bis zum Bambi haben Sie alle großen<br />
Auszeichnungen erhalten. Trotzdem<br />
werden Sie auf der Straße manchmal<br />
nicht erkannt.<br />
Brandt: Lange Zeit wussten die Leute nur,<br />
sie kennen mich irgendwoher. Aber sie<br />
waren sich nicht sicher, ob sie mich schon<br />
mal im Fernsehen gesehen haben oder<br />
ob ich letzten Monat ihre Geschirrspülmaschine<br />
repariert habe. Durch den „Polizeiruf“<br />
hat sich das ein wenig geändert.<br />
SPIEGEL: Werden Sie direkt nach einer<br />
Ausstrahlung öfter angesprochen?<br />
Brandt: Nach dem Sonntagskrimi hält die<br />
Aufmerksamkeit bis ungefähr mittwochs<br />
an. Am Donnerstag lässt sie wieder nach,<br />
und am Sonntag sind schon die nächsten<br />
dran. Im Übrigen mache ich nicht so ein<br />
Bohei um mich und meine Arbeit.<br />
Manchmal werde ich gefragt, warum man<br />
privat so wenig von mir wisse. Das kann<br />
ich nicht nachvollziehen. Ich veröffent -<br />
liche zwar nicht, wo ich mit dem Hund<br />
spazieren gehe, aber natürlich erzähle ich<br />
bei allem, was ich in meinen Filmen mache,<br />
wahnsinnig viel von mir selbst.<br />
SPIEGEL: Über den Kommissar Hanns von<br />
Meuffels, den Sie im Münchner „Polizeiruf“<br />
spielen, weiß man aber auch nicht<br />
gerade viel.<br />
Brandt: Sie schauen ihm doch zu und sehen,<br />
was er erlebt. In der Realität lernen<br />
Sie einen Menschen ja auch nicht dadurch<br />
kennen, dass er Ihnen als Erstes seinen<br />
Lebenslauf aufsagt. Ich habe gerade meinen<br />
siebten Meuffels abgedreht, und ich<br />
mag die Folgen alle. Aber ich weiß, dass<br />
es Leute gibt, denen das, was wir da am<br />
Sonntagabend veranstalten, zu viel ist.<br />
SPIEGEL: Wem denn?<br />
Das Gespräch führten die Redakteure Markus Brauck<br />
und Alexander Kühn.<br />
154<br />
Brandt: Meinem Nachbarn zum Beispiel.<br />
Der hat sehr klare Vorstellungen davon,<br />
was am heiligen Sonntagabend sein darf<br />
und was nicht. Sein wesentlicher Beschwerdepunkt<br />
ist, dass ihm meine „Polizeirufe“<br />
zu unruhig sind. Er meint, das sei<br />
alles zu verwirrend. Es soll schon gruselig<br />
zugehen, aber in erster Linie ruhig. Ruhe<br />
ist den Leuten wichtig, das höre ich öfters.<br />
SPIEGEL: Bei einem Krimi?<br />
Brandt: Ja, beim Sonntagskrimi wollen sie<br />
entspannen, bevor die Woche anfängt.<br />
Bekannte und Bekanntes treffen. Und<br />
dann so was! Die schnellen Schnitte und<br />
die Handkamera, er nennt das Wackelei,<br />
werden oft kritisiert: ob die nicht gelernt<br />
hätten, eine Kamera zu bedienen und so.<br />
Es gibt ein starkes Bedürfnis danach, dass<br />
die Dinge immer gleich sind. Und, ganz<br />
wichtig: so wie früher.<br />
SPIEGEL: Was entgegnen Sie Ihrem Nachbarn<br />
auf seine Kritik?<br />
Brandt: Ich unterhalte mich freundlich mit<br />
ihm, er ist ja sehr nett. Letztlich erkläre<br />
ich ihm aber, dass ich kein Wunschkonzert<br />
veranstalte, wo man sich die Musik<br />
bestellt, die man hören möchte. Ich bin<br />
ja keine Jukebox. Ich mache das so, wie<br />
ich es gut finde, akzeptiere aber auch,<br />
wenn jemand das nicht mag. So verstehe<br />
ich die Verabredung, und mein Nachbar<br />
und ich leben gut damit.<br />
SPIEGEL: Verfolgen Sie auch, wie in Internetforen<br />
über Ihre Arbeit diskutiert wird?<br />
Brandt: Nein, da bin ich altmodisch. Ich<br />
kann mich doch nicht ernsthaft mit jemandem<br />
auseinandersetzen, der sich<br />
Pupsi2000 nennt. Wenngleich es auch in<br />
der echten Welt zu denkwürdigen Begegnungen<br />
kommt. So wie mit dem Herrn,<br />
der im Restaurant ein Autogramm von<br />
mir wollte. Ich sagte: Entschuldigung,<br />
jetzt esse ich gerade, vielleicht später?<br />
Da wurde er böse, ging weg und sagte:<br />
Und für so was zahle ich Gebühren!<br />
SPIEGEL: Sie stechen hervor durch Ihre<br />
minimalistische Spielweise. Haben Sie<br />
Angst vor Übertreibungen?<br />
Brandt: Nennen wir es lieber Skepsis dem<br />
Pathos gegenüber. Die ist in meiner Persönlichkeit<br />
begründet. Ich bin halt nicht<br />
so ergriffen von mir selbst und unterspiele<br />
lieber, auch im Leben. Mein Blick auf die<br />
Dinge ist kleinteilig, ich baue Details<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
zusammen, daraus ergibt sich dann ein<br />
Ganzes. Die Art, wie jemand spielt, hat<br />
ja damit zu tun, wie er auf die Welt blickt.<br />
Wenn draußen ein Porsche vorbeifährt,<br />
bewundern Sie womöglich das tolle Auto.<br />
Ich frage mich eher, warum der Mann am<br />
Steuer so traurig schaut, und nehme später,<br />
wenn er aussteigt, vielleicht noch<br />
wahr, dass sein Hosenlatz aufsteht. Und<br />
baue dann daraus eine Geschichte. Mich<br />
haben schon immer Nischen interessiert.<br />
Und Merkwürdigkeiten.<br />
SPIEGEL: Im Leben oder als Schauspieler?<br />
Brandt: Sowohl als auch. Ich laufe Gefahr,<br />
Wesentliches zu vernachlässigen, weil ich<br />
mich in bizarren Details verliere. Was<br />
mich besonders interessiert, ist das Scheitern.<br />
Ich bin wahrscheinlich der leibhaftige<br />
Gegenentwurf zum Fußballtrainer Jürgen<br />
Klopp. Der hat gesagt, er sei ins Gewinnen<br />
verliebt. Ich bin verliebt ins Verlieren.<br />
Oder zumindest darin, davon zu erzählen.<br />
SPIEGEL: Scheitern ist aber erst im Nachhinein<br />
komisch.<br />
Brandt: Ich finde, wir haben ein gestörtes<br />
Verhältnis zum Scheitern. Es ist ein zu<br />
Unrecht vernachlässigter wesentlicher<br />
Teil des Lebens, oder? Mich rührt es total<br />
an, wenn Menschen etwas versuchen und<br />
es nicht glückt.<br />
SPIEGEL: Was war Ihr schönstes Scheitern?<br />
Brandt: Ein krachendes Misslingen war<br />
eine Inszenierung am Theater, dessen Namen<br />
ich nicht nenne, für die der Regisseur,<br />
dessen Namen ich nicht nenne, die Bühne<br />
komplett mit Schmierseife bedecken ließ,<br />
damit wir Schauspieler uns Abend für<br />
Abend vor ein paar hundert zahlenden<br />
Zuschauern beim Brüllen klassischer Verse<br />
auf die Fresse legten. Dekonstruktion<br />
und so weiter, Sie verstehen? Das fand<br />
ich so doof, dass ich bemüht war, mich<br />
coram publico unsichtbar zu machen. Lustig:<br />
Man steht auf der Bühne und demon -<br />
striert: Eigentlich bin ich gar nicht da.<br />
SPIEGEL: Sind Sie ein Verlierertyp?<br />
Brandt: Im Schauspielerberuf habe ich<br />
mich zumindest lange so empfunden. Ich<br />
habe ja, bevor ich meinen ersten Film<br />
drehte, die klassische Ochsentour durchs<br />
deutsche Stadttheater gemacht: Oldenburg,<br />
Wiesbaden, Mannheim, Frankfurt<br />
und so weiter. Irgendwann wollte ich da<br />
weg, ich fühlte mich deplatziert.
DIETER MAYR / DER SPIEGEL<br />
SPIEGEL: Haben Sie sich gefragt, warum<br />
keiner merkt, wie gut Sie sind?<br />
Brandt: Nein, ich hatte nie diese beleidigte<br />
Attitüde: Ihr verkennt mich, ihr Arschgeigen!<br />
Ich habe die Fehler eher bei mir<br />
gesucht und hatte meinen Ausdruck noch<br />
nicht gefunden. Ein Musiker braucht auch<br />
seine Zeit, bis er sein Instrument kennt.<br />
Genauso ist das mit der Schauspielerei.<br />
SPIEGEL: Sie waren schon Anfang vierzig,<br />
als Sie im Fernsehen ein Begriff wurden.<br />
Brandt: Mancher braucht eben etwas länger,<br />
bis er mit sich identisch ist. Ihre Frage<br />
unterstellt allerdings, eine halbwegs prominente<br />
Position im deutschen Fernsehen<br />
sei der Gipfel schauspielerischer Erfüllung.<br />
Das würde ich dann doch in Frage<br />
stellen. Das Hadern mit mir selbst, diese<br />
Unzufriedenheit trage ich allerdings bis<br />
heute mit mir herum. Mein Gott, ich höre<br />
mich so pessimistisch an! Dabei meine<br />
ich das gar nicht negativ. Oder nicht<br />
mehr. Irgendwann habe ich kapiert, dass<br />
der Zweifel ein zwingender Baustein meiner<br />
Arbeit ist. Früher hat der Zweifel<br />
mich gelähmt. Heute treibt er mich an.<br />
SPIEGEL: Haben Sie mal überlegt, die<br />
Schauspielerei hinzuschmeißen und ein<br />
Café aufzumachen?<br />
Brandt: Den Gedanken, in die Gastronomie<br />
zu wechseln, gab es auch. Bestimmt<br />
zehnmal in meiner Laufbahn. Am liebsten<br />
wäre mir einer von diesen Strandkiosks<br />
in Südfrankreich, vor denen immer<br />
so gebräunte ältere Herren mit Kapitänsmütze<br />
und Goldkettchen sitzen. Ich<br />
wäre dann einer von denen, toll.<br />
SPIEGEL: Was war Ihre größte Krise?<br />
Brandt: Ich hatte mit Mitte dreißig eine<br />
sehr unglückliche Phase, da wurde ich immer<br />
verschlossener, hatte immer weniger<br />
Zugang zu mir selbst. Es war schlicht und<br />
ergreifend eine Depression, Leben doof,<br />
Arbeit doof, man kennt das ja. Das führte<br />
zu einem Punkt, wo ich dachte, das tu ich<br />
mir jetzt nicht mehr an. Aber im Innern<br />
wusste ich, es ist noch nicht zu Ende, ich<br />
muss da durch, ich habe noch etwas zu<br />
erzählen. Als ich nichts mehr erwartet<br />
habe, wurde es besser. Der profanere<br />
Grund war, dass mir nichts einfiel, was<br />
ich stattdessen hätte tun können.<br />
SPIEGEL: Gibt es diese Sehnsucht nach einem<br />
Berufswechsel immer noch?<br />
Brandt: Nein, weil ich weiß, dass sich der<br />
realistische Wunsch zu einem unrealis -<br />
tischen gewandelt hat.<br />
SPIEGEL: Von wegen: Wer nimmt mich<br />
denn noch in meinem Alter?<br />
Brandt: Na ja, die Optionen verringern<br />
sich, das bedeutet Älterwerden ja wohl<br />
im Wesentlichen. Das Positive daran ist,<br />
dass man weiß: Das, was ich jetzt mache,<br />
ist und bleibt es. Außerdem ist dieser<br />
Beruf ganz gut für mich, weil er darauf<br />
beruht, Dinge halb zu können oder halb<br />
zu wissen. Ich muss ja immer so tun als<br />
ob. Unter uns: Es ist eine totale Hochstapler-Geschichte.<br />
Aber solange das<br />
155
nicht weiter auffällt, sehe ich kein<br />
großes Problem.<br />
SPIEGEL: Im jüngsten „Polizeiruf“ sagt<br />
der Kommissar und Adelssprössling<br />
Meuffels: „Ich kenne meinen Vater<br />
vor allem aus dem Fernsehen.“ Ist<br />
das noch Meuffels oder schon Brandt?<br />
Brandt: Es ist Meuffels. Aber der ist<br />
natürlich immer auch ein bisschen<br />
Matthias Brandt. Ich bin schließlich<br />
mein eigenes Material, alles, was ich<br />
habe. Leander Haußmann hat den<br />
Satz mit dem Vater ins Drehbuch<br />
geschrieben und mich gefragt, ob das<br />
okay sei. Weil ja klar ist, was da bei<br />
den Zuschauern mitschwingt. Ich fand<br />
es eine schöne und spielerische Art,<br />
mit meiner Herkunft umzugehen.<br />
SPIEGEL: Ist der Umstand, dass Sie<br />
Willy Brandts Sohn sind, privat oder<br />
öffentlich?<br />
Brandt: Darauf habe ich keinen<br />
Einfluss mehr. Es ist ein wichtiger<br />
Teil meiner Biografie, den ich nicht<br />
verleugnen kann und möchte. Trotzdem<br />
ist es mir eine Zeitlang total<br />
auf den Zeiger gegangen, ausschließlich<br />
darüber definiert zu werden.<br />
SPIEGEL: Den Gedenksendungen zum<br />
100. Geburtstag Ihres Vaters haben<br />
Sie sich konsequent verweigert.<br />
Brandt: Ich fand, dass ich zu diesen<br />
Sendungen, so wie sie geplant<br />
waren, nichts Wesentliches hätte<br />
beitragen können. Ich hätte dort bei<br />
einem anderen Thema nicht mitgemacht,<br />
warum dann bei diesem? Ich<br />
muss auch sagen, dass ich mich als<br />
Zuschauer und Leser ein wenig dar -<br />
über wundere, wie lust- und inspirationslos<br />
dieses Brandt-Gedenken<br />
sich, mit einigen Ausnahmen, dahinschleppt.<br />
Es ist doch keiner zwangsverpflichtet,<br />
sich zu erinnern. Wenn<br />
einem dazu nichts einfällt, kann<br />
man es doch auch bleibenlassen.<br />
SPIEGEL: Ist in Ihrer Kindheit im Kanzlerbungalow<br />
schon Ihr Blick fürs Skurrile<br />
entstanden?<br />
Brandt: Im Kanzlerbungalow bin ich als<br />
Kind nur zweimal gewesen, der war für<br />
alte Menschen konzipiert, eine Familie<br />
mit Kindern konnte dort nicht wohnen.<br />
Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen:<br />
Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich<br />
glaube schon – nein, inzwischen bin ich<br />
mir sogar sicher: Ich hatte im Hinblick<br />
auf meinen späteren Beruf sehr viel<br />
Anschauungsmaterial, weil ich gewisser -<br />
maßen in eine höfische Situation hineingeboren<br />
wurde. Und ich habe mir vieles<br />
angeschaut. Die ersten zehn Jahre meines<br />
Lebens habe ich nur beobachtet. Das ist<br />
mein Hauptfundus, bis heute.<br />
SPIEGEL: Hat es Ihnen imponiert, Staatsgäste<br />
aus aller Welt zu sehen?<br />
Brandt: Als Kind sind die einem wurscht.<br />
Kinder sind auch in der Regel keine<br />
Sozialdemokraten und demzufolge nicht<br />
156<br />
Vater und Sohn Brandt 1964, Fußballer Netzer 1971<br />
„Sich selbst einzuwechseln ist auch eine Option“<br />
an sozialdemokratischen Berühmtheiten<br />
interessiert. Meine Helden waren andere.<br />
Über allen Günter Netzer. Wichtiger war,<br />
wie viel ich damals über Hierarchie und<br />
Macht gelernt habe. Das prägt mich bis<br />
heute. Allem Zeremoniellen wohnt ja etwas<br />
Skurriles inne. Nehmen Sie nur das<br />
englische Königshaus, das ich wahnsinnig<br />
interessant finde. Dort herrschen strenge<br />
Regeln, und es gibt lauter Protagonisten,<br />
die, bis auf Mami, permanent an diesen<br />
Regeln scheitern und darüber dann oft<br />
noch richtig gute Witze machen.<br />
SPIEGEL: Wer ist Ihr Lieblings-Windsor?<br />
Brandt: Prince Philip, weil er einen phantastischen<br />
Humor hat.<br />
SPIEGEL: Er ist oft ziemlich peinlich, finden<br />
Sie nicht?<br />
Brandt: Ich glaube, dass das gezielte Geschmacklosigkeiten<br />
sind, um zu testen, was<br />
passiert. Der Mann weiß genau, was er<br />
sagt! Einmal hat er den nigerianischen<br />
Staatspräsidenten bei einem Dinner, zu<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
dem dieser in seiner Landestracht erschienen<br />
war, begrüßt mit: „Na, schon<br />
bettfertig gemacht?“ Das kann man<br />
als rassistische Äußerung betrachten.<br />
Zumindest als sehr unhöflich. Ich<br />
finde es einfach nur irre lustig. Eigentlich<br />
möchte ich das Gespräch hier<br />
unterbrechen und mit Ihnen die britische<br />
Hymne singen. Auch für Prinz<br />
Charles habe ich von jeher viel übrig.<br />
Ich war stets auf seiner Seite.<br />
SPIEGEL: Weil er ein Verlierer ist, der<br />
womöglich nie König werden wird?<br />
Brandt: So sehe ich ihn gar nicht. Ich<br />
glaube, es gibt bei ihm eine große<br />
Würde in der Lächerlichkeit, und<br />
davor habe ich allergrößte Hochachtung.<br />
Stellen Sie sich vor, der ganze<br />
Planet bekommt ein Telefonpro -<br />
tokoll von Ihnen zu lesen, in dem<br />
steht, dass Sie ein Tampon sein<br />
möchten! Sich da nicht zu entleiben,<br />
sondern das Ding weiter durchzuziehen<br />
– das hat Größe.<br />
SPIEGEL: War Ihr Faible für die Mon -<br />
archie ein Grund, warum Sie vor<br />
einigen Jahren die Hauptrolle im<br />
Kinderfilm „Des Kaisers neue Kleider“<br />
gespielt haben?<br />
Brandt: Es war immer mein Lieblingsmärchen.<br />
Der Vorgang, dass da einer<br />
steht und nackt ist und alle tun so,<br />
als wäre nichts, mit dem haben wir<br />
doch oft zu tun. Wissen Sie, so anstrengend<br />
meine Kindheit manchmal<br />
war – was ich als positiv empfinde<br />
ist, dass ich total unbeeindruckt von<br />
sogenannten Autoritäten bin.<br />
SPIEGEL: Weil Sie den Hierarchen zeigen,<br />
dass Sie sie nicht ernst nehmen?<br />
Brandt: Nein, weil manche Dinge bei<br />
mir nicht funktionieren würden und<br />
deshalb von vornherein unterlassen<br />
werden. Ich reagiere nicht auf Druck<br />
oder Ultimaten oder irgendwas in<br />
der Art. Ich könnte mich auch nie<br />
in diese behördenartigen Apparate hin -<br />
einbegeben. Ich bekomme das ja nur<br />
peripher mit bei meinem Arbeitgeber …<br />
SPIEGEL: … der ARD.<br />
Brandt: Von der Struktur her entspricht so<br />
ein deutscher Fernsehsender wahrscheinlich<br />
der Administration von Belgien. Und<br />
je größer der Apparat ist, desto weniger<br />
Entscheidungen werden dort getroffen.<br />
Das scheint das Prinzip zu sein. In dem<br />
Moment, wo etwas entschieden wird,<br />
bringt das den Apparat erst mal zum Erliegen:<br />
Schocklähmung. Das Schmiermittel<br />
der Institutionen ist die Unbestimmtheit.<br />
SPIEGEL: So, wie Sie das sagen, klingt das<br />
nach absurdem Theater.<br />
Brandt: Ja, aber ich kann mir einfach nicht<br />
vorstellen, was dort den ganzen Tag geschieht.<br />
Für alles Administrative fehlt mir<br />
die Phantasie.<br />
SPIEGEL: Sie haben mal gesagt, Sie fühlten<br />
sich vom deutschen Fernsehen unterfordert.<br />
ULLSTEIN BILD<br />
HORSTMÜLLER
Medien<br />
Brandt: Das habe ich gesagt? Was für ein<br />
blöder Satz. Ich verstehe den Gedanken,<br />
aber es klingt doch sehr hochmütig.<br />
SPIEGEL: Hoffen Sie darauf, dass Sie jemand<br />
aus den Niederungen des Fernsehens<br />
herauszieht, so wie es der bis dato<br />
kaum beachtete Christoph Waltz es durch<br />
Quentin Tarantino erfahren hat?<br />
Brandt: Niederungen? Entschuldigen Sie<br />
mal, wie reden Sie denn über meine<br />
Arbeit? Nein, tue ich nicht, dann hätte<br />
ich ja nicht mehr alle Tassen im Schrank.<br />
Auf so etwas kannst du doch nicht<br />
warten.<br />
SPIEGEL: Bei Ihrem Hang zum Skurrilen –<br />
warum sind Sie eigentlich kein Komiker<br />
geworden?<br />
Brandt: Kommt vielleicht noch. Ich bin<br />
ja, wie Sie richtig festgestellt haben, ein<br />
Spätzünder. Die Biografie des Schau -<br />
spielers Theo Lingen heißt: „Komiker aus<br />
Versehen“. Wahrscheinlich bin ich ein<br />
Tragöde aus Versehen. Stan Laurel und<br />
Oliver Hardy, Jack Lemmon, Peter Sellers<br />
– alle meine frühesten Helden waren<br />
Komödianten.<br />
SPIEGEL: Aber keinen anderen verehrten<br />
Sie so sehr wie Günter Netzer.<br />
Brandt: Das größte Idol, das ich je hatte<br />
und habe. Schwarzer Ferrari, schwarze<br />
Klamotten, die Disco „Lovers’ Lane“ in<br />
Mönchengladbach und dann noch ab und<br />
zu einen Traumpass spielen. Und: Der<br />
Mann hat sich, als es gar nicht mehr anders<br />
ging, selbst eingewechselt, 1973 im<br />
Pokalfinale in Düsseldorf. Das habe ich<br />
mir fürs Leben gemerkt: Sich selbst einzuwechseln<br />
ist auch eine Option.<br />
SPIEGEL: Haben Sie ihn später mal kennen -<br />
gelernt?<br />
Brandt: Wir saßen mal im selben Lokal.<br />
Meine Frau wunderte sich, warum ich<br />
plötzlich so klemmig war. Ich wollte ihn<br />
nicht ansprechen. Ich konnte meine kindliche<br />
Befangenheit nicht überwinden. Ich<br />
bin selbst mit einem Idol aufgewachsen<br />
und weiß, wie viel Leute in jemanden<br />
hineinprojizieren, den sie verehren. Aber<br />
dann sprach Netzer plötzlich mich an,<br />
um mir zu sagen, dass er meine Arbeit<br />
schätzt! Damit konnte ich überhaupt<br />
nicht umgehen. Ich habe nicht verstanden,<br />
warum er plötzlich meinen Text sagt,<br />
ein Schauspieleralptraum!<br />
SPIEGEL: Stimmt es eigentlich, dass Sie auf<br />
einem Auge blind sind?<br />
Brandt: Nein, das nicht, aber ich sehe<br />
auf dem linken Auge sehr schlecht. Die<br />
Sehfähigkeit beträgt zehn Prozent, von<br />
Geburt an. Der Augenarzt hat mir erklärt,<br />
dass das Hirn das kompensiert,<br />
wenn man es schon als Kind hat.<br />
SPIEGEL: Hat das Einfluss auf Ihre Arbeit<br />
als Schauspieler?<br />
Brandt: Nein, aber auf mein Tennisspiel.<br />
Weil ich kein räumliches Sehen habe,<br />
haue ich immer am Ball vorbei.<br />
SPIEGEL: Herr Brandt, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
PRESSE<br />
Wer war<br />
Mister X?<br />
Wegen einer zweifelhaften Aussage<br />
ermittelte die Münchner<br />
Staatsanwaltschaft gegen einen<br />
Journalisten und<br />
zwei leitende Kriminalbeamte.<br />
Reporter Bendixen<br />
MARTIN BINDER / BR<br />
Vom Restaurant im siebten Stock<br />
des Hotels Bayerischer Hof in<br />
München haben Besucher einen<br />
wunderbaren Blick über die Stadt, bei<br />
gutem Wetter bis zu den Alpen. Doch<br />
die beiden Journalisten, die sich im<br />
Oktober vergangenen Jahres dort trafen,<br />
interessierten sich kaum für die schöne<br />
Aussicht. Stattdessen, so behauptet ein<br />
Informant der Münchner Staatsanwaltschaft,<br />
hätten sie über die Vorbereitung<br />
einer Straftat gesprochen:<br />
Es sei darum gegangen, Beamte<br />
zu bestechen, um an<br />
brisante Dokumente zu<br />
kommen.<br />
Zwar waren die Vorwürfe<br />
gegen Oliver Bendixen,<br />
Reporter beim Bayerischen<br />
Rundfunk, nicht mit belegbaren<br />
Fakten begründet.<br />
Doch das hielt die Ermittler<br />
nicht davon ab, Maßnahmen<br />
einzuleiten, als ginge<br />
es um ein Schwerverbrechen.<br />
Telefone wurden abgehört,<br />
Familienangehörige<br />
überwacht, Beschattungen<br />
angeordnet.<br />
So vehement agierten die Staatsanwälte,<br />
dass ihre Aktion nun Politiker und Berufsverbände<br />
gleichermaßen aufbringt.<br />
Über eine „diffuse Einstellung“ zum Journalismus<br />
klagt Michael Busch, Vorsitzender<br />
des Bayerischen Journalisten-Verbands.<br />
Und die bayerische SPD will wissen,<br />
wer dieser Informant ist, dem die<br />
Justiz so viel Glauben schenkte.<br />
Es war der 14. September 2012, als der<br />
ominöse Zeuge bei der Staatsanwaltschaft<br />
München I auftauchte und zunächst<br />
einmal Vertraulichkeit verlangte.<br />
Die wird üblicherweise gewährt, wenn<br />
Lebensgefahr oder „unzumutbare Nachteile“<br />
drohen. Warum sie in diesem Fall<br />
vereinbart wurde, will die Behörde nicht<br />
verraten.<br />
Er wisse von einem Kontaktmann, behauptete<br />
der Informant, dass Bendixen,<br />
der über „exzellente Kontakte zum Po -<br />
lizeiapparat“ verfüge, „einhundertvierzig<br />
Akten/Leitzordner aus dem Fall<br />
Hypo Alpe Adria ./. BayernLB auf Datenträger<br />
gegen Entgelt“ besorgen könne.<br />
30 000 Euro verlangten die beiden Chefs<br />
der LKA-Abteilung Ermittlungen/Ope -<br />
rative Spezialeinheiten dafür. Der „Vollzug<br />
dieses Geschäftes stehe in Bälde<br />
bevor“.<br />
Die Staatsanwaltschaft witterte den<br />
großen Fall. Schnell beantragte sie die<br />
erforderlichen Beschlüsse und ersuchte<br />
das Bundeskriminalamt (BKA) um Ermitt -<br />
lungen. Sämtliche Telefonanschlüsse der<br />
drei Betroffenen seien zu überwachen,<br />
„höchste Eile“ sei geboten.<br />
Doch die Bundesbehörde reagierte ungewohnt<br />
zurückhaltend. „Das BKA wird<br />
mit diesem Informanten nicht zusammenarbeiten“,<br />
heißt es in einem Schreiben.<br />
„Bei der gegenwärtigen Verdachtslage“<br />
werde das Amt „keine aktiven verdeckten<br />
Ermittlungshandlungen gegenüber<br />
Journalisten“ vornehmen.<br />
Die Staatsanwaltschaft München focht<br />
das nicht an. Sie ließ die Telefone der<br />
Polizisten und ihrer Angehörigen abhören,<br />
beantragte die Observation der Verdächtigen.<br />
So hörten die Ermittler mit,<br />
wie am Abend nach dem Treffen im Bayerischen<br />
Hof der Journalist<br />
Bendixen mit dem Kriminalbeamten<br />
W. telefonierte.<br />
Der Inhalt: belangloses Geplänkel<br />
über 8 Minuten<br />
und 19 Sekunden.<br />
W.: „Wie geht’s dir<br />
sonst?“<br />
Bendixen: „Du, ganz,<br />
ganz ordentlich. Wir gehen<br />
nächste Woche mal Kaffee<br />
trinken, wir zwei, oder?“<br />
W.: „Des machen wir.“<br />
Im vergangenen Sommer<br />
wurden die Ermittlungen<br />
ohne jedes Ergebnis<br />
eingestellt. Die „Kontaktperson“,<br />
von der der ominöse<br />
Informant gesprochen hatte, war<br />
anhand von Bendixens Terminkalen -<br />
der schnell enttarnt: Es war sein Gesprächspartner<br />
aus dem Bayerischen<br />
Hof: der frühere „Focus“-Journalist Wilhelm<br />
Dietl, der das Magazin vor Jahren<br />
verlassen musste, weil er allzu eng mit<br />
dem Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet<br />
hatte. Es sei aber nie um<br />
die Akten gegangen, und er habe auch<br />
niemandem von dem Gespräch erzählt,<br />
behauptet Dietl. Damit bleibt die Fra -<br />
ge offen, von wem der geheimnisvolle<br />
Informant sein Wissen gehabt haben<br />
will.<br />
Mit einer Anfrage an die Staatsregierung<br />
verlangt die bayerische SPD nun<br />
Aufklärung, warum die Staatsanwaltschaft<br />
ihrem Mister X so viel Glauben<br />
schenkte. „Notfalls“, sagt SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender<br />
Markus Rinderspacher,<br />
werden wir das „von einem Untersuchungsausschuss<br />
klären lassen“.<br />
ANDREAS ULRICH<br />
DER SPIEGEL 50/2013 157
Impressum<br />
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax -2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)<br />
HERAUSGEBER Rudolf Augstein (1923 – 2002)<br />
CHEFREDAKTEUR Wolfgang Büchner (V. i. S. d. P.)<br />
STELLV. CHEFREDAKTEURE<br />
Klaus Brinkbäumer, Dr. Martin Doerry<br />
MITGLIED DER CHEFREDAKTION<br />
Nikolaus Blome (Leiter des Hauptstadtbüros)<br />
ART DIRECTION Uwe C. Beyer<br />
Politischer Autor: Dirk Kurbjuweit<br />
DEUTSCHE POLITIK · HAUPTSTADTBÜRO Stellvertretende Leitung:<br />
Christiane Hoffmann, René Pfister. Redaktion Politik: Nicola Abé, Dr.<br />
Melanie Amann, Ralf Beste, Horand Knaup, Peter Müller, Ralf Neukirch,<br />
Gordon Repinski. Autor: Markus Feldenkirchen<br />
Redaktion Wirtschaft: Sven Böll, Markus Dettmer, Cornelia Schmergal,<br />
Gerald Traufetter. Reporter: Alexander Neubacher, Christian Reiermann<br />
Meinung: Dr. Gerhard Spörl<br />
DEUTSCHLAND Leitung: Alfred Weinzierl, Cordula Meyer (stellv.),<br />
Dr. Markus Verbeet (stellv.); Hans-Ulrich Stoldt (Panorama). Redaktion:<br />
Felix Bohr, Jan Friedmann, Michael Fröhlingsdorf, Hubert Gude,<br />
Carsten Holm, Charlotte Klein, Petra Kleinau, Guido Kleinhubbert,<br />
Bernd Kühnl, Gunther Latsch, Udo Ludwig, Maximilian Popp, Andreas<br />
Ulrich, Antje Windmann. Autoren, Reporter: Jürgen Dahlkamp, Dr.<br />
Thomas Darnstädt, Gisela Friedrichsen, Beate Lakotta, Bruno Schrep,<br />
Katja Thimm, Dr. Klaus Wiegrefe<br />
Berliner Büro Leitung: Frank Hornig. Redaktion: Sven Becker, Markus<br />
Deggerich, Özlem Gezer, Sven Röbel, Jörg Schindler, Michael Sontheimer,<br />
Andreas Wassermann, Peter Wensierski. Autoren: Stefan Berg,<br />
Jan Fleischhauer, Konstantin von Hammerstein<br />
WIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler, Michael Sauga (Berlin),<br />
Susanne Amann (stellv.), Marcel Rosenbach (stellv., Medien und Internet).<br />
Redaktion: Markus Brauck, Isabell Hülsen, Alexander Jung,<br />
Nils Klawitter, Alexander Kühn, Martin U. Müller, Jörg Schmitt, Janko<br />
Tietz. Autoren, Reporter: Markus Grill, Dietmar Hawranek, Michaela<br />
Schießl<br />
AUSLAND Leitung: Clemens Höges, Britta Sandberg, Juliane von Mittelstaedt<br />
(stellv.). Redaktion: Dieter Bednarz, Manfred Ertel, Jan Puhl,<br />
Sandra Schulz, Samiha Shafy, Daniel Steinvorth, Helene Zuber. Autoren,<br />
Reporter: Ralf Hoppe, Hans Hoyng, Susanne Koelbl, Dr. Christian<br />
Neef, Christoph Reuter<br />
Diplomatischer Korrespondent: Dr. Erich Follath<br />
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Rafaela von Bredow, Olaf<br />
Stampf. Redaktion: Dr. Philip Bethge, Manfred Dworschak, Marco<br />
Evers, Dr. Veronika Hackenbroch, Laura Höflinger, Julia Koch, Kerstin<br />
Kullmann, Hilmar Schmundt, Matthias Schulz, Frank Thadeusz, Christian<br />
Wüst. Autor: Jörg Blech<br />
KULTUR Leitung: Lothar Gorris, Dr. Joachim Kronsbein (stellv.).<br />
Redaktion: Lars-Olav Beier, Susanne Beyer, Dr. Volker Hage, Ulrike<br />
Knöfel, Philipp Oehmke, Tobias Rapp, Katharina Stegelmann, Claudia<br />
Voigt, Martin Wolf. Autoren, Reporter: Georg Diez, Wolfgang Höbel,<br />
Thomas Hüetlin, Dr. Romain Leick, Matthias Matussek, Elke Schmitter,<br />
Dr. Susanne Weingarten<br />
KulturSPIEGEL: Marianne Wellershoff (verantwortlich). Tobias<br />
Becker, Anke Dürr, Maren Keller, Daniel Sander<br />
GESELLSCHAFT Leitung: Matthias Geyer, Dr. Stefan Willeke, Barbara<br />
Supp (stellv.). Redaktion: Hauke Goos, Barbara Hardinghaus, Wiebke<br />
Hollersen, Ansbert Kneip, Katrin Kuntz, Dialika Neufeld, Bettina Stiekel,<br />
Jonathan Stock, Takis Würger. Reporter: Uwe Buse, Ullrich Fichtner,<br />
Jochen-Martin Gutsch, Guido Mingels, Cordt Schnibben, Alexander<br />
Smoltczyk<br />
SPORT Leitung: Gerhard Pfeil, Michael Wulzinger. Redaktion: Rafael<br />
Buschmann, Lukas Eberle, Maik Großekathöfer, Detlef Hacke, Jörg<br />
Kramer<br />
SONDERTHEMEN Leitung: Dietmar Pieper, Annette Großbongardt<br />
(stellv.). Redaktion: Annette Bruhns, Angela Gatterburg, Uwe Klußmann,<br />
Joachim Mohr, Bettina Musall, Dr. Johannes Saltzwedel, Dr.<br />
Eva-Maria Schnurr, Dr. Rainer Traub<br />
MULTIMEDIA Jens Radü; Roman Höfner, Marco Kasang, Bernhard<br />
Riedmann<br />
CHEF VOM DIENST Thomas Schäfer, Katharina Lüken (stellv.),<br />
Holger Wolters (stellv.)<br />
SCHLUSSREDAKTION Anke Jensen; Christian Albrecht, Gesine Block,<br />
Regine Brandt, Lutz Diedrichs, Bianca Hunekuhl, Ursula Junger, Sylke<br />
Kruse, Maika Kunze, Stefan Moos, Reimer Nagel, Manfred Petersen,<br />
Fred Schlotterbeck, Sebastian Schulin, Tapio Sirkka, Ulrike Wallenfels<br />
PRODUKTION Solveig Binroth, Christiane Stauder, Petra Thormann;<br />
Christel Basilon, Petra Gronau, Martina Treumann<br />
BILDREDAKTION Michaela Herold (Ltg.), Claudia Jeczawitz, Claus-<br />
Dieter Schmidt; Sabine Döttling, Susanne Döttling, Torsten Feldstein,<br />
Thorsten Gerke, Andrea Huss, Antje Klein, Elisabeth Kolb, Matthias<br />
Krug, Parvin Nazemi, Peer Peters, Karin Weinberg, Anke Wellnitz<br />
E-Mail: bildred@spiegel.de<br />
SPIEGEL Foto USA: Susan Wirth, Tel. (001212) 3075948<br />
GRAFIK Martin Brinker, Johannes Unselt (stellv.); Cornelia Baumermann,<br />
Ludger Bollen, Thomas Hammer, Anna-Lena Kornfeld, Gernot<br />
Matzke, Cornelia Pfauter, Julia Saur, André Stephan, Michael Walter<br />
LAYOUT Wolfgang Busching, Jens Kuppi, Reinhilde Wurst (stellv.);<br />
Michael Abke, Katrin Bollmann, Claudia Franke, Bettina Fuhrmann,<br />
Ralf Geilhufe, Kristian Heuer, Nils Küppers, Sebastian Raulf, Barbara<br />
Rödiger, Doris Wilhelm<br />
Besondere Aufgaben: Michael Rabanus<br />
Sonderhefte: Rainer Sennewald<br />
TITELBILD Suze Barrett, Arne Vogt; Iris Kuhlmann, Gershom Schwalfenberg<br />
Besondere Aufgaben: Stefan Kiefer<br />
INTERNET www.spiegel.de<br />
REDAKTIONSBLOG spiegel.de/spiegelblog<br />
TWITTER @derspiegel<br />
FACEBOOK facebook.<strong>com</strong>/derspiegel<br />
158<br />
E-Mail spiegel@spiegel.de<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND<br />
BERLIN Pariser Platz 4a, 10117 Berlin; Deutsche Politik, Wirtschaft<br />
Tel. (030) 886688-100, Fax 886688-111; <strong>Deutschland</strong>, Wissenschaft,<br />
Kultur, Gesellschaft Tel. (030) 886688-200, Fax 886688-222<br />
DRESDEN Steffen Winter, Wallgäßchen 4, 01097 Dresden, Tel. (0351)<br />
26620-0, Fax 26620-20<br />
DÜSSELDORF Georg Bönisch, Frank Dohmen, Barbara Schmid, Fidelius<br />
Schmid , Benrather Straße 8, 40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-<br />
01, Fax 86679-11<br />
FRANKFURT AM MAIN Matthias Bartsch, Martin Hesse, Simone Salden,<br />
Anne Seith, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Tel. (069)<br />
9712680, Fax 97126820<br />
KARLSRUHE Dietmar Hipp, Waldstraße 36, 76133 Karlsruhe, Tel. (0721)<br />
22737, Fax 9204449<br />
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Anna Kistner, Conny Neumann, Rosental<br />
10, 80331 München, Tel. (089) 4545950, Fax 45459525<br />
STUTTGART Büchsenstraße 8/10, 70173 Stuttgart, Tel. (0711) 664749-<br />
20, Fax 664749-22<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND<br />
BOSTON Johann Grolle, 25 Gray Street, 02138 Cambridge, Massachusetts,<br />
Tel. (001617) 9452531<br />
BRÜSSEL Christoph Pauly, Christoph Schult, Bd. Charlemagne 45,<br />
1000 Brüssel, Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436<br />
KAPSTADT Bartholomäus Grill, P. O. Box 15614, Vlaeberg 8018, Kapstadt,<br />
Tel. (002721) 4261191<br />
LONDON Christoph Scheuermann, 26 Hanbury Street, London E1 6QR,<br />
Tel. (0044203) 4180610, Fax (0044207) 0929055<br />
MADRID Apartado Postal Número 100 64, 28080 Madrid, Tel. (0034)<br />
650652889<br />
MOSKAU Matthias Schepp, Glasowskij Pereulok Haus 7, Office 6,<br />
119002 Moskau, Tel. (007495) 22849-61, Fax 22849-62<br />
NEU-DELHI Dr. Wieland Wagner, 210 Jor Bagh, 2F, Neu-Delhi 110003,<br />
Tel. (009111) 41524103<br />
NEW YORK Alexander Osang, 10 E 40th Street, Suite 3400, New York,<br />
NY 10016, Tel. (001212) 2217583, Fax 3026258<br />
PARIS Mathieu von Rohr, 12, Rue de Castiglione, 75001 Paris, Tel.<br />
(00331) 58625120, Fax 42960822<br />
PEKING Bernhard Zand, P. O. Box 170, Peking 100101, Tel. (008610)<br />
65323541, Fax 65325453<br />
RIO DE JANEIRO Jens Glüsing, Caixa Postal 56071, AC Urca,<br />
22290-970 Rio de Janeiro-RJ, Tel. (005521) 2275-1204, Fax 2543-9011<br />
ROM Fiona Ehlers, Walter Mayr, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel.<br />
(003906) 6797522, Fax 6797768<br />
SAN FRANCISCO Thomas Schulz, P.O. Box 330119, San Francisco, CA<br />
94133, Tel. (001212) 2217583<br />
TEL AVIV Julia Amalia Heyer, P. O. Box 8387, Tel Aviv-Jaffa 61083,<br />
Tel. (009723) 6810998, Fax 6810999<br />
WARSCHAU P.O. Box 31, ul. Waszyngtona 26, PL- 03-912 Warschau,<br />
Tel. (004822) 6179295, Fax 6179365<br />
WASHINGTON Marc Hujer, Holger Stark, 1202 National Press Building,<br />
Washington, D.C. 20045, Tel. (001202) 3475222, Fax 3473194<br />
DOKUMENTATION Dr. Hauke Janssen, Cordelia Freiwald (stellv.), Axel<br />
Pult (stellv.), Peter Wahle (stellv.); Jörg-Hinrich Ahrens, Dr. Susmita<br />
Arp, Dr. Anja Bednarz, Ulrich Booms, Dr. Helmut Bott, Viola Broecker,<br />
Dr. Heiko Buschke, Andrea Curtaz-Wilkens, Johannes Eltzschig, Johannes<br />
Erasmus, Klaus Falkenberg, Catrin Fandja, Anne-Sophie Fröhlich,<br />
Dr. André Geicke, Silke Geister, Thorsten Hapke, Susanne Heitker,<br />
Carsten Hellberg, Stephanie Hoffmann, Bertolt Hunger, Joachim Immisch,<br />
Kurt Jansson, Michael Jürgens, Tobias Kaiser, Renate Kemper-<br />
Gussek, Jessica Kensicki, Ulrich Klötzer, Ines Köster, Anna Kovac,<br />
Peter Lakemeier, Dr. Walter Lehmann-Wiesner, Michael Lindner,<br />
Dr. Petra Ludwig-Sidow, Rainer Lübbert, Sonja Maaß, Nadine Markwaldt-Buchhorn,<br />
Dr. Andreas Meyhoff, Gerhard Minich, Cornelia<br />
Moormann, Tobias Mulot, Bernd Musa, Nicola Naber, Margret Nitsche,<br />
Sandra Öfner, Thorsten Oltmer, Dr. Vassilios Papadopoulos, Axel<br />
Rentsch, Thomas Riedel, Andrea Sauerbier, Maximilian Schäfer, Marko<br />
Scharlow, Rolf G. Schierhorn, Mirjam Schlossarek, Dr. Regina Schlüter-<br />
Ahrens, Mario Schmidt, Thomas Schmidt, Andrea Schumann-Eckert,<br />
Ulla Siegenthaler, Jil Sörensen, Rainer Staudhammer, Tuisko Steinhoff,<br />
Dr. Claudia Stodte, Stefan Storz, Rainer Szimm, Dr. Eckart Teichert,<br />
Nina Ulrich, Ursula Wamser, Peter Wetter, Kirsten Wiedner, Holger<br />
Wilkop, Karl-Henning Windelbandt, Anika Zeller, Malte Zeller<br />
LESER-SERVICE Catherine Stockinger<br />
NACHRICHTENDIENSTE AFP, AP, dpa, Los Angeles Times / Washington<br />
Post, New York Times, Reuters, sid<br />
SPIEGEL-VERLAG RUDOLF AUGSTEIN GMBH & CO. KG<br />
Verantwortlich für Anzeigen: Norbert Facklam<br />
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 67 vom 1. Januar 2013<br />
Mediaunterlagen und Tarife: Tel. (040) 3007-2540, www.spiegel-qc.de<br />
Commerzbank AG Hamburg<br />
Konto-Nr. 6181986, BLZ 200 400 00<br />
Verantwortlich für Vertrieb: Thomas Hass<br />
Druck: Prinovis, Dresden / Prinovis, Itzehoe<br />
VERLAGSLEITUNG Matthias Schmolz, Rolf-Dieter Schulz<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG Ove Saffe<br />
DER SPIEGEL (USPS No. 0154520) is published weekly by SPIEGEL VERLAG. Subscription<br />
price for USA is $ 370 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St, Englewood,<br />
NJ 07631. Periodicals postage is paid at Paramus, NJ 07652. Postmaster: Send address changes to:<br />
DER SPIEGEL, GLP, P.O. Box 9868, Englewood, NJ 07631.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
Service<br />
Leserbriefe<br />
SPIEGEL-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg<br />
Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />
Hinweise für Informanten:<br />
Falls Sie dem SPIEGEL vertrauliche Dokumente und Informationen<br />
zukommen lassen wollen, finden Sie unter<br />
der Webadresse www.spiegel.de/briefkasten Hinweise,<br />
wie Sie die Redaktion erreichen und sich schützen.<br />
Wollen Sie wegen vertraulicher Informationen direkt<br />
Kontakt zum SPIEGEL aufnehmen, stehen Ihnen folgende<br />
Wege zur Verfügung:<br />
Post: DER SPIEGEL, c/o „Briefkasten“, Ericusspitze 1,<br />
20457 Hamburg<br />
PGP-verschlüsselte Mail: briefkasten@spiegel.de (den<br />
entsprechenden PGP-Schlüssel finden Sie unter<br />
www.spiegel.de/briefkasten)<br />
Telefon: 040-3007-0, Stichwort „Briefkasten“<br />
Fragen zu SPIEGEL-Artikeln/Recherche<br />
Telefon: (040) 3007-2687 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: artikel@spiegel.de<br />
Nachdruckgenehmigungen für Texte, Fotos, Grafiken:<br />
Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlags. Das gilt auch für die<br />
Aufnahme in elektronische Datenbanken und Mailboxen<br />
sowie für Vervielfältigungen auf CD-Rom.<br />
<strong>Deutschland</strong>, Österreich, Schweiz:<br />
Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: nachdrucke@spiegel.de<br />
übriges Ausland:<br />
New York Times News Service/Syndicate<br />
E-Mail: nytsyn-paris@nytimes.<strong>com</strong><br />
Telefon: (00331) 41439757<br />
Nachbestellungen<br />
SPIEGEL-Ausgaben der letzten Jahre sowie<br />
alle Ausgaben von SPIEGEL GESCHICHTE<br />
und SPIEGEL WISSEN können unter<br />
www.amazon.de/spiegel versandkostenfrei<br />
innerhalb <strong>Deutschland</strong>s nachbestellt werden.<br />
Historische Ausgaben<br />
Historische Magazine Bonn<br />
www.spiegel-antiquariat.de Telefon: (0228) 9296984<br />
Kundenservice<br />
Persönlich erreichbar Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,<br />
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg<br />
Telefon: (040) 3007-2700 Fax: (040) 3007-3070<br />
E-Mail: aboservice@spiegel.de<br />
Abonnement für Blinde<br />
Audio Version, Deutsche Blindenstudienanstalt e.V.<br />
Telefon: (06421) 606265<br />
Elektronische Version, Frankfurter Stiftung für Blinde<br />
Telefon: (069) 955124-<br />
Abonnementspreise<br />
Inland: 52 Ausgaben € 218,40<br />
Studenten Inland: 52 Ausgaben € 153,40 inkl.<br />
sechsmal UniSPIEGEL<br />
Österreich: 52 Ausgaben € 234,00<br />
Schweiz: 52 Ausgaben sfr 361,40<br />
Europa: 52 Ausgaben € 273,00<br />
Außerhalb Europas: 52 Ausgaben € 351,00<br />
Der digitale SPIEGEL: 52 Ausgaben € 202,80<br />
Befristete Abonnements werden anteilig berechnet.<br />
Abonnementsbestellung<br />
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,<br />
20637 Hamburg – oder per Fax: (040) 3007-3070,<br />
www.spiegel.de/abo<br />
Ich bestelle den SPIEGEL<br />
❏ für € 4,20 pro Ausgabe<br />
❏ für € 3,90 pro digitale Ausgabe<br />
❏ für € 0,50 pro digitale Ausgabe zusätzlich zur<br />
Normallieferung. Eilbotenzustellung auf Anfrage.<br />
Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Hefte<br />
bekomme ich zurück. Bitte liefern Sie den SPIEGEL an:<br />
Name, Vorname des neuen Abonnenten<br />
Straße, Hausnummer oder Postfach<br />
PLZ, Ort<br />
Ich zahle<br />
❏ bequem und bargeldlos per Bankeinzug (1/4-jährl.)<br />
Bankleitzahl<br />
Konto-Nr.<br />
Geldinstitut<br />
❏ nach Erhalt der Jahresrechnung. Eine Belehrung<br />
über Ihr Widerrufsrecht erhalten Sie unter:<br />
www.spiegel.de/widerrufsrecht<br />
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten<br />
SP13-001<br />
SD13-006<br />
SD13-008 (Upgrade)
Register<br />
SONNTAG, 15. 12., 23.00 – 23.45 UHR | RTL<br />
SPIEGEL TV MAGAZIN<br />
Augen auf beim Geschenkekauf – Hochsaison<br />
der Taschendiebe; Wachstumsmarkt<br />
und sozialer Trend – Veganes<br />
Vegane Hardcore-Band<br />
Leben; Großmeister des flachen Witzes –<br />
Unterwegs mit Fips Asmussen.<br />
MONTAG, 9. 12., 21.05 – 21.55 UHR | SKY<br />
SPIEGEL GESCHICHTE<br />
Überleben in Amsterdam –<br />
Vom Untergrund ins Parlament<br />
Der ehemalige Amsterdamer<br />
Bürgermeister Ed van Thijn hat lange<br />
über seine Kriegserfahrungen ge -<br />
schwiegen. Zwei Jahre lang lebt der<br />
jüdische Junge im Untergrund, dann<br />
finden ihn die deutschen Besatzer<br />
und bringen ihn ins Lager Wester -<br />
bork. Doch die Eisenbahner streiken.<br />
Die Deportationen in die Konzen -<br />
trationslager sind für kurze Zeit<br />
eingestellt. Van Thijn überlebt. Als<br />
Politiker beteiligt er sich später am<br />
Aufbau eines demokratischen<br />
Europa.<br />
SONNTAG, 15. 12., 15.30 – 16.05 UHR | 3SAT<br />
HITEC<br />
Schnelles Internet für alle –<br />
(K)ein Grundrecht?<br />
Surfen, streamen, chatten – schnelles<br />
Internet ist für viele Deutsche selbstverständlich.<br />
Doch nicht für alle.<br />
Während in den Ballungsräumen<br />
Übertragungsraten von 50 Mbit/s zur<br />
Verfügung stehen, bleibt für Bewohner<br />
in ländlichen Regionen schnelles<br />
Internet oft ein Traum. Im brandenburgischen<br />
Blumberg in der Nähe von<br />
Berlin beispielsweise sind viele in<br />
ihrer beruflichen Existenz bedroht:<br />
Ihre Internetverbindung ist so langsam,<br />
dass sie oft nicht einmal Mails<br />
mit Anhängen verschicken können.<br />
160<br />
GESTORBEN<br />
Chris Howland, 85. Wenn Deutsche sich<br />
in den sechziger Jahren einen Engländer<br />
vorstellten, hatten viele den Entertainer<br />
vor Augen, der sogar<br />
das Zertrümmern eines<br />
Sparschweins besang<br />
(„Hämmerchen<br />
Polka“) und als Erster<br />
im deutschen Fern -<br />
sehen eine versteck -<br />
te Kamera einsetzte.<br />
Howland, der mit der<br />
britischen Armee nach<br />
Hamburg gekommen<br />
war, moderierte zunächst<br />
beim Soldatensender BFN. 1952<br />
ging er zum Nordwestdeutschen Rundfunk.<br />
Weil er noch kein Deutsch konnte,<br />
schrieb er seine Texte auf Englisch, ließ<br />
sie übersetzen und las sie ab. Aus einem<br />
alten deutschen Vornamen und einer<br />
westfälischen Brotsorte setzte er seinen<br />
Spitznamen Heinrich Pumpernickel zusammen.<br />
Engagiert war er als „Schallplatten-Jockey“,<br />
und weil man Jockeys<br />
mit Pferden verbindet, spielte er in seiner<br />
Radiosendung gelegentlich das Geräusch<br />
galoppierender Hufe ein. Ab 1961 machte<br />
Howland auch im Fernsehen Karriere.<br />
Seine Show „Musik aus Studio B“ war<br />
für die damalige Jugend so prägend wie<br />
für spätere Generationen MTV. Bis zuletzt<br />
hatte er bei WDR 4 seine eigene Radiosendung.<br />
Chris Howland starb in der Nacht<br />
zum 30. November in Rösrath bei Köln.<br />
Paul Walker, 40. Er wirkte wie ein kalifornischer<br />
Sonnyboy, kannte aber auch<br />
die wolkenverhangenen Tage ziemlich<br />
gut. Schon als Teenager stand Walker vor<br />
der Kamera, zunächst vor allem in Fernsehserien.<br />
Der Durchbruch gelang ihm<br />
2001 mit dem Film „The Fast and the Furious“,<br />
in dem der Action-Star einen verdeckten<br />
Ermittler spielt. Dieser lässt sich<br />
in eine Gang von jungen Männern und<br />
Frauen einschleusen, die geheime Autorennen<br />
veranstalten,<br />
findet aber selbst immer<br />
mehr Gefallen<br />
an der halsbrecherischen<br />
Raserei. Sechs<br />
Filme dieser Reihe<br />
wurden bislang gedreht,<br />
der siebte war<br />
gerade in Arbeit, als<br />
Paul Walker am 30.<br />
November im kalifornischen<br />
Valencia in einem<br />
Sportwagen tödlich verunglückte,<br />
als Beifahrer seines Freundes und Geschäftspartners<br />
Roger Rodas. Der Mythos<br />
des Stars, der jung, schön und auf der<br />
Überholspur ums Leben kam, ähnlich wie<br />
einst James Dean, war sofort in der Welt.<br />
PETER BISCHOFF / GETTY IMAGES<br />
HAHN LIONEL / ABACA<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
André Schiffrin, 78. Er setzte sich für Autoren<br />
und Werke ein, von denen er überzeugt<br />
war – nicht für solche, die ihm<br />
Marktlogik und Konsensdenken vorgaben.<br />
Als kleiner Junge mit seinen jüdischen<br />
Eltern aus Paris in die USA geflohen,<br />
übernahm er 1963 die Leitung des von<br />
seinem Vater mitbegründeten New Yorker<br />
Verlags Pantheon Books. In dieser<br />
Position machte er viele Größen der Geistesgeschichte<br />
des 20. Jahrhunderts erstmals<br />
einem englischsprachigen Publikum<br />
zugänglich: Foucault, Sartre, Beauvoir,<br />
Duras, Bourdieu. Er pflegte seine geistige<br />
Beziehung zum alten Kontinent, besaß<br />
aber auch verlegerischen Instinkt und<br />
Mut. Schiffrin war es, der als Erster dem<br />
später berühmt gewordenen „Maus“-Comic<br />
von Art Spiegelman eine Chance gab.<br />
In Büchern wie „Verlage ohne Verleger“<br />
(2000) oder „Words and Money“ (2010)<br />
warnte Schiffrin vor den Gefahren von<br />
Großverlagen für Schriftsteller. André<br />
Schiffrin starb am 1. Dezember in Paris.<br />
Peter Graf, 75. Kri -<br />
tikern galt der Ver -<br />
sicherungskaufmann<br />
und Gebrauchtwagen -<br />
händler aus Mannheim<br />
als Prototyp des<br />
ehrgeizigen Vaters,<br />
als cholerischer Schlei -<br />
fer, der sein Kind<br />
abschottete. Freunde<br />
und Familienmitglieder<br />
dagegen lobten den umsichtigen Aufbau<br />
der Karriere seiner Tochter Stefanie:<br />
Graf formte sie zu einer der besten Tennisspielerinnen<br />
der Geschichte. Als ihr<br />
Manager jedoch war er unbestritten überfordert.<br />
Er war ein Raffke, der sich Antritts-<br />
und Preisgelder oft bar auszahlen<br />
ließ. 1997 verurteilte ihn ein Gericht wegen<br />
Steuerhinterziehung in Höhe von<br />
12,3 Millionen D-Mark zu drei Jahren und<br />
neun Monaten Haft. Im April 1998 kam<br />
er vorzeitig frei und arbeitete wieder als<br />
Tennistrainer. Über das Verhältnis zu seiner<br />
Tochter sagte Graf: „Wir haben unser<br />
Seelenheil gefunden.“ Peter Graf starb<br />
am 30. November in Mannheim an Krebs.<br />
ROLF HAID / DPA<br />
Axel Hecht, 69. Sein Magazin, die Kunstzeitschrift<br />
„Art“, beschrieb er einmal so:<br />
„Wir sind das Gegenteil von Bayreuth.“<br />
Zur Begründung führte Hecht – Mit -<br />
initiator, Chefredakteur, später Herausgeber<br />
– an: „Wir zwingen unsere Leser<br />
nicht auf die Knie vor der Kunst.“ Der<br />
Germanist, der sich als Autodidakt in die<br />
bildende Kunst vertieft hatte und Kulturressortleiter<br />
beim „Stern“ war, erkannte<br />
die Marktlücke für ein Kunstmagazin.<br />
„Art“, 1979 erstmals erschienen, wurde<br />
das größte Europas. Axel Hecht starb am<br />
26. November in Hamburg.
Personalien<br />
Fahnenträger<br />
Der Dalai Lama, 78, fühlt sich von Mao Zedong ermächtigt, die tibetische Flagge<br />
zu zeigen. Das sagte der spirituelle Führer der Tibeter während eines Treffens<br />
mit japanischen Parlamentariern in Tokio. Die Botschaft richtete sich wohl eher<br />
an die Adresse der chinesischen Besatzungsmacht in Tibet. Seine Heiligkeit<br />
berichtete, Mao habe ihn 1954 bei einem Treffen gefragt, ob Tibet eine eigene<br />
Flagge habe, was er bejaht habe. Der chinesische Revolutionär habe geantwortet:<br />
„Gut, dann müssen Sie die neben der Nationalflagge hissen.“ Die Tibet-Flagge<br />
ist heute ein Symbol für den Freiheitskampf und wird als solche von den Chinesen<br />
abgelehnt. Der Dalai Lama gilt der Führung in Peking als „Spalter“ und<br />
„Wolf in Mönchs kutte“. In den vergangenen Wochen ist es wiederholt zu Gewalt<br />
von chinesischen Soldaten gegen Tibeter gekommen, die sich weigerten, die chinesische<br />
Flagge zu hissen.<br />
KEITH TSUJI / GETTY IMAGES<br />
Alte Liebe rostet nicht<br />
Er stammte aus <strong>Deutschland</strong> und war<br />
groß und durstig. Vor 30 Jahren waren<br />
sie unzertrennlich, er war quasi die<br />
erste Liebe der US-Schauspielerin<br />
Brooke Shields, heute 48. Die Rede ist<br />
von einem kastanienbraunen Mercedes<br />
SEC, Baujahr 1983, ihrem ersten<br />
eigenen Auto, mit dem sie in ihrer<br />
Heimat New Jersey zur Schule fuhr.<br />
Nachdem Shields nach Los Angeles<br />
gezogen war, hatte ihre Mutter den<br />
Wagen verkauft und Shields ihn wohl<br />
bald vergessen – bis eine Passantin in<br />
New York der Schauspielerin vor ein<br />
paar Wochen ein Foto zeigte. Darauf<br />
war ein alter Mercedes mit „Zu verkaufen“-Schild<br />
zu sehen, ergänzt um<br />
den Hinweis: „Das Auto gehörte früher<br />
Brooke Shields.“ Es war tatsächlich<br />
ihr Auto, wie sie an einem „I Love<br />
Gstaad“-Aufkleber erkannte. Über<br />
einen Mittelsmann kaufte die frühere<br />
Besitzerin den Wagen zurück, für<br />
5500 Dollar. Der Mercedes sei noch<br />
gut in Schuss, berichtete jetzt der<br />
„New Yorker“.<br />
GREGORIO T. BINUYA/EVERETT COLLE / ACTION PRESS<br />
162<br />
FAMEFLYNET / AGENCY PEOPLE IMAGE<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES<br />
Mäkelndes Model<br />
Das „New York“-Magazin hat sie gerade<br />
als „größten Popstar der Welt“ identifiziert.<br />
Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt,<br />
um an der Sängerin Taylor Swift, 23, her -<br />
umzumäkeln, wie das Victoria’s-Secret-<br />
Model Jessica Hart, 27, jetzt erfahren<br />
musste. Hart hatte die Frage, ob Swift<br />
wohl das Zeug für die Präsentation der<br />
Luxusdessous von Victoria’s Secret (VS)<br />
habe, verneint. Das Model war am Rande<br />
einer Modenschau angesprochen worden.<br />
Swift hatte dort einen Gesangsauftritt.<br />
Hart attestierte der Sängerin „mangelndes<br />
Selbstbewusstsein“ und „fehlende<br />
Erfahrung“, Eigenschaften, die für die<br />
fachgerechte Präsentation dieser Wäsche<br />
unerlässlich seien. Im Klartext: Die Musikerin<br />
hat nach Ansicht des Models so viel<br />
Sex-Appeal wie eine Gehwegplatte. Harts<br />
Offenheit hatte Folgen: Das VS-Management<br />
drohte öffentlich, sie zu feuern.
Happy Bunny<br />
Zusammen werden sie kommendes Jahr 100 Jahre alt: Supermodel Kate Moss, 39,<br />
und das Männermagazin „Playboy“. Die Britin feiert diesen Anlass im Häschenkostüm;<br />
sie ist, erstmals überhaupt im „Playboy“, auf dem Cover der Jubiläumsausgabe<br />
im Januar zu sehen und im Inneren des Hefts auch nackt zu bewundern.<br />
Von Feministinnen wird Moss kritisiert: Sie habe sich 25 Jahre lang selbstbewusst<br />
im Modezirkus behauptet, der Auftritt im „Playboy“ aber sei eine Enttäuschung.<br />
DER SPIEGEL 50/2013<br />
COURTESY MERT ALAS AND MARCUS PIGGOTT FOR PLAYBOY<br />
Peer Steinbrück, 66, letzter Kanzlerkandidat<br />
der SPD, hat keinen offiziellen<br />
Rückzugsort im Willy-Brandt-Haus<br />
mehr. Sein Büro in der fünften Etage<br />
der Parteizentrale wurde bereits an<br />
den ehemaligen thüringischen Wirtschaftsminister<br />
Matthias Machnig vergeben.<br />
Machnig, Manager der SPD-<br />
Bundestagswahlkampagnen 1998 und<br />
2002, soll den Europawahlkampf für<br />
EU-Parlamentspräsident Martin<br />
Schulz leiten. Den Posten in Thüringen<br />
hatte Machnig wegen einer Finanzaffäre<br />
aufgeben müssen. Eine<br />
Stärkung für lange Abende dürfte er<br />
bereits in einem der Schränke gefunden<br />
haben: Steinbrück hatte im Wahlkampf<br />
dort für Gäste einige Flaschen<br />
Wein deponiert und liegenlassen.<br />
Frank-Jürgen Weise, 62, Chef der Bundesagentur<br />
für Arbeit, will ab Januar<br />
eine TV-Imagekampagne für die<br />
Agentur beginnen. Das kündigt er in<br />
einer Weihnachtsbotschaft an seine<br />
gut 100000 Mitarbeiter an. Er schreibt,<br />
die Bundesagentur habe 2013 ihren<br />
Beitrag zu einem stabilen Arbeitsmarkt<br />
geleistet. „Vor allem haben wir<br />
viel gelernt und die Konsequenzen<br />
daraus gezogen“, so der Behördenchef.<br />
Der Bundesrechnungshof hatte<br />
der Agentur vorgeworfen, Bilanzen<br />
wegen überzogener und teilweise falscher<br />
Zielvorgaben zu schönen. Statt<br />
sich um die Menschen zu kümmern,<br />
seien die Agenturen vor allem damit<br />
beschäftigt, Vorgaben von Controllern<br />
zu erfüllen – teils mit Manipulationen,<br />
um im Wettbewerb gut auszusehen.<br />
Ab Februar 2014 will Weise seine Controller<br />
mit einem „so noch nie da gewesenen<br />
Programm intensiv schulen“.<br />
Anders Behring Breivik, 34, norwegischer<br />
Massenmörder, ist mit seinem<br />
Politologiestudium an der Osloer Universität<br />
vorerst gescheitert. Trotz internationaler<br />
Proteste hatte die Uni<br />
den Häftling des Hochsicherheitsgefängnisses<br />
Ila im September zum Fernstudium<br />
zugelassen. Nun teilte die<br />
Hochschule mit, dass der Rechtsextremist<br />
nicht an den drei obligatorischen<br />
Semesterabschlussprüfungen teilnehmen<br />
werde. „Schon vor einem Monat<br />
hat Breivik sich von den Prüfungen in<br />
Internationaler Politik und Politischer<br />
Theorie abgemeldet, und nun hat er<br />
auch den Test im Fach Öffentliche<br />
Politik und Verwaltung abgesagt“,<br />
zitierte die Osloer Tageszeitung „Verdens<br />
Gang“ den Institutsleiter. Ob der<br />
zu 21 Jahren Haft mit anschließender<br />
Sicherheitsverwahrung verurteilte<br />
Breivik damit seine Universitätslaufbahn<br />
endgültig beendet hat, ist unklar.<br />
163
Hohlspiegel<br />
Aus der „Mitteldeutschen Zeitung“: „An<br />
der Poststraße/Ecke Kurze Gasse hätten<br />
sich ihr zwei unbekannte männliche Männer<br />
von der Seite genähert und ihr dabei<br />
die Tasche samt Inhalt aus der Hand entrissen.“<br />
Aus dem „Tagesspiegel“<br />
Aus der „Emder Zeitung“: „Zwar könne<br />
nicht zwischen dem Laub von privaten<br />
und öffentlichen Bäumen unterschieden<br />
werden, aber dennoch müsse auf diesen<br />
Unterschied geachtet werden.“<br />
Aus einer Anzeige im „Konstanzer Anzeiger“<br />
Aus den „Nordbayerischen Nachrichten“:<br />
„Statt der bisher geschätzten Mehraus -<br />
gaben von 50 Millionen Euro soll der Bundeshaushalt<br />
nur um einen einstelligen Milliardenbetrag<br />
zusätzlich belastet werden.“<br />
Rückspiegel<br />
Zitate<br />
Die „Süddeutsche Zeitung“ zum Plan des<br />
SPIEGEL-Verlags, den Erscheinungstag<br />
des Nachrichten-Magazins zu ändern:<br />
Von Januar 2015 an soll das Blatt wieder<br />
samstags erscheinen. Diese Nachricht teilte<br />
der neue Chefredakteur Wolfgang<br />
Büchner am Montag den Ressortleitern<br />
von SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE in<br />
einer Konferenz mit. Für den Wechsel<br />
auf den Samstag gab es Applaus. Marktforscher<br />
wollen herausgefunden haben,<br />
dass der Samstag als Lesetag so beliebt<br />
ist, dass manche Abonnenten das Magazin<br />
fast eine Woche lang liegen lassen.<br />
Das „Handelsblatt“ über das „SPIEGEL-<br />
Gespräch – live an der Uni“ mit Siemens-<br />
Chef Joe Kaeser:<br />
Vor allem das Desaster beim Berliner Flughafen<br />
sieht Kaeser erstaunlich gelassen.<br />
„Das ist kein Problem, den braucht keiner<br />
im Augenblick.“ Wenn der Flughafen in<br />
fünf bis zehn Jahren eröffnet werde, reiche<br />
das auch noch. Hier sei „natürliche<br />
Gelassenheit“ gefragt. Weniger entspannt<br />
zeigte sich Kaeser bei der SPIEGEL-<br />
Veranstaltung ob der hausgemachten Probleme.<br />
Bei der Anbindung der Offshore-<br />
Windparks an das Stromnetz habe Siemens<br />
die falschen Partner gesucht. „Wir<br />
haben uns selbst überschätzt und bis zuletzt<br />
die Schuld bei anderen gesucht.“<br />
Noch kritischer sieht er die verspätete<br />
Auslieferung der neuen ICEs an die Bahn,<br />
eine „Megapeinlichkeit“. Das Ganze sei<br />
„ein bisschen wie das ,Warten auf Godot‘.<br />
Das Gute ist: Die Züge kommen“.<br />
Die „tageszeitung“ in einer Glosse über<br />
Rituale im politischen Berlin:<br />
Aus der „Heilbronner Stimme“<br />
Aus dem „Weser-Kurier“: „Die Sprecherin<br />
des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung<br />
sagte, der Komet sei<br />
ausschließlich morgens, kurz nach Sonnenuntergang,<br />
zu sehen.“<br />
Aus einer Werbung des Lebensmittel-<br />
Discounters Cool<br />
Aus der „Bild am Sonntag“: „Briefe von<br />
gefälschten Anwälten oder Notaren versprechen<br />
hohe Geldgewinne – gegen<br />
Bearbeitungsgebühr.“<br />
164<br />
Berlin hat seine eigene Presslufthammersprache<br />
mit immenser Lautstärke ent -<br />
wickelt, weil alle Ohropax im politischen<br />
Gehör haben. Brüllt also jemand „Standort<br />
<strong>Deutschland</strong> in Gefahr“ und hält sich<br />
dabei eine Pistole an die Schläfe, nimmt<br />
das politisch trainierte Gehirn etwas anderes<br />
wahr. Es hört: „Die Branche ist gerade<br />
über die unsicheren Rahmenbedingungen<br />
beunruhigt“ und sieht Sorgenfalten<br />
auf der Stirn … Nun ist es tatsächlich<br />
so, dass sich diese Art der Dauerempörung<br />
abnutzt und eben vor sich hinplätschert<br />
… Wenn wir jetzt schon das Ende<br />
der Geschichte erreicht hätten, würde es<br />
eben ewig so weitergehen. Bis sich die<br />
Sonne in 4,5 Milliarden Jahren aufbläht,<br />
die Erde in Gluthitze taucht und damit<br />
den Standort <strong>Deutschland</strong> ernsthaft gefährdet.<br />
Falls es den SPIEGEL bis dahin<br />
noch gibt, dann bekommt er die Story sicherlich<br />
exklusiv, und die „taz“ fragt empört,<br />
was an einer Apokalypse denn bitte<br />
noch links sein soll.<br />
DER SPIEGEL 50/2013