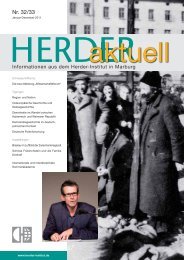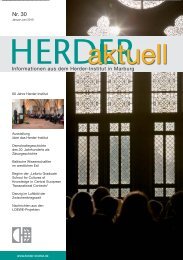Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20 ... - Herder-Institut
Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20 ... - Herder-Institut
Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20 ... - Herder-Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert
TAGUNGEN<br />
ZUR OSTMITTELEUROPA-FORSCHUNG<br />
Herausgegeben vom <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
10
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Aktuelle Forschungsprobleme<br />
Herausgegeben von<br />
HANS LEMBERG<br />
VERLAG HERDER-INSTITUT � MARBURG � <strong>20</strong>00
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation <strong>in</strong> der<br />
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische<br />
Daten s<strong>in</strong>d <strong>im</strong> Internet über<br />
abrufbar.<br />
© <strong>20</strong>00 by <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, 35037 Marburg, Gisonenweg 5-7<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Pr<strong>in</strong>ted <strong>in</strong> Germany<br />
Satz: <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, 35037 Marburg<br />
Druck <strong>und</strong> B<strong>in</strong>dung: Druckerei Herr, 35390 Gießen<br />
Umschlagbild aus: Die Ostgebiete des Deutschen Reiches, Würzburg 1957<br />
ISBN 3-87969-275-0
Inhalt<br />
E<strong>in</strong>führung........................................................................................................... 1<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>in</strong> der Forschung<br />
Hans-Jürgen K a r p : <strong>Grenzen</strong> – e<strong>in</strong> wissenschaftlicher Gegenstand............... 9<br />
Horst F ö r s t e r : <strong>Grenzen</strong> – e<strong>in</strong>e geographische Zwangsvorstellung?........... 19<br />
Peter K r ü g e r : Der Wandel der Funktion von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> <strong>in</strong>ternationalen<br />
System <strong>Ostmitteleuropa</strong>s <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert............................................. 39<br />
Peter H a s l i n g e r : Funktionspr<strong>in</strong>zip Staatsgrenze: Aspekte se<strong>in</strong>er<br />
Anwendbarkeit <strong>im</strong> Bereich der Osteuropaforschung........................................... 57<br />
Karl von D e l h a e s : Wirtschaftliche Großräume oder nationalstaatliche<br />
Parzellierung? Die ökonomischen Funktionen von <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>in</strong> den Jahrzehnten um die Mitte des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts ............................ 67<br />
Staaten <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>und</strong> ihre <strong>Grenzen</strong><br />
Edgar H ö s c h : Die „Balkanisierung“ – Vor- <strong>und</strong> Schreckbilder der Entstehung<br />
neuer Nationalstaaten ............................................................................. 79<br />
Robert L u f t : „Alte <strong>Grenzen</strong>“ <strong>und</strong> Kulturgeographie. Zur historischen<br />
Konstanz der <strong>Grenzen</strong> Böhmens <strong>und</strong> der böhmischen Länder............................ 95<br />
Włodz<strong>im</strong>ierz B o r o d z i e j : Die polnische Grenzdiskussion <strong>im</strong> Lande<br />
<strong>und</strong> <strong>im</strong> Exil (1939-1945) ..................................................................................... 137<br />
Gert von P i s t o h l k o r s : Historische <strong>und</strong> ethnische <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong><br />
baltischen Raum .................................................................................................. 149<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Menschen <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa<br />
Hans L e m b e r g : <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa<br />
– Genese <strong>und</strong> Wechselwirkungen........................................................................ 159<br />
s
Mathias N i e n d o r f : Die Grenze als Grauzone. Zum Problem der Perspektive<br />
<strong>in</strong> den deutsch-polnischen Beziehungen der Zwischenkriegszeit .........<br />
Hannelore B u r g e r : <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen – Bericht<br />
183<br />
über e<strong>in</strong> Projekt....................................................................................................<br />
Hanns H a a s : Dörfer an der Grenze – Bericht von e<strong>in</strong>em österreichisch-<br />
195<br />
tschechischen Forschungsprojekt ........................................................................ <strong>20</strong>9<br />
Hans L e m b e r g u.a.: Arbeitsbibliographie................................................... 247<br />
Verzeichnis der Autoren...................................................................................... 291<br />
sf
E<strong>in</strong>führung<br />
<strong>Grenzen</strong> haben <strong>in</strong> den neunziger Jahren e<strong>in</strong>e neue Aktualität gewonnen. Vier Jahrzehnte<br />
lang war das Staatensystem <strong>in</strong> Europa unter der Hegemonie der atomaren Supermächte<br />
USA <strong>und</strong> Sowjetunion stabil geblieben – e<strong>in</strong>e Veränderung war kaum<br />
mehr vorstellbar. Aber schon die Situation von 1945 hatte <strong>in</strong> gewissem S<strong>in</strong>ne auf<br />
e<strong>in</strong>en älteren Zustand zurückgegriffen <strong>und</strong> nach der <strong>im</strong> Zweiten Weltkrieg <strong>und</strong> seit<br />
1938 angestellten ephemeren „Neuordnung Europas“ von Hitlers <strong>und</strong> bald auch Stal<strong>in</strong>s<br />
Gnaden <strong>in</strong> großem Maße die nach dem Ersten Weltkrieg geschaffenen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong><br />
Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropa wiederhergestellt, von relativ wenigen, wenn auch signifikanten<br />
Änderungen an der polnischen Ost-, West- <strong>und</strong> Nordgrenze, <strong>im</strong> Baltikum<br />
<strong>und</strong> an e<strong>in</strong>igen anderen Stellen <strong>im</strong> östlichen Europa abgesehen.<br />
Gerade der gegen Ende der vierziger Jahre rasch gewachsene Antagonismus der<br />
beiden Weltlager bed<strong>in</strong>gte für die europäische Zone entlang des Eisernen Vorhangs<br />
e<strong>in</strong> striktes Status-quo-Denken, was die Verteilung der beiden E<strong>in</strong>fluß- <strong>und</strong> Herrschaftssphären<br />
<strong>in</strong> Ost <strong>und</strong> West, aber auch was die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong>nerhalb der „Lager“<br />
anlangte. Die sowjetische Völkerrechtswissenschaft versuchte sogar, wenn auch wohl<br />
vergeblich, die „Unverletzbarkeit von <strong>Grenzen</strong>“ als „neues Pr<strong>in</strong>zip“ <strong>in</strong>s Völkerrecht<br />
e<strong>in</strong>zuführen. 1 Selbst eklatante E<strong>in</strong>griffe wie die Niederschlagung des Aufstands <strong>in</strong><br />
Ungarn oder die Intervention <strong>in</strong> der C+SSR vermochten der Erhaltung des Status quo<br />
zuliebe nicht, die Westmächte zum E<strong>in</strong>greifen herauszufordern. Die Erhaltung der bestehenden<br />
Staatenordnung, auch <strong>und</strong> vor allem der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa, erschien als<br />
gleichbedeutend mit der Friedenswahrung. Das alles wurde anders, als an der Wende<br />
zu den neunziger Jahren die kommunistischen Reg<strong>im</strong>e <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> zusammenbrachen,<br />
zuletzt <strong>in</strong> der DDR <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Tschechoslowakei; <strong>in</strong> Polen, Jugoslawien<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der Sowjetunion selbst war die Erosion bereits <strong>im</strong> Gange.<br />
Die <strong>Grenzen</strong>-Frage wurde jetzt <strong>in</strong> zweierlei H<strong>in</strong>sicht aktuell: E<strong>in</strong>erseits ist gerade<br />
<strong>in</strong> diesem Augenblick <strong>und</strong> durch die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks ermöglichte<br />
E<strong>in</strong>igung Deutschlands die deutsch-polnische Grenze zum ersten Mal nach<br />
Kriegsende <strong>in</strong>ternational gesichert worden, andererseits aber entstanden an anderer<br />
1 LARISA IVANOVA VOLOVA: Nerus=<strong>im</strong>ost' granic – novyj pr<strong>in</strong>cip mez=dunarodnogo prava<br />
[Die Unverletzlichkeit der <strong>Grenzen</strong> als neues Völkerrechtspr<strong>in</strong>zip], Rostov 1987. – JERZY<br />
TYRANOWSKI: Zasada nienaruszałności granic w prawie mieçdzynarodowym [Der Gr<strong>und</strong>satz<br />
der Unverletzlichkeit von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Völkerrecht], Warszawa 1987 (Biblioteka spraw<br />
mieçdzynarodowych, 118).<br />
1
Stelle gerade <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa <strong>und</strong> <strong>in</strong> Südosteuropa neue <strong>Grenzen</strong>, oder,<br />
besser gesagt: ältere <strong>Grenzen</strong> gewannen neue Qualität. B<strong>in</strong>nengrenzen, wie e<strong>in</strong>ige<br />
<strong>Grenzen</strong> sozialistischer Sowjetrepubliken oder von Teilrepubliken Jugoslawiens oder<br />
der Grenze zwischen Tschechischer <strong>und</strong> Slowakischer Republik, wurden zu Außengrenzen<br />
von neuen Staaten, die es entweder vorher nur als unerfülltes Wunschziel nationaler<br />
Bewegungen oder <strong>im</strong> Höchstfall als kurzfristige Staatsgebilde aus Gnade von<br />
Hegemonialmächten gegeben hatte (die Ukra<strong>in</strong>e, Kroatien, die Slowakei). Nationale<br />
Befreiungsbewegungen artikulieren sogar den Anspruch, ehemals autonome Sowjetrepubliken<br />
der RSFSR oder autonome Prov<strong>in</strong>zen <strong>in</strong> Serbien zu souveränen Staaten<br />
zu erheben.<br />
Andererseits verloren Außengrenzen, vor allem <strong>im</strong> ehemaligen Ostblock, ihren<br />
Schrecken, allen voran die deutsch-deutsche Grenze bzw. die Berl<strong>in</strong>er Mauer, deren<br />
„Fall“ geradewegs zum Symbol der e<strong>in</strong>getretenen politischen Wende wurde. Schon<br />
e<strong>in</strong> Jahr nach dem Mauerfall war diese „verschw<strong>und</strong>ene“ Grenze <strong>im</strong> wiedervere<strong>in</strong>igten<br />
Deutschland zu e<strong>in</strong>er der oft nur noch auf Landkarten, <strong>im</strong>mer schwerer <strong>in</strong> der<br />
Landschaft selbst wiederzuf<strong>in</strong>denen Verwaltungsgrenzen zwischen B<strong>und</strong>esländern<br />
geworden. Daß gar die Reste der Berl<strong>in</strong>er Mauer zehn Jahre danach nur noch mit<br />
Mühe aufzuspüren s<strong>in</strong>d, wird bereits von der Tourismusbranche <strong>und</strong> von Denkmalpflegern<br />
beklagt.<br />
Mit diesen gegenläufigen Vorgängen kam gleichzeitig die Historizität von <strong>Grenzen</strong>,<br />
die ja <strong>in</strong> der ersten Jahrh<strong>und</strong>erthälfte so stark die Öffentlichkeit beschäftigt hatte,<br />
danach aber <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf ihre Wandelbarkeit nahezu vergessen worden war 2 , mit<br />
e<strong>in</strong>em Mal wieder zum Bewußtse<strong>in</strong>. Auf e<strong>in</strong>mal fanden wieder <strong>Grenzen</strong> erneut <strong>in</strong> der<br />
Alltagswelt Interesse, <strong>und</strong> sie erlebten <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der neunziger Jahre auch<br />
wissenschaftlich geradezu e<strong>in</strong>e Konjunktur.<br />
Als 1992 während e<strong>in</strong>er Beratung <strong>im</strong> Vorstand des J.G. <strong>Herder</strong>-Forschungsrates<br />
über mögliche Tagungsthemen Hugo Weczerka das Thema „<strong>Grenzen</strong>“ vorschlug, war<br />
das Thema sozusagen noch „neu“; gleichwohl erschien es sofort allen Beteiligten als<br />
attraktiv. Schon damals wurden Überlegungen angestellt, wie e<strong>in</strong>e solche Tagung<br />
aussehen könnte. Wegen der notwendigen Umorganisation von J. G. <strong>Herder</strong>-<br />
Forschungsrat <strong>und</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> 3 kam e<strong>in</strong>e solche Tagung jedoch erst <strong>im</strong> Frühjahr<br />
1995 zustande; sie wurde geme<strong>in</strong>sam vom umgestalteten <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> <strong>und</strong> vom<br />
2 Peter Hasl<strong>in</strong>ger spricht <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht von „fast gespenstischer Ruhe“, s. unten, S. 58.<br />
3 1992: Vorlage der Empfehlungen des Wissenschaftsrates: Wissenschaftsrat. Empfehlungen<br />
<strong>und</strong> Stellungnahmen 1992, Köln 1993, S. 317–368; 1992 <strong>und</strong> 1993: Mitgliederversammlungen<br />
zur Beratung der Umgestaltungen; Gründung des neuen <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s e.V.;<br />
1994: Übergabetagung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s vom bisherigen Träger, dem <strong>Herder</strong>-<br />
Forschungsrat, auf den neuen Trägervere<strong>in</strong>, <strong>in</strong> dem der J. G. <strong>Herder</strong>-Forschungsrat e<strong>in</strong>es<br />
von elf korporativen Mitgliedern ist; s. dazu den Tagungsband: Aspekte der Zusammenarbeit<br />
<strong>in</strong> der <strong>Ostmitteleuropa</strong>forschung. Tagung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s <strong>und</strong> des J.G. <strong>Herder</strong>-<br />
Forschungsrates am 22./23. Februar 1994, hrsg. von HUGO WECZERKA, Marburg 1996 (Tagungen<br />
zur <strong>Ostmitteleuropa</strong>-Forschung, 1).<br />
2
<strong>Herder</strong>-Forschungsrat veranstaltet; die Fachkommission Zeitgeschichte des <strong>Herder</strong>-<br />
Forschungsrates widmete ihr richtungweisende Vorüberlegungen. 4<br />
Die Referate dieser vom 29. bis 31. März 1995 abgehaltenen <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären<br />
<strong>und</strong> – heute schon e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit – <strong>in</strong>ternationalen Tagung mußten lange<br />
auf ihre Publikation warten, weil e<strong>in</strong>ige Texte erst mit Verzögerung zu beschaffen<br />
waren, dann wieder e<strong>in</strong>e neuerlich anstehende <strong>und</strong> <strong>in</strong>zwischen mit gutem Ergebnis<br />
abgelaufene Evaluation des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s andere Prioritäten erforderte, <strong>und</strong><br />
schließlich waren Berichte über laufende Projekte, die 1995 ganz am Ende der Tagung,<br />
sozusagen <strong>in</strong> marg<strong>in</strong>e vorgetragenen wurden, durch deren Fortentwicklung<br />
<strong>in</strong>zwischen so weit überholt, daß den damaligen Referenten Gelegenheit gegeben<br />
werden mußte, ihre Texte dem neuen Projektstand zu adaptieren. Das ist - bisweilen<br />
unter erheblicher Erweiterung - geschehen, <strong>und</strong> zu guter Letzt ist es noch gelungen,<br />
zwei weitere, während der Tagung nicht vorgetragene Projektberichte <strong>in</strong> das Gesamtmanuskript<br />
mit e<strong>in</strong>zubeziehen, um das Bild dessen, was das Spektrum gegenwärtiger<br />
Arbeitsvorhaben über <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> ausmacht, wenigstens e<strong>in</strong>igermaßen<br />
breit, wenn auch ke<strong>in</strong>esfalls vollständig erfassen zu können. Es ist zu hoffen,<br />
daß die Leser <strong>und</strong> nicht zuletzt diejenigen Autoren, die schon früh ihre<br />
Manuskripte zur Verfügung gestellt hatten, die Verzögerung verzeihen.<br />
Das Thema „<strong>Grenzen</strong>“ hat seither an Attraktivität gewonnen; zahlreiche Tagungen<br />
<strong>und</strong> Projekte haben sich <strong>in</strong>zwischen damit beschäftigt, weitere s<strong>in</strong>d vorgesehen. 5 Die<br />
<strong>im</strong> vorliegenden Band abgedruckten Referate der Marburger Tagung von 1995 haben<br />
also Aussicht, mit anderen Tagungsbänden zusammen künftig e<strong>in</strong>e Vorstellung<br />
darüber zu vermitteln, was <strong>in</strong> den neunziger Jahren des zu Ende gehenden Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
über <strong>Grenzen</strong> gedacht <strong>und</strong> geforscht worden ist. 6<br />
4 Im Vorfeld ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Sitzung der Fachkommission Zeitgeschichte des <strong>Herder</strong>-<br />
Forschungsrates – <strong>in</strong>sbesondere auf Anregung von Rolf Ahmann – e<strong>in</strong>e Panel-Struktur für<br />
die Tagung entwickelt worden; wegen der Kürze der für die Vorbereitung zur Verfügung<br />
stehenden Zeit wurde jedoch der traditionellen Tagungsform der Vorzug gegeben.<br />
5 Z.B.: „<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>“ (Nida/Nidden, Litauen, August 1996), „<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong><br />
Grenzräume <strong>in</strong> der deutschen <strong>und</strong> polnischen Geschichte. XXVIII. deutsch-polnische<br />
Schulbuchkonferenz“ (Frankfurt/Oder Juni 1998), „<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzregionen <strong>in</strong> Südosteuropa<br />
vom ausgehenden <strong>19.</strong> bis zum Ende des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts“ (Tüb<strong>in</strong>gen, November<br />
1998); Projektentwicklung „Grenzregionen <strong>im</strong> Osten der EU. Strukturen - Voraussetzungen<br />
– Perspektiven” (Philipps-Universität Marburg, um 1997); „Granice i pogranicza. Historia<br />
codziennos;ci i dos;wiadczen; [<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzgebiete. Alltags- <strong>und</strong> Erfahrungsgeschichte]“<br />
(Bia¬ystok Oktober 1998) usw.; s. auch die Beiträge von Hannelore Burger,<br />
Hanns Haas, Peter Hasl<strong>in</strong>ger <strong>und</strong> Mathias Niendorf <strong>im</strong> vorliegenden Bande.<br />
6 Fast gleichzeitig ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e parallele Publikation: Grenze <strong>im</strong> Kopf. Beiträge zur<br />
Geschichte der Grenze <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, hrsg. von PETER HASLINGER, Frankfurt am<br />
Ma<strong>in</strong> u.a. 1999.<br />
3
Im folgenden soll der Aufbau des vorliegenden Bandes skizziert werden. In e<strong>in</strong>em<br />
ersten Block wird der wissenschaftliche Zugang zum Problem <strong>Grenzen</strong> allgeme<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
unter dem besonderen Blickw<strong>in</strong>kel der <strong>Ostmitteleuropa</strong>forschung aus der Sicht verschiedener<br />
Wissenschaftsdiszipl<strong>in</strong>en <strong>in</strong> den Blick gefaßt:<br />
Hans-Jürgen Karp (Marburg) schlägt e<strong>in</strong>en weiten Bogen mit exemplarischen<br />
Schlaglichtern auf die Schlüsselrolle des <strong>Grenzen</strong>-Begriffs <strong>in</strong> der Theologie (Paul Tillich<br />
stellte rückblickend se<strong>in</strong> Leben unter das Leitmotiv der Grenze 7 ), <strong>in</strong> der Sprachgeschichte,<br />
auch unter siedlungs- <strong>und</strong> sozialgeschichtlichem Aspekt seit dem Mittelalter<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf die literarische Gestaltung von „Grenzland“-Situationen.<br />
Horst Förster (Tüb<strong>in</strong>gen) n<strong>im</strong>mt sich der <strong>Grenzen</strong> aus der Sicht der Geographie<br />
an, derjenigen Wissenschaft, die sich seit dem späten <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert des <strong>Grenzen</strong>-<br />
Problems mit besonderem Nachdruck <strong>und</strong> <strong>in</strong> verschiedenen Wahrnehmungsbereichen<br />
(politische <strong>und</strong> Kulturgeographie, Regionalforschung, Geopolitik usw.) bemächtigt<br />
hat.<br />
Der Beitrag von Peter Krüger (Marburg) bildete <strong>in</strong> der Tagung den öffentlichen<br />
E<strong>in</strong>leitungsvortrag. Er packt das Thema der <strong>Grenzen</strong> aus der Perspektive der <strong>in</strong>ternationalen<br />
Beziehungen an. Dabei spielen Staatsgrenzen verständlicherweise e<strong>in</strong>e<br />
herausragende Rolle; Peter Krüger wendet sich aber darüber h<strong>in</strong>aus dem „Frontier“-<br />
Phänomen zu, das über den früheren Ansatz von Dietrich Gerhard <strong>und</strong> die Turnersche<br />
These h<strong>in</strong>aus gerade <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> bis <strong>in</strong>s <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert verfolgt werden kann.<br />
Der Verteidigung von <strong>Grenzen</strong> durch Machtmittel gegenüber wird die wirkliche<br />
Sicherung von <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em funktionierenden, kooperativen <strong>in</strong>ternationalen System<br />
erblickt.<br />
Verschiedene Theorieansätze aus den der Geschichte benachbarten Diszipl<strong>in</strong>en<br />
faßt Peter Hasl<strong>in</strong>ger (Freiburg) zusammen <strong>und</strong> skizziert auf ihrem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>im</strong> Zusammenhang mit e<strong>in</strong>em Freiburger Projekt Hypothesen <strong>und</strong> Forschungsfelder,<br />
die <strong>in</strong> der <strong>Ostmitteleuropa</strong>- <strong>und</strong> Osteuropaforschung allgeme<strong>in</strong> <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf das<br />
<strong>Grenzen</strong>-Problem als weiterführend ersche<strong>in</strong>en.<br />
Aus ökonomischer Sicht untersucht <strong>im</strong> letzten Beitrag des ersten Teils Karl von<br />
Delhaes (Marburg) die ökonomischen Funktionen von <strong>Grenzen</strong> anhand der Frage<br />
staatlicher E<strong>in</strong>wirkungen auf den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
In e<strong>in</strong>er zweiten Gruppe von Beiträgen werden <strong>in</strong> unterschiedlichen Schnittebenen<br />
von Süden nach Norden die Länder <strong>Ostmitteleuropa</strong>s <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf Grenzprobleme<br />
beleuchtet: Zunächst erörtert Edgar Hösch (München) anhand der Staatsentstehungen<br />
<strong>im</strong> südöstlichen Europa <strong>im</strong> späteren <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert das, was <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schmähenden<br />
Publizistik nach dem Ersten Weltkrieg als „Balkanisierung“ bezeichnet wurde, wenn<br />
nämlich die Parzellierung größerer Staaten nach dem nationalen Pr<strong>in</strong>zip an jenen<br />
7 Dieses Lebensgefühl sche<strong>in</strong>t <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert häufiger vorhanden gewesen zu se<strong>in</strong>, vgl.<br />
die Memoiren von EUGEN LEMBERG: E<strong>in</strong> Leben <strong>in</strong> Grenzzonen <strong>und</strong> Ambivalenzen. Er<strong>in</strong>nerungen,<br />
niedergeschrieben 1972, mit e<strong>in</strong>em Nachtrag von 1975, <strong>in</strong>: Lebensbilder zur<br />
Geschichte der böhmischen Länder, Band 5: Eugen Lemberg 1903–1976, hrsg. von FERDI-<br />
NAND SEIBT, München 1986, S. 133–278.<br />
4
früheren Vorgang <strong>in</strong> Südosteuropa er<strong>in</strong>nerte. Grenzfragen waren <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d – nicht nur<br />
auf dem Balkan – e<strong>in</strong>gespannt <strong>in</strong> die Konkurrenz von nationalen Bewegungen <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>ternationalem Mächtesystem.<br />
Robert Luft (München) legt das Schicksal der „alten <strong>Grenzen</strong>“ Böhmens exemplarisch<br />
dar, <strong>in</strong>dem er zunächst sie Stück für Stück umschreitet <strong>und</strong> ihre historische<br />
Tiefe auslotet <strong>und</strong> dann die Frage nach ihrer Def<strong>in</strong>ition stellt: Es s<strong>in</strong>d weniger natürliche<br />
<strong>Grenzen</strong> als solche ger<strong>in</strong>gerer Verdichtung. E<strong>in</strong> besonderes Augenmerk richtet<br />
er auf die Praktikabilität ethnischer <strong>Grenzen</strong> – e<strong>in</strong>e für Böhmen besonders kritische<br />
Frage.<br />
Wenn die Probleme der Folgen des Münchner Abkommens für Robert Luft e<strong>in</strong>en<br />
Prüfste<strong>in</strong> für das Verhältnis von Nationalitäten <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> bilden, so schließt sich<br />
daran die nahezu gleichzeitige polnische Diskussion „<strong>im</strong> Lande <strong>und</strong> <strong>im</strong> Exil“ an, die<br />
für die Zeit des Zweiten Weltkrieges W¬odz<strong>im</strong>ierz Borodziej (Warschau) nachzeichnet<br />
<strong>und</strong> dabei vor allem historische <strong>und</strong> sozusagen geopolitische Argumente als richtungweisend<br />
herausstellt. Er ordnet die Diskussion <strong>in</strong> das traditionelle <strong>und</strong> aktuelle<br />
Panorama der polnischen Politik <strong>und</strong> der sich rasch wandelnden Konstellationen <strong>im</strong><br />
alliierten Lager <strong>im</strong> Laufe des Krieges e<strong>in</strong> <strong>und</strong> diagnostiziert die polnische „Westverschiebung“<br />
als e<strong>in</strong> Stück Souveränitätsfrage.<br />
Die nördlichste Position <strong>in</strong> diesem Themenblock beleuchtet Gert von Pistohlkors<br />
(Gött<strong>in</strong>gen), der für die drei baltischen Staaten das Bed<strong>in</strong>gungsfeld von historischen<br />
<strong>und</strong> ethnischen Grenzbildungsfaktoren ausmißt <strong>und</strong> betont, daß vor diesen die völkerrechtliche<br />
Frage maßgebend für Stabilität von <strong>Grenzen</strong> bleibt.<br />
„<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Menschen <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa“ ist der Titel der dritten<br />
Gruppe von Referaten. Dar<strong>in</strong> wird zunächst e<strong>in</strong>leitend von Hans Lemberg (Marburg)<br />
die Genese der Rolle <strong>und</strong> der ideologischen Begründung von <strong>Grenzen</strong> bis zum Nationalstaat<br />
des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts verfolgt <strong>und</strong> die <strong>in</strong> Nationalstaaten üblichen<br />
Lösungsmöglichkeiten für die grenzbed<strong>in</strong>gten nationalen M<strong>in</strong>derheiten behandelt, allem<br />
voran der Bevölkerungstransfer. Wie das Zusammenleben solcher M<strong>in</strong>derheiten<br />
<strong>und</strong> ihre Konflikte dies- <strong>und</strong> jenseits e<strong>in</strong>es relativ kle<strong>in</strong>räumigen Abschnitts e<strong>in</strong>er<br />
neuen Grenze aussehen konnten, erfährt man von Mathias Niendorf (Warschau).<br />
Schließlich werden zwei umfangreiche, <strong>in</strong> Österreich behe<strong>im</strong>atete Projekte<br />
vorgestellt: Hannelore Burger (Wien) referiert Ansätze <strong>und</strong> Ergebnisse e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>ternationalen<br />
Projekts zu „<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen“ <strong>im</strong> Habsburgerreich vor<br />
der Mitte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>und</strong> über die e<strong>in</strong>es österreichischtschech(oslowak)ischen<br />
Projekts berichtet Hanns Haas (Salzburg), <strong>in</strong> dem es um die<br />
langsame Nationa-<br />
lisierung von „Dörfern an der Grenze“ g<strong>in</strong>g.<br />
Den Abschluß des Bandes bildet e<strong>in</strong>e „Arbeitsbibliographie“ zum Thema <strong>Grenzen</strong>,<br />
die <strong>im</strong> Laufe von mehreren Jahren entstanden ist <strong>und</strong> an der neben dem Herausgeber<br />
verschiedene Koautoren mitgearbeitet haben. Sie hat nicht nur zur Vorbereitung<br />
der genannten Tagung gedient, sondern ist auch für Lehrveranstaltungen des Herausgebers<br />
genutzt worden <strong>und</strong> wurde an Interessenten <strong>in</strong> verschiedenen Entwicklungsstadien<br />
verteilt. Schließlich wurden wichtige Titel aus den Beiträgen dieses Bandes <strong>in</strong><br />
5
die Arbeitsbibliographie aufgenommen. Es ist zu hoffen, daß die Liste dem e<strong>in</strong>en oder<br />
der anderen, die sich mit <strong>Grenzen</strong>problemen beschäftigen, stellenweise neue Anregungen<br />
geben kann.<br />
Schließlich sei noch darauf h<strong>in</strong>gewiesen, daß während der Tagung, deren Ergebnisse<br />
<strong>im</strong> vorliegenden Band präsentiert werden, <strong>im</strong> Tagungsraum e<strong>in</strong>e von Wolfgang<br />
Kreft gestaltete Ausstellung von Karten aus dem Bestand des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s gezeigt<br />
wurde. 8<br />
Herrn Dr. Hans-Werner Rautenberg <strong>und</strong> dem Team der Veröffentlichungsabteilung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s ist für Geduld <strong>und</strong> k<strong>und</strong>ige redaktionelle Betreuung des<br />
Bandes ausdrücklich zu danken.<br />
Lectori salutem!<br />
Marburg an der Lahn, <strong>im</strong> Herbst 1999 Hans Lemberg<br />
8 WOLFGANG KREFT: <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>im</strong><br />
Kartenbild. [Ausstellungskatalog über 27 Karten], Marburg 1995. DERS.: Das östliche Mitteleuropa<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Bild thematischer Karten,<br />
Leipzig 1996.<br />
6
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>in</strong> der Forschung
<strong>Grenzen</strong> – e<strong>in</strong> Gegenstand wissenschaftlicher Forschung<br />
von<br />
Hans-Jürgen K a r p<br />
Die Universalität der Fragestellung, der hier mit e<strong>in</strong>igen Reflexionen nachgegangen<br />
werden soll, macht e<strong>in</strong>e Beschränkung notwendig, ermöglicht aber zugleich, die<br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen Aspekte exemplarisch an ausgewählten Beispielen zu behandeln. Die<br />
Auswahl beschränkt sich auf drei wissenschaftliche Diszipl<strong>in</strong>en: Die Grenze als wissenschaftlicher<br />
Gegenstand wird an e<strong>in</strong>igen Forschungen aus der Sprachgeschichte,<br />
der Sozialgeschichte <strong>und</strong> der Literaturgeschichte vorgestellt werden. In ihrer allgeme<strong>in</strong>sten<br />
Form ist die Frage nach Wesen <strong>und</strong> Bedeutung von Grenze philosophischer<br />
Art. Daher sollen am Anfang die Aussagen zweier bedeutender Religionsphilosophen<br />
des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts – e<strong>in</strong>es katholischen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es evangelischen – stehen, die sich<br />
<strong>in</strong> ihrem Denken mit dem Phänomen der Grenze beschäftigt haben.<br />
I<br />
Der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte († 1983) hat sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>leitenden<br />
Dies-Vortrag des W<strong>in</strong>ters 1957/58 mit der Grenze <strong>im</strong> Leben der Wissenschaften<br />
befaßt. 1 Se<strong>in</strong>e Überlegungen beg<strong>in</strong>nen mit der Frage nach den <strong>Grenzen</strong> zwischen<br />
den e<strong>in</strong>zelnen Wissenschaften, die <strong>in</strong> den regionalen Ordnungen des Seienden gründen,<br />
nach den <strong>Grenzen</strong> der Wissenschaft selber <strong>und</strong> dem, was noch nicht oder nicht<br />
mehr Wissenschaft ist, d. h. nach den <strong>Grenzen</strong> der Wissenschaften, die sie von ihren<br />
Voraussetzungen abgrenzen, <strong>und</strong> nach ihren <strong>Grenzen</strong> zum noch nicht Gewußten <strong>und</strong><br />
zum Unwißbaren schlechth<strong>in</strong>. In e<strong>in</strong>em zweiten Schritt fragt Welte nach dem Wesen<br />
der Grenze selbst. „Grenze waltet (...) zunächst als Position, d. h. als Best<strong>im</strong>mung, sie<br />
waltet auch als Negation, d. h. als Unterscheidung“, jedoch „als e<strong>in</strong>e Unterscheidung,<br />
die überall zugleich vere<strong>in</strong>t“. 2 „Die Grenze, die die Bereiche trennt, ist auch das ihnen<br />
beide Geme<strong>in</strong>same. (...) Die Grenze waltet, <strong>in</strong>dem sie zusammenhält, verknüpft <strong>und</strong><br />
benachbart, was sie zugleich trennt. (...) Es liegt am scheidenden Wesen der Grenze<br />
1 BERNHARD WELTE: Die Grenze <strong>im</strong> Leben der Wissenschaft, <strong>in</strong>: Bedeutung <strong>und</strong> Funktion<br />
der Grenze <strong>in</strong> den Wissenschaften, Freiburg i. Br. 1958 (Freiburger Dies Universitatis,<br />
Band 6), S. 9-<strong>19.</strong><br />
2 Ebenda, S. 13.<br />
9
selbst, daß dieses mit gehe<strong>im</strong>nisvoller Notwendigkeit unverbrüchlich auch e<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dendes<br />
ist.“ Die Frage nach dem, was die Grenze ist, „frägt schließlich <strong>in</strong> das Gehe<strong>im</strong>nis<br />
des Se<strong>in</strong>s selbst h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>.“ 3<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> dieser dialektischen Def<strong>in</strong>ition des Wesens der Grenze wird<br />
verständlich, daß für Paul Tillich (+ 1965) „der Ort der Grenze (...) der für die Erkenntnis<br />
fruchtbare Ort“ war, wie er <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>leitung zu se<strong>in</strong>em Frühwerk „Religiöse<br />
Verwirklichung“ schrieb, <strong>in</strong> dem er sich mit dem Grenzgebiet von Kirche <strong>und</strong> Gesellschaft,<br />
von Religion <strong>und</strong> Kultur, von Heiligem <strong>und</strong> Profanem, von Theologie <strong>und</strong> Philosophie<br />
beschäftigte. 4 Tillich, der se<strong>in</strong>e wissenschaftliche Laufbahn 1924 <strong>in</strong> Marburg<br />
als außerordentlicher Professor für systematische Theologie <strong>und</strong> Religionsphilosophie<br />
begann, emigrierte 1933 nach Amerika <strong>und</strong> führte sich dort mit e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Schrift<br />
e<strong>in</strong>, der er den Titel „On the Bo<strong>und</strong>ary-L<strong>in</strong>e“ gab. Dar<strong>in</strong> charakterisiert er <strong>in</strong> zwölf<br />
Kapiteln se<strong>in</strong> Leben <strong>und</strong> Denken. 5 In der E<strong>in</strong>leitung zu dieser autobiographischen<br />
Skizze betont er, daß der Begriff der Grenze geeignet sei, Symbol für se<strong>in</strong>e ganze persönliche<br />
<strong>und</strong> geistige Entwicklung zu se<strong>in</strong>. 6<br />
Aus Anlaß der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Tillich<br />
hielt der Preisträger 1962 e<strong>in</strong>e Rede mit dem Titel „<strong>Grenzen</strong>“. 7 In ihr thematisierte<br />
er „das Dase<strong>in</strong> auf der Grenze, die Grenzsituation“, die „der Durchgang“ ist, „den<br />
jeder e<strong>in</strong>zelne gehen muß <strong>und</strong> den die Völker gehen müssen, um zum Frieden zu gelangen.<br />
Denn der Friede ist das Stehen <strong>im</strong> Übergreifenden, das <strong>im</strong> Überschreiten <strong>und</strong><br />
Rücküberschreiten der Grenze gesucht wird. Nur wer Anteil an den beiden Seiten e<strong>in</strong>er<br />
Grenzl<strong>in</strong>ie hat, kann dem Übergreifenden <strong>und</strong> damit dem Frieden dienen, nicht,<br />
wer sich <strong>in</strong> der momentanen Ruhe e<strong>in</strong>es fest Begrenzten sicher fühlt“. 8 In der Angst,<br />
die eigenen <strong>Grenzen</strong> zu überschreiten <strong>und</strong> dem Fremden zu begegnen, sieht Tillich<br />
die „Ursache e<strong>in</strong>es das Fremde hassenden Fanatismus. Man will die Grenze, die man<br />
nicht überschreiten konnte, auslöschen, <strong>in</strong>dem man das Fremde zerstört“. 9 „Aber die<br />
Grenze ist nicht nur das, was überschritten, sie ist auch das, was verwirklicht werden<br />
muß. Grenze gehört zur Form, <strong>und</strong> Form macht jedes D<strong>in</strong>g zu dem, was es ist.“ 10 Es<br />
geht darum, daß Personen, nicht nur als e<strong>in</strong>zelne, sondern auch als Glieder von nationalen,<br />
kulturellen <strong>und</strong> religiösen Geme<strong>in</strong>schaften, daß Völker ihre Identität <strong>und</strong> damit<br />
ihre Wesensgrenzen f<strong>in</strong>den. Identität <strong>und</strong> Wesensgrenze e<strong>in</strong>es Volkes drücken sich <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>em Berufungsbewußtse<strong>in</strong> aus. „Friede ist möglich, wo Macht <strong>im</strong> Dienst e<strong>in</strong>es<br />
3<br />
Ebenda, S. 14.<br />
4<br />
PAUL TILLICH: Religiöse Verwirklichung, Berl<strong>in</strong> 1930, hier S. 11.<br />
5<br />
Deutsch unter dem Titel: Auf der Grenze, <strong>in</strong>: PAUL TILLICH: Auf der Grenze. E<strong>in</strong>e Auswahl<br />
aus dem Lebenswerk. Mit e<strong>in</strong>em Vorwort von HEINZ ZAHRNT zur Taschenbuchausgabe<br />
(Serie Piper, Band 593), München, Zürich 1987, S. 13-68.<br />
6<br />
Ebenda, S. 13.<br />
7<br />
PAUL TILLICH: <strong>Grenzen</strong>. Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen<br />
Buchhandels am 23. September 1962 <strong>in</strong> der Paulskirche <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong>, Stuttgart<br />
1962.<br />
8<br />
Ebenda, S. 4.<br />
9<br />
Ebenda, S. 7.<br />
10<br />
Ebenda, S. 9.<br />
10
echten Berufungsbewußtse<strong>in</strong>s steht <strong>und</strong> das Wissen um die Wesensgrenze die Wirklichkeitsgrenzen<br />
<strong>in</strong> ihrer Wichtigkeit herabsetzt.“ 11<br />
Zu der Theologie <strong>und</strong> Religiosität Tillichs, der zeit se<strong>in</strong>es Lebens e<strong>in</strong> Grenzgänger<br />
zwischen Theologie <strong>und</strong> Philosophie, zwischen der Theologie <strong>und</strong> allen anderen Lebensgebieten<br />
gewesen, aber niemals e<strong>in</strong> Überläufer geworden ist 12 , wird gleichwohl<br />
kritisch angemerkt, daß sie durch e<strong>in</strong>en starken, ja gefährlichen Impuls gekennzeichnet<br />
sei, „den Abstand zwischen Gott <strong>und</strong> Welt zu verwischen.“ 13<br />
II<br />
Die Sprachwissenschaft hat sich seit langem mit dem Ursprung des deutschen Wortes<br />
Grenze befaßt. G. A. Tzschoppe <strong>und</strong> G. A. Stenzel haben es 1832 für e<strong>in</strong> <strong>in</strong> Schlesien<br />
althe<strong>im</strong>isches Wort gehalten. Se<strong>in</strong>e Herkunft von dem „allen Slaven geläufigen Wort“<br />
granitza ist zuerst von Jakob Gr<strong>im</strong>m 1865 erkannt worden, nur war noch nicht klar,<br />
wann, wo zuerst <strong>und</strong> warum es entlehnt wurde. 14<br />
Für die Beantwortung dieser Fragen hat <strong>in</strong>zwischen die sprachwissenschaftliche<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung mit der Aufnahme des Gesamtbestandes slawischer Wörter <strong>in</strong><br />
der deutschen Schriftsprache die Voraussetzungen geschaffen. 15 Hans-Werner Nicklis<br />
bezeichnet Granitze, Grenitze, Grenze als „das bedeutendste polnische Lehnwort der<br />
deutschen Sprache, zu dem sich (unter wenigen anderen) noch Kaschemme (= Wirtshaus)<br />
h<strong>in</strong>zugesellt“. Nach se<strong>in</strong>er Auffassung s<strong>in</strong>d „geme<strong>in</strong>sames Tr<strong>in</strong>ken <strong>und</strong><br />
,Granitzen setzen‘ als noch komplementäre Sphären e<strong>in</strong>es gemitteten Alltags zu def<strong>in</strong>ieren“.<br />
16<br />
Nach me<strong>in</strong>en eigenen tastenden Versuchen, die Rezeption des Wortes granica <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>en möglichen Zusammenhang mit e<strong>in</strong>er neuen rationalen Grenzidee <strong>im</strong> Osten zu<br />
br<strong>in</strong>gen 17 , hat auch Herbert Kolb die Vermutung geäußert, „daß das Wort damals e<strong>in</strong>e<br />
Bedeutungsnuance gehabt habe, die mit den Bezeichnungsmitteln der aufnehmenden<br />
Sprache, vorab Deutsch <strong>und</strong> Late<strong>in</strong>, nicht zureichend oder nicht prägnant wiedergegeben<br />
werden konnte“. 18<br />
11<br />
Ebenda, S. 11 f., hier S. 12.<br />
12<br />
HEINZ ZAHRNT <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vorwort zu TILLICH: Auf der Grenze (wie Anm. 5), S. 3.<br />
13<br />
Ebenda, S. 9.<br />
14<br />
HERBERT KOLB: Zur Frühgeschichte des Wortes ,Grenze‘, <strong>in</strong>: Archiv für das Studium der<br />
neueren Sprachen <strong>und</strong> Literaturen, Bd. 226, 141 (1989), S. 344-356, hier S. 345 f., Anm. 5.<br />
15<br />
E<strong>in</strong>zelnachweise ebenda, S. 344, Anm. 1.<br />
16<br />
HANS-WERNER NICKLIS: Von der ,Grenitze‘ zur Grenze. Die Grenzidee des late<strong>in</strong>ischen<br />
Mittelalters (6. – 15. Jhdt.), <strong>in</strong>: Blätter für deutsche Landesgeschichte 128 (1992), S. 1-27,<br />
hier S. 22.<br />
17<br />
HANS-JÜRGEN KARP: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> während des Mittelalters, Köln, Wien<br />
1972 (Forschungen <strong>und</strong> Quellen zur Kirchen- <strong>und</strong> Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd.<br />
9).<br />
18<br />
KOLB (wie Anm. 14), S. 346.<br />
11
Etymologisch läßt sich granica unmittelbar auf polnisch gran zurückführen, das<br />
etwas Hervorragendes, Kantiges, Scharfes oder auch Ecke <strong>und</strong> W<strong>in</strong>kel bedeutet. 19<br />
Granica ist dann das Zeichen, die Gestalt, die durch e<strong>in</strong>e Spitze bzw. Kante charakterisiert<br />
ist. Das kann entweder e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kerbung <strong>in</strong> Baumstämmen oder auch e<strong>in</strong> Erd-<br />
oder Holzhaufen se<strong>in</strong>, dessen Form sich nach oben verjüngt oder der an den Ecken<br />
e<strong>in</strong>es Gebiets aufgeschüttet ist. Das Wort hat aber auch – etwa <strong>im</strong> Bulgarischen – die<br />
Bedeutung von Eiche, weshalb ihm e<strong>in</strong>e „bisemantische“ Struktur zugeschrieben<br />
wird. <strong>20</strong><br />
In den Grenzbeschreibungen der Urk<strong>und</strong>en des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts bezeichneten<br />
granicia oder granicies – also die lat<strong>in</strong>isierten Formen des polnischen granica – <strong>im</strong><br />
S<strong>in</strong>gular e<strong>in</strong>en geographischen oder topographischen Punkt am Außenrand e<strong>in</strong>es abgemessenen<br />
Gr<strong>und</strong>stücks, meistens e<strong>in</strong>en Baum, <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e Eiche, die durch<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kerbung besonders gekennzeichnet ist. Durch e<strong>in</strong>e geradl<strong>in</strong>ig zu denkende<br />
Verb<strong>in</strong>dung zwischen diesen Punkten ergibt sich e<strong>in</strong>e l<strong>in</strong>eare Außenabmessung der<br />
betreffenden Landfläche, die gewöhnlich durch den Plural graniciae ausgedrückt<br />
wird. Die Bedeutung des Wortes entwickelt sich sehr schnell von Grenzzeichen über<br />
den gekennzeichneten Grenzbaum <strong>und</strong> Grenzpunkt zur Grenzl<strong>in</strong>ie.<br />
Bei diesem Bef<strong>und</strong> ist die Schlußfolgerung Kolbs e<strong>in</strong>igermaßen überraschend. Er<br />
stellt fest, „die Außenabmessung von Landbesitz durch eigens dazu markierte Bäume“<br />
sei „e<strong>in</strong> vom Altland her seit alters vertrauter (...) Brauch“, <strong>und</strong> erklärt die Entlehnung<br />
von granica „nicht zuletzt“ aus dem „Zusammentreffen e<strong>in</strong>er bekannten Sache<br />
mit e<strong>in</strong>em fremden Wort <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er mehrsprachigen Umwelt“, <strong>in</strong> der dieses Wort<br />
„den Vorzug hatte, für die Beteiligten auf beiden Seiten e<strong>in</strong>deutig zu se<strong>in</strong>“. 21<br />
Geradezu entgegengesetzt argumentiert Hans-Werner Nickels <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Habilitationsvortrag,<br />
<strong>in</strong> dem er auf dem H<strong>in</strong>terg<strong>und</strong> der Grenzidee des late<strong>in</strong>ischen Mittelalters<br />
die Entwicklung „von der ,Grenitze‘ zur Grenze“ untersucht. Er stellt die geomorphologische<br />
Struktur des Altreichs den grenzenlosen dünnbesiedelten Heide- <strong>und</strong><br />
Waldflächen des Ostens gegenüber <strong>und</strong> macht geltend, daß die gesamteuropäische<br />
Ostbewegung mit ihrer „planmäßigen, mit geometrischer Akribie vorstoßenden Landerschließung“<br />
geradezu „e<strong>in</strong>es neuen sprachlichen Gefäßes bedurfte, um die massive<br />
Kollision von Natur- <strong>und</strong> Kulturraum begrifflich fassen zu können. 22 In der ostelbischen<br />
Slavia wurde der moderne Gedanke der l<strong>in</strong>earen Grenze geboren. 23 Im Zuge<br />
der Ostkolonisation erreichte der Begriff der Grenze „e<strong>in</strong>e qualitativ neue Ebene (...),<br />
ohne aber noch den Reifegrad e<strong>in</strong>er nationalstaatlichen oder völkerrechtlichen Abgrenzungspraxis<br />
nach sich zu ziehen“. 24 ,Grenitzen zeichnen‘ <strong>und</strong> ,Grenitzen setzen‘<br />
wird zu e<strong>in</strong>em „Leitbegriff der Ostkolonisation“. 25 Im Gegensatz zum germanischen<br />
19 KARP (wie Anm. 17), S. 147 f.<br />
<strong>20</strong> KOLB (wie Anm. 14), S. 349 f.<br />
21 Ebenda, S. 355.<br />
22 NICKLIS (wie Anm. 16), S. 14.<br />
23 Ebenda, S. 17.<br />
24 Ebenda, S. <strong>19.</strong><br />
25 Ebenda, S. 22.<br />
12
Grenzumgang, der Grenzpunkte summiere, gehe es be<strong>im</strong> slawischen bzw. germanoslawischen<br />
Grenzumgang darum, L<strong>in</strong>earität zu begründen. 26 „Da sich die Regionen<br />
östlich der Elbe zu idealtypischen Gebieten von Grenzzeichen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er rationalen<br />
Grenzidee schlechth<strong>in</strong> entwickelt hatten, mußte auch der Begriff für Grenzmal <strong>und</strong><br />
für die l<strong>in</strong>eare, formale slawische Grenzauffassung endlich von der europäischen Slavia<br />
geborgt werden“. 27 Die Zuordnung der Idee l<strong>in</strong>earer Grenzziehung zur „ethnospezifischen<br />
Gedankenwelt der slawischen Völker“ n<strong>im</strong>mt der Autor allerd<strong>in</strong>gs doch<br />
nur sehr vorsichtig vor. Angedeutet wird <strong>im</strong>merh<strong>in</strong> die besondere Bedeutung der rationalen<br />
Grenzidee für den Deutschen Orden <strong>und</strong> se<strong>in</strong>en Territorialstaat 28 .<br />
III<br />
Die weitere Wort- <strong>und</strong> Begriffsgeschichte von „Grenze“ ist bisher noch unzureichend<br />
erforscht. Hans Medick hat dazu – auch <strong>im</strong> Vergleich zum Französischen („frontière“<br />
<strong>und</strong> „l<strong>im</strong>ite“ ), bei dem sich Parallelen <strong>und</strong> Eigentümlichkeiten zeigen, – e<strong>in</strong>ige Anmerkungen<br />
gemacht. 29 Er stellt zu Recht fest, daß die Begriffsgeschichte der Grenze<br />
„nur e<strong>in</strong> Bestandteil e<strong>in</strong>er umfassenden sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise<br />
ist“ 30 , um die es ihm <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie geht.<br />
In der Gegenwart konstatiert Medick bei der Beschäftigung mit der Frage von<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzziehungen e<strong>in</strong>e Verlagerung des Interesses „von den politischmilitärischen<br />
Abgrenzungen auf kulturelle <strong>und</strong> ethnische Ausgrenzungen“. 31 Er stellt<br />
die überkommene E<strong>in</strong>engung des Grenzbegriffs auf e<strong>in</strong> staatliches Territorium oder<br />
gar auf naturräumliche Vorgegebenheiten <strong>in</strong> Frage <strong>und</strong> plädiert für e<strong>in</strong>e Erweiterung<br />
durch E<strong>in</strong>beziehung symbolisch-kultureller <strong>und</strong> sozialer Elemente der Grenzziehung,<br />
Abgrenzung <strong>und</strong> Grenzbeschreibung. Als Leitgedanke für e<strong>in</strong>e von ihm angeregte<br />
vergleichende Sozialgeschichte von Grenzbildungsprozessen dient ihm e<strong>in</strong>e Formulierung<br />
des Soziologen Georg S<strong>im</strong>mel aus dem Jahre 1908: „Die Grenze ist nicht e<strong>in</strong>e<br />
räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern e<strong>in</strong>e soziologische Tatsache,<br />
die sich räumlich formt.“ 32 Zur Illustration se<strong>in</strong>es Anliegens verweist Medick <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em kurzen Forschungsbericht auf hierzulande weitgehend unbekannt gebliebene<br />
26<br />
Ebenda, S. <strong>20</strong>.<br />
27<br />
Ebenda, S. 21.<br />
28<br />
Ebenda, S. <strong>20</strong>.<br />
29<br />
HANS MEDICK: Zur politischen Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Neuzeit Europas, <strong>in</strong>:<br />
SOWI. Sozialwissenschaftliche Informationen <strong>20</strong> (1991), Heft 3 (= Sonderheft <strong>Grenzen</strong>),<br />
S. 157-163.<br />
30<br />
DERS.: Grenzziehungen <strong>und</strong> die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur Begriffsgeschichte<br />
<strong>und</strong> politischen Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Frühen Neuzeit, <strong>in</strong>: Grenzland.<br />
Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, hrsg. von BERND WEISBROD,<br />
Hannover 1993, S. 195-211, hier S. <strong>20</strong>3.<br />
31<br />
Ebenda, S. 195.<br />
32<br />
GEORG SIMMEL: Soziologische Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung<br />
(1908), 6. Aufl. Berl<strong>in</strong> 1983, S. 467.<br />
13
Arbeiten wie die des deutsch-amerikanischen Historikers Dietrich Gerhard, des Gründers<br />
der französischen Annales-Schule Lucien Febvre sowie des amerikanischen Historikers<br />
Peter Sahl<strong>in</strong>s.<br />
Der gr<strong>und</strong>legende Aufsatz von Dietrich Gerhard aus dem Jahre 1961 setzte sich<br />
mit der klassischen Frontier-Hypothese des amerikanischen Historikers Frederick<br />
Jackson Turner von 19<strong>20</strong> ause<strong>in</strong>ander 33 , die e<strong>in</strong>en Zusammenhang der offenen Siedlungsgrenzen<br />
<strong>im</strong> Westen Nordamerikas mit der Entstehung e<strong>in</strong>er offenen Gesellschaft<br />
behauptete, e<strong>in</strong>em „Zusammenhang von Siedlungs- <strong>und</strong> Grenzbildungsprozessen <strong>und</strong><br />
der Ausbildung der sozialen Strukturen, der Mentalität <strong>und</strong> der politischen Kultur e<strong>in</strong>er<br />
Gesellschaft“. 34 Gerhard vergleicht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Untersuchung die Verhältnisse <strong>in</strong><br />
Nordamerika mit denen <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>und</strong> Rußland <strong>und</strong> entdeckt dort <strong>im</strong> Unterschied<br />
zu den „offenen, wandernden Grenzzonen freier Siedler des amerikanischen<br />
Westens“ stärker herrschaftlich angeleitete Siedlungsbewegungen <strong>und</strong> Grenzbildungsprozesse.<br />
35<br />
Lucien Febvres Ansatz 36 läßt sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er apodiktischen Formulierung zusammenfassen:<br />
„Nicht von der Grenze, der frontière selbst, muß man ausgehen, um sie zu<br />
erforschen, sondern vom Staat.“ 37 Personengruppen <strong>im</strong> Dienste des werdenden Territorialstaats<br />
führen e<strong>in</strong>erseits se<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong> auf naturräumliche Vorgegebenheiten zurück,<br />
andererseits betonen sie die „Machbarkeit“ des Raumes durch den Staat als die<br />
grenzziehende Instanz – Grenzziehung also durch Herstellung des politisch-sozialen<br />
Raumes. Breitere Bevölkerungsgruppen s<strong>in</strong>d daran erst später <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>es Mentalitätswandels<br />
beteiligt, durch den sie die Grenzvorstellungen des modernen militarisierten<br />
Nationalismus ver<strong>in</strong>nerlicht haben. 38<br />
Dieser Ansatz – daß also <strong>im</strong> Prozeß der neuzeitlichen Staats- <strong>und</strong> Nationsbildung<br />
der Staat <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e <strong>Institut</strong>ionen die entscheidende oder gar alle<strong>in</strong>ige Rolle bei der<br />
Grenzsetzung spielen – wurde <strong>in</strong> den letzten Jahren durch e<strong>in</strong>e Reihe von Arbeiten,<br />
<strong>in</strong>sbesondere durch e<strong>in</strong>e Modellstudie von Peter Sahl<strong>in</strong>s 39 , <strong>in</strong> Frage gestellt. Sahl<strong>in</strong>s<br />
<strong>in</strong>terpretiert den Grenzbildungsprozeß zwischen Frankreich <strong>und</strong> Spanien <strong>in</strong> den Pyrenäen<br />
vom 17. bis zum <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert als e<strong>in</strong>en zweibahnigen Vorgang, nämlich ei-<br />
33 DIETRICH GERHARD: Neusiedlung <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelles Erbe. Zum Problem von Turners<br />
„Frontier“. E<strong>in</strong>e vergleichende Geschichtsbetrachtung, <strong>in</strong>: E<strong>in</strong> Leben aus freier Mitte. Beiträge<br />
zur Geschichtsforschung. Festschrift für Ulrich Noack, Gött<strong>in</strong>gen 1961, S. 255-295,<br />
auch <strong>in</strong>: DERS.: Alte <strong>und</strong> Neue Welt <strong>in</strong> vergleichender Geschichtsbetrachtung, Gött<strong>in</strong>gen<br />
1962, S. 108-140. – FREDERICK JACKSON TURNER: The Significance of the Frontier <strong>in</strong><br />
American History (1893), <strong>in</strong>: DERS.: The Frontier <strong>in</strong> American History, New York 19<strong>20</strong><br />
(Repr<strong>in</strong>t 1985), S. 1-38.<br />
34 MEDICK: Grenzziehungen (wie Anm. 29), S. 197.<br />
35 Ebenda.<br />
36 LUCIEN FEBVRE: „Frontière“ – Wort <strong>und</strong> Bedeutung (1928), <strong>in</strong>: DERS.: Das Gewissen des<br />
Historikers, Berl<strong>in</strong> 1988, S. 27-38.<br />
37 Ebenda, S. 32, zitiert nach MEDICK: Grenzziehungen (wie Anm. 29), S. 199, Anm. 10.<br />
38 MEDICK: Grenzziehungen (wie Anm. 29), S.198 f.<br />
39 PETER SAHLINS: Bo<strong>und</strong>aries. The Mak<strong>in</strong>g of France and Spa<strong>in</strong> <strong>in</strong> the Pyrenees, Berkeley<br />
14<br />
1989.
nerseits als Durchsetzung e<strong>in</strong>es vom Staat zentral gesteuerten Prozesses, andererseits<br />
als Geltendmachung spezifisch lokaler Interessen <strong>und</strong> Wahrung der lokalen Identität<br />
der Gesellschaften an der Grenze. Se<strong>in</strong>e Perspektive ist die „auf die Grenze“ <strong>und</strong> „von<br />
der Grenze her“. Im Ergebnis ersche<strong>in</strong>t die Grenze „als e<strong>in</strong> eigentümliches soziales,<br />
kulturelles <strong>und</strong> politisches Gebilde (...), das die Gesellschaften <strong>und</strong> Staaten vone<strong>in</strong>ander<br />
trennt <strong>und</strong> doch zugleich ihren Austausch fördert“. 40 So entstanden Staat <strong>und</strong> nationale<br />
Identität eher durch den alltäglichen Streit <strong>und</strong> Austausch an der Grenze als<br />
durch Aktionen <strong>in</strong> den hauptstädtischen Zentren der Macht. Solche vielgestaltigen<br />
„offenen“ <strong>Grenzen</strong>, die es auch <strong>in</strong> den Territorien des frühneuzeitlichen Deutschland<br />
gab, behielten ihre befreiende Wirkung bis weit <strong>in</strong>s <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert. 41<br />
IV<br />
„Offene“ <strong>Grenzen</strong> s<strong>in</strong>d gewiß etwas anderes als „verwischte“ <strong>Grenzen</strong>, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
literaturgeschichtlichen Arbeit thematisiert worden s<strong>in</strong>d. Die Kulturlandschaft Galizien<br />
mit ihren nationalen, konfessionellen <strong>und</strong> kulturellen Abgrenzungen <strong>in</strong> der zweiten<br />
Hälfte des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> zu Beg<strong>in</strong>n des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts ist Gegenstand e<strong>in</strong>er literaturwissenschaftlichen<br />
Abhandlung, mit der die Krakauer Germanist<strong>in</strong> Maria Klańska 1991<br />
hervorgetreten ist. 42 Es handelt sich um e<strong>in</strong>e Analyse deutschsprachiger Prosatexte<br />
aus der Zeit von 1846 <strong>und</strong> 1914, <strong>in</strong> denen <strong>im</strong> Gegensatz zu dem idealisierten Galizienbild,<br />
das <strong>im</strong> polnischen Bewußtse<strong>in</strong> lebendig ist, e<strong>in</strong> negatives Gegenbild der Prov<strong>in</strong>z<br />
zutage tritt, das von sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Mißständen <strong>und</strong> nationalen<br />
Zwistigkeiten geprägt ist. Zwei Jahre später legte die Autor<strong>in</strong> an Hand literarischer<br />
Texte von Joseph Roth e<strong>in</strong>en Aufsatz über Lemberg, die mult<strong>in</strong>ationale Landeshauptstadt,<br />
vor, die sie <strong>im</strong> Titel als „Stadt der verwischten <strong>Grenzen</strong>“ bezeichnet. 43 Die vielgestaltigen<br />
<strong>Grenzen</strong> s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs nicht oder jedenfalls nur <strong>in</strong>direkt Gegenstand der<br />
literturwissenschaftlichen Interpretation. Das Leitmotiv der „verwischten <strong>Grenzen</strong>“<br />
stammt von Roth selbst, der 1924 <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Reportage „Lemberg, die Stadt“ 44 den genius<br />
loci der ehemaligen Hauptstadt se<strong>in</strong>er galizischen He<strong>im</strong>at festzuhalten versucht<br />
<strong>und</strong> sie eben als „Stadt der verwischten <strong>Grenzen</strong>“ gerühmt hat. E<strong>in</strong>e Mischung von<br />
nüchterner Ironie <strong>und</strong> naiv-k<strong>in</strong>dlicher Anhänglichkeit ist bezeichnend für se<strong>in</strong>e Optik,<br />
die sich etwa <strong>in</strong> der folgenden Anekdote spiegelt. „In Lemberg ereignete es sich, daß<br />
e<strong>in</strong> Lastwagenpferd durch e<strong>in</strong> offenes Kanalgitter fiel. Die Kanalöffnungen <strong>in</strong> Lemberg<br />
s<strong>in</strong>d nicht größer, die Pferde nicht kle<strong>in</strong>er als <strong>in</strong> der ganzen europäischen Welt.<br />
40<br />
MEDICK: Grenzziehungen (wie Anm. 29), S. <strong>20</strong>6.<br />
41<br />
Ebenda, S. <strong>20</strong>7.<br />
42<br />
MARIA KLAÔSKA: Problemfeld Galizien. Zur Thematisierung e<strong>in</strong>es nationalen <strong>und</strong> politisch-sozialen<br />
Phänomens <strong>in</strong> deutschsprachiger Prosa 1846-1914, Wien, Köln u.a. 1991.<br />
43<br />
DIES.: Lemberg. Die „Stadt der verwischten <strong>Grenzen</strong>“, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Germanistik N. F.<br />
III – 1 (1993), S. 33-47.<br />
44<br />
Veröffentlicht <strong>in</strong> der „Frankfurter Zeitung“ vom 22. 11. 1924, vgl. JOSEPH ROTH: Werke,<br />
hrsg. von HERMANN KESTEN, Köln 1975-1976, Bd. IV, S. 840.<br />
15
Aber Gott läßt W<strong>und</strong>er geschehen. Jeden Tag läßt Gott W<strong>und</strong>er geschehen. Jeden<br />
Sonntag übertrifft er sich selbst.“ 45<br />
In se<strong>in</strong>en publizistischen Texten wie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en „galizischen“ Werken gestalten sich<br />
„Roths K<strong>in</strong>dheitser<strong>in</strong>nerungen, die Sehnsucht nach dem Vielvölkerstaat, die Erlebnisse<br />
aus dem Krieg <strong>und</strong> die Verzweiflung über den allumfassenden Antisemitismus <strong>in</strong><br />
Deutschland zu e<strong>in</strong>em Mosaik der ostgalizischen Landschaft <strong>und</strong> ihrer Menschen“ 46 .<br />
E<strong>in</strong> wichtiges Element ist die jüdisch-slawische Nachbarschaft mit ihrer Spannung<br />
zwischen Fremdheit <strong>und</strong> Vertrautheit. Das Grenzgebiet zu Rußland erhält e<strong>in</strong>en ambivalenten<br />
Symbolgehalt: Bestandteil der idyllischen Landschaft s<strong>in</strong>d auch die Sümpfe.<br />
„Ke<strong>in</strong>er war so kräftig wie der Sumpf. Niemand konnte der Grenze standhalten“,<br />
heißt es <strong>im</strong> „Radetzkymarsch“. 47 Die Nähe zur russischen Grenze <strong>und</strong> die Ferne zur<br />
Hauptstadt Wien „verliehen dem Leben an der Grenze die Funktion e<strong>in</strong>er Sammell<strong>in</strong>se.“<br />
48 E<strong>in</strong>ige Gestalten sehen die kommenden Ereignisse voraus. Kritisch merkt Maria<br />
Klańska an: „Der allem Nationalen abholde <strong>und</strong> von der ungestillten Sehnsucht der<br />
ewigen Wanderer getriebene Roth konnte sich nicht <strong>in</strong> die Gedankenwelt jener nach<br />
123 Jahren der Teilung die Auferstehung ihres Staates freudig feiernden Polen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>versetzen.“<br />
49 Man wird vielleicht h<strong>in</strong>zufügen können, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Wunsch nach<br />
Harmonie „verwischten“ sich die real existierenden <strong>Grenzen</strong>.<br />
„Verwischte <strong>Grenzen</strong>“ – das Leitmotiv zeigt, obwohl die Autor<strong>in</strong> es nur als Chiffre<br />
für das friedliche, heitere Zusammenleben verschiedener ethnischer <strong>und</strong> konfessioneller<br />
Gruppen <strong>in</strong> Lemberg zu verstehen sche<strong>in</strong>t, me<strong>in</strong>es Erachtens doch eher den<br />
ambivalenten Charakter der Grenze <strong>im</strong> Verständnis Roths. Dem Begriff haftet gar etwas<br />
Negatives, die Realitäten Negierendes an, wenn doch „Grenze“- wie oben gesagt<br />
– per def<strong>in</strong>itionem „zusammenhält, verknüpft <strong>und</strong> benachbart, was sie zugleich<br />
trennt“. 50 Wird der dialektische Charakter der Grenze „verwischt“, verliert sie ihre<br />
ordnende Funktion.<br />
Während Maria Kla¹ska e<strong>in</strong>en Aspekt von Grenze am konkreten Beispiel Galiziens<br />
<strong>und</strong> der Stadt Lemberg <strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage von Texten Joseph Roths <strong>in</strong> den<br />
Blick n<strong>im</strong>mt, hat der Posener Germanist Hubert Or—owski <strong>im</strong> gleichen Jahr das Thema<br />
gr<strong>und</strong>sätzlicher <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>er behandelt. 51 Se<strong>in</strong> Beitrag befaßt sich mit der<br />
kurzlebigen Karriere des Begriffs der deutschen Grenzlandliteratur nach dem Ersten<br />
Weltkrieg, mit ihrer trennenden <strong>und</strong> spaltenden Funktion <strong>und</strong> ihrer politischen In-<br />
45<br />
JOSEPH ROTH: Land <strong>und</strong> Leute, <strong>in</strong>: DERS.: Werke, Bd. IV, S. 835, zitiert nach KLAÔSKA,<br />
Lemberg (wie Anm. 43), S. 40.<br />
46<br />
Ebenda, S. 41.<br />
47<br />
JOSEPH ROTH: Radetzkymarsch (Romane I), Köln 1984, S. 467, zitiert nach KLAÔSKA,<br />
Lemberg (wie Anm. 43), S. 43.<br />
48<br />
Ebenda.<br />
49<br />
Ebenda, S. 45.<br />
50<br />
Siehe oben S. 2 f. mit Anm. 3.<br />
51<br />
HUBERT OR¡OWSKI: Grenzlandliteratur. Zur Karriere e<strong>in</strong>es Begriffs <strong>und</strong> Phänomens, <strong>in</strong>:<br />
He<strong>im</strong>at <strong>und</strong> He<strong>im</strong>atliteratur <strong>in</strong> Vergangenheit <strong>und</strong> Gegenwart, hrsg. von DEMS., Instytut Filologii<br />
Germa¹skiej UAM, Pozna¹ 1993, S. 9-18.<br />
16
strumentalisierung. Se<strong>in</strong>en Ausführungen stellt der Autor als Motto e<strong>in</strong> Zitat von<br />
Horst Bienek voran: „Die Grenze ist es, die den Menschen prägt. Ganz tief, bis <strong>in</strong>s<br />
Unbewußte.“<br />
Die deutsche Grenzlandliteratur war noch bis <strong>in</strong> die Zeit nach 1945 h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> von e<strong>in</strong>er<br />
„axiologischen Asymmetrie“ best<strong>im</strong>mt, von den asymmetrischen Gegenbegriffen<br />
„Pole – Deutscher“, „Polentum – Deutschtum“, „Slaven – Germanen“. 52 Ihr stellt Or-<br />
—owski die „neue Grenzlandliteratur“ gegenüber, die es, gleichgültig, ob sie so oder<br />
wie auch <strong>im</strong>mer bezeichnet wird, <strong>in</strong> der „doppeldeutschen“ Nachkriegsliteratur <strong>und</strong><br />
auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Nationalliteraturen <strong>Ostmitteleuropa</strong>s seit e<strong>in</strong>iger Zeit gibt. Es ist die<br />
He<strong>im</strong>atliteratur (verlorener) Grenzlandschaften, die die durch die Grenzverschiebungen<br />
<strong>und</strong> Vertreibungen der Bevölkerung „verlorene He<strong>im</strong>at“ literarisch gestaltet. Diese<br />
neue Grenzlandliteratur hat gerade <strong>in</strong> der deutschen <strong>und</strong> der polnischen Literatur<br />
e<strong>in</strong>en zentralen Stellenwert erreicht. In ihr wird „die bisher best<strong>im</strong>mende Asymmetrie<br />
der ethnisch-ethisch-zivilisatorischen Legit<strong>im</strong>ierung“ zugunsten e<strong>in</strong>er „kulturanthropologisch<br />
verstandenen Nachbarschaft der Ethnien“ 53 aufgegeben. Möglich<br />
geworden ist diese – relative späte – Neuorientierung durch die – <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne des oben<br />
zitierten Mottos – „distanzierende Erfahrung der ,prägenden Grenze‘“. 54<br />
*<br />
Die hier vorgelegten wenigen Beispiele dürften nicht nur gezeigt haben, welche bedeutende<br />
Rolle <strong>Grenzen</strong> als Forschungsgegenstand verschiedener wissenschaftlicher<br />
Diszipl<strong>in</strong>en spielen. Sie lassen darüber h<strong>in</strong>aus erkennen, daß der Begriff der Grenze<br />
als universale anthropologische Kategorie verstanden werden muß.<br />
52 Ebenda, S. 14.<br />
53 Ebenda.<br />
54 Ebenda, S. 15.<br />
17
<strong>Grenzen</strong> – e<strong>in</strong>e geographische Zwangsvorstellung?<br />
von<br />
Horst Förster<br />
1. Zur Problematisierung: Von der „Geographie der natürlichen <strong>Grenzen</strong>“ zur<br />
„Geography of Border Landscapes“<br />
In se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>führung zu dem Sammelband „Deutschlands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte“<br />
spannt Alexander Demandt unter der Frage „Was heißt Grenze“ e<strong>in</strong>en weiten wissenschaftsgeschichtlichen<br />
Bogen von der „historia sacra“ bis h<strong>in</strong> zu modernen, verhaltenstheoretischen<br />
Interpretationen der Grenz- <strong>und</strong> Abgrenzungsproblematik. Er kommt dabei<br />
zu dem Schluß, daß die „Grenze“ zweifellos e<strong>in</strong> „historisches Thema von Rang“<br />
sei. Aber er fragt zugleich: Ist die „Grenze“ nicht eher e<strong>in</strong> Thema für den Geographen<br />
als für den Historiker?<br />
Zitat: „Wenn die Geschichte sich <strong>in</strong> den Bahnen bewegt, die ihr der Boden vorschreibt,<br />
wenn e<strong>in</strong>e Politik um so erfolgreicher ist, je genauer sie die Erde studiert, auf<br />
der sie sich abspielt, wenn die politischen <strong>Grenzen</strong> e<strong>in</strong>es Landes nicht eher stabil werden<br />
als sie die natürlichen L<strong>in</strong>ien erreicht haben, dann liegt der Schlüssel zu ihrem<br />
Verständnis <strong>in</strong> der Hand des Geographen“ (Demandt, 1993, S. 22).<br />
Ohne diese Übertragung e<strong>in</strong>er „Schlüsselfunktion“ aus der wissenschaftlichen<br />
Nachbarschaft überbewerten zu wollen oder die Rhetorik der Frage zu prüfen, zeigt bereits<br />
e<strong>in</strong> flüchtiger Blick <strong>in</strong> die Diszipl<strong>in</strong>geschichte der Geographie, daß dieses um die<br />
Mitte des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts aufgekommene „Konzept der natürlichen <strong>Grenzen</strong>“<br />
nicht nur wissenschaftliche Irrwege verursachte (vgl. Schultz, 1993), sondern<br />
auch das Feld öffnete für e<strong>in</strong>e Politische Geographie, die nach 1933 <strong>in</strong> das Fahrwasser<br />
nationalsozialistischer Machtpolitik geriet.<br />
In e<strong>in</strong>em bereits 1969 von der Akademie für Raumforschung publizierten Referateband<br />
„Grenzbildende Faktoren <strong>in</strong> der Geschichte“ leitete der damalige Vizepräsident<br />
der Kommission der Europäischen Geme<strong>in</strong>schaft, F. Hellwig, se<strong>in</strong>en Beitrag über die<br />
„Überw<strong>in</strong>dung von <strong>Grenzen</strong>“ mit e<strong>in</strong>er Anekdote e<strong>in</strong>. Im Frühjahr 1564 versuchten<br />
zwei Landvermesser <strong>im</strong> Auftrag des Herzogs Karl III. von Lothr<strong>in</strong>gen, e<strong>in</strong>e Landkarte<br />
des Herzogtums zu erstellen, um durch e<strong>in</strong>e kartographische Aufnahme klare Verhältnisse<br />
über den Herrschaftsbereich zu ermöglichen. Doch die Auftragnehmer versagten.<br />
Aus e<strong>in</strong>er Karte, die zwanzig Jahre später auf der Gr<strong>und</strong>lage dieser Aufnahmen veröffentlicht<br />
wurde, war ersichtlich, daß die beiden Landvermesser mehr <strong>in</strong>teressiert waren<br />
an e<strong>in</strong>er Erfassung <strong>und</strong> Darstellung der Topographie von Flüssen <strong>und</strong> Seen, von Gebir-<br />
19
gen <strong>und</strong> Ebenen, von Wälder <strong>und</strong> Siedlungen – modern gesprochen, an der „geographischen<br />
Substanz“ – als an der eigentlichen Aufgabe, der Festlegung von <strong>Grenzen</strong>. Bei<br />
den Landvermessern handelte es sich um G. Mercator <strong>und</strong> se<strong>in</strong>en Sohn. Wenige Jahre<br />
später präsentierte Mercator der erstaunten Fachwelt se<strong>in</strong>e Weltkarte.<br />
Diese beiden Textbelege habe ich aus verschiedenen Gründen vorangestellt. Zum<br />
e<strong>in</strong>en kennzeichnet das von Demandt angedeutete Konzept von den „natürlichen <strong>Grenzen</strong><br />
oder L<strong>in</strong>ien“ tatsächlich den Beg<strong>in</strong>n <strong>und</strong> das von Hellwig bereits vor mehr als 25<br />
Jahren angedeutete Problem von der „Überw<strong>in</strong>dung der <strong>Grenzen</strong>“ den aktuellen Stand<br />
kulturgeographischer Forschungen zum „Phänomen Grenze“. Zum anderen zeigt sich<br />
<strong>in</strong> der Arbeitsweise Mercators nicht nur e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>problem geographischer Methodologie,<br />
sondern auch die Gr<strong>und</strong>frage der „Grenzproblematik“: nämlich die Frage nach<br />
dem Maßstab.<br />
Unmittelbar vor dem Systemzusammenbruch <strong>in</strong> Ostmittel- <strong>und</strong> Osteuropa, vor der<br />
entscheidenden Zäsur <strong>in</strong> den politischen, ökonomischen <strong>und</strong> sozialen Entwicklungsprozessen<br />
Europas, die selbstverständlich auch für unser Forschungsanliegen von großer<br />
Bedeutung wurde, legten Dennis Rumley <strong>und</strong> Julian V. M<strong>in</strong>ghi unter dem Titel<br />
„The Geography of Border Landscapes“ e<strong>in</strong>en wissenschaftlich gewichtigen Beitrag<br />
vor. Auf der Gr<strong>und</strong>lage von zwölf <strong>in</strong>ternationalen Fallstudien wurde hier erstmals der<br />
Versuch unternommen, Ziele <strong>und</strong> Konzepte e<strong>in</strong>er geographischen Grenzraumforschung<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er modernen, sozialgeographisch orientierten Politischen Geographie zu<br />
entwickeln.<br />
Zwischen diesen beiden hier angedeuteten Forschungsansätzen möchte ich me<strong>in</strong>en<br />
folgenden Diskussionsbeitrag zur Thematik „Grenze <strong>und</strong> Grenzraum als Gegenstand<br />
der geographischen Forschung“ ansiedeln.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der übergroßen Fülle an Literatur zu diesem Forschungsfeld <strong>und</strong> <strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick<br />
auf den mir zur Verfügung stehenden Raum möchte ich zwei Schwerpunkte setzen:<br />
1. Unter e<strong>in</strong>em ersten Punkt soll <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sehr kurzen diszipl<strong>in</strong>historischen Exkurs e<strong>in</strong>e<br />
Annäherung an das Phänomen „Grenze“ als e<strong>in</strong>e ansche<strong>in</strong>end „geographische<br />
Zwangsvorstellung“ (Hans Lemberg) zwischen Politischer Geographie <strong>und</strong> Geopolitik<br />
versucht werden,<br />
2. <strong>und</strong> unter e<strong>in</strong>em zweiten Punkt möchte ich e<strong>in</strong>ige Forschungsfelder <strong>und</strong> Forschungsansätze<br />
vorstellen, die <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit den aktuellen raumstrukturellen<br />
Veränderungsprozessen <strong>in</strong> Europa zu sehen s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> sich thematisch<br />
zwischen angewandter Politischer Geographie <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er neuen „Geopolitik“ e<strong>in</strong>ordnen<br />
lassen.<br />
<strong>20</strong>
2. Die Grenze als Gegenstand der kulturgeographischen Forschung. Von der<br />
Politischen Geographie zur Geopolitik<br />
Bevor <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kurzen diszipl<strong>in</strong>historischen Exkurs der Frage nachgegangen wird,<br />
„wozu <strong>und</strong> zu welchem Zweck“ versuchen Geographen <strong>Grenzen</strong> zu f<strong>in</strong>den oder zu <strong>in</strong>terpretieren,<br />
muß <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vorbemerkung auf zwei wesentliche Prämissen unserer Betrachtung<br />
h<strong>in</strong>gewiesen werden.<br />
Seit ihrer Etablierung als moderne Wissenschaft <strong>in</strong> der zweiten Hälfte des letzten<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts (A. v. Humboldt <strong>und</strong> C. Ritter werden traditionell als ihre „Väter“ bezeichnet)<br />
gehört der sogenannte „Doppelte Dualismus“, gehören Dichotomien zum logischen<br />
System der Geographie. Stark generalisiert gesprochen bezieht sich e<strong>in</strong> erster<br />
Dualismus auf die Forschungsobjekte, auf geofaktorbezogene oder raumbezogene Fragestellungen,<br />
d.h. also z.B. auf den Gegensatz von Allgeme<strong>in</strong>er Geographie <strong>und</strong> Regionaler<br />
Geographie (Länderk<strong>und</strong>e).<br />
E<strong>in</strong> zweiter Dualismus ist mit dem Ursache-Wirkungsgefüge <strong>im</strong> physischen Bereich<br />
bzw. <strong>im</strong> anthropogenen Bereich verb<strong>und</strong>en, d.h. e<strong>in</strong>e Dichotomie zwischen Naturgesetzlichkeit<br />
<strong>und</strong> Sozialgesetzlichkeit. Seit Beg<strong>in</strong>n wissenschaftlicher geographischer<br />
Forschung wurde <strong>in</strong> vielfältigen Konzeptionen versucht, diese Dichotomien zu überw<strong>in</strong>den<br />
bzw. zu verb<strong>in</strong>den, z.B. <strong>im</strong> länderk<strong>und</strong>lichen Konzept, <strong>im</strong> Landschaftskonzept,<br />
<strong>im</strong> ökologischen Konzept, <strong>in</strong> der Prozeßforschung.<br />
E<strong>in</strong>e zweite Prämisse: Ziel e<strong>in</strong>er jeden geographischen Raumanalyse ist es, <strong>in</strong> der<br />
sche<strong>in</strong>bar ungeordneten Vielfalt der Phänomene <strong>im</strong> Raum gewisse Regelhaftigkeiten<br />
zu erkennen oder Gesetze abzuleiten. Obwohl es nun ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>deutige Def<strong>in</strong>ition dieses<br />
„Raumes“ gibt („Räume werden gemacht“), können wir ihm durchaus qualitative Eigenschaften<br />
zuweisen: z.B. Lagemoment, Fläche, Gr<strong>und</strong>rißform <strong>und</strong> auch Grenze.<br />
Folglich müssen wir bei e<strong>in</strong>er Betrachtung der Grenze als qualitative Kategorie des<br />
Raumes neben der Maßstabsebene vor allem die unterschiedlichen Objektebenen beachten.<br />
Ohne der gr<strong>und</strong>sätzlichen Diskussion um die Begriffe „Grenze“ oder „Grenzraum“<br />
ausweichen zu wollen, sei als erster Schritt unserer Betrachtung auf die unter geographiedidaktischen<br />
Zielstellungen zusammengestellte Typologie von <strong>Grenzen</strong> durch M.<br />
Geiger (1997) zurückgegriffen (Abb. 1). Während sich M. Le<strong>im</strong>gruber (1980) <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em<br />
Forschungsbericht aus pragmatischen Gründen auf drei Gr<strong>und</strong>typen von <strong>Grenzen</strong> beschränkt<br />
(politische, wirtschaftlich-funktionale, psychologische), läßt diese Übersicht nicht<br />
nur die unterschiedlichen Objektebenen, sondern auch die verschiedenen Funktionen deutlich<br />
werden (Gr<strong>und</strong>lage: Schw<strong>in</strong>d, 1972, Ante, 1981, Haggett, 1991).<br />
Es ist nun ke<strong>in</strong>eswegs verw<strong>und</strong>erlich, daß e<strong>in</strong>e diszipl<strong>in</strong>geschichtliche Analyse h<strong>in</strong>sichtlich<br />
formaler Erkenntniswerte, konkreter Forschungskonzepte oder wissenschaftstheoretischer<br />
Ansätze über 150 Jahre h<strong>in</strong>weg e<strong>in</strong>e Entwicklung aufzeigen kann, die<br />
e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en ist <strong>in</strong> die jeweiligen historisch-politischen (z.T. ideologischen) oder sozial-ökonomischen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Bezüglich der „Grenze als Forschungsgegenstand“ hat H.D. Schultz (1993) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
sehr anregenden <strong>und</strong> auch zum Widerspruch herausfordernden Studie über „Deutsch-<br />
21
lands natürliche <strong>Grenzen</strong>“ diese Verflechtungen sehr deutlich werden lassen. Anknüpfend<br />
an Fichtes Auffassungen vom Staat <strong>und</strong> se<strong>in</strong>en natürlichen <strong>Grenzen</strong>, verfolgt er<br />
diese Ideen über die Gründungsphase der wissenschaftlichen Hochschulgeographie am<br />
Ende des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts h<strong>in</strong>aus bis <strong>in</strong> die Zwischenkriegszeit. Zitat: „Vor allem war<br />
es die Geographie, <strong>in</strong> der das Konzept der ’natürlichen <strong>Grenzen</strong>‘ bzw. ’natürlicher<br />
Länder‘ auf fruchtbaren Boden fiel: Mit den ’natürlichen Ländern‘ bot sich ihr die<br />
Chance, sich aus der bloßen Hilfswissenschaft für die Geschichte, als die sie noch bis<br />
zu Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts galt, auf Dauer zu befreien“ (H.D. Schultz, 1993, S.<br />
34). In jene Phase, <strong>in</strong> der versucht wurde, „Staaten- <strong>und</strong> Erdgrenzen“ <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu<br />
br<strong>in</strong>gen, fallen auch jene unglückseligen Diskussionen um die Abgrenzung von Mitteleuropa,<br />
die sich von A. Zeune (1808) über v. Bülow (1834) bis h<strong>in</strong> zu Kirchhoff (1882)<br />
<strong>und</strong> Partsch (1904) verfolgen lassen <strong>und</strong> die dann vor allem durch die spätere Publikation<br />
von Naumann (1915) neuen Aufschwung erhielten.<br />
Abb. 1: Räumliche <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa<br />
D<strong>im</strong>ension<br />
Arten von <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Naturraum:<br />
tellurische <strong>Grenzen</strong><br />
geozonale <strong>Grenzen</strong><br />
arealgeographische <strong>Grenzen</strong><br />
hypsometrische <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Kulturraum:<br />
ethnographische <strong>Grenzen</strong><br />
kulturelle <strong>Grenzen</strong><br />
siedlungsräumliche <strong>Grenzen</strong><br />
wirtschaftsräumliche <strong>Grenzen</strong><br />
verkehrsräumliche <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> politischen Verwaltungsraum:<br />
transnationale <strong>Grenzen</strong><br />
nationale <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>in</strong>tranationale <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Planungsraum:<br />
<strong>Grenzen</strong> von Strukturräumen<br />
<strong>Grenzen</strong> von Planungsregionen<br />
<strong>Grenzen</strong> von Fördergebieten<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Handlungsraum:<br />
Aktionsräumliche <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Wahrnehmungsraum:<br />
Informationsgrenzen<br />
Kommunikationsgrenzen<br />
Zeitgrenzen<br />
Quelle: Geiger, 1997, S. 5.<br />
22<br />
Beispiele von <strong>Grenzen</strong><br />
oder umgrenzten Gebieten<br />
- Kont<strong>in</strong>entalgrenzen<br />
- Kl<strong>im</strong>azonen<br />
- Naturräume, Verbreitungsgrenzen<br />
- Höhengrenzen<br />
- Volksgrenzen, Sprachgrenzen<br />
- Religionsgrenzen<br />
- Ökumene, Anökumene<br />
- Anbaugrenzen, Währungs-, Zollgrenzen<br />
- Verkehrsbarrieren, Erreichbarkeitsgrenzen<br />
- <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong>ternationaler Bündnisse<br />
- Festland-, Meeres- u. Luftraumgrenzen<br />
- B<strong>in</strong>nengrenzen: Bezirke, Wahlkreise<br />
- Verdichtungsräume, periphere Räume<br />
- Gebietse<strong>in</strong>heiten<br />
- Zielgebiete von Fördermaßnahmen<br />
- E<strong>in</strong>zugsgebiete<br />
- Reichweitegebiete<br />
- Sperrgebiete, Schutzgebiete<br />
- Reichweite von Zensur oder Kabelnetzen<br />
- Sprachbarrieren<br />
- <strong>Grenzen</strong> von Zeitzonen
Zweifellos besaß die Geographie (besser: zahlreiche geographische Hochschullehrer)<br />
<strong>in</strong> dieser Periode, die politisch <strong>und</strong> ideologisch best<strong>im</strong>mt war durch die Reichsgründung<br />
von 1871, die Erwerbung von Kolonien seit 1884/85 <strong>und</strong> die Entstehung e<strong>in</strong>es<br />
neuen politischen Bewußtse<strong>in</strong>s (<strong>und</strong> bald <strong>im</strong>perialistischen Bewußtse<strong>in</strong>s) (BECK<br />
1973, S. 261), e<strong>in</strong>en Legit<strong>im</strong>ationsdrang. E<strong>in</strong>erseits blieb man verhaftet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Naturdeterm<strong>in</strong>ismus,<br />
suchte die Allgeme<strong>in</strong>e Geographie wie die Länderk<strong>und</strong>e naturwissenschaftlich<br />
zu untermauern, andererseits blickte man zurück auf die Vorbilder A. v.<br />
Humboldt <strong>und</strong> C. Ritter, deren „Regionale Geographien“ sich direkt aus dem Historismus<br />
der Romantik ableiten ließen.<br />
Erst mit F. Ratzel (1844-1904) hat die Geographie <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne der heutigen Kulturgeographie<br />
e<strong>in</strong>e klare Systematik erfahren. Er gilt zu Recht als Begründer der beziehungswissenschaftlichen<br />
Periode der Anthropogeographie, denn für ihn stand diese<br />
Frage nach der Abhängigkeit des Menschen von den Naturbed<strong>in</strong>gungen <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong><br />
des Interesses – e<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>istische Sicht <strong>in</strong> der Tradition des Positivismus am<br />
Ende des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Ratzel gilt auch als Begründer der wissenschaftlichen Politischen Geographie. Se<strong>in</strong><br />
Bestreben, den Staat zu verstehen als e<strong>in</strong> lebendiges Gebilde, das als bodenständiger<br />
Organismus <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Raumes zu sehen ist <strong>und</strong> <strong>in</strong> dessen Gestaltsveränderungen<br />
Gesetzmäßigkeiten zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, hat die deutsche <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale Geographie<br />
nachhaltig bee<strong>in</strong>flußt. Mit se<strong>in</strong>er „Politischen Geographie“ (Untertitel: Oder die Geographie<br />
der Staaten, des Verkehrs <strong>und</strong> des Krieges) hat er wesentlich zur Typologie der<br />
<strong>Grenzen</strong>, so auch zur Revision des „Natürliche <strong>Grenzen</strong>-Konzeptes“ beigetragen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die Ideen Ratzels vielfach mißverstanden <strong>und</strong> auch mißbraucht<br />
worden, nicht zuletzt der Begriff „Lebensraum“, der zwanzig Jahre später zu zweifelhaften<br />
Ehren kam.<br />
Aber auch bei Ratzel war bereits die H<strong>in</strong>wendung zu praktisch-politischen Folgerungen<br />
spürbar. Verhängnisvoll für die Diszipl<strong>in</strong>geschichte wurde dann die <strong>in</strong> Anlehnung<br />
an den schwedischen Staatsrechtler Kjellen geführte Diskussion um Geopolitik –<br />
als Lehre über den Staat, als Organismus <strong>und</strong> Ersche<strong>in</strong>ung <strong>im</strong> Raum <strong>und</strong> die Vermischung<br />
der Begriffe; die Vermischung von wissenschaftlicher Forschung <strong>und</strong> praktisch-propagandistischer<br />
Anwendung, Tendenz <strong>und</strong> Prognose. 1935 legte W. Vogel e<strong>in</strong>en<br />
umfangreichen Literaturbericht zur Politischen Geographie <strong>und</strong> Geopolitik für die<br />
Jahre 1909 bis 1934 vor. Obwohl er durchaus zwischen wissenschaftlicher Politischer<br />
Geographie <strong>und</strong> Geopolitik unterscheidet, ist se<strong>in</strong>e Argumentation für die Beschäftigung<br />
mit „<strong>Grenzen</strong>“ symptomatisch. Zitat: „Der deutschen Forschung ist der Anstoß<br />
zur <strong>in</strong>tensiven Beschäftigung mit dem Grenzproblem hauptsächlich dadurch gekommen,<br />
daß von italienischer Seite <strong>in</strong> der Anfangszeit des Weltkrieges (<strong>in</strong> der Wirklichkeit<br />
aber schon vorher) die Forderung der Ausdehnung des italienischen Staatsgebietes<br />
bis zur Hauptwasserscheide der Alpen erhoben wurde“ (VOGEL 1935, S. 163). Ähnliches<br />
galt, so Vogel, für die deutsche Westgrenze, wo die Franzosen den Rhe<strong>in</strong> seit langem<br />
zur „natürlichen Grenze“ Frankreichs stempeln wollten (vgl. Abb. 2).<br />
23
24<br />
Abb. 2
Zusammenfassend läßt sich mit J. Matznetter (1974) jene Periode der Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
von Politischer Geographie <strong>und</strong> Geopolitik, wobei letztere zur bloßen politschen<br />
Zweckbest<strong>im</strong>mung wurde, nicht nur <strong>in</strong> die Zeitabschnitte 1919-1924, 1925-<br />
1933, 1934-1945 untergliedern, sondern lassen sich die Forschungsansätze konkret an<br />
folgenden auslösenden Momenten festmachen, so z.B.<br />
– an den Pariser Vorortverträgen,<br />
– an der Zerschlagung des Habsburgerreiches <strong>und</strong> der Entstehung der Nachfolgestaaten,<br />
– an Gebietsabtretungen <strong>und</strong> Verlusten der Überseegebiete,<br />
– an der Absperrung von Rohstoffgebieten <strong>und</strong> an dem Abdrängen von Weltmärkten.<br />
E<strong>in</strong> Forschungsansatz, der <strong>in</strong> der Diszipl<strong>in</strong>geschichte der Geographie m.E. noch<br />
kaum aufgearbeitet wurde, sei mit den Aktivitäten der Reichsarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft für<br />
Raumforschung (z.B. Raumordnung <strong>im</strong> „Neuen Osten“) auf verschiedener Maßstabsebene<br />
abschließend angedeutet (vgl. Abb. 3).<br />
3. Die „Grenze“ <strong>in</strong> den Ansätzen moderner Regionalforschung <strong>und</strong> die „Renaissance“<br />
der Geopolitik<br />
Obwohl mit den gr<strong>und</strong>legenden Arbeiten von C. Troll (1947), H. Overbeck (1957) <strong>und</strong><br />
vor allem P. Schöller (1957) mit e<strong>in</strong>er Abklärung der Irrwege der Politischen Geographie<br />
e<strong>in</strong>e klare wissenschaftstheoretisch abgesicherte Trennung <strong>und</strong> Distanzierung der<br />
Politischen Geographie von e<strong>in</strong>er pseudowissenschaftlichen Geopolitik vorgelegt wurde,<br />
zeichnete sich die deutsche Geographie bezüglich politisch-geographischer Fragestellungen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere bezüglich des Phänomens „Grenze“, bis <strong>in</strong> die späten 60er<br />
Jahre durch e<strong>in</strong>e z.T. verständliche Abst<strong>in</strong>enz aus.<br />
Umso stärker wurden „Grenzprobleme“ <strong>in</strong> den Analysen amerikanischer, englischer<br />
oder französischer Geographen <strong>in</strong> das politisch-geographische Forschungszentrum gerückt.<br />
So hat der 1963 von J. M<strong>in</strong>ghi vorgelegte umfangreiche Literaturbericht über die<br />
„<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Politischen Geographie“ nicht nur E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die Rezeptionsprozesse<br />
Ratzelscher Ideen <strong>und</strong> deren Weiterentwicklung (z.B. über Semple, Hold, Hartshorne<br />
oder Lösch) eröffnet, sondern <strong>im</strong> Versuch der Klassifikation der Forschungsansätze<br />
zugleich e<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>legung zur „Theorie der Grenze“ geleistet. Die schon bei Ratzel<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>en Nachfolgern z.T. vorhandene Differenzierung der Term<strong>in</strong>ologie von Mark,<br />
Grenzmark, Grenzl<strong>in</strong>ie, Grenzsaum wurde <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gesetzt mit den Term<strong>in</strong>i:<br />
border, borderl<strong>in</strong>e, bo<strong>und</strong>ary, frontier oder border landscape (vgl. Abb. 4).<br />
25
26<br />
Abb. 3
Abb. 4: Typologie der Fallstudien über Politische <strong>Grenzen</strong><br />
(nach MINGHI 1963)<br />
1. Studien über umstrittene Gebiete<br />
2. Studien über die Auswirkungen von Grenzveränderungen<br />
3. Studien über die Entwicklung von <strong>Grenzen</strong><br />
4. Studien über die Festlegung <strong>und</strong> Demarkation von <strong>Grenzen</strong><br />
5. Studien über Exklaven <strong>und</strong> Zwergstaaten<br />
6. Studien über <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Meer<br />
7. Studien über <strong>Grenzen</strong> bei Streitigkeiten um Bodenschätze <strong>und</strong> Wasser<br />
8. Studien über <strong>in</strong>nere <strong>Grenzen</strong><br />
Trotz vielfältiger neuer Aufgabendef<strong>in</strong>itionen für die Politische Geographie durch<br />
P. Schöller, K.A. Boesler <strong>und</strong> andere, wonach nicht der Staat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em politischen<br />
Handeln <strong>im</strong> Mittelpunkt der Forschung stehen sollte, sondern die auf die Kulturlandschaft<br />
e<strong>in</strong>wirkenden politischen Kräfte – so auch die Grenze –, wurden auch unter<br />
raumordnungs- <strong>und</strong> raumordnungspolitischen Aspekten vornehmlich die B<strong>in</strong>nengrenzen<br />
(sowohl <strong>im</strong> deutschen als auch <strong>im</strong> ostmitteleuropäischen Raum) zum Gegenstand<br />
der Forschung. Die gelungene Konzeption e<strong>in</strong>er neuen Staatengeographie durch M.<br />
Schw<strong>in</strong>d (1972) bildete zweifellos – zusammen mit wenigen Ansätzen zur Erforschung<br />
grenzüberschreitender Probleme (Saarland/Lothr<strong>in</strong>gen, Regio Basiliensis, Alpen-Adria<br />
etc.) – e<strong>in</strong>e Ausnahme.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs wurden <strong>in</strong> jener Zeit – nicht zuletzt unter dem E<strong>in</strong>fluß anglo-amerikanischer<br />
Regional Science – theoretische Konzeptionen zur Grenzproblematik entwickelt<br />
(u.a. RAFFESTIN 1986; Elements for a theorie of the frontier; GUICHONNET/<br />
RAFFESTIN 1974, etc.).<br />
Für die nachfolgende, überblickartige Kennzeichnung der Forschungsfelder <strong>und</strong><br />
Forschungsansätze <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er modernen Regionalforschung stütze ich mich auf<br />
e<strong>in</strong>ige ausgewählte Studien, die sowohl aus dem deutschsprachigen Raum als auch aus<br />
den west- <strong>und</strong> ostmitteleuropäischen Ländern vorgelegt wurden, z.B. SEGER, BELUSZ-<br />
KY (1993), AUBERT, ERDÖSI, TOTH (1993), SCHABHÜSER (1993), O’LOUGHLIN, V.D.<br />
WUSTEN (1993), SZSCEPAŃSKI (1993), HELLER (1993), HAJDÚ, HORVATH (1994), KO-<br />
TER (1995), KRÄTKE, HEEG, STEIN (1997), WACKERMANN (1998), BÜRKNER, KO-<br />
WALKE (1996).<br />
Obwohl <strong>in</strong> den meisten der mir zugänglichen Arbeiten, vor allem bei HELLER<br />
(1993) <strong>und</strong> BÜRKNER (1996), bei allen „Grenzraumforschungen“, e<strong>in</strong> Theoriedefizit<br />
konstatiert wird, möchte ich dennoch – nicht zuletzt um die Fülle <strong>und</strong> Vielfalt der Forschungsansätze<br />
etwas transparenter ersche<strong>in</strong>en zu lassen – e<strong>in</strong>ige theoretische Bemerkungen<br />
vorausschicken (vgl. Abb. 5).<br />
27
28<br />
Abb. 5
Das nebenstehende Schema nach Seger, M./Beluszky, P. (1993) versucht, die vielfältigen<br />
Aspekte der Bedeutung von <strong>Grenzen</strong> an sich <strong>und</strong> für die Grenzregion an drei<br />
theoretischen Ansätzen, die allerd<strong>in</strong>gs unterschiedlichen Sachbereichen zugeordnet<br />
s<strong>in</strong>d, festzumachen:<br />
1. der erste bezieht sich auf unterschiedliche Typen von Regionen, d.h. Areal-versus<br />
Kont<strong>in</strong>uum-Ansatz; <strong>Grenzen</strong> als Bruchl<strong>in</strong>ien <strong>und</strong> grenzunabhängige Strukturen,<br />
2. der zweite Ansatz verdeutlicht die handlungstheoretische Begründung von grenzüberschreitenden<br />
Interaktionen:<br />
a) zentrierte Regionen <strong>und</strong> peripherer Grenzraum (Peripherie-Ansatz <strong>und</strong> Übersprungeffekte),<br />
b) Potentialdifferenz- <strong>und</strong> Diffusions-Ansatz (grenzüberschreitender Verkehr <strong>und</strong><br />
Reichweiten bzw. E<strong>in</strong>zugsbereiche),<br />
3. der dritte Ansatz vermittelt als politisch-historischer Ansatz Machtverhältnisse <strong>und</strong><br />
Grenzverschiebungen.<br />
Abb. 6: Wesentliche Forschungsansätze der <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzraumforschung<br />
(1) Determ<strong>in</strong>istischer Ansatz<br />
(RATZEL 1897; SEMPLE 1971; BOGGS 1940<br />
(2) Landschaftsgeographischer Ansatz<br />
(HASSINGER 1932; SCHWIND 1950; BURGHARDT 1962)<br />
(3) Sozialgeographische Ansätze:<br />
a) Wahrnehmungstheoretische Ansätze<br />
b) Verhaltensorientierte Ansätze<br />
c) Migrationstheoretische Ansätze<br />
(SEGER, BELUSZKY 1993)<br />
(4) Regionalwissenschaftliche Ansätze<br />
(KRÄTKE et al. 1997)<br />
Wenn wir nun <strong>im</strong> folgenden Schritt das umfangreiche Tableau von Forschungsfeldern<br />
<strong>und</strong> Forschungsansätzen betrachten (vgl. Zusammenstellung bei HELLER 1993,<br />
BÜRKNER et al. 1996), dann spiegelt sich dar<strong>in</strong> nicht nur e<strong>in</strong> Stück Diszipl<strong>in</strong>geschichte<br />
der „Grenzraumforschung“ wider, sondern wir erkennen <strong>in</strong> dieser Dynamik den Paradigmenwechsel<br />
der Geographie Ende der 60er Jahre, die Übernahme der Systemtheorie<br />
(Stichwort: Kulturlandschaftsforschung als Prozeßforschung) <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>flüsse der Sozialwissenschaften.<br />
29
Um diesen Wechsel noch etwas mehr zu verdeutlichen, habe ich die Forschungsansätze<br />
auf vier wesentliche Kategorien reduziert (vgl. auch HELLER 1993), wobei ich<br />
nicht betonen muß, daß die dritte <strong>und</strong> vierte Kategorie <strong>in</strong> der empirischen Praxis oftmals<br />
verknüpft s<strong>in</strong>d (vgl. Abb. 6).<br />
Es bleibt hier zunächst festzuhalten, daß e<strong>in</strong>e moderne politisch-geographische wie<br />
auch wirtschaftsgeographische Analyse von <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzregionen auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage sozialgeographischer Fragestellungen resp. regionalwissenschaftlicher Ziele<br />
zu erfolgen hat. Beispiele bilden jene zahlreichen Studien aus dem deutschfranzösischen<br />
Grenzraum, aber auch aus den Grenzgebieten Bayerns <strong>und</strong> Böhmens,<br />
Westungarns oder Österreichs bzw. aus den deutsch-polnischen Grenzgebieten.<br />
Aus der Vielzahl der Forschungsarbeiten zu den „border-regions“ seien exemplarisch<br />
nur die Untersuchungen der PAN (1994), die Analysen der deutsch-polnischen<br />
Raumordnungskommission (1993) oder die Analysen zu den Euro-Regionen (Deutschland,<br />
Polen, Tschechien) genannt.<br />
Neben dieser politisch-geographischen Regionalanalyse zu Grenzräumen, neben<br />
dem neuen Aufschwung der Politischen Geographie als Folge neuer politischer Strukturen<br />
<strong>und</strong> Konflikte, läßt sich aber zugleich e<strong>in</strong>e erstaunliche Renaissance der Geopolitik<br />
verzeichnen.<br />
Nicht zuletzt unter dem E<strong>in</strong>fluß resp. <strong>in</strong> Anlehnung an die französischen Arbeiten<br />
von M. Foucher (1993) lassen sich <strong>in</strong> Polen wie <strong>in</strong> Tschechien neuerd<strong>in</strong>gs Forschungen<br />
zur geostrategischen <strong>und</strong> geopolitischen Situation jener Länder f<strong>in</strong>den. Beispiele: der<br />
1993 <strong>in</strong> Ljubljana publizierte Sammelband zu geographischen Aspekten der Grenzgebiete<br />
(Beiträge über Slowenien, Ungarn, Slowenien/Italien, Österreich etc.), vor allem<br />
aber der 1993 vom IG PAN veröffentlichte Band zur „Contemporary Political Geography“<br />
bzw. der 1994 <strong>im</strong> tschechischen „Sbornik“ (99/1994) abgedruckte Beitrag zur<br />
„Geopolitischen Entwicklung des tschechischen Staates“.<br />
Bereits zu E<strong>in</strong>gang dieses Diskussionsbeitrages war darauf h<strong>in</strong>gewiesen worden,<br />
daß sich mit den e<strong>in</strong>schneidenden Veränderungen <strong>in</strong> Europa, mit der zunehmenden Integration<br />
<strong>in</strong> Westeuropa <strong>und</strong> den raumwirksamen Transformationsprozessen <strong>in</strong> Ostmittel-<br />
<strong>und</strong> Osteuropa auch die Thematik der Grenz- <strong>und</strong> Grenzraumforschung verändert<br />
hat. Während <strong>im</strong> Westen als Auswirkungen jener Prozesse die räumlichen Disparitäten<br />
trotz gegensteuernder Bemühungen der Raumordnungspolitik <strong>im</strong>mer mehr zunehmen,<br />
treten <strong>im</strong> Osten als Folge jener Transformationen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er kaum vorhandenen Regionalpolitik<br />
vorsozialistische Raummuster wieder <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung. Allgeme<strong>in</strong> läßt sich,<br />
das zeigen zahlreiche raumstrukturelle Analysen aus Ungarn, Polen oder Tschechien,<br />
e<strong>in</strong>e Renaissance des Regionalismus konstatieren.<br />
30
Abb. 7<br />
31
Abb. 8: Grenzraumforschungvor Beg<strong>in</strong>n der Transformationsprozesse <strong>in</strong> Europa<br />
(1) Grenzregionen als periphere Räume<br />
(2) Grenzüberschreitende Beziehungen<br />
(3) E<strong>in</strong>fluß der <strong>Grenzen</strong> auf das Verhalten der Grenzlandbewohner<br />
Grenzraumforschung seit Beg<strong>in</strong>n der Transformationsprozesse<br />
(1) Verhalten der Bevölkerung <strong>in</strong> den Grenzregionen<br />
(<strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne aktionsräumlicher Verflechtungsanalysen)<br />
(2) Ökonomische Umstrukturierungsprozesse <strong>in</strong> den Grenzregionen (<strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne<br />
regionalwissenschaftlicher Analysen)<br />
(3) Analysen der neuen grenzüberschreitenden Planungsregionen (<strong>im</strong> doppelten<br />
S<strong>in</strong>ne: von „oben“, von „unten“)<br />
(4) Gesamtgesellschaftliche Transformationsanalysen als Basis zur Untersuchung<br />
regionaler Veränderungsprozesse<br />
Zweifellos wird die neue räumliche Dynamik <strong>in</strong> Europa durch die Transformation<br />
der Länder des ehemaligen RGWs <strong>und</strong> ihre Integration <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en europäischen Wirtschaftsraum<br />
wesentlich verändert werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich auch<br />
für die Grenz- <strong>und</strong> Grenzraumforschung neue Aufgabenfelder. Die nachfolgende Übersicht<br />
(vgl. Abb. 8) ist e<strong>in</strong> Ergebnis der aktuellen Diskussion um diese Forschungsfelder<br />
(vgl. Varia-Sitzung auf dem Potsdamer Geographentag 1995 bzw. die Beiträge von<br />
BÜRKNER, MAIER, WEBER, STRYJAKIEWICZ, ASCHAUER, 1996). Während <strong>in</strong> der Zeit<br />
vor der „Wende“ mehr raumstrukturelle Fragen („Periphere Räume“) <strong>und</strong> beschreibende<br />
Analysen grenzüberschreitender Beziehungen <strong>im</strong> Mittelpunkt standen, rücken nun<br />
verstärkt – neben den modernen regionalwissenschaftlichen Analysen – auch sozialökonomisch<br />
best<strong>im</strong>mte Themen <strong>in</strong> den Mittelpunkt.<br />
Als e<strong>in</strong> Beispiel für die aktuellen Ansätze regionalwissenschaftlicher „Grenzraumforschung“<br />
sei die Untersuchung von KRÄTKE et al. (1997) über die Deutsch-Polnische<br />
Grenzregion (vgl. Abb. 9) angeführt.<br />
Die bereits mehrfach angesprochenen gegenwärtigen Raumentwicklungsprozesse <strong>in</strong><br />
Europa, die mit Integration, Transformation, EU- <strong>und</strong> NATO-Osterweiterung nur<br />
stichwortartig umrissen werden können, bedeuten für die Politische Geographie wie<br />
auch für die moderne Wirtschaftsgeographie neue Aufgabenfelder. Nicht mehr die<br />
„Abgrenzung“ steht dabei <strong>im</strong> Mittelpunkt, sondern die mögliche „Überw<strong>in</strong>dung“ der<br />
Grenze. Die Renaissance des politischen <strong>und</strong> sozial-ökonomischen Regionalismus<br />
führt zur Entstehung „neuer Räume“, denen wiederum neue Qualitäten, z.B. die Grenze,<br />
zukommt. Solche „neuen Räume“ bilden z.B. die grenzüberschreitenden Planungs-<br />
<strong>und</strong> Entwicklungsräume, denen e<strong>in</strong> aus dem „Westen“ <strong>im</strong>portiertes Raummodell (EU-<br />
32
Abb. 9<br />
33
Abb. 10<br />
34
Abb. 11<br />
35
REGIO) zugr<strong>und</strong>e liegt <strong>und</strong> das zur Aktivierung des endogenen Raumpotentials resp.<br />
zur Strukturverbesserung ehemals peripherer Grenzregionen führen soll (vgl. Abb. 10).<br />
So hat die Grenze als Gegenstand der Politischen Geographie <strong>im</strong> Zuge der diszipl<strong>in</strong>historischen<br />
Entwicklungen sehr unterschiedliche wissenschaftliche Bewertungen<br />
erfahren, von der natürlichen <strong>und</strong> politischen Grenze <strong>in</strong> der Abkopplungs- <strong>und</strong> Etablierungsphase<br />
der wissenschaftlichen Geographie über die Politisierung der Grenze <strong>und</strong><br />
ihre Instrumentalisierung <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er irregeleiteten Geopolitik bis h<strong>in</strong> zur Grenze<br />
als Faktor der Kulturlandschaftsentwicklung.<br />
Der neue Regionalismus <strong>in</strong> Europa (sowohl e<strong>in</strong> politischer als auch e<strong>in</strong> sozialökonomischer)<br />
hat die Regionalwissenschaftler zur Konstruktion zahlreicher „Raummodelle“<br />
verführt (Abb. 11). Diese Raummuster s<strong>in</strong>d <strong>im</strong> wesentlichen Erkenntnisse der<br />
neuen „Geopolitik“, als Beispiele s<strong>in</strong>d hier Brunet, Foucher, Lacoste, aber auch Gorzelak<br />
zu nennen. Um e<strong>in</strong> Abdriften dieser neuen Geopolitik, verstanden als <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Lehre, <strong>in</strong> re<strong>in</strong>e Geostrategie zu vermeiden, sollte die Politische Geographie<br />
hierzu die theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen bieten (vgl. BOESLER 1997).<br />
Literaturnachweis<br />
ANTE, ULRICH: Politische Geographie, Braunschweig 1981.<br />
ASCHAUER, WOLFGANG: Systemwandel <strong>und</strong> Grenzöffnung als Faktoren der Regionalentwicklung<br />
– das Beispiel der ungarisch-österreichischen Grenzregion, <strong>in</strong>: Geographische<br />
Grenzraumforschung <strong>im</strong> Wandel, hrsg. von HANS-JOACHIM BÜRKNER<br />
<strong>und</strong> HARTMUT KOWALKE, Potsdam 1996, S. 55-75.<br />
BECK, HANNO: Geographie. Europäische Entwicklung <strong>in</strong> Texten <strong>und</strong> Erläuterungen,<br />
Freiburg, München 1973.<br />
BOESLER, KLAUS-ACHIM: Gedanken zum Konzept der Politischen Geographie, <strong>in</strong>: Die<br />
Erde 105 (1974), S. 7-33.<br />
DERS.: Neue Ansätze der Politischen Geographie <strong>und</strong> Geopolitik, <strong>in</strong>: Erdk<strong>und</strong>e 51<br />
(1997), S. 309-317.<br />
Bruchl<strong>in</strong>ie Eiserner Vorhang, hrsg. von MARTIN SEGER <strong>und</strong> PAL BELUSZKY, Wien u.a.<br />
1993.<br />
BÜRKNER, HANS-JOACHIM: Geographische Grenzraumforschung vor neuen Herausforderungen<br />
– Forschungskonzeptionen vor <strong>und</strong> nach der politischen Wende <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>,<br />
<strong>in</strong>: Geographische Grenzraumforschung <strong>im</strong> Wandel, hrsg. von HANS-<br />
JOACHIM BÜRKNER <strong>und</strong> HARTMUT KOWALKE, Potsdam 1996, S. 1-11.<br />
DEMANDT, ALEXANDER: Die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte Deutschlands, <strong>in</strong>: Deutschlands<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte, hrsg. von DEMS., München 1993, S. 9-31.<br />
Deutschlands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte, hrsg. von ALEXANDER DEMANDT, München<br />
1993.<br />
European Challenges and Hungarian Responces <strong>in</strong> Regional Policy, hrsg. von ZOLTÁN<br />
HAJDÚ <strong>und</strong> GYULA HORVÁTH, Pécs 1994.<br />
36
FOUCHER, MICHAEL: Fragments d’Europe, Lyon 1995.<br />
GEIGER, MICHAEL: Europas <strong>Grenzen</strong> – grenzenloses Europa, <strong>in</strong>: Praxis Geographie 27<br />
(1977), Heft 10, S. 4-11.<br />
Geographische Grenzraumforschung <strong>im</strong> Wandel, hrsg. von HANS-JOACHIM BÜRKNER<br />
<strong>und</strong> HARTMUT KOWALKE, Potsdam 1996.<br />
GUICHONNET, PAUL – RAFFESTIN, CLAUDE: Géographie des frontières, Paris 1974.<br />
HAGGETT, PETER: Geographie. E<strong>in</strong>e moderne Synthese, New York 1983.<br />
HARTSHORNE, RICHARD: Geographic and Political Bo<strong>und</strong>aries <strong>in</strong> Upper Silesia, <strong>in</strong>:<br />
Annals of the Association of American Geographers 23 (1933), S. 195-228.<br />
HELLER, WILFRIED: Politische <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzräume aus anthropogeographischer<br />
Sicht, <strong>in</strong>: Grenzland, hrsg. von BERND WEISBROD, Hannover 1993, S. 173-194.<br />
HELLWIG, FRITZ: Die Überw<strong>in</strong>dung der Grenze, <strong>in</strong>: Grenzbildende Faktoren <strong>in</strong> der Geschichte,<br />
hrsg. von der Akademie für Raumforschung <strong>und</strong> Landesplanung, Hannover<br />
1969 (Forschungs- <strong>und</strong> Sitzungsberichte, Bd. 48), S. 113-121.<br />
KRÄTKE, STEFAN – HEEG, SUSANNE – STEIN, ROLF: Regionen <strong>im</strong> Umbruch. Probleme<br />
der Regionalentwicklungen an den <strong>Grenzen</strong> zwischen Ost <strong>und</strong> West, Frankfurt/M.,<br />
New York 1997.<br />
LACOSTE, YVES: Geographie <strong>und</strong> politisches Handeln. Perspektiven e<strong>in</strong>er neuen Geopolitik,<br />
Berl<strong>in</strong> 1990.<br />
LEIMGRUBER, WALTER: Die Grenze als Forschungsobjekt der Geographie, <strong>in</strong>: Regio<br />
Basiliensis 21 (1980), H. 1/2, S. 67-78.<br />
MATZNETTER, JOSEF: E<strong>in</strong>leitung, <strong>in</strong>: Politische Geographie, hrsg. von DEMS., München<br />
1977, S. 1-27.<br />
MINGHI, JULIAN V.: Bo<strong>und</strong>ary Studies <strong>in</strong> Political Geography, <strong>in</strong>: Annals of the Association<br />
of American Geographers 53 (1963), S. 407-428.<br />
OVERBECK, HERRMANN: Das politischgeographische Lehrgebäude von Friedrich Ratzel<br />
<strong>in</strong> der Sicht unserer Zeit, <strong>in</strong>: Die Erde 88 (1957), S. 169-192.<br />
Politische Geographie, hrsg. von JOSEF MATZNETTER, München 1977.<br />
RATZEL, FRIEDRICH: Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehres<br />
<strong>und</strong> des Krieges, München, Berl<strong>in</strong> 1903.<br />
Region and Regionalism. Social and Political Aspects, hrsg. von MAREK KOTER,<br />
Opole/Lodz 1995.<br />
Regional Problems <strong>in</strong> East-Central Europe after the Political Changes, hrsg. von<br />
ANTAL AUBERT, FERENC ERDÖSI <strong>und</strong> JOZSEF TÓTH, Pécs 1993.<br />
SCHABHÜSER, BRIGITTE: Grenzregionen <strong>in</strong> Europa. Zu ihrer derzeitigen Bedeutung <strong>in</strong><br />
Raumforschung <strong>und</strong> Raumordnungspolitik, <strong>in</strong>: Information zur Raumentwicklung<br />
(1993), H. 9/10, S. 655-668.<br />
SCHÖLLER, PETER: Wege <strong>und</strong> Irrwege der Politischen Geographie <strong>und</strong> Geopolitik, <strong>in</strong>:<br />
Erdk<strong>und</strong>e 11 (1957), S. 1-<strong>20</strong>.<br />
SCHULTZ, HANS-DIETRICH: Deutschlands „natürliche“ <strong>Grenzen</strong>, <strong>in</strong>: Deutschlands<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte, hrsg. von ALEXANDER DEMANDT, München 1993, S.<br />
32-93.<br />
37
SCHWIND, MARTIN: Allgeme<strong>in</strong>e Staatengeographie, Berl<strong>in</strong> 1972.<br />
STRYJAKIEWICZ, TADEUSZ: Euroregionen an der deutsch-polnischen Grenze <strong>und</strong> Probleme<br />
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, <strong>in</strong>: Geographische Grenzraumforschung<br />
<strong>im</strong> Wandel, hrsg. von HANS-JOACHIM BÜRKNER <strong>und</strong> HARTMUT KO-<br />
WALKE, Potsdam 1996, S. 43-54.<br />
The Geography of Border Landscapes, hrsg. von DENNIS RUMLEY <strong>und</strong> JULIAN<br />
MINGHI, London, New York 1991.<br />
The New Political Geography of Eastern Europe, hrsg. von JOHN O’LONGHLIN <strong>und</strong><br />
HERMAN VAN DER WUSTEN, London, New York 1993.<br />
TROLL, CARL: Die geographische Wissenschaft <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> den Jahren 1933 bis<br />
1945, <strong>in</strong>: Erdk<strong>und</strong>e 1 (1947), S. 3-48.<br />
VOGEL, WALTHER: Politische Geographie <strong>und</strong> Geopolitik (1909-1934), <strong>in</strong>: Geographisches<br />
Jahrbuch 49 (1935), S. 78-304.<br />
38
Der Wandel der Funktion von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong><br />
<strong>in</strong>ternationalen System <strong>Ostmitteleuropa</strong>s <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
von<br />
Peter Krüger<br />
E<strong>in</strong> für unser Thema <strong>in</strong> jeder H<strong>in</strong>sicht belangvolles amerikanisches Sprichwort lautet:<br />
„Good fences make good neighbors“, <strong>und</strong> es f<strong>in</strong>det besondere Anerkennung <strong>im</strong> amerikanischen<br />
Westen, dem heroisierten <strong>und</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Wirkungen so umstrittenen Entfaltungsraum<br />
der „Frontier“, des <strong>im</strong>mer weiter vorgeschobenen Grenzraumes <strong>im</strong> Prozeß<br />
der Erschließung der kont<strong>in</strong>entalen Landmasse durch die Amerikaner. Wenn man<br />
das Phänomen der Grenze genauer untersuchen <strong>und</strong> Aussagen darüber sammeln will,<br />
kann die Feststellung: „Gute Zäune – gute Nachbarn“ Aufmerksamkeit beanspruchen;<br />
denn sie besagt, auf das Thema übertragen, daß gut geregelte <strong>Grenzen</strong> e<strong>in</strong> gutes Zusammenleben<br />
der Staaten ermöglichen. Gut geregelte <strong>Grenzen</strong> s<strong>in</strong>d demnach offenk<strong>und</strong>ig<br />
solche, die klar festgelegt, unstrittig, gesichert <strong>und</strong> von allen Beteiligten akzeptiert<br />
s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>sbesondere also solche, die ke<strong>in</strong>e Beunruhigung oder Bedrohungsängste<br />
auslösen oder etwa durch die Art ihrer Entstehung <strong>und</strong> die Machtverhältnisse e<strong>in</strong>e<br />
Gefahr bedeuten. Diese Voraussetzungen weisen aber schon über die eigentliche<br />
Grenzregelung h<strong>in</strong>aus. Ihre befriedigende Festlegung alle<strong>in</strong> genügt nicht; um sie dauerhaft<br />
zu sichern, bedarf es e<strong>in</strong>es weiterreichenden <strong>in</strong>ternationalen E<strong>in</strong>vernehmens,<br />
also e<strong>in</strong>es gut geordneten Staatensystems. Ke<strong>in</strong>e dieser Voraussetzungen traf zu, als<br />
die Sieger des Ersten Weltkriegs nach harten Ause<strong>in</strong>andersetzungen die <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>Ostmitteleuropa</strong>s neu gezogen hatten. Es gab weder viele gute Zäune noch gute<br />
Nachbarn, es gab daher ebensowenig e<strong>in</strong> zufriedenstellend geregeltes, funktionierendes<br />
<strong>in</strong>ternationales System – trotz aller Anstrengungen auf der Pariser Friedenskonferenz;<br />
die Interessen <strong>und</strong> Ziele divergierten zu sehr. Aber die zum Teil katastrophalen<br />
Auswirkungen der neuen <strong>Grenzen</strong> – Auswirkungen, die man übrigens ke<strong>in</strong>esfalls<br />
pauschal der Friedenskonferenz zur Last legen sollte, die bei der Grenzziehung vor<br />
ungeahnten Schwierigkeiten stand – bleiben weith<strong>in</strong> unerklärlich, wenn man sie nur<br />
<strong>im</strong> Kontext <strong>und</strong> als Ergebnis der Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg betrachtet,<br />
gleichgültig, ob die Konsequenzen für e<strong>in</strong>zelne Länder oder für das <strong>in</strong>ternationale System<br />
zur Debatte stehen. Aufgr<strong>und</strong> der anhaltenden Brisanz dieser Problematik sche<strong>in</strong>en<br />
e<strong>in</strong>ige Überlegungen über den Charakter von <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> über ihre Funktion <strong>in</strong><br />
langfristigen historischen Zusammenhängen s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> veranlaßt.<br />
E<strong>in</strong>e systematische <strong>und</strong> umfassende Erörterung des Themas der Grenze <strong>in</strong> Vergangenheit<br />
<strong>und</strong> Gegenwart ist hier nicht erforderlich, vielmehr geht es um e<strong>in</strong>ige Gesichtspunkte<br />
<strong>in</strong> bezug auf den Gegenstand der Tagung, zu dem ich mit me<strong>in</strong>en Aus-<br />
39
führungen angesichts der aus diesen Anlaß versammelten geballten Sachkompetenz<br />
nur e<strong>in</strong>en bescheidenen, auf e<strong>in</strong>ige Zusammenhänge <strong>und</strong> fortbestehende Fragen aufmerksam<br />
machenden Beitrag leisten kann. Warnen möchte ich zunächst vor e<strong>in</strong>er bedeutungsschweren<br />
Überfrachtung des Begriffs der Grenze, <strong>in</strong>sbesondere für die deutsche<br />
Geschichte, so nahe das gerade hier liegt, angesichts der Schwierigkeiten, welche<br />
die deutsche Nation mit ihren <strong>Grenzen</strong> hatte. 1 Die Grenze ist allerd<strong>in</strong>gs, <strong>und</strong> zwar<br />
für mehrere wissenschaftliche Diszipl<strong>in</strong>en, e<strong>in</strong>e Forschungsaufgabe von herausragender<br />
Bedeutung, weil Abgrenzungen für jede Form <strong>und</strong> Stufe menschlicher Kultur unentbehrlich<br />
s<strong>in</strong>d. Wahllose Begeisterung für das Überw<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Aufheben von<br />
<strong>Grenzen</strong>, gleich welcher Art, zeugt nur von Naivität oder fortgeschrittener Gedankenlosigkeit,<br />
ke<strong>in</strong>esfalls jedoch von fortschrittlichem Denken, aber das bedeutet nicht,<br />
daß man der Versuchung nachgeben sollte, sie zum Mythos zu stilisieren. Es gibt genug<br />
derartiger Mythen, <strong>und</strong> wir brauchen dabei nicht nur an die häufigen Ansätze <strong>und</strong><br />
unsäglichen Formulierungskünste <strong>im</strong> Deutschen zu denken, etwa an die makabre<br />
Wortschöpfung „blutende <strong>Grenzen</strong>“ 2 ; denn dazu zählt auch der Mythos von den natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> 3 <strong>und</strong> selbstverständlich die „Frontier“, der Mythos von der den<br />
amerikanischen Nationalcharakter prägenden Kraft der wandernden Grenze <strong>im</strong> Zuge<br />
der Westexpansion der Vere<strong>in</strong>igten Staaten, e<strong>in</strong> Mythos, der übrigens unter ähnlichen<br />
Voraussetzungen auch andernorts entstand oder Nachahmung fand wie etwa <strong>in</strong> der<br />
„Frontera“ Chiles. 4 Damit ist schon e<strong>in</strong>e wesentliche Funktion von <strong>Grenzen</strong> für den<br />
nationalen Mythos genannt – mit beträchtlichen Auswirkungen für die Nachbarn <strong>und</strong><br />
damit für das <strong>in</strong>ternationale System.<br />
E<strong>in</strong> für die deutsche Geschichte vergleichbar mythenträchtiges Grenz-Syndrom<br />
heißt Ostkolonisation. Dieser historische Vorgang wurde später, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er vom geschichtlichen<br />
Denken nachhaltig bee<strong>in</strong>flußten Zeit, <strong>in</strong>terpretiert als das Vorantreiben<br />
der nationalen <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Osten seit dem Hochmittelalter, <strong>und</strong> er prägte sich tief <strong>in</strong><br />
das deutsche National- <strong>und</strong> Geschichtsbewußtse<strong>in</strong> e<strong>in</strong>, obwohl sehr zweifelhaft ist,<br />
<strong>in</strong>wieweit sich die neuzeitliche, an Hand des territorial geschlossenen, souveränen<br />
Staates entwickelte Auffassung von präzisen <strong>Grenzen</strong> als wesentliches Element moderner<br />
Staatsbildung 5 überhaupt auf mittelalterliche Verhältnisse anwenden läßt.<br />
1 Deutschland, deutscher Staat, deutsche Nation. Historische Erk<strong>und</strong>ungen e<strong>in</strong>es Spannungsverhältnisses,<br />
hrsg. von PETER KRÜGER, Marburg 1993, S. 42ff.<br />
2 Siehe z. B.: Blutende <strong>Grenzen</strong>. Deutsche Not <strong>in</strong> der Ostmark, hrsg. von PAUL ROGGEN-<br />
HAUSEN, Bielefeld, Leipzig o.J. (Velhagen & Klas<strong>in</strong>gs deutsche Lesebogen, Nr. 172).<br />
3 LUCIEN FEBVRE: »Frontière« Wort <strong>und</strong> Bedeutung [1928], <strong>in</strong>: DERS.: Das Gewissen des<br />
Historikers, Berl<strong>in</strong> 1988, S. 27-38; PETER SAHLINS: Natural Frontiers Revisited. France's<br />
Bo<strong>und</strong>aries s<strong>in</strong>ce the Seventeenth Century, <strong>in</strong>: American Historical Review 95 (1990), S.<br />
1423-1451.<br />
4 FREDERICK JACKSON TURNER: The Frontier <strong>in</strong> American History, New York 19<strong>20</strong>; außerdem<br />
den Roman von LUIS DURAND: Frontera, Santiago de Chile 1949.<br />
5 Anregend darüber SAMUEL E. FINER: State-build<strong>in</strong>g, State Bo<strong>und</strong>aries and Border Control.<br />
An Essay on Certa<strong>in</strong> Aspects of the first State-Build<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Western Europe considered <strong>in</strong><br />
the Light of the Rokkan-Hirschman Model, <strong>in</strong>: Social Science Information 13 (1974), S.<br />
79-126.<br />
40
Wenn auch ke<strong>in</strong>eswegs unbestritten, wurde die seit der zweiten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
maßgeblich von politischen Intentionen bee<strong>in</strong>flußte Rücker<strong>in</strong>nerung an die<br />
Ostkolonisation dann nach 1918, unter den Auspizien des nationalistischen Grenz-<br />
<strong>und</strong> Volkstumskampfes, der emphatisch beschworenen deutschen Kulturmission <strong>im</strong><br />
Osten <strong>und</strong> des noch geschichtsmächtigeren Mythos vom Vorrang beanspruchenden,<br />
kaum abgrenzbaren Reich der Deutschen <strong>in</strong> Mitteleuropa, zu e<strong>in</strong>er erheblichen Bee<strong>in</strong>trächtigung<br />
der Fähigkeit des <strong>in</strong>ternationalen Systems, auf der Basis der neuen <strong>Grenzen</strong><br />
akzeptable, zur Kooperation e<strong>in</strong>ladende Verhältnisse <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> herbeizuführen.<br />
Zweifellos gab es noch andere Bee<strong>in</strong>trächtigungen, <strong>und</strong> das Deutsche Reich<br />
war auch nicht der e<strong>in</strong>zig Schuldige. Trotzdem liegt <strong>in</strong> den jeweils vorherrschenden<br />
nationalen <strong>und</strong> von daher <strong>in</strong> dieser Region tief historisch geprägten Vorstellungen<br />
über die <strong>Grenzen</strong> – Vorstellungen, die mite<strong>in</strong>ander unvere<strong>in</strong>bar waren <strong>und</strong> e<strong>in</strong> von<br />
hoher Konfliktbereitschaft zeugendes Bewußtse<strong>in</strong> hervorbrachten – der schwerwiegendste<br />
Gr<strong>und</strong> für die Ruhelosigkeit <strong>und</strong> Instabilität des ohneh<strong>in</strong> erschütterten <strong>in</strong>ternationalen<br />
Systems <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>. Die neuen <strong>Grenzen</strong> nach dem Ersten Weltkrieg<br />
waren zur Befriedigung sowohl nationalstaatlicher als auch ethnischer Ansprüche<br />
gezogen worden <strong>und</strong> erfüllten <strong>in</strong>folgedessen e<strong>in</strong>e spezifisch moderne Funktion,<br />
die sich allerd<strong>in</strong>gs mit e<strong>in</strong>em <strong>im</strong>mer enger verflochtenen Staatensystem schwer vere<strong>in</strong>baren<br />
ließ. Die Feststellung bedarf allerd<strong>in</strong>gs weiterer Begründungen <strong>und</strong> Überlegungen.<br />
Heutzutage kann man, besonders <strong>in</strong> sogenannten fortschrittlichen Kreisen, den<br />
E<strong>in</strong>druck gew<strong>in</strong>nen, <strong>Grenzen</strong> seien nur noch dazu da, um überw<strong>und</strong>en zu werden, ja –<br />
sie seien Relikte e<strong>in</strong>es überholten Staatsverständnisses des eifersüchtig auf se<strong>in</strong>e Unversehrtheit<br />
bedachten Nationalstaats, e<strong>in</strong>er Wortverb<strong>in</strong>dung von zwei politischgesellschaftlichen<br />
Gestaltungsformen, Staat <strong>und</strong> Nation, die <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e beide obsolet<br />
seien <strong>und</strong> daraus möglichst bald die Konsequenzen zu ziehen hätten. Das ist falsch.<br />
Wer sich heute ernsthaft mit <strong>Grenzen</strong> beschäftigt, sollte dies unvore<strong>in</strong>genommen tun<br />
<strong>und</strong> sie nicht von vornhere<strong>in</strong> zu den Häßlichkeiten des menschlichen Dase<strong>in</strong>s rechnen.<br />
Alle Vorteile <strong>und</strong> Fortschritte des Rechtsstaates, der Verfassung, der Menschen-<br />
<strong>und</strong> Bürgerrechte, <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e der Kultur <strong>und</strong> Gesittung des Menschen s<strong>in</strong>d nur <strong>in</strong> der<br />
Abgegrenztheit des eigenen, überschaubaren Geme<strong>in</strong>wesens durchzusetzen <strong>und</strong> zu<br />
gewährleisten, ungeachtet der Forderung nach ihrer universellen Geltung; denn selbst<br />
wenn sie auf der ganzen Welt durchgesetzt wären, blieben doch die vielen unterschiedlichen,<br />
traditionsgeb<strong>und</strong>enen Formen ihrer Verwirklichung. Aber nicht alle<strong>in</strong><br />
von e<strong>in</strong>er weltumspannenden Kultur- <strong>und</strong> Rechtsgeme<strong>in</strong>schaft, auch von e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>heitlichen<br />
Weltgesellschaft s<strong>in</strong>d wir noch sehr weit entfernt, <strong>und</strong> es ersche<strong>in</strong>t wenigstens<br />
zweifelhaft, ob man diesen Zustand unbed<strong>in</strong>gt ändern sollte, selbst <strong>in</strong> Anbetracht<br />
der Tatsache, daß die Ambivalenz aller menschlichen Gestaltungen die Abgegrenztheit<br />
politischer Organisation zu e<strong>in</strong>er Quelle des Unrechts <strong>und</strong> des Schreckens<br />
machen kann.<br />
Akzeptierte Normen des Verkehrs der Menschen untere<strong>in</strong>ander hängen nicht von<br />
der e<strong>in</strong>heitlichen, grenzenlosen Weltgesellschaft ab. Erst <strong>Grenzen</strong> gewähren die Möglichkeit<br />
wirksamer Maßnahmen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>igermaßen homogenen <strong>und</strong> dauerhafter<br />
41
Ordnung zugänglichen Anwendungsbereich, erst <strong>Grenzen</strong> schaffen die Voraussetzungen<br />
für die Gültigkeit von Maßnahmen über die <strong>Grenzen</strong> h<strong>in</strong>aus durch Interessenausgleich<br />
<strong>und</strong> Vere<strong>in</strong>barungen zwischen den Staaten <strong>und</strong> vor allem durch die Ermöglichung<br />
der adäquaten Verwirklichung geme<strong>in</strong>sam als s<strong>in</strong>nvoll anerkannter Regelungen<br />
<strong>in</strong> unterschiedlichen Rechts- <strong>und</strong> Kulturbereichen.<br />
Dies <strong>in</strong> Rechnung gestellt, erhält der vielgeschmähte, engstirnige Nationalismus<br />
der 1918/19 neu geschaffenen oder nach Umfang <strong>und</strong> Struktur tiefgreifend veränderten<br />
Staaten Osteuropas 6 e<strong>in</strong> etwas anderes Aussehen. Auch wenn ihre Verantwortung<br />
für e<strong>in</strong>e ganze Reihe von Fehlentwicklungen bestehen bleibt, so ist doch anzuerkennen,<br />
daß die klare Abgrenzung des neuen Staatsgebiets <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e volle Unabhängigkeit<br />
<strong>und</strong> nationale Verfügbarkeit e<strong>in</strong>e geradezu existentielle Bedeutung für diese Staaten<br />
<strong>und</strong> ihre, ungeahnte Anstrengungen kostende, Konsolidierung besaß – Unterpfand<br />
ihrer ungesicherten Souveränität. Diese wichtige Funktion der <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> der Unabhängigkeit<br />
gilt <strong>im</strong> Zeitalter des modernen souveränen Staates generell als unentbehrlich<br />
gerade für neue, stark vergrößerte oder anderen gr<strong>und</strong>legenden Veränderungen<br />
unterworfene Staaten. Allerd<strong>in</strong>gs kann die damit gewonnene Eigenständigkeit nur<br />
die Voraussetzung für die Konsolidierung se<strong>in</strong> <strong>und</strong> muß zur Verfassungs-, Verwaltungs-<br />
<strong>und</strong> Gesellschaftsreform als Mittel der staatlichen Integrierung genutzt werden,<br />
wie etwa <strong>in</strong> den Rhe<strong>in</strong>b<strong>und</strong>staaten. Geschlossene, mit nationalistischer Symbolik<br />
überlastete <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> eifersüchtig bewachte Unabhängigkeit auf allen Gebieten<br />
schaffen alle<strong>in</strong> noch ke<strong>in</strong>e dauerhafte Stabilisierung des Staates; beides wirkt <strong>im</strong> Gegenteil<br />
auf Dauer destabilisierend, weil es dann eigentlich zum Selbstzweck erhoben,<br />
das Verhältnis von Zweck <strong>und</strong> Mitteln umgekehrt wird. Hier deuten sich wechselseitig<br />
wirkende Zusammenhänge von Grenze <strong>und</strong> Verfassung an, <strong>und</strong> die Sicherung der<br />
Grenze erhält e<strong>in</strong>e viel umfassendere staatlich-gesellschaftliche D<strong>im</strong>ension; sie erschöpft<br />
sich nicht <strong>in</strong> der Verteidigung oder <strong>in</strong>ternationalen Garantie. Integration von<br />
Staat <strong>und</strong> Gesellschaft ist e<strong>in</strong>e unerläßliche, obgleich ebensowenig ausreichende, Bed<strong>in</strong>gung<br />
der Grenzsicherung; auch das Deutsche Reich hat das <strong>im</strong> Falle Elsaß-<br />
Lothr<strong>in</strong>gens erfahren müssen. Das ist auch nicht erstaunlich, zeigt doch die Bedeutung<br />
der modernen Grenze seit der frühen Neuzeit den Übergang von der dynastischen<br />
Agglomeration, von Erbgew<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Erbteilungen zum modernen Flächenstaat<br />
mit der E<strong>in</strong>heit von Territorium <strong>und</strong> Bevölkerung, Verfassung <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
– e<strong>in</strong> gewaltiger, zeitlich gestreckter Prozeß staatlicher Integration <strong>und</strong> Verdichtung<br />
<strong>in</strong> Europa seit dem Spätmittelalter. Schon hier erweist sich die heute geläufige Floskel<br />
vom Charakter der <strong>Grenzen</strong>, nämlich Barriere oder Interaktionsansporn zu se<strong>in</strong>, als<br />
analytisch unergiebig: Dieser Tatbestand ist ke<strong>in</strong>e funktionale Erklärung, sondern<br />
selbst erklärungsbedürftig, abhängig von den <strong>in</strong>neren Verhältnissen benachbarter<br />
Staaten <strong>und</strong> ihren Beziehungen untere<strong>in</strong>ander, vor allem aber vom Zustand des Staatensystems.<br />
6 Das Jahr 1919 <strong>in</strong> der Tschechoslowakei <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, hrsg. von HANS LEMBERG<br />
<strong>und</strong> PETER HEUMOS, München 1993; Ethnicity and Nationalism. Case Studies <strong>in</strong> their Intr<strong>in</strong>sic<br />
Tension and Political Dynamics, hrsg. von PETER KRÜGER, Marburg 1993.<br />
42
Das Stichwort vom funktionalen Charakter der Grenze ist aber noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiter<br />
zu spannenden Rahmen <strong>in</strong> unserem Zusammenhang wichtig, nämlich bei der Frage<br />
nach unterschiedlichen Arten <strong>und</strong> Funktionen von <strong>Grenzen</strong>, die sich nach 1918 etwa<br />
als mehr oder weniger konfliktfördernd erweisen konnten, <strong>und</strong> vor allem nach<br />
dem Bewußtse<strong>in</strong>, den verbreiteten Vorstellungen, die sich mit best<strong>im</strong>mten <strong>Grenzen</strong>,<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie also den Ostgrenzen des Deutschen Reiches verbanden, gleichgültig,<br />
welcher formalen Klassifikation man sie nun zurechnen möchte. Die nächstliegende<br />
Klassifikation sche<strong>in</strong>t die Unterscheidung zwischen künstlichen <strong>und</strong> natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> zu se<strong>in</strong> – aber auch die <strong>in</strong>zwischen anerkanntermaßen unbefriedigendste. Eigentlich<br />
gibt es nur künstliche <strong>Grenzen</strong>; denn alle s<strong>in</strong>d das Ergebnis menschlicher,<br />
politischer Entscheidungen. Sie können, vor allem bei der Wassergrenze, natürliche<br />
Gegebenheiten dabei zu Hilfe nehmen, aber niemals s<strong>in</strong>d die sogenannten natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> gegebene <strong>Grenzen</strong>, die die Natur selbst gesteckt habe <strong>und</strong> denen deshalb höherer<br />
Rang <strong>und</strong> Wert zukomme. Derartige Urteile führen zu mythischen Überhöhungen,<br />
abgesehen davon, daß natürliche <strong>Grenzen</strong> häufig konfliktreicher <strong>und</strong> unpraktischer<br />
s<strong>in</strong>d als andere. Die Entwicklung der Idee der natürlichen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Frankreich<br />
seit dem 15. Jahrh<strong>und</strong>ert bietet dafür e<strong>in</strong> illustratives Beispiel. 7 Ähnliches gilt<br />
für ethnische, historische oder andere kulturell def<strong>in</strong>ierte <strong>Grenzen</strong> 8 , wenn es um die<br />
Abgrenzung von Staaten geht, <strong>und</strong> weil dafür auch „künstlich/natürlich“ e<strong>in</strong>en abwegigen<br />
Gegensatz <strong>und</strong> „künstlich“ e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>adäquate Bezeichnung darstellt, ist der<br />
Schluß völlig gerechtfertigt, daß echte <strong>Grenzen</strong> nur die politischen <strong>Grenzen</strong> s<strong>in</strong>d, also<br />
die aufgr<strong>und</strong> politischer Maßnahmen <strong>im</strong> weitesten S<strong>in</strong>ne entstandenen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> ihrer<br />
präzisen Festlegung <strong>und</strong> völkerrechtlichen Gültigkeit. Allerd<strong>in</strong>gs entsteht e<strong>in</strong>e<br />
wirkliche politische Grenze <strong>im</strong> modernen S<strong>in</strong>ne nur, wenn alle Beteiligten als gleichberechtigte,<br />
souveräne Staaten anerkannt s<strong>in</strong>d.<br />
Da es sich aber um vom Menschen geschaffene, nicht um gegebene, außerhalb<br />
menschlich-politischer Verfügungsgewalt stehende L<strong>in</strong>ien handelt, können sie auch<br />
bestritten <strong>und</strong> geändert werden. Um so wichtiger werden die Pr<strong>in</strong>zipien <strong>und</strong> Normen,<br />
auf die sich Grenzforderungen stützen lassen, besonders <strong>in</strong> der Moderne seit der<br />
wachsenden Beteiligung breiterer Schichten an der politischen Willensbildung <strong>und</strong><br />
der öffentlichen Me<strong>in</strong>ung, die man gew<strong>in</strong>nen muß. Und so entwickelten die Verfechter<br />
e<strong>in</strong>er best<strong>im</strong>mten Grenzziehung, vor allem unter dem E<strong>in</strong>fluß des Nationalismus<br />
<strong>und</strong> des Nationalstaats, der entsprechenden Forderungen e<strong>in</strong>e viel größere Brisanz<br />
verlieh <strong>und</strong> häufig e<strong>in</strong>en den Spielraum der Politik e<strong>in</strong>engenden Druck ausübte, e<strong>in</strong>e<br />
ungeme<strong>in</strong> ergiebige Phantasie, sobald es darum g<strong>in</strong>g, Pr<strong>in</strong>zipielles zugunsten der eigenen<br />
Forderungen <strong>in</strong>s Feld zu führen – vom Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht bis zum historischen<br />
Recht, von Siedlungs- <strong>und</strong> Kulturräumen bis zu Wirtschaftszusammenhängen<br />
<strong>und</strong> strategischen Notwendigkeiten. Spannungen, die daraus entstehen, s<strong>in</strong>d desto gefährlicher<br />
je größer die Diskrepanz ist zwischen e<strong>in</strong>er Grenze <strong>und</strong> den über sie h<strong>in</strong>ausreichenden<br />
wirtschaftlichen, kulturellen, ethnischen <strong>und</strong> anderen Regionen.<br />
7 Siehe dazu Anm. 3.<br />
8 ULRICH ANTE: Politische Geographie, Braunschweig 1981, S. 104 ff.<br />
43
Aus denselben Bed<strong>in</strong>gungen heraus hat die Grenzsicherung e<strong>in</strong> ganz anderes Gewicht<br />
als früher gewonnen. Gerade weil die <strong>Grenzen</strong> präzisiert, demarkiert, bewacht<br />
werden, wahrnehmbar geworden s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> auch für den e<strong>in</strong>zelnen spürbare Konsequenzen<br />
haben, entsteht zugleich mit ihnen ihre Unsicherheit: Sie können nicht nur<br />
dauernd, selbst aus ger<strong>in</strong>gfügigen Anlässen, verletzt werden, was meist empf<strong>in</strong>dliche<br />
Reaktionen nach sich zieht, vielmehr wird ihre Unsicherheit zu e<strong>in</strong>em gr<strong>und</strong>legenden<br />
Problem. Es geht um die territoriale Sicherheit <strong>und</strong> damit um die Sicherheit des modernen<br />
Staates überhaupt. Je weiter sich die Kriegsmittel entwickeln, desto verw<strong>und</strong>barer<br />
wird er. Deshalb wird so große Mühe darauf verwendet, die Unverletzlichkeit<br />
der <strong>Grenzen</strong> als vorrangiges Völkerrechtspr<strong>in</strong>zip zu verankern <strong>und</strong> für entsprechende<br />
Garantien zu sorgen. Damit ist man darauf angewiesen, funktionierende Formen <strong>in</strong>ternationaler<br />
Organisation zu etablieren, e<strong>in</strong>e Anstrengung, die sich von der Ordnung<br />
des Wiener Kongresses bis zu den neuen <strong>in</strong>ternationalen <strong>Institut</strong>ionen des Völkerb<strong>und</strong>s<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>es Artikels 10 zieht, der für die neuen ostmitteleuropäischen Staaten<br />
von so großer Bedeutung war – wenn es nur gelungen wäre, automatisch wirksame<br />
Garantieverpflichtungen des Völkerb<strong>und</strong>es <strong>im</strong> Falle der Gefahr zu erlangen. E<strong>in</strong>e solche<br />
direkte Sanktionsverpflichtung g<strong>in</strong>g den meisten Regierungen 1919 <strong>und</strong> danach<br />
zu weit, <strong>und</strong> so rief die umstrittene Regelung der Grenzfragen <strong>und</strong> ihre Belastung des<br />
<strong>in</strong>ternationalen Systems <strong>in</strong> der Folgezeit den unzutreffenden E<strong>in</strong>druck hervor, daß<br />
konfliktträchtige Konsequenzen aus <strong>in</strong>ternationalen Grenzregelungen unvermeidlich<br />
seien. Daß Grenzregelungen als Interessenausgleich <strong>und</strong> entspannender Konsolidierungsvorgang<br />
zum Instrument e<strong>in</strong>er dauerhaften <strong>in</strong>ternationalen Ordnung werden<br />
können, hat demgegenüber der Wiener Kongreß bewiesen. Allerd<strong>in</strong>gs waren dafür<br />
e<strong>in</strong>vernehmliche europäische Lösungen die Voraussetzung. Diese Voraussetzung war<br />
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg nicht gegeben.<br />
Es gibt noch e<strong>in</strong>e Sonderform der Grenze, von der bisher nicht die Rede war, <strong>und</strong><br />
man mag auf den ersten Blick berechtigte Zweifel äußern, ob sie mit den umstrittenen<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> seit 1918 irgend etwas zu tun hat: Es handelt sich um<br />
ganz oder partiell offene, sich verschiebende Grenzräume. Der klassische Fall ist die<br />
amerikanische „Frontier“, die kont<strong>in</strong>entale Erschließung <strong>und</strong> Verschiebung der<br />
Grenzregionen <strong>im</strong> Zuge der Westexpansion der Vere<strong>in</strong>igten Staaten. 9 In Deutschland<br />
wäre Vergleichbares höchstens <strong>in</strong> der deutschen Ostsiedlung des Mittelalters 10 zu f<strong>in</strong>-<br />
9 JOHN MACK FARAGHER: The Frontier Trail. Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Turner and Re<strong>im</strong>ag<strong>in</strong><strong>in</strong>g the American<br />
West (Review Article), <strong>in</strong>: American Historical Review 98 (1993), S. 106-117; The<br />
American Frontier. Oppos<strong>in</strong>g Viewpo<strong>in</strong>ts, hrsg. von MARY ELLEN JONES, San Diego 1994.<br />
10 LOTHAR DRALLE: Die Deutschen <strong>in</strong> Ostmittel- <strong>und</strong> Osteuropa. E<strong>in</strong> Jahrtausend europäischer<br />
Geschichte, Darmstadt 1991; JAN PISKORSKI: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters<br />
<strong>in</strong> der Entwicklung des östlichen Mitteleuropa. Zum Stand der Forschung aus polnischer<br />
Sicht, <strong>in</strong>: Jahrbuch für die Geschichte Ost- <strong>und</strong> Mitteldeutschlands 40 (1991), S. 27-<br />
84; PETER ERLEN: Europäischer Landesausbau <strong>und</strong> mittelalterliche Ostsiedlung. E<strong>in</strong> struktureller<br />
Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden <strong>und</strong> dem Ordensland<br />
Preußen, Marburg 1992; Die historische Wirkung der östlichen Regionen des Reiches,<br />
hrsg. von HANS ROTHE, Köln u.a. 1992; ROBERT BARTLETT: The Mak<strong>in</strong>g of Europe. Conquest,<br />
Colonization, and Cultural Change, 950-1350, London 1993.<br />
44
den. Nun ist <strong>im</strong>mer wieder umstritten, was vergleichbar ist. Zu Recht hat sich Klaus<br />
Zernack dagegen gewehrt, daß nur solche Phänomene sich vergleichen ließen, „deren<br />
strukturelle Vergleichbarkeit vorgegeben sei. Das ist schon re<strong>in</strong> methodologisch e<strong>in</strong><br />
Zirkel <strong>und</strong> sachlich völlig unergiebig. Denn erst <strong>in</strong> der Prüfung von Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mungen,<br />
Abweichungen <strong>und</strong> Kontrasten sowie der jeweils <strong>in</strong>dividuellen Bed<strong>in</strong>gungen der<br />
historischen Phänomene werden die Strukturen erkennbar“. 11 Im vorliegenden Fall<br />
möchte ich noch etwas weitergehen. Gerade die beträchtlichen zeitlichen, kulturellen<br />
<strong>und</strong> räumlichen Unterschiede machen den Vergleich ähnlicher historischer Phänomene<br />
– hier der <strong>im</strong>mer weiter getriebenen Siedlungsexpansion, verb<strong>und</strong>en mit der Ausdehnung<br />
best<strong>im</strong>mter Formen des Rechts, des Wirtschaftens, der Herrschaft etc. –<br />
fruchtbar, sofern man entweder die Unterschiede erfassen oder – was me<strong>in</strong>e Absicht<br />
ist – aus der Fülle der Unterschiede die wenigen um so bemerkenswerteren Ähnlichkeiten<br />
hervorheben will. Kühn bleibt trotzdem die Behauptung, daß dies zum Thema<br />
gehören soll.<br />
Dietrich Gerhard gehört zu den ganz wenigen Historikern, die diesen Vergleich als<br />
Teil e<strong>in</strong>es umfangreichen, für e<strong>in</strong>e umfassende Fragestellung gedachten Satzes an<br />
Beispielen versucht haben. Das liegt gut 40 Jahre zurück. Er kommt zu dem Ergebnis,<br />
daß Siedlungsexpansion <strong>und</strong> B<strong>in</strong>nenwanderung eng zusammengehörten <strong>und</strong> daß für<br />
beides, vor allem aber für die „wandernde Grenze“ der „mobile Charakter e<strong>in</strong>er Gesellschaft“<br />
maßgebend sei. Infolgedessen gebe es zwar sehr unterschiedliche Formen<br />
<strong>und</strong> Bed<strong>in</strong>gungen der Siedlungsexpansion <strong>und</strong> der wandernden Grenze <strong>in</strong> den von<br />
ihm vornehmlich herangezogenen Beispielen der Vere<strong>in</strong>igten Staaten, Kanadas, Australiens<br />
<strong>und</strong> Rußlands, gr<strong>und</strong>legend aber bleibe, daß es sich hierbei um gesellschaftliche<br />
Mobilität <strong>und</strong> um e<strong>in</strong>e Lebensordnung gehandelt habe, „die entweder die ständische<br />
Gliederung, die e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>zug des alten Europa gewesen war, nie entwickelt hat<br />
oder aber <strong>im</strong> Begriff war, sich von ihr zu befreien“. Deshalb gehöre die Ostkolonisation<br />
gerade nicht dazu <strong>und</strong> sei mit der Frontier nicht vergleichbar. Denn: „Gewiß war<br />
auch die alteuropäische Gesellschaft, vom geographischen oder vom gesellschaftlichen<br />
Gesichtspunkt gesehen, ke<strong>in</strong>eswegs statisch. Und doch unterscheidet sie sich<br />
von der Entwicklung, die seit dem 18. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong> der Französischen Revolution<br />
Europa ergriffen hat, vor allem dadurch, daß sie Überlieferung <strong>und</strong> soziale Gliederung<br />
akzeptierte, daß die soziale Mobilität sie nicht best<strong>im</strong>mte. Indem Turner die entgegengesetzten<br />
Merkmale der amerikanischen ‚frontier‘ betonte, arbeitete er jene Züge<br />
heraus, die der amerikanischen Gesellschaft eigentümlich s<strong>in</strong>d.“ 12<br />
Die Geme<strong>in</strong>samkeiten <strong>und</strong> damit die Vergleichsglieder hauptsächlich <strong>in</strong> der gesellschaftlichen<br />
Mobilität <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Befreiung von der Feudal- <strong>und</strong> Ständegesellschaft<br />
zu sehen, ersche<strong>in</strong>t mir nicht nur zu eng, sondern am Kern der Sache vorbeizu-<br />
11 KLAUS ZERNACK: „Ostkolonisation“ <strong>in</strong> universalgeschichtlicher Perspektive, <strong>in</strong>: Universalgeschichte<br />
<strong>und</strong> Nationalgeschichte, hrsg. von G. HÜBINGER u.a. Festschrift für Ernst Schul<strong>in</strong>,<br />
Freiburg i. Br. 1994, S. 109.<br />
12 DIETRICH GERHARD: Neusiedlung <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelles Erbe. Zum Problem von Turners<br />
„Frontier“. E<strong>in</strong>e vergleichende Geschichtsbetrachtung, <strong>in</strong>: DERS.: Alte <strong>und</strong> neue Welt <strong>in</strong><br />
vergleichender Geschichtsbetrachtung, Gött<strong>in</strong>gen 1962, S. 139 f. (engl. Or. 1959).<br />
45
gehen. Der Bezugspunkt der Französischen Revolution <strong>und</strong> der großen Wende zur<br />
Moderne ist bei e<strong>in</strong>em Vergleich unterschiedlicher, zeitlich weit ause<strong>in</strong>anderliegender<br />
Prozesse abwegig. So lohnend auch unter E<strong>in</strong>beziehung der geographischen Forschung<br />
– der Vergleich Ostsiedlung/Frontier wird für Stadt <strong>und</strong> Land gelegentlich<br />
durchaus gezogen 13 – e<strong>in</strong>e umfassende Erörterung wäre, sie muß hier auf sich beruhen,<br />
abgesehen von wenigen Überlegungen <strong>in</strong> Beschränkung auf unser Thema. Selbst<br />
wenn man allgeme<strong>in</strong> an der Modernisierungswirkung von Siedlungsexpansion festhalten<br />
will, ist der Vergleich mit der Ostsiedlung sehr wohl möglich <strong>und</strong> auch ergiebig.<br />
Mobilität <strong>und</strong> Modernisierung s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Monopole der modernen Gesellschaft,<br />
wie sie sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts durchsetzte, sondern Kennzeichen<br />
auch des Höhepunkts der Ostsiedlung <strong>im</strong> Mittelalter, <strong>in</strong> der Zeit vom 12. bis<br />
14. Jahrh<strong>und</strong>ert. Deren Bedeutung liegt gerade dar<strong>in</strong>, daß sie Teil – wenn auch e<strong>in</strong> besonders<br />
wichtiger – e<strong>in</strong>es gewaltigen Entwicklungsschubs von europäischen Ausmaßen<br />
war, der, teils <strong>in</strong> der Siedlungsexpansion, teils <strong>im</strong> Landesausbau, nicht nur periphere<br />
Rückständigkeiten ausglich <strong>und</strong> Osteuropa an die gesamteuropäische Entwicklung<br />
anschloß, sondern von den ländlichen <strong>und</strong> städtischen Siedlungsformen über die<br />
Verbesserung der Produktions-, Wirtschafts- <strong>und</strong> Verkehrsstruktur bis zu den Formen<br />
der politischen, gesellschaftlichen <strong>und</strong> kirchlichen Organisation e<strong>in</strong>e durchaus planmäßige<br />
Ausgestaltung <strong>und</strong> Verbesserung brachte. Insoweit hält dieser vielfältige <strong>und</strong><br />
differenzierte Prozeß e<strong>in</strong>em Vergleich mit der Erschließung des amerikanischen Westens<br />
durchaus stand. Wie tief <strong>und</strong> <strong>in</strong> welcher H<strong>in</strong>sicht dieser Vorgang die Entfaltung<br />
der Vere<strong>in</strong>igten Staaten bee<strong>in</strong>flußte oder prägte, ist <strong>in</strong>sgesamt <strong>im</strong>mer noch schwer abzuschätzen.<br />
Die neueste amerikanische Forschung darüber ist fasz<strong>in</strong>ierend <strong>und</strong> reicht<br />
<strong>in</strong> ihren, lokale <strong>und</strong> regionale Entwicklungen mit säkularen Trends sowie methodischer<br />
Vielfalt verb<strong>in</strong>denden, unseren landesgeschichtlichen Forschungen teilweise<br />
ähnlichen Untersuchungen weit h<strong>in</strong>aus über die berühmte, enorm e<strong>in</strong>flußreiche Frontier-These<br />
des amerikanischen Historikers Frederick Jackson Turner von 1893 14 , auf<br />
die Gerhard <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en von mir zitierten Sätzen Bezug nahm. Für Turner wurde die<br />
Frontier zur wichtigsten Kraft e<strong>in</strong>er eigenständigen amerikanischen Geschichte, das<br />
anfangs unermeßliche freie Land <strong>im</strong> Westen zum Unterpfand des <strong>im</strong>mer wieder erneuerten<br />
Pioniergeistes <strong>und</strong> vor allem der fortschreitenden Demokratisierung. Die<br />
Heranbildung e<strong>in</strong>es genu<strong>in</strong> amerikanischen, nicht mehr von europäischen Traditionen<br />
abhängigen Nationalcharakters verband sich mit dieser Kräftigung <strong>und</strong> Entfaltung der<br />
Demokratie.<br />
Obwohl diese nachhaltige These <strong>in</strong> der generellen Form e<strong>in</strong>er gr<strong>und</strong>legenden Bedeutung<br />
des Westens für die amerikanische Geschichte trotz aller späteren Kritik –<br />
besonders an der Demokratisierungsthese – gültig <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ständige Herausforderung<br />
für nachfolgende Historikergenerationen blieb, handelt es sich doch auch um e<strong>in</strong>e Heroisierung,<br />
e<strong>in</strong>en sich tief <strong>und</strong> wirksam e<strong>in</strong>prägenden Mythos des amerikanischen Na-<br />
13 HANS-JÜRGEN NITZ: Historical Geography, <strong>in</strong>: 40 Years after. German Geography. Developments,<br />
Trends and Prospects 1952-1992, hrsg. von ECKART EHLERS, Bonn 1992, S. 145-<br />
172.<br />
14 Siehe dazu Anm. 3 <strong>und</strong> 9.<br />
46
tional- <strong>und</strong> Geschichtsbewußtse<strong>in</strong>s. Und das ist der Punkt, der für unser Thema bedeutsam<br />
ist. Es geht um die Wirkung des Mythos von der Grenze auf die <strong>in</strong>ternationalen<br />
Beziehungen seit dem Ersten Weltkrieg, nicht um irgende<strong>in</strong>e Berufung auf historische<br />
<strong>Grenzen</strong> selbst; <strong>und</strong> der amerikanische Frontier-Mythos bildet den klärenden<br />
Kontrast zu den Wirkungen vom Mythos der deutschen Ostkolonisation. Dies soll<br />
aber durch den noch etwas weitergeführten Vergleich zwischen beiden historischen<br />
Prozessen samt ihrer Mythologisierung vertieft werden, wobei <strong>in</strong> bezug auf die Mythen<br />
sofort <strong>in</strong>s Auge spr<strong>in</strong>gt, daß es sich <strong>im</strong> deutschen Fall um e<strong>in</strong>en historisch gebrochenen<br />
Rückgriff auf e<strong>in</strong>en viele Jahrh<strong>und</strong>erte zurückliegenden Prozeß handelt, <strong>im</strong><br />
amerikanischen Fall h<strong>in</strong>gegen um <strong>in</strong> ihrer Schlußphase noch erlebte Vorgänge, um<br />
e<strong>in</strong> unmittelbares Anknüpfen an die jüngste Vergangenheit.<br />
Turners Frontier-Mythos sollte die nationale Demokratie stärken, ihr die Aufbruchsenergie<br />
e<strong>in</strong>er großen Vergangenheit geben, <strong>und</strong> es ist nicht zu leugnen, daß<br />
Appelle zur Bewältigung neuer großer Aufgaben, der „New Frontiers“, die Amerikaner<br />
<strong>im</strong>mer wieder st<strong>im</strong>uliert, sie auf die Verwirklichung ihrer Tugenden <strong>und</strong> Ideale<br />
festgelegt haben. Der Funktion nach handelt es sich also – trotz mancher Skepsis –<br />
um e<strong>in</strong>en die moderne demokratische Gesellschaft <strong>und</strong> den nationalen Verfassungsstaat<br />
fördernden Mythos. Das kann man vom Mythos der Ostkolonisation best<strong>im</strong>mt<br />
nicht behaupten – ganz <strong>im</strong> Gegenteil. Für unser Thema ist wichtig, ob das <strong>in</strong> der Sache,<br />
dem historischen Prozeß selbst lag oder Folge des Jahrh<strong>und</strong>erte später erst, nach<br />
dem alles verändernden Durchbruch der modernen Welt geformten Mythos war – e<strong>in</strong><br />
Mythos, der se<strong>in</strong>e schärfste, anti-moderne Ausprägung <strong>in</strong> dem mit großen Krisen verb<strong>und</strong>enen<br />
neuen Aufbruch zu e<strong>in</strong>er neuen Moderne <strong>in</strong> der Zeit von den 1880er bis <strong>in</strong><br />
die 1930er Jahre erhielt. 15 Um dies zu klären, möchte ich mit e<strong>in</strong>igen kurzen H<strong>in</strong>weisen<br />
den Vergleich zwischen Frontier <strong>und</strong> Ostsiedlung auf Gebiete lenken, auf denen<br />
er bisher nicht durchgeführt wurde, wobei es hier um gewisse Ähnlichkeiten geht <strong>und</strong><br />
die großen Unterschiede beiseite bleiben.<br />
Voraussetzung für beide Prozesse, die ihrer Bedeutung nach Entwicklungsschübe<br />
für die Peripherie von seltener Intensität <strong>und</strong> dauerhaft verändernder Wirkung auslösten,<br />
waren Intensivierungs- oder Verdichtungsvorgänge <strong>in</strong> den jeweiligen Zentren<br />
(Bevölkerungsvermehrung, Produktivitätsfortschritte durch technische <strong>und</strong> organisatorische<br />
Verbesserungen, Kapitalbildung, straffere politische <strong>und</strong> adm<strong>in</strong>istrative Zusammenfassung<br />
auf verschiedenen Ebenen). Sie ermöglichten es erst, daß <strong>in</strong> beiden<br />
Fällen der Siedlungsexpansion Rahmenbed<strong>in</strong>gungen gesetzt wurden, welche die künftige<br />
Organisation der zu erschließenden Gebiete, ihre Siedlungsform, ihre rechtliche<br />
<strong>und</strong> politische, ja ihre Verfassungsgestaltung festlegten.<br />
Ostsiedlung (besonders vom 12.-14. Jahrh<strong>und</strong>ert) wie Frontier (von der Kolonialzeit<br />
bis weit <strong>in</strong> die zweite Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts) waren Teil umfassender Wanderungs-<br />
<strong>und</strong> Ausbauprozesse; sie zogen auf sich <strong>und</strong> konzentrierten Migrationsbewegungen<br />
mit weitem E<strong>in</strong>zugsbereich. Für die Frontier ist das klar, aber auch die<br />
Ostsiedlung war ja ke<strong>in</strong> nur von Deutschen getragener Prozeß. Sie stand <strong>im</strong> großen<br />
15<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertwende. Der Aufbruch <strong>in</strong> die Moderne 1880-1930, 2 Bde., hrsg. von AUGUST<br />
NITSCHKE u.a., Re<strong>in</strong>bek 1990.<br />
47
Zusammenhang des Landesausbaus, der Ausbreitung <strong>und</strong> Intensivierung der Lebens-<br />
<strong>und</strong> Gesellschaftsformen Europas; die amerikanische Frontier war Teil der letzten<br />
großen Wellen europäischer Siedlungserschließung <strong>in</strong> Übersee. Mit der Ausdehnung<br />
des Reiches <strong>und</strong> deutscher Territorialherrschaft auf der e<strong>in</strong>en, der Vere<strong>in</strong>igten Staaten<br />
auf der anderen Seite war e<strong>in</strong>e relativ rasche Besiedlung, organisatorische Dichte <strong>und</strong><br />
Geschlossenheit <strong>in</strong> abgegrenzten Territorien verb<strong>und</strong>en, Voraussetzung für die Konsolidierung<br />
<strong>und</strong> das Fortschreiten der Erschließung weiterer Regionen. Erschließung<br />
ist <strong>in</strong> umfassendem S<strong>in</strong>n zu verstehen – von der Siedlung über neue Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Verkehrsstrukturen bis zur neuen rechtlich-verfassungsmäßigen <strong>und</strong> kirchlichen Ordnung<br />
– <strong>und</strong> war verb<strong>und</strong>en mit Modernisierung <strong>und</strong> Ausgestaltung der mitgebrachten<br />
politisch-gesellschaftlichen Organisationsformen. Es handelte sich um gewaltige, beschleunigte<br />
Entwicklungsprozesse, die E<strong>in</strong>beziehung der erschlossenen Gebiete <strong>in</strong> die<br />
Gesamtstruktur der – <strong>und</strong> das ist wichtig – selbst <strong>in</strong> rascher Entfaltung begriffenen<br />
Altländer: e<strong>in</strong>e wesentliche Etappe <strong>in</strong> der Europäisierung Europas <strong>und</strong> der Amerikanisierung<br />
Amerikas.<br />
Den wichtigsten Zusammenhang für unser Thema bildet dabei die Bedeutung von<br />
Ostsiedlung <strong>und</strong> Frontier für Staat, Nation <strong>und</strong> Verfassung. Im amerikanischen Fall<br />
ist dieser Zusammenhang unmittelbar gegeben, <strong>im</strong> Falle der deutschen Ostsiedlung<br />
muß man von längeren <strong>und</strong> komplizierteren Entwicklungen ausgehen. Trotzdem handelte<br />
es sich auch hier um Gr<strong>und</strong>lagen, Ansätze zum Prozeß der Staatsbildung auf territorialer<br />
Basis. Und was den zweiten, <strong>in</strong> der deutschen Geschichte ebenso schwierigen<br />
Begriff angeht, den der Nation, so kann man sich dem behutsamen Urteil Helmut<br />
Beumanns aus dem Jahre 1988 anschließen: Zu den „Entstehungspotentialen“ der<br />
deutschen Nation <strong>im</strong> Mittelalter gehöre die lange Ostgrenze zur heidnischen Welt,<br />
„e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>guläre Herausforderung, die <strong>in</strong> der ersten Phase“ der Nationsbildung „<strong>im</strong> Bed<strong>in</strong>gungszusammenhang<br />
mit der Kaiserpolitik zur ottonischen Missionspolitik, später<br />
zum Landesausbau bei der Ostsiedlungsbewegung seit dem 12. Jahrh<strong>und</strong>ert geführt<br />
hat“. 16 Und was den E<strong>in</strong>fluß auf die Rechts- <strong>und</strong> Verfassungsentwicklung angeht, so<br />
hat er se<strong>in</strong>e Basis <strong>in</strong> der Verfügung der Regierung der Vere<strong>in</strong>igten Staaten e<strong>in</strong>erseits,<br />
der Fürsten, Bischöfe, Orden etc. andererseits über den zu besiedelnden Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Boden. Dies ermöglichte über die Richtl<strong>in</strong>ien zur Besiedlungsform <strong>in</strong> beiden Fällen<br />
Verfassunggebung. Die präzisen Anweisungen <strong>in</strong> den spätmittelalterlichen Urk<strong>und</strong>en<br />
wie <strong>in</strong> den amerikanischen Landverordnungen von 1785 <strong>und</strong> 1787 regelten zusammen<br />
mit der Bodenvergabe Rechte <strong>und</strong> Pflichten der Siedler, verzahnten Land- <strong>und</strong> Stadtsiedlung,<br />
sorgten für planmäßige Anlage von Städten <strong>und</strong> Dörfern, gaben Rechtsnormen<br />
vor <strong>und</strong> legten die Gestaltung größerer territorialer E<strong>in</strong>heiten fest. 17 Selbstver-<br />
16 HELMUT BEUMANN: Europäische Nationenbildung <strong>im</strong> Mittelalter, <strong>in</strong>: Geschichte <strong>in</strong> Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Unterricht 39 (1988), S. 591.<br />
17 Urk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung <strong>im</strong> Mittelalter, 2 Bde., hrsg.<br />
von HERBERT HELBIG <strong>und</strong> LORENZ WEINRICH, Darmstadt 1968-70; Documents on American<br />
History, New York 1944, Nr. 78, 82; HERMANN WELLENREUTHER: „First pr<strong>in</strong>ciples of<br />
freedom“ <strong>und</strong> die Vere<strong>in</strong>igten Staaten als Kolonialmacht, 1781-1803: Die Northwest Ord<strong>in</strong>ance<br />
von 1787 <strong>und</strong> ihre Verwirklichung <strong>im</strong> Northwest Territory, <strong>in</strong>: Revolution <strong>und</strong> Be-<br />
48
ständlich gab es <strong>im</strong> e<strong>in</strong>zelnen große Unterschiede, aber <strong>in</strong> den Gr<strong>und</strong>zügen e<strong>in</strong>er<br />
rechtlich geregelten, den Neusiedlern besseres Recht <strong>und</strong> ihren Ansiedlungen e<strong>in</strong>e<br />
planmäßigere modernere Struktur verschaffenden Siedlungsexpansion mit Modernisierungsschüben,<br />
Verfassungsübertragungen <strong>und</strong> – obgleich <strong>im</strong> deutschen Fall sehr<br />
begrenzten – Freiräumen zur Selbstgestaltung liegen doch bemerkenswerte Parallelen.<br />
18<br />
Die Form der Rücker<strong>in</strong>nerung nun, des Mythos, der sich bildete, ist maßgebend<br />
für den E<strong>in</strong>fluß der nach Osten verschobenen Grenzräume der mittelalterlichen Ostsiedlung<br />
auf die deutsche Haltung gegenüber den Ostgrenzen von 1919 <strong>und</strong> auf die<br />
besondere Funktion, die man ihnen zuschrieb. Wie die vergleichende Betrachtung der<br />
Ostsiedlung mit der Entwicklung <strong>und</strong> dem Mythos der Frontier gezeigt hat, wäre auch<br />
<strong>im</strong> deutschen Fall e<strong>in</strong> sogenannter fortschrittlicher Mythos der Ostsiedlung denkbar<br />
gewesen, der sich vornehmlich auf Modernisierung, neue Gestaltungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> – etwa <strong>im</strong> Blick auf historische Begründungen für europäische Kooperation – gesamteuropäische<br />
Prozesse unter nachhaltiger deutscher Beteiligung hätte berufen<br />
können. Aber schon <strong>in</strong> der Nationalversammlung von 1848/49 wurden gelegentlich<br />
der Vorrang des Reiches <strong>und</strong> die national-deutsche Kulturmission <strong>in</strong> Osteuropa beschworen<br />
19 ; <strong>und</strong> <strong>im</strong> Zuge der repressiven Polenpolitik Preußens <strong>20</strong> <strong>und</strong> vor allem des<br />
sich verschärfenden, <strong>in</strong>tegralen <strong>und</strong> teilweise schon völkische Züge annehmenden<br />
deutschen Nationalismus <strong>im</strong> Kaiserreich nahm der Mythos der Ostsiedlung e<strong>in</strong>e ganz<br />
andere, anti-moderne Gestalt an. Man berief sich auf die Geschichte, auf Glanz <strong>und</strong><br />
Erfolge der Ostsiedlung, <strong>und</strong> behauptete, e<strong>in</strong> geschichtliches Recht auf die kulturelle<br />
<strong>und</strong> politische Vormachtstellung der Deutschen „<strong>im</strong> Osten“ zu haben. Infolgedessen<br />
erhielt die Grenze e<strong>in</strong>e ganz neue, destabilisierende Funktion. In der Reduzierung <strong>und</strong><br />
historischen Verfälschung der Ostsiedlung auf e<strong>in</strong>e anachronistische deutschnationale<br />
Großleistung – der Historikerstreit der 1860er Jahre über die richtige Kaiserpolitik<br />
<strong>im</strong> Mittelalter lieferte erste Stichworte: Nationalpolitische Ostexpansion<br />
oder <strong>im</strong>periale Italienpolitik – bereitete sich die Forderung nach e<strong>in</strong>er als Wiederaufnahme<br />
deklarierten Expansion des Deutschtums <strong>im</strong> Osten vor. Nicht nur <strong>in</strong> Deutsch-<br />
wahrung. Untersuchungen zum Spannungsverhältnis von revolutionärem Selbstverständnis<br />
<strong>und</strong> politischer Praxis <strong>in</strong> den Vere<strong>in</strong>igten Staaten von Amerika, hrsg. von ERICH ANGER-<br />
MANN, München 1979 (Historische Zeitschrift, Beiheft 5 – neue Folge), S. 89-188.<br />
18 Walter Schles<strong>in</strong>ger schrieb 1963 (zitiert bei ROTHE – wie Anm. 10, S. 35), ostdeutsche Kolonisierung<br />
sei nicht nur bloßer Landesausbau, sondern e<strong>in</strong>e Bewegung, die mit der Ostwanderung<br />
deutscher Bevölkerung <strong>und</strong> „mit der Ausdehnung politischer Herrschaft, mit<br />
der Mission <strong>und</strong> der Übertragung westlicher Rechts-, Wirtschafts- <strong>und</strong> Verfassungsformen<br />
nach dem Osten auf das <strong>in</strong>nigste verflochten“ sei.<br />
19 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituirenden Nationalversammlung,<br />
hrsg. von FRANZ WIGARD, Bd. 7, S. 4927-4929, Bd. 8, S. 5721 (Abg.<br />
Schulz, 29.1. u. 15.3.1849).<br />
<strong>20</strong> BRIGITTE BALZER: Die preußische Polenpolitik 1894-1908 <strong>und</strong> die Haltung der deutschen<br />
konservativen <strong>und</strong> liberalen Parteien. Unter besonderer Berücksichtigung der Prov<strong>in</strong>z Posen,<br />
Frankfurt a.M. (usw.) 1990.<br />
49
land verbreitete Vorstellungen e<strong>in</strong>er beg<strong>in</strong>nenden großen Ause<strong>in</strong>andersetzung zwischen<br />
Germanentum <strong>und</strong> Slawentum kennzeichneten den ideologischen H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>.<br />
Unter diesen Voraussetzungen kam es vor allem seit dem Ende des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
zu e<strong>in</strong>em oberflächlich absurd wirkenden, dennoch folgerichtigen <strong>und</strong> für die<br />
Unsicherheit der deutschen <strong>Grenzen</strong> nach 1918 gr<strong>und</strong>legenden Vorgang. In der <strong>im</strong>mer<br />
schärferen Wendung gegen die polnische Bevölkerung <strong>in</strong> den preußischen Ostprov<strong>in</strong>zen<br />
wurden die bestehenden politischen <strong>Grenzen</strong> zwischen Rußland <strong>und</strong> dem<br />
Deutschen Reich quasi unterlaufen <strong>und</strong> traten h<strong>in</strong>ter den Sprach- <strong>und</strong> Siedlungsgrenzen<br />
zurück. Das führte zu e<strong>in</strong>em Grenzkampf ohne strittige politische <strong>Grenzen</strong>, weil<br />
es sich schon um e<strong>in</strong>en Volkstumskampf handelte, dessen <strong>Grenzen</strong> ganz woanders<br />
verliefen. Aus ihm jedoch entwickelte sich <strong>in</strong> falscher historischer Analogiebildung<br />
die Vorstellung von e<strong>in</strong>em erneut offenen <strong>und</strong> umkämpften Grenzraum <strong>im</strong> Osten, <strong>in</strong><br />
dem man die deutsche Vormacht <strong>und</strong> überlegene Kultur durchsetzen müsse. Neben<br />
anderen politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Interessen, die sich diese Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
zunutze zu machen suchten, s<strong>in</strong>d die der ostelbischen Großgr<strong>und</strong>besitzer zu<br />
nennen, die den gesellschaftlichen Wert von landwirtschaftlicher Siedlungsausdehnung<br />
<strong>und</strong> Ertragssteigerung <strong>in</strong> dezidierter, anti-moderner Wendung gegen Industriewirtschaft<br />
<strong>und</strong> Großstadtentwicklung hervorhoben. Ihren Propagandisten fiel die Umdeutung<br />
der Ostsiedlung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Agrarmythos leicht; e<strong>in</strong> Pendant dazu ist „the agrarian<br />
myth“ <strong>im</strong> amerikanischen Westen. 21 In Anlehnung an die Festigung der Grenzräume<br />
mit Hilfe der Markgrafschaften oder Marken war nun wieder von der Ostmark<br />
die Rede, die vom Slawentum bedroht sei. Ke<strong>in</strong> Ger<strong>in</strong>gerer als Fritz Hartung hat <strong>in</strong><br />
Lexikonartikeln von 1923 dieses historisierende Aufgreifen alter Formen anschaulich<br />
gemacht: „Ostmark [...] heißen seit dem <strong>19.</strong> Jahrh. die nord-östlichen, durch die Polen<br />
gefährdeten Grenzgebiete Deutschlands [...].“ Und Ostmarkenpolitik war der Kampf<br />
für das Deutschtum <strong>in</strong> bedrohter Grenzregion (aber mit Gehaltszulage): Im Herbst<br />
1894 wurde der Ostmarkenvere<strong>in</strong> zur Stärkung des nationalen Bewußtse<strong>in</strong>s <strong>und</strong> zur<br />
kulturellen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Kräftigung des Deutschtums <strong>in</strong> den preußischen Ostprov<strong>in</strong>zen<br />
gegründet; e<strong>in</strong> zeittypischer Agitationsvere<strong>in</strong>, der <strong>in</strong> prononcierter Gegnerschaft<br />
zur angeblich zu polenfre<strong>und</strong>lichen Regierungspolitik entstand – diese Schwächung<br />
der Regierungspolitik verschärfte sich nach 1918 noch <strong>im</strong> antirepublikanischen<br />
S<strong>in</strong>ne. Der Vere<strong>in</strong> hatte beträchtlichen Erfolg <strong>in</strong> der lobbyistischen Mobilisierung von<br />
kostspieligen staatlichen Unterstützungsprogrammen <strong>im</strong> Namen von Deutschtum <strong>und</strong><br />
Nation – e<strong>in</strong>schließlich Ostmarkzulage für Beamte, „um dem Streben nach Versetzung<br />
<strong>in</strong> die bequemeren re<strong>in</strong> deutschen Bezirke entgegenzutreten“. 22<br />
Dabei s<strong>in</strong>d zwei D<strong>in</strong>ge vor allem – außer dem Revisionismus <strong>und</strong> dem Wirtschaftsgefälle<br />
– von gr<strong>und</strong>legender Bedeutung für die außergewöhnlichen Schwierigkeiten<br />
des <strong>in</strong>ternationalen Systems mit den <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> seit 1918 gewesen:<br />
Zum e<strong>in</strong>en die Entwertung, das Verblassen der tatsächlichen völkerrechtlichpolitischen<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> ihrer stabilisierenden Funktion angesichts der seit den<br />
21 DONALD WORSTER: Beyond the Agrarian Myth, <strong>in</strong>: DERS.: Under Western Skies. Nature<br />
and History <strong>in</strong> the American West, New York, Oxford 1992, S. 3-18.<br />
22 Politisches Handwörterbuch, hrsg. von PAUL HERRE, Bd. 2, Leipzig 1923, S. 263.<br />
50
1890er Jahren allmählich das Bewußtse<strong>in</strong> beherrschenden, aus völkischnationalhistorischer<br />
Sicht alle<strong>in</strong> wirklichen Grenze des deutschen Volkstums <strong>und</strong> angesichts<br />
des Kampfes für se<strong>in</strong>e Sicherung, Ausdehnung <strong>und</strong> überlegene Stellung; zum<br />
anderen die bedrohliche Tatsache, daß sich damit – unterstützt von verzerrenden historischen<br />
Analogien – die Überzeugung von e<strong>in</strong>em wieder offenen Grenzraum <strong>im</strong><br />
Osten durchsetzte, der nicht nur verteidigt, sondern unter erneuter ostkolonisatorischer<br />
Anstrengung wieder offensiv von Deutschen durchdrungen, besiedelt, beherrscht<br />
werden müsse: Der Mythos von der wahren nationalen Aufgabe der Ostkolonisation.<br />
Beide Auffassungen wurden durch den Ersten Weltkrieg <strong>in</strong> jeder H<strong>in</strong>sicht<br />
<strong>und</strong> besonders unter dem E<strong>in</strong>druck großer militärischer Erfolge des Reiches, die ganz<br />
neue Expansionschancen <strong>im</strong> Osten versprachen, enorm verstärkt, noch mehr sogar<br />
durch den plötzlichen Umschlag von großen Zukunftsaussichten <strong>in</strong> die Niederlage<br />
<strong>und</strong> das Ende des Kaiserreichs <strong>und</strong> <strong>in</strong> den verhaßten Versailler Vertrag mit se<strong>in</strong>en<br />
Gebietsverlusten <strong>im</strong> Osten. Sie schufen deutsche M<strong>in</strong>derheiten unter polnischer Herrschaft<br />
– e<strong>in</strong> als unerträglich empf<strong>und</strong>ener Zustand, der den Volkstumskampf erst<br />
recht geboten <strong>und</strong> die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong>diskutabel ersche<strong>in</strong>en ließ. Nun erst recht konnten<br />
nicht nur für die radikalen nationalistischen Kreise Volkstums-, Grenz- <strong>und</strong> Expansionskampf<br />
um freien Raum <strong>im</strong> Osten verschmelzen, legit<strong>im</strong>iert durch die pseudohistorische<br />
Anknüpfung an den „Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische Großtat<br />
des deutschen Volkes <strong>im</strong> Mittelalter“ 23 <strong>und</strong> die Überlegenheit des Deutschtums als<br />
Kulturträger. Ohne diese Doktr<strong>in</strong> hätte man schwerlich von freiem Raum <strong>im</strong> Osten<br />
sprechen können.<br />
Wie sehr sich diese Auffassung von e<strong>in</strong>er jahrh<strong>und</strong>ertealten deutschen Best<strong>im</strong>mung<br />
zur Expansion, Durchdr<strong>in</strong>gung <strong>und</strong> kulturellen Führung <strong>im</strong> Osten unter hohen<br />
Diplomaten zum<strong>in</strong>dest als Argumentationsmittel durchgesetzt hatte, zeigen die e<strong>in</strong>leitenden<br />
Sätze e<strong>in</strong>er Denkschrift des Botschafters <strong>in</strong> Moskau Nadolny von Anfang<br />
1934: „Die deutsche Politik ist <strong>in</strong> ihrer Auswirkung nach Westen <strong>und</strong> Osten seit jeher<br />
auf den Leitsatz e<strong>in</strong>gestellt: Im Westen Statik, <strong>im</strong> Osten Dynamik. Im Westen Beschränkung<br />
auf die Erreichung unserer nationalen E<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> Herbeiführung stabiler<br />
Verhältnisse gegenüber den europäischen Altstaaten, nach Osten dagegen Dynamik<br />
<strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Ausdehnung unseres E<strong>in</strong>flusses <strong>in</strong> die Weiten des osteuropäischen<br />
<strong>und</strong> asiatischen Territoriums.“ 24<br />
Die Vorstellungswelt von dem noch nicht gefestigten, Expansion erlaubenden<br />
Grenzraum <strong>und</strong> der überlegenen Stellung des Reiches <strong>im</strong> Osten – der übrigens führende<br />
Diplomaten <strong>und</strong> Außenpolitiker der We<strong>im</strong>arer Republik skeptisch gegenüberstanden<br />
– war selbstverständlich für die Unterm<strong>in</strong>ierung des Staatensystems <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong> Scheitern an den Grenzfragen dort nicht alle<strong>in</strong> verantwortlich.<br />
Grenzstreitigkeiten <strong>und</strong> teilweise erbitterte nationalistische Ause<strong>in</strong>andersetzungen<br />
darüber waren <strong>in</strong> ganz Osteuropa verbreitet, <strong>und</strong> schwere Spannungen wurden <strong>im</strong>mer<br />
23<br />
KARL HAMPE: Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes<br />
<strong>im</strong> Mittelalter, Leipzig, Berl<strong>in</strong> 1921.<br />
24<br />
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 (= ADAP), Serie C (1933-1937), Bd.<br />
II/1, Gött<strong>in</strong>gen 1973, S. 316.<br />
51
wieder auch von außen <strong>in</strong> diesen Raum h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>getragen. Aber Deutschland nahm dort<br />
e<strong>in</strong>e überragende Stellung e<strong>in</strong>, von se<strong>in</strong>em Verhalten h<strong>in</strong>g weitgehend ab, ob die Region<br />
sich beruhigen würde oder nicht, <strong>und</strong> <strong>in</strong> dieser Situation wirkte der <strong>in</strong>nenpolitische<br />
Druck, der von solchen, den tatsächlichen Verhältnissen gar nicht angemessenen<br />
Ost-Mythen <strong>und</strong> Ideologien ausg<strong>in</strong>g, ungeme<strong>in</strong> belastend auf die deutsche Außenpolitik<br />
<strong>und</strong> die Behandlung der Grenzfragen. Selbst wenn man die dah<strong>in</strong>ter wirksamen<br />
Interessen analysiert, von den <strong>in</strong> ihrer Form überholten, unmodernen Großmachtvorstellungen,<br />
die schließlich auf e<strong>in</strong>en möglichst weiten, unangreifbaren, autarken Lebensraum<br />
unter Vorherrschaft der germanisch-deutschen Rasse h<strong>in</strong>ausliefen, bis zur<br />
Bekämpfung der modernen, pluralistischen Industriegesellschaft, Verfassung <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsformen, so bleibt doch die expansionistische, auf e<strong>in</strong>gängigen historischen<br />
Deutungen aufbauende Vorstellung vom Vorrecht der Deutschen als Kulturträger <strong>im</strong><br />
Osten e<strong>in</strong> eigenständiges Phänomen nationalistisch-historischer Bewußtse<strong>in</strong>sbildung.<br />
Zu se<strong>in</strong>er weiten Verbreitung <strong>und</strong> politischen Wirksamkeit trug sowohl der Mythos<br />
vom Reich der Deutschen <strong>in</strong> Mitteleuropa <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er <strong>Grenzen</strong> überschreitenden, gegenüber<br />
bloßen Staaten höheren Qualität als auch die nicht verw<strong>und</strong>ene Niederlage,<br />
die – wie es hieß – Entreißung deutschen Kulturbodens, erheblich bei.<br />
Betrachtet man diese Problematik <strong>und</strong> die Funktion der <strong>Grenzen</strong> abschließend<br />
vom Staatensystem her, so enthüllt sich das ganze Ausmaß e<strong>in</strong>es gr<strong>und</strong>legenden Konflikts<br />
zwischen e<strong>in</strong>er Politik der Staatsraison <strong>und</strong> des notwendigen Interessenausgleichs<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es anerkannten, die Handlungsmöglichkeiten l<strong>im</strong>itierenden Rahmens<br />
von Rechten <strong>und</strong> Pflichten der Staaten <strong>im</strong> <strong>in</strong>ternationalen System e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong><br />
dem Anspruch auf e<strong>in</strong>seitige Durchsetzung weitgehender Konzeptionen, die auf best<strong>im</strong>mten<br />
– <strong>und</strong> zwar nicht verallgeme<strong>in</strong>erungsfähigen – Pr<strong>in</strong>zipien, Ideologien, Traditionen<br />
beruhen, <strong>und</strong> auf Geltendmachung der Vorstellungen, die e<strong>in</strong> Staat von se<strong>in</strong>er<br />
Stellung <strong>in</strong> der Welt hat, andererseits. <strong>Grenzen</strong> spielen unter den modernen Staaten<br />
als Ausdruck der Machtverhältnisse <strong>und</strong> präzise Markierung ihrer Souveränitätsbereiche<br />
e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle; deshalb genießen sie auch als <strong>in</strong>ternationale Ordnungsstruktur<br />
besondere Beachtung <strong>und</strong> Sicherung <strong>im</strong> Völkerrecht <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d Unterpfand<br />
der formalen Gleichheit der Staaten. Treten nun politische Strömungen oder gar<br />
Staaten auf, die nicht nur präzise umrissene Forderungen auf ganz best<strong>im</strong>mte Grenzänderungen<br />
verwirklichen – was gefährlich genug für das <strong>in</strong>ternationale System se<strong>in</strong><br />
mag -, sondern <strong>Grenzen</strong>, wenigstens <strong>in</strong> gewissen Regionen, aufweichen, labiler gestalten<br />
<strong>und</strong> zur eigenen, e<strong>in</strong>em Vormachtanspruch unterworfenen Disposition stellen<br />
wollen, so stürzen sie jene geregelte <strong>und</strong> austarierte Ordnung <strong>und</strong> schaffen e<strong>in</strong>en Zustand<br />
der Labilität <strong>und</strong> Unsicherheit – denn wo könnten Forderungen <strong>im</strong> Namen e<strong>in</strong>es<br />
Pr<strong>in</strong>zips wie etwa des ethnisch-nationalen begrenzt werden?<br />
Der Wiener Kongreß bietet wohl das e<strong>in</strong>drucksvollste moderne Beispiel e<strong>in</strong>er<br />
Neuordnung des Staatensystems durch Befriedigung von als legit<strong>im</strong> anerkannten Interessen,<br />
durch geme<strong>in</strong>same Normen, durch e<strong>in</strong>e auf Zusammenarbeit angelegte Verschränkung<br />
der Verträge, Territorialregelungen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>flußverteilung <strong>und</strong> nicht zuletzt<br />
durch das Instrument der akzeptierten, auf Beruhigung <strong>und</strong> Dauer zielenden<br />
Grenzregelungen. Für <strong>Ostmitteleuropa</strong> war damit die Grenzfrage zwischen Rußland,<br />
52
Österreich <strong>und</strong> Preußen bzw. Deutschland für e<strong>in</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert geregelt. Ohnmächtig<br />
<strong>in</strong> Frage gestellt wurden sie nur von den Nationalbewegungen. Es bedurfte der gr<strong>und</strong>stürzenden<br />
Katastrophe des Ersten Weltkriegs, um den Nationalitäten <strong>in</strong> den drei zusammenbrechenden<br />
Kaiserreichen e<strong>in</strong>e Chance zur eigenen Staatsbildung zu geben.<br />
Das ist allerd<strong>in</strong>gs nur die e<strong>in</strong>e Seite der historischen Entwicklung. Die Problematik<br />
hatte sich schon lange vorher auf die B<strong>in</strong>nengrenzen <strong>und</strong> das Feld der <strong>in</strong>neren<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen <strong>in</strong> den drei östlichen Großmächten verschoben. So entstanden<br />
unterhalb der Ebene des Staatensystems <strong>und</strong> der geordneten <strong>Grenzen</strong> neue Fronten<br />
<strong>und</strong> neuralgische Grenzräume, <strong>in</strong> denen sich die Nationalitäten mischten <strong>und</strong> überlagerten,<br />
als Grenzräume des Volkstumskampfes vor allem <strong>in</strong> Deutschland. Die Friedensverträge<br />
nach dem Ersten Weltkrieg 25 machten praktisch das nationale Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht<br />
zur Basis der Neuordnung. Europa war zum erstenmal nationalstaatlich<br />
durchorganisiert – e<strong>in</strong> ungeheurer Wandel zu Lasten der Hauptverlierer des Krieges,<br />
der drei östlichen Großmächte, von denen die Habsburger Monarchie völlig verschwand,<br />
während das Schicksal des revolutionären, zunächst isolierten Sowjetrußland<br />
ungewiß war <strong>und</strong> nur Deutschland als bloß vorübergehend geschwächt gelten<br />
konnte, trotz aller schweren Verluste. Se<strong>in</strong>e Stellung <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> hatte sich<br />
e<strong>in</strong>deutig verstärkt. Denn es gab ke<strong>in</strong>e weitere Großmacht mehr <strong>in</strong> diesem Raum, solange<br />
Sowjetrußland um das Überleben <strong>und</strong> den machtpolitischen Wiederaufstieg<br />
rang. Zwischen beiden war <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> e<strong>in</strong>e große Zahl neuer Staaten vom<br />
Baltikum bis nach Österreich <strong>und</strong> Ungarn entstanden. Aus B<strong>in</strong>nengrenzen waren Außengrenzen<br />
geworden, was die Nationalitätenprobleme nur verschärfte <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Fülle<br />
von Grenzkonflikten auslöste –, nicht nur mit den besiegten, zu – nie verw<strong>und</strong>enen –<br />
Gebietsabtretungen verpflichteten Großmächten, sondern auch der neuen Nationalstaaten<br />
untere<strong>in</strong>ander.<br />
Demgegenüber waren die <strong>in</strong>tegrierenden Momente der neuen Ordnung sehr<br />
schwach ausgebildet. Für e<strong>in</strong>en großen politischen Verb<strong>und</strong> saßen die Interessengegensätze<br />
zu tief, für e<strong>in</strong>en wirtschaftlichen ebenfalls, wobei man bisher übersehen hat,<br />
daß die dafür erforderlichen wirtschaftlichen Anreize <strong>und</strong> auf anderen Wegen unerreichbaren<br />
großen Vorteile fehlten. Sie hätten von den Großmächten kommen müssen<br />
(<strong>in</strong> dieser Erwägung liegt übrigens e<strong>in</strong> neuer Ansatz zur wirtschaftlichen Integrationstheorie).<br />
Die <strong>Grenzen</strong> konnten also nicht durch <strong>in</strong>ternationale Zusammenschlüsse gesichert<br />
werden. Der Völkerb<strong>und</strong> als neue, der zunehmenden <strong>in</strong>ternationalen Verflechtung<br />
angemessene Staatenorganisation war global ausgerichtet, stellte ke<strong>in</strong>e Ersatzlösung<br />
für e<strong>in</strong>e neue europäische Ordnung dar <strong>und</strong> blieb ohne se<strong>in</strong>e Ergänzung durch<br />
e<strong>in</strong> kooperatives, auf friedlichen Interessenausgleich <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>same Behandlung<br />
europäischer Probleme konzentriertes europäisches Konzert der Großmächte unvollständig<br />
<strong>und</strong> nur sehr begrenzt aktionsfähig. Der e<strong>in</strong>zige ernsthafte <strong>und</strong> <strong>in</strong>geniöse Versuch<br />
<strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit, diesem Übelstand abzuhelfen, waren die Locarno-<br />
Verträge <strong>und</strong> ihre enge Verflechtung von Völkerb<strong>und</strong> <strong>und</strong> erneuertem europäischem<br />
Konzert. Sie brachten, entgegen aller zeitgenössischen <strong>und</strong> späteren Rhetorik, vorü-<br />
25 Knapp, aber umfassend <strong>und</strong> auf der Höhe der Forschung ALAN SHARP: The Versailles Settlement.<br />
Peacemak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Paris, 1919, Ho<strong>und</strong>mills, London 1991.<br />
53
ergehend nicht nur e<strong>in</strong>e bessere Sicherung <strong>und</strong> Entspannung <strong>im</strong> Westen, sondern –<br />
gegründet auf Kriegsverzicht <strong>und</strong> E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung Deutschlands <strong>in</strong> e<strong>in</strong> System der Großmachtkooperation<br />
– auch für die Ostgrenze. 26 Diese Verlagerung der Problematik auf<br />
die von viel weitergehenden wirtschaftlichen, politischen <strong>und</strong> Sicherheits<strong>in</strong>teressen<br />
bee<strong>in</strong>flußte Ebene der Großmachtbeziehungen, bei denen auch, wie stets seit ihrem<br />
entscheidenden E<strong>in</strong>greifen <strong>in</strong> den Ersten Weltkrieg, die Vere<strong>in</strong>igten Staaten von großem<br />
E<strong>in</strong>fluß waren, sorgte für e<strong>in</strong>e zeitweise Entspannung <strong>und</strong> Dämpfung der völkisch-nationalistischen<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung mit den deutschen <strong>Grenzen</strong>.<br />
Aber dieser Geist von Locarno blieb Episode. Die Diskrepanzen <strong>in</strong> den außenpolitischen<br />
Interessen <strong>und</strong> der Druck der Weltwirtschaftskrise hatten daran ihren Anteil,<br />
wichtiger war der Verfall der ungefestigten We<strong>im</strong>arer Republik, hervorgerufen durch<br />
die <strong>in</strong>neren Zerwürfnisse e<strong>in</strong>er zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Der <strong>in</strong>nenpolitische<br />
Wandel h<strong>in</strong> zu autoritären staatlichen Lösungen <strong>und</strong> der Versuch, autoritäre Strukturen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>en völkischen Nationalismus als Integrations<strong>in</strong>strumente zu benutzen, ließ<br />
die Forderung nach Beseitigung „unserer Verstümmelung <strong>im</strong> Osten“ 27 <strong>und</strong> nach Err<strong>in</strong>gung<br />
der Vorherrschaft <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> wieder laut werden. Das best<strong>im</strong>mte zunehmend<br />
die Außenpolitik – man denke an die viel weiterreichenden Ziele h<strong>in</strong>ter dem<br />
Versuch, 1931 e<strong>in</strong>e deutsch-österreichische Zollunion durchzusetzen. 28 Trotzdem<br />
blieb Locarno auch <strong>in</strong> der Anfangsphase des Dritten Reichs die e<strong>in</strong>zige Sicherheitsvere<strong>in</strong>barung<br />
<strong>in</strong> Europa, selbst für die deutschen Nachbarn <strong>im</strong> Osten. Die stereotyp<br />
wiederholte, analytisch wertlose Floskel von den zwei Klassen von <strong>Grenzen</strong> oder den<br />
<strong>Grenzen</strong> unterschiedlicher Heiligkeit, die <strong>in</strong> Locarno durch die Garantie der deutschen<br />
Westgrenze <strong>und</strong> die Verweigerung der Garantie für die Ostgrenze geschaffen<br />
worden seien, verkennt völlig die politische B<strong>in</strong>dungswirkung e<strong>in</strong>er europäischen Regelung<br />
<strong>in</strong> der traditionellen Form des europäischen Konzerts. Vor dem 7. März 1936,<br />
an dem Hitler den Locarno-Pakt kündigte <strong>und</strong> Truppen <strong>in</strong> das entmilitarisierte Rhe<strong>in</strong>land<br />
e<strong>in</strong>maschieren ließ, hätte ke<strong>in</strong>e noch so revisionistische Reichsregierung es gewagt,<br />
gegen diese Verträge zu verstoßen <strong>und</strong> – durch welche Maßnahmen auch <strong>im</strong>mer<br />
– die Änderung der Ostgrenze zu erzw<strong>in</strong>gen. Außerdem sollte man sich klarmachen,<br />
daß es nicht die für so labil <strong>und</strong> gefährdet erklärten Ostgrenzen, sondern die mit<br />
ihren Großmachtgarantien als vorbildlich <strong>und</strong> erstrebenswert betrachteten Regelungen<br />
des Rhe<strong>in</strong>paktes von Locarno waren, die als erste zerbrachen. Und Ende August<br />
26 PETER KRÜGER: Locarno <strong>und</strong> die Frage e<strong>in</strong>es europäischen Sicherheitssystems unter besonderer<br />
Berücksichtigung <strong>Ostmitteleuropa</strong>s, <strong>in</strong>: Locarno <strong>und</strong> Osteuropa. Fragen e<strong>in</strong>es europäischen<br />
Sicherheitssystems <strong>in</strong> den <strong>20</strong>er Jahren, hrsg. von RALPH SCHATTKOWSKY, Marburg<br />
1994, S. 9-27.<br />
27 ADAP, Serie C, Bd. I/2, S. 826 (Aufz. v. Hassells, 24.9.1933).<br />
28 ADAP, Serie B (1925-1933), Bd. XVII, S. 219f. (Instruktion v. Bülows, 15.4.1931). – Zusammenfassend<br />
PETER KRÜGER: Der Funktionswandel von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> europäischen Staatensystem<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Deutschland <strong>und</strong> Europa. Historische, politische<br />
<strong>und</strong> geographische Aspekte. Festschrift zum 51. Deutschen Geographentag, hrsg. von<br />
ECKART EHLERS, Bonn 1997, S. 73-84; für die Moderne WILFRIED VON BREDOW: The<br />
Chang<strong>in</strong>g Character of National Borders, <strong>in</strong>: Citizenship Studies 2 (1998), S. 365-376.<br />
54
1939, als die, gemessen an den tatsächlichen Möglichkeiten, günstigsten Voraussetzungen<br />
zum Schlag gegen Polen gegeben waren, da waren es gerade jene traditionellen<br />
Führungseliten, vor allem <strong>im</strong> auswärtigen Dienst, die Stresemanns Locarno-<br />
Politik kritisiert hatten <strong>und</strong> nichts sehnlicher erwarteten als e<strong>in</strong>e Gelegenheit zur Revision<br />
der Ostgrenzen, die vor dem Risiko des großen Krieges zurückschreckten. Hitler<br />
g<strong>in</strong>g das Risiko e<strong>in</strong>.<br />
Sich Grenzgarantien zu verschaffen, hat für sich alle<strong>in</strong> noch nie e<strong>in</strong>e Grenze gesichert.<br />
E<strong>in</strong>e Analyse des <strong>in</strong>ternationalen Systems seit 1815 <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
ergibt, daß Garantien als politische Ordnungselemente <strong>und</strong> Handlungsrestriktionen<br />
wertvoll s<strong>in</strong>d, aber nur, wenn dies <strong>im</strong> Rahmen e<strong>in</strong>es von allen Beteiligten akzeptierten<br />
Regelungssystems geschieht. Das existierte für Stresemann, aber nicht für Hitler. Und<br />
Hitler war es, der die <strong>in</strong> Deutschland von der nationalistisch verzerrten Er<strong>in</strong>nerung an<br />
die Ostkolonisation geprägte Vorstellung von der offenen Grenze als Expansionsraum<br />
<strong>in</strong>s Extrem steigerte <strong>und</strong> zu verwirklichen trachtete: Für ihn gab es gr<strong>und</strong>sätzlich ke<strong>in</strong>e<br />
dauerhafte Grenze, sondern höchstens vorübergehende Abgrenzungen oder vorzugsweise<br />
e<strong>in</strong>e völlig labile, <strong>in</strong> der Schwebe der Unentschiedenheit gehaltene Situation.<br />
<strong>Grenzen</strong> waren Verfügungsmasse ebenso wie die Bevölkerung – von der Umsiedlung<br />
bis zur Vernichtung.<br />
E<strong>in</strong>e andere Variante der Bedeutungsreduzierung von <strong>Grenzen</strong> führte die Sowjetunion<br />
als beherrschende Führungsmacht des Ostblocks <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
vor. <strong>Grenzen</strong> wurden nicht obsolet, sondern neu <strong>und</strong> dauerhaft festgelegt <strong>und</strong><br />
teilweise durch Vertreibungs- <strong>und</strong> Umsiedlungsaktionen großen Ausmaßes vor den<br />
belastenden Ansprüchen der M<strong>in</strong>derheiten gesichert. Aber diese <strong>Grenzen</strong> waren nun<br />
tatsächlich <strong>Grenzen</strong> zweiter Klasse, ke<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong> zwischen gleichberechtigten Partnern,<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> ihrer Wirksamkeit zugunsten der Sowjetunion so e<strong>in</strong>geschränkt, daß sie<br />
jederzeit von ihr durchbrochen werden konnten (von Militär, Partei, RGW etc.). Neben<br />
diesen zu B<strong>in</strong>nengrenzen des Ostblocks degradierten <strong>Grenzen</strong> gab es nur e<strong>in</strong>e<br />
wirkliche Grenze <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, die zwischen Ost <strong>und</strong> West. Sie teilte Deutschland<br />
<strong>und</strong> Europa. Allerd<strong>in</strong>gs übte sie <strong>in</strong> bezug auf durchaus mögliche spätere Grenzkonflikte,<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie mit Deutschland, aber auch sonst <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, die<br />
heilsame Wirkung e<strong>in</strong>er jahrzehntelangen Abkühlungsperiode aus, <strong>in</strong> der die betroffenen<br />
Staaten sich mit dem status quo abf<strong>in</strong>den mußten, sich konsolidieren <strong>und</strong> ihre<br />
anfangs schwer zu überw<strong>in</strong>denden bitteren Gegensätze – zwischen Deutschland <strong>und</strong><br />
Polen besonders – allmählich <strong>in</strong> Verständigungsbereitschaft verwandeln konnten.<br />
Nach dem Zusammenbruch des Sowjet<strong>im</strong>periums s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige der alten Schwierigkeiten<br />
<strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> (Fragen nationaler Zugehörigkeit, M<strong>in</strong>derheitenprobleme,<br />
wirtschaftliche Abschottung u.ä.) wieder aufgetaucht <strong>und</strong> geben den <strong>Grenzen</strong> wieder<br />
e<strong>in</strong> übertriebenes Gewicht. Überw<strong>und</strong>en werden können diese Schwierigkeiten nur<br />
unter zwei Bed<strong>in</strong>gungen: Wenn sich dort e<strong>in</strong> Sicherheit gewährleistendes <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensive<br />
Kooperation oder gar Integration ermöglichendes <strong>in</strong>ternationales System etabliert<br />
<strong>und</strong> wenn die Staaten ihre <strong>in</strong>neren Spannungen <strong>und</strong> Gegensätze <strong>im</strong> Aufbau e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong><br />
bejahten pluralistischen Zivilgesellschaft <strong>und</strong> Verfassung aufzuheben vermögen,<br />
also durch die Festigung e<strong>in</strong>er Gesellschaft, die nicht mehr auf <strong>in</strong>nere Integration<br />
55
durch Zusammenschluß gegen die Außenwelt angewiesen ist. Alles andere ist unzulänglich.<br />
Und das wäre auch das Fazit am Ende me<strong>in</strong>er Überlegungen: Selbst wenn die<br />
Notwendigkeit <strong>und</strong> Fähigkeit, <strong>Grenzen</strong> verteidigen zu können, außer Zweifel steht, so<br />
läßt sich die Sicherheit von <strong>Grenzen</strong> nicht mit Hilfe der Anhäufung <strong>im</strong>mer umfangreicherer<br />
Machtmittel <strong>und</strong> Garantien gewährleisten, sondern nur durch e<strong>in</strong>e gute, allseits<br />
akzeptierte, Geme<strong>in</strong>samkeit ermöglichende Verfassung <strong>und</strong> durch e<strong>in</strong> Kooperation<br />
förderndes, funktionsfähiges <strong>und</strong> ebenfalls von allen akzeptiertes <strong>in</strong>ternationales<br />
System.<br />
56
Funktionspr<strong>in</strong>zip Staatsgrenze – Aspekte se<strong>in</strong>er<br />
Anwendbarkeit <strong>im</strong> Bereich der Osteuropaforschung 1<br />
von<br />
Peter Hasl<strong>in</strong>ger<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n der 1990er Jahre konnte Hans Medick noch feststellen, daß das Thema<br />
„Grenze“ <strong>im</strong> Deutschland der Nachkriegszeit <strong>im</strong> Unterschied zur französischen <strong>und</strong><br />
amerikanischen Geschichtsschreibung wenig Forschungstradition besitzt. 2 Diese Aussage<br />
fiel <strong>in</strong> die erste Phase e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiveren Beschäftigung der deutschsprachigen<br />
Historiographie mit allen Facetten von „<strong>Grenzen</strong>“, e<strong>in</strong>e Entwicklung, die durch den<br />
Fall des Eisernen Vorhangs <strong>und</strong> den Wandel der <strong>in</strong>nerdeutschen Staats- zu e<strong>in</strong>er B<strong>in</strong>nengrenze<br />
ihren letzten Anstoß erhielt. Das Forschungs<strong>in</strong>teresse verbreiterte sich unter<br />
Anwendung neuer Methoden (etwa der oral history) um die Analyse von Entwick-<br />
1 Dieser Beitrag entstand <strong>im</strong> Rahmen des Projektes „Staatsgrenze <strong>und</strong> Identität <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
1918-1938“, das als Teilprojekt <strong>im</strong> Sonderforschungsbereich 541 „Identitäten <strong>und</strong><br />
Alteritäten. Die Funktion von Alterität für die Konstitution <strong>und</strong> Konstruktion von Identität“<br />
der Universität Freiburg verankert ist. An dieser Stelle möchte ich auch der Projektleiter<strong>in</strong><br />
Monika Glettler sowie den Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern, Éva Kovács, Elena Mannová,<br />
Joach<strong>im</strong> von Puttkamer <strong>und</strong> Éva Varga, herzlich für die Zusammenarbeit <strong>und</strong> zahlreiche<br />
Anregungen danken.<br />
2 HANS MEDICK: Grenzziehungen <strong>und</strong> die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur<br />
Begriffsgeschichte <strong>und</strong> politischen Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der frühen Neuzeit, <strong>in</strong>:<br />
Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, hrsg. von BERND<br />
WEISBROD, Hannover 1993, S. 195-<strong>20</strong>7, hier S. 196-197. Herausgehoben werden können<br />
für den Bereich der französischen <strong>und</strong> anglosächsischen Forschung zum Thema „Grenze“<br />
unter anderem folgende Werke: JOHN W. COLE, ERIC R. WOLF: The hidden frontier. Ecology<br />
and ethnicity <strong>in</strong> an Alp<strong>in</strong>e valley, New York, London 1974; LUCIEN FEBVRE: La terre<br />
et l’evolution huma<strong>in</strong>e. Introduction géographique a l´histoire, 3. Aufl. Paris 1938; MICHEL<br />
FOUCHER: Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris 1988; PAUL GUI-<br />
CHONNET, CLAUDE RAFFESTIN: Géographie des frontières, Paris 1974; OWEN D. LATTIMO-<br />
RE: The Frontier <strong>in</strong> History, <strong>in</strong>: Theory <strong>in</strong> Anthropology. A Sourcebook, hrsg. von ROBERT<br />
A. MANNERS <strong>und</strong> DAVID KAPLAW, Chicago 1968; D. H. MILLER: The frontier. Comparative<br />
studies, Oklahoma 1977; DIETER NORDMANN: Des l<strong>im</strong>ites d´état aux frontières nationale,<br />
<strong>in</strong>: Les lieux de memoire 2. La nation, hrsg. von PIERRE NORA, Paris 1986, S. 35-61;<br />
PETER SAHLINS: Bo<strong>und</strong>aries: The Mak<strong>in</strong>g of France and Spa<strong>in</strong> <strong>in</strong> the Pyrenees, Berkeley<br />
1989; FREDERIK JACKSON TURNER: The frontier <strong>in</strong> American history, New York 19<strong>20</strong>;<br />
Border identities. Nation and state at <strong>in</strong>ternational frontiers, hrsg. von THOMAS M. WILSON<br />
<strong>und</strong> JACQUES ANCEL: Géographie des frontières, Paris 1938.<br />
57
lungsprozessen auf der Mikroebene, <strong>im</strong> Bereich der politischen Geschichte wurde der<br />
bislang dom<strong>in</strong>ierende diplomatiegeschichtliche Zugang um rezeptionsgeschichtliche<br />
Elemente ergänzt. 3 Demnach br<strong>in</strong>gen es frühere Jahrzehnte fast gespenstischer Ruhe<br />
um das Thema „<strong>Grenzen</strong>“ <strong>in</strong> der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft mit sich,<br />
daß e<strong>in</strong>e Synthese, die e<strong>in</strong>e zusammenfassende Aspektschau bieten könnte, wohl noch<br />
auf Jahre nicht zu erwarten se<strong>in</strong> wird.<br />
Soweit dies bereits beurteilt werden kann, blieb überdies e<strong>in</strong>e ganze Reihe methodischer<br />
Ansätze aus dem Bereich von Nachbarwissenschaften (vor allem der Human-<br />
<strong>und</strong> Sozialgeographie, der politischen Geographie, der Kulturanthropologie, den<br />
Kommunikationswissenschaften <strong>und</strong> der Migrationsforschung) bisher weitgehend unberücksichtigt.<br />
Aus der Sicht der Geschichtswissenschaften ist demgegenüber jedoch<br />
auch festzuhalten, daß den <strong>in</strong> anderen Diszipl<strong>in</strong>en entworfenen Funktionsmodellen<br />
von <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> entsprechenden theoretischen Überlegungen, die sich vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
der Globalisierungsdebatte e<strong>in</strong>er ausgesprochenen Konjunktur erfreuen, der<br />
3 Folgende Zusammenstellung bietet e<strong>in</strong>en Überblick zu e<strong>in</strong>igen jüngst erschienenen Werken,<br />
die hierzu neue Aspekte entwickeln: INGE BENNEWITZ, RAINER POTRATZ: Zwangsaussiedlungen<br />
an der <strong>in</strong>nerdeutschen Grenze. Analysen <strong>und</strong> Dokumente, Berl<strong>in</strong> 1994; KATHA-<br />
RINA EISCH: Grenze. E<strong>in</strong>e Ethnographie des bayrisch-böhmischen Grenzraumes, München<br />
1996; Literaturen der Grenze – Theorie der Grenze, hrsg. von RICHARD FABER <strong>und</strong> B.<br />
NAUMANN, Würzburg 1995; Literatur an der Grenze. Der Raum Saarland-Lothr<strong>in</strong>gen-<br />
Luxemburg-Elsaß als Problem der Literaturgeschichtsschreibung, hrsg. von UWE GRUND<br />
<strong>und</strong> GÜNTHER SCHOLDT, Saarbrücken 1992; HANNS HAAS: Die Zerstörung der Lebense<strong>in</strong>heit<br />
„Grenze“ <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>: Kontakte <strong>und</strong> Konflikte. Böhmen, Mähren <strong>und</strong> Österreich.<br />
Aspekte e<strong>in</strong>es Jahrtausends geme<strong>in</strong>samer Geschichte, hrsg. von THOMAS WINKEL-<br />
BAUER, Waidhofen an der Thaya 1993; ANDREAS HARTMANN, SABINE KÜNSTING: Grenzgeschichten.<br />
Berichte aus dem deutschen Niemandsland, 2. Aufl. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1990;<br />
Die Grenze als Ort der Annäherung. 750 Jahre deutsch-litauische Beziehungen, hrsg. von<br />
ARTHUR HERMANN, Köln 1992; Hart an der Grenze. Burgenland <strong>und</strong> Westungarn, hrsg.<br />
von TRAUDE HORVATH <strong>und</strong> EVA MÜLLNER, Wien 1992; Grenz-Fall. Das Saarland zwischen<br />
Frankreich <strong>und</strong> Deutschland 1945-1960, hrsg. von RAINER HUDEMANN, St. Ingbert<br />
1997; Stadt an der Grenze, hrsg. von BERNHARD KIRCHGÄSSNER <strong>und</strong> WILHELM OTTO KEL-<br />
LER, Sigmar<strong>in</strong>gen 1990; Kulturen an der Grenze. Waldviertel, We<strong>in</strong>viertel, Südböhmen,<br />
Südmähren, hrsg. von ANDREA KOMLOSY, VÁCLAV BŮŽEK <strong>und</strong> FRANTIŠEK SVÁTEK, Waidhofen<br />
an der Thaya 1995; HANS MEDICK: Zur politischen Sozialgeschichte der Grenze <strong>in</strong><br />
der Neuzeit Europas, <strong>in</strong>: Sozialwissenschaftliche Informationen <strong>20</strong> (1991), S. 157-163;<br />
EDITH SAURER: Zwischen dichter <strong>und</strong> grüner Grenze. Grenzkontrolle <strong>in</strong> der vormärzlichen<br />
Habsburgermonarchie, <strong>in</strong>: Grenzöffnung, Migration, Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alität, hrsg. von ARNO PIL-<br />
GRAM, Baden-Baden 1993, S. 169-177; Grenze der Hoffnung. Geschichte <strong>und</strong> Perspektiven<br />
der Grenzregion an der Oder, hrsg. von H. SCHULTZ <strong>und</strong> A. NOTHNAGLE, Potsdam 1996;<br />
HANS-DIETRICH SCHULTZ: Deutschlands „natürliche“ <strong>Grenzen</strong>, <strong>in</strong>: Deutschlands <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>in</strong> der Geschichte, hrsg. von ALEXANDER DEMANDT, München 1989, S. 33-93; Grenzland<br />
(wie Anm. 2); FRANZISKA WEIN: Deutschlands Strom – Frankreichs Grenze. Geschichte<br />
<strong>und</strong> Propaganda am Rhe<strong>in</strong> 1919-1930, Essen 1992; Grenze <strong>im</strong> Kopf. Beiträge zur Geschichte<br />
der Grenze <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, hrsg. von PETER HASLINGER, Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
1999.<br />
58
Vorwurf mangelnder historischer Tiefe <strong>und</strong> entsprechender Kurzatmigkeit der Diagnose<br />
nicht erspart werden kann. E<strong>in</strong> <strong>im</strong> wesentlichen auf dem Grenzverständnis des<br />
<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts beruhendes Funktionsmodell von Staatsgrenze wird weitgehend unh<strong>in</strong>terfragt<br />
übernommen, entsprechend der Gesichtspunkt ihrer Genese nahezu völlig<br />
ausgeblendet. Hier liegt es nun an der historischen Forschung, Korrekturen am jeweiligen<br />
Grenzverständnis anzubr<strong>in</strong>gen, sich jedoch <strong>im</strong> Gegenzug auch methodischen<br />
Zugängen zu öffnen, die das Forschungs<strong>in</strong>teresse bislang nur wenig geleitet haben.<br />
Entsprechend setzt sich dieser Beitrag zum Ziel, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ersten Schritt kurz auf<br />
e<strong>in</strong>ige Aspekte der Entstehung europäischer Staatsgrenzen e<strong>in</strong>zugehen, um anschließend<br />
anhand der Bündelung von Theorieansätzen aus benachbarten Diszipl<strong>in</strong>en Funktionsmodelle<br />
von Staatsgrenzen <strong>und</strong> Grenzregionen zu entwerfen. Anknüpfend an<br />
e<strong>in</strong>zelne Hypothesen sollen Forschungsfelder aufgezeigt <strong>und</strong> Fragestellungen entworfen<br />
werden, die speziell für den osteuropäischen Bereich (<strong>Ostmitteleuropa</strong>, Südosteuropa<br />
<strong>und</strong> das Gebiet der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion) relevant ersche<strong>in</strong>en.<br />
Staatsgrenzen können erst seit der zweiten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts als de jure<br />
Ausdruck der räumlichen Begrenzung von Staatsmacht gewertet werden. Demgegenüber<br />
überwiegt <strong>in</strong> der ersten Phase des Entstehungsprozesses von Staatsgrenzen e<strong>in</strong>e<br />
schrittweise verlaufende Umwertung der rechtlich-feudalem Denken entspr<strong>in</strong>genden<br />
Abgrenzungsl<strong>in</strong>ien bzw. Grenzzonen zu e<strong>in</strong>er <strong>im</strong> Gelände sichtbar gemachten, für alle<br />
Bevölkerungsgruppen gleichermaßen relevanten L<strong>in</strong>ie. 4 Entsprechend bildete das<br />
Problem der Def<strong>in</strong>ition der <strong>Grenzen</strong> vor dem <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert für die europäischen<br />
Staaten des Ancien rég<strong>im</strong>e e<strong>in</strong>e der Hauptursachen für die Entstehung bewaffneter<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen. Erst Verbesserungen <strong>in</strong> Vermessungsmethoden <strong>und</strong> kartographischer<br />
Technik sowie die vermehrte Wahrnehmung von Territorium aus spatial/militärischer<br />
Perspektive zogen die zunehmende Verwendung von Kartenmaterial<br />
<strong>in</strong> der <strong>in</strong>ternationalen Diplomatie nach sich. Die Praxis, Friedensverträge durch Karten<br />
zu ergänzen, diese mit zu unterzeichnen <strong>und</strong> zu siegeln, setzte sich <strong>im</strong> Lauf des<br />
18. Jahrh<strong>und</strong>erts durch, wobei e<strong>in</strong>e zunehmende Genauigkeit der Grenzl<strong>in</strong>ien mit der<br />
Erstellung detaillierter Katastral- <strong>und</strong> Militärkarten seit dem Beg<strong>in</strong>n des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
e<strong>in</strong>herg<strong>in</strong>g. 5<br />
Für den osteuropäischen Bereich würde sich zum Aspekt der Veränderung des<br />
Verständnisses von Staatsgrenze <strong>und</strong> Grenzregion demnach noch e<strong>in</strong> reiches Betätigungsfeld<br />
erschließen, waren gerade das ausgehende 17. <strong>und</strong> das gesamte 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
durch e<strong>in</strong>schneidende Grenzveränderungen gekennzeichnet (<strong>in</strong>folge der Rükkeroberung<br />
Ungarns, der kriegerischen Ause<strong>in</strong>andersetzungen zwischen dem Russischen<br />
<strong>und</strong> dem Osmanischen Reich <strong>und</strong> der Teilungen Polens). Inwiefern es sich be-<br />
4 Für das Mittelalter vgl. zum osteuropäischen Bereich vor allem: HANS-JÜRGEN KARP:<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> während des Mittelalters. E<strong>in</strong> Beitrag zur Entstehungsgeschichte<br />
der Grenzl<strong>in</strong>ie aus dem Grenzraum, Köln 1972.<br />
5 JOHN BLACK: Bo<strong>und</strong>aries and conflict. International relations <strong>in</strong> ancien rég<strong>im</strong>e Europe, <strong>in</strong>:<br />
Eurasia. World Bo<strong>und</strong>aries volume 3, hrsg. von CARL GRUNDY-WARR, London, New York<br />
1994, S. 19-55, hier S. 28-31.<br />
59
sich bereits um nach „modernen“ Pr<strong>in</strong>zipien gezogene Staatsgrenzen handelte, müßte<br />
für die Außengrenzen vor allem des Osmanischen Reiches noch e<strong>in</strong>gehender <strong>und</strong> aus<br />
vergleichender Perspektive untersucht werden; zum<strong>in</strong>dest <strong>im</strong> nordöstlichen Bereich<br />
Europas f<strong>in</strong>den sich z. B. bis <strong>in</strong> das frühe <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert noch Überlappungsgebiete<br />
von Staatssouveränität, die entweder als Niemandsland oder als Kondom<strong>in</strong>ium örtlich<br />
bzw. geme<strong>in</strong>sam verwaltet wurden. 6<br />
Mit der Herausbildung von Nationalstaaten mit Gewaltmonopol, e<strong>in</strong>er Zentralbürokratie<br />
<strong>und</strong> der Sistierung sozioökonomisch wirksamer B<strong>in</strong>nengrenzen (wie etwa<br />
von Zwischenzoll<strong>in</strong>ien) erhielt die Staatsgrenze auch <strong>in</strong> der östlichen Hälfte Europas<br />
jene Konnotation, die wir heute mit ihr verb<strong>in</strong>den: die e<strong>in</strong>er Begrenzung der legislativen,<br />
exekutiven <strong>und</strong> judikativen Zuständigkeit des jeweiligen Staates. Diese L<strong>in</strong>ie<br />
muß, dem Exklusivitätsanspruch des modernen Staates wegen, e<strong>in</strong>deutig def<strong>in</strong>iert<br />
se<strong>in</strong>; die Summe aller <strong>Grenzen</strong> darf daher <strong>in</strong> letzter Konsequenz ke<strong>in</strong> Territorium unberücksichtigt<br />
lassen. 7 Entsprechend läßt sich aus nationalstaatlicher Perspektive die<br />
Grenze als L<strong>in</strong>ie letzter Begrenzung staatlichen E<strong>in</strong>flusses def<strong>in</strong>ieren. Staatsgrenze<br />
fungiert als territoriale Manifestation von Machtverhältnissen, sie ist das Objekt politischen<br />
Handelns auf oberster Ebene, <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Änderung ihres Verlaufs bedarf der<br />
Sanktionierung nationaler bzw. transnationaler Akteure. Diese Perspektive des Zentrums<br />
betont den Konstrukt- <strong>und</strong> Funktionscharakter von Staatsgrenzen, welche aus<br />
dieser Sicht als Außenhaut des eigenen Staatskörpers wahrgenommen werden. 8<br />
Entsprechend wäre auch die Grenzregion als adm<strong>in</strong>istrative E<strong>in</strong>heit auf e<strong>in</strong>er Seite<br />
der Staatsgrenze zu def<strong>in</strong>ieren, <strong>in</strong> welcher sich e<strong>in</strong>erseits die staatliche Infrastruktur<br />
gegen die Staatsgrenze h<strong>in</strong> ausdünnt, die sich jedoch andererseits zur Ausübung e<strong>in</strong>er<br />
Reihe spezifischer Tätigkeiten gleichsam anbietet – diese s<strong>in</strong>d vor allem meist mit<br />
Kontroll- (Migration <strong>und</strong> Güterverkehr) <strong>und</strong> Verteidigungsbedürfnissen (militärischer<br />
Grenzschutz) verb<strong>und</strong>en. Aus dieser Perspektive bilden Zentrum <strong>und</strong> Grenze gleich-<br />
6 So wurden etwa „geme<strong>in</strong>same Bezirke“ entlang der Grenze zwischen dem zaristischen<br />
Rußland <strong>und</strong> dem Königreich Dänemark-Norwegen, die sich auch durch e<strong>in</strong>e Mischbesteuerung<br />
auszeichneten, erst <strong>im</strong> Jahr 1826 geteilt. BLACK (wie Anm. 5), S. 22. Vgl. zu diesem<br />
Aspekt für den französisch-spanischen Grenzbereich: FRANÇOIS BEGUIN: Strategies<br />
frontalières dans les Pyrénées la f<strong>in</strong> de l´ancien rég<strong>im</strong>e, <strong>in</strong>: Frontières et l<strong>im</strong>ites, Paris 1991,<br />
S. 69-80; PETER SAHLINS: Natural Frontiers Revisited: France´s Bo<strong>und</strong>aries s<strong>in</strong>ce the Seventeenth<br />
Century, <strong>in</strong>: American Historical Review 95 (1990), S. 1423-1451; DERS. (wie<br />
Anm. 2).<br />
7 CLAUDE BLUMANN: Frontières et l<strong>im</strong>ites, <strong>in</strong>: Societé Francaise pour le Droit International,<br />
Colloques de Poitiers, La Frontière, Paris 1980, S. 5. Zitiert nach: ANTHONY CARTY: Für<br />
e<strong>in</strong>en neuen Grenzbegriff <strong>im</strong> Völkerrecht, <strong>in</strong>: Literaturen der Grenze (wie Anm. 3), S. 253-<br />
272, hier S. 253.<br />
8 DENNIS RUMLEY, JULIAN V. MINGHI: Introduction, <strong>in</strong>: The geography of border landscape,<br />
hrsg. von DENS., London, New York 1991, 1-14, hier S. 2. WALTER LEIMGRUBER: Segregation<br />
oder Integration. Innen- <strong>und</strong> Außengrenzen als Maßstäbe des Denkens <strong>und</strong> Handelns<br />
<strong>in</strong> der Schweiz, <strong>in</strong>: Geographische R<strong>und</strong>schau 43 (1991), S. 488-493, hier S. 488-489. Siehe<br />
auch folgende Studie: ANSSI PAASI: Territories, bo<strong>und</strong>aries and consciousness. The<br />
chang<strong>in</strong>g geographies of the F<strong>in</strong>nish-Russian border, Chichester, New York 1996.<br />
60
sam e<strong>in</strong>e funktionale E<strong>in</strong>heit: 9 Vorgänge <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Grenzregion haben direkte Auswirkungen<br />
<strong>im</strong> Zentrum <strong>und</strong> umgekehrt, wobei sich dies meist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Veränderung des<br />
Transparenzgrades der Staatsgrenze ausdrückt.<br />
Diese Sicht unterschätzt jedoch die Eigendynamik lokaler <strong>und</strong> regionaler Faktoren<br />
entlang von Staatsgrenzen, vor allem h<strong>in</strong>sichtlich der M<strong>in</strong>derheitenfrage. 10 Die Gefahr<br />
e<strong>in</strong>es zu zentrumsbezogenen Verständnisses von Staatsgrenze liegt entsprechend<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Wahrnehmung von Grenzregionen als per def<strong>in</strong>itionem periphere Gebiete –<br />
vor allem <strong>im</strong> westeuropäischen Bereich gibt es durchwegs Grenzregionen, die sich<br />
dynamisch entwickeln <strong>und</strong> grenzüberschreitende zentralräumliche Funktionen übernehmen<br />
können. Der Umkehrschluß, daß Grenzregionen nicht zw<strong>in</strong>gend bzw. auf<br />
Dauer benachteiligte Räume darstellen müssen, verweist e<strong>in</strong>erseits auf die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Entwicklung e<strong>in</strong>er Grenzregion, andererseits auf den Transparenzgrad<br />
der Staatsgrenze. 11 Dieser Gesichtspunkt führt uns zu e<strong>in</strong>em zweiten Def<strong>in</strong>itionsansatz<br />
von Grenze: Der regionalen bzw. lokalen Sicht entspräche die Auffassung<br />
von Staatsgrenze als Bereich des Aufe<strong>in</strong>andertreffens unterschiedlicher politischer<br />
<strong>und</strong> sozioökonomischer Parameter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em territorialen Kont<strong>in</strong>uum. Diesem Grenzmodell<br />
entspräche die Wahrnehmung von Grenzregion als Gebietsstreifen auf beiden<br />
Seiten e<strong>in</strong>er Staatsgrenze, <strong>in</strong> deren Zentrum die Grenze als Sondersituation e<strong>in</strong>e Ausdifferenzierung<br />
grenzüberschreitender Austauschbeziehungen <strong>und</strong> Interaktionen bed<strong>in</strong>gt.<br />
In der Regel kommt es zwar über die Staatsgrenze h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Bereichen zu<br />
e<strong>in</strong>er Steigerung des Güteraustausches, der <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Zusammensetzung stark selektiv<br />
ist <strong>und</strong> über den lokalen Bedarf h<strong>in</strong>ausgeht. 12 In den meisten Aspekten wird jedoch –<br />
selbst bei größtmöglicher Bereitschaft von staatlicher Seite, die Transparenz e<strong>in</strong>er<br />
Grenze durch Abkommen (wie z. B. über den kle<strong>in</strong>en Grenzverkehr) zu gewährleisten<br />
– e<strong>in</strong>e Barriere- <strong>und</strong> Verzerrungswirkung der Staatsgrenze festzustellen se<strong>in</strong>; dies um-<br />
9<br />
SIGRUN ANSELM: <strong>Grenzen</strong> trennen, <strong>Grenzen</strong> verb<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>: Literaturen der Grenze (wie<br />
Anm. 3), S. 197-<strong>20</strong>9, hier S. <strong>20</strong>2-<strong>20</strong>3.<br />
10<br />
Studien hierzu bieten u. a. folgende Werke: Deutsche <strong>und</strong> Polen zwischen den Kriegen.<br />
M<strong>in</strong>derheitenstatus <strong>und</strong> „Volkstumskampf“ <strong>im</strong> Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung<br />
aus beiden Ländern 19<strong>20</strong>-1939, hrsg. von RUDOLF JAWORSKI <strong>und</strong> MARIAN WOJ-<br />
CIECHOWSKI, 2 Bde., München u.a. 1997; MATHIAS NIENDORF: M<strong>in</strong>derheiten an der Grenze.<br />
Deutsche <strong>und</strong> Polen <strong>in</strong> den Kreisen Flatow (Złotów) <strong>und</strong> Zempelburg (Sępólno Krajeńskie)<br />
1900-1939, Wiesbaden 1997; PETER HASLINGER: Der ungarische Revisionismus<br />
<strong>und</strong> das Burgenland 1922-1932, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1994.<br />
11<br />
Vgl. hierzu: NILES M. HANSEN: Border region development and cooperation. Western Europe<br />
and the U.S.-Mexico borderlands <strong>in</strong> comparative perspective, <strong>in</strong>: Across bo<strong>und</strong>aries,<br />
hrsg. von ORLANDO MARTINEZ, El Paso 1986.<br />
12<br />
H. BREUNER: „Grenzgefälle“ – Hemmungs- oder Anregungsfaktoren für räumliche Entwicklung,<br />
<strong>in</strong>: Aachener Geographische Arbeiten 14 (1981), S. 425-437.<br />
61
so mehr, als sich die beiden benachbarten Staaten h<strong>in</strong>sichtlich ihrer sozialökonomischen<br />
<strong>und</strong> politischen Systeme unterscheiden. 13<br />
Es stellt <strong>im</strong> Bereich der Sozialgeographie e<strong>in</strong>e anerkannte These dar, daß entlang<br />
<strong>in</strong>ternationaler <strong>Grenzen</strong> Aktionsräume verschoben oder e<strong>in</strong>geschränkt werden.<br />
Grenzüberschreitungen wohnt daher per se e<strong>in</strong> restriktives Moment <strong>in</strong>ne, da die<br />
Staatsgrenze <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>en Übergangsbereich zwischen „eigenbest<strong>im</strong>mtem“ <strong>und</strong><br />
„fremdbest<strong>im</strong>mtem“ Bereich festsetzt. Dieser Aspekt müßte aus mikrohistorischer<br />
bzw. anthropologischer Perspektive um die Beobachtung ergänzt werden, daß e<strong>in</strong><br />
Preis- <strong>und</strong> Rechtsgefälle für die Lokalbevölkerung durchaus auch e<strong>in</strong>e Reihe von<br />
Möglichkeiten eröffnet. 14 Bei E<strong>in</strong>schreiten des Staates tendieren diese Grenzüberschreitungen<br />
<strong>in</strong> Richtung Illegalität (Schmuggel). Erreichen legistische <strong>und</strong> logistische<br />
Gegenmaßnahmen (Verschärfung der E<strong>in</strong>fuhr- <strong>und</strong> Ausfuhrbest<strong>im</strong>mungen, verschärfte<br />
Zoll- <strong>und</strong> Grenzkontrollen) e<strong>in</strong> best<strong>im</strong>mtes Ausmaß, führt dies zwangsläufig<br />
zu e<strong>in</strong>er Ausdünnung grenzüberschreitender Interaktionen. E<strong>in</strong>er Staatsgrenze kommt<br />
aus der Sicht der Lokalbevölkerung hierbei e<strong>in</strong>e Subjektrolle zu, die ihre personelle<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>frastrukturelle Verkörperung <strong>in</strong> der Grenzadm<strong>in</strong>istration f<strong>in</strong>det. Das Gefühl der<br />
Marg<strong>in</strong>alisierung, des unverschuldet an den Rand gedrängt Se<strong>in</strong>s, mündet nicht selten<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en verstärkten Bezug auf den Schutz <strong>und</strong> Vertrautheit vermittelnden Kle<strong>in</strong>raum.<br />
Gerade für den osteuropäischen Bereich wäre <strong>in</strong> diesem Zusammenhang aus identitätspolitischer<br />
Perspektive die Frage nach der Entstehung <strong>und</strong> Tradierung e<strong>in</strong>es<br />
„Grenzbewußtse<strong>in</strong>“ zu stellen. Für Grenzsäume kann <strong>in</strong> diesem Zusammenhang von<br />
der Forschungshypothese ausgegangen werden, daß diese bereits vor der Etablierung<br />
l<strong>in</strong>earer <strong>Grenzen</strong> durch e<strong>in</strong>en niederen Grad <strong>in</strong>frastruktureller Durchdr<strong>in</strong>gung <strong>und</strong> die<br />
Entwicklung charakteristischer Wirtschaftsstrategien gekennzeichnet waren, welche<br />
der Lokalbevölkerung <strong>im</strong> Falle e<strong>in</strong>er Eskalation von Konfliktlagen e<strong>in</strong>e unverzügliche<br />
Migration <strong>in</strong> schwerer zugängliche Bereiche ermöglichten. Vor allem für Regionen<br />
mit e<strong>in</strong>er weit zurückreichenden Konflikttradition bliebe daher zu erforschen, auf<br />
welche Lebensbereiche <strong>und</strong> Gruppen (z. B. Diasporam<strong>in</strong>oritäten) soziale Interaktionen<br />
über die Grenze bzw. den Grenzsaum h<strong>in</strong>weg beschränkt blieben. Zudem wird<br />
die Frage aufzuwerfen se<strong>in</strong>, ob die Schließung lokaler Kle<strong>in</strong>gesellschaften mit e<strong>in</strong>er<br />
e<strong>in</strong>seitigen Selbstabgrenzung gegenüber dem „Fe<strong>in</strong>dland“, dem Territorum jenseits<br />
des Grenzraumes, <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Bezugssystem gesetzt werden kann. Nicht zuletzt f<strong>in</strong>den sich<br />
gerade für Südosteuropa zahlreiche Beispiele für e<strong>in</strong>en extrem konfrontativ ausgestalteten<br />
Grenzbegriff, der meist <strong>in</strong> Identitätstopoi e<strong>in</strong>er exponierten Randlage, e<strong>in</strong>es<br />
„Grenzlandes“ 15 ihren Ausdruck f<strong>in</strong>det.<br />
13 GERT RITTER, JOSEPH HAJDU: Die deutsch-deutsche Grenze. Analyse ihrer räumlichen<br />
Auswirkungen <strong>und</strong> der raumwirksamen Staatstätigkeit <strong>in</strong> den Grenzgebieten, Köln 1982,<br />
S. 18.<br />
14 STEFAN KRÄTKE: Probleme <strong>und</strong> Perspektiven der deutsch-polnischen Grenzregion, <strong>in</strong>:<br />
Grenze der Hoffnung (wie Anm. 3), S. 162-<strong>20</strong>3, hier S. 169.<br />
15 Der Ausdruck „borderland“ wurde <strong>in</strong> der anglosächsischen Literatur erstmals 1937 für die<br />
Region entlang der Grenze zwischen den USA <strong>und</strong> Kanada verwendet, <strong>in</strong> dem, so der Autor,<br />
e<strong>in</strong> auf die Präsenz der Staatsgrenze zurückzuführender kultureller Unterschied festzu-<br />
62
Die parallel zu der Herausbildung von Staatsgrenzen verlaufenden Prozesse der<br />
Exklusion <strong>und</strong> Inklusion von Territorium würden, so könnte e<strong>in</strong>e Schlußfolgerung<br />
lauten, durch soziale Exklusions- <strong>und</strong> Inklusionsmechanismen ergänzt. Entwickelt<br />
diese Verschränkung <strong>in</strong> Identitätsdiskursen e<strong>in</strong>e politisch relevante Eigendynamik,<br />
werden entlang sprachlicher oder konfessioneller <strong>Grenzen</strong> Grenzbildungsprozesse zur<br />
Ausbildung neuer staatlicher oder quasistaatlicher E<strong>in</strong>heiten e<strong>in</strong>geleitet, was forcierte<br />
Migrationen bis h<strong>in</strong> zu ethnischen Säuberungen zur Folge haben kann. Gerade <strong>im</strong><br />
H<strong>in</strong>blick auf die zahlreichen Grenzverschiebungen <strong>in</strong> der ersten Hälfte unseres Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
(Balkankriege, Pariser Vorortverträge, die Grenzrevisionen zwischen Münchener<br />
Abkommen <strong>und</strong> den Pariser Friedensverträgen von 1947) ersche<strong>in</strong>t es <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang hilfreich, analog der frühen Klassifizierung von Grenzl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong><br />
„antezedente“ <strong>und</strong> „subsequente“ <strong>Grenzen</strong> 16 zusätzlich zwischen zwei Gr<strong>und</strong>typen<br />
von Staatsgrenzen zu unterscheiden: zwischen jenen <strong>Grenzen</strong>, die bei ihrer Konstitution<br />
als <strong>in</strong>ternationale Grenze direkt an adm<strong>in</strong>istrative Traditionen anknüpften <strong>und</strong><br />
daher seitens der Lokalbevölkerung über e<strong>in</strong> Rechts- <strong>und</strong> Identifikationsgefälle entsprechend<br />
ver<strong>in</strong>nerlicht s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong> jenen Staatsgrenzen, die mit ke<strong>in</strong>er zuvor existierenden<br />
adm<strong>in</strong>istrativen L<strong>in</strong>ie höherer Ordnung deckungsgleich wären. 17 Bei letzterem<br />
Grenztypus kann von e<strong>in</strong>em Fehlen ver<strong>in</strong>nerlichter Vorprägungen ausgegangen werden,<br />
so daß aus dieser Perspektive die neu festgesetzte Staatsgrenze e<strong>in</strong> als kulturelles<br />
<strong>und</strong> sozioökonomisches Kont<strong>in</strong>uum zu begreifendes Territorium durchschnitten hätte.<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung dieser Grenzregionen <strong>in</strong> die jeweiligen Rechts- <strong>und</strong> Verwaltungssysteme<br />
sowie Maßnahmen zur Sicherung der neuen Außengrenze (etwa durch die<br />
E<strong>in</strong>richtung von ausgewiesenen Stellen zum Zweck des Grenzübertritts) stünden aus<br />
dieser Perspektive am Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er Ause<strong>in</strong>anderentwicklung von die Grenzl<strong>in</strong>ie bislang<br />
überlappenden Merkmalsräumen. Weitgehend abgekoppelt von der Ausgestaltung<br />
der bilateralen Beziehungen entwickelt sich e<strong>in</strong>e derartige Staatsgrenze zu e<strong>in</strong>er<br />
alle Bereiche des Alltagslebens umfassenden Trennl<strong>in</strong>ie. 18<br />
stellen sei; die Gründe hierfür seien zum Teil lokaler Natur, lägen zudem <strong>im</strong> „nationalen<br />
Unterschied“ (national contrast) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er unterschiedlichen E<strong>in</strong>wanderungspolitik. S. B.<br />
JONES: The Cordilleran section oc the Canadian-United States boderland, <strong>in</strong>: Geographical<br />
Journal 89 (1987), S. 439-450. Zur aktuellen borderland-Forschung siehe u.a.: ANTONY<br />
IJAOLA ASIWAJU: Borderland Research. A Comparative Perspective, El Paso 1983; JULIAN<br />
V. MINGHI: European Borderlands. International Harmony, Landscape Change and New<br />
Conflict, <strong>in</strong>: Eurasia (wie Anm. 5), S. 89-98; hervorzuheben ist zudem: JOHN ROBERT VIC-<br />
TOR PRESCOTT: Political Frontiers and Bo<strong>und</strong>aries, London 1987; MARZIO STRASSOLDO:<br />
Regional development and national defence. A conflict of values and power <strong>in</strong> a frontier,<br />
<strong>in</strong>: Bo<strong>und</strong>aries and regions. Explorations <strong>in</strong> the values and power <strong>in</strong> a frontier, Trieste<br />
1973, S. 387-416.<br />
16 RICHARD HARTSHORE: Suggestions as to the term<strong>in</strong>ology of political bo<strong>und</strong>aries, <strong>in</strong>: Annals<br />
of the Association of American Geographers 26 (1936), S. 56-57.<br />
17 Dies träfe <strong>in</strong> der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise auf nahezu alle <strong>Grenzen</strong><br />
Ungarns, die Ostgrenze Polens oder die Mehrzahl der <strong>in</strong>nerbaltischen <strong>Grenzen</strong> zu.<br />
18 Bruchl<strong>in</strong>ie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung <strong>im</strong> österreichisch-ungarischen Grenzraum,<br />
hrsg. von MARTIN SEGER <strong>und</strong> PAL BELUSZKY, Wien 1993, S. 14.<br />
63
Der an e<strong>in</strong>er Staatsgrenze <strong>in</strong> der Regel latent vorhandene Spannungszustand – e<strong>in</strong><br />
Indifferenzzustand von Defensive <strong>und</strong> Offensive 19 – muß, so kann als Forschungshypothese<br />
formuliert werden, <strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles <strong>und</strong> kollektives Denken <strong>und</strong> Handeln<br />
e<strong>in</strong>fließen <strong>und</strong> beispielsweise zur Politisierung vieler Aktivitäten führen, die <strong>in</strong><br />
B<strong>in</strong>nengebieten ke<strong>in</strong>e entsprechende Relevanz besitzen. Vor allem für jene<br />
Generationen, die ihre <strong>in</strong>dividuellen territorialen Bezugsnetze vor dem Entstehen der<br />
Staatsgrenze entwickelten, bedeutete die neue Situation durchweg e<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>schneidende Veränderung der „Bewegungsnormalität“. Die Staatsgrenze wurde <strong>in</strong><br />
der Regel als logistisches Problem betrachtet <strong>und</strong> entsprechend versucht, bisherige<br />
grenzüberschreitende Praktiken (<strong>im</strong> ländlichen Bereich etwa Jahrmarktbesuche,<br />
E<strong>in</strong>kaufs- oder Wallfahrten) entgegen den neuen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen möglichst<br />
beizubehalten. Dies machte es jedoch nötig, den Amtsorganen der<br />
Grenzadm<strong>in</strong>istration gegenüber e<strong>in</strong>en neuartigen Habitus zu entwickeln, der eigenen<br />
Interessen <strong>und</strong> dem Kontrollbedürfnis des Staates be<strong>im</strong> Grenzübertritt <strong>in</strong> gleicher<br />
Weise Rechnung trug – <strong>in</strong> vielen Fällen führte dies zu lokalen Kompromissen, so daß<br />
die Grenze auch ohne die nötigen Papiere überschritten werden konnte. Aus dieser<br />
Perspektive kann Schmuggeltätigkeit <strong>im</strong> übrigen abseits ökonomischer Aspekte auch<br />
als <strong>in</strong>dividuelle Wiederherstellung e<strong>in</strong>er durch die Grenzziehung<br />
„verlorengegangenen“ bzw. „beschnittenen“ Lebenswelt gedeutet werden.<br />
Dieses Beispiel ließe die generalisierende Annahme zu, daß e<strong>in</strong> wesentliches<br />
Funktionspr<strong>in</strong>zip von Staatsgrenze <strong>im</strong> Bereich ihrer Wahrnehmung seitens der Akteure<br />
auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt werden kann, stellt sie doch für e<strong>in</strong> best<strong>im</strong>mtes<br />
Bevölkerungssegment jeweils e<strong>in</strong> positiv besetztes Innen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> neutral,<br />
exotisch oder – <strong>und</strong> dies vor allem <strong>in</strong> Osteuropa – negativ konnotiertes Außen her.<br />
Aus nationalstaatlicher Perspektive muß <strong>in</strong> diesem Zusammenhang auf e<strong>in</strong>e Besonderheit<br />
vor allem Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropas h<strong>in</strong>gewiesen werden: Spätestens seit<br />
der Zwischenkriegszeit dom<strong>in</strong>ieren hier Staaten, die sich als von e<strong>in</strong>er oder mehreren<br />
ethnischen Gruppen geprägt oder zum<strong>in</strong>dest getragen verstanden. Die Abgrenzung<br />
der Staatengebilde zue<strong>in</strong>ander erfolgte <strong>im</strong> wesentlichen nach dem Postulat, e<strong>in</strong>e<br />
Sprachgrenze sei identisch mit der Kulturgrenze e<strong>in</strong>er best<strong>im</strong>mten Bevölkerung <strong>und</strong><br />
stelle daher die Scheidel<strong>in</strong>ie zweier (aus dieser Perspektive unvere<strong>in</strong>barer) nationaler<br />
politischer Kulturen dar. Sprachgrenzen seien daher die natürliche Gr<strong>und</strong>lage zur<br />
Ziehung e<strong>in</strong>er idealen Staatsgrenze.<br />
Wie schon mehrfach festgehalten wurde, führten die sprachlich-ethnische Gemengelage<br />
sowie staatsrechtliche, wirtschaftliche, verkehrstechnische <strong>und</strong> militärstrategische<br />
Argumente <strong>und</strong> Rücksichten nach der Grenzziehung durchwegs zu e<strong>in</strong>er Inkohärenz<br />
von Sprach- <strong>und</strong> Staatsgrenzen. Vor allem Grenzregionen mit ethnischer M<strong>in</strong>derheitsbevölkerung<br />
mußten aus dem Blickw<strong>in</strong>kel des Zentrums Behauptungs- <strong>und</strong><br />
Profilierungsgebiete darstellen, dem „andersnationalen“ Nachbarstaat gegenüber<br />
ebenso wie regionalen Eliten, die dem vormaligen Staat gegenüber oft Restloyalitäten<br />
bewahrten. Es mußte <strong>im</strong> Interesse des Staates gelegen se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> neu übernommenen<br />
19 GEORG SIMMEL: Soziologie des Raumes, <strong>in</strong>: DERS.: Schriften zur Soziologie, Frankfurt<br />
1983, S. 227. Zitiert nach: ANSELM (wie Anm. 9), S. 197.<br />
64
Gebieten den eng begrenzten bzw. auf andere Zentren ausgerichteten Interessens- <strong>und</strong><br />
Wahrnehmungshorizont der lokalen Bevölkerung aufzubrechen. In der lokalen Bevölkerung<br />
nach wie vor präsente, auf die vormalige Staatsdoktr<strong>in</strong> gerichtete Identifikationsmuster<br />
bargen aus dieser Perspektive die Gefahr e<strong>in</strong>er Mobilisierung regionaler<br />
Bewußtse<strong>in</strong>s<strong>in</strong>halte <strong>in</strong> sich; entsprechend ist <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit <strong>in</strong> Ostmittel-<br />
<strong>und</strong> Südosteuropa <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong> Zentralisationsreflex der Staatsadm<strong>in</strong>istration<br />
vor allem peripher gelegenen Gebieten gegenüber festzustellen. Die e<strong>in</strong>em Souveränitätswechsel<br />
zwangsläufig nachfolgende Rechts- <strong>und</strong> Verwaltungsangleichung wurde<br />
<strong>in</strong> den meisten Staaten unter der Zielsetzung von Anb<strong>in</strong>dung, Erwerbssicherung <strong>und</strong><br />
staatsbürgerlicher „Sozialisierung“ durchgeführt; die neuen Staatsgrenzen sollten sich<br />
zu Außengrenzen staatsbürgerlichen Wohlverhaltens entwickeln.<br />
Der rezeptionsgeschichtliche Zugang auf das Thema „Staatsgrenze“ würde für die<br />
kommunistische Periode den Prozeß der Umwertung früherer, dem nationalen bzw.<br />
nationalistisch-faschistischen Diskursen entstammenden Topoi von Grenze als<br />
Schutzwall oder Bastion <strong>in</strong>s Zentrum des Interesses rücken – <strong>und</strong> dies sowohl h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Außengrenze (gegenüber dem kapitalistischen System) als auch der<br />
ehemaligen Konfliktl<strong>in</strong>ien zwischen den Bündnisstaaten des späteren Warschauer<br />
Paktes. Dies ersche<strong>in</strong>t nicht zuletzt aufgr<strong>und</strong> der tatsächlichen <strong>und</strong> potentiellen Brisanz<br />
des Themas „<strong>Grenzen</strong>“ für den osteuropäischen Bereich als besonders dr<strong>in</strong>glich.<br />
E<strong>in</strong>e noch vor dem Zerfall der Sowjetunion <strong>und</strong> Jugoslawiens, <strong>im</strong> Jahr 1987, erstellte<br />
Übersicht weist von den 13 verzeichneten europäischen Grenzkonflikten alle<strong>in</strong> neun<br />
diesem Teil Europas zu. <strong>20</strong> Für die aktualitätsbezogene Osteuropaforschung gälte es<br />
auch die These zu überprüfen, daß der Siegeleffekt <strong>in</strong>ternationaler <strong>Grenzen</strong> durch e<strong>in</strong>e<br />
weltweite Globalisierung zunehmend aufgehoben werden würde; 21 denn wie <strong>im</strong> Falle<br />
Jugoslawiens besitzt auch die „Vergrenzung“ ehemaliger B<strong>in</strong>nen- zu vollfunktionalen<br />
Staatsgrenzen <strong>im</strong> postsowjetischen Bereich, vor allem <strong>in</strong> der Kaukasusregion <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
Zentralasien, potentiellen Konfliktcharakter.<br />
Insgesamt wären solche vergleichenden Untersuchungen über das Management<br />
der Topoi „Grenze“ bzw. „Grenzland“ bei Prozessen der Ausbildung von Gruppenidentität<br />
notwendig, die auch die Ergebnisse der westeuropäischen Regionalismusdebatte,<br />
vor allem für den südosteuropäischen Bereich verstärkt berücksichtigen würde.<br />
22 Zusätzlich müßten weitere lokale <strong>und</strong> regionale Fallstudien helfen, das bisher<br />
<strong>20</strong> ALAN J. DAY: Border and territorial disputes, Harlow 1987.<br />
21 DAVID NEWMAN: The functional presence of an „erased“ bo<strong>und</strong>ary. The re-emergence of<br />
the Green L<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>: The middle east and north Africa. World bo<strong>und</strong>aries series 2, hrsg. von<br />
CLIVE H. SCHOFIELD <strong>und</strong> RICHARD N. SCHOFIELD, London, New York 1994, S. 71-98, hier<br />
S. 71.<br />
22 Zur Rezeption möglicher Ansätze siehe vor allem: JOCHEN BLASCHKE: Volk, Nation, <strong>in</strong>terner<br />
Kolonialismus, Ethnizität. Konzepte zur politischen Soziologie regionalistischer Bewegungen<br />
<strong>in</strong> Westeuropa, Berl<strong>in</strong> 1985; RICHARD PIEPER: Region <strong>und</strong> Regionalismus. Zur<br />
Wiederentdeckung e<strong>in</strong>er räumlichen Kategorie <strong>in</strong> der soziologischen Theorie, <strong>in</strong>: Geographische<br />
R<strong>und</strong>schau 89 (1987), S. 534-538; STEIN ROKKAN, DEREK W. URWIN: Economy,<br />
Territory, Identity, London 1983; PETER WEICHHART: Die Region – Ch<strong>im</strong>äre, Artefakt oder<br />
65
nur schemenhafte Bild der „<strong>Grenzen</strong>“ Osteuropas zu konkretisieren. Hierbei wird das<br />
räumliche Umfeld auf beiden Seiten des e<strong>in</strong>zelnen Grenzsegements vorerst als spezifische<br />
Situation zu begreifen <strong>und</strong> die Kle<strong>in</strong>räumigkeit der Entwicklung zu berücksichtigen<br />
se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>e Verknüpfung e<strong>in</strong>es lokal-regionalen Bezuges mit anderen Ebenen<br />
könnte vermehrt angestrebt werden. Geht man nämlich von der Beobachtung aus, daß<br />
adm<strong>in</strong>istrative B<strong>in</strong>nengrenzen, die unterschiedliche ethnische Regionen trennen, bei<br />
e<strong>in</strong>er Veränderung des Kräfteverhältnisses dazu tendieren, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale<br />
Grenze übergeführt zu werden 23 , stellt das Thema „Grenze“ auch <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>es der<br />
großen Potentiale e<strong>in</strong>er Osteuropaforschung <strong>im</strong> gesamteuropäischen Rahmen dar;<br />
denn ohne deren Expertise bezüglich regionaler Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> historischer Traditionen<br />
werden tragfähige Analysen zu Konfliktmanagement <strong>und</strong> Konfliktprävention<br />
<strong>in</strong> weiteren Eskalationsfällen kaum zu erwarten se<strong>in</strong>.<br />
Strukturpr<strong>in</strong>zip sozialer Systeme?, <strong>in</strong>: Region <strong>und</strong> Regionsbildung <strong>in</strong> Europa. Konzepte der<br />
Forschung <strong>und</strong> empirische Bef<strong>und</strong>e, hrsg. von GERHARD BRUNN, Baden-Baden 1996, S.<br />
25-43.<br />
23 NEWMAN (wie Anm. 21), S. 73.<br />
66
Wirtschaftliche Großräume<br />
oder nationalstaatliche Parzellierung?<br />
Die ökonomischen Funktionen von <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>in</strong> den Jahrzehnten um die Mitte des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
von<br />
Karl von D e l h a e s<br />
I. E<strong>in</strong>führung: Ökonomische Interpretationen von Staatsgrenzen<br />
Da se<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong> die Zuständigkeit e<strong>in</strong>es Staates <strong>in</strong> räumlicher H<strong>in</strong>sicht def<strong>in</strong>ieren,<br />
ist ihre potentielle ökonomische Funktion abhängig von Art <strong>und</strong> Ausmaß wirtschaftsrelevanter<br />
Zuständigkeiten, die der Staat beansprucht. Wie schon die zeitliche <strong>und</strong><br />
örtliche Begrenzung <strong>im</strong> Untertitel des Themas vermuten läßt, ist dieser Anspruch <strong>im</strong><br />
Verlauf der Entwicklung nicht <strong>im</strong>mer <strong>und</strong> nicht überall e<strong>in</strong>er gleichbleibenden Norm<br />
gefolgt.<br />
Es ist unter anderen von Ernst Heuß darauf h<strong>in</strong>gewiesen worden, daß der <strong>in</strong>ternationale<br />
Handel, d.h. der Staatsgrenzen überschreitende Wirtschaftsverkehr zwischen<br />
relativ <strong>in</strong>terventionsfreien, gleichermaßen marktwirtschaftlich orientierten Ländern<br />
eigentlich ke<strong>in</strong>en eigenständigen, von der allgeme<strong>in</strong>en Raumwirtschaftstheorie abgegrenzten<br />
Untersuchungsgegenstand darstellt. In se<strong>in</strong>er Schrift „Wirtschaftssysteme<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationaler Handel“ legt er dar, daß die natürliche Raumgeb<strong>und</strong>enheit von<br />
Gütern <strong>und</strong> Produktionsfaktoren – darunter die des arbeitenden Menschen – erst mit<br />
dem besonders nach dem Ersten Weltkrieg zunehmenden staatlichen Engagement <strong>in</strong><br />
allen Lebensbereichen durch e<strong>in</strong>e nationale Geb<strong>und</strong>enheit überlagert wurde. 1 Zum e<strong>in</strong>en<br />
bestand dieses Engagement <strong>im</strong> Versuch der E<strong>in</strong>flußnahme des Staates auf die<br />
Entscheidungen der privaten Anbieter <strong>und</strong> Nachfrager am Markt, <strong>in</strong>sbesondere auch<br />
dort, wo sie grenzüberschreitende Transaktionen betrafen. Zum anderen war es die –<br />
freilich <strong>in</strong> enger Wechselwirkung mit dem erstgenannten Aspekt stehende – Bereitstellung<br />
öffentlicher Güter. Erst hierdurch wurden nationale <strong>Grenzen</strong> wirtschaftlich<br />
bedeutsam als Zollgrenzen, Währungsgrenzen <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> der Besteuerung, aber<br />
beispielsweise auch als <strong>Grenzen</strong> zwischen Betriebsverfassungs-, Sozialversicherungs-<br />
oder Bildungssystemen. 2<br />
Im weiteren werde ich mich etwas ausführlicher mit der Entwicklung der direkten<br />
staatlichen E<strong>in</strong>flußnahme auf den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr unserer<br />
1<br />
Vgl. ERNST HEUSS: Wirtschaftssysteme <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationaler Handel, Zürich, Sankt Gallen<br />
1955, S. 14-<strong>19.</strong><br />
2<br />
Ebenda, S. 18.<br />
67
Region befassen, um dann abschließend e<strong>in</strong>ige Bemerkungen zur Relevanz nationaler<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em erweiterten Kontext zu machen, wie ihn etwa die neue politische<br />
Ökonomie als Ausgangspunkt n<strong>im</strong>mt.<br />
II. Staatliche Interventionen <strong>in</strong> grenzüberschreitende Markttransaktionen:<br />
der Individualgüterbereich<br />
1. Zollpolitik<br />
Traditionell dienten Zölle der staatlichen E<strong>in</strong>nahmeerzielung. <strong>Grenzen</strong> boten sich bei<br />
schwach entwickelter F<strong>in</strong>anzwirtschaft als zweckmäßigster Erhebungsort an. Noch<br />
1925 bestanden etwa <strong>in</strong> Rumänien fast die Hälfte, <strong>in</strong> Polen <strong>im</strong>merh<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Viertel, <strong>in</strong><br />
der Tschechoslowakei dagegen nur e<strong>in</strong> Sechstel der Staatse<strong>in</strong>nahmen aus Zöllen. 3<br />
Beg<strong>in</strong>nend mit dem Kameralismus <strong>und</strong> zunehmend seit der Industrialisierung wurden<br />
sie aber auch zur Ermutigung oder zum Schutz e<strong>in</strong>he<strong>im</strong>ischer Produktion e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
In Gegenrichtung zur Ausbreitung der Industrialisierung von England aus ergab sich<br />
<strong>in</strong> unserer Region e<strong>in</strong> ausgeprägtes Schutzzollgefälle. So waren die russischen <strong>und</strong><br />
selbst noch die österreichischen Sätze von den deutschen derart verschieden, daß <strong>im</strong><br />
neu entstandenen Polen bis Mitte 1921 zwischen dem ehemals preußischen <strong>und</strong> den<br />
übrigen Teilungsgebieten e<strong>in</strong>e Wirtschaftsgrenze aufrecht erhalten werden mußte. 4<br />
Die Slowakei kam zwar nicht aus e<strong>in</strong>em anderen Zollgebiet <strong>in</strong> den neuen Staatsverband.<br />
Der Wegfall des <strong>im</strong> Königreich Ungarn mittels Subventionen geübten Protektionismus<br />
führte aber auch hier zu Anpassungsproblemen, die die Industrie veröden<br />
ließen. 5 Die folgende Tabelle zeigt Umfang <strong>und</strong> ansteigende Tendenz des Zollprotektionismus<br />
der Länder unserer Region <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit. Er bezieht sich auf<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong> Industrie, wobei die Sonderrolle der Tschechoslowakei als e<strong>in</strong>ziges<br />
Land mit hochentwickelter Industrie bemerkenswerterweise kaum sichtbar wird.<br />
3 Vgl. ZDENEK DRABEK: Foreign Trade Performance and Policy, <strong>in</strong>: The Economic History<br />
of Eastern Europe 1919-1975, vol. I: Econonic Structure and Performance Between the<br />
Two Wars, hrsg. von MICHAEL C. KASER <strong>und</strong> EDWARD A. RADICE, Oxford 1985, S. 379-<br />
531, hier S. 412.<br />
4 Vgl. GYÖRGY RÁNKI <strong>und</strong> JERZY TOMASZEWSKI: The Role of the State <strong>in</strong> Industry, Bank<strong>in</strong>g<br />
and Trade, <strong>in</strong>: The Economic History of Europe 1919-1985, vol. II: Interwar Policy, the<br />
War and Reconstruction, hrsg. von MICHAEL C. KASER <strong>und</strong> EDWARD A. RADICE, Oxford<br />
1986, S. 3-48, hier S. 12 f.<br />
5 Ebenda, S. <strong>20</strong>.<br />
68
Tabelle 1: Höchstzölle <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> 1913, 1927 <strong>und</strong> 1931<br />
(als Prozentsatz vom Preis [cif], ungewichtete Mittelwerte)<br />
Warengruppe Jahr LAND<br />
Tschechoslowakei<br />
Ungarn Polen Rumänien<br />
1913 31,2 c 31,2 c 69,5 d 35,3<br />
Nahrungsmittel a 1927 37,7 34,5 75,5 47,6<br />
1931 89,0 64,4 118,0 90,0<br />
1913 21,8 c 21,8 c 71,0 d 33,6<br />
Halbfabrikate b 1927 23,5 32,0 38,3 44,5<br />
1931 32,2 40,6 46,2 56,4<br />
1913 24,0 c 24,0 c 90,0 d 28,5<br />
Fertigwaren 1927 46,0 41,0 69,5 60,3<br />
1931 44,0 55,5 61,4 69,5<br />
1913 25,7 c 25,7 c 77,0 d 33,0<br />
Durchschnitt 1927 35,8 35,8 61,0 51,0<br />
1931 55,0 53,5 75,0 72,0<br />
a: ohne Alkoholika b: ohne Erdölprodukte c: Österreich-Ungarn d: Rußland<br />
Quelle: HEINRICH LIEPMANN: Tariff Levels and the Economic Unity of Europe,<br />
London 1938, S. 392, 395, 397-399.<br />
2. Währungspolitik<br />
Es waren jedoch nicht ausschließlich <strong>und</strong> nicht e<strong>in</strong>mal vornehmlich die Zölle, die die<br />
<strong>Grenzen</strong> zu protektionistischen Schutzwällen machten. In dieser Funktion wurden sie<br />
durch nationale Währungsmanipulationen ergänzt <strong>und</strong> zeitweise sogar verdrängt. 6<br />
Zwar hatte es nationale Währungen auch vor dem Ersten Weltkrieg gegeben, aber die<br />
allgeme<strong>in</strong>e Akzeptanz <strong>und</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeit des Goldstandards ließen kaum Spielraum<br />
für nationale Währungspolitik. Nach den großen Inflationen – <strong>in</strong> unserem Raum <strong>in</strong><br />
Deutschland, Polen <strong>und</strong> Ungarn – war, trotz zeitweiliger Rückkehr zu e<strong>in</strong>em nom<strong>in</strong>ellen<br />
Goldstandard, das Vertrauen allgeme<strong>in</strong> gebrochen <strong>und</strong> Außen- <strong>und</strong> Innenwert der<br />
Währungen wurden zu Parametern staatlicher Politik. Die folgende Tabelle vermittelt<br />
hiervon, abgesehen von den großen Inflationen <strong>in</strong> Polen <strong>und</strong> Ungarn, auf den ersten<br />
Blick ke<strong>in</strong> dramatisches Bild. Die Vorgänge werden erst deutlicher, wenn man sich<br />
dazu <strong>in</strong>s Gedächtnis ruft, daß die beiden Leitwährungen der damaligen Zeit, Pf<strong>und</strong><br />
6 Ebenda S. 12 f.<br />
69
<strong>und</strong> Dollar 1931 bzw. 1933 den Goldstandard verließen <strong>und</strong> effektiv der Abwertung<br />
unterworfen waren. Zu dieser Zeit hatte <strong>in</strong> unserer Region der allgeme<strong>in</strong>e amtliche<br />
Wechselkurs bereits fast jegliche Funktion als Preiskomponente zur Steigerung des<br />
Außenhandels verloren. Vielfach wurden Geschäfte <strong>in</strong> den 30er Jahren je nach Warenart,<br />
Herkunfts- oder Best<strong>im</strong>mungsland zu speziellen Kursen abgerechnet.<br />
Tabelle 2: Wechselkurse <strong>und</strong> Inlandspreisniveau 1913 -1937<br />
Land<br />
Tschechoslowakei Ungarn Polen Rumänien<br />
Jahr WechselInlandsWechsel- Inlands-preise Wechsel-kurs InlandsWechselInlandskurspreisekurspreisekurspreise 1913 0,<strong>20</strong> 13 0,<strong>20</strong> 84 0,24 81 0,19 2<br />
1919 0,04 - - <strong>20</strong>46 0,01 - 0,02 -<br />
1921 0,01 260 0,001 5126 0,0003 37957 0,01 31<br />
1923 0,03 128 0,00005 422101 0,000002 97281870 0,005 57<br />
1925 0,03 98 0,00001 1437563 0,18 119 0,005 75<br />
1927 0,03 99 0,17 92 0,11 162 0,006 92<br />
1929 0,03 100 0,17 100 0,11 100 0,006 100<br />
1931 0,03 93 0,17 86 0,11 82 0,006 73<br />
1933 0,04 91 0,21 77 0,14 67 0,007 57<br />
1935 0,04<br />
1937 0,03 94 0,29 87 0,19 62 0,007 66<br />
(Wechselkurse: E<strong>in</strong>heit der Landeswährung <strong>in</strong> US $; Preisniveau: Lebenshaltungs<strong>in</strong>dex<br />
1929 = 100)<br />
Quelle: Völkerb<strong>und</strong>statistik nach RÁNKI <strong>und</strong> TOMASZEWSKI (wie Anm. 4), S. 178, 182,<br />
230.<br />
3. Adm<strong>in</strong>istrative E<strong>in</strong>griffe: Devisenbewirtschaftung, Kapitalverkehrskontrollen, Güterkont<strong>in</strong>gentierung,<br />
Außenhandelsmonopole<br />
Es ist e<strong>in</strong> ökonomischer Geme<strong>in</strong>platz, daß, wenn die Preise – wie hier durch Zölle<br />
<strong>und</strong> Währungsmanipulation – außer Funktion gesetzt werden, die Mengenregulierung<br />
nicht mehr vom Markt bewältigt werden kann. Es oblag nun also den Staaten, die<br />
Geld- <strong>und</strong> Warenströme über ihre <strong>Grenzen</strong> zum Ausgleich zu br<strong>in</strong>gen. Sicherlich<br />
standen die <strong>in</strong> folgender Zusammenstellung aufgelisteten Maßnahmen <strong>in</strong> Zusammenhang<br />
mit den Anpassungsproblemen nach dem Ersten Weltkrieg <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere mit<br />
den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Zugleich waren sie aber auch das Ergebnis von<br />
Aktionszwängen, <strong>in</strong> die sich die ostmitteleuropäischen Staaten Schritt um Schritt<br />
selbst begeben hatten.<br />
70
Tabelle 3: Adm<strong>in</strong>istrative E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> den <strong>in</strong>ternationalen Geld- <strong>und</strong> Warenverkehr<br />
Land<br />
E<strong>in</strong>griff<br />
Tschechoslowakei<br />
Ungarn<br />
Polen<br />
Rumänien<br />
Devisenbewirtschaftung<br />
ab 1931<br />
ab 1931<br />
ab 1936<br />
ab 1932<br />
Kapitalverkehrskontrolle<br />
ab 1932<br />
(Erleichterungen<br />
ab 1937)<br />
-<br />
ab 1936<br />
ab 1933<br />
Warenlenkung<br />
bis 1921 Zwangskartelle als Exportmonopole,<br />
Lizensierung<br />
durch Außenhandelsamt<br />
ab 1932 Importkont<strong>in</strong>gente <strong>und</strong><br />
-lizenzen<br />
ab 1933 Zwangskartelle als<br />
Außenhandelsmonopole<br />
bis 1924 Importembargoliste<br />
ab 1931 differenzierte Exportprämien<br />
ab 1932 Importkont<strong>in</strong>gente <strong>und</strong><br />
-lizenzen<br />
bis 1921 Lizenzierung durch Außenhandelsamt<br />
ab 1932 Importkont<strong>in</strong>gente <strong>und</strong><br />
-lizenzen<br />
Förderung von Exportkartellen<br />
bis 1922 Exportverbote<br />
ab 1932 Importkont<strong>in</strong>gente <strong>und</strong><br />
-lizenzen<br />
Präferentielle Exportförderung<br />
Sie standen damit freilich nicht alle<strong>in</strong> <strong>und</strong> waren <strong>in</strong> ihren Entscheidungen nicht<br />
<strong>im</strong>mer von den größeren Handelspartnern <strong>und</strong> Kreditgebern unabhängig. Insbesondere<br />
ihr nach Tradition <strong>und</strong> räumlicher Lage wichtigster Handelspartner, das Deutsche<br />
Reich, hatte e<strong>in</strong>en Teil der beschriebenen E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>en oder anderen Form<br />
vorexerziert <strong>und</strong> damit auch zu entsprechenden Reaktionen Anlaß gegeben. Obwohl<br />
es mit den Volkswirtschaften der USA, Großbritanniens <strong>und</strong> Frankreichs noch e<strong>in</strong><br />
weites Feld für den Handel auf der Basis konvertibler Währungen gab, traf ganz allgeme<strong>in</strong><br />
die Beobachtung J. M. Keynes zu, der 1926 <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Schrift „The End of<br />
Laissez-Faire“ konstatierte: „We do not dance even yet to a new tune. But change is<br />
<strong>in</strong> the air.“ 7<br />
7 Siehe JOHN MAYNARD KEYNES: The End of Laissez-Faire, London 1926, S. 3.<br />
71
4. Ostmitteleuropäischer Interventionismus der Zwischenkriegszeit: Anspruch <strong>und</strong><br />
Folgen für die Qualität der neuen <strong>Grenzen</strong><br />
In unserer Region hatte der Erste Weltkrieg die meisten Grenzveränderungen gebracht,<br />
<strong>und</strong> somit war hier die Besorgnis um ihren Bestand am stärksten ausgeprägt.<br />
Die großen Inflationen <strong>und</strong> später die Weltwirtschaftskrise erschütterten nachhaltig<br />
das Vertrauen <strong>in</strong> die Koord<strong>in</strong>ationsleistungen des Marktes. Was lag näher, als sich <strong>in</strong><br />
der Hoffnung auf Konsolidierung <strong>im</strong> Bereich der Währung wie dem der Wirtschaftsentwicklung<br />
den <strong>Institut</strong>ionen der neugef<strong>und</strong>enen Staatlichkeit zuzuwenden? Die Regierenden<br />
antworteten mit e<strong>in</strong>er Fülle zunächst punktueller wirtschaftspolitischer<br />
Maßnahmen 8 , deren geme<strong>in</strong>same Gr<strong>und</strong>lage anfangs allenfalls Erfahrungen aus der<br />
Kriegswirtschaft waren. Als Zielbündel lassen sich noch am ehesten Autarkie – <strong>in</strong>sbesondere<br />
auch für den Verteidigungsfall –, Freiheit von E<strong>in</strong>flüssen <strong>und</strong> verme<strong>in</strong>tlicher<br />
Ausbeutung von jenseits der Grenze 9 sowie – naturgemäß – Wachstum <strong>und</strong> hohe Beschäftigung<br />
erkennen.<br />
Ke<strong>in</strong>es dieser Ziele, mit Ausnahme vielleicht der Zurückdrängung des E<strong>in</strong>flusses<br />
ausländischer Privatfirmen <strong>und</strong> zeitweise der Belebung der Beschäftigung, ist rückschauend<br />
durch die staatlichen Interventionen nachhaltig gefördert oder gar erreicht<br />
worden. Indem die Staaten an ihren jeweiligen <strong>Grenzen</strong> den wirtschaftlich tätigen<br />
Bürgern <strong>im</strong>mer weitere Kompetenzen entzogen, koppelten sie sich mehr <strong>und</strong> mehr<br />
von e<strong>in</strong>er multilateralen <strong>in</strong>ternationalen Arbeitsteilung mit dem dazugehörigen Wohlstands-<br />
<strong>und</strong> Entwicklungspotential ab. Das Inlandspreisniveau lag aufgr<strong>und</strong> der zahlreichen<br />
Kartelle <strong>und</strong> Monopole <strong>in</strong> der Regel über dem der Weltmarktpreise. In den<br />
Verträgen zwischen <strong>in</strong>dividuellen Anbietern <strong>und</strong> Nachfragern, deren Gew<strong>in</strong>n<strong>in</strong>teresse<br />
e<strong>in</strong>e unparteiische Instanz gegenüber nationalistischem Eifer hätte se<strong>in</strong> können, wur-<br />
8 WALTER EUCKEN schildert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Gr<strong>und</strong>lagen der Wirtschaftspolitik (Tüb<strong>in</strong>gen 1952,<br />
hier zitiert nach 4. Aufl. Tüb<strong>in</strong>gen 1968) diese Vorgehensweise knapp, aber klarsichtig <strong>im</strong><br />
Kapitel V: Die Wirtschaftspolitik der Exper<strong>im</strong>ente (S. 55-58) wie auch ihre Folgen <strong>im</strong> Kapitel<br />
X: Die Wirtschaftspolitik der Exper<strong>im</strong>ente – Ergebnis (S. 149-154). Obgleich er sich<br />
überwiegend auf deutsche Erfahrungen bezieht, stellt er fest: „Der Druck der Tagesprobleme<br />
ist es, der auch <strong>in</strong> anderen Ländern den Anstoß zu Exper<strong>im</strong>enten gab <strong>und</strong> gibt. S<strong>in</strong>ken<br />
der Agrarpreise, Arbeitslosigkeit, Rückgang des Exports <strong>und</strong> andere Schäden. Am<br />
stärksten war der Anstoß, der von der großen Krisis 1929/32 ausg<strong>in</strong>g. Die Verh<strong>in</strong>derung<br />
der Wiederkehr e<strong>in</strong>er solchen Katastrophe wird nunmehr e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>gedanke aller wirtschaftspolitischen<br />
Exper<strong>im</strong>ente. (...) An irgende<strong>in</strong>er Stelle wird e<strong>in</strong> Exper<strong>im</strong>ent begonnen:<br />
Manipulierung von Preisen, Abwertung oder Politik des billigen Geldes.“ (S. 57) Den für<br />
die hier <strong>in</strong>teressierenden Länder spezifisch ausgeprägten Beweggr<strong>und</strong>, die Abwehr ausländischer<br />
E<strong>in</strong>flüsse, erwähnt er allerd<strong>in</strong>gs nicht.<br />
9 Da e<strong>in</strong>e Aufzählung der Publikationen, <strong>in</strong> denen dieser Zeitgeist Niederschlag fand, hier<br />
nicht zu leisten wäre, sei nur auf e<strong>in</strong>e der äußerst seltenen Ausnahmen h<strong>in</strong>gewiesen. LEO-<br />
POLD WELLISZ, e<strong>in</strong> liberaler polnischer Unternehmer <strong>und</strong> hoher Wirtschaftsfunktionär der<br />
Zwischenkriegszeit, warb <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Buch: Foreign Capital <strong>in</strong> Poland (London 1938) für<br />
das Engagement ausländischen Kapitals <strong>in</strong> Polen <strong>und</strong> war damit se<strong>in</strong>er Zeit, bezogen auf<br />
die uns <strong>in</strong>teressierende Region, um m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> halbes Jahrh<strong>und</strong>ert voraus.<br />
72
nen, wurden die Staaten zunehmend gleichsam Seniorpartner. Wegen der mangelnden<br />
Konvertibilität der e<strong>in</strong>genommenen Währungen konnten Erträge aus e<strong>in</strong>em Geschäft<br />
auch wieder nur be<strong>im</strong> selben staatlichen Partner ausgegeben werden. Dieser Bilateralismus,<br />
der <strong>in</strong> unserer Region während der 30er Jahre vorherrschend wurde – obgleich<br />
ursprünglich dem Streben nach mehr Eigenständigkeit entsprungen –, schuf letztlich<br />
neue <strong>und</strong> größere Abhängigkeiten <strong>in</strong> von vornhere<strong>in</strong> nationalen Kategorien.<br />
5. Die Zeit der Zentralverwaltungswirtschaften<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung des sowjetischen Modells e<strong>in</strong>er Zentralverwaltungswirtschaft Ende<br />
der 40er Jahre machten sich die Staaten schließlich für Produktion, Angebot <strong>und</strong><br />
Nachfrage auch der Güter des <strong>in</strong>dividuellen Konsums <strong>in</strong>nerhalb ihrer <strong>Grenzen</strong> nahezu<br />
alle<strong>in</strong> zuständig. Die oben für die Zwischenkriegszeit angedeuteten Tendenzen wurden<br />
damit auf die Spitze getrieben.<br />
Was dies für die trennende Potenz der <strong>Grenzen</strong> gegenüber der restlichen Welt<br />
ausmachte, braucht hier nicht betont zu werden. Aber auch entlang der sogenannten<br />
„Fre<strong>und</strong>schaftsgrenzen“ zwischen den sozialistischen Staaten war die Isolation vom<br />
Nachbarn für jeden Reisenden augenfällig.<br />
In der Festschrift für Wilhelm Wöhlke 10 habe ich mich ausführlicher mit dem Dilemma<br />
des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe befaßt, e<strong>in</strong>en wirtschaftlichen<br />
Großraum wenigstens für die sogenannte „sozialistische Arbeitsteilung“ zu schaffen.<br />
Die hartnäckige Verteidigung der nationalen Planautonomie der kle<strong>in</strong>eren Staaten gegene<strong>in</strong>ander<br />
<strong>und</strong> vor allem gegenüber der Sowjetunion 11 wie auch der systemspezifische<br />
Mangel zum<strong>in</strong>dest kompatibler Preissysteme als Koord<strong>in</strong>ationsbasis haben diese<br />
weitgesteckten Pläne <strong>im</strong>mer wieder frustriert. Bilateraler <strong>und</strong> naturaler Tausch mit<br />
se<strong>in</strong>en zahlreichen retardierenden Folgen blieb dom<strong>in</strong>ierend. Die Logik der zentralen<br />
Planung hätte nämlich als Alternative nur e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same, das heißt letztlich sowjetisch<br />
beherrschte Wirtschaftsadm<strong>in</strong>istration des ganzen Raumes unter Fortfall nationaler<br />
<strong>Grenzen</strong> m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong> ihrer wirtschaftlichen Funktion zugelassen.<br />
10 Vgl. KARL VON DELHAES: Autarkietendenzen versus „sozialistische Arbeitsteilung“, <strong>in</strong>:<br />
Berl<strong>in</strong>er Geographische Abhandlungen, Heft 53 (Festschrift für Wilhelm Wöhlke), Berl<strong>in</strong><br />
1990, S. 71-80.<br />
11 Bezeichnend für diese Haltung war der ZK-Beschluß der rumänischen KP vom 22. April<br />
1964: „Die planmäßige Leitung der Volkswirtschaft ist e<strong>in</strong>e der gr<strong>und</strong>legenden, unveräußerlichen<br />
<strong>und</strong> wesentlichen Attribute der Souveränität der sozialistischen Staaten, da der<br />
Staatsplan das Haupt<strong>in</strong>strument ist, durch das dieser se<strong>in</strong>e politischen <strong>und</strong> sozialwirtschaftlichen<br />
Ziele verwirklicht.“ Zitiert nach: JENS HACKER <strong>und</strong> ALEXANDER USCHAKOW: Die<br />
Integration <strong>Ostmitteleuropa</strong>s 1961-1965, Köln 1966, S. 230.<br />
73
III. Die räumliche Begrenzung des Angebotes öffentlicher Güter: E<strong>in</strong> Plädoyer für<br />
staatliche Parzellierung<br />
Bei den bisherigen Ausführungen sollte e<strong>in</strong>e gewisse Skepsis gegenüber e<strong>in</strong>er positiven<br />
Funktion nationaler <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Individualgüterbereich deutlich geworden se<strong>in</strong>.<br />
Sie beruht auf der Gr<strong>und</strong>annahme, daß dort, wo Angebot <strong>und</strong> Nachfrage überhaupt<br />
vom Markt koord<strong>in</strong>iert werden können, er diese Aufgabe ohne Fremde<strong>in</strong>flüsse am besten<br />
bewältigt. Dies muß jedoch nicht heißen, daß Großräume ohne <strong>Grenzen</strong> das e<strong>in</strong>zige<br />
s<strong>in</strong>d, was den Ökonomen zu unserem Thema e<strong>in</strong>fällt. Obgleich die Grenzziehung<br />
zwischen den Kategorien je nach politischer Gr<strong>und</strong>e<strong>in</strong>stellung verschieden vorgenommen<br />
wird, räumen auch die liberalen Exponenten dieser Diszipl<strong>in</strong> e<strong>in</strong>, daß es Güter<br />
gibt, deren Bereitstellung <strong>und</strong> Verteilung nicht oder nicht <strong>in</strong> befriedigendem Umfang<br />
über den Markt zu bewerkstelligen ist. Es s<strong>in</strong>d dies die sogenannten Kollektivgüter<br />
wie beispielsweise die Rechtsordnung, <strong>in</strong>nere <strong>und</strong> äußere Sicherheit, eventuell soziale<br />
Fürsorge <strong>und</strong> vieles andere mehr. Ihre Bereitstellung wird geme<strong>in</strong>sam beschlossen,<br />
sie stehen pr<strong>in</strong>zipiell allen Mitgliedern zur Verfügung <strong>und</strong> sollen deshalb auch<br />
geme<strong>in</strong>sam f<strong>in</strong>anziert werden. 12<br />
Unter anderem aber weil für Kollektive noch ke<strong>in</strong> besseres Beschlußverfahren als<br />
das Mehrheitspr<strong>in</strong>zip gef<strong>und</strong>en wurde, ergeben sich <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Bereitstellung<br />
von Kollektivgütern <strong>im</strong>mer wieder M<strong>in</strong>derheitenprobleme für Menschen,<br />
die etwa e<strong>in</strong> kollektives Gut, das sie f<strong>in</strong>anzieren müssen, nicht wünschen oder e<strong>in</strong>es<br />
wünschen, das nicht angeboten wird. Diese Probleme werden <strong>in</strong> aller Regel umso<br />
größer, je größer das anbietende Kollektiv ist, das heißt, desto mehr Menschen <strong>in</strong>nerhalb<br />
se<strong>in</strong>er <strong>Grenzen</strong> zusammengefaßt werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus aber n<strong>im</strong>mt die Zahl der Alternativen, die e<strong>in</strong>em widerwilligen<br />
Mitglied geboten werden, wie auch se<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terkollektive Mobilität mit der Ausdehnung<br />
oder Zusammenlegung von Kollektiven ab. Es wird dem E<strong>in</strong>zelnen <strong>im</strong>mer<br />
schwerer, sich oder se<strong>in</strong> steuerfähiges Besitztum dem staatlichen Erhebungsmonopol<br />
durch Abwanderung zu entziehen <strong>und</strong> so e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>ternationalen Wettbewerb um e<strong>in</strong><br />
angemessenes Kollektivgüterangebot bei entsprechender f<strong>in</strong>anzieller Belastung anzuregen.<br />
Auch aus liberaler ökonomischer Sicht s<strong>in</strong>d Staatsgrenzen also dann angemessen<br />
• wenn sie die Mobilität von Menschen, Kapital <strong>und</strong> Individualgütern nicht zusätzlich<br />
beschränken <strong>und</strong><br />
• wenn, soweit die kollektive Bereitstellung von Gütern nicht zu umgehen ist, dafür<br />
das kle<strong>in</strong>ste mögliche Kollektiv gewählt wird.<br />
12 Für e<strong>in</strong>e etwas ausführlichere Darstellung vgl. hierzu etwa: KARL VON DELHAES: Förderation,<br />
Konförderation <strong>und</strong> Regionalismus <strong>in</strong> ökonomischer Sicht, <strong>in</strong>: Volksgruppen <strong>in</strong> Ostmittel-<br />
<strong>und</strong> Südosteuropa = Südosteuropastudien, Bd. 52, hrsg. von GEORG BRUNNER <strong>und</strong><br />
HANS LEMBERG, Baden-Baden 1994, S. 295-309.<br />
74
Dieses freilich wird <strong>im</strong>mer seltener ausschließlich <strong>in</strong> den nationalstaatlichen <strong>Grenzen</strong>,<br />
sondern ebenso <strong>in</strong> föderativen Gliederungen oberhalb oder unterhalb dieser Ebene<br />
gef<strong>und</strong>en werden können. 13<br />
13 Siehe hierzu auch KARL VON DELHAES: Organiz<strong>in</strong>g the Supply of Public Goods <strong>in</strong> the<br />
Transition Process, <strong>in</strong>: Communist Economies and Economic Transformation, vol. 5, no 1,<br />
1993, pp. 87-101.<br />
75
Staaten <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>und</strong> ihre <strong>Grenzen</strong>
Die „Balkanisierung“ –<br />
Vor- <strong>und</strong> Schreckbilder der Entstehung neuer Nationalstaaten<br />
von<br />
Edgar H ö s c h<br />
Die gegenwärtigen schrecklichen Ereignisse <strong>in</strong> Bosnien haben dem alten Vorurteil<br />
vom Balkan als e<strong>in</strong>em Pulverfaß, als e<strong>in</strong>em Störfaktor <strong>im</strong> zivilisierten Europa, neue<br />
Nahrung gegeben. Sie führen <strong>in</strong> drastischer Weise die destruktiven Auswirkungen e<strong>in</strong>es<br />
fanatischen Nationalismus vor Augen. In e<strong>in</strong>em multiethnischen Umfeld mit e<strong>in</strong>er<br />
ausgeprägten Gemengelage unterschiedlicher sprachlich-ethnischer Gruppen <strong>und</strong><br />
Konfessionen mußten sich verheerende Auswirkungen für das Zusammenleben der<br />
Menschen ergeben. Durch die Sprengwirkung der nationalen Idee waren zu Beg<strong>in</strong>n<br />
dieses Jahrh<strong>und</strong>erts die großen ostmitteleuropäischen <strong>und</strong> südosteuropäischen Länderkonglomerate<br />
endgültig zerschlagen worden. Sie waren <strong>in</strong> den Jahrh<strong>und</strong>erten zuvor<br />
während des monarchischen Zeitalters <strong>in</strong> der europäischen Geschichte ohne<br />
Rücksicht auf Herkunft <strong>und</strong> Sprache der Bevölkerung aus eher zufälligen dynastischen<br />
Verb<strong>in</strong>dungen <strong>und</strong> wahllosen territorialen Umschichtungen zusammengewachsen.<br />
Die Zukunft sollte nach dem Willen der Friedensmacher am Ausgang des großen<br />
Völkerr<strong>in</strong>gens 1918 <strong>in</strong> der europäischen Staatenordnung dem nationalstaatlichen<br />
Pr<strong>in</strong>zip gehören. Heute sehen wir, daß die territorialen Abgrenzungsversuche zwischen<br />
den e<strong>in</strong>zelnen Balkanstaaten, die <strong>in</strong> mühevollen Verhandlungen am Ausgang<br />
des Ersten Weltkrieges <strong>in</strong> den Pariser Vorortsverträgen von den Großmächten zudiktiert<br />
worden waren, trotz leidvoller Erfahrungen <strong>in</strong> der Vergangenheit <strong>im</strong>mer noch<br />
nicht konsensfähig s<strong>in</strong>d. Die Gr<strong>und</strong>lagen des sog. Versailler Systems stehen erneut<br />
zur Disposition. Daß es sich nicht mehr nur um e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nere Angelegenheit der Balkanstaaten<br />
handelt, haben die Ereignisse der vergangenen Monate deutlich gemacht.<br />
Auf der anstehenden Suche nach e<strong>in</strong>er dauerhafteren Friedenslösung <strong>in</strong> Südosteuropa<br />
werden sich vor allem die e<strong>in</strong>stigen allmächtigen Friedensmacher ihrer Verantwortung<br />
nicht entziehen können. Es besteht Anlaß genug, e<strong>in</strong>e historische Bilanz zu ziehen<br />
<strong>und</strong> über die Fehler der Vergangenheit nachzudenken.<br />
„We are strongly of the op<strong>in</strong>ion that <strong>in</strong> the last analysis economic considerations<br />
will outweigh nationalistic affiliations <strong>in</strong> the Balkans, and that a settlement which <strong>in</strong>sures<br />
economic prosperity is most likely to be a last<strong>in</strong>g one“ 1 , heißt es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Memorandum<br />
vom Dezember 1917, das <strong>im</strong> Beratungsgremium des amerikanischen<br />
1<br />
The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 45, hrsg. von ARTHUR S. LINK Pr<strong>in</strong>ceton, New Jersey<br />
1984, S. 538.<br />
79
Präsidenten, dem sog. Inquiry, erarbeitet worden war. 2 Diese abschließende<br />
prospektivische Zukunftserwartung enthüllt <strong>in</strong> geradezu entwaffnender Offenheit den<br />
naiven Glauben der amerikanischen Führung am Ende des Ersten Weltkrieges an die<br />
Geltung der Vernunft <strong>in</strong> den zwischenstaatlichen Beziehungen <strong>und</strong> mehr noch an die<br />
heilenden Kräfte der Wirtschaft.<br />
Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hat <strong>in</strong> den berühmten 14 Punkten,<br />
die er am 8.1.1918 als Adresse an die beiden Häuser des Kongresses richtete, <strong>in</strong> zwei<br />
Punkten mit sehr viel vorsichtigeren Umschreibungen speziell auf die anstehenden<br />
territorialen Neuregelungen <strong>in</strong> Südosteuropa Bezug genommen. Punkt 12 garantiert<br />
den territorialen Restbestand des Osmanischen Reiches auf dem europäischen Festland<br />
<strong>und</strong> sichert den Balkanvölkern unter türkischer Hoheit e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nere Autonomie<br />
zu. In Punkt 11 war der Rückzug der Mittelmächte aus Rumänien, Serbien <strong>und</strong> Montenegro<br />
verlangt, Serbien e<strong>in</strong> Zugang zur See <strong>in</strong> Aussicht gestellt, die Hoffnung auf<br />
e<strong>in</strong>e Lösung der nachbarschaftlichen Beziehungen nach den historisch gewordenen<br />
Loyalitäten <strong>und</strong> dem Nationalitätspr<strong>in</strong>zip – „along historically established l<strong>in</strong>es of allegiance<br />
and nationality“ – zum Ausdruck gebracht <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale Garantie<br />
der politischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Unabhängigkeit <strong>und</strong> der territorialen Integrität<br />
versprochen worden. 3 Im übrigen hielt der amerikanische Präsident zu diesem Zeitpunkt<br />
noch ohne Vorbehalt an dem Weiterbestehen des Habsburgerreiches als Ordnungsfaktor<br />
<strong>im</strong> Donauraum fest. Er wollte nur den Völkern der Donaumonarchie e<strong>in</strong>e<br />
freie autonome Entwicklung zugestanden wissen. „The peoples of Austria-Hungary“,<br />
heißt es <strong>in</strong> Punkt 10, „whose place among the nations we wish to see safeguarded and<br />
assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous development“.<br />
Im Verlauf der Friedensverhandlungen <strong>in</strong> Paris kehrte sehr rasch bei allen Beteiligten<br />
Ernüchterung e<strong>in</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere der puritanische Moralist Wilson sah sich<br />
bald hilflos den Rankünen europäischer Gehe<strong>im</strong>diplomatie <strong>und</strong> den Zwängen europäischer<br />
Sicherheits- <strong>und</strong> Machtpolitik ausgeliefert. 4 Nationale Egoismen, Rücksichtnahmen<br />
auf die Verbündeten <strong>und</strong> die handfesten Eigen<strong>in</strong>teressen der Großmächte 5 ,<br />
die nicht selten den Erwartungen <strong>und</strong> Wünschen der betroffenen Völker widersprachen,<br />
waren auf ke<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Nenner zu br<strong>in</strong>gen. Vertragliche Zugeständnisse,<br />
die vorab schon noch während der Kriegshandlungen <strong>in</strong> <strong>in</strong>teralliierten Gehe<strong>im</strong>absprachen<br />
Rumänien <strong>und</strong> Italien gewährt worden waren, blockierten umfassende Neuregelungen.<br />
Italien waren für die Kündigung des Dreib<strong>und</strong>es <strong>und</strong> die Kriegsbeteili-<br />
2<br />
LAWRENCE E. GALFAND: The Inquiry. American Preparations for Peace, 1917-1919, New<br />
Haven/Conn., London 1963.<br />
3<br />
The Papers of Woodrow Wilson (wie Anm. 1).<br />
4<br />
HANS-JÜRGEN SCHRÖDER: Deutschland <strong>und</strong> Amerika <strong>in</strong> der Epoche des Ersten Weltkrieges<br />
1900-1924, Stuttgart 1993=EKrefelder Hefte zur deutsch-amerikanischen Geschichte, Bd.<br />
1), S. 39 f.<br />
5<br />
Zu den britischen Zielen <strong>im</strong> Donauraum MARIE-LUISE RECKER: England <strong>und</strong> der Donauraum<br />
1919-1929. Probleme e<strong>in</strong>er europäischen Nachkriegsordnung, Stuttgart 1976, <strong>und</strong> zu<br />
den britischen Friedensplanern jetzt ERIK GOLDSTEIN: W<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g the Peace. British Diplomatic<br />
Strategy, Peace Plann<strong>in</strong>g, and the Paris Peace Conference 1916-19<strong>20</strong>, Oxford 1991.<br />
80
gung an der Seite der Alliierten <strong>in</strong> Artikel 4 des Londoner Vertrages vom 26. April<br />
1915 das Trent<strong>in</strong>o, das Cisalp<strong>in</strong>e Tirol bis zur Brennergrenze, Triest, die Markgrafschaften<br />
Görz <strong>und</strong> Gradisca <strong>und</strong> ganz Istrien bis zum Quarnero unter E<strong>in</strong>schluß der<br />
Inseln <strong>in</strong> Aussicht gestellt worden. Nach Artikel 5 sollte Italien die Prov<strong>in</strong>z Dalmatien<br />
<strong>in</strong> den gegenwärtigen Verwaltungsgrenzen <strong>und</strong> nach Artikel 6 die volle Souvernänität<br />
über Valona <strong>und</strong> die Insel Sasseno erhalten. Mit der Besetzung Fiumes <strong>im</strong> September<br />
1919 durch die Freischaren Gabriele D'Annunzios erhöhte Italien se<strong>in</strong>e Territorialforderungen<br />
nach Kriegsende noch weiter über den Londoner Vertrag h<strong>in</strong>aus.<br />
Der rumänische Premier Ioan I. C. Brătianu hatte sich die Neutralitätszusage für<br />
se<strong>in</strong> Land <strong>im</strong> Petersburger Vertrag am 1. Oktober 1915 von dem russischen Außenm<strong>in</strong>ister<br />
Sazonov mit weitgehenden territorialen Zusagen <strong>in</strong> Siebenbürgen <strong>und</strong> <strong>in</strong> den<br />
rumänisch besiedelten Teilen der Bukow<strong>in</strong>a honorieren lassen <strong>und</strong> <strong>im</strong> Pokerspiel mit<br />
den Ententemächten um den Kriegse<strong>in</strong>tritt Rumäniens <strong>im</strong> Bukarester Vertrag vom 17.<br />
August 1916 den Besitzanspruch auf die Süddobrudscha, die Bukow<strong>in</strong>a bis zum Pruth<br />
unter E<strong>in</strong>schluß von Czernowitz <strong>und</strong> auf Siebenbürgen mit dem Banat durchzusetzen<br />
verstanden. 6 Großrumänien war so auf Kosten der Nachbarn selbst wieder zu e<strong>in</strong>em<br />
kle<strong>in</strong>en Vielvölkerstaat geworden.<br />
Auch ohne diese territorialen Vorabsprachen der Alliierten, deren Verb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
von dem amerikanischen Präsidenten bestritten wurde, hätten sich die hehren Pr<strong>in</strong>zipien,<br />
unter denen die Friedensmacher <strong>in</strong> Paris angetreten waren, nicht ohne Abstriche<br />
<strong>in</strong> der Praxis umsetzen lassen. In den Pariser Vorortsverträgen spiegelt sich e<strong>in</strong> Kompromiß,<br />
der e<strong>in</strong>e stillschweigende Begünstigung der Verbündeten <strong>und</strong> die zwangsläufige<br />
Benachteiligung der Kriegsverlierer e<strong>in</strong>schloß. Und mit den beiden Neuschöpfungen<br />
der Tschechoslowakei <strong>und</strong> Jugoslawiens waren teilweise überhastet Bevölkerungsgruppen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Staat zusammengeführt worden, die bisher nur<br />
wenige historische Geme<strong>in</strong>samkeiten verbanden <strong>und</strong> deren anfänglich euphorischer<br />
Vere<strong>in</strong>igungswille sehr bald erheblichen Belastungen ausgesetzt war. Charles Seymour,<br />
amerikanisches Mitglied der Territorialkommission, die konkrete Vorschläge<br />
zu den Grenzziehungen zu erarbeiten hatte, stellte <strong>in</strong> der Rückschau auf das Pariser<br />
Vertragswerk resignierend fest: „No honest student of European conditions, however,<br />
can be bl<strong>in</strong>d to the new dangers which have been created. It is <strong>und</strong>eniable that a considerable<br />
stretch of territory has been Balkanized.“ 7 Dieser Begriff der „Balkanisierung“<br />
ist <strong>im</strong> Zusammenhang mit den Nationalstaatsgründungen am Ende des Ersten<br />
Weltkrieges als term<strong>in</strong>us technicus <strong>in</strong> das politische Vokabular e<strong>in</strong>gegangen. Er weist<br />
auf die offenk<strong>und</strong>igen Unst<strong>im</strong>migkeiten <strong>und</strong> Fragwürdigkeiten der neuen Grenzregelungen<br />
<strong>in</strong> Südosteuropa h<strong>in</strong>, <strong>und</strong> er hebt die unübersehbaren destruktiven Auswirkungen<br />
nationalstaatlicher Organisationsmodelle überhaupt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em politischen Umfeld<br />
hervor, dessen multiethnische Siedlungsstrukturen nur e<strong>in</strong>e sehr unzulängliche Um-<br />
6 SHERMAN DAVID SPECTOR: Rumania at the Paris Peace Conference. A Study of the Diplomacy<br />
of Ioan I. C. Brătianu, New York 1962, S. 18ff.<br />
7 What Really Happened at Paris: The Story of the Peace Conference, 1918-1919, by American<br />
Delegates, hrsg. von EDWARD M. HOUSE <strong>und</strong> CHARLES SEYMOUR, New York 1921,<br />
S.106-107, zitiert nach SPECTOR, S. 130.<br />
81
setzung des Selbstbest<strong>im</strong>mungsrechtes zuließen. 8 Gerade dieses bunte Völkergemisch,<br />
das oft auf engstem Raume zusammenlebte, hatte <strong>in</strong> der Vergangenheit <strong>im</strong>mer<br />
wieder die Balkanreisenden fasz<strong>in</strong>iert. Als der berühmte Reiseschriftsteller des <strong>19.</strong><br />
Jahrh<strong>und</strong>erts Ludwig He<strong>in</strong>rich Fürst von Pückler-Muskau 1836 das ottonische Athen<br />
besuchte, fand er e<strong>in</strong> „Viertel antik, e<strong>in</strong> anderes türkisch, e<strong>in</strong>s neugriechisch <strong>und</strong> das<br />
letzte baierisch; tausendjährige <strong>und</strong> heutige Ru<strong>in</strong>en durche<strong>in</strong>ander gemengt, daneben<br />
nagelneue, grüne, gelbe <strong>und</strong> weiße Häuser, <strong>im</strong> Geschmack der Nürnberger Spielsachen<br />
aufgeführt; alte abgebrochene Straßen <strong>im</strong> gräßlichsten Chaos; breite, abgew<strong>in</strong>kkelte<br />
neue...“. 9 Und daran schließt sich das E<strong>in</strong>geständnis: „In Athen erst werde ich<br />
wieder gewahr, daß ich mich <strong>in</strong> Europa bef<strong>in</strong>de.“ Die für nationalstaatliche Regelungen<br />
schier unlösbaren Probleme aus diesen ethnographischen Gegebenheiten läßt die<br />
anschauliche Schilderung der kle<strong>in</strong>räumigen Verteilung der „Rassen“ <strong>in</strong> Mazedonien<br />
erahnen, die der gelehrte Reiseschriftsteller Emil von Laveleye <strong>im</strong> zweiten Band se<strong>in</strong>es<br />
Buches über die „Balkanländer“ von 1888 e<strong>in</strong>fügte: „Den Weststreifen Macedoniens,<br />
von jenseits des Dr<strong>in</strong>s bis Prizrend, bewohnen die Albanesen, <strong>und</strong> weiter <strong>im</strong><br />
Osten, jenseits Ochridas bis zur Eisenbahnl<strong>in</strong>ie Saloniki-Mitrowitza, stösst man bereits<br />
auf die anfangs noch mit Arnauten <strong>und</strong> walachischen Z<strong>in</strong>zaren vermischten Bulgaren.<br />
Der Norden wird hauptsächlich durch Serben, theilweise aber auch durch Arnauten<br />
bevölkert, <strong>und</strong> der Osten, wie der ganze mittlere Bereich, gehört den Bulgaren,<br />
die fast bis nach Seres <strong>und</strong> Soloniki (sic!) h<strong>in</strong> sich ausdehnen. Die Griechen sitzen <strong>in</strong><br />
den Küstenbezirken <strong>und</strong> spielen durch ihre höhere Bildungsstufe <strong>und</strong> ihre umfangreicheren<br />
Beziehungen zum Auslande <strong>in</strong> den meisten Städten e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Saloniki<br />
ist be<strong>in</strong>ahe e<strong>in</strong>e jüdische Stadt, <strong>und</strong> die dort ansässigen Griechen stammen grösstentheils<br />
von den Z<strong>in</strong>zaren ab. Walachen <strong>in</strong> zusammenhängenden Gruppen s<strong>in</strong>d <strong>im</strong><br />
Bereiche des P<strong>in</strong>dus <strong>und</strong> <strong>im</strong> Viljaet Monastir anzutreffen.“ 10<br />
In ke<strong>in</strong>er Region des östlichen Europas waren die Friedensmacher nach 1918 bei<br />
den anstehenden Grenzregelungen mit vergleichbar schwierigen Problemen konfrontiert<br />
gewesen wie gerade auf der Balkanhalb<strong>in</strong>sel. Nirgendwo sonst divergierten die<br />
Kriegsziele <strong>und</strong> längerfristigen Planungen der Großmächte <strong>in</strong> vergleichbarer Weise<br />
<strong>und</strong> nirgendwo sonst waren die Bemühungen um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>vernehmliche Friedensregelung<br />
zudem so sehr vorbelastet durch e<strong>in</strong>e längere leidvolle Vorgeschichte e<strong>in</strong>es unerbittlichen<br />
Volkstumskampfes, <strong>in</strong> dem alle Exzesse e<strong>in</strong>es übersteigerten Nationalismus<br />
– Bandenterror, gewaltsame ethnische Säuberungen, Bevölkerungstransfers <strong>und</strong><br />
Zwangsass<strong>im</strong>ilierungen, Mord <strong>und</strong> Totschlag – schon bis zum bitteren Ende durchexerziert<br />
worden waren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e unheilvolle Verb<strong>in</strong>dung von Konfession <strong>und</strong> Nation<br />
8 Zur Entstehungsgeschichte der Nationalstaaten Südosteuropas zusammenfassend CHARLES<br />
<strong>und</strong> BARBARA JELAVICH: The Establishment of the Balkan National-States, 1804-19<strong>20</strong>, Seattle,<br />
London 1977 EA History of East Central Europe, Bd. 8).<br />
9 Zitiert nach GUNNAR HERING: Der Hof Ottos von Griechenland, <strong>in</strong>: Höfische Kultur <strong>in</strong><br />
Südosteuropa. Bericht der Kolloquien der Südosteuropa-Kommission 1988 bis 1990, hrsg.<br />
von REINHARD LAUER <strong>und</strong> HANS GEORG MAJER, Gött<strong>in</strong>gen 1994, S. 253-281, hier S. 259-<br />
260.<br />
10 EMIL VON LAVELEYE: Die Balkanländer, 2. Bd., Leipzig 1888, S. <strong>20</strong>3.<br />
82
die Voraussetzungen für e<strong>in</strong> gutnachbarliches Zusammenleben bis <strong>in</strong> die Dorfgeme<strong>in</strong>schaften<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> zerstört hatten.<br />
Der Begriff des „Balkans“ hat unter dem E<strong>in</strong>druck dieser schrecklichen Ereignisse,<br />
die sich <strong>in</strong> der Endphase des Türkenkampfes vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit<br />
abspielten, e<strong>in</strong>en pejorativen Beigeschmack erhalten. Er hat ihn bis heute<br />
nicht mehr verloren. Der Balkan bezeichnet <strong>im</strong> populären Geschichtsverständnis e<strong>in</strong>e<br />
periphere Randzone des europäischen Kulturkreises „h<strong>in</strong>ten, weit, <strong>in</strong> der Türkei“<br />
(J.W. von Goethe) an der Grenze zu „Asien“, wo die Völker aufe<strong>in</strong>anderschlagen <strong>und</strong><br />
sich – so die verbreitete Me<strong>in</strong>ung der Mitteleuropäer – die rauheren Umgangsformen<br />
e<strong>in</strong>er atavistischen Lebensweise erhalten haben <strong>und</strong> die Relikte e<strong>in</strong>er rückständigen<br />
Stammesgesellschaft mit erstaunlicher Widerstandskraft dem zivilisatorischen Fortschritt<br />
trotzen. 11<br />
Die Wurzeln dieses Klischees reichen weit <strong>in</strong> die Vergangenheit zurück. Es reproduziert<br />
e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geschränkte historische Erfahrung der Mitteleuropäer, die auf die Türkengefahr<br />
<strong>und</strong> die Türkenfurcht der frühen Neuzeit zurückverweist. Südosteuropa<br />
wurde seit dem E<strong>in</strong>bruch der Osmanen <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert vornehmlich als gefährdetes<br />
Grenzland des Abendlandes erfahren. Auf den frühneuzeitlichen Reichstagen<br />
wurde die Türkenfrage zeitweilig zu e<strong>in</strong>em beherrschenden Thema <strong>in</strong> den Verhandlungen<br />
des Kaisers mit den Reichsständen. 12 Es wurde zusätzlich belastet durch die<br />
Konfessionsfrage <strong>im</strong> Reich. Die protestantischen Reichsstände haben sich ihre Hilfe<br />
durch Zugeständnisse <strong>in</strong> der reichsrechtlichen Anerkennung der neuen Lehre honorieren<br />
lassen. „Der Türke ist der Lutherischen Glück“, hieß e<strong>in</strong> geflügeltes Wort zu dieser<br />
Zeit. An der Türkenfront selbst s<strong>in</strong>d zur militärischen Abwehr <strong>und</strong> E<strong>in</strong>dämmung<br />
der äußeren Bedrohung seit der Mitte des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>in</strong>nerhalb der habsburgischen<br />
Militärgrenze geeignete Organisationsformen der Landesverteidigung entwikkelt<br />
worden, <strong>in</strong> die systematisch Balkanflüchtl<strong>in</strong>ge als grenznahe Wehrbauern e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en<br />
wurden. Die heutige Kraj<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Kroatien ist e<strong>in</strong> Ergebnis dieser Konstellation.<br />
E<strong>in</strong>e trutzige Grenzermentalität machte sich <strong>in</strong> den gefährdeten Grenzregionen breit,<br />
die auf Abgrenzung <strong>und</strong> Ausgrenzung des islamischen Balkans angelegt war. Die<br />
Vorstellung, als antemurale christianitatis das Abendland vor den asiatischen Horden<br />
verteidigen zu müssen, ist <strong>im</strong> Geschichtsbild der Ungarn, Rumänen, Slowenen <strong>und</strong><br />
Kroaten tief verwurzelt. In der nationalen Geschichtsschreibung n<strong>im</strong>mt seither der<br />
11 TRAIAN STOIANOVICH: A Study <strong>in</strong> Balkan Civilization, New York 1967. – Zu den Klischees<br />
<strong>im</strong> Balkanbild des Abendlandes vgl. KIRIL PETKOV: Infidels, Turks, and Women:<br />
The South Slavs <strong>in</strong> the German M<strong>in</strong>d, ca. 1400-1600, Frankfurt u.a. 1997, sowie <strong>in</strong>sbesondere<br />
MARIA TODOROVA: Imag<strong>in</strong><strong>in</strong>g the Balkans, New York, Oxford 1997, vgl. auch die<br />
Vorstudien von DERS.: The Balkans: From Discovery to Invention, <strong>in</strong>: Slavic Review 53, 2<br />
(1994), S. 453-482, <strong>und</strong> DIES.: Hierarchies of Eastern Europe: East Central Europe versus<br />
the Balkans. Occasional Papers. The Woodrow Wilson Center, Wash<strong>in</strong>gton Number 40<br />
(1995).<br />
12 WINFRIED SCHULZE: Reich <strong>und</strong> Türkengefahr <strong>im</strong> späten 16. Jahrh<strong>und</strong>ert. Studien zu den<br />
politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Auswirkungen e<strong>in</strong>er äußeren Bedrohung, München<br />
1978.<br />
83
Türkenkampf e<strong>in</strong>e zentrale Rolle e<strong>in</strong> 13 <strong>und</strong> Horrorberichte verzeichnen das Bild der<br />
Türkenherrschaft bis zur Unkenntlichkeit (beispielsweise die übertriebenen Vorstellungen<br />
über die Auswirkungen der sog. Knabenlese).<br />
Als seit dem Ausgang des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts – beg<strong>in</strong>nend mit der Rückeroberung<br />
Ungarns durch die kaiserlichen Truppen – radikale Lösungsversuche der sog. „Orientalischen<br />
Frage“ anstanden, hatten sich die Freiheitshoffnungen der Balkanchristen<br />
weiterh<strong>in</strong> äußeren Zwängen unterzuordnen. Die europäische Diplomatie folgte anderen<br />
Prioritäten. Sie scheute <strong>im</strong>mer mehr den großen Umbruch <strong>und</strong> sah zur Sicherung<br />
des monarchischen Systems <strong>in</strong> vorsichtigen Del<strong>im</strong>itationsbemühungen ihre vordr<strong>in</strong>glichere<br />
Aufgabe. Die Furcht vor der europäischen Revolutionspartei nährte bei Metternich<br />
e<strong>in</strong> pr<strong>in</strong>zipielles Mißtrauen gegenüber allen Volksbewegungen, <strong>und</strong> für die<br />
nationalen Ambitionen der kle<strong>in</strong>en Völker brachte er ke<strong>in</strong>erlei Verständnis auf.<br />
Die <strong>Grenzen</strong> der modernen Balkanstaaten, die unter diesen Voraussetzungen <strong>im</strong><br />
<strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert auf ehemaligem osmanischen Reichsterritorium entstanden waren,<br />
orientierten sich noch nicht an den ethnographischen Gegebenheiten. Es waren<br />
fremdbest<strong>im</strong>mte vorläufige Demarkationsl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er globalen Ause<strong>in</strong>andersetzung.<br />
Dabei trat die ursprüngliche Frontstellung des christlichen Abendlandes mit<br />
dem Islam <strong>im</strong>mer mehr <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> konkurrierende machtpolitische Überlegungen<br />
der europäischen Pentarchie <strong>und</strong> handfeste wirtschaftliche Interessen best<strong>im</strong>mten<br />
den Handlungsablauf. Entgegen den nachträglichen Mythenbildungen waren<br />
es <strong>in</strong> dieser Phase noch nicht die e<strong>in</strong>zelnen Völker selbst, die sich als best<strong>im</strong>mende<br />
Akteure <strong>in</strong> das Geschehen e<strong>in</strong>schalteten <strong>und</strong> dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Akt kollektiver Anstrengung<br />
e<strong>in</strong>e Staatsgründung <strong>in</strong> den <strong>Grenzen</strong> ihrer jeweiligen Siedlungsgebiete erzwungen<br />
haben. 14 Die Staatsterritorien der <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert entstehenden modernen<br />
Balkanstaaten bei den Griechen, Serben, Montenegr<strong>in</strong>ern <strong>und</strong> Rumänen s<strong>in</strong>d von den<br />
Mächten ohne Rücksicht auf nationale Ziele <strong>und</strong> Wünsche zudiktiert worden. Nach<br />
dem Willen der Signatarstaaten fanden so beispielsweise <strong>in</strong> dem neugegründeten Hellenenstaat<br />
1828 nur etwa 58% der am Freiheitskampf beteiligten griechischen Gebiete<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>sgesamt weniger als die Hälfte aller Griechen Südosteuropas, Kle<strong>in</strong>asiens <strong>und</strong><br />
13 GUNNAR HERING: Die Osmanenzeit <strong>im</strong> Selbstverständnis der Völker Südosteuropas, <strong>in</strong>:<br />
Die Staaten Südosteuropas <strong>und</strong> die Osmanen, hrsg. von HANS GEORG MAIER, München<br />
1989 ESüdosteuropa-Jahrbuch, <strong>19.</strong> Bd.), S. 355-380.<br />
14 Vgl. die kritischen Bemerkungen zum Begriff der sog. „nationalen Revolutionen“ <strong>in</strong> Südosteuropa<br />
von HARALD HEPPNER: Theorie <strong>und</strong> Realität der „Nationalen Revolution“ <strong>in</strong><br />
Bulgarien <strong>in</strong> den siebziger Jahren des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Nationalrevolutionäre Bewegungen<br />
<strong>in</strong> Südosteuropa <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, hrsg. von CHRISTO CHOLOLCEV, KARLHEINZ<br />
MACK <strong>und</strong> ARNOLD SUPPAN, Wien, München 1992, S. 60-67.= =Zu den Nationalbewegungen<br />
auf dem Balkan u.a. die Überblicksdarstellungen von WESLEY M.GEWEHR: The Rise of<br />
Nationalism <strong>in</strong> the Balkans, 1800-1930, o.O. 1931 (Repr<strong>in</strong>t Hambden/Conn. 1967); DIMI-<br />
TRIJE DJORDJEVIC: Révolutions nationales des peuples balkaniques 1804-1914, Belgrad<br />
1965; EMIL NIEDERHAUSER: The Rise of Nationality <strong>in</strong> Eastern Europe. Budapest 1981;<br />
Nationalbewegungen auf dem Balkan, hrsg. von NORBERT REITER, Berl<strong>in</strong> 1983 EBalkanologische<br />
Veröffentlichungen 5).<br />
84
des Inselarchipels Aufnahme. 15 Der horror vacui ließ die europäischen Diplomaten,<br />
die mit der Lösung der Orientalischen Frage befaßt waren, vor e<strong>in</strong>em großen Waffengang<br />
zurückschrecken. Um e<strong>in</strong>en vorschnellen Zusammenbruch des Osmanischen<br />
Reiches mit unabsehbaren Konsequenzen zu vermeiden, setzten sie auf die Reformfähigkeit<br />
des Sultanreg<strong>im</strong>es. Großzügige Autonomieregelungen sollten dem Sultan die<br />
Loyalität der christlichen Untertanen erhalten. Die Wiener Politik hatte schon mit<br />
Rücksicht auf die eigenen slawischen Völker <strong>in</strong>nerhalb der Donaumonarchie ke<strong>in</strong><br />
sonderliches Interesse, größere eigenständige Staatsgebilde der Slawen auf der Balkanhalb<strong>in</strong>sel<br />
zuzulassen. Mit der Okkupation (1878) <strong>und</strong> der späteren Annexion Bosniens<br />
<strong>und</strong> der Herzegow<strong>in</strong>a (1908) riskierte sie lieber den Konflikt mit dem erwachenden<br />
Nationalismus der Südslawen.<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Südosteuropa hatten <strong>in</strong> der Zeit des Türkenkampfes stets e<strong>in</strong>en Kompromißcharakter<br />
<strong>und</strong> sie beanspruchten mit dem fortschreitenden Verfall des Osmanischen<br />
Reiches <strong>im</strong> Laufe des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts nur e<strong>in</strong>e vorläufige Geltung <strong>in</strong> der Abgrenzung<br />
der befreiten christlichen Gebiete vom verbliebenen Herrschaftsbereich des<br />
Sultans. Sie waren <strong>in</strong> ihren aktuellen Festlegungen zudem weitgehend von sachfremden<br />
machtpolitischen oder ökonomischen Interessen best<strong>im</strong>mt. 16 E<strong>in</strong> erwachendes<br />
Selbstbewußtse<strong>in</strong> unter den Balkanvölkern mußte diese willkürlichen Beschneidungen<br />
der nationalen Ambitionen als e<strong>in</strong>e unerträgliche E<strong>in</strong>schränkung des Selbstbest<strong>im</strong>mungsrechts<br />
empf<strong>in</strong>den. Sie waren zudem <strong>in</strong> der Regel ohne Anhörung der Betroffenen<br />
verfügt worden. Die Entscheidungen spezieller Grenzbegehungskommissionen,<br />
die vor Ort zur Umsetzung der jeweiligen Konferenzbeschlüsse notwendig<br />
waren, s<strong>in</strong>d deshalb auch nie als dauerhafte Lösungen empf<strong>und</strong>en worden. Sie wurden<br />
allenfalls als zeitweilige Markierungen der Interessensphären h<strong>in</strong>genommen.<br />
Grenzüberschreitungen <strong>und</strong> gezielte Grenzverletzungen zählten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er betont antiislamischen<br />
christlichen Umwelt zu den männlichen Tugenden <strong>im</strong> Türkenkampf. Sie<br />
wurden vom Mythos des Heroischen verklärt, wie sich u.a. an der Bedeutungswandlung<br />
des griechischen „Klephten“ vom Räuber – so die eigentliche Wortbedeutung –<br />
zum Volkshelden ablesen läßt. 17 E<strong>in</strong> latenter Risorg<strong>im</strong>ento-Nationalismus stellte die<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit der Grenzregelungen generell <strong>in</strong> Frage. Er ist von den Großmächten<br />
bewußt <strong>in</strong>s Kalkül e<strong>in</strong>bezogen worden. Selbst die Amerikaner vermerkten 1917 nicht<br />
ohne Zynismus den Widerspruch zwischen den ordnungspolitischen Vorstellungen<br />
der Großmächte <strong>und</strong> den konkreten Zukunftserwartungen der Balkanvölker, die auf<br />
e<strong>in</strong>e rasche Befreiung vom islamischen Joch hofften: „Our policy must therefore con-<br />
15<br />
GUNNAR HERING: Die politischen Parteien <strong>in</strong> Griechenland 1821-1936, Teil 1, München<br />
1992, S. 54.<br />
16<br />
CASPAR HEER: Territorialentwicklung <strong>und</strong> Grenzfragen von Montenegro <strong>in</strong> der Zeit se<strong>in</strong>er<br />
Staatswerdung (1830-1887), Bern u.a. 1981 EGeist <strong>und</strong> Wirken der Zeiten, Nr. 61).<br />
17<br />
Vgl. GABRIELLA SCHUBERT: „Heldentum“ auf dem Balkan – Mythos <strong>und</strong> Wirklichkeit, <strong>in</strong>:<br />
Zeitschrift für Balkanologie 29 (1993), S. 16-33; zusätzliche Aspekte bei FIKRET ADANIR:<br />
Heiduckentum <strong>und</strong> osmanische Herrschaft. Sozialgeschichtliche Aspekte der Diskussion<br />
um das frühneuzeitliche Räuberwesen <strong>in</strong> Südosteuropa, <strong>in</strong>: Südost-Forschungen 41 (1982),<br />
S. 43-116.<br />
85
sist first <strong>in</strong> a stirr<strong>in</strong>g up of nationalist discontent, and then <strong>in</strong> refus<strong>in</strong>g to accept the extreme<br />
logic of this discontent, which would be the dismemberment of Austria-<br />
Hungary.“ 18<br />
Umso eifriger waren die Balkanvölker bei den schwierigen <strong>in</strong>ternen Abgrenzungsversuchen<br />
<strong>in</strong> den befreiten Gebieten darum bemüht, Argumente für e<strong>in</strong>e Ausweitung<br />
des eigenen Territoriums zu sammeln oder mit militärischen Mitteln vollendete<br />
Tatsachen zu schaffen. Die oft beschworene <strong>in</strong>nerbalkanische Solidarität, die bei<br />
vielen regionalen Aufstandsversuchen <strong>im</strong>mer wieder Freiwillige aus den Nachbarvölkern<br />
zu den Waffen eilen ließ, zerbrach sehr schnell, wenn es um den eigenen Vorteil<br />
g<strong>in</strong>g oder die Aufteilung der Beute anstand. Der pure nationale Egoismus zeigte sich<br />
<strong>im</strong> serbisch-bulgarischen Krieg von 1886 <strong>und</strong> während der beiden Balkankriege von<br />
1912/13. Die Folge dieser Gr<strong>und</strong>e<strong>in</strong>stellung war e<strong>in</strong>e verhängnisvolle Involvierung<br />
der nationalen Geschichtsschreibung <strong>in</strong> das schmutzige tagespolitische Geschäft. 19<br />
Sie erschwert bis heute – wie die Behandlung der Mazedonien-, der Bosnien- oder der<br />
Kosovo-Frage zeigt – e<strong>in</strong>e sachliche Diskussion der komplexen historischen Zusammenhänge.<br />
Die Vorkämpfer e<strong>in</strong>es derartigen Risorg<strong>im</strong>ento-Nationalismus ignorierten bewußt<br />
die erheblichen Wandlungen, die seit den mittelalterlichen Herrschaftsbildungen die<br />
ethnographischen Gegebenheiten gr<strong>und</strong>legend verändert haben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Areal, das<br />
jahrh<strong>und</strong>ertelang durch Migrationen <strong>und</strong> Siedlungsverlagerungen geprägt war. In ihren<br />
Leitideen knüpften sie an die nur noch fiktiven Legit<strong>im</strong>ationen mittelalterlicher<br />
Reichsbildungen an. Sie wurden ungeachtet nachweislicher Kont<strong>in</strong>uitätsbrüche <strong>und</strong><br />
weitreichender <strong>in</strong>terethnischer Verschiebungen dennoch ohne E<strong>in</strong>schränkungen für<br />
die eigene Sache <strong>in</strong> der Gegenwart <strong>in</strong> Anspruch genommen. <strong>20</strong> Das geschichtliche Argument,<br />
das dem Geme<strong>in</strong>schaftswerk der nationalen Erweckung dienen sollte, wurde<br />
so zur Waffe gegen den Nachbarn <strong>und</strong> Konkurrenten geschmiedet. Im Jahre 1843 äußerte<br />
sich Ioannis Kolettis vor der griechischen Nationalversammlung zu den territorialen<br />
Umrissen e<strong>in</strong>es künftigen griechischen Nationalstaates mit folgenden Worten:<br />
„Das Königreich Griechenland ist nicht Griechenland; es macht nur e<strong>in</strong>en Teil, <strong>und</strong><br />
zwar den kle<strong>in</strong>sten <strong>und</strong> ärmsten, Griechenlands aus. Grieche ist nicht nur, wer <strong>im</strong> Königreich<br />
wohnt, sondern auch der E<strong>in</strong>wohner von Ioann<strong>in</strong>a, Thessaloniki, Serres,<br />
Konstant<strong>in</strong>opel, Trapezunt, Kreta, Samos oder irgende<strong>in</strong>es Landes der griechischen<br />
Geschichte oder des Stammes... Es gibt zwei große Zentren des Griechentums. Athen<br />
ist die Hauptstadt des Königreiches. Konstant<strong>in</strong>opel ist die große Hauptstadt, der<br />
Traum <strong>und</strong> die Hoffnung der Griechen.“ 21 Der E<strong>in</strong>wand des streitbaren Gelehrten Ja-<br />
18 The Papers of Woodrow Wilson (wie Anm. 1), S. 459-474, hier S. 463.<br />
19 Kritisch zu den Voraussetzungen <strong>und</strong> Auswirkungen des Nationalismus <strong>in</strong> Südosteuropa<br />
HOLM SUNDHAUSSEN: Nationsbildung <strong>und</strong> Nationalismus <strong>im</strong> Donau-Balkan-Raum, <strong>in</strong>:<br />
Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 48 (1993), S. 233-258, mit weiterführenden<br />
Literaturverweisen.<br />
<strong>20</strong> PASCHALIS M. KITROMILIDES: „Imag<strong>in</strong>ed Communities“ and the Orig<strong>in</strong>s of the National<br />
Question <strong>in</strong> the Balkans, <strong>in</strong>: European History Quarterly 19 (1989), S. 149-192.<br />
21 HERING (wie Anm. 15), S. 190.<br />
86
kob Philipp Fallmerayer – erhoben schon <strong>im</strong> Jahre 1830 auf dem Höhepunkt der europaweiten<br />
philhellenischen Bewegung –, daß <strong>in</strong> den Adern der modernen Griechen<br />
ke<strong>in</strong> Tropfen antiken Blutes mehr zu f<strong>in</strong>den sei, die slawische Landnahme auf der<br />
Balkanhalb<strong>in</strong>sel <strong>und</strong> die Siedlungsausbreitung der Albaner ihre Spuren h<strong>in</strong>terlassen<br />
hätten, focht die nationalen Ideologen nur wenig an. Die Serben standen den Griechen<br />
<strong>in</strong> der Mystifizierung der glorreichen Vergangenheit <strong>und</strong> der handlichen Aufbereitung<br />
verme<strong>in</strong>tlicher historischer Argumente für die aktuellen politischen Ziele nicht nach.<br />
Ilija d~ê~◊~åáå beanspruchte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em politischen Programm, das er <strong>in</strong> dem berühmten<br />
„k~¦Éêí~åáàÉ“ von 1844 entwickelte 22 , für se<strong>in</strong> Volk die <strong>Grenzen</strong> des Duschan-<br />
Reiches <strong>im</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert. „Serbien muß ständig danach trachten“, notierte er, „aus<br />
dem Gebäude des türkischen Staates nur Ste<strong>in</strong> um Ste<strong>in</strong> herauszureißen <strong>und</strong> <strong>in</strong> sich<br />
aufzunehmen, so daß es aus diesem guten Material auf der guten alten Gr<strong>und</strong>lage des<br />
serbischen Kaiserreiches wieder e<strong>in</strong>en neuen großen serbischen Staat aufbauen <strong>und</strong><br />
errichten kann“. 23 Zur Erläuterung muß man allerd<strong>in</strong>gs h<strong>in</strong>zufügen, daß ihm der Gedanke<br />
von der rußlandfe<strong>in</strong>dlichen polnischen Emigration um Fürst Adam Czartoryski<br />
<strong>und</strong> dessen Balkanbeauftragten, Franti◊ek Zach, nahelegt worden ist <strong>und</strong> er noch ke<strong>in</strong>e<br />
territorialen Ambitionen gegenüber den Südslawen <strong>in</strong> der Habsburgermonarchie<br />
be<strong>in</strong>haltete. Die Kroaten standen den Griechen <strong>und</strong> Serben nicht nach. Der irredentistische<br />
Großkroatismus e<strong>in</strong>es Ante pí~ê¦ÉîᎠ(1823-1896) vere<strong>in</strong>nahmte ohne Bedenken<br />
Slowenen wie Serben für e<strong>in</strong>en künftigen kroatischen Nationalstaat, wenn er erklärte,<br />
daß „die gesamte Bevölkerung zwischen Makedonien <strong>und</strong> Deutschland, zwischen<br />
der Donau <strong>und</strong> dem Adriatischen Meer nur e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Nationalität, nur e<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>ziges Leben, das kroatische Leben, hat“. 24<br />
E<strong>in</strong>e Aufteilung des verfügbaren Raumes nach der „Großen Idee“ (Megale Idea)<br />
der Griechen oder nach diesen großserbischen <strong>und</strong> großkroatischen Plänen hätte den<br />
Anra<strong>in</strong>ern kaum mehr Entfaltungsmöglichkeiten gelassen. Erbittert wurde – <strong>und</strong> wird<br />
bis heute – unter den Historikern um den Nachweis von Siedlungskont<strong>in</strong>uitäten gestritten,<br />
um daraus Territorialforderungen für die Gegenwart abzuleiten (vgl. den ungarisch-rumänischen<br />
Streit um Siebenbürgen oder den griechisch-mazedonischen<br />
Streit um Makedonien).<br />
Nicht übersehen sollte man, daß Protagonisten des nationalen Gedankens <strong>und</strong> die<br />
sog. „nationalen Erwecker“ unter den Balkanvölkern <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert erhebliche<br />
Schwierigkeiten hatten, ihren Landsleuten <strong>in</strong> mühseliger Kle<strong>in</strong>arbeit zunächst das Gefühl<br />
der geme<strong>in</strong>samen ethnischen Herkunft <strong>und</strong> Geschichte, der geme<strong>in</strong>samen Sprache<br />
<strong>und</strong> Kultur, der volkstümlichen Traditionen <strong>und</strong> Gebräuche zu vermitteln. Bei der<br />
E<strong>in</strong>führung der Sprache als objektivem ethnischen Unterscheidungskriterium übersahen<br />
sie geflissentlich die Unsicherheiten sprachlicher <strong>und</strong> ethnischer Zuordnungen. In<br />
traditionellen Mischgebieten, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e funktionelle Mehrsprachigkeit die Regel<br />
22 PAUL N. HEHN: The Orig<strong>in</strong>s of Modern Pan-Serbish=–=The 1844 Nacertanija of Ilija Garasan<strong>in</strong>:<br />
An Analysis and Translation, <strong>in</strong>: East European Quarterly 9 (1975), S. 153-171.<br />
23 WOLF DIETRICH BEHSCHNITT: Nationalismus bei Serben <strong>und</strong> Kroaten 1830-1914. Analyse<br />
<strong>und</strong> Typologie der nationalen Ideologie, München 1980, S. 56.<br />
24 Zitiert nach BEHSCHNITT (wie Anm. 23), S. 181.<br />
87
war, waren Zufälligkeiten der <strong>in</strong>dividuellen Entscheidungen nicht ausgeschlossen,<br />
zumal die Behörden alle Manipulationsmöglichkeiten zu nutzen verstanden, die e<strong>in</strong>e<br />
unterschiedliche Gewichtung des Sprachkriteriums bei den Volkszählungen bot, um<br />
bei Erhebungen e<strong>in</strong> der Regierung genehmes Ergebnis zu erreichen. 25 Die Sprache<br />
eignete sich nur bed<strong>in</strong>gt als objektives Unterscheidungskriterium 26 , weil sie erst über<br />
durchaus fragwürdige <strong>und</strong> zum<strong>in</strong>dest diskussionsfähige Sprachnormierungsversuche<br />
zu e<strong>in</strong>em Abgrenzungs<strong>in</strong>strument geschmiedet wurde. Die Sprachreformer Ljudevit<br />
Gaj bei den Kroaten <strong>und</strong> Vuk StefanoviŽ h~ê~NjᎠbei den Serben haben beide ihre<br />
Normierungsvorschläge für e<strong>in</strong>e Schriftsprache auf der gleichen Gr<strong>und</strong>lage, dem Štokavischen,<br />
entwickelt <strong>und</strong> eher noch zur Verwirrung beigetragen 27 <strong>und</strong> der Phantasie<br />
der nationalen Ideologen freien Lauf gelassen. Vuk h~ê~NjᎠselbst vertrat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
berühmten Schrift „Srbi svi i svuda“ (1849) e<strong>in</strong>en sprachlich-kulturellen Großserbismus,<br />
der die štokavisch-sprechenden Teile der Kroaten den Serben zuschlug. „Karad‹áŽ<br />
entwarf damit für das Serbentum e<strong>in</strong> Raumbild, das ungefähr dem heutigen Jugoslawien<br />
entsprach.“ 28 Das Religionsbekenntnis spielte als ethnisches Unterscheidungskriterium<br />
bei Karadžić noch ke<strong>in</strong>e entscheidende Rolle. Noch 1861 me<strong>in</strong>te er <strong>in</strong><br />
Reaktion auf Kritiker: „Serben können sich gerechterweise alle Štokavci nennen,<br />
welchen Glauben sie auch haben, <strong>und</strong> wo auch <strong>im</strong>mer sie wohnen.“ Bei den Kroaten<br />
war es e<strong>in</strong> etatistischer oder e<strong>in</strong> ausgeweiteter kultureller Nationsbegriff, der <strong>in</strong> ähnlicher<br />
Weise <strong>in</strong> extensive Territorialforderungen e<strong>in</strong>mündete.<br />
Die nationalen Ideologen unter den Balkanvölkern zogen es notfalls vor, unpassende<br />
ethnographische Erhebungen durch gefälschtes Beweismaterial <strong>in</strong> ihrem S<strong>in</strong>ne<br />
zu korrigieren. Kartographen <strong>und</strong> Ethnographen ließen sich <strong>im</strong> Vorfeld anstehender<br />
oder angestrebter Grenzveränderungen bei allen Anra<strong>in</strong>ern als willige Handlanger<br />
mißbrauchen. 29 Das Diktat e<strong>in</strong>es engstirnigen Sprachnationalismus nahm der E<strong>in</strong>zelperson<br />
die Entscheidungsfreiheit, sich e<strong>in</strong>er best<strong>im</strong>mten ethnischen Gruppe zugehörig<br />
fühlen zu wollen. Dies hatte teilweise absurde Folgen für e<strong>in</strong>e staatliche Nationalitätenpolitik,<br />
wie unlängst Rolf Wörsdöfer sehr anschaulich für die julisch-dalmat<strong>in</strong>ische<br />
Grenzregion vor Augen geführt hat. Von dem e<strong>in</strong>zigartigen Völkermosaik, das nach<br />
25<br />
Vgl. EMIL BRIX: Die Umgangssprachen <strong>in</strong> Altösterreich zwischen Agitation <strong>und</strong> Ass<strong>im</strong>ilation.<br />
Die Sprachenstatistik <strong>in</strong> den zisleithanischen Volkszählungen 1880-1910, Wien 1982.<br />
26<br />
NORBERT REITER: Sprache <strong>in</strong> nationaler Funktion, <strong>in</strong>: Ethnogenese <strong>und</strong> Staatsbildung <strong>in</strong><br />
Südosteuropa, hrsg. von KLAUS-DETLEV GROTHUSEN, Gött<strong>in</strong>gen 1974, S. 104-115, <strong>und</strong><br />
DERS.: Gruppe, Sprache, Nation, Berl<strong>in</strong> 1984 EBalkanologische Veröffentlichungen 9).<br />
27<br />
Zum Gesamtproblem der Sprachnormierungen: Sprachen <strong>und</strong> Nationen <strong>im</strong> Balkanraum.<br />
Die historischen Bed<strong>in</strong>gungen der Entstehung der heutigen Nationalsprachen, hrsg. von<br />
CHRISTIAN HANNICK, Köln, Wien 1987 ESlavistische Forschungen, Bd. 56).<br />
28<br />
BEHSCHNITT (wie Anm. 23), S. 72. Zur Problematik der Programmschrift „Srbi svi i svuda“<br />
a.a.O., S. 72-82.<br />
29<br />
Dazu die klassische Darstellung von HENRY ROBERT WILKINSON: Maps and Politics. A<br />
Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia, Liverpool 1951.<br />
88
den ethnographischen Erhebungen des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts noch e<strong>in</strong> Dutzend „nationaler<br />
Varietäten“ aufwies 30 , blieben nur noch Slawen <strong>und</strong> Italiener.<br />
Vuk Karadžić wollte 1861 eher wiederwillig neben der Sprache allenfalls die Konfessionszugehörigkeit<br />
noch als zusätzliches Kriterium zur Unterscheidung zwischen<br />
Kroaten <strong>und</strong> Serben gelten lassen. E<strong>in</strong> Katholik möge sagen, „er sei Kroate, wenn<br />
auch <strong>im</strong>mer er es will“. 31 Wir wissen heute, daß selbst dem Glaubensbekenntnis <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er geschlossenen bäuerlichen Gesellschaft, aus der es für den E<strong>in</strong>zelnen kaum e<strong>in</strong><br />
Entr<strong>in</strong>nen gab, nur e<strong>in</strong>e beschränkte Aussagekraft beizumessen ist. 32 Dies lehren zahlreiche<br />
Beispiele gerade <strong>in</strong> Südosteuropa. Unter den Bed<strong>in</strong>gungen der islamischen<br />
Fremdherrschaft zählten die vielfältigen Ersche<strong>in</strong>ungsformen e<strong>in</strong>es Kryptochristentums<br />
33 ebenso zur Alltagsrealität wie Zwangsbekehrungen oder auch freiwilliger<br />
Glaubenswechsel. Über die Herkunft <strong>und</strong> die ethnische Zuordnung beispielsweise der<br />
musl<strong>im</strong>ischen Pomaken <strong>in</strong> Bulgarien, der Gagausen oder der bosnischen Musl<strong>im</strong>e 34<br />
gehen daher bis heute die Me<strong>in</strong>ungen erheblich ause<strong>in</strong>ander. Im erbitterten Kirchenkampf<br />
der Jahrh<strong>und</strong>ertwende <strong>in</strong> Mazedonien 35 ermöglichte die Trennungsl<strong>in</strong>ie zwischen<br />
den Anhängern des Ökumenischen Patriarchen <strong>und</strong> den sog. Exarchisten noch<br />
längere Zeit nach der von den Türken geförderten Errichtung des bulgarischen Exarchates<br />
(1870) noch ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>e unzweifelhafte Unterscheidung von Griechen<br />
<strong>und</strong> Bulgaren. Für e<strong>in</strong>e allmähliche Klärung der Fronten sorgten erst die <strong>in</strong>tensive<br />
30 ROLF WÖRSDÖRFER: „Ethnizität“ <strong>und</strong> Entnationalisierung. Umsiedlung <strong>und</strong> Vertreibung <strong>in</strong><br />
Dalmatien, Istrien <strong>und</strong> Julisch-Venetien (1927-1954), <strong>in</strong>: Österreichische Zeitschrift für<br />
Geschichtswissenschaften 5 (1994), 2, S. <strong>20</strong>1-232.<br />
31 BEHSCHNITT (wie Anm. 23), S. 81.<br />
32 WOLFGANG KESSLER: Politik, Kultur <strong>und</strong> Gesellschaft <strong>in</strong> Kroatien <strong>und</strong> Slawonien <strong>in</strong> der<br />
ersten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts. Historiographie <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen, München 1981 (Südosteuropäische<br />
Arbeiten 77), S. 58 ff., <strong>und</strong> DERS.: Programm <strong>und</strong> Politik der nationalen Integration<br />
<strong>in</strong> den kroatischen Ländern <strong>in</strong> der zweiten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Jugoslawien.<br />
Integrationsprobleme <strong>in</strong> Geschichte <strong>und</strong> Gegenwart, hrsg. von KLAUS DETLEV<br />
GROTHUSEN, Gött<strong>in</strong>gen 1984, S. 151-163.<br />
33 PETER BARTL: Kryptochristentum <strong>und</strong> Formen des religiösen Synkretismus <strong>in</strong> Albanien, <strong>in</strong>:<br />
Grazer <strong>und</strong> Münchener balkanologische Studien, München 1967 EBeiträge zur Kenntnis<br />
Südosteuropas <strong>und</strong> des Nahen Orients, Bd. 2), S. 117-127.<br />
34 H.-MICHAEL MIEDLIG: Wer s<strong>in</strong>d die Musl<strong>im</strong>e <strong>in</strong> Bosnien-Herzegow<strong>in</strong>a?, <strong>in</strong>: Südosteuropa<br />
Mitteilungen 34 (1994), 4, S. 279-293.=–=Zur Entwicklung des Nationalitätenproblems bei<br />
den bosnischen Musl<strong>im</strong>en SREČKO M. DŽAJA: Konfessionalität <strong>und</strong> Nationalität Bosniens<br />
<strong>und</strong> der Herzegow<strong>in</strong>a, München 1984; MUHAMED HADZIJAHIC: Die Anfänge der nationalen<br />
Entwicklung <strong>in</strong> Bosnien <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Herzegow<strong>in</strong>a, <strong>in</strong>: Südost-Forschungen 21 (1962), S.<br />
168-193, <strong>und</strong> WOLFGANG HÖPKEN: Konfession, territoriale Identität <strong>und</strong> nationales Bewußtse<strong>in</strong>:<br />
Die Musl<strong>im</strong>e <strong>in</strong> Bosnien zwischen österreichisch-ungarischer Herrschaft <strong>und</strong><br />
Zweitem Weltkrieg (1878-1941), <strong>in</strong>: Formen des nationalen Bewußtse<strong>in</strong>s <strong>im</strong> Lichte zeitgenössischer<br />
Nationalismustheorien, hrsg. von EVA SCHMIDT-HARTMANN, München 1994, S.<br />
233-253.<br />
35 Zur Gründung des Exarchats <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er nationalbulgarischen Bedeutung ZINA MARKOVA:<br />
Balgarskata ekzarchija 1870-1879, Sofija 1989.<br />
89
Aufklärungsarbeit unter der weith<strong>in</strong> analphabetischen bäuerlichen Bevölkerung. 36 Sie<br />
wurde über staatlich geförderte Bildungs<strong>in</strong>itiativen <strong>und</strong> konkurrierende Schulgründungen<br />
der Griechen, Bulgaren <strong>und</strong> Serben betrieben. 37 Und nicht zuletzt war es e<strong>in</strong><br />
systematischer Bandenterror, der mit Zwangsmitteln für e<strong>in</strong>e Bere<strong>in</strong>igung der Fronten<br />
sorgte. Der gnadenlose Volkstumskampf hat an der Jahrh<strong>und</strong>ertwende <strong>in</strong> Mazedonien<br />
e<strong>in</strong>e breite Blutspur h<strong>in</strong>terlassen. 38 Die Untaten christlicher Banden, die wehrlose<br />
Dörfer überfielen, die Bewohner drangsalierten <strong>und</strong> zu nationalen Bekenntnissen<br />
zwangen, drohten Ausmaße anzunehmen, die selbst die vielbeschworenen „Bulgarischen<br />
Greuel“ der Türken 39 <strong>in</strong> den Schatten stellten. 40<br />
Man war am Ausgang des Ersten Weltkrieges <strong>in</strong> amerikanischen Kreisen noch opt<strong>im</strong>istisch<br />
genug, die Krise <strong>im</strong> Zusammenleben der Balkanvölker mit den klassischen<br />
Mitteln der Diplomatie <strong>und</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage exakter wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
beilegen zu können. 41 „The ult<strong>im</strong>ate relationship of the different Balkan nations<br />
must be based upon a fair balance of nationalistic and economic considerations, applied<br />
<strong>in</strong> a generous and <strong>in</strong>ventive spirit after <strong>im</strong>partial and scientific <strong>in</strong>quiry.“ 42 Und<br />
obwohl man Konkretisierungen e<strong>in</strong>es möglichen Grenzverlaufes noch tunlichst vermeiden<br />
wollte, wagte man es doch schon, sich <strong>in</strong> Teilbereichen auf e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong>e<br />
Gr<strong>und</strong>sätze festzulegen. „It would obviously be unwise“, heißt es vorsichtig <strong>in</strong> dem<br />
unmittelbar anschließenden Passus, „to attempt at this t<strong>im</strong>e to draw frontiers for the<br />
36 Zur Rolle des Geschichtsunterrichts vgl. für Serbien <strong>und</strong> die Südslawen CHARLES JELA-<br />
VICH: Serbian Textbooks: Toward Greater Serbia or Yugoslavia?, <strong>in</strong>: Slavic Review 42<br />
(1983), S. 601-619, <strong>und</strong> DERS.: Nationalism as Reflected <strong>in</strong> the Textbooks of the South<br />
Slavs <strong>in</strong> the N<strong>in</strong>eteenth Century, <strong>in</strong>: Canadian Review of Studies <strong>in</strong> Nationalism 16 (1989)<br />
1-2, S. 15-34, sowie jetzt die zusammenfassende Studie DERS.: South Slav Nationalisms.<br />
Textbooks and Yugoslav Union before 1914, Columbia 1990.<br />
37 Vgl. die Belege zu den bulgarischen Bildungsbemühungen <strong>in</strong>: Makedonien. E<strong>in</strong>e Dokumentensammlung,<br />
Sofia 1982, <strong>und</strong> zu den griechischen E<strong>in</strong>richtungen ST. PAPADOPOULOS:<br />
Écoles et associations grecques dans la Macédonie du nord durant le dernier siècle de la<br />
dom<strong>in</strong>ation Turque, <strong>in</strong>: Balkan Studies 2 (1962), S. 397-442; vgl. auch BERTOLD SPULER:<br />
Die M<strong>in</strong>derheitenschulen der europäischen Türkei von der Reformzeit bis zum Weltkrieg<br />
(mit e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>leitung über das türkische Schulwesen), Breslau 1936.<br />
38 DOUGLAS DAKIN: The Greek Struggle <strong>in</strong> Macedonia 1897-1913, Thessaloniki 1966, Neudruck<br />
1993, <strong>und</strong> zu den H<strong>in</strong>tergründen der Makedonischen Frage aus osmanischer Sicht<br />
FIKRET ADANIR: Die Makedonische Frage. Ihre Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung bis 1908,<br />
Wiesbaden 1979 EFrankfurter Historische Abhandlungen, Bd. <strong>20</strong>).<br />
39 Mythos <strong>und</strong> Wahrheit dieser Vorfälle untersucht ANDREAS KÖRBER: William Ewart Gladstones<br />
„Bulgarian Horrors and the Question of the East“=–=e<strong>in</strong>e unbrauchbare Quelle? E<strong>in</strong><br />
Beitrag zur Glaubwürdigkeit von H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><strong>in</strong>formationen, <strong>in</strong>: 110 Jahre Wiedererrichtung<br />
des bulgarischen Staats 1878-1988, hrsg. von KLAUS-DETLEV GROTHUSEN, München<br />
1990 ESüdosteuropa-Studien, Bd. 44), S. 87-118.<br />
40 Vgl. ADANIR (wie Anm. 38), S. 217 ff.<br />
41 Zu den Beratungsgremien während der Verhandlungen DIMITRI KITSIKIS: Le rôle des experts<br />
… la conférence de la paix de 19<strong>19.</strong> Gestation d'une technocratie en politique <strong>in</strong>ternationale,<br />
Ottawa 1972.<br />
42 The Papers of Woodrow Wilson (wie Anm. 1), S. 470.<br />
90
Balkan states. Certa<strong>in</strong> broad considerations, however, may tentatively be kept <strong>in</strong><br />
m<strong>in</strong>d. They are <strong>in</strong> brief these: 1) that the area annexed by Rumania <strong>in</strong> the Dobrudga is<br />
almost surely Bulgarian <strong>in</strong> character and should be returned; 2) that the bo<strong>und</strong>ary between<br />
Bulgaria and Turkey should be restored to the Enos-Midia l<strong>in</strong>e, as agreed upon<br />
at the conference of London; 3) that the south bo<strong>und</strong>ary of Bulgaria should be the<br />
Aegean Sea coast from Enos to the gulf of Orfano, and should leave the mouth of the<br />
Struma river <strong>in</strong> Bulgarian territory; 4) that the best access to the sea for Serbia is<br />
through Saloniki; 5) that the f<strong>in</strong>al disposition of Macedonia cannot be determ<strong>in</strong>ed<br />
without further <strong>in</strong>quiry; 6) that an <strong>in</strong>dependent Albania is almost certa<strong>in</strong>ly an <strong>und</strong>esirable<br />
political entity.“<br />
Nicht nur die Amerikaner unterschätzten die unlösbaren Probleme, die vor Ort auf<br />
die Friedensmacher warteten, <strong>und</strong> gegen die grausame Logik e<strong>in</strong>es Sprachnationalismus<br />
<strong>in</strong> den Balkanländern waren sie gänzlich hilflos. E<strong>in</strong>sichtigen Beobachtern vor<br />
Ort wie dem Sachverständigen für M<strong>in</strong>derheitenfragen <strong>in</strong> der amerikanischen Delegation,<br />
Archibald Cary Coolidge 43 , blieben der Konflikt zwischen den unterschiedlichen<br />
Pr<strong>in</strong>zipien, die bei den Grenzregelungen angelegt wurden – Geschichte, Geographie<br />
<strong>und</strong> die Rechte der Nationalitäten –, ke<strong>in</strong>eswegs verborgen. 44 Die unvermeidlichen<br />
Grenzstreitigkeiten, die durch die Konferenzbeschlüsse ausgelöst wurden, haben nicht<br />
unwesentlich zu e<strong>in</strong>er Verschärfung der Gegensätze beigetragen. Balkanisierung<br />
me<strong>in</strong>t auch <strong>und</strong> gerade die negativen praktisch-politischen Schlußfolgerungen, die<br />
schon vor den Pariser Friedensbemühungen aus der verworrenen Sachlage <strong>in</strong> den<br />
Mischgebieten gezogen worden waren. Deportation, Flucht <strong>und</strong> Vertreibung waren<br />
längst vor dem Ende des Ersten Weltkrieges bittere Realität für die Völker <strong>in</strong> Südosteuropa<br />
geworden. 45 Teilweise wurde schon nach den Balkankriegen versucht, den als<br />
unumgänglich erachteten Bevölkerungstransfer wenigstens durch bilaterale Vere<strong>in</strong>barungen<br />
<strong>in</strong> geordnetere Bahnen zu lenken. Die Wirren des russischen Bürgerkrieges,<br />
die nach dem Zusammenbruch des Zarismus e<strong>in</strong>en Großteil der ca. 600 000 Pontusgriechen<br />
zum Exodus bewogen, <strong>und</strong> die nachfolgende kle<strong>in</strong>asiatische Katastrophe<br />
von 1922/23 haben Griechenland mit e<strong>in</strong>em Flüchtl<strong>in</strong>gsproblem belastet, das <strong>in</strong> Relation<br />
zur Bevölkerung des Mutterlandes alle bis dah<strong>in</strong> denkbaren Vorstellungen<br />
sprengte. Dem Blutbad, das türkische Truppen am 13. September 1922 bei der Erobe-<br />
43 GEORG E. SCHMID: Die Coolidge-Mission <strong>in</strong> Österreich 1919: Zur Österreichpolitik der<br />
USA während der Pariser Friedenskonferenz, <strong>in</strong>: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs<br />
24 (1971), S. 433-467.<br />
44 ERWIN VIEFHAUS: Die M<strong>in</strong>derheitenfrage <strong>und</strong> die Entstehung der M<strong>in</strong>derheitenschutzverträge<br />
auf der Pariser Friedenskonferenz 19<strong>19.</strong> E<strong>in</strong>e Studie zur Geschichte des Nationalitätenproblems<br />
<strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, Würzburg 1960 EMarburger Ostforschungen, Bd.<br />
11), S. 123 ff.<br />
45 P. LADAS STEPHEN: The Exchange of M<strong>in</strong>orities. Bulgaria, Greece and Turkey, New York<br />
1932. – Zum Gesamtproblem vgl. HANS LEMBERG: Nationale „Entmischung“ <strong>und</strong><br />
Zwangswanderungen <strong>in</strong> Mittel- <strong>und</strong> Osteuropa 1938-1948, <strong>in</strong>: Westfälische Forschungen<br />
39 (1989), S. 383-392, <strong>und</strong> DERS.: „Ethnische Säuberung“: E<strong>in</strong> Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?,<br />
<strong>in</strong>: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung<br />
„Das Parlament“ B 46/92 (6. November 1992), S. 27-38.<br />
91
ung Smyrnas angerichtet hatten, waren annähernd 30 000 Christen zum Opfer gefallen.<br />
Im Zuge des Bevölkerungsaustausches, der <strong>im</strong> Januar 1923 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Separatprotokoll<br />
zwischen Venizelos <strong>und</strong> Inönü vere<strong>in</strong>bart worden war, verloren etwa 300 000<br />
Musl<strong>im</strong>e <strong>und</strong> ca. 1,1 Millionen Christen ihre angestammte He<strong>im</strong>at. Der Kreis der Betroffenen<br />
wurde nach der Religionszugehörigkeit best<strong>im</strong>mt. Dieses willkürliche Auswahlkriterium<br />
zwang selbst die türkischsprechenden orthodoxen Karamanlis <strong>in</strong><br />
Kle<strong>in</strong>asien <strong>und</strong> die griechischsprechenden Musl<strong>im</strong>e auf Kreta zur Abwanderung. 46<br />
<strong>Grenzen</strong> zwischen den Staaten <strong>in</strong> Südosteuropa bedeuteten <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
<strong>im</strong>mer blutige E<strong>in</strong>schnitte <strong>und</strong> gewaltsame Zäsuren. Sie zertrennten Siedlungsgeme<strong>in</strong>schaften<br />
ethnischer Gruppen, die sich auf lokaler Basis <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>räumigen arbeitsteiligen<br />
Nachbarschaften arrangiert hatten, <strong>und</strong> nötigten die Sprecher des gleichen<br />
Idioms zu staatlichen Zusammenschlüssen, die ihrer Organisationsstruktur nach auf<br />
ethnische Exklusivität angelegt waren. Der Streit um Revisionen der Grenzregelungen<br />
<strong>und</strong> um die E<strong>in</strong>haltung der M<strong>in</strong>derheitenrechte war mit den Entscheidungen der Pariser<br />
Friedenskonferenz schon vorprogrammiert. Die am meisten betroffenen Ungarn,<br />
die <strong>im</strong> Trianon-Vertrag vom 4. Juni 19<strong>20</strong> auf zwei Drittel des ehemaligen Staatsterritoriums<br />
<strong>und</strong> der Staatsbevölkerung verzichten mußten, waren nicht bereit, e<strong>in</strong>e Grenzregelung<br />
widerspruchslos h<strong>in</strong>zunehmen, die mehr als e<strong>in</strong> Drittel der Magyaren, über 3<br />
Millionen, zwang, als M<strong>in</strong>derheit <strong>in</strong> den Nachbarstaaten (1,7 Mill. <strong>in</strong> Rumänien, über<br />
1 Mill. <strong>in</strong> der Tschechoslowakei <strong>und</strong> 558 000 <strong>in</strong> Jugoslawien) zu leben. Bulgarien<br />
verlor mit der Abtretung des südlichen Mazedonien nicht nur e<strong>in</strong>en Teil der von Bulgaren<br />
besiedelten Regionen, sondern wurde von dem wichtigen Zugang zur Ägäis abgeschnitten.<br />
Die M<strong>in</strong>derheitenschutzverträge <strong>und</strong> die ausgleichende Kompetenz des<br />
Völkerb<strong>und</strong>es, die als tragende Stützpfeiler des Versailler Systems <strong>in</strong> das Pariser Vertragswerk<br />
e<strong>in</strong>gezogen worden waren, hielten den wachsenden Belastungen nicht<br />
stand. Sie boten vor e<strong>in</strong>er adm<strong>in</strong>istrativen Majorisierung durch die Titularnationen<br />
ke<strong>in</strong>en h<strong>in</strong>reichenden Schutz. Der Völkerb<strong>und</strong> versagte <strong>in</strong> der ihm zugedachten Rolle<br />
als Schlichtungs<strong>in</strong>stanz, weil bei den Beteiligten <strong>und</strong> Betroffenen der Wille zum<br />
Kompromiß fehlte. Die Menschen mußten <strong>in</strong> den sog. Nachfolgestaaten des Versailler<br />
Systems <strong>in</strong> unsicheren <strong>Grenzen</strong> leben. Unzulänglichkeiten der Grenzziehungen <strong>in</strong> den<br />
ethnischen Mischgebieten waren nicht zu übersehen. Nahezu alle Balkanstaaten waren<br />
während der Zwischenkriegszeit <strong>in</strong> ihrem territorialen Bestand von Revisionsforderungen<br />
der Nachbarn bedroht <strong>und</strong> nur der Druck von außen verh<strong>in</strong>derte gewaltsame<br />
Lösungsversuche auf eigene Faust. Nach Joseph Rothschild bed<strong>in</strong>gten <strong>im</strong> Ost- <strong>und</strong><br />
Südosteuropa der Zwischenkriegszeit geme<strong>in</strong>same <strong>Grenzen</strong> nahezu zwangsläufig<br />
fe<strong>in</strong>dliche Beziehungen. 47 Der gleiche Autor ist aber <strong>im</strong> Abstand e<strong>in</strong>er Generation<br />
<strong>und</strong> nach den Erfahrungen der nationalsozialistischen <strong>und</strong> kommunistischen Exper<strong>im</strong>ente<br />
heute eher geneigt, den an der Friedensregelung nach 1918 beteiligten Staatsmännern<br />
<strong>und</strong> Diplomaten größeres Verständnis entgegenbr<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> ihnen auch bei<br />
der Regelung der strittigen Grenzfragen wieder mehr Gerechtigkeit widerfahren zu<br />
46<br />
RICHARD CLOGG: A Short History of Modern Greece, Cambridge u.a. 1979, S. 1<strong>20</strong>-121.<br />
47<br />
JOSEPH ROTHSCHILD: East Central Europe between the Two World Wars, 3. Aufl. Seattle,<br />
London 1979, S. 8.<br />
92
lassen. Er n<strong>im</strong>mt sie gegen den Vorwurf <strong>in</strong> Schutz, die M<strong>in</strong>derheiten schnöde verraten<br />
zu haben. Immerh<strong>in</strong> hätten die Grenzregelungen bei allen Ungere<strong>im</strong>theiten dre<strong>im</strong>al<br />
mehr Menschen <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit von fremder Herrschaft befreit als umgekehrt<br />
zu e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>derheitenstatus unter e<strong>in</strong>em fremden Mehrheitsvolk gezwungen.<br />
Außerdem seien die durchaus bedauerlichen Zuordnungen von M<strong>in</strong>derheiten zu e<strong>in</strong>em<br />
andersnationalen Staat nicht willkürlich geschehen, sondern anderen, ökonomischen<br />
oder strategischen Prioritäten gefolgt – <strong>und</strong> diese Prioritäten seien eben unvere<strong>in</strong>bar<br />
gewesen mit den nationalen.<br />
Volksabst<strong>im</strong>mungen <strong>in</strong> umstrittenen Grenzregionen waren wegen der ungleichen<br />
regionalen Verteilung der ethnischen Gruppen <strong>und</strong> der unterschiedlichen Zuordnung<br />
der Stadtbevölkerung <strong>und</strong> des bäuerlichen Umlandes ke<strong>in</strong> geeigneter Weg, um e<strong>in</strong>e<br />
gerechtere Lösung zu f<strong>in</strong>den. Die Operationen von Freischaren <strong>und</strong> die nachfolgenden<br />
Agitationskampagnen, die die Befragung der Bevölkerung begleiteten, heizten<br />
die aufgewühlten Leidenschaften nur noch zusätzlich an <strong>und</strong> vergifteten die nachbarschaftlichen<br />
Beziehungen. Dies zeigte sich <strong>im</strong> südlichen Kärnten am 10.10.19<strong>20</strong> <strong>und</strong><br />
bei der fragwürdigen Abst<strong>im</strong>mung <strong>in</strong> Ödenburg <strong>im</strong> Burgenland am 14.12.1921. Die<br />
Ergebnisse blieben umstritten <strong>und</strong> belasteten das Verhältnis Österreichs zu Ungarn<br />
<strong>und</strong> Jugoslawien <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit noch mehr.<br />
Diese depr<strong>im</strong>ierende Sachlage hat sich trotz Teilerfolge, wie bei der Lösung der<br />
Triest-Frage zwischen Italien <strong>und</strong> Jugoslawien, bis zur Gegenwart kaum geändert.<br />
Der Zypern-Konflikt, die Zwangsbulgarisierungen der Živkov-Ära 48 , die Diskr<strong>im</strong><strong>in</strong>ierungen<br />
der Kosovo-Albaner <strong>und</strong> die andauernden rumänisch-ungarischen Konfrontationen<br />
<strong>in</strong> Siebenbürgen, der bulgarisch-griechische Streit um das mazedonische Erbe<br />
oder die neuerlichen griechisch-albanischen Differenzen <strong>in</strong> Nordepirus s<strong>in</strong>d unverkennbare<br />
Anzeichen e<strong>in</strong>es fortschwelenden Dauerkonfliktes. 49 In dem leidgeprüften<br />
Bosnien versagten bisher alle Lösungsversuche. 50<br />
Zum Neuaufbau e<strong>in</strong>er stabilen Staatenordnung reichten die Kräfte des „Neuen Europa“<br />
nicht mehr aus, für das der künftige tschechoslowakische Präsident Thomas G.<br />
Masaryk während des Ersten Weltkrieges die Werbetrommel gerührt hatte. Masaryk<br />
selbst war mit der missionarischen Vision angetreten, den bisher unterdrückten kle<strong>in</strong>en<br />
Völkern zu ihrem Recht zu verhelfen. Er war noch opt<strong>im</strong>istisch genug, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
freiheitlichen <strong>und</strong> demokratischen Europa die negativen Folgen e<strong>in</strong>er „Balkanisie-<br />
48<br />
WOLFGANG HÖPKEN: Zwischen Kulturkonflikt <strong>und</strong> Repression. Die türkische M<strong>in</strong>derheit<br />
<strong>in</strong> Bulgarien 1944-1991, <strong>in</strong>: Nationen Nationalitäten M<strong>in</strong>derheiten. Probleme des Nationalismus<br />
<strong>in</strong> Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, der<br />
Ukra<strong>in</strong>e, Italien <strong>und</strong> Österreich 1945-1990, hrsg. von VALERIA HEUBERGER, OTHMAR KO-<br />
LAR, ARNOLD SUPPAN <strong>und</strong> ELISABETH VYSLONZIL, Wien, München 1994, S. 179-<strong>20</strong>2.<br />
49<br />
Zur M<strong>in</strong>derheitenfrage <strong>in</strong> Südosteuropa heute HUGH POULTON: The Balkans. M<strong>in</strong>orities<br />
and States <strong>in</strong> Conflict, London 1991; Nationalitätenprobleme <strong>in</strong> Südosteuropa, hrsg. von<br />
ROLAND SCHÖNFELD, München 1987 EUntersuchungen zur Gegenwartsk<strong>und</strong>e Südosteuropas,<br />
Bd. 25).<br />
50<br />
HENRIK BIRNBAUM: The Ethno-L<strong>in</strong>guistic Mosaic of Bosnia and Hercegov<strong>in</strong>a, <strong>in</strong>: Die Welt<br />
der Slaven 32 (1977), S. 1-31.<br />
93
ung“ überw<strong>in</strong>den zu können. In se<strong>in</strong>en späteren Er<strong>in</strong>nerungen rechtfertigte er den<br />
notwendigen Bruch mit der Vergangenheit. „Den großen Nationen“, schreibt er, „namentlich<br />
den Engländern <strong>und</strong> Amerikanern, die geradezu an kont<strong>in</strong>entale Maßstäbe<br />
gewöhnt s<strong>in</strong>d, bei denen Sprachenfragen ke<strong>in</strong>e Rolle spielen, ersche<strong>in</strong>t die Befreiung<br />
der zahlreichen kle<strong>in</strong>en Nationen <strong>und</strong> die Entstehung kle<strong>in</strong>erer Staaten politisch <strong>und</strong><br />
sprachlich als e<strong>in</strong>e beschwerliche <strong>und</strong> unangenehme ‚Balkanisierung‘. Aber die Verhältnisse<br />
s<strong>in</strong>d, wie sie eben s<strong>in</strong>d, durch Natur <strong>und</strong> Geschichte gegeben: durch h<strong>und</strong>ertjährige<br />
Gewalt vere<strong>in</strong>fachten die Türkei, Österreich-Ungarn, Deutschland <strong>und</strong> Rußland<br />
halb Europa, aber eben durch Gewalt <strong>und</strong> mechanisch, also nur auf e<strong>in</strong>ige Zeit;<br />
durch Freiheit <strong>und</strong> Demokratie läßt sich die Balkanisierung abschaffen, <strong>und</strong> zwar<br />
noch besser.“ 51<br />
Hehre Worte des Staatsmannes, der wie ke<strong>in</strong> anderer mitgeholfen hat, das Zeitalter<br />
der kle<strong>in</strong>en Völker <strong>und</strong> der nationalstaatlichen Ordnung <strong>in</strong> Europa <strong>in</strong> die Praxis umzusetzen.<br />
In der Rückschau ist am Ende des Jahrh<strong>und</strong>erts der kle<strong>in</strong>en Nationalstaaten<br />
Ernüchterung e<strong>in</strong>gekehrt. Masaryks Zukunftsvision e<strong>in</strong>er neuen stabilen Staatenordnung<br />
<strong>in</strong> Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropa harrt <strong>im</strong>mer noch der Verwirklichung. Ob der<br />
neue Mitteleuropa-Gedanke, der seit den 80er Jahren <strong>in</strong> den betroffenen Ländern favorisiert<br />
wird, e<strong>in</strong>e tragfähigere Alternative bieten wird, muß sich noch erweisen. Die<br />
gegenwärtigen Vorgänge <strong>in</strong> Südosteuropa st<strong>im</strong>men wenig hoffnungsvoll. Sie lassen<br />
noch ke<strong>in</strong>e Abkehr vom Irrweg e<strong>in</strong>es überzogenen Sprachnationalismus <strong>und</strong> den destruktiven<br />
Folgerungen des ethnischen Pr<strong>in</strong>zips erkennen, ganz zu schweigen von e<strong>in</strong>em<br />
Neubeg<strong>in</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesamteuropäischen Geist der Versöhnung <strong>und</strong> des Völkerfriedens,<br />
den wir alle wünschen <strong>und</strong> erhoffen.<br />
Nur e<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>legender Bewußtse<strong>in</strong>swandel verspricht e<strong>in</strong>en Ausweg. Leider droht<br />
<strong>im</strong> gegenwärtigen Kriegsgeschehen <strong>im</strong>mer mehr <strong>in</strong> Vergessenheit zu geraten, daß<br />
sich gerade <strong>in</strong> der Geschichte Südosteuropas durch die Jahrh<strong>und</strong>erte e<strong>in</strong> reicher<br />
Schatz an fruchtbaren <strong>in</strong>terethnischen Erfahrungen angesammelt hat. Sie müßten <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Zeit aufgewühlter Leidenschaften <strong>und</strong> nationalistischer Exzesse den betroffenen<br />
Menschen erneut bewußt gemacht werden. Dazu wird es <strong>in</strong> Zukunft noch e<strong>in</strong>er mühsamen<br />
Aufklärungsarbeit bedürfen.<br />
51<br />
T.G. MASARYK: Die Weltrevolution. Er<strong>in</strong>nerungen <strong>und</strong> Betrachtungen 1914-1918, Berl<strong>in</strong><br />
1927, S. 439-444.<br />
94
„Alte <strong>Grenzen</strong>“ <strong>und</strong> Kulturgeographie<br />
Zur historischen Konstanz der <strong>Grenzen</strong> Böhmens<br />
<strong>und</strong> der böhmischen Länder<br />
von<br />
Robert L u f t<br />
Der Verlauf von Böhmens Außengrenzen, häufig als Raute, als Fünfeck oder <strong>in</strong> Herzform<br />
vere<strong>in</strong>fachend skizziert, ist aus ungezählten Kartenwerken seit langem <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong><br />
gut bekannt. 1 Zu dieser Bekanntheit mag beigetragen haben, daß die böhmischen<br />
ebenso wie die mährischen <strong>Grenzen</strong> für Jahrh<strong>und</strong>erte weitgehend unverändert<br />
blieben. Die geographische Ausdehnung Böhmens <strong>und</strong> Mährens war <strong>in</strong> ihrer Gr<strong>und</strong>form<br />
bereits um das Jahr 1000 ausgebildet. 2 Seit dem Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts festigte<br />
sich <strong>in</strong> fast allen Abschnitten auch <strong>im</strong> kle<strong>in</strong>räumigen Bereich der Grenzverlauf.<br />
Die böhmischen <strong>und</strong> mährischen <strong>Grenzen</strong> weisen somit als Trennl<strong>in</strong>ien von Verwaltungsbereichen<br />
e<strong>in</strong>e ungewöhnliche Konstanz auf. Sie gehören – unabhängig davon,<br />
ob sie als Staats- oder B<strong>in</strong>nengrenze fungierten – zu den ältesten <strong>und</strong> dauerhaftesten,<br />
<strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e durchgängig <strong>und</strong> bis heute bestehenden Abgrenzungen von Herrschafts-<br />
oder Verwaltungsgebieten <strong>in</strong> Europa. 3<br />
1 Im folgenden wird – abweichend vom Sektionsthema „Staaten <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>und</strong> ihre<br />
<strong>Grenzen</strong>“ – nur die Situation Böhmens bzw. der böhmischen Länder Böhmen, Mähren <strong>und</strong><br />
Österreichisch bzw. Tschechisch Schlesien behandelt, nicht jedoch die <strong>Grenzen</strong> der Slowakei<br />
bzw. der gesamten Tschechoslowakei. Der reizvolle <strong>und</strong> kontrastreiche Vergleich der<br />
Geschichte der böhmischen mit den slowakischen <strong>Grenzen</strong> muß an dieser Stelle leider unterbleiben.<br />
– Mit Böhmen ist hier <strong>und</strong> <strong>im</strong> folgenden die territorial geschlossene Verwaltungse<strong>in</strong>heit<br />
Böhmen <strong>im</strong> engeren S<strong>in</strong>ne geme<strong>in</strong>t, wie sie bis <strong>in</strong> die Mitte des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
bestand, <strong>und</strong> nicht das gesamte Herrschaftsgebiet der böhmischen Krone mit Mähren,<br />
Schlesien, den Lausitzen oder gar dem mittelalterlichen böhmischen Lehensbesitz <strong>in</strong> sächsischen,<br />
thür<strong>in</strong>gischen oder oberpfälzischen Gebieten.<br />
2 Am genauesten <strong>in</strong>formiert die Grenzbeschreibung der Prager Diözese von 1086 über damalige<br />
Gebietszugehörigkeiten. Zahlreiche Grenzangaben stammen dann aus der Zeit Přemysl<br />
Otakars II.<br />
3 Die Qualität der Verwaltungsgrenzen bzw. der Wandel e<strong>in</strong>er Außengrenze zu e<strong>in</strong>er B<strong>in</strong>nengrenze,<br />
von e<strong>in</strong>er Territorial- oder Staatsgrenze zur <strong>in</strong>neren Verwaltungsgrenze braucht<br />
<strong>in</strong> diesem Zusammenhang nicht zu <strong>in</strong>teressieren, wird aber oft von Arbeiten der politischen<br />
Geographie ignoriert, die nur souveräne Staaten zum Objekt wählt. Aus dieser Sichtweise<br />
heraus ersche<strong>in</strong>en die böhmischen <strong>Grenzen</strong> nicht als „alt“ <strong>und</strong> als wenig dauerhaft. Sie<br />
wiesen angeblich nur e<strong>in</strong>en Bestand von 100 bis <strong>20</strong>0 Jahren auf. Vgl. die Karte von Colum<br />
Gilfillan, <strong>in</strong> NORMAN J.G. POUNDS: Political Geography, New York 1963, S. 29; zitiert<br />
nach ALEXANDER DEMANDT: Die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte Deutschlands, <strong>in</strong>: Deutsch-<br />
95
Diese Besonderheit <strong>in</strong> der territorialen Entwicklung tritt noch schärfer <strong>im</strong> Vergleich<br />
mit den wichtigsten Nachbarländern – wie Sachsen, Bayern oder Schlesien –<br />
hervor, die zwar <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong> vergleichbares Alter, nicht jedoch e<strong>in</strong>e auch nur annähernd<br />
ähnliche Konstanz <strong>im</strong> Gebietsumfang vom Mittelalter bis <strong>in</strong>s <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
aufweisen können. Wenn der Begriff der „alten“ oder „historischen“ Grenze überhaupt<br />
e<strong>in</strong>e Berechtigung hat, dann <strong>im</strong> Fall Böhmens <strong>und</strong> Mährens bzw. der Tschechischen<br />
Republik. 4 Diese bloße Feststellung sollte aber weder zu e<strong>in</strong>er Mythologisierung<br />
führen, noch als naturgesetzlicher Determ<strong>in</strong>ismus zur Rechtfertigung oder Infragestellung<br />
des e<strong>in</strong>en oder anderen „historischen“ oder „unhistorischen“ Grenzverlaufs<br />
verstanden werden. 5 Es kann bei e<strong>in</strong>er derartigen Untersuchung nur darum gehen,<br />
E<strong>in</strong>flußfaktoren, Ursachen <strong>und</strong> strukturelle Zusammenhänge e<strong>in</strong>es historischen Phänomens<br />
<strong>in</strong> ihrem Bed<strong>in</strong>gungsrahmen herauszuarbeiten <strong>und</strong> zu erklären. 6<br />
S<strong>in</strong>d Böhmens „historische“ <strong>Grenzen</strong> „natürlich“?<br />
Große Relevanz hat das Argument von „historischen <strong>Grenzen</strong>“ – geme<strong>in</strong>t waren „bestehende“,<br />
„alte“, „bewährte“ – oder von „natürlichen <strong>Grenzen</strong>“ mit dem Ende des<br />
Ersten Weltkriegs gewonnen, 7 als e<strong>in</strong>e Fülle neuer <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa gezogen wurde<br />
lands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte, hrsg. von DEMS., 3. Aufl. München 1993, S. 9-31, hier S.<br />
26.<br />
4 Selbst der nationalsozialistischen Propaganda fiel es schwer, diese „Historizität“ <strong>in</strong> Frage<br />
zu stellen. So blieb dem Autor e<strong>in</strong>es <strong>im</strong> Vorfeld des Münchener Abkommens verfaßten<br />
programmatischen Fachaufsatzes zur „Beweglichkeit der politischen Grenze Böhmens“<br />
nichts anderes übrig, als auf den Sonderfall Egerland <strong>und</strong> auf Grenzveränderungen von vor<br />
1400 zu verweisen <strong>und</strong> für die folgenden Jahrh<strong>und</strong>erte festzustellen, es habe sich „während<br />
der letzten 1000 Jahre bis 1918 nur [um] e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>nengrenze“ gehandelt. Vgl. RUDOLF<br />
KÄUBLER: Die Unbeständigkeit der „historischen“ <strong>Grenzen</strong> Böhmens aufgezeigt am Beispiel<br />
Westböhmens, <strong>in</strong>: Geographische Zeitschrift 44 (1938), S. 361-371, Zitate S. 365.<br />
5 Zum Mißverständnis, daß aus e<strong>in</strong>em hohen Alter e<strong>in</strong>er Grenze gerne universaler Ewigkeitsanspruch,<br />
ja mythologische Sakralität abgeleitet wird, vgl. KATHARINA EISCH: Grenze.<br />
E<strong>in</strong>e Ethnographie des bayerisch-böhmischen Grenzraums, München 1996 (Bayerische<br />
Schriften zur Volksk<strong>und</strong>e, Bd. 5), S. 41.<br />
6 In diesem Beitrag werden aus diesem Gr<strong>und</strong>e alle Ortsbezeichnungen, so weit sie existieren,<br />
auch für Teile Deutschlands bei der ersten Nennung konsequent zweisprachig bzw.<br />
mehrsprachig angegeben, gleichgültig ob es sich um heutige oder ehemals amtliche oder<br />
nur kulturelle <strong>und</strong> umgangssprachliche Formen handelt. Da aus Namensformen Gebiets-<br />
<strong>und</strong> Herrschaftsansprüche abgeleitet wurden <strong>und</strong> werden, kann nur e<strong>in</strong>e völlig unvore<strong>in</strong>genommene<br />
Verwendung aller Namensformen (<strong>in</strong> diesem Fall aus dem Tschechischen, Deutschen<br />
<strong>und</strong> Polnischen) verh<strong>in</strong>dern, daß durch e<strong>in</strong>seitige Namensverwendung oder die alle<strong>in</strong>ige<br />
Angabe amtlicher Bezeichnungen unterschwellig e<strong>in</strong> <strong>im</strong>plizites Vorverständnis für e<strong>in</strong>e<br />
„berechtigte“ oder „gerechte“ Grenzziehung entsteht.<br />
7 Zu den geforderten Arrondierungen heißt es z.B. <strong>im</strong> tschechischen Mémoire No. 10: Problèmes<br />
des rectifications des frontières Tchècoslovaques et Germano-Autrichiennes: „Elles<br />
font naturellement partie du corps de la Bohême“. Die tschechoslowakischen Denkschrif-<br />
96
<strong>und</strong> als die Tschechoslowakische Republik entstand bzw. deren territoriale Abgrenzung<br />
auf den Pariser Friedenskonferenzen vere<strong>in</strong>bart wurde. 8 Im Gegensatz zum slowakischen<br />
Bereich, zu Ungarn, Polen, Litauen, Rumänien oder der Türkei wurde der<br />
böhmische <strong>und</strong> mährische Grenzverlauf während dieser umwälzenden territorialen<br />
Neuordnung Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropas von der <strong>in</strong>ternationalen Politik nicht<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich zur Disposition gestellt. Die „historischen Länder“ wurden als E<strong>in</strong>heit<br />
<strong>in</strong> ihren „historischen <strong>Grenzen</strong>“ anerkannt. E<strong>in</strong>e Rolle könnte dabei gespielt haben,<br />
daß Böhmen <strong>und</strong> Mähren <strong>im</strong> politischen Erlebens- <strong>und</strong> Bezugszeitraum der damaligen<br />
Akteure, ja <strong>im</strong> ganzen langen <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert (d.h. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit, <strong>in</strong> der es seit der<br />
Französischen Revolution <strong>und</strong> den Napoleonischen Kriegen <strong>im</strong> gesamten Gebiet des<br />
Heiligen Römischen Reichs <strong>und</strong> nochmals zwischen 1859 <strong>und</strong> 1871 flächendeckend<br />
zu unzähligen neuen Grenzl<strong>in</strong>ien kam), von Grenzaufhebungen oder e<strong>in</strong>schneidenden<br />
Grenzänderungen nicht betroffen waren. 9 Die neuen mittel-, ost- <strong>und</strong> südosteuropäischen<br />
Grenzziehungen von 1918/21 lösten ihrerseits e<strong>in</strong>e – <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der<br />
dreißiger Jahre den Scheitelpunkt erreichende – Welle propagandistischer <strong>und</strong> wissenschaftlicher<br />
Publikationen aus, häufig aus politischer <strong>und</strong> nationaler Intention verfaßt.<br />
In diesem Rahmen wurden auch die <strong>Grenzen</strong> Böhmens, Aspekte der deutschen<br />
<strong>und</strong> böhmischen Grenzgebiete <strong>und</strong> vor allem das Thema „Grenzkampf“ publizistisch<br />
ten für die Friedenskonferenz von Paris 1919/19<strong>20</strong>, übersetzt <strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>leitung hrsg.<br />
von HERMANN RASCHHOFER, Berl<strong>in</strong> 1937, S. 276-297, hier S. 283/284 bzw. auch S. 90/91;<br />
vgl. auch die der Edition angefügten Karten. – Zitate auch <strong>in</strong> [ANONYMUS]: Alliierte<br />
Kriegspolitik <strong>und</strong> tschechische <strong>Grenzen</strong> 1914-19<strong>19.</strong> E<strong>in</strong>e Antwort an André Tardieu, <strong>in</strong>:<br />
Berl<strong>in</strong>er Monatshefte 16 (1938), S. 1017-1044. – Vgl. auch FERDINAND PEROUTKA: Budování<br />
státu [Das Aufbauen des Staates], Bd. 2: 1919, Nachdruck, Praha 1991, S. 702 f.<br />
8 Die <strong>Grenzen</strong> der Tschechoslowakei wurden gegenüber Deutschland <strong>in</strong> Versailles (28. Juni<br />
1919), gegenüber Österreich <strong>in</strong> Sa<strong>in</strong>t-Germa<strong>in</strong>-en-Laye (10. September 1919), gegenüber<br />
Ungarn <strong>in</strong> Trianon (4. Juni 19<strong>20</strong>), gegenüber Rumänien <strong>in</strong> Sèvres (10. August 19<strong>20</strong>) vertraglich<br />
festgelegt <strong>und</strong> anerkannt. Die <strong>in</strong> Sèvres <strong>und</strong> auf Botschafterkonferenzen <strong>in</strong> Spa <strong>und</strong><br />
Paris 19<strong>20</strong> getroffenen Grenzregelungen mit Polen wurden nicht ratifiziert. – Allgeme<strong>in</strong><br />
dazu u.a. DAGMAR PERMAN: The Shap<strong>in</strong>g of the Czechoslovak State. Diplomatic History<br />
of the Bo<strong>und</strong>aries of Czechoslovakia, 1914-19<strong>20</strong>, Leiden 1962; JOZEF KLIMKO: Politické a<br />
právne dej<strong>in</strong>y hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938) [Politische <strong>und</strong> rechtliche<br />
Geschichte der <strong>Grenzen</strong> der Vormünchner Republik (1918-1938)], Bratislava 1986, mit<br />
Karten S. 146-152; ANTONÍN KLIMEK: Jak se dělal mír roku 19<strong>19.</strong> Československo na konferenci<br />
ve Versailles [Wie Friede <strong>im</strong> Jahr 1919 gemacht wurde. Die Tschechoslowakei auf<br />
der Konferenz von Versailles], Praha 1989 (Slovo k historii 19); FRANK HADLER: Peacemak<strong>in</strong>g<br />
1919 <strong>im</strong> Spiegel der Briefe Edvard Benešs von der Pariser Friedenskonferenz, Teil<br />
I: Januar bis April 1919; Teil II: Mai bis August 1919, <strong>in</strong>: Berl<strong>in</strong>er Jahrbuch für osteuropäische<br />
Geschichte 1 (1994), Heft 1, S. 213-255; Heft 2, S. 225-257.<br />
9 Allgeme<strong>in</strong> dazu PETER KRÜGER: Der Funktionswandel von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> europäischen Staatensystem<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Deutschland <strong>und</strong> Europa. Historische, politische<br />
<strong>und</strong> geographische Aspekte. Festschrift zum 51. Geographentag, Bonn 1997: „Europa<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Welt <strong>im</strong> Wandel“, hrsg. von ECKART EHLERS, Bonn 1997, S. 73-84.<br />
97
<strong>in</strong>tensiv behandelt. 10 In diesen Jahren erlebte gleichzeitig die böhmisch-mährische<br />
Kartographieforschung mit dem Nachdruck historischer Karten <strong>und</strong> zahlreichen Veröffentlichungen<br />
e<strong>in</strong>en Höhepunkt. 11 Erst die politischen Veränderungen der späten<br />
achtziger <strong>und</strong> neunziger Jahre des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts sollten die Forschungen zur Geschichte<br />
von <strong>Grenzen</strong> erneut stärker beleben. 12<br />
E<strong>in</strong>e Betrachtung der <strong>Grenzen</strong> Böhmens <strong>in</strong> den letzten zweih<strong>und</strong>ert Jahren führt<br />
zwangsläufig dazu, bei der Untersuchung über diese beiden Jahrh<strong>und</strong>erte – <strong>und</strong> damit<br />
über den zeitlichen Schwerpunkt dieser auf das <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert ausgerichteten<br />
Tagung – h<strong>in</strong>auszugehen <strong>und</strong> die Entwicklung seit dem Mittelalter <strong>in</strong> den Blick zu<br />
nehmen. Konstanz <strong>und</strong> Stabilität der Grenze kann dabei nicht das Detail <strong>im</strong> Gelände<br />
me<strong>in</strong>en <strong>und</strong> nicht alle lokalen Grenzstreitigkeiten um Äcker, Wiesen, Wälder oder<br />
e<strong>in</strong>zelne Gehöfte berücksichtigen, so aufschlußreich diese se<strong>in</strong> mögen. Es kann nur<br />
um Grenzänderungen mittlerer Größe gehen, die die Gr<strong>und</strong>struktur des betreffenden<br />
Territoriums nicht entscheidend veränderten. Auch die Geschichte der bilateralen<br />
Grenzkommissionen, die seit dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> größeren Zeitabständen <strong>im</strong>mer<br />
wieder e<strong>in</strong>gerichtet wurden, um die Grenze neu zu begehen, den Grenzverlauf an Ort<br />
<strong>und</strong> Stelle genau zu vermessen, festzulegen <strong>und</strong> zu markieren, ist für Böhmen wie für<br />
andere Territorien noch nicht zusammenfassend beschrieben worden. 13 Es kann daher<br />
10 Exemplarisch seien genannt HERMANN AUBIN: Von Raum <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> des deutschen<br />
Volkes. Studien zur Volksgeschichte, Breslau 1938; ALOIS WEISSTHANNER: Der Kampf<br />
um die bayerisch-böhmische Grenze von Furth bis Eisenste<strong>in</strong> von den Hussitenkriegen bis<br />
zum Dreißigjährigen Kriege mit besonderer Berücksichtigung siedlungsgeschichtlicher<br />
Verhältnisse, Diss. München 1938; <strong>in</strong> Auszügen auch <strong>in</strong>: Verhandlungen des Historischen<br />
Vere<strong>in</strong>es von Oberpfalz <strong>und</strong> Regensburg 89 (1939), S. 187-358. – Vgl. dazu auch das Literaturverzeichnis<br />
am Ende dieses Bandes.<br />
11 Z.B. Kartographische Denkmäler der Sudetenländer, hrsg. von BERNHARD BRANDT, 10<br />
Hefte, Prag 1930-1936 (Geographisches <strong>Institut</strong> der Deutschen Universität <strong>in</strong> Prag); Monumenta<br />
cartographica Bohemiae (1518-17<strong>20</strong>), hrsg. von VÁCLAV ŠVAMBERA <strong>und</strong> B. ŠA-<br />
LAMON, e<strong>in</strong>gel. von K. KUCHAŘ, Praha 1938; KARL A. SEDLMEYER: Historische Kartenwerke<br />
Böhmens, <strong>in</strong>: Petermanns Geographische Mitteilungen 88 (1942), S. 469-471.<br />
12 Vgl. dazu das Literaturverzeichnis am Ende dieses Bandes.<br />
13 E<strong>in</strong>e der ältesten dokumentierten Grenzbegehungen fand <strong>im</strong> frühen 16. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>im</strong><br />
Erzgebirge <strong>und</strong> ähnlich <strong>im</strong> Riesengebirge bezeichnenderweise zwischen Herrschaftsbesitzern<br />
<strong>und</strong> nicht den Landesherren statt. CONRAD MÜLLER: E<strong>in</strong>e Schönburgisch-Hartenste<strong>in</strong>ische<br />
Grenzra<strong>in</strong>ung am Fichtelberg 1529, <strong>in</strong>: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 55<br />
(1934), S. 161-177. – Für den deutsch-tschechisch/tschechoslowakischen Bereich kam es<br />
1926 bis 1929 zu e<strong>in</strong>er Begehung der ca. <strong>20</strong>00 km langen Grenze, deren Resultat e<strong>in</strong>e Revision<br />
<strong>und</strong> Neuaufnahme sowie dann das bilaterale Grenzurk<strong>und</strong>enwerk von 1937 war.<br />
1983 wurde an der bayerisch-tschechischen Grenze erneut e<strong>in</strong>e Vermessungsaktion des<br />
Grenzverlaufs begonnen. Dazu EISCH (wie Anm. 5), S. 28-39. – Nach 1990 wurde wiederum<br />
e<strong>in</strong>e mehrjährige Grenzrevision vere<strong>in</strong>bart. Das neue Grenzurk<strong>und</strong>enwerk mit e<strong>in</strong>er<br />
Dokumentation der 811 km langen geme<strong>in</strong>samen Grenze von Tschechischer Republik <strong>und</strong><br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland soll 1999 veröffentlicht werden.<br />
98
<strong>im</strong> folgenden nur um markantere, verwaltungspolitisch <strong>und</strong> sozioökonomisch relevante<br />
Grenzänderungen gehen. 14<br />
Zu der bemerkenswerten, Epochen übergreifenden, generellen Stabilität der böhmischen<br />
<strong>Grenzen</strong> kommt die Größe des böhmischen Territoriums h<strong>in</strong>zu. Im mitteleuropäischen<br />
Bereich f<strong>in</strong>det sich ke<strong>in</strong> zweites Beispiel, das für beides gleichermaßen<br />
gilt. 15 So drängt sich die Frage auf, warum gerade die böhmischen <strong>Grenzen</strong> dieses hohe<br />
Alter erreichen konnten, warum sie durch historische Konstanz <strong>und</strong> Stabilität gekennzeichnet<br />
s<strong>in</strong>d, warum Böhmen territorial e<strong>in</strong>e derartige Kont<strong>in</strong>uität aufweist. E<strong>in</strong>e<br />
Antwort sche<strong>in</strong>t mir äußerst schwierig zu se<strong>in</strong>, da weder die Historizität selbst zu<br />
e<strong>in</strong>em Gr<strong>und</strong> für die Konstanz geworden se<strong>in</strong> kann, noch die so e<strong>in</strong>gängige Erklärung,<br />
es seien mit umgrenzenden Gebirgen „natürliche“ <strong>Grenzen</strong> gegeben 16 , zutreffend<br />
ist. Auch das unter Bezug auf den mittelalterlichen Chronisten Cosmas von Prag<br />
von František Palacký <strong>und</strong> anderen gerne kolportierte Bild e<strong>in</strong>es von unüberw<strong>in</strong>dbaren<br />
Gebirgen begrenzten „böhmischen Kessels“ ist schlichtweg falsch <strong>und</strong> wird alle<strong>in</strong><br />
schon durch den grenzüberschreitenden Vorgang des hochmittelalterlichen Landesausbaus<br />
widerlegt. 17<br />
14 Auf Grenzstreitigkeiten <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>ere Grenzbere<strong>in</strong>igungen <strong>im</strong> Rahmen der Arbeit der verschiedenen<br />
bilateralen Grenzkommissionen mit Bayern, Sachsen <strong>und</strong> Preußen wird <strong>im</strong> E<strong>in</strong>zelfall<br />
noch e<strong>in</strong>zugehen se<strong>in</strong>.<br />
15 Auch die österreichischen Länder, <strong>in</strong>sbesondere Niederösterreich, weisen ähnlich alte <strong>und</strong><br />
konstante <strong>Grenzen</strong> auf, wobei die <strong>Grenzen</strong> zwischen den e<strong>in</strong>zelnen österreichischen Ländern<br />
e<strong>in</strong>e höhere Konstanz auszeichnet als die <strong>Grenzen</strong> zu anderen Territorien. Zu berücksichtigen<br />
ist für die österreichischen Länder zudem, daß kirchliche Eigenterritorien bis<br />
1800 – anders als <strong>in</strong> Böhmen <strong>und</strong> Mähren – die Ausbildung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>neren territorialen Geschlossenheit<br />
verh<strong>in</strong>derten.<br />
16 Propagandistisch <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Staatsgründung VIKTOR DVORSKÝ: Území<br />
československého národa [Das Territorium der tschechoslowakischen Nation], Praha 1918,<br />
S. 67: „České národní území má z 91 % znamenité hranice přirozené“ (Das tschechische<br />
nationale Gebiet hat zu 91 % erstklassige natürliche <strong>Grenzen</strong>). – Unter den Militärstrategen<br />
hatte dagegen 1809 der sächsische Obrist-Lieutenant <strong>und</strong> königliche Flügeladjutant Friedrich<br />
Carl von Langenau erklärt, e<strong>in</strong> Grenzverlauf entlang von Eger, Elbe <strong>und</strong> Iser sei „la<br />
l<strong>im</strong>ite la plus naturelle pour la Saxe“. Nach ROLF VIEWEG: Die böhmische Enklave Schirgiswalde<br />
zwischen Österreich <strong>und</strong> Sachsen von 1809 bis 1845, (Diss. Hamburg) Hamburg<br />
1999, S. 39 f.<br />
17 Z.B. „Mächtig <strong>und</strong> aus hartem Geste<strong>in</strong> gefügt ragt <strong>im</strong> Herzen Europas das böhmische Massiv<br />
empor, gleichsam e<strong>in</strong>e von der Natur aufgetürmte Zitadelle gegen die weiten Ebenen<br />
des europäischen Ostens. Die Gebirge an den <strong>Grenzen</strong>, der Böhmerwald <strong>und</strong> das Erzgebirge<br />
<strong>im</strong> Südwesten, Westen <strong>und</strong> Nordwesten, das Elbsandste<strong>in</strong>-, Lausitzer- <strong>und</strong> Isergebirge<br />
<strong>im</strong> Norden, das Riesen-, Adler- <strong>und</strong> Altvatergebirge <strong>im</strong> Nordosten <strong>und</strong> Osten bilden die<br />
Wälle dieser Festung Böhmen <strong>und</strong> der Länder Mähren <strong>und</strong> Sudetenschlesien.“ HANSGEORG<br />
LOEBEL: Geschichte der Deutschen <strong>in</strong> den Sudetenländern – e<strong>in</strong> Überblick, <strong>in</strong>: Erbe <strong>und</strong><br />
Leistung. Sudetendeutschtum <strong>in</strong> Bildern. Landschaft – Menschen – Kultur – Geschichte.<br />
Böhmen – Mähren – Schlesien, bearb. vom Sudetendeutschen Archiv, München 1970, unpag<strong>in</strong>ierter<br />
E<strong>in</strong>leitungsteil, zweite Textseite. – Die widerspruchsvolle pathetische Stilisierung<br />
Böhmens <strong>und</strong> Mährens als Bollwerk gegen den Osten <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der nicht<br />
99
Walter Sperl<strong>in</strong>g hat – <strong>in</strong> Anlehnung an Karl Sedlmeyer 18 <strong>und</strong> andere – dem <strong>in</strong><br />
Schulatlanten noch <strong>im</strong>mer zu f<strong>in</strong>denden <strong>und</strong> <strong>in</strong>sgesamt sehr geschichtsträchtigen Mythos<br />
e<strong>in</strong>es „böhmischen Kessels“, e<strong>in</strong>er „Festung Böhmen“, e<strong>in</strong>er „Bastion“ oder „Zitadelle<br />
Böhmen“ schon 1981 die nüchterne geographische Beschreibung gegenübergestellt.<br />
„In Wirklichkeit ist es, wie es <strong>in</strong> den topographischen Karten besser zum<br />
Ausdruck kommt, ganz anders: Die Höhen steigen sanft <strong>und</strong> <strong>in</strong> gestuften Flächen auf,<br />
das Kammgebirge ist ke<strong>in</strong>eswegs geschlossen, <strong>und</strong> <strong>im</strong> Innern liegt ke<strong>in</strong> großer 'Kessel',<br />
sondern e<strong>in</strong> System von vielfach verstellten Hochflächen <strong>und</strong> Hügelländern.“ 19<br />
Auch geologisch <strong>und</strong> geomorphologisch bilden die Höhenzüge ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches <strong>und</strong><br />
zusammenhängendes oder geschlossenes System. Vor allem ist nicht ersichtlich, wie<br />
aus e<strong>in</strong>em „natürlich“ geographischen Argument oder gar aus der Metapher des Siedetopfs<br />
oder des Abgr<strong>und</strong>s e<strong>in</strong>e historisch-politische Kausalität für die hohe Stabilität<br />
von <strong>Grenzen</strong> abgeleitet werden könnte; es gibt zu viele Gegenbeispiele.<br />
weniger pathetischen Aufzählung der Gebirge, die Böhmen nach Westen <strong>und</strong> Norden <strong>und</strong><br />
damit nach Deutschland h<strong>in</strong> (nicht aber nach Osten) abgrenzen, erfreut sich seit Jahrzehnten<br />
e<strong>in</strong>er gewissen Popularität <strong>und</strong> ist bis <strong>in</strong> die jüngste Zeit häufig anzutreffen, übersieht<br />
aber, daß alle großen Schlachten <strong>im</strong> Inneren Böhmens <strong>und</strong> nicht an se<strong>in</strong>en <strong>Grenzen</strong> geschlagen<br />
wurden. – KARL HAUSHOFER: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> ihrer geographischen <strong>und</strong> politischen<br />
Bedeutung, Berl<strong>in</strong>-Grunewald 1927, spricht <strong>in</strong> dieser wissenschaftlich-geopolitischen<br />
Kampfschrift, mit der er „e<strong>in</strong>en Grenz<strong>in</strong>st<strong>in</strong>kt“ <strong>und</strong> e<strong>in</strong> „<strong>im</strong>mer waches Grenzbewußtse<strong>in</strong>“<br />
schaffen wollte (S. 6), heroisierend von den „Schanzen der Waldfestung Böhmen“ (S. 180)<br />
<strong>und</strong> von „der leider großenteils geräumten Waldfestung“ (S. 111).<br />
18 KARL A. SEDLMEYER: Die Festung Böhmen, e<strong>in</strong> Phantom <strong>und</strong> ihre Beziehungen zu den<br />
Sudetenländern, <strong>in</strong>: Bohemia 2 (1961), S. 287-296. — Schon vor dem Ersten Weltkrieg<br />
stellte E. HERNECK: Böhmen als geographischer E<strong>in</strong>heitsbegriff, <strong>in</strong>: Deutsche Arbeit 4<br />
(1904/05), S. 335-345 <strong>und</strong> 398-407 fest, daß der Böhmerwald „ohne e<strong>in</strong>heitliche Geschlossenheit“<br />
sei (S. 336), daß für das Erzgebirge gelte: „Vierzehn Hauptübergänge machen,<br />
nicht weit von e<strong>in</strong>ander entfernt, den Gebirgswall wegsam“ (S. 337), <strong>und</strong> daß das Lausitzergebirge<br />
„wegen bequemer Übergänge“ e<strong>in</strong> „günstig entwickeltes Durchgangsland“ sei<br />
(S. 338).<br />
19 WALTER SPERLING: Tschechoslowakei. Beiträge zur Landesk<strong>und</strong>e <strong>Ostmitteleuropa</strong>s, Stuttgart<br />
1981, S. 21-22, Zitat S. 22. Ähnlich für die böhmische Nordgrenze WALTER SPERLING:<br />
Schlesische Landschaftsnamen. Bemerkungen zu e<strong>in</strong>em Forschungsvorhaben, <strong>in</strong>: Jahrbuch<br />
der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 36/37 (1995/1996), S. 385-<br />
421, hier S. 388: „Schlesien besitzt überwiegend ke<strong>in</strong>e 'natürlichen', also der Landesnatur<br />
entlehnten <strong>Grenzen</strong>. Selbst die Gebirgsgrenze gegen Mähren <strong>und</strong> Böhmen verläuft ke<strong>in</strong>eswegs<br />
auf der Wasserscheide, wechselt <strong>im</strong> Osten mehrmals ihre Richtung.“ – Gegen die <strong>im</strong><br />
<strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert aufblühende Vorstellung der festungsartigen natürlichen Grenzberge Böhmens<br />
polemisiert unter H<strong>in</strong>weisen auf die politische Geschichte <strong>und</strong> auf militärische Strategien<br />
PAVEL BĚLINA: Čechy – mýtus přírodní pevnosti [Böhmen – der Mythos der natürlichen<br />
Festung], <strong>in</strong>: Střední Evropa 10 (1994), Nr. 38-39, S. 77-82. – Dies erkannte, wenn<br />
auch aus anderen Gründen <strong>und</strong> mit politisch-expansiven Absichten bereits KÄUBLER (wie<br />
Anm. 4), S. 371: „Das Relief ist nirgends so steil, daß es dem verb<strong>in</strong>denden Verkehr e<strong>in</strong>e<br />
unübersteigbare Schranke geboten hätte“.<br />
100
Nicht nur geographisch, sondern auch politisch <strong>und</strong> kulturell bilden Gebirge oder<br />
Bergketten – ebenso übrigens wie Flußlandschaften – häufig e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit, e<strong>in</strong>en eigenständigen,<br />
strukturell homogenen Raum. Die Notwendigkeit der „natürlichen<br />
Grenze“ (frontière naturelle bzw. l<strong>im</strong>ite naturelle, přirozená hranice) wurde besonders<br />
von Militärstrategen des 18. <strong>und</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>in</strong> Frankreich, dann <strong>im</strong> Rahmen des<br />
geopolitischen Nationalismus seit <strong>Herder</strong>, speziell von vielen Fachgelehrten der Geographie,<br />
Staatswissenschaften <strong>und</strong> Geschichte <strong>in</strong> Deutschland <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
<strong>und</strong> schließlich von der auf Friedrich Ratzel zurückgehenden Geopolitik propagiert.<br />
<strong>20</strong> Sie läßt sich historisch kaum bestätigen. Weder markierten die Kämme der<br />
Alpen, des Schwarzwalds, von Taunus <strong>und</strong> Balkan-Gebirge oder anderer Bergketten<br />
für längere Zeiten politische <strong>Grenzen</strong>, noch waren sie die Orte entscheidender militärischer<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen oder wirksamer Verteidigungsl<strong>in</strong>ien. Vielmehr bilden<br />
Gebirge häufig als spezifische Transfer-Landschaft e<strong>in</strong>en eigenen Wirtschafts-, Sozial-<br />
<strong>und</strong> Kulturraum, der sich von den umgebenden Gebieten unterscheidet <strong>und</strong> durch<br />
se<strong>in</strong>e <strong>in</strong>neren Bezüge deutlich von diesen abgrenzt. E<strong>in</strong>e Berglandschaft politischadm<strong>in</strong>istrativ<br />
durch e<strong>in</strong>e Grenzl<strong>in</strong>ie zu teilen, zu zerschneiden, ist aus vielen Gründen<br />
wenig s<strong>in</strong>nvoll, auch wenn es <strong>im</strong>mer wieder propagiert wurde. Der Rand e<strong>in</strong>es Gebirges<br />
könnte daher – den geographischen Konzepten naturräumlicher Gliederungen folgend<br />
– eher <strong>und</strong> besser begründbar als „natürliche Grenze“ def<strong>in</strong>iert werden als e<strong>in</strong><br />
Gebirgskamm oder e<strong>in</strong>e Wasserscheide. Die Beständigkeit von Grenzverläufen kann<br />
somit nicht alle<strong>in</strong> formalistisch aus der Oberflächenstruktur bzw. aus der geomorphologischen<br />
oder physischen Geographie abgeleitet werden. Vielmehr beweist das Beispiel<br />
der mährisch-niederösterreichischen Grenze, daß e<strong>in</strong> Grenzverlauf, der ke<strong>in</strong>esfalls<br />
als „natürlich“ beschrieben werden kann, ebenfalls über Jahrh<strong>und</strong>erte weitgehend<br />
unverändert bleiben kann. 21<br />
Im konkreten Fall der Böhmen <strong>in</strong> weiten Teilen umrahmenden Berglandschaften<br />
kommt h<strong>in</strong>zu, daß weder Kämme noch Wasserscheiden den genauen Grenzverlauf<br />
erklären können. 22 Seit dem Mittelalter wurde zudem bei Grenzbeschreibungen <strong>und</strong><br />
<strong>20</strong> Vgl. allgeme<strong>in</strong> dazu für die Diskurse <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> Deutschland HANS-DIETRICH<br />
SCHULTZ: Deutschlands „natürliche“ <strong>Grenzen</strong>. „Mittellage“ <strong>und</strong> „Mitteleuropa“ <strong>in</strong> der Diskussion<br />
der Geographen seit dem Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Geschichte <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
15 (1989), S. 248-281; DERS.: Deutschlands „natürliche“ <strong>Grenzen</strong>, <strong>in</strong>: Deutschlands<br />
<strong>Grenzen</strong> (wie Anm. 3), S. 32-93; DERS.: „Deutschland? aber wo liegt es?“ Zum Naturalismus<br />
<strong>im</strong> Weltbild der deutschen Nationalbewegung <strong>und</strong> der klassischen deutschen Geographie,<br />
<strong>in</strong>: Deutschland <strong>und</strong> Europa (wie Anm. 9), S. 85-104.<br />
21 Zu dieser Grenzl<strong>in</strong>ie vgl. HANS HIRSCH: Die Entstehung der Grenze zwischen Niederösterreich<br />
<strong>und</strong> Mähren, <strong>in</strong>: Deutsches Archiv für Landes- <strong>und</strong> Volksforschung 1 (1937), S. 856-<br />
866; FRANZ HIERONYMUS RIEDL: Die Entwicklung der Grenze zwischen Niederösterreich<br />
<strong>und</strong> Mähren, Masch. Diss. Innsbruck 1951.<br />
22 Alle<strong>in</strong> die Quellgebiete von Eger <strong>und</strong> Lausitzer Neiße widersprechen der Vorstellung von<br />
der böhmischen Grenze als durchgängiger Wasserscheide. – Karten zu Grenzverlauf <strong>und</strong><br />
Wasserscheiden z.B. bei JOSEF DOBIÁŠ: Seit wann bilden die natürlichen <strong>Grenzen</strong> von<br />
Böhmen auch se<strong>in</strong>e politische Landesgrenze?, <strong>in</strong>: Historica 6 (1963), S. 5-44, zwischen S.<br />
32 <strong>und</strong> 33, oder <strong>in</strong>: Atlas Republiky československé / Atlas der Tschechoslovakischen Re-<br />
101
kartographischen Darstellungen die Betonung nicht auf den Höhenunterschied, sondern<br />
auf die Vegetation, auf die umfangreichen Waldlandschaften gelegt. So heißt es<br />
beispielsweise <strong>in</strong> der Maiestas Carol<strong>in</strong>a Karls IV. 1355: „<strong>in</strong> unserem erhabenen Wald,<br />
h<strong>in</strong>ter dem bekanntlich die <strong>Grenzen</strong> unseres Königreiches liegen“. 23 Erst <strong>in</strong> Karten<br />
des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts treten an die Stelle des Waldgürtels auf allen Seiten Hügel- oder<br />
Gebirgsketten. Von den frühesten Quellen bis <strong>in</strong>s <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert wurde von trennenden<br />
Grenzwäldern <strong>und</strong> von e<strong>in</strong>em geschlossenen, breiten Wald (silva l<strong>im</strong><strong>in</strong>aris, media<br />
silva) gesprochen <strong>und</strong> nicht von Grenzgebirgen. 24 Georg Agricola stellte z.B. ohne<br />
H<strong>in</strong>weis auf die Topographie fest: „Circum Bohemia <strong>in</strong>gens est sylva“. 25 Und noch<br />
<strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert hieß es <strong>im</strong> bayerisch-böhmischen Grenzgebiet „h<strong>in</strong>term Wald“<br />
(nicht: h<strong>in</strong>term Berg, Gebirge, Kamm etc.) oder „draußen“ bzw. „<strong>im</strong> Böhm' dr<strong>in</strong>“,<br />
wenn jenseits der Grenze geme<strong>in</strong>t war. 26<br />
Instabile Bereiche der historisch konstanten böhmischen <strong>Grenzen</strong> (15. bis <strong>20</strong>.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
E<strong>in</strong>e Antwort auf die Frage, warum <strong>in</strong>sbesondere die <strong>Grenzen</strong> Böhmens über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
weitgehend konstant blieben, kann möglicherweise die Betrachtung der<br />
kle<strong>in</strong>räumigen Grenzänderungen geben, die zwischen dem 15. <strong>und</strong> der Mitte des <strong>20</strong>.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts erfolgten. E<strong>in</strong>e detaillierte Gegenüberstellung des böhmischen Grenzverlaufs<br />
des 14./15. Jahrh<strong>und</strong>ert mit dem tschechoslowakischen des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
publik, Red. JAROMÍR PANTOFLÍČEK, Praha/Prag 1936, Karte 5 (Mapa hydrografická);<br />
SPERLING: Tschechoslowakei (wie Anm. 19), S. 71.<br />
23 Maiestas Carol<strong>in</strong>a. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von<br />
1355, hrsg. <strong>und</strong> übers. von BERND-ULRICH HERGEMÖLLER, München 1995 (Veröffentlichungen<br />
des Collegium Carol<strong>in</strong>um, Bd. 74), hier S. 154/155: Kap. 63. – Weitere Beispiele<br />
bei JOHANN LOSERTH: Der Grenzwald Böhmens, <strong>in</strong>: Mittheilungen des Vere<strong>in</strong>es für Geschichte<br />
der Deutschen <strong>in</strong> Böhmen 21 (1883/84), S. 177-<strong>20</strong>1.<br />
24 Quellenbelege u.a. bei DOBIÁŠ (wie Anm. 22), u.a. S. 24 f., 27, 36, 41. — JOSEF LINZ: Die<br />
Grenze zwischen Böhmen <strong>und</strong> dem historischen Egerland, o.O. o.J. (Masch. Manuskript,<br />
Bibliothek des Collegium Carol<strong>in</strong>um), S. 1. Für das 14. Jahrh<strong>und</strong>ert berechnet L<strong>in</strong>z den<br />
böhmisch-egrischen Grenzwald auf e<strong>in</strong>e Tiefe von 4 bis 25 km, ebenda, S. 56 f. <strong>und</strong> S. 69.<br />
– Zur Veränderung <strong>in</strong> den Karten KARL SCHNEIDER: Über die Entwicklung des Kartenbildes<br />
von Böhmen. E<strong>in</strong> Beitrag zur Geschichte der Geographie dieses Landes, <strong>in</strong>: Mitteilungen<br />
des Vere<strong>in</strong>es für Geschichte der Deutschen <strong>in</strong> Böhmen 45 (1907), S. 321-367, hier S.<br />
322.<br />
25 GEORG AGRICOLA: Ausgewählte Werke. Gedenkausgabe, Bd. 6, Berl<strong>in</strong> (DDR) 1961, S. 36.<br />
Zitiert nach ROLAND J. HOFFMANN: Zur Rezeption des Begriffs der Sudeti montes <strong>im</strong> Zeitalter<br />
des Humanismus <strong>und</strong> der Reformation, <strong>in</strong>: Jahrbuch für sudetendeutsche Museen <strong>und</strong><br />
Archive (1993-1994), S. 73-184, hier S. 101, ähnlich auch S. 106.<br />
26 Zum Grenzverständnis auch EISCH (wie Anm. 5), u.a. S. 177 <strong>und</strong> S. 199.<br />
102
zw. Tschechiens nach 1989 27 zeigt nur m<strong>in</strong><strong>im</strong>ale, aber doch e<strong>in</strong>ige kle<strong>in</strong>ere bemerkenswerte<br />
Abweichungen. 28 Da sich <strong>im</strong> Fall Böhmens die politischen <strong>und</strong> die kirchlich-adm<strong>in</strong>istrativen<br />
<strong>Grenzen</strong> seit dem Mittelalter weitgehend deckten, s<strong>in</strong>d außerdem<br />
die Gebiete untersuchenswert, <strong>in</strong> denen dies gerade nicht der Fall war. Infolge e<strong>in</strong>es<br />
Herrschaftswechsels fielen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Kle<strong>in</strong>regionen an der Grenze für Jahrzehnte,<br />
wenn nicht Jahrh<strong>und</strong>erte die politischen <strong>und</strong> kirchlichen Zugehörigkeiten ause<strong>in</strong>ander,<br />
so daß auch <strong>in</strong> diesen Fällen von abweichenden, nicht konstanten Herrschafts-<br />
<strong>und</strong> Verwaltungsgrenzen gesprochen werden kann. Am besten verdeutlicht dies die<br />
Situation vor 1800, als die Diözesangrenzen noch nicht überall den modifizierten politischen<br />
<strong>Grenzen</strong> angepaßt worden waren. Auffällig ist zudem die Tatsache, daß vor<br />
allem die Bereiche, <strong>in</strong> denen vom Mittelalter bis <strong>in</strong> die europäische Sattelzeit um<br />
1800 kle<strong>in</strong>ere Grenzverschiebungen erfolgt waren, zwischen 1914 <strong>und</strong> 1945 erneut<br />
<strong>und</strong> verstärkt zur Disposition gestellt wurden. Die erste Hälfte des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
erweist sich dabei als die Periode der böhmischen Geschichte, <strong>in</strong> der die meisten <strong>und</strong><br />
variantenreichsten Pläne für Grenzänderungen vorgelegt <strong>und</strong> am <strong>in</strong>tensivsten Grenzdiskussionen<br />
geführt wurden. Zu gr<strong>und</strong>sätzlichen Veränderungen kam es jedoch e<strong>in</strong>zig<br />
für sieben Jahre <strong>in</strong>folge des Münchener Abkommens, das aber gerade nicht <strong>in</strong> der<br />
jahrh<strong>und</strong>ertealten Traditionsl<strong>in</strong>ie von konzipierten <strong>und</strong> praktizierten kle<strong>in</strong>räumigen<br />
Modifikationen des Grenzverlaufs steht.<br />
Betrachtet man die böhmischen Grenzabschnitte, <strong>in</strong> denen es <strong>in</strong> den vergangenen<br />
fünf Jahrh<strong>und</strong>erten zu beachtenswerteren territorialen Veränderungen kam 29 , so zeigt<br />
27 Für die spätmittelalterlichen <strong>Grenzen</strong> vgl. verschiedene Karten z.B. JAN JANÁK, ZDEŇKA<br />
HLEDÍKOVÁ: Děj<strong>in</strong>y správy v českých zemích do roku 1945 [Geschichte der Verwaltung <strong>in</strong><br />
den böhmischen Ländern bis zum Jahr 1945], Praha 1989, příloha 1, 4 <strong>und</strong> 5. – Im folgenden<br />
werden sowohl für Orte <strong>in</strong> den bömischen Ländern wie <strong>in</strong> Deutschland, Österreich <strong>und</strong><br />
Polen, soweit vorhanden, sowohl die deutschen wie die tschechischen Namensformen angegeben.<br />
Zu den tschechischen Formen für Orte außerhalb der böhmischen Länder vgl. Ottův<br />
slovník naučný [Ottos Konversationslexikon], 40 Bde., Praha 1888-1943; Ottův zeměpisný<br />
atlas [Ottos geographischer Atlas], hrsg. von FRANTIŠEK MACHÁT, Redaktion JIN-<br />
DŘICH METELKA, Praha 1924.<br />
28 Unberücksichtigt bleibt <strong>in</strong> diesem Zusammenhang, daß sich <strong>in</strong> der Frühneuzeit <strong>Grenzen</strong><br />
generell auf e<strong>in</strong>e L<strong>in</strong>ie reduzierten, e<strong>in</strong> Prozeß, der <strong>in</strong> weniger stark erschlossenen Gebieten<br />
häufig später e<strong>in</strong>setzte <strong>und</strong> länger dauerte als <strong>in</strong> dichtbesiedelten Regionen. In Mitteleuropa<br />
lassen sich bis <strong>in</strong>s 18. Jahrh<strong>und</strong>ert sowohl Grenzzonen <strong>und</strong> Grenzsäume als auch scharf gezogene<br />
Grenzl<strong>in</strong>ien nachweisen. Die Grenz- <strong>und</strong> Zollstationen lagen <strong>in</strong> früheren Jahrh<strong>und</strong>erten<br />
oft nicht dicht beie<strong>in</strong>ander oder e<strong>in</strong>ander gegenüber, sondern waren durch e<strong>in</strong>en<br />
breiten Grenzstreifen, <strong>im</strong> böhmischen Fall meist vom Grenzwald getrennt. Vgl. u.a. dazu<br />
das Schwerpunktheft von Siedlungsforschung 9 (1991), <strong>in</strong>sbesondere JOHANN-BERNHARD<br />
HAVERSATH: Historisch-geographische Aspekte politischer <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Mitteleuropa mit<br />
besonderer Berücksichtigung der heutigen deutsch-tschechischen Grenze, ebenda, S. 173-<br />
198, sowie die Beiträge von Hans-Jürgen Karp <strong>und</strong> Horst Förster <strong>in</strong> diesem Band.<br />
29 Für Detail<strong>in</strong>formationen <strong>und</strong> weiterführende Literatur zu e<strong>in</strong>zelnen Orten, <strong>im</strong> folgenden<br />
nicht e<strong>in</strong>zelnen angemerkt, vgl. Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands, Bd. 7:<br />
Bayern, hrsg. von KARL BOSL, Stuttgart 1961; Bd. 8: Sachsen, hrsg. von WALTER SCHLE-<br />
SINGER, Stuttgart 1965; Ndr. Stuttgart 1990; Handbuch der Historischen Stätten. Schlesien,<br />
103
sich bereits <strong>im</strong> Norden mit der Grafschaft Glatz (Kłodzko, Kladsko) die erste Besonderheit.<br />
Die zu Böhmen gehörige Landschaft wurde seit dem 13. Jahrh<strong>und</strong>ert mehrfach<br />
<strong>in</strong> Gänze – <strong>und</strong> zum Teil zusammen mit dem Braunauer Stiftsland – an niederschlesische<br />
Piastenherzöge verlehnt bzw. verpfändet <strong>und</strong> war seit 1459 als Grafschaft<br />
böhmisches Lehen <strong>im</strong> Verband der schlesischen Fürstentümer. Die besondere rechtliche<br />
B<strong>in</strong>dung an Böhmen blieb nach dem Übergang des Herrschaftsbesitzes an das<br />
Haus Habsburg bestehen. 1742/43 g<strong>in</strong>g die Grafschaft <strong>in</strong> preußische Oberhoheit über,<br />
wurde aber erst 1815 endgültig <strong>in</strong> die Prov<strong>in</strong>z Schlesien e<strong>in</strong>gegliedert. 30 Kirchenrechtlich<br />
blieb dieses Gebiet bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg als e<strong>in</strong>ziges niederschlesisches<br />
Territorium Teil der Erzdiözese Prag, obwohl schon vor 1972 traditionell<br />
enge B<strong>in</strong>dungen an das Bistum Breslau (Wrocław) bestanden hatten. Mit ca.<br />
1.600 qkm gehörte dieses Gebiet zu den größten, deren Anschluß tschechische Politiker<br />
<strong>im</strong> Zusammenhang mit der Staatsgründung der ČSR energisch forderten. 31 Die<br />
vollständige Angliederung oder zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e Teilung der Region Glatz – e<strong>in</strong>schließlich<br />
von Grenzänderungen <strong>in</strong> den Bereichen von Nachod (Náchod), Braunau<br />
(Broumov) <strong>und</strong> dem schlesischen Neurod (Nowa Ruda) – wurden auf den Pariser<br />
Friedenskonferenzen aufgr<strong>und</strong> von strategischen <strong>und</strong> politischen Überlegungen mehrfach<br />
ernsthaft, letztlich aber ohne Konsequenz erwogen. 32 Zwischen 1942 <strong>und</strong> 1945<br />
war das Glatzer Gebiet nochmals Objekt tschechoslowakischer Ambitionen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationaler<br />
Verhandlungen, ohne daß es zu e<strong>in</strong>er neuen Grenzl<strong>in</strong>ie gekommen wäre. 33<br />
hrsg. von HUGO WECZERKA, Stuttgart 1977; Handbuch der Historischen Stätten – Österreich,<br />
Bd. 1: Donauländer <strong>und</strong> Burgenland, hrsg. von KARL LECHNER, Stuttgart 1985;<br />
Handbuch der Historischen Stätten. Böhmen <strong>und</strong> Mähren, hrsg. von JOACHIM BAHLCKE,<br />
WINFRIED EBERHARD <strong>und</strong> MILOSLAV POLÍVKA, Stuttgart 1998.<br />
30 WŁADYSŁAW DZIEWULSKI: Zarys rozwoju przestrzennego Kłodzka od czasów najdawniejszych<br />
do drugiej wojny światowej [Abriß der räumlichen Entwicklung von Glatz von<br />
den ältesten Zeiten bis zum Zweiten Weltkrieg], <strong>in</strong>: Rocznik ziemi kłodzkiej 3 (1958), S.<br />
11-48.<br />
31 Mémoire No. 9: Le problème de la région de Glatz, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften<br />
(wie Anm. 7), S. 266-275 <strong>und</strong> Karten; vgl. auch PERMAN (wie Anm. 8), S. 125-<br />
129 <strong>und</strong> Anhang 2. Karte mit den tschechoslowakischen Gebietsvorstellungen vom 12.<br />
März 19<strong>19.</strong><br />
32 Conférence de la Paix 1919-<strong>20</strong>. Recueil des Actes de la Conférence, Partie IV: Commissions<br />
de la Conférence, C: Questions territoriales, Bd. 1: Commission des affaires tchécoslovaques,<br />
Paris 1923; hier <strong>und</strong> <strong>im</strong> folgenden zitiert nach der deutschen Übersetzung bei<br />
KURT RABL: Das R<strong>in</strong>gen um das sudetendeutsche Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht 1918/<strong>19.</strong> Materialien<br />
<strong>und</strong> Dokumente, München 1958 (Veröffentlichungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um, Bd.<br />
3), S. 160-162, 173-175, 191. – PERMAN (wie Anm. 8), u.a. S. 127, 136, 153.<br />
33 MILIČ ČAPEK: A Key to Czechoslovakia, the Territory of Kladsko (Glatz). A Study of a<br />
Frontier Problem <strong>in</strong> Middle Europe, New York 1946; FRANTIŠEK KULHÁNEK: Boj o Kladsko<br />
[Das Kampf um das Glatzer Gebiet], Praha 1946; Naše Kladsko [Unser Glatzer Gebiet],<br />
Praha 1946. – Auch <strong>im</strong> Bereich des Riesengebirges, wo die Grenze über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
weitgehend stabil war, forderte die Tschechoslowakei 1918/19 den Anschluß e<strong>in</strong>es<br />
Grenzstreifens von ca. 5 km Tiefe; Mémoire No. 10, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften<br />
(wie Anm. 7), S. 286/287.<br />
104
Das nächste geographische Zentrum mit e<strong>in</strong>er relativ stark oszillierenden Grenze<br />
ist der Abschnitt zwischen Isergebirge <strong>und</strong> Elbe mit dem Friedländer Bereich, dem<br />
Zittauer Becken <strong>und</strong> dem „Böhmischen Niederland“, auch „Rumburger Grenzw<strong>in</strong>kel“<br />
genannt. 34 Im 13. <strong>und</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert, als Böhmen zeitweise bis nach Pirna (Perno;<br />
1294 bis 1404 böhmisch) <strong>und</strong> auf dem anderen Elbeufer weiter nach Norden reichte,<br />
kam es <strong>in</strong> diesem Bereich noch zu e<strong>in</strong>em häufigen Wechsel der Zugehörigkeiten zu<br />
Böhmen, zu Meißen oder zur Oberlausitz bzw. zu den Diözesen Meißen <strong>und</strong> Prag,<br />
wobei sich politische <strong>und</strong> kirchliche Verwaltungsgebiete häufig nicht deckten. Während<br />
das alte böhmische Lehen Zittau (Žitava), d.h. Stadt <strong>und</strong> Weichbild, sich <strong>im</strong><br />
14./15. Jahrh<strong>und</strong>ert dem B<strong>und</strong> der königlichen lausitzischen Städte anschloß, verblieb<br />
es kirchenrechtlich als e<strong>in</strong>ziger Teil der Oberlausitz für Jahrh<strong>und</strong>erte bei der Erzdiözese<br />
Prag. Im Zittauer Becken verfestigte sich der Grenzverlauf zu Böhmen – mit<br />
der Ausnahme von Weigsdorf (Višňová) – <strong>im</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert, stand aber <strong>im</strong> <strong>20</strong>.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert mehrfach auf der Tagesordnung der Grenzl<strong>in</strong>ien diskutierenden Diplomatie.<br />
35<br />
Stadt <strong>und</strong> Herrschaft Friedland (Frýdlant), die noch <strong>im</strong> 13. Jahrh<strong>und</strong>ert zu Meißen<br />
gehört hatten, gewannen mit der Herzogswürde Albrechts von Wallenste<strong>in</strong> kurzfristig<br />
e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>und</strong> gehörten sowohl 1918/19 wie <strong>im</strong> Sommer 1938 zu den Gebieten,<br />
deren Anschluß an Sachsen denkbar schien. Zwei kle<strong>in</strong>ere Geme<strong>in</strong>den des<br />
Friedländer Gebietes hatte Österreich <strong>in</strong> der Schlußakte des Wiener Kongresses an<br />
Preußen bzw. Preußisch-Schlesien abgetreten. E<strong>in</strong>e weitergehende Grenzrevision<br />
durch Abtretung dieser überwiegend deutschbesiedelten Gebiete „h<strong>in</strong>ter den Bergen“<br />
an Deutschland schlug aufgr<strong>und</strong> von militärisch-strategischen, geographischen <strong>und</strong><br />
völkischen Überlegungen beispielsweise Ende der achtziger Jahren des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
auch der tschechische Politiker Julius Grégr vor. 36 Bei den Pariser Friedensver-<br />
34 HELENE JAHN-LANGEN: Das Böhmische Niederland. Bevölkerungs- <strong>und</strong> Sozialstruktur e<strong>in</strong>er<br />
Industriedorflandschaft, München 1960 (Wissenschaftliche Materialien zur Landesk<strong>und</strong>e<br />
der böhmischen Länder, Bd. 4), S. 5-6. – Nicht nachweisbar war für mich die Studie<br />
von R. NAUMANN: Werden <strong>und</strong> Wandlungen der sächsisch-böhmischen Grenze, <strong>in</strong>: Die<br />
höhere Schule 15 (1937).<br />
35 RUDOLF WENISCH: Die Grenze zwischen Böhmen <strong>und</strong> der Oberlausitz, <strong>in</strong>: Jahrbuch der<br />
Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag, Jg. 3: Dekanatsjahr 1925-26,<br />
Prag 1927, S. 18-21 [Kurzfassung der gleichnamigen ungedruckten Prager Dissertation]. –<br />
Aus nationaltschechischer Sicht ANTONÍN FRINTA, HUGO ROKYTA: Žitavsko v českých děj<strong>in</strong>ách<br />
[Das Zittauer Gebiet <strong>in</strong> der tschechischen Geschichte], Praha 1947 (Sborník prací<br />
členů výzkumného vědeckého sboru při Koord<strong>in</strong>ačním hraničním výboru v Praze). – Vgl.<br />
auch die Diözesankarten <strong>in</strong> JANÁK, HLEDÍKOVÁ (wie Anm. 27), příloha 5.<br />
36 Neben dem Friedländer <strong>und</strong> Warnsdorf-Rumburg-Schluckenauer Gebiet nannte Grégr das<br />
weitere Egerland <strong>und</strong> Gebiete <strong>im</strong> Erzgebirge. Vgl. JULIUS GRÉGR: Na obranu západního<br />
Slovanstva. VI. <strong>und</strong> VII. [Zur Verteidigung des Westslawentums. VI. <strong>und</strong> VII.], <strong>in</strong>: Národní<br />
listy vom 22. <strong>und</strong> 27. September 1888. Für den H<strong>in</strong>weis danke ich Herrn Dr. Roland J.<br />
Hoffmann, München, herzlich. Auszüge aus dem Text zusammen mit deutscher Übersetzung<br />
auch <strong>in</strong>: Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dokumentation zu Ursachen,<br />
105
handlungen 1919 hatte die tschechoslowakische Delegation anfangs – <strong>und</strong> dabei an<br />
Grégr anknüpfend – den Verzicht auf Friedland bzw. e<strong>in</strong>e Volksabst<strong>im</strong>mung darüber<br />
angeboten, nahm jedoch rasch wieder von dieser Position Abstand. 37 Ähnliche Überlegungen<br />
gab es <strong>im</strong> tschechoslowakischen Exil zu Beg<strong>in</strong>n des Zweiten Weltkriegs. 38<br />
Dies galt <strong>in</strong> ähnlicher Weise auch für die Herrschaften Schluckenau (Šluknov) <strong>und</strong><br />
Rumburg (Rumburk) sowie das sie umgebende bergige Böhmische Niederland. E<strong>in</strong>st<br />
meißnisch, gehörte diese böhmische Herrschaft <strong>im</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>ert zum „Schle<strong>in</strong>itzer<br />
Ländchen“, dem geschlossenen, die böhmisch-sächsische bzw. -lausitzische Grenze<br />
übergreifenden Herrschaftsgebiet e<strong>in</strong>er meißnischen Adelsfamilie. Das 1572 als unmittelbares<br />
böhmisches Kronlehen verbriefte Schirgiswalde (Šerachov) war seit 1635<br />
als geistliche Herrschaft e<strong>in</strong>e böhmische Exklave <strong>im</strong> Sächsischen. Weder Karl VI.<br />
noch Maria Theresia oder die joseph<strong>in</strong>ischen Katasterregulierungen erreichten e<strong>in</strong>e<br />
Klärung der strittigen Zugehörigkeit mehrerer Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> diesem Abschnitt. Über<br />
Jahrzehnte kam daher für diesen Bereich ke<strong>in</strong> böhmisch-sächsischer Grenzausgleich<br />
zustande. Im Frieden von Schönbrunn 1809 mußte Österreich dem auf seiten Napoleons<br />
kämpfenden Sachsen Schirgiswalde, Niederleutersdorf bei Warnsdorf (Varnsdorf)<br />
<strong>und</strong> weitere kle<strong>in</strong>ere Exklaven des Böhmischen Niederlands <strong>und</strong> des Friedländer Bereichs<br />
abtreten. Da die Übergabe nicht abgeschlossen wurde, blieb <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Geme<strong>in</strong>de Schirgiswalde für Jahrzehnte e<strong>in</strong>e neutrale Zone <strong>im</strong> Grenzbereich zwischen<br />
beiden Staaten, die sich selbst verwaltete, Steuerfreiheit genoß, rechtlich Böhmen,<br />
wirtschaftlich h<strong>in</strong>gegen seit 1834 dem Zollvere<strong>in</strong> verb<strong>und</strong>en war. Erst 1845<br />
wurde Schirgiswalde vollständig <strong>in</strong> das sächsische Staatsgebiet e<strong>in</strong>gegliedert, während<br />
das österreichische Recht <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de noch für e<strong>in</strong>ige Jahrzehnte Gültigkeit<br />
behielt. Am 5. März 1848 kam der umfangreiche „Haupt-Grenz- <strong>und</strong> Territorialrezeß“<br />
zwischen Österreich <strong>und</strong> Sachsen zustande, der wiederum nicht alle Gebietsstreitigkeiten<br />
löste. 39 1919 wurde die Verkle<strong>in</strong>erung oder völlige Abtretung des Rumburger<br />
Zipfels <strong>in</strong> den Verhandlungen der Alliierten <strong>in</strong>tensiv diskutiert bzw. e<strong>in</strong>e Entschei-<br />
Planung <strong>und</strong> Durchführung e<strong>in</strong>er „ethnischen Säuberung“ <strong>in</strong> der Mitte Europas, 1848-<br />
1945/46, Bd. 1, München <strong>20</strong>00, S. 165-169, hier S. 169 (<strong>im</strong> Druck).<br />
37 Mémoire No. 10, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie Anm. 7), S. 290/291-<br />
292/293; Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32),<br />
S. 159, 175; PERMAN (wie Anm. 8), S. 144, 153 f. <strong>und</strong> Anhang 2. Karte; ZDENĚK ŠOLLE:<br />
Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919 [Masaryk<br />
<strong>und</strong> Beneš <strong>in</strong> ihren Briefen aus der Zeit der Pariser Friedensverhandlungen <strong>im</strong> Jahr<br />
1919], 2 Bde., Praha 1993/94 (Práce z děj<strong>in</strong> České akademie věd B, Bd. 1 <strong>und</strong> 6), S. 349<br />
Anm. 3, S. 124, 215.<br />
38 TOMAN BROD: K reakčním plánům buržoasní emigrace za zneužití čs. zapadní vojenské<br />
jednotky (1940-1941) [Zu den reaktionären Plänen der bürgerlichen Emigration zum Mißbrauch<br />
der tschechoslowakischen militärischen E<strong>in</strong>heiten <strong>im</strong> Westen], <strong>in</strong>: Historie a vojenství<br />
(1956), Heft 3, S. 295-362, u.a. S. 306 f.<br />
39 WENISCH (wie Anm. 35), S. <strong>20</strong>-21; HELMUT RAHN: Die E<strong>in</strong>wirkungen der tschechoslowakischen<br />
Grenze auf das deutsche Grenzgebiet am Beispiel der Geme<strong>in</strong>den Schirgiswalde,<br />
Sohland <strong>und</strong> Wehrsdorf, (Diss. Leipzig 1938) Borna 1940. – Neuerd<strong>in</strong>gs VIEWEG: Die<br />
böhmische Enklave Schirgiswalde (wie Anm. 16).<br />
106
dung durch e<strong>in</strong>e Volksabst<strong>im</strong>mung angeregt. Zeitweise galt diese Gebietsabtretung<br />
auf amerikanischen Druck h<strong>in</strong> sogar als bereits vere<strong>in</strong>bart. 40<br />
Der weitere Verlauf der sächsisch-böhmischen Grenze das Erzgebirge nach Westen<br />
entlang war seit Mitte des 15. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e konstant, nachdem die an<br />
Meißen bzw. Sachsen verpfändeten Städte wie Brüx (Most) oder Dux (Duchcov)<br />
wieder an die böhmische Krone zurückgefallen waren. 41 Bereits zuvor war das expansivere<br />
Ausgreifen Böhmens über den heutigen Grenzverlauf h<strong>in</strong>aus nach Norden abgebrochen<br />
worden, es blieben nur noch formale lehensrechtliche B<strong>in</strong>dungen <strong>in</strong>s Sächsische<br />
<strong>und</strong> Vogtländische bestehen. Infolge des Schmalkaldischen Krieges kamen<br />
1547/56 Teile der Herrschaft Schwarzenberg mit der Silberstadt Gottesgab (Boží Dar)<br />
gegenüber der Grenzstadt Oberwiesenthal <strong>und</strong> mit der südwestlich davon gelegenen<br />
Bergstadt Platten (Horní Blatná) an Böhmen. 42 Die <strong>im</strong> Vergleich zur alten oberlausitzisch-böhmischen<br />
Grenze größere Kont<strong>in</strong>uität der Grenze <strong>im</strong> Erzgebirge zeigt sich<br />
auch <strong>in</strong> der Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung von politisch <strong>und</strong> kirchlich adm<strong>in</strong>istrativer Zugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> dar<strong>in</strong>, daß <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert ke<strong>in</strong>e wesentlichen Grenzkorrekturen erwogen<br />
wurden. Der tschechoslowakische Außenm<strong>in</strong>ister Edvard Beneš schlug 1919 <strong>in</strong> Paris<br />
h<strong>in</strong>sichtlich des Grenzabschnitts <strong>im</strong> Erzgebirge e<strong>in</strong>zig e<strong>in</strong>e Begradigung mit e<strong>in</strong>em<br />
Gebietstausch vor, <strong>in</strong> den die ehemaligen Industriesiedlungen von Schmiedeberg<br />
(Šmídeberk/Kovářská) <strong>und</strong> Weipert (Vejprty) e<strong>in</strong>bezogen werden sollten. 43<br />
Das Egerland war 1256 bzw. 1322 als ständige Reichspfandschaft der Krone<br />
Böhmens übertragen <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Folgezeit mehrfach geteilt <strong>und</strong> neu abgegrenzt worden.<br />
44 Der bei Böhmen verbleibende östliche Teil um die Reichsstadt Eger (Cheb)<br />
40 Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32), S. 175 f.,<br />
180, 182-188, 192. Insbesondere das amerikanische Ausschußmitglied Allan W. Dulles<br />
forderte e<strong>in</strong>e Abtretung des Rumburger <strong>und</strong> Egerer Gebiets an Sachsen, ebenda <strong>und</strong> S. 84.<br />
41 KURT OBERDORFFER: Die Verpfändung Nordwestböhmens an Meissen-Sachsen <strong>im</strong> Jahr<br />
1425, <strong>in</strong>: He<strong>im</strong>at <strong>und</strong> Volk. Forschungsbeiträge zur sudetendeutschen Geschichte. Festschrift<br />
für Wilhelm Wostry, hrsg. von ANTON ERNSTBERGER, Brünn u.a. 1937, S. 195-218.<br />
42 PETR JANČÁREK: Česko-saská hranice v Krušných horách do třicetileté války [Die böhmisch-sächsische<br />
Grenze <strong>im</strong> Erzgebirge bis zum Dreißigjährigen Krieg], <strong>in</strong>: Čechy a Sasko<br />
v proměnách děj<strong>in</strong> / Böhmen <strong>und</strong> Sachsen <strong>im</strong> Wandel der Geschichte, bearb. von KRISTINA<br />
KAISEROVÁ, Ústí n.L. 1993 (Acta Universitatis Purkynianae. Phil. et Hist., Bd. 1, Slavogermanica<br />
II), S. 133-140; WALTER SCHLESINGER: Entstehung <strong>und</strong> Bedeutung der sächsisch-böhmischen<br />
Grenze, <strong>in</strong>: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 59 (1938), S. 6-38,<br />
hier S. 29 <strong>und</strong> 35; ERICH BERLET: Die sächsisch-böhmische Grenze <strong>im</strong> Erzgebirge. E<strong>in</strong><br />
Beitrag zur politischen Geographie, Diss. Leipzig 1900, <strong>in</strong>sbesondere S. 51 f., auch als Beilage<br />
zum Jahresbericht 1898/99 der Städtischen Realschule mit Progymnasium <strong>in</strong> Oschatz,<br />
Oschatz 1900.<br />
43 Mémoire No. 10, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie Anm. 7), S. 288/289;<br />
Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32), S. 164<br />
<strong>und</strong> 175.<br />
44 Die zeitweise Integration der Oberpfalz <strong>in</strong> das Königreich Böhmen, 1355 formal bestätigt<br />
<strong>und</strong> daher manchmal auch „Neuböhmen“ genannt, kann <strong>in</strong> diesem Zusammenhang vernachlässigt<br />
werden, da dieses bedeutendste territoriale Ausgreifen Böhmens Episode blieb<br />
<strong>und</strong> nach wenigen Jahrzehnten bereits vor 1400 zu Ende g<strong>in</strong>g. Vgl. WILHELM VOLKERT:<br />
107
nahm bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches als eigenes Territorium<br />
staats- <strong>und</strong> verfassungsrechtlich e<strong>in</strong>e Sonderstellung <strong>im</strong> Kronverband Böhmens e<strong>in</strong>.<br />
Anläßlich der Pragmatischen Sanktion trat 1721 letztmalig der Egerer Landtag zusammen,<br />
1806 erfolgte die abschließende Inkorporierung <strong>in</strong> das böhmische Königreich,<br />
1810/17 g<strong>in</strong>g das Egerland auch kirchenrechtlich vom Regensburger Bistum an<br />
die Prager Erzdiözese über. Das Bewußtse<strong>in</strong> von der Tradition der Reichspfandschaft<br />
<strong>und</strong> der historischen Sonderstellung bewirkten, daß bis <strong>in</strong>s <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert die Zugehörigkeit<br />
des engeren wie des weiteren Egerlands zu Böhmen thematisiert wurde. Unabhängig<br />
davon führte die territoriale Zersplitterung <strong>in</strong> diesem Bereich kont<strong>in</strong>uierlich<br />
zu kle<strong>in</strong>eren Grenzänderungen, die mit e<strong>in</strong>er österreichisch-bayerischen Vere<strong>in</strong>barung<br />
von 1816 weitgehend zum Abschluß kamen, als die böhmisch-österreichische Exklave<br />
Redwitz (Marktredwitz, Ředvice) von Bayern e<strong>in</strong>getauscht wurde. Nach weiteren<br />
Grenzverträgen von 1846 <strong>und</strong> 1862, <strong>in</strong> denen unter anderem noch bestehende <strong>und</strong> seit<br />
Jahrh<strong>und</strong>erten umstrittene kle<strong>in</strong>ere En- <strong>und</strong> Exklaven aufgelöst <strong>und</strong> Dörfer getauscht<br />
wurden, darunter die vormals böhmischen Ortschaften Ottengrün <strong>und</strong> Ernestgrün gegen<br />
Schönl<strong>in</strong>d (Krásná Lípa) <strong>und</strong> Alt-Albenreuth (Starý Albenreuth/Mýt<strong>in</strong>a), bildete<br />
sich <strong>in</strong> diesem Bereich e<strong>in</strong>e geschlossene Grenzl<strong>in</strong>ie heraus. 45<br />
Geographisch noch exponierter, meist aber als Teil des Egerlands betrachtet, war<br />
das reichsunmittelbare Lehen Asch (Aš), dessen Sonderstellung dadurch unterstrichen<br />
wird, daß es als e<strong>in</strong>ziger Landstrich Böhmens nicht von der Rekatholisierung betroffen<br />
wurde <strong>und</strong> protestantisches Gebiet blieb. Das „Ascher Ländchen“, ursprünglich<br />
zum Egerland gehörend <strong>und</strong> von diesem um 1400 gelöst, hatte <strong>im</strong> böhmischen Kronverband<br />
– ebenso wie <strong>im</strong> Mittelalter das benachbarte Schönbacher Ländchen, das Gebiet<br />
von Elbogen (Loket) 46 oder das an die Grafschaft Glatz angrenzende Braunauer<br />
Ländchen – e<strong>in</strong>en gewissen Sonderstatus <strong>in</strong>ne, der rechtlich vergleichsweise spät erst<br />
1775 bzw. 1806 endgültig aufgehoben wurde. Alle<strong>in</strong> schon aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er geographischen<br />
Situation wurde die Abtrennung des „Ascher Zipfels“ <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
häufiger angeboten, gefordert oder empfohlen als die anderer Gebiete. Die Verwirklichung<br />
scheiterte meist daran, daß ke<strong>in</strong> Präzedenzfall für die Veränderbarkeit der „historischen“<br />
<strong>Grenzen</strong> geschaffen werden sollte oder daß e<strong>in</strong>e solche Gebietsveränderung<br />
aufgr<strong>und</strong> der ger<strong>in</strong>gen Größe <strong>und</strong> des Zusammenhangs mit dem Egerland nur <strong>im</strong><br />
Pfalz <strong>und</strong> Oberpfalz bis zum Tod König Ruprechts, <strong>in</strong>: Handbuch der bayerischen Geschichte,<br />
neu hrsg. von ANDREAS KRAUS, Bd. III/3, 3. Aufl. München 1995, S. 52-71.<br />
45 HERIBERT STURM: Die alte Reichspfandschaft Eger <strong>und</strong> ihre Stellung <strong>in</strong> der Geschichte der<br />
böhmischen Länder, <strong>in</strong>: Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder, hrsg. von KARL<br />
BOSL, Bd. 2: Die böhmischen Länder von der Hochblüte der Ständeherrschaft bis zum Erwachen<br />
e<strong>in</strong>es modernen Nationalbewußtse<strong>in</strong>s, Stuttgart 1974, S. 1-95, <strong>in</strong>sbesondere S. 87-<br />
95; DERS.: Der Grenzvertrag von 1862, <strong>in</strong>: DERS.: Oberpfalz <strong>und</strong> Egerland, Geisl<strong>in</strong>gen/<br />
Steig 1964, S. 165-178, sowie mehrere Aufsätze der Festschrift HERIBERT STURM: Nordgau<br />
– Egerland – Oberpfalz. Studien zu e<strong>in</strong>er historischen Landschaft, München, Wien 1984<br />
(Veröffentlichungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um, Bd. 43).<br />
46 RUDOLF SCHREIBER: Die Stellung des mittelalterlichen Elbogener Landes zu Böhmen, <strong>in</strong>:<br />
Mitteilungen des Vere<strong>in</strong>es für Geschichte der Deutschen <strong>in</strong> Böhmen 74 (1936), S. 1-28 <strong>und</strong><br />
81-94.<br />
108
Rahmen gr<strong>und</strong>sätzlicher Grenzkorrekturen denkbar schien. Bei den Pariser Friedensverhandlungen<br />
erklärte die Tschechoslowakei Anfang 1919 ihren Verzicht auf dieses<br />
Gebiet, was vom Unterausschuß der Kommission für tschecho-slowakische Angelegenheiten<br />
zust<strong>im</strong>mend zur Kenntnis genommen wurde. 47<br />
Mit eigenen Delegationen <strong>in</strong> Prag <strong>und</strong> Paris hatten Eger <strong>und</strong> Asch 1918/19 unter<br />
Berufung auf die historische Entwicklung wie auf das nationale Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht<br />
e<strong>in</strong>e Neuordnung ihrer staatlichen Zugehörigkeit zu erreichen versucht. Außenm<strong>in</strong>ister<br />
Beneš erwog mehrfach, das Egerland mit dem Ascher Bezirk abzutreten oder<br />
gegen oberschlesisches Gebiet um Ratibor (Racibórz, Ratiboř) zu tauschen. Die Alliierten<br />
waren 1919 – ebenso wie 1942/44 – geneigt, das Egerland <strong>und</strong> das Ascher<br />
Ländchen entlang e<strong>in</strong>er Nord-Süd-L<strong>in</strong>ie von Graslitz (Kraslice) nach Unter-Sandau<br />
(Dolní Žandov) von Böhmen zu lösen. 48 Im April 1919 beschloß jedoch der Oberste<br />
Rat der Pariser Konferenz – <strong>und</strong> entsprechend die Alliierten am Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs –, überhaupt ke<strong>in</strong>e Korrektur des bestehenden deutsch-böhmischen<br />
Grenzverlaufs zu billigen, um zu verh<strong>in</strong>dern, daß durch ger<strong>in</strong>gfügige Grenzkorrekturen<br />
die Diskussion über das ethnographische oder sprachnationale Pr<strong>in</strong>zip angeheizt<br />
würde. 49 Es kam daher zu ke<strong>in</strong>erlei Gebietsabtretungen seitens der Tschechoslowakei.<br />
An der bayerisch-böhmischen Grenze gab es seit dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert von Waldmünchen<br />
(Mnichov nad Lesy) über Furth <strong>im</strong> Wald (Bavorský Brod/Brod nad Lesy)<br />
<strong>und</strong> das Eisenste<strong>in</strong>er Tal bis zum Rachel bei Frauenau fortwährende Grenzstreitigkeiten,<br />
die sich durch wechselseitige Okkupationen von Grenzstreifen während <strong>und</strong> nach<br />
dem Spanischen Erbfolgekrieg zu Beg<strong>in</strong>n des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts verschärften. Nach<br />
langen Verhandlungen wurde das strittige Gebiet 1764 <strong>in</strong> Prag mit der Unterzeichnung<br />
des bayerisch-böhmischen Hauptgrenzvertrages geteilt <strong>und</strong> die bis heute gültige<br />
Grenze festgelegt. Nach Abschluß der genauen Grenzvermessungen gehörten dann<br />
beispielsweise Vollmau (Folmava) oder Markt Eisenste<strong>in</strong> (Železná Ruda) def<strong>in</strong>itiv<br />
zum Königreich Böhmen. 50 E<strong>in</strong>ige böhmische Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> der Nähe von Waldmünchen<br />
verblieben jedoch noch für Jahrzehnte bei der Diözese Regensburg (Řezno),<br />
während bayerische Geme<strong>in</strong>den bei Eisenste<strong>in</strong> weiterh<strong>in</strong> dem Bistum Budweis (České<br />
Budějovice) unterstanden. Vor allem der Abschnitt bei Furth <strong>im</strong> Wald sollte bei<br />
den Pariser Friedensverhandlungen 1919 wieder thematisiert werden, ohne daß jedoch<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich oder weiter südlich bzw. <strong>im</strong> oberösterreichisch-böhmischen Be-<br />
47 Mémoire No. 10, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie Anm. 7), S. 294/295-<br />
296/297; Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32),<br />
S. 178 f., 192; PERMAN (wie Anm. 8), S. 144, 153 f. <strong>und</strong> Anhang Karte 2.<br />
48 Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32), S. 159,<br />
177-179, 182-188, 192; PERMAN (wie Anm. 8), S. 153 f.<br />
49 Allgeme<strong>in</strong> dazu PERMAN (wie Anm. 8).<br />
50 HANS-JOACHIM HÄUPLER: Der Bayerisch-böhmische Hauptgrenzvertrag von 1764, <strong>in</strong>: Bohemia<br />
33 (1992), S. 44-72; WALTER ZIEGLER: Die bayerisch-böhmische Grenze <strong>in</strong> der Frühen<br />
Neuzeit. E<strong>in</strong> Beitrag zur Grenzproblematik <strong>in</strong> Mitteleuropa, <strong>in</strong>: Menschen <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>in</strong> der Frühen Neuzeit, hrsg. von WOLFGANG SCHMALE <strong>und</strong> REINHARD STAUBER, Berl<strong>in</strong><br />
1998, S. 116-130; WEISSTHANNER (wie Anm. 10).<br />
109
Bereich nördlich von Freistadt (Cáhlav) die vorgeschlagenen Veränderungen ernsthaft<br />
<strong>in</strong> Betracht gezogen worden wären. 51<br />
Während der Versailler Vertrag Böhmens <strong>Grenzen</strong> unverändert ließ, wurden <strong>im</strong><br />
Friedensvertrag von Sa<strong>in</strong>t Germa<strong>in</strong> vom Herbst 1919 die <strong>Grenzen</strong> Böhmens an e<strong>in</strong>er<br />
e<strong>in</strong>zigen Stelle verändert. Dies betraf e<strong>in</strong>en Abschnitt, <strong>in</strong> dem – anders als <strong>in</strong> den bisher<br />
behandelten Bereichen – die Grenzl<strong>in</strong>ie seit dem Mittelalter für Jahrh<strong>und</strong>erte konstant<br />
<strong>und</strong> unstrittig war. Bei Gmünd (Cmunt) <strong>in</strong> der Nähe von Weitra (Vitoraz), das<br />
<strong>im</strong> Hochmittelalter böhmisches Lehen war, wurde Südböhmen e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eres niederösterreichisches<br />
Gebiet mit České Velenice, hervorgegangen aus den Geme<strong>in</strong>den<br />
Böhmzeil <strong>und</strong> Unterwielands, sowie Rottschachen (Rapšach), Erdweis (Nová Ves nad<br />
Lužnicí) <strong>und</strong> weiteren kle<strong>in</strong>eren Ortschaften angeschlossen. 52<br />
Abr<strong>und</strong>end sei der Vollständigkeit halber noch die böhmisch-mährische Grenze<br />
erwähnt, die sich über Jahrh<strong>und</strong>erte durch e<strong>in</strong>e beachtliche Konstanz auszeichnete,<br />
heute aber nicht mehr existiert <strong>und</strong> selbst nachgeordnete Verwaltungsgebiete nicht<br />
mehr scheidet. Im Mittelalter entstanden, <strong>im</strong> nördlichen Teil sich nicht mit den Diözesangrenzen<br />
von Leitomischl (Litomyšl) <strong>und</strong> Olmütz (Olomouc) deckend, kam es <strong>in</strong><br />
den folgenden Jahrh<strong>und</strong>erten nur zu m<strong>in</strong><strong>im</strong>alen Modifikationen durch den Wechsel<br />
e<strong>in</strong>iger Herrschaften bzw. Liegenschaften von der böhmischen <strong>in</strong> die mährische<br />
Landtafel <strong>und</strong> umgekehrt. 53 Erst mit den Verwaltungsreformen von 1948 wurde diese<br />
traditionell als B<strong>in</strong>nengrenze verstandene Trennl<strong>in</strong>ie aufgehoben <strong>und</strong> bis heute nicht<br />
51 Conférence de la Paix, nach der deutschen Übersetzung bei RABL (wie Anm. 32), S. 164,<br />
181.<br />
52 HANNS HAAS: Die Pariser Friedenskonferenz 1919 <strong>und</strong> die Frage Gmünd, <strong>in</strong>: Kamptal-<br />
Studien 3 (1982/83), S. 213-247; DERS.: Zur Problematik der österreichisch-tschechoslowakischen<br />
Grenze 1918-1919, <strong>in</strong>: Jižní Morava – brána a most / Südmähren – Tor <strong>und</strong><br />
Brücke, Mikulov 1969, S. 131-140; WALTER HUMMELBERGER: Die niederösterreichischtschechoslowakische<br />
Grenzfrage 1918/19, <strong>in</strong>: Sa<strong>in</strong>t-Germa<strong>in</strong> 1919, hrsg. von ISABELLA<br />
ACKERL <strong>und</strong> RUDOLF NECK, Wien 1989, S. 78-111; PERMAN (wie Anm. 8), u.a. S. 210;<br />
ZDENĚK ŠÍPEK: Spory ČSR s Rakouskem o vedení státní hranice v jižních Čechách po<br />
první světové válce [Die Streitigkeiten zwischen der ČSR <strong>und</strong> Österreich um die Ziehung<br />
der Staatsgrenze <strong>in</strong> Südböhmen nach dem Ersten Weltkrieg], <strong>in</strong>: Jihočeský sborník historický<br />
35 (1966), S. 33-40; ANDREA KOMLOSY: Sozial- <strong>und</strong> wirtschaftshistorischer Abriß<br />
der Region Gmünd-České Velenice, <strong>in</strong>: Das Waldviertel 41 (1992), Nr. 1, S. 26-61. – Zur<br />
Frage e<strong>in</strong>es slawischen Fürstentums Weitra/Vitorazko, das <strong>im</strong> 13. Jahrh<strong>und</strong>ert unterg<strong>in</strong>g,<br />
<strong>und</strong> zu dessen Beziehungen zu Böhmen vgl. VINZENZ PRÖKL: Das böhmische Weitra-<br />
Gebiet, se<strong>in</strong>e Germanisierung <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e weiteren Geschicke, <strong>in</strong>: Mittheilungen des Vere<strong>in</strong>es<br />
für Geschichte der Deutschen <strong>in</strong> Böhmen 14 (1876), S. 77-94; neuerd<strong>in</strong>gs auch WOLF-<br />
GANG KATZENSCHLAGER: Vitorazsko – Weitraer Gebiet?, <strong>in</strong>: Das Waldviertel 46 (1997),<br />
Nr. 2, S. 124-166.<br />
53 JINDŘICH SCHULZ: Vývoj českomoravské hranice do 15. století [Die Entwicklung der böhmisch-mährischen<br />
Grenze bis zum 15. Jahrh<strong>und</strong>ert], <strong>in</strong>: Historická geografie 4 (1970), S.<br />
52-81; DERS.: Hraniční spory mezi Čechami a Moravou od konce 15. do 1. čtvrt<strong>in</strong>y 17. století<br />
[Grenzstreitigkeiten zwischen Böhmen <strong>und</strong> Mähren vom Ende des 15. bis <strong>in</strong>s 1. Viertel<br />
des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts], <strong>in</strong>: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis facultas philosophica<br />
55 – historica 15 (1971), S. 45-73.<br />
110
mehr restituiert. Trotz verschiedener Initiativen hat die Tschechische Republik nach<br />
1993 darauf verzichtet, zur alten Ländergliederung zurückzukehren. Für die Jahrzehnte<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg waren Kreise<strong>in</strong>teilungen best<strong>im</strong>mend, welche die<br />
böhmisch-mährische Grenze ignorierten. So st<strong>im</strong>mten die Westgrenzen des Nord- <strong>und</strong><br />
des Südmährischen Kreises bzw. die Ostgrenzen des Ost- <strong>und</strong> des Südböhmischen<br />
Kreises nicht mit der alten Landesgrenze übere<strong>in</strong>. 54<br />
Faßt man die Grenzänderungen <strong>und</strong> die Debatten über Verlegungen der böhmischen<br />
<strong>Grenzen</strong> zusammen, wie sie vom ausgehenden Mittelalter bis <strong>in</strong> die Mitte des<br />
<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts dokumentiert s<strong>in</strong>d, so zeigt sich, daß die <strong>Grenzen</strong> Böhmens über gut<br />
fünfh<strong>und</strong>ert Jahre <strong>im</strong> Detail zwar nicht ganz so konstant waren, wie man me<strong>in</strong>en<br />
könnte, daß aber <strong>in</strong>sgesamt cum grano salis doch von e<strong>in</strong>er großen territorialen Kont<strong>in</strong>uität<br />
<strong>und</strong> dauerhaften Stabilität der Grenze gesprochen werden muß. Die meisten<br />
Grenzänderungen erfolgten <strong>in</strong> vornationaler Zeit, also vor 1848. Im <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
<strong>in</strong> dem <strong>im</strong> ostmitteleuropäischen Raum zahlreiche neue <strong>Grenzen</strong> entstanden, unzählige<br />
Grenzkorrekturen vorgeschlagen wurden <strong>und</strong> zum Teil heftig umstritten waren,<br />
kam es nur zu äußerst ger<strong>in</strong>gfügigen Verschiebungen der böhmischen Grenzl<strong>in</strong>ie,<br />
wenn man die gr<strong>und</strong>sätzlich anders begründeten Grenzziehungsversuche der deutschösterreichischen<br />
Prov<strong>in</strong>zen Ende 1918 <strong>und</strong> des Münchener Abkommens von 1938<br />
e<strong>in</strong>mal außer acht läßt.<br />
Fünf regionale Zonen oder Abschnitte s<strong>in</strong>d hervorzuheben, an denen die Grenze<br />
während mehrerer Jahrh<strong>und</strong>erte oszillierte oder häufiger zur Disposition stand: Glatz,<br />
Friedland bzw. Rumburg, das mittlere Erzgebirge, das Egerland mit Asch sowie der<br />
bayerisch-böhmische Bereich um Furth <strong>und</strong> Eisenste<strong>in</strong>. Als sechste Kle<strong>in</strong>region trat<br />
<strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert noch das Gmünder Gebiet h<strong>in</strong>zu.<br />
Ursachen für Unbeständigkeiten e<strong>in</strong>er historisch stabilen Grenze<br />
Betrachtet man die Anlässe, Gründe <strong>und</strong> Begründungen für die Grenzänderungen, so<br />
dom<strong>in</strong>ieren wirtschaftsgeographische <strong>und</strong> verkehrspolitische Faktoren gegenüber allen<br />
anderen, auch gegenüber staatsrechtlich-historischen. Besondere historische <strong>und</strong><br />
rechtliche Entwicklungen <strong>und</strong> Traditionen hatten e<strong>in</strong>zig für die Regionen Glatz <strong>und</strong><br />
Egerland mit Asch e<strong>in</strong>e Bedeutung. Militärisch-strategische sowie ethnische <strong>und</strong> nationale<br />
Argumente gewannen <strong>in</strong> diesem Zusammenhang erst <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert an<br />
Relevanz. Bis dah<strong>in</strong>, d.h. sogar während des national orientierten <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
waren <strong>in</strong>sbesondere letztere völlig wirkungslos <strong>und</strong> politisch irrelevant gewesen.<br />
Selbst noch bei den Pariser Friedensverhandlungen von 1919/<strong>20</strong> stellte die tschechoslowakische<br />
Delegation ökonomische Zusammenhänge <strong>in</strong> den Vordergr<strong>und</strong>, auch<br />
wenn sie versuchte, sprachnationale oder ethnographische Aspekte <strong>in</strong> die Diskussion<br />
54 HELMUT SLAPNICKA: Die neue Verwaltungsgliederung der Tschechoslowakei <strong>und</strong> ihre<br />
Vorläufer, <strong>in</strong>: Der Donauraum 5 (1960), S. 139-158.<br />
111
zu br<strong>in</strong>gen. 55 Für die <strong>in</strong>ternational anerkannte Festlegung des böhmischen Grenzverlaufs<br />
<strong>im</strong> Detail nach 1918/19 spielten schließlich ethnisch-nationale Überlegungen<br />
faktisch ke<strong>in</strong>e Rolle, wie die Forschung übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mend feststellt. 56 „Die Vertreter<br />
der alliierten Mächte widmeten den ethnographischen Argumenten ke<strong>in</strong>erlei Aufmerksamkeit.“<br />
57 Die Akten der Ausschüsse für Gebietsfragen der Pariser Friedenskonferenz<br />
belegen anschaulich die vorrangige <strong>und</strong> gliedernde Bedeutung von wirtschaftsgeographischen<br />
Bezügen <strong>und</strong> ökonomischen Gravitationszentren bei den politischen<br />
Grenzdiskussionen. Ähnliches sollte dann für die alliierten Pläne über neue<br />
Grenzziehungen <strong>in</strong> den Jahren 1941 bis 1946 gelten, bei denen für die böhmischen<br />
Länder nur kle<strong>in</strong>e Rektifikationen erwogen wurden. 58<br />
Wirtschaftliche bzw. f<strong>in</strong>anzielle Interessen waren beispielsweise schon <strong>im</strong> Spätmittelalter<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der Frühneuzeit für den Wechsel der Landeszugehörigkeit von Gottesgab<br />
<strong>und</strong> Platten sowie des Egerlands ausschlaggebend <strong>und</strong> wirkten sich bis h<strong>in</strong> zu<br />
kle<strong>in</strong>räumigen Grenzänderungen zur Nutzung von Wäldern, Wiesen oder Wegen aus.<br />
Die Wirtschaftsbeziehungen <strong>und</strong> die wirtschaftsgeographisch überwiegende Ausrichtung<br />
auf Gebiete jenseits der Grenze wurden <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert als Argumente für<br />
e<strong>in</strong>e Abtretung der Gebiete Friedland <strong>und</strong> Rumburg an Sachsen von verschiedensten<br />
Kräften <strong>im</strong>mer wieder <strong>in</strong>s Feld geführt. Daß es <strong>im</strong> Fall des Egerlands über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
nicht zu e<strong>in</strong>er Veränderung se<strong>in</strong>er prekären Zugehörigkeit kam, könnte möglicherweise<br />
auch daran gelegen haben, daß dieses Gebiet gleichermaßen enge wirtschaftliche<br />
B<strong>in</strong>dungen an die Oberpfalz bis nach Nürnberg (Nor<strong>im</strong>berk) wie an Westböhmen<br />
mit dem Handels- <strong>und</strong> Industriezentrum Pilsen (Plzeň) hatte, was sich die<br />
Waage hielt <strong>und</strong> somit jeweils grenzpolitisch egalisierte. Dagegen war die wirtschaftliche<br />
Integration des Ascher Ländchens <strong>in</strong> das Dreieck Selb, Hof <strong>und</strong> Plauen (Plavno)<br />
so markant, daß e<strong>in</strong>e Abtrennung dieses Gebietes vielfach unausweichlich erschien.<br />
Dom<strong>in</strong>ierendes Argument bei fast allen realisierten Grenzänderungen <strong>und</strong> für viele<br />
Grenzänderungsvorschläge war ganz konkret die verkehrsgeographische Situation.<br />
Bereits <strong>im</strong> 18., vor allem aber <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert wurden die En- <strong>und</strong> Exklaven an<br />
der Grenze zu Sachsen <strong>und</strong> Bayern aufgelöst, um <strong>im</strong> beiderseitigen Interesse e<strong>in</strong> ver-<br />
55 „Les raisons économiques sont les plus <strong>im</strong>portantes“. Mémoire No. 8, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen<br />
Denkschriften (wie Anm. 7), S. 264/265, ähnlich S. 124/125, 296/297 <strong>und</strong> öfter.<br />
56 Vgl. hierzu <strong>und</strong> zum folgenden neben den deutschsprachigen Editionen zu den Pariser<br />
Friedensverhandlungen von 1919: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie Anm. 7);<br />
RABL (wie Anm. 32); vor allem JOHANN WOLFGANG BRÜGEL: Tschechen <strong>und</strong> Deutsche<br />
1918-1938, München 1967, S. 95-98, <strong>und</strong> PERMAN (wie Anm. 8).<br />
57 HAAS: Pariser Friedenskonferenz (wie Anm. 52), S. 235.<br />
58 PETER KRÜGER: Die Tschechoslowakei <strong>in</strong> den Verhandlungen der Alliierten von der Altantik-Charta<br />
bis zur Potsdamer Konferenz, <strong>in</strong>: Das Jahr 1945 <strong>in</strong> der Tschechoslowakei. Internationale,<br />
nationale <strong>und</strong> wirtschaftlich-soziale Probleme, hrsg. von KARL BOSL, München,<br />
Wien 1971, S. 37-64, hier S. 50, 55, 59. – Zu den alliierten Diskussionen über Grenzverschiebungen<br />
vgl. auch DETLEF BRANDES: Großbritannien <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e osteuropäischen Alliierten<br />
1939–1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei <strong>und</strong> Jugoslawiens <strong>im</strong><br />
Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran, München 1988 (Veröffentlichungen<br />
des Collegium Carol<strong>in</strong>um, Bd. 59), u.a. S. 393, 396 oder 412.<br />
112
kehrs- <strong>und</strong> verwaltungstechnisch geschlossenes Territorium zu schaffen. Die besondere<br />
verkehrspolitische Situation des Egerlands als Transitregion wurde schon erwähnt,<br />
die des Ascher Ländchens zeigte sich zuletzt Anfang November 1989 bei der<br />
Ausreisewelle von DDR-Bürgern über das Gebiet der ČSSR. Auch die Stadt Glatz<br />
galt traditionell als zentraler Verkehrsknotenpunkt, der Prag <strong>und</strong> Böhmen mit der<br />
schlesischen Hauptstadt Breslau <strong>und</strong> weiter mit Oberschlesien, Krakau (Kraków,<br />
Krakov) oder Warschau (Warszawa, Varšava) verb<strong>in</strong>det, was 1914/19 <strong>und</strong> 1942/45<br />
wiederholt zur Untermauerung böhmischer bzw. tschechoslowakischer Gebietsansprüche<br />
angeführt wurde. 59<br />
Mit der wachsenden Bedeutung der Eisenbahnen wurden neben den alten Handelswegen<br />
<strong>und</strong> den ausgebauten Überlandstraßen sowie ihren Zollstationen vor allem<br />
die Bahnstrecken <strong>und</strong> die Bahnhöfe zu Auslösern von Grenzkorrekturen. Die das<br />
Rumburger Gebiet <strong>in</strong> West-Ost-Richtung durchschneidenden Bahnl<strong>in</strong>ien, die zum<br />
Teil dort ohne Verb<strong>in</strong>dung mit dem Inneren Böhmens endeten, waren 1918/19 ebenso<br />
e<strong>in</strong> Argument für den Anschluß an Sachsen wie die verkehrsmäßige Ausrichtung von<br />
Friedland auf Reichenberg (Liberec) für den Verbleib jenes Gebietes bei Böhmen<br />
sprach. Tschechoslowakische Ansprüche auf Furth <strong>im</strong> Wald wurden gleichermaßen,<br />
wenn auch ohne Erfolg, mit der verkehrspolitischen Bedeutung des Bahnhofs begründet<br />
wie die Gebietsforderungen bei Gmünd, die nicht nur den Bahnhof betrafen, sondern<br />
auch kle<strong>in</strong>ere Nebenl<strong>in</strong>ien unter tschechoslowakische Hoheit br<strong>in</strong>gen sollten. Alle<strong>in</strong><br />
die Rolle des Bahnhofs von Gmünd als Kreuzungspunkt zweier böhmischer<br />
Bahnl<strong>in</strong>ien <strong>im</strong> Rahmen des tschechoslowakischen Verkehrsnetzes <strong>und</strong> nicht die<br />
sprachlich-ethnische Situation <strong>in</strong> den umgebenden Dörfern war maßgeblich dafür, daß<br />
19<strong>20</strong> die Grenze dort neu gezogen wurde. Der zweiten 1919/<strong>20</strong> realisierten Gebietsänderung,<br />
die Feldsberg (Valtice), Unter- <strong>und</strong> Oberthemenau (Poštorná <strong>und</strong> Charvátská<br />
Nová Ves) <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>ere umliegende Geme<strong>in</strong>den von Niederösterreich nach<br />
Mähren wechseln ließ, lag ebenfalls die Absicht zugr<strong>und</strong>e, e<strong>in</strong>e regionale Bahnl<strong>in</strong>ie,<br />
die Zna<strong>im</strong> (Znojmo) über Nikolsburg (Mikulov) mit dem mährisch-slowakischen Eisenbahnknoten<br />
L<strong>und</strong>enburg (Břeclav) verb<strong>in</strong>det, durchgehend auf dem Territorium<br />
des tschechoslowakischen Staates verlaufen zu lassen. Zudem g<strong>in</strong>g das nahezu unbesiedelte<br />
waldreiche Mündungsdreieck von March <strong>und</strong> Thaya von Niederösterreich<br />
nach Mähren über, um der ČSR die une<strong>in</strong>geschränkte Regulierung bzw. Kanalisierung<br />
von beiden Flüssen zu ermöglichen. 60<br />
59 Vgl. bereits die frühesten Entwürfe von Karten für e<strong>in</strong>en arrondierten böhmischen bzw.<br />
tschechoslowakischen Staat von Karel Kramář <strong>und</strong> T.G. Masaryk von 1914 <strong>und</strong> vom Frühjahr<br />
1915. KLIMEK: Jak se dělal mír (wie Anm. 8), Farbkarte S. 5; KLIMKO (wie Anm. 8),<br />
Karte 1, S. 146; PERMAN (wie Anm. 8), Anhang Karte 1.<br />
60 Dazu <strong>in</strong>sb. HAAS: Pariser Friedenskonferenz (wie Anm. 52); ZDENĚK ŠÍPEK: Spory Československa<br />
s Rakouskem o vedení státních hranic na Jižní Moravě v letech 1918-1923 [Die<br />
Streitigkeiten zwischen der Tschechoslowakei <strong>und</strong> Österreich um die Ziehung der Staatsgrenzen<br />
<strong>in</strong> Südmähren <strong>in</strong> den Jahren 1918-1923], Mikulov 1968, mit Karten; DERS.: Spory<br />
ČSR s Rakouskem (wie Anm. 52); vgl. auch RABL (wie Anm. 32), S. 193.<br />
113
Für das böhmische wie für das mährische Beispiel läßt sich daher die These aufstellen,<br />
daß Grenzänderungen nicht so sehr machtpolitische oder militärisch-strategische<br />
Ursachen hatten, sondern <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e die Folge von allgeme<strong>in</strong>eren Modernisierungsprozessen<br />
waren. Parallel dazu bewirkten seit dem Mittelalter bzw. seit der<br />
Frühneuzeit mehrere Schübe erhöhter Ressourcenausnutzung <strong>und</strong> wachsender Verwaltungssystematisierungen<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten e<strong>in</strong>e<br />
Verengung der Grenzzonen auf Grenzstreifen bzw. Grenzl<strong>in</strong>ien. Nahezu alle böhmischen<br />
Grenzverschiebungen waren Folge sozioökonomischer <strong>und</strong> technologischer<br />
Wandlungen. Dies gilt sowohl für die grenzverschiebende wirtschaftliche Erschließung<br />
von Randregionen <strong>in</strong> der Frühneuzeit wie für die aus verwaltungstechnischer<br />
Sicht angestrebte Arrondierung e<strong>in</strong>es von Enklaven zerklüfteten Grenzverlaufs <strong>im</strong> 18.<br />
<strong>und</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert als auch für die <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert relevant werdende geschlossene<br />
Kontroll- <strong>und</strong> Verfügungsmacht über Verkehrswege oder Verkehrsknotenpunkte.<br />
Grenzkorrekturen waren daher stets um so leichter durchsetzbar, je mehr sie die<br />
wirtschaftlich-verkehrstechnische Praktikabilität des Grenzverlaufs erhöhten.<br />
Spielten vor allem ökonomische <strong>und</strong> verkehrspolitische Aspekte für konkrete<br />
kle<strong>in</strong>räumige Modifikationen der böhmischen <strong>Grenzen</strong> von der Frühneuzeit bis <strong>in</strong>s<br />
<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle, so liegt die Vermutung nahe, daß diese<br />
Faktoren umgekehrt ebenso die Jahrh<strong>und</strong>erte dauernde generelle territoriale Konstanz<br />
Böhmens erklären können. Es läßt sich die These aufstellen, daß seit dem ausgehenden<br />
Mittelalter die kulturgeographischen Eigenheiten <strong>in</strong> der Grenzzone, daß <strong>in</strong>sbesondere<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Siedlungsgeographie sowie die Struktur der Verkehrswege<br />
dafür verantwortlich waren, daß es während e<strong>in</strong>es halben Jahrtausends zu mehreren<br />
kle<strong>in</strong>eren, jedoch nicht zu markanteren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>schneidenden Veränderungen der<br />
<strong>Grenzen</strong> Böhmens kam.<br />
Es waren nicht <strong>in</strong> erster H<strong>in</strong>sicht geomorphologische Bed<strong>in</strong>gungen oder die Vegetation,<br />
die e<strong>in</strong>e lang andauernde Kont<strong>in</strong>uität der <strong>Grenzen</strong> Böhmens verursachten, sondern<br />
<strong>in</strong>sbesondere der niedrige Grad der grenzregionalen ökonomischen <strong>und</strong> bevölkerungsmäßigen<br />
Entwicklung, der maßgeblich für die ungewöhnlich hohe zeitliche Stabilität<br />
dieser politischen Grenze <strong>in</strong> Mitteleuropa wurde. E<strong>in</strong>e genauere Betrachtung<br />
der böhmischen Grenzzonen h<strong>in</strong>sichtlich Wirtschaftsstruktur, Besiedlungsdichte oder<br />
Verlauf der Verkehrswege bestätigt dies. „E<strong>in</strong> siedlungsarmer Streifen umsäumt<br />
Böhmen“, stellte e<strong>in</strong> Fachaufsatz schon um 1900 fest. 61 Im Grenzbereich fehlten Verkehrsknotenpunkte<br />
<strong>und</strong> beachtlichere Handelsumschlagplätze. Verkehrswege verliefen<br />
nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen parallel zur Grenze, ja vielfach ließ erst die Schaffung von<br />
abgeschlossenen politischen <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert Straßen auf beiden Seiten<br />
entlang der Grenzl<strong>in</strong>ie entstehen. Der direkte Grenzsaum von meist e<strong>in</strong>em Dutzend<br />
Kilometer Tiefe war <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> der Regel kulturlandschaftlich „nicht verdichtet“, sondern<br />
eher ökonomisch <strong>und</strong> verkehrstechnisch schwach entwickelt <strong>und</strong> traditionell<br />
dünn besiedelt. Die ger<strong>in</strong>ge kulturlandschaftliche Dichte ist dabei nicht wie <strong>in</strong> anderen<br />
Regionen e<strong>in</strong>e Folge der Grenze, sondern umgekehrt bewirkte die über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
unverändert nichtverdichtete Struktur der direkten Grenzregionen die historische<br />
61 HERNECK (wie Anm. 18), S. 399.<br />
114
hohe Stabilität des Grenzverlaufs. In der historischen Entwicklung fehlten Anreize,<br />
welche die politisch entscheidenden Kräfte hätten dazu bewegen können, e<strong>in</strong>e Veränderung<br />
des Grenzverlaufs herbeizuführen.<br />
Die Landschaftszonen beiderseits der böhmischen <strong>Grenzen</strong> waren schon vor der<br />
Vertreibung <strong>und</strong> Aussiedlung der deutschen Bevölkerung ke<strong>in</strong>e Regionen wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> kulturgeographischer Konzentration oder Verdichtung. 62 Es gibt ke<strong>in</strong>e größeren<br />
böhmischen Grenzzonen, die grenzüberschreitend von e<strong>in</strong>er außergewöhnlichen ökonomischen<br />
Dynamik geprägt waren oder s<strong>in</strong>d. Weder lassen sich größere zusammenhängende<br />
fruchtbare Landstriche f<strong>in</strong>den, noch entstanden kapital<strong>in</strong>tensive Spezialkulturen<br />
oder Industriezweige. Selbst <strong>im</strong> Erzgebirge blieben Bergbauorte wie Sankt Joach<strong>im</strong>sthal<br />
(Jáchymov), Gottesgab, Weipert oder Schmiedeberg punktuelle städtische<br />
bzw. talbezogene Wirtschaftszentren, deren Bodenschätze sich zudem meist relativ<br />
rasch erschöpften <strong>und</strong> die sich somit nicht zu größeren geschlossenen Wirtschaftsregionen<br />
erweitern konnten. 63 Sie entwickelten sich selbst <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
nicht zu offenen Agglomerationsräumen, nach 1945 geh<strong>in</strong>dert unter anderem durch<br />
den militärisch brisanten Uranabbau. Das nordböhmische Braunkohlenrevier von<br />
Komotau (Chomutov) über Brüx (Most) bis Dux (Duchcov) oder die nordböhmische<br />
Glasregion reichten dagegen nicht an die Grenze heran, sondern unterschieden sich<br />
sozioökonomisch deutlich von der direkten Grenzzone.<br />
Böhmen kennt zwar e<strong>in</strong>e Reihe paarweise an der Grenze liegender Zoll- <strong>und</strong><br />
Übergangsgeme<strong>in</strong>den – so Warnsdorf (Varnsdorf) / Seifhennersdorf, Georgswalde<br />
(Jiříkov) / Ebersbach, Gottesgab (Boží Dar) / Oberwiesenthal, Markt Eisenste<strong>in</strong> (Železná<br />
Ruda) / Bayerisch Eisenste<strong>in</strong> <strong>und</strong> České Velenice / Gmünd –, e<strong>in</strong>e wirkliche<br />
Grenzstadt ist jedoch nicht zu f<strong>in</strong>den. Es gibt ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziges städtisches Zentrum, das<br />
an bzw. auf der Grenze liegt. Erst recht gibt es ke<strong>in</strong>e bedeutenderen grenzüberschrei-<br />
62 Exemplarisch hat die regionale Gliederung <strong>im</strong> Rahmen kulturlandschaftlicher Prozesse anhand<br />
verschiedener geographischer Kriterien für das an Sachsen angrenzende Nordböhmen<br />
dargestellt HORST FÖRSTER: Nordböhmen: Raumbewertung <strong>und</strong> Kulturlandschaftsprozesse<br />
1918-1970, Paderborn 1978 (Bochumer geographische Arbeiten, Bd. 11), <strong>in</strong>sb. S. 193 Abb.<br />
41: Kulturlandschaftliche Raumtypen Nordböhmens.<br />
63 Detailliert wird das Zusammenwirken von Wirtschaft, Verkehr <strong>und</strong> Besiedlung <strong>in</strong> den wenig<br />
beachteten tschechoslowakischen wirtschafts- <strong>und</strong> sozialhistorischen Forschungen über<br />
Modellbildungen, Klassifikationen <strong>und</strong> Theorien von Industrieregionen erschlossen. Vgl.<br />
dazu die Arbeiten des Schlesischen <strong>Institut</strong>s <strong>in</strong> Opava, <strong>in</strong>sbesondere die Reihe „Průmyslové<br />
oblasti“ 1 ff. (1967 ff.) bzw. die Unterreihe „Studie k vývoji průmyslových oblastí“ des<br />
„Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě“. Darüber h<strong>in</strong>aus: Vznik a vývoj průmyslová<br />
oblastí. Teorie a metody výzkumu [Entstehung <strong>und</strong> Entwicklung von Industriegebieten.<br />
Theorie <strong>und</strong> Methoden der Forschung], Opava 1967; Metodologické a metodické otázky<br />
výzkumu průmyslových oblastí za kapitalismu [Methodologische <strong>und</strong> methodische Fragen<br />
der Erforschung der Industriegebiete während des Kapitalismus], Opava 1981; JIŘÍ MATĚJ-<br />
ČEK: Pokus o klasifikaci a periodizaci vývoje uhelných a železářských oblastí v českých<br />
zemích do stabilizace jejich odvětvové struktury [Versuch e<strong>in</strong>er Klassifikation <strong>und</strong> Periodisierung<br />
der Entwicklung der Kohlen- <strong>und</strong> Erzreviere <strong>in</strong> den böhmischen Ländern bis zur<br />
Stabilisierung ihrer Branchenstruktur], <strong>in</strong>: Slezský sborník 77 (1979), S. 211-221.<br />
115
tenden Agglomerationen, wie sie sich andernorts <strong>im</strong> Gebiet von Aachen-Maastricht,<br />
<strong>im</strong> Saargebiet oder <strong>im</strong> Dreiländereck Basel-Weil-Lörrach herausgebildet haben.<br />
Wenn man die Bevölkerungsdichte beiderseits der Grenze betrachtet, was bedauerlicherweise<br />
die meisten tschechischen <strong>und</strong> deutschen thematischen Karten aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer E<strong>in</strong>schränkung auf das jeweilige Staatsgebiet nicht erlauben, zeigt sich, daß der<br />
direkte böhmische Grenzsaum meist beiderseits bevölkerungsarm war <strong>und</strong> ist. 64 Die<br />
niedrige Siedlungsdichte <strong>in</strong> Grenznähe verh<strong>in</strong>derte zudem e<strong>in</strong> ausgeprägteres System<br />
von Arbeitsmigration <strong>und</strong> Pendlerwesen, was <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e vergleichsweise schwache<br />
grenzüberschreitende Dynamik bed<strong>in</strong>gte. Selbst <strong>in</strong> Fällen, wo ökonomisch <strong>und</strong><br />
siedlungsmäßig dynamischere Teilregionen bis an die böhmische Grenzl<strong>in</strong>ie heranreichen<br />
– <strong>im</strong> Bereich von Teplitz (Teplice) auf böhmischer Seite oder bei Annaberg-<br />
Buchholz auf sächsischer Seite –, greifen diese dann nicht <strong>in</strong> derselben Qualität über<br />
die Grenze h<strong>in</strong>aus. 65 Das Dichtegefälle an der Grenze ist genau <strong>in</strong> diesen Abschnitten<br />
besonders markant. Die Grenze trennte gerade dort Gebiete unterschiedlichen Verdichtungsgrades.<br />
E<strong>in</strong>e Ausnahme bildet das zeitweise hoch entwickelte Textilgebiet von Rumburg,<br />
Schluckenau <strong>und</strong> Warnsdorf sowie das Industriegebiet von Friedland, die <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert mit den angrenzenden sächsischen Gebieten h<strong>in</strong>sichtlich Bevölkerungsdichte<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftsstruktur vergleichbar waren <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der traditionell<br />
hohen Quote wechselseitiger Arbeitsmigration grenzüberschreitende E<strong>in</strong>zugsbereiche<br />
aufwiesen. 66 Vor allem „<strong>im</strong> Bereich zwischen Friedland <strong>und</strong> oberer Iser hatte sich auf<br />
der Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>es alten Siedlungsnetzes mit ausgebildeten zentralen Funktionen<br />
seit der 2. Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts e<strong>in</strong> relativ dichtes System kle<strong>in</strong>erer <strong>und</strong> mittlerer<br />
Industriezentren herausgebildet, die <strong>im</strong> engeren Bereich von Neiße <strong>und</strong> oberer Iser<br />
zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dustriellen Verdichtungszone zusammenwuchsen“, die sowohl mit der<br />
Lausitz als auch mit der Reichenberger Industrieregion <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung stand. 67 Diese<br />
grenzüberschreitende sozioökonomische Masse bed<strong>in</strong>gte gerade die grenzgeschichtlich<br />
labile Lage dieser Gebiete <strong>im</strong> frühen <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert. Für die beiden nordböhmischen<br />
grenznahen Verdichtungzonen kommt h<strong>in</strong>zu, daß sie von den nächst gelegenen<br />
böhmischen Siedlungs- <strong>und</strong> Wirtschaftszentren durch bevölkerungsarme <strong>und</strong> wirtschaftlich<br />
schwache Zwischenzonen getrennt waren. 68 Der Zusammenhang zwischen<br />
prekärer territorialer Zugehörigkeit e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> grenzüberschreitend hoher Bevölkerungskonzentration<br />
<strong>und</strong> besonders entwickelter Wirtschaftsstrukturen sowie e<strong>in</strong>er<br />
Absonderung vom Landes<strong>in</strong>neren durch e<strong>in</strong>e dazwischen liegende schwächere kul-<br />
64 Dies gilt, wie gesagt, auch schon für die Zeit vor der Vertreibung <strong>und</strong> Aussiedlung der<br />
Deutschen, wodurch auf böhmischer Seite das Phänomen aber noch verstärkt wurde. Vgl.<br />
z.B. Atlas Republiky československé (wie Anm. 22), Karte 16 (Hustota obyvatelstva).<br />
65 FÖRSTER: Nordböhmen (wie Anm. 62), S. 179 Abb. 34: Verstädterungszonen Nordböhmens;<br />
S. 182 Abb. 36: Funktionale Siedlungszonen Nordböhmens.<br />
66 Ausführlicher für das Böhmische Niederland FÖRSTER: Nordböhmen (wie Anm. 62), S. 90-<br />
92; JAHN-LANGEN: Das Böhmische Niederland (wie Anm. 33).<br />
67 FÖRSTER: Nordböhmen (wie Anm. 62), S. 93.<br />
68 Ebenda, S. 96-98 mit Abb. 14: Sozioökonomische Raume<strong>in</strong>heiten Nordböhmens vor 1945.<br />
116
turgeographische Zone andererseits trifft gleichermaßen für das Ascher Ländchen, für<br />
das Glatz benachbarte Nachod oder für České Velenice, den ehemaligen Gmünder<br />
Vorort, zu. 69<br />
Es stellt sich daher die Frage, <strong>in</strong>wieweit e<strong>in</strong>e Konzentration von Wirtschaftsgütern,<br />
Bodenschätzen, Verkehrsknotenpunkten, Handels-, Siedlungs- <strong>und</strong> Migrationszentren<br />
an oder auf der Grenze die historische Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit erhöhen, daß e<strong>in</strong>e<br />
Grenze – über längere Zeiten betrachtet – eher zur Instabilität neigt. Auch wenn das<br />
angeführte Beispiel der über Jahrh<strong>und</strong>erte stabilen böhmischen <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> die Fälle<br />
geplanter <strong>und</strong> realisierter kle<strong>in</strong>räumiger Grenzänderungen diese Überlegung bereits<br />
plausibel ersche<strong>in</strong>en lassen, soll aus dem tschechoslowakischen Bereich noch e<strong>in</strong> anderes<br />
Beispiel kurz vorgestellt werden.<br />
Grenzfluktuation <strong>und</strong> kulturgeographische Verdichtung: das Beispiel Teschen/<br />
Oberschlesien<br />
Das komplexeste Grenzproblem für die drei böhmischen Länder bzw. den westlichen<br />
Teil der Tschechoslowakei war <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert die Teschen-Frage. Zwischen<br />
1918 <strong>und</strong> den fünfziger Jahren blieb die Grenzziehung <strong>im</strong> weiteren Oberschlesien mit<br />
den Eckpunkten Ratibor, Bielitz (Bílsko, Bielsko-Biała) <strong>und</strong> Ostrau (Ostrava) zwischen<br />
den Anra<strong>in</strong>erstaaten umstritten. Die Ause<strong>in</strong>andersetzungen um das Gebiet von<br />
Teschen (Těšín, Cieszyn) führte 1919 <strong>und</strong> 1938 zwischen der Tschechoslowakei <strong>und</strong><br />
Polen sogar zu mehreren militärischen Konflikten. Bis heute werden die Ause<strong>in</strong>andersetzungen<br />
um das Teschener Gebiet <strong>in</strong> beiden Staaten, aber auch <strong>in</strong> Deutschland häufig<br />
als vorwiegend nationaler Konflikt <strong>in</strong>terpretiert. Die Historiographie neigt noch<br />
<strong>im</strong>mer dazu, das ethnische, sprachnationale <strong>und</strong> nationalpolitische Bekenntnis der Bevölkerung<br />
<strong>in</strong> diesem mehrsprachigen, multiethnischen <strong>und</strong> mehrkonfessionellen Gebiet<br />
als Angelpunkt des Konflikts <strong>und</strong> als Maßstab für „richtige“ Grenzziehungen anzusehen.<br />
70<br />
Betrachtet man die politische Entwicklung <strong>in</strong> diesem Raum, so ist zu berücksichtigen,<br />
daß Schlesien anders als Böhmen niemals zu e<strong>in</strong>em homogenen Territorialstaat<br />
69 Vgl. u.a. die Karten zur Bevölkerungsdichte <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert z.B. <strong>in</strong>: Diercke Weltatlas,<br />
2. Aufl. Braunschweig 1991, S. 71; Atlas Republiky československé (wie Anm. 22), Karte<br />
16 (Hustota obyvatelstva).<br />
70 JAROSLAV VALENTA: Die Teschener Frage <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit 1918-1939, <strong>in</strong>: Polen<br />
<strong>und</strong> die böhmischen Länder <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, hrsg. von PETER HEUMOS, München<br />
1997 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um, Bd. 17), S. 129-150, mit<br />
H<strong>in</strong>weisen auf die entsprechend argumentierende tschechische <strong>und</strong> polnische Literatur<br />
DERS.: Česko-Polské vztahy v letech 1918-19<strong>20</strong> a Těšínské Slezsko [Die tschechischpolnischen<br />
Beziehungen <strong>in</strong> den Jahren 1918-19<strong>20</strong> <strong>und</strong> das Teschener Schlesien], Ostrava<br />
1961. – Aus polnischem bzw. aus deutschnationalem Blickw<strong>in</strong>kel folgen dieser Sichtweise<br />
die materialreichen Bände von FRANCISZEK SZYMICZEK: Walka o Śląsk Cieszyński w latach<br />
1914-19<strong>20</strong> [Der Kampf um das Teschener Schlesien <strong>in</strong> den Jahren 1914-19<strong>20</strong>], Katowice<br />
1938, <strong>und</strong> von KURT WITT: Die Teschener Frage, Berl<strong>in</strong> 1935.<br />
117
wurde, sondern daß die Landesstruktur durch die sich behauptenden starken mediären<br />
Herrschaftsebenen von e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>neren gebietsmäßigen Zersplitterung <strong>in</strong> Fürstentümer<br />
<strong>und</strong> M<strong>in</strong>derstandesherrschaften mit zahlreichen Enklaven gekennzeichnet war. Im<br />
österreichischen Herzogtum Teschen, dessen Nordgrenze seit der preußisch-österreichischen<br />
Teilung von 1742 Staatsgrenze war, brach die Grenzfrage 1918 <strong>in</strong> dem<br />
Moment auf, als die Herrschaftskont<strong>in</strong>uität nach e<strong>in</strong>er Phase rasanten wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> bevölkerungsmäßigen Wachstums <strong>und</strong> Strukturwandels mit der Absetzung der<br />
habsburgischen Seitenl<strong>in</strong>ie <strong>und</strong> dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen<br />
Doppelmonarchie endete. Anders als <strong>im</strong> Falle Böhmens wurde damit der ebenfalls<br />
sehr alte <strong>und</strong> über Jahrh<strong>und</strong>erte stabile Grenzverlauf des Herzogtums gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>in</strong><br />
Frage gestellt. Direkt nach der Auflösung der Donaumonarchie resultierte aus der polnischen<br />
Besetzung e<strong>in</strong>es Großteils des Gebietes am 5. November 1918 e<strong>in</strong>e Demarkationsl<strong>in</strong>ie,<br />
die ungefähr <strong>in</strong> der Mitte zwischen der alten mährisch-schlesischen Grenze<br />
<strong>und</strong> der Olsa verlief <strong>und</strong> die etwa drei Viertel des alten Herzogtums mit Teschen,<br />
Karw<strong>in</strong> (Karv<strong>in</strong>á), Freistadt (Fryštát) <strong>und</strong> Oderberg ([Nový] Bohumín) unter polnische<br />
Kontrolle brachte. Infolge e<strong>in</strong>es wenige Tage dauernden Krieges <strong>in</strong> den letzten<br />
Januartagen des Jahres 1919, bei dem tschechoslowakische Truppen das Areal bis zur<br />
Weichsel besetzten, kam es am 3. Februar 1919 auf Druck der Alliierten zu e<strong>in</strong>er neuen<br />
Demarkationsl<strong>in</strong>ie, die meist dem Lauf der Olsa folgend das Teschener Herzogtum<br />
<strong>in</strong> ungefähr zwei gleich große Teile zerschnitt.<br />
Die Teschen-Frage galt auf den Pariser Friedensverhandlungen als besonders<br />
schwieriges Thema. Zusätzlich zu den zeitweise realisierten Demarkationsl<strong>in</strong>ien wurden<br />
zahlreiche weitere Grenzl<strong>in</strong>ien erörtert. 71 Zwischen Oktober 1919 <strong>und</strong> Sommer<br />
19<strong>20</strong> bestand e<strong>in</strong>e neutrale Zone, die ungefähr das Gebiet zwischen den beiden Demarkationsl<strong>in</strong>ien<br />
von 1918 <strong>und</strong> 1919 umschloß <strong>und</strong> <strong>im</strong> Süden noch weiter nach Osten<br />
reichte. In diesem Gebiet sollte die dort stationierte alliierte Kontroll- <strong>und</strong> Verwaltungskommission<br />
e<strong>in</strong>e Volksabst<strong>im</strong>mung vorbereiten, zu der es aber nicht kam. Mit<br />
dem Pariser Botschafterbeschluß vom 28. Juli 19<strong>20</strong> wurde e<strong>in</strong>e wiederum leicht modifizierte<br />
Grenzl<strong>in</strong>ie zwischen der Tschechoslowakei <strong>und</strong> Polen vere<strong>in</strong>bart, ohne daß<br />
der Grenzverlauf völkerrechtlich abschließend geregelt worden wäre. Damit fielen<br />
knapp 1300 qkm des ca. 2300 qkm großen böhmisch-schlesischen Herzogtums an die<br />
ČSR. Auch wenn der vere<strong>in</strong>barte Grenzverlauf bis 1938 unverändert blieb, wurde er<br />
von beiden Staaten formal nicht bestätigt. Die <strong>im</strong> Oktober 1938 von polnischer Seite<br />
erfolgte Okkupation führte wiederum zu e<strong>in</strong>er neuen Grenzl<strong>in</strong>ie, die Oderberg e<strong>in</strong>schließend<br />
zum Teil noch westlich der ersten Demarkationsl<strong>in</strong>ie vom November 1918<br />
verlief. 72 Während des Krieges gab es wiederholt Vorstöße zu e<strong>in</strong>er erneuten Neu-<br />
71 PERMAN (wie Anm. 8), S. 228-275: The Teschen Dispute; The Unf<strong>in</strong>ished Bus<strong>in</strong>ess. – JU-<br />
LES LAROCHE: La question de Teschen devant la conférence de la Paix 1919-19<strong>20</strong>, <strong>in</strong>: Revue<br />
d'histoire diplomatique 62 (1948), S. 8-27.<br />
72 Die zahlreichen Grenzl<strong>in</strong>ien zwischen 1918 <strong>und</strong> 1945 f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Karte vollständig<br />
verzeichnet. Am <strong>in</strong>formativsten ALFRED BOHMANN: Die tschechoslowakischen Gebietsabtretungen<br />
an Polen <strong>und</strong> Ungarn 1938/39, <strong>in</strong>: ZfO <strong>20</strong> (1971), S. 465-496, hier S. 474<br />
<strong>und</strong> Karte 2: „Das Olsa-Gebiet“ zwischen S. 474/475; KLIMKO (wie Anm. 8), S. 34-39,<br />
118
gliederung des Ostrau-Karw<strong>in</strong>er Reviers. 73 Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde<br />
der Grenzverlauf von 1921 <strong>in</strong> den polnisch-tschechoslowakischen Abkommen von<br />
1947 bzw. 1958 def<strong>in</strong>itiv anerkannt. 74<br />
Im Zusammenhang mit dem tschechischen Anspruch auf das Teschener Gebiet<br />
standen 1919 Forderungen nach dem Anschluß des oberschlesischen Gebietes um Ratibor<br />
an die ČSR. 75 Obwohl die Pariser Friedenskonferenzen diesen Anspruch <strong>in</strong>sgesamt<br />
verwarfen, wechselte aufgr<strong>und</strong> des Versailler Friedensvertrags mit dem Hultsch<strong>in</strong>er<br />
Ländchen (Hlučínsko), das <strong>in</strong> früheren Zeiten zum Fürstentum Troppau gehört<br />
hatte, e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er Teil des geforderten Gebiets <strong>im</strong> Januar 19<strong>20</strong> von Deutschland<br />
an die Tschechoslowakei. 76 Mit mehr als 300 qkm war das Hultsch<strong>in</strong>er Ländchen, das<br />
von den Städten Troppau (Opava), Ostrau <strong>und</strong> Oderberg begrenzt wurde, etwa doppelt<br />
so groß wie die beiden anderen, zuvor nicht zu den böhmischen Ländern gehörenden<br />
Gebietsanschlüsse von 1919/<strong>20</strong> zusammen, die von Niederösterreich abgetrennten<br />
Gebiete um České Velenice <strong>und</strong> um Feldsberg. 1938 wurde das Hultsch<strong>in</strong>er<br />
Gebiet an Preußen zurückgegliedert, 1945 dann der Grenzverlauf von 19<strong>20</strong> wieder<br />
hergestellt.<br />
Karte S. 151; OTAKAR KÁŇA, RYSZARD PAVELKA: Těšínsko v polsko-československých<br />
vztazích 1918-1939 [Das Teschner Gebiet <strong>in</strong> den polnisch-tschechoslowakischen Beziehungen<br />
1918-1939], Ostrava 1970, <strong>in</strong>sb. Karte zwischen S. 240/241; JAROSLAV VALENTA:<br />
Vyvrcholení národně osvobozeneckého hnutí a utvoření samostatných států (1918-19<strong>20</strong>)<br />
[Der Höhepunkt der nationalen Befreiungsbewegung <strong>und</strong> die Bildung unabhängiger Staaten<br />
(1918-19<strong>20</strong>)], <strong>in</strong>: Češi a Poláci v m<strong>in</strong>ulosti [Tschechen <strong>und</strong> Polen <strong>in</strong> der Vergangenheit],<br />
Bd. 2, hrsg. von VÁCLAV ŽÁČEK, Praha 1967, S. 431-480, Karte zwischen S.<br />
432/433. – Vgl. auch Mémoire No. 4: Le problème de la Silésie de Teschen <strong>und</strong> No 4a:<br />
Memorandum sur la situation en Silésie, <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie<br />
Anm. 7), S. 110-157; WITT (wie Anm. 70), pass<strong>im</strong> <strong>und</strong> Karte S. 174 [dort fehlerhaft „Demarkationsl<strong>in</strong>ie<br />
vom 5. Sept. 1918“ statt 5. Nov. 1918].<br />
73 Dazu auch neuerd<strong>in</strong>gs RALF GEBEL: „He<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“. Konrad Henle<strong>in</strong> <strong>und</strong> der Reichsgau<br />
Sudetenland 1938-1945, München 1999 (Veröffentlichungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um,<br />
Bd. 83), S. 338 f.; VOLKER ZIMMERMANN: Die Sudetendeutschen <strong>im</strong> NS-Staat. Politik <strong>und</strong><br />
St<strong>im</strong>mung der Bevölkerung <strong>im</strong> Reichsgau Sudetenland (1938-1945), Essen 1999 (Veröffentlichungen<br />
der Deutsch-Tschechischen <strong>und</strong> Deutsch-Slowakischen Historikerkommission,<br />
Bd. 9), S. 285-287.<br />
74 VALENTA: Die Teschener Frage (wie Anm. 70), S. 150; DUŠAN JANÁK: Spor o slezské pohraničí<br />
v letech 1945-1947 [Der Streit um das schlesische Grenzgebiet <strong>in</strong> den Jahren 1945-<br />
1947], <strong>in</strong>: Střední Evropa 8 (1993), Nr. 27, S. 79-84.<br />
75 Vgl. auch Mémoire No. 8: La Haute Silesie Tchéque (Région de Ratibor), <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen<br />
Denkschriften (wie Anm. 7), S. 256-265.<br />
76 Aus deutscher <strong>und</strong> tschechischer Sicht mit Rechtfertigungscharakter: Das Hultsch<strong>in</strong>er<br />
Ländchen <strong>im</strong> Versailler Friedensvertrag, hrsg. von EBERHARD BOLLACHER, Stuttgart 1930;<br />
JAROSLAV VALENTA: Přípojení Hlučínska k Československé republice [Die Angliederung<br />
des Hultsch<strong>in</strong>er Ländchens an die Tschechoslowakei], <strong>in</strong>: Slezský sborník 58 (1960), S. 1-<br />
18.<br />
119
Sowohl <strong>im</strong> Teschener als auch <strong>im</strong> Hultsch<strong>in</strong>er Gebiet kam es zu völlig neuen<br />
Grenzziehungen. 77 In beiden Fällen hatten zudem für Jahrh<strong>und</strong>erte die politische <strong>und</strong><br />
die kirchliche Zugehörigkeit nicht übere<strong>in</strong>gest<strong>im</strong>mt. Das seit der Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
preußisch-schlesische Hultsch<strong>in</strong>er Ländchen hatte stets zur mährischen Diözese<br />
Olmütz gehört, während Teschen dem Bistum Breslau zugeordnet gewesen<br />
war. Erst 1972 sollte e<strong>in</strong>e kirchliche Gebietsreform Diözesan- <strong>und</strong> Staatsgrenzen <strong>in</strong><br />
Oberschlesien zur Deckung br<strong>in</strong>gen. Obwohl <strong>in</strong> den Ause<strong>in</strong>andersetzungen um die<br />
Gebiete von Teschen, Ostrau <strong>und</strong> Ratibor zwischen 1918 <strong>und</strong> 1947 von verschiedenen<br />
Seiten ethnographische <strong>und</strong> sprachlich-nationale Argumente <strong>in</strong>s Feld geführt <strong>und</strong><br />
mehrfach Volksabst<strong>im</strong>mungen vorgesehen wurden, läßt sich pr<strong>in</strong>zipiell ke<strong>in</strong>er der<br />
vorgeschlagenen oder realisierten Grenzverläufe mit den L<strong>in</strong>ien von Sprachen- <strong>und</strong><br />
Nationalitätenkarten <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung br<strong>in</strong>gen. 78 Kompliziert wurde die Angelegenheit<br />
dadurch, daß <strong>in</strong> dem mehrsprachigen Gebiet neben den drei Nationalsprachen<br />
Tschechisch, Deutsch <strong>und</strong> Polnisch mit dem „wasserpolakisch“ genannten Schlonsakischen<br />
<strong>und</strong> mit dem Hultsch<strong>in</strong>er Mährischen noch besondere Mischdialekte mit eigenständigen<br />
politischen Identitätsmustern verbreitet waren.<br />
Wesentlicher Streitpunkt <strong>in</strong> der Region um Ostrau, Teschen <strong>und</strong> Hultsch<strong>in</strong> waren<br />
seit 1918 die wirtschaftlichen <strong>und</strong> verkehrstechnischen Gegebenheiten. Vor allem das<br />
Gebiet zwischen Oderberg, Ostrau <strong>und</strong> der Olsa, das sogenannte Ostrau-Karw<strong>in</strong>er-<br />
Revier, war von Kohle <strong>und</strong> Stahl sowie dem Schnittpunkt europäischer Fernverkehrswege<br />
geprägt. Seit dem frühen <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert war es <strong>in</strong> dieser zuvor wirtschaftlich<br />
unterdurchschnittlich entwickelten Gegend zu e<strong>in</strong>em geradezu explodierenden<br />
Wirtschaftsaufschwung gekommen. Im Zusammenhang mit den ertragreichen Kohlengruben<br />
war <strong>in</strong> Mährisch Ostrau <strong>und</strong> östlich davon das bedeutendste Montan<strong>in</strong>dustriezentrum<br />
der Habsburgermonarchie entstanden. In Oderberg bestand e<strong>in</strong>er der<br />
größten Verschiebebahnhöfe Europas, <strong>in</strong> dem die Güterverkehrsstrecken von Prag,<br />
Wien bzw. Brünn (Brno), Budapest, Breslau bzw. Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Krakau bzw. Lemberg<br />
77 Dies bedurfte auch politischer Rechtfertigungen. So nahm der tschechoslowakische Außenm<strong>in</strong>ister<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Sammlung außenpolitischer Gr<strong>und</strong>satzerklärungen auch se<strong>in</strong>e parlamentarische<br />
Rede „Boj o Těšínsko: Jak a proč došlo k rozdělení Těšínska“ (Der Kampf ums Teschener<br />
Gebiet: Wie <strong>und</strong> warum es zur Teilung des Teschener Landes kam) vom 4. August<br />
19<strong>20</strong> auf; EDVARD BENEŠ: Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá<br />
[Probleme des Neuen Europas <strong>und</strong> die tschechoslowakische Außenpolitik], Praha 1924, S.<br />
61-82. – Dazu u.a. auch KOLOMAN GAJAN: Masaryk, Beneš <strong>und</strong> Kramář <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>flußnahme<br />
auf die Gestaltung der Friedensverträge, <strong>in</strong>: Versailles – St. Germa<strong>in</strong> – Trianon.<br />
Umbruch <strong>in</strong> Europa vor fünfzig Jahren, hrsg. von KARL BOSL, München, Wien 1971, S.<br />
25-36, hier S. 31 <strong>und</strong> 35.<br />
78 Z.B. auch nicht die auf den Pariser Konferenzen 1919 erörterte Tissi-L<strong>in</strong>ie westlich der Olsa;<br />
WITT (wie Anm. 70), S. 138 <strong>und</strong> Karte S. 174. – Nationale Ansprüche unterstreicht<br />
auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg die Schrift von JAN RATIBOŘSKÝ: Češi na Ratibořsku<br />
a Hlubčicku. Hornoslezská Haná [Die Tschechen <strong>im</strong> Gebiet von Ratibor <strong>und</strong> Leobschütz.<br />
Die oberschlesische Hanna], Praha 1946.<br />
1<strong>20</strong>
(L’viv, Lwów) sich kreuzten. 79 Diese nordmährisch-ostschlesische Region entwickelte<br />
sich – nach Wien – zu e<strong>in</strong>em der wichtigsten Migrationszentren <strong>in</strong> der Donaumonarchie,<br />
das vor allem Menschen aus Galizien, aber auch aus Mähren <strong>und</strong> Ungarn anzog.<br />
Diese sozioökonomische <strong>und</strong> kulturlandschaftliche Dynamik <strong>und</strong> die daraus resultierende<br />
grenzüberschreitende Verdichtung – <strong>und</strong> nicht so sehr die Sprachen- oder<br />
Nationalitätenfrage – untergruben die Stabilität der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> dieser Region. Das<br />
verdeutlicht besonders die Tatsache, daß die verschiedenen konzipierten <strong>und</strong> praktizierten<br />
Demarkations- <strong>und</strong> Grenzl<strong>in</strong>ien der Jahre 1918 bis 19<strong>20</strong> bzw. von 1938/39 nur<br />
den an Bodenschätzen, Bevölkerung, Industrie <strong>und</strong> Verkehrswegen stark verdichteten<br />
westlichen bzw. nordwestlichen Teil des alten Herzogtums Teschen <strong>und</strong> des angrenzenden<br />
Ostrauer Gebietes durchschnitten. Der von Landwirtschaft <strong>und</strong> Textil<strong>in</strong>dustrie<br />
geprägte östliche Teil Teschens stand bei Neugliederungsüberlegungen selten zur<br />
Diskussion. 80 Kurzzeitig wurde 1919 sogar erwogen, das Teschener Herzogtum zusammen<br />
mit dem Ostrauer Gebiet politisch zu verselbständigen. 81 Ähnlich der völkerrechtlichen<br />
Anerkennung der luxemburgischen Souveränität 1866, der Sonderstellung<br />
Danzigs nach 19<strong>20</strong> oder des <strong>in</strong>ternationalen Sonderstatuts von Triest 1947 wäre so<br />
e<strong>in</strong>e weitere h<strong>in</strong>sichtlich Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft hochverdichtete Region durch<br />
e<strong>in</strong>e völkerrechtliche Verselbständigung den Integrationsbestrebungen zweier bzw.<br />
dreier rivalisierender Anra<strong>in</strong>erstaaten entzogen worden.<br />
In den Ause<strong>in</strong>andersetzungen um die <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Teschener <strong>und</strong> <strong>im</strong> oberschlesischen<br />
Bereich g<strong>in</strong>g es letztendlich um die Nutzung <strong>und</strong> Kontrolle von Wirtschaftskraft,<br />
Bevölkerung <strong>und</strong> Verkehrswegen. Ethnographische oder sprachnationale<br />
Aspekte waren nachrangig, fast ohne Bedeutung waren ebenfalls militärisch-strategische,<br />
historische oder naturräumliche Gesichtspunkte. Entscheidend für den 19<strong>20</strong><br />
festgelegten Grenzverlauf war beispielsweise die Absicht, die auf dem l<strong>in</strong>ksseitigen<br />
Olsaufer verlaufende überregionale Bahnl<strong>in</strong>ie, die sogenannte Kaschau-Oderberg-<br />
Bahn, der Tschechoslowakei zuzusprechen, <strong>und</strong> nicht pr<strong>im</strong>är, den Fluß als Trennl<strong>in</strong>ie<br />
zu nutzen. Auch der Anschluß des Hultsch<strong>in</strong>er Ländchens an die ČSR muß <strong>in</strong> diesen<br />
Zusammenhang e<strong>in</strong>geordnet werden, da damit die damals noch nicht erschlossenen<br />
Ausläufer des Ostrau-Karw<strong>in</strong>er-Kohlenreviers westlich der Oder <strong>in</strong> die Industrieregion<br />
<strong>in</strong>tegriert wurden. Außerdem verschob sich damit die Situierung Ostraus von der<br />
79 Vgl. u.a. WITT (wie Anm. 70), S. 61 mit e<strong>in</strong>er Karte zur Schlüsselstellung des Dreiecks von<br />
Teschen-Ostrau-Oderberg <strong>im</strong> ostmitteleuropäischen Eisenbahnsystem.<br />
80 Vgl. Anm. 70. – Karten zur Verdichtung von Besiedlung <strong>und</strong> Bevölkerung zu Bodenschätzen<br />
<strong>und</strong> Industrie u.a. Atlas Republiky československé (wie Anm. 22), Karte 16 (Hustota<br />
obyvatelstva), Karte 7 (Nerostné bohatství) <strong>und</strong> die verschiedenen Industriekarten; SPER-<br />
LING: Tschechoslowakei (wie Anm. 19), S. 105 Abb. 24; S. 253 Abb. 56-58; WITT (wie<br />
Anm. 70), Karten S. 40 <strong>und</strong> 229. – Westschlesien (Tschechoslowakei). E<strong>in</strong>e anthropologische<br />
Studie mit e<strong>in</strong>em Atlas, Bd. 1: ROBERT SOBOTIK: Raum <strong>und</strong> Bevölkerung, Prag 1930.<br />
81 Das ostmährisch-schlesische Industriegebiet (M. Ostrau-Teschen-Bielitz) e<strong>in</strong>e selbständige,<br />
neutrale Republik!, Wien 1919; WITT (wie Anm. 70), S. 128-130; PERMAN (wie Anm.<br />
8), u.a. S. 230 f.<br />
121
alten Grenz- zu e<strong>in</strong>er zentraleren B<strong>in</strong>nenlage. Die dynamische, aber angesichts des<br />
Kohlenabbaus räumlich beengte Agglomeration konnte auf diese Weise ihr H<strong>in</strong>terland<br />
erweitern. Ethnisch-nationale Überlegungen spielten generell nur e<strong>in</strong>e nachgeordnete<br />
Rolle. So wurden mit den Grenzziehungen von Teschen <strong>und</strong> Hultsch<strong>in</strong> dom<strong>in</strong>ant<br />
polnisch- oder deutschsprachige Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Grenznähe ebenfalls <strong>in</strong> die<br />
Tschechoslowakei e<strong>in</strong>gegliedert, andererseits verblieben <strong>in</strong> der Gegend von Leobschütz<br />
(Głubczyce, Hlubčice) <strong>und</strong> Ratibor tschechischsprachige Ortschaften bei<br />
Deutschland, wie bei allen Unterschieden <strong>im</strong> Detail die unzähligen Nationalitäten-<br />
<strong>und</strong> Sprachenstatistiken oder entsprechende deutsche, polnische oder tschechische<br />
Karten für diese Region belegen. 82<br />
Das Beispiel der Industrieregion Teschen/Oberschlesien zeigt ebenso wie die gesamte<br />
Entwicklung der böhmischen <strong>Grenzen</strong>, daß allgeme<strong>in</strong>, vor allem aber nach dem<br />
Ersten Weltkrieg die konkreten Grenzfestlegungen allen nationalen <strong>und</strong> ethnischen<br />
Diskursen zum Trotz von ökonomischen <strong>und</strong> verkehrstechnischen Gesichtspunkten<br />
best<strong>im</strong>mt waren. Während die auf politischen <strong>und</strong> nationalen Vorgaben beruhende<br />
Gründung neuer Staaten <strong>und</strong> die Umwandlung von Verwaltungsgrenzen zu Staatsgrenzen<br />
nach 1918 unabhängig von ökonomischen <strong>und</strong> verkehrsgeographischen Kriterien<br />
erfolgte, überwogen bei der kle<strong>in</strong>räumigen Grenzziehung wirtschaftliche <strong>und</strong><br />
kulturgeographische Überlegungen <strong>und</strong> diese setzten sich, quasi kompensatorisch,<br />
gegenüber allen ethnischen <strong>und</strong> sprachnationalen Forderungen durch. Die Breite der<br />
Diskussionen über ethnographische, sprachlich-nationale <strong>und</strong> kulturell-politische Zugehörigkeit<br />
von Bevölkerungsgruppen <strong>und</strong> Landstrichen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> die ger<strong>in</strong>ge<br />
allgeme<strong>in</strong>e Aufmerksamkeit für wirtschaftlich-verkehrstechnische Kriterien andererseits<br />
stehen <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umgekehrten Verhältnis zu ihrer Wirkungskraft<br />
auf Grenzverläufe.<br />
Je schwächer die klassischen kulturgeographischen Faktoren (Siedlungsdichte,<br />
Verkehrsnetz, Bodenschätze <strong>und</strong> Industrie) kle<strong>in</strong>räumlich ausgeprägt waren, um so<br />
eher tendierten – zum<strong>in</strong>dest soweit es sich für die <strong>Grenzen</strong> der böhmischen Länder sagen<br />
läßt – die politisch entscheidenden Kräfte dazu, den bestehenden Grenzverlauf<br />
völlig unverändert zu lassen. 83 Gilt allgeme<strong>in</strong>, daß e<strong>in</strong> Grenzverlauf dann am besten<br />
ist, „wenn er den Lebensansprüchen der Bevölkerung auf beiden Seiten weitestgehend<br />
entspricht“, 84 so boten die <strong>in</strong>sgesamt nur wenig verdichteten Grenzzonen den<br />
82 U.a. RATIBOŘSKÝ (wie Anm. 78); Das Hultsch<strong>in</strong>er Ländchen (wie Anm. 76). – Weitere Literatur<br />
zu den e<strong>in</strong>zelnen Orten siehe: Handbuch der Historischen Stätten. Schlesien (wie<br />
Anm. 29).<br />
83 Auf die grenzformende Kraft von Wirtschaftsräumen wiesen, wenn auch <strong>im</strong> böhmischen<br />
Fall nicht gerade mit überzeugenden Argumenten, bereits OSKAR SCHWARZER / MARKUS<br />
A. DENZEL: Wirtschaftsräume <strong>und</strong> die Entstehung von <strong>Grenzen</strong>. Versuch e<strong>in</strong>es historischsystematischen<br />
Ansatzes, <strong>in</strong>: Sozialwissenschaftliche Informationen <strong>20</strong> (1991), Heft 3, S.<br />
172-178, h<strong>in</strong>.<br />
84 So die Forschung zusammenfassend WILFRIED HELLER: Politische <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzräume<br />
aus anthropogeographischer Sicht, <strong>in</strong>: Grenzland. Beiträge zur Geschichte der<br />
deutsch-deutschen Grenze, hrsg. von BERND WEISBROD, Hannover 1993 (Veröffentlichun-<br />
122
eteiligten Akteuren kaum Anlaß, Grenzverschiebungen anzustreben. Andererseits<br />
ließ jede neue Grenzziehung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em hochverdichteten Gebiet Ungleichheiten entstehen,<br />
die zu e<strong>in</strong>em Faktor künftiger Instabilität der Grenze werden konnten. Nachgeordnete<br />
kulturgeographische Elemente wie Mehrheitssprache, nationales Bekenntnis<br />
<strong>und</strong> Konfession waren bei den Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg höchstens<br />
von sek<strong>und</strong>ärer Bedeutung. So wurden nach 1918 meist auch nur dort Volksabst<strong>im</strong>mungen<br />
erwogen, wo e<strong>in</strong>e Neugliederung angesichts der Wirtschaftsstruktur <strong>und</strong> der<br />
Verkehrsverb<strong>in</strong>dungen s<strong>in</strong>nvoll erschien. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e wurden bei den Pariser<br />
Friedenskonferenzen beispielsweise nur für den Rumburger <strong>und</strong> Friedländer Grenzzipfel<br />
<strong>und</strong> für oberschlesische Gebiete, aber nicht für andere deutschsprachige Gebiete<br />
Böhmens Abst<strong>im</strong>mungen der Bevölkerung über e<strong>in</strong>en Gebietswechsel vorgeschlagen.<br />
Die Praktikabilität ethnischer <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> ihre Problematik <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Im <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert ist zwe<strong>im</strong>al mit mehr oder weniger revolutionärem Anspruch der<br />
Versuch unternommen worden, Böhmen bzw. die böhmischen Länder durch völlig<br />
neue politische <strong>Grenzen</strong> aufzugliedern. Unter Berufung auf e<strong>in</strong>e angeblich unvermeidliche<br />
sprachliche <strong>und</strong> nationale Separierung der Bevölkerung <strong>und</strong> auf seit der<br />
Frühneuzeit verbreitete Vorstellungen von der notwendigen nationalen Homogenität<br />
e<strong>in</strong>es Staates wurde versucht, <strong>im</strong> Innern des alten böhmischen Herrschaftsgebiets<br />
neue Staats- bzw. Verwaltungsgrenzen zu errichten.<br />
In der Umbruchsituation am Kriegsende <strong>im</strong> Oktober <strong>und</strong> November 1918 ließ der<br />
Zerfall der Habsburgermonarchie e<strong>in</strong>e Teilung Böhmens, Mährens <strong>und</strong> Österreichisch<br />
Schlesiens zwischen den neuen Staaten Deutsch-Österreich <strong>und</strong> Tschechoslowakei<br />
kurzfristig möglich ersche<strong>in</strong>en. Doch vermochten die ad hoc gebildeten österreichischen<br />
bzw. deutschösterreichischen Landesregierungen von Deutschböhmen <strong>und</strong> Sudetenland<br />
<strong>und</strong> die neuen Regionalverwaltungen Böhmerwaldgau <strong>und</strong> Deutsch-<br />
Südmähren, die jeweils alle deutschsprachigen Geme<strong>in</strong>den zusammenfassen sollten,<br />
es nicht, zwischen Oktober <strong>und</strong> Dezember e<strong>in</strong>e geschlossene Territorialgewalt aufzubauen.<br />
Mehrere Anläufe Mitte November 1918, zwischen den sich zu Deutsch-<br />
Österreich bekennenden Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> den von der tschechoslowakischen Regierung<br />
<strong>in</strong> Prag kontrollierten Gebieten e<strong>in</strong>e Demarkationsl<strong>in</strong>ie festzulegen, scheiterten.<br />
Ebenso wenig fand die Schaffung neuer deutschösterreichischer Prov<strong>in</strong>zen <strong>in</strong>ternationale<br />
Anerkennung, <strong>und</strong> selbst die Republik Österreich sollte bald die Unterstützung<br />
derartiger Bestrebungen e<strong>in</strong>stellen.<br />
Die territoriale Abgrenzung erfolgte dabei alle<strong>in</strong> durch die Entscheidung der Lokalverwaltungen<br />
bzw. auf der Ebene der Gerichtsbezirke. Zur Ausbildung e<strong>in</strong>er faktischen<br />
Grenzl<strong>in</strong>ie kam es daher nicht, zumal <strong>in</strong> manchen Geme<strong>in</strong>den neben <strong>und</strong> zu-<br />
gen der Historischen Kommission für Niedersachsen <strong>und</strong> Bremen, Bd. 38/9), S. 173-194,<br />
hier S. 174.<br />
123
sammen mit der deutschen Verwaltung e<strong>in</strong> tschechischer Nationalausschuß tätig war.<br />
Die sozialen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> verkehrstechnischen Probleme (he<strong>im</strong>kehrende Soldaten,<br />
die zusammengebrochene Lebensmittel- <strong>und</strong> Brennstoffversorgung) ließen außerdem<br />
e<strong>in</strong>e überlokale Tätigkeit nach anderen als nationalen Kriterien vordr<strong>in</strong>glich<br />
werden, so daß auf den mittleren <strong>und</strong> unteren Verwaltungsebenen die Überschneidungen<br />
<strong>und</strong> Verknüpfungen, pragmatischen Verb<strong>in</strong>dungen <strong>und</strong> Verhandlungen gegenüber<br />
territorialen Separierungsbestrebungen überwogen. Bemerkenswert ist zudem,<br />
daß die nach Wien orientierten deutschen Landesregierungen die zwischen<br />
Deutschland <strong>und</strong> den böhmischen Ländern bestehenden <strong>Grenzen</strong> nicht <strong>in</strong> Frage stellten,<br />
sondern e<strong>in</strong>e Auflösung dieser Außengrenzen nur <strong>im</strong> Rahmen e<strong>in</strong>es Anschlusses<br />
Deutschösterreichs an das Deutsche Reich <strong>in</strong> Betracht kommen sollte. Das E<strong>in</strong>rücken<br />
tschechoslowakischer Verbände beendete das nicht e<strong>in</strong>mal zwei Monate dauernde Intermezzo<br />
<strong>und</strong> führte bereits <strong>im</strong> Dezember 1918 <strong>und</strong> Januar 1919 dazu, daß der Wirkungsbereich<br />
der zentralen Prager Verwaltungsstellen wieder bis zu den böhmischen<br />
<strong>und</strong> mährischen Landesgrenzen reichte. 85<br />
Ausgangspunkt für die seit Ende des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts von deutschböhmischer Seite<br />
angestrebte Teilung Böhmens bzw. der böhmischen Länder war das nationale Paradigma.<br />
Dieses <strong>in</strong> verschiedenen Varianten e<strong>in</strong>es durch Sprache, Abstammung <strong>und</strong><br />
Tradition def<strong>in</strong>ierten Volksverständnisses hatte das politische Denken der bürgerlichen<br />
Eliten <strong>und</strong> dann der breiteren Öffentlichkeit während der Regierungszeit Kaiser<br />
Franz Josephs zunehmend best<strong>im</strong>mt. Bereits František Palacký <strong>und</strong> Adolf Fischhof<br />
hatten auf dem Kremsierer Reichstag 1848/49 die territoriale Aufteilung der Habsburgermonarchie<br />
– <strong>und</strong> damit auch der böhmischen Länder – nach Volksstämmen angeregt,<br />
ohne dabei genaue Grenzl<strong>in</strong>ien vorzuschlagen oder Kriterien für die konkrete<br />
Festlegung solcher Grenzl<strong>in</strong>ien anzugeben. Andere Theoretiker der Nationalitätenfrage<br />
folgten ihnen dar<strong>in</strong> bis zum Ende der Donaumonarchie. 86 In den neunziger Jahren<br />
begannen Politiker <strong>und</strong> Statistiker <strong>im</strong> Zusammenhang mit Plänen für e<strong>in</strong>en deutschtschechischen<br />
„böhmischen Ausgleich“ auf der Gr<strong>und</strong>lage der Volkszählungen für<br />
Böhmen konkrete Abgrenzungen auf der Ebene der Gerichtsbezirke bzw. e<strong>in</strong>zelner<br />
Geme<strong>in</strong>den auszuarbeiten. Diese kamen dann bei der nationalen Abgrenzung der<br />
böhmischen Reichsratswahlkreise von 1906 zur Anwendung. Diese Aufteilung schuf<br />
jedoch ke<strong>in</strong> durch e<strong>in</strong>e Grenzl<strong>in</strong>ie abgeschlossenes Territorium, sondern ordnete auch<br />
räumlich nicht ane<strong>in</strong>ander grenzende Geme<strong>in</strong>den demselben Wahlkreis zu, teilte Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>deteile, wenn sich lokale M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong> best<strong>im</strong>mten Stadtvierteln<br />
konzentrierten, <strong>und</strong> konnte aufgr<strong>und</strong> der Unterscheidung von städtischen <strong>und</strong><br />
85 HANNS HAAS: Die deutsch-böhmische Frage 1918–1919 <strong>und</strong> das österreichisch-tschechoslowakische<br />
Verhältnis, <strong>in</strong>: Bohemia 13 (1972), S. 336-383; DERS.: Österreich-Ungarn als<br />
Friedensproblem. Aspekte der Friedensregelung auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie<br />
<strong>in</strong> den Jahren 1918-1918, 2 Bde., Masch. Diss. Salzburg 1968.<br />
86 Vgl. u.a. dazu das umfangreiche Material bei ROBERT A. KANN: Das Nationalitätenproblem<br />
der Habsburgermonarchie. Geschichte <strong>und</strong> Ideengehalt der nationalen Bestrebungen<br />
vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches <strong>im</strong> Jahre 1918, 2 Bde., 2. Aufl. Graz, Köln<br />
1964.<br />
124
ländlichen Wahlkreisen auch problemlos städtische oder dörfliche Sprach<strong>in</strong>seln <strong>in</strong> national<br />
e<strong>in</strong>heitliche Wahlkreise e<strong>in</strong>beziehen. 87<br />
Während die tschechische Politik <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert durch die Verb<strong>in</strong>dung des<br />
Naturrechts mit der Konzeption des Böhmischen Staatsrechts e<strong>in</strong>en nationalen Anspruch<br />
auf das gesamte Territorium der böhmischen Länder entwickelt hatte, propagierten<br />
deutschböhmische Gruppierungen um 1900 den nationalen Gedanken radikaler.<br />
Sie strebten <strong>im</strong> Interesse e<strong>in</strong>es Gesamt- oder Alldeutschtums danach, die alten<br />
staatlich-adm<strong>in</strong>istrativen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong>nerhalb der Donaumonarchie, aber auch die<br />
<strong>Grenzen</strong> zwischen Österreich-Ungarn <strong>und</strong> Deutschland, durch Staatsgrenzen entlang<br />
der Sprachgrenze zu ersetzen, um e<strong>in</strong>en ungeteilten großen <strong>in</strong>tegralen Nationalstaat<br />
zu schaffen. 88 Hatte um 1848 die großdeutsche Konzeption die böhmischen Länder<br />
noch als Ganzes Deutschland zugeordnet, so dachten Deutschnationale um 1900 an<br />
e<strong>in</strong>e neue Grenze, die ethnisch-nationale <strong>und</strong> politische Territorien zur Deckung br<strong>in</strong>gen<br />
sollte. <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> ihr Verlauf wurden mit diesen Vorstellungen von e<strong>in</strong>em ethnisch<br />
homogenen Nationalstaat zu e<strong>in</strong>er politisch-ideologischen Frage.<br />
Gr<strong>und</strong>lage für diese Positionen e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tegralen Nationalstaates war e<strong>in</strong> Wandel<br />
<strong>im</strong> politischen, nationalen <strong>und</strong> geographischen Denken seit der historischen Sattelzeit<br />
des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts. Bis <strong>in</strong>s späte <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert wurde e<strong>in</strong>e sprachlich oder ethnisch<br />
nationale Beschreibung stets nur auf Personen <strong>und</strong> <strong>Institut</strong>ionen bezogen. Erst<br />
seit der zweiten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts wurden Sprache bzw. Volkszugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> Territorium bzw. Fläche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Zusammenhang zue<strong>in</strong>ander gesetzt. Die Vorstellung,<br />
daß zwischen e<strong>in</strong>er Sprache <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em abgrenzbaren Gebiet e<strong>in</strong>e pr<strong>in</strong>zipielle<br />
Verknüpfung bestehen könnte, war dem Europa des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts noch fremd. Die<br />
Sprache bzw. Nationalität der Bevölkerung <strong>und</strong> ihre räumliche Verteilung wurden<br />
zwar seit der Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>im</strong> Rahmen der Kameralistik <strong>und</strong> der aufblühenden<br />
Statistik systematischer erfaßt, die räumliche Veranschaulichung durch entsprechende<br />
thematische Karten erfolgte aber erst gut e<strong>in</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert später. Infolge<br />
der kulturellen <strong>und</strong> nationalpolitischen Romantik <strong>und</strong> der sich entwickelnden Sprachen-<br />
<strong>und</strong> Nationalitätenkartographie kamen seit den vierziger Jahren des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
räumlich-flächige geographische Darstellungen von sprachlich def<strong>in</strong>ierten<br />
Gebieten zum Durchbruch. 89<br />
87 HEINRICH RAUCHBERG: Der nationale Besitzstand <strong>in</strong> Böhmen, 3 Bde., Leipzig 1905; DERS.:<br />
Die statistischen Unterlagen der österreichischen Wahlreform, <strong>in</strong>: Statistische Monatschrift<br />
N.F. 12 (1907), S. 229-269 <strong>und</strong> 296-319; auch als Separatum: Brünn 1907; OSKAR LENZ:<br />
E<strong>in</strong>e neue Sprachenkarte von Böhmen, <strong>in</strong>: Deutsche Arbeit 4 (1905), S. 407-409; SUZANNE<br />
G. KONIRSH: The Struggle for Power between Germans and Czechs, 1907-1911, Diss.<br />
Stanford 1952, S. 495-497.<br />
88 Z.B. die Arbeit des von Vertretern der deutschen Schutzvere<strong>in</strong>e getragenen „Zweiteilungsausschusses“<br />
für Böhmen; HARALD BACHMANN: Der deutsche Volksrat für Böhmen <strong>und</strong><br />
die deutschböhmische Parteipolitik, <strong>in</strong>: ZfO 14 (1965), S. 266-294, hier 284 f.<br />
89 In diesem S<strong>in</strong>ne auch für Westeuropa D. NORDMAN: Überlegungen zum Begriff der Grenze<br />
<strong>in</strong> Frankreich vom 16. bis zum Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts (Sektion „Grenzüberschreitungen<br />
<strong>und</strong> die Machbarkeit des Raums, 1500-1900“), <strong>in</strong>: Bericht über die 39. Versammlung<br />
deutscher Historiker <strong>in</strong> Hannover 23. bis 26. September 1992, Stuttgart 1994, S. 132-133. –<br />
125
Karten des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts zeigten <strong>im</strong> Pr<strong>in</strong>zip ke<strong>in</strong>e nationalen, ethnischen oder<br />
volksk<strong>und</strong>lichen Aspekte, sondern konzentrierten sich auf adm<strong>in</strong>istrative <strong>Grenzen</strong> der<br />
politischen oder kirchlichen Verwaltungse<strong>in</strong>heiten. Noch <strong>im</strong> Vormärz standen dem<br />
„gebildeten“ Durchschnittsbewohner der böhmischen Länder die verwaltungsmäßige<br />
Unterteilung <strong>und</strong> die Diözesangrenzen se<strong>in</strong>es Landes eher vor Augen als nationale<br />
Grenzl<strong>in</strong>ien. Erst <strong>in</strong> der Mitte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts tauchten Karten auf, welche die<br />
Verbreitung von Sprachen, von ethnischen oder nationalen Gruppen <strong>und</strong> von nationalem<br />
Bekenntnis der Bevölkerung flächig <strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>deutigen Begrenzungsl<strong>in</strong>ien darstellten,<br />
zuerst <strong>in</strong> den dreißiger Jahren des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts für Ungarn 90 <strong>und</strong> e<strong>in</strong> bis<br />
zwei Jahrzehnte später dann auch für Österreich bzw. Böhmen <strong>und</strong> Mähren. 91 Seit den<br />
sechziger Jahren des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts wurden von Politikern <strong>in</strong> der Habsburgermonarchie<br />
territoriale Herrschaftsansprüche aufgr<strong>und</strong> der sprachlichen oder ethnischen<br />
Besiedlungsverhältnisse erhoben. E<strong>in</strong> derart def<strong>in</strong>iertes nationales Gebiet ließ sich am<br />
besten mit e<strong>in</strong>er Karte <strong>und</strong> flächiger Färbung veranschaulichen. Karten wurden so zu<br />
e<strong>in</strong>em zentralen Faktor <strong>in</strong> den politischen Ause<strong>in</strong>andersetzungen <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em leicht<br />
e<strong>in</strong>gängigen <strong>und</strong> handhabbaren Element der nationalen Agitation. 92 Die Kartographie<br />
KLAUS FEHN: Territorialatlanten – raumbezogene <strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Gr<strong>und</strong>lagenwerke<br />
der geschichtlichen Landesk<strong>und</strong>e, <strong>in</strong>: Blätter für deutsche Landesgeschichte 127 (1991), S.<br />
19-46, verweist auf Karten aus der Zeit vor 1800, die „Sprachgrenzen“ verzeichneten.<br />
90 JOHANNES DÖRFLINGER: Sprachen- <strong>und</strong> Völkerkarten des mitteleuropäischen Raumes vom<br />
18. Jahrh<strong>und</strong>ert bis <strong>in</strong> die 2. Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: 4. Kartographiehistorisches<br />
Colloquium, Karlsruhe 1988, hrsg. von WOLFGANG SCHARFE, HEINZ MUSALL <strong>und</strong> JOA-<br />
CHIM NEUMANN, Berl<strong>in</strong> 1990, S. 183-195; HOLGER FISCHER: Karten zur räumlichen Verteilung<br />
der Nationalitäten <strong>in</strong> Ungarn. Darstellungsmöglichkeiten <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> ihrer Interpretation<br />
am Beispiel von ungarischen Nationalitätenkarten des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>:<br />
Aspekte ethnischer Identität, hrsg. von EDGAR HÖSCH <strong>und</strong> GERHARD SEEWANN, München<br />
1991, S. 325-393.<br />
91 Eigenheiten e<strong>in</strong>zelner älterer Karten, die sprachliche Aspekte schematisch abbildeten, können<br />
an dieser Stelle nicht diskutiert werden. – Der französischen Diplomatie lag während<br />
der Revolution von 1848 e<strong>in</strong>e „Carte Ethnographique“ der Donaumonarchie vor; abgedruckt<br />
<strong>in</strong> ERNST BIRKE: Frankreich <strong>und</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, Köln, Graz<br />
1960, zwischen S. 160-161. – E<strong>in</strong>en kurzen Überblick über die ethnographischen Karten<br />
für Böhmen bis 1900 gibt RAUCHBERG: Der nationale Besitzstand (wie Anm. 87), Bd. 1, S.<br />
45-49. – Nach EVA SEMOTANOVÁ: Thematische Kartographie <strong>in</strong> den böhmischen Ländern<br />
<strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>: Prager wirtschafts- <strong>und</strong> sozialhistorische Mitteilungen 3 (1996), S.<br />
37-49, hier S. 37, erschien 1850 die erste Karte, die sich mit Nationalitäten- <strong>und</strong> Sprachenverhältnissen<br />
<strong>in</strong> Mähren beschäftigte. – Zu Karl von Czoernigs Ethnographischer Karte<br />
von 1856 vgl. neuerd<strong>in</strong>gs JOSEF VAŘECKA: A Contemporary Understand<strong>in</strong>g of the National<br />
Question Accord<strong>in</strong>g to the Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie Together<br />
with the Current Form of National Self-Identification <strong>in</strong> the Czech Lands, <strong>in</strong>: Samoidentyfikacja<br />
mniejszości narodowych i religijnych w Europie środkowo-wschodniej. Problematyka<br />
atlasowa, Lubl<strong>in</strong> 1998 (Materiały Instytutu Europy środkowo-wschodniej), S.<br />
156-159.<br />
92 FISCHER (wie Anm. 90), S. 333 f. – Auch <strong>in</strong> früheren Zeiten wurde die politische Bedeutung<br />
der Kartographie schon als bedrohlich empf<strong>und</strong>en. So untersagten die egrischen Stän-<br />
126
schuf, wie es e<strong>in</strong> führender Wissenschaftler der Zwischenkriegszeit formulierte, „Belege<br />
für Rechtsansprüche <strong>im</strong> volkspolitischen Kampf“. 93<br />
Den entscheidenden Wandel brachte dabei die rasche Verbreitung von stark vere<strong>in</strong>fachenden,<br />
aber optisch sehr plausiblen Nationalitäten- <strong>und</strong> Sprachenkarten, die<br />
e<strong>in</strong> Gebiet ungeteilt <strong>und</strong> ausdrucksstark e<strong>in</strong>farbig markierten, sobald e<strong>in</strong>e Bevölkerungsgruppe<br />
mehr als 50 Prozent <strong>in</strong> dem jeweiligen Bezirk ausmachte. 94 Die gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Problematik der deutschen wie tschechischen „Volkstumskarten“ liegt dar<strong>in</strong>,<br />
daß sie als thematische Karten je nach Aggregationsebene <strong>und</strong> kartographischer Präsentation<br />
der Ergebnisse der Volkszählungen nach der Umgangssprache zu unterschiedlichen<br />
Ergebnissen kamen. Bereits die zugr<strong>und</strong>eliegende Statistiken s<strong>in</strong>d aufgr<strong>und</strong><br />
der Subjektivität <strong>und</strong> Relativität von Erhebungen zu Mutter-, Umgangs- <strong>und</strong><br />
präferierter Sprache <strong>und</strong> dem problematischen Schluß auf e<strong>in</strong>e damit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
stehende nationale oder ethnische Identität unscharf <strong>und</strong> problematisch. Bei der kartographischen<br />
Umsetzung spielt dann vor allem die Größe der räumlichen Gr<strong>und</strong>e<strong>in</strong>heit<br />
e<strong>in</strong>e maßgebliche Rolle. Die Grenzl<strong>in</strong>ie zwischen Sprachgruppen verläuft anders,<br />
je nachdem ob die Nationalitätenverhältnisse auf der Ebene des Politischen Bezirks,<br />
des Gerichtsbezirks, der Geme<strong>in</strong>de oder von Geme<strong>in</strong>deteilen aufgeschlüsselt <strong>und</strong> dargestellt<br />
wurden. H<strong>in</strong>zu kommt, daß die sprachlichen bzw. ethnographischen Verhältnisse<br />
oft nicht sehr differenziert <strong>und</strong> ohne Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte<br />
wiedergegeben werden, häufig nationale M<strong>in</strong>derheiten ab e<strong>in</strong>er best<strong>im</strong>mten Größe (<strong>in</strong><br />
der Regel ab <strong>20</strong> Prozent, teilweise aber schon ab 49 Prozent) sogar überhaupt nicht<br />
mehr zur Darstellung kommen. Auf diese Weise wurden gemischtsprachige Gebiete<br />
gerne generalisierend als national homogene Räume der Mehrheitsbevölkerung veranschaulicht<br />
oder zum<strong>in</strong>dest von vielen Betrachtern als solche rezipiert. 95<br />
de Johann Chr. Müller 1714, auch das Egerland <strong>im</strong> Rahmen se<strong>in</strong>er Kartographie Böhmens<br />
zu vermessen <strong>und</strong> zu kartographieren. Erst als vere<strong>in</strong>bart worden war, daß die Karte des<br />
Egerlands <strong>im</strong> Auftrag der Stadt Eger erstellt werde <strong>und</strong> daß die Karte nicht mit den Karten<br />
Böhmens zusammengeb<strong>und</strong>en werden dürfe <strong>und</strong> die Kupferplatten <strong>in</strong> den Besitz der Stadt<br />
Eger übergehen würden, konnte dieses epochale kartographische Unternehmen auch <strong>im</strong><br />
Egerland durchgeführt werden. Vgl. VIKTOR KARELL: Das Egerland <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Weltbäder,<br />
Frankfurt/Ma<strong>in</strong> 1966, S. 55 f.<br />
93 HUGO HASSINGER: Bemerkungen über Entwicklung <strong>und</strong> Methode von Sprachen- <strong>und</strong><br />
Volkstumskarten, <strong>in</strong>: Wissenschaft <strong>im</strong> Volkstumskampf. Festschrift Erich Gierach, hrsg.<br />
von KURT OBERDORFFER, BRUNO SCHIER <strong>und</strong> WILHELM WOSTRY, Reichenberg 1941, S.<br />
47-62, hier S. 47.<br />
94 Das <strong>in</strong> der Fläche größer wirkende Rot oder Schwarz wurde dabei meist für die eigene Nationalität<br />
gewählt, während optisch hellere Farben wie grau, gelb oder grün für die konkurrierende<br />
nationale Gruppe Verwendung fanden.<br />
95 FISCHER (wie Anm. 90), S. 337. – Es wäre e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teressante Aufgabe, gerade nicht die<br />
Sprachen <strong>und</strong> Nationalitäten, sondern das Element von Mehrsprachigkeit <strong>und</strong> multiethnischer<br />
Mischung <strong>in</strong> den Mittelpunkt e<strong>in</strong>er kartographischen Wiedergabe zu stellen.<br />
E<strong>in</strong>sprachige Gebiete würden dann peripher ersche<strong>in</strong>en, während je nach Vielfalt <strong>und</strong> Grad<br />
der Sprachen <strong>und</strong> Ethnien die gemischten Gebiete besonders betont würden.<br />
127
Nationale <strong>und</strong> sprachliche Trennl<strong>in</strong>ien gibt es nicht <strong>im</strong> Gelände, sondern sie s<strong>in</strong>d<br />
von kartographischen Vorlagen übertragene, <strong>im</strong>ag<strong>in</strong>ierte Territorialvorstellungen. Die<br />
Sprachgrenze ist somit e<strong>in</strong> geographisch relatives Element <strong>und</strong> e<strong>in</strong> räumlich nicht klar<br />
abgrenzbarer kulturgeographischer Faktor. Sprachen- <strong>und</strong> sogenannte Volkstums-<br />
Karten Böhmens trugen aber entscheidend dazu bei, daß sich <strong>im</strong> Bewußtse<strong>in</strong> sowohl<br />
der Politiker als auch der Bevölkerung e<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachtes geographisches Bild von national<br />
gegliederten, weitgehend homogenen <strong>und</strong> relativ scharf getrennten Gebieten<br />
oder Räumen verbreitete. Die Kartographie wirkte daher nicht nur bei der Diskussion<br />
über Grenzänderungen mit, sondern förderte auch die Entstehung völlig neuer <strong>Grenzen</strong>.<br />
Sie unterstützte seit dem <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert vor allem <strong>im</strong> multiethnischen Mittel-<br />
<strong>und</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> den tiefgreifenden Wandel der Grenzvorstellungen. Die Unzahl<br />
der zwischen 1860 <strong>und</strong> 1940 für den Bereich der böhmischen Länder hergestellten<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> hoher Auflage verbreiteten Sprachen- <strong>und</strong> Nationalitätenkarten 96 führte zu e<strong>in</strong>er<br />
Marg<strong>in</strong>alisierung der harten Faktoren der Kulturgeographie wie Besiedlungsdichte,<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Verkehrsstruktur. Unabhängig davon, daß die e<strong>in</strong>zelnen Sprachen-<br />
<strong>und</strong> Nationalitätenkarten unterschiedliche nationale oder ethnische Trennl<strong>in</strong>ien<br />
veranschaulichten, wurden aus ethnischen <strong>und</strong> „Volkstums“-<strong>Grenzen</strong> ideologische<br />
<strong>und</strong> politische Max<strong>im</strong>en.<br />
Erst mit den Diskussionen über Sprachen- <strong>und</strong> Nationalitätengrenzen erhielten<br />
diese Trennl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>e neue „kulturgeographische“ Qualität <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d politisch relevant<br />
geworden. Auch wenn der <strong>in</strong> der Logik des ethnisch-nationalen Pr<strong>in</strong>zips <strong>und</strong> des<br />
gerade erst se<strong>in</strong>en Siegeszug antretenden „Selbstbest<strong>im</strong>mungsrechts der Nationen“<br />
stehende kurzlebige Versuch, <strong>in</strong> den böhmischen Ländern eigene deutschösterreichische<br />
Prov<strong>in</strong>zen zu schaffen, scheiterte, wirkten die Ideen fort. Daß es „gelang, die öffentlich-rechtlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> zu überw<strong>in</strong>den oder doch wenigstens die Sprachgrenze<br />
gleichberechtigt neben den staatlich-territorialen <strong>Grenzen</strong> zur Geltung zu br<strong>in</strong>gen“,<br />
war, wie selbst der sudetendeutsche Historiker Josef Pfitzner 1937 bekannte, nicht nur<br />
e<strong>in</strong> Verdienst des nationalen Strebens, sondern vor allem e<strong>in</strong> Ergebnis der jüngsten<br />
Entwicklungen se<strong>in</strong>er Zeit. 97 Erst seit Mitte der dreißiger Jahre des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
hatte die Sudetendeutsche Partei unter Konrad Henle<strong>in</strong> den Gedanken e<strong>in</strong>er verwaltungsmäßigen<br />
Trennung der Sprachgruppen <strong>in</strong> den böhmischen Ländern forciert. 98 Sie<br />
konnte sich dabei auf nationale Positionen <strong>in</strong> den böhmischen Ländern <strong>und</strong> auf den<br />
Nationalsozialismus <strong>im</strong> Deutschen Reich stützten. Im Zusammenhang mit der Angliederung<br />
Österreichs an das Deutsche Reich propagierte Henle<strong>in</strong> <strong>im</strong> ersten Halbjahr<br />
96 Vgl. <strong>in</strong>sbesondere den Überblick von HASSINGER (wie Anm. 93) <strong>und</strong>: Volks- <strong>und</strong> Sprachenkarten<br />
Mitteleuropas, Teil III: Sudeten- <strong>und</strong> Karpatenländer. Die Tschechoslowakei <strong>in</strong><br />
ihren <strong>Grenzen</strong> von 1918, bearb. von F. A. DOUBEK, H. HASSINGER, O. A. ISBERT, M.<br />
KLANTE <strong>und</strong> H. ULBRICHT, <strong>in</strong>: Deutsches Archiv für Landes- <strong>und</strong> Volksforschung 2<br />
(1938), S. 963-983.<br />
97 JOSEF PFITZNER: Nationales Erwachen <strong>und</strong> Reifen der Sudetendeutschen, <strong>in</strong>: Das Sudetendeutschtum.<br />
Se<strong>in</strong> Wesen <strong>und</strong> Werden <strong>im</strong> Wandel der Jahrh<strong>und</strong>erte, hrsg. von GUSTAV PIR-<br />
CHAN, WILHELM WEIZSÄCKER <strong>und</strong> HEINZ ZATSCHEK, Brünn 1937, S. 419-447, hier S. 433.<br />
98 GEBEL (wie Anm. 73), S. 83, pass<strong>im</strong>.<br />
128
1938 dann <strong>im</strong> Gleichklang mit Hitler den Anschluß der Gebiete mit sudetendeutscher<br />
Bevölkerung an das Deutsche Reich, wobei umstritten war, welches Mehrheitskriterium<br />
geme<strong>in</strong>t war, auf welche Verwaltungse<strong>in</strong>heit <strong>und</strong> auf welche Volkszählung sich<br />
die statistischen Angaben beziehen sollten. 99<br />
Mit dem Münchener Abkommen, dem deutsch–tschecho-slowakischen Protokoll<br />
über die Demarkation vom <strong>20</strong>. November 1938, dem darauf folgenden Beschluß der<br />
<strong>in</strong> München e<strong>in</strong>gesetzten <strong>in</strong>ternationalen Grenzkommission <strong>und</strong> dem abschließenden<br />
detaillierten Dresdner Grenzziehungsprotokoll vom Januar 1939 entstand schrittweise<br />
die neue Grenzl<strong>in</strong>ie, die nicht mehr als Rektifikation der bis dah<strong>in</strong> bestehenden<br />
Grenzverläufe verstanden werden kann. 100 Diese Grenzfestlegung griff nicht e<strong>in</strong>mal<br />
auf den unteren Ebenen auf bestehende Verwaltungsgrenzen zurück, sondern war <strong>in</strong><br />
jeder H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong> Novum. H<strong>in</strong>sichtlich der <strong>Grenzen</strong> zu anderen Ländern <strong>und</strong> Gauen<br />
des Großdeutschen Reiches blieben dagegen für den neu geschaffenen Reichsgau Sudetenland<br />
die alten böhmischen <strong>und</strong> österreichisch-schlesischen <strong>Grenzen</strong> als Verwaltungsl<strong>in</strong>ien<br />
unverändert bestehen. Nur <strong>im</strong> südwestlichen Böhmen <strong>und</strong> <strong>in</strong> Südmähren<br />
wurde 1938 die alte Landesgrenze durch den Anschluß der abgetretenen Gebiete an<br />
die Länder Bayerische Ostmark sowie Ober- <strong>und</strong> Niederdonau aufgehoben.<br />
Wenn das nationale Pr<strong>in</strong>zip partiell die Kont<strong>in</strong>uität der historischen Außengrenzen<br />
<strong>und</strong> der territorialen E<strong>in</strong>heit Böhmens durch die Absicht <strong>in</strong> Frage stellte, <strong>im</strong> Inneren<br />
übergeordnete neue, nun nationale <strong>Grenzen</strong> zu ziehen, so läßt sich auch das theoretische<br />
Gegenstück f<strong>in</strong>den. Im Zusammenhang mit der Staatsentstehung der Tschechoslowakei<br />
trat erstmals seit Jahrh<strong>und</strong>erten wieder e<strong>in</strong>e <strong>im</strong>periale böhmische bzw.<br />
tschechoslowakische Komponente auf, die e<strong>in</strong>e Verschiebung der <strong>Grenzen</strong> Böhmens<br />
nach außen propagierte <strong>und</strong> so die bisherige historische Geschlossenheit aufzulösen<br />
beabsichtigte. Von tschechischer Seite wurden seit Beg<strong>in</strong>n des Ersten Weltkrieges als<br />
Reaktion auf großdeutsche Pläne vere<strong>in</strong>zelt Gegenentwürfe e<strong>in</strong>er tschechisch-böh-<br />
99 Hitler forderte z.B. <strong>im</strong> September 1938 das Pr<strong>in</strong>zip der e<strong>in</strong>fachen Mehrheit aufgr<strong>und</strong> des<br />
Bevölkerungsstandes vor 1918. HELMUTH K.G. RÖNNEFARTH: Die Sudetenkrise <strong>in</strong> der <strong>in</strong>ternationalen<br />
Politik. Entstehung, Verlauf, Auswirkung, 2 Bde., Wiesbaden 1961 (Veröffentlichungen<br />
des <strong>Institut</strong>s für Europäische Geschichte Ma<strong>in</strong>z, Bd. 21), Bd. 1, S. 583.<br />
100 THEODORE PROCHÁZKA: The Del<strong>im</strong>itation of Czechoslovak-German Frontiers after Munich,<br />
<strong>in</strong>: Journal of Central European Affairs 21 (1961), S. <strong>20</strong>0-218; ZDENĚK ŠÍPEK: Mnichovská<br />
dohoda a „spory“ o československo-rakouské státní hranici [Das Münchener Abkommen<br />
<strong>und</strong> die Streitigkeiten über die tschechoslowakisch-österreichische Staatsgrenze],<br />
<strong>in</strong>: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karolovy – Historie 1 (1996), S. 113-171 (mit<br />
zahlreichen Detailkarten); VOJTĚCH LAŠTOVKA: Vytyčení západočeské státní hranice pomnichovské<br />
republiky [Das Festlegen der westböhmischen Staatsgrenze der nachmünchner<br />
Republik], <strong>in</strong>: M<strong>in</strong>ulostí západočeského kraje 7 (1970), S. 33-48; HARTMUT SINGBARTL:<br />
Die Durchführung der deutsch-tschechoslowakischen Grenzregelungen von 1938 <strong>in</strong> völkerrechtlicher<br />
<strong>und</strong> staatsrechtlicher Sicht, München 1971 (Veröffentlichungen des Sudetendeutschen<br />
Archivs, Bd. 5), S. 42-44, 57-66, ohne Inhalte <strong>und</strong> Art der Ause<strong>in</strong>andersetzungen<br />
näher zu erläutern. – Die Grenzziehungsarbeiten <strong>im</strong> Gelände wurden von deutscher<br />
Seite bereits seit Ende Januar 1939 verschleppt; RÖNNEFARTH (wie Anm. 99), Bd. I, S.<br />
724.<br />
129
misch nationalen Großraumbildung entwickelt. Politiker wie Karel Kramář <strong>und</strong> Tomáš<br />
Garrigue Masaryk entwarfen schon <strong>in</strong> den ersten Kriegsjahren Karten, nach denen<br />
e<strong>in</strong> tschechischer, tschechoslowakischer bzw. slawischer Staat vor allem das<br />
Glatzer Becken <strong>und</strong> die Gegend von Ratibor, das Gebiet der Lausitzer Sorben, die<br />
Slowakei <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> dort wohnender Kroaten <strong>und</strong> anderer Slawen e<strong>in</strong>en Teil<br />
Westungarns e<strong>in</strong>beziehen sollte. 101 In reduzierter <strong>und</strong> modifizierter Form flossen diese<br />
Vorstellungen <strong>in</strong> Propagandakarten des Tschechoslowakischen Nationalrates <strong>in</strong> Paris<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Karten des tschechoslowakischen Außenm<strong>in</strong>isteriums e<strong>in</strong>, die 1919 bei den<br />
Pariser Friedensverhandlungen vorgelegt wurden. 102<br />
Weit radikalere Pläne propagierten e<strong>in</strong>zelne Publizisten bei Kriegsende. Am bekanntesten<br />
ist die Karte des ehemaligen Militärs Hanuš Kuffner mit e<strong>in</strong>em tschechischen<br />
Max<strong>im</strong>alprogramm, die aber <strong>in</strong> ihrer Bedeutung vielfach überschätzt bzw. von<br />
der Gegenseite mißbraucht <strong>und</strong> hochgespielt wurde. Neben der „Wiedervere<strong>in</strong>igung“<br />
mit Schlesien sah diese Konzeption für die böhmischen Länder e<strong>in</strong> Glacis gegenüber<br />
Deutschland <strong>und</strong> Österreich vor. Kuffner forderte für den neuen Staat e<strong>in</strong>en Grenzverlauf<br />
vom Fuß des Fichtelgebirges über Regensburg (Řezno) <strong>und</strong> der Donau folgend<br />
über Passau (Pasov) <strong>und</strong> L<strong>in</strong>z (L<strong>in</strong>ec), dann teilweise über die Donau nach Süden h<strong>in</strong>ausgreifend<br />
bis Wien (Vídeň) e<strong>in</strong>. 103 Während des Zweiten Weltkrieges wurden <strong>im</strong><br />
tschechischen Widerstand <strong>und</strong> <strong>im</strong> Exil partiell ähnlich ausgreifende territoriale Überlegungen<br />
ventiliert, um künftig e<strong>in</strong>er deutschen Bedrohung besser standhalten zu<br />
können. 104 Andere expansive Nationalisten träumten <strong>im</strong> frühen <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert von<br />
drei tschechoslowakischen „Korridoren“ zu den Südslawen <strong>und</strong> an die Adria unter<br />
E<strong>in</strong>schluß von Wien, zweitens zu den Sorben <strong>und</strong> an der Elbe entlang bis zur Mündung<br />
<strong>in</strong> die Nordsee sowie drittens über die Slowakei nach Rußland. 105<br />
Mit den territorialen Abgrenzungsversuchen Ende 1918 <strong>und</strong> mit der Grenzziehung<br />
von München 1938 e<strong>in</strong>erseits sowie mit den eher vagen tschechischen Großraumuto-<br />
101 Vgl. Anm. 56. – JAN GALANDAUER: Vznik Československé republiky 1918. Programy,<br />
projekty, předpoklady [Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik. Programme,<br />
Projekte, Voraussetzungen], Praha 1988, u.a. S. 146 f. <strong>und</strong> 243.<br />
102 Vgl. KLIMKO (wie Anm. 8), Karte 2, S. 147; PERMAN (wie Anm. 8), Anhang Karte 2 mit<br />
den tschechoslowakischen Gebietsvorstellungen vom 12. März 1919; sowie die Karten <strong>im</strong><br />
Anhang <strong>in</strong>: Die tschechoslowakischen Denkschriften (wie Anm. 7).<br />
103 HANUŠ KUFFNER: Náš stát a světový mír, Praha 1917; dt.: Unser Staat <strong>und</strong> der Weltfrieden,<br />
Warnsdorf 1922; die Karte auch z.B. bei WITT (wie Anm. 70), S. 170. – Zur om<strong>in</strong>ösen Geschichte<br />
dieser Karte <strong>und</strong> ihres Autors RICHARD A. HOFFMANN: Wer war Hanuš Kuffner?<br />
Versuch e<strong>in</strong>er Klärung se<strong>in</strong>es politischen Werdeganges, <strong>in</strong>: Informationsbrief für sudetendeutsche<br />
He<strong>im</strong>atarchive <strong>und</strong> He<strong>im</strong>atmuseen 16 (1978), S. 38-54; HANS LEMBERG: Die<br />
Tschechoslowakei <strong>im</strong> Jahr 1. Der Staatsaufbau, die Liquidierung der Revolution <strong>und</strong> die<br />
Alternativen 1919, <strong>in</strong>: Das Jahr 1919 <strong>in</strong> der Tschechoslowakei <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>,<br />
hrsg. von DEMS. <strong>und</strong> PETER HEUMOS, München 1993, S. 225-248, hier S. 228 f.<br />
104 BROD (wie Anm. 38), S. 308 Anm. 42.<br />
105 Zu den offiziellen tschechischen politischen Kriegszielen, zu Kuffner <strong>und</strong> anderen obskuren<br />
tschechischen Publizisten vgl. auch HUMMELBERGER (wie Anm. 52), S. 80-87 (<strong>und</strong><br />
dessen Diskussionsbeitrag ebenda, S. 394).<br />
130
pien andererseits standen sich seit dem Ersten Weltkrieg zwei Konzeptionen gegenüber,<br />
die beide nationale Max<strong>im</strong>alprogramme waren <strong>und</strong> die beide mit dem bisherigen<br />
Grenzverständnis brachen. Beide strebten nicht nach Grenzkorrekturen, sondern<br />
trachteten danach, durch e<strong>in</strong>e ethnisch-national oder strategisch begründete <strong>im</strong>periale<br />
Geopolitik die historischen <strong>Grenzen</strong> Böhmens gr<strong>und</strong>sätzlich aufzuheben.<br />
Bemerkenswert ist dabei nicht, daß solche Konzeptionen aufgr<strong>und</strong> historischpolitischer<br />
Konstellationen ke<strong>in</strong>e Chancen auf e<strong>in</strong>e dauerhafte Realisierung hatten,<br />
sondern daß sie alle <strong>im</strong> Detail gar nicht konsequent durchführbar <strong>und</strong> praktikabel waren.<br />
Im Münchener Abkommen fand die Sprachgrenze zwar 1938 ihre politischsymbolische<br />
Verwirklichung. Die dah<strong>in</strong>ter stehende These, die Nationalitätenfrage<br />
lasse sich beispielsweise <strong>im</strong> Bereich der böhmischen Länder territorial abschließend<br />
regeln <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Grenzl<strong>in</strong>ie könne nach rational feststellbaren nationalen, ethnischen<br />
oder sprachlichen Kriterien gezogen werden, wurde jedoch widerlegt. Das Pr<strong>in</strong>zip der<br />
nationalen Selbstbest<strong>im</strong>mung konnte nicht gelöst <strong>und</strong> auch formal nicht vollständig<br />
verwirklicht werden, wie die lokalen Verhältnisse zeigten. Die Grenzziehung <strong>in</strong>folge<br />
des Münchener Abkommens machte gerade nicht e<strong>in</strong>e Sprach- oder Nationalitätengrenze<br />
zur Staatsgrenze. Es blieben nicht nur Sprach<strong>in</strong>seln wie Iglau (Jihlava) <strong>und</strong> die<br />
städtischen M<strong>in</strong>derheiten unberücksichtigt. Vielmehr wurden mehrere h<strong>und</strong>erttausend<br />
Tschechen, die <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>den ohne deutschsprachige Mehrheit lebten, dem Großdeutschen<br />
Reich e<strong>in</strong>verleibt, <strong>in</strong> besonderer Zahl <strong>im</strong> nordmährisch-westschlesischen Bereich.<br />
106 Selbst entlang der neuen Grenzl<strong>in</strong>ie kamen tschechische Dörfer auf die deutsche<br />
Seite <strong>und</strong> seltener deutsche auf die tschechische.<br />
E<strong>in</strong> Vergleich von Sprachen- <strong>und</strong> Nationalitätenkarten mit den Karten der <strong>Grenzen</strong><br />
der Tschecho-Slowakischen Republik von 1938/39 bzw. des Protektorats „Böhmen<br />
<strong>und</strong> Mähren“ zeigt, daß die Grenze des Münchener Abkommens <strong>im</strong> Detail nicht<br />
der sprachlich-nationalen Siedlungslage folgte, sondern jeweils ökonomisch-verkehrstechnische<br />
Argumente oder e<strong>in</strong>deutige wirtschaftliche Interessen bei den von<br />
deutscher Seite beherrschten Del<strong>im</strong>itationsverhandlungen den Ausschlag gaben. 107<br />
E<strong>in</strong> markantes Beispiel, bei dem die nationalen oder sprachlichen Bevölkerungsverhältnisse<br />
<strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den völlig ignoriert wurden, ist der nordwestmährisch-ostböhmische<br />
Schönhengstgau <strong>im</strong> Bereich von Zwittau (Svitavy), wo zwei kle<strong>in</strong>ere deutsche<br />
Sprach<strong>in</strong>seln mite<strong>in</strong>ander verb<strong>und</strong>en wurden, <strong>in</strong>dem größere re<strong>in</strong> tschechischsprachige<br />
Gebiete an Deutschland angeschlossen wurden. Auffälligerweise gerade<br />
dort, wo sich die zentralen Bahnl<strong>in</strong>ien von Prag nach Brünn <strong>und</strong> Ostrau verzweigten.<br />
108 Nationale Bed<strong>in</strong>gungen spielten auch ke<strong>in</strong>e Rolle, als das an der Sprachgrenze<br />
106 PROCHÁZKA (wie Anm. 100), S. 211, Anm. 58, mit H<strong>in</strong>weisen auf tschechoslowakische<br />
Quellen. Mit weiterführenden H<strong>in</strong>weisen neuerd<strong>in</strong>gs GEBEL (wie Anm. 73), S. 275-278,<br />
<strong>und</strong> auch die Karte S. 425; ZIMMERMANN (wie Anm. 73), S. 279-281.<br />
107 Pläne für e<strong>in</strong>en mit der neuen Grenzziehung verb<strong>und</strong>enen Bevölkerungsaustausch wurden<br />
nicht verwirklicht. Vgl. BRANDES (wie Anm. 58); HANS LEMBERG: „Ethnische Säuberung“:<br />
E<strong>in</strong> Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?, <strong>in</strong>: Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte.<br />
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 46/92 (6. November 1992), S. 27-38.<br />
108 PROCHÁZKA (wie Anm. 100), S. <strong>20</strong>2 f., 211.<br />
131
liegende tschechischsprachige nordmährische Nesselsdorf (Kopřivnice) mit dem<br />
Stammwerk der Automobil-, Waggon- <strong>und</strong> Panzerwerke Tatra <strong>in</strong> das Großdeutsche<br />
Reich <strong>in</strong>tegriert wurde. Zahlreiche weitere Fälle, die Bahnl<strong>in</strong>ien, Kohlengruben <strong>und</strong><br />
Elektrizitätswerke, Masch<strong>in</strong>enfabriken, Ste<strong>in</strong>brüche etc. betrafen, s<strong>in</strong>d für die Gegenden<br />
von Budweis, Taus (Domažlice), Pilsen, Hohenelbe (Vrchlabí) <strong>und</strong> Ostrau belegt.<br />
109 Das Pr<strong>in</strong>zip der nationalen Grenze wurde <strong>im</strong> kle<strong>in</strong>räumlichen Zusammenhang<br />
stets <strong>und</strong> systematisch durch verkehrstechnische, ökonomische oder siedlungsmäßige<br />
Bed<strong>in</strong>gungen gebrochen. 110<br />
Die „Münchner“ Grenze verlief durch nahezu alle bedeutenderen <strong>in</strong>dustriellen Agglomerationsräume<br />
Böhmens. Mit Nordböhmen, aber auch mit den Wirtschaftszentren<br />
von Pilsen, Ostrau oder Brünn waren kulturgeographisch hochverdichtete Regionen<br />
betroffen. Die latente Instabilität e<strong>in</strong>er derartigen Grenzziehung ist durch die sozioökonomische<br />
Natur von Sprachgrenzen bed<strong>in</strong>gt. Auch wenn sich die deutschtschechische<br />
Sprachgrenze <strong>in</strong> weiten Teilen Böhmens vermutlich über Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
h<strong>in</strong>weg nur wenig bewegte, so entwickelten die Migrationen gerade <strong>in</strong> <strong>in</strong>dustriell <strong>und</strong><br />
sozioökonomisch aufsteigenden Regionen e<strong>in</strong>e besondere nationale Dynamik. Neuere<br />
Forschungen bestätigen, daß nicht der „Sprachenkampf“ <strong>in</strong> Politik, Publizistik <strong>und</strong><br />
Gesellschaft, sondern vor allem die Wanderungsbewegungen <strong>in</strong> bevölkerungsreichen<br />
Kle<strong>in</strong>regionen an der Sprachgrenze diese L<strong>in</strong>ie veränderten. 111 Wirtschafts- <strong>und</strong> Verkehrszentren<br />
an e<strong>in</strong>er politischen Grenze s<strong>in</strong>d aber, wie bereits ausgeführt, gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
durch die Interessen der beteiligten Herrschaftsgebiete von Rektifikationen bedroht.<br />
Die Probleme der aus zwei unverb<strong>und</strong>enen Teilen bestehenden „künstlichen Region<br />
Sudetenland“ 112 wie auch die engen Verb<strong>in</strong>dungen, die während des Krieges zwi-<br />
109 Ebenda, S. <strong>20</strong>3 <strong>und</strong> 210-214; LAŠŤOVKA (wie Anm. 100), S. 42 f.; JOSEF BARTOŠ: Okupované<br />
pohraničí a české obyvatelstvo 1938-1945 [Die okkupierten Grenzgebiete <strong>und</strong> die<br />
tschechische Bevölkerung 1938-1945], Praha 1978; GEBEL (wie Anm. 74), S. 62 f.<br />
110 Dies widerlegt Bohmanns Behauptung: „Die Sprachengrenze wurde zur Staatsgrenze. Sie<br />
wurde besonders <strong>in</strong> Böhmen mit großer Korrektheit gezogen, ohne Rücksicht auf wirtschaftliche<br />
B<strong>in</strong>dungen <strong>und</strong> Verkehrswege.“ ALFRED BOHMANN: Bevölkerungsbewegungen<br />
<strong>in</strong> Böhmen 1847-1947 mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der nationalen<br />
Verhältnisse, München 1958 (Wissenschaftliche Materialien zur Landesk<strong>und</strong>e der böhmischen<br />
Länder, Bd. 3), S. 219 f. – Daladier hatte bereits während der Konferenz von München<br />
am 29./30. September 1938 weitreichende Ausnahmen von dem nationalen Pr<strong>in</strong>zip <strong>im</strong><br />
schlesischen Bereich gefordert; RÖNNEFARTH (wie Anm. 99), Bd. 1, S. 661.<br />
111 Material <strong>und</strong> weitere H<strong>in</strong>weise zum Aspekt der Sprachgrenze ausführlich bei VLASTISLAV<br />
HÄUFLER: The Ethnographic Map of the Czech Lands, 1880-1970, Praha 1973 (Rozpravy<br />
čsl. akademie věd - řada matematických a přírodních věd, Heft 83/6); MARK CORNWALL:<br />
The Struggle on the Czech-German Language Border, 1880-1940, <strong>in</strong>: The English Historical<br />
Review 109 (1994), S. 914-951.<br />
112 GEORG R. SCHROUBEK: Die künstliche Region: Beispiel „Sudetenland“, <strong>in</strong>: Regionale Kulturanalyse.<br />
Protokollmanuskript e<strong>in</strong>er wissenschaftlichen Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft<br />
für Volksk<strong>und</strong>e vom 8.-11. Okt. 1978 <strong>in</strong> München, hrsg. von DEMS. <strong>und</strong> HELGE<br />
BERNDT, München 1979, S. 25-29, hier S. 25.<br />
132
schen dem Reichsgau Sudetenland <strong>und</strong> dem Protektorat Böhmen <strong>und</strong> Mähren bestanden,<br />
s<strong>in</strong>d weitere Belege für die absehbare Episodenhaftigkeit der 1938 gezogenen<br />
<strong>Grenzen</strong>. Bereits <strong>im</strong> Sommer 1940 stellten deutsche nationalsozialistische Stellen<br />
fest, daß sich die Festlegungen von 1938 trotz der zahlreichen Ausnahmen aus ökonomischen<br />
<strong>und</strong> verkehrstechnischen Gründen nicht bewährt hätten, da „die deutschtschechische<br />
Volkstumsgrenze <strong>in</strong> den meisten Abschnitten landschaftlich, raumpolitisch,<br />
verkehrsmäßig <strong>und</strong> wirtschaftlich e<strong>in</strong>heitliche Gebiete durchschneidet“. 113 Die<br />
NSDAP <strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige Verwaltungsbehörden <strong>und</strong> Dienststellen g<strong>in</strong>gen frühzeitig davon<br />
aus, daß die Zweiteilung der böhmischen Länder von 1938/39 nur e<strong>in</strong>e Übergangsersche<strong>in</strong>ung<br />
se<strong>in</strong> werde. 114 Sowohl die Parteigaue der NSDAP als auch die Wehrersatzbezirke<br />
oder die Zuständigkeitsbereiche der Reichsbahndirektionen ignorierten die<br />
1938/39 geschaffene Verwaltungsgliederung. 115 Allgeme<strong>in</strong> wurde erwartet, daß nach<br />
Kriegsende e<strong>in</strong>e Neugliederung der böhmischen Länder erfolgen werde. Die „Münchner“<br />
Grenze blieb unabhängig davon e<strong>in</strong>e kurze Episode. 1945 erlangten die historischen<br />
Landesgrenzen als <strong>Grenzen</strong> der erneuerten Tschechoslowakei wieder Gültigkeit.<br />
Zusammenfassung<br />
Böhmen wird nicht nur von Geographen aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Zentralität durchgängig als<br />
„natürliche“ E<strong>in</strong>heit, als kont<strong>in</strong>uierliche historisch-politische Individualität gesehen,<br />
die es geschlossen zu verwalten, zu beherrschen <strong>und</strong> gegebenenfalls als Ganzes zu<br />
erobern <strong>und</strong> zu besetzen gelte. 116 Trotz des Münchener Abkommens zweifelten selbst<br />
NSDAP-Institionen nicht gr<strong>und</strong>sätzlich daran, daß die räumliche E<strong>in</strong>heit Böhmens,<br />
113 Zitiert nach GEBEL (wie Anm. 73), S. 337; ähnlich S. 343; auch bei ZIMMERMANN (wie<br />
Anm. 73), S. 285.<br />
114 DETLEF BRANDES: Die Tschechen unter deutschem Protektorat, Teil 1: Besatzungspolitik,<br />
Kollaboration <strong>und</strong> Widerstand <strong>im</strong> Protektorat Böhmen <strong>und</strong> Mähren bis Heydrichs Tod<br />
(1939-1942), München 1969, S. 32-37, 133 f. <strong>und</strong> 222; ZIMMERMANN (wie Anm. 73), S.<br />
159 f.; GEBEL (wie Anm. 73), S. 330 f.<br />
115 Dazu auch EDGAR PSCHEIDT: Der „Sudetenatlas“ – e<strong>in</strong>e weitgehend unbekannte Quelle zur<br />
Geschichte des Reichsgaues Sudetenland, <strong>in</strong>: Region – Territorium – Nationalstaat – Europa.<br />
Beiträge zu e<strong>in</strong>er europäischen Geschichtslandschaft. Festschrift für Ludwig Hammermayer,<br />
hrsg. von WOLF D. GRUNER <strong>und</strong> MARKUS VÖLKEL, Rostock 1998 (Rostocker Beiträge<br />
zur Deutschen <strong>und</strong> Europäischen Geschichte 4), S. 377-421, hier S. 414, 416, 418.<br />
116 Beispiele bei SCHULTZ (wie Anm. <strong>20</strong>), S. 274. – So auch <strong>in</strong> [ANONYMUS]: Alliierte Kriegspolitik<br />
(wie Anm. 7), S. 1042. – Diskutiert werden kann hier nicht die fragwürdige, aber oft<br />
genannte kulturhistorische Aussage: „Böhmen bildete <strong>im</strong>mer e<strong>in</strong>e politische E<strong>in</strong>heit, d.h.<br />
e<strong>in</strong> Staatsganzes <strong>und</strong> auch e<strong>in</strong>e Kulture<strong>in</strong>heit“, so z.B. E. HERNECK: Böhmen als geographischer<br />
E<strong>in</strong>heitsbegriff, <strong>in</strong>: Deutsche Arbeit 4 (1904/05), Heft 5, S. 335-345; Heft 6, S.<br />
398-407, hier S. 400.<br />
133
zum<strong>in</strong>dest h<strong>in</strong>sichtlich Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehrsnetz, ke<strong>in</strong>e Teilungen <strong>und</strong> wesentliche<br />
Grenzveränderungen zulasse. 117<br />
Als Herrschaftsgebiet war Böhmen bereits <strong>im</strong> Spätmittelalter, <strong>und</strong> damit lange vor<br />
dem allgeme<strong>in</strong>en Territorialisierungsprozeß der Frühneuzeit, geographisch konsolidiert.<br />
Zudem war das politische Verwaltungsgebiet <strong>in</strong> weiten Teilen mit dem kirchenrechtlichen<br />
identisch. Die für die böhmischen Herrscher – wie für viele andere Dynastien<br />
– seit dem Spätmittelalter verpflichtenden Pr<strong>in</strong>zipien der territorialen Unveränderbarkeit<br />
<strong>und</strong> Unteilbarkeit 118 konnten <strong>in</strong>sbesondere deshalb für Jahrh<strong>und</strong>erte wirksam<br />
werden, weil Grenzänderungen mittlerer D<strong>im</strong>ension aufgr<strong>und</strong> der Zentralität des<br />
Landes <strong>und</strong> der ökonomisch <strong>und</strong> besiedlungsmäßig <strong>in</strong>sgesamt wenig dichten Grenzzonen<br />
kaum gew<strong>in</strong>nversprechend waren.<br />
Diese geographische Integrität wurde weder von Schweden oder Bayern <strong>in</strong> den<br />
Kriegen des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts noch von Bayern <strong>und</strong> Preußen <strong>im</strong> 18. <strong>und</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
oder von Sachsen oder Napoleon 1809 angetastet, obwohl auch damals <strong>im</strong>mer<br />
wieder neue Pläne für Arrondierungen <strong>und</strong> Gebietsabtretungen oder gar für e<strong>in</strong>e völlige<br />
Neugliederung Böhmens kursierten. 119 Ebenso verzichtete Friedrich II. von Preußen<br />
1742 <strong>im</strong> Berl<strong>in</strong>er Friedensschluß mit Österreich auf se<strong>in</strong>e ursprüngliche, wohl<br />
eher aus taktischen Gründen aufgestellte Forderung, neben Glatz den daran angrenzenden<br />
Teil Nordostböhmens um Königgrätz (Hradec Králové) Preußen bzw. Preußisch-Schlesien<br />
anzuschließen. Napoleon gab 1809 <strong>im</strong> Frieden von Schönbrunn se<strong>in</strong>e<br />
vage geäußerte Absicht rasch wieder auf, Sachsen um nordwestböhmische Gebiete<br />
bis zu Eger <strong>und</strong> Iser zu erweitern. Auch Bismarcks Politik sah <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
dem Krieg gegen Österreich 1866 ke<strong>in</strong>erlei territoriale Veränderungen für die böhmischen<br />
Länder vor.<br />
Böhmen ist somit e<strong>in</strong> Territorium, das nicht nur seit dem 15. Jahrh<strong>und</strong>ert ke<strong>in</strong>e<br />
expansiven Tendenzen mehr aufwies, sondern bis <strong>in</strong>s <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert nicht mehr ernst<br />
zu nehmenderen Bestrebungen ausgesetzt war, die auf „irgende<strong>in</strong>e Teilung oder Abtrennung,<br />
irgende<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung oder Verkürzung der <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Gebiete“ – so<br />
e<strong>in</strong>e Eidesformel böhmischer Könige aus dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert – zielten. 1<strong>20</strong><br />
Die ungewöhnliche Konstanz der alten Landesgrenzen Böhmens bzw. die Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
alte Integrität des Territoriums s<strong>in</strong>d strukturell begründet. Wirtschafts-, verkehrs-<br />
<strong>und</strong> siedlungsgeographische Gegebenheiten <strong>und</strong> weniger die re<strong>in</strong>e Topographie<br />
waren für diese historische Stabilität ursächlich. Insbesondere die <strong>im</strong> engeren<br />
Grenzbereich meist schwach ausgeprägten kulturlandschaftlichen Faktoren <strong>und</strong> Ressourcen<br />
bed<strong>in</strong>gten die Historizität der Grenzl<strong>in</strong>ien. Im böhmischen Fall wurde der direkte<br />
Grenzraum nicht peripher, weil er Grenzgebiet war, sondern, weil die Grenzregionen<br />
bedeutungsarm <strong>und</strong> kulturgeographisch wenig verdichtet waren, blieb der Ver-<br />
117 GEBEL (wie Anm. 73), S. 258 <strong>und</strong> 337-351.<br />
118 Vgl. z.B. die von Karl IV. <strong>in</strong> der Maiestas Carol<strong>in</strong>a 1355 <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Goldenen Bulle 1356<br />
verbotene Teilung oder Verkle<strong>in</strong>erung des Königreiches Böhmen; Maiestas Carol<strong>in</strong>a (wie<br />
Anm. 23), S. 69 <strong>und</strong> 71.<br />
119 So auch ZIEGLER (wie Anm. 50), S. 129.<br />
1<strong>20</strong> Maiestas Carol<strong>in</strong>a (wie Anm. 23), S. 71.<br />
134
lauf der böhmischen Außengrenzen weitgehend unstrittig <strong>und</strong> unverändert. Nur dort,<br />
wo dies nicht der Fall war, kam es während e<strong>in</strong>es halben Jahrtausends zu kle<strong>in</strong>regionalen<br />
Grenzänderungen oder zum<strong>in</strong>dest zu Diskussionen darüber. Das markanteste<br />
Beispiel für e<strong>in</strong>e prekäre Grenzsituation ist das nordmährisch-oberschlesische Gebiet<br />
von Teschen, Ostrau <strong>und</strong> Ratibor, <strong>in</strong> dem aus der Entstehung des Industriereviers e<strong>in</strong>e<br />
Grenzfrage resultierte.<br />
Nationalitäten-, Sprach-, M<strong>und</strong>arten- oder Religions- <strong>und</strong> Konfessionsgrenzen<br />
stehen nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em direkten Zusammenhang mit der Topographie oder mit den<br />
klassischen kulturgeographischen Gegebenheiten wie Besiedlung, Bodenschätze,<br />
Verkehrswege <strong>und</strong> Wirtschaftsstruktur. Der Gedanke, daß diejenigen politischen<br />
<strong>Grenzen</strong> „am stabilsten s<strong>in</strong>d, die sich entweder an ethnische, an kulturelle oder an religiöse<br />
Scheidel<strong>in</strong>ien anlehnen“ 121 , bestätigt sich zum<strong>in</strong>dest für den Fall Böhmens<br />
nicht <strong>und</strong> ist generell eher fragwürdig. Bis zum Ende des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts spielten<br />
nationale <strong>und</strong> kulturelle Aspekte <strong>in</strong> den Ause<strong>in</strong>andersetzungen über die Veränderung<br />
von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Bereich der böhmischen Länder ke<strong>in</strong>e Rolle, doch auch <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
gaben andere als ethnisch- oder sprachnationale Gründe den Ausschlag für<br />
die meisten Rektifikationen.<br />
Auch wenn die „nationalen <strong>und</strong> sprachlichen“ Mischungsverhältnisse der Bevölkerung<br />
<strong>in</strong> Böhmen vielen Beobachtern als vergleichsweise territorial e<strong>in</strong>fach zu lösende<br />
Frage erschienen (<strong>im</strong> Gegensatz etwa zu den als so unentwirrbar angesehenen<br />
Verhältnissen auf dem Balkan), mußten alle Versuche, <strong>in</strong> Böhmen e<strong>in</strong>e nationale<br />
Grenze oder die Sprachgrenze zur Aufteilung von politischen Verwaltungsgebieten zu<br />
nutzen, pr<strong>in</strong>zipiell scheitern. Da die Grenzziehung, wie sie 1938 von Deutschland erzwungen<br />
wurde, unter Berufung, aber nicht auf der Gr<strong>und</strong>lage nationaler Kriterien<br />
erfolgte, wurde die neue Trennl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> letzter Konsequenz aufgr<strong>und</strong> „praktischer“ Erwägungen<br />
<strong>und</strong> der kulturgeographischen Bed<strong>in</strong>gungen festgelegt. Die völlig neue politische<br />
Gliederung hatte jedoch, da sie meist ökonomisch <strong>und</strong> siedlungsmäßig hoch<br />
verdichtete Regionen durchschnitt, kaum Aussicht auf Bestand.<br />
Die ethnische Homogenisierung des Staates, <strong>im</strong> Laufe des vorangegangenen Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
allgeme<strong>in</strong> zum Paradigma erhoben <strong>und</strong> für den Bereich der böhmischen<br />
Länder bis 1945 mehrfach mittels „neuer“ <strong>Grenzen</strong> geplant, wurde nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg <strong>in</strong> umgekehrter Weise durch das Radikalmittel des Bevölkerungstransfers<br />
der Verwirklichung näher gebracht. Am Ende des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts sche<strong>in</strong>t bedauerlicherweise<br />
der Schluß, daß, wenn e<strong>in</strong>e staatliche oder politische Verwaltungse<strong>in</strong>heit<br />
nicht durch Grenzänderungen den sprachnationalen oder ethnischen Bevölkerungsstrukturen<br />
anzupassen ist, die Bevölkerung durch Austausch, Aussiedlung oder Ausweisung<br />
e<strong>in</strong>em national def<strong>in</strong>ierten Territorium anzugleichen sei, noch <strong>im</strong>mer logisch<br />
<strong>und</strong> unausweichlich zu se<strong>in</strong>.<br />
121 E. W. BORNTRÄGER: <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht. Gedanken zu F<strong>in</strong>alität <strong>und</strong> Relativität<br />
von Grenzziehungen, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Politik 39 (1992), Heft 1, S. 49-71, hier S.<br />
68. Bornträger ignoriert zudem das Teschener Problem sowie die Grenzfragen <strong>in</strong> der Nordslowakei,<br />
wenn er die Konstanz der tschechoslowakisch-polnischen Grenze hervorhebt.<br />
135
136
Die polnische Grenzdiskussion <strong>im</strong> Lande <strong>und</strong> <strong>im</strong> Exil<br />
(1939 – 1945)<br />
von<br />
W—odz<strong>im</strong>ierz B o r o d z i e j<br />
Bekanntlich bef<strong>in</strong>det sich Polen seit sechs Jahren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase des Umbruchs, <strong>in</strong> der<br />
alles anders wird: das politische <strong>und</strong> ökonomische System, alltägliche Verhaltensweisen<br />
<strong>und</strong> Überlebensmuster, soziale Schichtung <strong>und</strong> Öffentlichkeit. Stabil sche<strong>in</strong>t <strong>in</strong><br />
diesem Augenblick paradoxerweise nur das, was jahrzehntelang Anlaß deutschpolnischer<br />
Streitereien <strong>und</strong> polnisch-sowjetischer Verdächtigungen gewesen ist: die<br />
Staatsgrenzen. Nach fünfzig Jahren s<strong>in</strong>d sie das vielleicht e<strong>in</strong>zige Ergebnis des Zweiten<br />
Weltkriegs, das von ke<strong>in</strong>er Seite <strong>im</strong> In- <strong>und</strong> Ausland <strong>in</strong> Frage gestellt wird, das<br />
weder revidiert noch aufgelöst werden soll – e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit <strong>und</strong> gerade<br />
deshalb e<strong>in</strong>e Rarität <strong>in</strong> bewegten Zeiten.<br />
Die gesellschaftliche Akzeptanz für den 1945 zustande gekommenen Grenzverlauf<br />
hat mit den erbitterten publizistischen, juristischen <strong>und</strong> geschichtswissenschaftlichen<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen der letzten Jahrzehnte wenig zu tun. Bekanntermaßen haben<br />
Historiker, Journalisten <strong>und</strong> Politiker nach 1945 kont<strong>in</strong>uierlich versucht, ihrer eigenen<br />
Partei das Hauptverdienst für die Gew<strong>in</strong>ne <strong>im</strong> Osten <strong>und</strong> die Schuldlosigkeit für die<br />
Verluste <strong>im</strong> Osten anzudichten. Die Effektivität dieser Bemühungen sche<strong>in</strong>t <strong>im</strong> Lichte<br />
des heutigen kollektiven Bewußtse<strong>in</strong>s ger<strong>in</strong>g: Je stärker das Stichwort „Jalta“ die<br />
Diskussion um die Volksrepublik Polen prägt, desto weniger glaubhaft wirken alle<br />
Versicherungen, denen zufolge die „Rückkehr“ der „Wiedergewonnenen Gebiete“<br />
polnischen Politikern, e<strong>in</strong>erlei welcher couleur, zu verdanken sei. Auf den Punkt<br />
br<strong>in</strong>gt diese E<strong>in</strong>sicht der Satiriker Micha— Ogórek, der <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em „Polenführer“ von<br />
1991 die „geographische Lage“ des Landes folgendermaßen def<strong>in</strong>iert:<br />
„Je nach historischer Epoche sollte man Polen weiter östlich oder weiter westlich<br />
suchen. Allgeme<strong>in</strong> könnte man sagen, daß Polen <strong>im</strong> Pr<strong>in</strong>zip zwischen dem 24. <strong>und</strong><br />
dem 38. Breitengrad <strong>im</strong> Osten <strong>und</strong> zwischen dem 14. <strong>und</strong> 16. Breitengrad <strong>im</strong> Westen<br />
liegt; irgendwo <strong>in</strong> dieser Gegend müßte man es f<strong>in</strong>den. Wenn nicht, so ist gerade Teilungszeit<br />
(...) Die heutige Ostgrenze Polens ist die Grenze des russischen Teilungsgebiets<br />
nach der Dritten Teilung <strong>und</strong> verläuft wie 1795. Sie wurde von der Zar<strong>in</strong> Kathar<strong>in</strong>a<br />
best<strong>im</strong>mt. Die Westgrenze knüpft direkt an das Jahr 1138 an, als sie zum letzten<br />
Mal auf diese Art verlief. Der Ideenspender war Boleslaus Schiefm<strong>und</strong> (...) Die kürzeste<br />
Grenze hat Polen mit Rußland. Rußland bewacht jedoch die <strong>Grenzen</strong> auf dem<br />
längsten Abschnitt, auch auf dem deutsch-polnischen, <strong>und</strong> das auf beiden Seiten (...)<br />
Seitdem es diese <strong>Grenzen</strong> gibt, haben ihren Platz gewechselt: Ustrzyki Dolne – von<br />
137
der UdSSR nach Polen; Glatz wechselte auf die böhmische Seite <strong>und</strong> zurück, Sw<strong>in</strong>emünde<br />
– von Deutschland via UdSSR nach Polen. Elb<strong>in</strong>g änderte se<strong>in</strong>e Lage von e<strong>in</strong>er<br />
Meeresstadt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>nenstadt nach dem Verlust des Zugangs zum Meer. Polen<br />
hält se<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong> für unverrückbar.“ 1<br />
Damit ist e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>sätzliche Vorbemerkung zum Thema Grenzdiskussion <strong>im</strong><br />
Lande <strong>und</strong> <strong>im</strong> Exil 1939-1945 po<strong>in</strong>tiert: Die Fragestellung erfordert seit dem Ende der<br />
80er Jahre ke<strong>in</strong>e Zensurenverteilung mehr, sei es für prophetische Gaben oder für<br />
Kurzsichtigkeit. Der Beweis, daß sowohl die Ost- als auch die Westgrenze wenig mit<br />
geschichtlicher Logik oder Gerechtigkeit zu tun haben, ist längst erbracht, ebenso wie<br />
der Nachweis, daß der Verlust Lembergs oder der Gew<strong>in</strong>n Breslaus <strong>in</strong> unvergleichbar<br />
größerem Maße dem Kräftespiel der Großen Drei zuzuschreiben s<strong>in</strong>d als der <strong>in</strong>nerpolnischen<br />
Diskussion.<br />
Dennoch s<strong>in</strong>d die Gr<strong>und</strong>züge dieser Diskussion nicht ohne Interesse. In Exil <strong>und</strong><br />
<strong>im</strong> Untergr<strong>und</strong> wurden während des Zweiten Weltkriegs vielerlei Pläne entworfen,<br />
die nach 1945 direkt <strong>in</strong> die Archive wanderten. Die harte Prüfung durch die Realität<br />
überstanden nur die wenigsten. Aber gerade die Mitarbeiter des Westbüros des regierungstreuen<br />
Widerstands fanden als nahezu e<strong>in</strong>zige größere, geschlossene Personengruppe<br />
des alten Establishments sofort Verwendung <strong>im</strong> neuen Beamtenapparat. E<strong>in</strong>ige<br />
kommunistische Spitzenpolitiker wie W—adys—aw Gomu—ka oder Zygmunt Modzelewski<br />
scheuten offensichtlich ke<strong>in</strong>e Mühe, um die e<strong>in</strong>zigen „Westspezialisten“, die<br />
es damals <strong>im</strong> Lande gab, <strong>im</strong> M<strong>in</strong>isterium für die Wiedergewonnenen Gebiete bzw. <strong>im</strong><br />
Außenm<strong>in</strong>isterium unterzubr<strong>in</strong>gen. In ihren Memoiren vermittelten diese den E<strong>in</strong>druck,<br />
der perfekt mit den Thesen der kommunistischen Propaganda übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mte:<br />
Es habe e<strong>in</strong> konsequentes Streben des aufgeklärten <strong>und</strong> staatsbewußten Teils der alten<br />
Elite gegeben, den Schwerpunkt Polens nach Westen zu verlegen. 2 Daß dabei ausgerechnet<br />
Roman Dmowski als Urvater dieser Idee <strong>im</strong> H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> auftauchte, erschwerte<br />
die Beweisführung nicht unbed<strong>in</strong>gt; je deutlicher sich <strong>in</strong> den 60er Jahren die<br />
Legit<strong>im</strong>ation des Systems von e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternationalistisch-ideologischen zu e<strong>in</strong>er national-staatsmännischen<br />
wandelte, desto größer wurde der Wert geschichtlich f<strong>und</strong>ierter<br />
Tradition; <strong>in</strong> diesem Zusammenhang gewährte gerade die Verb<strong>in</strong>dung zu Dmowski<br />
<strong>und</strong> Jan Pop—awski den begehrten Anstrich von nationaler Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Orig<strong>in</strong>alität.<br />
3 Damit ist die erste, <strong>in</strong> der Literatur der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre vertretene These umrissen:<br />
Die kle<strong>in</strong>e Gruppe der „Westexperten“ habe sich gegen die Mehrheit der auf<br />
1 MICHA¡ OGÓREK: Przewodnik po Polsce [Führer durch Polen], Warszawa 1991, S. 5 f.<br />
2 Als Beispiel für den Untergr<strong>und</strong> LEOPOLD GLUCK: Od ziem postulowanych do ziem odzyskanych<br />
[Von beanspruchten zu wiedergewonnenen Gebieten], Warszawa 1971; für das<br />
Londoner Exil JÓZEF WINIEWICZ: Co pamiętam z dlugiej drogi życia [Was mir auf e<strong>in</strong>em<br />
langen Lebensweg <strong>im</strong> Gedächtnis geblieben ist], Pozna¹ 1985.<br />
3 Zur Entwicklung der sog. myśl zachodnia siehe BERNARD PIOTROWSKI: O Polskę nad Odrą<br />
i Baltykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Pozna¹skiego (1919-<br />
1939) [Polen an der Oder <strong>und</strong> an der Ostsee. Der Westgedanke <strong>und</strong> die deutschlandk<strong>und</strong>lichen<br />
Forschungen der Universität Posen (1919-1939)], Pozna¹ 1987; MARIAN MROCZKO:<br />
Polska myśl zachodnia 1918-1939 [Der polnische Westgedanke 1918-1939], Pozna¹ 1986.<br />
138
den Osten fixierten alten Elite durchgesetzt, die Unterstützung der Gesellschaft für die<br />
Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie gewonnen <strong>und</strong> damit den Boden für die Rückkehr Polens <strong>in</strong> die alte<br />
piastische He<strong>im</strong>at vorbereitet.<br />
In e<strong>in</strong>e ähnliche Richtung geht die These von der entscheidenen Rolle der Kommunisten<br />
bei der Westverschiebung Polens. Im Schrifttum des kommunistischen Exils<br />
<strong>und</strong> Untergr<strong>und</strong>s gibt es bekanntlich kaum Belege für e<strong>in</strong>e konsequente Orientierung<br />
auf die Zielpunkte Breslau <strong>und</strong> Stett<strong>in</strong>; diese tauchen erst <strong>in</strong> den letzten Monaten des<br />
Krieges nach Unterzeichnung des polnisch-sowjetischen Abkommens vom 26. Juli<br />
1944 auf. Das historische Verdienst liegt daher nach Marian Orzechowski 4 <strong>und</strong> anderen<br />
Parteihistorikern <strong>in</strong> der Absage an die Ostgrenze von 1939, <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> die<br />
Zwangsläufigkeit historischer Prozesse, deren Krönung die „Rückkehr“ zur Oder-<br />
Neiße-L<strong>in</strong>ie darstellt. Auch diese Argumentation hat jedoch ihre Tücken: Die kommunistische<br />
Propaganda der Kriegs- <strong>und</strong> Nachkriegszeit sperrte sich lange Zeit gegen<br />
die E<strong>in</strong>sicht von e<strong>in</strong>em direkten Zusammenhang zwischen den Verlusten <strong>im</strong> Osten<br />
<strong>und</strong> dem Gew<strong>in</strong>n <strong>im</strong> Westen. Noch 1969 schaffte Orzechowski <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er bereits erwähnten,<br />
bis heute gr<strong>und</strong>legenden Arbeit über die Westverschiebung Polens den<br />
Sprung über diese Latte nicht. Das Kompensationspr<strong>in</strong>zip, das ja <strong>im</strong> diplomatischen<br />
Kräftespiel von 1943-1945 e<strong>in</strong>e zentrale Rolle gespielt hatte, kommt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Buch<br />
nur am Rande vor. 5<br />
Die dritte These wird von e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>zelperson, nämlich von Sarah Meiklejohn Terry<br />
vertreten. In ihrem Buch über Władysław Sikorski 6 versuchte sie, den ersten M<strong>in</strong>isterpräsidenten<br />
der Exilregierung als e<strong>in</strong>samen Vorreiter des polnisch-sowjetischen<br />
Ausgleichs auf der Basis e<strong>in</strong>er partiellen Westverschiebung Polens zu präsentieren.<br />
1939-1943 sei er an se<strong>in</strong>en <strong>in</strong>nenpolitischen Gegnern <strong>und</strong> an den Angelsachsen gescheitert,<br />
nach 1945 sei niemand daran <strong>in</strong>teressiert gewesen, se<strong>in</strong>e Rolle bei der neuen<br />
Grenzziehung der Vergessenheit zu entreißen. Die Argumentation von Frau Terry hat<br />
durchaus ihre Vorzüge, sie revidiert das von beiden erstgenannten Richtungen vertretene<br />
Bild der „Ostfixierung“ des polnischen Exils <strong>in</strong> London erheblich. Gegen sie<br />
spricht h<strong>in</strong>gegen die e<strong>in</strong>hellige Ablehnung ihrer Kernthese durch polnische Autoren 7 ,<br />
die auf ihre Arbeit e<strong>in</strong>gegangen s<strong>in</strong>d: Zu zahlreich s<strong>in</strong>d die Gegenbeweise, zu dürftig<br />
sche<strong>in</strong>t die Quellenbasis für ihre Behauptung, derzufolge der M<strong>in</strong>isterpräsident <strong>im</strong><br />
4 MARIAN ORZECHOWSKI: Odra-Nysa Łużycka-Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II<br />
wojny światowej [Oder – Lausitzer Neiße – Ostsee <strong>im</strong> polnischen politischen Denken der<br />
Ära des Zweiten Weltkriegs], Wroc—aw etc. 1969.<br />
5 Nur wenn das Kompensationspr<strong>in</strong>zip ausnahmsweise von den Kommunisten <strong>in</strong>s Spiel gebracht<br />
wurde, bewertete es der Autor als e<strong>in</strong> „nützliches <strong>und</strong> unersetzliches Argument“<br />
(ebenda, S. 235 f.); die gesamte Argumentation der Gegenseite unterzog er e<strong>in</strong>er erbarmungslosen<br />
Kritik.<br />
6 SARAH MEIKLEJOHN TERRY: Poland´s Place <strong>in</strong> Europe. General Sikorski and the Orig<strong>in</strong> of<br />
the Oder-Neisse L<strong>in</strong>e, 1939-1943, Pr<strong>in</strong>ceton 1983.<br />
7 Vgl. die skeptischen Bemerkungen von WINIEWICZ (wie Anm. 2), S. 291 ff., <strong>und</strong> WALEN-<br />
TYNA KORPALSKA: Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna [E<strong>in</strong>e politische<br />
Biographie], Wrocław etc. 1981, S. 235.<br />
139
Exil seit 1940 auf e<strong>in</strong>e Neuordnung der mitteleuropäischen Landkarte unter Berücksichtigung<br />
russischer Territorialansprüche h<strong>in</strong>gearbeitet habe.<br />
Das Problem aller drei Interpretationsmuster liegt nun dar<strong>in</strong>, daß sie – explizit wie<br />
die beiden ersten, <strong>im</strong>plizit <strong>im</strong> Fall des dritten – den Maßstab für ihr Urteil aus dem<br />
heutigen Verlauf der polnisch – deutschen Grenze ableiten. Möglichkeiten für e<strong>in</strong> anderes<br />
Endergebnis gab es aber bekanntlich genug: Hätten sich die Amerikaner <strong>in</strong><br />
Potsdam auf die Glatzer Neiße versteift, hätten die Sowjets ihr Deutschlandspiel<br />
schon 1944 begonnen <strong>und</strong> Breslau bzw. Stett<strong>in</strong> <strong>in</strong> ihrer Besatzungszone belassen – der<br />
Bezugspunkt der Nachkriegsliteratur wäre e<strong>in</strong> anderer gewesen. Nun kann man ihre<br />
Tendenz <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em engeren S<strong>in</strong>n auslegen, als es offensichtlich die Absicht der Autoren<br />
gewesen ist. Es g<strong>in</strong>ge dann nicht mehr um Belege, welches politische Lager frühzeitig<br />
die künftigen Entscheidungen vorausgesehen <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e propagandistischen Bestrebungen<br />
auf die Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie fixiert hat. Statt dessen müßte es sich dann um<br />
den Nachweis handeln, welche Gruppierungen die Lösung der Grenzfrage <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne<br />
der polnischen Staatsraison den eigentlichen Entscheidungsträgern <strong>und</strong> der Gesellschaft<br />
unter Besatzungsherrschaft derart nachhaltig suggeriert haben, daß die Chancen<br />
für e<strong>in</strong>en derartigen Kriegsschluß erheblich gestiegen s<strong>in</strong>d?<br />
Die Frage <strong>im</strong>pliziert natürlich, daß wir genau wissen, was die polnische Staatsraison<br />
1939-1945 gewesen ist. Die Literatur über die Westverschiebung geht ja davon<br />
aus, daß der Tausch von 180 000 km 2 <strong>im</strong> Osten gegen 103 000 km 2 <strong>im</strong> Westen diesen<br />
Begriff trifft. Genau umgekehrt verstand ihn aber die Mehrheit des Londoner Establishments;<br />
so schildert z.B. W—adys—aw Pobóg-Mal<strong>in</strong>owski, der Historiker des Exils,<br />
ausführlich den Kampf der Regierung um die Ostgrenze <strong>und</strong> vermag die Westverschiebung<br />
ausschließlich <strong>in</strong> diesem Zusammenhang zu sehen – ohne sie auf mehreren<br />
h<strong>und</strong>ert Seiten se<strong>in</strong>es Handbuchs zu thematisieren. 8 Wir stoßen an dieser Stelle auf<br />
e<strong>in</strong> Problem, dessen Existenz nur angedeutet werden kann. Würde nämlich jemand<br />
versuchen, Orzechowski <strong>und</strong> Pobóg-Mal<strong>in</strong>owski parallel zu lesen, könnte er leicht<br />
den E<strong>in</strong>druck davontragen, Untersuchungen über zwei unterschiedliche Realitäten vor<br />
Augen zu haben: Gr<strong>und</strong>verschieden s<strong>in</strong>d Auswahl <strong>und</strong> Gewichtung der Tatsachen, oft<br />
direkt entgegengesetzt die Wertmuster, ebenso verschieden fällt zwangsläufig das<br />
Endurteil aus.<br />
In bezug auf unser Thema kann man sich die Erklärung leicht machen mit dem<br />
H<strong>in</strong>weis, daß die Westexperten <strong>in</strong> der Regel mehr oder m<strong>in</strong>der eng mit der Nationaldemokratie<br />
verb<strong>und</strong>en waren <strong>und</strong> daß sie <strong>in</strong> ihrer überwiegenden Mehrheit aus westpolnischen<br />
Gebieten stammten. In der Tat klagten sie übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mend über die Verständnislosigkeit<br />
ihrer ost- bzw. zentralpolnischen Gesprächspartner 9 ; Józef W<strong>in</strong>iewicz,<br />
<strong>im</strong> Londoner Exil Beamter <strong>im</strong> M<strong>in</strong>isterium Seyda, malt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Er<strong>in</strong>nerungen<br />
e<strong>in</strong> Bild des permanenten Mißverständnisses zwischen „West“- <strong>und</strong> „anderen“ Polen:<br />
1939 waren beileibe nicht alle Spuren der Teilungszeit verwischt. Dennoch greift diese<br />
Erklärung zu kurz. Denn: Die Ause<strong>in</strong>andersetzung um die Priorität von West- oder<br />
8 WŁADYSŁAW POBÓG-MALINOWSKI: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 [Die<br />
neueste politische Geschichte Polens 1864-1945], Bd. II/2, Londyn 1960.<br />
9 Vgl. GLUCK (wie Anm. 2), S. 62 f.; WINIEWICZ (wie Anm. 2), pass<strong>im</strong>.<br />
140
Ostgrenze war nicht nur e<strong>in</strong>e Fortsetzung des alten Streits zwischen Dmowski <strong>und</strong><br />
Pi—sudski, sie war es nicht e<strong>in</strong>mal pr<strong>im</strong>är. Vielmehr war sie an erster Stelle e<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
um die Souveränität Polens, um se<strong>in</strong>e gesellschaftspolitische Verfassung<br />
<strong>und</strong> um die Rolle der Sowjetunion <strong>in</strong>nerhalb des künftigen polnischen Staates.<br />
Die Westverschiebung bzw. der Verlust von Wilna <strong>und</strong> Lemberg bedeuteten mehr als<br />
die Beschneidung der territorialen Integrität, derentwegen Polen den Kampf gegen<br />
das Dritte Reich aufgenommen hatte; daß e<strong>in</strong> nach Westen verschobenes Polen „logischerweise<br />
militärisch, ökonomisch <strong>und</strong> politisch <strong>in</strong> die Verantwortlichkeit der Sowjetunion<br />
fallen muß“ 10 hatte nicht nur George F. Kennan erkannt. Polnische Diplomaten<br />
<strong>und</strong> Politiker haben es ihren angelsächsischen Gesprächspartnern oft vorgehalten,<br />
<strong>und</strong> der damalige M<strong>in</strong>isterpräsident Tomasz Arciszewski beg<strong>in</strong>g <strong>im</strong> Dezember<br />
1944 den Fehler, das Dilemma öffentlich anzusprechen: Die Verschiebung Polens an<br />
Oder <strong>und</strong> Lausitzer Neiße war ohne die Aufgabe des bisherigen Souveränitätsbegriffs,<br />
ohne die Preisgabe der Zweiten Republik <strong>und</strong>enkbar. In der Ause<strong>in</strong>andersetzung um<br />
die <strong>Grenzen</strong> g<strong>in</strong>g es also um mehr als um materielle oder strategische Gew<strong>in</strong>n- <strong>und</strong><br />
Verlustrechnungen; es g<strong>in</strong>g darum, ob e<strong>in</strong> souveränes, <strong>im</strong> Westen leicht vergrößertes<br />
Polen zu den Siegern des Zweiten Weltkriegs zählen werde – oder ob es die Opferung<br />
se<strong>in</strong>er Ostgebiete zum Zwecke der Saturierung e<strong>in</strong>er Großmacht zuläßt, ähnlich große<br />
Gebietsverluste wie das Dritte Reich h<strong>in</strong>n<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> die Wiederbegründung se<strong>in</strong>er Unabhängigkeit<br />
an e<strong>in</strong>e Schutzmachtrolle Rußlands b<strong>in</strong>den läßt. Nur aus dieser Alternative<br />
heraus wird die eigentliche Bedeutung der Grenzdiskussion verständlich: Wer für<br />
„Riga“ (d.h. die Unantastbarkeit der polnischen Ostgrenze von 1921) optierte, setzte<br />
sich für die Fortsetzung der Zweiten Republik e<strong>in</strong>; wer für „Jalta“, d.h. den def<strong>in</strong>itiven<br />
Verzicht auf die Ostgebiete durch die Westverschiebung wiedergutmachen wollte,<br />
wollte nur retten, was noch zu retten war. 11<br />
Diesen H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> gilt es zu beachten, wenn man die Grenzdiskussion referiert.<br />
Andererseits – <strong>und</strong> das macht das Thema derart schwierig – gab es <strong>in</strong> den Plänen <strong>und</strong><br />
Programmen e<strong>in</strong>e Reihe von Elementen, die mit dem oben skizzierten Dilemma<br />
nichts oder nur wenig zu tun hatten. Wenn etwa die radikale Rechte die Wiederherstellung<br />
des „alten slawischen Siedlungsgebiets“ zwischen Elbe <strong>und</strong> Oder forderte,<br />
wenn sie die „m<strong>in</strong><strong>im</strong>ale Sicherheitssphäre“ Polens <strong>im</strong> „Städteviereck Stett<strong>in</strong> – Triest –<br />
Odessa – Pskov mit der Mündung der Narva“ ortete, so entwickelte sie das Erbe<br />
Dmowskis <strong>und</strong> Pop—awskis, ohne auch nur ansatzweise auf die realen Verhältnisse der<br />
vierziger Jahre e<strong>in</strong>zugehen. In diesen Zusammenhang gehören die oft bemühten Pläne<br />
von e<strong>in</strong>em „Imperium der Polnischen Nation“, das dem angeborenen polnischen<br />
„Herrschafts<strong>in</strong>st<strong>in</strong>kt“ Rechnung tragen, „Elemente unserer Zivilisation“ den mitteleuropäischen<br />
Verbündeten beibr<strong>in</strong>gen sollte u.a. mehr. Das realpolitische Problem wurde<br />
<strong>in</strong> diesen <strong>und</strong> ähnlichen Denkfiguren dadurch gelöst, daß man Rußland zum<br />
Trümmerhaufen erklärte. Der westliche Fe<strong>in</strong>d sollte durch Begradigung <strong>und</strong> Verkürzung<br />
der deutsch-polnischen Grenze auf die Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie <strong>im</strong> Schach gehalten<br />
10 GEORGE F. KENNAN: Memoiren e<strong>in</strong>es Diplomaten, 4. Aufl. München 1983, S. 222.<br />
11 Exemplarisch diese Haltung bei Jakub Berman <strong>im</strong> Interview mit TERESA TORAÔSKA, dt.<br />
Übersetzung: Die da oben. Polnische Stal<strong>in</strong>isten zum Sprechen gebracht, Köln 1987.<br />
141
werden 12 ; e<strong>in</strong>e Vorstellung, die 1941 genauso real oder irreal se<strong>in</strong> mochte wie das<br />
Programm der Ostexpansion.<br />
Die Massenpartei der Rechten, die Nationaldemokratie, hatte die Oder-Neiße-<br />
L<strong>in</strong>ie als mögliches Friedensziel bereits vor Kriegsbeg<strong>in</strong>n <strong>in</strong>s Auge gefaßt. 13 Im<br />
Sommer 1941 fand sich dieser Plan ebenfalls <strong>im</strong> Mittelpunkt des Grenzprogramms<br />
der Bauernpartei. 14 Zurückhaltender zeigten sich <strong>in</strong> diesem Punkt die christlichdemokratischen<br />
Parteien <strong>und</strong> die Sozialisten – die e<strong>in</strong>zigen, die sich vom Programm<br />
der Vere<strong>in</strong>igten Staaten Europas angesprochen fühlten <strong>und</strong> bis 1944 an der Unmöglichkeit<br />
von millionenhaften Massenaussiedlungen festhielten. Diese relativ kle<strong>in</strong>en<br />
Gruppierungen des Zentrums <strong>und</strong> der nichtkommunistischen L<strong>in</strong>ken gaben sich auch<br />
h<strong>in</strong>sichtlich der europäischen Nachkriegsordnung wesentlich moderater. Das antideutsche<br />
Sicherheitssytem wollte man eher e<strong>in</strong>em gesamteuropäischen Bündnis als<br />
e<strong>in</strong>em von Polen geführten Imperium anvertrauen.<br />
Die Exilregierung blieb h<strong>in</strong>ter den Erwartungen der größten Parteien des Untergr<strong>und</strong>s<br />
weit zurück. Zwar sondierte der neue Außenm<strong>in</strong>ister August Zaleski bereits<br />
<strong>im</strong> Oktober 1939 die westlichen Verbündeten h<strong>in</strong>sichtlich der polnischen Kontrolle<br />
über Ostpreußen, <strong>und</strong> <strong>in</strong> der ersten Nummer des Informationsbullet<strong>in</strong>s des Außenm<strong>in</strong>isteriums<br />
vom November diesen Jahres f<strong>in</strong>den wir den H<strong>in</strong>weis, daß die künftige Sicherheit<br />
Polens die Übernahme Ostpreußens erfordert. 15 Das außenpolitische Programm<br />
der Regierung mußte jedoch nach Lage der D<strong>in</strong>ge auf die Verteidigung der<br />
Ostgrenze fixiert se<strong>in</strong>; offensichtlich brauchte man ke<strong>in</strong>e Hellseherkünste, um die hier<br />
drohende Gefahr frühzeitig zu erkennen. Jan Szembek, bis 1939 Stellvertreter Becks<br />
<strong>im</strong> polnischen Außenm<strong>in</strong>isterium, war gewiß ke<strong>in</strong> Vordenker se<strong>in</strong>es Amtes, sah aber<br />
schon zu Beg<strong>in</strong>n des Krieges mit aller Deutlichkeit den Zusammenhang zwischen der<br />
Neuziehung der Ost- <strong>und</strong> der Westgrenze. Die Entscheidungen h<strong>in</strong>sichtlich der Westgrenzen<br />
bereiteten ihm weniger Bauchschmerzen, äußerte er <strong>in</strong> drei Gesprächen mit<br />
12<br />
Vgl. dazu neben ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 14-28, ANDRZEJ FRISZKE: Myśl polityczna<br />
Polski Podziemnej 1939-1945 [Das politische Denken Polens <strong>im</strong> Untergr<strong>und</strong> 1939-<br />
1945], <strong>in</strong>: DERS. u.a: Polska Podziemna 1939-1945 [Polen <strong>im</strong> Untergr<strong>und</strong> 1939-1945],<br />
Warszawa 1991, S. 143-229.<br />
13<br />
Vgl. dazu JERZY JANUSZ TEREJ: Rzeczywistość i polityka [Wirklichkeit <strong>und</strong> Politik], Warszawa<br />
1979, S. 102, 376.<br />
14<br />
Dazu ausführlich STANISŁAW DĄBROWSKI: Koncepcje powojennych granic Polski w programach<br />
i działalności polskiego ruchu ludowego w latach 1935-1945[Die Konzeptionen<br />
der Nachkriegsgrenzen Polens <strong>in</strong> den Programmen <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Tätigkeit der polnischen<br />
Volks(Bauern-)bewegung <strong>in</strong> den Jahren 1939-1945], Wrocław etc. 1971, hier: S. 15 f.<br />
15<br />
Dazu <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren historischen Kontext WOJCIECH WRZESIÔSKI: Warmia i Mazury w<br />
polskiej myśli politycznej 1864-1945 [Ermland <strong>und</strong> Masuren <strong>im</strong> polnischen politischen<br />
Denken 1864-1945], Warszawa 1984, S. 348 ff.; die ursprüngliche britische Kritik an diesen<br />
Plänen („I am sorry to see that General Sikorski is toy<strong>in</strong>g with the East Prussian ambition<br />
which always struck me as rather silly when advanced by the wilder Polish <strong>im</strong>perialists<br />
before the war (...) the Poles are <strong>in</strong>curably romantic <strong>in</strong> their ideas“) zit. bei TERRY (wie<br />
Anm. 6), S. 151 f. Zur weiteren Entwicklung vgl. DETLEF BRANDES: Großbritannien <strong>und</strong><br />
se<strong>in</strong>e osteuropäischen Alliierten 1939-1943, München 1988, S. 106 ff.<br />
142
führenden Diplomaten <strong>und</strong> Politikern der neuen Regierung <strong>im</strong> Oktober 1939: „Ich<br />
kann mich aber mit dem Gedanken der Abtretung Lembergs nicht abf<strong>in</strong>den. (...) Was<br />
die Ostgebiete betrifft, so fürchte ich, daß die Alliierten wegen Rußland unsere Interessen<br />
mit leichter Hand opfern könnten.“ 16<br />
In den ersten drei Kriegsjahren konzentrierte sich die Regierung daher auf die<br />
Wiederholung der Forderung nach Wiederherstellung der Ostgrenze von 1921; der<br />
Wunsch nach „gerechter Wiedergutmachung“ <strong>im</strong> Westen wurde bewußt unpräzise<br />
gehalten. 17 Stal<strong>in</strong>s Angebot vom Dezember 1941, die polnischen Ansprüche auf Ostpreußen<br />
<strong>und</strong> die Oderl<strong>in</strong>ie zu unterstützen, wurde zwar nicht direkt ausgeschlagen,<br />
aber auch nicht konsequent <strong>in</strong> den Grenzverhandlungen mit den Alliierten e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Im Gegenzug wolle er die polnisch-sowjetische Grenze „e<strong>in</strong> bißchen“ revidieren, soll<br />
Stal<strong>in</strong> damals zu Sikorski gesagt haben; dieses „čut’-čut’“ rief bei den Polen tiefes<br />
Mißtrauen hervor 18 , das mit der „russischen Karte“ verb<strong>und</strong>ene Risiko war offenk<strong>und</strong>ig:<br />
„Wir müssen uns e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung zwischen unseren Westforderungen mit der<br />
Frage der Ostgrenze widersetzen“ – heißt es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em regierungs<strong>in</strong>ternen Thesenpapier<br />
vom Dezember 1943 –, „weil dies der Weg zum Verlust der Ostgebiete wäre, auf<br />
jeden Fall zu dem Verlust e<strong>in</strong>es beachtlichen Teils davon mit Wilna <strong>und</strong> zur E<strong>in</strong>kreisung<br />
Polens durch die Sowjets“. 19<br />
Freilich war der umgekehrte Gedankengang, daß nämlich Polen unabhängig von<br />
der Frage der Ostgrenze Anspruch auf Entschädigungen <strong>im</strong> Westen habe, nach Lage<br />
der D<strong>in</strong>ge schon 1941 e<strong>in</strong>germaßen theoretisch; trotzdem wurde er bis 1944 – zuletzt<br />
nur noch mit größter Mühe – aufrechterhalten. Parallel dazu versuchte der damalige<br />
M<strong>in</strong>isterpräsident Stanisław Mikołajczyk, die sowjetischen Ansprüche zu se<strong>in</strong>en<br />
Gunsten zu wenden. In Gesprächen mit den Angelsachsen, schrieb er Anfang 1944 an<br />
die Führung des Untergr<strong>und</strong>s, „wirkt das Argument am besten, daß sie, je mehr sie<br />
uns <strong>im</strong> Osten beschneiden, desto mehr <strong>im</strong> Westen geben <strong>und</strong> desto mehr Deutsche<br />
vertrieben werden müssen. (...) Jeder größere Schaden Polens <strong>im</strong> Osten steigert se<strong>in</strong>e<br />
Ansprüche <strong>im</strong> Westen, <strong>in</strong>klusive der Entfernung e<strong>in</strong>er größeren Zahl der Deutschen“.<br />
<strong>20</strong><br />
16<br />
JAN SZEMBEK: Diariusz. Wrzesie¹-grudzie¹ 1939 [Tagebuch September bis Dezember<br />
1939], hrsg. von BOGDAN GRZELOÔSKI, Warszawa 1989, S. 97, 109, 125.<br />
17<br />
„(...) die künftigen <strong>Grenzen</strong> Polens müssen die Sicherheit des Landes als e<strong>in</strong>es Bestandteiles<br />
der europäischen Ordnung gewährleisten; sie müssen Polen die vitale Notwendigkeit<br />
des breiten Zugangs zum Meer sichern, der entsprechend vor fremden E<strong>in</strong>griffen geschützt<br />
wäre“; den Text der polnischen Beitrittserklärung zur Atlantik-Charta zit. nach ORZE-<br />
CHOWSKI (wie Anm. 4), S. 57. Ebenda, S. 52-71, <strong>und</strong> WRZESIÔSKI (wie Anm. 15), S. 348-<br />
357, zahlreiche H<strong>in</strong>weise auf die Äußerungen des Exilkab<strong>in</strong>etts. E<strong>in</strong> knapper Überblick<br />
auch bei WIES¡AW DOBRZYCKI: Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947 [Die<br />
Westgrenze <strong>in</strong> der polnischen Politik 1944-1947], Warszawa 1974, S. 19-30.<br />
18<br />
Dazu ausführlich, wenngleich nicht ganz überzeugend, TERRY (wie Anm. 6), S. 245-256.<br />
19<br />
ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 68.<br />
<strong>20</strong><br />
Ebenda, S. 70. Ebenda, auch bei t owbpfÔphf= <strong>und</strong> DOBRZYCKI zahlreiche H<strong>in</strong>weise auf<br />
dieses Motiv <strong>in</strong> Regierungspapieren.<br />
143
Die Exilregierung zeigte sich <strong>in</strong> der Frage der Westgrenzen nicht nur wegen<br />
ostpolitischer Erwägungen <strong>und</strong> wegen des angelsächsischen Widerstands sehr<br />
bedächtig. Das von Miko—ajczyk erwähnte Problem der deutschen Bevölkerung war<br />
selbst 1944 ke<strong>in</strong>eswegs def<strong>in</strong>itiv entschieden. In se<strong>in</strong>er Studie über Masuren <strong>und</strong> das<br />
Ermland zeigt Wojciech Wrzesiński, daß gerade diese Frage für alle polnischen<br />
Gruppen „das größte Problem“ darstellte, das sich <strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick auf die künftige<br />
E<strong>in</strong>verleibung Ostpreußens stellte. 21 Die Lösungsvorschläge variierten zwischen<br />
gänzlicher Aussiedlung <strong>und</strong> allmählicher Ass<strong>im</strong>ilierung möglichst großer<br />
Personengruppen mit e<strong>in</strong>er Reihe von Zwischenstufen; das nach Kriegsende<br />
tatsächlich realisierte Konzept kam den Planungen der Rechten wohl am nächsten.<br />
Die zahlreichen Schwierigkeiten, die mit der Formulierung e<strong>in</strong>es regierungsamtlichen<br />
„Westprogramms“ zusammenh<strong>in</strong>gen, wurden erst 1942 überw<strong>und</strong>en. In se<strong>in</strong>em<br />
Beschluß vom 7. Oktober legte sich das Kab<strong>in</strong>ett Sikorski auf die „E<strong>in</strong>verleibung<br />
Danzigs, Ostpreußens <strong>und</strong> des Oppelner Schlesien“ fest. E<strong>in</strong>e Ausdehnung des<br />
Staatsgebiets weiter westlich hielt man <strong>in</strong> London für unrealistisch; offensichtlich unter<br />
dem Druck des Untergr<strong>und</strong>s gelang es aber dem für Nachkriegsplanungen zuständigen<br />
M<strong>in</strong>ister Marian Seyda, die Idee e<strong>in</strong>er Zone der „engeren polnischen Besatzung“<br />
westlich der neuen Staatsgrenze <strong>im</strong> Kab<strong>in</strong>ett durchzusetzen; sie sollte bis zur<br />
Oder <strong>und</strong> zur Lausitzer Neiße (<strong>in</strong>klusive Rügens <strong>und</strong> e<strong>in</strong>iger Brückenköpfe auf dem<br />
l<strong>in</strong>ken Oderufer) reichen. Das Konzept wurde den Briten <strong>und</strong> Amerikanern vorgelegt;<br />
<strong>in</strong> der Arbeit von Frau Terry spielt es e<strong>in</strong>e zentrale Rolle. 22<br />
Das Regierungsprogramm erlitt e<strong>in</strong> ähnliches Schicksal wie viele Aktivitäten des<br />
Exilkab<strong>in</strong>etts: Zu wenig für das Land, zu viel für das westliche Ausland, wurde es<br />
ähnlich rasch wie die Pläne für e<strong>in</strong>e polnisch-tschechoslowakische Konföderation zu<br />
e<strong>in</strong>em Dokument von ausschließlich historischer Bedeutung. Die eigentliche<br />
Entwicklung des Grenzprogramms vollzog sich weiterh<strong>in</strong> <strong>im</strong> Untergr<strong>und</strong>. Nachdem<br />
die Bauernpartei vorübergehend von der Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie abgerückt war, setzte sich<br />
<strong>im</strong> obersten Organ des regierungstreuen Untergr<strong>und</strong>s (1943: Politische Vertretung des<br />
Landes, Krajowa Reprezentacja Polityczna; 1944: Rat der Nationalen E<strong>in</strong>heit, Rada<br />
Jedności Narodowej) zunächst die eher gemäßigte Richtung durch. In den Beschlüssen<br />
vom Juli 1943 <strong>und</strong> vom März 1944 visierte man den Anschluß Ostpreußens, Danzigs,<br />
Oberschlesiens sowie von Teilen Pommerns <strong>und</strong> Niederschlesiens an, wobei<br />
Stett<strong>in</strong> <strong>und</strong> Breslau auf der deutschen Seite belassen wurden. Im Süden – so der Programmentwurf<br />
von 1943 – sollte die Grenze entlang der Glatzer Neiße verlaufen 23 ;<br />
die Idee e<strong>in</strong>er Großmacht Polen wich def<strong>in</strong>itiv dem Konzept der engen Anb<strong>in</strong>dung an<br />
21 WRZESIÔSKI (wie Anm. 15), S. 392, 396-412.<br />
22 ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 61-65 ; BRANDES (wie Anm. 15), S. 405 ff. TERRY (wie<br />
Anm. 6), pass<strong>im</strong>, unterstreicht wohl zu Recht den Zusammenhang zwischen „Westprogramm“<br />
<strong>und</strong> polnisch-tschechoslowakischen Konföderationsplänen.<br />
23 ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 38 f. Die Annexionspläne <strong>im</strong> Kontext weiterer deutschlandpolitischer<br />
Überlegungen präsentiert BRONISŁAW PASIERB: Polska myśl polityczna<br />
okresu II wojny światowej wobec Niemiec [Das polnische politische Denken <strong>in</strong> der Zeit<br />
des Zweiten Weltkriegs <strong>in</strong> bezug auf Deutschland], Wroc—aw 1986.<br />
144
die Westmächte. Im Frühjahr 1944 zogen die Nationaldemokraten ihre Unterschrift<br />
unter dem Programm des Rates der Nationalen E<strong>in</strong>heit zurück – u.a. deshalb, weil sie<br />
die Absenz der Lausitzer Neiße <strong>im</strong> Dokument für untragbar hielten. 24 Paradoxerweise<br />
kam der Rat gerade dieser Forderung der Rechten <strong>im</strong> Februar 1945 entgegen: Angesichts<br />
des Verlustes der Ostgebiete, wie er sich nach Jalta endgültig abzeichnete, legten<br />
sich alle Parteien des regierungstreuen Untergr<strong>und</strong>s auf das Oder-Neiße-<br />
Programm fest.<br />
Der Beschluß des RJN vom 22. Februar 1945 ist freilich nur sehr schwer als Krönung<br />
des Westprogramms Dmowskis <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Nachfolger <strong>in</strong>terpretierbar. Angemessener<br />
sche<strong>in</strong>t se<strong>in</strong>e Genese beleuchtet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Artikel des Biuletyn Informacyjny<br />
(des Hauptorgans der künftigen Armia Krajowa) vom Sommer 1941. Im Kommentar<br />
zum zweideutigen Text des soeben abgeschlossenen polnisch-sowjetischen Vertrages<br />
hieß es damals, daß „die künftige Best<strong>im</strong>mung unserer <strong>Grenzen</strong> ohneh<strong>in</strong> vom weiteren<br />
Lauf der Ereignisse abhängen wird – <strong>und</strong> von der realen Kraft, die Polen am Ende<br />
des Krieges verkörpern wird“. 25 Im Februar 1945 war nun klar, daß diese „reale<br />
Kraft“ weit weniger <strong>in</strong>s Gewicht fiel, als 1941 die größten Skeptiker vermutet hatten.<br />
Miko—ajczyk trug dieser Lage seit dem Warschauer Aufstand Rechnung, konnte sich<br />
aber letztlich gegen das von den Nationaldemokraten bis zu den Sozialisten vere<strong>in</strong>igte<br />
Londoner Exil nicht durchsetzen. Übrig blieb e<strong>in</strong>e letzte Verteidigungsl<strong>in</strong>ie: der E<strong>in</strong>tritt<br />
<strong>in</strong> die Provisorische Regierung der Nationalen E<strong>in</strong>heit. Miko—ajczyk hoffte noch<br />
<strong>im</strong>mer, daß die Preisgabe der Ostgebiete e<strong>in</strong> tragfähiges F<strong>und</strong>ament für e<strong>in</strong>e polnischrussische<br />
Zusammenarbeit abgeben, daß Moskau die Souveränität der Republik nicht<br />
entscheidend bee<strong>in</strong>trächtigen werde. Das geme<strong>in</strong>same Auftreten von Bierut <strong>und</strong> Miko—ajczyk<br />
<strong>in</strong> Potsdam ist vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> kaum als symbolträchtige Krönung<br />
e<strong>in</strong>er genu<strong>in</strong> polnischen „Westidee“ <strong>in</strong>terpretierbar. Wenn aber die Koalition von<br />
1945 je e<strong>in</strong>e Überlebenschance gehabt haben soll, so bot die Westverschiebung e<strong>in</strong>es<br />
der wenigen F<strong>und</strong>amente dafür.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Ostgrenze waren die Trennl<strong>in</strong>ien zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Programmen<br />
stabiler. Im zweiten Halbjahr 1941, <strong>in</strong> dem die Hoffnungen auf e<strong>in</strong>e Neuordnung<br />
der osteuropäischen Landkarte <strong>in</strong>folge der Auflösung der Sowjetunion ihren<br />
Höhepunkt erreichten, f<strong>in</strong>den wir zwar e<strong>in</strong>e Reihe von phantastischen Plänen, die Polen<br />
e<strong>in</strong>e dom<strong>in</strong>ierende Rolle <strong>in</strong> Osteuropa zusprachen. Daß es derartige Pläne aber nur<br />
24 ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 39, Anm. 137, 140. Die Begründung lautete: „(...) derartige<br />
Pläne konnten nur <strong>in</strong> irrealen Hirnen von Berufspolitikern h<strong>in</strong>term grünen Schreibtisch<br />
entstehen, die sich sorgen, daß wir die Gebiete bis zur Oder <strong>und</strong> Neiße nach Aussiedlung<br />
der Deutschen nicht besiedeln <strong>und</strong> bewirtschaften können. (...) Polen kann ohne Wilna <strong>und</strong><br />
Lemberg nicht existieren, aber auch ohne Stett<strong>in</strong> <strong>und</strong> Breslau kann es den kle<strong>in</strong>sten Sturm<br />
der Geschichte nicht überstehen“.<br />
25 Zit. nach WŁODZIMIERZ BORODZIEJ, ANDRZEJ CHMIELARZ, ANDRZEJ FRISZKE, ANDRZEJ<br />
KUNERT: Polska Podziemna 1939-1945 [Polen <strong>im</strong> Untergr<strong>und</strong> 1939-1945], Warszawa<br />
1991, S. 175.<br />
145
auf der Rechten gegeben hätte, st<strong>im</strong>mt nicht ganz. 26 Richtig ist jedoch e<strong>in</strong>e andere<br />
Feststellung: Zwischen 1939 <strong>und</strong> 1944 gab es außer den Kommunisten ke<strong>in</strong>e Partei,<br />
die e<strong>in</strong>e Revision der Ostgrenze zu Ungunsten Polens <strong>in</strong> Betracht gezogen hätte. Die<br />
polnisch-sowjetische Grenze von 1921 galt allen Parteien des regierungstreuen Untergr<strong>und</strong>s,<br />
aber auch den etwas abseits stehenden l<strong>in</strong>kssozialistischen Gruppierungen<br />
als unantastbar; dasselbe gilt für das Londoner Exilkab<strong>in</strong>ett. H<strong>in</strong>gegen g<strong>in</strong>g die Polnische<br />
Arbeiterpartei seit ihrem Entstehen von der Preisgabe der Ostgebiete aus, ohne<br />
<strong>in</strong> diesem Punkt e<strong>in</strong>e überzeugende Argumentation zu entwickeln. Bis 1944 sollte die<br />
Losung vom Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht der Ukra<strong>in</strong>er, Weißrussen <strong>und</strong> Litauer die faktisch<br />
längst vollzogene Aufgabe von 47% des alten Staatsgebiets verschleiern. Für das<br />
Prestige der polnischen Kommunisten war diese Absage selbstmörderisch; dennoch<br />
ließ Moskau nicht locker. 27<br />
Fragen wir weiter nach dem E<strong>in</strong>fluß der Kriegszielprogramme <strong>in</strong> Exil <strong>und</strong> Untergr<strong>und</strong><br />
auf die Gesellschaft <strong>und</strong> die eigentlichen Entscheidungsträger, so sche<strong>in</strong>en drei<br />
Hypothesen wichtig.<br />
Erstens kennen wir e<strong>in</strong>e Reihe von Zeugnissen, die auf e<strong>in</strong>e gewisse Popularisierung<br />
des „Westprogramms“ h<strong>in</strong>weisen. Anders formuliert: Die polnische Gesellschaft<br />
sche<strong>in</strong>t – vor allem <strong>im</strong> westlichen Teil des Landes – von dem sicheren Erwerb Danzigs,<br />
Ostpreußens <strong>und</strong> Ostoberschlesiens überzeugt gewesen zu se<strong>in</strong>. Wir werden nie<br />
wissen, was der durchschnittliche Pole 1944 mit Wroc—aw oder Szczec<strong>in</strong> assoziierte;<br />
auf dem heutigen Stand der Forschung muß die Antwort reichen, daß er damit wohl<br />
mehr anzufangen wußte als 1939.<br />
Noch weniger bekannt ist der E<strong>in</strong>fluß der Exil- <strong>und</strong> Untergr<strong>und</strong>propaganda h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Ostgrenze. Waren die Polen 1944 auf den Verlust von Wilna <strong>und</strong> Lemberg<br />
vorbereitet oder waren sie vielmehr fest davon überzeugt, daß ihnen, den ersten<br />
Opfern Hitlers, derartiges Unrecht nicht geschehen könnte? Auch hier wissen wir<br />
noch <strong>im</strong>mer wenig. Vorsichtig könnte man sagen, daß die Bewohner der ostpolnischen<br />
Gebiete ihre Zukunft weit pess<strong>im</strong>istischer sahen als ihre Landsleute <strong>in</strong> Zentral-<br />
26 1942 warnte z.B. das Hauptorgan der Bauernpartei vor der Ostexpansion – dafür sei Polen<br />
<strong>im</strong> Augenblick zu schwach; sobald sich aber der Staat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en neuen Westgrenzen gefestigt<br />
haben werde, „kommt der zweite Teil unserer historischen Aufgabe – die Ostexpansion<br />
(...) die Rückkehr auf die Gebiete der Piasten wird uns die Kraft zum Marsch nach<br />
Osten geben“. Zit. nach DĄBROWSKI (wie Anm. 14), S. 23. Zu ähnlichen Überlegungen bei<br />
den Christdemokraten vgl. ORZECHOWSKI (wie Anm. 4), S. 31, Anm. 102.<br />
27 Im Frühjahr 1943 bemängelte Georgij D<strong>im</strong>itrow die offensichtlich als nicht ganz e<strong>in</strong>deutig<br />
empf<strong>und</strong>ene Losung vom Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht; <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Depesche vom 2. April 1943<br />
bedrängte er die Führung der PPR, dem „1939 geäußerten Willen der ukra<strong>in</strong>ischen, weißrussischen<br />
<strong>und</strong> litauischen Bevölkerung (...) präziser“ Rechnung zu tragen; zit. nach MA-<br />
RIA EWA OZÓG: Władysław Gomulka. Biografia polityczna [E<strong>in</strong>e politische Biographie],<br />
Bd. I, Warszawa 1989, S. 86; Auszüge aus der Korrespondenz mit den polnischen Kommunisten,<br />
besonders aber der <strong>in</strong>terne Schriftverkehr der sowjetischen Behörden über die<br />
PPR, s<strong>in</strong>d veröffentlicht <strong>in</strong>: Polska-ZSRR. Struktury podleg—o‘ci. Dokumenty WKP(b) [Polen-UdSSR.<br />
Strukturen der Abhängigkeit. Dokumente der Allunions-KP(b)] 1944-1949,<br />
Warszawa 1995.<br />
146
oder Westpolen, wobei die Erlebnisse aus den Jahren 1939-1941 e<strong>in</strong>e erheblich größere<br />
Rolle gespielt haben dürften als jegliche Propaganda. Das Bild ist jedoch, wie<br />
bereits gesagt, sehr verschwommen; sogar die Rolle des Grenzrevisionismus <strong>in</strong> der<br />
Untergr<strong>und</strong>presse von 1944-1948 ist kaum erforscht, <strong>und</strong> über die „schweigende<br />
Mehrheit“ <strong>in</strong> diesen Jahren wissen wir noch weniger. Daß der Widerstand gegen die<br />
„Sowjetisierung“ Polens <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der 40er Jahre e<strong>in</strong>e se<strong>in</strong>er Legit<strong>im</strong>ationsquellen<br />
aus dem Verlust Ostpolens bezogen hat, ist e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e B<strong>in</strong>senwahrheit,<br />
andererseits e<strong>in</strong>e problematische E<strong>in</strong>schätzung: Den Bürgerkrieg von 1944-1948 kann<br />
man sich sehr wohl auch ohne die Abtrennung der ostpolnischen Gebiete vorstellen.<br />
Schließlich bleibt noch der E<strong>in</strong>fluß der polnischen Grenzdiskussion auf die eigentlichen<br />
Entscheidungsträger von 1945 zu beurteilen. Bei der Rekonstruktion dieses<br />
Bildes dürfen wir von der Voraussetzung ausgehen, daß die St<strong>im</strong>mung <strong>im</strong> Lande<br />
selbst auf Churchill/Attlee, Roosevelt/Truman <strong>und</strong> Stal<strong>in</strong> so gut wie ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluß<br />
gehabt hat. Wenn überhaupt, so hätten sie nur mit der Interpretation dieser St<strong>im</strong>mung<br />
als e<strong>in</strong>em Argument ihrer Gesprächspartner rechnen müssen, die die Verhältnisse <strong>in</strong><br />
der He<strong>im</strong>at auf recht willkürliche <strong>und</strong> <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>e unkontrollierbare Weise präparieren<br />
konnten. Das Urteil der seriösen Historiographie über die Rolle von Sikorski, Miko—ajczyk<br />
<strong>und</strong> Wanda Wasilewska ist freilich recht e<strong>in</strong>deutig: ke<strong>in</strong>er von ihnen dürfte<br />
<strong>im</strong> Prozeß des decision-mak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> London, Wash<strong>in</strong>gton oder Moskau e<strong>in</strong>e größere<br />
Rolle gespielt haben. Sikorski hatte noch e<strong>in</strong> gewisses Gewicht; dennoch s<strong>in</strong>d sich<br />
alle se<strong>in</strong>e Biographen, von Marian Kukiel bis Meiklejohn Terry dah<strong>in</strong>gehend e<strong>in</strong>ig,<br />
daß se<strong>in</strong> E<strong>in</strong>fluß <strong>in</strong> den letzten Monaten vor se<strong>in</strong>em Tod zurückgegangen ist – <strong>und</strong><br />
selbst 1940/41 konnte er ja <strong>in</strong> der Grenzfrage ke<strong>in</strong>e substantiellen Festlegungen der<br />
Angelsachsen erreichen. Se<strong>in</strong>e Nachfolger wurden von den Westmächten systematisch<br />
übergangen. Der E<strong>in</strong>fluß der kommunistischen Spitzenpolitiker <strong>im</strong> Moskauer<br />
Exil bei der Festlegung der Ostgrenze beschränkte sich auf die Grenzkorrektur bei<br />
Bia—ystok, h<strong>in</strong>sichtlich der Westgrenze s<strong>in</strong>d wir ohne die Kenntnis der sowjetischen<br />
Akten auf Mutmaßungen angewiesen. Erst das geme<strong>in</strong>same Auftreten der Provisorischen<br />
Regierung der Nationalen E<strong>in</strong>heit <strong>in</strong> Potsdam verlieh der polnischen St<strong>im</strong>me<br />
e<strong>in</strong> gewisses Gewicht, das trotzdem – wie wir wissen – bei der Entscheidung für die<br />
Lausitzer Neiße ke<strong>in</strong>eswegs entscheidende Bedeutung besessen hat.<br />
E<strong>in</strong>e kurze Zusammenfassung: Die Grenzdiskussion <strong>in</strong> Exil <strong>und</strong> Untergr<strong>und</strong> verlief<br />
auf zwei Ebenen. Zum e<strong>in</strong>en stellte sie die Fortsetzung tradierter ideengeschichtlicher<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen um die Ost- bzw. Westorientierung Polens dar. Im<br />
Schatten von Krieg <strong>und</strong> Besatzung dachte die Rechte zu Ende, wovon sie schon <strong>im</strong>mer<br />
geträumt hatte: die Vorstellung von e<strong>in</strong>er Großmacht Polen. Die kommunistische<br />
L<strong>in</strong>ke griff diese Idee auf, amputierte den dazugehörigen Gr<strong>und</strong>gedanken e<strong>in</strong>er polnischen<br />
Mission <strong>im</strong> Osten <strong>und</strong> versuchte, die gesamte gesellschaftliche Energie auf den<br />
Westen zu lenken. Die übrigen politischen Gruppen <strong>und</strong> Lager brachten zwar eigene<br />
Variationen zum Thema Großmacht Polen vor, bewegten sich aber <strong>im</strong>mer zwischen<br />
den von rechts <strong>und</strong> von l<strong>in</strong>ks vorgegebenen Denkfiguren; e<strong>in</strong>zig bei den Sozialisten<br />
f<strong>in</strong>den wir e<strong>in</strong>e Aff<strong>in</strong>ität zur Idee der europäischen Integration, wie sie die westeuropäische<br />
Entwicklung nach 1945 dom<strong>in</strong>ieren sollte.<br />
147
Die polnische Grenzdiskussion war aber zugleich – <strong>und</strong> wohl doch <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
– e<strong>in</strong>e Diskussion darüber, ob das erste Opfer Hitlers se<strong>in</strong>en <strong>im</strong> September 1939 zerschlagenen<br />
Staat auch als quasi-Sieger aufgeben könne bzw. solle. Die große Mehrheit<br />
der politischen Elite antwortete mit e<strong>in</strong>em klaren Ne<strong>in</strong>, das vordergründig e<strong>in</strong><br />
Ne<strong>in</strong> zum Verlust der Ostgebiete war. Über die gesellschaftlichen Reaktionen wissen<br />
wir wesentlich weniger; die Tatsache, daß die Westverschiebung als orig<strong>in</strong>är polnische<br />
Idee präsentierbar war, dürfte aber die Akzeptanz von Jalta <strong>und</strong> Potsdam ebenso<br />
gefördert haben, wie es die 1944/45 offensichtliche Machtlosigkeit tat.<br />
Auf den letzten Seiten ihrer Arbeit über Polen <strong>in</strong> den vierziger Jahren schrieb Krystyna<br />
Kersten den <strong>in</strong>zwischen klassischen Satz, man könne die Geschichte Polens<br />
1943-1948 <strong>in</strong> der These zusammenfassen, daß „alle e<strong>in</strong>e Niederlage erlitten <strong>und</strong> zugleich<br />
alle gewonnen haben“. 28 Kaum anders verhält es sich mit den Teilnehmern der<br />
Grenzdiskussion <strong>in</strong> Exil <strong>und</strong> Untergr<strong>und</strong>. Sowohl die territorialen Verluste als auch<br />
die Gew<strong>in</strong>ne erreichten das größte Ausmaß, das <strong>in</strong> den Programmen der Kriegszeit<br />
vorgedacht worden war. In der offiziellen landespolnischen Presse wurde diese Ambivalenz<br />
schon 1945 sorgfältig ausgeblendet, angesagt waren triumphale Loblieder;<br />
<strong>im</strong> Exil dom<strong>in</strong>ierte die Trauer um den Verlust. Alle wollten Recht behalten – nachdem<br />
offenk<strong>und</strong>ig geworden war, daß sich alle geirrt hatten.<br />
28 KRYSTYNA KERSTEN: Narodz<strong>in</strong>y systemu w—adzy. Polska 1943-1948 [Die Geburt des Herrschaftssystems],<br />
Warszawa 1985, S. 328.<br />
148
Historische <strong>und</strong> ethnische <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> baltischen Raum<br />
von<br />
Gert von P i s t o h l k o r s<br />
Nach der Wiedergabe der „Süddeutschen Zeitung“ vom <strong>20</strong>. März 1995 sei wenige<br />
Tage zuvor <strong>in</strong> der lettischen Tageszeitung „Diena“ (der Tag) darüber reflektiert worden,<br />
wo denn Vertreter der 1991 wiedererstandenen baltischen Staaten Estland, Lettland<br />
<strong>und</strong> Litauen die Fünfzig-Jahr-Feiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges begehen<br />
sollten: <strong>in</strong> London, Paris, Moskau oder auch nur geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong> Riga? E<strong>in</strong>igkeit herrsche<br />
<strong>in</strong> den drei baltischen Hauptstädten Tall<strong>in</strong>n/Reval, Riga <strong>und</strong> Vilnius darüber, daß<br />
die Entscheidung für den e<strong>in</strong>en oder anderen Ort <strong>in</strong> jedem Fall <strong>in</strong> der Wirkung em<strong>in</strong>ent<br />
politisch sei. Letztlich werde man wohl entweder nach Moskau fahren oder zu<br />
Hause bleiben. „Für Moskau spricht, daß dort der Zweite Weltkrieg für alle drei baltischen<br />
Staaten beendet wurde. Gegen Moskau sprechen mehrere Gründe. Bis heute<br />
will Moskau se<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluß auf das Baltikum nicht aufgeben, mit allen drei Republiken<br />
gibt es Grenzstreitigkeiten ...“<br />
Politische Streitigkeiten an der Grenze <strong>und</strong> über den Grenzverlauf bleiben <strong>in</strong> den<br />
1990er Jahren <strong>im</strong> Zentrum der Aufmerksamkeit <strong>in</strong> den baltischen Staaten <strong>und</strong> auch <strong>in</strong><br />
Rußland. Über <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> baltischen Raum wird jedoch unter den verschiedensten<br />
Fragestellungen nachgedacht. Die neueste Arbeit über „Die Sozialgeschichte der Ostgrenze<br />
Estlands <strong>im</strong> Mittelalter“ untersucht vor allem die Bedeutung des Grenzsaumes<br />
<strong>und</strong> Grenzraumes für das Alltagsleben <strong>im</strong> unmittelbaren Grenzbereich vor mehr als<br />
sechsh<strong>und</strong>ert Jahren. 1 Ältere Arbeiten haben sich mit der Ostgrenze Livlands stärker<br />
unter ideologischen Gesichtspunkten beschäftigen wollen <strong>und</strong> behauptet, daß zwischen<br />
Ost <strong>und</strong> West oder gar zwischen Sarmatentum <strong>und</strong> Zivilisation e<strong>in</strong>e Wasserscheide<br />
entstanden sei. Über <strong>Grenzen</strong> zwischen dem late<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> dem russischorthodox<br />
geprägten Europa hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er posthum veröffentlichten gr<strong>und</strong>legenden Arbeit<br />
noch Werner Conze nachgedacht <strong>und</strong> damit viel Aufmerksamkeit erregt. 2 In diesem<br />
kurzen Beitrag soll hier <strong>im</strong> Anschluß an das e<strong>in</strong>leitende Zitat aus der „Diena“ nur<br />
nach historischen <strong>und</strong> ethnischen Argumentationen gefragt werden, die <strong>in</strong> der aktuellen<br />
politischen Diskussion über <strong>Grenzen</strong> e<strong>in</strong>e Rolle spielen <strong>und</strong> gespielt haben. Über<br />
1 Vgl. ANTI SELART: Zur Sozialgeschichte der Ostgrenze Estlands <strong>im</strong> Mittelalter, <strong>in</strong>: Zeitschrift<br />
für <strong>Ostmitteleuropa</strong>-Forschung 47 (1998), S. 5<strong>20</strong>-543.<br />
2 Vgl. WERNER CONZE: <strong>Ostmitteleuropa</strong>. Von der Spätantike bis zum 18. Jahrh<strong>und</strong>ert, hrsg.<br />
<strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>em Nachwort von KLAUS ZERNACK, München 1992.<br />
149
die Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> baltischen Raum ist für die Neuzeit noch zu wenig<br />
geforscht worden, so daß die besonders wichtige Frage nach der Sozialgeschichte<br />
der <strong>Grenzen</strong> zwischen den baltischen Staaten untere<strong>in</strong>ander sowie nach Osten gegenüber<br />
Rußland <strong>im</strong> e<strong>in</strong>zelnen gar nicht beantwortet werden kann. An der Konstellation<br />
jedoch, wie sie die „Diena“ politisch <strong>in</strong> der Hoffnung auf den Beg<strong>in</strong>n der endgültigen<br />
Nachkriegszeit nach den Jahren der Wende von 1989 <strong>und</strong> 1991 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ironischen<br />
Vorüberlegung über geme<strong>in</strong>same Gedenkveranstaltungen zugr<strong>und</strong>e legt, hat sich bis<br />
heute, drei Jahre nach den Fünfzig-Jahr-Feiern, die <strong>im</strong> übrigen getrennt <strong>in</strong> den jeweiligen<br />
Hauptstädten begangen wurden, nicht viel geändert.<br />
In den Beziehungen zwischen Rußland <strong>und</strong> den baltischen Staaten geht es allerd<strong>in</strong>gs<br />
nicht alle<strong>in</strong> um „Grenzstreitigkeiten“, sondern um mehr: Moskau behält es sich<br />
jederzeit vor, mit ethnischen Argumentationen, zum Schutz der russischen M<strong>in</strong>derheit,<br />
<strong>in</strong> die <strong>in</strong>neren Angelegenheiten der baltischen Staaten e<strong>in</strong>zugreifen. Die große<br />
russische M<strong>in</strong>derheit an den Grenzsäumen Estlands <strong>und</strong> Lettlands, aber auch <strong>in</strong> den<br />
Hauptstädten der drei baltischen Staaten gibt ständig Anlaß zu entsprechenden E<strong>in</strong>mischungen,<br />
die <strong>in</strong> der Tat <strong>im</strong>mer wieder öffentlich beklagt werden. 3 Dazu e<strong>in</strong>ige Zahlen:<br />
<strong>in</strong> Estland leben nach e<strong>in</strong>er Zählung von 1989 61,5 Prozent Esten, neben kle<strong>in</strong>eren<br />
M<strong>in</strong>derheiten von Ukra<strong>in</strong>ern, Weißrussen <strong>und</strong> Polen <strong>im</strong> übrigen 30,3 Prozent<br />
Russen, die <strong>im</strong> Zuge der sowjetischen Industrialisierung <strong>und</strong> Militarisierung Estlands<br />
bewußt angesiedelt worden s<strong>in</strong>d. Noch vor wenigen Jahren wurde der östliche Teil<br />
der Landschaft Virumaa – deutsch Wierland – <strong>im</strong> Volksm<strong>und</strong> auch „Interfront-Land“<br />
genannt, <strong>in</strong> Anspielung auf die russische politische Gruppierung, die sich als Gegenpol<br />
zur estnischen Volksfrontbewegung „rahvar<strong>in</strong>ne“ zur Verteidigung der alten Sowjetmacht<br />
gebildet hatte. Die wichtigsten Industriestädte Ostwierlands, Kohtla-Järve,<br />
Sillamäe <strong>und</strong> Kiviöli, s<strong>in</strong>d ganz russisch dom<strong>in</strong>iert. In der größten Industriestadt dieser<br />
Region Estlands, der Grenzstadt Narva, leben nur noch ca. drei Prozent Esten. Der<br />
<strong>im</strong> Frieden von Tartu/Dorpat am 2. Februar 19<strong>20</strong> ausgehandelte Grenzverlauf zwischen<br />
Rußland <strong>und</strong> Estland soll nicht mehr <strong>in</strong> allen Best<strong>im</strong>mungen gelten. Nunmehr<br />
bildet der Narvafluß die Grenze. Der Grenzstreifen von ca. 10 km östlich des Narvaflusses<br />
bis zur Nordspitze des Peipussees ist auf Beschluß Stal<strong>in</strong>s bereits 1944 – nach<br />
der Erneuerung der Sowjetmacht <strong>in</strong> Estland – an die RSFSR gefallen <strong>und</strong> wird wohl<br />
ebensowenig jemals wieder zu Estland gehören wie das südlichere Petschurgebiet östlich<br />
von Werro, <strong>in</strong> dem vor allem Setukesen wohnen, die ihrerseits nicht gefragt worden<br />
s<strong>in</strong>d, ob sie bei Rußland bleiben oder wie zwischen 19<strong>20</strong> <strong>und</strong> 1944 wieder zu Estland<br />
gehören wollen. Völkerrechtlich betrachtet gibt es nach wie vor offene Fragen<br />
zwischen Estland <strong>und</strong> Rußland, auch wenn an der faktischen Anerkennung des<br />
Grenzverlaufes wohl niemand mehr rütteln wird. 4<br />
3 Leser der <strong>in</strong> Riga ersche<strong>in</strong>enden „Baltic T<strong>im</strong>es“ f<strong>in</strong>den H<strong>in</strong>weise auf entsprechende Streitigkeiten<br />
<strong>und</strong> Ängste <strong>in</strong> jeder Nummer dieser Wochenzeitung.<br />
4 Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen zum Thema „<strong>Grenzen</strong>“ bei HANS MEDICK: Zur politischen<br />
Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Neuzeit Europas, <strong>in</strong>: Sozialwissenschaftliche Informationen<br />
(SOWI), <strong>20</strong> (1991), 3, S. 157-163. Neueste Publikation zum engeren Thema: WAY-<br />
NE C. THOMPSON: Citizenship and Borders: Legacies of Soviet Empire <strong>in</strong> Estonia, <strong>in</strong>: Jour-<br />
150
Auch <strong>in</strong> Lettland beziehen sich die „Grenzstreitigkeiten“ weniger auf den tatsächlichen<br />
Grenzverlauf als auf die ständige Gefahr der E<strong>in</strong>mischung unter ethnischen<br />
Vorzeichen. 5 Zwar ist <strong>im</strong> Frieden von Riga vom 11. August 19<strong>20</strong> das Gebiet um den<br />
östlichen Eisenbahnknotenpunkt Abrene – russisch Pytalovo – zwischen Lettgallen<br />
<strong>und</strong> dem Nordostzipfel Livlands lettisch geworden <strong>und</strong> erst 1944 ähnlich wie der<br />
Streifen östlich von Narva der RSFSR zugeschlagen worden. Es gibt deshalb <strong>in</strong> Lettland<br />
Kräfte, die aus wirtschaftlichen wie aus völkerrechtlichen Gründen dr<strong>in</strong>gend für<br />
e<strong>in</strong>e Rückgabe des Abrenegebietes an Lettland öffentlich e<strong>in</strong>treten. Stillschweigend<br />
wird jedoch anerkannt, daß r<strong>und</strong> um Abrene fast nur Russen wohnen, die mit Lettland<br />
kaum mehr etwas verb<strong>in</strong>den dürfte. Schwerwiegender ist allerd<strong>in</strong>gs die Tatsache, daß<br />
<strong>in</strong> der Hauptstadt Riga mit ihren über 880 000 E<strong>in</strong>wohnern – etwa e<strong>in</strong>em Drittel der<br />
Gesamte<strong>in</strong>wohnerschaft Lettlands – nur etwa 30 Prozent Letten wohnen. Die Russen<br />
überwiegen stark <strong>im</strong> Straßenbild. Auch die zweitgrößte Stadt Lettlands Daugavpils/<br />
Dünaburg <strong>im</strong> südöstlichen Grenzbereich zu Weißrußland <strong>und</strong> zu Litauen ist russisch<br />
geprägt. Dort leben nur ca. 13 Prozent Letten bzw. Lettgaller. Ähnlich wie <strong>in</strong> Estland<br />
existiert <strong>im</strong> östlichen Bereich der Republik Lettland e<strong>in</strong> Grenzsaum, <strong>in</strong> dem überwiegend<br />
russisch gesprochen <strong>und</strong> mit gemischten Gefühlen an die neue Republik gedacht<br />
wird.<br />
Litauen schließlich wäre e<strong>in</strong> Staat ohne geme<strong>in</strong>same Grenze mit Rußland, wenn<br />
man von der „Kal<strong>in</strong><strong>in</strong>gradskaja oblast’“, dem ehemaligen nördlichen Ostpreußen um<br />
Königsberg, absehen wollte, was aber natürlich nicht möglich ist. Durch Litauen verläuft<br />
vielmehr e<strong>in</strong>e Eisenbahnl<strong>in</strong>ie, mit der dieses Randgebiet an den eigentlichen russischen<br />
Staat angeb<strong>und</strong>en ist. E<strong>in</strong> derartiger „Korridor“ könnte gewiß ähnlich wie se<strong>in</strong><br />
historisches Vorbild zu Irritationen führen, doch s<strong>in</strong>d die getroffenen Regelungen <strong>in</strong><br />
der gegenwärtigen Praxis offenbar völlig stabil. Im Frieden von Moskau vom 12. Juli<br />
19<strong>20</strong> sollte nach dem Willen der damaligen Sowjetmacht das „Wilnagebiet“ an Litauen<br />
fallen, <strong>und</strong> es sollte um etwa zwei Drittel größer se<strong>in</strong> als es 1940, nach dem Diktat<br />
Stal<strong>in</strong>s <strong>und</strong> der Übergabe an die Litauische SSR, schließlich wurde. Im übrigen ist <strong>in</strong><br />
Litauen sicher unvergessen, daß Michail dçêÄ~¦Éî 1990 die territoriale Integrität Litauens<br />
<strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick auf das Gebiet um Vilnius <strong>und</strong> um Klaipeda/Memel angezweifelt<br />
<strong>und</strong> laut darüber nachgedacht hat, ob Litauen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er alten Gestalt von vor 1940<br />
nicht groß genug gewesen sei. In Litauen stellt sich jedoch <strong>in</strong>zwischen die Grenzfrage<br />
nicht mehr ernsthaft, weder mit Polen noch mit Rußland. Vielmehr haben beide Staaten<br />
Litauen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er jetzigen Gestalt ausdrücklich anerkannt. Damit ist e<strong>in</strong> Grenzkonflikt<br />
beendet worden, der die Staatsbeziehungen <strong>im</strong> östlichen Europa der Zwischenkriegszeit<br />
nachhaltig vergiftet hat. Im übrigen leben <strong>in</strong> Litauen wegen der schwachen<br />
Industrialisierung <strong>und</strong> Urbanisierung nur ca. neun Prozent Russen. Es ist naheliegend<br />
davon auszugehen, daß <strong>in</strong> der besonderen Lage Litauens als Durchgangsland zwi-<br />
nal of Baltic Studies (JBS) XXIX (1998), S. 109-134. Gr<strong>und</strong>legend zur Geschichte Estlands<br />
TOIVO U. RAUN: Estonia and the Estonians. Hoover <strong>Institut</strong>ion Press, 2. Aufl. Stanford<br />
1992, pass<strong>im</strong>.<br />
5 Gr<strong>und</strong>legend zur lettischen Geschichte ANDREJS PLAKANS: The Latvians. A Short History.<br />
Hoover <strong>Institut</strong>ion Press, Stanford 1995 (Studies of Nationalities), pass<strong>im</strong>.<br />
151
schen zwei weit ause<strong>in</strong>anderliegenden Teilen Rußlands mehr Konfliktstoff liegen<br />
könnte als <strong>in</strong> ethnischen Irredentafragen <strong>in</strong> bezug auf die russisch sprechende Bevölkerung<br />
<strong>in</strong> der Republik. 6<br />
Für die baltischen Staaten, die ohne lange Vorplanung am Ende des Ersten Weltkrieges<br />
zwar <strong>im</strong> wesentlichen aus eigenem Antrieb, aber doch auch <strong>im</strong> Zeichen e<strong>in</strong>es<br />
„Patts der Mächte“ (Stop<strong>in</strong>ski) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es Schwächeanfalls des Russischen Reiches<br />
entstanden s<strong>in</strong>d, für kle<strong>in</strong>e Staaten also, die nicht auf e<strong>in</strong>e respekterheischend lange<br />
Unabhängigkeit zurückblicken können, liegt <strong>in</strong> der Abweichung vom Völkerrecht e<strong>in</strong><br />
Moment der Unsicherheit. 7 Daß Rußland die Friedensschlüsse von 19<strong>20</strong> e<strong>in</strong>seitig für<br />
obsolet erklärt hat <strong>und</strong> davon ausgeht, daß Stal<strong>in</strong> 1944 Fakten geschaffen habe, nach<br />
denen sich jeder richten müsse, schließt gute Nachbarschaft zwischen Rußland <strong>und</strong><br />
den baltischen Staaten zwar nicht aus, macht sie aber auch nicht stabiler. Vielleicht<br />
kann F<strong>in</strong>nland e<strong>in</strong> gutes Beispiel se<strong>in</strong>, das ja auch erst 1917 zu e<strong>in</strong>em selbständigen<br />
Staat wurde 8 . Es hatte aber seit der Zugehörigkeit zum Russischen Reich zwischen<br />
1809 <strong>und</strong> 1917 <strong>im</strong> Verlauf des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>im</strong> Unterschied zu den Ostseeprov<strong>in</strong>zen<br />
<strong>und</strong> zu den litauischen Gouvernements nach <strong>in</strong>nen Staat machen können <strong>und</strong> war<br />
gegen E<strong>in</strong>flüsse aus St. Petersburg weitgehend abgeschirmt worden, nicht zuletzt<br />
durch wohlwollende Generalgouverneure, die die Vertretung f<strong>in</strong>nländischer Interessen<br />
<strong>in</strong> der Metropole zu ihrem eigentlichen Beruf zu machen suchten. 9 F<strong>in</strong>nland<br />
konnte 1863 e<strong>in</strong>en eigenen Landtag eröffnen, <strong>in</strong> dem zu jeweils 25 Prozent Adel,<br />
6 Neueste Publikation zur Geschichte Litauens: Deutschland <strong>und</strong> Litauen. Bestandsaufnahmen<br />
<strong>und</strong> Aufgaben der historischen Forschung, hrsg. von NORBERT ANGERMANN <strong>und</strong> JOA-<br />
CHIM TAUBER, Lüneburg 1995. Den neuesten Stand der politischen Problematik <strong>in</strong> den baltischen<br />
Staaten spiegelt das Beiheft zur Wochenzeitung „Das Parlament“ Nr. 37/98 vom 4.<br />
September 1998 recht gut wider. Vgl. vor allem die Beiträge von Konrad Maier (Estland),<br />
Detlef Henn<strong>in</strong>g (Lettland) sowie Joach<strong>im</strong> Tauber (Litauen).<br />
7 Nach wie vor gr<strong>und</strong>legend GEORG VON RAUCH: Geschichte der baltischen Staaten, 3. Aufl.<br />
München 1990. Wichtig auch: JOHN HIDEN, PATRICK SALMON: The Baltic Nations and Europe.<br />
Estonia, Latvia & Lithuania <strong>in</strong> the Twentieth Century, London, New York 1991. Zum<br />
Thema „Patt“ vgl. die kürzlich erschienene Dissertation von SIEGMAR STOPINSKI: Das Baltikum<br />
<strong>im</strong> Patt der Mächte. Zur Entstehung Estlands, Lettlands <strong>und</strong> Litauens <strong>im</strong> Gefolge des<br />
Ersten Weltkriegs, Berl<strong>in</strong> 1997 (Nordeuropäische Studien, Bd. 11). Diese Doktorarbeit<br />
enthält allerd<strong>in</strong>gs faktisch ke<strong>in</strong>e eigenen Archivstudien <strong>und</strong> fußt auf der m. E. e<strong>in</strong>seitigen<br />
These, daß die baltischen Staaten nahezu alles dem historischen Zufall zu verdanken gehabt<br />
hätten. Wichtiger: The Independence of the Baltic States: Orig<strong>in</strong>s, Causes, and Consequences.<br />
A Comparison of the Crucial Years 1918-1919 and 1990-1991, hrsg. von EBER-<br />
HARD DEMM u.a., Chicago 1996 (zahlreiche wichtige Aufsätze).<br />
8 Zur Staatlichkeit <strong>in</strong> F<strong>in</strong>nland gr<strong>und</strong>legend RISTO ALAPURO: State and Revolution <strong>in</strong> F<strong>in</strong>land,<br />
Berkeley, Los Angeles 1988 (mit umfangreichen Literaturverweisen).<br />
9 Dazu gr<strong>und</strong>legend ROBERT SCHWEITZER: Autonomie <strong>und</strong> Autokratie. Die Stellung des<br />
Großfürstentums F<strong>in</strong>nland <strong>im</strong> russischen Reich <strong>in</strong> der zweiten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
(1863-1899), Giessen 1978 (Marburger Abhandlungen zur Geschichte <strong>und</strong> Kultur Osteuropas,<br />
Bd. 19), sowie OSMO JUSSILA: Nationalismi ja vallankumous venäläis-suomalaisissa<br />
suhteissa 1899-1914 [Nationalismus <strong>und</strong> Revolution <strong>in</strong> den russisch-f<strong>in</strong>nischen Beziehungen<br />
1899-1914], Hels<strong>in</strong>ki 1979 (Historiallisia Tutk<strong>im</strong>uksia 110).<br />
152
Geistlichkeit, Bürger <strong>und</strong> Bauern vertreten waren. Eigene Posthoheit, e<strong>in</strong>e eigene<br />
Währung <strong>im</strong> Großfürstentum sowie eigenes Militär waren Ausdruck der <strong>im</strong> Verlauf<br />
des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts erworbenen <strong>in</strong>neren Selbständigkeit. Als die Zeit der Unterdrükkung<br />
mit der sogenannten Russifizierung unter dem Generalgouverneur Nikolaj Bobrikov<br />
<strong>im</strong> Jahr 1899 begann, war F<strong>in</strong>nland bereits e<strong>in</strong> nach <strong>in</strong>nen konsolidiertes Großfürstentum<br />
mit e<strong>in</strong>er klaren Abgrenzung gegenüber Rußland <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er f<strong>in</strong>nischen<br />
Dom<strong>in</strong>anz <strong>im</strong> Innern.<br />
In den Ostseeprov<strong>in</strong>zen h<strong>in</strong>gegen schien die Besonderheit der Region nur ständisch<br />
legit<strong>im</strong>iert. Die Privilegien Peters des Großen von 1710 bzw. 1721 waren den<br />
Ständen <strong>in</strong> Stadt <strong>und</strong> Land – Reval, Riga sowie der Estländischen <strong>und</strong> der Livländischen<br />
Ritterschaft – zwar für alle Zeiten zugesichert <strong>und</strong> bis zum Regierungsantritt<br />
Alexanders III. <strong>im</strong> Jahr 1881 auch <strong>in</strong> voller Gültigkeit, blieben aber nach <strong>in</strong>nen stets<br />
umkämpft <strong>und</strong> wurden durch e<strong>in</strong> staatliches militärisches, ökonomisches <strong>und</strong> fiskalisches<br />
Interesse laufend politisch neu <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> konterkarriert. 10<br />
In F<strong>in</strong>nland stützte sich die Russische Reichsregierung auf das Mehrheitsvolk der<br />
F<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> die Fennomanenbewegung, die als konservativ <strong>und</strong> reichsfre<strong>und</strong>lich galt.<br />
In den Ostseeprov<strong>in</strong>zen h<strong>in</strong>gegen stützte sich St. Petersburg zunächst ausschließlich<br />
auf die führenden Deutschen <strong>in</strong> Stadt <strong>und</strong> Land <strong>und</strong> behandelte die Esten <strong>und</strong> Letten<br />
als Angehörige e<strong>in</strong>es Bauernstandes, dem allenfalls <strong>in</strong> Zeiten der Not die Fürsorge der<br />
Reichsbehörden zuteil werden mußte, wenn die Ritterschaften ihrer ständischen Tutelpflicht<br />
nicht gerecht zu werden schienen. Immer wieder ist von St. Petersburg aus<br />
<strong>in</strong> die <strong>in</strong>neren Verhältnisse e<strong>in</strong>gegriffen worden, besonders drastisch zu Zeiten der<br />
Statthalterschaftsverfassung unter Kathar<strong>in</strong>a II., <strong>in</strong> Zeiten der Agrarreformen <strong>in</strong> der<br />
ersten Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> aus Anlaß der sogenannten Konversionsbewegung<br />
der 1840er Jahre, als über 106 000 Esten <strong>und</strong> Letten vom lutherischen Glauben<br />
ihrer Väter zur russisch-orthodoxen Staatskirche übertraten <strong>in</strong> der Hoffnung, dadurch<br />
ihre soziale Lage zu verbessern.<br />
Erst 1882 – mit der Manase<strong>in</strong>schen Senatorenrevision <strong>in</strong> den Gouvernements Livland<br />
<strong>und</strong> Kurland – drangen Vertreter estnischer <strong>und</strong> lettischer Vere<strong>in</strong>e mit ihren Anliegen<br />
nachhaltig vor den kaiserlichen Thron. Charakteristisch ist dabei die Argumentation<br />
<strong>in</strong> Grenzfragen: die estnischen <strong>und</strong> lettischen Petitionisten – versehen mit Zehntausenden<br />
von Unterschriften – wollten die historischen <strong>Grenzen</strong> zwischen den Gouvernements<br />
Estland, Livland <strong>und</strong> Kurland durch ethnische ersetzt wissen. Den Mehrheitsvölkern<br />
sollte durch Aufhebung der Prov<strong>in</strong>z Livland zu ihrem Recht verholfen<br />
<strong>und</strong> damit der stärksten Bastion der ständischen Ordnung, der Livländischen Ritterschaft<br />
<strong>und</strong> ihrem Landtag, der Garaus gemacht werden. Entlang der Sprachengrenze<br />
zwischen dem estnischen <strong>und</strong> lettischen Siedlungsgebiet sollte durch e<strong>in</strong>en adm<strong>in</strong>istrativen<br />
Akt aus St. Petersburg e<strong>in</strong>e neue Gliederung der Ostseegouvernements e<strong>in</strong>geleitet<br />
werden. Im übrigen sollte die russische Landschaftsordnung – die Zemstvo-<br />
10 Vgl. zusammenfassend das Kapitel des Autors dieses Beitrages GERT VON PISTOHLKORS:<br />
„Die Ostseeprov<strong>in</strong>zen unter russischer Herrschaft (1710/95-1914), <strong>in</strong>: Baltische Länder,<br />
hrsg. von DEMS., Berl<strong>in</strong> 1994 (Deutsche Geschichte <strong>im</strong> Osten Europas), S. 266-450, bes. S.<br />
266-278.<br />
153
Organisation – auf die neuen Gouvernements übertragen werden, damit Esten <strong>und</strong><br />
Letten zum<strong>in</strong>dest die Gleichberechtigung mit der deutschen Oberschicht <strong>in</strong> der<br />
Selbstverwaltung erreichen konnten. Wie bekannt, hat erst die Provisorische Regierung<br />
unter dem Fürsten L’vov <strong>im</strong> Jahre 1917 nach der Februarrevolution unter dem<br />
E<strong>in</strong>druck von Demonstrationen estnischer Soldaten <strong>in</strong> Petrograd diesem alten Wunsch<br />
Rechnung getragen <strong>und</strong> die Zweiteilung verfügt. Von Estland <strong>und</strong> Lettland <strong>im</strong> modernen<br />
S<strong>in</strong>n sprach freilich <strong>in</strong> Rußland vor 1917 noch kaum jemand. 11<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf historische <strong>Grenzen</strong> haben Esten <strong>und</strong> Letten die schmerzliche Erfahrung<br />
machen müssen, daß sich die 1710/21 vertraglich verfügten Privilegierungen<br />
von Deutschen <strong>in</strong> Stadt <strong>und</strong> Land <strong>im</strong> Russischen Reich bis zum Ende des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
als erstaunlich stabil erwiesen haben. Die nationalen Bewegungen der Esten<br />
<strong>und</strong> Letten seit den 1860er Jahren fanden h<strong>in</strong>gegen mehr Gegner als Befürworter <strong>in</strong><br />
St. Petersburg. In se<strong>in</strong>er „Geschichte der baltischen Staaten“ von 1970 hat Georg von<br />
Rauch den Beg<strong>in</strong>n der „Epoche der Eigenstaatlichkeit“ für Estland, Lettland <strong>und</strong> Litauen<br />
dennoch nachdrücklich mit e<strong>in</strong>er positiven Wertung versehen: „Sie hatten sie –<br />
die Unabhängigkeit (GvP) – nicht so sehr fremder Hilfe als den eigenen militärischen<br />
Kräften <strong>und</strong> ihrem festen politischen Willen zu verdanken.“ 12 Diese großzügige Ermutigung<br />
zu eigenem historischem Selbstbewußtse<strong>in</strong> <strong>im</strong> Zeitalter Bre‹nevs bedarf<br />
unter dem leitenden Gesichtspunkt historischer <strong>und</strong> ethnischer Argumentationen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der <strong>Grenzen</strong> zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>er knappen Überprüfung. Die Vorgänge an den<br />
<strong>Grenzen</strong> Estlands <strong>im</strong> Jahre 1919 mögen dafür als Beispiel dienen.<br />
Von Karsten Brüggemann ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em quellennahen <strong>und</strong> argumentativ überzeugenden<br />
Aufsatz herausgearbeitet worden, wie zielstrebig der estnische militärische<br />
Führer Oberst Johan Laidoner (1884-1953) auf die Unabhängigkeit e<strong>in</strong>er Republik<br />
Estland h<strong>in</strong>gearbeitet hat. 13 Während Laidoner auf der e<strong>in</strong>en Seite die Nordwest-<br />
Armee unter gìÇÉåᦠunterstützte, gewann er mit der Annahme des sowjetischen Verhandlungsangebots<br />
Ende September 1919 den notwendigen Handlungsspielraum zur<br />
Verfolgung se<strong>in</strong>es wichtigsten politischen Zieles, der staatlichen Unabhängigkeit. Die<br />
estnische Seite hatte nunmehr zwei Eisen <strong>im</strong> Feuer – e<strong>in</strong> rotes <strong>und</strong> e<strong>in</strong> weißes. Sie<br />
konnte ruhig abwarten, was aus dem Vormarsch von gìÇÉåᦠauf Petrograd wurde.<br />
Als gìÇÉåᦠschließlich vorübergehend hoffen durfte, erfolgreich zu se<strong>in</strong>, ließ er alle<br />
Masken fallen <strong>und</strong> brüstete sich mit der Feststellung, daß es für ihn nur das e<strong>in</strong>e, unteilbare<br />
Rußland gebe, selbstverständlich auch unter E<strong>in</strong>schluß Estlands. Insgesamt<br />
nahm er mit se<strong>in</strong>em weißen Offizierskorps gegenüber der „Kartoffelrepublik“ Estland<br />
e<strong>in</strong>e durchgängig kaum verschleierte fe<strong>in</strong>dliche Haltung e<strong>in</strong>.<br />
Die Esten wurden <strong>im</strong> übrigen zu Sündenböcken für alle Fehler der russischen Führung<br />
gemacht. Zwar war die estnische Seite <strong>im</strong> eigenen Interesse lange Zeit bereit<br />
11 Nach wie vor gr<strong>und</strong>legend ist die von deutschen, estnischen <strong>und</strong> lettischen Autoren verfaßte<br />
Aufsatzsammlung <strong>in</strong> zwei Bänden: Von den baltischen Prov<strong>in</strong>zen zu den baltischen<br />
Staaten 1917-19<strong>20</strong>, hrsg. von JÜRGEN VON HEHN u.a., Marburg/Lahn 1971 <strong>und</strong> 1977.<br />
12 Vgl. GEORG VON RAUCH (wie Anm. 7), S. 80.<br />
13 Vgl. KARSTEN BRÜGGEMANN: Kooperation <strong>und</strong> Konfrontation: Estland <strong>im</strong> Kalkül der weißen<br />
Russen 1919, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Ostforschung 43 (1994), S. 534-552.<br />
154
gewesen, an e<strong>in</strong>em Zusammengehen mit der Nordwest-Armee festzuhalten, doch war<br />
auch klar, daß nationalpolitische Ziele auf beiden Seiten dom<strong>in</strong>ierten <strong>und</strong> daß der Antibolschewismus<br />
alle<strong>in</strong> nicht genügend Kitt bot, um beide Parteien auf Dauer beie<strong>in</strong>anderzuhalten.<br />
Es war deshalb nur konsequent, daß die Esten schließlich die Initiative<br />
zu Verhandlungen mit der Sowjetmacht übernahmen, um ihren eigenen Interessen<br />
zu dienen, die bereits e<strong>in</strong>deutig auf die Unabhängigkeit von Rußland gerichtet waren.<br />
Im e<strong>in</strong>zelnen ist allerd<strong>in</strong>gs von He<strong>in</strong>z von zur Mühlen nachgewiesen worden, wie<br />
schwierig sich die Verhandlungen um e<strong>in</strong>e verteidigungsfähige Grenze zwischen Estland<br />
<strong>und</strong> Rußland gestalteten. 14 Die Grenzziehung ca. 10 km östlich der Stadt Narva,<br />
die auch erst 1917 von Ingermanland zum Territorium des Gouvernements Estland<br />
zurückgekehrt war, konnte weder historisch noch ethnisch ausreichend begründet<br />
werden. Im Grenzstreifen lebten vor allem Russen. Narva selbst h<strong>in</strong>gegen war e<strong>in</strong>e<br />
vor allem von Esten bewohnte Stadt mit e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en kaufmännischen deutschen<br />
Oberschicht <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er nach der Volkszählung von 1897 bemessenen Gesamtzahl von<br />
16 577 E<strong>in</strong>wohnern, davon 14,6 Prozent Russen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges<br />
wuchs die Industriestadt mit fünf großen Fabriken <strong>in</strong>nerhalb der Krenholmer<br />
Manufaktur auf 45 000 Menschen an, zumeist Arbeiter, die sich <strong>im</strong> neugeschaffenen<br />
Arbeiter- <strong>und</strong> Soldatenrat nach dem Februar 1917 politisch stark engagierten. Nach<br />
dem Abzug der deutschen Truppen Ende November 1918 wurde sogar e<strong>in</strong>e estnische<br />
Arbeiterkommune <strong>in</strong> Narva ausgerufen. Im Januar 1919 obsiegte jedoch bereits die<br />
estnische Armee <strong>in</strong> Narva, die die Stadt nicht mehr herausgab. Der Anspruch auf<br />
Narva wurde zwar historisch <strong>und</strong> ethnisch begründet, wobei es ke<strong>in</strong>e Rolle spielte,<br />
daß die Stadt <strong>in</strong> schwedischer <strong>und</strong> russischer Zeit zwischen dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong><br />
1917 die Hauptstadt Ingermanlands gewesen war. Durchgesetzt wurde der Anspruch<br />
auf Narva jedoch durch e<strong>in</strong>en völkerrechtlich verb<strong>in</strong>dlichen Vertrag <strong>und</strong> durch militärische<br />
Präsenz.<br />
Mitten <strong>im</strong> H<strong>in</strong> <strong>und</strong> Her <strong>und</strong> <strong>im</strong> Zeichen militärischer Ause<strong>in</strong>andersetzungen <strong>im</strong><br />
erweiterten Gebiet um Narva begannen <strong>in</strong> Tartu/Dorpat am 5. Dezember 1919 die<br />
Verhandlungen zwischen den Sowjets <strong>und</strong> dem estnischen Vertreter Jaan Poska<br />
(1866-19<strong>20</strong>) ohne Teilnahme von Letten <strong>und</strong> Litauern. Den Esten g<strong>in</strong>g es vornehmlich<br />
um die Grenzfrage. Die Sowjets h<strong>in</strong>gegen wollten <strong>im</strong> Ergebnis vor allem e<strong>in</strong>e<br />
Garantie, daß sich auf estnischem Boden ke<strong>in</strong>e Kräfte zur Intervention mehr sammeln<br />
konnten. Die Esten verlangten zunächst e<strong>in</strong>e Grenzl<strong>in</strong>ienführung ca. 15 bis <strong>20</strong> km östlich<br />
von Narva <strong>und</strong> g<strong>in</strong>gen dabei von e<strong>in</strong>er Position der militärischen Stärke aus. Die<br />
Sowjets setzten dem e<strong>in</strong>en eigenen, völlig <strong>in</strong>diskutablen Vorschlag entgegen, der ihnen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>ie von K<strong>und</strong>a bis zum Peipussee e<strong>in</strong>en gewichtigen Teil des östlichen<br />
Wierland samt Narva zugeschlagen hätte. Sie räumten allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>, daß sie ethnische<br />
Gesichtspunkte berücksichtigen wollten, sobald die estnische Seite garantieren<br />
würde, daß Rußland vor e<strong>in</strong>er Intervention aus Estland durch weiße Truppen geschützt<br />
wäre. Auf die h<strong>in</strong>haltende Taktik der Sowjets ließ sich Poska jedoch nicht e<strong>in</strong>.<br />
Die Verhandlungen wurden von durchgängigen militärischen Scharmützeln beider<br />
14 Vgl. HEINZ VON ZUR MÜHLEN: Die Narva-Frage <strong>und</strong> die Grenze <strong>im</strong> Nordosten Estlands, <strong>in</strong>:<br />
Zeitschrift für Ostforschung 41 (1992), S. 248-257.<br />
155
Seiten begleitet. Das für die Republik Estland überaus befriedigende Ergebnis mit<br />
dem Grenzstreifen mehr als zehn km östlich von Narva <strong>und</strong> dem ganzen Petschurgebiet<br />
<strong>im</strong> Süden des Staates verdankten die Esten nach dem Urteil Mühlens ihrem „militärischen<br />
Widerstand“ <strong>und</strong> ihrem Mißtrauen gegenüber allen Zusicherungen der sowjetischen<br />
Verhandlungsführer. Strategische Gesichtspunkte waren alle<strong>in</strong> ausschlaggebend<br />
für das Insistieren auf dem Grenzstreifen. Narva wäre, nur durch den Fluß von<br />
der russischen Seite getrennt, angesichts der militärischen Kräfteverhältnisse nicht zu<br />
verteidigen gewesen.<br />
Aus dem Beispiel der Verhandlungen zwischen der Sowjetmacht <strong>und</strong> Estland <strong>in</strong><br />
den Jahren 1919/<strong>20</strong> kann gelernt werden, daß es wichtig ist, völkerrechtlich gesicherte<br />
Ergebnisse anzustreben, an die sich alle halten müssen. Ethnische <strong>und</strong> historische<br />
Argumentationen s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen nur Hilfsgrößen. Das heutige Estland würde aus wirtschaftlichen<br />
wie auch aus strategischen Gründen angesichts völlig ungleichgewichtiger<br />
militärischer Verhältnisse <strong>im</strong> Grenzraum zu Rußland auf den Grenzstreifen bei<br />
Narva gewiß verzichten können, wie auch Lettland auf das Abrenegebiet. Schwierig<br />
ist allerd<strong>in</strong>gs das völkerrechtliche Problem <strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Anerkennung der<br />
Friedensverträge von 19<strong>20</strong>. E<strong>in</strong> stillschweigender Verzicht auf diese wichtigen Best<strong>im</strong>mungen<br />
der Friedensverträge von 19<strong>20</strong>, die Rußland unter Jelz<strong>in</strong> 1991 pauschal<br />
ja <strong>im</strong>merh<strong>in</strong> anerkannt hat, könnte als Schwäche ausgelegt werden <strong>und</strong> zur Fortsetzung<br />
e<strong>in</strong>seitiger Pressionen führen, wie Estland sie freilich unter völlig anderen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
bereits um die Mitte der 1930er Jahre erlebt hat. Er<strong>in</strong>nerungen daran lassen<br />
sich nicht ohne weiteres verdrängen. Nach der Ermordung des führenden Parteifunktionärs<br />
Kirov <strong>in</strong> Len<strong>in</strong>grad <strong>im</strong> Dezember 1934 wurden aus Gründen der Ablenkung<br />
von <strong>in</strong>neren Schwierigkeiten plötzlich Stichbahnen an die sowjetisch-estnische<br />
Grenze gebaut. Drohungen wurden ausgestoßen. Die e<strong>in</strong>seitigen Erklärungen <strong>und</strong> Unterscheidungen<br />
des russischen Außenm<strong>in</strong>isters Kosyrev aus dem Jahr 1991 über „nahe“<br />
<strong>und</strong> über „unabhängige“ Nachbarn, die niemals dementiert worden s<strong>in</strong>d, tragen<br />
heutzutage nicht dazu bei, daß völlig spannungsfrei über Grenzprobleme zwischen<br />
Rußland <strong>und</strong> den baltischen Staaten nachgedacht werden kann. Es wird durch Verhandlungen<br />
<strong>in</strong> naher Zukunft entschieden werden müssen, ob fünfzig Jahre nach dem<br />
Ende des Zweiten Weltkrieges historische <strong>und</strong> ethnische Argumentationen <strong>im</strong> Nordosten<br />
Europas <strong>in</strong> Zukunft vor allem der Entfaltung von historischen Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
über ethnische Unterschiede h<strong>in</strong>weg dienen können oder nicht.<br />
156
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Menschen <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa –<br />
Genese <strong>und</strong> Wechselwirkungen<br />
von<br />
Hans L e m b e r g<br />
<strong>Grenzen</strong> – Gesellschaften – vormoderne Staaten<br />
Wenn wir uns <strong>im</strong> folgenden mit der Genese <strong>und</strong> den Wechselwirkungen von <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten <strong>im</strong> östlichen Europa beschäftigen 1 , dann wird es angebracht se<strong>in</strong>,<br />
e<strong>in</strong>en langen, wenn auch raschen Anlauf zu machen <strong>und</strong> damit <strong>im</strong> Mittelalter anzufangen.<br />
Grob gesagt: <strong>Grenzen</strong> gab es schon vor den Staaten, <strong>und</strong> zwar zunächst als Marken,<br />
mehr oder weniger breite Gebietsstreifen, Wildnisse zwischen den Herrschaftskernen<br />
der sogenannten mittelalterlichen Personenverbandsstaaten, die noch nicht als<br />
Staaten <strong>im</strong> modernen S<strong>in</strong>ne angesehen werden können. Mit dem mittelalterlichen<br />
Landesausbau <strong>im</strong> östlichen Mitteleuropa hat das slawische Wort granica aus dem<br />
Vorfeld der Germania Slavica, des späteren Ostdeutschland (also aus dem preußischen<br />
Ordensland, aus Pommern <strong>und</strong> Schlesien), geme<strong>in</strong>sam mit der von ihm bezeichneten<br />
Sache den Siegeszug nach Westen angetreten, „granica“ nämlich <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>er l<strong>in</strong>ear verstandenen, abgesteckten Grenze zwischen zunächst privaten, dann aber<br />
<strong>im</strong>mer mehr auch öffentlichen Rechtsbereichen. 2<br />
Bis zum Zeitalter der Reformation hatte sich das Lehnwort „Grenze“ auch <strong>in</strong> der<br />
deutschen Sprachform längst durchgesetzt. Als sich jetzt, <strong>im</strong> 16./17. Jahrh<strong>und</strong>ert, der<br />
moderne Territorialstaat herausbildete, bemächtigten sich die Staatstheoretiker der<br />
1 Der Beitrag zur Tagung von 1995 ist <strong>in</strong>zwischen weiterentwickelt <strong>und</strong> <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Versionen <strong>in</strong> Nidden/Litauen 1996, Tüb<strong>in</strong>gen 1997 <strong>und</strong> Kiel 1998 vorgetragen worden. Die<br />
vorliegende Fassung ist <strong>im</strong> wesentlichen die der Abschiedsvorlesung des Verf. an der Philipps-Universität<br />
Marburg am 23. Juli 1998.<br />
2 Vgl. dazu den Beitrag von Hans-Jürgen Karp <strong>im</strong> vorliegenden Band; vgl. auch DERS.:<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> während des Mittelalters. E<strong>in</strong> Beitrag zur Entstehungsgeschichte<br />
der Grenzl<strong>in</strong>ie aus dem Grenzsaum, Köln, Wien 1972 (Forschungen <strong>und</strong> Quellen<br />
zur Kirchen- <strong>und</strong> Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 9); HERBERT KOLB: Zur Frühgeschichte<br />
des Wortes „Grenze“, <strong>in</strong>: Archiv für das Studium der neueren Sprachen <strong>und</strong> Literaturen<br />
226, Jg. 141 (1989), 2. Halbbd., S. 344–356; HANS-WERNER NICKLIS: Von der<br />
„Grenitze“ zur Grenze. Die Grenzidee des late<strong>in</strong>ischen Mittelalters (6.–15. Jh.), <strong>in</strong>: Blätter<br />
für deutsche Landesgeschichte 123 (1992), S. 1–30; WINFRIED SCHICH: Die „Grenze“ <strong>im</strong><br />
östlichen Mitteleuropa <strong>im</strong> hohen Mittelalter, <strong>in</strong>: Siedlungsforschung 9 (1991), S. 135–146.<br />
159
Grenze <strong>und</strong> ihrer Zeichen als e<strong>in</strong>es wesentlichen Elements, das für die Konstituierung<br />
der Territorialherrschaft, der superioritas territorialis notwendig ist. 3 Seither gelten<br />
als Def<strong>in</strong>ition, was eigentlich den Staat ausmache, die noch uns geläufigen drei Kriterien:<br />
1. die Staatsgewalt, 2. das Staatsvolk <strong>und</strong> 3. das Staatsgebiet. Dieses Staatsgebiet<br />
aber, das Territorium, darüber gibt es ke<strong>in</strong>en Streit, ist durch e<strong>in</strong>e mit Grenzzeichen<br />
abgesteckte Grenze de-f<strong>in</strong>iert. 4<br />
E<strong>in</strong>en anderen Anlauf bietet die nächste Frage: Wie war die menschliche Gesellschaft<br />
<strong>in</strong> der frühen Neuzeit gegliedert, also vor den Umwälzungen der Französischen<br />
Revolution, <strong>in</strong> deren Folge die Gesellschaft egalitär strukturiert worden ist? Wenn<br />
man möglichst weit zu abstrahieren versucht, fällt auf, daß es vor der Französischen<br />
Revolution e<strong>in</strong>e Teilung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e privilegierte <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e (viel größere) nichtprivilegierte<br />
Großgruppe gab; wer nicht privilegiert war, auf den kam es überhaupt nicht an,<br />
der zählte <strong>in</strong> politischer H<strong>in</strong>sicht nicht mit. Der populus, die politische Nation, bestand<br />
nur aus den Privilegierten, man kann auch sagen: aus den Standespersonen, den<br />
Ständen. 5<br />
Änderten sich <strong>in</strong> dieser Epoche <strong>Grenzen</strong> durch Kriege oder durch dynastische Ereignisse,<br />
dann blieb unterhalb der Ebene des Souveräns das soziale Gefüge von Privilegierten<br />
<strong>und</strong> Nichtprivilegierten erhalten; ja mehr noch: die Privilegien wurden <strong>in</strong> der<br />
Regel vom neuen Souverän bestätigt; <strong>und</strong> so blieb h<strong>in</strong>sichtlich der <strong>in</strong>neren sozialen,<br />
rechtlichen <strong>und</strong> kulturellen Verhältnisse wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em verschnürten Paket alles be<strong>im</strong><br />
alten 6 , auch wenn die Reichsgrenzen nun ganz anderswo verliefen <strong>und</strong> der Landesherr<br />
gewechselt hatte. Das Weiterleben des Privilegium Sigism<strong>und</strong>i Augusti <strong>im</strong> Baltikum 7<br />
oder des Andreanum <strong>in</strong> Siebenbürgen 8 s<strong>in</strong>d hierfür e<strong>in</strong>drucksvolle Beispiele.<br />
3 Dazu vgl. DIETMAR WILLOWEIT: Rechtsgr<strong>und</strong>lagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit,<br />
Herrschaftsrechte <strong>und</strong> Territorium <strong>in</strong> der Rechtswissenschaft der Neuzeit, Köln, Wien 1975<br />
(Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 11), bes. S. 274 ff.; s. auch HANS MEDICK:<br />
Grenzziehung <strong>und</strong> die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur Begriffsgeschichte<br />
<strong>und</strong> politischen Sozialgeschichte der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Frühen Neuzeit, <strong>in</strong>: Grenzland. Beiträge<br />
zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, hrsg. von B. WEISBROD, Hannover 1993,<br />
S. 195-211.<br />
4 Zur Drei-Elementenlehre <strong>im</strong> Völkerrecht vgl.: KNUT IPSEN u.a.: Völkerrecht, 4. Aufl. München<br />
1999, S. 55-59; GEORG DAHM, JOST DELBRÜCK <strong>und</strong> RÜDIGER WOLFRUM: Völkerrecht,<br />
Bd. I/1, 2. Aufl. Berl<strong>in</strong>, New York 1989, S. 125-131.<br />
5 Vgl. HANS LEMBERG: Der Weg zur Entstehung der Nationalstaaten <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>, <strong>in</strong>:<br />
Osteuropa zwischen Nationalstaat <strong>und</strong> Integration, hrsg. von GEORG BRUNNER, Berl<strong>in</strong> 1995<br />
(Osteuropaforschung. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropak<strong>und</strong>e, 33),<br />
S. 45-71 (mit e<strong>in</strong>er schematischen Skizze).<br />
6 Ulrich Scheuner mündlich <strong>in</strong> der Diskussion zu se<strong>in</strong>em Vortrag. Vgl. ULRICH SCHEUNER:<br />
Nationalstaatspr<strong>in</strong>zip <strong>und</strong> Staatenordnung seit dem Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Staatsgründung<br />
<strong>und</strong> Nationalitätspr<strong>in</strong>zip. Unter Mitwirkung von PETER ALTER hrsg. von THEO-<br />
DOR SCHIEDER, München, Wien 1974 (Studien zur Geschichte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, 7), S.<br />
9–37.<br />
7 KLAUS-DIETRICH STAEMMLER: Preußen <strong>und</strong> Livland <strong>in</strong> ihrem Verhältnis zur Krone Polen<br />
1561–1586, Marburg/Lahn 1953 (Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte <strong>und</strong> Landes-<br />
160
In e<strong>in</strong>em solchen System konnte es also nicht, wie <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, so etwas<br />
geben wie ethnische M<strong>in</strong>derheiten. Der Begriff von Mehrheit <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheit verlangt<br />
ja, daß Menschen, deren Gleichheit vorausgesetzt wird, gezählt, nicht aber nach dem<br />
Grad ihrer Privilegierung gewogen werden. Zudem spielte es <strong>in</strong> der vormodernen Zeit<br />
ke<strong>in</strong>e Rolle, welcher Sprache sich die Menschen zur Kommunikation bedienten, also<br />
welches ihre Muttersprache war. Die Kultsprache, die Rechts- <strong>und</strong> Wissenschaftssprache<br />
waren meist ohneh<strong>in</strong> anders: Late<strong>in</strong>isch, Westrussisch-Kirchenslawisch,<br />
Französisch, möglicherweise Neuhochdeutsch, Osmanisch oder was auch <strong>im</strong>mer.<br />
Freilich - es gab religiöse Gruppen, die man aus heutiger Sicht mit M<strong>in</strong>derheiten<br />
vergleichen könnte: sie waren konfessionell oder religiös anders e<strong>in</strong>gestellt als die <strong>im</strong><br />
Lande herrschende Religion <strong>und</strong> konnten dessentwegen entsprechenden Verfolgungen<br />
ausgesetzt werden. Dennoch ist das Begriffspaar „Mehrheit“ <strong>und</strong> „M<strong>in</strong>derheit“<br />
auch hier abwegig: Auch bei den Konfessionen g<strong>in</strong>g es um Gruppen, die eher nach<br />
dem ständischen Pr<strong>in</strong>zip konstituiert waren; selbst die Toleranz zwischen diesen<br />
Gruppen ähnelte – vor dem Zeitalter der Aufklärung – eher ständischen Bündnissen. 9<br />
Historisches Recht, Naturrecht <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong><br />
Frühneuzeitliche <strong>Grenzen</strong> zwischen Territorialstaaten waren meist <strong>in</strong> irgende<strong>in</strong>er<br />
Weise historisch-juristisch legit<strong>im</strong>iert, zu Recht oder nur dem Anspruch nach. Die<br />
Durchsetzung des modernen, zentral organisierten Flächenstaates <strong>und</strong> die Verdrängung<br />
älterer, traditioneller, eher ständisch geprägter Herrschaften sollte die Landkarte<br />
des europäischen Staatensystems der frühen Neuzeit <strong>im</strong>mer wieder verändern. Es ist<br />
überflüssig, <strong>in</strong>s Gedächtnis zu rufen, wie oft Territorien mittlerer Größe wie etwa Livland<br />
von e<strong>in</strong>er Hand <strong>in</strong> die andere g<strong>in</strong>gen; oder wie mit den verschiedenen Komb<strong>in</strong>ationen<br />
von Unionen seit dem späten Mittelalter auch große Territorien <strong>im</strong>mer wieder<br />
die Zugehörigkeit zu Dynastien oder Staatsverbänden wechselten. Wenn aber <strong>Grenzen</strong><br />
verändert wurden, dann meist mit historisch-rechtlicher Argumentation <strong>und</strong> oft<br />
genug entlang alter L<strong>in</strong>ien.<br />
Im Zeitalter der Aufklärung schien diese historisch-legit<strong>im</strong>istische Argumentation<br />
durch rationale Vorwände für Grenzziehungen <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> gedrängt zu werden.<br />
Montesquieu lehrte, jeder Staat habe se<strong>in</strong>e „l<strong>im</strong>ites naturelles“. Die Natur selbst<br />
also, nicht die Festlegung <strong>in</strong> verstaubten, überkommenen Privilegien solle künftig den<br />
k<strong>und</strong>e Ost-Mitteleuropas, 8). – Zum Weiterleben: Die Capitulationen der livländischen Ritter-<br />
<strong>und</strong> Landschaft <strong>und</strong> der Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst deren Confirmationen. Nach<br />
den Orig<strong>in</strong>aldocumenten mit Vorausstellung des Privilegium Sigism<strong>und</strong>i Augusti <strong>und</strong> e<strong>in</strong>igen<br />
Beilagen hrsg. von C[ARL] SCHIRREN, Dorpat 1865.<br />
8 Quellen zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen 1191–1975, hrsg. von ERNST WAGNER,<br />
Köln, Wien 1976 (Schriften zur Landesk<strong>und</strong>e Siebenbürgens, 1), S. 15–<strong>20</strong>.<br />
9 Vgl. WALTER DAUGSCH: Toleranz <strong>im</strong> Fürstentum Siebenbürgen. Politische <strong>und</strong> gesellschaftliche<br />
Voraussetzungen der Religionsgesetzgebung <strong>im</strong> 16. <strong>und</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>:<br />
Kirche <strong>im</strong> Osten 26 (1983), S. 35–72.<br />
161
Maßstab für die Begrenzung des Territorialstaates geben. Bis zu se<strong>in</strong>en natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> sei der Staat kraft Naturgesetzes berechtigt vorzudr<strong>in</strong>gen; sie zu überschreiten<br />
freilich bedeute dessen Übertretung. 10 Gerade <strong>in</strong> Frankreich, zumal <strong>im</strong> Zeitalter<br />
der Revolution, verlagerte sich <strong>im</strong> Zeichen der Aufklärung das Gewicht der Argumentation<br />
von den früher auch dort gebräuchlichen historischen Begründungsmustern<br />
gänzlich auf die der quasi natürlichen Best<strong>im</strong>mung. Nun freilich, <strong>in</strong> den Revolutionskriegen,<br />
schien sich diese Vision mit der Erreichung der sogenannten natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> von Ozean <strong>und</strong> Pyrenäen, Alpen <strong>und</strong> Rhe<strong>in</strong>-Maas zu erfüllen.<br />
Derart spektakuläre „natürliche“ <strong>Grenzen</strong> wird man allerd<strong>in</strong>gs <strong>im</strong> b<strong>in</strong>nenländischen<br />
<strong>Ostmitteleuropa</strong> kaum oder gar nicht f<strong>in</strong>den 11 , sieht man e<strong>in</strong>mal von Ausnahmen<br />
ab, wie etwa der Düna <strong>im</strong> 18., der Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert oder den<br />
allerd<strong>in</strong>gs über Jahrh<strong>und</strong>erte h<strong>in</strong>weg „natürliche“ <strong>Grenzen</strong> bildenden Bergkämmen<br />
vom Erzgebirge über die Sudeten bis zu den Karpathen; 12 eher dann schon <strong>in</strong> Südosteuropa,<br />
wie gewisse Teile der Save oder der Donau, das Balkangebirge oder die Dr<strong>in</strong>a.<br />
Gerade <strong>im</strong> flacheren <strong>und</strong> weniger geographisch akzentuierten <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
spielte das Argument der natürlichen Grenze e<strong>in</strong>e recht ger<strong>in</strong>ge Rolle.<br />
Doch auch <strong>in</strong> solchen Gegenden Europas konnte man der Natur <strong>und</strong> ihrer grenzbildenden<br />
Kraft argumentativ zum Durchbruch verhelfen: War denn nicht, wie man<br />
<strong>im</strong> Zeitalter der Romantik zu wissen glaubte, das neu entdeckte Volkstum e<strong>in</strong> ganz<br />
ursprüngliches, natürliches Element? Konnten da nicht auch Volkstümer, Völker, Nationen<br />
ihren eigenen Platz auf der Landkarte beanspruchen, viel gültiger <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne des<br />
natürlichen Rechts als die historisch gewachsenen <strong>Grenzen</strong> der Länder <strong>und</strong> Staaten? 13<br />
10 N.J.G. POUNDS: The orig<strong>in</strong> of the idea of natural frontiers <strong>in</strong> France, <strong>in</strong>: Annals. Association<br />
of American Geographers 41 (1951), S. 146-157; DERS.: France and „Les l<strong>im</strong>ites naturelles“<br />
from the seventeenth to twentieth centuries, ebenda 44 (1954), S. 51-62; JOHANN<br />
SÖLCH: Die Auffassung der „natürlichen <strong>Grenzen</strong>“ <strong>in</strong> der wissenschaftlichen Geographie,<br />
Innsbruck 1924.<br />
11 HANS-DIETRICH SCHULTZ: Deutschlands „natürliche“ <strong>Grenzen</strong>. „Mittellage“ <strong>und</strong> „Mitteleuropa“<br />
<strong>in</strong> der Diskussion der Geographen seit dem Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Geschichte<br />
<strong>und</strong> Gesellschaft 15 (1989), S. 248-281.<br />
12 Zur ideologisierenden Überhöhung der „natürlichen“ Grenze der böhmischen Länder siehe<br />
allerd<strong>in</strong>gs den Beitrag von Robert Luft <strong>im</strong> vorliegenden Band.<br />
13 Über natürliche Gränzen, <strong>in</strong>: Deutsche Blätter, Nr. 57 (Bd. 2, Stück 3) v. 29.12.1813, S. 33-<br />
42. Dort: Politiker verstehen „seit e<strong>in</strong>igen Jahrzehenden“ unter natürlichen <strong>Grenzen</strong>: Gebirge,<br />
Seen, „am liebsten aber Flüsse“. „Es tut uns leid, diese Herren <strong>in</strong> solch e<strong>in</strong>er bequemen<br />
E<strong>in</strong>richtung stören zu müssen. Die Natur, die bei Best<strong>im</strong>mung dieser [d.h. der natürlichen<br />
<strong>Grenzen</strong>, H.L.] leiten muß, ist doch wohl nicht die todte des Bodens, sondern die lebendige<br />
der Völker, denn um dieser willen ist jener da, nicht sie für ihn.“ (S. 33); die Sprache<br />
sei das unterscheidende Merkmal (S. 34). Ströme seien „die Puls- <strong>und</strong> Blutadern der<br />
Länder“; die Sprache sei die „e<strong>in</strong>zig gültigste Naturgränze“: ERNST MORITZ ARNDT: Der<br />
Rhe<strong>in</strong>, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Gränze, Leipzig 1813, <strong>in</strong>: Arndts<br />
Werke, hrsg. von AUGUST LEFFSON u. W. STEFFENS, 1912, XI, S. 41; zit. bei ALEXANDER<br />
DEMANDT: Die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte Deutschlands, <strong>in</strong>: Deutschlands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der<br />
Geschichte, hrsg. von ALEXANDER DEMANDT, 3. Aufl. München 1993, S. 9–31, hier: S. 15;<br />
162
Tatsächlich hat der E<strong>in</strong>bruch des ethnisch-nationalen Gedankens für das <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zu e<strong>in</strong>em ganz neuen Nachdenken über <strong>Grenzen</strong>, ja zu neuen Konstitutionspr<strong>in</strong>zipien<br />
der Staaten selbst <strong>und</strong> der menschlichen Gesellschaft dar<strong>in</strong> geführt. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
konnten be<strong>im</strong> Ausbau <strong>und</strong> be<strong>im</strong> Nacheifern der nationalen Idee dann doch wieder<br />
natürliche <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> geographischen S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>e Rolle spielen, wenn sie sich nur<br />
annäherungsweise mit der Volksgrenze zur Deckung br<strong>in</strong>gen ließen, wie der Rhe<strong>in</strong>,<br />
an dem man die Wacht zu halten gelobte 14 oder auch die Memel, bis zu der, wie eben<br />
bis zur Maas am anderen Ende, die deutsche Sprache reichte <strong>und</strong> folglich auch e<strong>in</strong> zu<br />
erstrebendes e<strong>in</strong>iges Deutschland sich ausdehnen sollte. 15<br />
Entsprechend dieser Gewichtsverlagerung – von der geographischen Topographie<br />
zur Ethnie oder zur ethnisch (nicht historisch-rechtlich) geprägten Nation – entstanden<br />
auch seit der Mitte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts e<strong>in</strong>e Vielzahl von teils empirischen, teils<br />
dem Anspruchsdenken verpflichteten, eher utopischen Nationalitätenkarten, die wichtige<br />
Mittel der Politik bis <strong>in</strong> unsere Tage bilden sollten. 16 Von da aus war es zur Idee<br />
<strong>und</strong> schließlich auch zur Verwirklichung des Nationalstaats unter der Devise „E<strong>in</strong><br />
Volk, e<strong>in</strong> Reich“ nicht mehr weit.<br />
Freilich stießen sich hier - <strong>und</strong> das über e<strong>in</strong>en großen Zeitraum das lange <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
h<strong>in</strong>durch - die Pr<strong>in</strong>zipien <strong>im</strong> Raume: Noch war das historische Recht der Legit<strong>im</strong>ität<br />
übermächtig, <strong>und</strong> gerade erst war es ja nach den napoleonischen Turbulenzen<br />
<strong>im</strong> Friedenswerk von Wien 1815 noch e<strong>in</strong>mal gefestigt worden – wenn man auch<br />
nicht übersehen darf, daß sich hier vor allem für die mittleren <strong>und</strong> westlichen Teile<br />
des Reiches bzw. se<strong>in</strong>er Nachfolgegebilde allerhand geändert hatte. Ob es aber nun<br />
die alte Legit<strong>im</strong>ität war, die etwa <strong>in</strong> den baltischen Prov<strong>in</strong>zen des Russischen Reiches<br />
s. auch: S<strong>in</strong>d Flüsse schickliche Gränzen der Staaten?, <strong>in</strong>: Schlesische Prov<strong>in</strong>zialblätter 60<br />
(1814), 121-127.<br />
14<br />
MAX SCHNECKENBURGER: Die Wacht am Rhe<strong>in</strong> (1840), <strong>in</strong>: Schauenburgs allgeme<strong>in</strong>es<br />
Deutsches Kommersbuch, 44. Aufl. Lahr o.J. [nach 1886], S. 31 f.; entstanden <strong>in</strong> der<br />
„Rhe<strong>in</strong>krise“ von 1840. Vgl. UTZ JAEGGLE: Trennen <strong>und</strong> Verb<strong>in</strong>den. Warum ist es am<br />
Gr<strong>und</strong>e des Rhe<strong>in</strong>es so schön?, <strong>in</strong>: SOWI. Sozialwissenschaftliche Informationen, Stuttgart<br />
<strong>20</strong> (1991), Nr. 3, S. 179–185, hier: S. 182; „Rhe<strong>in</strong>“ wird hier metaphorisch auch für die<br />
bedroht ersche<strong>in</strong>enden Gebiete jenseits, also westlich des Rhe<strong>in</strong>es verstanden.<br />
15<br />
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN: Das Lied der Deutschen, [Erstausgabe] Hamburg, Stuttgart<br />
1841.<br />
16<br />
JOHANNES DÖRFLINGER: Sprachen <strong>und</strong> Völkerkarten des mitteleuropäischen Raumes vom<br />
18. Jahrh<strong>und</strong>ert bis <strong>in</strong> die 2. Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: 4. Kartographiehistorisches<br />
Colloquium, Karlsruhe 1988. Vorträge <strong>und</strong> Berichte, hrsg. von WOLFGANG SCHARFE,<br />
HEINZ MUSALL <strong>und</strong> JOACHIM NEUMANN, Berl<strong>in</strong> 1990, S. 183–195; HOLGER FISCHER: Karten<br />
zur räumlichen Verteilung der Nationalitäten <strong>in</strong> Ungarn. Darstellungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> ihrer Interpretation am Beispiel von ungarischen Nationalitätenkarten des <strong>19.</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong>: Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
„Deutsche <strong>und</strong> Magyaren als nationale M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> Donauraum“, hrsg. von EDGAR<br />
HÖSCH <strong>und</strong> GERHARD SEEWANN, München 1991, S. 325–393. Zur Rolle von Karten als<br />
Propaganda<strong>in</strong>strument: GUNTRAM HENRIK HERB: Under the map of Germany. Nationalism<br />
and Propaganda 1918–1945, London, New York 1997, hier bes. S. 8–12.<br />
163
zunächst lange gewahrt blieb, oder e<strong>in</strong>e neue der preußischen, österreichischen <strong>und</strong><br />
selbst russischen Teilungsgebiete Polens samt dem eigenartigen Kongreß-Königreich,<br />
noch lange vermochte zum<strong>in</strong>dest die Idee der historischen Legit<strong>im</strong>ität die politisch<br />
Denkenden <strong>in</strong> ihrem Bann zu halten.<br />
Das Festhalten an der herkömmlichen Begründung von Staaten <strong>und</strong> damit der historischen<br />
Begrenzung von Territorialstaaten war selbst dort zu beobachten, wo das<br />
ethnisch-nationale Pr<strong>in</strong>zip sich <strong>im</strong>mer stärker vordrängte. Die deutschen Diskussionen<br />
des Jahres 1848 ließen diese Kreuzung der Argumentationen deutlich erkennen,<br />
deutlicher noch die Ause<strong>in</strong>andersetzung der sechziger Jahre <strong>in</strong> den baltischen Prov<strong>in</strong>zen<br />
Rußlands, die mit den Namen Samar<strong>in</strong> <strong>und</strong> Schirren verb<strong>und</strong>en war. Wenn irgendwo,<br />
dann prallten hier das historische Recht <strong>und</strong> das natürliche Pr<strong>in</strong>zip der Nationalität<br />
hart aufe<strong>in</strong>ander. 17<br />
Es ist aber bemerkenswert, wie die Figur des „historischen Staatsrechts“, also der<br />
alten, gewachsenen <strong>und</strong> vielleicht sogar zwischenzeitlich gestörten oder zerstörten<br />
Legit<strong>im</strong>ität der frühen Neuzeit, bis <strong>in</strong>s späte <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>im</strong>mer noch lebenskräftig<br />
war. Das konnte sich so auswirken, daß – wie <strong>im</strong> Fall der deutschbaltischen Legit<strong>im</strong>isten<br />
– der Kampf um dieses Pr<strong>in</strong>zip von se<strong>in</strong>en alten Trägern bis zum Untergang<br />
weitergefochten wurde, das heißt: bis zur Herabstufung zur nationalen M<strong>in</strong>derheit <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em egalitär organisierten Nationalstaat 18 , oder aber daß sich ganz neue Trägerschichten<br />
dieses Pr<strong>in</strong>zips annahmen. 19<br />
Gerade dies läßt sich anhand der tschechischen <strong>und</strong> ähnlich auch der kroatischen<br />
Nationalbewegung exemplifizieren. Im Habsburgerreich hatte man ja 1848 <strong>und</strong> dann<br />
endgültig 1867 erlebt, wie es den Ungarn gelungen war, durch das Pochen auf das historische<br />
Staatsrecht des Regnum Hungariae die Dualisierung des Staates zu erreichen<br />
<strong>und</strong> damit e<strong>in</strong> großes Maß ungarischer Autonomie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er der beiden Reichshälften.<br />
In e<strong>in</strong>er Art Nachahmungsaktion <strong>20</strong> , wenn auch mit anderem Akzent, haben<br />
nun tschechische Politiker sich des traditionellen Arguments des Adels der böhmischen<br />
Länder bedient <strong>und</strong> ebenfalls die Historischen Rechte der Länder der Sankt-<br />
Wenzelskrone e<strong>in</strong>gefordert, dieses Argument aber sozusagen auf das Interesse der<br />
modernen tschechischen Nation umgewidmet. Die böhmischen Länder (<strong>in</strong> ihren alten<br />
historischen <strong>Grenzen</strong>, versteht sich) sollten somit künftig der Gliedstaat der Habsburgermonarchie<br />
se<strong>in</strong>, <strong>in</strong> dem die Tschechen die Mehrheit bildeten. 21 Wenn die Deut-<br />
17 CARL SCHIRREN: Livländische Antwort an Herrn Juri Samar<strong>in</strong>, Leipzig 1869.<br />
18 Über die Schwierigkeiten dieses Wandels vgl. MICHAEL GARLEFF: Die Deutschbalten als<br />
nationale M<strong>in</strong>derheit <strong>in</strong> den unabhängigen Staaten Estland <strong>und</strong> Lettland, <strong>in</strong>: Deutsche Geschichte<br />
<strong>im</strong> Osten Europas. Baltische Länder, hrsg. von GERT VON PISTOHLKORS, Berl<strong>in</strong><br />
1994, S. 452–550, bes.: S. 482–488.<br />
19 Hierzu beispielsweise: TADEUSZ ÒEPKOWSKI: Polska – Narodz<strong>in</strong>y nowoczesnego narodu.<br />
1764–1870 [Polen – Geburt e<strong>in</strong>er modernen Nation], Warszawa 1967.<br />
<strong>20</strong> Vgl. JAN KR=EN: Die Konfliktgeme<strong>in</strong>schaft. Tschechen <strong>und</strong> Deutsche 1780–1918, München<br />
1996 (Veröffentlichungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um, 71), S. 77.<br />
21 OTTO URBAN: Die tschechische Gesellschaft 1848–1918, Bd. 1, Wien, Köln, We<strong>im</strong>ar 1994<br />
(Anton G<strong>in</strong>dely Reihe zur Geschichte der Donaumonarchie <strong>und</strong> Mitteleuropas, 2), S. 278<br />
164
schen zur Vermeidung dieser neuen M<strong>in</strong>derheitenrolle <strong>im</strong> Gegenzug die Unterscheidung<br />
von tschechisch <strong>und</strong> deutsch besiedelten Gebieten <strong>im</strong> Lande mit nationalitätenrechtlichen<br />
Folgen forderten – <strong>und</strong> damit eigentlich die Verwirklichung der damals<br />
schon auf vielen Nationalitätenkarten zu sehenden ethnischen Grenze <strong>in</strong>nerhalb der<br />
böhmischen Länder 22 -, wurde ihnen von der tschechischen Seite das Anstreben e<strong>in</strong>er<br />
„Landeszerreißung“ vorgeworfen. 23<br />
Wandel zur modernen Nation<br />
Dieses Wetteifern der unterschiedlichen Pr<strong>in</strong>zipien ist weniger e<strong>in</strong> Ausdruck besonderer<br />
taktischer Gerissenheit auf der e<strong>in</strong>en oder der anderen Seite, sondern <strong>in</strong> ihm verkörpert<br />
sich der langsame Wandel von der vormodernen, ständisch geprägten Nation,<br />
bei der die verwendete Sprache e<strong>in</strong>er privilegierten oder e<strong>in</strong>er nichtprivilegierten<br />
Schicht eher nebensächlich <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e private Angelegenheit war, h<strong>in</strong> zu modernen<br />
ff. pass<strong>im</strong>; JIR=Í KOR=ALKA, R.J. CRAMPTON: Die Tschechen, <strong>in</strong>: Die Habsburgermonarchie<br />
1848–1918, Bd. 3, hrsg. von ADAM WANDRUSZKA u. PETER URBANITSCH, 1. Teilband,<br />
Wien 1980, S. 489–521; Zur „Wandelbarkeit“ des „Mehrheits-M<strong>in</strong>derheits-Verhältnisses“<br />
vgl.: JIR=Í KOR=ALKA: Tschechen <strong>im</strong> Habsburgerreich <strong>und</strong> <strong>in</strong> Europa 1815–1914. Sozialgeschichtliche<br />
Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung <strong>und</strong> der Nationalitätenfrage<br />
<strong>in</strong> den böhmischen Ländern, Wien, München 1991 (Schriftenreihe des Österreichischen<br />
Ost- <strong>und</strong> Südosteuropa-<strong>Institut</strong>s, 18), S. 133–139.<br />
22 Vgl. dazu MARK CORNWALL: The Struggle on the Czech-German Language Border, 1880–<br />
1940, <strong>in</strong>: The English Historical Review 109 (1994), S. 914–951. E<strong>in</strong> Beispiel: C. GRÄF:<br />
Das Königreich Böhmen. Kartenbeilage zu: Böhmen. Land <strong>und</strong> Volk. Geschildert von<br />
mehreren Fachgelehrten. Mit e<strong>in</strong>er, die Sprachgränzen bezeichnenden, Karte von Böhmen.<br />
Prag 1864. Vgl. auch die kartographischen Arbeiten des Sohnes des letzten hessischen<br />
Kurfürsten, He<strong>in</strong>rich [von] Hanau, der <strong>in</strong> der kartographischen Anstalt Freytag & Berndt<br />
aufwendige Karten mit von ihm vorgesehenen autonomen nationalen Kronländern der<br />
Habsburgermonarchie veröffentlicht hat, z.B. HEINRICH HANAU: Triaskarte der Habsburger<br />
Monarchie, Wien 1909; DERS.: Neue Triaskarte [...], Wien o.J.; DERS.: Deutschböhmen,<br />
Tschechischböhmen, Mähren, Schlesien. [Anlage zur Neuen Triaskarte], Wien o.J. Siehe<br />
dazu demnächst MARGRET LEMBERG: E<strong>in</strong> fürstlicher Dilettant. He<strong>in</strong>rich Hanau – E<strong>in</strong> Sohn<br />
des letzten Kurfürsten. (Vorauss. <strong>20</strong>00.)<br />
23 HELMUT SLAPNICKA: Die Stellungnahme des Deutschtums der Sudetenländer zum „Historischen<br />
Staatsrecht“, <strong>in</strong>: Das böhmische Staatsrecht <strong>in</strong> den deutsch-tschechischen Ause<strong>in</strong>andersetzungen<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts, hrsg. von ERNST BIRKE <strong>und</strong> KURT OBER-<br />
DORFFER, Marburg/ Lahn 1960, S. 15–41. E<strong>in</strong>e Karikatur zur „Landeszerreißung“: „Necháme<br />
si ten nás= drahý starý gobelín naposled tím buldoggem rozsápat?“ [„Lassen wir uns<br />
diesen unseren teuren Gobel<strong>in</strong> zu guter Letzt durch diese Bulldogge zerreißen?“ Der böhmische<br />
Löwe bewacht e<strong>in</strong>en Teppich mit den Umrissen des Königreichs Böhmen gegen<br />
e<strong>in</strong>e Bulldogge mit Pickelhaube <strong>und</strong> der Aufschrift „Liberecký trhan“ (Reichenberger<br />
Reißteufel)], aus: S+ípy vom 6.10.1906; Nachdruck der Karikatur <strong>in</strong>: Gleiche Bilder, gleiche<br />
Worte. Deutsche, Österreicher <strong>und</strong> Tschechen <strong>in</strong> der Karikatur 1848-1948, Ausstellungskatalog,<br />
München 1997, S. 248; siehe dort auch S. 230.<br />
165
demokratischen Nationen, die auf der nachrevolutionären Gleichheit aller Menschen<br />
beruhen <strong>und</strong> bei denen das sprachlich-ethnische Pr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>en ganz hohen, ja entscheidenden<br />
Stellenwert bekommen hat. 24<br />
Dies wurde besonders dort mit Händen greifbar, wo sich e<strong>in</strong>e bisher privilegierte<br />
„natio“ <strong>im</strong> alten S<strong>in</strong>ne, etwa die Deutschbalten oder die Siebenbürger Sachsen, nun –<br />
<strong>im</strong> nationalen Zeitalter, also <strong>im</strong> späten <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, zunehmend auf ihr<br />
ethnisches Element reduziert <strong>und</strong> damit <strong>in</strong> die Rolle von „Auslandsdeutschen“ gedrängt,<br />
jetzt auf e<strong>in</strong>mal sich <strong>in</strong> ihren alten Siedlungsgebieten als nationale M<strong>in</strong>derheit<br />
<strong>in</strong> andersnationalen Staaten wiederfanden. 25 Die für solche Gruppen dramatischen<br />
Entwicklungen, die aus diesem jähen Wandel resultierten, nämlich die weitgehenden<br />
erzwungenen oder freiwilligen Umsiedlungen „he<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“, wie die oft zynisch<br />
verwendete Formel e<strong>in</strong>st lautete, haben <strong>in</strong> den dreißiger Jahren begonnen <strong>und</strong> sich auf<br />
<strong>in</strong>dividueller Basis bis <strong>in</strong> die Gegenwart fortgesetzt. 26<br />
Erst spät <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong> aller Konsequenz aber erst <strong>im</strong> <strong>20</strong>., s<strong>in</strong>d nationale<br />
bzw. ethnische M<strong>in</strong>derheiten wirklich als solche wahrgenommen worden. Im Habsburgerreich<br />
kann man diesem Wandel gut nachspüren. Der Theorie nach galt die stolze<br />
Def<strong>in</strong>ition des Staatsgr<strong>und</strong>gesetzes von 1867 <strong>in</strong> Cisleithanien, wo es lapidar hieß:<br />
„Die Volksstämme s<strong>in</strong>d gleichberechtigt.“ Man hat diese bew<strong>und</strong>ernswerte Formulierung<br />
als e<strong>in</strong> „Verheißungsgesetz“ bezeichnet – denn der Weg zur Verwirklichung dieser<br />
Gleichberechtigung ist – während der restlichen Jahrzehnte der Existenz der Monarchie<br />
– <strong>im</strong>mer wieder versucht <strong>und</strong> nie zu Ende gegangen worden – es ist die leidvolle<br />
Geschichte etwa der böhmischen Ausgleichsversuche oder all der stets umkämpften<br />
Sprachengesetze. 27<br />
E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> hierfür dürfte das aus dem Westen übernommene parlamentarische<br />
Mehrheitspr<strong>in</strong>zip gewesen se<strong>in</strong>, das mit der Demokratisierung der Gesellschaft untrennbar<br />
verb<strong>und</strong>en ist. Der Jurist Georg Jell<strong>in</strong>ek hat vor genau 100 Jahren, 1898, <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Vortrag <strong>in</strong> Wien das Recht der M<strong>in</strong>oritäten untersucht. 28 Dar<strong>in</strong> stellte er fest,<br />
daß die Annahme des Pr<strong>in</strong>zips von Mehrheitsentscheidungen gehe pr<strong>in</strong>zipiell von der<br />
Möglichkeit des Wechsels von Majoritäten <strong>und</strong> M<strong>in</strong>oritäten aus. Dieses Pr<strong>in</strong>zip gerate<br />
dort an se<strong>in</strong>e Grenze, wo Festlegungen diesem Wechsel gr<strong>und</strong>sätzlich entgegenste-<br />
24<br />
Hier <strong>und</strong> <strong>im</strong> folgenden vgl. LEMBERG: Der Weg (wie Anm. 5).<br />
25<br />
WOLFGANG KESSLER: Universitas Saxonum. Personenverband – Gruppenautonomie –<br />
Volksgruppe, <strong>in</strong>: Gruppenautonomie <strong>in</strong> Siebenbürgen. 500 Jahre siebenbürgisch-sächsische<br />
Nationsuniversität, hrsg. von DEMS., Köln [u.a.] 1990 (Siebenbürgisches Archiv. Folge 3,<br />
Bd. 24), S. 3–27.<br />
26<br />
Für die Deutschbalten vgl.: DIETRICH A. LOEBER: Diktierte Option. Die Umsiedlung der<br />
Deutsch-Balten aus Estland <strong>und</strong> Lettland 1939–1941. Dokumentation, Neumünster 1972;<br />
JÜRGEN VON HEHN: Die Umsiedlung der baltischen Deutschen – das letzte Kapitel baltischdeutscher<br />
Geschichte, Marburg/Lahn 1982 (Marburger Ostforschungen, 40).<br />
27<br />
GERALD STOURZH: Die Gleichberechtigung der Nationalitäten <strong>in</strong> der Verfassung <strong>und</strong> Verwaltung<br />
Österreichs 1848-1918, Wien 1985.<br />
28<br />
GEORG JELLINEK: Das Recht der M<strong>in</strong>oritäten. Vortrag, gehalten <strong>in</strong> der juristischen Gesellschaft<br />
zu Wien, Wien 1898.<br />
166
hen, dann nämlich, wenn es sich um religiöse oder nationale Gruppen handelt, deren<br />
Mehrheitsverhältnis <strong>im</strong> wesentlichen konstant, also nicht austauschbar ist.<br />
So hat es nationale M<strong>in</strong>derheiten <strong>im</strong> parlamentarisch-verfassungsmäßigen S<strong>in</strong>ne <strong>in</strong><br />
den übernationalen Staaten vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich nicht gegeben, was<br />
es aber gab, war die Furcht davor, zur M<strong>in</strong>derheit – <strong>und</strong> damit sozusagen dauerhaft<br />
m<strong>in</strong>derberechtigt – zu werden. Der Begriff der M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> ethnisch-nationalen<br />
S<strong>in</strong>ne wurde folglich, soweit zu sehen, damals <strong>im</strong>mer nur <strong>in</strong> der Abwehrfunktion gegen<br />
e<strong>in</strong>e Übervorteilung durch irgendwelche – meist nationalen – Mehrheiten gebraucht,<br />
man denke an die „M<strong>in</strong>derheitenvere<strong>in</strong>e“ oder „M<strong>in</strong>derheitenschulen“, etwa<br />
der Tschechen <strong>im</strong> deutschsprachigen böhmischen Grenzgebiet. 29 Natürlich waren Rivalitäten<br />
dieser Art <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten der Habsburgermonarchie an der Tagesordnung,<br />
<strong>im</strong> Schulwesen, <strong>in</strong> der Wirtschaft, ja <strong>in</strong> allen Lebensbereichen. Meist<br />
aber, vor allem eben <strong>im</strong> öffentlichen Bewußtse<strong>in</strong>, waren das – zumal <strong>in</strong> Cisleithanien<br />
– ke<strong>in</strong>e Ause<strong>in</strong>andersetzungen zwischen M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> Mehrheiten, sondern<br />
Rivalitäten pr<strong>in</strong>zipiell gleichberechtigter Nationalitäten.<br />
Nationalstaatsgrenzen <strong>und</strong> nationale M<strong>in</strong>derheiten<br />
Das änderte sich erst mit dem Ersten Weltkrieg. Der Nationalstaatsgedanke erlebte<br />
jetzt, <strong>im</strong> Weltkrieg <strong>und</strong> an dessen Ende, e<strong>in</strong>en ungeheuren Aufschwung, vor allem<br />
durch das von Wilson wie auch von Len<strong>in</strong> geforderte Pr<strong>in</strong>zip der „self determ<strong>in</strong>ation<br />
of nations“. 1915, mitten <strong>im</strong> Ersten Weltkrieg, schrieb vorausschauend der schweizerische<br />
Anthropologe Georges Montandon: Um e<strong>in</strong>en dauerhaften Frieden zu erlangen,<br />
müsse man <strong>im</strong> anbrechenden Zeitalter der Nationalität den zu erwartenden neuen Nationalstaaten<br />
natürliche <strong>Grenzen</strong> geben, die gut zu verteidigen seien. Sodann aber<br />
müsse man diejenigen Menschen, die nicht zur jeweiligen Staatsnation gehören,<br />
„massenhaft verpflanzen“, also aus dem Staat ausweisen – ohne Eigentums- oder<br />
auch nur Besuchsrecht <strong>im</strong> bisherigen He<strong>im</strong>atstaat. 30<br />
29 E<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die zeitgenössische Argumentation vermittelt F. BE=LEHRÁDEK: S+kolství<br />
mens=<strong>in</strong>ové a Ústr=ední matice s=kolská [M<strong>in</strong>derheitenschulwesen <strong>und</strong> der Zentrale Schulvere<strong>in</strong><br />
(Matice)], <strong>in</strong>: C+eská politika, hrsg. von ZDENE=K TOBOLKA, Teil 5, Praha 1913 (Lajchteru`v<br />
výbor nejleps=ích spisu` pouc=ných, 39), S. 335–433.<br />
30 GEORGES MONTANDON: Frontières nationales: Déterm<strong>in</strong>ation objective de la condition<br />
pr<strong>im</strong>ordiale nécessaire à l'obtention d'une paix durable, Lausanne 1915 (mit e<strong>in</strong>er Karte der<br />
vermuteten zukünftigen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa). Den H<strong>in</strong>weis auf Montandon als den wohl ersten<br />
Vertreter dieser Auffassung verdanke ich JOSEPH B. SCHECHTMANN: Postwar Population<br />
Transfers <strong>in</strong> Europe. 1945-1955, Philadelphia 1962, Annex: „Pro and Contra Population<br />
Transfer“, S. 389-396. – Die folgenden Abschnitte stützen sich u.a. auf HANS LEMBERG:<br />
„Ethnische Säuberung“: E<strong>in</strong> Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?, <strong>in</strong>: Aus Politik<br />
<strong>und</strong> Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. B 46/92, 6. November<br />
1992, S. 27-38; Wiederabdruck <strong>in</strong>: Mit unbestechlichem Blick... Studien von Hans Lemberg<br />
zur Geschichte der böhmischen Länder <strong>und</strong> der Tschechoslowakei. Festgabe zu sei-<br />
167
Diese erschreckende Vision verriet e<strong>in</strong>e beachtliche Voraussicht der künftigen<br />
unmenschlichen Brutalität des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts. Das, was Montandon „transplantation<br />
massive“, „massenhafte Verpflanzung“, nannte, wurde später Wirklichkeit, <strong>und</strong> es<br />
erhielt die verschiedenartigsten Namen: population exchange oder Bevölkerungstransfer,<br />
Umsiedlung, He<strong>im</strong>holung <strong>in</strong>s Reich, Ausweisung, Vertreibung, odsun oder<br />
wysiedlenie przymusowe. Der erst vor wenigen Jahren <strong>in</strong> Südosteuropa geprägte Ausdruck<br />
„etnic=ko c=is=c;enje“, „ethnische Säuberung“, hat sich mit unglaublicher Schnelligkeit<br />
<strong>und</strong> Effizienz über die ganze Welt verbreitet – vielleicht wegen se<strong>in</strong>er unübertroffen<br />
schönrednerischen Formulierung, die etwas Positives, also Re<strong>in</strong>es, Sauberes,<br />
suggeriert, sicher aber auch weil der schreckliche Vorgang, den er bezeichnet, unerwartet<br />
nach langer Pause abermals Wirklichkeit geworden ist, <strong>und</strong> das nicht nur irgendwo<br />
<strong>in</strong> der Dritten Welt – sondern bei uns <strong>in</strong> Europa. 31<br />
Die Neuordnung des östlichen Europa auf der Friedenskonferenz von Paris 1919<br />
sollte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er H<strong>in</strong>sicht dem von Montandon vorgeahnten Pr<strong>in</strong>zip nahekommen, d.h.<br />
die neu geschaffenen Nationalstaaten sollten <strong>Grenzen</strong> erhalten, die möglichst alle Angehörigen<br />
der jeweiligen ethnisch verstandenen Staatsnation umfassen sollten. Das<br />
Problem dabei war freilich das unbequeme Faktum der weith<strong>in</strong> ethnisch gemischten<br />
Bevölkerung der jeweiligen Staaten, mit anderen Worten: Jetzt gab es wirklich <strong>im</strong> eigentlichen<br />
S<strong>in</strong>ne Staatsnationen, <strong>und</strong> es gab nationale M<strong>in</strong>derheiten.<br />
Die „staatstragenden“ Nationen (Titularnationen), also <strong>in</strong> Lettland die Letten, <strong>in</strong><br />
Polen die Polen usw., bildeten nicht nur die Mehrheit, sie best<strong>im</strong>mten auch die Politik;<br />
die Angehörigen anderer Nationalitäten befanden sich h<strong>in</strong>gegen <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>derzahl,<br />
wurden also als „M<strong>in</strong>derheiten“ klassifiziert. Bei e<strong>in</strong>igen von ihnen hatte sich –<br />
so etwa bei den Deutschbalten <strong>in</strong> Estland <strong>und</strong> Lettland – durch diese Veränderung der<br />
Urteilskriterien förmlich e<strong>in</strong> Wandel von der sozialen Führungsschicht zur kle<strong>in</strong>en<br />
M<strong>in</strong>derheit vollzogen: Nun wurde <strong>in</strong> der Tat nicht mehr „gewogen“, sondern „gezählt“.<br />
Daß <strong>in</strong> zweien der neugegründeten Staaten selbst die Titularnation nicht e<strong>in</strong>mal<br />
von vornhere<strong>in</strong> vorhanden war <strong>und</strong> erst mühsam durch Synthese konstituiert werden<br />
mußte, treibt dieses Problem sozusagen auf die Spitze: Es gab ja zunächst weder<br />
„Tschechoslowaken“, noch „Jugoslawen“, sondern Tschechen <strong>und</strong> Slowaken <strong>im</strong> e<strong>in</strong>en,<br />
Serben, Kroaten <strong>und</strong> Slowenen <strong>im</strong> anderen Falle. Der mit großer Mühe unternommene<br />
Versuch, synthetische Staatsnationen zusammenzuschweißen, ist, wie man<br />
weiß, nicht gelungen; dennoch wurde selbst <strong>in</strong> der Tschechoslowakei <strong>und</strong> <strong>in</strong> Jugosla-<br />
nem 65. Geburtstag, hrsg. von FERDINAND SEIBT, JÖRG K. HOENSCH, HORST FÖRSTER,<br />
FRANZ MACHILEK <strong>und</strong> MICHAELA MAREK, München 1998 (Veröffentlichungen des Collegium<br />
Carol<strong>in</strong>um, 90), S. 377–396.<br />
31 Versuch e<strong>in</strong>er knappen Gesamtschau der ethnischen Säuberungen <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert bei<br />
NORMAN NAIMARK: Das Problem der ethnischen Säuberung <strong>im</strong> modernen Europa, <strong>in</strong>: Zeitschrift<br />
für <strong>Ostmitteleuropa</strong>forschung 48 (1999), S. 317–349.<br />
168
wien e<strong>in</strong>e deutliche Unterscheidung von „Staatsnationen“ <strong>und</strong> „M<strong>in</strong>derheiten“ durchgehalten.<br />
32<br />
Das von Montandon geforderte Pr<strong>in</strong>zip des ethnisch homogenen Nationalstaats,<br />
der durch Umsiedlungen hergestellt werden sollte, wurde freilich zunächst nicht angewendet.<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lich kannten die Peacemakers se<strong>in</strong>e Broschüre gar nicht. Ohneh<strong>in</strong><br />
war der Gedanke e<strong>in</strong>es Bevölkerungstransfers damals schon nicht mehr neu;<br />
kurz vor dem Ersten Weltkrieg war er sogar – auf freiwilliger Basis – <strong>im</strong> Bereich des<br />
Balkankriegsschauplatzes praktiziert worden.<br />
Den neuen Staaten des Systems der Pariser Vororteverträge waren aber, was die<br />
Behandlung der nationalen M<strong>in</strong>derheiten anlangte, <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf ethnische Säuberungen<br />
durch Bevölkerungstransfers die Hände geb<strong>und</strong>en: In den die Pariser Friedensverhandlungen<br />
von 1919 abschließenden Verträgen, die die Existenz der neuen<br />
Staaten sicherten, war e<strong>in</strong>e Klausel e<strong>in</strong>gebaut, die diese Staaten zum Schutz „rassischer,<br />
ethnischer <strong>und</strong> religiöser M<strong>in</strong>derheiten“ verpflichtete: Nur wenn dieser als Bestandteil<br />
<strong>in</strong> die Verfassungen aufgenommen wurde, wurden die neuen Staaten von der<br />
Völkergeme<strong>in</strong>schaft anerkannt. 33<br />
Es durften also, mit anderen Worten, M<strong>in</strong>derheiten weder gewaltsam an die<br />
Staatsnationen ass<strong>im</strong>iliert, noch durften sie aus dem Lande ausgesiedelt werden. Die<br />
Verpflichtung zum M<strong>in</strong>derheitenschutz wurde von e<strong>in</strong>igen der Staaten als E<strong>in</strong>schränkung<br />
ihrer Souveränität kritisiert <strong>und</strong> eher widerwillig gehandhabt; an der Praxis des<br />
M<strong>in</strong>derheitenschutzes gab es viel auszusetzen; als Pr<strong>in</strong>zip <strong>und</strong> als Regulierungs<strong>in</strong>strument<br />
bedeutete es e<strong>in</strong>en ausbaufähigen Ansatz <strong>in</strong> der richtigen Richtung. 34<br />
Wenigstens <strong>in</strong> der Südostecke Europas allerd<strong>in</strong>gs, wo der Weltkrieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
griechisch-türkischen Krieg fortgesetzt wurde <strong>und</strong> e<strong>in</strong> unerträgliches Flüchtl<strong>in</strong>gselend<br />
herrschte, wurde der Gedanke e<strong>in</strong>es sogar erzwungenen ethnischen Bevölkerungsaustausches<br />
zwischen Griechenland <strong>und</strong> der Türkei auf <strong>in</strong>ternationalen Druck <strong>im</strong> Vertrag<br />
von Lausanne verwirklicht. Beteiligt an dieser Regelung war nicht zuletzt der Friedensnobelpreisträger<br />
<strong>und</strong> Völkerb<strong>und</strong>s-Flüchtl<strong>in</strong>gskommissar Fridtjof Nansen.<br />
Dies ist e<strong>in</strong> Indiz dafür, daß das Konzept der „Entmischung“ (unmix<strong>in</strong>g of populations<br />
<strong>in</strong> der Formulierung von Lord Curzon) nicht pr<strong>im</strong>är als Gewaltakt des <strong>in</strong>tegralen<br />
32 Dazu HANS LEMBERG: Unvollendete Versuche nationaler Identitätsbildung <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
<strong>im</strong> östlichen Europa: die „Tschechoslowaken“, die „Jugoslawen“, das „Sowjetvolk“,<br />
<strong>in</strong>: Nationales Bewußtse<strong>in</strong> <strong>und</strong> kollektive Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven<br />
Bewußtse<strong>in</strong>s, hrsg. von HELMUT BERDING, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1994 (suhrkamp taschenbuch<br />
wissenschaft, 1154), S. 581-607.<br />
33 ERWIN VIEFHAUS: Die M<strong>in</strong>derheitenfrage <strong>und</strong> die Entstehung der M<strong>in</strong>derheitenschutzverträge<br />
auf der Pariser Friedenskonferenz. E<strong>in</strong>e Studie zur Geschichte des Nationalitätenproblems<br />
<strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, Würzburg 1960 (Marburger Ostforschungen, 4).<br />
34 Dazu s. die Beiträge <strong>im</strong> zweiten Teil von: <strong>Ostmitteleuropa</strong> zwischen den beiden Weltkriegen<br />
(1918-1939). Stärke <strong>und</strong> Schwäche der neuen Staaten, nationale M<strong>in</strong>derheiten, hrsg.<br />
von HANS LEMBERG, Marburg 1997 (Tagungen zur <strong>Ostmitteleuropa</strong>-Forschung, 3); ferner<br />
MARTIN SCHEUERMANN: Die M<strong>in</strong>derheitenpolitik des Völkerb<strong>und</strong>es <strong>in</strong> Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropa<br />
<strong>in</strong> den zwanziger Jahren, Phil. Diss. Marburg 1999 (<strong>im</strong> Druck).<br />
169
Nationalismus zu verstehen war, sondern zunächst <strong>und</strong> weith<strong>in</strong> als e<strong>in</strong>e humanitäre<br />
Konfliktlösungsstrategie <strong>im</strong> <strong>in</strong>ternationalen Rahmen, als e<strong>in</strong>e ult<strong>im</strong>a ratio zur Herstellung<br />
des Friedens, wenn denn e<strong>in</strong> solcher nicht durch e<strong>in</strong>e adäquate Grenzziehung<br />
herzustellen war. 35<br />
Das Ergebnis von Lausanne, e<strong>in</strong>e recht weitreichende, wenn auch bei weitem nicht<br />
völlige ethnische Homogenisierung beider beteiligter Staaten Griechenland <strong>und</strong> Türkei,<br />
wirkte fortan als e<strong>in</strong>e Art Idealtypus für e<strong>in</strong>e solche Lösung, die allerd<strong>in</strong>gs wegen<br />
ihrer Härte eher als orientalisch <strong>und</strong> als für Mitteleuropa nicht recht praktikabel galt. 36<br />
Realistisch erschienen <strong>in</strong> der Tat <strong>in</strong> den zwanziger Jahren <strong>und</strong> bis <strong>in</strong> die Mitte der<br />
dreißiger Jahre für die Lösung von M<strong>in</strong>derheitenproblemen nicht die Grenz-Veränderung<br />
<strong>und</strong> nicht die Umsiedlung, sondern der M<strong>in</strong>derheitenschutz oder allenfalls<br />
e<strong>in</strong>e mehr oder weniger verdeckte Ass<strong>im</strong>ilation.<br />
„Entmischung“ durch Umsiedlung <strong>im</strong> NS-Herrschaftsbereich<br />
Erst die bewußte Zerstörung des sogenannten Versailler Systems durch Hitlers Politik<br />
brachte wieder das bisher pe<strong>in</strong>lich vermiedene Instrument der Grenzveränderung zum<br />
Zwecke der Herstellung wenigstens e<strong>in</strong>es, des deutschen Nationalstaates zur Anwendung.<br />
Diese Grenzveränderungen (Saarland, Anschluß Österreichs, ja auch noch das<br />
Münchener Abkommen) standen unter der Devise, die <strong>Grenzen</strong> des Staates so zu verlegen,<br />
daß sie möglichst mit den <strong>Grenzen</strong> des deutschen Volkes übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mten:<br />
„E<strong>in</strong> Volk, e<strong>in</strong> Reich...“.<br />
Das Muster des Münchener Abkommens (E<strong>in</strong>verleibung von Deutschen <strong>in</strong>s Reich<br />
durch Grenzverschiebung 37 ) schien <strong>in</strong> bezug auf den Bündnispartner Italien nicht anwendbar.<br />
So wurde der schon 1923 <strong>im</strong> deutschen Auswärtigen Amt erörterte Gedanke<br />
aufgegriffen, die Südtiroler <strong>in</strong>s Reich umzusiedeln. Diese Umsiedlung hat, so wenig<br />
Dauerhaftes dabei herausgekommen ist, doch e<strong>in</strong>e Signalfunktion als e<strong>in</strong>e Art von<br />
35 Vgl. hierzu das Standardwerk von STEPHEN P. LADAS: The Exchange of M<strong>in</strong>orities. Bulgaria,<br />
Greece and Turkey, New York 1932; Das Verhandlungsprotokoll: Lausanne Conference<br />
on Near Eastern Affairs 1922-1923. Records of Proceed<strong>in</strong>gs and Draft Terms of Peace.<br />
Presented to Parliament by Command of His Majesty, London 1923.<br />
36 So noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vortrag am 17. März 1939 ROBERT WILLIAM SETON-WATSON: The Problem<br />
of Small Nations and the European Anarchy, Nott<strong>in</strong>gham 1939 (Montague Burton International<br />
Relations Lecture 1939). Ähnlich JOHN S. STEPHENS: Danger Zones of Europe.<br />
A Study of National M<strong>in</strong>orities London 1929 (Merttens Lecture on War and Peace, 3), S.<br />
31 f.; CARLYLE AYLMER MACARTNEY: National States and national M<strong>in</strong>orities, London<br />
1934, S. 448 f.<br />
37 Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d schon <strong>im</strong> Münchener Abkommen Regelungen für e<strong>in</strong>en „Austausch der<br />
Bevölkerungen“ (deutsche <strong>und</strong> tschechische Rest-M<strong>in</strong>derheiten nach der neuen Grenzziehung)<br />
vere<strong>in</strong>bart worden: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1915-1938 (ADAP),<br />
Serie D, Band 2, Baden-Baden 1950, Dokument Nr. 675.<br />
170
Prototyp e<strong>in</strong>er solchen Umsiedlung für Mitteleuropa gehabt. Jetzt hatte sich ja offensichtlich<br />
gezeigt, daß diese Methode nicht nur <strong>im</strong> Orient anwendbar war. 38<br />
Fortan schienen sich offensichtlich die Alternative von Grenzänderungen oder Bevölkerungsaustausch<br />
oder die Komb<strong>in</strong>ation von beiden Methoden durchaus zur Konfliktlösung<br />
für M<strong>in</strong>oritätenprobleme anzubieten. Das zeigte sich, als unmittelbar nach<br />
der Sudetenkrise <strong>im</strong> britischen Foreign Office erwogen wurde, ob man für die ungarisch-rumänische<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung eher das e<strong>in</strong>e oder das andere empfehlen sollte.<br />
39<br />
Der größte mögliche Krisenfall, der drohende Kriegsausbruch zwischen Deutschland<br />
<strong>und</strong> Polen, erwies <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em unmittelbaren Vorfeld recht deutlich, daß dieser<br />
Gedanke nun schon <strong>in</strong> der Luft lag, endemisch geworden war: In der zweiten Augusthälfte<br />
unternahm die britische Diplomatie erhebliche Anstrengungen, <strong>in</strong> den von Hitler<br />
hochgespielten Krisengebieten (Korridor, Oberschlesien) die M<strong>in</strong>derheitenprobleme<br />
ke<strong>in</strong>eswegs durch Grenzveränderungen, sondern durch e<strong>in</strong>en exchange of populations<br />
etwa nach Südtiroler Muster zu beseitigen. E<strong>in</strong> solcher Austausch ist, wie<br />
bekannt, vor dem Kriegsausbruch nicht mehr zustandegekommen. 40<br />
Es spricht für die allgeme<strong>in</strong>e Akzeptanz des „Entmischungs“-Gedankens, daß<br />
auch noch während des Zweiten Weltkriegs die Argumentation für e<strong>in</strong>en Bevölkerungsaustausch<br />
erstaunlich unisono auf beiden kriegführenden Seiten ausfiel. So f<strong>in</strong>det<br />
sich <strong>in</strong> der Rede Hitlers vor dem Reichstag vom 6. Oktober 1939, die die Umsiedlungen<br />
<strong>im</strong> Osten ankündigte, neben der Rassen-Ideologie die vertraute Motivation<br />
wieder: Die Umsiedlung solle die <strong>in</strong> ganz Osteuropa vertretenen „Splitter deutschen<br />
Volkstums“ <strong>und</strong> damit Konfliktstoffe beseitigen; am Ende sollten sich „bessere Trennungsl<strong>in</strong>ien“<br />
als bisher ergeben 41 , d.h. mit anderen Worten: Staatsgrenzen sollten<br />
möglichst homogene Nationalstaaten umschließen. Diese Rede Hitlers bildete ganz<br />
bewußt das propagandistische Vorspiel zu e<strong>in</strong>er neuen Law<strong>in</strong>e von Umsiedlungen<br />
38 Dazu vgl. LEOPOLD STEURER: Südtirol zwischen Rom <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong> 1919-1939, Wien, München,<br />
Zürich 1980 (zugleich Phil. Diss. Wien 1975/76); Option – He<strong>im</strong>at – Opzioni. E<strong>in</strong>e<br />
Geschichte Südtirols. Una storia dell' Alto Adige, Katalog zur Ausstellung des Tiroler Geschichtsvere<strong>in</strong>s,<br />
Bozen 1989.<br />
39 Sir Reg<strong>in</strong>ald Hoare am 30.09.1938: „If we emerge safely out of the Czech forest we shall, I<br />
suppose, presently f<strong>in</strong>d ourselves <strong>in</strong> the Hungarian wood...“ Public Record Office, London:<br />
(Foreign Office) FO [künftig nur: FO] 371/22454 R7970/153/37. Der britische Botschafter<br />
<strong>in</strong> Bukarest, Sir Michael Palairet, schrieb dazu am 3.11.1938: „I am <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ed to believe that<br />
an exchange of population, rather than a revision of frontiers, might solve some of Romania’s<br />
troubles“... Das „schreckliche Beispiel“ der C+SR müsse Rumänien für Ratschläge zugänglicher<br />
machen. Antwort von E.M.B. Ingram vom 18.11.1938: Er sei unentschieden, ob<br />
das e<strong>in</strong>e oder das andere; man solle beide Möglichkeiten König Carol vortragen, wenn er<br />
nach London komme. FO 371/22455 R 8959/135/37.<br />
40 Belege dafür bei LEMBERG: „Ethnische Säuberung“ (wie Anm. 30), S. 30 f.<br />
41 Der großdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers vom 1. September 1939 bis 10.<br />
März 1940. München 1942, S. 67-100, hier: S. 82 f.<br />
171
deutscher Bevölkerungsgruppen aus osteuropäischen Nachbarstaaten aufgr<strong>und</strong> von<br />
Umsiedlungsverträgen unter der Devise „he<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“. 42<br />
Dies ist aber wohl e<strong>in</strong>er der letzten Schritte der NS-Führung <strong>in</strong> Richtung auf e<strong>in</strong>e<br />
ethnische Homogenisierung des Großdeutschen Reiches gewesen. So mutet es symptomatisch<br />
an, daß die am 7. Oktober 1939 abgeschlossene Polen-Denkschrift des<br />
jungen Theodor Schieder, der versuchte, die Festlegung der <strong>Grenzen</strong> mit der nationalen<br />
Homogenität der Bevölkerung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen, <strong>und</strong> dabei ausgiebig mit<br />
dem Instrument des Bevölkerungstransfers operierte, ohne jede Folge blieb, da sie<br />
schon Mitte des gleichen Monats als obsolet galt <strong>und</strong> daher „den entscheidenden Stellen<br />
überhaupt nicht mehr zugeleitet“ wurde, „weil die Lage der D<strong>in</strong>ge sich allzu sehr<br />
verändert hat[te]“. 43<br />
Inzwischen hatte nämlich, schon e<strong>in</strong>en Tag nach der zitierten Hitler-Rede, die SS<br />
die Regie des Umsiedlungswesens unter dem Etikett „Festigung des deutschen Volkstums“<br />
übernommen. 44 <strong>Grenzen</strong> spielten fortan <strong>und</strong> für den Rest der NS-Herrschaft<br />
fast nur noch e<strong>in</strong>e utopische oder gar ke<strong>in</strong>e Rolle mehr – ihre Festlegung war für die<br />
Zeit nach dem Krieg verschoben; sie waren mehr <strong>und</strong> mehr auf die Funktion von B<strong>in</strong>nengrenzen<br />
e<strong>in</strong>es vor allem nach Osten h<strong>in</strong> potentiell unbegrenzten großdeutschen,<br />
großgermanischen Herrschaftsraums abgesunken, dem freilich größte Probleme bevorzustehen<br />
schienen, wie die zu weit gewordene Jacke des Reichs mit dem nicht<br />
schnell genug wachsen wollenden deutschen „Volkskörper“ angefüllt werden könne;<br />
es gab <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht jetzt eher e<strong>in</strong>en „Raum ohne Volk“ als e<strong>in</strong> „Volk ohne<br />
Raum“. So hat es beispielsweise <strong>in</strong> deutschen Schulatlanten seit dem Jahre 1943 ke<strong>in</strong>e<br />
Nationalitätenkarte Mitteleuropas mehr gegeben – <strong>in</strong> früheren Auflagen des gleichen<br />
Atlas waren solche Karten durchaus <strong>und</strong> mit hochrangigem Bildungsanspruch<br />
vorhanden. 45 Den Schülern des Jahres 1943 aber sollte nicht mehr vor Augen geführt<br />
42 HELLMUTH HECKER: Die Umsiedlungsverträge des Deutschen Reiches während des Zweiten<br />
Weltkrieges, Hamburg 1971 (Werkhefte der Forschungsstelle für Völkerrecht <strong>und</strong> ausländisches<br />
öffentliches Recht der Universität Hamburg, 17). S. dazu auch die deutsche<br />
Propaganda-Karte des „Volksb<strong>und</strong>es für das Deutschtum <strong>im</strong> Ausland“, Berl<strong>in</strong> 1940, unter<br />
dem Titel: „Die Umsiedlungen des Führers“, abgedruckt <strong>in</strong>: Föhn. Heft 6/7, Innsbruck<br />
1980, S. 167.<br />
43 Vorläufer des „Generalplans Ost“. E<strong>in</strong>e Dokumentation über Theodor Schieders Polendenkschrift<br />
vom 7. Oktober 1939. E<strong>in</strong>geleitet <strong>und</strong> kommentiert von ANGELIKA EBBING-<br />
HAUS <strong>und</strong> KARL HEINZ ROTH, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Sozialgeschichte des <strong>20</strong>. <strong>und</strong> 21. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
1 (1992), S. 62–94. Das Zitat ist e<strong>in</strong>em Brief von Albert Brackmann <strong>und</strong> Wolfgang<br />
Kohte an Hermann Aub<strong>in</strong> vom 16.10.1939 entnommen. Ebenda, S. 93 f.<br />
44 R. L. KOEHL: RKFDV. German Resettlement and Population Policy 1939-1945. A history<br />
of the Reich Commission for the Strengthen<strong>in</strong>g of Germandom, Cambridge 1957.<br />
45 Sydow-Wagners methodischer Schul-Atlas, bearb. von HERMANN HAACK u. HERMANN<br />
LAUTENSACH, 22. Aufl. Gotha, Reichenberg 1943. In dem mit September 1943 datierten<br />
Vorwort wird darauf h<strong>in</strong>gewiesen, auf „Völker-, Rassen- <strong>und</strong> Sprachenkarten“ sei „entsprechend<br />
den amtlichen Richtl<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> der Neuauflage verzichtet“ worden; ebenda, S. IX.<br />
Diese Karten f<strong>in</strong>den sich zuletzt noch <strong>in</strong> der Auflage von 1942 des gleichen Atlas (fre<strong>und</strong>liche<br />
Auskunft von Dr. Robert Maier, Georg-Eckert-<strong>Institut</strong>, Braunschweig).<br />
172
werden, daß ke<strong>in</strong>eswegs überall <strong>im</strong> so gerühmten Großdeutschen Reich Deutsche<br />
wohnten.<br />
Kurze Zeit nach Kriegsbeg<strong>in</strong>n war also offensichtlich e<strong>in</strong>e neue Qualität <strong>in</strong> das<br />
von uns beobachtete Spannungsfeld: hie territoriale <strong>Grenzen</strong> – da ethnische Zugehörigkeit<br />
der Bevölkerung gekommen: Es wirkten <strong>in</strong> den mite<strong>in</strong>ander konkurrierenden<br />
„bevölkerungswissenschaftlichen“, kriegswirtschaftlichen, bürokratischen, Partei-<br />
<strong>und</strong> SS-Planungsstäben des Umsiedlungswesens die verschiedensten Ansätze von<br />
Rassepolitik, agrarökonomischer Umstrukturierung, Raumordnung, „Germanisierung<br />
des Bodens“, Ausweisung (<strong>und</strong> Vernichtung) „unerwünschter Elemente“, zusammen<br />
<strong>und</strong> gegene<strong>in</strong>ander; die Vorarbeiten zum „Generalplan Ost“ bzw. „Generalsiedlungsplan“<br />
zeigen dies <strong>in</strong> aller Deutlichkeit. 46 Die nationalstaatliche Homogenisierung des<br />
Großdeutschen Reiches wurde dabei weitgehend aus den Augen verloren; „Raum“-,<br />
Umsiedlungs- <strong>und</strong> Vernichtungspolitik g<strong>in</strong>gen Hand <strong>in</strong> Hand. 47<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> population transfer <strong>in</strong> der Anti-Hitler-Koalition<br />
Demgegenüber nahm sich die alliierte Planung für die Nachkriegszeit <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf<br />
die geforderte Homogenisierung von Nationalstaaten eher traditionell aus, wenn auch<br />
hier neue Modifikationen zu bemerken waren. Sie resultierten<br />
1. aus den Erfahrungen aus dem Vorgehen der deutschen Okkupationsmacht nicht<br />
nur <strong>im</strong> Osten Europas,<br />
2. aus dem Versuch, die Planung e<strong>in</strong>er künftigen Kriegsverhütung <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung<br />
zu br<strong>in</strong>gen mit dem sich verfestigenden Gedanken, Deutschland künftig am<br />
Wiedererstarken zu h<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> schließlich die Deutschen für die Kriegsverbrechen<br />
der NS-Führung kollektiv zu bestrafen.<br />
In H<strong>in</strong>sicht auf unser Problem (<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten) bedeutete das: Von Anfang<br />
an, noch <strong>in</strong> der Zeit, als Großbritannien die ganze Last des Krieges gegen Hitler<br />
alle<strong>in</strong> trug, bezogen sich die Planungsstudien <strong>und</strong> dann die festen Pläne für die Nachkriegszeit<br />
auf Grenzveränderungen (zum<strong>in</strong>dest Zurücknahme der Änderungen nach<br />
1938 oder 1937, dann sehr bald auch e<strong>in</strong>e Beschneidung des Reichsgebiets <strong>im</strong> Osten,<br />
vor allem nachdem man ab Mitte 1941 auf den sowjetischen Bündnispartner Rücksicht<br />
nehmen mußte) <strong>und</strong>, <strong>im</strong> gleichen Atemzug mit den Grenzveränderungen, auf ex-<br />
46<br />
Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, hrsg. von CZESŁAW MADAJCZYK u.a.,<br />
München u.a. 1994.<br />
47<br />
ROLF-DIETER MÜLLER: Hitlers Ostkrieg <strong>und</strong> die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit<br />
von Wehrmacht, Wirtschaft <strong>und</strong> SS, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1991 (Fischer Taschenbuch<br />
10573); MICHAEL G. ESCH: „Ges<strong>und</strong>e Verhältnisse“. Deutsche <strong>und</strong> polnische Bevölkerungspolitik<br />
<strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> 1939–1950, Marburg 1998 (Materialien <strong>und</strong> Studien zur<br />
<strong>Ostmitteleuropa</strong>-Forschung, 2). Zum Zusammenhang von Umsiedlungswesen <strong>und</strong> Holocaust<br />
vgl. GÖTZ ALY: „Endlösung“. Völkerverschiebung <strong>und</strong> der Mord an den europäischen<br />
Juden, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1995.<br />
173
changes of populations: Zugr<strong>und</strong>e lag diesem Junkt<strong>im</strong> die fest verwurzelte Überzeugung,<br />
daß die Existenz nationaler M<strong>in</strong>derheiten nach dem Kriege unbed<strong>in</strong>gt vermieden<br />
werden müsse, da sie der <strong>in</strong>neren Stabilität der Staaten <strong>und</strong> dem Frieden zwischen<br />
ihnen notwendig <strong>im</strong> Wege stünden.<br />
Der Auftrag, den das britische Foreign Office dem „Foreign Research and Press<br />
Service“ erteilte (daraufh<strong>in</strong> wurde e<strong>in</strong> entsprechendes Dokument <strong>im</strong> Februar 1942<br />
vorgelegt), zeigt dies <strong>in</strong> aller Deutlichkeit. Dort wurde zunächst die Frage nach den<br />
künftigen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Ostmittel- <strong>und</strong> Südosteuropa gestellt, also der deutschpolnischen,<br />
der deutsch-tschechischen <strong>und</strong> der italienisch-deutsch-jugoslawischen<br />
<strong>Grenzen</strong>. Dabei solle man zwar nicht allzu viel Rücksicht auf ethnologische Erwägungen<br />
nehmen, „but, <strong>in</strong> so far as this leads to advocat<strong>in</strong>g exchange of populations, it<br />
will be well to prepare a second paper on [...] Lessons to be learnt from past exchanges<br />
of populations....“ 48<br />
In diesem heute schon fast klassisch zu nennenden Memorandum wurden trotz der<br />
Mahnung, ethnologische Erwägungen zu vernachlässigen, die „ethnographischen“<br />
Probleme schon <strong>im</strong> Hauptteil <strong>im</strong>mer wieder erwogen <strong>und</strong> damit der Transfer deutscher<br />
(<strong>und</strong> nicht nur deutscher) M<strong>in</strong>derheiten, der mit Grenzveränderungen nahezu <strong>im</strong><br />
Normalfall verb<strong>und</strong>en se<strong>in</strong> würde, <strong>in</strong> aller Ausführlichkeit diskutiert; <strong>im</strong> Anhang zur<br />
zweiten Frage werden dann vor allem die aus Präzedenzfällen zu ziehenden Lehren<br />
erörtert.<br />
Schon zuvor, <strong>im</strong> Mai 1940, war e<strong>in</strong> ähnliches Memorandum vom gleichen Gremium<br />
erarbeitet worden. Dabei standen <strong>in</strong> der Reihenfolge der Erörterung die Transfers<br />
sogar <strong>im</strong> Vordergr<strong>und</strong>, <strong>und</strong> zwar mit ausdrücklichen Anknüpfungen an die erwähnte<br />
Hitlerrede <strong>und</strong> die „transfers“ vor <strong>und</strong> nach Lausanne, <strong>in</strong> Südtirol <strong>und</strong> <strong>im</strong> Baltikum<br />
bzw. <strong>in</strong> den von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten; ferner wurde Bezug<br />
genommen auf e<strong>in</strong> bisher von der Forschung zu wenig <strong>in</strong> diesen Zusammenhang gestelltes<br />
Moment: Die Umsiedlungspläne der Zionisten für die paläst<strong>in</strong>ensischen Araber.<br />
49 Die <strong>Grenzen</strong>frage folgte <strong>in</strong> dem Memorandum von 1940 erst danach – <strong>in</strong> großer<br />
Ausführlichkeit. 50<br />
Die L<strong>in</strong>ie ließe sich von diesen Memoranden aus weiterzeichnen bis zur zunehmenden<br />
Konkretisierung der Grenzänderungspläne, mit denen die sozusagen nachziehende<br />
ethnische Homogenisierung der veränderten Staatsgebiete durch Umsiedlungen<br />
48 F.R.P.S.: Memoranda on Frontiers of European Confederations and the Transfer of German<br />
Populations (<strong>20</strong>.02.1942). FO 371/30930 - C 2167/241/18.<br />
49 Dazu NUR MASALHA: Expulsion of the Palest<strong>in</strong>ians: The Concept of ‚Transfer‘ <strong>in</strong> Zionist<br />
Political Thought, 1882-1948, Wash<strong>in</strong>gton D.C. 1992 (<strong>Institut</strong>e for Palest<strong>in</strong>e Studies);<br />
CHAIM SIMONS: International Proposals to transfer Arabs from Palest<strong>in</strong>e 1895–1947, Hoboken,<br />
N.J. 1988; ISRAEL SHAHAK: A History of the Concept of Transfer <strong>in</strong> Zionism, <strong>in</strong>:<br />
Journal of Palest<strong>in</strong>e Studies 17 (1989), S. 22–37.<br />
50 JAN RYCHLÍK: Memorandum Britského královského <strong>in</strong>stitutu mez<strong>in</strong>árodních vztahu` o<br />
transferu národnostních mens=<strong>in</strong> z r. 1940 [E<strong>in</strong> Memorandum des Royal <strong>Institut</strong>e for International<br />
Relations über den Transfer nationaler M<strong>in</strong>derheiten aus d. J. 1940], <strong>in</strong>: C+eský<br />
c=asopis historický 91 (1993), S. 612–631.<br />
174
– <strong>im</strong> deutsch-polnischen Bereich <strong>im</strong>mer bis zum jeweils aktuellen Planungsstand der<br />
polnischen Westgrenze – angestrebt wurde. 51 Die Abtrennung Ostpreußens vom<br />
Reich <strong>und</strong> die Aussiedlung der dortigen deutschen Bevölkerung bildete den Anfang<br />
der sich mit zunehmendem Kriegsverlauf ausweitenden Grenzverschiebungspläne <strong>im</strong><br />
Osten Deutschlands, bei denen die Kompensation für das sowjetisch annektierte Ostpolen<br />
e<strong>in</strong>e gewichtige Rolle spielte. Bei all diesen Grenzplanungs-Varianten wurde<br />
stets geradezu automatisch die Konsequenz des sich sche<strong>in</strong>bar notwendig daraus ergebenden<br />
Bevölkerungstransfers mitberechnet.<br />
Für die wiederzuerrichtende Tschechoslowakei sollte zunächst e<strong>in</strong> Abschneiden<br />
der re<strong>in</strong> deutsch besiedelten Grenzvorsprünge <strong>in</strong> Böhmen mit dem Austausch verbleibender<br />
M<strong>in</strong>derheiten komb<strong>in</strong>iert werden, erst später lief es auf e<strong>in</strong>e völlige Restaurierung<br />
der alten C+SR-Grenze <strong>und</strong> die vollständige Austreibung der Deutschen h<strong>in</strong>aus. 52<br />
Bei der <strong>in</strong> relativ kurzer Zeit entwickelten Konzeption des „displacement“, des<br />
„transfer“ der deutschen Bevölkerung aus den wiederherzustellenden Territorium vor<br />
allem der Tschechoslowakei <strong>und</strong> des <strong>in</strong> der <strong>Grenzen</strong>-Planung von Mal zu Mal mehr<br />
nach Westen <strong>und</strong> Norden vorgeschobenen polnischen Staatsgebiets hat es e<strong>in</strong>en mühsam<br />
überdeckten Dissens beispielsweise zwischen der tschechoslowakischen Exilregierung<br />
<strong>und</strong> der britischen Regierung um die Begründung gegeben: Die Benes=-<br />
Exilregierung stellte – je länger, je mehr – das Motiv der Bestrafung zunächst der sudetendeutschen<br />
Nazis <strong>und</strong> aller Mitläufer <strong>in</strong> den Vordergr<strong>und</strong>; dagegen wandte die<br />
britische Regierung e<strong>in</strong>, von der die kle<strong>in</strong>en Exilregierungen abhängig waren, das Bestrafungsmotiv<br />
sei ungeeignet, denn es ermögliche den Verbleib e<strong>in</strong>er „anti-nazi“<br />
deutschen Restm<strong>in</strong>derheit – <strong>und</strong> damit bliebe das M<strong>in</strong>derheitenproblem weiter beste-<br />
51 Karte mit alternativen Grenzplanungs-E<strong>in</strong>tragungen als Anhalt für Nachberechnungen der<br />
zu transferierenden Deutschen: FO 371/39139 C 9093/2750/18. Die Karte ist <strong>in</strong> Schwarz-<br />
Weiß-Druck veröffentlicht <strong>in</strong> DETLEF BRANDES: Die britische Regierung kommt zu e<strong>in</strong>em<br />
Zwischenergebnis. Die Empfehlungen des britischen Interdepartmental Committee on the<br />
Transfer of German Population vom Mai 1944, <strong>in</strong>: Occursus - Setkání - Begegnung.<br />
Sborník ku pocte= 65. narozen<strong>in</strong> prof. dr. Jana Kr=ena [Sammelband zu Ehren des 65. Geburtstages<br />
von Prof. Dr. Jan Kr=en], hrsg. von ZDENE=K POUSTA, PAVEL SEIFTER, JIR=Í PES=EK,<br />
Praha 1996, S. 45-68, hier S. 47.<br />
52 TOMÁS= STANE=K: Odsun Ne=mcu` z C+eskoslovenska [Die Ausweisung der Deutschen aus der<br />
Tschechoslowakei] 1945–1947, Praha 1991; HANS LEMBERG: Die Entwicklung der Pläne<br />
für die Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, <strong>in</strong>: Der Weg <strong>in</strong> die Katastrophe.<br />
Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938-1947, hrsg. von DETLEF BRAN-<br />
DES u. VÁCLAV KURAL, Essen 1994 (Veröfftl. des <strong>Institut</strong>s für Kultur <strong>und</strong> Geschichte der<br />
Deutschen <strong>im</strong> östlichen Europa, 3), S. 77-92; Wiederabdruck <strong>in</strong>: Mit unbestechlichem<br />
Blick... (s. o., Anm. 30), S. 343–360; DETLEF BRANDES: Großbritannien <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e osteuropäischen<br />
Alliierten 1939–1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei <strong>und</strong> Jugoslawiens<br />
<strong>im</strong> Londoner Exil vom Kriegsausbruch bis zur Konferenz von Teheran, München<br />
1988 (Veröffentlichungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um, 59). S. demnächst von DEMS.: „Transfer“:<br />
Pläne <strong>und</strong> Entscheidungen zur Vertreibung der Deutschen (<strong>und</strong> Magyaren) aus der<br />
Tschechoslowakei, Polen <strong>und</strong> Ostdeutschland 1939–1945 (Monographie).<br />
175
hen. Die britische Regierung verfolgte aber an erster Stelle das Pr<strong>in</strong>zip der ethnischen<br />
Homogenisierung zur künftigen Konfliktvermeidung. 53<br />
Ne<strong>in</strong>, die Staaten der Nachkriegszeit <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong> durften <strong>in</strong> ihren <strong>Grenzen</strong><br />
ke<strong>in</strong>e ethnischen M<strong>in</strong>derheiten mehr behalten. Außenm<strong>in</strong>ister Eden hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
knappen Vermerk zum Abschlußbericht des Interdepartmental Committee on the<br />
Transfer of German Populations vom Mai 1944 54 die Sache auf den Punkt gebracht:<br />
„My own policy w[oul]d be such: [...] there sh[oul]d be no national m<strong>in</strong>orities <strong>in</strong> Europe;<br />
anyone who disliked the idea of stay<strong>in</strong>g <strong>in</strong> his own home on such conditions<br />
[d.h. ohne M<strong>in</strong>derheitenschutz <strong>und</strong> unter stärkstem Ass<strong>im</strong>ilierungsdruck, H.L.],<br />
w[oul]d have to clear out.“ 55<br />
Seit 1944 aber, angesichts der sich verfestigenden Pläne für e<strong>in</strong>en großen Gebietszuwachs<br />
Polens auf bisher deutschem Gebiet bis zu Oder <strong>und</strong> Neiße <strong>und</strong> für die Totalaussiedlung<br />
der Deutschen aus diesen Gebieten <strong>und</strong> aus der C+SR, wuchsen die vorher<br />
hier <strong>und</strong> da <strong>in</strong> den Planungsgremien vorhandenen britisch-alliierten Bedenken 56 –<br />
53 Vgl. Richtl<strong>in</strong>ienentwurf des Foreign Office, Central Department, für Besuch des Secretary<br />
of State <strong>in</strong> USA vom 3.4.1943: Benes= habe vorgeschlagen, den Transfer mit Kriegsverbrechen<br />
zu motivieren. Die britische Regierung „do not at present consider it desirable to accept<br />
any such l<strong>im</strong>ited criterion“. FO 371/34396 C 3655/416/62. Die Hochrangigkeit des<br />
Pr<strong>in</strong>zips gegen alle Bedenken <strong>und</strong> Varianten der Ausführung charakterisiert der Satz: „We<br />
are [...] committed to a pr<strong>in</strong>ciple, but not to a method.“ O’Neill an Troutbeck: „Transfer of<br />
German Populations“ (13.11.1943): FO 371/64221 C 11913/279/18; vgl. auch BRANDES:<br />
Die britische Regierung (wie Anm. 51), S. 51).<br />
54 Diesen Bericht analysiert ausführlich BRANDES: Die britische Regierung (wie Anm. 51).<br />
55 Ebenda, S. 67. – Da durch Nachlässigkeit des Verlages <strong>in</strong> dem genannten Band ke<strong>in</strong>e der<br />
85 Fußnoten des genannten Beitrags abgedruckt worden ist, hier die F<strong>und</strong>stelle (fre<strong>und</strong>licher<br />
H<strong>in</strong>weis des Verfassers): Vermerk Eden v. 9.6.1944, FO 371/39092, C6391/2<strong>20</strong>/18. –<br />
Zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong> Exemplar des gr<strong>und</strong>sätzlich wichtigen 51-seitigen Reports des Interdepartmental<br />
Comittee on the transfer of German Population ist – Ironie der Geschichte – nach<br />
e<strong>in</strong>em ersten Durchgang (dazu auch der Vermerk Edens) am 23. Juni 1944 vorläufig mit<br />
dem Vermerk „the problem with which this report deals is one that does not exist at the<br />
moment, but is capable of becom<strong>in</strong>g exceed<strong>in</strong>gly acute after the war“ weitergeleitet worden<br />
<strong>und</strong> offensichtlich irgendwo <strong>im</strong> Dienstgang steckengeblieben, dann aber sieben Jahre später<br />
„amongst some cab<strong>in</strong>et papers“ <strong>im</strong> German Political Department wiedergef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
der C-division am 7.8.1951 mit dem bedauernden Bemerken zurückgegeben worden: „No<br />
further action can be taken at this late date.“ Dazwischen lag die gesamte Vertreibung <strong>und</strong><br />
Aussiedlung der Deutschen aus <strong>Ostmitteleuropa</strong>.<br />
56 E<strong>in</strong>e relativ frühe Abwägung des Für <strong>und</strong> Wider des Transfer: J.D. Mabbott am 1.09.1942<br />
unter Bezug auf das F.R.P.S.-Memorandum vom Februar 1942 (s.o., Anm. 48), FO<br />
371/31500 U 4<strong>20</strong>/61/72; s. auch <strong>im</strong> Abschlußbericht des <strong>in</strong> Anm. 55 genannten Komitees,<br />
S. 8, Abs. 8 <strong>und</strong> pass<strong>im</strong>; es spricht für die Offenheit <strong>in</strong> den britischen Planungsgremien,<br />
daß selbst e<strong>in</strong> gegenüber den Grenzänderungs- <strong>und</strong> Transferplänen <strong>im</strong> deutsch-polnischen<br />
Bereich außerordentlich skeptischer Zeitungsartikel (Germany’s Eastern Frontiers. By a<br />
Student of Europe, <strong>in</strong>: S<strong>und</strong>ay Observer v. 27.02.1944) von G.W. Harrison kommentiert<br />
wurde mit: „A well balanced article. Sensible public discussion of this thorny matter will<br />
do no harm“ (2.03.1944). FO 371/39091 C 2869/2<strong>20</strong>/18, C 2864/2<strong>20</strong>/18.<br />
176
nicht so sehr gegen das Pr<strong>in</strong>zip des auf die Grenzverschiebung folgenden Bevölkerungstransfers<br />
oder wegen der vom Beg<strong>in</strong>n der Verwirklichung an <strong>und</strong> zunehmend<br />
1945 <strong>und</strong> 46 erkennbaren <strong>und</strong> scharf kritisierten Inhumanität der Maßnahme, sondern<br />
wegen ihrer zu erwartenden negativen Folgen für die soziale, ökonomische <strong>und</strong> politische<br />
Stabilität <strong>in</strong> dem von den Alliierten zu besetzenden bzw. schon besetzten<br />
Deutschland.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg – alte oder neue Pr<strong>in</strong>zipien?<br />
Er<strong>in</strong>nern wir uns an die These Montandons. Er hatte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er H<strong>in</strong>sicht Unrecht: Was<br />
1919, 1938 oder 1945 entstand, waren ke<strong>in</strong>e „natürlichen“ <strong>Grenzen</strong>, sie waren meist<br />
auch nicht <strong>in</strong> besonderem Maße zu verteidigen. Öfter schon waren sie sogar – horribile<br />
dictu – historisch. 57 Recht sollte Montandon allerd<strong>in</strong>gs dar<strong>in</strong> behalten, daß – von<br />
e<strong>in</strong>em best<strong>im</strong>mten Augenblick an – zuerst <strong>Grenzen</strong> gezogen wurden <strong>und</strong> dann die<br />
Staatsvölker an das Prokrustesbett der <strong>Grenzen</strong> angepaßt wurden; ethnisch-nationale<br />
M<strong>in</strong>derheiten wurden tatsächlich ausgetauscht, öfter jedoch (weil es nichts auszutauschen<br />
gab) e<strong>in</strong>seitig transferiert.<br />
Der Gedanke, daß von e<strong>in</strong>em Bevölkerungsaustausch e<strong>in</strong>e Befriedung zu erwarten<br />
sei, war selbst nach dem Paroxysmus der Bevölkerungsverschiebungen <strong>im</strong> <strong>und</strong> nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg noch nicht ad acta gelegt; dafür sprechen Episoden noch aus<br />
den Jahren 1948 <strong>und</strong> 1949, als <strong>im</strong> Triester Gebiet <strong>und</strong> <strong>in</strong> Mazedonien Diplomaten (es<br />
waren wieder britische) als Lösung für drängende Probleme die Vorzüge <strong>und</strong><br />
Nachteile e<strong>in</strong>es Bevölkerungsaustausches diskutierten. 58<br />
Insgesamt war aber <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf dieses Handlungsmuster <strong>in</strong>zwischen Skepsis<br />
e<strong>in</strong>gekehrt. Es war mittlerweile nur allzu deutlich geworden, daß die betroffenen Bevölkerungen<br />
selbst alles andere als begeistert waren über ihre Verschiebungen <strong>und</strong><br />
Umsiedlungen, auch dann, wenn es „he<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“ gehen sollte.<br />
E<strong>in</strong> Zeugnis dafür ist der Bericht des britischen M<strong>in</strong>derheitenexperten Macartney,<br />
der <strong>im</strong> April 1940 dem Foreign Office über Möglichkeiten des ungarisch-rumänischen<br />
Bevölkerungsaustauschs berichtete <strong>und</strong> am Rande darauf h<strong>in</strong>wies, welchen<br />
völligen St<strong>im</strong>mungsumschwung die erwähnte Hitlerrede vom Oktober 1939 mit der<br />
Ankündigung von Umsiedlungen „he<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“ bei den Deutschen <strong>in</strong> Ungarn hervorgerufen<br />
habe, die noch 1938 weitgehend pro Hitler e<strong>in</strong>gestellt gewesen seien. B<strong>in</strong>nen<br />
weniger Tage seien <strong>20</strong> 000 Anträge auf Magyarisierung von deutschen Namen<br />
e<strong>in</strong>gegangen, Familien hätten nach jüdischen Vorfahren zu suchen begonnen, selbst <strong>in</strong><br />
Ödenburg/Sopron hätten Deutsche auf e<strong>in</strong>mal magyarisch zu sprechen begonnen, <strong>und</strong><br />
57 Die bekannte Karte von COLUM GILFILLAN: European political bo<strong>und</strong>aries, <strong>in</strong>: Political<br />
Science Quarterly 39 (1924), 458–484, wiederabgedruckt u.a. von ALEXANDER DEMANDT<br />
<strong>in</strong>: Deutschlands <strong>Grenzen</strong> (wie Anm. 13), S. 26, ist <strong>in</strong>sofern irreführend, als sie bei der<br />
„Dauerhaftigkeit“ von <strong>Grenzen</strong> nur ihre Funktion als Staatsgrenzen berücksichtigt, nicht<br />
aber alte B<strong>in</strong>nengrenzen, die Staatsgrenzen wurden oder umgekehrt.<br />
58 LEMBERG: „Ethnische Säuberung“ (wie Anm. 30), S. 36.<br />
177
<strong>in</strong> deutsche höhere Schulen habe es fast ke<strong>in</strong>e Aufnahmeanträge mehr gegeben. Dies<br />
alles, um auf ke<strong>in</strong>en Fall <strong>in</strong> die Gruppe derjenigen zu kommen, die „he<strong>im</strong> <strong>in</strong>s Reich“<br />
umgesiedelt werden sollten. 59 – Selbst wenn diese Nachrichten übertrieben gewesen<br />
se<strong>in</strong> sollten, e<strong>in</strong> Kern davon ist doch wahrsche<strong>in</strong>lich.<br />
In der Diskussion, die <strong>in</strong> der britischen <strong>und</strong> amerikanischen Öffentlichkeit vor <strong>und</strong><br />
nach Kriegsende über S<strong>in</strong>n <strong>und</strong> Uns<strong>in</strong>n von Umsiedlungen zum Zwecke der ethnischen<br />
Homogenisierung von Staaten stattfand 60 , waren Argumente Pro <strong>und</strong> Contra zu<br />
hören:<br />
Es fanden sich entschiedene Befürworter, so der wohl<strong>in</strong>formierte Bernard Newman,<br />
der 1943 recht vehement die Idee des Bevölkerungsaustausches vertrat. Der<br />
Hauptbeweggr<strong>und</strong>: „The <strong>in</strong>convenience of the few cannot be allowed to prejudice the<br />
safety of the many.“ Die Härten müßten eben <strong>in</strong> Kauf genommen werden für den<br />
wichtigen Zweck der Befriedung. Ähnlich befürwortete Ex-US-Präsident Herbert<br />
Hoover den Bevölkerungstransfer als „Heroisches Heilmittel“; „die Härte des Wegbewegens“<br />
sei zwar groß, aber sie sei „ger<strong>in</strong>ger als das dauernde Leid der M<strong>in</strong>derheiten<br />
<strong>und</strong> die dauernde Wiederkehr von Kriegen“. 61<br />
Freilich gab es auch zahlreiche Kritiker der Bevölkerungstransfers, <strong>und</strong> es hatte<br />
sie schon <strong>in</strong> den Planungsorganen der Kriegszeit gegeben. So wies Eugene Kulischer,<br />
e<strong>in</strong> Experte für Migrationsgeschichte, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em längeren Artikel 1946 darauf h<strong>in</strong>,<br />
Massenumsiedlungen könnten <strong>in</strong> ihrem negativen Charakter nicht rational vernebelt<br />
werden. Überhaupt: „No artificial ethnic segregation can be durable“; ke<strong>in</strong> Staat lasse<br />
sich ethnisch re<strong>in</strong>, d.h. homogen erhalten. 62<br />
Aus dem Abstand e<strong>in</strong>es halben Jahrh<strong>und</strong>erts gesehen, ersche<strong>in</strong>t diese Skepsis<br />
durchaus berechtigt. Mehr noch: es hat sich erwiesen, daß zwar <strong>in</strong> der Tat durch die<br />
Massenumsiedlungen, Menschenvernichtungen <strong>und</strong> Vertreibungen die Staaten <strong>Ostmitteleuropa</strong>s<br />
<strong>und</strong> Südosteuropas ethnisch weit homogener geworden s<strong>in</strong>d. 63 Damit ist<br />
59<br />
FO 371/24429 - C 4668/1967/21.<br />
60<br />
Hier auch <strong>in</strong> bezug auf die befürchtete Umsiedlung von Juden <strong>und</strong> auf Jiddisch MARK VE-<br />
NIANOVICH VISHNYAK: Dos transferirn bafelkerungen vi a mitl tsu farentfern [beantworten]<br />
di problem fun m<strong>in</strong>oritetn, New York 1942.<br />
61<br />
LEMBERG: „Ethnische Säuberung“ (wie Anm. 30), S. 35. – Zusätzlich: Hans Holstad (früherer<br />
Präsident der türkisch-griechischen Austauschkommission) an Malk<strong>in</strong>: Exchange of<br />
populations as a means of prevent<strong>in</strong>g war (21.04.1943): Es genüge nicht, zur Vermeidung<br />
von M<strong>in</strong>derheitenproblemen nach dem Krieg <strong>Grenzen</strong> neu zu ziehen; wo M<strong>in</strong>derheiten<br />
verbleiben, müssen sie ausgetauscht werden; Schwierigkeiten dabei werden benannt. FO<br />
371/35318 U 1985/25/70.<br />
62<br />
EUGENE MICHEL KULISCHER: Population Transfer, <strong>in</strong>: South Atlantic Quarterly 45 (1946),<br />
S. 403–414; <strong>im</strong> gleichen Jahr wurde auch das Verhältnis von <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Massenmigrationen<br />
thematisiert von HANS ROTHFELS: Frontiers and Mass Migration <strong>in</strong> Eastern-Central<br />
Europe, <strong>in</strong>: Review of Politics (Notre Dame, Ind.) 8 (1946), S. 37-67. – Scharfe Kritik an<br />
den „expulsions“ bei R.H.M. WORSLEY: Mass Expulsions, <strong>in</strong>: N<strong>in</strong>eteenth Century and after<br />
138 (1945), S. 270–274; 139 (1946), S. 90–96.<br />
63<br />
Eastern European national m<strong>in</strong>orities 1919/1980. A Handbook, hrsg. von STEPHAN M. HO-<br />
RAK, Littleton, Colorado 1985, S. 2.<br />
178
aber auch e<strong>in</strong>e erhebliche kulturelle Verarmung gegenüber dem Mischzustand der<br />
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg e<strong>in</strong>getreten.<br />
Man wird ferner feststellen müssen, daß die Idee des ethnisch re<strong>in</strong>en Nationalstaats<br />
so wirksam gewesen ist, daß der noch <strong>im</strong> Völkerb<strong>und</strong> verankerte M<strong>in</strong>derheitenschutz<br />
von der Nachfolgeorganisation, den Vere<strong>in</strong>ten Nationen, nach dem Krieg nicht<br />
wieder aufgenommen worden ist. Ethnische M<strong>in</strong>derheiten galten bei den Führenden<br />
auch nach Kriegsende als e<strong>in</strong>e Konfliktursache per se, die es nicht nur – etwa durch<br />
„Integration“ <strong>in</strong> die Staatsnationen – zu beseitigen, sondern auch künftig zu vermeiden<br />
<strong>und</strong> jedenfalls nicht mehr zu schützen galt.<br />
Immerh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der UNO an die Stelle des alten M<strong>in</strong>derheitenschutzes Regelungen<br />
für den Schutz der allgeme<strong>in</strong>en Menschenrechte getreten, der <strong>in</strong>zwischen auch<br />
auf anderen Ebenen – <strong>in</strong> der EU, <strong>in</strong> der OSZE – nachdrückliche Unterstützung gef<strong>und</strong>en<br />
hat. Man hat also das Thema als <strong>in</strong>sgesamt erledigt <strong>und</strong> als historisiert betrachten<br />
können, vor allem da <strong>in</strong> den vierzig Jahren der paradoxen Stabilität des Ost-West-<br />
Dualismus ethnische Konflikte eigentlich nur noch aus Randgebieten Europas bekannt<br />
waren, aus Nordirland, dem Baskenland oder aus der Dritten Welt. Hat also<br />
Georges Montandon recht behalten? Lange Zeit mochte es fast so sche<strong>in</strong>en, wenn<br />
auch Untersuchungen <strong>im</strong> globalen Horizont gezeigt haben, daß nach 1945 die meisten<br />
<strong>in</strong>ternationalen Konflikte zu Bevölkerungsbewegungen geführt haben. 64<br />
Erst der Zusammenbruch der Pax Sovietica hat – gleichzeitig mit der Befreiung<br />
der betroffenen Länder – e<strong>in</strong>e neue Phase der Unruhe <strong>im</strong> <strong>in</strong>ternationalen System herbeigeführt,<br />
mit zahlreichen Staatsuntergängen <strong>und</strong> Staatsentstehungen. 65 Und wieder<br />
handelte es sich durchweg um Nationalstaaten, <strong>und</strong> erneut trat <strong>im</strong> Zusammenhang von<br />
(meist traditionellen) Grenzziehungen das Problem nationaler M<strong>in</strong>derheiten auf: Im<br />
Kaukasus, <strong>in</strong> Zentralasien, <strong>im</strong> Baltikum <strong>und</strong> – auf besonders bestürzende Weise, weil<br />
ganz nahe am mittleren Europa – <strong>im</strong> ehemaligen Jugoslawien.<br />
Das, was heute <strong>in</strong> den kroatisch-serbischen Mischgebieten Kroatiens oder Serbiens,<br />
vor allem aber <strong>in</strong> Bosnien-Herzegow<strong>in</strong>a oder <strong>im</strong> Kosovo geschieht, ist <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Willkür <strong>und</strong> Gewalttätigkeit eher mit dem Chaos vor der Konferenz von Lausanne zu<br />
vergleichen als mit dem „geregelten“ Bevölkerungsaustausch danach. Immerh<strong>in</strong> aber<br />
er<strong>in</strong>nern die Bemühungen der verschiedenen Beauftragten der UNO oder der Europäischen<br />
Geme<strong>in</strong>schaft, die sich um e<strong>in</strong>e Konfliktlösung bemühen, oder die Ansätze<br />
zu Jugoslawien-Konferenzen verzweifelt an die Situation von 1923 <strong>und</strong> ihre Akteure<br />
64 HARTO HAKOVIRTA: International Politics and Migration. A prel<strong>im</strong><strong>in</strong>ary Survey of the Migration.<br />
Aspects of fifty <strong>in</strong>ternational Disputes, Tampere 1978 (University of Tampere.<br />
Dept. of Political Science. Occasional Papers), S. 17.<br />
65 Vgl. dazu: Transformationen des <strong>in</strong>ternationalen Systems als Folge krisenhafter Veränderungen<br />
<strong>im</strong> östlichen Europa <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>: Das europäische Staatensystem <strong>im</strong><br />
Wandel, hrsg. von PETER KRÜGER, München, Wien 1996 (Schriften des Historischen Kollegs,<br />
35), S. 227-238; HANS LEMBERG: Alternativen zum <strong>in</strong>ternationalen System <strong>in</strong> der<br />
neuzeitlichen Geschichte Osteuropas, <strong>in</strong>: Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong> Wandel <strong>in</strong> der Staatenordnung<br />
der Neuzeit. Beiträge zur Geschichte des <strong>in</strong>ternationalen Systems, hrsg. von PETER KRÜ-<br />
GER, Marburg 1991 (Marburger Studien zur Neueren Geschichte, 1), S. 91-114.<br />
179
um Curzon <strong>und</strong> Nansen. Die heutige Lage mutet freilich fast noch schwieriger an:<br />
Was tun <strong>in</strong> dieser Situation? Die Abgrenzung geschlossener nationaler Siedlungsgebiete<br />
oder wenigstens nationaler Kantone, <strong>in</strong> der es ke<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>derheiten gibt, seien sie<br />
auch noch so ausgeklügelt, ersche<strong>in</strong>t angesichts der kle<strong>in</strong>räumigen Vermischung von<br />
meist mehr als zwei Nationalitäten als nahezu unmöglich.<br />
Seit Jahren wird von den verschiedenen nationalen Bürgerkriegsparteien (zunächst<br />
Serben, Musl<strong>im</strong>en <strong>und</strong> Kroaten, dann aber auch Serben <strong>und</strong> Albanern <strong>im</strong> Kosovo) der<br />
Versuch unternommen, durch die wilde Vertreibung von jeweils andersnationalen<br />
Bevölkerungsgruppen vollendete Tatsachen <strong>und</strong> damit Regionen von „gere<strong>in</strong>igtem“<br />
nationalem Charakter zu schaffen. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ist auch ganz ehrenwerten<br />
Historikerkollegen hierzulande der Gedanke e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>vernehmlichen Grenzänderung<br />
<strong>und</strong> des Zusammenschlusses national „relativ kompakter Geme<strong>in</strong>schaften – eventuell<br />
durch freiwillige <strong>und</strong> geregelte Umsiedlung von M<strong>in</strong>derheiten“ – als verlockend erschienen.<br />
66<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> nationale M<strong>in</strong>derheiten stehen so auch am Ende des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
<strong>in</strong> engster Beziehung. Gerade die bosnische Lösung, die <strong>in</strong> Dayton gef<strong>und</strong>en wurde,<br />
ersche<strong>in</strong>t hier als signifikant: Es handelt sich um den abermaligen – wiederum unerfüllbaren<br />
– Versuch (fast sechs Jahrzehnte nach dem Münchner Abkommen), M<strong>in</strong>derheitenprobleme<br />
durch e<strong>in</strong>e ethnische Grenzziehung zu lösen. Deren komplizierte<br />
L<strong>in</strong>ienführung <strong>und</strong> die dennoch <strong>in</strong> beiden Landesteilen, der „Serbischen Republik“<br />
<strong>und</strong> dem kroatisch-musl<strong>im</strong>ischen Territorium, verbleibenden M<strong>in</strong>derheiten lassen es<br />
als fraglich ersche<strong>in</strong>en, ob die <strong>im</strong> Dayton-Vertrag erzielte Grenzregelung weitere<br />
Probleme des Zusammenlebens <strong>und</strong> der Verdrängung der jeweils anderen Ethnie auf<br />
Dauer wird vermeiden können. Genau das gegenteilige Konzept versuchte die Staatengeme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>im</strong> Krieg von 1999 <strong>und</strong> danach <strong>im</strong> Kosovo durchzusetzen. Die Bevölkerung<br />
sollte hier gezwungen werden, ohne ethnische Separation friedlich mite<strong>in</strong>ander<br />
auszukommen, bzw. die schon begonnene ethnische Säuberung durch die serbische<br />
Staatsgewalt oder umgekehrt durch die UCçK sollte gestoppt werden. Welche der<br />
beiden Lösungen der mangelnden Kongruenz von Staatsgrenzen <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten<br />
zum Ziel führt oder ob überhaupt e<strong>in</strong>e davon das Problem zu lösen vermag, muß dah<strong>in</strong>gestellt<br />
bleiben, solange <strong>im</strong> Kosovo <strong>und</strong> <strong>in</strong> Bosnien <strong>und</strong> der Herzegow<strong>in</strong>a die potentiellen<br />
ethnischen Konflikte nur durch <strong>in</strong>ternationale Friedensschutztruppen h<strong>in</strong>tan<br />
gehalten werden können. 67<br />
So ist die Hoffnung auf e<strong>in</strong> „Europa ohne <strong>Grenzen</strong>“, die die Generation der jungen<br />
Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg begeistert hat, nur <strong>in</strong> Teilen des Kont<strong>in</strong>ents<br />
schon weitgehend verwirklicht worden. An anderen Stellen haben <strong>Grenzen</strong> nach wie<br />
vor – oder sogar mehr als ehedem – nationalstaatlichen Charakter, <strong>und</strong> Nichtangehörige<br />
der jeweiligen Staatsnation f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> problematischer oder bedrohter Lage<br />
von diesen <strong>Grenzen</strong> betroffen. Soll auch hier die „ethnische Säuberung“ wiederum<br />
66 LEMBERG: „Ethnische Säuberung“ (wie Anm. 30), S. 38.<br />
67 Vgl. MARIE-JANINE CALIC: Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton, <strong>in</strong>: Aus Politik<br />
<strong>und</strong> Zeitgeschichte B 34/99 v. <strong>20</strong>.08.1999, S. 22–32. – Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch<br />
zu Vorgeschichte, Verlauf <strong>und</strong> Konsequenz, Opladen/Wiesbaden 1999.<br />
180
das verme<strong>in</strong>tliche Allheilmittel bilden? S<strong>in</strong>d nicht h<strong>in</strong>gegen Regelungen des M<strong>in</strong>derheitenschutzes,<br />
etwa wie <strong>in</strong> der Völkerb<strong>und</strong>-Ära, besser als es ihr Ruf war <strong>und</strong> ist?<br />
Bietet ihre Fortentwicklung <strong>im</strong> Rahmen von UNO <strong>und</strong> OSZE, wenn sie denn nur konsequent<br />
vorangetrieben werden, nicht eher Aussicht auf e<strong>in</strong>e Befriedung? 68 Können<br />
nicht tatsächlich Autonomiemodelle <strong>in</strong> der Art des heutigen Südtirol, regionale Kooperationen<br />
oder föderative bzw. konföderative Modelle weit bessere Alternativen<br />
bilden als die Wahnvorstellung, von Nationalstaaten, wenn sie denn nur genug homogen,<br />
von ethnischen M<strong>in</strong>derheiten „gere<strong>in</strong>igt“ s<strong>in</strong>d, sei der allgeme<strong>in</strong>e Friede zu erhoffen?<br />
68 Vgl. RAINER HOFMANN: M<strong>in</strong>derheitenschutz <strong>in</strong> Europa. Überblick über die völker- <strong>und</strong><br />
staatsrechtliche Lage, <strong>in</strong>: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht <strong>und</strong> Völkerrecht<br />
52 (1992), Heft 1, S. 1-65; DIETER BLUMENWITZ: Internationale Schutzmechanismen zur<br />
Durchsetzung von M<strong>in</strong>derheiten- <strong>und</strong> Volksgruppenrechten, Köln 1997 (Kulturstiftung der<br />
Deutschen Vertriebenen. Studiengruppe für Politik <strong>und</strong> Völkerrecht. Forschungsergebnisse<br />
der Studiengruppe für Politik <strong>und</strong> Völkerrecht, 24); GEORG BRUNNER: Nationalitätenprobleme<br />
<strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheitenkonflikte <strong>in</strong> Osteuropa. Aktualisierte <strong>und</strong> vollst. überarb. Fassung<br />
Gütersloh 1996 (Strategien für Europa).<br />
181
Die Grenze als Grauzone.<br />
Zum Problem der Perspektive <strong>in</strong> den deutsch-polnischen<br />
Beziehungen der Zwischenkriegszeit<br />
von<br />
Mathias N i e n d o r f<br />
Die deutsch-polnischen Beziehungen <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit stellten e<strong>in</strong> äußerst<br />
vielschichtiges Problem dar. Sie erstreckten sich von der Ebene der <strong>in</strong>ternationalen<br />
Diplomatie bis zum unmittelbar zwischenmenschlichen Bereich. Das Verhältnis zwischen<br />
Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Warschau war <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch den außenpolitischen Gegensatz<br />
<strong>in</strong> der Grenzfrage best<strong>im</strong>mt, wurde jedoch zusätzlich belastet durch die M<strong>in</strong>derheitenproblematik.<br />
Das Pr<strong>in</strong>zip des Nationalstaates, dem die Versailler Friedensordnung<br />
zum Durchbruch verhelfen sollte, erwies sich <strong>in</strong> jenem Teil Europas als nicht durchführbar.<br />
Auch nach dem Verlust von großen Teilen se<strong>in</strong>er Ostgebiete waren <strong>in</strong><br />
Deutschland polnischsprachige Bevölkerungsgruppen verblieben, die ihrer zahlenmäßigen<br />
Stärke nach der deutschen M<strong>in</strong>derheit <strong>in</strong> Polen nicht nachstanden. Teilweise<br />
beträchtliche Unterschiede bestanden allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> puncto Nationalbewußtse<strong>in</strong>, sozioökonomischem<br />
Status <strong>und</strong> rechtlicher Lage.<br />
Die politische Bedeutung jener Thematik spiegelt sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Vielzahl von Veröffentlichungen<br />
wider, bei denen die <strong>Grenzen</strong> zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Publizistik<br />
nicht <strong>im</strong>mer e<strong>in</strong>deutig auszumachen s<strong>in</strong>d. Das Bemühen, territoriale Besitzansprüche<br />
zu legit<strong>im</strong>ieren beziehungsweise zu desavouieren, prägte bis weit nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg die Publikationen auf beiden Seiten. Deutsche wie polnische Darstellungen<br />
der Grenz- <strong>und</strong> Nationalitätenproblematik setzten dabei e<strong>in</strong> permanentes Konfliktverhältnis<br />
als gegeben voraus. Nicht nur Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Warschau, sondern auch die Staatsnationen<br />
<strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheiten standen sich <strong>in</strong> dieser Sichtweise frontal gegenüber. Der<br />
Alltag <strong>im</strong> Grenzgebiet, das Leben an der Nahtstelle zweier Länder <strong>und</strong> zweier Ethnien,<br />
konnte aus diesem Blickw<strong>in</strong>kel nur am Rande wahrgenommen werden.<br />
Demgegenüber soll <strong>im</strong> folgenden e<strong>in</strong> Ansatz vorgestellt werden, der die Zentralperspektive<br />
traditioneller Nationalgeschichtsschreibung mit e<strong>in</strong>em Blick auf die Peripherie<br />
kontrastiert. Gr<strong>und</strong>lage bildet e<strong>in</strong>e Fallstudie deutsch-polnischer Alltagsbeziehungen<br />
<strong>in</strong> der Prov<strong>in</strong>z. 1<br />
1 Inzwischen <strong>im</strong> Druck vorliegend: MATHIAS NIENDORF: M<strong>in</strong>derheiten an der Grenze. Deutsche<br />
<strong>und</strong> Polen <strong>in</strong> den Kreisen Flatow (Złotów) <strong>und</strong> Zempelburg (Sępólno Krajeńskie)<br />
1900-1939, Wiesbaden 1997 (Deutsches Historisches <strong>Institut</strong> Warschau. Quellen <strong>und</strong> Studien,<br />
Bd. 6). Die folgenden Anmerkungen beschränken sich auf dort nicht zu f<strong>in</strong>dende<br />
Nachweise. Weiteres Anschauungsmaterial bietet die Aktenedition: Deutsche <strong>und</strong> Polen<br />
183
Im Mittelpunkt der Darstellung steht der ehemalige westpreußische Kreis Flatow,<br />
der nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Deutschland <strong>und</strong> Polen geteilt wurde, wobei<br />
zu beiden Seiten der Grenze starke M<strong>in</strong>derheiten zurückblieben. Wie fast überall <strong>im</strong><br />
deutsch-polnischen Grenzgebiet war auch hier e<strong>in</strong>e ethnische Mischsiedlung vorherrschend;<br />
als etwas ungewöhnlich kann der hohe Anteil von Deutschsprachigen unter<br />
den Katholiken (vor dem Ersten Weltkrieg r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel) gelten. Der Restkreis Flatow<br />
wurde der neugeschaffenen Grenzmark Posen-Westpreußen mit der Hauptstadt<br />
Schneidemühl (Pi¬a) angegliedert. Die Geschichte der aus drei unzusammenhängenden<br />
Teilstücken bestehenden Prov<strong>in</strong>z, die sich schlauchartig über e<strong>in</strong>e Länge von 400<br />
km entlang der deutsch-polnischen Grenze erstreckte, ist auf das engste mit der Revisionspolitik<br />
des Reiches verb<strong>und</strong>en. 2 Das Festhalten am Namen der größtenteils an<br />
Polen abgetretenen Prov<strong>in</strong>zen signalisierte die Nichtanerkennung des Status quo <strong>und</strong><br />
damit zugleich den Anspruch, als sogenannte Traditionsprov<strong>in</strong>z e<strong>in</strong>e besondere nationale<br />
Aufgabe wahrzunehmen. Die östliche Hälfte des Kreises Flatow bildete seit<br />
19<strong>20</strong> e<strong>in</strong>en eigenständigen Kreis Zempelburg <strong>in</strong>nerhalb der polnischen Wojewodschaft<br />
Pommerellen, die <strong>in</strong> Deutschland meist nur als „Korridor“ bekannt war <strong>und</strong> das<br />
bevorzugte Objekt der Revisionspropaganda darstellte. Als „kle<strong>in</strong>ster, aber deutschester<br />
Kreis“ wies Zempelburg den höchsten Prozentsatz deutscher M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> westlichen<br />
Polen auf (1931: 40,4 %). Umgekehrt gehörte der Restkreis Flatow zu den<br />
Hochburgen der polnischsprachigen Bevölkerung <strong>im</strong> Reich (1925: 16,9 %). Besondere<br />
Beachtung hat <strong>in</strong> Wissenschaft <strong>und</strong> Publizistik der Umstand gef<strong>und</strong>en, daß sich<br />
von den polnischen M<strong>in</strong>derheitsschulen <strong>in</strong> Deutschland jede dritte <strong>im</strong> Kreis Flatow<br />
befand.<br />
Der Zusammenhang von Grenz- <strong>und</strong> ethnischen Konflikten beschäftigt die sozialwissenschaftlich<br />
ausgerichtete Forschung seit geraumer Zeit. 3 Anders als deren<br />
meist stark theorieorientierte Beiträge bewegt sich vorliegende Skizze vor allem auf<br />
der Ebene von Oberflächenphänomenen, auf jener Ebene also, auf der die zeitgenös-<br />
zwischen den Kriegen. M<strong>in</strong>derheitenstatus <strong>und</strong> „Volkstumskampf“ <strong>im</strong> Grenzgebiet. Amtliche<br />
Berichterstattung aus beiden Ländern 19<strong>20</strong>-1939, hrsg. von RUDOLF JAWORSKI <strong>und</strong><br />
MARIAN WOJCIECHOWSKI, München usw. 1997 (Texte <strong>und</strong> Materialien zur Zeitgeschichte,<br />
Bd. 9/1,2).<br />
2 Vgl. EDMUND SPEVACK: Borderland Nationalism, Westward Migration, and Anti-Polish<br />
Aggression: The Case of the Grenzmark Posen-Westpreussen, 1919-1939, <strong>in</strong>: East European<br />
Quarterly 30 (1996), S. 301-330.<br />
3 E<strong>in</strong>flußreich noch <strong>im</strong>mer: Ethnic Groups and Bo<strong>und</strong>aries. The Social Organization of Cultural<br />
Difference, hrsg. von FREDRIK BARTH, Bergen u.a. 1969; zu Forschungstrends <strong>und</strong> -<br />
desideraten <strong>in</strong> der Geschichtswissenschaft vgl. HANS MEDICK: Zur politischen Sozialgeschichte<br />
der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Neuzeit Europas, <strong>in</strong>: Sozialwissenschaftliche Informationen <strong>20</strong><br />
(1991), S.157-163; speziell zur deutsch-polnischen Grenze: GERARD LABUDA: Dzieje granicy<br />
polsko-niemieckiej jako zagadnienie badawcze [Die Geschichte der deutschpolnischen<br />
Grenze als Forschungsproblem], <strong>in</strong>: Problem granic i obszaru odrodzonego<br />
państwa polskiego (1918-1990), hrsg. von ANTONI CZUBIŃSKI, Poznań 1992 (Uniwersytet<br />
<strong>im</strong>. Adama Mickiewicza. Seria Historia, Bd. 174), S. 11-47.<br />
184
sischen Ause<strong>in</strong>andersetzungen geführt wurden. Diese s<strong>in</strong>d maßgeblich von der deutschen<br />
Seite best<strong>im</strong>mt worden, die <strong>im</strong> folgenden daher auch den Gang der Darstellung<br />
vorgeben.<br />
Die „blutende Grenze“ gehörte zu den Topoi der antipolnischen Propaganda von<br />
We<strong>im</strong>arer Republik <strong>und</strong> Drittem Reich. Beschworen wurde damit die Unhaltbarkeit<br />
der territorialen Regelung von Versailles. Nicht e<strong>in</strong> Staatsgebiet, sondern e<strong>in</strong> lebendiger<br />
Volkskörper sei durch die Grenze zerschnitten worden, suggerierte das Bild. 4<br />
Zur Illustration wurden e<strong>in</strong>ige <strong>im</strong>mer wiederkehrende Beispiele bemüht: Deutschlands<br />
e<strong>in</strong>ziger, wenige Meter schmale Weichselzugang bei Kurzebrack (Korzeniewo),<br />
gesperrte bzw. abgerissene Brücken oder durch Stacheldraht verbarrikadierte Bergwerksschächte<br />
<strong>in</strong> Oberschlesien. Gerade die Suggestivkraft solcher Bilder barg allerd<strong>in</strong>gs<br />
die Gefahr <strong>in</strong> sich, daß sie e<strong>in</strong>e Eigendynamik entwickelten <strong>und</strong> nicht mehr als<br />
symbolische Veranschaulichung e<strong>in</strong>es politischen Problems, sondern als das Problem<br />
selbst wahrgenommen wurden, das sich mit guten Willen <strong>und</strong> etwas Phantasie leicht<br />
lösen ließe. Mit der propagandistischen Konzentration auf e<strong>in</strong>ige Problempunkte der<br />
deutsch-polnischen Grenze gerieten zugleich jene Gebiete <strong>in</strong>s H<strong>in</strong>tertreffen, die wie<br />
der Kreis Flatow nicht mit entsprechend spektakulären Stellen aufwarten konnten.<br />
Dessen ungeachtet fand der Begriff der „blutenden Grenze“ auch hier Anwendung.<br />
E<strong>in</strong>e Denkschrift von Spitzenvertretern der Grenzmark aus Politik, Kirche <strong>und</strong><br />
Wirtschaft trieb die Körpermetaphorik auf die Spitze, <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong>e Unterscheidung<br />
zwischen „blutigen <strong>Grenzen</strong> ger<strong>in</strong>geren“ <strong>und</strong> solchen „ernsteren Grades“ e<strong>in</strong>geführt<br />
wurde. Unterscheidungsmerkmal sollte se<strong>in</strong>, ob „Kopf oder Schwanz abgeschnitten“<br />
sei. Von den <strong>in</strong>sgesamt 79 km Landesgrenze des Kreises Flatow entfielen dieser Def<strong>in</strong>ition<br />
zufolge die Hälfte (40 km) auf „blutige Grenze ersten Grades“. 5 Die sprachliche<br />
Artistik besaß e<strong>in</strong>en sehr konkreten H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>: Im Konkurrenzkampf um die<br />
Zuteilung von Subventionen versuchte sich die Grenzmark als die nach Ostpreußen<br />
(<strong>und</strong> neben Oberschlesien) am härtesten von Versailles betroffene Prov<strong>in</strong>z darzustellen,<br />
wobei zugleich auf den hohen Anteil nationaler M<strong>in</strong>derheiten verwiesen wurde.<br />
In der Anlage jener Denkschrift befand sich e<strong>in</strong>e umfangreiche Aufstellung von Subventionsanträgen.<br />
Die Hilferufe aus der Prov<strong>in</strong>z verfehlten nicht ihre Wirkung auf die<br />
maßgeblichen Instanzen der Hauptstadt. In der deutschen Öffentlichkeit allerd<strong>in</strong>gs<br />
hatten sie e<strong>in</strong> negatives Image der betroffenen Region zur Folge. Bedrohungszenarien<br />
waren nicht geeignet, privates Kapital <strong>und</strong> Investitionen anzuziehen, was wiederum<br />
die Abhängigkeit vom Staatshaushalt erhöhte. Die Subventionen aus Berl<strong>in</strong> (teilweise<br />
<strong>im</strong> Rahmen der sogenannten Osthilfe) trugen allmählich zur Behebung der gravie-<br />
4 Der obsessive Gebrauch jener Verstümmelungsmetaphorik legt tiefenpsychologische Interpretationen<br />
nahe; vgl. KLAUS THEWELEIT: Männerphantasien, Bd.1: Frauen, Körper, Fluten,<br />
Geschichte, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1977; INGE BAXMANN: Der Körper der Nation, <strong>in</strong>: Nation<br />
<strong>und</strong> Emotion. Deutschland <strong>und</strong> Frankreich <strong>im</strong> Vergleich. <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
hrsg. von ETIENNE FRANÇOIS, HANNES SIEGRIST <strong>und</strong> JAKOB VOGEL, Gött<strong>in</strong>gen 1995 (Kritische<br />
Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 110), S. 353-365.<br />
5 Die Grenzmark Posen-Westpreußen <strong>im</strong> Vergleich mit den anderen an neuen Reichsgrenzen<br />
gelegenen preußischen Landesteilen, Schneidemühl 1927 (unpag.).<br />
185
endsten Mängel <strong>in</strong> der Infrastruktur bei <strong>und</strong> untergruben so letztlich die ökonomische<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Grenzrevisionspropaganda.<br />
Ähnliche Versuche, Modernisierungsmaßnahmen mit Hilfe nationaler Rhetorik<br />
e<strong>in</strong>zufordern, lassen sich <strong>im</strong> Kreis Zempelburg wie auch <strong>im</strong> übrigen Westpolen nicht<br />
beobachten. Hierfür ist nicht alle<strong>in</strong> der chronische F<strong>in</strong>anzmangel Warschaus oder das<br />
Fehlen e<strong>in</strong>es der Osthilfe vergleichbaren Antragssystems verantwortlich. Die eigentliche<br />
strukturpolitische Herausforderung der Zweiten Republik stellten die sogenannten<br />
kresy <strong>im</strong> Osten dar, während die ehemals deutschen Gebiete <strong>im</strong> Verhältnis zu den<br />
übrigen Landesteilen nun e<strong>in</strong>en überdurchschnittlichen Entwicklungsstand verkörperten.<br />
Das demonstrative Herausstellen von Unzulänglichkeiten <strong>und</strong> Nachteilen der<br />
Grenzziehung hätte zudem <strong>im</strong> Widerspruch zur offiziellen Politik des Status quo gestanden.<br />
Deutschen Revisionsforderungen wurde zwar <strong>im</strong>mer wieder entgegengehalten,<br />
daß nicht dem Reich, sondern Polen <strong>in</strong> Versailles Unrecht geschehen sei, doch<br />
wurden aus dieser Argumentation <strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e aktuellen Gebietsansprüche abgeleitet.<br />
Soweit es den Unterhalt der politisch umstrittenen Grenze betraf, funktionierte die<br />
Zusammenarbeit des Starosten von Zempelburg mit se<strong>in</strong>em Kollegen <strong>in</strong> Flatow weitgehend<br />
reibungslos. Wie es e<strong>in</strong>er modernen, „l<strong>in</strong>earen“ Staatsgrenze entsprach, war<br />
die <strong>in</strong> Versailles am grünen Tisch gezogene Grenze nicht nur auf Karten e<strong>in</strong>gezeichnet,<br />
sondern auch <strong>im</strong> Gelände durch e<strong>in</strong> System von Grenzste<strong>in</strong>en <strong>und</strong> -pfählen präzise<br />
markiert. Die Kosten, die hierdurch entstanden, bedeuteten für die Bevölkerung<br />
vor Ort e<strong>in</strong>en, wenn auch bescheidenen, Zuwachs an Kaufkraft. 19<strong>20</strong> waren auf dem<br />
Gebiet des Restkreises Flatow bereits 32 Zollbedienstete tätig; 6 für die Aufstellung<br />
von Warntafeln wurden über <strong>20</strong>00 Mark an sieben E<strong>in</strong>he<strong>im</strong>ische gezahlt. 7 Mit diesen<br />
Schildern, die <strong>in</strong> 100 Metern Entfernung von der Grenze aufgestellt wurden, gab der<br />
Staat bereits zu erkennen, daß er zu e<strong>in</strong>er lückenlosen Überwachung se<strong>in</strong>es Hoheitsgebietes<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage war.<br />
Pr<strong>in</strong>zipiell ignoriert wurde die Staatsgrenze von R<strong>in</strong>dern, Schafen <strong>und</strong> Ziegen.<br />
Immer wieder f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der Prov<strong>in</strong>zpresse Meldungen, wonach verlaufenes Vieh<br />
unbürokratisch von der anderen Seite zurückgegeben wurde. Auch e<strong>in</strong>ige deutsche<br />
Bauern konnten ungestört ihre <strong>im</strong> Nachbarland gelegenen Wiesen bewirtschaften. E<strong>in</strong>e<br />
Änderung des Grenzverlaufs schien dem Landrat von Flatow daher auch nicht<br />
zw<strong>in</strong>gend notwendig, als ihn 1929 e<strong>in</strong>e Anfrage des Auswärtigen Amts erreichte, ob<br />
mit Warschau über e<strong>in</strong>en Gebietsaustausch an jener Stelle verhandelt werden solle.<br />
In se<strong>in</strong>er Bedeutung kaum zu überschätzen, obwohl bisher noch wenig erforscht,<br />
ist die E<strong>in</strong>richtung des kle<strong>in</strong>en Grenzverkehrs, die sich zunächst auf e<strong>in</strong>en Streifen<br />
von 5 km, später 10 km beiderseits der Grenze erstreckte. E<strong>in</strong>e Kontrolle der B<strong>in</strong>nengrenzen<br />
dieser Zone ließ sich noch sehr viel weniger durchführen als e<strong>in</strong>e systemati-<br />
6 Der Oberzollkontrollör <strong>in</strong> Flatow am 18.1.19<strong>20</strong> an das Landratsamt ebenda: Archiwum<br />
Państwowe w Koszal<strong>in</strong>ie, Landratsamt Flatow, Nr. 337.<br />
7 Der Kreisbaumeister des Kreises Flatow am 13.12.19<strong>20</strong> an das Landratsamt ebenda: Archiwum<br />
Państwowe w Poznaniu, Rejencja w Pile, Nr. 242.<br />
186
sche Überwachung der Staatsgrenze. E<strong>in</strong> Berechtigungsausweis für den kle<strong>in</strong>en<br />
Grenzverkehr ermöglichte de facto auch Fahrten <strong>in</strong>s Landes<strong>in</strong>nere. Dies war nicht zuletzt<br />
für Angehörige der deutschen M<strong>in</strong>derheit von Bedeutung, die die hohen Kosten<br />
e<strong>in</strong>es polnischen Reisepasses nicht aufzubr<strong>in</strong>gen vermochten. Die Nähe des Nachbarlandes<br />
bot darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e Reihe materieller Vorteile. Während der gesamten<br />
Zwischenkriegszeit blühte der Schmuggel. Das soziale Spektrum der <strong>im</strong> Kreis Zempelburg<br />
wegen Zollvergehen belangten Personen reichte von der Gänsehirt<strong>in</strong> bis zum<br />
Pfarrer. Neben Waren aller Art passierten auch Menschen illegal die Grenze, teilweise<br />
mit Hilfe gewerbsmäßiger Schleuser. Ihnen allen kam die Unübersichtlichkeit des<br />
Geländes zugute. E<strong>in</strong> polnischer Landwirt konnte dem Amtsgericht <strong>in</strong> Zempelburg<br />
glaubhaft machen, daß er überhaupt nicht wahrgenommen hatte, daß er be<strong>im</strong> Beerenpflücken<br />
auf deutsches Gebiet geraten war. Er wurde auf Kosten der Staatskasse freigesprochen.<br />
8 Den Alltag an der Nahtstelle zweier Länder brachte e<strong>in</strong> Zeitzeuge auf<br />
die Formel: „Die ’grüne‘ Grenze ... E<strong>in</strong> Augenblick des Risikos, etwas Herzklopfen –<br />
<strong>und</strong> das war’s.“ 9<br />
Inwieweit der Kreis Flatow <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Entwicklung tatsächlich von der Grenzziehung<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt wurde, läßt sich aufgr<strong>und</strong> der Quellenlage schwer beurteilen. Bereits<br />
der zeitgenössischen deutschen Forschung war nicht entgangen, daß es <strong>im</strong> Reich<br />
neben den Verlierern auch Gew<strong>in</strong>ner der Versailler Friedensregelung gegeben hatte.<br />
E<strong>in</strong>e der markantesten Beispiele dafür, wie e<strong>in</strong>e Ortschaft von der Übernahme zentralörtlicher<br />
Funktionen profitieren konnte, stellt gerade die Prov<strong>in</strong>zhauptstadt<br />
Schneidemühl dar, die bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht e<strong>in</strong>mal den Status<br />
e<strong>in</strong>er Kreisstadt besessen hatte. 10<br />
Im Kreis Flatow verfügten Handel <strong>und</strong> Gewerbe von alters her über ke<strong>in</strong>en größeren<br />
E<strong>in</strong>zugsbereich, sondern waren überwiegend auf den lokalen Markt ausgerichtet.<br />
Schwer getroffen von der Grenzziehung war gerade e<strong>in</strong>er der wirtschaftlich erfolgreichsten<br />
Betriebe, die weit über die Kreisgrenzen h<strong>in</strong>aus verbreitete „Flatower Zeitung“,<br />
die 19<strong>20</strong> e<strong>in</strong> Drittel ihrer Abonnenten verlor. Sie änderte ihren Namen <strong>in</strong> „Die<br />
Grenzmark“ <strong>und</strong> schlug e<strong>in</strong>en scharf antipolnischen Kurs e<strong>in</strong>. Der Titelkopf zeigte<br />
„e<strong>in</strong>en Ordensritter mit gespreizten Be<strong>in</strong>en, rechts <strong>und</strong> l<strong>in</strong>ks über e<strong>in</strong>er gezeichneten<br />
Grenze stehend, das Gesicht nach Osten gerichtet. Diese Figur vers<strong>in</strong>nbildlichte von<br />
da an den Standpunkt der Zeitung.“ 11<br />
Auch auf lokaler Ebene lassen sich somit Elemente der Grenzrevisions-<br />
Propaganda nachweisen. Allerd<strong>in</strong>gs ist deren Wirksamkeit nicht überzubewerten, wie<br />
8 Gazeta Sępoleńska [Zempelburger Zeitung] Nr. 124/25.10.1930.<br />
9 LEON KOWALSKI: Czas próby. Wspomnienia nauczyciela z ziemi › łotowskiej [Probezeit.<br />
Er<strong>in</strong>nerungen e<strong>in</strong>es Lehrers aus dem Flatower Land], Poznań 1965, S. 35: „ Zielona granica...<br />
Moment ryzyka, trochę bicia serca – i już.“<br />
10 Vgl. KARL BOESE: Geschichte der Stadt Schneidemühl, 2. Aufl. Würzburg 1965 (Ostdeutsche<br />
Beiträge aus dem Gött<strong>in</strong>ger Arbeitskreis, Bd. 30).<br />
11 F. W. SCHÖLER: Randbemerkungen über die Ruderei <strong>in</strong> Flatow <strong>und</strong> andere Künste, <strong>in</strong>:<br />
Neues Schlochauer <strong>und</strong> Flatower Kreisblatt 9 (1961), S. 1524.<br />
187
gerade das Schicksal jenes Blattes zeigt. Neben der journalistischen Qualität nahmen<br />
auch Auflagenziffern <strong>und</strong> politische Bedeutung der „Grenzmark“ kont<strong>in</strong>uierlich ab.<br />
In der benachbarten Prov<strong>in</strong>zhauptstadt etablierte sich das Zentrumsblatt „Grenzwacht“;<br />
die Flatower Brauerei produzierte nach der Fusion mit e<strong>in</strong>em Schneidemühler<br />
Konkurrenzbetrieb unter dem Namen „Grenzmarkbräu“. Diese Trivialisierung wie<br />
Kommerzialisierung e<strong>in</strong>er am „Grenz“-Begriff aufgezogenen Vorposten-Ideologie<br />
forderte ironische Kommentare von polnischer Seite heraus. Aber auch die deutsche<br />
Bevölkerung war mit der ihr zugedachten Rolle offenbar überfordert.<br />
Für die Prov<strong>in</strong>z mit ihrem umständlichen Doppelnamen begann sich <strong>in</strong>nerhalb wie<br />
außerhalb die tautologische Kurzform „Grenzmark“ e<strong>in</strong>zubürgern (<strong>in</strong> der sie auch <strong>in</strong><br />
vorliegendem Beitrag ersche<strong>in</strong>t). Der Oberpräsident beobachtete diese Entwicklung<br />
mit Sorge <strong>und</strong> stellte bedauernd fest, daß damit das Ziel, die Er<strong>in</strong>nerung an die abgetretenen<br />
Gebiete Posens <strong>und</strong> Westpreußens wachzuhalten, gefährdet sei. Dabei ließ es<br />
der höchste Beamte der Prov<strong>in</strong>z nicht an markigen Worten fehlen, wenn er bei anderer<br />
Gelegenheit e<strong>in</strong> besonderes Grenzlandbewußtse<strong>in</strong> der Bewohner beschwor, das<br />
die Unterstützung der Zentralbehörden verdiene.<br />
Um e<strong>in</strong>e größere Öffentlichkeit für die <strong>im</strong> Schatten Ostpreußens <strong>und</strong> Oberschlesiens<br />
stehende Grenzmark zu <strong>in</strong>teressieren, organisierten ihre Behörden <strong>im</strong> Oktober<br />
1928 e<strong>in</strong>e mehrtägige Pressefahrt. E<strong>in</strong>geladen waren neben Vertretern der Prov<strong>in</strong>zblätter<br />
Redakteure der führenden Tageszeitungen West- <strong>und</strong> Mitteldeutschlands. Die<br />
meist mehrteiligen Reportagen wurden später auch gesammelt als Monographie herausgegeben.<br />
12 Sie s<strong>in</strong>d aufschlußreich als Zeugnis e<strong>in</strong>er – wenn auch gelenkten –<br />
Außenwahrnehmung der Peripherie. Die Artikel vermitteln des Gefühl, als habe den<br />
stärksten E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong> Katastrophengebiet h<strong>in</strong>terlassen, für das nicht Versailles, sondern<br />
Panolis flammea verantwortlich war: der auch unter dem Namen Forleule bekannten<br />
Raupe waren <strong>im</strong> Kreis Schwer<strong>in</strong> an der Warthe über 10 000 ha Wald zum<br />
Opfer gefallen.<br />
Vergleichsweise blaß nehmen sich dagegen die Schilderungen von der Landesgrenze<br />
aus, die an mehreren Stellen, darunter auch <strong>im</strong> Kreis Flatow, besichtigt wurde.<br />
E<strong>in</strong>e gewisse Beachtung fand „Albert Konopkas Weiden-Handlung“ <strong>in</strong> Tirschtiegel<br />
(Trzciel, Kreis Meseritz), e<strong>in</strong> Kuriosum <strong>in</strong>sofern, als die Landesgrenze quer durch das<br />
Gebäude verlief. 13 Ansonsten er<strong>in</strong>nern die Reportagen ihrem Stil nach eher an Leitartikel.<br />
Was an Anschaulichkeit vor Ort fehlte, mußten Räsonnements vom Schreibtisch<br />
ersetzen. Der Vertreter e<strong>in</strong>es deutschnationalen Blattes bemühte se<strong>in</strong>e Phantasie<br />
<strong>und</strong> die se<strong>in</strong>er Leser, wenn er e<strong>in</strong> Bild wie dieses entwarf: „Höhnisch schaut der Pole<br />
von den 40 Meter hohen Türmen, die er unmittelbar an se<strong>in</strong>er Grenze errichtet, nach<br />
12<br />
Aufsätze aus der deutschen Presse. Die Prov<strong>in</strong>z Grenzmark Posen-Westpreußen, Schneidemühl<br />
1927.<br />
13<br />
Vgl. das Foto <strong>in</strong> WILLY SCHMIDT: Grenzland <strong>im</strong> Bilde, 2. Aufl. Neudamm o. J., S. 16. Ungeachtet<br />
se<strong>in</strong>es illustrativen Wertes fand das Bild ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> den überregionalen<br />
Kanon deutscher Grenzrevisionspropaganda.<br />
188
se<strong>in</strong>em nächsten Ziele, der Oder aus.“ 14 In ähnlicher Manier wurde von der Rechtspresse<br />
die Gefahr durch die polnische M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> Innern beschworen.<br />
Nahm e<strong>in</strong> Berichterstatter aus dem Westen aber die Gelegenheit wahr, e<strong>in</strong>mal mit<br />
e<strong>in</strong>em Polen <strong>in</strong>s Gespräch zu kommen, konnten vorgefaßte Me<strong>in</strong>ungen <strong>in</strong>s Wanken<br />
geraten: „Unterhält man sich mit solch polnischer Landarbeiterfamilie, dann bekommt<br />
man wirklich nicht den E<strong>in</strong>druck nationalistischer Aktivisten“, stellte der Korrespondent<br />
der „Kölnischen Zeitung“ mit leicht erstauntem Unterton fest, um<br />
sogleich relativierend h<strong>in</strong>zuzufügen: „Gefährlich werden solche Leute erst durch die<br />
<strong>in</strong>tellektuellen Aufhetzer“. 15 Weniger das seit Bismarck geläufige Stereotyp des e<strong>in</strong>fachen<br />
Polen als des besseren Untertanen verdient hier Beachtung. Weit aufschlußreicher<br />
ersche<strong>in</strong>t die Tatsache, daß der Journalist aus dem Rhe<strong>in</strong>land neben e<strong>in</strong>em<br />
Leipziger Kollegen der e<strong>in</strong>zige war, der bei der Schilderung zweier Domänen <strong>im</strong><br />
Kreis Flatow überhaupt e<strong>in</strong> Wort über die Nationalität der Arbeiter verlor. Die Aufmerksamkeit<br />
der übrigen Pressevertreter wurde gänzlich von den Unterkünften gefangen<br />
genommen <strong>und</strong> dem menschlichen Elend, das ihnen dort entgegenschlug. In<br />
dieser Akzentsetzung vermitteln die Reportagen letztlich doch e<strong>in</strong> zutreffendes Bild<br />
e<strong>in</strong>er Region, die weniger von nationalen Ause<strong>in</strong>andersetzungen als von den Strukturproblemen<br />
e<strong>in</strong>er Peripherie geprägt war.<br />
Jahre später stellte e<strong>in</strong> Bewohner fest: „Wer heute noch mit offenen Augen die<br />
Dörfer [...] des Kreises Flatow anschaut, wird sofort erkennen können, wo die Gutsbezirke<br />
am längsten bestanden haben <strong>und</strong> die schöpferischen Kräfte der Selbstverwaltung<br />
gelähmt waren [...].“ 16 Dort, wo die Wege besonders schlecht <strong>und</strong> die Schulgebäude<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „erbärmlichen Zustande“ seien, mußte es sich um e<strong>in</strong>en ehemaligen<br />
Gutsbezirk handeln. Siedlungsgeographische Unterschiede zwischen deutschen <strong>und</strong><br />
polnischen Dörfern waren dagegen nicht auszumachen, bemerkte ebenfalls Mitte der<br />
30er Jahre e<strong>in</strong> weiterer Beobachter <strong>im</strong> Kreis Flatow <strong>und</strong> fügte h<strong>in</strong>zu: „Auch die Bewohner<br />
der Dörfer geben <strong>in</strong> ihrer äußeren Ersche<strong>in</strong>ung kaum Anhaltspunkte für ihre<br />
Volkszugehörigkeit, gleichgültig, ob wir auf Erwachsene oder K<strong>in</strong>der unser besonderes<br />
Augenmerk richten; selbst wenn wir sie ansprechen, f<strong>in</strong>den wir schwerlich die<br />
Unterscheidung, sie werden alle <strong>in</strong> deutscher Sprache erwidern.“ 17 Die Zugehörigkeit<br />
zu e<strong>in</strong>er der beiden Nationen sei daher <strong>im</strong> wesentlichen e<strong>in</strong>e Frage des subjektiven<br />
Willens. Diese Def<strong>in</strong>ition stand <strong>im</strong> Widerspruch zur offiziellen Rassenlehre des Dritten<br />
Reichs, der zufolge die Zugehörigkeit zu e<strong>in</strong>em Volkstum erbbiologisch vorgegeben<br />
war. In der Praxis vor Ort ließ sich der dogmatische Ansatz allerd<strong>in</strong>gs nicht<br />
14 W. S[CHEUERMANN]: Grenzmarknöte. Die blutenden <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Posen-Westpreußen, <strong>in</strong>:<br />
Deutsche Tageszeitung Nr.498/21.10.1928, auch <strong>in</strong>: Aufsätze (wie Anm. 12), S. 45-47, hier<br />
S. 45.<br />
15 [DRESBACH]: Reisee<strong>in</strong>drücke aus Posen-Westpreußen (2), <strong>in</strong>: Kölnische Zeitung Nr.<br />
585a/23.10.1928, auch <strong>in</strong>: Aufsätze (wie Anm. 12), S. 95-99, hier S. 98.<br />
16 Fragment e<strong>in</strong>er masch<strong>in</strong>enschriftlichen Ausarbeitung über den Kreis Flatow um 1935 von<br />
EWALD STOBER, S. 190: Bestand des Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.<br />
17 LOTHAR DÖRING: E<strong>in</strong> M<strong>in</strong>derheitendorf <strong>im</strong> Osten, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Erdk<strong>und</strong>e. Neue Folge<br />
der Geographischen Wochenschrift, 4 (1936), S. 1033-1037, hier S. 1033.<br />
189
durchhalten. Die Vorgaben parteiamtlicher Ideologie spielten der M<strong>in</strong>derheitenführung<br />
schließlich das Argument <strong>in</strong> die Hand, wer als Pole se<strong>in</strong>er Herkunft untreu werde,<br />
bleibe <strong>in</strong> den Augen der Deutschen doch e<strong>in</strong> rassisch m<strong>in</strong>derwertiges Subjekt.<br />
Dem Revisionismus Berl<strong>in</strong>s <strong>in</strong> außenpolitischer H<strong>in</strong>sicht entsprach auch unter Hitler<br />
e<strong>in</strong>e expansive, auf Ass<strong>im</strong>ilation ausgerichtete M<strong>in</strong>derheitenpolitik <strong>im</strong> Innern. Ihr<br />
Objekt war dabei vor allem jene Bevölkerungsgruppe ohne stark ausgeprägtes Nationalbewußtse<strong>in</strong>,<br />
die als Zwischenschicht bezeichnet wurde. E<strong>in</strong>e direkte Entsprechung<br />
dieses Begriffes fehlte <strong>im</strong> Polnischen bezeichnenderweise, da sowohl <strong>in</strong> den Reihen<br />
der M<strong>in</strong>derheit wie von den Behörden jenseits der Grenze von e<strong>in</strong>er „objektiven“,<br />
durch Konfession <strong>und</strong> Sprache vorgegebenen Nationszugehörigkeit ausgegangen<br />
wurde. 18<br />
Während sich die polnische M<strong>in</strong>derheitenpolitik <strong>im</strong> wesentlichen auf behördliche<br />
Sanktionen stützte <strong>und</strong> auf die Verdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils zielte,<br />
war das Vorgehen auf der Gegenseite – <strong>in</strong>sbesondere während der NS-Zeit – sehr<br />
viel subtiler auf e<strong>in</strong>em System von Zuckerbrot <strong>und</strong> Peitsche aufgebaut. Die mangelnde<br />
Schärfe der ethnischen <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Alltag stellte für den deutschen Staat e<strong>in</strong>e<br />
Chance, für die polnische M<strong>in</strong>derheit tendenziell e<strong>in</strong>e Bedrohung dar. Die überlegene<br />
deutsche F<strong>in</strong>anzkraft wirkte selbst über Staatsgrenzen h<strong>in</strong>aus. Auch <strong>im</strong> Kreis Zempelburg<br />
schlossen sich vere<strong>in</strong>zelt Polen besser ausgestatteten, da von Berl<strong>in</strong> subventionierten<br />
Wirtschaftsorganisationen der deutschen M<strong>in</strong>derheit an. Was <strong>in</strong> der deutschen<br />
Literatur als „Volkstumskampf“ bezeichnet wurde, trug auf polnischer Seite<br />
den Namen „Grenzkampf“ (walka graniczna). Dieser „Kampf“ wurde <strong>in</strong> beiden Ländern<br />
auch auf symbolischer Ebene ausgetragen. Klare nationale <strong>Grenzen</strong> zu ziehen<br />
<strong>und</strong> diese <strong>im</strong> Alltag sichtbar werden zu lassen, war vor allem <strong>in</strong> den 30er Jahren –<br />
ungeachtet unterschiedlicher Ausgangsvoraussetzungen – das Ziel des deutschen wie<br />
des polnischen Nationalismus.<br />
Im Kreis Flatow stand dem Hakenkreuz das sogenannte Rod¬o gegenüber, e<strong>in</strong>e stilisierte<br />
Nachbildung des Weichsellaufs <strong>in</strong> weißer Farbe auf rotem Gr<strong>und</strong>. Das Emblem<br />
des Polenb<strong>und</strong>es (Zwiaçzek Polaków w Niemczech) sollte die Verb<strong>und</strong>enheit der<br />
M<strong>in</strong>derheit mit dem Mutterland zum Ausdruck br<strong>in</strong>gen. Im Kreis Zempelburg war die<br />
Zeit Mitte der 30er Jahre auch optisch weniger von e<strong>in</strong>em deutsch-polnischen Gegensatz<br />
als von Ause<strong>in</strong>andersetzungen <strong>in</strong>nerhalb der M<strong>in</strong>derheit geprägt. Die Parteiflagge<br />
der „Deutschen Vere<strong>in</strong>igung“ geriet des öfteren zum Ziel wütender Attacken der<br />
rivalisierenden „Jungdeutschen Partei“ (JDP). Nach dem Willen der Eliten sollte die<br />
nationale Mobilisierung nicht auf den Rahmen politischer Organisationen beschränkt<br />
bleiben, sondern möglichst sämtliche Lebensbereiche umfassen. Das Bemühen um<br />
symbolische Abgrenzung läßt sich besonders <strong>im</strong> Bereich des Brauchtums beobachten.<br />
18 Schon HANS ROTHFELS: Nationalität <strong>und</strong> Grenze <strong>im</strong> späten <strong>19.</strong> <strong>und</strong> frühen <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
<strong>in</strong>: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 9 (1961), S. 225-233, wies darauf h<strong>in</strong>, „daß <strong>in</strong> dem<br />
Anspruch, Grenze vom Pr<strong>in</strong>zip der Nationalität her zu reklamieren oder zu verteidigen, jedes<br />
Volk dazu neigt, die politisch-subjektive Theorie da anzurufen, wo es selbst ass<strong>im</strong>ilierend<br />
gewirkt hat, die kulturell-objektive aber da, wo es <strong>im</strong> eigenen Bestand [...] der Ass<strong>im</strong>ilation<br />
ausgesetzt gewesen ist“ (S. 229).<br />
190
Nach alter patriarchalischer Sitte beg<strong>in</strong>gen deutsche Gutsbesitzer <strong>im</strong> Kreis Zempelburg<br />
noch Ende der <strong>20</strong>er Jahre das Erntedankfest alle<strong>in</strong> <strong>im</strong> Kreis ihrer Arbeiter<br />
<strong>und</strong> Familienangehörigen. Berichte <strong>in</strong> der polnischen Presse hoben meist den gelungenen<br />
Verlauf derartiger Veranstaltungen hervor, ohne auf die Nationalität der Teilnehmer<br />
e<strong>in</strong>zugehen. Lediglich e<strong>in</strong>ige bei solchen Anlässen offenbar unvermeidliche<br />
Schlägereien trübten zuweilen das Bild. 19 1938 trat an die Seite der lokalen Festveranstaltungen<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Erntedankfeier der JDP <strong>in</strong> Zempelburg, die der Festredner<br />
als e<strong>in</strong>en „altdeutschen Brauch“ (zwyczaj staro-niemiecki) bezeichnete. <strong>20</strong> Zuvor hatte<br />
bereits auf dem Lande e<strong>in</strong>e Premiere stattgef<strong>und</strong>en – e<strong>in</strong>e katholische Jugendorganisation<br />
veranstaltete e<strong>in</strong>en Ernteumzug, der ausdrücklich mit dem Attribut „altpolnisch“<br />
(staropolski) versehen wurde. 21<br />
So reizvoll es ist, dem Phänomen des Nationalismus auf der Ebene dieser Symbolsprache<br />
nachzugehen, so problematisch ersche<strong>in</strong>t es, auf dieser Gr<strong>und</strong>lage alle<strong>in</strong> Aussagen<br />
über die Realität menschlichen Zusammenlebens treffen zu wollen. 22 Gerade<br />
e<strong>in</strong>e räumlich begrenzte Fallstudie bietet die Chance, Vorgaben e<strong>in</strong>er zentral propagierten<br />
Grenzlandideologie mit der Wirklichkeit vor Ort zu kontrastieren. Den zitierten<br />
St<strong>im</strong>men zeitgenössischer Beobachter ist das Ergebnis e<strong>in</strong>er Oral-History-Studie<br />
aus den Jahren 1991-1993 zur Seite zu stellen. Lediglich Personen, die <strong>im</strong> Erwachsenenalter<br />
<strong>in</strong> die Kreise Flatow <strong>und</strong> Zempelburg gezogen waren, bejahten die Frage, ob<br />
man stets hätte sicher se<strong>in</strong> können, es mit e<strong>in</strong>em Deutschen oder Polen zu tun zu haben.<br />
Altansässige Bewohner bezweifelten dies <strong>und</strong> verwiesen auf Phänomene nationaler<br />
Ambivalenz <strong>und</strong> Indifferenz. 23 Weitere Beispiele fördert e<strong>in</strong>e Durchsicht<br />
schriftlicher Quellen zutage.<br />
In manchen polnischen Dörfern war das standardsprachliche Wort für „Deutsche“<br />
(Niemcy) gänzlich unbekannt <strong>und</strong> statt dessen <strong>im</strong>mer nur von den „Lutherern“ (lutrzy)<br />
die Rede. Die traditionelle Gleichsetzung von Konfession <strong>und</strong> Nationalität führte<br />
zu kommunikativen Situationen, die von Zeitzeugen als amüsant empf<strong>und</strong>en wurden.<br />
So entschuldigte sich etwa e<strong>in</strong>e Deutsche bei ihrem Tanzpartner, e<strong>in</strong>em Lehrer der<br />
polnischen M<strong>in</strong>derheit, daß sie leider nicht „katholisch“ spräche. 24 Die politische<br />
B<strong>in</strong>dungskraft der Konfession trat <strong>in</strong> der Frage des Schulwesens zutage. Zum Leid-<br />
19 Vgl. Gazeta Sępoleńska Nr. 38/15.9.1927, Nr. 115/9.10.1928.<br />
<strong>20</strong> Kreiskommando der Staatspolizei <strong>in</strong> Zempelburg am 24.10.1938 an den Starosten ebenda,<br />
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Sępólnie, Nr. 961.<br />
21 Gazeta Sępoleńska Nr. 74/14.9.1938.<br />
22 Vgl. HEINZ-GERHARD HAUPT <strong>und</strong> CHARLOTTE TACKE: Die Kultur des Nationalen. Sozial-<br />
<strong>und</strong> kulturgeschichtliche Ansätze bei der Erforschung des europäischen Nationalismus <strong>im</strong><br />
<strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>: Kulturgeschichte heute, hrsg. von WOLFGANG HARDTWIG <strong>und</strong><br />
HANS-ULRICH WEHLER, Gött<strong>in</strong>gen 1996 (Geschichte <strong>und</strong> Gesellschaft, Sonderheft 16), S.<br />
255-283, hier besonders S. 267-269.<br />
23 Vgl. MATHIAS NIENDORF: „So e<strong>in</strong> Haß war nicht“. Zeitzeugenbefragungen zum deutschpolnischen<br />
Grenzgebiet der Zwischenkriegszeit, <strong>in</strong>: BIOS 10 (1997), S. 17-33, hier S. 27<br />
mit Anm. 7.<br />
24 KOWALSKI (wie Anm. 9), S. 40.<br />
191
wesen der preußischen Behörden verständigten sich Mitte der <strong>20</strong>er Jahre deutsche<br />
<strong>und</strong> polnische Katholiken auf die Forderung nach Wiedere<strong>in</strong>führung von Konfessionsschulen,<br />
der <strong>in</strong> der Stadt Flatow auch nachgegeben wurde. Der große Zuspruch<br />
der seit 1929 errichteten M<strong>in</strong>derheitsschulen erklärt sich nicht nur durch ihren nationalen,<br />
sondern auch durch ihren dezidiert katholischen Charakter.<br />
Wie sehr die Konfession das Zusammenleben der Bewohner best<strong>im</strong>mte, macht<br />
nicht zuletzt e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> Standesamtsakten <strong>und</strong> Kirchenbücher deutlich. Eheschließungen<br />
zwischen deutschen <strong>und</strong> polnischen Katholiken lassen sich verschiedentlich<br />
nachweisen; konfessionelle Mischehen besaßen dagegen Seltenheitswert. Heiraten<br />
zwischen Protestanten <strong>und</strong> Katholiken erfolgten fast nur <strong>in</strong> der Unterschicht. Die Bedeutung<br />
sozialer <strong>Grenzen</strong> gilt es auch bei den Versuchen nationaler Mobilisierung <strong>im</strong><br />
Auge zu behalten. Im Restkreis Flatow wie <strong>im</strong> Kreis Zempelburg standen deutsche<br />
<strong>und</strong> polnische Organisationen vor Schwierigkeiten, wenn das Vere<strong>in</strong>sleben traditionelle<br />
soziale Barrieren sprengen sollte, wie es der Ideologie e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tegralen Nationalismus<br />
entsprach. Es kam vor, daß sich die Bauern zurückzogen, wenn e<strong>in</strong>e Organisation<br />
von Arbeitern dom<strong>in</strong>iert wurde.<br />
Auch e<strong>in</strong>e der ältesten Formen von Wir-Gruppenbildung, die B<strong>in</strong>dung an den<br />
Wohnort, bewies <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit ihre Beharrungskraft. E<strong>in</strong> Lehrer der<br />
M<strong>in</strong>derheitsschule <strong>in</strong> Blankwitt (B¬eçkwit) w<strong>und</strong>erte sich, warum er auf so wenig Verständnis<br />
stieß, wenn er <strong>in</strong> Flatow be<strong>im</strong> Büro des Polenb<strong>und</strong>es vorsprach. Schließlich<br />
wurde ihm klar, daß dessen Leiter aus e<strong>in</strong>em Nachbardorf stammte, das sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Dauerfehde mit Blankwitt befand. E<strong>in</strong>e ähnlich ausgeprägte lokale Identität verrieten<br />
aber auch e<strong>in</strong>ige deutsche Bewohner des Ortes. Sie zitterten mit „ihrer“ polnischen<br />
Fußballmannschaft <strong>und</strong> waren stolz auf deren Siege: „Sieh e<strong>in</strong>er an, was unser<br />
Blankwitt nicht alles kann.“ 25<br />
E<strong>in</strong>e eigene Untersuchung verdiente die <strong>Institut</strong>ion der Gasthäuser, die zu beiden<br />
Seiten der Grenze als e<strong>in</strong>e Begegnungsstätte von Deutschen <strong>und</strong> Polen fungierten.<br />
Was für die Wirte zählte, war die Zahlungsfähigkeit <strong>und</strong> Konsumbereitschaft ihrer<br />
Gäste. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e konnte auch e<strong>in</strong>e als „Polenfresser<strong>in</strong>“ (polakożerczyni)<br />
bekannte Gasthausbesitzer<strong>in</strong> ihren Saal kostenlos Organisationen der polnischen<br />
M<strong>in</strong>derheit zur Verfügung stellen. In e<strong>in</strong>em mehrheitlich deutsch-katholischen Dorf<br />
des Kreises Zempelburg wiederum hatte der staatstragende Aufständischen- <strong>und</strong><br />
Kriegervere<strong>in</strong> (Towarzystwo Powstańców i Wojaków) Schwierigkeiten bei der Suche<br />
nach e<strong>in</strong>em Versammlungsraum. Als schließlich e<strong>in</strong> Lokal gef<strong>und</strong>en war, mußten die<br />
Mitglieder auf das Anst<strong>im</strong>men der patriotischen „Rota“ verzichten, die ihrer dritten<br />
Strophe wegen von deutscher Seite als Provokation empf<strong>und</strong>en wurde. 26<br />
25 KOWALSKI (wie Anm. 9), S. 56: „Ho, ho – patrzcie, co nasz Błękwit potrafi!“<br />
26 Gazeta Sępoleńska Nr. 30/12.3.1929. Die umstrittene Stelle lautete „Nie będzie Niemiec<br />
plu— nam w twarz“ (Der Deutsche wird uns nicht <strong>in</strong>s Gesicht spucken); vgl. DIONIZA<br />
WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA: Nie rzuc<strong>im</strong> ziemi, skąd nasz ród [Wir lassen nicht die<br />
Erde, von der wir stammen], Warszawa 1988.<br />
192
Wirtshausschlägereien waren der M<strong>in</strong>derheitenpresse wie den Behörden beider<br />
Länder stets e<strong>in</strong>e Meldung wert, sofern e<strong>in</strong> nationaler H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> vermutet werden<br />
konnte. Auch wenn von e<strong>in</strong>er Dunkelziffer auszugehen ist, ersche<strong>in</strong>en die überlieferten<br />
Fälle für e<strong>in</strong>en Zeitraum von zwei Jahrzehnten nicht allzu zahlreich. Besonderes<br />
Interesse verdienen gerade die Situationen, <strong>in</strong> denen es Akteuren vor Ort gelang,<br />
Streitigkeiten beizulegen beziehungsweise Konflikte nicht eskalieren zu lassen.<br />
Ernste Gefahr schien e<strong>in</strong>em deutschen Turnfest zu drohen, das <strong>in</strong> der zweiten<br />
Hälfte der 30er Jahre <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zempelburger Hotel begangen wurde. Kurz vor Beg<strong>in</strong>n<br />
des abendlichen Höhepunkts, dem Tanz, näherte sich dem Saale<strong>in</strong>gang e<strong>in</strong> angetrunkener<br />
Vertreter des Turnvere<strong>in</strong>s „Sokó¬“ (Falke). Auf das Ersuchen des Ordners,<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>ladung zu präsentieren, reagierte er mit dem Satz „Ich b<strong>in</strong> e<strong>in</strong> echter Pole“<br />
<strong>und</strong> unterstrich dieses Bekenntnis mit e<strong>in</strong>er Ohrfeige. Er erhielt die nicht m<strong>in</strong>der<br />
schlagkräftige Antwort: „Und ich b<strong>in</strong> e<strong>in</strong> echter Deutscher“. Das ruhige, entschiedene<br />
Auftreten des Ordners, der sich nicht e<strong>in</strong>schüchtern, aber auch nicht provozieren ließ,<br />
bewegte den Polen schließlich zum E<strong>in</strong>lenken. Auf se<strong>in</strong>en Vorschlag ließen die beiden<br />
Turner ihren nicht nur verbalen Schlagabtausch friedlich bei e<strong>in</strong>em Glas Bier<br />
auskl<strong>in</strong>gen. 27<br />
Konfliktbeilegungen wie diese wurden dadurch erleichtert, daß sich Deutsche <strong>und</strong><br />
Polen nicht <strong>in</strong> geschlossenen Blöcken frontal gegenüberstanden, sondern sich ihre<br />
Lebenswelten vielfach berührten. Insofern kommt dem Vorfall <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kle<strong>in</strong>stadthotel<br />
s<strong>in</strong>nbildhafter Charakter zu. Das Turnfest fand zwar (nicht zuletzt auf behördlichem<br />
Druck) als e<strong>in</strong>e geschlossene Veranstaltung <strong>im</strong> Saal statt, doch schloß dies<br />
nicht aus, daß sich e<strong>in</strong> Deutscher bei anderer Gelegenheit <strong>im</strong> selben Haus zu e<strong>in</strong>em<br />
Polen an die Theke setzte. Die lokalen Konfliktlösungsmechanismen erwiesen sich<br />
allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> dem Maße als überfordert, <strong>in</strong> dem vorhandene nationale Gegensätze<br />
beiderseits der Grenze von Berl<strong>in</strong> aus <strong>in</strong>strumentalisiert wurden. Sie dienten der Legit<strong>im</strong>ierung<br />
sehr viel weitreichenderer Ziele: zunächst des militärischen Angriffs auf<br />
Polen, dann der ideologisch motivierten Vernichtung se<strong>in</strong>er Eliten. Die Erfahrungen<br />
der Jahre 1939-1945 dürfen aber nicht unreflektiert auf e<strong>in</strong>en Zeitraum von zwei<br />
Jahrzehnten zurückprojiziert werden.<br />
So wie die <strong>Grenzen</strong> zweier Staaten besaßen auch die <strong>Grenzen</strong> zwischen zwei<br />
Ethnien lange Zeit nicht die Bedeutung, die ihnen von der deutschen wie der polnischen<br />
Historiographie zugeschrieben wurde. Lokale Identität, konfessionelle Solidarität,<br />
Gesichtspunkte des sozialen Prestiges <strong>und</strong> nicht zuletzt das ökonomische Eigen<strong>in</strong>teresse<br />
stellten gewichtige Größen <strong>im</strong> Alltag dar, die sich dem exklusiven Loyalitätsanspruch<br />
der Nation gegenüber behaupten konnten. Die an e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Ausschnitt<br />
der deutsch-polnischen Grenze gewonnenen Erkenntnisse legen Skepsis gegenüber<br />
Forschungsansätzen nahe, die nicht alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong> antagonistisches Verhältnis zwischen<br />
beiden Nationen, sondern auch diese Großgruppen selbst als „essentielle“ Gegebenheiten<br />
voraussetzen. Die Kritik an der Schwarz-Weiß-Malerei vergangener Jahrzehn-<br />
27 WILLI TRABANT: „Völkerverständigung“ <strong>in</strong> Zempelburg. Turnfest <strong>im</strong> Hotel Wachholz –<br />
Der außergewöhnliche „Höhepunkt“, <strong>in</strong>: Der Westpreuße 1965, Nr. <strong>20</strong>, S. 13.<br />
193
te besitzt ihrerseits bereits Tradition. Zwischentöne nicht nur wahrzunehmen, sondern<br />
auch darzustellen, war bisher vor allem aber e<strong>in</strong>e Domäne schöngeistiger Literatur. 28<br />
Für die Geschichtswissenschaft gibt es <strong>in</strong> der Grenzlandproblematik noch Themen zu<br />
entdecken.<br />
28 Als e<strong>in</strong> Bruch mit der stereotypenhaften Darstellung der polnischen Westgebiete gilt die<br />
1960 preisgekrönte Erzählung von LESZEK PROROK: Wyspiarze [Insulaner], die auf Recherchen<br />
<strong>im</strong> Kreis Flatow beruht; vgl. die kommentierte 3. Aufl. Wrocław 1974.<br />
194
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen –<br />
Bericht über e<strong>in</strong> Projekt<br />
von<br />
Hannelore B u r g e r<br />
Das Thema Grenze ist derzeit von äußerster Aktualität. Der Fall des Eisernen Vorhangs<br />
– e<strong>in</strong>st hermetische Systemgrenze zwischen Ost <strong>und</strong> West –, die seither verstärkt<br />
vor sich gehende Integration Europas (verb<strong>und</strong>en mit e<strong>in</strong>em Verblassen der alten<br />
nationalstaatlichen <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> dem Entstehen e<strong>in</strong>er neuen Außengrenze) sowie<br />
auch die vielbeschworene Globalisierung mit der ihr <strong>in</strong>newohnenden Tendenz zur<br />
Überschreitung jeglicher <strong>Grenzen</strong> haben nicht nur das Bewußtse<strong>in</strong> über die Bedeutung<br />
von <strong>Grenzen</strong> verschärft, sondern auch die wissenschaftliche Forschung zu diesem<br />
Thema stark verändert.<br />
Anders als <strong>in</strong> Frankreich, wo Lucien Febvre <strong>in</strong> der Schule der geographie huma<strong>in</strong>e<br />
stehend auf die Veränderlichkeit der Vorstellung von Grenze seit dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
– <strong>und</strong> ganz besonders seit der französischen Revolution – aufmerksam gemacht hat<br />
(FEBVRE 1988), hat sich die deutschsprachige Geschichtswissenschaft mit der Geschichte<br />
der Grenze bisher kaum befaßt. E<strong>in</strong>ige ältere Arbeiten (RATZEL 1892,<br />
HAUSHOFER 1927) beschwören vor allem geopolitisch-strategische Aspekte der Grenze<br />
oder schreiben ihr geradezu biologische Qualitäten zu. Erst <strong>in</strong> jüngster Zeit s<strong>in</strong>d<br />
Arbeiten erschienen, die sich auch mit den sozio-ökonomischen, sozialpsychologischen<br />
oder symbolisch-kulturellen Aspekten von <strong>Grenzen</strong> befassen (SAURER 1989,<br />
MEDICK 1991, ULBRICH 1991). Bewußt wird jetzt, daß es neben der sichtbaren Grenze,<br />
der Staatsgrenze, <strong>in</strong> jedem Land auch unsichtbare <strong>in</strong>nere <strong>Grenzen</strong> (E<strong>in</strong>he<strong>im</strong>ische/Fremde)<br />
gibt, daß jede Grenze sowohl Inklusion als auch Exklusion bedeutet.<br />
Mit der Existenz <strong>und</strong> dem Werden e<strong>in</strong>er Staatsgrenze engstens verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d Fragen<br />
der Grenzüberwachung, des Paß- <strong>und</strong> Meldewesens, der Staatsbürgerschaft, des<br />
Asylwesens, der E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Auswanderung sowie der Fremdengesetzgebung. Alle diese<br />
Themen wurden von der Geschichtswissenschaft bisher kaum bearbeitet, vor allem<br />
nicht auf die Habsburgermonarchie bezogen, deren Grenz-Landschaft nicht nur wegen<br />
der Wechselfälle der historischen Grenzziehungen, sondern auch wegen der Heterogenität<br />
der ihr zugehörigen Länder, Lebenswelten <strong>und</strong> Bewohner e<strong>in</strong>e äußerst komplexe<br />
war. Diese zu untersuchen war das Vorhaben des vom österreichischen B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Wissenschaft <strong>und</strong> Verkehr <strong>im</strong> Rahmen des Forschungsprogramms<br />
„<strong>Grenzen</strong>loses Österreich“ <strong>in</strong> Auftrag gegebenen dreijährigen Forschungsprojektes:<br />
„<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzüberschreitungen. Die Bedeutung der <strong>Grenzen</strong> für die staatliche<br />
195
<strong>und</strong> soziale Entwicklung des Habsburgerreiches von der Mitte des 18. bis zur Mitte<br />
des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts“.<br />
Die wissenschaftliche Leitung dieses Forschungsprojekts lag <strong>in</strong> den Händen von<br />
Univ. Prof. Dr. Edith Saurer <strong>und</strong> Hofrat Univ. Doz. Dr. Waltraud He<strong>in</strong>dl, von denen<br />
auch die Gr<strong>und</strong>konzeption des Forschungsvorhabens stammte. Zur Mitarbeit am Projekt<br />
gewonnen wurden: Dr. Hannelore Burger (Wien), Dr. Pavel Cibulka (Brünn),<br />
Andrea Geselle (Mailand), Dr. Svjatoslav Pacholkiv (Lemberg), Dr. Zdenka<br />
Stoklásková (Brünn), Mag. Harald Wendel<strong>in</strong> (Wien). Mit ergänzenden Beiträgen vertreten<br />
s<strong>in</strong>d: Dr. Andrea Komlosy <strong>und</strong> Univ. Doz. Milan Hlavačka.<br />
Projektorganisation<br />
Die empirischen Untersuchungen wurden überwiegend <strong>in</strong> folgenden Archiven durchgeführt:<br />
Haus-, Hof- <strong>und</strong> Staatsarchiv (Wien), Österreichisches Staatsarchiv (Wien),<br />
Niederösterreichisches Landesarchiv (Wien), Archiv der Stadt Wien, Geme<strong>in</strong>dearchiv<br />
Perchtoldsdorf, Staatsarchiv Brünn, Zentralstaatsarchiv Prag, Mährisches Landesarchiv<br />
(Brünn), Zentrales Historisches Gebietsarchiv (Lemberg), Staatsarchiv Venedig,<br />
Staatsarchiv Mailand. Zum Austausch der aus den Archivalien gewonnenen Erkenntnisse,<br />
zu Literaturbesprechungen, zur Festsetzung von Forschungsschwerpunkten <strong>und</strong><br />
zur Formulierung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Forschungsperspektive sowie zur Vorstellung<br />
von Teilergebnissen trafen die Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen des Projektes etwa<br />
dre<strong>im</strong>al jährlich zu e<strong>in</strong>em je zweitätigen workshop <strong>in</strong> Wien zusammen. Dazu wurden<br />
auch an anderen Grenzprojekten arbeitende Wissenschaftler <strong>und</strong> Wissenschaftler<strong>in</strong>nen<br />
zu Referaten <strong>und</strong> zum Gedankenaustausch e<strong>in</strong>geladen. Mehrfach wurde das Forschungsprojekt<br />
auf Tagungen <strong>und</strong> Symposien vorgestellt, darunter be<strong>im</strong> Symposium<br />
„Abgrenzung <strong>und</strong> Ausblick“ des Wissenschaftsm<strong>in</strong>isteriums <strong>in</strong> Wien <strong>im</strong> Oktober<br />
1996, am Collegium Budapest, <strong>Institut</strong>e for Advanced Study 1997 <strong>und</strong> be<strong>im</strong> 2. Bohemistentreffen<br />
des Collegium Carol<strong>in</strong>um <strong>in</strong> München 1998. E<strong>in</strong> dreibändiger Endbericht<br />
liegt seit April 1998 vor, dessen Drucklegung (<strong>im</strong> Böhlau Verlag, Wien) gegenwärtig<br />
vorbereitet wird. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sowie das fertiggestellte<br />
Buch sollen (<strong>im</strong> Frühjahr <strong>20</strong>00) bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>ternationalen Symposium <strong>in</strong> Wien<br />
zum Thema „<strong>Grenzen</strong>“ vorgestellt werden.<br />
Die oben angesprochene Vielschichtigkeit des Themas Grenze, das nicht nur historisch-politisch,<br />
sondern auch philosophisch, sozialpsychologisch, sozio-ökonomisch<br />
abgehandelt werden kann, machte von vornhere<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zeitliche, räumliche <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>haltliche „Begrenzung“ sowie e<strong>in</strong>e Schwerpunktsetzung auf best<strong>im</strong>mte Aspekte –<br />
die nach Durchsicht des vorhandenen Archivmaterials erfolgte – erforderlich:<br />
zeitlich: ca. 1750 bis 1850 (1867)<br />
räumlich: die nordöstliche sowie die südliche Staatsgrenze der Habsburgermonarchie,<br />
196
B<strong>in</strong>nengrenzen: Landesgrenzen, Zollgrenzen, Diözesangrenzen,<br />
Kreisgrenzen, Herrschaftsgrenzen, andere <strong>in</strong>nere <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>in</strong>haltlich: Paßwesen, Staatsbürgerschaft, Armenrecht, He<strong>im</strong>atrecht, Schub,<br />
Fremdenrecht, Aus- <strong>und</strong> E<strong>in</strong>wanderung, Grenze<strong>in</strong>richtung, Grenzbewachung,<br />
Lebenswelten an der Grenze<br />
staatsrechtlich: Gesetzliche Entwicklung, Entwicklung von Adm<strong>in</strong>istrativverfahren<br />
sozial- Bedeutung von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> Alltag, lebensweltliche Perspektipsychologisch:<br />
ven, Veränderung mentaler Strukturen, Fremdse<strong>in</strong>, Personse<strong>in</strong>, Verschiebung<br />
von Zugehörigkeiten, Nationsbewußtse<strong>in</strong>, Staatsbewußtse<strong>in</strong><br />
philosophisch: begriffsgeschichtliche, semiotische, phänomenologische, sozialphilosophische<br />
Ansätze.<br />
Im folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse aus den e<strong>in</strong>zelnen Forschungsschwerpunkten<br />
zusammengefaßt werden:<br />
Das Paßwesen<br />
Das Paßwesen ist e<strong>in</strong>e staatliche Hoheitsfunktion par excellence. Moderne Staatstheoretiker<br />
sehen es als e<strong>in</strong> Mittel legit<strong>im</strong>er Herrschaft (Max Weber). Hannelore Burger<br />
versteht es zugleich als „Ausdruck der Kultur e<strong>in</strong>es Staates“, se<strong>in</strong>er Gastlichkeit, se<strong>in</strong>es<br />
Umgangs mit den Fremden, dabei br<strong>in</strong>gt sie die Entstehung des modernen Paßwesens<br />
<strong>in</strong> Zusammenhang mit dem Problem „personaler Identität“ – e<strong>in</strong>em zentralen<br />
Topos der Philosophie der Aufklärung. So führten die polizeilichen Strategien der<br />
Identifizierung – die <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Entstehung des Paßwesens beschrieben<br />
werden – gewollt oder ungewollt zur Anerkennung e<strong>in</strong>es Individuums als Person.<br />
Das Paßwesen erweist sich – wie so viele andere Bereiche auch – als e<strong>in</strong> vergessener<br />
Aspekt österreichischer Staatlichkeit. Zwischen 1752 <strong>und</strong> 1857 (dem Ersche<strong>in</strong>en<br />
des ersten österreichischen Paßgesetzes) existierte es <strong>in</strong> H<strong>und</strong>erten von E<strong>in</strong>zeldekreten<br />
repetitiven, aufhebenden, manchmal kontradiktorischen Charakters mit unterschiedlichem<br />
Geltungsbereich. Ebenso verwirrend <strong>und</strong> widersprüchlich erschienen<br />
die Kompetenzen der paßerteilenden Behörden. Dennoch lassen sich e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong>e<br />
Gr<strong>und</strong>sätze des österreichischen Paßwesens formulieren:<br />
das utilitaristische Pr<strong>in</strong>zip:<br />
Die Trennung zwischen aus der Sicht des Staates nützlichen <strong>und</strong><br />
unnützen Reisen wird schon <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Circular Maria Theresias aus<br />
dem Jahr 1752 deutlich. Die joseph<strong>in</strong>ische Gesetzgebung verstärkt<br />
diese Tendenz. So postuliert das Auswanderungspatent von 1784<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich Reisefreiheit, sofern die angestrebte Reise nicht<br />
Auswanderung bezweckte, staatsfe<strong>in</strong>dliche Ziele verfolgte oder<br />
197
Luxusbedürfnissen diente. Den für Handel <strong>und</strong> Wandel notwendigen<br />
Zielen sollte <strong>in</strong>des ke<strong>in</strong> H<strong>in</strong>dernis <strong>in</strong> den Weg gelegt werden.<br />
Trotz aller veränderlichen Variablen <strong>in</strong> Kriegs- <strong>und</strong> Friedenszeiten,<br />
Revolutions- <strong>und</strong> Umbruchsepochen sollte sich diese Trennung<br />
zwischen „nützlichen“ <strong>und</strong> „unnützen“ Reisen als dauerndes Element<br />
absolutistischer Paßpolitik erweisen.<br />
das Pr<strong>in</strong>zip der Evidenzhaltung:<br />
Kontrolle über die Bewegung der Bevölkerung <strong>im</strong> Raum zu erlangen,<br />
ihre unkontrollierte Ab- <strong>und</strong> Zuwanderung, ihr Herumvagieren,<br />
ihre Flucht vor Konskription <strong>und</strong> Wehrdienst zu verh<strong>in</strong>dern<br />
wird mit dem E<strong>in</strong>setzen der Kreisämter <strong>und</strong> Polizeidirektionen zur<br />
zentralen Aufgabe staatlicher Instanzen. Das Evidenzpr<strong>in</strong>zip ist<br />
engstens mit der Territorialstaatswerdung verb<strong>und</strong>en. Im Bereich<br />
des Paßwesens bedeutet es: Vorschreibung von Paßprotokollbüchern,<br />
zeitlich <strong>und</strong> örtlich befristete Vergabe von Pässen, Vidierungspflicht,<br />
geb<strong>und</strong>ene Marschrouten, Kautionen, Rückzitationen,<br />
Strafen bei unerlaubtem Fernbleiben (Verlust des Vermögens, der<br />
Staatsbürgerschaft).<br />
das Pr<strong>in</strong>zip der Steuerung:<br />
Das Paßwesen erweist sich – zusammen mit der Zollpolitik – als<br />
e<strong>in</strong> wichtiges Fe<strong>in</strong>steuerungs<strong>in</strong>strument des absolutistischen Staates<br />
<strong>im</strong> H<strong>in</strong>blick auf gesellschaftpolitische oder ökonomische Zielsetzungen<br />
(Merkantilismus, Physiokratismus, Populationspolitik<br />
bis h<strong>in</strong> zur neoabsolutistischen Freihandelspolitik). Paßerteilung<br />
geschieht dabei <strong>im</strong>mer <strong>im</strong> Modus von Inklusion <strong>und</strong> Exklusion, ist<br />
Mittel von Privilegierung <strong>und</strong> Diskr<strong>im</strong><strong>in</strong>ierung.<br />
Untersucht wurde die Paßpolitik gegenüber verschiedenen Gruppen: dem Adel,<br />
den Beamten, den Händlern <strong>und</strong> Handwerkern, den Geistlichen <strong>und</strong> Studenten, den<br />
Ärzten <strong>und</strong> Künstlern, den Bettlern <strong>und</strong> Vaganten, den E<strong>in</strong>he<strong>im</strong>ischen <strong>und</strong> Fremden,<br />
Inländern <strong>und</strong> Ausländern, gegenüber Männern <strong>und</strong> Frauen. Die Ergebnisse s<strong>in</strong>d<br />
überaus komplex, manchmal muten sie geradezu paradox an. Paßrechtlich privilegierte<br />
s<strong>in</strong>d – nach Hannelore Burger –: wandernde Handwerksgesellen, Händler <strong>und</strong><br />
Großhändler, Adlige über 28 Jahre, Studierende der protestantischen Theologie, Frauen,<br />
wenn sie eigenberechtigt waren <strong>und</strong> <strong>in</strong>sofern sie ke<strong>in</strong>e Erlaubnis der Wehrbehörde<br />
benötigten. Zu den paßrechtlich diskr<strong>im</strong><strong>in</strong>ierten Gruppen gehören: alle wehrpflichtigen<br />
Männer, nichteigenberechtigte Frauen, Adlige unter 28 Jahren, „jakob<strong>in</strong>ischer<br />
Umtriebe“ verdächtige Handwerksgesellen, Studenten, Priester, Pilger, Ordensleute,<br />
Ärzte <strong>und</strong> W<strong>und</strong>ärzte, „schlechtges<strong>in</strong>nte <strong>und</strong> bedenkliche“ Fremde (Emigranten,<br />
fremde Priester, potentielle Revolutionäre) sowie die Kategorie der „bedenklichen<br />
Menschen überhaupt“. Hannelore Burger zeigt, daß es gerade diese seltsame Gruppe<br />
der bedenklichen Menschen überhaupt (zu ihr gehören nicht nur politisch verdächtige<br />
Ausländer, sondern auch Künstler, Komödianten, Gaukler, mit Tieren herumziehende<br />
198
Schausteller – alles „fahrende Volk“) ist, die durch ihr ständiges Unterlaufen des Gebots<br />
der Seßhaftigkeit, durch ihr Heraustreten aus dem engen Kreis der He<strong>im</strong>at (Außer-Kreis-gehen),<br />
durch ihr „Vazieren“ <strong>und</strong> „Herumstürzen <strong>in</strong> Lande“ erheblich zur<br />
Territorialstaatswerdung beitrug. Indem sie den Staat zwangen, auf ihre <strong>im</strong>mer schon<br />
verdächtige Bewegung mit <strong>im</strong>mer subtileren Paßverordnungen zu reagieren, wurden<br />
die „bedenklichen Menschen“ contre cœur zum Mitschöpfer e<strong>in</strong>es bedeutenden Instruments<br />
des modernen Flächenstaates: des Reisepasses. Entlang der zentralen Begriffe:<br />
Kompetenz, Evidenz, Egalisierung <strong>und</strong> Kontrolle wird weiters die staatsrechtliche<br />
Entwicklung des österreichischen Paßwesens dargestellt. Illustrative Fallgeschichten<br />
machen die oft kontradiktorischen Zielsetzungen des Staates deutlich: Verpolizeilichung<br />
<strong>und</strong> Überwachung vs. Gleichförmigkeit <strong>und</strong> Beschleunigung.<br />
E<strong>in</strong> eigener Beitrag beschäftigt sich mit dem Lombardo-Venezianischen Paßwesen<br />
mit se<strong>in</strong>er häufig vom übrigen österreichischen Paßsystem abweichenden Praxis. Andrea<br />
Geselle zeichnet <strong>in</strong> ihrem Beitrag „Bewegung <strong>und</strong> ihre Kontrolle <strong>in</strong> Lombardo-<br />
Venetien“ vor allem den nachhaltigen E<strong>in</strong>fluß der französischen Gesetzgebung seit<br />
der Zeit der napoleonischen Kriege nach <strong>und</strong> zeigt anhand des Studiums von Archivalien<br />
des venezianischen Staatsarchivs auf, wie h<strong>in</strong>dernisreich der Weg war, die Verwaltung<br />
der italienischen Länder – nach dem Willen Kaiser Franz I. – „auf österreichischen<br />
Fuß“ zu stellen. Nach ihren Untersuchungen über die Akzeptanz der neuen<br />
<strong>Grenzen</strong> – das überreiche Archivmaterial beleuchtet sowohl die Situation der grenzüberschreitenden<br />
Menschen wie auch die besonderen Probleme der Adm<strong>in</strong>istration –<br />
war das erst knapp vor der bürgerlichen Revolution von 1848 der Fall. Doch trotz der<br />
zu diesem Zeitpunkt vollständigen adm<strong>in</strong>istrativen E<strong>in</strong>gliederung der italienischen<br />
Länder <strong>in</strong> die österreichische Monarchie blieb Lombardo-Venetien aus vielen Gründen<br />
e<strong>in</strong> Sonderfall. Beispielsweise führte die schon <strong>in</strong> der Zeit der französischen Besatzung<br />
e<strong>in</strong>geführte <strong>und</strong> unter der österreichischen Herrschaft beibehaltene Carta<br />
d’iscrizione – e<strong>in</strong> System der allgeme<strong>in</strong>en Ausweispflicht – zu e<strong>in</strong>er stärker ortsbezogenen<br />
Identität. Der <strong>in</strong> den italienischen Ländern <strong>im</strong>mer schon dichtere Handels- <strong>und</strong><br />
Reiseverkehr sowie der aus der besonderen politischen Situation unklar bleibende<br />
Status Lombardo-Venetiens als Inland/Ausland brachte <strong>in</strong> der alltäglichen Praxis des<br />
Paßwesens zahllose Probleme mit sich. Liberalismus, Eisenbahnwesen <strong>und</strong> Dampfschiffahrt<br />
führen jedoch auch hier zu e<strong>in</strong>em Modernisierungsschub <strong>und</strong> br<strong>in</strong>gen am<br />
Ende e<strong>in</strong>es der dichtesten <strong>und</strong> komplexesten Paßsysteme Europas zu Fall (nach dem<br />
Anschluß Österreichs an den Deutschen Paßkartenvere<strong>in</strong> entfällt 1859 die „Vidierung<br />
<strong>im</strong> Innern“). Stufenweise werden alle Inlandspässe abgeschafft. 1865 entfällt auch die<br />
Paßkontrolle an den österreichischen Außengrenzen. Damit wird bis zum Ersten<br />
Weltkrieg paßlose Grenzüberschreitung <strong>in</strong> großen Teilen Europas möglich (die großen<br />
Ausnahmen blieben Rußland <strong>und</strong> Frankreich). In den italienischen Ländern der<br />
Habsburgermonarchie wurden diese Reformen enthusiastisch aufgenommen – sie<br />
kamen allerd<strong>in</strong>gs viel zu spät, um hier noch wirksam zu werden.<br />
199
Die Staatsbürgerschaft<br />
Zu den erwähnten unsichtbaren <strong>in</strong>neren <strong>Grenzen</strong> gehört zweifellos auch die Staatsbürgerschaft.<br />
In der öffentlichen Debatte <strong>und</strong> <strong>in</strong> zahlreichen Arbeiten wird gegenwärtig<br />
auf die Problematik der unterschiedlichen Konzeptionen der europäischen Staatsbürgerschaftsmodelle<br />
h<strong>in</strong>gewiesen <strong>und</strong> – nicht zuletzt aus der Notwendigkeit, e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>same europäische (Staats)Bürgerschaft zu entwickeln – auf die bestehenden<br />
Antagonismen zwischen dem ius soli <strong>und</strong> dem ius sangu<strong>in</strong>is aufmerksam gemacht<br />
(HABERMAS 1982, FERRY 1994, BRUBAKER 1994). Hannelore Burger zeigt – nach e<strong>in</strong>er<br />
begriffsgeschichtlichen Analyse des semantischen Feldes „Staatsbürgerschaft“ <strong>im</strong><br />
altösterreichischen Kontext –, daß von dem e<strong>in</strong>en Modell österreichischer Staatsbürgerschaft<br />
nicht gesprochen werden kann. Entsprechend den Veränderungen des politischen<br />
Systems – vom Reformabsolutismus der joseph<strong>in</strong>ischen Epoche über Frühkonstitutionalismus<br />
<strong>und</strong> Neoabsolutismus bis h<strong>in</strong> zum differenzialistischen Konstitutionalismus<br />
der Ausgleichsepoche – unterliegt es vielmehr e<strong>in</strong>er ständigen Transformation:<br />
Das territorial best<strong>im</strong>mte Modell des joseph<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>wanderungsstaates wird <strong>im</strong><br />
vollendeten Absolutismus Metternichscher Prägung abgelöst durch das voluntaristische<br />
Modell (Willenserklärung statt stillschweigender oder ipso facto-E<strong>in</strong>bürgerung),<br />
es folgt die neoabsolutistische „Reichsbürgerschaft“ (1849) <strong>und</strong> schließlich die „allgeme<strong>in</strong>e<br />
österreichische Staatsbürgerschaft“ nach dem Staatsgr<strong>und</strong>gesetz von 1867.<br />
Dennoch lassen sich e<strong>in</strong>ige dauerhafte Elemente – Elemente e<strong>in</strong>er longue durée – <strong>im</strong><br />
altösterreichischen Staatsbürgerrecht ausmachen. Als solche erwiesen sich:<br />
• E<strong>in</strong> trotz des nach 1811 dom<strong>in</strong>ant werdenden Abstammungspr<strong>in</strong>zips (ius sangu<strong>in</strong>is)<br />
starkes territoriales Element (ius soli), das sich u.a. <strong>in</strong> der anhaltenden Bedeutung<br />
des 10jährigen Wohnsitzes als Erwerbsgr<strong>und</strong> der Staatsbürgerschaft wie des<br />
He<strong>im</strong>atrechtes zeigt.<br />
• Die starke Determ<strong>in</strong>iertheit der österreichischen Staatsbürgerschaft durch das Privatrecht<br />
(die §§ 28-31 des ABGB bilden bis zum Ende der Monarchie den Kern<br />
des Staatsbürgerschaftsrechtes) bed<strong>in</strong>gte, daß die Elemente des bürgerlichen<br />
Rechts: Gleichbehandlung, Freiwilligkeit <strong>und</strong> Vertragsfreiheit – zum<strong>in</strong>dest als<br />
Versprechen – <strong>in</strong> dieser enthalten waren.<br />
• E<strong>in</strong> aus der Zeit der Kodifizierung des bürgerlichen Rechts stammendes, naturrechtlich<br />
begründetes weltbürgerliches Element, das gr<strong>und</strong>sätzlich jedem die<br />
Staatsbürgerschaft zubilligte, der sich „ke<strong>in</strong>es Verbrechens schuldig“ gemacht hatte<br />
(Franz v. Zeiller). Dieses weltbürgerliche Element hatte zur Konsequenz, daß<br />
Sprache, Religion <strong>und</strong> Kultur ke<strong>in</strong>e wesentlichen Kriterien der österreichischen<br />
Staatsbürgerschaft bildeten.<br />
Anhand von jüngst rekonstruierten Akten der Hofkanzlei verfolgt Hannelore Burger<br />
die Geschichte des Adm<strong>in</strong>istrativverfahrens der Staatsbürgerschaftserteilung seit<br />
<strong>in</strong> Kraft treten des Allgeme<strong>in</strong>en Bürgerlichen Gesetzbuches <strong>im</strong> Jahr 1812. In e<strong>in</strong>igen<br />
Fällen gelang es, den jeweiligen Anlaß für bedeutende gesetzliche Änderungen (Aufhebung<br />
der zehnjährigen Ersitzung, allgeme<strong>in</strong>e Willenserklärung <strong>und</strong> Eidesleistung)<br />
<strong>20</strong>0
<strong>im</strong> Staatsbürgerschaftsrecht aufzuspüren. Dargestellt werden – anhand der gesetzlichen<br />
Entwicklung sowie illustrativer Fallbeispiele – die verschiedenen Arten des Erwerbs<br />
<strong>und</strong> Verlustes der österreichischen Staatsbürgerschaft (Eheschließung, Gewerbeantritt,<br />
Diplomerlangung, E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den öffentlichen Dienst, Annahme fremder<br />
Dienste, E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Auswanderung etc.). Empirische Daten liegen für Niederösterreich/Wien<br />
zwischen 1813 <strong>und</strong> 1843 vor. Im Abstand e<strong>in</strong>es Dezenniums konnten<br />
Aussagen über Herkunft, Geschlecht, Beruf, Stand, Konfession, „Moralität“, Dauer<br />
des Aufenthalts sowie Zahl der E<strong>in</strong>gebürgerten <strong>und</strong> der Ablehnungen gemacht werden.<br />
Für das Jahr 1833 etwa zeigt sich das Bild e<strong>in</strong>es biedermeierlich-vormärzlichen<br />
Wiens mit e<strong>in</strong>em hohen Bedarf an gut ausgebildeten Handwerkern (was sich <strong>in</strong> relativ<br />
kurzen E<strong>in</strong>bürgerungszeiten niederschlägt). Weiters wird deutlich, daß der Erwerb der<br />
Staatsbürgerschaft <strong>im</strong> allgeme<strong>in</strong>en mit positiven Lebensveränderungen korreliert – <strong>im</strong><br />
weitesten S<strong>in</strong>ne ersche<strong>in</strong>t er als Indikator für Aufstieg <strong>und</strong> Erfolg (Gewerbegründung,<br />
Eheschließung, Diplomerlangung). Besondere Aufmerksamkeit wurde der Staatsbürgerschaft<br />
der Frau gewidmet. Die empirischen Untersuchungen (<strong>im</strong> Jahr 1833 lag der<br />
Anteil der e<strong>in</strong>gebürgerten Frauen bei 26 %) korrigieren e<strong>in</strong> wenig das Klischee von<br />
der unmündigen, abhängigen, erwerbslosen Frau, die die Staatsangehörigkeit nur auf<br />
dem Wege der sogenannten familienrechtlichen Tatsachen erwirbt, wie es die theoretische<br />
Literatur zur Staatsbürgerschaft evoziert. E<strong>in</strong>zelne Fallbeispiele aus den E<strong>in</strong>bürgerungsakten<br />
des Niederösterreichischen Landesarchivs belegen überdies, daß<br />
Frauen nicht nur eigenberechtigt die Staatsbürgerschaft begehrten <strong>und</strong> auch erhielten,<br />
daß sie selbständig den Untertaneneid ablegten, sondern auch, daß Frauen mit der<br />
Eheschließung ke<strong>in</strong>eswegs <strong>im</strong>mer bereitwillig die fremde Staatsbürgerschaft annahmen<br />
bzw. die eigene aufgaben.<br />
Die Reichsbürgerschaft des Neoabsolutismus (nach der Märzverfassung von<br />
1849) bedeutete – nach Hannelore Burger – <strong>in</strong> vieler H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong>e staatsrechtliche<br />
<strong>und</strong> – vermittels ihrer engen Kopplung an das He<strong>im</strong>atrecht – auch ökonomische<br />
Schließung des österreichischen Kaiserstaates. Aus liberaler Sicht wurde die allgeme<strong>in</strong>e<br />
Reichsbürgerschaft (die zuerst auch Ungarn e<strong>in</strong>schloß) als e<strong>in</strong> Fortschritt, als<br />
Wende h<strong>in</strong> zum modernen Verfassungsstaat gerühmt. Für langjährig ansässige, nichthe<strong>im</strong>atberechtigte<br />
Fremde sowie auch für Frauen bedeutete sie allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e Verschlechterung<br />
ihrer staatsrechtlichen Position, da erst jetzt die Unterscheidung zwischen<br />
aktivem <strong>und</strong> passivem Bürgerstatus wirksam wird. Die staatsrechtliche Situation<br />
nach dem Ausgleich 1867 führte auch <strong>im</strong> Staatsbürgerschaftsrecht zu e<strong>in</strong>er überaus<br />
komplexen Situation. Das österreichische (cisleithanische) <strong>und</strong> das ungarische<br />
(transleithanische) Staatsbürgerschaftsrecht waren nur wenig mite<strong>in</strong>ander kompatibel<br />
<strong>und</strong> brachten – vor allem für die Angehörigen der Behörden beider Reichsteile – zahlreiche<br />
Probleme mit sich. Die Rufe nach e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen allgeme<strong>in</strong>en „Reichsbürgerschaft“<br />
wurden zuletzt <strong>im</strong>mer lauter. Im wesentlichen blieben sie ungehört.<br />
Doch führten – wie Hannelore Burger zeigt – diese staatsrechtlichen „Kuriosa“ – wie<br />
auch das Weiterbestehen von Inkolat <strong>und</strong> Indigenat, Schutzbürgern <strong>und</strong> anderen gemischten<br />
Staatsbürgern – sowie die Besonderheiten e<strong>in</strong>es staatlichen Gebildes, das<br />
nur langsam zu e<strong>in</strong>em Territorialstaat zusammenwuchs <strong>und</strong> mit se<strong>in</strong>en heterogenen<br />
<strong>20</strong>1
Strukturen wenig dem Idealbild e<strong>in</strong>es modernen Nationalstaats entsprach, notwendig<br />
zu e<strong>in</strong>er eher differenzialistischen Praxis der Staatsbürgerschaftserteilung, die dem<br />
altösterreichischen Rechtspragmatismus überhaupt entsprach. Gerade diese Heterogenität<br />
<strong>und</strong> die – wenn auch nicht <strong>im</strong>mer freiwillig geübte – Politik der Anerkennung<br />
der Differenz macht das altösterreichische Modell der Staatsbürgerschaft für die Debatte<br />
um die europäische (Staats)Bürgerschaft besonders <strong>in</strong>teressant.<br />
Der Schub<br />
In engem Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft, mehr aber noch mit dem He<strong>im</strong>atrecht<br />
(„politisches Domicil“) sowie mit der staatlichen Armenfürsorge steht der<br />
Schub. Harald Wendel<strong>in</strong> versteht den Schub als e<strong>in</strong>e Praxis, Kontrolle über die Bewegung<br />
der Bevölkerung <strong>im</strong> Raum zu gew<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> – entsprechend der joseph<strong>in</strong>ischen<br />
Auffassung vom Wohlfahrtsstaat – „jedem Individuum se<strong>in</strong>en Platz“ zuzuweisen.<br />
In Ause<strong>in</strong>andersetzung mit den Theorien Michel Foucaults <strong>und</strong> Michel de Certeaus<br />
wird der Schub gesehen e<strong>in</strong>erseits als Instrument der Herstellung e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zigen<br />
„Diszipl<strong>in</strong>arraums“ (<strong>im</strong> großen Prozeß der Entstehung e<strong>in</strong>es neuen Herrschaftsraums:<br />
des modernen Territorialstaates) <strong>und</strong> andererseits als Ort, wo durch „die Kunst des<br />
Handelns“, durch best<strong>im</strong>mte Alltagspraktiken, durch Strategie <strong>und</strong> Taktik der Betroffenen<br />
ständig „Raum“ zurückgewonnen wird. Am Beispiel mehrerer exakt rekonstruierter<br />
Schubfälle zeigt Harald Wendel<strong>in</strong>, wie es e<strong>in</strong>igen Schübl<strong>in</strong>gen <strong>im</strong>mer wieder<br />
gelang, an den Ort, von dem sie weggeschoben worden waren, zurückzukehren. Der<br />
besonders <strong>in</strong>struktive Fall des 75jährigen Josef Weibel, der 1822 zwischen Perchtoldsdorf<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>em mutmaßlichen Geburtsort am Bodensee <strong>in</strong> Vorderösterreich ergebnislos<br />
h<strong>in</strong>- <strong>und</strong> hergeschoben wurde, beleuchtet die ganze Problematik des Schubes:<br />
höchste bürokratische Effizienz <strong>im</strong> Interesse der Durchsetzung des He<strong>im</strong>atpr<strong>in</strong>zips<br />
<strong>und</strong> der Armenfürsorge, gepaart mit e<strong>in</strong>er ungeheuren Verschwendung von Ressourcen<br />
bei letztlich dürftigem Erfolg. Das reiche Material über den Schub – Harald<br />
Wendel<strong>in</strong> analysierte sowohl die Protokolle des „Partikularschubes“ wie auch des sogenannten<br />
„Wiener Hauptschubs“, der vierzehntägig von der Haupt- <strong>und</strong> Residenzstadt<br />
über best<strong>im</strong>mte Schubstrecken <strong>in</strong> alle Landesteile der Monarchie durchgeführt<br />
wurde, darüber h<strong>in</strong>aus die Schublisten des Geme<strong>in</strong>dearchivs von Perchtoldsdorf – erlaubt<br />
neue Aufschlüsse über e<strong>in</strong>e andere Art des „Reisens“, über Armut, die zweifelhafte<br />
Bedeutung von „He<strong>im</strong>at“, über Fremdse<strong>in</strong>, nicht zuletzt aber auch die erstaunliche<br />
Mobilität armer <strong>und</strong> ärmster Bevölkerungsschichten.<br />
Fremdse<strong>in</strong><br />
Wie schon <strong>im</strong> Kapitel über He<strong>im</strong>atrecht, Armenversorgung <strong>und</strong> Schub deutlich wurde,<br />
war die Kategorie des Fremdse<strong>in</strong>s ke<strong>in</strong>eswegs mit dem Ausländerstatus identisch.<br />
Fremd <strong>im</strong> engeren S<strong>in</strong>n waren schon diejenigen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de oder e<strong>in</strong>er<br />
<strong>20</strong>2
Stadt nicht das He<strong>im</strong>atrecht besaßen. Die Grenze zwischen E<strong>in</strong>he<strong>im</strong>isch- <strong>und</strong> Fremdse<strong>in</strong><br />
verlief also häufig quer durch e<strong>in</strong>en Ort. Die besondere Situation der Fremden <strong>in</strong><br />
den böhmischen Ländern beleuchtet Zdenka Stoklásková <strong>in</strong> ihrem Beitrag „Fremdse<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> Böhmen <strong>und</strong> Mähren“. Nach e<strong>in</strong>em Exkurs durch die Geschichte des Fremdenrechts<br />
stellt sie fest, daß Fremde <strong>in</strong> den böhmischen Ländern zu allen Zeiten e<strong>in</strong>e große<br />
Rolle gespielt <strong>und</strong> die böhmische Kultur stark geprägt haben. Doch der Status der<br />
Fremden differierte über die Jahrh<strong>und</strong>erte außerordentlich. Waren Fremde <strong>im</strong> Mittelalter<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der frühen Neuzeit als Kolonisten hochwillkommen, <strong>im</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
aufgr<strong>und</strong> der vorherrschenden Populationstheorie geschätzte E<strong>in</strong>wanderer, so wurde<br />
nach der Französischen Revolution das Mißtrauen gegen Fremde <strong>im</strong>mer stärker. Zu<br />
allen Zeiten aber wurde unterschieden zwischen nützlichen <strong>und</strong> schädlichen – <strong>in</strong> der<br />
Term<strong>in</strong>ologie des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts: „unbedenklichen <strong>und</strong> gutges<strong>in</strong>nten“ <strong>und</strong> „bedenklichen<br />
<strong>und</strong> schlechtges<strong>in</strong>nten“ – Fremden. Zdenka Stoklásková untersucht akribisch<br />
die rechtliche Situation begünstigter <strong>und</strong> benachteiligter Fremder: Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong><br />
Emigranten, türkische Handelsleute, fremde Juden, fremde Militärangehörige, fremde<br />
Hausierer, Kurort- <strong>und</strong> Badegäste, fremde Kranke, fremde Vaganten, Musikanten ...<br />
Das zeitgenössische Fremdenrecht entfaltet sich vor uns <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „Tableau“ von<br />
Identitäten <strong>und</strong> Unterschieden. Durch <strong>im</strong>mer fe<strong>in</strong>ere Unterscheidungen, durch e<strong>in</strong>e<br />
strenge Kategorisierung <strong>und</strong> Klassifizierung versuchte man – nicht zuletzt durch e<strong>in</strong><br />
ausgefeiltes Paßrecht <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e strenge Evidenz – die Angst vor dem Fremden zu bannen.<br />
Anhand e<strong>in</strong>zelner Aktenstücke des mährischen Landesarchivs gel<strong>in</strong>gt es, das besondere<br />
Schicksal etwa e<strong>in</strong>es französischen Geistlichen Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts bei<br />
se<strong>in</strong>er Odyssee durch Mähren oder – am anderen Ende der Skala – das kokette Spiel<br />
e<strong>in</strong>er niederländischen Emigrant<strong>in</strong> mit den Behörden sichtbar zu machen. E<strong>in</strong>e andere<br />
Art des „Fremdse<strong>in</strong>s“ wird <strong>in</strong> der Analyse der Fabrik- <strong>und</strong> Lohnarbeiterprotokolle des<br />
Brünner Polizeipräsidiums deutlich. Anhand dieser umfangreichen Quelle, <strong>in</strong> der alle<br />
Personen erfaßt waren, die <strong>in</strong> Brünn arbeiteten, aber nicht he<strong>im</strong>atberechtigt waren,<br />
zeigt Zdenka Stoklásková, daß der Begriff „He<strong>im</strong>at“ für <strong>im</strong>mer mehr Arme zur bloßen<br />
Fiktion wurde, da die enge Auslegung der he<strong>im</strong>atrechtlichen Best<strong>im</strong>mungen –<br />
besonders seitens der großen Städte – ab Mitte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts verh<strong>in</strong>derte, daß<br />
mittellose Personen das He<strong>im</strong>atrecht <strong>in</strong> ihrer Wohngeme<strong>in</strong>de erlangten. E<strong>in</strong> wieder<br />
anderer Fremdheitsbegriff spiegelt sich <strong>in</strong> dem wider, was <strong>in</strong> der tschechischen Geschichtsforschung<br />
unter dem Schlagwort „Kont<strong>in</strong>uitätstheorie“ seit Generationen diskutiert<br />
wird. Zdenka Stokláskovás Interesse ist es nicht, diesen – letztlich wohl müßigen<br />
– Streit zu entscheiden, sondern darauf h<strong>in</strong>zuweisen, daß es unabhängig vom realen<br />
Status des Fremden auch e<strong>in</strong> Gefühl des Ewig-fremd-Bleibens geben kann, welches<br />
<strong>im</strong> Bewußtse<strong>in</strong> der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Land zusammenlebenden verschiedenen Ethnien<br />
sogar über Jahrh<strong>und</strong>erte vorhanden se<strong>in</strong> <strong>und</strong> unter Umständen e<strong>in</strong>e gefährliche<br />
Sprengkraft entfalten kann.<br />
Grenze als „Lebenswelt“<br />
<strong>20</strong>3
Untersucht wurde e<strong>in</strong>erseits die (nach 1815) südliche Staatsgrenze zwischen Lombardo-Venetien<br />
<strong>und</strong> dem Kirchenstaat (Andrea Geselle) <strong>und</strong> andererseits die nordöstliche<br />
Staatsgrenze zwischen Galizien <strong>und</strong> Rußland (Svjatoslav Pacholkiv). Dabei stellen<br />
beide Autoren fest, daß die Staatsgrenze für die Grenzbewohner selbst erheblich<br />
leichter passierbar war als für andere Reisende. Paßloses – legales wie illegales –<br />
Überqueren der Grenze war lange Zeit möglich, <strong>in</strong>sbesondere für jene, die den Grenzwachen<br />
persönlich bekannt waren. Erst durch die rigorose Durchsetzung e<strong>in</strong>er lückenlosen<br />
Evidenzhaltung der Bevölkerung, die den Zweck hatte, unkontrollierte Abwanderungen,<br />
Flucht vor Konskription <strong>und</strong> Wehrdienst zu verh<strong>in</strong>dern, bekam die Staatsgrenze<br />
Bedeutung auch für die <strong>in</strong> der besonderen „Lebenswelt Grenze“ ansässige Bevölkerung.<br />
Dementsprechend wurden Fragen des lokalen Grenzverkehrs <strong>und</strong> die Regelung<br />
der sogenannten „Grenzzone“ allmählich zum Bestandteil bilateraler Grenzverträge,<br />
aus denen sich allmählich die völkerrechtlichen Normen des „kle<strong>in</strong>en<br />
Grenzverkehrs“ entwickelten. Doch <strong>in</strong> beiden Fällen dauerte es lange, bis die politische<br />
Staatsgrenze auch <strong>in</strong> den Köpfen der Menschen verankert war, bis sie von ihnen<br />
respektiert <strong>und</strong> als Lebensraum auch genutzt wurde.<br />
Fast paradox ersche<strong>in</strong>t das Ergebnis, daß gerade die Po-Grenze, die als „natürliche“<br />
Grenze am ehesten dem Idealbild von e<strong>in</strong>er Grenze <strong>im</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert entsprach<br />
– wie Andrea Geselle herausarbeitet –, wesentlich länger chaotisch <strong>und</strong> wenig kontrollierbar<br />
blieb als die „künstliche“ Grenze Galiziens, die durch Diktat der Großmächte<br />
<strong>im</strong> Zuge der polnischen Teilungen entstanden war. Diese war nicht nur<br />
Staatsgrenze, sondern wurde vielfach auch als Außengrenze Europas, als Trennl<strong>in</strong>ie<br />
zwischen Okzident <strong>und</strong> Orient empf<strong>und</strong>en. Markiert wurde sie nicht nur durch die üblichen<br />
Grenzste<strong>in</strong>e, Grenzwachen, Zollämter, sondern auch durch militärische Festungen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> diesen stationierte Truppen. Doch obwohl, wie Svjatoslav Pacholkiv<br />
anschaulich beschreibt, die neue Grenze „tief <strong>in</strong> die Ordnung des alltäglichen Lebens“<br />
e<strong>in</strong>griff, ganze Dörfer, Güter, Diözesen – die vertraute Lebenswelt von Polen, Ukra<strong>in</strong>ern<br />
<strong>und</strong> Juden dieser Region – zerteilte, wurde sie doch vermittels e<strong>in</strong>er durch Realismus<br />
<strong>und</strong> Kompromißbereitschaft gekennzeichneten „Politik der Grenze“ am Ende<br />
weitgehend von der Bevölkerung akzeptiert. Die Entstehung <strong>und</strong> das Werden der<br />
neuen Staatsgrenze <strong>in</strong> Galizien widerlegt schließlich auch die häufig geäußerte These,<br />
<strong>Grenzen</strong> müßten, um stabil zu se<strong>in</strong>, entweder natürlichen Gegebenheiten folgen (Gebirgskämmen,<br />
Flüssen) oder möglichst mit den ethnisch-kulturellen oder sprachlichen<br />
<strong>Grenzen</strong> übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>men. Das Beispiel der galizischen Grenze zeigt vielmehr, daß<br />
auch e<strong>in</strong>e durch politische Verträge zustande gekommene „künstliche“ Grenze stabil<br />
zu se<strong>in</strong> vermag, solange sie als nützlich angesehen <strong>und</strong> durch <strong>in</strong>ternationale Übere<strong>in</strong>künfte<br />
garantiert wird. Und noch e<strong>in</strong> weiterer „Mythos“, der <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der polnischen<br />
Nationalgeschichtsschreibung <strong>und</strong> auch <strong>in</strong> der sowjetischen Geschichtsschreibung<br />
lange Zeit tradiert wurde, wird durch Pacholkiv dekonstruiert, daß nämlich<br />
die galizische Staatsgrenze ausschließlich den Interessen der als Fremdherrschaft<br />
charakterisierten österreichischen Monarchie gedient <strong>und</strong> der polnisch-nationalen Sache<br />
geschadet habe, ja, daß es sich <strong>im</strong> Fall Galiziens nur um e<strong>in</strong>e „kolonial ausgebeu-<br />
<strong>20</strong>4
tete Prov<strong>in</strong>z des Habsburgerstaates“ gehandelt habe. Pacholkivs Ansatz, die galizischrussische<br />
Grenze aus e<strong>in</strong>er „lebensweltlichen Perspektive“ – durchaus <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne der<br />
Phänomenologie Husserls – zu beschreiben, führt ihn zu ganz anderen Ergebnissen.<br />
Die zunächst willkürlich <strong>und</strong> ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen gezogene<br />
Staatsgrenze brachte für Galizien auch e<strong>in</strong>e andere Staatsordnung, die <strong>im</strong> Gegensatz<br />
zur früheren der polnischen Adelsrepublik stand, e<strong>in</strong>e Ordnung, die zugleich absolutistisch,<br />
aufgeklärt, anational <strong>und</strong> egalitär war. Die Grenze – Symbol <strong>und</strong> Bestandteil<br />
dieser neuen Ordnung – wurde durch <strong>in</strong>teraktives Handeln der Grenzbewohner nicht<br />
nur <strong>im</strong>mer wieder korrigiert, verändert <strong>und</strong> durchlässiger gemacht, sondern schuf<br />
durch E<strong>in</strong>grenzung auch e<strong>in</strong>e neue, spezifisch „galizische“ Kultur, <strong>in</strong> der das Recht<br />
auf Unterschied sich schließlich allen hegemonialen Bestrebungen widersetzte.<br />
Ebensfalls zum Projektschwerpunkt „Lebenswelten an der Grenze“ erstellte Pavel<br />
Cibulka e<strong>in</strong>e Mikrostudie über „E<strong>in</strong>e Herrschaft an der Grenze“, war doch die Herrschaftsgrenze<br />
lange Zeit jene Grenze, die <strong>im</strong> Leben der bäuerlichen untertänigen Bevölkerung<br />
die wichtigste Rolle spielte. Konkret geht es dabei um das liechtenste<strong>in</strong>sche<br />
Dom<strong>in</strong>ium L<strong>und</strong>enburg (Břeclav), das nicht nur e<strong>in</strong>e der bedeutendsten mährischen<br />
Herrschaften war, sondern das durch se<strong>in</strong>e besondere Lage <strong>im</strong> mährischniederösterreichisch-ungarisch<br />
(slowakischen) Grenzgebiet nicht nur Herrschaftsgrenze,<br />
sondern auch Landesgrenze war.<br />
Anhand der <strong>im</strong> Liechtenste<strong>in</strong>schen Archiv vorf<strong>in</strong>dlichen Aktenstücke: Passiersche<strong>in</strong>e,<br />
Entlaßsche<strong>in</strong>e, Ehekonsense etc. untersucht Pavel Cibulka besondere Formen<br />
der Mobilität sowie das Migrationsverhalten der Bevölkerung <strong>im</strong> Grenzgebiet. Dabei<br />
stellt er fest, daß sowohl legale als auch illegale Grenzüberschreitungen – Gesellenwanderung,<br />
Eheschließung, Handel, Auswanderung – von der Bevölkerung als Möglichkeit<br />
e<strong>in</strong>er realen oder auch bloß <strong>im</strong>ag<strong>in</strong>ierten Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse<br />
verstanden <strong>und</strong> wahrgenommen wurde. So führten hohe Robot- <strong>und</strong> andere<br />
Dienstleistungen auf dem liechtenste<strong>in</strong>schen Dom<strong>in</strong>ium – die mit der außerordentlichen<br />
Bautätigkeit der Liechtenste<strong>in</strong>er <strong>in</strong> Zusammenhang stehen dürften – zur Abwanderung<br />
der Bevölkerung vor allem nach Ungarn. „Fremde Werber“ sowie der enge<br />
Kontakt mit bereits ausgewanderten Verwandten, die <strong>in</strong> der Ferne „ihr Glück gemacht<br />
hatten“, ließen Ungarn Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts vielfach als „das gelobte Land“ ersche<strong>in</strong>en,<br />
auch wenn, wie sich zeigte, die realen Verhältnisse dort oft härter waren als<br />
<strong>in</strong> der mährischen He<strong>im</strong>at. So kam es aufgr<strong>und</strong> von Anwerbung <strong>und</strong> der Tätigkeit e<strong>in</strong>es<br />
Paßfälschers <strong>im</strong> Jahr 1791 zu e<strong>in</strong>er regelrechten Massenflucht aus der l<strong>und</strong>enburgischen<br />
Gr<strong>und</strong>herrschaft nach Ungarn. Manche der illegal Ausgewanderten kehrten<br />
später enttäuscht zurück. Die Motive für die Emigration waren Ende des 18. <strong>und</strong> zu<br />
Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts überwiegend wirtschaftlicher (<strong>und</strong> nicht mehr religiöser)<br />
Natur. Abgesehen von der Auswanderung <strong>und</strong> Flucht vor dem Wehrdienst spielte die<br />
Landesgrenze – vor allem jene nach Niederösterreich – <strong>im</strong> Bewußtse<strong>in</strong> der Bevölkerung<br />
jedoch e<strong>in</strong>e eher untergeordnete Rolle. Pavel Cibulka entwickelt e<strong>in</strong>e besondere<br />
Hierarchie der <strong>Grenzen</strong>, bei der deutlich wird, daß die Grenze des eigenen Feldes, die<br />
Grenze der Geme<strong>in</strong>de (besonders <strong>im</strong> Falle der Verarmung), die Grenze der Gr<strong>und</strong>herrschaft,<br />
die Kreisgrenze (aber auch die Sprachgrenze) das Bewußtse<strong>in</strong> <strong>und</strong> das rea-<br />
<strong>20</strong>5
le Leben der Bevölkerung stärker best<strong>im</strong>mten als die Landesgrenze. Dennoch wurde<br />
der Lebensraum Grenze <strong>im</strong>mer schon als Chance, die engen Lebensverhältnisse zu<br />
verbessern, verstanden <strong>und</strong> genutzt. Die besondere Grenze mit Ungarn aber war – wie<br />
Pavel Cibulka feststellt – für die l<strong>und</strong>enburgischen Untertanen „Versprechen <strong>und</strong><br />
Drohung zugleich“.<br />
Andrea Komlosy stellt <strong>in</strong> ihrem Beitrag die Frage nach den „ökonomischen <strong>Grenzen</strong>“,<br />
die – so ihre These – häufig gegenläufig zu den politisch-adm<strong>in</strong>istrativen verliefen.<br />
Weiters stellt sie aus wirtschafts- <strong>und</strong> sozialhistorischer Perspektive Überlegungen<br />
zu den Ursachen regionaler Disparitäten an, die das Fallen der B<strong>in</strong>nenzollgrenzen<br />
<strong>und</strong> die dadurch ermöglichte volkswirtschaftliche Integration der österreichischen<br />
Länder – die Herstellung e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zigen großen B<strong>in</strong>nenmarktes mit freiem Kapital-<br />
<strong>und</strong> Warenverkehr – eher verstärkt als gemildert hatte. Ihr Interesse gilt dabei vornehmlich<br />
den Zentrenbildungs- <strong>und</strong> Peripherisierungsprozessen, die durch staatliche<br />
E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> die ökonomische Landschaft hervorgerufen wurden. Im Streit um die sogenannte<br />
„Rückständigkeitsthese“ (die Frage, ob der ökonomische Rückstand Österreichs-Ungarns<br />
gegenüber den entwickelteren westeuropäischen Industriestaaten <strong>im</strong><br />
Verlauf des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts eher größer oder kle<strong>in</strong>er wurde) entwickelt Andrea<br />
Komlosy unter E<strong>in</strong>beziehung der jüngsten Debatte über die ungleiche regionale Entwicklung<br />
<strong>im</strong> Weltmaßstab als Voraussetzung für das kapitalistische Wirtschaftssystem<br />
(Immanuel Wallerste<strong>in</strong> <strong>und</strong> andere) die These, nach der die Peripherisierung der<br />
östlichen Regionen der Habsburgermonarchie nicht mehr „als auslösendes Moment<br />
für die Rückständigkeit gegenüber Westeuropa angesehen werden“ dürfe, sondern <strong>im</strong><br />
Gegenteil gerade als Voraussetzung für den Aufstieg <strong>und</strong> die Entwicklung e<strong>in</strong>iger<br />
wirtschaftlich besonders begünstigter Regionen (darunter ab Mitte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
auch die böhmischen Länder) nach westeuropäischem Muster. Peripherisierung<br />
überwiegend agrarisch oder kle<strong>in</strong>gewerblich strukturierter Regionen ist danach e<strong>in</strong><br />
notwendiger – <strong>und</strong> auch gewollter – Prozeß, um den Rückstand gegenüber den entwickelteren<br />
Industrieländern allmählich aufzuholen <strong>und</strong> das <strong>in</strong> Europa – <strong>in</strong> ökonomischer<br />
H<strong>in</strong>sicht – bestehende West-Ost-Gefälle schwächer werden zu lassen. Paß- <strong>und</strong><br />
Zollgesetzgebung als Instrumente e<strong>in</strong>er „Politik der <strong>Grenzen</strong>“ trugen dazu entscheidend<br />
bei.<br />
Literaturauswahl<br />
BRUBAKER, ROGERS: Staats-Bürger. Frankreich <strong>und</strong> Deutschland <strong>im</strong> historischen<br />
Vergleich, Hamburg 1994.<br />
FEBVRE, LUCIEN: „Frontière“ – Wort <strong>und</strong> Bedeutung, <strong>in</strong>: Das Gewissen des Historikers,<br />
hrsg. von ULRICH RAULFF, Berl<strong>in</strong> 1988, S. 27-38.<br />
FERRY, JEAN-MARC: Europäische Identität <strong>und</strong> europäischer Bürgerstatus, <strong>in</strong>: Projekt<br />
Europa. Postnationale Identität: Gr<strong>und</strong>lage für e<strong>in</strong>e europäische Demokratie?,<br />
hrsg. von NICOLE DEWANDRE <strong>und</strong> JACQUES LENOBLE, Berl<strong>in</strong> 1994, S. 111-118.<br />
<strong>20</strong>6
HABERMAS, JÜRGEN: Staatsbürgerschaft <strong>und</strong> nationale Identität, <strong>in</strong>: Faktizität <strong>und</strong><br />
Geltung, Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1992, S. 632-660.<br />
HEINDL, WALTRAUD: Gehorsame Rebellen. Bürokratie <strong>und</strong> Beamte <strong>in</strong> Österreich<br />
1780 bis 1848, Wien 1991.<br />
MEDICK, HANS: Zur politischen Sozialgeschichte der Grenze <strong>in</strong> der Neuzeit Europas,<br />
<strong>in</strong>: Sozialwissenschaftliche Informationen <strong>20</strong> (1991), S. 157-163.<br />
RATZEL, FRIEDRICH: Über allgeme<strong>in</strong>e Eigenschaften der geographischen <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>und</strong> über die politische Grenze. Sonderdruck aus den Berichten der Königlich<br />
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzung am 6. Februar 1892.<br />
SAURER, EDITH: Straße, Schmuggel, Lottospiel. Materielle Kultur <strong>und</strong> Staat <strong>in</strong> Niederösterreich,<br />
Böhmen <strong>und</strong> Lombardo-Venetien <strong>im</strong> frühen <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, Gött<strong>in</strong>gen<br />
1989.<br />
ULBRICH, CLAUDIA: Rhe<strong>in</strong>grenze, Revolten <strong>und</strong> Französische Revolution, <strong>in</strong>: Die<br />
Französische Revolution <strong>und</strong> die Oberrhe<strong>in</strong>lande, hrsg. von VOLKER RÖDEL, Sigmar<strong>in</strong>gen<br />
1991, S. 223-244.<br />
<strong>20</strong>7
Dörfer an der Grenze – Bericht von e<strong>in</strong>em<br />
österreichisch-tschechischen Forschungsprojekt<br />
von<br />
Hanns H a a s<br />
Das vorgestellte Forschungsprojekt verdankt se<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>er Idee des österreichischen<br />
Wissenschaftsm<strong>in</strong>isteriums, das 1996 tausendjährige „<strong>Grenzen</strong>lose Österreich“<br />
durch die Vergabe von Forschungsprojekten zu würdigen. Der Leitl<strong>in</strong>ie des<br />
Milleniums entsprachen Thematik <strong>und</strong> Mitarbeiterstab. Insgesamt zwölf österreichische<br />
<strong>und</strong> tschechische Historiker sowie Ethnographen befaßten sich 1997 bis 1998<br />
mit der Grenze zwischen den Ländern Mähren <strong>und</strong> Niederösterreich bzw. der Tschechoslowakei<br />
<strong>und</strong> Österreich, <strong>und</strong> weil die deutsche Sprache an diesem Grenzabschnitt<br />
e<strong>in</strong>ige Dörfer weit nach Mähren reichte, zugleich auch mit der ethnischen deutschtschechischen<br />
Grenze auf mährischem Gebiet. 1 Dabei g<strong>in</strong>g es jedoch nicht bloß um<br />
Grenzbeziehungen <strong>im</strong> engeren S<strong>in</strong>ne, sondern um die tiefer liegende Integration der<br />
Bevölkerung <strong>in</strong> die jeweiligen nationalen bzw. nationalstaatlichen Kollektiva, also um<br />
die Nationalisierung der Grenzbevölkerung sowie um die Akzeptanz e<strong>in</strong>er nationalen<br />
Grenze <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Staatsgrenze mitten durch e<strong>in</strong>e bis dah<strong>in</strong> „grenzenlose“ Soziallandschaft.<br />
Als Untersuchungse<strong>in</strong>heit wählte das Projekt e<strong>in</strong>en mikrogeschichtlichen Zugang,<br />
<strong>in</strong>dem es die soziale <strong>und</strong> kulturelle Tiefenwirkung der adm<strong>in</strong>istrativen <strong>und</strong> ethnischen<br />
<strong>Grenzen</strong> auf mehrere Grenzdörfer untersuchte. Während die Nationalismusforschung<br />
für gewöhnlich die Integration sozialer Substrate <strong>und</strong> Regionen zur gesellschaftlichen<br />
Großgruppe untersucht, 2 wählte das Projekt den umgekehrten Weg, die Prägekraft des<br />
Ethnischen <strong>und</strong> Nationalen <strong>im</strong> dörflichen Mikrokosmos zu untersuchen. Als Arbeits-<br />
1 Mitarbeiter am vorgestellten Forschungsprojekt „Verfe<strong>in</strong>dete Brüder an der Grenze: Böhmen/Mähren/Niederösterreich.<br />
Die Zerstörung der Lebense<strong>in</strong>heit ’Grenze‘ 1938 bis 1948“:<br />
Hanns Haas (Leiter), Niklas M. Perzi (Kautzen),<br />
Peter Mähner (Wien-Altenburg, Projektbetreuer), Franz Pötscher (Horn),<br />
Bohuslav Beneš (Brünn), Thomas Samhaber (Waidhofen),<br />
Jir=í Dvor=ák (C+eské Budĕjovice/Budweis), J<strong>in</strong>dr=ich Schwippel (Prag),<br />
Bruno Kirchner (Horn), Franz Weisz (Wien-Schwechat),<br />
Petr Mal<strong>in</strong>a (Znojmo/Zna<strong>im</strong>), Jir=í Z<strong>im</strong>ola (C+eské Budĕjovice/Bud-<br />
Ewald Hiebl (Salzburg) weis - jetzt Nová Bystr=ice/Neubistriz)<br />
2 Roots of Ethnic Mobilisation, ed. by DAVID HOWELL <strong>in</strong> collaboration with GERT VON PI-<br />
STOHLKORS and ELLEN WIEGANDT, Dartmouth 1992 (Comparative Studies on Governments<br />
an non-dom<strong>in</strong>ant Ethnic Groups <strong>in</strong> Europe. 1850-1940, 7).<br />
<strong>20</strong>9
hypothese diente die Annahme, daß der moderne Nationalismus <strong>im</strong> agrarischen Dorf<br />
nur partielle Deutungskompetenz <strong>und</strong> Ordnungskraft erlangte, soweit es den Notwendigkeiten<br />
<strong>und</strong> Interessen e<strong>in</strong>er Öffnung nach außen entsprach, während das Dorf sonst<br />
<strong>in</strong> allen wesentlichen Bereichen se<strong>in</strong>er sozialen Organisation <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er kulturellen<br />
Comments e<strong>in</strong>er tradierten, wenngleich auch wandlungsfähigen agrarisch-dörflichen<br />
S<strong>in</strong>nordnung verpflichtet blieb. Methodisch komb<strong>in</strong>iert das Projekt e<strong>in</strong>en sozialgeschichtlichen<br />
mit e<strong>in</strong>em lebensweltlichen wahrnehmungsgeschichtlichen Zugang. 3<br />
Auf diese Weise wird der überschaubare dörfliche Sozialraum allseitig <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en wirtschaftlichen,<br />
sozialen, alltagsbezogenen <strong>und</strong> popularkulturellen Interdependenzen erfaßt.<br />
4 So lassen sich die Interessenskreise bzw. Netzwerke erkennen, <strong>in</strong> welchen Ordnungsideen<br />
tradiert werden <strong>und</strong>/oder auf das Dorf von außen e<strong>in</strong>wirken. Dieser Zugriff<br />
über das Lebensweltlich-Normative war unerläßlich. Denn erst auf der Ebene der<br />
Zuschreibung <strong>und</strong> S<strong>in</strong>ngebung lassen sich Fragen von ethnischer <strong>und</strong> nationaler<br />
Orientierung erörtern, erst hier greift die Nationalisierung als alternatives Organisationsmodell<br />
<strong>und</strong> Loyalitätsangebot zum Dorf. Etwas überspitzt könnte man formulieren,<br />
daß sich auf der Ebene des Dorfes gleichsam exper<strong>im</strong>entartig die beiden alternativen<br />
Gesellschaftsformen, die überschaubare dörfliche Lebenswelt <strong>und</strong> die <strong>im</strong>ag<strong>in</strong>ierte<br />
Nation, <strong>in</strong> Beziehung setzen lassen. Doch auch die Nachteile der mikrogeschichtlichen<br />
Betrachtung s<strong>in</strong>d nicht zu leugnen. Die Konzentration auf die kle<strong>in</strong>e<br />
Szenerie führt zu e<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>gularisierung der Ergebnisse auf Kosten der Repräsentativität<br />
der Aussage. Je <strong>in</strong>tensiver man die Dörfer erforscht, desto <strong>in</strong>dividueller <strong>und</strong> unvergleichbarer<br />
werden sie. Erst wieder die Bezugnahme auf gleiche Analyseelemente,<br />
eben Sprachgebrauch, Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität, erlaubt den Vergleich zwischen den<br />
e<strong>in</strong>zelnen <strong>in</strong>tegrierten Dorfe<strong>in</strong>heiten. 5 Gr<strong>und</strong>sätzlich geht es jedoch nicht darum nachzuforschen,<br />
wie sich die große Welt <strong>und</strong> die großen Tendenzen <strong>im</strong> kle<strong>in</strong>en widerspie-<br />
3 ALFRED SCHÜTZ: Der s<strong>in</strong>nhafte Aufbau der sozialen Welt. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>leitung <strong>in</strong> die verstehende<br />
Soziologie, Frankfurt/M. 1974; BERNHARD MIEBACH: Soziologische Handlungstheorie.<br />
E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung, Opladen 1991; ERNST LANGTHALER: Das „E<strong>in</strong>zelne“ <strong>und</strong> das „Ganze“.<br />
Oder: Vom Versuch, die Geschichte der „He<strong>im</strong>at“ zu rekonstruieren, <strong>in</strong>: Unsere He<strong>im</strong>at<br />
63 (1992), S. 80 ff.<br />
4 HANS MEDICK: Mikro-Historie, <strong>in</strong>: Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie.<br />
E<strong>in</strong>e Diskussion, hrsg. von WINFRIED SCHULZE, Gött<strong>in</strong>gen 1994, S. 40-53; DERS.: Entlegene<br />
Geschichte? Sozialgeschichte <strong>und</strong> Mikro-Historie <strong>im</strong> Blickfeld der Kulturanthropologie,<br />
<strong>in</strong>: Alltagskultur, Subjektivität <strong>und</strong> Geschichte. Zur Theorie <strong>und</strong> Praxis von Alltagsgeschichte,<br />
hrsg. von der Berl<strong>in</strong>er Geschichtswerkstatt, Münster 1994, S. 94-109; DERS.: Weben<br />
<strong>und</strong> Überleben <strong>in</strong> Laich<strong>in</strong>gen 1650-1900. Lokalgeschichte als Allgeme<strong>in</strong>e Geschichte,<br />
Gött<strong>in</strong>gen 1996 (Veröff. des Max-Planck-<strong>Institut</strong>s für Geschichte, 126), S. 13-37.<br />
5 Parallelstudien zur lebensweltlichen Prägekraft der Grenze stehen wenige zur Verfügung:<br />
Bruchl<strong>in</strong>ie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung <strong>im</strong> österreichisch-ungarischen Grenzraum<br />
(Südburgenland/Oststeiermark-Westungarn), hrsg. von MARTIN SEGER <strong>und</strong> PAUL BE-<br />
LUSZKY, Wien u.a. 1993; TRAUDE HORVATH <strong>und</strong> EVA MÜLLER: „. . . Die Grenze ist für uns<br />
ganz normal“. Ausgewählte Ergebnisse e<strong>in</strong>es grenzüberschreitenden Forschungsprojektes,<br />
<strong>in</strong>: Hart an der Grenze. Burgenland <strong>und</strong> Westungarn, hrsg. von DENS., Wien 1992, S. 163-<br />
174.<br />
210
geln, sondern welche Lebenszusammenhänge das Dorf kennzeichnen <strong>und</strong> wie es mit<br />
der nationalen E<strong>in</strong>speisung zurechtkam.<br />
Der Untersuchungszeitraum umfaßte jenen Zeitraum der letzten achtzig Jahre, der<br />
durch lebensgeschichtliche Interviews, teils unter E<strong>in</strong>schluß der Familiengeschichte,<br />
noch abzudecken war. Parallel dazu erfolgten entsprechende Archivrecherchen sowie<br />
e<strong>in</strong>e umfangreiche Erfassung personenbezogener Daten aus den Volkszählungen 1910<br />
bis 1950. Fokussiert wurde dabei allerd<strong>in</strong>gs auf das tragische Jahrzehnt 1938-1948, <strong>in</strong><br />
welchem der Nationalismus überraschend auch <strong>im</strong> Untersuchungsgebiet die be<strong>in</strong>ahe<br />
une<strong>in</strong>geschränkte Deutungskompetenz erlangte <strong>und</strong> die Zerstörung der „Lebense<strong>in</strong>heit<br />
Grenze“ bewirkte. Die Folge waren die ethnischen Säuberungen der Jahre 1938<br />
bis 1948.<br />
Lebensweltlich orientierte Parallelstudien zur Tiefenwirkung von Nation <strong>und</strong><br />
Grenze gibt es bescheiden wenige. Auch die besten Lokalgeschichten verbleiben zumeist<br />
bei e<strong>in</strong>er Analyse politischer <strong>Institut</strong>ionen, Funktionäre <strong>und</strong> Maßnahmen. 6 Sie<br />
nehmen also ihren Ausgang be<strong>im</strong> Politischen <strong>und</strong> erreichen die lokale wirtschaftlichsoziale<br />
Ebene sowie die Alltagswelt nur am Rande, die örtlichen S<strong>in</strong>nordnungen<br />
kaum. Sonst lebensweltlich bzw. milieutheoretisch <strong>in</strong>spirierte Geschichte erfolgt <strong>in</strong><br />
großen Räumen <strong>und</strong> sozialen Zusammenhängen, <strong>in</strong>dem beispielsweise die Nationalisierung<br />
der französischen Bauern oder die politische Prägekraft des Lebensmodells<br />
Dorf <strong>in</strong> best<strong>im</strong>mten Regionen Deutschlands untersucht wird. 7 Die regionalgeschichtlich<br />
orientierten Grenzstudien befassen sich <strong>in</strong> aller Regel mit den Nachteilen <strong>und</strong><br />
Vorteilen periphärer Lage auf die Wirtschaftsstruktur. 8 E<strong>in</strong>e von geographischen <strong>und</strong><br />
soziologischen Paradigmen bee<strong>in</strong>flußte Studie zum „nationalen Differenzierungsprozeß<br />
am Beispiel ausgewählter Orte <strong>in</strong> Kärnten <strong>und</strong> <strong>im</strong> Burgenland“ behandelt die<br />
Strukturzusammenhänge zwischen Wirtschaft, Marktbeziehungen <strong>und</strong> politischer Organisierung,<br />
nicht auch Prozesse der Wahrnehmung <strong>und</strong> subjektiven Identität, wie also<br />
Sozialstruktur auf die kulturelle ethnische Orientierung e<strong>in</strong>wirkt. Nur wenige<br />
Dorfmonographien s<strong>in</strong>d auf dem Umweg über lebensgeschichtliche Interviews bis auf<br />
die Ebene privater <strong>und</strong> gruppenspezifischer S<strong>in</strong>nordnungen vorgestoßen <strong>und</strong> können<br />
daher analog zum vorliegenden Projekt die nationale E<strong>in</strong>speisung <strong>in</strong> dörflich-<br />
6 OSWALD ÜBEREGGER: Freienfeld unterm Liktorenbündel. E<strong>in</strong>e Fallstudie zur Geschichte<br />
der Südtiroler Geme<strong>in</strong>den unter dem Faschismus, hrsg. von RICHARD SCHOBER, Innsbruck<br />
1996; Das Frankenfelser Buch, hrsg. von BERNHARD GAMSJÄGER <strong>und</strong> ERNST LANGTHALER,<br />
Frankenfels 1997.<br />
7 JAMES R. LEHNING: Peasant and French. Cultural contact <strong>in</strong> rural France dur<strong>in</strong>g the n<strong>in</strong>eteenth<br />
century, Cambridge 1995; WOLFRAM PYTA: Dorfgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> Parteipolitik<br />
1918-1933. Die Verschränkung von Milieu <strong>und</strong> Parteien <strong>in</strong> den protestantischen Landgebieten<br />
Deutschlands <strong>in</strong> der We<strong>im</strong>arer Republik, Düsseldorf 1996 (Beiträge zur Geschichte<br />
des Parlamentarismus <strong>und</strong> der politischen Parteien, Bd. 106); SIEGFRIED WEICHLEIN <strong>in</strong>:<br />
Sozialmilieus <strong>und</strong> politische Kultur <strong>in</strong> der We<strong>im</strong>arer Republik, Gött<strong>in</strong>gen 1996 (Kritische<br />
Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 115).<br />
8 ANDREA KOMLOSY: Räume <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong>. Zum Wandel von Raum, Politik <strong>und</strong> Ökonomie<br />
vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> moderner Staatenbildung <strong>und</strong> weltwirtschaftlicher Globalisierung, <strong>in</strong>:<br />
Zeitgeschichte 22 (1995), S. 385-404.<br />
211
agrarische Sozialzusammenhänge <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nstrukturen untersuchen. 9 Am nächsten<br />
kommen dem hier gewählten Ansatz jedoch ethnograpische Untersuchungen, die sich<br />
teils mit e<strong>in</strong>zelnen Elementen kultureller Praxis <strong>im</strong> Dorfkontext befassen <strong>und</strong> teils<br />
kulturelle Interferenzen bzw. allumfassende Strukturunterschiede zwischen M<strong>in</strong>derheitendörfern<br />
untersuchen. 10 Andere Spezialuntersuchungen wieder gruppieren um<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>zelfall den dörflichen „Eigens<strong>in</strong>n“. 11 Nur ausschnittsweise behandeln kollektivbiographische<br />
Ansätze auch Aspekte dörflichen Zusammenlebens. 12 Weitgehend<br />
parallel zu Denkannahmen <strong>und</strong> Ergebnissen des Projektes ist e<strong>in</strong>e kurze tschechische<br />
Studie zu e<strong>in</strong>em se<strong>in</strong>erzeit zweisprachigen mittelmährischen Dorf. 13 Während<br />
9<br />
Blatten. E<strong>in</strong> Dorf an der Grenze, hrsg. von JOHANNES MOSER <strong>und</strong> ELISABETH KATSCHNIG-<br />
FLATSCH (Kuckuck. Sonderband 2/1992); Pári. Über das Leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ungardeutschen<br />
Dorf, hrsg. von LEANDER PETZOLDT, INGO SCHNEIDER <strong>und</strong> PETRA STRENG, Innsbruck<br />
1996; HERBERT SCHWEDT: Nemesnádudwar-Nadwar. Leben <strong>und</strong> Zusammenleben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
ungardeutschen Geme<strong>in</strong>de, Marburg 1990; VÁCLAV FROLEC: Horní Ve=stonice [Oberwisternitz],<br />
Brno 1984; viele weitere Detailstudien <strong>in</strong>: DERS.: Malorolnické a záhumenkové<br />
hospodar=ení v jihomoravské pohranic=ní vesnici [Kle<strong>in</strong>bäuerliche <strong>und</strong> private Hofwirtschaft<br />
<strong>im</strong> südmährischen Grenzdorf], <strong>in</strong>: Jiz=ní Morava 15 (1979), S. 81-89; DERS.: Zvyková tradice<br />
v z=ivote= jihomoravské pohranic=ní obce [Sittentradition <strong>im</strong> Leben des südmährischen<br />
Grenzdorfes], <strong>in</strong>: Jiz=ní Morava 12 (1976), S. 91-104; Socializace vesnice a prome=ny lidové<br />
kultury [Sozialisation des Dorfes <strong>und</strong> Wandlungen der Volkskultur], bearb. von VÁCLAV<br />
FROLEC (Uherské Hradište= 1, Pr=ehledy výsledku` výzkumu), Uherské Hradištĕ 1981; Socializace<br />
vesnice a prome=ny lidové kultury [Sozialisation des Dorfes <strong>und</strong> Wandlungen der<br />
Volkskultur], bearb. von VÁCLAV FROLEC (Uherské Hradište= 2, Sborník materiálu` z II.<br />
Sem<strong>in</strong>ár=e „Socializace Vesnice a Prome=ny Lidové Kultury v Jihomoravském Kraji“ 26.-<br />
27.1.1982 Stráz=nice), Uherské Hradište= 1983; Socializace vesnice a prome=ny lidové kultury<br />
[Sozialisation des Dorfes <strong>und</strong> Wandlungen der Volkskultur], bearb. von VÁCLAV FRO-<br />
LEC (Uherské Hradište= 3, Sborník materiálu` z III. Sem<strong>in</strong>ár=e „Socializace Vesnice a<br />
Prome=ny Lidové Kultury v Jihomoravském Kraji“ 31.3.-1.4.1983 Kromer=íž)=, Uherské<br />
Hradište= 1984.<br />
10<br />
JOHN W. COLE, ERIC R. WOLFE: Die unsichtbare Grenze. Ethnizität <strong>und</strong> Ökologie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Alpental, Bozen 1995.<br />
11<br />
H. INHETVEEN: Staatliche Macht <strong>und</strong> dörfliche Ehre: Die Geschichte e<strong>in</strong>es Ortsbauernführers,<br />
<strong>in</strong>: Krise ländlicher Lebenswelten. Analysen, Erklärungsansätze <strong>und</strong> Lösungsperspektiven,<br />
hrsg. von KLAUS M. SCHMALS <strong>und</strong> RÜDIGER VOIGT, New York 1986, S. 163-189.<br />
12<br />
UTA MÜLLER-HANDL: „Die Gedanken laufen oft zurück . . .“. Flüchtl<strong>in</strong>gsfrauen er<strong>in</strong>nern<br />
sich an ihr Leben <strong>in</strong> Böhmen <strong>und</strong> Mähren <strong>und</strong> an den Neuanfang <strong>in</strong> Hessen nach 1945,<br />
Wiesbaden 1993 (Forschungen zur Integration der Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> Vertriebenen <strong>in</strong> Hessen<br />
nach 1945, Bd. 3); INGRID KAISER-KAPLANER: Die Sachsen <strong>und</strong> Landler <strong>in</strong> Siebenbürgen.<br />
Dargestellt anhand von Chroniken <strong>und</strong> erzählten Er<strong>in</strong>nerungen, Klagenfurt, Wien u.a. 1996<br />
(Studia Car<strong>in</strong>thiaca Slovenica, Bd. 11); DIES.: Gottscheer Frauenschicksale <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
E<strong>in</strong>e sozialgeschichtliche Untersuchung Vertriebener anhand narrativer Quellen, <strong>in</strong>:<br />
Flucht <strong>und</strong> Vertreibung. Zwischen Aufrechnung <strong>und</strong> Verdrängung, hrsg. von ROBERT<br />
STREIBEL, Wien 1994, S. 237-256.<br />
13<br />
VERA FROLCOVÁ: Vztahy C+echu` a Ne=mcu` v pr=íme=stké obci Moravany u Brna v názorech a<br />
zkus=enostech dvou generací [Die Beziehungen zwischen Tschechen <strong>und</strong> Deutschen <strong>in</strong> der<br />
vorstädtischen Geme<strong>in</strong>de Moravany bei Brünn <strong>in</strong> den Ansichten <strong>und</strong> den Erfahrungen<br />
212
die Zeitgeschichtsschreibung der Lebense<strong>in</strong>heit Dorf nur ger<strong>in</strong>ge Bedeutung e<strong>in</strong>räumt,<br />
profitieren Fachleute zu älteren Geschichtsperioden vielfach von der Gegenüberstellung<br />
dörflicher B<strong>in</strong>nenlogik <strong>und</strong> staatlichen Vorgaben. Vor allem bei solchen<br />
Studien konnte das Projekt entsprechende Anleihen nehmen. 14<br />
Funktionale Integration: Höfe <strong>und</strong> Dorf<br />
Im sozialgeschichtlichen Abschnitt n<strong>im</strong>mt das Projekt vielfach Anleihe bei der historischen<br />
Agrarsoziologie, welche die Formen ländlicher Familienwirtschaft auf ökologische<br />
Voraussetzungen von Topographie <strong>und</strong> Produktenpalette bezieht. 15 Die Dorfstrukturen<br />
s<strong>in</strong>d zwar nicht mit gleicher Intensität, aber doch anhand von Fallbeispielen<br />
aus unterschiedlichen Bereichen behandelt, so daß der Zusammenhang zum Ökotypus<br />
erkennbar wird. Die Auswahl der untersuchten Dörfer erfolgte nach den dort<br />
entwickelten Kriterien, <strong>in</strong>dem jeweils Dörfer <strong>in</strong> der We<strong>in</strong>bauzone, <strong>im</strong> ertragreichen<br />
zweier Generationen], <strong>in</strong>: Etnické procesy v nove= osídlených oblastech na Morave=. Na<br />
pr=íklade= vybraných obcí v jihomoravském a severomoravském kraji, hrsg von ALEXANDRA<br />
NAVRATÍLOVÁ s kolektivem, Brno 1986, S. 139-145.<br />
14 Vgl. dazu MICHAEL FRANK: Dörfliche Gesellschaft <strong>und</strong> Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alität. Das Fallbeispiel Lippe<br />
1650-1800, Paderborn u.a. 1995; K. WRIGHTSON: Two concepts of order: Justices and<br />
juryman <strong>in</strong> seventeenth-century England, <strong>in</strong>: An ungovernable people, hrsg. von J. BREWER<br />
<strong>und</strong> J. STYLES, London 1980, S. 21-46.<br />
15 MICHAEL MITTERAUER: Formen ländlicher Familienwirtschaft. Historische Ökotypen <strong>und</strong><br />
familiale Arbeitsorganisation <strong>im</strong> österreichischen Raum, <strong>in</strong>: Familienstruktur <strong>und</strong> Arbeitsorganisation<br />
<strong>in</strong> ländlichen Gesellschaften, hrsg. von JOSEF EHMER <strong>und</strong> MICHAEL MITTE-<br />
RAUER, Wien u.a. 1986, S. 185-323; NORBERT ORTMAYR: Woodland Peasants. Ecological<br />
adaption <strong>in</strong> an Austrian peasant community 1870-1938, <strong>in</strong>: Ethnologia Europaea, Kopenhagen<br />
1989, S. 105-124; DERS.: Amerikaner <strong>in</strong> den Alpen. Historisch-kulturanthropologische<br />
Studien über die alpenländische Gesellschaft, <strong>in</strong>: Clios Rache. Neue<br />
Aspekte strukturgeschichtlicher <strong>und</strong> theoriegeleiteter Geschichtsforschung <strong>in</strong> Österreich,<br />
hrsg. von KARL KASER <strong>und</strong> KARL STOCKER, Wien u.a. 1992, S. 131-150; CLEMENS ZIM-<br />
MERMANN: Dorf <strong>und</strong> Land <strong>in</strong> der Sozialgeschichte, <strong>in</strong>: Sozialgeschichte <strong>in</strong> Deutschland, Bd<br />
2, Handlungsräume des Menschen <strong>in</strong> der Geschichte, Gött<strong>in</strong>gen 1986, S. 90-112; VITTORIO<br />
CASTELLANO: Il Paese. Values and social change <strong>in</strong> an Italian village, New York 1974;<br />
LAURENCE WYLIE: Dorf <strong>in</strong> der Vaucluse. Der Alltag e<strong>in</strong>er französischen Geme<strong>in</strong>de, Stuttgart<br />
1969; KURT WAGNER: Leben auf dem Lande <strong>im</strong> Wandel der Industrialisierung. „Das<br />
Dorf war früher auch ke<strong>in</strong>e heile Welt“. Die Veränderung der dörflichen Lebensweise <strong>und</strong><br />
der politischen Kultur <strong>im</strong> H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der Industrialisierung – am Beispiel des nordhessischen<br />
Dorfes Körle, Frankfurt Ma<strong>in</strong> 1986; UTZ JEGGLE: Kieb<strong>in</strong>gen – e<strong>in</strong>e He<strong>im</strong>atgeschichte.<br />
Zum Prozeß der Zivilisation <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em schwäbischen Dorf, Tüb<strong>in</strong>gen 1977; ALBERT ILI-<br />
EN, UTZ JEGGLE: Leben auf dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes <strong>und</strong> zur Sozialpsychologie<br />
se<strong>in</strong>er Bewohner, Opladen 1978; HARRIET G. ROSENBERG: A Negotiated World:<br />
Three Centuries of Change <strong>in</strong> a French Alp<strong>in</strong>e Community, Toronto u.a. 1988; PIER PAOLO<br />
VIAZZO: Upland communities. Environment, population and social structure <strong>in</strong> the Alps<br />
s<strong>in</strong>ce the sixteenth century, Cambridge u.a. 1989.<br />
213
Weizenanbaugebiet <strong>und</strong> <strong>in</strong> der gemischtwirtschaftlichen Acker/Viehwirtschaft/<br />
Waldwirtschaft ausgewählt wurden. Zusätzlich zu diesen re<strong>in</strong>en Agrardörfern wurden<br />
Dörfer mit gemischter agrarisch-<strong>in</strong>dustrieller Struktur <strong>und</strong> bescheidenen zentralörtlichen<br />
Funktionen ausgewählt. In diesem Falle dienten Arbeiten zur <strong>in</strong>dustriellen Diaspora<br />
<strong>in</strong> agrarischem Umfeld als Referenzliteratur. 16<br />
Der ökologische Typus bed<strong>in</strong>gte e<strong>in</strong>e erstaunliche Variationsbreite des bäuerlichen<br />
Wirtschaftens <strong>und</strong> der Dorfgesellschaft, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> bezug auf Hofgrößen<br />
<strong>und</strong> Rekrutierung der Arbeitskräfte mit entsprechenden Auswirkungen auf die ethnischen<br />
Verhältnisse. In den Dörfern mit We<strong>in</strong>bau <strong>und</strong> Gemüsekulturen begegnen wir<br />
dem Familienbetrieb <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der marktorientierten Intensivkulturen vielfach<br />
sehr kle<strong>in</strong>en lebensfähigen Hofstellen. Nur wenige größere Bauern beschäftigten hier<br />
Dienstboten. Für saisonale Spitzen standen e<strong>in</strong>ige Tagwerker <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>häusler des<br />
eigenen Ortes zur Verfügung. Zur Ernte oder Lese kamen zusätzlich Saisonarbeiter<br />
aus dem Landes<strong>in</strong>nern oder der Slowakei. Im Soziotop We<strong>in</strong>baudorf herrschte de facto<br />
Realteilung, <strong>in</strong>dem alle K<strong>in</strong>der erbten <strong>und</strong> lebensfähige Höfe zumeist durch Heirat<br />
zustandekamen, was die Heiratskreise auf wenige benachbarte Dörfer, <strong>und</strong> zwar auch<br />
jenseits der Landes- bzw. Staatsgrenze zu Österreich, e<strong>in</strong>engte. Die We<strong>in</strong>baudörfer<br />
waren daher durch e<strong>in</strong> hohes Maß an Endogamie <strong>und</strong> enge Verwandtschaftsbeziehungen<br />
gekennzeichnet. In diesen Dörfern f<strong>in</strong>den wir kaum Zuwanderung, da bei wirtschaftlichen<br />
Schwierigkeiten nie ganze Hofstellen, sondern allenfalls e<strong>in</strong>zelne<br />
Gr<strong>und</strong>stücke an Dorfgenossen oder Bauern der Nachbargeme<strong>in</strong>den verkauft wurden<br />
<strong>und</strong> auf dem Restgut e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation von kle<strong>in</strong>bäuerlicher Intensivkultur <strong>und</strong> Taglöhnerarbeit<br />
die agrarische Existenz sicherte. Unter diesen Verhältnissen fehlte <strong>in</strong><br />
Gnadlersdorf/Hnanice jeder wirtschaftliche Anreiz für e<strong>in</strong>e tschechische Zuwanderung.<br />
Erst die Zollstation brachte <strong>in</strong> den Zwanzigerjahren die Präsenz tschechischer<br />
Staatsfunktionäre. Ähnliche Verhältnisse herrschten <strong>im</strong> bäuerlichen Sektor des gemischt<br />
agrarisch-proletarischen Nachbarortes Schattau/« atov.<br />
Im Weizenanbaugebiet der mährischen Hochebene tradierte das streng e<strong>in</strong>gehaltene<br />
Anerbenrecht die Beibehaltung der Hofgrößen als Voraussetzung für extensive<br />
Kulturen. In Notzeiten konnte man allenfalls partiell alternative Erwerbszweige suchen,<br />
beispielsweise die Viehaufzucht. Bei existentiellen Schwierigkeiten mußten jedoch<br />
die Höfe verkauft werden, teils an die Dorfgenossen, teils an Interessenten deutscher<br />
bzw. tschechischer Nachbardörfer, teils an tschechische Interessenten des B<strong>in</strong>nenlandes,<br />
während e<strong>in</strong>e Zuwanderung aus Niederösterreich nicht festzustellen ist. In<br />
der Ackerbauzone bestand auch ke<strong>in</strong> wirtschaftlicher Gr<strong>und</strong> für dörfliche Endogamie,<br />
wenn auch <strong>im</strong>mer noch mehr als die Hälfte der Ehegatten aus den Dörfern selbst <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong> weiterer hoher Prozentsatz aus den Nachbardörfern stammten. Die engen Heiratskreise<br />
waren eben auch kulturell bed<strong>in</strong>gt, da die Dorfburschen fremde Bewerber nur<br />
16 Die Roten am Land. Arbeitsleben <strong>und</strong> Arbeiterbewegung <strong>im</strong> westlichen Österreich, hrsg.<br />
von KURT GREUSSING, Steyr 1989; Zeit-gerecht. 100 Jahre katholische Soziallehre, hrsg.<br />
von EMMERICH TÁLOS <strong>und</strong> ALOIS RIEDLSPERGER, Steyr 1991; SYLVIA HAHN, WOLFGANG<br />
MADERTHANER, GERALD SPRENGNAGEL: Aufbruch <strong>in</strong> der Prov<strong>in</strong>z. Niederösterreichische<br />
Arbeiter <strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert, Wien 1989.<br />
214
sehr ungern <strong>und</strong> nach langen Kämpfen um „ihre“ Dorfmädchen akzeptierten <strong>und</strong> erst<br />
e<strong>in</strong>e großzügige Spende das „E<strong>in</strong>kaufen“ <strong>in</strong>s Dorf ermöglichte. Die relativ umfangreichen<br />
Bauernhöfe der Ackerbauzone, die ab e<strong>in</strong>er Größe von 10 ha lebensfähig waren,<br />
erforderten relativ viele familienfremde Dienstboten, vor allem <strong>in</strong> jenen Generationenausschnitten,<br />
<strong>in</strong> denen die eigenen K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> die Alten als Arbeitskräfte ausfielen.<br />
Auch <strong>in</strong> deutschen Dörfern begegnen wir vielen tschechischen Dienstboten,<br />
von denen wiederum e<strong>in</strong>ige <strong>in</strong> Bauernhöfe e<strong>in</strong>heirateten. Die erhebliche tschechische<br />
Zuwanderung <strong>in</strong>s Weizenanbaugebiet hat also vornehmlich wirtschaftliche Gründe,<br />
wenn auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Fällen die Mithilfe nationaler tschechischer Organisationen<br />
nicht auszuschließen ist. Auf diese Weise wurde etwa das an der Grenze der beiden<br />
Landessprachen liegende ehemals deutsche Baumöhl/Podmolí <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrere Generationen<br />
dauernden Prozeß tschechisch majorisiert. Das tschechische Masovice/Groß<br />
Maispitz <strong>und</strong> das deutsche Luggau/Lukov blieben jedoch bis zuletzt e<strong>in</strong>sprachig.<br />
Nur zwei tschechische Bauern, e<strong>in</strong> tüchtiger <strong>und</strong> e<strong>in</strong> wirtschaftlich glückloser,<br />
wanderten <strong>in</strong> Luggau zu.<br />
Sehr komplexe Verhältnisse herrschten <strong>in</strong> der Untersuchungszone um Böhmisch<br />
Rudoletz. Hier ist e<strong>in</strong> langes Nebene<strong>in</strong>ander von bäuerlicher Subsistenzwirtschaft <strong>und</strong><br />
Industrie mit entsprechender Instabilität der wirtschaftlichen Strukturen <strong>und</strong> ethnischen<br />
Verhältnisse festzustellen. So bewirkte zuerst die blühende eisenverarbeitende<br />
Industrie e<strong>in</strong>e gewisse tschechische Zuwanderung <strong>in</strong> das bis dah<strong>in</strong> ganz deutsche <strong>in</strong>dustriell-agrarische<br />
Dorf Unter-Radischen – 1871 kam das erste Haus <strong>in</strong> tschechische<br />
Hände. Gravierender aber war die Abwanderung vieler deutscher „Industriebauern“<br />
nach dem Ende der örtlichen Eisen<strong>in</strong>dustrie um 1900 <strong>und</strong> der Aufkauf ihrer bescheidenen<br />
Höfe durch tschechische Zuwanderer. Gr<strong>und</strong>sätzlich hielt auch die re<strong>in</strong> familienwirtschaftlich<br />
geführte waldbäuerliche Subsistenzwirtschaft Südwestmährens zur<br />
Erhaltung des Hofes am Anerbenrecht fest, so daß nur wenige Dienstboten benötigt<br />
wurden. Doch die niederösterreichischen Ballungszentren übten weiterh<strong>in</strong> starke Anziehungskraft<br />
auf die deutschen Kle<strong>in</strong>bauern aus, die bei ökonomischen<br />
Schwierigkeiten ihre Höfe verkauften, was weitere Schübe tschechischer<br />
Zuwanderung aus der Böhmisch-Mährischen Höhe brachte, die letzte unmittelbar<br />
nach dem Ersten Weltkrieg. Zuletzt war Unter-Radischen <strong>in</strong> den Zwanzigerjahren<br />
schon überwiegend tschechisch. Oberradischen war ohneh<strong>in</strong> schon länger ethnisches<br />
Überlagerungsgebiet mit zuletzt nur noch vier deutschen Familien. Außerdem<br />
entwickelten sich <strong>im</strong> 18. <strong>und</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert aus Holzfällersiedlungen neue<br />
tschechische Dörfer, beispielsweise Neuwelt/Nový Svet. Die Änderung der<br />
ethnischen Verhältnisse war jedenfalls e<strong>in</strong>e Folge wirtschaftlicher Schubkräfte,<br />
wenngleich auch nationale Schutzverbände den tschechischen Bauern Kredite zum<br />
Ankauf der Höfe vermittelten, was die nicht m<strong>in</strong>der eifrige nationale deutsche<br />
Bodenpolitik Überall begegnen nicht <strong>im</strong>mer wir verh<strong>in</strong>dern der familialen konnte. Hofwirtschaft, <strong>in</strong> den We<strong>in</strong>baudörfern er-<br />
gänzt durch verwandtschaftliche oder nachbarschaftliche Hilfeleistung sowie Taglöhner.<br />
In der Ges<strong>in</strong>dewirtschaft des Weizenanbaugebietes spielten die Taglöhner e<strong>in</strong>e<br />
etwas ger<strong>in</strong>gere Rolle, mehr <strong>in</strong> Luggau als <strong>in</strong> Groß-Maispitz <strong>und</strong> Baumöhl. Behauste<br />
<strong>und</strong> unbehauste Taglöhner sowie Kle<strong>in</strong>bauern waren stets an der funktionalen Integra-<br />
215
tion beteiligt, <strong>in</strong>dem sie ihre Arbeitskraft gegen Naturallohn bzw. Geld oder gegen<br />
Spann- <strong>und</strong> Fuhrdienste zur Bearbeitung ihrer kle<strong>in</strong>en Felder zur Verfügung stellten.<br />
In seltenen Fällen mußten Taglöhnerfamilien sogar „um den Z<strong>in</strong>s arbeiten“. 17 Be<strong>in</strong>ahe<br />
alle Dorfgenossen verfügten über e<strong>in</strong> Haus <strong>und</strong> e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Gr<strong>und</strong>stück. Nur die spät<br />
zugewanderten Staatsbeamten <strong>und</strong> Lehrer sowie e<strong>in</strong>zelne Inleute verfügten oft nicht<br />
über Haus <strong>und</strong> Acker. Was die waldbäuerliche Zone anbelangt, so bewirkte die Reagrarisierung<br />
der Industriedörfer e<strong>in</strong>e starke Aufsplitterung auf unterschiedliche Hofgrößen,<br />
wobei doch noch e<strong>in</strong>e ethno-soziale Struktur zu erkennen ist, da die größeren<br />
Hofstellen zumeist, aber nicht ausschließlich den Deutschen gehörten, die tschechischen<br />
Zuwanderer h<strong>in</strong>gegen vornehmlich Kle<strong>in</strong>landwirte <strong>und</strong> behauste Taglöhner waren,<br />
welche nicht nur bei den Bauern, sondern vor allem <strong>im</strong> Staatsforst Beschäftigung<br />
fanden. Diese ethno-soziale Schichtung ist sonst jedoch <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Falle nachzuweisen.<br />
Sie spielt auch ke<strong>in</strong>e Rolle <strong>im</strong> tschechisch überschichteten Dorf Baumöhl des<br />
Weizenanbaugebietes.<br />
Die räumliche B<strong>in</strong>nengliederung entspricht <strong>in</strong> den We<strong>in</strong>baudörfern der Besitzstruktur.<br />
In Gnadlersdorf gehörte die Dorfmitte den größeren <strong>und</strong> mittleren Bauern;<br />
an den Ausfallstraßen entlang siedelten Kle<strong>in</strong>bauern <strong>und</strong> Arbeiter. E<strong>in</strong> neuer Dorfteil,<br />
das Außerort, war sozial gemischt – e<strong>in</strong>e Folge der Realteilung. Schattau war sozialräumlich<br />
r<strong>in</strong>gförmig geschichtet. Hier umschlossen die stattlichen Anwesen der W<strong>in</strong>ter-<br />
<strong>und</strong> Sommerseite den breiten Anger, der den Bach entlang auf beiden Seiten<br />
durch Kle<strong>in</strong>häusler <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>e Gewerbetreibende verbaut war. Ganz abseits <strong>in</strong> Richtung<br />
Bahnhof entwickelte sich das Industriedorf. Das Ackerbaudorf Luggau war e<strong>in</strong><br />
Dorfzwill<strong>in</strong>g: auf der e<strong>in</strong>en Seite das alte Bauerndorf der Mittelbauern <strong>und</strong> anschließend<br />
die neuzeitliche Kle<strong>in</strong>bauernsiedlung Luggau-Neudörfl. In den ethnisch überlagerten<br />
Dörfern Baumöhl sowie <strong>in</strong> den Waldbauerndörfern lebten Kle<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Mittelbauern<br />
ganz unsystematisch <strong>im</strong> Gemenge. Nirgends f<strong>in</strong>det sich jedoch <strong>in</strong> den Bauerndörfern<br />
e<strong>in</strong>e räumliche Separierung der beiden Ethnien auf Dorfviertel oder Häuserzeilen.<br />
Die Angehörigen der beiden Volksgruppen lebten vermischt Hof an Hof, Haus<br />
an Haus, wie es Kauf oder E<strong>in</strong>heirat mit sich brachten. E<strong>in</strong>e Ausnahme bildete lediglich<br />
der erst <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit entstandene Dorfteil Auf der Heide/Na Hátech<br />
des Dorfes Baumöhl, wo der tschechische Gendarm, der F<strong>in</strong>anzbeamte, der Förster<br />
<strong>und</strong> Forstarbeiter wohnten. In Gnadlersdorf h<strong>in</strong>gegen waren die Grenzer <strong>im</strong> Zollhaus<br />
konzentriert <strong>und</strong> ihre Beziehungen zur schmalen tschechischen Dorfarmut relativ lokker.<br />
In Böhmisch Rudoletz entstand um die tschechische Bürgerschule e<strong>in</strong> zweites<br />
Ortszentrum für Lehrpersonal <strong>und</strong> Staatsbeamte. Auch das mehrheitlich tschechische<br />
Industrieviertel von Schattau lag abseits des deutschen Bauerndorfes. In allen diesen<br />
beiden Fällen folgte jedoch die ethnische Segmentierung der sozialen Untergliederung.<br />
Die wirtschaftliche B<strong>in</strong>nenorientierung der Dörfer bezog sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf<br />
die Produktion. Was den Absatz anbelangt, so waren die Dörfer <strong>in</strong> unterschiedlichem<br />
Grade <strong>in</strong> wirtschaftliche Makrostrukturen e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Für best<strong>im</strong>mte Funktionen<br />
bestanden funktionelle Verflechtungen mit Nachbardörfern oder <strong>im</strong> Rahmen der<br />
17 Gnadlersdorf, Interview Sch., S. 5.<br />
216
Kle<strong>in</strong>region. Beispielsweise konnten <strong>im</strong> beheizbaren Vortreibhaus der Geme<strong>in</strong>de<br />
Gnadlersdorf „auch Parteien aus den Nachbargeme<strong>in</strong>den“ gegen Entgelt veredelte<br />
Reben e<strong>in</strong>legen. 18 Mit 1.000 Kronen beteiligte sich die Geme<strong>in</strong>de Gnadlersdorf an e<strong>in</strong>er<br />
Lagerhausgenossenschaft am Bahnhof Schattau/Šatov. 19 Geme<strong>in</strong>sam bemühten<br />
sich die benachbarten Geme<strong>in</strong>den um e<strong>in</strong>e Verbesserung der Straßen. Stark marktabhängig<br />
waren die We<strong>in</strong>bau- <strong>und</strong> Intensivkulturen etwa bei Tafeltrauben, Gurken <strong>und</strong><br />
Gemüse. Die Getreidebauern wiederum waren <strong>in</strong> den Dreißigerjahren auf die staatlichen<br />
Ankaufkont<strong>in</strong>gente bei allerd<strong>in</strong>gs ger<strong>in</strong>gen Preisen angewiesen. Nur die waldbäuerliche<br />
Wirtschaft verharrte <strong>in</strong> der Subsistenzorientierung der Selbstversorgung.<br />
Doch überall sicherten erst diverse Nebengewerbe wie Bauwirtschaft <strong>und</strong> Waldarbeit<br />
das Überleben der Kle<strong>in</strong>häusler <strong>und</strong> Taglöhner. Die Holzarbeit war <strong>im</strong>mer noch sehr<br />
arbeits<strong>in</strong>tensiv, die Vermarktung durch die Staats- <strong>und</strong> Gutsbetriebe erfolgte schon <strong>im</strong><br />
großen Stil. Auf diese Weise war auch das periphere Bauerndorf stets mit den großen<br />
wirtschaftlichen Konjunkturen verkoppelt. Auch die gesammelten Pilze <strong>und</strong> Beeren<br />
g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> die Verbraucherzentren Prag <strong>und</strong> Wien. Häufig entstanden spezielle Wirtschaftskreisläufe<br />
über alle ethnischen Grenzl<strong>in</strong>ien h<strong>in</strong>weg. So belieferten Baumöhler<br />
Kle<strong>in</strong>bauern die Bauern des Thayaboden südöstlich von Zna<strong>im</strong> mit We<strong>in</strong>stecken <strong>und</strong><br />
Brennholz. Die Bauern des Flachlandes holten regelmäßig <strong>in</strong> best<strong>im</strong>mten Wäldern der<br />
Grenzdörfer das Brennholz. Die Saisonarbeiter <strong>und</strong> die Dienstboten kamen stets aus<br />
demselben Rayon. E<strong>in</strong> spezieller Funktionskreis wurde auch durch die Hengstsprungstation<br />
von Weskau/Bezkov gebildet. Nur die zur Staatsgrenze aufgewertete mährisch-niederösterreichische<br />
Grenze beh<strong>in</strong>derte zeitweise den Wirtschaftsverkehr, ehe<br />
der <strong>in</strong>stitutionalisierte Kle<strong>in</strong>e Grenzverkehr beispielsweise das Vermahlen von niederösterreichischem<br />
Getreide <strong>in</strong> südmährischen Mühlen ermöglichte.<br />
Agrarisch-proletarische Mischtypen<br />
E<strong>in</strong>e spezielle Note ergab sich aus der E<strong>in</strong>beziehung der beiden <strong>in</strong>dustriellen Inseln<br />
Schattau <strong>und</strong> Böhmisch Rudoletz. Hier g<strong>in</strong>g es um die Rekonstruktion der sozialen<br />
<strong>und</strong> politischen Strukturen von Bauerndorf <strong>und</strong> Arbeiterdorf <strong>und</strong> um ihre Berührung<br />
bzw. Bee<strong>in</strong>flussung. Das Arbeiterdorf Schattau entstand seit den 1880er Jahren <strong>im</strong><br />
Nahbereich der Tonwarenfabrik <strong>und</strong> Ziegelei sowie der Eisenbahnstation. Sehr deutlich<br />
lassen sich die soziale Stabilisierung der proletarischen Schichten durch Familienbildung<br />
<strong>und</strong> Verortung durch <strong>in</strong> der Generationenabfolge sowie <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
der politischen Selbstf<strong>in</strong>dung des proletarischen Milieus <strong>und</strong> der räumlichen Viertelbildung<br />
nachzeichnen. So entwickelten sich <strong>in</strong> Schattau zwei differente soziale Strukturen<br />
<strong>und</strong> S<strong>in</strong>nsysteme, beherrscht vom Ethos der agrarischen Ordnung respektive<br />
von der proletarischen Kultur. Die parallele soziale Integration erlaubte dennoch viele<br />
Grenzüberschreitungen, beispielsweise die Rekrutierung der Dienstboten <strong>und</strong> Taglöhner<br />
aus der Arbeiterschaft <strong>und</strong> umgekehrt den Wechsel von Dienstboten <strong>in</strong> die Fabrik,<br />
18 Geme<strong>in</strong>deausschußsitzung Gnadlersdorf, 21. 7. 1906.<br />
19 Geme<strong>in</strong>deausschußsitzung Gnadlersdorf, 2. 7. 1915.<br />
217
so daß viele Biographien förmlich <strong>im</strong> Übergangsfeld der beiden Milieus angesiedelt<br />
s<strong>in</strong>d. Auch die Etablierung von Kle<strong>in</strong>bauern bzw. Häuslerexistenzen stand mit diesen<br />
sozialen Mehrfachb<strong>in</strong>dungen <strong>im</strong> Zusammenhang. Aus der räumlichen Nähe der beiden<br />
Dörfer <strong>im</strong> Dorf ergaben sich die typischen Konflikte e<strong>in</strong>er fragmentierten Gesellschaft,<br />
z. B. Felddiebstahl, unterschiedliche Haltung zur Kirche, sehr differente Interessen<br />
auf der <strong>in</strong>stitutionalisierten Geme<strong>in</strong>deebene. Andererseits förderten die sozialen<br />
Interaktionen <strong>und</strong> die Kenntnis des räumlich so nahen „Anderen“ e<strong>in</strong>en gewissen M<strong>in</strong><strong>im</strong>alkonsens.<br />
Dazu kamen die agrarische Herkunft der Industriearbeiter <strong>und</strong> das Inseldase<strong>in</strong><br />
der Arbeiterschaft mitten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geschlossenen <strong>und</strong> selbstbewußten agrarischen<br />
Ambiente. Daher blieben best<strong>im</strong>mte Elemente von agrarischer Dorfkultur<br />
auch für die Arbeiterschaft verb<strong>in</strong>dlich, etwa die gelockerte Kirchenb<strong>in</strong>dung <strong>und</strong><br />
Brauchtumsformen. Es ist bezeichnend, daß auch das Arbeiterdorf an kirchlichen Anlässen<br />
wie Kirtagen <strong>und</strong> dem österlichen Ratschen festhielt. In Böhmisch Rudoletz<br />
war die Verb<strong>in</strong>dung mit der agrarischen Sozial- <strong>und</strong> S<strong>in</strong>nstruktur noch enger, da auch<br />
die halbproletarischen Existenzen <strong>in</strong> agrarischen Bereichen wie <strong>im</strong> Forst, <strong>in</strong> den Mühlen<br />
<strong>und</strong> den landwirtschaftlichen Verarbeitungsbetrieben beschäftigt waren. Ansätze<br />
zu e<strong>in</strong>er proletarischen Gruppenbildung waren so viel weniger gegeben, auch dadurch,<br />
daß zumeist die für die Subsistenz notwendigen Formen agrarischer Kle<strong>in</strong>wirtschaften<br />
beibehalten wurden. Diese komplexen Mischformen kennt man übrigens<br />
auch aus der proletarischen Diaspora Westösterreichs.<br />
Das Gesamtdorf<br />
Die genossenschaftlichen Strukturen der Agrardörfer waren noch weitgehend <strong>in</strong>takt. <strong>20</strong><br />
Die Höfe waren durch viele alltägliche <strong>und</strong> außerordentliche Notwendigkeiten aufe<strong>in</strong>ander<br />
angewiesen, wie nachbarschaftliche Hilfe, geme<strong>in</strong>samer Ankauf von Masch<strong>in</strong>en,<br />
Hilfe bei Bränden, Bürgschaften bei Krediten. Die funktionale Integration<br />
umschloß e<strong>in</strong>e bescheidene Palette des Dorfhandwerks, das waren die zumeist auch<br />
landwirtschaftlich begüterten Schmiede, Wagner, Gemischtwarenhändler <strong>und</strong> Wirte<br />
sowie die Kle<strong>in</strong>häuslerexistenzen Schneider(<strong>in</strong>) <strong>und</strong> Schuster. Selbst die Pfarrer waren<br />
durch die Pfarrwirtschaft <strong>in</strong>s ökonomische Dorfleben e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Pfarrer <strong>und</strong><br />
Lehrer handelten jedoch <strong>im</strong> kirchlichen <strong>und</strong> staatlichen Auftrag <strong>und</strong> waren daher nur<br />
partiell <strong>in</strong>s Dorf <strong>in</strong>tegriert. Daraus konnten typische Konflikte entstehen, etwa zwischen<br />
kirchlicher <strong>und</strong> weltlicher Norm oder zwischen traditionsbewußten Bauern <strong>und</strong><br />
dem gebildeten Modernisierungselan des Lehrers. (E<strong>in</strong>e eigene Geme<strong>in</strong>de unterstützte<br />
die dörfliche B<strong>in</strong>nenorientierung.) Viele wirtschaftliche Steuerungsfunktionen waren<br />
<strong>in</strong>stitutionell auf Geme<strong>in</strong>deebene geregelt, beispielsweise die Bestellung der Feld-<br />
<strong>20</strong> Es handelte sich bei Gnadlersdorf/Hnanice, Baumöhl/Podmolí, Luggau/Lukov <strong>und</strong> den<br />
Dörfern des Gebietes um Böhmisch Rudoletz/C+eský Rudolec wirklich noch um Bauerndörfer<br />
mit mehrheitlich agrarischer Bevölkerung. Auch <strong>in</strong> den gemischtwirtschaftlichen Orten<br />
Schattau/S+atov <strong>und</strong> Böhmisch-Rudoletz/C+eský Rudolec war noch etwa jeweils die Hälfte<br />
der Bevölkerung <strong>in</strong> der Landwirtschaft beschäftigt.<br />
218
<strong>und</strong> We<strong>in</strong>gartenhüter, das herbstliche „Schließen“ der We<strong>in</strong>gärten e<strong>in</strong>ige Wochen vor<br />
der Lese, Ankauf <strong>und</strong> Haltung des Geme<strong>in</strong>destiers, Ausbesserung von Wegen <strong>und</strong><br />
Brücken, die geme<strong>in</strong>schaftliche Nutzung der Allmende, die Verpachtung der geme<strong>in</strong>deeigenen<br />
Gr<strong>und</strong>stücke, Anpflanzung der Obstbäume <strong>und</strong> Lizitation ihrer Früchte.<br />
Die Geme<strong>in</strong>deausschußprotokolle von Oberradischen/Horní Radíkov kreisen die Jahre<br />
über um die Errichtung e<strong>in</strong>er Straßenverb<strong>in</strong>dung. In Baumöhl <strong>und</strong> <strong>in</strong> Schattau wurden<br />
zur Beschäftigung von Arbeitslosen Straßenbauarbeiten <strong>in</strong> Angriff genommen.<br />
Dazu kamen sicherheitspolizeiliche Agenden des Bürgermeisters, etwa bei öffentlichen<br />
Feiern <strong>und</strong> Tänzen. Doch auch <strong>im</strong> engeren volkskulturellen Bereich waren dem<br />
Bürgermeister gewohnheitsmäßig best<strong>im</strong>mte Aufgaben überantwortet. Beispielsweise<br />
mußte er den von der Dorfburschenschaft gewählten Ersten Burschen bestätigen. Auf<br />
vielen kulturellen <strong>und</strong> moralischen Gebieten war außerdem e<strong>in</strong> Zusammenwirken<br />
beider „Dorfobrigkeiten“, von Bürgermeister <strong>und</strong> Pfarrer, angebracht, etwa bei der<br />
feierlichen Bischofsvisitation oder zur Anschaffung e<strong>in</strong>es würdigen Geläutes der<br />
Pfarrkirche. E<strong>in</strong>ige staatliche Aufgaben, etwa die Durchführung von Wahlen für die<br />
diversen Vertretungskörperschaften <strong>und</strong> die Mitwirkung an der Rekrutierung besorgte<br />
die Geme<strong>in</strong>de überhaupt <strong>im</strong> „übertragenen Wirkungsbereich“.<br />
E<strong>in</strong> zweiter Aufgabenkreis betraf die Positionierung der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> Beziehung<br />
zu Nachbargeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> zu den höheren Instanzen von Land <strong>und</strong> Staat <strong>und</strong> Selbstverwaltungskörpern.<br />
Hier galt der Gr<strong>und</strong>satz, <strong>in</strong>tern e<strong>in</strong>en Ausgleich zwischen verschiedenen<br />
sozialen <strong>und</strong> Gruppen<strong>in</strong>teressen zu f<strong>in</strong>den, um die Dorf<strong>in</strong>teressen gegen<br />
außen durchzusetzen. Die agrarischen Monostrukturen erleichterten diesen Konsens.<br />
Hier widerspiegelte die Zusammensetzung der Geme<strong>in</strong>deausschüsse lediglich die<br />
dörflichen sozialen Gruppen<strong>in</strong>teressen. Nicht zufällig waren Bürgermeister <strong>und</strong> die<br />
Geme<strong>in</strong>deausschußmitglieder zumeist Bauern, allenfalls ergänzt durch Gewerbetreibende<br />
<strong>und</strong> den Lehrer. In den agrarisch-proletarischen Mischtypen jedoch häuften<br />
sich auch national deutbare Interessenkonflikte.<br />
E<strong>in</strong> spezielles Problem entstand den Geme<strong>in</strong>den freilich durch die modernen Formen<br />
politischer Organisation, Partizipation <strong>und</strong> Lagerbildung. Politik bedroht die<br />
E<strong>in</strong>heit der Geme<strong>in</strong>den. Für die deutschen Bauerngeme<strong>in</strong>den kam dabei vor allem der<br />
Dissens zwischen katholisch-politisch/christlichsozial <strong>und</strong> deutschnational/agrarisch<br />
<strong>in</strong> Frage, <strong>in</strong> agrarisch-proletarischen Mischtypen ergänzt durch Arbeiterparteien. Diese<br />
politischen Polaritäten wurden <strong>in</strong> ethnisch gemischten Orten auf jeweils zwei Varianten<br />
zerlegt. Sie werden <strong>im</strong> Zusammenhang mit der nationalen Orientierung behandelt,<br />
welche gleichfalls e<strong>in</strong>e zentrale politische E<strong>in</strong>speisung betrifft. Auf Geme<strong>in</strong>deebene<br />
war Parteipolitik <strong>in</strong> den Bauerndörfern nur selten handlungsleitend, da sie ke<strong>in</strong>e<br />
Orientierung für <strong>in</strong>nerdörfliche Problemlagen anbot. Ihre Organisationskapazität bezog<br />
sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf die Partizipation auf den höheren politischen Ebenen von<br />
Land <strong>und</strong> Staat. Größere Bedeutung erlangte Politik jedoch <strong>in</strong> den wirtschaftlichsozialen<br />
Mischtypen sowie generell <strong>im</strong> Politisierungsschub der Dreißigerjahre.<br />
219
Kommunikative Integration der Dörfer<br />
Der Hof bildete den <strong>in</strong>neren Kern der sozialen Welt sowohl für die Inhaberfamilie,<br />
die Dienstboten sowie temporär für die Taglöhner oder mitarbeitenden Kle<strong>in</strong>häusler,<br />
die <strong>in</strong> aller Regel dauernde B<strong>in</strong>dungen zu best<strong>im</strong>mten Höfen unterhielten. Der Hof<br />
war auch räumlich „geschlossen“. Nur zur Erntezeit, sobald die Gurkene<strong>in</strong>käufer erwartet<br />
wurden, blieb <strong>im</strong> We<strong>in</strong>baugebiet das Hoftor sogar spätabends offen. Die enge<br />
B<strong>in</strong>dung an den Hof bedeutete für den e<strong>in</strong>zelnen Kontrolle, Fehlen von Privatheit,<br />
Leben <strong>in</strong> abgezirkelten sozialen <strong>und</strong> topographischen Räumen, je nach Stellung <strong>in</strong> der<br />
Hofhierarchie, nach Geschlecht, Alter, Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> Stand. Selbst der außerhäusliche<br />
Handlungsspielraum war durch die geme<strong>in</strong>schaftliche Feld- <strong>und</strong> We<strong>in</strong>gartenarbeit<br />
der Hofangehörigen best<strong>im</strong>mt. Die Nachbarschaft war daher be<strong>in</strong>ahe<br />
<strong>im</strong>mer der erste außerhäusliche Kommunikationskreis, <strong>und</strong> zwar be<strong>im</strong> Fehlen von<br />
Verwandtschaft auch für Hilfeleistungen. Weder e<strong>in</strong>e besondere Nähe von Alterskohorten<br />
noch e<strong>in</strong>e sonst auf Zuneigung, nicht auf ökonomischer Notwendigkeit beruhende<br />
B<strong>in</strong>dung zwischen nicht verwandten Familien war festzustellen. Mehr Freiheit<br />
<strong>in</strong> bezug auf Fre<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> freien Umgang <strong>und</strong> selbst Zutritt zu den Häusern<br />
genossen die heranwachsenden K<strong>in</strong>der. Die Sozialisationskraft von Kirche <strong>und</strong> Gasthaus<br />
kommt noch zur Sprache.<br />
Insgesamt bildete das Dorf für die Mehrheit se<strong>in</strong>er Bewohner die erste <strong>und</strong> be<strong>in</strong>ahe<br />
ausschließliche Erfahrungswelt. Nur zu den Kirtagen, zu den Wallfahrten, zur Firmung,<br />
zum Markt <strong>im</strong> nächsten Zentralort <strong>und</strong> zur Erlernung der Nachbarsprachen auf<br />
der Basis von zeitweiligem K<strong>in</strong>deraustausch – den sogenannten „Wechsel“ – mußte<br />
das Dorf verlassen werden. E<strong>in</strong>en wichtigen E<strong>in</strong>schnitt bildeten Rekrutierung, Militärzeit<br />
<strong>und</strong> Kriegsdienst <strong>im</strong> Ersten Weltkrieg. Im Untersuchungszeitraum vollzog sich<br />
allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e wichtige Ausdehnung der Erfahrungswelt durch den jetzt häufigen Besuch<br />
der Bürgerschule vor allem von Söhnen, vere<strong>in</strong>zelt auch Töchtern reicherer Bauern<br />
der We<strong>in</strong>bau- <strong>und</strong> Getreidebauzone. Kaum zufällig wurde <strong>in</strong> den Dreißigerjahren<br />
der Schulweg durch die anderssprachigen Dörfer nach Zna<strong>im</strong>/Znojmo häufig von nationalen<br />
Gehässigkeiten gekennzeichnet. Auch die bäuerlichen Fortbildungsschulen<br />
brachten neue Informationen <strong>und</strong> Deutungsangebote <strong>und</strong> wurden prompt zu e<strong>in</strong>er<br />
Agentur des Nationalismus. Im Waldbauerngebiet nutzten die K<strong>in</strong>der der zugewanderten<br />
tschechischen Tagelöhner das vom tschechoslowakischen Staat bereitgestellte<br />
Bildungsangebot, was auf e<strong>in</strong>e rasche Rezeption der bürgerlichen Orientierungs- <strong>und</strong><br />
Aufstiegsmuster schließen läßt. Gegen Ende der Dreißigerjahre entgrenzte das städtische<br />
Freizeitangebot, vor allem das K<strong>in</strong>o, tendenziell die dörflichen Begegnungs- <strong>und</strong><br />
Erfahrungshorizonte. Wieder ist die leichte Überw<strong>in</strong>dbarkeit der Staatsgrenze festzustellen,<br />
da die Gnadlersdorfer beispielsweise vorwiegend das K<strong>in</strong>o <strong>im</strong> niederösterreichischen<br />
Nachbarort Retzbach frequentierten. Auch ihr Erspartes brachten sie sowohl<br />
<strong>in</strong> Zna<strong>im</strong> wie <strong>im</strong> niederösterreichischen Retzbach auf die Sparkasse. Fahrrad <strong>und</strong> Motorrad<br />
erhöhten die Mobilität ungeme<strong>in</strong>, <strong>und</strong> zwar weniger für die Arbeitsbeziehungen<br />
als für die Freizeit. Der Weltkrieg unterbrach jäh diese Entwicklung.<br />
2<strong>20</strong>
Normative <strong>und</strong> kulturelle Integration der Dörfer<br />
Erst mit der normativen <strong>und</strong> kulturellen Dorf<strong>in</strong>tegration wird die lebensweltliche D<strong>im</strong>ension<br />
der Untersuchung <strong>im</strong> engeren S<strong>in</strong>ne erreicht. Der soziologische Lebensweltbegriff<br />
ist auf der subjektiven Ebene angesiedelt. Lebenswelt bedeutet daher die D<strong>im</strong>ension<br />
der Auslegung von Wirklichkeit durch den e<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> kommunikativ<br />
vernetzte Personengruppen. Es ist die „reflexive Zuwendung“ zu erlebtem Handeln <strong>in</strong><br />
Form von Nachdenken, kultureller Praxis <strong>und</strong> Alltagshandeln, welche S<strong>in</strong>n erzeugt,<br />
<strong>und</strong> zwar <strong>in</strong> der Begegnung mit anderen, nicht als <strong>in</strong>dividueller Akt, so daß man Lebenswelten<br />
auch zugleich als S<strong>in</strong>nprov<strong>in</strong>zen, <strong>in</strong> unserem Falle die dörfliche, mit <strong>in</strong>tersubjektiver<br />
Gültigkeit bezeichnen kann. Geme<strong>in</strong>same Erfahrungen werden <strong>in</strong> diesem<br />
Aneignungsvorgang zum lebensweltlichen Wissensvorrat <strong>und</strong> zur Rout<strong>in</strong>e verdichtet,<br />
welche <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit biographischen Komponenten soziales Handeln steuern. 21<br />
Lebenswelt besitzt e<strong>in</strong>e relativ dauerhafte Struktur, weil nur Kont<strong>in</strong>uität ungestörtes<br />
Alltagshandeln ermöglicht. Im Rout<strong>in</strong>efall reicht der erworbene Wissensvorrat zur<br />
Deutung aktueller Entscheidungssituationen bzw. muß nur unwesentlich durch neue<br />
Wissensquellen bereichert werden. Trotz aller Stabilität der wirtschaftlichen <strong>und</strong> sozialen<br />
Verhältnisse <strong>und</strong> trotz e<strong>in</strong>er mächtigen Tradition unterlag jedoch auch das<br />
südmährische Dorf laufender Veränderung, nicht zuletzt be<strong>im</strong> Generationenwechsel.<br />
Wir haben es so gesehen mit e<strong>in</strong>er Abfolge von Dörfern <strong>im</strong> Zeitkont<strong>in</strong>uum zu tun.<br />
Das südmährische Dorf besaß jedoch große Anpassungskapazität an solche Veränderungen<br />
der Umwelt. Erst das <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert entriß den Dörfern diese Adaptionskompetenz.<br />
Die großen Zäsuren der Jahre 1938, 1945 <strong>und</strong> 1948 s<strong>in</strong>d nicht zufällig mit<br />
der Zerstörung der tradierten Dörfer <strong>und</strong> ihrer Rekonstruktion als willige Subjekte<br />
staatlich-politischer Zentralgewalt verb<strong>und</strong>en.<br />
Normatives Wissen ist e<strong>in</strong> sperriger Gegenstand. So viel ist klar, es geht um regelgeb<strong>und</strong>ene<br />
Wahrnehmung, feste Bedeutungszuschreibungen sozialer Umweltfaktoren<br />
<strong>und</strong> Konstellationen sowie verb<strong>in</strong>dliche Gr<strong>und</strong>annahmen über die zentralen Lebensvollzüge<br />
von Arbeit, Besitz, Nutzungsrechten, Ehre, Kommunikation, Spiritualität,<br />
Habitus, Sexualverhalten usf. Die untersuchten Dörfer bildeten auf dieser Ebene e<strong>in</strong>e<br />
durch Normen <strong>in</strong>tegrierte abgegrenzte S<strong>in</strong>nwelt. Anders formuliert: s<strong>in</strong>ngeleitete soziale<br />
Praxis konstituierte den sozialen Zusammenhang „Dorf“ <strong>und</strong> honorierte besondere<br />
Verdienste bzw. sanktionierte gegebenenfalls Regelverletzungen. Solche S<strong>in</strong>nbezüge<br />
können nur <strong>in</strong>direkt aus sozialem Handeln, besonders aus er<strong>in</strong>nerten biographischen<br />
Schlüsselszenen, allenfalls unter vorsichtiger E<strong>in</strong>beziehung erzählter E<strong>in</strong>schätzungen<br />
<strong>und</strong> Deutungen, abgeleitet werden. Beispielsweise war die große Bedeutung<br />
von Gr<strong>und</strong>besitz <strong>im</strong> Denken <strong>und</strong> Handeln der Dorfbewohner aus allen Interviews<br />
zu erkennen. Ererbter Gr<strong>und</strong>besitz sollte zum m<strong>in</strong>desten bewahrt, jedoch nach<br />
Möglichkeit vermehrt werden. Diese Weisheit entsprach e<strong>in</strong>er ökonomischen Ordnung,<br />
die bis zuletzt direkt oder <strong>in</strong>direkt auf der Nutzung von Gr<strong>und</strong>besitz beruhte.<br />
Sie reflektiert aber zugleich die Werte e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> Bewegung geratenen Ordnung, <strong>in</strong> der<br />
21<br />
BERNHARD MIEBACH: Soziologische Handlungstheorie. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung, Darmstadt 1991,<br />
S. 127-152.<br />
221
nicht nur das Erbe, sondern auch die <strong>in</strong>dividuelle Tüchtigkeit über die Verteilung von<br />
Lebenschancen best<strong>im</strong>mte. Die dörfliche Gesellschaft taxierte daher sehr präzise<br />
Fleiß, Sparsamkeit <strong>und</strong> Lebensführung. Bis heute werden die beiden nach Luggau zugewanderten<br />
tschechischen Bauern nach ihrer Tüchtigkeit beurteilt, <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong> seltener<br />
Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung von allen deutschen <strong>und</strong> tschechischen Respondenten der e<strong>in</strong>e<br />
als tüchtig, der andere als glücklos wirtschaftender. Die agrarische Wertordnung<br />
hatte Vorrang vor der Wahrnehmung ethnischer Divergenz. So verurteilten tschechische<br />
Altsiedler mehrmals den „Abschub“ e<strong>in</strong>es Dorfgenossen mit der Begründung,<br />
der Betreffende sei doch e<strong>in</strong> guter <strong>und</strong> fleißiger Bauer gewesen. 22<br />
Leichter zugänglich ist die kulturelle Integration. Kultur ist e<strong>in</strong>e Form der Deutung<br />
<strong>und</strong> Interpretation bestehender Verhältnisse. Sie bietet die Möglichkeit, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
eigenen Formensprache, mit überlieferten Regeln <strong>und</strong> zu best<strong>im</strong>mten Anlässen den<br />
Alltag gleichzeitig zu überhöhen <strong>und</strong> dennoch die Gr<strong>und</strong>struktur der Besitzordnung,<br />
der Verteilung von Lebenschancen, der Arbeitsweise <strong>und</strong> der geltenden Normen zu<br />
bestätigen. Populare Alternativkultur zur f<strong>und</strong>amentalen Kritik der Verhältnisse spielte<br />
<strong>im</strong> Untersuchungsgebiet ke<strong>in</strong>e Rolle, Subkultur e<strong>in</strong>zelner Substrate, etwa der Saisonarbeiter<br />
oder der jüdischen Diaspora, waren nicht faßbar. Die dörfliche Kultur war<br />
somit affirmativ zur bestehenden zivilisatorischen Ordnung. Ihre stabilisierende Wirkung<br />
erzielte sie vor allem durch ihre Angebote zur Lebensbewältigung, seien es<br />
kirchlich sanktionierte Glaubensüberzeugungen <strong>und</strong> Frömmigkeitspflege, seien es<br />
nicht sanktionierte Heilangebote wie Aberglaube <strong>und</strong> Magie. 23 Popularkulturelle<br />
Überzeugungen <strong>und</strong> Umgangsformen unterliegen zwar <strong>in</strong> Brauch <strong>und</strong> Gebrauch der<br />
„autochthonen“ stilistischen Tradition <strong>und</strong> Anwendungspraxis. Sie s<strong>in</strong>d dennoch zumeist<br />
weiter verbreitete, lediglich lokal variierte Muster, die außerdem <strong>in</strong> ihrer geschichtlichen<br />
Genese durch viele Fäden mit hochkulturellen, oft obrigkeitlich verordneten<br />
Kulturformen verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. Das gilt <strong>in</strong> besonderem Maße für die seit dem<br />
Trident<strong>in</strong>um zentralistisch <strong>und</strong> obrigkeitlich normierten katholischen Glaubens- <strong>und</strong><br />
Frömmigkeitsformen.<br />
Als erste kulturelle Instanz ist die katholische Kirche, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Dörfern des westlichen<br />
Untersuchungsgebietes zusätzlich die Böhmische Brüdergeme<strong>in</strong>de zu nennen.<br />
Die meisten der untersuchten Dörfer waren zugleich Pfarren, <strong>in</strong> allen Dörfern befanden<br />
sich zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e durchaus geräumige Kapelle sowie e<strong>in</strong> Friedhof. Der sonntägliche<br />
Gottesdienst vere<strong>in</strong>te die ganze Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> der Pfarrkirche, nur die Frauen<br />
besuchten häufig die Frühmesse. Die weite Entfernung vom Pfarrort erschwerte <strong>in</strong><br />
den kle<strong>in</strong>eren Dörfern des westlichen Untersuchungsgebietes den Kirchgang. Außerdem<br />
waren hier die Angehörigen der halb agrarisch-proletarischen Schicht laue Kirchengänger.<br />
Die Mitglieder der böhmischen Brüderkirche wurden <strong>in</strong> der dörflichen<br />
Umgebung stets als „anders“, wenn auch nicht als „fremd“ wahrgenommen. In Böhmisch-Rudoletz<br />
wurde der e<strong>in</strong>zige Angehörige der „Böhmischen Brüder“ von beiden<br />
22 Vgl. Interviews H. <strong>und</strong> P., Unterradischen/Dolní Radníkov.<br />
23 BOHUSLAV BENEŠ: Gibt es noch e<strong>in</strong>e Volkskultur? Jahreszeitliche Bräuche <strong>in</strong> Südmähren<br />
<strong>und</strong> Niederösterreich, <strong>in</strong>: Kulturen an der Grenze, hrsg. von ANDREA KOMLOSY, VÁCLAV<br />
BU`Z=EK <strong>und</strong> FRANTIŠEK SVÁTEK, Wien 1995, S. 255-262.<br />
222
Seiten abschätzig beurteilt, „der katholische Glaube, das war ja das Verb<strong>in</strong>dende“. 24<br />
Interkonfessionelle Ehen waren ungleich seltener als <strong>in</strong>terethnische Ehen <strong>und</strong> kamen<br />
be<strong>in</strong>ahe nur <strong>im</strong> agrarisch-proletarischen Mischmilieu vor. Die „Böhmischen Brüder“<br />
hatten e<strong>in</strong>en Weg von zehn Kilometern zu ihrer Pfarrkirche Groß Lhota/Velká Lhota.<br />
Erst 1933 wurde <strong>im</strong> nahen Walterschlag/Valt<strong>in</strong>ov e<strong>in</strong>e Seelsorgstation der Brüderkirche<br />
e<strong>in</strong>geweiht. Ihren Verstorbenen blieb auch das Glockengeläute der Dorfkapelle<br />
Oberrasdischen bis 1948 (!) verwehrt. Alle Angehörigen der Brüderkirche waren aus<br />
der etwa zehn Kilometer entfernten, fünf Dörfer umfassenden religiösen Enklave<br />
Groß Lhota zugewandert.<br />
Die katholische Osterbeichte, das Eheaufgebot, die Versehgänge wurden <strong>in</strong> der<br />
üblichen Weise e<strong>in</strong>gehalten. Erst <strong>im</strong> anwachsenden Deutschnationalismus der Dreißigerjahre<br />
verloren e<strong>in</strong>zelne Formen dieser kirchlich geprägten öffentlichen Kulte an<br />
Verb<strong>in</strong>dlichkeit, <strong>in</strong>dem beispielsweise <strong>in</strong> Schattau dem zur Visitation ankommenden<br />
Bischof be<strong>in</strong>ahe der übliche Triumphbogen am Ortse<strong>in</strong>gang verwehrt wurde. Die Beliebtheit<br />
mancher Pfarrer war e<strong>in</strong>e Folge ihrer Freigiebigkeit. Die meisten Pfarrer<br />
auch der deutschen Dörfer waren Tschechen von Herkunft <strong>und</strong> Bekenntnis, sie beherrschten<br />
jedoch das Deutsche fehlerfrei. Klagen über e<strong>in</strong>e Bevorzugung der e<strong>in</strong>en<br />
oder anderen Sprache s<strong>in</strong>d bisher <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigen Falle überliefert, e<strong>in</strong> Zeichen für<br />
die vermittelnde Funktion des Klerus <strong>im</strong> Nationalitätenkampf. Das Glaubensleben<br />
wurde vom „politischen Katholizismus“ durch neue, teils auch auf Vere<strong>in</strong>sbasis organisierte<br />
Formen bereichert. Standesbündnisse für unverheiratete Männer s<strong>in</strong>d aus<br />
Schattau überliefert. Neben Kirche <strong>und</strong> Pfarrer existierten auch die popularen autonomen<br />
Frömmigkeitsformen, etwa Bittgänge sowie kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> große Wallfahrten.<br />
Bildstöcke <strong>und</strong> Kreuze prägten die südmährische Sakrallandschaft.<br />
In popularkultureller H<strong>in</strong>sicht waren die Dörfer erstaunlich homogen, bezogen auf<br />
die Verb<strong>in</strong>dlichkeit der volkskulturellen Praxis <strong>in</strong> ihren überlieferten <strong>und</strong> von allen<br />
problemlos „erkannten“ Formen <strong>und</strong> Funktionen. Die <strong>im</strong> agrarischen Bereich entstandene<br />
Popularkultur wurde auch von den agrarisch-<strong>in</strong>dustriellen Mischtypen, e<strong>in</strong>zelne<br />
Formen sogar von der großen <strong>in</strong>dustriellen Enklave Schattau tradiert. „Brauchtum“<br />
diente beispielsweise zur Untergliederung der Zeit <strong>in</strong> Tag, Woche, Jahr <strong>und</strong> Leben,<br />
zur Verdeutlichung der biographischen Zäsuren, zur Regeneration <strong>in</strong> der arbeitsfreien<br />
Zeit, zur Ordnung des alltäglichen Umgangs etwa durch Grußsitten <strong>und</strong> Umgangsformen,<br />
zur Festlegung oder Bestätigung von Geltungshierarchien, zur Regelung des<br />
Heiratsmarktes sowie zur bereits besprochenen Lebensbewältigung, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong><br />
Notzeiten. Die Brauchtumsformen trugen weiters vielfach zur Schlichtung von Konflikten<br />
<strong>in</strong>sbesondere zwischen den Generationen bei. Überhaupt bildete die durch<br />
Konventionen geregelte Konkurrenz, etwa Kräftemessen oder Wetts<strong>in</strong>gen, e<strong>in</strong> wesentliches<br />
Pr<strong>in</strong>zip volkskultureller Praxis. Von zentraler Bedeutung war sodann die<br />
Selbstdarstellung des Dorfes, etwa der Empfang der auswärtigen Burschen an der<br />
Dorfgrenze, der Besuch auswärtiger Kirtage durch die Dorfburschenschaft oder die<br />
rigorose Zurückweisung fremder Bewerber um die he<strong>im</strong>ischen Mädchen. E<strong>in</strong>en eigentümlichen<br />
rituellen Residualbestand bildete die alljährliche Begehung der Ge-<br />
24 Interview M. aus Böhmisch Rudoletz/C+eský Rudolec.<br />
223
me<strong>in</strong>degrenzen, welche die besondere Bedeutung des Gr<strong>und</strong>besitzes sowie die<br />
Reichweite des Dorfes <strong>im</strong> topographischen Weichbild <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung rief.<br />
Die Dorfviertel bzw. die Dorfzwill<strong>in</strong>ge bildeten partiell eigene dörfliche Strukturen<br />
mit Wirtshaus <strong>und</strong> Dorfburschenschaft. So gab es beispielsweise <strong>in</strong> Luggau <strong>und</strong><br />
<strong>im</strong> Luggauer Neudörfl jeweils Wirtshaus <strong>und</strong> Burschenschaft. Auch aus Gnadlersdorf<br />
wird aus älterer Zeit von zwei getrennten Burschenschaften berichtet, <strong>und</strong> noch <strong>im</strong><br />
Untersuchungszeitraum der Dreißigerjahre war die Gnadlersdorfer Burschenschaft<br />
<strong>in</strong>tern <strong>in</strong> den „Kellerklub“ der reichen Bauernsöhne <strong>und</strong> die „Außerörtler“ der Häusler<br />
untergliedert. 25 Die beiden Luggauer Burschenschaften kamen jedoch häufig an<br />
der Grenze zwischen beiden Teildörfern oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der beiden Dorfwirtshäuser<br />
zusammen. Auch gegen außen traten sie zumeist geme<strong>in</strong>sam auf, etwa bei Kirtagsbesuchen.<br />
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß e<strong>in</strong> struktureller Zusammenhang zwischen<br />
agrarischem Ökotypus <strong>und</strong> Ethnizität bzw. Nationalität nicht zu erkennen war,<br />
weder <strong>in</strong> den zweisprachigen Dörfern noch zwischen deutschen <strong>und</strong> tschechischen<br />
Mehrheitsdörfern <strong>und</strong> auch nicht entlang der mährisch-niederösterreichischen Adm<strong>in</strong>istrativgrenze.<br />
Wirtschaftsform, Besitzverteilung, Erbgewohnheiten, Kultur <strong>und</strong><br />
normatives Wissen folgten den agrarischen Notwendigkeiten, <strong>und</strong> sie zeigten nirgends<br />
ethnisch bed<strong>in</strong>gte Varianten. Nur <strong>in</strong>direkt bewirkten die <strong>in</strong>stabilen Besitzverhältnisse<br />
<strong>im</strong> Getreidegebiet sowie <strong>im</strong> reagrarisierten Industriegebiet e<strong>in</strong>e Zuwanderung<br />
tschechischer Bauern <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>häusler. Auch entlang der Adm<strong>in</strong>istrativgrenze<br />
zwischen Mähren <strong>und</strong> Niederösterreich läßt sich ke<strong>in</strong>e derartige ökologische Grenze<br />
feststellen. Sogar <strong>in</strong> den komplexen Mischtypen war die ethnische Raumbildung lediglich<br />
e<strong>in</strong>e Folge der sozialen Gruppierung. Dieses Ergebnis kontrastiert auffällig<br />
mit ethnographischen Paralleluntersuchungen. Bekannt ist die Differenzierung der<br />
agrarischen Wirtschaftsform entlang von ethnischen Gruppierungen <strong>in</strong> der Batschka,<br />
<strong>im</strong> Banat, <strong>in</strong> Siebenbürgen, Nordungarn-Transkarpatien usf. Dort war die Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung<br />
zwischen Wirtschaftsform <strong>und</strong> Ethnos e<strong>in</strong>e Folge der Zuwanderung von<br />
Siedlern <strong>in</strong> mehreren Schüben vom Mittelalter über die merkantilistische Neusiedlung<br />
<strong>und</strong> die nachfolgende B<strong>in</strong>nenkolonisation. So kam es, daß nebene<strong>in</strong>ander ungarische,<br />
serbische, deutsche oder rumänische Dörfer mit ihrer jeweils spezifischen Wirtschaftsform<br />
lagen <strong>und</strong> häufig sogar ethnische Dorfviertel unterschiedliche Wirtschaftsformen<br />
kultivierten. 26 In anderen Fällen ist die ethnosoziale Struktur durch soziale<br />
Hierarchien geschichtet, so daß beispielsweise ruthenisch-ukra<strong>in</strong>ische Bauern<br />
<strong>und</strong> polnische Gutsherrschaft benachbart lebten. Wieder <strong>in</strong> anderen Fällen wird die<br />
ethnische Differenzierung von Wirtschaftsweise, Agrarverfassung <strong>und</strong> Erbformen auf<br />
die Prägekraft der nationalen Zivilisationen an der Sprachgrenze zurückgeführt. So<br />
läuft bis heute am Südtiroler Nonsberg die „unsichtbare“ germanisch-romanische<br />
25 Gnadlersdorf, Interview R., S. 25-29.<br />
26 Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen <strong>und</strong> ihre Nachbarn, hrsg. von IN-<br />
GEBORG WEBER-KELLERMANN, Frankfurt Ma<strong>in</strong> 1978.<br />
224
Kulturgrenze exakt zwischen den Bergdörfern St. Felix <strong>und</strong> Tret. 27 Man muß also <strong>in</strong><br />
Südmähren auf fe<strong>in</strong>e Zeichen <strong>und</strong> schwach konturierte Bilder achten, wenn man <strong>in</strong><br />
dieser sonst so homogenen „grenzenlosen“ Sozialwelt dennoch das Ethnische <strong>und</strong> Nationale<br />
erkennen will.<br />
Erst die mikroanalytische Tiefenschärfe aufgr<strong>und</strong> von lebensgeschichtlichen Befragungen<br />
<strong>und</strong> Volkszählungsdaten erlaubte tatsächlich auf Dorfebene die Rekonstruktion<br />
von sprachlich-ethnisch-nationalen Deutungskulturen auf Begegnungsebenen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Beziehungsnetzen. Dabei zeigte sich, daß die ethnisch-nationalen Kategorien<br />
nicht alle<strong>in</strong> aus fremder <strong>und</strong> störender E<strong>in</strong>speisung <strong>in</strong> lokale Deutungskulturen<br />
entstanden, sondern auch „autonome“ Reglements von Dorf <strong>und</strong> Region bildeten. Die<br />
soziale Organisationskapazität von deutsch <strong>und</strong> tschechisch war <strong>in</strong>sgesamt auf den<br />
drei Ebenen von Sprachverwendung, Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität zu erkennen.<br />
Deutsche <strong>und</strong> Tschechen <strong>im</strong> agrarischen Kontext: Sprachverwendung <strong>und</strong><br />
Ethnizität<br />
In der Sprachverwendung spielte die numerische Stärke der jeweiligen Sprachgruppen<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Im vorwiegend deutschen oder tschechischen agrarischen<br />
Dorf galt als außerhäusliche Umgangssprache die Sprache der Mehrheit. Zahlenmäßig<br />
unbedeutende M<strong>in</strong>derheiten, zumeist nur wenige Familien, häufig der unterbäuerlichen<br />
bzw. proletarischen Schicht angehörend, paßten sich <strong>im</strong> außerhäuslichen Umgang<br />
sprachlich an ihre Umgebung an. (Zu schwach für den Aufbau eigener ethnisch<br />
gefärbter Folklore waren sie <strong>in</strong> den popularkulturellen dörflichen Kontext e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.<br />
So gehörten auch die wenigen Gnadlersdorfer tschechischen Jugendlichen zur<br />
dörflichen Burschenschaft.) Solche verstreuten M<strong>in</strong>derheiten waren sogar trotz staatlicher<br />
Förderung <strong>in</strong> Wahrheit nicht gegen e<strong>in</strong>e völlige Ass<strong>im</strong>ilation geschützt. Die zugewanderten<br />
Familien behielten zwar die mitgebrachte Haussprache, sie verloren diese<br />
jedoch <strong>in</strong> der nächsten Generation. Häufig zeigte sich be<strong>im</strong> Wechsel der politischen<br />
Machtverhältnisse die Erfolglosigkeit aller Bemühungen, Streum<strong>in</strong>derheiten zu<br />
stabilisieren, da sich nun die Ass<strong>im</strong>ilanten rasch zur Mehrheit bekannten. Fremdsprachige<br />
Ehepartner verleugneten <strong>in</strong> der Regel nicht die ethnische Herkunft <strong>und</strong> vermittelten<br />
ihren K<strong>in</strong>dern oft rud<strong>im</strong>entäre Kenntnisse ihrer Herkunftssprache. Zählten die<br />
M<strong>in</strong>derheiten zur beamteten oder gebildeten Schicht, dann blieben sie gegen Ass<strong>im</strong>ilation<br />
resistent, weil ihre kulturelle Identität <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em größeren Erfahrungszusammenhang<br />
verortet war. Sie partizipierten ohneh<strong>in</strong> nur partiell an der dörflichen volkskulturellen<br />
Szene, während sie das Substrat für e<strong>in</strong> reges nationales Leben <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en für<br />
sportliche, kulturelle <strong>und</strong> politische Tätigkeiten bildeten. (Es waren vor allem die<br />
Lehrer <strong>und</strong> die nationalen Schutzvere<strong>in</strong>e, welche die Staatsbeamten <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>en halb-<br />
27 COLE/WOLFE: Die unsichtbare Grenze (wie Anm. 10). Dazu: Südtirol <strong>im</strong> Auge der Ethnographen,<br />
hrsg. von REINHARD JOHLER, LUDWIG PAULMICHL <strong>und</strong> BARBARA PLANKENSTEI-<br />
NER, Wien, Lana 1991.<br />
225
agrarischen tschechischen M<strong>in</strong>derheiten zum nationalpolitischen Milieu verdichteten.)<br />
Spezielle Verhältnisse herrschten jedoch <strong>in</strong> den zweisprachigen agrarischen Dörfern<br />
<strong>in</strong> der deutsch-tschechischen Überlagerungszone. Im folgenden werden speziell<br />
die komplexen Verhältnisse des Getreidedorfes Baumöhl/Podmolí referiert, welche<br />
als typisch für zweisprachige Dörfer gelten können. Das lange Zusammenleben seit<br />
vielen Generationen <strong>und</strong> die vielen Mischehen führten hier zu wirklicher Zweisprachigkeit<br />
zum<strong>in</strong>dest aller hier sozialisierten Bewohner, weniger der als Erwachsene<br />
Zugewanderten. Da aber ke<strong>in</strong>e der beiden Sprachen dom<strong>in</strong>ant war <strong>und</strong> Tschechisch<br />
bzw. Deutsch auch ke<strong>in</strong>em best<strong>im</strong>mten sozialen Segment zugeordnet werden konnte,<br />
waren beide Sprachen gleichermaßen <strong>in</strong> Gebrauch, so wie es die Notwendigkeit der<br />
Verständigung <strong>und</strong> die Sprachkenntnisse der Beteiligten erforderten. Folgerichtig bildete<br />
die Sprachverwendung auf der Alltagsebene ke<strong>in</strong>en festen Gruppenzusammenhang<br />
von deutsch <strong>und</strong> tschechisch.<br />
Sprachkompetenz war vor allem durch familiäre Herkunft <strong>und</strong> Hausb<strong>in</strong>dung best<strong>im</strong>mt.<br />
Wer <strong>im</strong> Dorf selbst aufgewachsen war, beherrschte angesichts der dauernden<br />
Präsenz von Deutsch <strong>und</strong> Tschechisch zumeist problemlos beide Sprachen, wer aus<br />
e<strong>in</strong>em tschechischen – oder seltener aus e<strong>in</strong>em deutschen – Nachbardorf zugewandert<br />
war, nur die jeweils eigene Muttersprache. Die K<strong>in</strong>der von Zuwanderern erwarben<br />
anstandslos die jeweils zweite Dorfsprache, so daß Sprachfertigkeit <strong>in</strong>nerhalb von<br />
Familien nach Dauer der Ansässigkeit <strong>und</strong> Generationszugehörigkeit geschichtet war.<br />
Die he<strong>im</strong>ischen <strong>und</strong> die wenigen zugewanderten deutschen Bauern lebten Hof an Hof<br />
mit ihren oft schon seit fünfzig Jahren <strong>im</strong> Dorf ansässigen, vere<strong>in</strong>zelt jedoch erst <strong>in</strong><br />
jüngerer Zeit zugesiedelten tschechischen Bauern. Mischehen waren zwar durchaus<br />
an der Tagesordnung, doch folgte die Haussprache zumeist dem männlichen Hoferben:<br />
das „Haus“, nicht die Familie ist die soziale Gr<strong>und</strong>e<strong>in</strong>heit des alteuropäischen<br />
Dorfes. Nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Fällen fand tatsächlich e<strong>in</strong> Wechsel der Haussprache statt,<br />
wenn etwa e<strong>in</strong> Austragsbauer e<strong>in</strong>e des Deutschen ganz unk<strong>und</strong>ige Tschech<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es<br />
Nachbardorfes heiratete <strong>und</strong> aus praktischen Gründen jetzt <strong>im</strong> Austragsstübel tschechisch<br />
zur Verkehrssprache wurde. 28 Dennoch war selbst bei komplex geschichteter<br />
ethnischer Herkunft die Haussprache unzweideutig festgelegt. Sprachwechsel fand<br />
daher nur <strong>in</strong>dividuell, als Ass<strong>im</strong>ilation e<strong>in</strong>es neuen Familienmitglieds statt. Es gab jedoch<br />
nicht den langsamen Sprachwechsel ganzer Familien von e<strong>in</strong>er zur anderen Generation,<br />
wie etwa unter den so ganz anderes gelagerten Kärntner Verhältnissen, wo<br />
<strong>im</strong> Prozeß der Ass<strong>im</strong>ilation e<strong>in</strong>e Zeitlang beide Familiensprachen nebene<strong>in</strong>ander bestehen,<br />
bis e<strong>in</strong>e erste Generation e<strong>in</strong>sprachig erzogen wird. Die Festlegung e<strong>in</strong>er<br />
Haussprache verdrängte außerdem nicht vollends die zweite Sprache. So war es nicht<br />
unüblich, daß beispielsweise e<strong>in</strong>e tschechische Großmutter oder tschechische Dienstboten<br />
den pr<strong>im</strong>är deutsch sozialisierten K<strong>in</strong>dern das Tschechische spielerisch vermittelten.<br />
E<strong>in</strong> „K<strong>in</strong>derwechsel“ zur Erlernung der jeweils anderen Sprache war für Baumöhler<br />
K<strong>in</strong>der nicht notwendig. Viele Interviewpartner aus Baumöhl beherrschen<br />
noch heute beide Sprachen.<br />
28 Interview W., S. 14 f.<br />
226
Was die außerhäusliche <strong>und</strong> öffentliche Kommunikation anbelangt, so waren<br />
Deutsch <strong>und</strong> Tschechisch gleichwertige Dorfsprachen. Stets berücksichtigte man die<br />
konkrete Kontaktsituation. Mit dem e<strong>in</strong>en Nachbarn sprach man <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung<br />
zur jeweiligen Haussprache Deutsch, mit dem anderen Tschechisch: „Das war so, <strong>und</strong><br />
der Nachbar überm Zaun, das war halt der soused (= Nachbar), <strong>und</strong> man hat Guten<br />
Morgen <strong>und</strong> Guten Abend gesagt, <strong>und</strong> waren ke<strong>in</strong>e Reibereien, komischerweise.“ 29<br />
Die nachbarliche Kommunikation auf deutsch oder tschechisch betraf die üblichen<br />
Fragen der Arbeitse<strong>in</strong>teilung. „Da hat man gfragt, was wir am Feld schon fertig s<strong>in</strong>d,<br />
<strong>und</strong> wir haben gsagt, heut gehen wir dort <strong>und</strong> dort h<strong>in</strong>.“ 30 Auf der Straße wechselte<br />
die Sprache nach den Kompetenzen der beteiligten Kontaktpersonen. K<strong>in</strong>der wechselten<br />
mitten <strong>in</strong> Gespräch <strong>und</strong> Spiel die Sprache. „Naja, dort, unter die K<strong>in</strong>der, mit<br />
den tschechischen. Wir haben e<strong>in</strong>e Weile böhmisch geredet, dann e<strong>in</strong>e Weile deutsch,<br />
wie wir es wollen haben.“ 31 Be<strong>im</strong> Betreten e<strong>in</strong>es fremden Hofes richtete man sich<br />
nach der Hofsprache. E<strong>in</strong>e Respondent<strong>in</strong> er<strong>in</strong>nert sich heute noch, daß die zu Besuch<br />
kommende tschechische Großmutter regelmäßig diese ungeschriebenen Regeln mißachtete<br />
<strong>und</strong> den deutschen Schwiegersohn tschechisch begrüßte, obwohl sie e<strong>in</strong>igermaßen<br />
deutsch sprach. „Wenn die Großmutter kommen ist, me<strong>in</strong> Vater hat gsagt,<br />
grüß dich, Oma! Die Großmutter hat gsagt: Vítám te= Tobito, die hat net gsagt, grüß<br />
dich. In der Kirche hat sie e<strong>in</strong> jedes Lied, e<strong>in</strong> jedes Gebet <strong>und</strong> alles ohne Büchl auswendig<br />
können. Aber die hat zhaus ke<strong>in</strong> deutsches Wort über die Lippen bracht.“ 32<br />
Zweisprachigkeit galt als erwünschte Kompetenz <strong>und</strong> zwar trotz sprachlicher Interferenzen<br />
die volle Kenntnis der regionalen m<strong>und</strong>artlichen Variante von Deutsch <strong>und</strong><br />
Tschechisch. Das bezeugt auch der leichte Spott über vere<strong>in</strong>zelte Fälle von Sprachvermischung<br />
durch tschechische Zuwanderer der ersten Generation. Die Dorfbewohner<br />
wußten also um zwei kompakte Sprachtexte, die jeder <strong>in</strong> möglichst re<strong>in</strong>er Form<br />
beherrschen sollte.<br />
E<strong>in</strong>e solche Sprachsituation erforderte erhebliche soziale Kompetenzen der Sprecher,<br />
da für jede Begegnungsebene speziell die Sprache festzulegen war. Nur unter<br />
den Voraussetzungen dichter sozialer Kontakte <strong>und</strong> bei E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die persönlichen<br />
Lebensverhältnisse aller Dorfbewohner war e<strong>in</strong>e situativ richtige Wahl der Sprache<br />
möglich. In abgeschwächter Form galt Zweisprachigkeit <strong>in</strong>nerhalb der ganzen breiteren<br />
Berührungszone von Deutschen <strong>und</strong> Tschechen bei familiären oder wirtschaftlichen<br />
Kontakten zu den Nachbardörfern. Auch dabei wurde ganz pragmatisch die am<br />
ehesten nützliche Sprache gewählt. Auf diese Weise flossen die beiden Sprachen <strong>im</strong><br />
Alltagskontext gewissermaßen <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander, mit allmählich ger<strong>in</strong>gerer Präsenz. Der<br />
vom Nationalismus geprägte Term<strong>in</strong>us „Sprachgrenze“ ist zur Charakterisierung dieser<br />
Situation ganz ungeeignet. Er zieht territorial <strong>und</strong> mental e<strong>in</strong>e Kommunikationsgrenze<br />
durch e<strong>in</strong>e Übergangszone, die besser mit dem Begriff des „Kont<strong>in</strong>uums“ zu<br />
29 Interview W., S. 6.<br />
30 Interview W., S. 28.<br />
31 Interview M., S. 11.<br />
32 Interview A., S. 13.<br />
227
erfassen ist. Von Sprachgrenze war daher auch <strong>in</strong> den Interviews ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziges Mal<br />
die Rede.<br />
Konflikte waren <strong>im</strong> Alltag angesichts des fehlenden Gruppenzusammenhangs der<br />
Sprachen <strong>und</strong> ohne ethnische Handlungszwänge selten. Weil Sprachverwendung<br />
nicht an e<strong>in</strong> übergeordnetes Wertesystem geb<strong>und</strong>en war, diente sie friktionsfrei den<br />
Notwendigkeiten <strong>in</strong>nerdörflicher Kommunikation. Diesem ethnisch neutralen „Kont<strong>in</strong>uum“<br />
entspricht die sehr <strong>in</strong>dividuell geprägte Er<strong>in</strong>nerungsebene der Respondenten<br />
an die dörfliche Harmonie zwischen Menschen beider Sprachen. (Er<strong>in</strong>nerung bezieht<br />
sich auf verschiedene Erfahrungs- <strong>und</strong> Verarbeitungsebenen.)<br />
Zur gesellschaftlichen Konstruktion <strong>und</strong> Funktion von Ethnizität<br />
Erst auf der kulturellen Ebene gewann der Unterschied zwischen deutsch <strong>und</strong> tschechisch<br />
gruppenbildende Bedeutung, <strong>in</strong>dem die Folklore zusätzlich zu ihrer sonstigen<br />
Funktion der lebensweltlichen Orientierung e<strong>in</strong>e weitere der ethnischen Identifikation<br />
übernahm. 33 Kurz gesagt, <strong>in</strong> den zweisprachigen Dörfern wurde das örtliche bzw. regionale<br />
kirchliche <strong>und</strong> popularkulturelle Formenrepertoire <strong>in</strong> zwei Varianten zur ethnischen<br />
Identifikation angeboten. Daher besuchten Deutsche <strong>und</strong> Tschechen die<br />
Sonntagsmesse mit deutscher oder tschechischer Predigt, daher gab es ethnisch def<strong>in</strong>ierte<br />
Wirtshäuser, Burschenschaften, oft auch Kirtage, Fasch<strong>in</strong>gsbälle usf. Ethnizität<br />
wurde also durch kulturelle Praxis <strong>in</strong> abgesonderten Räumen konstruiert. Erst dort,<br />
wo die puren Notwendigkeiten des Alltags aufhörten, erlangten die psychischen Bedürfnisse<br />
des Ethnischen ihr Recht, suchte man Wärme <strong>und</strong> Geborgenheit sprachlich<br />
homogener Kultur. Es war jedoch stets dasselbe Bezugssystem wie katholische Religiosität,<br />
Frömmigkeit, die agrarisch-dörfliche Werteordnung, die kulturellen Orte,<br />
welche gleichsam verdoppelt wurden. Anlässe <strong>und</strong> Ablauf der ethnisch konnotierten<br />
Praxis waren weiterh<strong>in</strong> vom Ortskontext best<strong>im</strong>mt. E<strong>in</strong> nennenswerter ethnisch best<strong>im</strong>mter<br />
Unterschied des Formenmaterials, mit Ausnahme von Liedern <strong>und</strong> Re<strong>im</strong>en,<br />
bestand nicht. Die ethnische Untergliederung der Dorfgesellschaft wurde durchgehend<br />
vom Gedanken der Symmetrie beherrscht, <strong>in</strong>dem nach Maßgabe der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> der Organisationskapazität der örtlichen Sprachgruppen die Popularkultur<br />
<strong>in</strong> zwei Varianten, auf symbolisch gewidmeten Räumen kultiviert wurde.<br />
Zwischen deutsch <strong>und</strong> tschechisch herrschte dabei ke<strong>in</strong> anderes Konkurrenzpr<strong>in</strong>zip<br />
als sonst zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Dorfteilen, zwischen Haupt- <strong>und</strong> Nebendorf bzw.<br />
33 Vgl. dazu L’UBICA DROPPOVÁ: Integrierungs- <strong>und</strong> Differenzierungselemente <strong>in</strong> der Folklore<br />
multiethnischer Lokalitäten, <strong>in</strong>: Ethnocultural processes <strong>in</strong> Central Europe <strong>in</strong> <strong>20</strong> th century<br />
(Comenius University Bratislava. Philosophical Faculty. Department of Ethnologie),<br />
Bratislava 1994, S. 150-156; DIES.: Ethnoidentifikationsfunktionen der Folklore <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
ethnisch gemischten Gebiet, <strong>in</strong>: Folklore <strong>in</strong> the identification processes of society, Bratislava<br />
1994 (Etnologické stúdie 1), S. 140-143; MARTA ŠRÁMKOVÁ, MARTA TONCROVÁ: Zur<br />
Frage der Identifizierungsfunktion der Folklore <strong>in</strong> Kontaktgebieten, <strong>in</strong>: Folklore <strong>in</strong> the<br />
identification processes of society, Bratislava 1994 (Etnologické stúdie l), S. 144-146.<br />
228
zwischen den Dörfern untere<strong>in</strong>ander. So wie zwei deutsche Burschenschaften um den<br />
schöneren Kirtag <strong>und</strong> die bessere Musik konkurrierten oder <strong>in</strong> Schattau die Orts- <strong>und</strong><br />
Betriebsfeuerwehr um die Ehre, e<strong>in</strong>en Brandplatz als erste zu erreichen, so konkurrierten<br />
auch die ethnischen Gruppen um Ansehen, Ehre, Farbenprächtigkeit, Tüchtigkeit.<br />
In den Waldbauerndörfern des westlichen Untersuchungsgebietes war sogar<br />
be<strong>im</strong> Tanz „die Jugend e<strong>in</strong>s“ <strong>und</strong> wurde ethnische Symmetrie durch e<strong>in</strong>e zeitweilige<br />
Raumwidmung bewirkt: „Dann haben sie <strong>im</strong>mer e<strong>in</strong>en Kreis gemacht, da haben die<br />
Tschechen gesungen, dann haben wieder die Deutschen gesungen“ (Interview C+ervenec).<br />
34 Dem Symmetriepr<strong>in</strong>zip entsprachen auch die teils zweisprachigen, teils alternierend<br />
deutschen <strong>und</strong> tschechischen Sonntagsmessen der Walddörfer.<br />
Die so gebildeten ethnischen Netzwerke reichten so weit wie sonst die volkskulturellen<br />
Kontakte von Dorf zu Dorf, beispielsweise die „Kirtagskreise“ oder best<strong>im</strong>mte<br />
Funktionkreise, beispielsweise die Hilfeleistung bei Bränden, das heißt zwei bis drei<br />
Dörfer weit. Ethnische Gruppenbildung war nicht der Fernsteuerung unterworfen <strong>und</strong><br />
bedurfte nicht der modernen vere<strong>in</strong>smäßigen Organisation. Pfarrer <strong>und</strong> Lehrer waren<br />
nicht notwendigerweise oder nur peripher <strong>in</strong> die ethnisch gefärbte volkskulturelle<br />
Praxis e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en, wohl aber der Bürgermeister, der beispielsweise die gewählte<br />
Hierarchie der Dorfburschen bestätigte. Symmetrie, Konkurrenz <strong>und</strong> dörflich-regionale<br />
Reichweite s<strong>in</strong>d somit die drei Organisationspr<strong>in</strong>zipien von Ethnizität. Auf diese<br />
Weise erlaubte popularkulturelle Praxis die ethnische Gliederung der Dorfgesellschaft<br />
<strong>und</strong> die Festlegung <strong>in</strong>dividueller Identität, ohne die funktionale Integration des Dorfes<br />
zu gefährden.<br />
Wieder dient das komplexe Fallbeispiel Baumöhl zur Illustration. Auch hier entstanden<br />
die ethnischen Varianten volkskultureller Praxis durchwegs <strong>in</strong> arbeitsfreien<br />
Räumen. Die außerhäusliche Frömmigkeitspflege beispielsweise blieb auf Dorfebene<br />
ethnisch neutral. Geme<strong>in</strong>sam wurde der Rosenkranz <strong>in</strong> der kle<strong>in</strong>en Dorfkapelle gebetet<br />
<strong>und</strong> g<strong>in</strong>g man auf Wallfahrt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en nahen Gnadenort. Wer auf der Wallfahrt die<br />
gerade gewählte Sprache nicht beherrschte, murmelte den Text <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Sprache. Zur<br />
Sonntagsmesse g<strong>in</strong>gen die Baumöhler Dorfbewohner allerd<strong>in</strong>gs getrennte Wege, zur<br />
deutschen Messe <strong>in</strong> die zuständige Pfarrkirche Luggau <strong>und</strong> zur tschechischen Nachmittagsmesse<br />
– nach Großmaispitz. 35 Es war also e<strong>in</strong>e kulturelle Vorgabe „von außen“,<br />
welche zur Konstituierung von ethnischen Wir-Gruppen beitrug. 36<br />
34 E<strong>in</strong>e Parallele wird aus slowakischen Dörfern berichtet, dort wurden „bei vielen Folkloregelegenheiten“<br />
abwechselnd Lieder <strong>in</strong> den drei Sprachen slowakisch, ungarisch <strong>und</strong><br />
deutsch gesungen. DROPPOVÁ: Integrierungs- <strong>und</strong> Differenzierungselemente (wie Anm.<br />
33), S. 151.<br />
35 Geme<strong>in</strong>dechronik Baumöhl.<br />
36 Die Volkssprache spielte seit den Kirchenreformen der frühen Neuzeit <strong>in</strong> der Seelsorge e<strong>in</strong>e<br />
wichtige Rolle. Predigt, Kirchenlied <strong>und</strong> Gebete folgten stets den örtlichen sprachlichen<br />
Verhältnissen. Daher f<strong>in</strong>den wir schon <strong>im</strong> 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> gemischten Pfarren Mährens<br />
gelegentlich zwei Priester <strong>und</strong> vere<strong>in</strong>zelt waren sogar die Gotteshäuser dauernd <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
böhmische <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e deutsche Kirche mit jeweils eigener Kanzel untergliedert. Diese<br />
Zweiteilung währte beispielsweise <strong>in</strong> der ehemaligen deutschen Kölle<strong>in</strong>er Sprach<strong>in</strong>sel<br />
durch zweih<strong>und</strong>ert Jahre, bis zuletzt nach dem sukzessiven Zuzug von tschechischen Bau-<br />
229
Ethnisch differenziert war das vorösterliche „Ratschen“ – e<strong>in</strong> Heischebrauch respektive<br />
Lärmbrauchtum, um die <strong>in</strong> der Karwoche „nach Rom geflogenen“ Glocken<br />
zu ersetzen. Obwohl die Dorfbuben sonst „durche<strong>in</strong>and g´mischt“ spielten 37 , gab es<br />
e<strong>in</strong>e deutsche <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e tschechische Ratscherpartie. Wieder g<strong>in</strong>g es um die Ehre des<br />
Ersten. In e<strong>in</strong>er handfesten Rauferei unter den Sieben- bis Zehnjährigen wurde entschieden,<br />
wer als erster die best<strong>im</strong>mte Ste<strong>in</strong>platte vor der Kapelle, den Ausgangspunkt<br />
des Ratschens betreten durfte. Dann betete die angeblich stets siegreiche deutsche<br />
Ratscherpartie ihr Vaterunser <strong>und</strong> zog als erste <strong>in</strong>s Dorf. Erst „dann s<strong>in</strong>d die anderen<br />
aufi <strong>und</strong> haben auch bet´ <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>tnachi gangen“; sie „haben h<strong>in</strong>tnachiratschen<br />
müssen, die Tschechen“. 38 Diese symbolische Verweisung auf den zweiten<br />
Platz ist für die Respondenten sehr wichtig. „Weil man nicht zwe<strong>im</strong>al Gebetläuten<br />
kann“, mußte die tschechische Gruppe e<strong>in</strong>e alternative „R<strong>und</strong>e“ gehen, vielleicht e<strong>in</strong>e<br />
weniger ertragreiche bei ärmeren Häusern. Später wurde jedoch dieses Kräfter<strong>in</strong>gen<br />
durch bleibende räumliche Widmung entschärft, <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong>e Gruppe <strong>in</strong>s Dorf g<strong>in</strong>g<br />
<strong>und</strong> die andere <strong>in</strong>s neue tschechische Dorfviertel na Hátech. 39<br />
Ethnisch untergliedert war auch das Kirtagsbrauchtum. Baumöhl widmete dem<br />
Patron se<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Dorfkapelle am 6. September gleich zwei Feste, e<strong>in</strong> deutsches<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong> tschechisches <strong>in</strong> den jeweiligen Gasthäusern. Die Gasthäuser bildeten ohneh<strong>in</strong><br />
die e<strong>in</strong>zige permanente ethnisch fixierte soziale E<strong>in</strong>richtung. In den Zwanzigerjahren<br />
gab es <strong>in</strong> Baumöhl zwei Wirtshäuser, Kiesl<strong>in</strong>g <strong>im</strong> Ortszentrum für die Deutschen<br />
<strong>und</strong> Hopp an der Ausfallstraße gegen den nächsten tschechischen Ort Großmaispitz/Hluboké<br />
Masuvky für die Tschechen. 40 Als Kiesl<strong>in</strong>g 1929 aus familiären Gründen<br />
geschlossen wurde 41 <strong>und</strong> Hopp auch die deutsche K<strong>und</strong>schaft anzog, wurde die<br />
ethnische Symmetrie provisorisch wiederhergestellt, <strong>in</strong>dem die Deutschen ihren Kirtag<br />
vor dem Gasthaus abhielten <strong>und</strong> den Tschechen das Gastz<strong>im</strong>mer reserviert blieb. 42<br />
Klare Verhältnisse entstanden erst wieder, als Alois Mollik 1931 abseits vom Orts-<br />
ern <strong>und</strong> der Ass<strong>im</strong>ilation der letzten deutschen Bauern seit 1804 <strong>in</strong> der „deutschen Kirch“<br />
ke<strong>in</strong>e Predigt mehr gelesen wurde. JOHANNA SPUNDA: Die verlorenen Inseln. E<strong>in</strong> Beitrag<br />
zur Erforschung der nationalen Ause<strong>in</strong>andersetzung <strong>und</strong> Umvolkung, <strong>in</strong>: Bohemia. Jahrbuch<br />
des Collegium Carol<strong>in</strong>um 2 (1961), S. 357-413.<br />
37<br />
Interview A., S. 11.<br />
38<br />
Interview A., S. 10 f.<br />
39<br />
Geme<strong>in</strong>dechronik Baumöhl.<br />
40<br />
I: „Wie haben sie geheißen, die Wirte? H: Kiesl<strong>in</strong>g der deutsche, der böhmische hat Hopp<br />
geheißen.“ Interview H., S. 4. (Die Interviewte verbrachte nur ihre K<strong>in</strong>dheit <strong>in</strong> Baumöhl,<br />
sie kennt daher nicht die spätere Umwidmung der Gasthöfe.)<br />
41<br />
Geme<strong>in</strong>dechronik Baumöhl.<br />
42<br />
„Im September, auf Ägidi, ist <strong>im</strong>mer der Baumöhler Kirtag gwesen. War schön, wirklich<br />
schön. Da haben sie <strong>in</strong> Baumöhl gefeiert, nicht <strong>im</strong> Gastz<strong>im</strong>mer, da s<strong>in</strong>d ja die Tschechen,<br />
der Wirt, gwesen. Weil der deutsche hat ja dann zusperren müssen. Der war <strong>im</strong> Ort dr<strong>in</strong>,<br />
der deutsche Wirt.“ Interview H., S. 4. „Da hat der Kiesl<strong>in</strong>g dann n<strong>im</strong>mer das Gasthaus<br />
ghabt, der Deutsche. Dann hat es der Tschech gehabt, der Hopp, <strong>und</strong> der hat auch vorm<br />
Haus so e<strong>in</strong>en Platz ghabt, haben sie auch. Da b<strong>in</strong> ich ja alle Jahre (von Unterretzbach) aufigfahrn.<br />
Dort hab ich nachher Kirtag . . .“ Interview H., S. 5.<br />
230
kern, an der Straße nach Zna<strong>im</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Nähe des neuen Dorfviertels Hátech, das<br />
neu erbaute tschechische „Restaurace“ – so auch <strong>im</strong> deutschen Sprachgebrauch – eröffnete,<br />
während Hopp mit se<strong>in</strong>er verbleibenden deutschen K<strong>und</strong>schaft zum deutschen<br />
Gasthaus wurde. Jeder <strong>im</strong> Dorf wußte um die tschechische Herkunft des<br />
Hopp, 43 aber es war <strong>in</strong> der deutschen Dorfme<strong>in</strong>ung „unser Gasthaus“. 44 Der extreme<br />
Nationalismus <strong>in</strong>terpretierte den Positionswechsel des Gastwirtes Hopp jedoch als nationalen<br />
Verrat. Hopp <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Frau wurden 1945 erst <strong>in</strong> letzter M<strong>in</strong>ute vom Abschub<br />
(odsun) ausgenommen, denn „sie haben das Volk verraten <strong>und</strong> sie haben mit<br />
den Deutschen kollaboriert, sie s<strong>in</strong>d zu deutschen Staatsbürgern geworden“ <strong>und</strong> werden<br />
daher „das Ka<strong>in</strong>smal von Verrätern das ganze Leben tragen“. 45<br />
Der Dorfkirtag konstruierte für wenige Tage zwei ethnisch differente, jedoch parallele<br />
Dörfer. Doch nach außen präsentierte sich die Dorfburschenschaft wieder geme<strong>in</strong>sam.<br />
Die „Kirtagskreise“ der Baumöhler Burschenschaften orientierten sich nach<br />
räumlichen, nicht nach ethnischen Kriterien. Alle Nachbarorte wurden besucht, das<br />
deutsche Luggau ebenso wie die tschechischen Orte Großmaispitz <strong>und</strong> Weskau. E<strong>in</strong><br />
Respondent, damals Altbursch der deutschen Burschenschaft, er<strong>in</strong>nert sich sogar an<br />
geme<strong>in</strong>same Fahrten deutscher <strong>und</strong> tschechischer Jugendlicher <strong>im</strong> „verkranzten E<strong>in</strong>führwagen“<br />
nach Großmaispitz. 46 Auch das Empfangsritual <strong>im</strong> tschechischen Großmaispitz<br />
galt der ganzen Dorfburschenschaft: „Wir s<strong>in</strong>d gfahren bis zum Anfang der<br />
Ortschaft. Dann ist der Altbursch e<strong>in</strong>igangen, hat gmeldt, wir s<strong>in</strong>d da. Die s<strong>in</strong>d mit<br />
der Musik rausgangen, haben uns re<strong>in</strong>blatt, (d. i. e<strong>in</strong>begleiten) haben wir gsagt. Die<br />
tschechischen, also die Ortsburschen vorn, die Musik <strong>und</strong> dann wir mit dem Wagen<br />
h<strong>in</strong>tnachi, net.“ 47<br />
Der Kirtag war e<strong>in</strong>e Angelegenheit der beiden örtlichen Dorfburschenschaften der<br />
unverheirateten Männer, sie sorgten für Ausschmückung, Musik <strong>und</strong> ordentliche<br />
Durchführung. F<strong>in</strong>anziert wurde der Kirtag durch die E<strong>in</strong>trittsgelder, e<strong>in</strong> etwaiges Defizit<br />
trug die Burschenschaft. Die zahlenmäßig stärkere Baumöhler deutsche Dorfburschenschaft<br />
konnte e<strong>in</strong> solches Risiko leicht e<strong>in</strong>gehen, die tschechische war dafür<br />
nicht <strong>im</strong>mer <strong>in</strong> der Lage. Mitte der Dreißigerjahre waren es 28 deutsche <strong>und</strong> nur zehn<br />
tschechische Burschen. Unter diesen Voraussetzungen gab es e<strong>in</strong>ige Jahre <strong>in</strong> Baumöhl<br />
ke<strong>in</strong>en tschechischen Kirtag. Anstandslos besuchten <strong>in</strong> solchen Jahren die<br />
Tschechen den deutschen Kirtag <strong>und</strong> erhielten dort ihren eigenen Tisch. 48 Sonst jedoch<br />
g<strong>in</strong>g jeder zu se<strong>in</strong>er Kirtagsfeier. Doch kam es auch schon e<strong>in</strong>mal vor, daß die<br />
deutschen Burschen zum tschechischen Kirtag g<strong>in</strong>gen, <strong>und</strong> weil die „die bessere Musi<br />
. . . <strong>und</strong> mehr Leut“ hatten, e<strong>in</strong>en Streit um e<strong>in</strong> Mädchen anzettelten, um „die Leute<br />
43<br />
Interview W., S. 51.<br />
44<br />
Interview A., S. 35: „Ich weiß nicht, ob er nicht von e<strong>in</strong>em Tschechen abgestammt hat. Ich<br />
weiß es nicht, aber es ist unser Gasthaus gewesen.“<br />
45<br />
Geme<strong>in</strong>dechronik Baumöhl.<br />
46<br />
Interview A., S. 12. Auch Reiter schildert den Kirtagsbesuch <strong>in</strong> Großmaispitz <strong>und</strong> Weskau<br />
mit Wagen, Interview R., S. 7.<br />
47<br />
Interview A., S. 16.<br />
48<br />
Interview A., S. 14.<br />
231
(zu) vertreiben“. 49 Nur <strong>in</strong> diesen volkskulturellen Szenerien kam es zu solcher dorftypischen<br />
Konkurrenz. 50 Die Begegnungsebenen von Alltag <strong>und</strong> Feiertag werden von<br />
den betagten Respondenten säuberlich separiert. Da „kann ich nicht sagen, daß wir<br />
g´wesen wären wie H<strong>und</strong> <strong>und</strong> Katz. Nur bei gewisse Sachen da hat es halt alleweil<br />
was geben, da hat es Reibereien geben, sagen wir be<strong>im</strong> Ratschen gehen oder am<br />
Kirchtag oder <strong>im</strong> Fasch<strong>in</strong>g. Da ist halt alleweil e<strong>in</strong> weng e<strong>in</strong> Zwist dr<strong>in</strong> gwesen.“ 51<br />
Diese Rivalität <strong>im</strong> Dorf<strong>in</strong>nern stellte außerdem nicht das geschlossene Auftreten der<br />
Dorfburschen gegen auswärtige Konkurrenten <strong>in</strong> Frage. Männerehre g<strong>in</strong>g über ethnische<br />
Zugehörigkeit. Ihre Dorfmädchen verteidigten deutsche <strong>und</strong> tschechische Burschen<br />
geme<strong>in</strong>sam. „Na, aber bei uns hat es das net geben, daß von der Nachbarortschaft,<br />
ob das jetzt e<strong>in</strong> Deutscher oder e<strong>in</strong> Tschech war, zu e<strong>in</strong>em unsrigen Mädchen<br />
hat gehen können. Da ist es uns nicht zu dumm gwesen, s<strong>in</strong>d wir die ganze Nacht dort<br />
g´sessen haben paßt bis er z´haus geht, dann haben wir ihn recht droschen. Bis daß er<br />
sich e<strong>in</strong>kauft hat, also e<strong>in</strong> Faßl oder zwei Faßl Bier zahlt hat, dann hat er zu uns<br />
g´hört. Dann hat er kommen können, wie wann er he<strong>im</strong>g<strong>in</strong>gert.“ 52<br />
Nationalität: Die Nation <strong>im</strong> Dorf – nationale Partizipation<br />
Die dritte, die nationale Ebene der deutsch-tschechischen Differenzierung war e<strong>in</strong><br />
modernes Element politischer Kultur <strong>und</strong> Steuerung. Nunmehr g<strong>in</strong>g es um die symbolische<br />
Integration des Dorfes <strong>in</strong> die lediglich <strong>im</strong>ag<strong>in</strong>ierte, nicht durch direkten Kontakt<br />
hergestellte gesellschaftliche Großgruppe Nation. Die moderne Nation ist nicht<br />
e<strong>in</strong>fach e<strong>in</strong>e Verlängerung oder qualitative Veränderung bestehender sprachlichethnischer<br />
Gruppen zur politischen Willensgeme<strong>in</strong>schaft, sondern e<strong>in</strong>e durch Agitation<br />
<strong>und</strong> Organisation gebildete neue soziale Großgruppe. 53 Erst das politische Handeln<br />
nationaler Eliten <strong>und</strong> die Kraft von Massenbewegungen formte hier <strong>in</strong> Zentraleuropa<br />
aus dem spröden ethnischen Material die moderne Nation. Daher mutierte die Nationalitätenfrage<br />
an der Peripherie des Agitationsgebietes zur Grenzfrage. Die Glaubwürdigkeit<br />
des Nationalismus für das agrarische Dorf beruht offenbar auf se<strong>in</strong>er Deutungskompetenz<br />
für die „großen Zusammenhänge“ der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen<br />
<strong>und</strong> politischen Entwicklung, welche nunmehr auch <strong>in</strong> den Lebensalltag der<br />
kle<strong>in</strong>en Leute e<strong>in</strong>griffen. Vielfach vermittelte der Nationalismus neuerd<strong>in</strong>gs nützliche<br />
49 Interview A., S. 34.<br />
50 Interview W., S. 12.<br />
51 Interview A., S. 34.<br />
52 Interview A., S. 16.<br />
53 ERNEST GELLNER: Nationalismus <strong>und</strong> Moderne, Berl<strong>in</strong> 1991; DERS.: Nationalismus <strong>in</strong> Osteuropa,<br />
Wien 1996 (Passagen, Heft 6); KARL WILHELM DEUTSCH: Nationenbildung – Nationalstaat<br />
– Integration, hrsg. von A. ASHKENASI <strong>und</strong> P. SCHULZE, Düsseldorf 1972 (Studienbücher<br />
zur auswärtigen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Politik, Bd. 2); DERS.: Der Nationalismus<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Alternativen, München 1972 (Serie Piper 26); DERS.: Soziale Mobilisierung <strong>und</strong><br />
politische Entwicklung, <strong>in</strong>: Wandel, hrsg. von ZAPF, S. 329-350.<br />
232
<strong>und</strong> notwendige kulturelle Fähigkeiten, gewandte Umgangsformen, schriftliche Ausdrucksfähigkeit<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e aus ethnischen Überlieferungen gebildete überregional<br />
brauchbare nationale Standardsprache. Aus dieser Bildungsmission resultierte die<br />
große Bedeutung der Lehrer als Agenten der Nationalisierung. Der Nationalismus leistete<br />
weiters Hilfe bei der Herstellung ökonomischer <strong>und</strong> sozialer Außenbeziehungen,<br />
etwa <strong>im</strong> Rahmen von Genossenschaften, Bankwesen, Feuerwehren, der kulturellen<br />
<strong>und</strong> Sportorganisationen. Auf diese Weise wurden ganze Zweige moderner Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Kulturtechnik dem Nationalismus dienstbar, jedoch <strong>in</strong> Konkurrenz mit<br />
anderen politischen Orientierungen <strong>und</strong> Weltanschauungen, die den sozialen Gruppenzusammenhang<br />
beispielsweise auf Klassenbasis oder mittels Religionsb<strong>in</strong>dung<br />
organisierten. In besonderer Weise profitierte der Nationalismus von den Tendenzen<br />
der Durchstaatlichung, welche das Dorf durch Steuerwesen, Militärdienst, Volkszählungen<br />
<strong>und</strong> Schulpflicht zugleich verunsicherten <strong>und</strong> zu kollektiven Solidaritätsb<strong>in</strong>dungen<br />
erzogen – man denke an die Assentierungsbräuche <strong>und</strong> die Veteranenbewegung.<br />
Sodann öffnete die Demokratisierung der politischen Ordnung mit den entsprechenden<br />
<strong>Institut</strong>ionen der „bürgerlichen Öffentlichkeit“ <strong>und</strong> den Wahlen <strong>in</strong> die diversen<br />
Vertretungskörper e<strong>in</strong>e weitere E<strong>in</strong>bruchsstelle der nationalen Logik <strong>in</strong> lebensweltliche<br />
Zusammenhänge. Nationalismus bedeutete schließlich die größere ideelle<br />
He<strong>im</strong>at nach dem tendenziellen Bedeutungsverlust der kle<strong>in</strong>en überschaubaren Lebenswelten<br />
von Dorf, Stadtviertel <strong>und</strong> Region. Der Nation gehörte vor allem die Zukunft.<br />
Während das kulturelle System von Ethnizität lediglich die bestehende Welt<br />
affirmativ <strong>in</strong>terpretierte, versprach die Nation e<strong>in</strong>e bessere Welt, <strong>und</strong> daraus resultiert<br />
ihre große Überzeugungskraft.<br />
Die Nation mußte durch Vermittlungs<strong>in</strong>stanzen <strong>und</strong> symbolische Partizipation die<br />
Vorstellung von Geme<strong>in</strong>samkeit evozieren. Die Bauerndörfer erzog <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie der<br />
Lehrer zur Nation. Er vermittelte die kulturellen Standards von Hochsprache <strong>und</strong> <strong>in</strong>tellektueller<br />
Bildung. Damit ergänzte bzw. ersetzte er den autochthonen Wissenskanon<br />
durch neue Werte aus fremden Entstehungszusammenhängen jenseits des Dorfhorizontes<br />
<strong>und</strong> erfüllte diese erlernte fremde Welt mit den sent<strong>im</strong>entalen Inhalten von<br />
Staat <strong>und</strong>/oder Nation. Se<strong>in</strong> Bildungsauftrag reichte jedoch über die Schule weit h<strong>in</strong>e<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> die dörfliche Lebenswelt. Der Lehrer vermittelte dem Dorf das Organisationspr<strong>in</strong>zip<br />
des Vere<strong>in</strong>swesens, er stellte die Außenkontakte zu überregionalen Netzwerken<br />
auf vielen Gebieten von Wirtschaft <strong>und</strong> Kultur her, <strong>und</strong> er agitierte für politische,<br />
häufig jedoch prononciert nationale Parteien. In zweisprachigen Dörfern übernahm er<br />
vor allem die Aufgabe, die Angehörigen des eigenen Ethnikums partiell aus dem<br />
Ortskontext herauszuheben <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er eigenen Wir-Gruppe zusammenzufassen. Die<br />
Inklusion <strong>in</strong> die Nation erfolgte hauptsächlich durch kulturpolitische Aktivitäten <strong>in</strong><br />
abgesonderten Räumen <strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>em eigenen Jahreskalender. Auch <strong>in</strong> den untersuchten<br />
Dörfern präsentierte sich der Nationalismus durch e<strong>in</strong>e vom Volkskulturellen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich abgesonderte kulturelle Praxis, durch Feste zu profanen Anlässen wie<br />
die Republikfeier, die Geburtstagsfeier der Staatspräsidenten, die Hus-Feiern <strong>und</strong><br />
schulischen Weihnachtsfeiern. So gab es <strong>in</strong> Baumöhl zur zehnjährigen Staatsgründungsfeier<br />
1928 „e<strong>in</strong> Lager am Háte“ – der Baumöhler Dorfschullehrer Šrot verwen-<br />
233
dete wörtlich den Begriff tábor, Lager. 54 Nicht zufällig verwandelte der Lehrer die bescheidenen<br />
tschechischen Bauern <strong>und</strong> die Staatsbeamten für solche Gelegenheiten <strong>in</strong><br />
die „tschechoslowakische“ Öffentlichkeit (1935), somit zu e<strong>in</strong>em Teil der <strong>im</strong>ag<strong>in</strong>ierten<br />
tschechoslowakischen politischen Nationalität.<br />
Das Dorf wurde zum Bauste<strong>in</strong> der e<strong>in</strong>sprachigen Nation, daher zergliederte die nationale<br />
Festkultur die zweisprachige Dorfgesellschaft scharf <strong>in</strong> Eigene <strong>und</strong> Fremde.<br />
Deutsche <strong>und</strong> tschechische Nationalkultur war auch auf der Dorfebene nicht mehr<br />
„symmetrisch“, anders als die ethnische Kultur, welche e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames agrarisches<br />
Kultursystem <strong>in</strong> zwei Sprachvarianten gleich deutete. Der Nationalismus erfand <strong>im</strong><br />
Dorf Unterschiede, Ethnizität betonte <strong>in</strong> der Vielfalt das Geme<strong>in</strong>same. Die Ethnien<br />
repräsentierten Facetten des e<strong>in</strong>en Dorfes, während auf der nationalen Ebene der<br />
symbolische Streit um Dom<strong>in</strong>anz, Vorherrschaft, Erstgeburtsrecht, Raumbeherrschung,<br />
e<strong>in</strong>seitige Darstellung gegen außen g<strong>in</strong>g. Der Nationalismus konstruierte kulturelle<br />
Uniformität, Ethnizität akzeptierte Vielfalt. Der Nationalismus durchzog das<br />
Dorf mit <strong>Grenzen</strong>, <strong>und</strong> er grenzte es gegen Dörfer <strong>und</strong> Regionen anderer Ethnizität<br />
ab. Die von Angehörigen bürgerlicher oder verbürgerlichter agrarischer Schichten getragenen<br />
nationalen Netzwerke reichten gr<strong>und</strong>sätzlich über die eigene Region h<strong>in</strong>aus.<br />
Vere<strong>in</strong>zelt übernahmen sogar Industriefirmen des „B<strong>in</strong>nenlandes“ Patronage über<br />
M<strong>in</strong>derheitenschulen. In letzter Instanz war die fremdgesteuerte nationale Idee den<br />
tonangebenden Instanzen der Zentrale unterworfen.<br />
Interferenzen zwischen ethnischem <strong>und</strong> nationalem Ausdrucksvermögen<br />
Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität bildeten zwei eigenständige, jedoch vielfach verzahnte sozialkulturelle<br />
Begegnungsebenen. E<strong>in</strong>erseits übernahm die nationale Kulturpraxis lokale<br />
ethnische Elemente. In e<strong>in</strong>igen mehrheitlich deutschen Dörfern organisierten<br />
Agenten e<strong>in</strong>es nationalen Schutzvere<strong>in</strong>s die Dorfburschenschaft. Außerdem wurde<br />
der Leonhardiritt von deutschen nationalen Vere<strong>in</strong>en organisiert. Nicht ganz geklärt<br />
ist das Verhältnis der nationalen tschechischen Husfeuer zu älteren Traditionen, wie<br />
dem Hexenverbrennen <strong>und</strong> dem Johannisfeuer. Als e<strong>in</strong>deutig deutsch galten h<strong>in</strong>gegen<br />
die Sonnenwendfeuer. Vermutlich bewirkte <strong>in</strong> diesen Feuerbräuchen die nationale<br />
Konnotation älterer, vielleicht sogar geme<strong>in</strong>samer deutsch-tschechischer Traditionen<br />
e<strong>in</strong>e heillose Unübersichtlichkeit der Anlässe <strong>und</strong> Formen. Andererseits etablierten<br />
deutsche <strong>und</strong> tschechische Kulturvere<strong>in</strong>e Feste <strong>und</strong> Veranstaltungen mit volkskulturellem<br />
Anstrich. Sowohl <strong>in</strong> Gnadlersdorf als auch <strong>in</strong> Baumöhl organisierte die Národní<br />
jednota Weihnachtsfeiern mit national ausgerichteten Programmen. Lokale Trachten<br />
gab es nicht, daher <strong>im</strong>portierten die tschechische Folkloristik bunte <strong>in</strong>nermährische<br />
Trachten <strong>und</strong> die deutschen Volkstumsverbände das alp<strong>in</strong>e Dirndl <strong>und</strong> die Lederhose.<br />
54 Ebenda.<br />
234
Andererseits unterlagen nationale Kulturpraktiken durch Verortung <strong>im</strong> Dorfkontext<br />
dem Trend der Ethnisierung <strong>im</strong> S<strong>in</strong>ne autonomer Ausgestaltung von Tradition.<br />
Mit ihren Fasch<strong>in</strong>gsbällen <strong>und</strong> dem Laientheater näherte sich die národní jednota<br />
wiederum der tradierten Lebenswelt. Zu solchen Anlässen <strong>und</strong> Aktivitäten kehrte die<br />
nationalpolitisch gesteuerte Kulturpflege gleichsam <strong>in</strong>s Dorf zurück. Tatsächlich folgten<br />
die „national“ def<strong>in</strong>ierten geselligen Anlässe bald dem Gr<strong>und</strong>gedanken der Symmetrie<br />
<strong>und</strong> Konkurrenz statt denen von nationaler S<strong>in</strong>gularität <strong>und</strong> von Konflikten. In<br />
Schattau entfremdeten gegenseitige Besuche der Turnvere<strong>in</strong>e vom Auftrag der nationalen<br />
Separation. Am Gnadlersdorfer Kirtag tanzten auch die tschechischen Zöllner<br />
der Grenzstation mit den deutschen Bauernmädchen. Die Feuerwehren mit ihrer Verpflichtung<br />
zur Hilfeleistung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em best<strong>im</strong>mten Rayon verharrten überhaupt <strong>im</strong><br />
Schwebezustand zwischen nationaler <strong>und</strong> örtlich/regionaler B<strong>in</strong>dung. Das ursprünglich<br />
auf Kaiser <strong>und</strong> Vaterland bezogene Rekrutierungsbrauchtum wurde bruchlos auf<br />
die neuen tschechoslowakischen Verhältnisse übertragen <strong>und</strong> erfüllte weiterh<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Funktion als männlicher Initiationsritus. Die Bürgermeister der ethnisch gemischten<br />
Orte brachten die deutschen <strong>und</strong> tschechischen Rekruten geme<strong>in</strong>sam zur Assentierung.<br />
Deutsche <strong>und</strong> tschechische Kriegstote stehen bis heute auf den Tafeln der<br />
Schattauer „Kriegergedenkstätte“.<br />
Die ethnische Separation wurde nicht zuletzt durch die weit verbreitete Kenntnis<br />
der zweiten Dorf- bzw. Landessprache abgeschwächt. Diese agrarische Welt verfügte<br />
über e<strong>in</strong>e spezielle Kulturtechnik zur Aneigung des Fremden, <strong>in</strong>dem die heranwachsenden<br />
K<strong>in</strong>der entweder zeitweise die jeweils andere Dorfschule besuchten oder aber<br />
für mehrere Wochen, Monate oder e<strong>in</strong> Schuljahr <strong>in</strong>s andere Sprachmilieu „auf Wechsel“<br />
kamen. Auch die tschechischen Dienstboten brachten den K<strong>in</strong>dern häufig tschechische<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse bei, wie umgekehrt tschechische Dienstboten das Deutsche<br />
<strong>in</strong> Wort <strong>und</strong> manchmal mit Hilfe der Bäuer<strong>in</strong> auch <strong>in</strong> Schrift erlernten. 55<br />
Die soziale Genese von ethnisch-nationaler Identität<br />
Den drei Ebenen von Sprachverwendung, Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität entsprechen<br />
mehrere Er<strong>in</strong>nerungsebenen, was den Widerspruch zwischen angeblich problemloser<br />
Koexistenz (auf den ersten beiden Ebenen) <strong>und</strong> angeblich unerträglicher, wachsender<br />
nationaler Spannung (jetzt auf der nationalen Ebene) erklärt. Denn so deutlich die drei<br />
Ebenen <strong>im</strong> analytischen Prozeß vone<strong>in</strong>ander ablösbar s<strong>in</strong>d, so verzahnt liegen sie <strong>in</strong><br />
der Alltagswirklichkeit <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Biographien <strong>und</strong> so unscharf konturiert s<strong>in</strong>d<br />
sie <strong>im</strong> Nacherzählen. Vom Biographischen führt die Frage zur Identität, verstanden<br />
als Übere<strong>in</strong>st<strong>im</strong>mung von <strong>in</strong>dividueller Biographie <strong>und</strong> sozialem Umfeld, als Ver<strong>in</strong>nerlichung<br />
handlungsleitender Bilder. Identitätsbildung ist <strong>im</strong> zweisprachigen Dorf<br />
55 Gnadlersdorf, Interview K., S. 19; vgl. dazu HELMUT PAUL FIELHAUER: K<strong>in</strong>der-Wechsel<br />
<strong>und</strong> „Böhmisch-Lernen“. Sitte, Wirtschaft <strong>und</strong> Kulturvermittlung <strong>im</strong> früheren niederösterreichisch-tschechoslowakischen<br />
Grenzgebiet, Wien 1978 (Oesterr. Zeitschrift für Volksk<strong>und</strong>e,<br />
Bd. 32), S. 115-125.<br />
235
<strong>und</strong> bei Mischehen e<strong>in</strong> komplexer Prozeß. Sprache <strong>und</strong> ethnische Zugehörigkeit wurden<br />
zwar <strong>im</strong> Regelfall familiär tradiert, doch bewußte ethnische Identität erst durch<br />
die ethno-nationale Praxis wirklich festgelegt. Dem nationalen Bekenntnis konnte<br />
sich unter den Bed<strong>in</strong>gungen der örtlichen ethnischen <strong>und</strong> nationalen Gruppenbildung<br />
niemand entziehen. Für best<strong>im</strong>mte Handlungszusammenhänge mußte jeder Dorfbewohner<br />
se<strong>in</strong>e Wir-Gruppe wählen. Erst <strong>in</strong> dieser Komb<strong>in</strong>ation von Sprache, Herkunft,<br />
kultureller ethnischer Verortung <strong>und</strong> politischer Partizipation entstand das Wissen um<br />
die eigene ethnische Identität, während auf der Ebene der <strong>in</strong>dividuellen Biographie<br />
<strong>und</strong> der Alltagspraxis die Frage deutsch oder tschechisch oft nicht zu entscheiden<br />
war. Abstammung <strong>und</strong> Abst<strong>im</strong>mung best<strong>im</strong>men die ethnische Zugehörigkeit. Das<br />
willentliche Element war nicht wegzudenken, daher kam es bei unklarer Ausgangsposition,<br />
oft unter wechselnden politischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, zum nationalen Bekenntniswechsel.<br />
Auf diese Weise stabilisierte erst der neue tschechoslowakische<br />
Staat die von Ass<strong>im</strong>ilation gefährdete ethnische Identität der tschechischen Arbeiter<br />
<strong>in</strong> den <strong>in</strong>dustriellen Enklaven Schattau <strong>und</strong> Bömisch Rudoletz. Erwartungsgemäß<br />
folgte <strong>in</strong> den Dreißigerjahren e<strong>in</strong>e Trendwende <strong>in</strong> Richtung Deutschtum. Vor allem<br />
kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sozial deprivierte Sprachm<strong>in</strong>derheiten unterlagen dem Trend zur Ass<strong>im</strong>ilation.<br />
Der Sohn des tschechischen Gnadlersdorfer Kle<strong>in</strong>häuslers Cermák beherrschte<br />
bei Schulbeg<strong>in</strong>n ke<strong>in</strong> Wort Deutsch. Er ist trotz tschechischer Volksschulbildung <strong>im</strong><br />
deutschen Gnadlersdorfer Ambiente „e<strong>in</strong> Deutscher worden“ <strong>und</strong> <strong>im</strong> Zweiten Weltkrieg<br />
gefallen. 56 Se<strong>in</strong> tschechischer Vater wurde 1938 von Dorfburschen verprügelt<br />
<strong>und</strong> die Familie aus dem Dorf verjagt. In den zugleich konfessionell gemischten Dörfern<br />
der Waldbauerndörfer g<strong>in</strong>gen nicht selten der nationale <strong>und</strong> der konfessionelle<br />
Bekenntniswechsel Hand <strong>in</strong> Hand. Aus solchen Unsicherheiten resultierten die häufigen<br />
amtlichen Korrekturen des Nationalitätsbekenntnisses <strong>in</strong> den Volkszählungsoperaten.<br />
Anpassungskrisen<br />
Die drei synchronen Ebenen von Sprachverwendung, Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong> diachroner Betrachtung unterschiedlich stark gewichtet. In Anpassungskrisen beherrschte<br />
das Nationale nachhaltig das öffentliche Dorfleben. War der Konflikt durch<br />
partielle Integration se<strong>in</strong>er Vorgaben <strong>in</strong> das Regelsystem gelöst, kehrte das Dorf wieder<br />
zu se<strong>in</strong>em Alltag zurück. Bewegung <strong>und</strong> Ruhe, Innovation <strong>und</strong> Rout<strong>in</strong>e bildeten<br />
auf diese Weise e<strong>in</strong>en eigenartigen dörflichen Rhythmus. Auf lange Sicht gewann<br />
zwar das Nationale an Bedeutung; es gab <strong>im</strong>mer häufiger Anlässe für nationale Feiern;<br />
nationale Partizipation wurde selbstverständlich, niemand konnte sich der nationalen<br />
Deklaration entziehen. Die Wirkmacht des Nationalen blieb jedoch stets auf best<strong>im</strong>mte<br />
klar umgrenzte Zeiten <strong>und</strong> Räume reduziert. Von e<strong>in</strong>em langfristigen Zerfallsprozeß<br />
des Dorfes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geschlossenen Kette von nationalen Konflikten kann<br />
56 Gnadlersdorf, Interview F., S. 26.<br />
236
daher nicht die Rede se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>e solche vorwiegend auf behördlichem Schriftgut beruhende<br />
klassische Sichtweise der Nationalismusforschung wird der südmährischen Situation<br />
nicht gerecht. Allenfalls ist zu vermuten, daß die <strong>in</strong> vielen Konflikten über<br />
Jahrzehnte h<strong>in</strong>weg gesammelten Hoffnungen <strong>und</strong> Ängste unterbewußt dennoch zu<br />
mentalen Prägungen verdichtet wurden, welche <strong>im</strong> Ernstfall der ausgehenden Dreißigerjahre<br />
unter geänderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen als zerstörerisches Potential wirkten.<br />
Nationalismus wäre so gesehen e<strong>in</strong> negativer Lernprozeß für den Eventualfall. E<strong>in</strong><br />
solcher <strong>in</strong> psychischen Tiefenstrukturen angesiedelter mentalitätsgeschichtlicher Erklärungsansatz<br />
schien den Projektmitarbeitern empirisch nicht e<strong>in</strong>lösbar.<br />
Nationales Konfliktmaterial lieferten nur wenige, aber wichtige Anlässe. In den<br />
untersuchten Dörfern kamen lediglich die Volkszählungen, die Wahlen <strong>in</strong> die politischen<br />
Vertretungskörper sowie die Schule <strong>in</strong> Frage. Die drei Konfliktzonen widerspiegeln<br />
Facetten der Frage nach der Vorherrschaft e<strong>in</strong>er der beiden Dorfnationen.<br />
Die Volkszählungen lieferten Daten für die offizielle nationale Zuschreibung des Dorfes;<br />
die Geme<strong>in</strong>dewahlen best<strong>im</strong>mten das politische Stärkeverhältnis von deutsch <strong>und</strong><br />
tschechisch <strong>im</strong> Geme<strong>in</strong>deausschuß sowie <strong>im</strong> Ortsschulrat; Schule <strong>und</strong> Lehrer schließlich<br />
formierten das kulturelle Bild von Jugend <strong>und</strong> Erwachsenen, ihren politischen<br />
Willen sowie ihr nationalpolitisches Bekenntnis.<br />
Die große Anpassungskrise des Untersuchungszeitraumes folgte dem sonst recht<br />
unspektakulären staatlichen Souveränitätswechsel von Altösterreich zur Tschechoslowakei.<br />
Das deutsche <strong>und</strong> gemischtsprachige Südmähren zählten zwar zum deutschösterreichischen<br />
Anspruchsgebiet, doch die militärische deutschösterreichische Präsenz<br />
war eher symbolisch, so daß schon zur Jahreswende 1918/19 ganz Südmähren <strong>in</strong><br />
tschechoslowakischer Gebietsgewalt war. Der Staatsvertrag von St. Germa<strong>in</strong> vom 10.<br />
September 1919 bestätigte die mährisch-niederösterreichische Adm<strong>in</strong>istrativgrenze<br />
als Staatsgrenze, mit e<strong>in</strong>igen Abweichungen bei Gmünd <strong>und</strong> Feldsberg abseits des<br />
Untersuchungsgebietes. Nun wurden die <strong>in</strong>neren Verhältnisse an die tschechoslowakischen<br />
staatlichen Vorgaben angepaßt. Vielfach wurden e<strong>in</strong>fach die Verhältnisse auf<br />
den Kopf gestellt, so daß der deutschen die tschechische Präsenz folgte. Jetzt kamen<br />
auch <strong>in</strong> die deutschen Dörfer, z.B. Gnadlersdorf, tschechische Gendarmen <strong>und</strong> Grenzer,<br />
dann brachte die (unter nationalen Gesichtspunkten durchgezogene) Landreform<br />
e<strong>in</strong> paar tschechische Forstbeamte <strong>und</strong> Waldarbeiter (Baumöhl), <strong>und</strong> mit dieser tschechischen<br />
Zuwanderung kam zusätzlich zur deutschen die tschechische M<strong>in</strong>derheitenschule,<br />
sobald zehn tschechische K<strong>in</strong>der da waren. Die Schule wirkte <strong>in</strong> Richtung Separation.<br />
Es gab ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>samen Veranstaltungen oder Ausflüge der beiden Ortsschulen<br />
von Gnadlersdorf, Schattau <strong>und</strong> Böhmisch Rudoletz. Da <strong>und</strong> dort übten die<br />
Staatsbehörden Druck auf zweisprachige Familien oder kle<strong>in</strong>e Staatsangestellte, beispielsweise<br />
Straßenräumer aus, ihre K<strong>in</strong>der <strong>in</strong> die tschechische Schule zu schicken,<br />
<strong>und</strong> was der Druck nicht bewirkte, das erreichten kle<strong>in</strong>e Vergünstigungen wie Gratislehrmaterial<br />
<strong>und</strong> Weihnachtsgaben. E<strong>in</strong>e nationalbewußte Personalpolitik brachte<br />
k<strong>in</strong>derreiche Grenzerfamilien nach Gnadlersdorf. Doch alle diese Maßnahmen reichten<br />
kaum h<strong>in</strong>, solche tschechischen M<strong>in</strong>derheitenschulen am Leben zu erhalten. Die<br />
Staatskulte wechselten die Bezugspunkte, vom Kaiser auf den Staatspräsidenten. Die<br />
237
gut situierten Bauern waren von solchen Veränderungen <strong>in</strong> Wahrheit nicht existentiell<br />
betroffen. Ausdrücklich me<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Respondent<strong>in</strong> auf die Frage nach den Auswirkungen<br />
der nationalpolitischen Veränderungen: Das war für uns nicht wichtig, „wir waren<br />
ja Bauern“ (Gnadlersdorf). So stabilisierten sich <strong>in</strong> den deutschen Dörfern bald<br />
die neuen Verhältnisse. Zaghaft wurden die neuen tschechischen Elemente <strong>in</strong> die Dorfordnung<br />
<strong>in</strong>tegriert. Die tschechischen Grenzer kauften ihre Lebensmittel günstig bei<br />
den deutschen Bauern (Interview Schwarz), sie frequentierten die deutschen Gasthäuser,<br />
wurden zu den beliebten Kellerpartien geladen <strong>und</strong> kamen selbstverständlich zu<br />
den Kirtagen. Der Direktor der tschechischen M<strong>in</strong>derheitenschule vermittelte sogar<br />
den K<strong>in</strong>derwechsel <strong>in</strong>s tschechische Sprachgebiet, das heißt, er kl<strong>in</strong>kte sich <strong>in</strong> das<br />
ethnische System e<strong>in</strong>.<br />
Schwieriger waren die Verhältnisse <strong>in</strong> den tatsächlich stark gemischten Dörfern.<br />
In Baumöhl g<strong>in</strong>g es der Staatsverwaltung darum, das halb e<strong>in</strong>gedeutschte tschechische<br />
Element dem Tschechentum wieder zurückzugew<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> das Dorf durch kulturpolitische<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> tschechischen Zuzug allmählich zu erobern – alle Nationalismen<br />
träumen von ethnischer Purifikation, nur die Methoden haben e<strong>in</strong>e Bandbreite<br />
von struktureller bis zu manifester Gewalt. 57 E<strong>in</strong>en scharfen E<strong>in</strong>schnitt <strong>in</strong> der<br />
Dorfgeschichte markierte die Umwandlung der deutschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e tschechische Volksschule,<br />
da nun die jüngeren deutschen K<strong>in</strong>der durch e<strong>in</strong>e Privatschule des Deutschen<br />
Kulturverbandes unterrichtet wurden <strong>und</strong> die größeren <strong>in</strong> die deutsche Schule des<br />
Nachbardorfes Luggau gehen mußten – <strong>in</strong>sgesamt waren 1919 22 K<strong>in</strong>der zum deutschen<br />
Unterricht gemeldet. Der Verlust ihrer se<strong>in</strong>erzeit mit großen Opfern erbauten<br />
Volksschule war für die Deutschen e<strong>in</strong> traumatisches Ereignis. Alle Interviews der<br />
Erlebnisgeneration kommen <strong>in</strong> den ersten M<strong>in</strong>uten auf dieses Thema zu sprechen.<br />
„Wie die Tschechen kommen s<strong>in</strong>d, ist e<strong>in</strong> (unverständlich), hat e<strong>in</strong>e Leiter gnommen,<br />
hat ‘Schul’ überweißigt <strong>und</strong> ‘Škola’ aufigschrieb´n mit dem Kalk. Da haben die Deutschen<br />
schwer glitten, sehr schwer.“<br />
Die Situation bei den K<strong>in</strong>dergärten glich der Schulentwicklung, nur daß dafür<br />
Geme<strong>in</strong>de <strong>und</strong> Vere<strong>in</strong>e zuständig waren. Es bestanden nunmehr nebene<strong>in</strong>ander auch<br />
zwei K<strong>in</strong>dergärten, der seit längerem bestehende deutsche mußte freilich <strong>in</strong> den Dreißigerjahren<br />
wegen K<strong>in</strong>dermangels zusperren, der 1919 von Regierungskommissär<br />
Vocilka <strong>in</strong> die Wege geleitete tschechische K<strong>in</strong>dergarten konnte <strong>im</strong> Herbst 1926 se<strong>in</strong><br />
neues Haus beziehen. Auch die gewählte Geme<strong>in</strong>deverwaltung wurde abgesetzt <strong>und</strong><br />
der Bürgermeister durch e<strong>in</strong>en Regierungskommissar ersetzt. Bei den am 24. Juni<br />
1919 abgehaltenen Geme<strong>in</strong>deratswahlen erreichten die deutschen Parteien jedoch<br />
noch die Mehrheit <strong>und</strong> behielten den Bürgermeister. Auf die kulturellen Strukturen<br />
von Schule <strong>und</strong> tschechischem K<strong>in</strong>dergarten folgte noch 1919 zusätzlich zum deutschen<br />
Wirtshaus Kiesl<strong>in</strong>g die Etablierung des tschechischen Gasthauses von František<br />
Hopp.<br />
Den nächsten nationalpolitisch relevanten Anlaß zu Ause<strong>in</strong>andersetzungen lieferte<br />
die Volkszählung des Jahres 1921. Nun g<strong>in</strong>g es ernsthaft um die Frage, wem das Dorf<br />
57 HANNS HAAS: Typen <strong>und</strong> Verlaufsmodelle ethnischer Homogenisierung unter Zwang, <strong>in</strong>:<br />
Beiträge zur Historischen Sozialk<strong>und</strong>e 4 (1996), S. 152-159.<br />
238
gehöre, den Deutschen oder den Tschechen. Tatsächlich brachte die Volkszählung die<br />
bereits erwähnte Umkehr von der deutschen zur tschechischen Mehrheit. Doch der<br />
nationale Bekenntniszwang verändert nur sehr langsam Ethnizität <strong>und</strong> Sprachverwendung.<br />
Daher beobachten wir <strong>in</strong> der nationalsozialistischen Volkszählung des Jahres<br />
1939 unter den verbliebenen Tschechen vielfach die erneute Rückverwandlung <strong>in</strong><br />
Deutsche.<br />
Der Abschied von der Vorherrschaft fällt <strong>im</strong>mer schwer. Die tschechischen Terra<strong>in</strong>gew<strong>in</strong>ne<br />
kränkten die Deutschen. „Ach, wir haben e<strong>in</strong>e Wut ghabt über die<br />
Tschechen. Ich kann es Ihnen nicht anders sagen“, er<strong>in</strong>nert sich Frau Huber. In Wahrheit<br />
berühren diese nationalen Hoffnungen <strong>und</strong> Ängste vorläufig nur e<strong>in</strong> schmales<br />
Segment des sozialen Lebens. Das Bauerndorf konnte der nationalen Konfrontation<br />
nicht ständige Aufmerksamkeit zuwenden. So folgten auch <strong>in</strong> Baumöhl auf die Anpassungskrise<br />
der Übergangszeit Jahre der Rout<strong>in</strong>e. Die he<strong>im</strong>ische Bevölkerung war<br />
national verortet. Die Zahl der Deutschen blieb von nun an be<strong>in</strong>ahe unverändert, jene<br />
der Tschechen stieg allerd<strong>in</strong>gs durch Zuzug von Sicherheits- <strong>und</strong> Forstpersonal. Parallel<br />
dazu erfolgte die politische Majorisierung bei den Geme<strong>in</strong>deratswahlen vom 25.<br />
November 1928, so daß nun sieben Tschechen <strong>und</strong> fünf Deutsche <strong>im</strong> Geme<strong>in</strong>deausschuß<br />
saßen. Damit war e<strong>in</strong> nächstes politisches Schlüsselereignis mit entsprechender<br />
nationaler Emotionalisierung e<strong>in</strong>getreten.<br />
Rasch kehrte jedoch die Normalität zurück. Man arrangierte sich mit der neuen<br />
Lage. Der tschechische Bürgermeister, F<strong>in</strong>anzwachtmeister <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>hausbesitzer<br />
Slaby, war <strong>im</strong> Dorf angesehen. Se<strong>in</strong>e Arbeit machte er ganz gut, <strong>in</strong> nationaler H<strong>in</strong>sicht<br />
war ohneh<strong>in</strong> nicht viel zu ändern. Weil Slaby nicht deutsch beherrschte, übernahm<br />
der Bauer Weid<strong>in</strong>ger als Geme<strong>in</strong>deratsmitglied die deutschen Agenden der<br />
Geme<strong>in</strong>deverwaltung. Auf diese Weise konnte die sonst <strong>im</strong> Dorfleben gelebte Zweisprachigkeit<br />
auf die amtliche Ebene übertragen werden. Es gibt ke<strong>in</strong>e Berichte über<br />
politisch motivierte Ause<strong>in</strong>andersetzungen oder Verteilungskämpfe auf Geme<strong>in</strong>deebene.<br />
Für e<strong>in</strong>e Art von Proporz sprechen die gleich hohen Subventionen für die beiden<br />
Feuerwehren. Die Vernunftehe zwischen Deutschen <strong>und</strong> Tschechen reichte jedoch<br />
nicht zu symbolischer Geme<strong>in</strong>samkeit. E<strong>in</strong> Kriegerdenkmal kam daher <strong>in</strong> Baumöhl<br />
nicht zustande, obwohl von den <strong>in</strong>sgesamt 47 Kriegsteilnehmern sieben nicht<br />
mehr <strong>in</strong>s Dorf zurückkehrten. 58 Ähnliche Kooperationsmodelle s<strong>in</strong>d aus dem zweisprachigen<br />
Unterradischen überliefert, denn dort wurde sogar die offizielle Geme<strong>in</strong>dechronik<br />
zweisprachig geführt. Unterradischen hatte ohneh<strong>in</strong> bereits seit 1906 neben<br />
der deutschen auch e<strong>in</strong>e tschechische Volksschule, so daß der Prozeß der nationalen<br />
<strong>und</strong> ethnischen Verfestigung der tschechischen Identität auf e<strong>in</strong>e längere Tradition als<br />
<strong>in</strong> Baumöhl zurückblickte. Diese zeitlichen Verschiebungen <strong>in</strong> der ethnopolitischen<br />
Entwicklung konnte die Feldforschung bisher nicht mit letzter Klarheit erklären. Es<br />
wäre möglich, daß <strong>in</strong> den Walddörfern der wirtschaftlich-soziale Strukturbruch der<br />
Reagrarisierung unter der vom B<strong>in</strong>nenland zugezogenen tschechischen Bevölkerung<br />
die Rezeption nationaler Deutungsmuster erleichterte, während die nach Baumöhl<br />
e<strong>in</strong>gewanderten Tschechen die agrarische Kont<strong>in</strong>uität des Dorfes gewährleisteten <strong>und</strong><br />
58 Geme<strong>in</strong>dechronik Baumöhl.<br />
239
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e bestehende Struktur e<strong>in</strong>lebten. Es ist aber auch denkbar, daß die nationale<br />
Agitation <strong>in</strong> der Nachbarschaft zum früher politisierten Kronland Böhmen das E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen<br />
nationaler Deutungsmuster erleichterte. Ethnische <strong>und</strong> nationale Koexistenz<br />
waren jedoch auch <strong>in</strong> den Walddörfern das Gr<strong>und</strong>muster der dörflichen Ordnung, die<br />
nationalen Konflikte beherrschten nur Ausnahmezeiten, <strong>und</strong> die Nationalisierung des<br />
Ethnikums bedurfte nicht erst wie <strong>in</strong> Baumöhl der staatlichen Unterstützung. Dennoch<br />
wird an solchen Facetten unterschiedlicher Entwicklung erneut die Frage nach<br />
der Repräsentativität der erforschten dörflichen Kulturmuster aufgeworfen. Nur zwei<br />
Parallelstudien zu e<strong>in</strong>em Brünner agrarischen Vorstadtdorf <strong>und</strong> zu slowakischen gemischten<br />
Agrargeme<strong>in</strong>den kommen zu ähnlichen Ergebnissen, denn auch sie zeigen<br />
die Dom<strong>in</strong>anz agrarisch-dörflicher Lebensnotwendigkeit vor der Betonung ethnischer<br />
Differenz. 59<br />
Entfremdung<br />
Alles <strong>in</strong> allem bewahrten die untersuchten Dörfer die Fähigkeit zur ethno-nationalen<br />
Koexistenz, weil sie die Unterscheidung von deutsch <strong>und</strong> tschechisch hauptsächlich<br />
<strong>im</strong> Rahmen ihrer tradierten Ethnizität <strong>und</strong> auf Dorfebene trafen. Nur dieser feste<br />
Rückhalt <strong>in</strong> ethnischer Moral <strong>und</strong> ethnischen Netzwerken erlaubte den Dörfern e<strong>in</strong>e<br />
partielle Resistenz gegen den Nationalismus, dem nur eng umrissene soziale Deutungskompetenz<br />
e<strong>in</strong>geräumt wurde, soweit allenfalls der E<strong>in</strong>fluß des Politischen<br />
reichte. Diese Balance zwischen Sprachkonventionen, Ethnizität <strong>und</strong> Nationalität kam<br />
<strong>in</strong> den ausgehenden Dreißigerjahren aus dem Gleichgewicht. Nunmehr ersetzte die<br />
Nation be<strong>in</strong>ahe gänzlich die autonomen Orientierungen. Die nationale Verengung war<br />
e<strong>in</strong>e Folge der großen politischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, die sich gerade den Grenzdörfern<br />
durch viele Zeichen <strong>und</strong> Anforderungen präsentierten. Die Politik gewann an<br />
Terra<strong>in</strong>. Am Beg<strong>in</strong>n stand seit 1934 die Flucht österreichischer Sozialdemokraten <strong>und</strong><br />
Kommunisten vor dem „ständestaatlichen“ Reg<strong>im</strong>e über die „grüne Grenze“ <strong>in</strong> die<br />
Tschechoslowakei. Südmährische deutsche Sozialdemokraten waren <strong>in</strong> die Netzwerke<br />
zum Schmuggel illegaler sozialdemokratischer Druckschriften nach Österreich <strong>in</strong>volviert.<br />
Umgekehrt lieferten konservative Deutsche dem österreichischen „Ständestaat“<br />
Informationen über die sozialdemokratischen Emigranten.<br />
Dieser Konflikt zwischen „rot“ <strong>und</strong> „schwarz“ wurde jedoch seit 1935 durch die<br />
Fernwirkungen des deutschen Nationalsozialismus überlagert. Jetzt frequentierte vor<br />
allem nationalsozialistische Propaganda die Grenze. Die vom Nationalsozialismus<br />
entfachte Aufbruchst<strong>im</strong>mung erfaßte rasch die mährischen Grenzlanddeutschen, allen<br />
voran die Jungen, zögernd folgten die Älteren. Der Nationalsozialismus bündelte<br />
mehrere Motive <strong>und</strong> Anliegen, <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die nationale Emotion, weil er erneut<br />
die Frage nach der staatlichen Zukunft der deutschen Volksgruppen stellte. Schon vor<br />
den tschechoslowakischen Parlamentswahlen des Jahres 1935 kursierte beispielsweise<br />
59 Siehe die oben unter Anmerkung 13 <strong>und</strong> 33 zitierten Arbeiten von Frolcová <strong>und</strong> Droppová.<br />
240
<strong>in</strong> Gnadlersdorf das Gerücht, „daß man das Gebiet bis Zna<strong>im</strong> an Österreich <strong>und</strong> später<br />
an Deutschland angliedern wird“. 60 Indirekt bestätigten die tschechoslowakischen<br />
Grenzschutzmaßnahmen solche Vorstellungen. Die Grenze wurde nach e<strong>in</strong>er langen<br />
Phase der problemlosen Durchlässigkeit wieder dichter. Der Kle<strong>in</strong>e Grenzverkehr<br />
wurde vielfach beh<strong>in</strong>dert. Schließlich markierte die tschechoslowakische Bunkerl<strong>in</strong>ie<br />
knapp h<strong>in</strong>ter den mährischen Grenzdörfern die B<strong>in</strong>nengrenze e<strong>in</strong>er nur noch erschwert<br />
passierbaren Verteidigungszone. Zu den nationalen kamen gesellschaftspolitische<br />
Probleme, vor allem die Überlebensfähigkeit <strong>und</strong> Modernisierungskapazität der<br />
kle<strong>in</strong>teiligen landwirtschaftlichen Struktur sowie die Versorgung der weichenden<br />
Hoferben <strong>und</strong> der besitzlosen Dorfarmut. Das Gerücht, ke<strong>in</strong> deutscher Lehrer werde<br />
mehr e<strong>in</strong>gestellt, war typisch für diese national zugespitzte Situation. E<strong>in</strong> Gnadlersdorfer<br />
Zeitgenosse me<strong>in</strong>te: „E<strong>in</strong> jeder hat ja ke<strong>in</strong>e Zukunft gesehen, das war e<strong>in</strong>mal<br />
logisch.“ 61 In Böhmisch Rudoletz erreichte der Nationalsozialismus rasch die schmale<br />
Schicht der Beamtenschaft, der modernisierungswilligen Großbauern <strong>und</strong> vor allem<br />
das halbproletarische Substrat. „Die haben e<strong>in</strong>e neue Ära vorgef<strong>und</strong>en, die haben sich<br />
emporarbeiten können“, berichtet e<strong>in</strong> Rudoletzer Kle<strong>in</strong>häuslersohn. 62 Als dritter Motivationsstrang<br />
ist die Säkularisierung zu nennen. So sehr Dorf <strong>und</strong> Kirche zusammengehörten,<br />
erreichten die Botschaften von e<strong>in</strong>em weniger kirchlich reglementierten<br />
Leben doch auch die agrarische Welt. In Rudoletz antizipierte die Jugend die ideologische<br />
Führerrolle des Nationalsozialismus <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er dörflichen Adepten fast vollkommen,<br />
„dem Pfarrer wurde nicht mehr zugehört“. 63<br />
Diese Motive gewannen jedoch nur sukzessive <strong>und</strong> nach Handlungsebenen unterschiedlich<br />
starke Deutungskompetenz. Gr<strong>und</strong>sätzlich ist von e<strong>in</strong>er Gewichtung nach<br />
Generationen auszugehen, da der extreme Nationalismus als erstes die Jungen erfaßte<br />
<strong>und</strong> erst <strong>im</strong> weiteren Verlauf auch die ältere Generation überzeugte oder zum<strong>in</strong>dest<br />
verstummen ließ. In sozialer H<strong>in</strong>sicht waren alle Schichten dem Nationalismus zugängig,<br />
<strong>in</strong> politischer blieben e<strong>in</strong>ige christlichsoziale <strong>und</strong> sozialdemokratische sowie<br />
die ohneh<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gen kommunistischen Segmente mehr oder weniger resistent. Für<br />
unseren Forschungszusammenhang relevant ist jedoch die unterschiedliche Deutungskompetenz<br />
des extremen Nationalismus auf den drei dörflichen Handlungsebenen.<br />
Die erste Handlungsebene des Politisch-Nationalen konnte die Henle<strong>in</strong>bewegung<br />
bzw. der Nationalsozialismus rasch durchdr<strong>in</strong>gen. Bei den Parlamentswahlen 1935<br />
erreichte Henle<strong>in</strong> auch <strong>in</strong> den deutschen Bauerngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> unter den Deutschen<br />
der gemischten Dörfer knapp die Mehrheit, blieb jedoch be<strong>in</strong>ahe überall unter dem<br />
landesweiten Durchschnitt von 67% der deutschen St<strong>im</strong>men. 64 Sonst läßt sich jedoch<br />
60<br />
Chronik der tschechischen Volksschule Gnadlersdorf, E<strong>in</strong>trag Schuljahr 1934/35.<br />
61<br />
Interview F., S. 41.<br />
62<br />
Interview F.<br />
63<br />
Ebenda.<br />
64<br />
HANNS HAAS: Die Zerstörung der Lebense<strong>in</strong>heit „Grenze“ <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert, <strong>in</strong>: Kontakte<br />
<strong>und</strong> Konflikte. Böhmen, Mähren <strong>und</strong> Österreich. Aspekte e<strong>in</strong>es Jahrtausends geme<strong>in</strong>samer<br />
Geschichte. Referate des Symposiums „Verb<strong>in</strong>dendes <strong>und</strong> Trennendes an der Grenze 3“<br />
241
auf Dorfebene die neue politische Wertorientierung nur <strong>in</strong> fe<strong>in</strong>en Zeichen ablesen. In<br />
erster L<strong>in</strong>ie g<strong>in</strong>gen die dörflichen Honoratioren auf Distanz zu den tschechoslowakischen<br />
Staatskulten. Dem toten Präsidenten Masaryk wurde noch die gebührende Reverenz<br />
erwiesen. Die Trauerfeier vom 21. September 1936 vere<strong>in</strong>te <strong>im</strong> ethnisch gemischten<br />
Baumöhl „die Bevölkerung beider Nationalitäten“, die Bürgermeister, Geme<strong>in</strong>deräte,<br />
Beamte, Lehrer, „deutsche <strong>und</strong> tschechische Vere<strong>in</strong>e“; die Büste wurde<br />
von e<strong>in</strong>em deutschen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em tschechischen Feuerwehrmann <strong>und</strong> von deutscher<br />
<strong>und</strong> tschechischer Schuljugend flankiert. 65 Dem neuen Präsidenten Beneš jedoch<br />
wurden diese Reverenzen verweigert. Die tschechoslowakischen Staatskulte verengten<br />
sich also wieder zur Angelegenheit der „staatstragenden“ Nation. E<strong>in</strong>e spezielle<br />
Form der Opposition war es, wenn Gnadlersdorfer Bauern ausgerechnet am Staatsgründungstag,<br />
dem 28. Oktober, vor dem Zollhaus Mist ausführten.<br />
Die ethnische Ebene blieb lange frei von Dissonanzen. Die beiden Baumöhler –<br />
deutsche <strong>und</strong> tschechische – Feuerwehren übten noch 1936 <strong>und</strong> 1937 geme<strong>in</strong>sam <strong>und</strong><br />
fuhren zusammen zu Feuerwehrtreffen. Allerd<strong>in</strong>gs gewann auf beiden Seiten die national,<br />
nicht ethnisch beherrschte Sek<strong>und</strong>ärfolklore an Bedeutung, etwa mit den bei<br />
den Tschechen verhaßten deutschen alp<strong>in</strong>en Trachten. Jedoch erst 1938 lassen sich<br />
echte Separierungstendenzen, ja Konflikte nachweisen. So wurde <strong>in</strong> Fra<strong>in</strong>/Vranov die<br />
tschechische Dorfjugend vom deutschen Sonnwendfeuer ferngehalten. 66 Auch die<br />
Sprachwahl erlangte zusehends Bekenntnischarakter. In der Schattauer Doleschalmühle<br />
beharrte die tschechische Belegschaft nun auf der tschechischen Betriebssprache.<br />
67 Die tschechische Bürokratie verteidigte oft kle<strong>in</strong>lich die seit 1918 erreichte<br />
Asymmetrie <strong>in</strong> der Geltung der beiden Landessprachen. Gleichzeitig def<strong>in</strong>ierte die<br />
nationalpolitische Propaganda die deutsche Volksgruppe als „Sudetendeutsche“ <strong>im</strong><br />
Gegensatz zum tradierten Selbstbild als „Südmährer“.<br />
Die Separation<br />
Der Anschluß der Sudetengebiete an das Deutsche Reich entfremdete vollends Deutsche<br />
<strong>und</strong> Tschechen. Jetzt begann die etappenweise ethnische Homogenisierung <strong>in</strong><br />
<strong>im</strong>mer grausameren Formen. Sofort verließen <strong>in</strong> der ersten Nacht nach dem Anschluß<br />
die Juden mit dem leichten Rucksack die deutschen Dörfer <strong>und</strong> mit ihnen die meisten<br />
der seit 1918 zugezogenen tschechischen Grenzer, F<strong>in</strong>anzer, Gendarmen, Bahnbediensteten<br />
<strong>und</strong> Lehrer. E<strong>in</strong>ige hier seit langem he<strong>im</strong>ische tschechische Bewohner<br />
wurden Opfer tätlicher Übergriffe durch „die besten Nachbarn“. 68 Sobald wie möglich<br />
verließen sie die Dörfer, es ist „ihnen unhe<strong>im</strong>lich geworden, weil sie <strong>im</strong>mer ge-<br />
vom 24.-27. Oktober 1992 <strong>in</strong> Zwettl, hrsg. von THOMAS WINKELBAUER, Waidhofen a. d. T.<br />
1993, S. 63-386, hier S. 371.<br />
65<br />
Chronik der tschechischen Volksschule Baumöhl, E<strong>in</strong>tragung Schuljahr 1936.<br />
66<br />
Fra<strong>in</strong>, Interview V.<br />
67<br />
Schattau, Interview D.<br />
68<br />
Gnadlersdorf, Interview Sch.-W.<br />
242
hört haben, also den treiben wir h<strong>in</strong>aus, der braucht nicht mehr <strong>im</strong> Dorf zu se<strong>in</strong>“. 69<br />
Mit ihnen wichen dem Druck jetzt auch die tschechischen Pfarrer, die den Deutschen<br />
seit Jahrzehnten fast akzentfrei gepredigt, sie getraut <strong>und</strong> ihre K<strong>in</strong>der getauft hatten.<br />
Die Auflösung des Dorfes zeigte sich an vielen symbolträchtigen Details. E<strong>in</strong> tschechischer<br />
Respondent, damals Schneiderlehrl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Schattau, berichtet, daß die deutschen<br />
Jugendlichen selbst <strong>im</strong> K<strong>in</strong>o von den tschechischen Jugendlichen wegrückten. 70<br />
Solche Schlüsselszenen der Entfremdung blieben dem Gedächtnis durch Jahrzehnte<br />
e<strong>in</strong>graviert. E<strong>in</strong> vertriebener Schaff<strong>in</strong>ger Tscheche kommentiert prägnant diese Auflösung<br />
der Dorfsolidarität: Die Deutschen „ließen uns 1938 <strong>in</strong> Stich“. 71<br />
Nach dem Ende des Großdeutschen Reiches wendete sich das Blatt zugunsten der<br />
Tschechen. Es steht außer Zweifel, daß die staatlichen <strong>und</strong> nationalen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
maßgeblich für die dörfliche Geschichte wurden, ob es sich um die Flucht der<br />
Deutschen vor der Roten Armee, die E<strong>in</strong>setzung tschechischer Verwaltungskommissäre,<br />
die Verdrängung <strong>und</strong> Vertreibung der Deutschen, die kommunistische Machtergreifung<br />
oder den Eisernen Vorhang handelt. Aus der dorfgeschichtlichen Perspektive<br />
bedeuten diese E<strong>in</strong>schnitte zugleich mehrere aufe<strong>in</strong>ander folgende, sich oft sogar<br />
überlappende Tendenzen, nämlich die Auflösung des deutschen Dorfes, die Rekonstruktion<br />
tradierter Dorfstrukturen durch die tschechischen <strong>und</strong> slowakischen Neusiedler<br />
nach 1945 sowie die Neustrukturierung des Dorfes unter den Voraussetzungen<br />
der Kollektivwirtschaft nach 1948. Diese Prozesse verliefen jedoch nicht l<strong>in</strong>ear <strong>und</strong><br />
ferngesteuert. Stets g<strong>in</strong>g es um e<strong>in</strong>e Verschränkung von Vorgaben <strong>und</strong> autonomen<br />
örtlichen Entwicklungen. Das Dorf war nicht nur Befehlsempfänger, sondern Akteur,<br />
<strong>und</strong> ist als solcher auch Gegenstand der Forschung.<br />
Besonders komplex s<strong>in</strong>d die beiden e<strong>in</strong>ander bed<strong>in</strong>genden Prozesse der Vertreibung<br />
der Deutschen <strong>und</strong> der tschechischen Neusiedlung <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander verschränkt, was<br />
den Dörfern vielfache autonome Handlungsmöglichkeiten erlaubte. 72 Der Impetus für<br />
die Vertreibung g<strong>in</strong>g trotz der großen <strong>in</strong>neren Entfremdung nicht von den Dörfern<br />
selbst aus. Schriftliche Quellen <strong>und</strong> lebensgeschichtliche Interviews liefern viele H<strong>in</strong>weise<br />
darauf, daß die politische Phantasie der verbliebenen oder der allmählich zurückkehrenden<br />
tschechischen Dorfbewohner von dörflich-agrarischen Kategorien geprägt<br />
war. Man dachte vage an e<strong>in</strong>e Umkehr der sozialen <strong>und</strong> der Machtverhältnisse,<br />
<strong>in</strong>dem die Deutschen <strong>in</strong>s H<strong>in</strong>terstübel oder auf die kle<strong>in</strong>en Anwesen übersiedeln, ihre<br />
69 Ebenda.<br />
70 Schattau, Interview T.<br />
71 Schaffa/Šafov, Interview C.; vgl. dazu die tschechischen Er<strong>in</strong>nerungsberichte: (Red.): Vyhnání<br />
C+echu` z pohranic=í 1938. Vzpomínky. [Die Vertreibung der Tschechen aus dem<br />
Grenzgebiet 1938. Er<strong>in</strong>nerungen], red. von KAREL ZELENÝ, Praha 1996.<br />
72 Zusätzlich zu den neu erschlossenen Dokumenten <strong>und</strong> den lebensgeschichtlichen Interviews<br />
wurden die umfangreichen Dokumentensammlungen <strong>und</strong> Monographien, beispielsweise<br />
folgende, herangezogen: Die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei,<br />
2 Bände, Berl<strong>in</strong> 1957 (Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa,<br />
Bd. 4, 2); SUSANNE LINSBICHLER: Die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der<br />
Tschechoslowakei, Diplomarbeit Univ. Wien 1991.<br />
243
öffentlichen Funktionen verlieren, daß jedenfalls die Nationalsozialisten bestraft <strong>und</strong><br />
entfernt werden sollten <strong>und</strong> sich auf diese Weise e<strong>in</strong> Zuwachs an tschechischer Präsenz<br />
<strong>im</strong> Grenzgebiet ergeben werde. In den Maitagen 1945 bestanden vielfach ganz<br />
„normale“ <strong>in</strong>nerdörfliche Umgangsformen, etwa <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Brandbekämpfung<br />
auch deutscher Gehöfte. Diese Rekonstruktion, allenfalls Modifikation<br />
der früheren Verhältnisse korrespondierte mit deutschen Erwartungen, sonst wäre die<br />
Rückkehr der vor der Kriegsfront Evakuierten <strong>in</strong> ihre He<strong>im</strong>atdörfer <strong>und</strong>enkbar. Das<br />
Dorf zeigte jedoch schon <strong>in</strong> dieser ersten Nachkriegsphase e<strong>in</strong> Janusgesicht. Denn die<br />
Vertrautheit mit den Verhältnissen <strong>und</strong> Handlungen des anderen führte e<strong>in</strong>erseits zu<br />
<strong>in</strong>dividueller Rache <strong>und</strong> Besitzaneignung, häufig jedoch auch zu spontaner Hilfe für<br />
Dorfgenossen, die man aus besseren Zeiten als gute Nachbarn kannte. 73 Aus Baumöhl<br />
ist aus den Maitagen e<strong>in</strong> dramatischer Zwischenfall überliefert. Dort brachte die Rote<br />
Armee zehn auf der Flucht ergriffene deutsche Gendarmen auf den Friedhof, unter<br />
ihnen den Postenkommandanten von Baumöhl <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> Baumöhl ansässigen<br />
Hilfsgendarmen. Die Tochter des Hilfsgendarmen verfolgte die schreckliche Szene<br />
aus der Entfernung: E<strong>in</strong>er nach dem anderen wurde erschossen. „Und so wäre jetzt<br />
me<strong>in</strong> Vater die Reih auch gwesen <strong>und</strong> der Postenführer. Und da war dann e<strong>in</strong> anderer,<br />
e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>he<strong>im</strong>ischer Tscheche. Hat er gsagt, verschw<strong>in</strong>d, schau, daß du weiterkommst<br />
<strong>und</strong> hat ihn weggstampert <strong>und</strong> den B. (Postenkommandant) auch. Na, so s<strong>in</strong>d sie mit<br />
dem Leben davonkommen“, <strong>und</strong> mit ihnen der Retzer Gendarm, während die sieben<br />
Dorf- <strong>und</strong> Regionsfremden ihr Leben lassen mußten. 74 Noch e<strong>in</strong>mal setzte die dörfliche<br />
Vertrautheit die Allmacht des Politischen außer Kraft. Immer noch umschloß das<br />
Dorf se<strong>in</strong>e von der Politik ausgegrenzten Angehörigen.<br />
Erst die obrigkeitliche Steuerung, die Beneš-Dekrete, die e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung von sozialer<br />
Begehrlichkeit mit nationalen Emotionen herstellten, sowie die gezielten Vertreibungsaktionen<br />
durch jugendliche Partisanene<strong>in</strong>heiten brachten e<strong>in</strong>e radikale Wende.<br />
In Südmähren unterscheiden wir nun zwei Typen von Vertreibung: Schon seit<br />
Mitte Mai 1945 an der Sprachgrenze <strong>und</strong> <strong>im</strong> reichen Agrargebiet das langsame E<strong>in</strong>sickern<br />
tschechischer Neusiedler <strong>und</strong> die Verdrängung der Deutschen <strong>in</strong> die H<strong>in</strong>terhöfe;<br />
sodann die schlagartige Aussiedlung ganzer Grenzdörfer seit Anfang Juni 1945<br />
anhand von vorbereiteten Listen <strong>und</strong> unter Partisanene<strong>in</strong>satz, folgend die wellenartigen<br />
Fluchtbewegungen über die Grenze aus Angst vor Zwangsarbeit <strong>im</strong> Landes<strong>in</strong>nern<br />
<strong>und</strong> zuletzt 1946 den formellen odsun/Abschub.<br />
Die <strong>im</strong> Mikrokontext unbrauchbare Logik des <strong>in</strong>tegralen Nationalismus zerstörte<br />
somit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em knappen Dezennium von 1938 bis 1948 die noch <strong>in</strong>takte Lebensform<br />
des Dorfes. Während das Nationale bis dah<strong>in</strong> nur jene Bereiche steuerte, die der dörf-<br />
73 Die deutschen Zeitgenossen berichten durchgehend, daß <strong>in</strong> der Regel die dorffremden<br />
Tschechen, nicht die he<strong>im</strong>ischen, zu Gewaltanwendung neigten. Vgl. dazu RAINER B. GEP-<br />
PERTH: Die Vertreibung, Ausweisung <strong>und</strong> Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus den<br />
südmährischen Gerichtsbezirken Fra<strong>in</strong> <strong>und</strong> Zna<strong>im</strong> 1945/46, Phil. Diss. Salzburg 1970.<br />
74 Interview W., S. 8, <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dechronik ist von sechs erschossenen Gendarmen die Rede.<br />
„Der Gr<strong>und</strong> für diese H<strong>in</strong>richtung ist e<strong>in</strong> Gehe<strong>im</strong>nis; vielleicht war es Rache von manchen<br />
Soldaten, deren Familien von deutschen Soldaten ermordet worden waren.“<br />
244
liche lebensweltliche Wissensvorrat nicht abdeckte, wurde nunmehr die dörfliche<br />
S<strong>in</strong>nstruktur durch die nationale S<strong>in</strong>nordnung ersetzt, obwohl weiterh<strong>in</strong> der Bedarf an<br />
lebensweltlicher Handlungskoord<strong>in</strong>ation bestand. 75 Die Deutschen g<strong>in</strong>gen, die Tschechen<br />
blieben. Doch der moralische Kredit des Dorfethos war verbraucht. Die kaum<br />
rekonstruierten Dörfer wurden erneut von der erzwungenen Sozialisierung e<strong>in</strong>er höheren<br />
Logik dienstbar. 76<br />
75<br />
BERNHARD MIEBACH: Soziologische Handlungstheorie. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung, Opladen 1991,<br />
S. 332.<br />
76<br />
Die Parlamentswahlen <strong>in</strong> der Tschechoslowakei 1935–1946–1948. E<strong>in</strong>e statistische Analyse,<br />
hrsg. von JIR=Í SLÁMA <strong>und</strong> KAREL KAPLAN, München 1986 (Veröffentlichungen des Collegium<br />
Carol<strong>in</strong>um, Bd. 53).<br />
245
Arbeitsbibliographie<br />
von<br />
Hans L e m b e r g<br />
unter Mitwirkung von Eckart Günther, Haik Porada <strong>und</strong> Hans-Werner Rautenberg<br />
sowie mit fre<strong>und</strong>lichen Ergänzungen von Ekkehard Buchhofer, Robert Luft<br />
<strong>und</strong> anderen.<br />
Vorbemerkung<br />
Diese Literaturliste ist als Arbeitsbibliographie zu praktischen Zwecken <strong>im</strong> Vorfeld<br />
der Tagung entstanden, deren Ergebnisse <strong>in</strong> diesem Band vorgelegt werden. Sie ist<br />
seither weiter entwickelt <strong>und</strong> unter anderem um unmittelbar auf <strong>Grenzen</strong> bezogene<br />
Titel aus den Fußnoten der Beiträge dieses Bandes ergänzt worden. Sie enthält nicht<br />
nur wissenschaftliche Literatur, sondern exemplarisch auch politische Kampfliteratur<br />
aus den Epochen, <strong>in</strong> denen Grenzfragen hohes Interesse fanden (Friedensverträge<br />
1919, We<strong>im</strong>arer <strong>und</strong> NS-Zeit – dort v.a. “Grenz- <strong>und</strong> Auslandsdeutschtum” –, Polen<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg, deutsch-deutsche Grenze u.a.m. – Wenn Sammelbände<br />
aufgeführt s<strong>in</strong>d, werden deren E<strong>in</strong>zelbeiträge nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen gesondert<br />
genannt.<br />
Die Arbeitsbibliographie erhebt – auch formal – nicht den Anspruch bibliographischer<br />
Vollkommenheit; so enthält sie stellenweise dort, wo Autopsie bzw. Verifizierung<br />
nicht erreichbarer Titel die Publikation zu lange aufgehalten hätte, unvollständige<br />
Angaben; andererseits s<strong>in</strong>d gelegentlich <strong>in</strong> eckigen Klammern weiterführende<br />
oder erklärende H<strong>in</strong>weise h<strong>in</strong>zugefügt. Dies alles bitten wir zu entschuldigen.<br />
Zur besseren Auff<strong>in</strong>dbarkeit bei Leih-Bestellungen ist die Angabe “In:” fett<br />
gedruckt.<br />
Across Bo<strong>und</strong>aries. Hrsg. v. O. Mart<strong>in</strong>ez.<br />
El Paso 1986.<br />
Adami, Vittorio: National Frontiers <strong>in</strong><br />
Relation to International Law (Engl.<br />
Übs.). London 1927.<br />
Alary, Eric: La ligne de démarcation<br />
(1940–1944). Paris 1995. (= Que<br />
sais-je? 3045).<br />
Albert, Andrzej: Wschodnie granice<br />
Polski [Die Ostgrenze Polens]. In:<br />
Zeszyty historyczne 53 (1980), 24–<br />
75.<br />
Albert, K.-H.: Überprüfung der Grenzzeichen<br />
an der Staatsgrenze<br />
zwischen der DDR <strong>und</strong> der C+SSR.<br />
In: Vermessungstechnik. Karlsruhe,<br />
37 (1989), 159 ff.<br />
Alliierte Kriegspolitik <strong>und</strong> tschechische<br />
<strong>Grenzen</strong> 1914–1918. In: Berl<strong>in</strong>er<br />
Monatshefte 16 (1938), 1017–1044.<br />
247
Alwart, Karl L.: 170 Jahre Grenze<br />
Bayern-Pfalz <strong>und</strong> Frankreich. Pirmasens<br />
1996.<br />
The American frontier. Oppos<strong>in</strong>g viewpo<strong>in</strong>ts.<br />
Hrsg. v. Mary Ellen Jones.<br />
San Diego 1994.<br />
An den <strong>Grenzen</strong> Rußlands. 11 Abhandlungen<br />
aus der Sammlung “Der<br />
Weltkrieg”. Hrsg. v. Sekretariat<br />
Sozialer Studentenarbeit. Mönchen-<br />
Gladbach 1916.<br />
Ancel, Jacques: Les frontières. Paris<br />
1938.<br />
Ancel, Jacques: L’évolution de la notion<br />
de frontière. In: Bullet<strong>in</strong>. Comité International<br />
des Sciences historiques<br />
5 (Juli 1933), Nr. <strong>20</strong>.<br />
Anderson, Malcolm: Frontiers. Territory<br />
and State Formation <strong>in</strong> the Modern<br />
World. Cambridge u.a. 1996.<br />
Arabian Bo<strong>und</strong>aries. Pr<strong>im</strong>ary documents<br />
1852–1957. Hrsg. v. Richard<br />
Schofield u. Gerald Blake. Farnham<br />
Commons, Buck. 1988.<br />
Arndt, Ernst Moritz: Der Rhe<strong>in</strong>,<br />
Teutschlands Strom, aber nicht<br />
Teutschlands Gränze. Leipzig 1813.<br />
In: Arndts Werke, hrsg. v. A. Leffson<br />
u. W. Steffens, 1912, XI, S. 41.<br />
Asiwaju, A. I.: Borderland Research. A<br />
Comparative Perspective. El Paso<br />
1983.<br />
Aub<strong>in</strong>, Hermann: Die Ostgrenze des alten<br />
Deutschen Reiches: Entstehung<br />
<strong>und</strong> staatsrechtlicher Charakter.<br />
Darmstadt 1959.<br />
Aub<strong>in</strong>, Hermann: Von Raum <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong><br />
des deutschen Volkes. Studien<br />
zur Volksgeschichte. Breslau 1938.<br />
The Austrian military border: its political<br />
and cultural <strong>im</strong>pact. Hrsg. v.<br />
Liviu Maior. Iasçi 1994.<br />
Bachmann, Harald: Der deutsche<br />
Volksrat für Böhmen <strong>und</strong> die<br />
248<br />
deutschböhmische Parteipolitik. In:<br />
Zeitschrift für Ostforschung 14<br />
(1965), 266–294.<br />
Bahrs, Hans: Begegnung an der Grenze.<br />
Berl<strong>in</strong> 1942 (= Nordland-Bücherei.<br />
27).<br />
Balcerak, Wies¬aw: Konzeption der polnischen<br />
Westgrenze nach der Auffassung<br />
der polnischen L<strong>in</strong>ken. In:<br />
Polnische Weststudien 4 (1985), 61–<br />
77.<br />
Bardonnet, Daniel: Frontières terrestres<br />
et frontières marit<strong>im</strong>es. In: Annuaire<br />
français de droit <strong>in</strong>ternational. Centre<br />
national de la recherche scientifique.<br />
Paris, 35 (1989), 1.<br />
Barre, Ala<strong>in</strong>: Frontières naturelles, frontières<br />
artificielles et circulation en<br />
Europe. In: Hommes et Terres<br />
du Nord. Villeneuve d’Ascq, 2–3<br />
(1994), 71–81.<br />
Bartlett, Robert u. Angus MacKay: Medieval<br />
Frontier Societies. Oxford,<br />
New York 1989.<br />
Bass<strong>in</strong>, Mark: Turner, Solov’ev, and the<br />
“frontier hypothesis”: The nationalist<br />
signification of open spaces. In: The<br />
Journal of Modern History 65<br />
(1993), 473–511.<br />
Batowski, Henryk: Zachód wobec<br />
granic Polski. 19<strong>20</strong>–1940. Niektóre<br />
fakty mniej znane [Der Westen <strong>und</strong><br />
die <strong>Grenzen</strong> Polens. E<strong>in</strong>ige weniger<br />
bekannte Fakten]. Òódz; 1995.<br />
Baud, Michel u.a.: Toward a comparative<br />
history of borderlands. In: Journal<br />
of World History. Honolulu, 8<br />
(1997), Nr. 2, 211–243.<br />
Baur, Carl von: Welches ist die ächte<br />
<strong>und</strong> natürliche Gränze zwischen<br />
Deutschland <strong>und</strong> Frankreich? E<strong>in</strong>e<br />
militärische Betrachtung. O.O. 1814.<br />
Beck, Johann Jodocus: Tractatus de jure<br />
l<strong>im</strong>itum, von Recht der Gränzen <strong>und</strong>
Markste<strong>in</strong>e, Wor<strong>in</strong>nen von Setzung<br />
der Gränz- Mark- <strong>und</strong> Gütterste<strong>in</strong> ...<br />
gehandelt wird. T. 1. Von Gränzen<br />
<strong>und</strong> Mark-Ste<strong>in</strong>en. Nürnberg 1729.<br />
Beck<strong>in</strong>dale, Robert P.: Rivers as political<br />
Bo<strong>und</strong>aries. Water, Earth and<br />
Man. London 1969.<br />
Behrens, He<strong>in</strong>z: Die polizeiliche Kontrolle<br />
des grenzüberschreitenden<br />
Verkehrs. Stuttgart u.a. 1979.<br />
Be=l<strong>in</strong>a, Pavel: C+echy – mýtus pr=írodní<br />
pevnosti [Böhmen – der Mythos der<br />
natürlichen Festung]. In: Str=ední Evropa<br />
38–39 (1994), 77–82.<br />
Benes=, Edvard: La question du directoire<br />
européen et la révision des<br />
frontières. Exposé fait devant la<br />
chambre des députés le 25 avril<br />
1933. Prag 1933 (= Sources et documents<br />
tchécoslovaques. 21).<br />
Benevolo, Leonardo u. Benno Albrecht:<br />
<strong>Grenzen</strong>. Topographie, Geschichte,<br />
Architektur (aus d. Ital.: I conf<strong>in</strong>i del<br />
paesaggio umano). Frankfurt/Ma<strong>in</strong>,<br />
New York 1995.<br />
Bennewitz, Inge u. Ra<strong>in</strong>er Potratz:<br />
Zwangsaussiedlungen an der <strong>in</strong>nerdeutschen<br />
Grenze. Analysen <strong>und</strong><br />
Dokumente. Berl<strong>in</strong> 1997.<br />
Berenyi, Jozsef: Sozialgeographische<br />
Aspekte <strong>in</strong> der Forschung der Grenzgebiete.<br />
Arbeitsmaterialien zur<br />
Raumordnung <strong>und</strong> Raumplanung.<br />
Heft 83, Bayreuth 1993, 43–48.<br />
Beyond borders: remak<strong>in</strong>g cultural identities<br />
<strong>in</strong> the new East and Central<br />
Europe. Hrsg. v. Laszlo Kuerti.<br />
Boulder u.a. 1997.<br />
Biger, Gideon: Physical geography and<br />
law: the case of <strong>in</strong>ternational river<br />
bo<strong>und</strong>aries. In: Geojournal. International<br />
journal of physical, biological,<br />
and economic geography and applications<br />
<strong>in</strong> environmental plann<strong>in</strong>g<br />
and ecology. Dordrecht, 17 (1988),<br />
341ff.<br />
Black, Jeremy: Bo<strong>und</strong>aries and Conflict.<br />
International Relations <strong>in</strong> ancien rég<strong>im</strong>e<br />
Europe. In: Eurasia. World<br />
Bo<strong>und</strong>aries. Hrsg. v. Carl Gr<strong>und</strong>y-<br />
Warr. Vol. 3. London, New York<br />
1994, 19–55, 28–31.<br />
Blaschke, Jochen: Volk, Nation, <strong>in</strong>terner<br />
Kolonialismus, Ethnizität. Konzepte<br />
zur politischen Soziologie regionalistischer<br />
Bewegungen <strong>in</strong> Westeuropa.<br />
Berl<strong>in</strong> 1985.<br />
Blatt, He<strong>in</strong>z: Die Oder-Neiße-Grenze<br />
<strong>in</strong> den politischen Konzeptionen<br />
Konrad Adenauers 1949–1963. In:<br />
Zwiaçzki niemiecko-polskie w kulturze<br />
i polityce = Zur Frage der<br />
deutsch-polnischen Beziehungen <strong>in</strong><br />
Kultur <strong>und</strong> Politik. Warszawa 1993,<br />
103–122.<br />
Bless<strong>in</strong>g, Werner K.: Anspruch <strong>und</strong><br />
Wirklichkeit e<strong>in</strong>er Grenze. Der westböhmisch-nordbayerische<br />
Grenzraum<br />
<strong>im</strong> frühen <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert. In: Die<br />
böhmischen Länder zwischen Ost<br />
<strong>und</strong> West. Festschrift für Karl Bosl<br />
zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferd<strong>in</strong>and<br />
Seibt. München 1983, 259–275<br />
(= Veröffentlichungen des Collegium<br />
Carol<strong>in</strong>um. 55).<br />
Blumann, Claude: Frontières et l<strong>im</strong>ites.<br />
In: La Frontière. Société Française<br />
pour le Droit International, Colloques<br />
des Poitiers. Paris 1980.<br />
Blutende <strong>Grenzen</strong>. Deutsche Not <strong>in</strong> der<br />
Ostmark. Hrsg. v. Paul Roggenhausen.<br />
Bielefeld, Leipzig, o.J.<br />
(= Velhagen & Klas<strong>in</strong>gs deutsche<br />
Lesebogen. Nr. 172).<br />
Blutende <strong>Grenzen</strong>. Langensalza u.a.<br />
1934 (= Aus deutschem Schrifttum<br />
<strong>und</strong> deutscher Kultur. 402/403, 494/<br />
495, 498/499).<br />
249
Boban, Ljubo: Hrvatske granice od 1918<br />
do 1991 god<strong>in</strong>e [Kroatische <strong>Grenzen</strong><br />
von 1918 bis 1991]. Zagreb 1992.<br />
Boehm, Max Hildebert: Die deutschen<br />
Grenzlande. 2. Aufl. Berl<strong>in</strong> 1930.<br />
Boggs, S. Whittemore: International<br />
bo<strong>und</strong>aries: A study of bo<strong>und</strong>ary<br />
functions and problems. New York<br />
1940.<br />
Bohác=, Antonín: Na;rodnostní mapa republiky<br />
C+eskoslovenske; [Die Nationalitätenkarte<br />
der Tschechoslowakischen<br />
Republik]. Praha 1929.<br />
Bohmann, Alfred: Die tschechoslowakischen<br />
Gebietsabtretungen an<br />
Polen <strong>und</strong> Ungarn 1938/39. In:<br />
Zeitschrift für Ostforschung <strong>20</strong><br />
(1971), 465–496.<br />
Bohmann, Alfred: Menschen <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />
4 Bde. Köln 1969–1975.<br />
Bojecko, Vasyl’ D. u.a.: Kordony Ukraj<strong>in</strong>y.<br />
Istoryc=na retrospektyva ta<br />
suc=asnyj stan [Die <strong>Grenzen</strong> der<br />
Ukra<strong>in</strong>e. Historische Retrospektive<br />
<strong>und</strong> gegenwärtiger Stand]. Kyjiv<br />
1994.<br />
Bondarvesky, Grigor: Bo<strong>und</strong>ary Issues<br />
<strong>in</strong> Central Asia. London 1996.<br />
Border and territorial disputes. Hrsg. v.<br />
Paul F. Diehl u. Gary Goertz. New<br />
York 1992.<br />
Border Approaches. Anthropological<br />
Perspectives on Frontiers. Hrsg. v.<br />
Hast<strong>in</strong>gs Donnan u. Thomas M. Wilson.<br />
London 1994.<br />
Border Identities. Nation and State at<br />
International Frontiers. Hrsg. v.<br />
Thomas M. Wilson u. Hast<strong>in</strong>gs<br />
Donnan. Cambridge u.a. 1998.<br />
Borders and Marg<strong>in</strong>s: post-colonialism<br />
and post-modernism. Hrsg. v. A. de<br />
Toro. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1995.<br />
250<br />
Bornträger, Ekkehard W.: Borders, Ethnicity<br />
and National Selfdeterm<strong>in</strong>ation.<br />
Wien 1999 (= Ethnos.<br />
52).<br />
Bornträger, Ekkehard W.: <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong><br />
Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht. Gedanken<br />
zu F<strong>in</strong>alität <strong>und</strong> Relativität von<br />
Grenzziehungen. In: Zeitschrift für<br />
Politik 39 (1992), H. 1, 49–71.<br />
Boswell, Bruce: The Eastern Bo<strong>und</strong>aries<br />
of Poland. Liverpool o.J. (nach<br />
1941).<br />
Bothe, Michael: Bo<strong>und</strong>aries. In: Encyclopedia<br />
of Public International Law.<br />
Hrsg. v. Rudolf Bernhardt. Bd. 1.<br />
Amsterdam u.a. 1992, 443–449.<br />
Bo<strong>und</strong>aries and Regions. Explorations<br />
<strong>in</strong> the Values and Power <strong>in</strong> a Frontier.<br />
Trieste 1973.<br />
Brandes, Detlef: Großbritannien <strong>und</strong><br />
se<strong>in</strong>e osteuropäischen Alliierten<br />
1939–1943. Die Regierungen Polens,<br />
der Tschechoslowakei <strong>und</strong><br />
Jugoslawiens <strong>im</strong> Londoner Exil vom<br />
Kriegsausbruch bis zur Konferenz<br />
von Teheran. München 1988 (=<br />
Veröffentlichungen des Collegium<br />
Carol<strong>in</strong>um. 59).<br />
Bredow, W<strong>in</strong>fried von: The Chang<strong>in</strong>g<br />
Character of National Borders. In:<br />
Citizenship Studies 2 (1998), 365–<br />
376.<br />
Breuner, H.: “Grenzgefälle” – Hemmungs-<br />
oder Anregungsfaktoren<br />
für räumliche Entwicklungen. In:<br />
Aachener Geographische Arbeiten,<br />
H. 14, 2. Teil (1981), 425–437.<br />
Br<strong>in</strong>cken, Anne-Dore van den: F<strong>in</strong>es<br />
Terrae. Die Enden der Erde <strong>und</strong><br />
der vierte Kont<strong>in</strong>ent auf mittelalterlichen<br />
Weltkarten. Hannover 1992<br />
(= Schriften. Monumenta Germaniae<br />
Historica. 36).
Broek, Jan O.M.: The Problem of ‘Natural<br />
Frontiers’. In: Frontiers of the<br />
Future. Lectures delivered <strong>und</strong>er the<br />
Auspices of the Committee on Internat.<br />
Relations on the Los Angeles<br />
Campus of the Univ. of California.<br />
Berkeley, Los Angeles 1941.<br />
Brown, Peter G. u. Henry Shue:<br />
Bo<strong>und</strong>aries. National Autonomy and<br />
its L<strong>im</strong>its. Totowa 1981.<br />
Bruchl<strong>in</strong>ie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung<br />
<strong>im</strong> österreichischungarischen<br />
Grenzraum. Hrsg. v.<br />
Mart<strong>in</strong> Seger u. Paul Beluszky.<br />
(Südburgenland / Oststeiermark-<br />
Westungarn). Wien, Köln, Graz<br />
1993 (= Studien zu Politik <strong>und</strong> Verwaltung.<br />
42).<br />
Brückner, Peter: Grenze <strong>und</strong> Abgrenzung<br />
– e<strong>in</strong> deutsches Dilemma.<br />
In: Ders.: Versuch, uns <strong>und</strong> anderen<br />
die B<strong>und</strong>esrepublik zu erklären. Berl<strong>in</strong><br />
1978, 24 ff.<br />
Buchhofer, Ekkehard: Der Kampf um<br />
die <strong>Grenzen</strong> der neuen deutschen<br />
Länder. In: Geographie <strong>und</strong> ihre Didaktik.<br />
Festschrift für Walter Sperl<strong>in</strong>g.<br />
T. 1. Hrsg. v. He<strong>in</strong>z Peter<br />
Brogiato u. Hans-Mart<strong>in</strong> Cloß. Trier<br />
1992, 211–231 (= Materialien zur<br />
Didaktik der Geographie. 15).<br />
Bücher der Grenzlande. Bd. 2 u.a., Heidelberg,<br />
Berl<strong>in</strong> 1937.<br />
Bürkner, Hans-Joach<strong>im</strong> u. H. Kowalke:<br />
Geographische Grenzraumforschung<br />
<strong>im</strong> Wandel. Potsdam 1996 (= Praxis<br />
Kultur- <strong>und</strong> Sozialgeographie. 15).<br />
Bufon, M.: Cultural and social d<strong>im</strong>ensions<br />
of borderlands. The case of the<br />
italo-slovene trans-border area. In:<br />
Geojournal. International journal of<br />
physical, biological, and economic<br />
geography and applications <strong>in</strong> envi-<br />
ronmental plann<strong>in</strong>g and ecology.<br />
Dordrecht, 30 (1993), Nr. 3, 235-240.<br />
Bu`z=ek, Václav u. Josef Grulich: Das<br />
wirtschaftliche Bild der böhmischösterreichischen<br />
Grenze <strong>in</strong> der<br />
frühen Neuzeit. In: Kontakte <strong>und</strong><br />
Konflikte. Böhmen, Mähren <strong>und</strong><br />
Österreich: Aspekte e<strong>in</strong>es Jahrtausends<br />
geme<strong>in</strong>samer Geschichte.<br />
Referate des Symposiums “Verb<strong>in</strong>dendes<br />
<strong>und</strong> Trennendes an der<br />
Grenze III” vom 24. bis 27. Oktober<br />
1992 <strong>in</strong> Zwettl. Hrsg. v. Thomas<br />
W<strong>in</strong>kelbauer. Horn-Waidhofen a. d.<br />
Thaya 1993, 147–153<br />
(= Schriftenreihe des Waldviertler<br />
He<strong>im</strong>atb<strong>und</strong>es. 36).<br />
Chahnmann, W.: Frontiers between East<br />
and West <strong>in</strong> Europe. In: The Geographical<br />
Review 39 (1949), 605–<br />
624.<br />
Chaloupecký, Václav: Unsere <strong>Grenzen</strong><br />
gegen Ungarn. Praha 1921.<br />
Ch<strong>in</strong>a and her neighbours. Borders, visions<br />
of the other, foreign policy<br />
10th to 19th century. Hrsg. v. Sab<strong>in</strong>e<br />
Dabr<strong>in</strong>ghaus u. Roderich Ptak.<br />
Wiesbaden 1997 (= South Ch<strong>in</strong>a and<br />
marit<strong>im</strong>e Asia. 6).<br />
Chlebowczyk, Józef: Ne=ktere; ota;zky<br />
vy;voje na;rodního ve=domí a<br />
na;rodního hnutí na jazykove;m<br />
pomezí [E<strong>in</strong>ige Fragen der Entwicklung<br />
des nationalen Bewußtse<strong>in</strong>s <strong>und</strong><br />
der Nationalbewegung an der<br />
Sprachgrenze]. In: Slezský Sborník<br />
63 (1965), 433–451.<br />
Chlebowczyk, Józef: Sprachlichnationale<br />
Grenzräume <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
<strong>im</strong> 18.–<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Probleme ihrer Entwicklungsmerkmale.<br />
In: La Pologne au XV e<br />
Congrès International des Sciences<br />
Historiques à Bucarest. Ètudes sur<br />
251
l’histoire de la culture de l’Europe<br />
centrale-orientale. Hrsg. v. Stanis¬aw<br />
Byl<strong>in</strong>a. Wroc¬aw u.a. 1980, 241–<br />
262.<br />
Ciok, Stanis¬aw: Problematyka obszarów<br />
przygranicznych Polski<br />
po¬udniowo-zachodniej. Studia<br />
spo—eczno-ekonomiczne [Die Problematik<br />
der polnischen Süd- <strong>und</strong><br />
West-Grenzgebiete. Sozioökonomische<br />
Studien]. Warszawa<br />
1990 (= Acta universitatis Wratislawiensis,<br />
Studia geograficzne. 48).<br />
Clausen, Fritz: Volk <strong>und</strong> Staat <strong>im</strong> Grenzland.<br />
O.O. 1936.<br />
Cole, John W. u. Eric R. Wolf: The<br />
Hidden Frontier. Ecology and Ethnicity<br />
<strong>in</strong> an Alp<strong>in</strong>e Valley. New<br />
York, London 1974.<br />
Conr<strong>in</strong>g, Hermann: Opus de f<strong>in</strong>ibus Imperii<br />
Romano-Germanici. 1654.<br />
Contested territory. Border disputes at<br />
the edge of the former Soviet empire.<br />
Hrsg. v. Tuomas Forsberg, Aldershot,<br />
Hants. [u.a.] 1995.<br />
(= Studies of communism <strong>in</strong> transition).<br />
Conze, Werner: Hans Rothfels. In: Historische<br />
Zeitschrift 237 (1983), 311–<br />
360.<br />
Cooperation and Conflict <strong>in</strong> Border Areas.<br />
Hrsg. v. Ra<strong>im</strong>ondo Strassoldo u.<br />
G. Delli Zotti. Milano 1982.<br />
Corley, Felix: Chang<strong>in</strong>g unjust borders.<br />
Month 26, 2 (Feb. 1993), 71–73.<br />
Cornwall, Mark: The Struggle on the<br />
Czech-German Language Border,<br />
1880–1940. In: The English Historical<br />
Review 109 (1994), 914–951.<br />
Craemer, Rudolf: Deutschtum <strong>im</strong> Völkerraum.<br />
Bd. 1. Stuttgart 1938.<br />
Cremers, Ehrhardt: Relativität der<br />
Grenze – <strong>Grenzen</strong> der Relativität.<br />
252<br />
Über das Bewußtse<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lebensweltlichen<br />
Herausforderung.<br />
Aachen 1990 (= Aachener Studien<br />
zur Semiotik <strong>und</strong> Kommunikationsforschung.<br />
13).<br />
Cross<strong>in</strong>g borders. Inner- and <strong>in</strong>tercultural<br />
exchanges <strong>in</strong> a multicultural<br />
society. Hrsg. v. He<strong>in</strong>z Ickstadt.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1997.<br />
Curzon of Kedleston, Lord: Frontiers.<br />
The Romanes Lecture. Oxford 1907.<br />
Czajka, Willi: Schlesiens Grenzwälder.<br />
In: Zeitschrift des Vere<strong>in</strong>s für<br />
Geschichte Schlesiens 68 (1934), 1–<br />
35 [zu “preseka”].<br />
C+apek, M.: A Key to Czechoslovakia,<br />
the Territory of Kladsko (Glatz). A<br />
Study of a Frontier Problem <strong>in</strong> Middle<br />
Europe. New York 1946.<br />
Dami, Aldo: Les frontières européennes<br />
de 1900 à 1975. Histoire territoriale<br />
de l’Europe. Genève 1976.<br />
Davies, Norman: Granice Polski w<br />
czasach najnowszych [<strong>Grenzen</strong> Polens<br />
<strong>in</strong> der neuesten Zeit]. In:<br />
Zeszyty Historyczne 68 (1948), 12–<br />
47.<br />
Dawson, William Harbutt: Germany <strong>und</strong>er<br />
the treaty. Repr. of 1933 ed.<br />
Freeport 1972.<br />
Day, Alan J.: Border and territorial disputes.<br />
Harlow 1987.<br />
Daçbrowski, Eugenio: La frontiera fra<br />
Polonia e Germania. Roma 1947.<br />
Daçbrowski, Stanis¬aw: Koncepcje<br />
powojennych granic Polski w programmach<br />
i dzia¬alnos;ci polskiego<br />
ruchu ludowego w latach 1939–45<br />
[Konzeptionen der Nachkriegsgrenzen<br />
Polens <strong>in</strong> den Programmen <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> der Tätigkeit der polnischen<br />
Volks-(Bauern-)bewegung <strong>in</strong> den<br />
Jahren 1939–45]. Wroc¬aw 1971
(= Monografie Slaçskie Ossol<strong>in</strong>eum.<br />
21).<br />
Dege, Wilfried: Zentralörtliche Beziehungen<br />
über Staatsgrenzen – untersucht<br />
<strong>im</strong> südlichen Oberrhe<strong>in</strong>gebiet.<br />
Paderborn 1978 (= Bochumer<br />
geographische Arbeiten. H. 34).<br />
Delli Zotti, G.: Transnational relations<br />
<strong>in</strong> a border region: The case of<br />
Friuli-Venetia Julia. In: Cooperation<br />
and Conflict <strong>in</strong> Border Areas. Hrsg.<br />
v. R. Strassoldo u. G. Delli Zotti.<br />
Milano 1982, 25–61.<br />
Die deutsche Ostgrenze. Unterlagen zur<br />
Erfassung der Grenzzerreißungsschäden.<br />
Bearb. v. Wilhlem Volz u.<br />
Hans Schwalm. Text <strong>und</strong> Mappenband.<br />
Leipzig 1929.<br />
Deutsche <strong>und</strong> Polen zwischen den<br />
Kriegen. M<strong>in</strong>derheitsstatus <strong>und</strong><br />
“Volkstumskampf” <strong>im</strong> Grenzgebiet.<br />
Amtliche Berichterstattung aus beiden<br />
Ländern 19<strong>20</strong>–1939. Hrsg. v.<br />
Rudolf Jaworski u. Marian Wojciechowski.<br />
München, New Providence,<br />
London, Paris 1997, 2 Bde.<br />
(= Texte <strong>und</strong> Materialien zur Zeitgeschichte.<br />
9).<br />
Deutsches Volk <strong>im</strong> europäischen<br />
Raum. E<strong>in</strong> Verzeichnis grenz- <strong>und</strong><br />
volkspolitischen Schrifttums. Hrsg.<br />
v. Grenzbüchereidienst [...]. Berl<strong>in</strong><br />
1938.<br />
Deutschlands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der<br />
Geschichte. Unter Mitarb. von<br />
Re<strong>im</strong>er Hansen hrsg. v. Alexander<br />
Demandt. 3. durchges. Aufl.<br />
München 1993.<br />
Diehl, Paul F. u. Gary Goertz: A territorial<br />
history of the International System.<br />
In: International Interactions 15<br />
(1989), 71–93.<br />
Dittgen, Herbert: Welt ohne <strong>Grenzen</strong>?<br />
Überlegungen zur Zukunft des<br />
Nationalstaates. In: Merkur 9–10<br />
(1997), 941–949.<br />
Dixon, Meredith Vibarth: The true facts<br />
about the disputed frontiers of<br />
Europe. London 1945.<br />
D’jakova, Natal’ja A. u. M. A. Cepelk<strong>in</strong>:<br />
Granicy Rossii v XVII–XX<br />
vekach. Priloz=enie k “Istorii Rossii”<br />
[Die <strong>Grenzen</strong> Rußlands <strong>im</strong> 17.–<strong>20</strong>.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Beilage zur “Geschichte<br />
Rußlands”]. Moskva 1995 (= Istorija<br />
Rossii. [15]).<br />
Dnistrjans’kyj, Myroslav S.: Kordony<br />
Ukra<strong>in</strong>y: terytorial’noadm<strong>in</strong>istratyvnyj<br />
ustryj [<strong>Grenzen</strong> der<br />
Ukra<strong>in</strong>e. Territoriales Verwaltungssystem].<br />
L’viv 1992<br />
(= Narodoznavci studii).<br />
Dobiás=, Josef: Seit wann bilden die<br />
natürlichen <strong>Grenzen</strong> von Böhmen<br />
auch se<strong>in</strong>e politische Landesgrenze?<br />
In: Historica 6 (1963), 5–44.<br />
Dobrzycki, Wies¬aw: Granica zachodnia<br />
w polityce polskiej [Die Westgrenze<br />
<strong>in</strong> der polnischen Politik] 1944–<br />
1947. Warszawa 1974.<br />
Dörfl<strong>in</strong>ger, Johannes: Sprachen <strong>und</strong><br />
Völkerkarten des mitteleuropäischen<br />
Raumes vom 18. Jahrh<strong>und</strong>ert bis <strong>in</strong><br />
die 2. Hälfte des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
In: 4. Kartographiehistorisches Colloquium,<br />
Karlsruhe 1988. Vorträge<br />
<strong>und</strong> Berichte. Hrsg. v. Wolfgang<br />
Scharfe, He<strong>in</strong>z Musall <strong>und</strong> Joach<strong>im</strong><br />
Neumann. Berl<strong>in</strong> 1990, 183–195.<br />
Dom<strong>in</strong>ian, Leon: The Frontiers of Language<br />
and Nationality <strong>in</strong> Europe.<br />
New York 1917.<br />
Dom<strong>in</strong>iczak, Henryk: Granica wschodnia<br />
Rzeczypospolitej Polskiej w la-<br />
tach 1919–1939 [Die Ostgrenze der<br />
Republik Polen <strong>in</strong> den Jahren 1919–<br />
1939]. Wyd. 1. Warszawa 1992.<br />
253
Dowty, Alan: Closed Borders. The Contemporary<br />
Assault on Freedom of<br />
Movement. New Haven 1987.<br />
Draus, Franciszek: La ligne Oder-Neisse<br />
et l’évolution des rapports Germano-<br />
Polonais. Paris 1990.<br />
Dreissig Jahre Bonn-Kopenhagener Erklärungen:<br />
Grenzland, M<strong>in</strong>derheiten,<br />
Partnerschaft. Hrsg. vom Kultusm<strong>in</strong>ister<br />
des Landes Schleswig-Holste<strong>in</strong>.<br />
Landeszentrale für Politische<br />
Bildung. Kiel 1985 (= Schriftenreihe<br />
Gegenwartsfragen. 47).<br />
Durach, Moritz: Grenze. In: Zeitschrift<br />
für Erdk<strong>und</strong>e 6 (1938), 5.<br />
Durka, W¬odz<strong>im</strong>ierz: Polsko-niemieckie<br />
pogranicze gospodarcze. Szkice z<br />
socjologii ekonomicznej [Das polnisch-deutsche<br />
Wirtschafts-<br />
Grenzland. Skizzen aus der<br />
Wirtschaftssoziologie]. Szczec<strong>in</strong><br />
1995.<br />
Dvorský, Viktor: Hranice C+eskoslo-<br />
venské Republiky [Die <strong>Grenzen</strong><br />
der Tschechoslowakischen Republik].<br />
Praha 19<strong>20</strong>.<br />
Dvorský, Viktor: Na;rod a pu`da [Volk<br />
<strong>und</strong> Boden]. Praha o. J. [1919]<br />
(= Cyklus o na;rodnosti. 1).<br />
Dvorský, Viktor: Území<br />
c=eskoslovenského národa [Das Territorium<br />
der tschechoslowakischen<br />
Nation]. Praha 1918.<br />
East, William Gordon: A historical geography<br />
of Europe. London 4. Aufl.<br />
1962.<br />
East, William Gordon: The nature of<br />
political geography. In: Politica 2<br />
(1937), 259–286.<br />
Ebel<strong>in</strong>g, Frank: Geopolitik. Karl<br />
Haushofer <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Raumwissenschaft<br />
1919–1945. Berl<strong>in</strong> 1994.<br />
Eberhardt, Piotr: Jak kszta¬towa¬a sieç<br />
granica wschodnia PRL [Wie sich<br />
254<br />
die Ostgrenze der Polnischen<br />
Volksrepublik formierte]. In:<br />
Zeszyty Historyczne 90 (1989), 3–<br />
34.<br />
Eberhardt, Piotr: Polska Granica<br />
wschodnia: 1939–1945 [Die polnische<br />
Ostgrenze: 1939–1945]. Warszawa<br />
[ca. 1992]. Literaturverzeichnis<br />
217–223.<br />
Eisch, Kathar<strong>in</strong>a: Grenze. E<strong>in</strong>e Eth-<br />
nographie des bayerisch-böhmischen<br />
Grenzraumes. München 1996<br />
(= Bayerische Schriften zur Volksk<strong>und</strong>e.<br />
5).<br />
Eisch, Kathar<strong>in</strong>a: Leben auf der Grenze.<br />
Zur Selbstverortung der Deutschen<br />
<strong>im</strong> Böhmerwald. In: Jahrbuch für<br />
deutsche <strong>und</strong> osteuropäische Volksk<strong>und</strong>e<br />
38 (1995), 169–187.<br />
Encyclopedia of International Bo<strong>und</strong>aries.<br />
Hrsg. v. Gideon Biger. New<br />
York 1995.<br />
L’Etablissement des Frontières en<br />
Europe après les Deux Guerres<br />
Mondiales. Hrsg. v. Christian<br />
Baechler (The Establishment of<br />
European Frontiers after the Two<br />
World Wars: Actes des Colloques de<br />
Strasbourg et de Montreal, Ju<strong>in</strong> et<br />
Septembre 1995 / Proceed<strong>in</strong>gs of the<br />
International Conferences Strasbourg<br />
& Montreal, June and September<br />
1995). Frankfurt am Ma<strong>in</strong> u.a. 1996.<br />
Ethnic Groups and Bo<strong>und</strong>aries. The Social<br />
Organization of Cultural Difference.<br />
Hrsg. v. Fredrik Barth. Boston<br />
1969.<br />
Eurasia. Hrsg. v. Carl Gr<strong>und</strong>y-Warr.<br />
London 1994 (= World Bo<strong>und</strong>aries<br />
Series. 3).<br />
Europa – aber wo liegen se<strong>in</strong>e <strong>Grenzen</strong>?<br />
Am 10. <strong>und</strong> 11. Juni 1995 <strong>im</strong><br />
Königsschloss <strong>in</strong> Warschau. 104.
Bergedorfer Gesprächskreis. Hamburg<br />
1995.<br />
Evans, Robert J.W.: Essay and Reflection:<br />
Frontiers and national identities<br />
<strong>in</strong> Central Europe. In: The International<br />
History Review 14 (1992), H.<br />
3, 480–502.<br />
Éger, György: Region, Ethnicity, Religion.<br />
Changes of Regional Characteristics<br />
and Ethnic Composition <strong>in</strong><br />
Certa<strong>in</strong> Hungarian Border Regions<br />
Between 1880–1980. In: Kle<strong>in</strong>e Nationen<br />
<strong>und</strong> Ethnische M<strong>in</strong>derheiten<br />
<strong>im</strong> Umbruch Europas. Ergebnisse<br />
der Internationalen Wissenschaftlichen<br />
Konferenz <strong>in</strong> Maribor,<br />
Slowenien, 3.–5. Febr. 1992. Hrsg.<br />
v. Silvo Devetak, S. Fleve, Gerhard<br />
Seewann. München 1993, 132–136.<br />
Faragher, John Mack: The frontier trail.<br />
Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Turner and re<strong>im</strong>ag<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
the American West (review article).<br />
In: American History Review 98<br />
(1993), 106–117.<br />
Fawcett, Charles B.: Frontiers. A study<br />
<strong>in</strong> political geography. Oxford 1918.<br />
Febvre, Lucien: “Frontière” – Wort <strong>und</strong><br />
Bedeutung (1928). In: Ders.: Das<br />
Gewissen des Historikers. Hrsg. v.<br />
Ulrich Raulff. Berl<strong>in</strong> 1988, 27–37.<br />
[Auch: Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1990].<br />
Fehn, Klaus: Die Auswirkungen der<br />
Veränderungen der Ostgrenze des<br />
Deutschen Reiches auf das Raumordnungskonzept<br />
des NS-Reg<strong>im</strong>es<br />
(1938–1942). In: Siedlungsforschung<br />
9 (1991), 199–227.<br />
Fehn, Klaus: Territorialatlanten – raumbezogene<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Gr<strong>und</strong>lagenwerke der geschichtlichen<br />
Landesk<strong>und</strong>e. In: Blätter für<br />
deutsche Landesgeschichte 127<br />
(1991), 19–46.<br />
Fehn, Klaus: Zentralismus <strong>und</strong> Regionalismus<br />
<strong>in</strong> der nationalsozialistischen<br />
Siedlungspolitik 1939–1945. In:<br />
Deutschland <strong>und</strong> Europa. Historische,<br />
politische <strong>und</strong><br />
geographische Aspekte. Festschrift<br />
zum 51. Geographentag, Bonn 1997:<br />
“Europa <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Welt <strong>im</strong> Wandel”.<br />
Hrsg. von Eckart Ehlers. Bonn 1997,<br />
133–145.<br />
Ferris, Elizabeth: Beyond borders: refugees,<br />
migrants and human rights <strong>in</strong><br />
the post-cold war era. Geneva 1993.<br />
Ficker, Adolph: Die Völkerstämme der<br />
österreichisch-ungarischen Monarchie,<br />
ihre Gebiete, Gränzen <strong>und</strong> Inseln.<br />
Historisch, geographisch <strong>und</strong><br />
statistisch dargestellt. Wien 1869<br />
(auch <strong>in</strong>: Mittheilungen aus dem<br />
Gebiete der Statistik 15 (1869)).<br />
Fielhauer, Helmut Paul: K<strong>in</strong>der-<br />
Wechsel <strong>und</strong> “Böhmisch-Lernen”.<br />
Sitte, Wirtschaft <strong>und</strong> Kulturvermittlung<br />
<strong>im</strong> frühen niederösterreichischtschechoslowakischen<br />
Grenzgebiet.<br />
In: Österreichische Zeitschrift für<br />
Volksk<strong>und</strong>e 32 (1978), 115–125.<br />
F<strong>in</strong>er, Samuel E.: State-Build<strong>in</strong>g. State<br />
Bo<strong>und</strong>aries and Border Control. An<br />
essay on certa<strong>in</strong> aspects of the first<br />
state-build<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Western Europe<br />
considered <strong>in</strong> the light of the Rokkan-Hirschman<br />
model. In: Social<br />
Science Information 13 (1974), 79–<br />
126.<br />
Fisch, Bernhard: Die Oder-Neiße-<br />
Grenze – Folge der deutschsowjetischen<br />
Verträge von 1939. In:<br />
Geschichte, Erziehung, Politik, 4<br />
(1993), 236-245.<br />
Fischer, Holger: Karten zur räumlichen<br />
Verteilung der Nationalitäten <strong>in</strong> Ungarn.<br />
Darstellungsmöglichkeiten <strong>und</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> ihrer Interpretation am<br />
255
Beispiel von ungarischen Nationalitätenkarten<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
In: Aspekte ethnischer<br />
Identität. Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
“Deutsche <strong>und</strong> Magyaren<br />
als nationale M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> Donauraum”.<br />
Hrsg. von Edgar Hösch <strong>und</strong><br />
Gerhard Seewann. München 1991,<br />
325–393.<br />
Fischer, Theobald: Das Deutsche Reich<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>en heutigen <strong>Grenzen</strong>: e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>tagsfliege. In: Geographischer<br />
Anzeiger 1 (1900), 1–2.<br />
Flath, Mart<strong>in</strong>a: Neue <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa.<br />
In: Praxis Geographie 10<br />
(1997), 12–16.<br />
Forstreuter, Adalbert: Schicksalsraum<br />
Westen. 1000-jähriger Kampf um<br />
deutsches Land. Hrsg. v. Rudolf<br />
Jung. 2 Bde. Berl<strong>in</strong> 1942.<br />
Foucher, Michel: Fronts et frontières.<br />
Un tour de monde géopolitique.<br />
Paris 1988, 2. Aufl. 1991.<br />
Foucher, Michel: Les géographes et les<br />
frontières. In: Hérodote 1984, Nr.<br />
33–34.<br />
Foucher, Michel: L’<strong>in</strong>vention des frontières.<br />
Paris 1986 (= Les sept épées.<br />
41).<br />
Framke, W.: Zentrale Orte <strong>und</strong> ihre<br />
Bereiche beiderseits der deutschdänischen<br />
Grenze. In: Berichte zur<br />
deutschen Landesk<strong>und</strong>e 33 (1967),<br />
257–272.<br />
Freytag-Lor<strong>in</strong>ghoven, Hugo v.: Die<br />
staatlichen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Europa,<br />
geschichtlich <strong>und</strong> militärisch betrachtet.<br />
Berl<strong>in</strong> 1921.<br />
Fr<strong>in</strong>ta, Antonín u. Hugo Rokyta:<br />
Z+itavsko v c=eských de=j<strong>in</strong>ách [Das<br />
Zittauer Gebiet <strong>in</strong> der tschechischen<br />
Geschichte], Praha 1947 (= Sborník<br />
prací c=lenu` výzkumného ve=deckého<br />
256<br />
sboru pr=i Koord<strong>in</strong>ac=ním hranic=ním<br />
výboru v Praze).<br />
Fritzsche, Hans: E<strong>in</strong> deutscher Grenzlandkampf<br />
<strong>im</strong> ausgehenden Mittelalter.<br />
[... Burg<strong>und</strong>]. Baruth, Mark,<br />
Berl<strong>in</strong> 1937, Diss. Heidelberg 1938.<br />
Frontières et contacts de civilisations.<br />
Colloque universitaire franco-suisse.<br />
Neuchâtel 1979.<br />
Frontiers and Borderlands. Anthropological<br />
Perspectives. Hrsg. v. Michael<br />
Rösler <strong>und</strong> Tobias Wendl.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong> u.a. 1999.<br />
Galandauer, Jan: Vznik C+eskoslovenské<br />
republiky 1918. Programy, projek-<br />
ty, pr=edpoklady [Die Entstehung<br />
der Tschechoslowakischen Republik.<br />
Programme, Projekte, Voraussetzungen].<br />
Praha 1988.<br />
Galicki, Sławomir: Koncepcje granic<br />
zachodnich Polski w okresie okupacji<br />
[Konzeptionen der Westgrenzen<br />
Polens <strong>in</strong> der Zeit der Okkupation].<br />
In: Przeglaçd zachodni 45<br />
(1989), Nr. 4, 177 ff.<br />
Gallusser, Werner: Grenze <strong>und</strong> Kulturlandschaft.<br />
In: Regio Basilensis.<br />
Basel, 22 / 2 u. 3 (1981), 59–68.<br />
Gatzemeier, Matthias: “Grenze (Peras)”.<br />
In: Historisches Wörterbuch der Philosophie.<br />
Hrsg. v. Joach<strong>im</strong> Ritter.<br />
Bd. 3. Basel, Stuttgart 1974, Sp.<br />
874 f.<br />
Geiger, Michael: Europas <strong>Grenzen</strong> –<br />
grenzenloses Europa. In: Praxis<br />
Geographie 10 (1997), 4–12.<br />
Gelberg, Leon: Uk¬ad PRL-FRN z 7<br />
grudnia 1970 r. Analiza Prawa [Vertrag<br />
zwischen der Polnischen<br />
Volksrepublik <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland vom 7.12.1970. Juristische<br />
Analyse]. Wroc¬aw 1974.
Genicot, Leopold: Ligne et zone: la<br />
frontière des pr<strong>in</strong>cipautés médiévales.<br />
In: Académie Royale des Sciences.<br />
Bruxelles. Classe des lettres et<br />
des sciences morales et politiques.<br />
Bullet<strong>in</strong>. 5th series. 56 (1970), 29–<br />
42.<br />
Geografski aspekti obmejnosti <strong>in</strong> regionalnega<br />
razvoja [Geographische<br />
Aspekte der Grenzregionen <strong>und</strong> der<br />
Regionalentwicklung]. Hrsg. v. Jurij<br />
Kunaver. Ljubljana 1994 (= Dela.<br />
10).<br />
Gerhard, Dietrich: Neusiedlung <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelles<br />
Erbe. Zum Problem<br />
von Turners “Frontier”. E<strong>in</strong>e vergleichende<br />
Geschichtsbetrachtung.<br />
In: Ders.: Alte <strong>und</strong> Neue Welt <strong>in</strong><br />
vergleichender Geschichtsbetrachtung.<br />
Gött<strong>in</strong>gen 1962, 108–140<br />
(Zuerst engl. 1959).<br />
Giordano, Ralph: “Hier war ja<br />
Schluß...”. Was von der deutschdeutschen<br />
Grenze geblieben ist.<br />
Hamburg 1996.<br />
Gielen, Imke: Das Verhältnis von Text<br />
<strong>und</strong> Karte bei Grenzstreitigkeiten <strong>im</strong><br />
Völkerrecht. Diss. jur. FU Berl<strong>in</strong><br />
1996.<br />
Gilfillan, S. Columb: European political<br />
bo<strong>und</strong>aries. In: Political science<br />
quarterly 39 (1924), 458–484.<br />
Gil-Har, Yitzhak: Del<strong>im</strong>itation bo<strong>und</strong>aries:<br />
Trans-Jordan and Saudi Arabia.<br />
Middle Eastern Studies 28 (Apr.<br />
1992), 374–384. Maps.<br />
Giordano, Ralph: “Hier war ja<br />
Schluß...”. Was von der deutschdeutschen<br />
Grenze geblieben ist.<br />
Hamburg 1996.<br />
Girtler, Roland: Schmuggler. Von <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>und</strong> ihren Überw<strong>in</strong>dern. L<strong>in</strong>z<br />
u.a. 1992.<br />
Glassner, Mart<strong>in</strong> Ira: Political Geography.<br />
New York u.a. 1992.<br />
Glastra, Folke u.a.: Border traffic:<br />
Transmission and signification <strong>in</strong> <strong>in</strong>tercultural<br />
communication. In:<br />
European Journal of Intercultural<br />
Studies 3 (1993), Nr. 2–3, 53–60.<br />
Global Bo<strong>und</strong>aries. Hrsg. v. Clive H.<br />
Schofield. London 1994. (World<br />
Bo<strong>und</strong>aries. Ser. 1).<br />
Golecki, Anton: Der Vertrag von Versailles<br />
<strong>und</strong> die Entstehung der<br />
deutsch-dänischen Grenze 1918–<br />
19<strong>20</strong>. In: Zeitschrift der Gesellschaft<br />
für schleswig-holste<strong>in</strong>ische<br />
Geschichte. 115 (1990), 255–286.<br />
Grabner, Barbara: Probleme mit der<br />
Slowakischen Grenze. In: Morgen.<br />
Kulturzeitschrift aus Niederösterreich,<br />
107 (1996), 14–15.<br />
Gradmann, Robert: Die Wissenschaft <strong>im</strong><br />
Dienste der deutschen<br />
Volkstumspolitik. Rede zur<br />
Reichsgründungsfeier. Erlangen<br />
1932 (= Erlanger Universitätsreden.<br />
12).<br />
Gräf, He<strong>in</strong>z u. Kurt Plück: Grenze durch<br />
Deutschland. [2. Aufl.] Düsseldorf<br />
1961.<br />
Grafenauer, Bogo: Oblikovanje severne<br />
slovenske narodnostne meje [Die<br />
Gestaltung der nördlichen<br />
slovenischen Nationalitätsgrenze].<br />
Ljubljana 1994. (Zgodov<strong>in</strong>ski<br />
časopis / Zbirka. 10).<br />
Granica na Odrze i Nysie w oczach<br />
zachodu i pan;stw niezaangazæowanych<br />
[Die Oder-Neiße-<br />
Grenze <strong>in</strong> den Augen des Westens<br />
<strong>und</strong> der blockfreien Staaten]. Warszawa<br />
1962 [Mschr. autogr.]. (Rada<br />
Naczelna Tow. Rozwoju Ziem.<br />
Zach. Komisja Propagandy. Materia¬y<br />
odczytowe. [1.]).<br />
257
Granice Hrvatske na zemljovid<strong>im</strong>a. Od<br />
XII. do XX. stoljeca [Die <strong>Grenzen</strong><br />
Kroatiens auf Landkarten vom 12.<br />
bis zum <strong>20</strong>. Jh. - Ausstellungskatalog].<br />
Texte v. Franjo Tu∂man u.a.<br />
Zagreb 1992.<br />
Granice i pogranicza. Jðzyk i historia.<br />
Materia¬y miðdzynarodowej konferencji<br />
naukowej [Grenze <strong>und</strong> Grenzland.<br />
Sprache <strong>und</strong> Geschichte. Materialien<br />
e<strong>in</strong>er Internationalen Konferenz].<br />
27./28. Mai 1993. Hrsg. von<br />
Stanis¬aw Dubisz <strong>und</strong> Alicja<br />
Nago;rko. Warszawa 1994.<br />
Granice pan;stwowe Polskiej Rzeczypospolitej<br />
Ludowej. Wybo;r Przepiso;w.<br />
Stan prawy na dzien; 1. 3. 1974 [Die<br />
Staatsgrenzen der Polnischen<br />
Volksrepublik. Stand 1. 3. 1974].<br />
Hrsg. v. Roman Ptas<strong>in</strong>;ski. Warszawa<br />
1974.<br />
Grasediek, Werner: Kont<strong>in</strong>uität <strong>und</strong><br />
Wandel kommunaler <strong>Grenzen</strong>. Vom<br />
Grenzweistum zur Geme<strong>in</strong>degrenze.<br />
Dargestellt am Beispiel von Steffeln/<br />
Eifel. In: Landesk<strong>und</strong>liche Vierteljahrsblätter.<br />
Trier, 34, Nr. 4 (1988),<br />
137.<br />
Greenberg, Susan: Borderl<strong>in</strong>e Case. In:<br />
Guardian Supplement v. <strong>20</strong>.10.1992,<br />
21. [Umwandlung alter B<strong>in</strong>nen- <strong>in</strong><br />
neue Außengrenze, hier tschechoslowakisch].<br />
Gregor, Gustav: Geschichte der Landkarten<br />
von Mähren <strong>und</strong> Schlesien.<br />
In: Mährisch-schlesische He<strong>im</strong>at 11<br />
(1966) 1, 64–68; 2, 104–109.<br />
Greif, F.: Grenzüberschreitende Regionalforschung<br />
– Gr<strong>und</strong>lagen, Ziele,<br />
Methoden. In: Regionalforschung<br />
<strong>und</strong> Regionalpolitik <strong>im</strong> Grenzgebiet<br />
Österreich/Ungarn (Vorträge e<strong>in</strong>es<br />
Sem<strong>in</strong>ars). Hrsg. v. H. Alfons.<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für Agrarwirtschaft.<br />
258<br />
Wien 1989, 55–69 (= Schriftenreihe<br />
Nr. 52).<br />
Greif, Franz: Regionalpolitik an der geme<strong>in</strong>samen<br />
Grenze. Das Beispiel<br />
Österreich–Ungarn. Regionális<br />
politika a közös határok memtén.<br />
Regional policy at the common border.<br />
Wien 1989 (= Schriftenreihe der<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für Agrarwirtschaft.<br />
73).<br />
Grentze, Grentzen, Grentzen-<br />
Besichtigung. In: Großes vollständiges<br />
Universal-Lexicon (Zedler). Bd.<br />
11. Halle-Leipzig 1735, 828–858.<br />
Grenz- <strong>und</strong> Auslandsdeutschtum. E<strong>in</strong><br />
beratendes Bücherverzeichnis. Bearb.<br />
v. Peter Langendorf. Leipzig 1934.<br />
Grenzbildende Faktoren <strong>in</strong> der<br />
Geschichte. Forschungsberichte [...].<br />
Hrsg. v. Günther Franz. Hannover<br />
1969 (= Histor. Raumforschung. 7.<br />
Veröffentlichungen der Akademie<br />
für Raumforschung <strong>und</strong> Landesplanung.<br />
48).<br />
Grenzdarstellungen <strong>in</strong> Schulatlanten.<br />
E<strong>in</strong>e Dokumentation mit Beiträgen<br />
von Ingo v. Münch u.a. Hrsg. v.<br />
Hans-Peter Vonhoff. Frankfurt 1980<br />
(= Informationen über Bildungsmedien<br />
<strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
8).<br />
Grenzdeutschland seit Versailles. Die<br />
grenz- <strong>und</strong> volkspolitischen Folgen<br />
des Friedensschlusses. Hrsg. v. Karl<br />
Christian v. Loesch u. Max Hildebert<br />
Boehm. Berl<strong>in</strong> 1930.<br />
Grenze (Gränze). In: Brockhaus’ Conversations-Lexikon.<br />
13. Aufl., Bd. 8.<br />
Leipzig 1884, 340–342.<br />
Die Grenze als Ort der Annäherung. 750<br />
Jahre deutsch-litauische Beziehungen.<br />
Hrsg. v. Arthur Hermann. Köln<br />
1992.
Grenze. Artikel. In: Deutsches<br />
Rechtswörterbuch (Wörterbuch der<br />
älteren deutschen Rechtssprache).<br />
Bd. 4, We<strong>im</strong>ar 1939–1951, Sp. 1096<br />
f.<br />
Die Grenze. Begriff <strong>und</strong> Inszenierung.<br />
Hrsg. v. Markus Bauer u. Thomas<br />
Rahn. Berl<strong>in</strong> 1997.<br />
Grenze <strong>im</strong> Kopf. Beiträge zur<br />
Geschichte der Grenze <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>.<br />
Hrsg. v. Peter Hasl<strong>in</strong>ger.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong> u.a. 1999 (=<br />
Wiener Osteuropastudien. 11).<br />
Grenze <strong>und</strong> Grenzbewohner: Nachbarn<br />
<strong>und</strong> Fremde, alte He<strong>im</strong>at – neue<br />
He<strong>im</strong>at, Abschied <strong>und</strong> Ankunft. 2.–<br />
4. Dezember 1994 Gub<strong>in</strong>-Guben,<br />
Dokumentation. Berl<strong>in</strong> 1995.<br />
Die <strong>Grenzen</strong> des Reiches. Bd. 1–...–<br />
Leipzig, Berl<strong>in</strong> 1941. Bd. 1. Gruenberg,<br />
L.: Die deutsche Südostgrenze.<br />
1941 (= Veröffentlichungen des<br />
Deutschen Auslandswissenschaftlichen<br />
<strong>Institut</strong>s. 5).<br />
<strong>Grenzen</strong> erfahren – Räume schaffen.<br />
Tagungsbericht der 42. Werktagung<br />
1993. Hrsg. v. He<strong>in</strong>z Rothbucher.<br />
Salzburg 1994 (= Veröffentlichung<br />
der Salzburger Internationalen Pädagogischen<br />
Werktagung. 48).<br />
<strong>Grenzen</strong> erkennen – Begrenzungen<br />
überw<strong>in</strong>den. Festschrift für Re<strong>in</strong>hard<br />
Schneider. Hrsg. v. Wolfgang Haubrichs<br />
u.a. Sigmar<strong>in</strong>gen 1999.<br />
Die <strong>Grenzen</strong> Kongress-Polens. Hrsg. v.<br />
V. Erich W<strong>und</strong>erlich u.a. Wien,<br />
Brünn 19<strong>19.</strong> SA aus: Mitteilungen<br />
der Geographischen Gesellschaft <strong>in</strong><br />
Wien. Bd. 61 u. 62.<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzregionen – Frontières<br />
et régions frontalières – Borders<br />
and border regions. Hrsg. v.<br />
Wolfgang Haubrichs u. Re<strong>in</strong>hard<br />
Schneider. Saarbrücken 1993<br />
(= Veröffentlichungen der Kommission<br />
für Saarländische Landesgeschichte<br />
<strong>und</strong> Volksforschung. 22).<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Hoffnung. Geschichte <strong>und</strong><br />
Perspektiven der Grenzregion an der<br />
Oder. Hrsg. v. Helga Schultz u. Alan<br />
Nothnagle. Potsdam 1996<br />
(= Frankfurter Studien zur Grenzregion.<br />
1).<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Raumvorstellungen (11. –<br />
<strong>20</strong>. Jh.). – Frontières et conceptions<br />
de l’espace (11e–<strong>20</strong>e siècles). Zürich<br />
1996 (= Clio Lucernensis. 3).<br />
<strong>Grenzen</strong>-los? Jedes System braucht<br />
<strong>Grenzen</strong> – aber wie durchlässig<br />
müssen sie se<strong>in</strong>? Hrsg. v. Ernst Ulrich<br />
von Weizsäcker. Berl<strong>in</strong>, Basel,<br />
Boston 1997.<br />
Grenz-Fall. Das Saarland zwischen<br />
Frankreich <strong>und</strong> Deutschland 1945–<br />
1960. Hrsg. v. Ra<strong>in</strong>er Hudemann. St.<br />
Ingbert 1997.<br />
Grenzgänger. Hrsg. v. Re<strong>in</strong>hard Schneider.<br />
Saarbrücken 1998<br />
(= Veröffentlichungen der Kommission<br />
für Saarländische Landesgeschichte<br />
<strong>und</strong> Volksforschung. 33).<br />
Grenzgeschichten. Berichte aus dem<br />
deutschen Niemandsland. Hrsg. v.<br />
Andreas Hartmann. Frankfurt am<br />
Ma<strong>in</strong> 1990.<br />
Die Grenzkommission. E<strong>in</strong>e Dokumentation<br />
über Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Tätigkeit.<br />
Bonn: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>ister für <strong>in</strong>nerdeutsche<br />
Beziehungen, 1979, 2.<br />
Aufl. 1979.<br />
Grenzland. Beiträge zur Geschichte der<br />
deutsch-deutschen Grenze. Hrsg. v.<br />
Bernd Weisbrod. Hannover 1993<br />
(= Veröffentlichungen der Historischen<br />
Kommission für Niedersachsen<br />
<strong>und</strong> Bremen. 38, 9).<br />
Grenzpolitische Hefte. Hrsg. Reichsstudentenführung.<br />
Abteilung für poli-<br />
259
tische Erziehung. Oststelle. Königsberg<br />
(1937). Aufgegangen <strong>in</strong>: Die<br />
studentische Kameradschaft, oder<br />
vielmehr: Grenzpolitische Mappen.<br />
Grenzrecht <strong>und</strong> Grenzzeichen. Freiburg/<br />
Br. 1940 (= Das Rechtswahrzeichen.<br />
Beiträge zur Rechtsgeschichte <strong>und</strong><br />
rechtlichen Volksk<strong>und</strong>e. H. 2).<br />
Grenzrevision <strong>und</strong> M<strong>in</strong>derheitenfra-<br />
ge zwischen beiden Weltkriegen.<br />
Bd. 1.2. Rostock 1982 (= Studien<br />
zur Geschichte der deutschpolnischen<br />
Beziehungen. Wilhelm-<br />
Pieck-Universität, Sektion<br />
Geschichte, Rostock).<br />
Die Grenzziehung an der Weichsel.<br />
(Marienwerder, Wpr.) [nach 1922].<br />
Die Grenzziehung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen typischen<br />
Beispielen. Bearb. v. d.<br />
Stiftung für deutsche Volks- <strong>und</strong><br />
Kulturbodenforschung Leipzig. SA<br />
aus: Die E<strong>in</strong>wirkungen der Gebietsabtretung<br />
auf die deutsche<br />
Wirtschaft, Bd. 1: Der deutsche Osten<br />
<strong>und</strong> Norden. Berl<strong>in</strong> 1930, 103–<br />
112.<br />
Gr<strong>im</strong>m, Jacob <strong>und</strong> Wilhelm: Artikel<br />
“Grenze”. In: Dies.: Deutsches<br />
Wörterbuch. Bd. 9. Leipzig 1935,<br />
Sp. 124–148.<br />
Grothe, Hugo: Grothes kle<strong>in</strong>es Handwörterbuch<br />
des Grenz- <strong>und</strong><br />
Auslandsdeutschtums. Leipzig,<br />
München, Berl<strong>in</strong> 1932.<br />
Gruenberg, Leo: Die deutsche Südostgrenze.<br />
Leipzig, Berl<strong>in</strong> 1941 (= Die<br />
<strong>Grenzen</strong> des Reiches. 1).<br />
Günter, M.M.: Self-determ<strong>in</strong>ation or territorial<br />
<strong>in</strong>tegrity? The U.N. <strong>in</strong> confusion.<br />
In: World Affairs. Wash<strong>in</strong>gton,<br />
141 (1979), 214–216.<br />
Guenther, Adolf: Der sudetendeutsche<br />
Volkstumskampf <strong>im</strong> Spiegel des<br />
260<br />
Grenzlandromans. Diss. Marburg.<br />
Würzburg 1940.<br />
Guichonnet, Paul u. Claude Raffest<strong>in</strong>:<br />
Géographie des frontières. Paris<br />
1974 (= Collection SUP. La<br />
géographie. 13).<br />
Haas, Hans u.a.: Verfe<strong>in</strong>dete Brüder an<br />
der Grenze: Böhmen/Mähren/ Niederösterreich.<br />
Die Zerstörung der Lebense<strong>in</strong>heit<br />
“Grenze” 1938 bis 1945.<br />
Forschungsbericht. Horn 1998.<br />
Haas, Hans: Die deutsch-böhmische<br />
Frage 1918–1919 <strong>und</strong> das<br />
österreichisch-tschechoslowakische<br />
Verhältnis. In: Bohemia 13 (1972),<br />
336–383.<br />
Haas, Hans: Die Pariser Friedenskonferenz<br />
1919 <strong>und</strong> die Frage Gmünd. In:<br />
Kamptal Studien 3 (1982/83), 213–<br />
247.<br />
Haas, Hans: Die Zerstörung der Lebense<strong>in</strong>heit<br />
Grenze <strong>im</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
In: Kontakte <strong>und</strong> Konflikte (s.u.),<br />
363–386.<br />
Haas, Hans: Typen <strong>und</strong> Verlaufsmodelle<br />
ethnischer Homogenisierung unter<br />
Zwang. In: Beiträge zur Historischen<br />
Sozialk<strong>und</strong>e 4 (1996),<br />
152–159.<br />
Haas, Hans: Zur Problematik der<br />
österreichisch-tschechoslowakischen<br />
Grenze 1918–19<strong>19.</strong> In: Jiz=ní Morava<br />
– brána a most [Südmähren – Tor<br />
<strong>und</strong> Brücke]. Mikulov 1969, 131–<br />
140.<br />
Hadler, Frank: Peacemak<strong>in</strong>g 1919 <strong>im</strong><br />
Spiegel der Briefe Edvard Benes=s<br />
von der Pariser Friedenskonferenz.<br />
Teil I: Januar bis April 19<strong>19.</strong> In:<br />
Berl<strong>in</strong>er Jahrbuch für osteuropäische<br />
Geschichte 1/1 (1994), 213–255;<br />
Teil II: Mai bis August 19<strong>19.</strong><br />
Ebenda, 1/2 (1994), 225–257.
Häufler, Vlastislav: O vzniku a vymezení<br />
nas=ich statních hranic [Über<br />
die Entstehung <strong>und</strong> Vermessung unserer<br />
Staatsgrenzen]. In: Acta Universitatis<br />
Carol<strong>in</strong>ae – Geographica<br />
13/2 (1978), 13–29.<br />
Häufler, Vlastislav: The Ethnographic<br />
Map of the Czech Lands, 1880–1970<br />
(= Rozpravy C+eskoslovenské<br />
akademie ve=d – r=ada matematicky;ch<br />
a pr=irodni;ch ve=d 83/6). Praha 1973.<br />
Häupler, Hans-Joach<strong>im</strong>: Der bayerischböhmische<br />
Hauptgrenzvertrag von<br />
1764. In: Bohemia. Zeitschrift für<br />
Geschichte <strong>und</strong> Kultur der böhmischen<br />
Länder 33 (1992), 44–72.<br />
Ha<strong>in</strong>z, Roland: Vom Risorg<strong>im</strong>ento-<br />
Nationalismus zu der “natürlichen”<br />
Grenze. Innsbrucker Diplomarbeit.<br />
1991.<br />
Halecki, Oskar Ritter v.: Polens Ostgrenze<br />
<strong>im</strong> Lichte der Geschichte<br />
Ostgaliziens, des Cholmer Landes<br />
<strong>und</strong> Podlachiens. Wien 1918<br />
(= Polens Grenzprobleme. 1).<br />
Halecki, Oskar: Europa. <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong><br />
Gliederungen se<strong>in</strong>er Geschichte.<br />
Darmstadt 1957 [poln. Orig<strong>in</strong>al: Historia<br />
Europy i jej podzia¬y].<br />
Handwörterbuch des Grenz- <strong>und</strong><br />
Auslandsdeutschtums. Hrsg. v. Carl<br />
Petersen u.a. 3 Bde. (mehr nicht<br />
ersch.). Breslau 1933–1938.<br />
Hangula, Lazarus: Die Grenzziehungen<br />
<strong>in</strong> den afrikanischen Kolonien Englands,<br />
Deutschlands <strong>und</strong> Portugals<br />
<strong>im</strong> Zeitalter des Imperialismus.<br />
1880–1914. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1991<br />
(= Europäische Hochschulschriften.<br />
Reihe 3, 493).<br />
Hansen, Niles: Border region development<br />
and cooperation. Western<br />
Europe and the US-Mexico borderlands<br />
<strong>in</strong> comparative perspective. In:<br />
Across Bo<strong>und</strong>aries. Hrsg. v. Oscar<br />
Mart<strong>in</strong>ez. El Paso 1986.<br />
Hardt, Walter: “Aktion Ungeziefer”.<br />
Zwangsdeportation am 5. Juni 1952<br />
aus Bettenhausen (Kreis Me<strong>in</strong><strong>in</strong>gen).<br />
Ursachen, H<strong>in</strong>tergründe <strong>und</strong><br />
Durchführung. Erfurt 1998 (= Der<br />
Landesbeauftragte des Freistaates<br />
Thür<strong>in</strong>gen für die Unterlagen des<br />
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen<br />
DDR <strong>in</strong>formiert. Reihe C,<br />
Monographien).<br />
Hart an der Grenze. Burgenland <strong>und</strong><br />
Westungarn. Hrsg. v. Traude<br />
Horvath u. Eva Müller. Wien 1992.<br />
Hartmann, L.: Die nationale Grenze<br />
vom soziologischen Standpunkt. In:<br />
Hauptprobleme der Soziologie. Er<strong>in</strong>nerungsgabe<br />
für Max Weber. Hrsg.<br />
v. Melchior Palyi u.a. Bd. 1.<br />
München 1923.<br />
Hartshorne, Richard: Suggestions on the<br />
Term<strong>in</strong>ology of political bo<strong>und</strong>aries.<br />
In: Annals, Association of American<br />
Geographers 26 (1936), 56–57.<br />
Hasl<strong>in</strong>ger, Peter: Der ungarische Re-<br />
visionismus <strong>und</strong> das Burgenland<br />
1922–1932. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1994<br />
(= Europäische Hochschulschriften.<br />
Reihe 3. Geschichte <strong>und</strong> ihre Hilfswissenschaften.<br />
616).<br />
Hasl<strong>in</strong>ger, Peter: H<strong>und</strong>ert Jahre<br />
Nachbarschaft. Die Beziehungen<br />
zwischen Österreich <strong>und</strong> Ungarn<br />
1895–1994. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> u.a.<br />
1996.<br />
Hassert, Kurt: Deutschlands Lage <strong>und</strong><br />
Grenze <strong>in</strong> ihren Beziehungen zu<br />
Verkehr <strong>und</strong> Politik. In: Festschrift<br />
Johann J. Re<strong>in</strong>. Bonn 1905<br />
(= Veröffentlichungen der<br />
Geographischen Vere<strong>in</strong>igung zu<br />
Bonn. 1).<br />
261
Hass<strong>in</strong>ger, Hugo: Bemerkungen über<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Methode von<br />
Sprach- <strong>und</strong> Volkstumskarten. In:<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Volkstumskampf.<br />
Festschrift für Erich Gierach. Hrsg.<br />
v. Kurt Oberdorffer, Bruno Schier u.<br />
Wilhelm Wostry. Reichenberg 1941,<br />
47–62.<br />
Hauptner, Rudolf: Die tschechoslowakische<br />
Landesbefestigung der<br />
Zwischenkriegszeit.<br />
Die Landesbefestigung<br />
<strong>in</strong> Böhmen <strong>und</strong> Mähren. In:<br />
Forschen, Erhalten, Pflegen, Nutzen.<br />
Wesel 1991, 135–158.<br />
Hauser, Przemys¬aw: Niemcy wobec<br />
sprawy polskiej. Paz;dziernik 1918 –<br />
czerwiec 1919 [Deutschland <strong>und</strong><br />
die Polnische Frage. Oktober 1918 –<br />
Juni 1919]. Poznan; 1984 (= Seria<br />
Historia. 121).<br />
Haushofer, Karl: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> ihrer<br />
geographischen <strong>und</strong> politischen Bedeutung.<br />
Berl<strong>in</strong>-Grunewald 1927;<br />
2. verb. Aufl. Heidelberg 1939<br />
(= Schriften zur Weltpolitik. 1).<br />
Haversath, Johann-Bernhard: Historisch-geographische<br />
Aspekte politischer<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Mitteleuropa<br />
mit besonderer Berücksichtigung<br />
der heutigen deutsch-tschechischen<br />
Grenze. In: Siedlungsforschung 9<br />
(1991), 173–198.<br />
Havlík, Lubomír E.: K otázce hranice<br />
jíz=ní Moravy v dobe= panství Boleslava<br />
Chrabrého [Zur Frage der<br />
Grenze Südmährens <strong>in</strong> der Herrschaftszeit<br />
von Boles¬aw Chrobry].<br />
In: Studia z dziejów polskich i<br />
czechos¬owackich 1 (1960), 75–91.<br />
Hechter, Michael: Internal Colonialism.<br />
The celtic fr<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> British national<br />
development 1536–1966. London<br />
1975.<br />
262<br />
Heer, Caspar: Territorialentwicklung <strong>und</strong><br />
Grenzfragen von Montenegro <strong>in</strong> der<br />
Zeit se<strong>in</strong>er Staatswerdung (1830–<br />
1887). Bern, Frankfurt, Las Vegas<br />
1981 (= Geist <strong>und</strong> Wirken der<br />
Zeiten. 61).<br />
Heigl, Franz: Ansätze e<strong>in</strong>er Theorie der<br />
Grenze. Wien 1978 (= Schriftenreihe<br />
der österreichischen Gesellschaft für<br />
Raumforschung <strong>und</strong> Raumplanung.<br />
28).<br />
Heile, Wilhelm: Das Problem gerechter<br />
<strong>Grenzen</strong> zwischen den Staaten. In:<br />
Friedenswarte, Okt./Nov. 1929.<br />
He<strong>in</strong>tschel von He<strong>in</strong>egg, Wolff: Der<br />
Ägäis-Konflikt. Die Abgrenzung des<br />
Festlandsockels zwischen<br />
Griechenland <strong>und</strong> der Türkei <strong>und</strong> das<br />
Problem der Inseln <strong>im</strong> Seevölkerrecht.<br />
Berl<strong>in</strong> 1989 (= Schriften zum<br />
Völkerrecht. 89).<br />
Heller, Wilfried: Politische <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong><br />
Grenzräume aus anthropogeographischer<br />
Sicht. In: Grenzland.<br />
Hannover 1993, 173–194.<br />
Helmolt, Hans F.: Die Entwicklung der<br />
Grenzl<strong>in</strong>ie aus dem Grenzsaume. In:<br />
Historisches Jahrbuch 17 (1896),<br />
235–264.<br />
Herschy, Reg<strong>in</strong>ald W.: Disputed Frontiers.<br />
A Prelude to Conflict? Lewes,<br />
Sussex 1993.<br />
Hertslet, E.: The map of Europe by<br />
treaty. 4 vols. London 1875–91.<br />
Herzog, Lawrence A.: International<br />
bo<strong>und</strong>ary cities: the debate on trans<br />
frontier plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> two border regions<br />
(Western Europa and the U.S.-<br />
Mexico Border). In: The Natural<br />
Resources Journal 31 (1991), Nr. 3,<br />
587–608.<br />
Heuse, Hans: Grenze <strong>und</strong> Grenzerfahrungen.<br />
In: Praxis Geschichte 4<br />
(1993), 56–59.
Higham, Rob<strong>in</strong>: Frontiers – a global<br />
view. In: Journal of the West. New<br />
York, 34, Nr. 4 (1995), 48–54.<br />
Hillbrand, Erich: Die Kartenbestände<br />
des Kriegsarchivs Wien für das Gebiet<br />
der Tschechoslowakei, Polens,<br />
des Baltikums <strong>und</strong> der deutschen<br />
Ostgebiete. In: Zeitschrift für Ostforschung<br />
7 (1958), 87–97.<br />
H<strong>in</strong>ks, A.R. (= A.R.H.): Bo<strong>und</strong>ary l<strong>im</strong>itations<br />
<strong>in</strong> the treaty of Versailles. In:<br />
Geographical Journal 54 (1919),<br />
103–113 [<strong>in</strong> den folgenden Nummern<br />
mehrere Aufsätze über Grenzziehungen<br />
gemäß der Pariser Vororteverträge].<br />
H<strong>in</strong>ks, A.R.: Notes on the techniques of<br />
bo<strong>und</strong>ary l<strong>im</strong>itation. In: Geographical<br />
Journal 58 (1921), 417–443.<br />
Hirsch, Hans: Die Entstehung der<br />
Grenze zwischen Niederösterreich<br />
<strong>und</strong> Mähren. In: Deutsches Archiv<br />
für Landes- <strong>und</strong> Volksforschung<br />
1 (1937), 856–866.<br />
Hirsch, Hans: Zur Entwicklung der<br />
böhmisch-österreichisch-deutschen<br />
Grenze. E<strong>in</strong> Beitrag zur historischen<br />
Geographie Böhmens. In: Jahrbuch<br />
des Vere<strong>in</strong>s für Geschichte der<br />
Deutschen <strong>in</strong> Böhmen 1 (1926), 7–<br />
32.<br />
The historical bo<strong>und</strong>aries between Bosnia,<br />
Croatia, Serbia: Documents and<br />
maps, 1815–1945. Hrsg. v. Anita L.<br />
P. Burdett. Neuchâtel 1995.<br />
Historische Grenzlandschaften <strong>Ostmitteleuropa</strong>s<br />
<strong>im</strong> 16.–<strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Gesellschaft – Wirtschaft – Politik.<br />
Studiensammlung. Hrsg. v. Mieczys¬aw<br />
Wojciechowski <strong>und</strong> Ralph<br />
Schattkowsky. Torun; 1996.<br />
Hlavác=ek, Ivan: Die Grenze des böhmischen<br />
Staates <strong>im</strong> Spiegel des It<strong>in</strong>erars<br />
der späten Pr=emysliden <strong>und</strong> der<br />
Luxemburger. In: Festschrift für Alfred<br />
Wendehorst. Neustadt/Aisch<br />
1992, 231–240.<br />
Hoffmann, Roland J.: Zur Rezeption des<br />
Begriffs der Sudeti montes <strong>im</strong><br />
Zeitalter des Humanismus <strong>und</strong> der<br />
Reformation. In: Jahrbuch für sudetendeutsche<br />
Museen <strong>und</strong> Archive<br />
(1993–1994), 73–184.<br />
Hofmann, Erw<strong>in</strong>: Die Traisch. Zwei<br />
<strong>Grenzen</strong> zwischen Waldsassen <strong>und</strong><br />
Eger. In: Die Oberpfalz. He<strong>im</strong>atzeitschrift<br />
für den ehemaligen<br />
bayerischen Nordgau 85 (1997), Nr.<br />
1, 9–16; Nr. 2, 92–102.<br />
Hofmann, Karl: Grenze, politische. In:<br />
Staatslexikon, 5. Aufl., Bd. 2.<br />
Freiburg i. Br. 1927, Sp. 811–818.<br />
Hoke, Rudolf: Artikel “Grenze”. In:<br />
Handwörterbuch zur deutschen<br />
Rechtsgeschichte. Hrsg. v. Adalbert<br />
Erler u. Ekkehard Kaufmann. Bd. 1.<br />
Berl<strong>in</strong> 1971, Sp. 1801–1804.<br />
Holdich, Thomas Col., Sir: Political<br />
Bo<strong>und</strong>aries. In: N<strong>in</strong>eteenth Century<br />
and After 77 (1915), Jan.–June,<br />
11<strong>19.</strong><br />
Holdich, Thomas H.: Bo<strong>und</strong>aries <strong>in</strong><br />
Europe and <strong>in</strong> the Near East. London<br />
1918.<br />
Holdich, Thomas H.: Political frontiers<br />
and bo<strong>und</strong>ary mak<strong>in</strong>g. London 1916.<br />
Holdich, Thomas: Geographical Problems<br />
<strong>in</strong> Bo<strong>und</strong>ary Mak<strong>in</strong>g. In: Geographical<br />
Journal 48 (1916), 421–<br />
440.<br />
Holzer, Otto: Die <strong>Grenzen</strong> Österreichs<br />
<strong>und</strong> Südmährens. Wien 1966.<br />
Horna, A.: Hranice Republiky<br />
c=eskoslovenské ve sve=tle historie<br />
[Die <strong>Grenzen</strong> der Tschechoslowakischen<br />
Republik <strong>im</strong> Licht der<br />
Geschichte]. Bratislava 1924.<br />
263
Hosák, Ladislav: Vývoj národnostních<br />
hranic na severní Morave= od dob nejstars=ích<br />
do roku 1848. [Die<br />
Entwicklung der Nationalitätengrenzen<br />
<strong>in</strong> Nordmähren seit den ältesten<br />
Zeiten bis zum Jahre 1848]. In:<br />
Vlastive=dný sborník str=ední a severní<br />
Moravy 2 (1923/24), 83–103.<br />
Hosák, Ladislav: Zu den Fragen der<br />
Entwicklung der mährischösterreichischen<br />
Grenze. In: Jiz=ní<br />
Morava – brána a most / Südmähren<br />
– Tor <strong>und</strong> Brücke. Mikulov 1969,<br />
56–65.<br />
Houdek, Fedor: Vznik hranice Slovenska<br />
[Die Entstehung der <strong>Grenzen</strong> der<br />
Slowakei]. Bratislava 1931.<br />
House, John W.: Frontier Studies: An<br />
applied approach. In: Political Studies<br />
from Spacial perspectives. Hrsg.<br />
v. Alan D. Barnett u. Peter J. Taylor.<br />
New York 1981, 291–312.<br />
House, John W.: The Frontier zone. A<br />
conceptual problem for policymakers.<br />
In: International Political<br />
Science Review (post 1980).<br />
Howk<strong>in</strong>s, T.J.: Railway geography and<br />
the demarcation of Poland’s Borders<br />
1918–1930. In: Journal of Transport<br />
Geography 4, H. 4 (1996), 287–299.<br />
Huber, Franz: Europa <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e fortbestehenden<br />
<strong>Grenzen</strong>. In: Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alistik<br />
6 (1997), 396–400.<br />
Das Hultsch<strong>in</strong>er Ländchen <strong>im</strong> Versailler<br />
Friedensvertrag. Hrsg. v. Eberhard<br />
Bollacher. Stuttgart 1930.<br />
Hummelberger, Walter: Die niederösterreichischtschechoslowakische<br />
Grenzfrage<br />
1918/19<strong>19.</strong> In: Sa<strong>in</strong>t Germa<strong>in</strong> 1919<br />
(s.u.), 78–111.<br />
Hussy, C. u.a.: Colloque “Être et devenir<br />
de frontières”. In: Le Globe. Re-<br />
264<br />
vue Genevoise de géographie 136<br />
(1996), 9–13.<br />
Hyde, C.C.: Maps as evidence <strong>in</strong> bo<strong>und</strong>ary<br />
disputes. In: American Journal<br />
of International Law 27 (1933), 311–<br />
316.<br />
Ibler, Hermann: Des Reiches Südgrenze<br />
<strong>in</strong> der Steiermark. Vergewaltigtes<br />
Selbstbest<strong>im</strong>mungsrecht. Graz 1940.<br />
Irredentism and <strong>in</strong>ternational Politics.<br />
Hrsg. v. Naomi Chazan. Boulder,<br />
London 1991 (= Adamant<strong>in</strong>e International<br />
Studies).<br />
Irsigler, Franz: Der E<strong>in</strong>fluß politischer<br />
<strong>Grenzen</strong> auf die Siedlungs- <strong>und</strong> Kulturlandschaftsentwicklung.<br />
E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung<br />
<strong>in</strong> die Tagungsthematik. In:<br />
Siedlungsforschung 9 (1991), 9–23.<br />
Jacobi, Georg Arnold: Natürliche Gränzen.<br />
Düsseldorf 1814.<br />
Jäschke, Kurt-Ulrich: Mehrfachvasallität<br />
<strong>in</strong> Grenzregionen – e<strong>in</strong> Forschungsdesiderat?<br />
In: Granice i pogranicza.<br />
Jeçzyk i historia. Warszawa 1994,<br />
65–117.<br />
Jäschke, Kurt-Ulrich: Reichsgrenzen<br />
<strong>und</strong> Vasallitäten – zur E<strong>in</strong>ordnung<br />
des französisch-deutschen<br />
Grenzraums <strong>im</strong> Mittelalter. In: Jahrbuch<br />
für westdeutsche Landesgeschichte<br />
1996, 113–179.<br />
Jahrbuch des <strong>Institut</strong>s für Grenz- <strong>und</strong><br />
Auslandsstudien. Hrsg. v. Max<br />
Hildebert Boehm u. Karl Christian v.<br />
Loesch. Berl<strong>in</strong>-Steglitz 1939<br />
[früherer Obertitel: Deutsches Grenzland,<br />
Berl<strong>in</strong> 1936].<br />
Jana;k, Jan u. Zden=ka Hledíkova: De=j<strong>in</strong>y<br />
spra;vy v c=esky;ch zemích do roku<br />
1945 [Geschichte der Verwaltung <strong>in</strong><br />
den böhmischen Ländern bis zum<br />
Jahr 1945]. Praha 1989.<br />
Janc=a;rek, Petr: C+esko-saska; hranice v<br />
Krus=ny;ch hora;ch do tr=icetilete; va;lky
[Die böhmisch-sächsische Grenze <strong>im</strong><br />
Erzgebirge bis zum Dreißigjährigen<br />
Krieg]. In: C+echy a Sasko v<br />
prome=na;ch de=j<strong>in</strong> / Böhmen <strong>und</strong><br />
Sachsen <strong>im</strong> Wandel der Geschichte.<br />
Sborník pr=íspe=vku` konference, ktera;<br />
se konala 10.–11.11.1993 v U:stí nad<br />
Labem. Bearb. v. Krist<strong>in</strong>a Kaiserova;.<br />
U:stí nad Labem 1993, 133–140<br />
(= Acta Universitatis Purkynianae.<br />
Phil. et. Hist. 1., Slavogermanica II).<br />
Janicki, Lech: Rechtsgr<strong>und</strong>lagen der<br />
Staatsgrenze an der Oder <strong>und</strong> Lausitzer<br />
Neiße. In: Festschrift für<br />
Claus Arndt. Heidelberg 1987, 71 ff.<br />
Januszajtis, Marian: Strategiczne<br />
granice Polski na wschodzie [Die<br />
strategischen <strong>Grenzen</strong> Polens <strong>im</strong> Osten].<br />
Warszawa 1918.<br />
Jasica, Roman: Granica polsko-niemiecka<br />
w s;wietle ustawodawstwa<br />
Republiki Federalnej Niemiec [Die<br />
polnisch-deutsche Grenze <strong>im</strong> Lichte<br />
der Verfassungsgesetzgebung der<br />
BRD]. Warszawa 1993 (= East<br />
European Research Group, Work<strong>in</strong>g<br />
Papers Series. 2).<br />
Jaskólski, Józef: Granice Polski [Die<br />
<strong>Grenzen</strong> Polens]. Òwów 19<strong>19.</strong><br />
Jaworski, Rudolf: Grenzlage, Rückständigkeit<br />
<strong>und</strong> nationale Agitation:<br />
Die “Bayerische Ostmark” <strong>in</strong> der<br />
We<strong>im</strong>arer Republik. In: Zeitschrift<br />
für bayerische Landesgeschichte 41<br />
(1978), 241–270.<br />
Jaworski, Rudolf: Kartographische<br />
Ortsbezeichnungen <strong>und</strong> nationale<br />
Emotionen. E<strong>in</strong> deutschtschechischer<br />
Streitfall aus den<br />
Jahren 1924/25. In: Stadtverfassung,<br />
Verfassungsrecht, Pressepolitik.<br />
Hrsg. v. Franz Quarthal <strong>und</strong> W<strong>in</strong>fried<br />
Setzler. Sigmar<strong>in</strong>gen 1980,<br />
250–261.<br />
Jeanneret, René: Regions et frontières<br />
<strong>in</strong>ternationales. Neufchâtel 1985.<br />
Jenk<strong>in</strong>s, Alan: Political geography:<br />
Achiev<strong>in</strong>g sovereignty and secure<br />
bo<strong>und</strong>aries. Geography 74 (Oct.<br />
1989), 358–359.<br />
Jiz=ní Morava. Bra;na i most [Südmähren.<br />
Tor <strong>und</strong> Brücke]. Mikulov 1969.<br />
Jones, Stephen B.: Bo<strong>und</strong>ary Concept <strong>in</strong><br />
the Sett<strong>in</strong>g of Place and T<strong>im</strong>e. In:<br />
Annals, Association of American<br />
Geographers 43,3 pt.1 (1959), 241–<br />
255.<br />
Jones, Stephen B.: Bo<strong>und</strong>ary-mak<strong>in</strong>g. A<br />
handbook for statesmen, treaty editors<br />
and bo<strong>und</strong>ary commissioners.<br />
Wash<strong>in</strong>gton, DC 1945 (= Carnegie<br />
Endowment for <strong>in</strong>ternational peace.<br />
Division of International Law.<br />
Monograph No. 8).<br />
Jordán, Frantis=ek: Jihomoravké<br />
pohranic=í a vztahy c=esko-rakouské v<br />
nové dobe= [Das südmährische Grenzland<br />
<strong>und</strong> die tschechischösterreichischen<br />
Beziehungen <strong>in</strong><br />
neuerer Zeit]. In: Jiz=ní Morava.<br />
Bra;na i most [Südmähren. Tor <strong>und</strong><br />
Brücke]. Mikulov 1969, 25–35.<br />
Jordan, Peter: Poland’s Frontiers. London<br />
1945.<br />
Jürgensen, Harald u. Ham (?) G. Voigt:<br />
Die volkswirtschaftlichen Wirkungen<br />
adm<strong>in</strong>istrativer Raumgrenzen.<br />
Hamburg 1963.<br />
Jung, Andreas: Der Aufhalter des<br />
Bösen. Carl Schmitt <strong>und</strong> die Grenze.<br />
In: Markus Bauer u. Thomas Rahn:<br />
Die Grenze. Begriff <strong>und</strong> Inszenierung.<br />
Berl<strong>in</strong> 1997.<br />
Kaczmarczyk, Zdzis¬aw: Polska granica<br />
zachodnia w perspektywie tysiaçca lat<br />
historii [Die polnische Westgrenze <strong>in</strong><br />
der Perspektive von 1000 Jahren<br />
265
Geschichte]. In: Przeglaçd zachodni<br />
51 (1995), Nr. 2, 135–152.<br />
Käubler, Rudolf: Die Unbeständigkeit<br />
der “historischen” <strong>Grenzen</strong> Böhmens<br />
aufgezeigt am Beispiel Westböhmens.<br />
In: Geographische Zeitschrift<br />
44 (1938), 361–371.<br />
Kalsto, Pal: The Dnjester Conflict. Between<br />
irredentism and separatism.<br />
In: Europe-Asia Studies 45, 6<br />
(1993), 973–1000.<br />
Kamann, O.S.: Secessions and the Right<br />
of Self-Determ<strong>in</strong>ation. An OAU Dilemma.<br />
In: Journal of modern African<br />
Studies 12 (1974), 360–363.<br />
Kampschulte, Andrea: Das<br />
österreichisch-ungarische Grenzgebiet<br />
– Entwicklungschancen <strong>und</strong> -<br />
probleme <strong>im</strong> Zuge der Grenzöffnung.<br />
In: Geographica Helvetica Nr.<br />
3 (1997), 97–105.<br />
Kán=a, Otakar u. Ryszard Pavelka:<br />
Te=s=ínsko v polsko-c=eskoslovenských<br />
vztazích 1918-1939 [Das Tetschener<br />
Land <strong>in</strong> den polnischtschechoslowakischen<br />
Beziehungen<br />
1918–1939]. Ostrava 1970.<br />
Kardum, Livija: Problem istoc=nih i zapadnih<br />
granica Kraljev<strong>in</strong>e Srba,<br />
Hrvata i Slovenaca na Paris=koj mirovnoj<br />
konferenciji 1919 [Das Problem<br />
der Ost- <strong>und</strong> Westgrenzen des<br />
Königreichs der Serben, Kroaten <strong>und</strong><br />
Slovenen <strong>in</strong> der Pariser Friedenskonferenz<br />
1919]. In: Politic=ka misao.<br />
C+asopis za politic=ke znanosti 26<br />
(1989), Nr. 4, 128.<br />
Karp, Hans-Jürgen: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong><br />
während des Mittelalters.<br />
E<strong>in</strong> Beitrag zur Entstehungsgeschichte<br />
der Grenzl<strong>in</strong>ie aus dem<br />
Grenzsaum. Köln, Wien 1972<br />
(= Forschungen <strong>und</strong> Quellen zur<br />
266<br />
Kirchen- <strong>und</strong> Kulturgeschichte Ostdeutschlands.<br />
9).<br />
Karschies, Erich: Dah<strong>in</strong>ter ist <strong>im</strong>mer die<br />
Sonne. E<strong>in</strong> Grenzlandbuch. Berl<strong>in</strong>-<br />
Leipzig 1943.<br />
Kaser, Karl: Freier Bauer <strong>und</strong> Soldat.<br />
Die Militarisierung der agrarischen<br />
Gesellschaft an der kroatischslawonischen<br />
Militärgrenze (1535–<br />
1881). Wien-Köln-We<strong>im</strong>ar 1997 (=<br />
Zur K<strong>und</strong>e Südosteuropas. 2, 22).<br />
Katz, Yossi: The Orig<strong>in</strong>s of the Conception<br />
of Israel’s State Borders and its<br />
<strong>im</strong>pact on the Strategy of War <strong>in</strong><br />
1948/49. In: The Journal of Strategic<br />
Studies. London, Vol. 18, Nr. 2<br />
(1995), 149–171.<br />
Keller, Sab<strong>in</strong>a u.a.: <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Perspektiven<br />
von grenzüberschreitenden<br />
Städtenetzwerken. In: Raumforschung<br />
<strong>und</strong> Raumordnung 1 (1997),<br />
14–27.<br />
Kellerman, Aharon: Transition <strong>in</strong> the<br />
mean<strong>in</strong>gs of frontiers: From settlement<br />
advanve to regional development.<br />
In: Journal of Geography 96<br />
(1997), Nr. 5, 230–235.<br />
Kempen, Bernhard: Die deutschpolnische<br />
Grenze nach der Friedensregelung<br />
des Zwei-plus-Vier-<br />
Vertrages. Frankfurt am Ma<strong>in</strong> u.a.<br />
1997 (= Kölner Schriften zu Recht<br />
<strong>und</strong> Staat. 1).<br />
Kerchnawe, Hugo: Die alte kk. Militärgrenze.<br />
Wien 1939.<br />
Kessler, Wolfgang: Jo;zef Chlebowczyk<br />
<strong>und</strong> die Nationsbildung <strong>im</strong> östlichen<br />
Mitteleuropa vom 18. bis zum Beg<strong>in</strong>n<br />
des <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts. In: Formen<br />
des nationalen Bewußtse<strong>in</strong>s <strong>im</strong><br />
Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien.<br />
Hrsg. v. Eva Schmidt-<br />
Hartmann. München 1994, 103–112.
Khan, L. Ali: The ext<strong>in</strong>ction of nationstates.<br />
A world without borders. The<br />
Hague 1996.<br />
K<strong>in</strong>dermann, He<strong>in</strong>z: Rufe über <strong>Grenzen</strong>.<br />
Antlitz <strong>und</strong> Lebensraum der Grenz<strong>und</strong><br />
Auslandsdeutschen <strong>in</strong> ihrer<br />
Dichtung. Berl<strong>in</strong> 1938 (= Die Bücher<br />
der jungen Generation).<br />
Kirchhoff, Alfred: Zur Verständigung<br />
über die Begriffe Nation <strong>und</strong> Nationalität.<br />
Halle/S. 1905.<br />
Kirkbright, Suzanne: Border and border<br />
experience. Investigations <strong>in</strong>to the<br />
philosophical and literary <strong>und</strong>erstand<strong>in</strong>g<br />
of a German motif. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong> u.a. 1997 (= European<br />
university studies 01, German language<br />
and literature. 1626).<br />
Kirn, Paul: Politische Geschichte der<br />
deutschen <strong>Grenzen</strong>. Leipzig 1. Aufl.<br />
1934, 2. Aufl. 1938, Mannhe<strong>im</strong> 3.<br />
Aufl. 1944, 4. Aufl. 1958 (= Meyers<br />
kle<strong>in</strong>e Reisebücher).<br />
Klafkowski, Alfons: Granica polskoniemiecka<br />
po II wojnie s;wiatowej<br />
[Die polnisch-deutsche Grenze nach<br />
dem II. Weltkrieg]. Poznan; 1970.<br />
Klafkowski, Alfons: Podstawy prawne<br />
granicy Odra-Nysa na tle umów jaltan;skiej<br />
i poczdamskiej [Rechtsgr<strong>und</strong>lagen<br />
der Oder-Neiße-Grenze<br />
auf dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der Vere<strong>in</strong>barungen<br />
von Jalta <strong>und</strong> Potsdam].<br />
Poznan; 1947.<br />
Klemenc=ic;, Mladen: Territorial proposals<br />
for the settlement of the war <strong>in</strong><br />
Bosnia-Hercegov<strong>in</strong>a. Durham 1994<br />
(= Bo<strong>und</strong>ary and territory brief<strong>in</strong>g.<br />
1,3).<br />
Klemenc=ic;, V.: Grenzregionen <strong>und</strong> nationale<br />
M<strong>in</strong>derheiten. Socialnogeografski<br />
problemi obmestnih <strong>in</strong><br />
obmejnih obmoc=ij [Sozial-<br />
geographische Probleme von Stadt<strong>und</strong><br />
Grenzgebieten]. In:<br />
Geographica Slovenica 8 (1978), 7–<br />
<strong>20</strong>.<br />
Klemenc=ic;, V.: The Function of Borders<br />
and the Development of Border Regions<br />
with<strong>in</strong> Yugoslavia. In:<br />
Geographica Iugoslavica 10 (1989),<br />
323–337.<br />
Klieman, Aaron S.: The politics of Partition.<br />
In: Journal of <strong>in</strong>ternational affairs<br />
18 (1964), 161f.<br />
Kl<strong>im</strong>ek, Antonín: Jak se de=lal mír roku<br />
19<strong>19.</strong> C+eskoslovensko na konferencii<br />
ve Versailles [Wie Friede <strong>im</strong> Jahr<br />
1919 gemacht wurde. Die Tschechoslowakei<br />
auf der Konferenz von<br />
Versailles]. Praha 1989 (= Slovo k<br />
historii. 19).<br />
Kl<strong>im</strong>ko, Jozef: Politické a právne dej<strong>in</strong>y<br />
hraníc predmníchovskej republiky<br />
(1918–1938) [Politische <strong>und</strong> rechtliche<br />
Geschichte der <strong>Grenzen</strong><br />
der vormünchner Republik (1918–<br />
1938)]. Bratislava 1986.<br />
Klüter, Helmut: Neue <strong>Grenzen</strong>, Staaten<br />
<strong>und</strong> Probleme. In: Geographie heute<br />
112 (1993), 32–39.<br />
Kneissl, Kar<strong>in</strong>: Der Grenzbegriff der<br />
Konfliktparteien <strong>im</strong> Nahen Osten.<br />
Wien (Univ. Diss.) 1991.<br />
Königk, Georg: Der Kampf um die<br />
deutsche Ostgrenze <strong>in</strong> Versailles.<br />
Berl<strong>in</strong> 1940.<br />
Kokot, Józef: Charakterystyka polskoniemieckiej<br />
granicy narodowos;ciowej<br />
na S:laçsku w XIX i XX<br />
wieku [Charakteristik der polnischdeutschen<br />
Nationalitätengrenze <strong>in</strong><br />
Schlesien <strong>im</strong> <strong>19.</strong> u. <strong>20</strong>. Jh.]. In:<br />
Studia S:laçskie 10 (1966), 145–166.<br />
267
Kolb, Herbert: Zur Frühgeschichte des<br />
Wortes “Grenze”. In: Archiv für das<br />
Studium der neueren Sprachen <strong>und</strong><br />
Literaturen 226, Jg. 141 (1989), 2.<br />
Halbbd., 344–356.<br />
Kolendo, Ireneusz T.: The question of<br />
borders and of a post-war union <strong>in</strong><br />
polish-czechoslovak relations dur<strong>in</strong>g<br />
the years 1940–1943. In: Acta Poloniae<br />
Historica. Warszawa, 54 (1986),<br />
137–165.<br />
Kolip<strong>in</strong>ski, Juliusz: Die Friedensgrenze.<br />
E<strong>in</strong>fluß der Grenze an Oder <strong>und</strong><br />
Neisse auf die Wirtschaft Deutschlands<br />
<strong>und</strong> Polens. (Granica pokoju<br />
). Stuttgart 1949. ([Materialunterlagen]<br />
Serie 12).<br />
Kolossow, W.A., A.D. Kr<strong>in</strong>datsch:<br />
Rußlands neue Grenzgebiete.<br />
Dargestellt am Beispiel des Gebietes<br />
Rostow am Don. In: Osteuropa 45<br />
(1995), 33–52.<br />
Komlosy, Andrea: An den Rand<br />
gedrängt. Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialgeschichte<br />
des Oberen Waldviertels.<br />
Wien 1988.<br />
Komlosy, Andrea: Räume <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />
Zum Wandel von Raum, Politik <strong>und</strong><br />
Ökonomie vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
moderner Staatenbildung <strong>und</strong> weltwirtschaftlicher<br />
Globalisierung. In:<br />
Zeitgeschichte 22 (1995), 385–404.<br />
Komlosy, Andrea: Wo die österreichischen<br />
an die böhmischen Länder<br />
grenzen: Kle<strong>in</strong>raum – Zwischenraum<br />
– Peripherie. In: Kontakte <strong>und</strong><br />
Konflikte (s.u.), 491–5<strong>20</strong>.<br />
Komlosy, Andrea: Zwischenraum. Südböhmen<br />
<strong>im</strong> Übergang. In: Forum.<br />
Wien (1993), 469–472.<br />
Konirsh, Suzanne G: The Struggle for<br />
Power between Germans and Czechs<br />
1907–1911. Diss. Stanford 1952.<br />
268<br />
Kontakte <strong>und</strong> Konflikte. Böhmen,<br />
Mähren <strong>und</strong> Österreich. Aspekte<br />
e<strong>in</strong>es Jahrtausends geme<strong>in</strong>samer<br />
Geschichte. Referate d. Symposiums<br />
“Verb<strong>in</strong>dendes u. Trennendes an d.<br />
Grenze III” vom 24. bis 27. Okt.<br />
1992 <strong>in</strong> Zwettl. Hrsg. v. Thomas<br />
W<strong>in</strong>kelbauer. Horn, Waidhofen an d.<br />
Thaya 1993 (= Schriftenreihe des<br />
Waldviertler He<strong>im</strong>atb<strong>und</strong>es. 36).<br />
Koop, Volker: “Den Gegner vernichten”.<br />
Die Grenzsicherung der DDR.<br />
Bonn 1996.<br />
Kosmala, Gerard: Zmiany granic politycznych<br />
w Europie S:rodkowej w<br />
okresie ostatnich stu lat [Wandel der<br />
politischen <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Mitteleuropa<br />
während der letzten h<strong>und</strong>ert Jahre].<br />
Wroc¬aw 1993.<br />
Kovács, Zoltán: Border Changes and<br />
Their Effect on the Structure of<br />
Hungarian Society. In: Political Geography<br />
Quarterly 8, 1 (1989), 79–<br />
86.<br />
Kowalski, W¬odz<strong>im</strong>ierz T.: Große Koalition<br />
<strong>und</strong> Westgrenze Polens (1941–<br />
1945). In: Polnische Weststudien 4<br />
(1985), 79–96.<br />
Kowalski, W¬odz<strong>im</strong>ierz T.: ZSSR a<br />
granica na Odrze i Nysie ¬uzæyckiej<br />
1941–1945. Warszawa 1965 (Dt.<br />
Übs. u.d.T.: Die UdSSR <strong>und</strong> die<br />
Grenze an der Oder <strong>und</strong> Lausitzer<br />
Neisse 1941–1945. Gött<strong>in</strong>gen 1966).<br />
Krätke, Stefan: Where East meets West:<br />
The German-Polish border region <strong>in</strong><br />
transformation. In: European Plann<strong>in</strong>g<br />
Studies 4 (1996), Nr. 6, 647–<br />
671.<br />
Kraszewski, Piotr: Polska granica<br />
zachodnia w koncepcjach rzaçdu RP<br />
na emigracji w latach 1939–1945<br />
[Die polnische Westgrenze <strong>in</strong> den<br />
Konzeptionen der polnischen Emi-
grationsregierung <strong>in</strong> den Jahren<br />
1939–1945]. In: Przeglaçd Zachodni,<br />
45 (1989), Nr. 5–6, 169-186.<br />
Krebs, Norbert: Deutschland <strong>und</strong><br />
Deutschlands <strong>Grenzen</strong>. Berl<strong>in</strong> 1929.<br />
Kristoff, L.A.D.: The nature of frontiers<br />
and bo<strong>und</strong>aries. In: Annals, Association<br />
of American Geographers 49<br />
(1959), 269–82.<br />
Kröger, Herbert: Deutsche <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong><br />
europäische Sicherheit. Berl<strong>in</strong> (Ost)<br />
1967 (= Blickpunkt Weltpolitik).<br />
Krüger, Peter: Der Funktionswandel von<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong> europäischen Staatensystem<br />
des <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
In: Deutschland <strong>und</strong> Europa. Historische,<br />
politische <strong>und</strong><br />
geographische Aspekte. FS zum 51.<br />
Deutschen Geographentag Bonn<br />
1997. Hrsg. v. Eckart Ehlers. Bonn<br />
1997, 73–84 (= Colloquium<br />
Geographicum, 24).<br />
Krumeich, Gerd: Der Rhe<strong>in</strong> als strategische<br />
Grenze. In: Franzosen <strong>und</strong><br />
Deutsche am Rhe<strong>in</strong> 1789–1918–<br />
1945. Essen 1989, 67–79.<br />
Krus=elj, Z+eljko: Krojac=i hrvatskih<br />
granica [Schneider der kroatischen<br />
<strong>Grenzen</strong>]. Zagreb 1991.<br />
Kubu`, Eduard: C+eskoslovenská zahranic=ní<br />
politika a problém rozhranic=ení<br />
Horního Slezska v roce<br />
1921 [Die tschechoslowakische<br />
Außenpolitik <strong>und</strong> das Problem der<br />
Grenzziehung Oberschlesiens <strong>im</strong><br />
Jahr 1921]. In: Slovanský pr=ehled<br />
(1992), 22–31.<br />
Kuffner, Hanus=: Nás= stát a sve=tový mír.<br />
S 5 mapami. Praha 1918; dt.: Unser<br />
Staat <strong>und</strong> der Weltfrieden. Mit 5<br />
Landkarten. Warnsdorf 1922.<br />
Kuhn, Walter: Der Löwenberger Hag<br />
<strong>und</strong> die Besiedlung der schlesischen<br />
Grenzwälder. In: Schlesien 8 (1968),<br />
401–480.<br />
Kuhn, Walter: Zu den <strong>Grenzen</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>s<br />
während des Mittelalters.<br />
In: Zeitschrift für Ostforschung 23<br />
(1974), 148–151.<br />
Kulturen an der Grenze. Waldviertel –<br />
We<strong>in</strong>viertel – Südböhmen – Südmähren.<br />
[Kultury na hranici]. Hrsg.<br />
v. Andrea Komlosy, Václav Bu`z=ek<br />
u. Frantis=ek Svátek. Wien 1995.<br />
Kupc=ik, Ivan: Die ersten kartographischen<br />
Festlegungen der<br />
tschechoslowakischen Staatsgrenzen.<br />
In: Bohemia. Zeitschrift für<br />
Geschichte <strong>und</strong> Kultur der böhmischen<br />
Länder 30 (1989), 41–51.<br />
Labuda, Gerard: Die polnische Westgrenze<br />
<strong>in</strong> der tausendjährigen<br />
Geschichte des Staates <strong>und</strong> Volkes.<br />
In: Polnische Weststudien 4 (1985),<br />
3–32.<br />
Labuda, Gerard: Polska granica zachodnia:<br />
Tysiaçc lat dziejów politycznych<br />
[Die polnische Westgrenze. 1000<br />
Jahre politischer Geschichte].<br />
Poznan; 1971, 2. Aufl. 1974.<br />
Lässig, S<strong>im</strong>one: Regionale Spezifika<br />
<strong>und</strong> grenzüberschreitende Beziehungsgeflechte.<br />
Juden <strong>in</strong> Böhmen<br />
<strong>und</strong> Sachsen am Beg<strong>in</strong>n des Emanzipationsprozesses.<br />
In: Blätter für<br />
deutsche Landesgeschichte 130<br />
(1994), 111–142.<br />
Lamel, J.: Geme<strong>in</strong>destruktur <strong>in</strong> den<br />
Grenzgebieten. In: Geme<strong>in</strong>de <strong>im</strong><br />
Grenzland. Kommunalpolitik <strong>und</strong><br />
Kommunalwissenschaft. Hrsg. v. Alfred<br />
Klose u. Elisabeth Langer: H. 7,<br />
o.O. 1980, 15–18.<br />
Lange, Friedrich: <strong>Grenzen</strong> zwischen<br />
Deutschen <strong>und</strong> Deutschen. München<br />
1933.<br />
269
Langhammer, Josef: Werden <strong>und</strong> Wert<br />
politischer Staats-<strong>Grenzen</strong>. Prag<br />
19<strong>19.</strong><br />
Lapradelle, Paul de: La frontière. Etude<br />
de droit <strong>in</strong>ternational. Paris 1928.<br />
Las=tovka, Vojte=ch: Vytyc=ení západoc=eské<br />
státní hranice pomnichovské<br />
republiky [Die Festlegung der westböhmischen<br />
Staatsgrenze der nachmünchner<br />
Republik]. In: M<strong>in</strong>ulostí<br />
západoc=eského kraje 7 (1970, 33–48.<br />
Latt<strong>im</strong>ore, Owen: Studies <strong>in</strong> Frontier<br />
History. Collected Papers 1928–<br />
1958. London 1962 [meist über asiatische<br />
<strong>Grenzen</strong>].<br />
Latt<strong>im</strong>ore, Owen: The Frontier <strong>in</strong> History<br />
(10 e Congresso <strong>in</strong>ternazionale di<br />
scienze storiche, Roma 1955. Relazioni.<br />
Vol. 1). Firenze 1955.<br />
Latzke, Walter: Schlesiens Südgrenze<br />
bis zum Anfange des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
In: Zeitschrift des Vere<strong>in</strong>s für<br />
Geschichte Schlesiens 71 (1937),<br />
57–101.<br />
Leersen, Joep Th. (Ed.): Borders<br />
and Territories. Amsterdam 1993<br />
(= Yearbook of European Stu-<br />
dies, 6).<br />
Le<strong>im</strong>gruber, Walter: Segregation oder<br />
Integration. Innen- <strong>und</strong> Außengrenzen<br />
als Maßstäbe des Denkens <strong>und</strong><br />
Handelns <strong>in</strong> der Schweiz. In:<br />
Geographische R<strong>und</strong>schau 43<br />
(1991), 488–493.<br />
Le<strong>im</strong>gruber, Walter: The perception of<br />
bo<strong>und</strong>aries – barriers or <strong>in</strong>vitation to<br />
<strong>in</strong>teraction. In: Regio Basiliensis.<br />
Basler Zeitschrift für Geographie.<br />
Revue de geographie de Bâle 30<br />
(1989), 49 ff.<br />
Lendl, Egon: Die Volksgrenze als Forschungsaufgabe.<br />
In: Zeitschrift für<br />
Erdk<strong>und</strong>e 6 (1938).<br />
270<br />
Lengereau, Marc: Les frontières allemandes<br />
(1919–1989). Frontières<br />
d’Allemagne et en Allemagne: Aspects<br />
territoriaux de la question allemande.<br />
Bern u.a. 1990 (= Contacts.<br />
Sér. IV – Bilans et enjeux. 3).<br />
Lenz, Oskar: E<strong>in</strong>e neue Sprachenkarte<br />
von Böhmen. In: Deutsche Arbeit 4<br />
(1905), 407–409.<br />
Lezzi, Maria: Über die <strong>Grenzen</strong>. E<strong>in</strong>e<br />
Wegbeschreibung des Projektes:<br />
“Auswirkungen der EG-<br />
Außengrenze auf die Raumordnungspolitik<br />
<strong>in</strong> Schweizer Grenzregionen”.<br />
In: Regio Basiliensis. Basler<br />
Zeitschrift für Geographie 34<br />
(1993), Nr. 1, 19–24.<br />
Lightfoot, Kent G. u.a.: Frontiers and<br />
Bo<strong>und</strong>aries <strong>in</strong> archaeological perspective<br />
(colonialist perspective). In:<br />
Annual Review of Anthropology.<br />
Palo Alto, 24 (1995), 471–492.<br />
Lilge, Carsten: Die Entstehung der<br />
Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie als Nebenprodukt<br />
alliierter Großmachtpolitik während<br />
des Zweiten Weltkrieges. Frankfurt/M.<br />
[u.a.] 1995 (= Europäische<br />
Hochschulschriften. 3, 650).<br />
L<strong>in</strong>nebach, Karl: Die gerechte Grenze<br />
<strong>im</strong> deutschen Westen – e<strong>in</strong><br />
1000jähriger Kampf. Berl<strong>in</strong> 1926<br />
(= Rhe<strong>in</strong>ische Schicksalsfragen.<br />
13.14).<br />
Literatur an der Grenze. Der Raum Saarland-Lothr<strong>in</strong>gen-Luxemburg-Elsaß<br />
als Problem der Literaturgeschichtsschreibung.<br />
Hrsg. v. Uwe<br />
Gr<strong>und</strong> u. Günter Scholdt. Saarbrücken<br />
1992.<br />
Literatur der Grenze – Theorie der<br />
Grenze. Hrsg. v. Richard Faber u.<br />
Barbara Naumann. Würzburg 1995.<br />
Loesch, August: The economics of location<br />
(= Übersetzung aus dem
Deutschen von ders.: Die räumliche<br />
Ordnung der Wirtschaft. E<strong>in</strong>e Untersuchung<br />
über Standort, Wirtschaftsgebiete<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Handel.<br />
Jena, 2. Aufl. 1944). New York<br />
1967.<br />
Loesch, Karl Christian v.: Das Antlitz<br />
der Grenzlande. Bde. 1–3. München<br />
1932–33.<br />
Loesch, Karl Christian v.: Die neue<br />
Grenze der Tschechoslowakei. In:<br />
Volk <strong>und</strong> Reich 14 (1938), 767–786.<br />
Lohr, Karlhe<strong>in</strong>z: Die geopolitischen<br />
Grenzbelange <strong>und</strong> die Verkehrsbeziehungen<br />
zwischen den beiden<br />
deutschen Staaten 1970 – 1990.<br />
H<strong>in</strong>tergründe, Analysen, Kommentare<br />
<strong>und</strong> Folgerungen. Berl<strong>in</strong> 1998.<br />
Loserth, Johann: Der Grenzwald Böhmens.<br />
In: Mitteilungen des Vere<strong>in</strong>es<br />
für Geschichte der Deutschen <strong>in</strong><br />
Böhmen 21(1883/84), 177–367.<br />
Luard, Evan: The <strong>in</strong>ternational regulation<br />
of frontier disputes. London<br />
1970.<br />
Luft, Robert: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>.<br />
In: Bohemia 36 (1995), 451–<br />
453.<br />
Luft, Robert: Verb<strong>in</strong>dendes <strong>und</strong> Trennendes<br />
an der Grenze. In: Bohemia<br />
33 (1992), 406 f., 35 (1994), 135.<br />
Lyde, Lionel William: Some frontiers<br />
of tomorrow. An <strong>in</strong>spiration for<br />
Europe. London 1915.<br />
Macartney, Carlyle Aylmer: Nation and<br />
State. In: Fortnightly n.s.: 144<br />
(1938: July/ Dec.), 196.<br />
Macha;c=ek, J.: Zme=ny hranic C+ech a<br />
zemí náležejících k Republice<br />
C+eskoslovenské od pr=íchodu C+echova<br />
[Grenzänderungen Böhmens <strong>und</strong><br />
der Länder, die zur C+SR gehören,<br />
seit der Ankunft des (Ahnvaters)<br />
C+ech]. Praha 1919 (= Levná knihovna<br />
“Národa”. 14).<br />
Magris, Claudio: Wer steht auf der anderen<br />
Seite? Salzburg, Wien 1993.<br />
Maier, Joerg: Bedeutung <strong>und</strong><br />
Auswirkungen von <strong>Grenzen</strong> zur<br />
DDR <strong>und</strong> C+SFR, oder: Wie<br />
verändern offene <strong>Grenzen</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Raum? In: Arbeitsmaterialien zur<br />
Raumordnung <strong>und</strong> Raumplanung.<br />
Heft 26, Bayreuth 1990, 1–<strong>20</strong>.<br />
Maks<strong>im</strong>yc=ev, Igor’ F.: Konec berl<strong>in</strong>skoj<br />
steny [Das Ende der Berl<strong>in</strong>er<br />
Mauer]. In: Mez=dunarodnaja z=izn’<br />
(1991) 2, S. 110–118.<br />
Mantoux, Paul: Les délibérations du<br />
conseil des Quatre. 24 mars – 28 ju<strong>in</strong><br />
19<strong>19.</strong> 2 Bde. Paris 1955.<br />
Manzo, Kathryn A.: Creat<strong>in</strong>g bo<strong>und</strong>aries.<br />
The politics of race and nation.<br />
Boulder u.a. 1996.<br />
Marczak, Tadeusz: Granica zachodnia w<br />
polskiej polityce zagranicznej w<br />
latach 1944–1950 [Die Westgrenze<br />
<strong>in</strong> der polnischen Außenpolitik <strong>in</strong><br />
den Jahren 1944–1950]. Wroc¬aw<br />
1995.<br />
Maritschnik, Konrad: Erlebtes Grenzland.<br />
Gnas 1993.<br />
Martel, René: Deutschlands blutende<br />
<strong>Grenzen</strong>. Oldenburg 1930.<br />
Marti, Roland: Grenzbezeichnungen –<br />
grenzüberschreitend. In: <strong>Grenzen</strong><br />
erkennen ↔ Begrenzungen überw<strong>in</strong>den.<br />
Festschrift für Re<strong>in</strong>hard<br />
Schneider. Hrsg. v. Wolfgang Haubrichs<br />
u.a. Sigmar<strong>in</strong>gen 1999, 19–<br />
33.<br />
Mart<strong>in</strong>stetter, Hermann: Die Staatsgrenzen.<br />
Siegenberg – Konstanz – Berl<strong>in</strong>,<br />
2. Auflage 1952.<br />
271
Mart<strong>in</strong>stetter, Hermann: Grenze. In:<br />
Staatslexikon, 6. Aufl., Bd. 3.<br />
Freiburg 1995.<br />
Mattisen, Edgar: Estonija – Rossija. Istorija<br />
granicy i ee problemy [Estland<br />
– Rußland. Geschichte e<strong>in</strong>er Grenze<br />
<strong>und</strong> ihre Probleme]. Tall<strong>in</strong>n 1995.<br />
Matuszewski, Ignacy: Granice Zachodnie<br />
[Die Westgrenzen]. New York<br />
1943.<br />
Maull, Otto: Politische <strong>Grenzen</strong>. Berl<strong>in</strong><br />
1928 (= Weltpolitische Bücherei. 3).<br />
Mayall, James: Nationalism and the <strong>in</strong>ternational<br />
order. In: Millennium 14<br />
(1985), Summer, 143–158.<br />
McIntyre, W. David: The Imperial Frontier<br />
<strong>in</strong> the Tropics, 1865–1875: A<br />
study of British colonial policy <strong>in</strong><br />
West Africa, Malaya and the South<br />
Pacific <strong>in</strong> the Age of Gladstone and<br />
Disraeli. London, Melbourne, New<br />
York 1967.<br />
McMahon, Henry A.: International<br />
Bo<strong>und</strong>aries. In: Journal of the Royal<br />
Society of Arts 84 (1935), 2–16.<br />
Medick, Hans: Grenzziehung <strong>und</strong> die<br />
Herstellung des politisch-sozialen<br />
Raumes. Zur Begriffsgeschichte <strong>und</strong><br />
politischen Sozialgeschichte der<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Frühen Neuzeit. In:<br />
Grenzland. Beiträge zur Geschichte<br />
der deutsch-deutschen Grenze. Hrsg.<br />
v. Bernd Weisbrod. Hannover 1993,<br />
195–211.<br />
Medick, Hans: Zur politischen Sozialgeschichte<br />
der <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der<br />
Neuzeit Europas. In: SOWI. Sozialwissenschaftliche<br />
Informationen <strong>20</strong><br />
(1991), Heft 3 (= Sonderheft <strong>Grenzen</strong>).<br />
Mehed<strong>in</strong>t*i, S<strong>im</strong>ion: Rumänien an der<br />
Ostgrenze Europas. Bukarest 1941.<br />
Me<strong>in</strong>ke, D.: Grenze. Ökonomische <strong>und</strong><br />
soziale Auswirkungen. In: Hand-<br />
272<br />
wörterbuch der Raumordnung. Hannover<br />
1970, Sp. 1060–1075.<br />
Mémoire concernant la dél<strong>im</strong>itation des<br />
frontières entre les états polonais<br />
et tchécoslovaque en Silésie de Cieszyn,<br />
Orawa et Spisz. Paris 19<strong>19.</strong><br />
Menschen über <strong>Grenzen</strong> – <strong>Grenzen</strong> über<br />
Menschen. Die multikulturelle<br />
Herausforderung. Hrsg. v. Klaus J.<br />
Bade. Herne 1995.<br />
Menschen <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Frühen<br />
Neuzeit. Hrsg. v. Wolfgang Schmale<br />
<strong>und</strong> Re<strong>in</strong>hard Stauber. Berl<strong>in</strong> 1998<br />
(= Innovationen. 2).<br />
Migration <strong>und</strong> Grenze. Hrsg. v. Andreas<br />
Gestrich u. Marita Krauss. Stuttgart<br />
1998 (= Stuttgarter Beiträge zur Historischen<br />
Migrationsforschung. 4).<br />
Mikesell, Marv<strong>in</strong> W.: The myth of the<br />
Nation State. In: Journal of Geography<br />
82 (1983), 257–260.<br />
Miller, D.H.: The Frontier. Comparative<br />
Studies. Oklahoma 1977.<br />
Milward, Alan S.: The frontier of national<br />
sovereignty. History and theory<br />
1945–1992. London 1993.<br />
M<strong>in</strong>ghi, Julian V<strong>in</strong>cent: Bo<strong>und</strong>ary Studies<br />
and National Prejudice. In: Professional<br />
Geographer 15,1 (1963),<br />
4–8.<br />
M<strong>in</strong>ghi, Julian V<strong>in</strong>cent: Bo<strong>und</strong>ary studies<br />
<strong>in</strong> political geography. In: Annals,<br />
Association of American Geographers<br />
53 (1963), 407–428.<br />
M<strong>in</strong>ghi, Julian V<strong>in</strong>cent: European<br />
Borderlands. International Harmony,<br />
Landscape Change and New Conflict.<br />
In: Eurasia. World Bo<strong>und</strong>aries<br />
Series 3. Hrsg. v. Carl Gr<strong>und</strong>y-Warr.<br />
London, New York 1994, 89–98.<br />
Das mitteleuropäische Grenz- <strong>und</strong><br />
Auslandsdeutschtum. E<strong>in</strong>e Materialsammlung.<br />
Hrsg. v. der Reichszentrale<br />
für He<strong>im</strong>atdienst. Abschn. 1 ff.
Berl<strong>in</strong>: 1929 ff. 1. Das Deutschtum<br />
<strong>im</strong> Osten. 1929. [Losebl.-Sammlung<br />
i.M.].<br />
Miyoshi, Masahiro: Considerations of<br />
Equity <strong>in</strong> the Settlement of Territorial<br />
and Bo<strong>und</strong>ary Disputes. Amsterdam<br />
1993 (= International Law <strong>in</strong><br />
Japanese Perspectives. 2).<br />
Montagnes, fleuves, forêts dans<br />
l’histoire. Barrières ou ligne de convergence?<br />
/ Berge, Flüsse, Wälder <strong>in</strong><br />
der Geschichte. H<strong>in</strong>dernisse oder<br />
Begegnungsräume? Hrsg. v. Jean-<br />
Franc*ois Bergier. St. Kathar<strong>in</strong>en<br />
1989.<br />
Moodie, Arthur E.: States and Bo<strong>und</strong>aries<br />
<strong>in</strong> the Danubian Lands. In: Slavonic<br />
and East European Review 26<br />
(1947/ 1948), 422.<br />
Moodie, Arthur E.: The Italo-Yugoslav<br />
bo<strong>und</strong>ary: a study <strong>in</strong> political geography.<br />
London 1945.<br />
Mroczko, Marian: Polska mys;l zachodnia<br />
1918–1939. Kszta¬towanie i<br />
upowszechnianie [Die polnische<br />
Westidee. Gestaltung <strong>und</strong> Verbreitung].<br />
Poznan; 1986.<br />
Mühlen, He<strong>in</strong>z von zur: Die Narva-<br />
Frage <strong>und</strong> die Grenze <strong>im</strong> Nordosten<br />
Estlands. In: Zeitschrift für Ostforschung<br />
41 (1992), 248–257.<br />
Müller, Karl: Die Lausitzer Grenze<br />
gegen Böhmen. In: Grenzgau Ostland<br />
(1926), 33–36, 79–80.<br />
Müller, Konrad: Staatsgrenzen <strong>und</strong><br />
evangelische Kirchengrenzen. Gesamtdeutsche<br />
Staatse<strong>in</strong>heit <strong>und</strong><br />
evangelische Kirchene<strong>in</strong>heit nach<br />
deutschem Recht. Hrsg. v. Axel<br />
Frhr. von Campenhausen. Tüb<strong>in</strong>gen<br />
1988 (Jus ecclesiasticum. 35).<br />
Murphy, Alexander B.: Historical justifications<br />
for territorial cla<strong>im</strong>s. In:<br />
Annals, Association of American<br />
Geographers, 80, 4 (1990), 531–548.<br />
Murty, Tadepalli S.: Frontiers. A chang<strong>in</strong>g<br />
concept. New Delhi 1978.<br />
Na¬kowski, Wacław: Terytorium Polski<br />
historycznej jako <strong>in</strong>dywidualno‘ c;<br />
geograficzna [Das Territorium des<br />
historischen Polen als geographische<br />
Individualität]. Warszawa 1912.<br />
National and International Bo<strong>und</strong>aries.<br />
Thessaloniki 1985 (= Thesaurus<br />
acroasium of Public International<br />
Law and of International Relations<br />
of Thessaloniki (Session 1983). 14).<br />
Neagoe, Sever: Teritoriul sçi frontierele<br />
în istoria Românilor [Das Territorium<br />
<strong>und</strong> die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der<br />
Geschichte der Rumänen]. Bucuresçti<br />
1995 (= Colectçia Valorile patriei).<br />
Nekuda, Vlad<strong>im</strong>ir: Die Südgrenze<br />
Mährens <strong>im</strong> Frühmittelalter aus der<br />
Sicht der Archäologie. In: Siedlungsforschung<br />
9 (1991), 69–78.<br />
Nelson, Peter: Land and Power. British<br />
and allied policy on Germany’s frontiers.<br />
London, Toronto 1963<br />
(= Studies <strong>in</strong> political history).<br />
Neuman, Gerald L.: Strangers to the<br />
Constitution: <strong>im</strong>migrants, borders,<br />
and f<strong>und</strong>amental law. Pr<strong>in</strong>ceton<br />
1996.<br />
Nicklis, Hans-Werner: Von der<br />
“Grenitze” zur Grenze. Die Grenzidee<br />
des late<strong>in</strong>ischen Mittelalters<br />
(6.–15. Jh). In: Blätter für deutsche<br />
Landesgeschichte 123 (1992), 1–30.<br />
Nicolson, Adam: Frontiers. From the<br />
Arctic Circle to the Aegean. London<br />
1957.<br />
Niendorf, Matthias: M<strong>in</strong>derheiten an der<br />
Grenze. Deutsche <strong>und</strong> Polen <strong>in</strong> den<br />
Kreisen Flatow (Z¬otów) <strong>und</strong> Zempelburg<br />
(Seçpólno Krajen;skie) 1900–<br />
273
1939. Wiesbaden 1997 (= Quellen<br />
<strong>und</strong> Studien. Deutsches Historisches<br />
<strong>Institut</strong> Warschau. 6).<br />
Nitz, Hans-Jürgen: Historical geography.<br />
In: 40 years after. German geography.<br />
Developments, trends and<br />
prospects 1952–1992. Hrsg. v.<br />
Eckart Ehlers. Bonn 1992, 145–172.<br />
Nordman, D.: Des l<strong>im</strong>ites d’état aux<br />
frontières nationales. In: Les lieux<br />
de mémoire. Hrsg. v. P. Nora. Bd. 2:<br />
La Nation. Paris 1986, 35–61.<br />
Nordman, D.: Überlegungen zum Begriff<br />
der Grenze <strong>in</strong> Frankreich vom<br />
16. bis zum Beg<strong>in</strong>n des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
(Sektion “Grenzüberschreitungen<br />
<strong>und</strong> die Machbarkeit des Raums,<br />
1500–1900”). In: Bericht über die<br />
39. Versammlung deutscher Historiker<br />
<strong>in</strong> Hannover 23. bis 26. September<br />
1992. Stuttgart 1994, S. 132<br />
f.<br />
Nouzille, Jean: Histoire des frontières.<br />
L’Autriche et l’Empire Ottoman.<br />
Paris 1991.<br />
Nyman, Alf: Gränsbegrepp och renodl<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong>om Wetenskappen. Exempel,<br />
analyser, teori. L<strong>und</strong> 1951 (= L<strong>und</strong>s<br />
Universitets Årsskrift NF 1,47,1).<br />
Nystuen, J. D.: Bo<strong>und</strong>ary Shapes and<br />
Bo<strong>und</strong>ary Problems. In: Papers of<br />
the Peace Research Society, Papers<br />
VII. Chicago Conference 1967, .... .<br />
O Granice wschodnie pan;stwa polskiego.<br />
Sprawozdanie z wicu<br />
zwo¬anego w Warszawie dnia 22.<br />
IX. 1918 roku przez grupeç Polako;w<br />
[Über die Ostgrenze des polnischen<br />
Staates. Bericht von der Beratung,<br />
die <strong>in</strong> Warschau am 22.9.1918 durch<br />
e<strong>in</strong>e Gruppe von Polen abgehalten<br />
wurde]. Warszawa 1918.<br />
Oberkrome, Willi: “Grenzkampf <strong>und</strong><br />
He<strong>im</strong>atdienst”. Geschichtswissen-<br />
274<br />
schaft <strong>und</strong> Revisionsbegehren. In:<br />
Tel Aviver Jahrbuch für deutsche<br />
Geschichte 25 (1996), 187–<strong>20</strong>4.<br />
Oberschlesiens blutende Grenze.<br />
(Beuthen 1931). Zugl.: Ostdeutsche<br />
Morgenpost v. <strong>20</strong>.3.1931. Abst<strong>im</strong>mungs-Gedenkausgabe.<br />
Die österreichische Militärgrenze.<br />
Geschichte <strong>und</strong> Auswirkungen.<br />
Hrsg. v. Gerhard Ernst. Regensburg<br />
1982 (= Schriftenreihe des Regensburger<br />
Osteuropa<strong>in</strong>stituts. 8).<br />
Die offene Grenze. Forschungsbe-<br />
richt polnisch-deutsche Grenzregion<br />
(1991–1993). Hrsg. v. Stanislaw<br />
Lisiecki. Potsdam 1996.<br />
Offene <strong>Grenzen</strong> – Neue Aufgaben für<br />
die Regionalpolitik. Wien 1991<br />
(= Schriftenreihe. Österreichische<br />
Raumordnungskonferenz. 94).<br />
Ogilvie, Alan Grant: Some aspects of<br />
bo<strong>und</strong>ary settlement at the Peace<br />
Conference. London 1922 (= Help<br />
for Students of History. 49).<br />
Ogilvie, Alan Grant: Europe and its<br />
Borderlands. Ed<strong>in</strong>burgh u.a. 1957.<br />
Olejnik, Karol: Obrona polskiej granicy<br />
zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego<br />
i monarchii stanowej [Die<br />
Verteidigung der polnischen Westgrenze.<br />
Zeitalter der Zersplitterung<br />
<strong>und</strong> der Ständemonarchie]. Poznan;<br />
1970.<br />
Oncken, Hermann: Die Rhe<strong>in</strong>politik<br />
Kaiser Napoleons III. von 1863 bis<br />
1870 <strong>und</strong> der Ursprung des Krieges<br />
von 1870–1871. Stuttgart 1926.<br />
Open borders? Closed societies? The<br />
ethical and political issues. Hrsg. v.<br />
Mark Gibney. New York 1988.<br />
Or¬owski, Hubert: Grenzlandliteratur.<br />
Zur Karriere e<strong>in</strong>es Begriffs <strong>und</strong><br />
Phänomens. In: He<strong>im</strong>at <strong>und</strong> He<strong>im</strong>atliteratur<br />
<strong>in</strong> Vergangenheit <strong>und</strong>
Gegenwart. Hrsg. v. Hubert<br />
Or¬owski. Poznan; 1993, 9–18.<br />
Orzechowski, Marian: Odra – Nysa<br />
Òuzæycka – Ba¬tyk w polskiej mys;li<br />
politycznej okresie II wojny<br />
s;wiatowej [Oder – Lausitzer Neiße –<br />
Ostsee <strong>im</strong> polnischen politischen<br />
Denken <strong>in</strong><br />
der Zeit des Zweiten Weltkriegs].<br />
Wroc¬aw 1969.<br />
Ostdeutsches Grenzlandleben. Von<br />
Memel bis Kattowitz (Beuthen 1928)<br />
(= Sonderausgabe der Ostdeutschen<br />
Morgenpost).<br />
Die Ostgebiete des Deutschen Reiches.<br />
Hrsg. v. Gotthold Rhode. 4. Aufl.<br />
Würzburg 1957.<br />
Otwarta granica. Raport z badan; na<br />
pograniczu polsko-niemieck<strong>im</strong><br />
1991– 1993 / Die Offene Grenze.<br />
Forschungsbericht polnisch-deutsche<br />
Grenzregion. 1991–1993. Poznan;<br />
1995 / Potsdam 1996 (= Frankfurter<br />
Studien zur Grenzregion. 2).<br />
Paasi, Anssi: Territories, Bo<strong>und</strong>aries<br />
and Consciousness. The Chang<strong>in</strong>g<br />
Geographies of the F<strong>in</strong>nish-Russian<br />
Border. Chichester, New York, Brisbane,<br />
Toronto, S<strong>in</strong>gapore 1996.<br />
Parpert, Friedrich: Grenze <strong>und</strong> Grenzüberschreitung.<br />
München, Basel<br />
1963.<br />
Paul, Gustav: Die räumlichen <strong>und</strong> rassischen<br />
Gestaltungskräfte der<br />
großdeutschen Geschichte. München<br />
1938.<br />
Peattie, Roderick: Grenzprobleme <strong>und</strong><br />
Friede. Wien 1948. (Orig<strong>in</strong>al <strong>in</strong><br />
Engl.: Look to the frontiers, 1944).<br />
Penck, Albrecht: Deutscher Volks- <strong>und</strong><br />
Kulturboden. In: Volk unter Völkern.<br />
Hrsg. v. Karl Christian v.<br />
Loesch, Breslau 1925, 62–73.<br />
Penck, Albrecht: Über politische <strong>Grenzen</strong>.<br />
Rektoratsrede, Berl<strong>in</strong> 1917.<br />
Perez, Sandra: Analyse spatiale des régions<br />
frontaliers et des effets des<br />
frontière. In: Le Globe. Revue Genevoise<br />
de géographie 136 (1996),<br />
13–17.<br />
Perman, Dagmar: The Shap<strong>in</strong>g of the<br />
Czechoslovak State. Diplomatic History<br />
of the Bo<strong>und</strong>aries of Czechoslovakia,<br />
1914–1918. Leiden 1962.<br />
Pickl, Othmar: 75 Jahre steirische<br />
Südgrenze (1918–1993). In:<br />
Österreich <strong>in</strong> Geschichte <strong>und</strong> Literatur<br />
mit Geographie. Wien, 37 (1993),<br />
326–339.<br />
Pieper, Richard: Region <strong>und</strong> Regionalismus.<br />
Zur Wiederentdeckung e<strong>in</strong>er<br />
räumlichen Kategorie <strong>in</strong> der soziologischen<br />
Theorie. In: Geographische<br />
R<strong>und</strong>schau 89 (1987), 534–538.<br />
Pieradzka, K.: Historyczny rozwój<br />
granicy Dolnego S:laçska do poczaçtku<br />
czasów nowozæytnych [Die historische<br />
Entwicklung der Grenze<br />
Niederschlesiens bis zum Beg<strong>in</strong>n der<br />
Neuzeit]. In: Przeglaçd Zachodni 4,<br />
Nr. 7–8 (1948), 40–71.<br />
Pilk<strong>in</strong>gton, John: Surface tension. [Historical<br />
perspective on the cont<strong>in</strong>u<strong>in</strong>g<br />
border dispute between Chile and<br />
Argent<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Patagonia]. In: Geographical<br />
Magaz<strong>in</strong>e 63 (Jun 1991),<br />
25–27.<br />
Piskorski, Jan M.: Tysiaçc lat granicy<br />
polsko-niemieckiej. In: Przeglaçd historyczny<br />
83 (1992), 597–615.<br />
Dt. Übersetzung: 1000 Jahre der<br />
deutsch-polnischen Grenze. In:<br />
Jahrbuch für die Geschichte Mittel-<br />
<strong>und</strong> Ostdeutschlands 44 (1996),<br />
129–150.<br />
Plakovic=, Konstant<strong>in</strong>: Stará hranica<br />
medzi Slovenskom a Moravou [Die<br />
275
alte Grenze zwischen der Slowakei<br />
<strong>und</strong> Mähren]. In: Vlastive=dny;<br />
C+asopis 38 (1989), Nr. 1, 47.<br />
Pleyer, Kleo: Die Kräfte des<br />
Grenzkampfes <strong>in</strong> <strong>Ostmitteleuropa</strong>.<br />
Hamburg 1937 (= Schriften des<br />
Reichs<strong>in</strong>stituts für Geschichte des<br />
Neuen Deutschlands).<br />
Ploessl, Hans: Dokumentation über die<br />
deutsch-österreichische Staatsgrenze.<br />
München 1977.<br />
Pogranicze jako problem kultury. Materia—y<br />
konferencji naukowej Opole 13<br />
– 14. 12. 1993 r. [Das Grenzland als<br />
Kulturproblem. Materialien e<strong>in</strong>er<br />
wissenschaftlichen Konferenz...].<br />
Hrsg. v. Teresa Smolińska. Opole<br />
1994.<br />
Pokorny;, Pavel R.: Hranice c=eských a<br />
moravských diecézí po roce 1918.<br />
In: Historické listy 2 (1992), 15–16.<br />
Polis=ensky,; Josef: Pohranic=í v de=j<strong>in</strong>ách<br />
str=ední Evropy [Die Grenzgebiete <strong>in</strong><br />
der Geschichte Mitteleuropas]. In:<br />
Jiz=ní Morava. Bra;na i most [Südmähren.<br />
Tor <strong>und</strong> Brücke]. Mikulov<br />
1969, 5–9.<br />
Das Polnische Grenzzonengesetz mit<br />
Ausführungsverordnung. Übers. u.<br />
e<strong>in</strong>gel. v. He<strong>in</strong>z Meyer, Osteuropa-<br />
<strong>Institut</strong> Berl<strong>in</strong>. Berl<strong>in</strong> 1937.<br />
Pomerance, M.: Self-Determ<strong>in</strong>ation <strong>in</strong><br />
Law and Practice. The New Doctr<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong> UN. London 1982.<br />
Porch, Douglas: The “Frontier” <strong>in</strong><br />
French Imperial Ideology. In: Journal<br />
of the West. New York, 34<br />
(1995), Nr. 4, 16–23.<br />
Potter, David: Empty areas and roman<br />
frontier policy. In: American journal<br />
of philology. John Hopk<strong>in</strong>s University.<br />
Balt<strong>im</strong>ore, 113 (1992), Nr. 2,<br />
269–274.<br />
276<br />
Po<strong>und</strong>s, Norman J.G.: France and “Les<br />
l<strong>im</strong>ites naturelles” from the seventeenth<br />
to twentieth centuries. In:<br />
Annals. Association of American<br />
Geographers 44 (1954), 51–62.<br />
Po<strong>und</strong>s, Norman J.G.: The orig<strong>in</strong> of the<br />
idea of natural frontiers <strong>in</strong> France.<br />
In: Annals. Association of American<br />
Geographers 41 (1951), 146–157.<br />
Prasek, V<strong>in</strong>cenc: Prome=ny na severních<br />
hranicích Moravských. In: C+asopis<br />
Matice Moravské 11 (1879), 77–95.<br />
Prescott, John R.V.: The geography of<br />
frontiers and bo<strong>und</strong>aries. Chicago<br />
1965.<br />
Prescott, John R.V.: Political Frontiers<br />
and bo<strong>und</strong>aries. London 2. Aufl.<br />
1987.<br />
Pr<strong>in</strong>z, Friedrich: Die <strong>Grenzen</strong> des Reiches<br />
<strong>in</strong> frühsalischer Zeit: E<strong>in</strong> Strukturproblem<br />
der Königsherrschaft. In:<br />
Die Salier <strong>und</strong> das Reich. I. Sigmar<strong>in</strong>gen<br />
1990, 159–174.<br />
Problem granic i obszaru odrodzonego<br />
pan;stwa polskiego [Das Problem der<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> der Ausdehnung des<br />
wiedergeborenen polnischen<br />
Staates]. Hrsg. v. Antoni Czub<strong>in</strong>;ski.<br />
Poznan; 1992 (= Seria Historia. Uniwersytet<br />
Imienia Adama<br />
Mickiewicza w Poznaniu. 174).<br />
Problemy spo—eczno-gospodarcze miast<br />
pogranicza polsko-niemieckiego<br />
[Sozioökonomische Probleme der<br />
Städ-te <strong>im</strong> polnisch-deutschen<br />
Grenzgebiet].<br />
Hrsg. v. Zbigniew Kurcz.<br />
Wroc¬aw 1992 (= Acta Universitatis<br />
Wartislaviensis. Socjologia. 6).<br />
Procházka, Theodore: The Del<strong>im</strong>itation<br />
of Czechoslovak-German Frontiers<br />
after Munich. In: Journal of Central<br />
European Affairs 21 (1961), <strong>20</strong>0–<br />
218.
Pütter, Johann Stephan: Staatsveränderungen<br />
des Deutschen Reiches von<br />
den ältesten bis auf die neuesten<br />
Zeiten <strong>im</strong> Gr<strong>und</strong>risse. Gött<strong>in</strong>gen<br />
1753.<br />
Puttkamer, Ell<strong>in</strong>or von: Die Curzon-<br />
L<strong>in</strong>ie als Ostgrenze Polens. In: Die<br />
Wandlung 1947, 175 ff.<br />
Quellen zur Entstehung der Oder-Neiße-<br />
L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> den diplomatischen Verhandlungen<br />
während des Zweiten<br />
Weltkrieges. Hrsg. v. Gotthold<br />
Rhode <strong>und</strong> Wolfgang Wagner. Stuttgart<br />
1956 (= Die deutschen Ostgebiete.<br />
3).<br />
Racek, Alfred: Philosophie der Grenze.<br />
E<strong>in</strong> Entwurf. Wien, Freiburg, Basel<br />
1983.<br />
Raffest<strong>in</strong>, Claude: Elements for a theory<br />
of the frontier. In: Diogenes (International<br />
Council for Philosophy and<br />
Humanistic Studies) 134 (1986), 1–<br />
18.<br />
Rahn, H.: Die E<strong>in</strong>wirkungen der<br />
tschechoslowakischen Grenze auf<br />
das deutsche Grenzgebiet am<br />
Beispiel der Geme<strong>in</strong>den Schirgiswalde,<br />
Sohland <strong>und</strong> Wehrsdorf.<br />
Diss. Leipzig, auch Borna 1940.<br />
Randelzhofer, Albrecht: Grenze. In:<br />
Lexikon des Rechts. Völkerrecht.<br />
Hrsg. v. Ignaz Seidl-Hohenveldern.<br />
2. Aufl. Neuwied u.a. 1992, 121 f.<br />
Raschhofer, Hermann: Die tschechoslowakischen<br />
Denkschriften für die<br />
Friedenskonferenz von Paris 1919–<br />
19<strong>20</strong>. Berl<strong>in</strong> 1937, 2. erg. Aufl.<br />
1938.<br />
Ratzel, Friedrich: Politische Geographie.<br />
München, Leipzig 1897; dar<strong>in</strong> v. a.<br />
Abschnitt 6: Die <strong>Grenzen</strong>. (445 ff.).<br />
– 3. Aufl. München 1923.<br />
Ratzel, Friedrich: Über allgeme<strong>in</strong>e Eigenschaften<br />
der geographischen<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> über die politische<br />
Grenze. Berichte der Königlich<br />
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.<br />
Sitzung am 6. Februar<br />
1892.<br />
Raubal: Formation de la frontière entre<br />
la Pologne et la Tchécoslovaquie.<br />
Paris 1928.<br />
Raven, Wolfram v.: Sichere <strong>Grenzen</strong>.<br />
In: Europäische Wehrk<strong>und</strong>e.<br />
Wehrwissenschaftliche R<strong>und</strong>schau<br />
(Neuer Titel: Europäische Sicherheit).<br />
Herford, 38 (1989), Nr. 10,<br />
581.<br />
Regieren <strong>in</strong> entgrenzten Räumen. Hrsg.<br />
v. Beate Kohler-Koch. Wiesbaden<br />
1999 (= Politische Vierteljahresschrift.<br />
Sonderheft 29).<br />
Region <strong>und</strong> Regionsbildung <strong>in</strong> Europa.<br />
Konzepte der Forschung <strong>und</strong> empirische<br />
Bef<strong>und</strong>e. Hrsg. von Gerhard<br />
Brunn. Baden-Baden 1996.<br />
Regionen an deutschen <strong>Grenzen</strong>: Strukturwandlungen<br />
der ehemaligen <strong>in</strong>nerdeutschen<br />
Grenze <strong>und</strong> an der<br />
deutschen Ostgrenze. Hrsg. v. Frank-<br />
Dieter Gr<strong>im</strong>m. Leipzig 1995<br />
(= Beiträge zur regionalen<br />
Geographie. 38).<br />
Reich, Robert B.: What is a nation?<br />
In: Political Science Quarterly 106<br />
(1991), 90–106.<br />
Reichert, Franz: <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Kartographie<br />
des Mittelalters. In: Migration<br />
<strong>und</strong> Grenze. Hrsg. v. Andreas<br />
Gestrich <strong>und</strong> Marita Krauss. Stuttgart<br />
1997 (= Stuttgarter Beiträge<br />
zur Historischen Migrationsforschung.<br />
4).<br />
Reread<strong>in</strong>g Frederick Jackson Turner:<br />
“The significance of the frontier <strong>in</strong><br />
American history” and other essays.<br />
Hrsg. v. John Mack. New York<br />
1994.<br />
277
Re;vay, Stephan: Die <strong>im</strong> Belvedere gezogene<br />
ungarisch-slowakische<br />
Grenze. Budapest 1941.<br />
Der Rhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Geschichte. Hrsg.<br />
v. Lucien Febvre. Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
u.a. 1994.<br />
Rhode, Gotthold: Die Ostgrenze Polens.<br />
Politische Entwicklung, kulturelle<br />
Bedeutung <strong>und</strong> geistige Auswirkung.<br />
Bd. 1: Im Mittelalter bis zum Jahre<br />
1401. Köln, Graz 1955.<br />
Riedel, Heiko: Wahrnehmungen von<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Grenzräumen: e<strong>in</strong>e kulturpsychologisch-geographische<br />
Untersuchung. Saarbrücken 1994<br />
(= Arbeiten aus dem geographischen<br />
<strong>Institut</strong> der Universität des Saarlandes).<br />
Riedl, Franz: Die Entwicklung der<br />
Grenze zwischen Niederösterreich<br />
<strong>und</strong> Mähren (Diss.). Innsbruck <strong>und</strong><br />
Bozen 1951.<br />
Ritter, Gert u.a.: The East-West German<br />
Bo<strong>und</strong>ary. In: Geographical Review.<br />
New York, 79 (1989), Nr. 3, 326.<br />
Ritter, Gert u. Joseph Hajdu: Die<br />
deutsch-deutsche Grenze. Analyse<br />
ihrer räumlichen Auswirkungen <strong>und</strong><br />
der raumwirksamen Staatstätigkeit <strong>in</strong><br />
den Grenzgebieten. Köln 1982<br />
(= Geostudien. 7).<br />
Ritter, Joach<strong>im</strong>: Artikel “Grenze,<br />
Schranke”. In: Historisches Wörterbuch<br />
der Philosophie. Hrsg. v.<br />
Joach<strong>im</strong> Ritter. Bd. 3. Basel, Stuttgart<br />
1974, Sp. 875 ff.<br />
Ritter, Jürgen u. Peter Joach<strong>im</strong> Lapp:<br />
Die Grenze. E<strong>in</strong> deutsches Bauwerk.<br />
Berl<strong>in</strong> 1997, 2. Aufl. 1998.<br />
Robejsek, Peter: Wo verläuft die künftige<br />
Ost-West-Grenze? Die Konturen<br />
der kommenden Teilung Europas.<br />
In: Europäische Sicherheit.<br />
Herford, Nr. 3 (1997), 40–44.<br />
278<br />
Rogge, John R.: The Balkanization of<br />
Nigeria’s federal System. A case<br />
study of the political geography of<br />
Africa. In: Journal of Geography 76<br />
(1977), 135–140.<br />
Rohkam, He<strong>in</strong>rich: Der Grafenkrieg.<br />
E<strong>in</strong> Beitrag zur Geschichte der<br />
Grenzziehung <strong>im</strong> Riesengebirge<br />
(1537–1710). In: Schlesien-<br />
Jahrbuch 11 (1939), 35–58.<br />
Rokkan, Ste<strong>in</strong> u. D. W. Urw<strong>in</strong>: Economy,<br />
Territory, Identity. London<br />
1983.<br />
Rokkan, Ste<strong>in</strong>: D<strong>im</strong>ensions of State<br />
Formation and Nation Build<strong>in</strong>g. In:<br />
The Formation of Nation States <strong>in</strong><br />
Western Europe. Hrsg. v. Ch. Tilly.<br />
Pr<strong>in</strong>ceton 1975, 562–600.<br />
Romsics, Ignac: Edvard Benes= and the<br />
Czechoslovak-Hungarian border. In:<br />
The New Hungarian Quarterly (new<br />
title: The Hungarian Quarterly) 33<br />
(1992), 94–106.<br />
Rónai, André: Biographie des frontières<br />
politiques du Centre-Est-Européen.<br />
Etude politico-géographique consacrée<br />
à l’histoire des Frontières. Budapest<br />
1936.<br />
Rothenberg, Gunther Erich: The Austrian<br />
Military Border <strong>in</strong> Croatia,<br />
1522–1747. Urbana 1960 (= Ill<strong>in</strong>ois<br />
studies <strong>in</strong> the social sciences. 48).<br />
Rothenberg, Gunther Erich: The Military<br />
Border <strong>in</strong> Croatia 1740–1881. A<br />
Study of an Imperial <strong>Institut</strong>ion.<br />
Chicago, London 1966.<br />
Rothfels, Hans: Frontiers and Mass Migrations<br />
<strong>in</strong> Eastern Central Europe.<br />
In: The Review of Politics 8 (1946),<br />
37 ff.<br />
Rothfels, Hans: Nationalität <strong>und</strong> Grenze<br />
<strong>im</strong> späten <strong>19.</strong> <strong>und</strong> frühen <strong>20</strong>. Jahr-
h<strong>und</strong>ert. In: Vierteljahrshefte für<br />
Zeitgeschichte 9 (1961), 225–233.<br />
Rumley, Denis u. Julian V. M<strong>in</strong>ghi: The<br />
Geography of Border Landscapes.<br />
London, New York 1988. 2. Aufl.<br />
London 1991.<br />
Rusticus: The Anthropologist’s Approach:<br />
A Note on Bo<strong>und</strong>aries and<br />
Frontiers. In: Sociological Review<br />
11 (1919), 46.<br />
Sahl<strong>in</strong>s, Peter: Bo<strong>und</strong>aries: The Mak<strong>in</strong>g<br />
of France and Spa<strong>in</strong> <strong>in</strong> the Pyrenees.<br />
Berkeley 1989.<br />
Sahl<strong>in</strong>s, Peter: Natural Frontiers Revisited:<br />
France’s Bo<strong>und</strong>aries s<strong>in</strong>ce the<br />
Seventeenth Century. In: American<br />
Historical Review 95 (1990), 1423–<br />
1451.<br />
Sa<strong>in</strong>t Germa<strong>in</strong> 19<strong>19.</strong> Hrsg. v. Isabella<br />
Ackerl <strong>und</strong> Rudolf Neck. Wien<br />
1989. (= Veröffentlichungen. Wissenschaftliche<br />
Kommission zur Erforschung<br />
der Geschichte der Republik<br />
Österreich. Bd. 7).<br />
Sandow, Erich: Die polnischpommerellische<br />
Grenze 1309–1454.<br />
Kitz<strong>in</strong>gen-Ma<strong>in</strong> 1954 (= Beihefte<br />
zum Jahrbuch der Albertus-<br />
Universität Königsberg / Preussen.<br />
6).<br />
Sangu<strong>in</strong>, André-Louis: Géographie<br />
politique: Bibliographie <strong>in</strong>ternationale.<br />
Montreal 1976.<br />
Sarkar, Benoy Kumar [V<strong>in</strong>aya-<br />
Kumara]: The Politics of Bo<strong>und</strong>aries<br />
and Tendencies <strong>in</strong> International Relations.<br />
Calcutta 1926.<br />
Saurer, Edith: Straße, Schmuggel, Lottospiel.<br />
Materielle Kultur <strong>und</strong> Staat<br />
<strong>in</strong> Niederösterreich, Böhmen <strong>und</strong><br />
Lombardo-Venetien <strong>im</strong> frühen <strong>19.</strong><br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Gött<strong>in</strong>gen 1989.<br />
Saurer, Edith: Zwischen dichter <strong>und</strong><br />
grüner Grenze. Grenzkontrolle <strong>in</strong><br />
der vormärzlichen Habsburgermonarchie.<br />
In: Grenzöffnung, Migration,<br />
Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alität. Hrsg. v. Arno Pilgram.<br />
Wien 1993, 169–177 (= Jahrbuch f.<br />
Rechts- <strong>und</strong> Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alsoziologie).<br />
Schacht, Horand Horsa: Unser Grenz-<br />
<strong>und</strong> Auslandsdeutschtum. München<br />
1931 (= Nationalsozialistische Bibliothek.<br />
23).<br />
Schäfer, Dietrich: Die <strong>Grenzen</strong><br />
deutschen Volkstums. Berl<strong>in</strong> o.J.<br />
(1918/ 19).<br />
Schamp, Eike W.: Die Bildung neuer<br />
grenzüberschreitender Regionen <strong>im</strong><br />
östlichen Mitteleuropa. In: Frankfurter<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> sozialgeographische<br />
Schriften. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong>, H. 67 (1995), 1–18.<br />
Schich, W<strong>in</strong>fried: Die “Grenze” <strong>im</strong><br />
östlichen Mitteleuropa <strong>im</strong> hohen<br />
Mittelalter. In: Siedlungsforschung 9<br />
(1991), 135–146.<br />
Schles<strong>in</strong>ger, Walter: Entstehung <strong>und</strong><br />
Bedeutung der sächsischböhmischen<br />
Grenze. In: Neues Archiv<br />
für sächsische Geschichte <strong>und</strong><br />
Altertumsk<strong>und</strong>e 59 (1938), 6–38.<br />
Schmid, Kar<strong>in</strong>: Das Grenzgesetz der<br />
DDR. Köln 1983 (= Berichte des<br />
B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stituts für Ostwissenschaftliche<br />
<strong>und</strong> Internationale<br />
Studien, 1983. Nr. 37).<br />
Schmidt, Christoph: Über die Grenze<br />
zwischen Estland <strong>und</strong> Livland <strong>und</strong><br />
ihre Bedeutung für die Agrar- <strong>und</strong><br />
Religionsgeschichte. In: Zeitschrift<br />
für Ostforschung 40 (1991), 500–<br />
521.<br />
Schmidt-Rösler, Andrea: Rumänien nach<br />
dem Ersten Weltkrieg. Die Grenzziehung<br />
<strong>in</strong> der Dobrudscha <strong>und</strong> <strong>im</strong><br />
Banat <strong>und</strong> die Folgeprobleme.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1994<br />
279
(= Europäische Hochschulschriften<br />
03, 622).<br />
Schmitz, Hans Jakob: Grenzmark <strong>und</strong><br />
Ostraum <strong>im</strong> Wandel der Geschichte.<br />
Schneidemühl 1938.<br />
Schnabel, Franz: Staatsgrenzen <strong>und</strong><br />
Volksgrenzen. E<strong>in</strong> Beitrag zur modernen<br />
Geistesgeschichte. In:<br />
Hochland 37 (1939/40).<br />
Schneider, Hans: Staatsgrenzen. In:<br />
Wörterbuch des Völkerrechts. Hrsg.<br />
v. Strupp-Schlochauer. Bd. 3, Berl<strong>in</strong><br />
1962, 332-334.<br />
Schneider, Karl: Über die Entwicklung<br />
des Kartenbildes von Böhmen. E<strong>in</strong><br />
Beitrag zur Geschichte der<br />
Geographie dieses Landes. In: Mitteilungen<br />
des Vere<strong>in</strong>s für Geschichte<br />
der Deutschen <strong>in</strong> Böhmen (1907),<br />
321–368.<br />
Schofield, Clive: Borderl<strong>in</strong>e cases.<br />
In: Geographical Magaz<strong>in</strong>e (1992),<br />
June, 30–33.<br />
Schofield, Richard N.: Man-made l<strong>in</strong>es<br />
that divide the world. Carl Gr<strong>und</strong>y-<br />
Warr. In: Geographical Magaz<strong>in</strong>e<br />
(1990), June, 10–15.<br />
Schreuer, Christoph: Status prawny polski<br />
granicy zachodniej [Der juristische<br />
Status der polnischen Westgrenze].<br />
In: Przeglaçd zachodni 47<br />
(1991), 111–128.<br />
Schröter, Bernd: Bemerkungen zu e<strong>in</strong>er<br />
Historiographie der Grenze. In:<br />
Jahrbuch für Geschichte von Staat,<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
Late<strong>in</strong>amerikas 31 (1994), 329–360.<br />
Schroubek, Georg R.: Die künstliche<br />
Region: Beispiel “Sudetenland”. In:<br />
Regionale Kulturanalyse. Protokollmanuskript<br />
e<strong>in</strong>er wissenschaftlichen<br />
Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft<br />
für Volksk<strong>und</strong>e vom 8.–11.<br />
Oktober 1978 <strong>in</strong> München. Hrsg.<br />
280<br />
von Helge Berndt <strong>und</strong> Georg R.<br />
Schroubek. München 1979, 25–29.<br />
Schugg-Reheis, Claudia u. Michael<br />
Bahr: <strong>Grenzen</strong>los. Thür<strong>in</strong>ger <strong>und</strong><br />
Franken schreiben über 45 Jahre<br />
Grenzdase<strong>in</strong>. Coburg 1991.<br />
Schulte, Aloys: Der Deutsche Staat.<br />
Verfassung, Macht <strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong>.<br />
Stuttgart, Berl<strong>in</strong> 1933.<br />
Schultke, Dietmar: Das Grenzreg<strong>im</strong>e<br />
der DDR. Innenansichten der siebziger<br />
<strong>und</strong> achtziger Jahre. In: Aus<br />
Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte 50 (1997),<br />
43–53.<br />
Schultke, Dietmar: Ke<strong>in</strong>er kommt<br />
durch... Die Geschichte der <strong>in</strong>nerdeutschen<br />
Grenze 1945–1990. Berl<strong>in</strong><br />
1999 (= Aufbau Taschenbuch. 8041).<br />
Schultz, Hans-Dietrich: “Deutschland?<br />
Aber wo liegt es?” Zum Naturalismus<br />
<strong>im</strong> Weltbild der deutschen Nationalbewegung<br />
<strong>und</strong> der klassischen<br />
deutschen Geographie. In: Deutschland<br />
<strong>und</strong> Europa. Historische, politische<br />
<strong>und</strong> geographische Aspekte.<br />
Festschrift zum 51. Geographentag<br />
Bonn 1997: “Europa <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Welt<br />
<strong>im</strong> Wandel”. Hrsg. von Eckart<br />
Ehlers. Bonn 1997, 85–104.<br />
Schultz, Hans-Dietrich: Deutschlands<br />
“natürliche” <strong>Grenzen</strong>. “Mittellage”<br />
<strong>und</strong> “Mitteleuropa” <strong>in</strong> der Diskussion<br />
der Geographen seit dem Beg<strong>in</strong>n<br />
des <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>erts. In:<br />
Geschichte <strong>und</strong> Gesellschaft 15<br />
(1989), 248–281.<br />
Schultz, Hans-Dietrich: Deutschlands<br />
“natürliche” <strong>Grenzen</strong>. In: Deutschlands<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Geschichte.<br />
München 1990, 33–88.<br />
Schultz, Hans-Dietrich: Pax<br />
geographica. Räumliche Konzepte<br />
für Krieg <strong>und</strong> Frieden <strong>in</strong> der<br />
geographischen Tradition. In:
Geographische Zeitschrift 75 (1987),<br />
1–22.<br />
Schultz, Helga u. Alan Nothnagle:<br />
Grenze der Hoffnung. Geschichte<br />
<strong>und</strong> Perspektiven der Grenzregion an<br />
der Oder. Potsdam 1996<br />
(= Frankfurter Studien zur Grenzregion.<br />
1).<br />
Schultze-Pfaelzer, Gerhard: Die große<br />
Grenze. Streifzüge am Rande Europas.<br />
Berl<strong>in</strong> 1937.<br />
Schulz, J<strong>in</strong>dřich: Hranic=ní spory mezi<br />
C+echami a Moravou od konce 15. do<br />
1. c=tvrt<strong>in</strong>y 17. století [Grenzstreitigkeiten<br />
zwischen Böhmen <strong>und</strong><br />
Mähren vom Ende des 15. bis zum 1.<br />
Viertel des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts]. In:<br />
Acta Universitatis Palackianae<br />
Olomucensis. Fac. philosophica –<br />
Historica 15 (1971), 45–73.<br />
Schulz, J<strong>in</strong>dřich: Vy;voj c=eskomoravské<br />
hranice do 15. století [Die Entwicklung<br />
der böhmisch-mährischen<br />
Grenze bis zum 15. Jh.]. In: Historická<br />
geografie 4 (1970), 52–81.<br />
Schwab, Oliver: Euroregionen an der<br />
deutsch-polnischen Grenze – gefangen<br />
<strong>im</strong> Politik- <strong>und</strong> Verwaltungsnetz?<br />
In: Raumforschung <strong>und</strong> Raumordnung<br />
Nr. 1 (1997), 4–14.<br />
Schwarzer, Oskar u. Markus A. Denzel:<br />
Wirtschaftsräume <strong>und</strong> die Entstehung<br />
von <strong>Grenzen</strong>. Versuch e<strong>in</strong>es<br />
historisch-systematischen Ansatzes.<br />
In: SOWI. Sozialwissenschaftliche<br />
Informationen. Stuttgart <strong>20</strong> (1991),<br />
Nr. 3, 172–178.<br />
Scott, James u.a.: Wo arm <strong>und</strong> reich<br />
aufe<strong>in</strong>ander prallen. Deutschpolnische<br />
<strong>und</strong> amerikanischmexikanische<br />
Grenze <strong>im</strong> Vergleich.<br />
In: Geographie heute 121 (1994),<br />
34–39.<br />
Sedla;ce=k, August: O ustálení hranice<br />
mezi C+echami a Luz=ici [Über die<br />
Verfestigung der Grenze zwischen<br />
Böhmen <strong>und</strong> der Lausitz]. In:<br />
C+asopis C+eského Musea 66 (1892),<br />
238–252.<br />
Sedláce=k, August: Jak se me=nily a<br />
ustálily meze C+ech a Rakous Dolních<br />
[Wie sich die <strong>Grenzen</strong> zwischen<br />
Böhmen <strong>und</strong> Niederösterreich<br />
verändert <strong>und</strong> gefestigt haben].<br />
Ta;bor 1877.<br />
Sedlmeyer, Karl A.: Die Festung Böhmen,<br />
e<strong>in</strong> Phantom <strong>und</strong> ihre Beziehungen<br />
zu den Sudetenländern. In:<br />
Bohemia-Jahrbuch 2 (1961), 287–<br />
296.<br />
Sedlmeyer, Karl A.: Historische<br />
Kartenwerke Böhmens. In: Petermanns<br />
Geographische Mitteilungen<br />
88 (1942), 469–471.<br />
Sella, Amnon: The USSR’s <strong>in</strong>terests<br />
along its southern borders and beyond.<br />
College Station, Texas. Center<br />
for Strategic Technology, Texas Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
Exper<strong>im</strong>ent Station, Texas<br />
(Occasional papers series. 13).<br />
Semotanová, Eva: Thematische Kartographie<br />
<strong>in</strong> den böhmischen Ländern<br />
<strong>im</strong> <strong>19.</strong> Jahrh<strong>und</strong>ert. In: Prager<br />
wirtschafts- <strong>und</strong> sozialhistorische<br />
Mitteilungen 3 (1996), 37–49.<br />
Sett<strong>in</strong>g Bo<strong>und</strong>aries: The Anthropology<br />
of Spatial and Social Organization.<br />
Hrsg. v. Deborah Pellow. Westport,<br />
Conn. 1996.<br />
Sevr<strong>in</strong>, Robert: Les échanges de population<br />
à la frontière entre la France et<br />
la Tournaisis. In: Annales de<br />
Géographie 58 (1949), 237–244.<br />
Shalowitz, Aaron Louis: Shore and Sea<br />
Bo<strong>und</strong>aries, with special reference to<br />
the <strong>in</strong>terpretation and use of Coast<br />
281
and Geodetic Survey data. 2 vols.<br />
Wash<strong>in</strong>gton 1962–64.<br />
Shared space. Divided space. Essays on<br />
conflict and territorial organization.<br />
Hrsg. v. Michael Chisholm. London<br />
u.a. 1990.<br />
Shehadi, Kamal S.: Ethnic selfdeterm<strong>in</strong>ation<br />
and the break-up of<br />
states: the power of ethnic separatism<br />
and <strong>in</strong>ternational responses to<br />
creat<strong>in</strong>g new states, redraw<strong>in</strong>g <strong>in</strong>ternational<br />
borders and salvag<strong>in</strong>g failed<br />
states. London 1993.<br />
Sieger, Robert: Die geographische Lehre<br />
von den <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> ihre praktische<br />
Bedeutung. In: Wissenschaftliche<br />
Abhandlungen des 21. deutschen<br />
Geographentags zu Breslau 1925.<br />
Berl<strong>in</strong> 1926, 197–211<br />
(= Verhandlungen des Deutschen<br />
Geographentages. 21).<br />
Sieger, Robert: Die Grenze <strong>in</strong> der politischen<br />
Geographie. In: Zeitschrift<br />
für Geopolitik 2 (1925), 661–671.<br />
Sievers, Wilhelm: Die geographischen<br />
<strong>Grenzen</strong> Mitteleuropas. Giessen<br />
1916.<br />
S<strong>im</strong>merd<strong>in</strong>g, Franz X.: Grenzzeichen,<br />
Grenzste<strong>in</strong>setzer <strong>und</strong> Grenzfrevler.<br />
E<strong>in</strong> Beitrag zur Kultur-, Rechts- <strong>und</strong><br />
Sozialgeschichte. München (1997).<br />
S<strong>im</strong>mler, Christiane: Das uti possidetis-<br />
Pr<strong>in</strong>zip. Zur Grenzziehung zwischen<br />
neu entstandenen Staaten. Berl<strong>in</strong><br />
1999 (= Schriften zum Völkerrecht.<br />
134).<br />
S<strong>im</strong>ply – the history of borders. In:<br />
New Internationalist (1991), Sept.,<br />
24f.<br />
S<strong>im</strong>pson, George: Frontier banditry and<br />
the colonial decision-mak<strong>in</strong>g process:<br />
the East Africa protectorate’s<br />
northern borderland prior to the First<br />
282<br />
World War. In: The International<br />
Journal of African Historical Studies<br />
29 (1996), Nr. 2, 279–309.<br />
S<strong>in</strong>gbartl, Hartmut: Die Durchführung<br />
der deutsch-tschechoslowakischen<br />
Grenzregelungen von 1938 <strong>in</strong> völkerrechtlicher<br />
<strong>und</strong> staatsrechtlicher<br />
Sicht. München 1971 (= Veröffentlichungen<br />
des Sudetendeutschen<br />
Archivs. 5).<br />
S<strong>in</strong>nhuber, Karl A.: The representation<br />
of disputed political bo<strong>und</strong>aries <strong>in</strong><br />
Sykes. In: Cartographic Journal 1<br />
(1964), <strong>20</strong>–28.<br />
Sitte, Wolfgang: Innen offen, außen zu.<br />
B<strong>in</strong>nen- <strong>und</strong> Außengrenze der EU<br />
am Beispiel Österreichs. In: Praxis<br />
Geographie 10 (1997), <strong>20</strong>–26.<br />
Skála, Emil: Die Entwicklung der<br />
Sprachgrenze <strong>in</strong> Böhmen von 1300<br />
bis etwa nach 1650 / Vývoj jazykové<br />
hranice v C+echách od roku 1330<br />
zhruba do roku 1650. In: Acta Universitatis<br />
Carol<strong>in</strong>ae – Philologica 5,<br />
Germanistica Pragensia 5 (1968), 7–<br />
15.<br />
Skubiszewski, Krzysztof: Zachodnia<br />
granica Polski [Die Westgrenze Polens].<br />
Gdan;sk 1969.<br />
Skubiszewski, Krzysztof: Zachodnia<br />
granica Polski w s;wietle traktatów<br />
[Die Westgrenze Polens <strong>im</strong> Lichte<br />
der Verträge]. Poznan; 1975.<br />
Slapnicka, Harry: Grenze <strong>und</strong><br />
Grenzraum. Zur Geschichte der<br />
Staats-, Landes-, Sprach- <strong>und</strong> Diözesangrenzen<br />
zwischen Österreich <strong>und</strong><br />
Böhmen. In: Mitteilungen des<br />
oberösterreichischen Landesarchivs,<br />
Band 17. L<strong>in</strong>z 1993, <strong>20</strong>5–224.<br />
Slapnicka, Helmut: Die neue Verwaltungsgliederung<br />
der Tschechoslowakei<br />
<strong>und</strong> ihre Vorläufer. In: Der<br />
Donauraum 5 (1960), 139–158.
Slataper, Scipio: Conf<strong>in</strong>i orientali. Trieste<br />
1986. (= Zibaldone. 1,1).<br />
Slezák, Lubomír: Die landwirtschaftliche<br />
Besiedlung des<br />
Grenzgebietes der böhmischen<br />
Länder nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg. In: Bohemia 23 (1983),<br />
165–225.<br />
Slowe, Peter M.: The geography of borderlands:<br />
the case of the Quebec-US<br />
borderlands. In: Geographical Journal<br />
157 (1991), July, 191–198.<br />
Sluga, Glenda: Trieste: ethnicity and the<br />
Cold War, 1945–54. In: Journal of<br />
Contemporary History 29 (2) (1994),<br />
285–303.<br />
Slusarczyk, Jacek: Granice Polski w tysiaçcleciu:<br />
(X–XX wiek) [Die Grenze<br />
Polens <strong>im</strong> Jahrtausend (10.–<strong>20</strong>. Jh.)].<br />
Wyd. 1. Torun; 1992.<br />
Slusarczyk, Jacek: Granice Polski w XX<br />
wieku: koncepcje, realizacja, zagrozæenia<br />
[Die <strong>Grenzen</strong> Polens <strong>im</strong> <strong>20</strong>.<br />
Jh.: Konzeptionen, Verwirklichung,<br />
Bedrohungen]. Torun; 1994.<br />
Slusarczyk, Jacek: Obszar i granice Polski<br />
(od X do XX wieku) [Gebiet <strong>und</strong><br />
<strong>Grenzen</strong> Polens (vom 10. bis zum<br />
<strong>20</strong>. Jh.)]. Torun; 1995.<br />
Sobczyn;ski, Marek: Trwa—os;c; dawnych<br />
granic pan;stwowych w krajobrazie<br />
kulturowym Polski = Stability of the<br />
old political bo<strong>und</strong>aries <strong>in</strong> the cultural<br />
landscape of Poland. Warszawa<br />
1993 (= Zeszyty Instytutu Geografii<br />
i Przestrzennego Zagospodarowania<br />
PAN. 14).<br />
Sölch, Johann: Die Auffassung der<br />
“natürlichen <strong>Grenzen</strong>” <strong>in</strong> der wissenschaftlichen<br />
Geographie. Innsbruck<br />
1924.<br />
Sopicki, Stanis¬aw: Eastern Poland.<br />
Chicago 1965.<br />
Sperl<strong>in</strong>g, Walter: Die deutsche Ostgrenze<br />
sowie polnische West- <strong>und</strong><br />
Nordgrenze <strong>in</strong> deutschen Schulatlanten<br />
seit 1946. Mit e<strong>in</strong>er Dokumentation.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong> 1991<br />
(= Studien zur <strong>in</strong>ternationalen<br />
Schulbuchforschung. 69).<br />
Sperl<strong>in</strong>g, Walter: Tschechoslowakei.<br />
Beiträge zur Landesk<strong>und</strong>e <strong>Ostmitteleuropa</strong>s.<br />
Stuttgart 1981.<br />
Spevack, Edm<strong>und</strong>: Borderland Nationalism,<br />
Westward Migration, and Anti-<br />
Polish Agression: The Case of<br />
the Grenzmark Posen-Westpreussen<br />
1919–1939. In: East European Quarterly<br />
30 (1996), 301–330.<br />
Spörl, Friedrich: Liberaler Nationalismus<br />
oder weiche <strong>Grenzen</strong>. Ethnizität<br />
<strong>und</strong> Territorialität auf dem Bal-<br />
kan am Beispiel Makedoniens. In:<br />
Geographie heute, Nr. 127 (1995),<br />
18–21.<br />
Spörl, Friedrich: Schaß de gockel usm<br />
jard<strong>in</strong>... Über Grenzveränderungen<br />
<strong>im</strong> lothr<strong>in</strong>gischen Raum (Sek<strong>und</strong>arstufe<br />
I). In: Geographie heute, Nr.<br />
73 (1989), 16 ff.<br />
Spojující a rozde=lující na hranici – Verb<strong>in</strong>dendes<br />
<strong>und</strong> Trennendes an der<br />
Grenze. C+eské Bude=jovice 1992<br />
(= Opera historica, 2, Editio Bohemiae<br />
Meridonalis).<br />
Sprachenpolitik <strong>in</strong> Grenzregionen /<br />
Politique l<strong>in</strong>guistique dans les<br />
re;gions frontalières / Language Policy<br />
<strong>in</strong> Border Regions / Polityka<br />
jeçzykowa na pograniczach. Hrsg. v.<br />
Roland Marti. Saarbrücken 1996<br />
(= Veröf-fentlichungen der Kommission<br />
für Saarländische Landesgeschichte<br />
<strong>und</strong> Volksforschung. 29).<br />
Spuler, Berthold: Mittelalterliche <strong>Grenzen</strong><br />
<strong>in</strong> Osteuropa. I. [mehr nicht<br />
ersch.] In: Jahrbücher für<br />
283
Geschichte Osteuropas 6 (1941),<br />
151–170.<br />
Sp<strong>und</strong>a, Johanna: Die verlorenen Inseln.<br />
E<strong>in</strong> Beitrag zur Erforschung der nationalen<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung <strong>und</strong><br />
Umvolkung. In: Bohemia-Jahrbuch<br />
2 (1961), 357–413.<br />
Srb, Vlad<strong>im</strong>i;r: U:zemí a obyvatelstvo<br />
C+eskoslovenské republiky [Gebiet<br />
<strong>und</strong> Bevölkerung der C+SR]. In:<br />
C+eskoslovenství, str=edevropanství,<br />
evropanství 1918–1998. Úvahy,<br />
sve=dectví a fakta. Brno 1998, 458–<br />
470.<br />
Staats- <strong>und</strong> Verwaltungsgrenzen <strong>in</strong><br />
<strong>Ostmitteleuropa</strong>. Histor. Kartenwerk,<br />
z. B. T. 3: Pommern. Hrsg. v. Franz<br />
Engel. München 1955.<br />
Stadt an der Grenze. Hrsg. v. Bernhard<br />
Kirchgässner u. Walter O. Keller.<br />
Sigmar<strong>in</strong>gen 1990.<br />
Stark, Joach<strong>im</strong>: Sprache als ethnische<br />
Grenze. In: Aspekte ethnischer Identität.<br />
Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
“Deutsche <strong>und</strong> Magyaren als<br />
nationale M<strong>in</strong>derheit <strong>im</strong> Donauraum”.<br />
Hrsg. von Edgar Hösch <strong>und</strong><br />
Gerhard Seewann. München 1991,<br />
35–67.<br />
Staszczak, Zofia: Pogranicze polskoniemieckie<br />
jako pogranicze etnograficzne<br />
[Das polnisch-deutsche<br />
Grenzgebiet als ethnographisches<br />
Grenzgebiet]. Poznan; 1978.<br />
Staszewski, Jacek: Na granicy z Prusami<br />
Ksiaçzæecymi [An d. Grenze zum<br />
Herzogtum Preußen]. In: Komunikaty<br />
mazursko-warm<strong>in</strong>;skie (1994),<br />
219–227.<br />
Steege, Helmut: Er<strong>in</strong>nerungen aus dem<br />
Spannungsbereich zweier Nationen.<br />
Erlebnisse <strong>im</strong> deutsch-polnischen<br />
Grenzgebiet 19<strong>20</strong>-1940. Lüneburg<br />
284<br />
1990 (= Lüneburger Ostdeutsche<br />
Dokumente. 12).<br />
Stökl, Günther: Die deutsch-slawische<br />
Südostgrenze des Reiches <strong>im</strong> 16.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. Breslau 1940.<br />
Stone, Kirk H.: World frontiers of settlement.<br />
In: GeoJournal 3 (1979),<br />
539–554.<br />
Strassoldo, Ra<strong>im</strong>ondo: Bo<strong>und</strong>aries and<br />
Regions. Explorations <strong>in</strong> the Growth<br />
and Peace Potential of the Peripheries.<br />
Trieste 1973.<br />
Strassoldo, Ra<strong>im</strong>ondo: From Barrier to<br />
Junction: Towards a Sociological<br />
Theory of Borders. Gorizia 1970.<br />
Strupp, Michael: Ch<strong>in</strong>as <strong>Grenzen</strong> mit<br />
Birma <strong>und</strong> mit der Sowjetunion.<br />
Völkerrechtliche Theorie <strong>und</strong> Praxis<br />
der Volksrepublik Ch<strong>in</strong>a. 2. Aufl.<br />
1987 (= Mitteilungen des <strong>Institut</strong>s<br />
für Asienk<strong>und</strong>e Hamburg. 155).<br />
Stryjakiewicz, T.: Die Voraussetzungen<br />
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit<br />
<strong>in</strong> der Euroregion<br />
Viadr<strong>in</strong>a aus polnischer Sicht. In:<br />
Frankfurter wirtschafts- <strong>und</strong> sozialgeographische<br />
Schriften. Frankfurt<br />
am Ma<strong>in</strong>, H. 67 (1995), 51–54.<br />
Studien zur territorialen Gliederung<br />
Deutschlands <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Hannover 1971<br />
(= Historische Raumforschung 9.<br />
Veröffentlichungen der Akademie<br />
für Raumforschung <strong>und</strong> Landesplanung).<br />
Study<strong>in</strong>g Bo<strong>und</strong>ary Conflicts. A theoretical<br />
framework. Hrsg. v. Sven<br />
Tägil u.a. L<strong>und</strong> 1977 (= L<strong>und</strong> Studies<br />
<strong>in</strong> International History. 9).<br />
Suette, Hugo: Der nationale Kampf <strong>in</strong><br />
der Südsteiermark 1867–1897.<br />
München 1936, zugl. Erlanger phil.<br />
Diss. (= Veröffentlichungen des <strong>Institut</strong>s<br />
zur Erforschung des
Deutschen Volkstums <strong>im</strong> Südosten<br />
[...]. 12).<br />
Su¬ek, Jerzy: Stanowisko rzaçdni NRF<br />
wobec granicy na Odrze i Nysie<br />
Òuzæyckiej [Regierungsstandpunkt<br />
der BRD bezüglich der Grenze an<br />
Oder <strong>und</strong> Lausitzer Neiße], 1949–<br />
1966. Poznan; 1969.<br />
Su¬owski, Zygmunt: Najstarsza granica<br />
zachodnia Polski [Die älteste Westgrenze<br />
Polens]. In: Przeglaçd<br />
Zachodni 8 (1952), H. 3–4, 343–483.<br />
Su¬owski, Zygmunt: Ujeçcie kartograficzne<br />
granic zachodnich Polski przedrozbiorowej<br />
[Die kartographische<br />
Erfassung der Westgrenzen Polens<br />
vor der Teilung]. In: Roczniki Historyczne<br />
23 (1957), 99–136.<br />
Suppan, Arnold: Ethnisches, ökonomisches<br />
oder strategisches Pr<strong>in</strong>zip?<br />
Zu den jugoslawischen Grenzziehungsvorschlägen<br />
gegenüber<br />
Österreich <strong>im</strong> Herbst <strong>und</strong> W<strong>in</strong>ter<br />
1918/<strong>19.</strong> In: Sa<strong>in</strong>t Germa<strong>in</strong> 1919<br />
(s.o.), 111–179.<br />
Swift, Richard: The jealous state. In:<br />
New Internationalist (Sept. 1991),<br />
11–13.<br />
Szaz, Zoltan Michael: Germany’s Eastern<br />
Frontiers. The Problem of the<br />
Oder-Neisse L<strong>in</strong>e. Chicago 1960;<br />
Deutsch: Die deutsche Ostgrenze.<br />
Geschichte <strong>und</strong> Gegenwart.<br />
Essl<strong>in</strong>gen o.J.<br />
Szücs, Jenö: Die drei historischen Regionen<br />
Europas. Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
1990.<br />
S+ípek, Zdene=k: Mnichovská dohoda a<br />
“spory” o c=eskoslovensko-rakouské<br />
státní hranici [Das Münchener Abkommen<br />
<strong>und</strong> die Streitigkeiten über<br />
die tschechoslowakischösterreichische<br />
Staatsgrenze]. In:<br />
Sborník pedagogické fakulty Uni-<br />
verzity Karlovy – Historie 1 (1966),<br />
113–171.<br />
S+ípek, Zdene=k: Spory C+eskoslovenska s<br />
Rakouskem o vedení státních hranic<br />
na Jiz=ní Morave= v letech 1918–1923<br />
[Die Streitigkeiten zwischen der<br />
Tschechoslowakei <strong>und</strong> Österreich<br />
um die Ziehung der Staatsgrenzen <strong>in</strong><br />
Südmähren <strong>in</strong> den Jahren 1918–<br />
1923]. Mikulov 1968.<br />
S+ípek, Zdene=k: Spory C+SR s<br />
Rakouskem o vedení státní hranice v<br />
jiz=ních C+echách po první sve=tové<br />
válce<br />
[Die Streitigkeiten zwischen der<br />
C+SR <strong>und</strong> Österreich um die Ziehung<br />
der Staatsgrenze <strong>in</strong> Südböhmen nach<br />
dem Ersten Weltkrieg]. In: Jihoc=eský<br />
sborník historický 35<br />
(1966), 33–40.<br />
Taganyi: Alte Grenzschutzvorrichtungen<br />
<strong>und</strong> Grenzödländer. In: Ungarische<br />
Jahrbücher. Berl<strong>in</strong> 1921,<br />
105 ff.<br />
Tanja, Gerard J.: The Legal Determ<strong>in</strong>ation<br />
of International Marit<strong>im</strong>e<br />
Bo<strong>und</strong>aries. 1990.<br />
Taschenbuch des Grenz- <strong>und</strong> Auslandsdeutschtums.<br />
Berl<strong>in</strong> 1925–1935.<br />
[Mehrere Hefte <strong>in</strong> 4 Schubern].<br />
Taylor, George Rogers: The Turner thesis<br />
concern<strong>in</strong>g the role of the frontier<br />
<strong>in</strong> American history. Boston 1956.<br />
Teichová, Alice: Kle<strong>in</strong>staaten <strong>im</strong> Spannungsfeld<br />
der Großmächte.<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Politik <strong>in</strong> Mittel- <strong>und</strong><br />
Südosteuropa <strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit.<br />
München 1988.<br />
Terry, Sarah Meiklejohn: Poland’s Place<br />
<strong>in</strong> Europe. General Sikorski and<br />
the Orig<strong>in</strong> of the Oder-Neisse l<strong>in</strong>e,<br />
1939–1943. Pr<strong>in</strong>ceton 1983.<br />
285
Thalhe<strong>im</strong>, Karl C.: Das Grenz-<br />
deutschtum. Berl<strong>in</strong> 1931<br />
(= Sammlung Göschen. 1026).<br />
Thalmann, Hanny: Gr<strong>und</strong>pr<strong>in</strong>zipien des<br />
modernen zwischenstaatlichen Nachbarrechts.<br />
Zürich 1951 (= Zürcher<br />
Studien zum <strong>in</strong>ternationalen Recht.<br />
19).<br />
The Frontier. Comparative Studies.<br />
Hrsg. v. William W. Savage u.<br />
Stephen I. Thompson. Norman/Oklahoma<br />
1979.<br />
Theory and Strategy of Border Areas<br />
Development. Hrsg. v. R. Ratti u. S.<br />
Reichmann. 1993.<br />
Thompson, V<strong>in</strong>cent: The Phenomenon<br />
of Shift<strong>in</strong>g Frontiers: The Kenya-<br />
Somalia case <strong>in</strong> the horn of Africa,<br />
1880s–1970s. In: Journal of Asian<br />
and African Studies 30, Nr. 1–2<br />
(1995), 1–40.<br />
Tichy, G.: Das steirische Grenzland.<br />
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.<br />
Studie <strong>im</strong> Auftrag der Steiermärkischen<br />
Landesregierung. Graz<br />
1990.<br />
Tillich, Paul: Auf der Grenze. E<strong>in</strong>e<br />
Auswahl aus dem Lebenswerk.<br />
München, Zürich 1987, 13–68<br />
(= Serie Piper. 593).<br />
Tillich, Paul: <strong>Grenzen</strong>. Rede bei der<br />
Verleihung des Friedenspreises des<br />
Deutschen Buchhandels am 23. September<br />
1962 <strong>in</strong> der Paulskirche <strong>in</strong><br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong>. Stuttgart 1962.<br />
Tojanc=evic;, V.: Razgranic=enje i<br />
postavljenje drz=avne granice izmedju<br />
Srbiju i Grc=ke 1912/13 god<strong>in</strong>e [Die<br />
Abgrenzung <strong>und</strong> Feststellung der<br />
Staatsgrenze zwischen Serbien <strong>und</strong><br />
Griechenland <strong>in</strong> den Jahren 1912/<br />
13]. In: Glas. Classe des sciences<br />
historiques. Beograd, vol. 354, Nr. 6<br />
(1988), 59.<br />
286<br />
Touval, Saadia: The bo<strong>und</strong>ary politics<br />
of <strong>in</strong>dependent Africa. Cambridge,<br />
Mass. 1972.<br />
Toynbee, Arnold J.: Terrritorial arrangement.<br />
In: The Treaty of Versailles<br />
and after. Hrsg. v. Lord Riddell.<br />
London 1935, 70–93.<br />
Trampler, Kurt: Um Volksboden <strong>und</strong><br />
Grenze. Heidelberg, Berl<strong>in</strong> 1935<br />
(= Schriften zur Geopolitik. 9).<br />
Transcaucasian bo<strong>und</strong>aries. Hrsg. v.<br />
John F. R. Wright. New York 1996<br />
(= Geopolitics and International<br />
Bo<strong>und</strong>aries Research Centre :<br />
The SOAS/GRC geopolitics<br />
series. 4).<br />
Troillet, Bernard: Das Elsass – Grenzland<br />
<strong>in</strong> Europa. Köln 1997.<br />
Tromeja – Obmejna Regija Jugoslavije,<br />
Austrije <strong>in</strong> Italije. = Das Dreiländereck<br />
– e<strong>in</strong>e Grenzregion Österreichs,<br />
Italiens <strong>und</strong> Jugoslawiens. Hrsg. v.<br />
M. Pak. Ljubljana 1990 (= Dela. 7).<br />
Trosiak, Cezary: Proces formowania sið<br />
pogranicza polsko-niemieckiego w<br />
latach 1945-1993 [Gestaltungsprozeß<br />
des polnisch-deutschen Grenzgebietes<br />
<strong>in</strong> den Jahren 1945-1993].<br />
In: Przeglaçd zachodni, 39 (1993),<br />
81-103.<br />
Truyol y Serra, Antonio: Las fronteras y<br />
las marcas. In: Revista Española de<br />
Derecho Internatcional, 10 (1957),<br />
105 ff.<br />
Tuma, Renate: Das Problem der territorialen<br />
Integrität Österreichs 1945–<br />
1947. Unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Grenzproblematik mit<br />
Deutschland, der Tschechoslowakei<br />
<strong>und</strong> Ungarn. Univ. Diss. Wien 1989.<br />
Turner and the sociology of the frontier.<br />
Hrsg. v. Richard Hofstadter. New<br />
York 1968.
Turner, Frederick Jackson: The Frontier<br />
<strong>in</strong> American History. New York<br />
19<strong>20</strong> (Repr<strong>in</strong>t 1985). Dt. Ausg.: Die<br />
Grenze. Ihre Bedeutung <strong>in</strong> der<br />
amerikanischen Geschichte. Bremen-Horn<br />
1947.<br />
Twaroch, Christoph: Festung Europa?<br />
Von den <strong>in</strong>neren <strong>und</strong> äußeren <strong>Grenzen</strong><br />
1989–1994. In: Morgen. Kulturzeitschrift<br />
aus Niederösterreich Nr.<br />
98 (1994), 10–11.<br />
Tyranowski, Jerzy: State Succession.<br />
Bo<strong>und</strong>aries and Bo<strong>und</strong>ary Treaties.<br />
In: Polish Year Book of International<br />
Law (1979–80). Warsaw<br />
1981, 130–135.<br />
Tyranowski, Jerzy: Zasada nienaruszalnos;ci<br />
granic w prawie mieçdzynarodowym<br />
[Der Gr<strong>und</strong>satz der Unverletzlichkeit<br />
von <strong>Grenzen</strong> <strong>im</strong><br />
Völkerrecht]. Warszawa 1987<br />
(= Biblioteka spraw mieçdzynarodowych.<br />
118).<br />
Ucarol, Rifat: The border dispute between<br />
the Ottoman empire and<br />
Greece; rearrang<strong>in</strong>g the border accord<strong>in</strong>g<br />
to the Berl<strong>in</strong> treaty of 1878<br />
and giv<strong>in</strong>g land to Greece (1878–<br />
1881). In: Revue Internationale<br />
d’histoire militaire 67 (1988), 119 ff.<br />
Über natürliche Gränzen. In: Deutsche<br />
Blätter, Nr. 57 (Bd. 2, Stück 3) v.<br />
29.12.1813, 33-42.<br />
Ulbrich, Claudia: Die Bedeutung der<br />
<strong>Grenzen</strong> für die Rezeption der Französischen<br />
Revolution an der Saar.<br />
In: Aufklärung, Politisierung <strong>und</strong><br />
Revolution. Pfaffenweiler 1991, S.<br />
147–174.<br />
Ulbrich, Claudia: Rhe<strong>in</strong>grenze, Revolten<br />
<strong>und</strong> Französische Revolution. In:<br />
Die Französische Revolution <strong>und</strong><br />
die Oberrhe<strong>in</strong>lande. Hrsg. v. Volker<br />
Rödel. Sigmar<strong>in</strong>gen 1991, 223-244.<br />
Unmenschliche Grenze. Hannover 1956.<br />
Unsere Grenzprobleme. Mschr. Berl<strong>in</strong><br />
1937 (Übs. aus d. Slowenischen aus:<br />
Nas=i obmejni problemi).<br />
Uschakow, Alexander: Die Oder-Neiße-<br />
L<strong>in</strong>ie/Grenze <strong>und</strong> der Hitler-Stal<strong>in</strong>-<br />
Pakt. In: Die historische Wirkung<br />
der östlichen Regionen des Reiches.<br />
Köln 1992, 299–330.<br />
Valenta, Jaroslav: Die Teschener Frage<br />
<strong>in</strong> der Zwischenkriegszeit 1918–<br />
1939. In: Polen <strong>und</strong> die böhmischen<br />
Länder <strong>im</strong> <strong>19.</strong> <strong>und</strong> <strong>20</strong>. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Hrsg. v. Peter Heumos. München<br />
1997), 129–150 (= Bad Wiesseer<br />
Tagungen des Collegium Carol<strong>in</strong>um.<br />
17.<br />
Valenta, Jaroslav: Pr=ipojení Hluc=ínska k<br />
C+eskoslovenské republice [Die Angliederung<br />
des Hultsch<strong>in</strong>er Ländchens<br />
an die Tschechoslowakei]. In:<br />
Slezský Sborník 58 (1960), 1–18.<br />
Var=ec=ka, Josef: A Contemporary Understand<strong>in</strong>g<br />
of the National Question<br />
Accord<strong>in</strong>g to the Ethnographische<br />
Karte der Oesterreichischen Monarchie.<br />
Together with the Current<br />
Form of National Self-Identification<br />
<strong>in</strong> the Czech Lands. In: Samoidentyfikacja<br />
mniejszos;ci narodowych i religijnych<br />
w Europie s;rodkowowschodniej.<br />
Problematyka atlasowa.<br />
Red. Jan Skarbek. Lubl<strong>in</strong> 1998, 156–<br />
159 (= Materia¬y Instytutu Europy<br />
s;rodkowo-wschodniej).<br />
Visscher, Charles de: Problèmes de conf<strong>in</strong>s<br />
en droit <strong>in</strong>ternational public.<br />
Paris 1969.<br />
Vobruba, Georg: Bedeutungsverluste<br />
von Staatsgrenzen. In:<br />
Österreichische Zeitschrift für<br />
Politikwissenschaft, 22 (1993), 85–<br />
92.<br />
287
Vogel, Walther: Zur Lehre von den<br />
<strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Räumen. In:<br />
Geographische Zeitschrift 32 (1926),<br />
191–198.<br />
Vojna kraj<strong>in</strong>a. Povijesni pregled – historiografija<br />
– rasprave [Die Militärgrenze.<br />
Historischer Überblick –<br />
Historiographie – Abhandlungen].<br />
Hrsg. von Dragut<strong>in</strong> Pavlic=evic;. Zagreb<br />
1984.<br />
Volk an der Grenze. Hrsg. v. Norbert<br />
Langer. Jena 1938 (= Deutsche<br />
Reihe. 46).<br />
Volks- <strong>und</strong> Sprachenkarten Mitteleuropas.<br />
Teil III: Sudeten- <strong>und</strong> Karpatenländer.<br />
Die Tschechoslowakei<br />
<strong>in</strong> ihren <strong>Grenzen</strong> von 1918. Bearb. v.<br />
Doubek, F.A., Hugo Hass<strong>in</strong>ger u.a.<br />
In: Deutsches Archiv für Landes-<br />
<strong>und</strong> Volksforschung 2 (1938), 963–<br />
983.<br />
Volova, Larisa Ivanova: Nerus=<strong>im</strong>ost’<br />
granic – novyj pr<strong>in</strong>cip<br />
mez=dunarodnogo prava [Die Unverletzlichkeit<br />
der <strong>Grenzen</strong> als neues<br />
Völkerrechtspr<strong>in</strong>zip]. Rostov 1987.<br />
Volz, Wilhelm: Lebensraum <strong>und</strong> Lebensrecht<br />
des deutschen Volkes. In:<br />
Deutsche Arbeit 24 (1925), 169–174.<br />
Vom Grenzland zum Raum der Kooperation:<br />
e<strong>in</strong> Expertengespräch des<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Raumordnung,<br />
Bauwesen <strong>und</strong> Städtebau. Red.<br />
K. Weiberg. Gött<strong>in</strong>gen 1990.<br />
Von <strong>Grenzen</strong> <strong>und</strong> Ausgrenzen. Interdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Beiträge zu den Themen<br />
Migration, M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong><br />
Fremdenfe<strong>in</strong>dlichkeit. Hrsg. v. Barbara<br />
Dankwart u.a. Marburg 1998.<br />
Voskresenskij, Aleksej D.: The difficult<br />
border. Current Russian and Ch<strong>in</strong>ese<br />
concepts of S<strong>in</strong>o-Russian relations<br />
and frontier problems. Commack,<br />
NY 1996.<br />
288<br />
Vujakovic, Peter: Mapp<strong>in</strong>g Europe’s<br />
myths. In: Geographical Magaz<strong>in</strong>e<br />
(Sep. 1992), 15–17.<br />
Vyhna;ní C+echu` z pohranic=í 1938.<br />
Vzpomínky [Die Vertreibung der<br />
Tschechen aus dem Grenzgebiet<br />
1938. Er<strong>in</strong>nerungen]. Hrsg. v. Karel<br />
Zelený. Praha 1996.<br />
Wagner, Wolfgang: Die Entstehung der<br />
Oder-Neiße-L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> den diplomatischen<br />
Verhandlungen während des<br />
Zweiten Weltkrieges. 3. Aufl. Marburg<br />
1968.<br />
Waldhe<strong>im</strong>, Franz: Der E<strong>in</strong>satz von Polizei,<br />
B<strong>und</strong>esgrenzschutz <strong>und</strong> Zollbehörden<br />
<strong>in</strong> Niedersachsen: rechtliche<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Vergleich mit<br />
dem Recht der DDR. Diss. Gött<strong>in</strong>gen<br />
1987.<br />
Walter, Bernd: Europäischer Enthusiasmus<br />
(1992: Wegfall der Grenzkontrollen,<br />
Erschwerung der Verbrechensbekämpfung).<br />
In: Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alistik.<br />
Zeitschrift für die gesamte<br />
kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alistische Wissenschaft <strong>und</strong><br />
Praxis. Heidelberg, 43, Nr. 2 (1989),<br />
66.<br />
Walter, Bernd: Interpretationen <strong>und</strong><br />
Tatsachen. Staatsgrenze – Kontur<br />
oder L<strong>im</strong>es?. In: Kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alistik.<br />
Zeitschrift für die gesamte kr<strong>im</strong><strong>in</strong>alistische<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Praxis, 48,<br />
Nr. 1 (1994), 47–52.<br />
Wambaugh, Sarah: Plebiscites S<strong>in</strong>ce the<br />
World War. 2 Bde. New York 1933.<br />
Wambaugh, Sarah: The Doctr<strong>in</strong>e of<br />
Self-Determ<strong>in</strong>ation. Oxford 19<strong>19.</strong><br />
Wandel, Paul: Wie es zur Oder-Neisse-<br />
Grenze kam. 2. Aufl. Berl<strong>in</strong> (Ost)<br />
1955.<br />
Wanderungsraum Europa: Menschen<br />
<strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> Bewegung. Hrsg. v.<br />
Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für
Sozialforschung v. Mirjana Morokvasic.<br />
Berl<strong>in</strong> 1994.<br />
Wawrik, Franz: Alte Landkarten der<br />
Sudetenländer <strong>in</strong> der<br />
Österreichischen Nationalbibliothek<br />
<strong>und</strong> <strong>im</strong> Kriegsarchiv Wien. In: Informationsbrief<br />
für sudetendeutsche<br />
He<strong>im</strong>atarchive <strong>und</strong> He<strong>im</strong>atmuseen<br />
15 (1978), 9–36.<br />
Wayne C. Thompson: Citizenship and<br />
Borders: Legacies of Soviet Empire<br />
<strong>in</strong> Estonia. In: Journal of Baltic<br />
Studies 29 (1998), 109–134.<br />
Webb, W.P.: The Great Frontier. Boston<br />
1952.<br />
Weigand, Karl: Flensburg als zentraler<br />
Ort <strong>im</strong> grenzüberschreitenden Reiseverkehr.<br />
Kiel 1965 (= Schriften des<br />
Geographischen <strong>Institut</strong>s der Universität<br />
Kiel. 25/II).<br />
We<strong>in</strong>, Franziska: Deutschlands Strom –<br />
Frankreichs Grenze. Geschichte <strong>und</strong><br />
Propaganda am Rhe<strong>in</strong> 1919–1930.<br />
Essen 1992 (= Düsseldorfer<br />
Schriften zur neueren Landesgeschichte<br />
<strong>und</strong> zur Geschichte<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens. 33).<br />
We<strong>in</strong>brenner, Uta: Europas <strong>Grenzen</strong>.<br />
Anregungen zu ihrer Darstellung <strong>in</strong><br />
Schulbüchern für Geographie. In:<br />
Internationale Schulbuchforschung<br />
18 (1996), 65-80.<br />
Weissberg, G.: Maps as evidence <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternational<br />
bo<strong>und</strong>ary disputes. In:<br />
American Journal of International<br />
Law 57 (1963), 781–803.<br />
Weißthanner, Alois: Der Kampf um die<br />
bayerisch-böhmische Grenze von<br />
Furth bis Eisenste<strong>in</strong> von den Hussitenkriegen<br />
bis zum 30-jährigen<br />
Kriege mit besonderer Berücksichtigung<br />
siedlungsgeschichtlicher<br />
Verhältnisse. Diss. München 1938,<br />
<strong>in</strong> Auszügen auch <strong>in</strong>: Verhandlungen<br />
des Historischen Vere<strong>in</strong>es von<br />
Oberpfalz <strong>und</strong> Regensburg 89<br />
(1939), 187-358.<br />
Welte, Bernhard u.a.: Bedeutung <strong>und</strong><br />
Funktion der Grenze <strong>in</strong> den Wissenschaften.<br />
Freiburg/Br. 1958<br />
(= Freiburger Dies Universitatis. 6).<br />
Wenisch, Rudolf: Die Grenze zwischen<br />
Böhmen <strong>und</strong> der Oberlausitz. In:<br />
Jahrbuch der Philosophischen Fakultät<br />
der Deutschen Universität<br />
Prag 3 (Dekanatsjahr 1925/26), Prag<br />
1927, S. 18–21.<br />
Wenz, Dieter: Die <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> den<br />
Köpfen. Deutschland, Frankreich<br />
<strong>und</strong> andere Probeläufe am Rhe<strong>in</strong>.<br />
Brühl 1992.<br />
Wiewióra, Boles¬aw: Granica polskoniemiecka<br />
w s;wietle prawa<br />
mieçdzynarodowego [Die polnischdeutsche<br />
Grenze <strong>im</strong> Lichte des<br />
Völkerrechts]. Poznan; 1957 (= Prace<br />
Instytutu zachodniego. 22).<br />
Wild, Trevor: From peripherality to new<br />
centrality? Transformation of Germany’s<br />
Zonenrandgebiet. In: Geography<br />
78 (1993), Nr. 3, 281–294.<br />
Willoweit, Dietmar: Rechtsgr<strong>und</strong>lagen<br />
der Territorialgewalt. Landesobrigkeit,<br />
Herrschaftsrechte <strong>und</strong> Territorium<br />
<strong>in</strong> der Rechtswissenschaft der<br />
Neuzeit. Köln, Wien 1975<br />
(= Forschungen zur deutschen<br />
Rechtsgeschichte. 11).<br />
W<strong>in</strong>kelbauer, Thomas: Zur Bedeutung<br />
der Grenze zwischen den Böhmischen<br />
Ländern <strong>und</strong> Österreich für<br />
Glaubensflüchtl<strong>in</strong>ge vom 15.–17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert. In: Unsere He<strong>im</strong>at.<br />
Zeitschrift des Vere<strong>in</strong>s für Landesk<strong>und</strong>e<br />
von Niederösterreich 3<br />
(1994), 189–<strong>20</strong>9.<br />
289
Wiskemann, Elizabeth: Germany’s<br />
Eastern Neighbours. Problems relat<strong>in</strong>g<br />
to the Oder-Neisse L<strong>in</strong>e and the<br />
Czech Frontier Regions. Oxford<br />
1956.<br />
Witt, Kurt: Die Teschener Frage. Berl<strong>in</strong><br />
1935.<br />
Wölker, Thomas: Wüstungsprozesse an<br />
der hessisch-thür<strong>in</strong>gischen Grenze<br />
nach 1945. In: Siedlungsforschung<br />
13 (1995), 147–155.<br />
Woh<strong>in</strong> steuert Europa? Erwartungen zu<br />
Beg<strong>in</strong>n der 90er Jahre. Hrsg. v. Jürgen<br />
Nötzold. Baden-Baden 1995.<br />
Wolff-Poweçska, Anna: Doktryna geopolityki<br />
w Niemczech [Die Doktr<strong>in</strong><br />
der Geopolitik <strong>in</strong> Deutschland].<br />
Poznan; 1979.<br />
Zabie¬¬o, Stanisław: O rzaçd i granice<br />
[Über Regierung <strong>und</strong> Grenze]. Warszawa<br />
2. Aufl. 1965.<br />
Zachodnia Granica Polski na konferencij<br />
poczdamskiej. Zbio;r dokumento;w<br />
[Die Westgrenze Polens auf der<br />
Potsdamer Konferenz. Dokumentensammlung].<br />
Bearb. v. Gwidon Rysiak.<br />
Opole 1970. In: Biuletyn<br />
niemcoznawczy. Nr. 4/5 [28/ 29].<br />
Zachodnie granice Polski. Frontières<br />
orientales de l’Allemagne. Wyd.<br />
przez Biuro Prac Kongresowych<br />
1:100000. Warszawa 19<strong>19.</strong> Karte<br />
46x86 cm.<br />
Zaisberger, Friederike: “Das Land <strong>und</strong><br />
Erzstift Salzburg”. E<strong>in</strong> Beitrag zur<br />
Entstehung des Landes <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er<br />
<strong>Grenzen</strong>. In: Landeshoheit. Beiträge<br />
zur Entstehung, Ausformung <strong>und</strong><br />
Typologie e<strong>in</strong>es Verfassungselements<br />
des römisch-deutschen Reiches.<br />
Hrsg. v. Erw<strong>in</strong> Riedenauer.<br />
München 1994, 213–235 (= Studien<br />
290<br />
zur bayerischen Verfassungs- <strong>und</strong><br />
Sozialgeschichte. 16).<br />
Záloha, Jiři: Historische Bibliographie<br />
des südböhmischen Grenzlandes jenseits<br />
Österreichs 1945–1990. E<strong>in</strong>e<br />
Auswahl aus tschechischen Publikationen.<br />
In: Kontakte <strong>und</strong> Konflikte<br />
(s. o.), 521–546.<br />
Zemek, Metode=j: Moravsko-uherská<br />
hranice v. 10.–13. Století (Pr=íspe=vek<br />
k nejstars=ím dej<strong>in</strong>ám Moravy) [Die<br />
mährisch-ungarische Grenze <strong>im</strong> 10.-<br />
13. Jahrh<strong>und</strong>ert (E<strong>in</strong> Beitrag zur<br />
ältesten Geschichte Mährens)]. Brno<br />
1972.<br />
Zernack, Klaus: Deutschlands Ostgrenze.<br />
In: Deutschlands <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong><br />
der Geschichte. Unter Mitarbeit von<br />
Re<strong>im</strong>er Hansen hrsg. v. Alexander<br />
Demandt. 3. Aufl. München 1993,<br />
135–160.<br />
Ziegfeld, Arnold Hillen: Die deutsche<br />
Kartographie nach dem Weltkriege.<br />
In: Volk unter Völkern. Bücher<br />
des Deutschtums. Bd. 1. Hrsg v. Karl<br />
Christian von Loesch. Breslau 1929,<br />
429–445.<br />
Ziegfeld, Arnold Hillen: Grenzkampf,<br />
Volkskampf. Bd. 1, Berl<strong>in</strong> 1937.<br />
Ziegler, Walter: Die bayerischböhmische<br />
Grenze <strong>in</strong> der Frühen<br />
Neuzeit. E<strong>in</strong> Beitrag zur Grenzproblematik<br />
<strong>in</strong> Mitteleuropa. In: Menschen<br />
<strong>und</strong> <strong>Grenzen</strong> <strong>in</strong> der Frühen<br />
Neuzeit. Hrsg. v. Wolfgang Schmale<br />
<strong>und</strong> Re<strong>in</strong>hard Stauber. Berl<strong>in</strong> 1998,<br />
116–130 (= Innovationen. 2).<br />
Ziel<strong>in</strong>ski, Henryk: Population Changes<br />
<strong>in</strong> Poland, 1939–1950. New York<br />
1956.<br />
Ziemie Zachodnie w granicy Macierzy.<br />
Drogi <strong>in</strong>tegracji [Die Westgebiete<br />
<strong>in</strong> den <strong>Grenzen</strong> des Mutterlandes.
Wege der Integration]. Hrsg. v.<br />
Gerard Labuda. Poznan; 1966.<br />
Zilius, Jonas: The Bo<strong>und</strong>aries of<br />
Lithuania. Wash<strong>in</strong>gton DC 19<strong>20</strong>.<br />
Z<strong>im</strong>mer, Gerhard: Gewaltsame territoriale<br />
Veränderungen <strong>und</strong> ihre völkerrechtliche<br />
Legit<strong>im</strong>ation. Berl<strong>in</strong> 1971.<br />
Zoltowski, Adam: Border of Europe. A<br />
Study of the Polish Eastern Prov<strong>in</strong>ces.<br />
o.O. 1950.<br />
Zum Thema: <strong>Grenzen</strong>. Hrsg. vom Rektor<br />
der Universität-GH Siegen.<br />
Verantw. Hrsg.: Waltraud Wende<br />
<strong>und</strong> Karl Riha. Siegen 1993<br />
(= Diagonal 1993, H. 2).<br />
Zur Grenze: Ethnographische Skizzen.<br />
Hrsg. v. Iris Laubste<strong>in</strong>. Tüb<strong>in</strong>gen<br />
1991.<br />
Zwettler, Otto: Die Entwicklung des an<br />
die Tschechoslowakei angeschlossenen<br />
Weitraer bzw. Gmünder Gebietes<br />
19<strong>20</strong> bis 1938. In: Kontakte <strong>und</strong><br />
Konflikte (s. o.), 401–411<br />
Z+ec=evic;, Miodrag u. Bogdan Lekic;:<br />
Frontiers and <strong>in</strong>ternal territorial division<br />
<strong>in</strong> Yugoslavia [Übs. von:<br />
Drz=avne granice i unutras=nja teritorijalna<br />
podela Jugoslavije]. Belgrade<br />
1991.<br />
291
Verzeichnis der Autoren<br />
Prof. Dr. Włodz<strong>im</strong>ierz Borodziej<br />
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL-00927<br />
Warszawa<br />
Dr. Hannelore Burger<br />
Rosentalgasse 11a/7, A-1140 Wien<br />
Dr. Karl von Delhaes<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> e.V., Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg<br />
Prof. Dr. Horst Förster<br />
Geographisches <strong>Institut</strong> der Universität Tüb<strong>in</strong>gen, Hölderl<strong>in</strong>str. 12, 7<strong>20</strong>74 Tüb<strong>in</strong>gen<br />
Prof. Dr. Hanns Haas<br />
Historisches Sem<strong>in</strong>ar, Rudolfskai 42, A-050<strong>20</strong> Salzburg<br />
Dr. Peter Hasl<strong>in</strong>ger<br />
Historisches Sem<strong>in</strong>ar der Universität Freiburg, Neuere <strong>und</strong> Osteuropäische Geschichte,<br />
Postfach, 79085 Freiburg<br />
Prof. Dr. Edgar Hösch<br />
<strong>Institut</strong> für Geschichte Osteuropas <strong>und</strong> Südosteuropas, Wagmüller Str. 23,<br />
80538 München<br />
Dr. Hans-Jürgen Karp<br />
Brandenburger Str. 5, 35041 Marburg<br />
Prof. Dr. Peter Krüger<br />
Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Geschichtswissenschaften, Fachgebiet Neuere<br />
Geschichte, Wilhelm-Röpke-Str. 6, 35032 Marburg<br />
Prof. Dr. Hans Lemberg<br />
Pappelweg 24, 35041 Marburg<br />
Robert Luft<br />
Collegium Carol<strong>in</strong>um, Hochstr. 8, 81669 München<br />
Dr. Mathias Niendorf<br />
Deutsches Historisches <strong>Institut</strong>, Pałac Kultury i Nauk, Plac Defilad 1, skr. 33,<br />
PL-00-901 Warszawa<br />
Dr. Dr. h.c. Gert von Pistohlkors<br />
Sem<strong>in</strong>ar für Mittlere <strong>und</strong> Neuere Geschichte, Universität Gött<strong>in</strong>gen, Platz der Gött<strong>in</strong>ger Sieben<br />
5, 37073 Gött<strong>in</strong>gen<br />
291