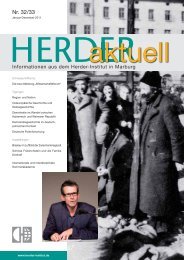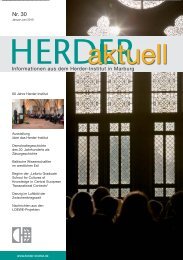Nr. 31 - Herder-Institut
Nr. 31 - Herder-Institut
Nr. 31 - Herder-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Nr</strong>. <strong>31</strong><br />
Juli-Dezember 2010<br />
HERDER aktuell<br />
Informationen aus dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in Marburg<br />
Schwerpunktthema:<br />
Kulturtransfer und Wissenswege<br />
Eröffnung der Leibniz Graduate School<br />
Badekultur und Bäderarchitektur an<br />
der Ostsee als Gegenstand von Tagung<br />
und Ausstellung<br />
Internationale und interdisziplinäre<br />
Sommerakademie<br />
www.herder-institut.de<br />
1
Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
Editorial<br />
Der Vortragssaal des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
wird derzeit umfassend erneuert,<br />
und auch inhaltlich hat unser<br />
<strong>Institut</strong> im Jahr 2010 einen wichtigen<br />
neuen Akzent gesetzt: Am 6.<br />
Dezember fand die feierliche Eröffnung<br />
der „Leibniz Graduate School<br />
for Cultures of Knowledge in Central<br />
European Transnational Contexts“<br />
statt. Hinter diesem komplexen<br />
Titel verbirgt sich mehrerlei:<br />
Zum einen ist damit eine neue<br />
Form der Nachwuchsförderung zu<br />
verstehen, die vom <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
im vergangenen Jahr erfolgreich<br />
eingeworben werden konnte und<br />
das alte Doktorandenprogramm ersetzt.<br />
Die Leibniz Graduate School<br />
unterstützt und unterstreicht jedoch<br />
auch in inhaltlicher Hinsicht<br />
ein ganz zentrales Anliegen des <strong>Institut</strong>s,<br />
nämlich die Reflexion über<br />
die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher<br />
Kommunikation in Vergangenheit<br />
und Gegenwart zwischen<br />
Ostmitteleuropa und dem<br />
deutschsprachigen Raum.<br />
Zum anderen unterstützt die<br />
Leibniz Graduate School damit die<br />
Internationalisierungsstrategie des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s in einer bisher nicht<br />
in der nötigen Dichte verfolgten<br />
Richtung: gegenüber westeuropäischen<br />
Partnern. In den kommenden<br />
Monaten findet eine Präsentation<br />
des Konzepts und der Einzelthemen<br />
des mehrheitlich von Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
und<br />
-wissenschaftlern aus Ostmitteleuropa<br />
formierten Kollegs in Glasgow<br />
und Stockholm statt. Jedoch auch<br />
eine Verbindung mit dem <strong>Herder</strong>-<br />
Stipendienprogramm ist geplant:<br />
Der Austausch wird die kommenden<br />
Jahre prägen und nicht zuletzt<br />
über das <strong>Herder</strong>-Alumni-Programm<br />
die konzeptionelle Diskussion über<br />
die Möglichkeiten und Grenzen des<br />
neuen Ansatzes intensivieren.<br />
Drittens ist die Leibniz Graduate<br />
School ein erneuter Beweis für<br />
die sehr fruchtbare Zusammenarbeit<br />
mit der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen, namentlich mit dem<br />
2<br />
– vom Wissenschaftsrat 2009 mit<br />
großem Erfolg evaluierten – Gießener<br />
Zentrum Östliches Europa und<br />
dem International Graduate Centre<br />
for the Study of Culture aus der<br />
Exzellenzinitiative. Die im abgelaufenen<br />
Jahr auch am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
mehrfach stattgefundenen Sitzungen<br />
mit den entsprechenden Sektionen<br />
und Research areas haben<br />
bereits jetzt erheblich zur Schärfung<br />
des Konzepts der Wissenskultur<br />
beigetragen, das in einer von<br />
sprachübergreifenden und transnationalen<br />
Dynamiken vielfältiger Art<br />
geprägten Untersuchungsregion<br />
viele neue Forschungsperspektiven<br />
zu eröffnen verspricht.<br />
Inhalt Seite<br />
Kulturtransfer und<br />
Wissenswege 3<br />
Tagungen und<br />
Ausstellungen 15<br />
Ereignisse und<br />
Informationen 18<br />
Personalien 22<br />
Gäste am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> 23<br />
Lehrveranstaltungen<br />
SS 2010 23<br />
Vorträge und<br />
Werkstattgespräche 24<br />
Neue Veröffentlichungen 29<br />
Terminvorschau <strong>31</strong><br />
Titelbild:<br />
Eröffnungsveranstaltung der<br />
Leibniz Graduate School<br />
in der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen<br />
Fotos: Claudia Junghänel<br />
Impressum<br />
„<strong>Herder</strong> aktuell“ erscheint halbjährlich<br />
und wird herausgegeben vom<br />
HERDER-INSTITUT e.V.<br />
35037 Marburg, Gisonenweg 5-7<br />
Tel. +49-6421-184-0<br />
Fax +49-6421-184-139<br />
mail@herder-institut.de<br />
www.herder-institut.de<br />
Direktor: Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
(V.i.S.d.P.)<br />
Redaktion: Dr. Anna Veronika Wendland<br />
Layout/Satz: Wolfgang Schekanski<br />
Verlag <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Fotos: Wolfgang Schekanski u. a.<br />
Druck: Jürgen Haas Print Consulting,<br />
Gladenbach<br />
Alle Bilddokumente befinden sich in den<br />
Sammlungen des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s.<br />
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet,<br />
Beleg erbeten.<br />
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:<br />
28. Februar 2011
Schwerpunktthema:<br />
Kulturtransfer und Wissenswege<br />
I prefer the edge: the place where<br />
countries, communities,<br />
allegiances,<br />
affi nities, and roots bump<br />
uncomfortably up against<br />
one another<br />
—where cosmopolitanism is<br />
not so much an identity<br />
as the normal condition of life.<br />
Der jüngst verstorbene britische Historiker<br />
Tony Judt schrieb die oben<br />
zitierten Worte 2010 im Rahmen einiger<br />
grundsätzlicher Überlegungen<br />
zu kulturellen Identitätspolitiken und<br />
deren Auswirkungen auf die Neuformierunggeisteswissenschaftlicher<br />
Disziplinen. Judt kritisierte die<br />
zunehmende Bedeutung fest gefügter<br />
und für undiskutierbar gehaltener<br />
ethnisch-kultureller, sozialer<br />
oder geschlechtlicher Identitäten<br />
in den westlichen Gesellschaften.<br />
Diese wurden ursprünglich im Zuge<br />
emanzipatorischer sozialer oder<br />
Minderheits-Bewegungen „entdeckt“,<br />
führten aber, so Judt, letztlich<br />
zu einer Identitätsbesessenheit,<br />
welche nicht nur den Zusammenhalt<br />
moderner Gesellschaften gefährde,<br />
sondern auch die Denkfreiheit an<br />
den Hochschulen einschränke.<br />
Der Absolutheit der Identität<br />
setzt Judt, ausgehend von seinen<br />
eigenen Erfahrungen als Nachkomme<br />
jüdischer Immigranten in Großbritannien,<br />
sein Bekenntnis zu den<br />
„Rändern“ entgegen. Judt meinte<br />
mit seinem Begriff des Kosmopolitismus<br />
als „Lebensbedingung“<br />
weniger die selbstgewählte Weltläufigkeit<br />
neuzeitlicher, meist bürgerlicher<br />
Intellektueller, Künstler<br />
oder Unternehmer, sondern jene<br />
geografischen und sozialen Räume,<br />
in denen Zugehörigkeitsgefühle<br />
und Identitätsvorstellungen<br />
(„Wurzeln“) sich ihrer selbst eben<br />
nicht so sicher sind, wo sie sich<br />
überschneiden und durch gegenseitige<br />
Beeinflussung in ständiger<br />
Veränderung sind.<br />
Solche Räume können sehr nah<br />
sein – überall dort, wo sich in den<br />
hitzigen Diskussionen um Parallelgesellschaften<br />
und Integration die<br />
leiseren Stimmen melden, die ihre<br />
persönliche Erfahrung im „Dazwischen“<br />
einbringen. Andere dieser<br />
Räume gibt es jedoch nur noch in<br />
der historischen Erinnerung, beispielsweise<br />
jener an die Städte und<br />
Grenzregionen Ost- und Ostmitteleuropas,<br />
deren kulturelle Vielstimmigkeit<br />
den Kriegen, Genoziden<br />
und Territorialpolitiken des 20.<br />
Jahrhunderts zum Opfer fiel.<br />
Die von Judt umrissenen Grenz-<br />
und Interferenzräume stehen auch<br />
im Mittelpunkt eines sich immer<br />
weiter ausdifferenzierenden Forschungsinteresses<br />
in den Geschichts-<br />
und Kulturwissenschaften.<br />
Dieses hat auf theoretischem<br />
Gebiet innovative Ansätze zur<br />
Deutung des Spannungsfeldes<br />
zwischen kultureller<br />
Differenz und kulturellem<br />
Austausch<br />
hervorgebracht. So<br />
behandelt die Übers<br />
e t z u n g s t h e o r i e<br />
heute nicht nur die<br />
sozialen Bedingungen<br />
und sprachlichzeichenförmigen<br />
Verfahren der Übersetzung<br />
von Texten,<br />
sondern versucht<br />
soziale Interaktionen<br />
und menschliche<br />
Kommunikation als<br />
Übersetzungsakte<br />
und Schaffung von „dritten“ Räumen<br />
der Vermittlung zwischen Ausgangs-<br />
und Zielgemeinschaften zu<br />
verstehen.<br />
Die Kulturtransferforschung löst<br />
sich von älteren Vorstellungen geschlossener<br />
Nationalkulturen, deren<br />
Literaturen, <strong>Institut</strong>ionen oder<br />
Rechtssysteme allenfalls verglichen<br />
wurden, ohne sie auf ihre Interaktion<br />
hin zu befragen. Kulturtransfers<br />
werden heute nicht mehr als<br />
Transport eines kulturellen Gegenstandes<br />
von A nach B, von akti-<br />
vem Sender zu passivem Empfänger<br />
verstanden. Vielmehr definiert<br />
man sie als hochkomplexe Kommunikations-<br />
und Übersetzungsprozesse,<br />
die keine der beteiligten<br />
Gesellschaften, und erst recht nicht<br />
den Transfergegenstand, unberührt<br />
lassen. Unzählige Beispiele könnten<br />
hier angeführt werden; manche<br />
sind aus unserer Lebenswirklichkeit<br />
gar nicht mehr wegzudenken, z.B.<br />
die mitteleuropäische Konsum- und<br />
Esskultur, die sich im Zuge eines<br />
schon mehrere Jahrhunderte andauerndenGlobalisierungsprozesses<br />
herausbildete. Epochemachende<br />
europäische Glaubens- und<br />
Wissenskulturen und <strong>Institut</strong>ionen<br />
werden längst als „eigene“ ausgewiesen,<br />
sind in Wirklichkeit aber<br />
übernommene, erworbene und<br />
vielfältig transformierte – wie das<br />
Christentum und seine Wandlung<br />
und Wanderung von der jüdischen<br />
Sekte an der östlichen Peripherie<br />
des römischen Imperiums bis zur<br />
Eliten- und schließlich Volksreligion<br />
in dessen Nachfolgereichen.<br />
In einigen Ländern mit vergleichsweise<br />
junger Staatstradition<br />
hat die Erfahrung mit Grenzlagen<br />
und Kulturtransfers ironischerweise<br />
sogar zur Konstituierung nationaler<br />
Narrative beigetragen, so im<br />
Falle Belgiens als einer Nation am<br />
Kreuzungspunkt romanischer und<br />
3<br />
Die Stipendiaten<br />
der Leibniz<br />
Graduate School<br />
(v.l.n.r.): Konrad<br />
Hierasimowicz,<br />
Dominika Piotrowska,<br />
Sylwia<br />
Werner, Justyna<br />
Turkowska und<br />
Christian Lotz.<br />
Hinter dem Rednerpult<br />
(v.l.n.r.)<br />
Hans-Jürgen<br />
Bömelburg,<br />
Koordinatorin<br />
Wiebke Rohrer,<br />
Peter Haslinger
Grußworte zur Er-<br />
öffnung der Leibniz<br />
Graduate School<br />
sprachen die Vizepräsidentin<br />
der JLU,<br />
Prof. Eva Burwitz-<br />
Melzer, sowie Prof.<br />
Horst Carl für das<br />
Gießener Graduate<br />
Centre for the Study<br />
of Culture (GCSC)<br />
und Prof. Thomas<br />
Bohn für das<br />
Gießener Zentrum<br />
Östliches Europa<br />
(GiZo). Der Baseler<br />
Afrika-Historiker<br />
Prof. Patrick Harries<br />
hielt den Festvortrag<br />
über „Knowledge<br />
and Knowing:<br />
Managing and<br />
Measuring the New<br />
Across Space and<br />
Through Time“.<br />
germanischer Sprachen und Kulturen,<br />
oder im Falle der Ukraine. Hier<br />
überlagern sich gleich mehrere Interferenzzonen:<br />
die frühe osteuropäische<br />
Erschließungsgrenze der<br />
Steppe zwischen bäuerlichen und<br />
nomadischen Kulturen, eine spätere<br />
zwischen muslimischem „Orient“<br />
und christlichem „Okzident“ und<br />
dazu noch jene zwischen orthodoxem<br />
und lateinischem Christentum<br />
mit ihren jeweils politisch-institutionellen,<br />
später auch imperial<br />
überformten Folgewirkungen. Das<br />
ukrainische historisch-politische<br />
Denken seit dem frühen 19. Jahrhundert<br />
übersetzte diese Grenzerfahrung<br />
schließlich in Territorialkonzepte<br />
eines Landes „zwischen Ost<br />
und West“.<br />
In der Entwicklung der geisteswissenschaftlichen<br />
Disziplinen und<br />
ihrer Selbstbeobachtung wiederum<br />
spielt die Analyse „reisender“ Konzepte<br />
eine große Rolle. Solche „travelling<br />
concepts“, welche Disziplingrenzen<br />
unterwandern, hat die<br />
Kulturwissenschaftlerin Mieke Bal<br />
2002 als metapherförmige „shorthand<br />
theories“ definiert. Gemeint<br />
sind Begriffe wie „Gedächtnis“,<br />
„Raum“ oder „Text“, die außerhalb<br />
ihrer Ursprungsdisziplinen –<br />
hier der Individualpsychologie, der<br />
Geografie und der Sprachwissenschaft<br />
– für Erkenntnisgewinn und<br />
theoretische Innovation sorgten.<br />
Viele dieser Konzepte haben zu<br />
den berühmten „turns“, d.h. Wenden<br />
und Neuorientierungen in den<br />
Geisteswissenschaften, beigetragen.<br />
Auch das Reisen selbst, der<br />
Übersetzungsakt und der Transfer<br />
können als solche disziplin-unterlaufenden<br />
Konzepte zum Tragen<br />
kommen. Vor allem tragen sie zur<br />
historischen Erkundung von „Rändern“<br />
bei: Sie erhellen jeweils unterschiedliche<br />
Aspekte, die bei der<br />
Entstehung von Peripherieregionen,<br />
Interferenzräumen oder „intermediären“<br />
Akteursgruppen von<br />
Bedeutung sind.<br />
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s sind<br />
solche vielstimmigen und vielsprachigen<br />
Interferenzräume und die<br />
4<br />
darin aktiven historischen Akteure<br />
das täglich Brot ihrer wissenschaftlichen,<br />
dokumentarischen, bibliothekarischen<br />
oder archivarischen<br />
Arbeit: Sie bilden den Gegenstandsbereich<br />
der <strong>Institut</strong>ssammlungen<br />
und vieler Forschungsprojekte,<br />
die am <strong>Institut</strong> betrieben<br />
werden. Ob Geschichtsregionen<br />
und Kunstlandschaften wie Schlesien<br />
oder die baltischen Länder,<br />
polyglotte und multikonfessionelle<br />
Metropolen wie Breslau, Lemberg<br />
oder Wilna, Spezialistennetzwerke<br />
wie die mittelalterlichen Notare<br />
im Ostseeraum, Wege offiziellen,<br />
verborgenen oder verbotenen Wissens,<br />
wie sie sich im Bibliothekswesen<br />
sozialistischer Länder abzeichneten:<br />
Der Jahresbericht 2010<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s wird davon<br />
wieder beredtes Zeugnis ablegen.<br />
Einige <strong>Institut</strong>smitarbeiterinnen und<br />
-mitarbeiter sind zudem in Kooperation<br />
mit der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen an Buchprojekten,<br />
Tagungen und der Planung von Forschungsprojekten<br />
beteiligt, welche<br />
die skizzierten kulturwissenschaftlichen<br />
Konzepte diskutieren und als<br />
Basis einer Ost- und Westeuropa<br />
integrierenden Wissenschaftskommunikation<br />
entwickeln.<br />
In dieser Ausgabe von <strong>Herder</strong>-<br />
Aktuell haben wir einige Beiträge<br />
versammelt, die Sie in den bisherigen<br />
Jahresberichten noch nicht<br />
verfolgen konnten. Sie alle thematisieren<br />
auf die eine oder andere<br />
Weise das Leitmotiv von Transfer<br />
und Wissenswegen, welche zur<br />
Konstitutierung von historischen<br />
Regionen beitrugen, aber auch<br />
zur Entstehung von andersartigen<br />
Räumen, jenen, die durch Kommunikation<br />
und Wissensvermittlung<br />
geschaffen werden und politische<br />
Grenzziehungen ignorieren.<br />
Die ersten fünf der im folgenden<br />
vorgestellten Autoren bearbeiten<br />
ihre Projekte als Doktoranden<br />
und Habilitanden in unserer von<br />
der Leibniz-Gemeinschaft finanzierten<br />
Graduiertenschule, die im<br />
April 2010 unter dem Generalthema<br />
„Wissenskulturen in transnationalen<br />
Kontexten“ ihre Arbeit auf-<br />
genommen hat. Sie wurde am 6.<br />
Dezember 2010 feierlich eröffnet.<br />
Aufnahmen von der Festveranstaltung<br />
an der Universität Gießen,<br />
dem Hochschulpartner der Leibniz-<br />
Graduiertenschule, finden Sie im<br />
Umfeld der Themenbeiträge.<br />
Justyna Turkowska untersucht<br />
die grenzüberschreitende Wissensvermittlung<br />
am Beispiel von<br />
Hygiene-Diskursen in der Provinz<br />
Posen; Dominika Piotrowska stellt<br />
sich einem klassischen Kulturtransfer-Thema,<br />
nämlich dem Wandern<br />
von Kunststilen und Repräsentationsauffassungen<br />
in Grenzregionen,<br />
exemplifiziert an neumärkischer<br />
Residenzarchitektur; Konrad<br />
Hierasimowicz präsentiert einen<br />
historisch wie kommunikationstheoretisch<br />
neuartigen Raum, jenen<br />
des Web 2.0, als Verständigungs-,<br />
Appell- und Resonanzraum für die<br />
weißrussische National- und Oppositionsbewegung;<br />
Sylwia Werner<br />
erkundet die „Lemberger Moderne“<br />
des frühen 20. Jahrhunderts<br />
als Fluchtpunkt eines weit über<br />
Stadt und Region ausgreifenden<br />
transdisziplinären Konzepttransfers;<br />
Christian Lotz bringt Licht in<br />
die transnationalen und -imperialen<br />
Verflechtungen bei der Verbreitung<br />
statistischen, ökonomischen<br />
und ökologischen Know-hows am<br />
Beispiel der Diskussion um die europäischen<br />
Holzressourcen im 19.<br />
Jahrhundert.<br />
Außerdem gibt uns Dorothee M.<br />
Goeze, die als Archivarin in der<br />
Dokumentesammlung des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s arbeitet, Einblicke in ihr<br />
Dissertationsprojekt zu Leben und<br />
Werk des estnischen Kulturwissenschaftlers<br />
Otto A. Webermann, eines<br />
Grenzgängers zwischen Sprachen<br />
und historisch konstituierten<br />
Wissenschaftskulturen im Baltikum<br />
und in der westlichen Emigration.<br />
Hinzugesellt haben wir diesen<br />
Werkstattberichten aus der wissenschaftlichen<br />
Arbeit noch ein<br />
Selbstzeugnis, das mit der <strong>Institut</strong>sgeschichte<br />
und den durch das<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> konstitutierten Wissens-<br />
und Kommunikationswegen<br />
zwischen (West-)Deutschland und
Polen zu tun hat: Horst von Chmielewski,<br />
ehemaliger Leiter der <strong>Institut</strong>sbibliothek,<br />
erinnert sich an seine<br />
frühen Reisen und Kontakte in<br />
heute schon lang zurückliegenden<br />
schwierigeren Zeiten.<br />
Die neuzeitliche Residenzarchitektur<br />
in der Neumark<br />
Mein von Prof. Jan Harasimowicz<br />
(Universität Breslau/Uniwersytet<br />
Wrocławski) betreutes Dissertationsprojekt,<br />
das im Rahmen der<br />
Leibniz Graduate School entsteht,<br />
beschäftigt sich mit dem Wissens-<br />
und Ideentransfer zwischen der<br />
Neumark und ihren Grenzgebieten<br />
einerseits sowie den großen<br />
europäischen Kulturzentren andererseits<br />
und dessen visueller und<br />
wissenskultureller Ausprägung und<br />
Kontextualisierung.<br />
Die neumärkische Residenzarchitektur<br />
der Jahre 1535 bis 1807<br />
wird unter Berücksichtigung der<br />
folgenden Aspekte untersucht: Erstens<br />
sind die ideologischen und visuellen<br />
Transfers und Diskurse von<br />
Interesse, zum Zweiten die machtpolitischen<br />
und soziokulturellen<br />
Auseinandersetzungen um die<br />
Wissenskodierung und Aneignung<br />
neuer Ausdrucksformen, die in den<br />
architektonischen und stilistischen<br />
Formen sichtbar wurden.<br />
Die Residenzarchitektur und ihre<br />
Objekte – Schlösser, Herrenhäuser,<br />
Gutshäuser – können als Archive<br />
und Medium der transnational aufgespannten<br />
Wissensbestände und<br />
regional übergreifenden Praktiken<br />
betrachtet werden. Zum einen spiegeln<br />
sie das visuelle Wissen und die<br />
transnationalen Einflüsse, zum anderen<br />
entstehen sie als Resultate<br />
eines wissenskulturellen Diskurses<br />
zwischen Architekten und Stiftern<br />
bzw. Bauherren.<br />
Ferner steht ein Residenzbau<br />
nicht nur für eine Summe von<br />
räumlichen und personalen Gestaltungselementen,<br />
sondern auch<br />
Zum Weiterlesen:<br />
Tony Judt, Edge People, The New<br />
York Review of Books Blog, February<br />
23, 2010, URL: http://www.nybooks.<br />
com/blogs/nyrblog/2010/feb/23/edge-<br />
people/<br />
für bestimmte Formen personaler<br />
und symbolischer Interaktion sowie<br />
kommunikativer Integration. Dazu<br />
gehörten Hoftage, verschiedene<br />
Festpraktiken sowie spezifische<br />
Lebensformen und Methoden der<br />
Kommunikation, die sich durch<br />
Kleidung, Gestik und Körpersprache<br />
manifestierten. Der Hof etablierte<br />
sich durch ein „höfisches“<br />
Wissen. In den Räumen eines Residenzbaues<br />
wurden Rituale von<br />
Doris Bachmann-Medick, Cultural<br />
turns. Neuorientierungen in den Kultur-<br />
wissenschaften, Reinbek 2006.<br />
Prunk, Reichtum, Glanz und Macht<br />
inszeniert und die künstlerische<br />
Form der Bauten diente einer vielschichtigen<br />
Positionierung – von<br />
der familiären über die soziokulturelle<br />
bis zur machtpolitischen. Ein<br />
Residenzbau war also viel mehr<br />
als nur ein künstlerisch gestaltetes<br />
repräsentatives Gebäude, das<br />
den Mitgliedern des Adels als Regierungs-<br />
oder Wohnsitz diente. Er<br />
spiegelte die Wünsche der Stifter<br />
Innenhof Schloß Küstrin vor 1945 (oben) und 2010 (unten)<br />
5<br />
Dominika Piotrowska<br />
studierte<br />
Kunstgeschichte<br />
in Wrocław und<br />
Marburg. Seit<br />
2008 arbeitet<br />
sie am <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>. Aus ihrem<br />
Spezialgebiet, der<br />
frühneuzeitlichen<br />
Profanarchitektur<br />
in Ostmitteleuropa,<br />
stammt auch ihr<br />
Promotionsprojekt<br />
zur Rolle von<br />
Transfers in der<br />
neumärkischen<br />
Residenzarchitektur.<br />
Sie ist Stipendiatin<br />
der Leibniz<br />
Graduate School<br />
und Doktoratsstudentin<br />
der Universität<br />
Wrocław.
Justyna Turkowska<br />
studierte Politikwissenschaften,<br />
Geschichte und Soziologie<br />
in Warschau,<br />
Hannover und Berlin.<br />
Danach arbeitete<br />
sie in Deutschland<br />
und Polen, unter<br />
anderem in Projekten<br />
zum europäischen<br />
Kulturaustausch, bei<br />
der Organisation von<br />
Schülerwettbewerben<br />
und als Redakteurin<br />
der Zeitschrift<br />
„Krytyka Polityczna“.<br />
Seit 2010 ist sie Stipendiatin<br />
der Leibniz<br />
Graduate School am<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>.<br />
und der Bewohner, die Wünsche<br />
der Architekten sowie die kulturellen<br />
Sinnzuschreibungen beider<br />
Gruppen wider.<br />
Die Neumark stellt aufgrund<br />
der vielschichtigen transnationalen<br />
Austauschprozesse, denen sie<br />
unterlag, ein sehr interessantes<br />
Forschungsgebiet dar. Sie ist eine<br />
östlich der Oder gelegene historische<br />
Landschaft (das ehemalige<br />
Ostbrandenburg), die trotz ihres<br />
provinziellen Charakters zu einer<br />
Schnittstelle von unterschiedlichen<br />
ideologischen und visuellen Tendenzen<br />
wurde. Zu ihnen gehörten<br />
unter anderem der ideologische<br />
und visuelle Transfer aus Italien im<br />
16. Jahrhundert, aus den Niederlanden<br />
im 17., aus Frankreich und<br />
England im 18. und 19. Jahrhundert<br />
sowie aus den angrenzenden<br />
Gebieten. Dieser Transfer spielte für<br />
die Profanarchitektur in der Neumark<br />
eine große Rolle und bedeutete<br />
neben den visuellen Konzepten<br />
auch eine sinnstiftende Umdeutung<br />
der Wohnkultur.<br />
Wissenschaft als Wille und Vorstellung<br />
Salomon Neumann – ein Berliner<br />
Armenarzt und ein guter Freud von<br />
Rudolph Virchow – pflegte zu sagen,<br />
Medizin sei eine soziale Wissenschaft<br />
und die Politik sei nichts<br />
weiter als Medizin im Großen. Diese<br />
Aussage kann man nicht nur auf<br />
die Medizin, sondern vor allem auf<br />
die sich in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts als Disziplin und<br />
Leitwissenschaft profilierende Hygiene<br />
anwenden, die zusammen<br />
mit der Wissens- und Wissenschaftspopularisierung<br />
im Fokus<br />
des hier vorgestellten Dissertationsprojekts<br />
steht. Der Arbeitstitel<br />
dieses Forschungsvorhabens<br />
lautet „Wissenschaft als Konstrukt<br />
und Inszenierung: ein deutsch-polnischer<br />
Vernetzungsfall im Spiegel<br />
6<br />
„Hygiene ist das Zauberwort der<br />
Moderne“<br />
Philipp Sarasin<br />
Bemerkenswert an der Neumark ist<br />
darüber hinaus, dass auf ihrem Territorium<br />
ein größeres bedeutsames<br />
Kulturzentrum fehlte. Daraus folgt,<br />
dass die Region besonders an einer<br />
künstlerischen Vernetzung mit<br />
außerhalb gelegenen Metropolen<br />
interessiert war. Sie wurde zum Ziel-<br />
und Durchdringungsgebiet vielfältiger<br />
Stiltransfers, die aus den unterschiedlichsten<br />
Kulturzentren kamen.<br />
Einen Schwerpunkt des Forschungsinteresses<br />
bilden die beiden<br />
im Feld der Residenzarchitektur<br />
agierenden sozialen Kreise – Stifter<br />
und Architekten. Einerseits besteht<br />
der Bedarf des künstlerischen, visuellen<br />
Ausdruckes seitens der<br />
Künstler, anderseits jener der Visualisierung<br />
ideologischer Bestrebungen<br />
seitens der Stifter. Aus diesem<br />
Aufeinandertreffen resultieren<br />
zahlreiche Fragen: Konnten beide<br />
Gruppen im Entstehungsprozess<br />
der Architektur erfolgreich kooperieren<br />
und gleichmäßig partizipieren<br />
und profitieren? Waren die Architekten<br />
und Baumeister immer den<br />
der Hygienediskurse“. Sein zentrales<br />
Anliegen ist, anhand der Hygienediskurse<br />
die konstitutive Rolle<br />
der Wissenschaftsvermittlung bei<br />
der Herausbildung von Wissenskulturen<br />
und -räumen sowie das<br />
Umdeutungs-, Stabilisierungs- und<br />
Hierarchisierungspotenzial der Wissenschaftspopularisierungaufzuspüren.<br />
Untersuchungsregion ist<br />
dabei ein preußisch-deutsch-polnischer<br />
Interferenzraum, die Provinz<br />
Posen in den Jahren 1871-1918.<br />
Dabei sind die folgenden Fragen<br />
leitend: Über welche Wissenswege<br />
wurde das hygienische Wissen<br />
vermittelt und in andere Wissensbereiche<br />
eingebunden? Inwiefern<br />
und wie wurde das Wissen instrumentalisiert;<br />
welche Bilder und gesellschaftlichen<br />
Strukturen wurden<br />
durch die Popularisierungsstrategien<br />
und -konzepte hervorgerufen,<br />
transformiert und etabliert; wie tief-<br />
Anforderungen der Stifter gewachsen?<br />
Übernahmen die Bauherren<br />
die westeuropäische Wohnkultur<br />
oder kann man von einer spezifisch<br />
„neumärkischen Wohnkultur“ sprechen?<br />
Wie haben sich innerhalb eines<br />
sich über fast 300 Jahre erstreckenden<br />
Zeitraumes die Rezeption<br />
und das Verständnis der Residenzarchitektur<br />
aus der Perspektive von<br />
Stiftern und Künstlern gewandelt?<br />
Die Arbeit betont also einen neuen<br />
Blickwinkel auf die regionale<br />
Architekturtradition, welche in den<br />
sozialen, politischen und wirtschaftlichen<br />
Kontext eingefügt wird. Statt<br />
die Architektur als ein geschlossenes<br />
System zu verstehen, wird sie<br />
als Resultat eines transnationalen<br />
Kulturtransfers betrachtet und bearbeitet.<br />
Das Forschungsprojekt<br />
geht somit über die bisherigen klassisch<br />
kunsthistorisch angelegten<br />
Arbeiten hinaus.<br />
gründig und dauerhaft wurden die<br />
Wissenskulturen und -räume durch<br />
diese Praktiken geprägt, definiert<br />
oder aber umgedeutet?<br />
Die Hygiene als eine Leitwissenschaft<br />
mit dem Anspruch auf<br />
Gehört- und Befolgtwerden profilierte<br />
sich im 19. Jahrhundert als<br />
eine gesundheitliche, aber auch<br />
moralische und soziale Normsetzungsinstanz,<br />
deren Beeinflussungs-<br />
und Durchsetzungskraft<br />
bis in die Bereiche der schulischen<br />
Ausbildung, der Bevölkerungspolitik,<br />
der Architektur oder sogar der<br />
Kriegsführung reichte. Dank ihres<br />
breit aufgeschlagenen Feldes (sex<br />
res non naturales) konnte sie als<br />
ein Aushandlungsort nicht nur für<br />
die Hygieniker, sondern auch für Ingenieure,<br />
Beamte, Lehrer, Priester<br />
und Popularisatoren aller Art sowie<br />
als eine Schnittstelle zwischen Populärwissenschaften<br />
und wissen-
schaftlichen Lehren fungieren. Die<br />
Populärwissenschaften dienten als<br />
Arena und Spiegelung der politischen<br />
und kulturellen Kontroversen<br />
und als Medium der Inszenierung<br />
und Konstruktion von Welterklärungsmodellen,<br />
die zwischen Laien<br />
und Wissenschaftlern entworfen<br />
wurden – in einem Dialog ohne eine<br />
scharfe Trennung, der durch einen<br />
offenen Zugang und eine gewisse<br />
Diskutierbarkeit der wissenschaftlichen<br />
Überlegungen gekennzeichnet<br />
war. Die hygienebezogenen<br />
Popularisierungspraktiken waren<br />
zwar auf die Verbreitung des hygienischen<br />
Wissens und auf die<br />
Implementierung neuester hygienischer<br />
Einrichtungen ausgerichtet.<br />
Sie beanspruchten aber auch<br />
gerade durch die Diskurse über<br />
soziale Schärfung oder moralische<br />
Disziplinierung die Hygienisierung<br />
des Sozialen, so dass man die Hygiene<br />
als eine Art Drehpunkt für die<br />
Verbreitung, Normierung und die<br />
soziale sowie nationale Kodierung<br />
des Wissens und der anhand dieses<br />
hygienischen Wissens geprägten<br />
transnational vernetzten hybriden<br />
Wissenskulturen wahrnehmen<br />
kann.<br />
In dem untersuchten preußischdeutsch-polnischen<br />
Wissensraum<br />
der Provinz Posen (einer im Zuge<br />
der drei Teilungen Polens und der<br />
napoleonischen Kriege von Preußen<br />
annektierten Provinz mit Sonderstatus),<br />
so meine zu prüfende Kernthe-<br />
se der Arbeit, unterlag die Wissenschaftspopularisierung<br />
sowohl der<br />
Hygiene als auch der anderen Wissenschaften<br />
einer doppelten aufklärerischen<br />
und nationalpolitischen<br />
Strategie und wurde oft politisch,<br />
national, kulturell oder aber konfessionell<br />
instrumentalisiert. Eine der<br />
Popularisierungsstrategien schien<br />
die nationale oder aber die soziale<br />
Mobilisierung zu sein, die häufig in<br />
Form einer direkten Ansprache und<br />
Zuordnung der Leser zu „unserem<br />
Volke“, zu „unseren Vorfahren“ oder<br />
durch eine Anspielung an gewisse<br />
nationale Redewendungen oder<br />
sozialgesellschaftliche Charakteristiken<br />
erfolgte. Anhand der Hygiene<br />
wurden u.a. die Gefahren- und<br />
Modernisierungskonzepte sowie<br />
die nationalen deutsch-polnischjüdischen<br />
und die konfessionellen<br />
Zuschreibungen ausgehandelt und<br />
konstruiert. Die Hygienediskurse<br />
spiegelten insofern nicht nur die<br />
Auseinandersetzungen um kulturelle<br />
und gesellschaftliche Bilder in<br />
den Zeiten nationaler Divergenzen<br />
und der Veränderung der vorherrschenden<br />
Deutungsmuster, sondern<br />
zeigen auch, wie bestimmte<br />
Wissensbestände wie die neusten<br />
medizinischen Entdeckungen oder<br />
Kanalisationseinrichtungen vom<br />
Zentrum in die Grenzregionen (u.a.<br />
Berlin – Posen, Posen – restliche<br />
Provinzteile), aber auch zwischen<br />
mehreren Zentren (u.a. Posen –<br />
Krakau – Lemberg – Warschau<br />
– Berlin – Dresden) vermittelt und<br />
in einem transnational geprägten<br />
Wissensraum aufgenommen und<br />
regional/kulturell/konfessionell angepasst<br />
wurden. Aufgrund ihrer<br />
mehrschichtigen kulturellen, konfessionellen<br />
und nationalen Struktur<br />
– in der Provinz Posen war die<br />
nationale und konfessionelle Zugehörigkeit<br />
nicht immer überlappend<br />
und die sprachlich konstruierte<br />
Identität höchst problematisch –<br />
stellt diese Region ein spannendes<br />
Untersuchungsfeld dar, in dem man<br />
nicht nur die ostmitteleuropäischen<br />
Popularisierungsmuster und wissenskulturelle<br />
Ausprägungen untersuchen,<br />
sondern auch die Mechanismen<br />
des Wissenstransfers, der<br />
Hybridisierung von Wissensräumen<br />
sowie von multilatenten dialogischen<br />
Wissenskulturen aufspüren<br />
und dechiffrieren kann.<br />
Die zu präsentierende Erforschung<br />
der Wissenschaftspopularisierung<br />
und deren Logik streben<br />
einen neuen wissenskulturellen<br />
Blickwinkel auf die regionale und<br />
transnationale Verflechtung der Region<br />
an. Sie hat zum Ziel, die deutschen<br />
Interpretationsparadigmen<br />
in Bezug auf die wissenschaftliche<br />
Kultur im preußisch-deutsch-polnischen<br />
Wissensraum zu überprüfen<br />
sowie der Frage nachzugehen, wie<br />
tiefgründig und dauerhaft Wissensordnungen<br />
und -kulturen durch<br />
solche Praktiken geprägt werden<br />
und welche Aspekte der heutigen<br />
Wissensgesellschaft auf diese Popularisierungsversuche<br />
des 19.<br />
Jahrhunderts zurückzuführen sind.<br />
7
Christian Lotz, Dr.<br />
phil., 1996-2003 Studium<br />
der Geschichte<br />
und Sozialwissenschaften<br />
in Leipzig,<br />
Edinburgh, Wien und<br />
Poznań/Posen. 2007<br />
Promotion in Stuttgart.<br />
2008/09 Forschungsaufenthalte<br />
am <strong>Institut</strong> für Europäische<br />
Geschichte<br />
in Mainz sowie an<br />
den Deutschen Historischen<br />
<strong>Institut</strong>en<br />
in Warschau und<br />
London. Seit Herbst<br />
2010 Stipendiat am<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in<br />
Marburg.<br />
Flusssysteme als<br />
Transportwege der<br />
Holzwirtschaft im<br />
Ostseeraum,<br />
Mitte 19. Jh.<br />
Rohstoffnachschub in Gefahr?<br />
Internationale Debatten um die Verfügbarkeit von Holzressourcen im<br />
Europa des 19. Jahrhunderts<br />
Beinahe wöchentlich hört man in<br />
Presse und Rundfunk von der Sorge<br />
um Ressourcen und Energie:<br />
Mal sind es Chinas Seltene Erden,<br />
dann wieder ein Solarenergie-Projekt<br />
in der Sahara oder das Öl in<br />
der Arktis. Solche Aufmerksamkeit<br />
für Ressourcen und deren Nutzung<br />
ist nicht allein ein Phänomen unserer<br />
heutigen Zeit. In der Geschichte<br />
begegnen uns zahlreiche Fälle, in<br />
denen Menschen über die Nutzung<br />
von Rohstoffen nachdachten und<br />
Maßnahmen ergriffen, um sie gegenwärtig<br />
und zukünftig nutzen zu<br />
können. Einer dieser Rohstoffe ist<br />
Holz.<br />
Historische Forschungsprojekte<br />
haben sich schon seit den 1960er<br />
Jahren mit der Ressource Holz<br />
befasst. Es ist auffällig, dass sich<br />
viele bisherige Studien in engen regionalen<br />
oder nationalen Grenzen<br />
bewegen, obwohl Holz bereits seit<br />
der Frühen Neuzeit grenzübergreifend<br />
gehandelt wurde. Ein wichtiger<br />
Handelsweg zog sich bspw.<br />
aus dem Ostseeraum durch das<br />
Skagerrak zu den Kolonialmächten<br />
des 17. und 18. Jahrhunderts, etwa<br />
nach Großbritannien oder in die<br />
Niederlande.<br />
8<br />
Grenzübergreifende Zusammenhänge<br />
stehen im Mittelpunkt des<br />
hier vorzustellenden Projekts. Es<br />
konzentriert sich auf die zweite<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts und<br />
verfolgt die Frage, wie Wissenschaftler<br />
die gegenwärtige und<br />
zukünftige Verfügbarkeit von Holzressourcen<br />
international diskutierten.<br />
Wie drängend den Zeitgenossen<br />
die Frage der Versorgung mit<br />
Nutzholz erschien, wird deutlich,<br />
wenn man sich beispielhaft vor<br />
Augen führt, dass zwischen 1871<br />
und 1890 der Import von Nutzholz<br />
ins Deutsche Reich um das Vierfache<br />
stieg: Insbesondere Bergwerke<br />
und das Eisenbahnnetz, aber auch<br />
Städte- und Schiffbau verlangten<br />
nach immer größeren Holzmengen.<br />
Die Untersuchung wählt als<br />
Akteure zum einen solche Statistiker,<br />
Forstwissenschaftler und<br />
Ökonomen, die an Forschungseinrichtungen<br />
der Imperien Ostmitteleuropas<br />
(Deutsches Reich,<br />
Österreich-Ungarn, Russland) tätig<br />
waren. Zum anderen werden auch<br />
solche Wissenschaftler berücksichtigt,<br />
die Kontakte nach Ostmitteleuropa<br />
pflegten. Dazu gehören<br />
bspw. Forstwissenschaftler aus<br />
Skandinavien, da der nördliche<br />
Ostseeraum in forstwirtschaftlicher<br />
Hinsicht von ganz ähnlichen<br />
Entwicklungen geprägt war wie<br />
der südliche, aber auch Fachleute<br />
aus Großbritannien, die sich um<br />
den Holznachschub für die eigene<br />
Volkswirtschaft sorgten und daher<br />
aufwändige Erkundungen über die<br />
verfügbaren Holzressourcen in Ostmitteleuropa<br />
anstrengten.<br />
Eine markante Entwicklung, die<br />
die Diskussion unter Fachwissenschaftlern<br />
zwischen 1870 und 1914<br />
prägte, lässt sich als „Verschiebung<br />
des räumlichen Horizonts“ charakterisieren:<br />
Noch Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts orientierten sich Erschließung<br />
und Nutzung von Holzressourcen<br />
beinahe ausschließlich<br />
an vorhandenen Wasserwegen.<br />
Da Holz eine schwere Ware ist,<br />
wären andere Transportwege zu<br />
kostspielig gewesen. Der räumliche<br />
Horizont, in dem die Akteure<br />
die Erschließung von Holzressourcen<br />
diskutierten, orientierte sich<br />
daher an den Wasserscheiden in<br />
Europa. Die beigefügte Karte zeigt<br />
dies exemplarisch für jene Flüsse,<br />
die in die Ostsee münden (vgl.<br />
dazu Karte: Der Ostseeraum). Mit<br />
der Ausbreitung des Eisenbahnnetzes<br />
in Ostmitteleuropa während<br />
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
dehnte sich nicht nur der<br />
nutzbare Raum für den Holzhandel<br />
über die Ostsee aus, sondern<br />
auch der räumliche Horizont der<br />
fachwissenschaftlichen Debatte.<br />
Geradezu beispielhaft wurde dies<br />
in den Verhandlungen des internationalen<br />
forstwissenschaftlichen<br />
Kongresses 1890 in Wien deutlich:<br />
Anders als noch Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
erschien den anwesenden<br />
Wissenschaftlern nun jede Region<br />
erschließbar, und sei sie noch so<br />
abgelegen. Daher hob eine Debatte<br />
an, ob und inwieweit die Forstwissenschaft<br />
an tradierten Konzepten<br />
von Nachhaltigkeit (hier rein ökono-
misch verstanden als das Prinzip,<br />
nur so viel Holz zu fällen, wie nachwachsen<br />
kann) festhalten müsse.<br />
Einerseits meldeten sich Stimmen,<br />
die eine Überwindung solcher<br />
Nachhaltigkeitsvorstellungen for-<br />
Die Entstehung von Ludwik Flecks Wissenschaftstheorie<br />
in der Wissenskultur<br />
der Lemberger Moderne<br />
Die Leitfrage des Marburger Leibniz<br />
Graduate School-Stipendienprogramms<br />
nach der transnationalen<br />
Zirkulation, Transformation und Tradierung<br />
von Wissen soll in meinem<br />
Forschungsprojekt selbstreflexiv<br />
weitergetrieben werden, indem nun<br />
gefragt wird, in welchen sozialen<br />
Kontexten und unter welchen historischen<br />
und kulturellen Voraussetzungen<br />
Theorien entstehen und<br />
sich durchsetzen können, die die<br />
kulturelle und soziale Bedingtheit<br />
von Wissenschaft behaupten. Ein<br />
früher Kronzeuge für die theoretische<br />
Grundlegung einer kulturalistischen<br />
Wissenschaftsauffassung<br />
ist der aus Lemberg stammende<br />
polnische Mediziner und Wissenschaftstheoretiker<br />
Ludwik Fleck<br />
(1896-1961).<br />
In meinem Projekt will ich zeigen,<br />
dass Flecks Theorie über die sich<br />
durch die Zirkulation und Transfomation<br />
von Ideen formierenden<br />
Denkstile und Denkkollektive ihrerseits<br />
in einem ganz bestimmten<br />
wissenskulturellen Milieu entstand,<br />
das sich durch eine ungewöhnliche<br />
dichte Vernetzung von Literatur,<br />
Kunst und Wissenschaften auszeichnete<br />
und innerhalb dessen<br />
sich zudem spezifische experimentelle<br />
Praktiken in Wissenschaft und<br />
Kunst ausgebildet hatten. Dieser<br />
fluktuierende ‚Denkverkehr‘, der auf<br />
engem Raum quer durch alle Disziplinen<br />
und kulturellen Gebiete zwischen<br />
hervorragenden Forschern<br />
und Kulturschaffenden stattfand,<br />
von denen viele seinerzeit zur Weltspitze<br />
zählten, brachte Flecks kulturalistische<br />
Theorie hervor. Am<br />
derten, da mit der Entwicklung des<br />
Verkehrswesens Holz von überall<br />
herangeschafft werden könne. Andererseits<br />
ließen sich Mahnungen<br />
vernehmen, dass die Entwicklung<br />
des Eisenbahnwesens eine Gefahr<br />
Lemberger ,Denkverkehr‘ nahmen<br />
u.a. teil: der Maler, Logiker und Philosoph<br />
Leon Chwistek, der Mathematiker<br />
und Begründer der Lemberger<br />
Mathematikerschule Hugo<br />
Steinhaus, der Serologe, Blutgruppen-<br />
und Rhesusfaktor-Entdecker<br />
sowie Erfinder des Vaterschaftstests<br />
Ludwik Hirszfeld, der Kinderarzt,<br />
Direktor der Lemberger Oper<br />
und Fotograf, Erfinder der fotografischen<br />
Blende Franciszek Groër,<br />
der Mathematiker und Begründer<br />
der modernen Funktional-Analysis<br />
Stefan Banach, der Psychiater Jakob<br />
Frostig und die Pädagogin Marianne<br />
Frostig und schließlich der<br />
Biologe Rudolf Weigl, der mit seiner<br />
Forschergruppe, zu der auch Fleck<br />
gehörte, den Anti-Fleckfieberimpfstoff<br />
entdeckte, wofür er mehrfach<br />
zum Nobel-Preis nominiert war.<br />
Fleck führte auch Kontroversen mit<br />
der Philosophin Izydora Dąmbska,<br />
dem Psychologen Tadeusz Tomaszewski<br />
und dem Psychiater<br />
Tadeusz Bilikiewicz. Zum gleichen<br />
bedeute, da nun auch jene Regionen<br />
angetastet würden, die lange<br />
Zeit als sichere Reserven für den<br />
Holzbedarf der Volkswirtschaften<br />
Europas angesehen worden waren.<br />
Zeitpunkt dominierten die Diskussionen<br />
in Lemberg die Philosophen<br />
aus der berühmten, sich der<br />
Semantik, Wissenschaftstheorie<br />
und Logik widmenden Lemberg-<br />
Warschauer Schule, wie Kazimierz<br />
Twardowski, Kazimierz Ajdukiewicz,<br />
Alfred Tarski und Władysław<br />
Tartakiewicz, aber auch Roman<br />
Ingarden war seinerzeit in der<br />
Stadt. Leopold Infeld – der spätere<br />
wissenschaftliche Partner Einsteins<br />
– begann seine Laufbahn<br />
als Physiker, Bronisław Malinowski<br />
begründete zu dieser Zeit die moderne<br />
Ethnologie, die vielseitigen<br />
Künstler Stanisław Lem, der als<br />
Junge Flecks Labor besuchte, und<br />
Stanisław Ignacy Witkiewicz zählten<br />
wie Bruno Schulz und Joseph<br />
Roth zum weiteren Umfeld Flecks.<br />
In diesem einzigartigen kulturellen<br />
und wissenschaftlichen Milieu<br />
Lembergs entwickelt Fleck seine<br />
Theorie über die Entstehung wissenschaftlicher<br />
Tatsachen, der zufolge<br />
Entdeckungen nicht Resultate<br />
9<br />
Sylwia Werner<br />
studierte Germanistik<br />
in Olsztyn<br />
und promovierte<br />
in Berlin. Sie<br />
war WissenschaftlicheMitarbeiterin<br />
an der Goethe-<br />
Universität Frankfurt<br />
und am Berliner<br />
Max-Planck-<br />
<strong>Institut</strong> für Wissenschaftsgeschichte.<br />
An der Leibniz<br />
Graduate School<br />
bearbeitet sie ein<br />
Postdoc-Vorhaben<br />
über Ludwik<br />
Flecks Wissenschaftstheorie.
Konrad Hierasimowicz<br />
studierte<br />
Soziologie, Informatik<br />
und Europäische<br />
Ethnologie /<br />
Kulturwissenschaft in<br />
Marburg. Seit 2010<br />
ist er Doktorand an<br />
der Leibniz Graduate<br />
School. Seine<br />
Arbeitsschwerpunkte<br />
sind Neue Medien;<br />
Minderheiten, Identitäten<br />
und nationale<br />
Diskurse in Ostmittel-<br />
und Osteuropa<br />
mit Schwerpunkt<br />
Belarus.<br />
einzelner Individuen sind, sondern<br />
von (Denk-)Kollektiven in komplexen<br />
Austauschprozessen unter bestimmten<br />
sozialen und psychologischen<br />
Umständen erzeugt werden.<br />
Was liegt nun näher als Flecks The-<br />
Von zweimal Belarus zu Belarus 2.0<br />
Mediale Narration nationaler Vergangenheit und Identität im Übergang<br />
von Printmedien zu Social Media<br />
Im Herbst 2011 jährt sich der Austritt<br />
der Republik Belarus (Weißrussland)<br />
aus der Sowjetunion<br />
zum zwanzigsten Mal. Doch selbst<br />
nach zwei Jahrzehnten staatlicher<br />
Unabhängigkeit existiert dort kein<br />
allgemein anerkanntes Bild der nationalen<br />
Geschichte und Identität.<br />
Zwei disparat operierende Diskurslager<br />
spalten die Gesellschaft und<br />
polarisieren sich entlang einer Ost-<br />
West-Achse historischer Deutung:<br />
Der offizielle Standpunkt tendiert<br />
dazu, westliche Einflussnahmen als<br />
fremd und kolonialistisch zu interpretieren,<br />
der oppositionelle sieht<br />
dagegen in der russischen und sowjetischen<br />
Präsenz überwiegend<br />
imperialistische und feindliche Motive.<br />
Seit dem letzten Jahrzehnt finden<br />
diese Diskurse zunehmend im<br />
Internet statt. Primäre Motive sind<br />
dabei politischer und ökonomischer<br />
Natur: Die staatliche Zensur, welche<br />
das Publizieren abweichender Ansichten<br />
einschränkt, wird dadurch<br />
kostengünstig umgangen. In meiner<br />
Dissertation, die im Rahmen der<br />
Leibniz Graduate School entsteht,<br />
möchte ich die aus unterschiedlichen<br />
Wissenskulturen heraus geführten<br />
Online-Diskurse belarussischer<br />
Vergangenheitsdeutung und<br />
Identität anhand eines geeigneten<br />
diskursanalytischen Instrumentariums<br />
untersuchen. In erster Linie<br />
soll dabei überprüft werden, inwiefern<br />
die nationalen Diskurse im Internet<br />
ihren in der Printmedien-Ära<br />
tradierten Praktiken folgen und wie<br />
offen sie neuen Logiken der Wissensvermittlung<br />
gegenüber sind.<br />
10<br />
orie auf ihn selbst anzuwenden?<br />
Den seinerzeit in Lemberg quer<br />
durch die Disziplinen und zwischen<br />
Wissenschaften und Künsten zirkulierenden<br />
Gedanken, Konzepten,<br />
Wahrnehmungsweisen, Methoden,<br />
Die Geschichte der impliziten<br />
Diskursmotive reicht bis ins 19.<br />
Jahrhundert zurück, als die Idee einer<br />
modernen belarussischen Nation<br />
durch Aktivitäten der im vor- und<br />
transnationalen Raum handelnden<br />
Wissenschaftler und Intellektuellen<br />
entstand. Die überwiegend aus<br />
russischem und polnischem Kulturraum<br />
stammenden Forscher untersuchten<br />
ethnokulturelle Besonderheiten<br />
nordwestlicher Gebiete des<br />
Zarenreiches und lieferten national<br />
motivierten Regionaleliten wissenschaftlich<br />
untermauerte Leitlinien,<br />
um die Geschichte des Großfürstentums<br />
Litauen, in dessen Grenzen<br />
sich das heutige Belarus bis 1795<br />
befand, aus einer belarussisch nationalen<br />
Perspektive zu deuten. Das<br />
auf dieser Grundlage ausgearbeitete<br />
nationalgeschichtliche Wissen<br />
verließ jedoch, bedingt durch den<br />
geringen Urbanisierungsgrad und<br />
niedrigen Bildungsstand der Bevölkerung,<br />
kaum seine überschaubar<br />
kleinen Kreise. Im Zuge des 20.<br />
Jahrhunderts veranlassten mehrere<br />
Machtsysteme Neuinterpretationen<br />
der belarussischen Geschichte<br />
und hinterließen die sich bis in die<br />
Gegenwart auswirkende asymmetrische<br />
Koexistenz disparater Entwürfe.<br />
Massenwirksame Verbreitungsmechanismen<br />
nationaler Geschichtskonzepte<br />
sind in Belarus,<br />
wie auch in anderen Ländern, stark<br />
von Entscheidungen staatlicher <strong>Institut</strong>ionen<br />
abhängig. In den letzten<br />
Jahren eröffnet jedoch das Internet<br />
immer mehr Menschen den Zugang<br />
zu alternativen Informationsquellen.<br />
Motiven und Stilen gilt es en detail<br />
nachzuspüren, um so die Formierungsprozesse<br />
eines spezifischen<br />
Lemberger Denkstils transparent zu<br />
machen.<br />
In Belarus ist das Medium besonders<br />
unter den jüngeren Bevölkerungsschichten<br />
populär und gilt als<br />
eine Oase des Pluralismus, den die<br />
klassischen Medien nicht ansatzweise<br />
bieten. Nationale Geschichte<br />
und Identität sind ihrem kontroversen<br />
Potential entsprechend stark<br />
vertretene Themen, und obwohl<br />
derartige publizistische Tätigkeiten<br />
bisher geringe Tragweite aufweisen,<br />
ist eine positive Entwicklung<br />
zu beobachten. Ein bedeutender<br />
Teil der Akteure befindet sich im<br />
Ausland und wäre ohne das Internet<br />
vom inländischen Diskurs größtenteils<br />
isoliert.<br />
Die Beschleunigung und Enträumlichung<br />
der Informationsverbreitung<br />
charakterisieren jedoch<br />
nicht den markantesten Unterschied<br />
zwischen Internet und Printmedien.<br />
Das qualitative Novum verbirgt sich<br />
hinter dem vereinfachenden Begriff<br />
Web 2.0 (oder Social Media), der<br />
die rasante Entfaltung interaktiver<br />
und kollaborativer Potentiale des<br />
Mediums bezeichnet: Jeder Nutzer<br />
kann bei Bedarf in den dynamisch<br />
und egalitär organisierten Herstellungsprozess<br />
der Online-Inhalte<br />
eingreifen. Die Wikipedia veranschaulicht<br />
als bevorzugtes Beispiel<br />
dieser Entwicklung, wie aus Beiträgen<br />
einzelner Teilnehmer eine ansehnliche,<br />
von unten organisierte<br />
Wissenssammlung emergiert. In einer<br />
aktuellen Studie zu diesem Thema<br />
kommt die Autorin zum Ergebnis,<br />
dass dieser Praxiswandel in der<br />
Wissenskonstruktion und -vermittlung<br />
nachhaltige und grundlegende<br />
Veränderungen der Wissenskultur
Kamunikat.org – ein Web 2.0 basiertes belarussisches Kulturportal mit<br />
umfangreicher Sammlung sonst schwer erhältlicher, von der offiziellen<br />
Realitätsdeutung abweichendender Literatur<br />
nach sich zieht: Die zunehmend<br />
verbreitete Erkenntnis, dass Wissen<br />
ein gesellschaftliches Konstrukt<br />
ist, verringert seinen universalen<br />
Anspruch und stellt eine Koexistenz<br />
potentiell widersprüchlicher<br />
Wahrheiten in Aussicht. Da sich die<br />
Wissensproduktion jedoch nicht<br />
dauerhaft durch Beliebigkeit auszeichnen<br />
kann, kann das klassische<br />
Wahrheitsmodell des Wissens vom<br />
Konsensmodell sukzessiv abgelöst<br />
werden. (siehe Daniela Pscheida:<br />
Das Wikipedia-Universum. Wie das<br />
Internet unsere Wissenskultur verändert,<br />
Bielefeld 2010.)<br />
Estnische Kulturgeschichte in Deutschland?<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Kulturvermittlung in Zeiten des<br />
Kalten Krieges<br />
Der Austausch von Kultur, von Wissen<br />
über Kultur ist heute ein vieldiskutiertes<br />
Thema in Bezug auf einzelne<br />
Länder und Regionen und ist<br />
nicht zuletzt auch mit der Vermittlung<br />
im www-Netz verbunden.<br />
Die hier vorgestellte Arbeit beschäftigt<br />
sich mit einer Kulturvermittlung<br />
in einem besonderen<br />
Sinne des Wortes, nämlich mit der<br />
verbindenden Tätigkeit durch eine<br />
Person. Somit steht nicht ein Ort<br />
oder eine Metropole als Kulturum-<br />
Betrachtet man belarussische Diskurse<br />
über nationale Identität und<br />
Geschichte aus dieser Perspektive<br />
und stellt sich ihre Ost-West-<br />
Deutungsachse in einem zweidimensionalen<br />
Grafen vor, bietet<br />
sich für seine vertikale Achse die<br />
Diskursoffenheit als eine sinnvoll<br />
korrespondierende Größe an. Ihre<br />
Ausprägungen reichen von stark<br />
monologischen bis zu pluralistischdialogischen<br />
Standpunkten: Ein Teil<br />
der Akteure beider Lager verharrt in<br />
klassischen Deutungsmustern und<br />
reproduziert Wissen stets im Rahmen<br />
tradierter Narrative, ein an-<br />
schlagplatz im Fokus, sondern eine<br />
ganz konkrete Person als Mittler<br />
von Informationen, die der wissenschaftlichen<br />
und der ethnokulturellen<br />
Geistesgeschichte eines Landes<br />
zugehören.<br />
Der estnische Literatur- und Kulturwissenschaftler<br />
Otto A. Webermann<br />
(1915-1971) teilt in seinem<br />
Lebensweg einerseits das typische<br />
Schicksal eines Esten in der Heimat,<br />
dann im Exil; andererseits hat<br />
er eine ganz besondere Stellung<br />
derer Teil versteht Geschichte und<br />
Identität als einen Prozess, der ein<br />
Optimum nur mit offenen Diskursen<br />
erreichen kann.<br />
An dieser Stelle knüpft meine<br />
Arbeit an und untersucht, wie sich<br />
der erfolgende mediale Wandel des<br />
Umgangs mit Wissen auf die Diskurse<br />
über belarussische nationale<br />
Geschichte auswirkt. Die zentrale<br />
Frage betrifft die aus unterschiedlichen<br />
Wissenskulturen heraus<br />
geführten diskursiven Deutungs-<br />
und Narrationslogiken historischer<br />
Ereignisse und die Resultate der<br />
Konfliktaustragung in einem konsensorientierten,<br />
klassische Machtstrukturen<br />
umgehenden Medium.<br />
Kann im Web 2.0 eine populärwissenschaftliche<br />
Synthese disparater<br />
Geschichtsentwürfe entstehen und<br />
lassen sich Verlagerungen der Diskurse<br />
im Rahmen des oben vorgeschlagenen<br />
Grafen beobachten?<br />
Ferner motiviert die leitende Frage<br />
zu allgemeineren Überlegungen<br />
über Chancen und Herausforderungen<br />
der sich durch die Neuen<br />
Medien wandelnden Wissens- und<br />
Wissenschaftspraxis im Hinblick<br />
auf die bestehende Möglichkeit der<br />
Objektivierung wissenskulturell bedingter<br />
Deutungsmuster und ihre<br />
reflexive Einbindung in einen transnationalen<br />
historischen Diskurs.<br />
Otto A. Webermann 1945 aus der<br />
Kriegsgefangenschaft kommend,<br />
Bildarchiv <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>: 159661<br />
11<br />
Dorothee M.<br />
Goeze<br />
studierte Buchwesen,<br />
Vergleichende<br />
Sprachwissenschaft,<br />
Geschichte<br />
in Mainz und<br />
Tartu/Estland,<br />
und arbeitete als<br />
wissenschaftliche<br />
Angestellte an der<br />
Universität Mainz.<br />
Seit 2000 ist sie<br />
Mitarbeiterin in<br />
der Dokumentesammlung<br />
des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s.<br />
Ihre Arbeitsgebiete<br />
umfassen:<br />
Sprachen und ihre<br />
soziokulturellen<br />
Hintergründe, Kulturwissenschaft,<br />
Estland und die<br />
Geschichte des<br />
Baltikums.
Otto A. Webermann<br />
zeigt einen<br />
Band aus der Universitätsbibliothek<br />
Dorpat, Aufnahme<br />
wohl 1943,<br />
Bildarchiv <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>: 168517<br />
Horst von Chmielewski<br />
ist promovierter<br />
Slavist und<br />
wissenschaftlicher<br />
Bibliothekar. Von<br />
April 1972 bis April<br />
1999 war er Leiter<br />
der Bibliothek des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s.<br />
innerhalb der wissenschaftlichen<br />
Diskussion seiner Zeit inne.<br />
Der Zeitrahmen seines Wirkens<br />
umfasst die freie Republik Estland,<br />
die Zeit des Zweiten Weltkriegs in<br />
Estland und Deutschland und die<br />
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in<br />
Deutschland.<br />
Eine bloße Biografie mit der<br />
Schilderung der Lebensstationen<br />
wird der Würdigung dieses estnischen<br />
Gelehrten aber nicht gerecht.<br />
Die Betrachtung eines Lebensweges<br />
unter den Aspekten<br />
eines bestimmten Kapitals, das ein<br />
Mensch für seine wissenschaftlichen<br />
Arbeiten nutzt und was ihn<br />
von anderen Zeitgenossen abhebt,<br />
ist mit vielerlei Fragestellungen behaftet.<br />
Diese fließen, mit Bezug auf<br />
die Kulturtheorie Pierre Bourdieus,<br />
in die hier vorgestellte Arbeit ein:<br />
12<br />
Webermanns Bildungsweg und<br />
seine Forschungsthemen, die er<br />
in Veröffentlichungen, in Lehrveranstaltungen<br />
und Vorträgen präsentieren<br />
konnte. Überlegungen<br />
darüber führen immer zur Wahrnehmung<br />
der politischen und auch<br />
bürokratischen Umstände, denen<br />
Webermann ausgesetzt war. Sein<br />
persönliches „Kulturkapital“ hat er<br />
letztendlich eher als „unsichtbares<br />
Fluchtgepäck“ aus Estland mitgenommen,<br />
als er 1944 sein Heimatland<br />
verließ. Die Möglichkeiten und<br />
Grenzen der Vermittlung dieses<br />
„unsichtbaren Kapitals“ werden<br />
erläutert: Da Webermann keinerlei<br />
einflussreiches oder gar prestigeträchtiges<br />
Amt wahrnehmen<br />
konnte, gilt es, sich mit seinen Forschungen<br />
und seiner Arbeitsmethode<br />
näher zu beschäftigen: Er hat<br />
sich im literaturwissenschaftlichen<br />
und im sprach- und kulturwissenschaftlichen<br />
Bereich auf estnische<br />
und baltische Themen konzentriert.<br />
Bei der Betrachtung der Themen<br />
ist durchaus zu berücksichtigen, in<br />
welchem Zusammenhang er arbeitete:<br />
Nicht selten handelte es sich<br />
um Auftragsarbeiten, die er anfertigen<br />
musste, um Geld zu verdienen.<br />
In Selbstzeugnissen gibt es aber<br />
Erkenntnisse über den Mittelpunkt<br />
seiner eigenen Forschungen: In<br />
diesem stand das 18. Jahrhundert,<br />
das durch aus Deutschland<br />
kommende Einflüsse auf die Geistesgeschichte<br />
Estlands (so in der<br />
Herrnhuter Bewegung und der Aufklärung)<br />
geprägt war. Webermanns<br />
bedeutsame Leistung hierbei liegt<br />
in seiner weitsichtigen, alle verschiedenen<br />
Aspekte bedenkenden<br />
Art der wissenschaftlichen Beschäftigung,<br />
gerade auch mit der<br />
Berücksichtigung und Würdigung<br />
von Kultureinflüssen, die auf die<br />
estnische kulturelle Eigenart wirkten.<br />
Diese negierte er in ihrer Bedeutung<br />
für die Entwicklung der<br />
estnischen Kulturgeschichte nicht<br />
und stellte ihnen die eigene estnische<br />
Historie als gleichwertig gegenüber.<br />
In diesem Sinne war Webermann<br />
mit seinem Standort Göttingen (ab<br />
1946 bis zu seinem Tod 1971) ein<br />
Vermittler von Wissen über Estland<br />
allgemein, über die estnische Geschichte,<br />
Literaturgeschichte, Folklore<br />
und Sprachwissenschaft. Dargestellt<br />
werden seine vermittelnden<br />
Tätigkeiten zu Esten im weiteren<br />
Ausland (wie USA, Kanada oder<br />
Schweden), zu den Deutschbalten<br />
in Deutschland und nicht zuletzt zu<br />
den Esten in der Heimat. Daneben<br />
scheint immer wieder eine neue<br />
Art der Betrachtungsweise der<br />
gesamtbaltischen Kulturgeschichte<br />
jenseits nationaler Schranken<br />
durch Webermann auf.<br />
Bibliothekarische Polen-Reisen<br />
in dramatischer Zeit (1979 bis 1983)<br />
Vor 30 Jahren erschütterten und<br />
faszinierten die Bilder von den<br />
Streiks auf der Danziger Lenin-<br />
Werft die Welt und es erscheint gerechtfertigt,<br />
dass die Medien auch<br />
hierzulande kürzlich wieder daran<br />
erinnerten, dass Polen seinerzeit<br />
im Ostblock einen Außenseiter<br />
darstellte. Die Danziger Ereignisse<br />
bildeten den Höhepunkt eines<br />
zehnjährigen Konflikts zwischen<br />
Arbeiterschaft und Parteiführung in<br />
Polen. Da meine erste Polenreise in<br />
den Mai 1979 und eine weitere in<br />
den Sommer 1980 fiel, wurde ich<br />
zeitweise Zeuge einer stürmischen<br />
Entwicklung.<br />
Für das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> war Polen<br />
ein einfacherer Partner als die<br />
ideologisch fixierte ČSSR oder die<br />
baltischen Sowjetrepubliken. Im<br />
<strong>Institut</strong> galt Polen auch auf Grund<br />
seines geografisch und bevölkerungsmäßig<br />
größeren Gewichts<br />
als besonders interessanter Partner.<br />
Ich übernahm 1976 das Polen-Referat<br />
innerhalb der Bibliothek<br />
und begann 1978 mit Vorbereitungen<br />
einer ersten Polen-Reise eines<br />
Bibliotheksleiters, nachdem<br />
Tauschbeziehungen ohne persönliche<br />
Kontakte bereits seit den sechziger<br />
Jahren bestanden. Die Reise<br />
fiel in die Zeit eines gesellschaftlichen<br />
Aufbruchs, gekennzeichnet<br />
einerseits durch die gerade erfolg-
te Wahl Karol Wojtyłas zum polnischen<br />
Papst, andererseits durch<br />
die sich verstärkenden sozialen<br />
Spannungen nach den Arbeiteraufständen<br />
von 1970 und 1976,<br />
die schließlich zur Gründung der<br />
„Solidarność“ führen sollten, insgesamt<br />
in eine Zeit der gesellschaftlichen<br />
Öffnung des Landes.<br />
Meine durch Korrespondenz mit<br />
den jeweiligen Einrichtungen vorbereitete<br />
Reise begann mit einem<br />
Besuch in einem Vorort von Krakau<br />
bei Prof. Dr. Alfons Schletz, einem<br />
Experten für die Geschichte<br />
der katholischen Kirche Polens und<br />
Herausgeber der Zeitschrift „Nasza<br />
Przesłość“. Prof. Schletz stellte<br />
in seinem <strong>Institut</strong> die Dokumentation<br />
seiner wissenschaftlichen und<br />
redaktionellen Arbeit in eindrucksvoller<br />
Weise vor. Ein sich anschließender<br />
Besuch der „Jagiellonischen<br />
Bibliothek“ in Krakau diente<br />
der gegenseitigen Information mit<br />
dem Ziel einer möglichen Ausweitung<br />
der Tauschbeziehungen und<br />
dem Kennenlernen der zweitwichtigsten<br />
Bibliothek Polens und ihrer<br />
Schätze.<br />
Besondere Erwartungen hatte ich<br />
an meinen Besuch in der Biblioteka<br />
Narodowa, der Nationalbibliothek<br />
Polens in Warschau, geknüpft.<br />
Sie wurden nicht enttäuscht. Der<br />
damalige Generaldirektor und angesehene<br />
Historiker Prof. Witold<br />
Stankiewicz und der Leiter der Erwerbungsabteilung<br />
Dr. Stanisław<br />
Kamiński gehörten nicht zu den<br />
ideologisch fixierten Vertretern ihres<br />
Fachs. Prof. Stankiewicz bezeichnete<br />
damals die bibliothekarische<br />
Welt als „Eine Welt“, unabhängig<br />
vom Eisernen Vorhang. Die Ergebnisse<br />
des Besuchs sollten über Jahre<br />
zum erheblichen Nutzen beider<br />
Seiten sein, mit der schmerzlichen<br />
Unterbrechung im Anschluss an<br />
die Ausrufung des Kriegsrechts im<br />
Dezember 1981 durch General Jaruzelski.<br />
Von besonderem Wert für mich<br />
war die Information über eine neue<br />
Aktivität im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br />
der Nationalbibliothek<br />
gemeinsam mit der Einrich-<br />
tung Polonia. 1979 war erstmals ein<br />
Kurs des polnischen Bibliothekswesens<br />
und der polnischen Kultur in<br />
Warschau veranstaltet worden. Zu<br />
dem für das Jahr 1980 vorgesehenen<br />
Kurs erhielt ich eine Einladung<br />
durch Vermittlung von Dr. Kamiński.<br />
So war eine Vertiefung der Kontakte<br />
in die Wege geleitet. Ich möchte<br />
nicht vergessen, meinen sich anschließenden<br />
Besuch in der Univer-<br />
sitätsbibliothek in Posen wenigstens<br />
zu erwähnen, wo man sich ebenfalls<br />
für eine Fortsetzung der Tauschbeziehungen<br />
interessierte.<br />
Das Jahr 1980 führte mit der Zunahme<br />
der Unzufriedenheit der Bevölkerung,<br />
besonders der Arbeiter,<br />
zu der in Osteuropa einmaligen Bewegung,<br />
dem Kampf der Unabhängigen<br />
Gewerkschaft Solidarność<br />
um das Durchsetzen eigener Forderungen<br />
gegen den Parteiapparat.<br />
Intellektuelle aus der Gruppierung<br />
KOR (ursprünglich Komitee<br />
zur Verteidigung der Arbeiter, später<br />
in Komitee zur gesellschaftlichen<br />
Selbstverteidigung umbenannt) hatten<br />
diese Bewegung unterstützt und<br />
sich nach der Gründung der Gewerkschaft<br />
Solidarność aufgelöst.<br />
Zur Zeit des Warschauer Bibliothekskurses<br />
im Juli und frühen August<br />
entwickelten sich lokale Warn-<br />
streiks in Teilen des Landes und<br />
kurz darauf die Streiks in der Danziger<br />
Leninwerft. So fiel dieser Kurs<br />
in eine sich dramatisierende Zeitspanne.<br />
Natürlich waren die Hauptthemen<br />
des Kurses schon länger<br />
vorbereitet und boten eine zu erwartende<br />
stolze Vorstellung nationaler<br />
kultureller Werte. Immerhin wagte<br />
einer der Referenten, Dr. Andrzej<br />
Paczkowski, eine kritische Bewer-<br />
Teilnehmende des Warschauer Bibliothekskurses im Sommer 1980 (v.l.n.r.):<br />
Joseph Placek, Horst v. Chmielewski, Kursteilnehmerin aus USA, Name unbekannt,<br />
Generaldirektor der Nationalbibliothek Warschau Prof. Dr. Witold Stankiewicz<br />
und Kursleiterin Barbara Białkowska<br />
tung der polnischen Presse. Die Vorträge<br />
und Führungen des Kurses fanden<br />
im historischen Krasinski-Palais<br />
in Warschau statt, in dem auch die<br />
Sondersammlungen für Kartografie,<br />
Musikalien, Handschriften und Frühdrucke<br />
untergebracht sind. Neben<br />
den Vorträgen und Führungen, auch<br />
zu Warschauer Friedhöfen, wurden<br />
auch Theateraufführungen vermittelt<br />
oder Sonderveranstaltungen. Im<br />
Rahmen des Kurses wurden zwei<br />
Exkursionen angeboten, einmal in<br />
den Norden mit dem Schwerpunkt<br />
Thorn, wo die damals modernste<br />
Universitätsbibliothek Polens vorgestellt<br />
wurde, zum anderen nach Krakau,<br />
Auschwitz und Zakopane. Alle<br />
Vorträge und Führungen wurden in<br />
polnischer Sprache gehalten.<br />
1981 war das Jahr der Hoffnungen,<br />
gewagter intellektueller Äußerungen<br />
wie etwa die der In-Fra-<br />
13
ge-Stellung eines übersteigerten<br />
polnischen Patriotismus durch<br />
Jan Józef Lipski („Zwei Vaterländer,<br />
zwei Patriotismen“), aber auch<br />
der Ängste der Polen, die sich im<br />
Dezember mit der Ausrufung des<br />
Kriegsrechts bestätigen sollten.<br />
Vorher hatten sich im Rahmen der<br />
Solidarność Gruppen von Bibliothekaren<br />
landesweit zusammengeschlossen,<br />
deren verschiedene<br />
Forderungen an die Regierung vor<br />
allem die Abschaffung der Zensur<br />
und den uneingeschränkten Zugang<br />
westlicher Literatur zu den<br />
polnischen Bibliotheken beinhalteten.<br />
Dr. Kamiński stellte eine Veröffentlichung<br />
inoffizieller Art unserer<br />
Bibliothek zur Verfügung, die in<br />
deutscher Übersetzung auch die<br />
Leser der Dokumentation Ostmitteleuropa<br />
erreichte.<br />
14<br />
Das Jahr 1982 brachte einen großen<br />
Rückschritt für die kulturellen und<br />
wissenschaftlichen Beziehungen<br />
Polens zu den Ländern der westlichen<br />
Welt. An eine sinnvolle Weiterführung<br />
der bisherigen Zusammenarbeit<br />
war zunächst nicht zu<br />
denken. Die Spitze der Warschauer<br />
Nationalbibliothek wurde ausgetauscht.<br />
Die neue strikte Parteilinie<br />
in der Bibliothek veranlasste den<br />
Weggang einer Reihe von Kollegen.<br />
Unter ihnen war auch S. Kamiński,<br />
der die Leitung der Erwerbungsabteilung<br />
der Universitätsbibliothek<br />
Warschau übernahm. Ende 1982<br />
unternahm ich eine private Reise<br />
nach Warschau, um eine offizielle<br />
Reise für das Jahr 1983 vorzubereiten.<br />
Bei meinem Aufenthalt in Warschau<br />
berichtete man mir über die<br />
Leiden der vielen Inhaftierten, aber<br />
auch von der Dankbarkeit für Hilfslieferungen<br />
aus Deutschland. In einer<br />
Kirche der Warschauer Altstadt<br />
waren die Folgen der Übergriffe von<br />
ZOMO-Soldaten auf hilflose Zivilisten<br />
zu sehen. Eine gewisse Normalisierung<br />
war 1983 festzustellen. Dr.<br />
Kamiński, nun in der Universitätsbibliothek<br />
Warschau, nutzte seine<br />
Erfahrungen im internationalen<br />
Schriftentausch unter stillschweigender<br />
Duldung von Vorgesetzten.<br />
Bei meinem ersten Besuch in<br />
der Bibliothek der KUL, der Katholischen<br />
Universität in Lublin, erhielt<br />
ich liebenswürdige Unterstützung<br />
durch Andrzej Paluchowski, den<br />
damaligen Leiter der Bibliothek. Die<br />
schon länger bestehenden guten<br />
Tauschbeziehungen konnten teilweise<br />
erweitert werden.<br />
Erfreulicherweise wurden in den<br />
folgenden Jahren Auslandsreisen<br />
für polnische Bibliothekare wieder<br />
möglich. Zu den besonders beliebten<br />
Zielen gehörten das Deutsche<br />
Polen-<strong>Institut</strong> in Darmstadt und<br />
auch das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in Marburg.<br />
Für Dr. Kamiński konnte ich,<br />
wie später auch für Dr. Cybulski<br />
und Stefan Czaja, vom Deutschen<br />
Bibliotheksinstitut finanzierte Reisen<br />
in die Bundesrepublik vermitteln.<br />
Zu meinen guten polnischen<br />
Freunden zählte auch der Volkskundler,<br />
Schriftsteller und spätere<br />
Verleger Przemysław Burchard und<br />
der international hochgeschätzte<br />
Grafiker Wojciech Jakubowski, für<br />
den ich in der Bibliothek des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
eine Exlibris-Ausstellung<br />
vorbereiten konnte. Herr Jakubowski<br />
ist als Einziger meiner<br />
Freunde noch unter den Lebenden.<br />
So verbindet sich mit dem Rückblick<br />
auf eine spannungsreiche Zeit<br />
auch ein wenig Traurigkeit. Ein kleiner<br />
Trost ist es, dass die verstorbenen<br />
Freunde das Ende des Kommunismus<br />
und das Wiedererstehen<br />
eines freien Polen noch für einige<br />
Zeit erleben durften und somit auch<br />
eine Epoche erleichterter kultureller<br />
und bibliothekarischer Beziehungen<br />
zwischen Ost und West.
Tagungen und Ausstellungen<br />
Badekultur und Bäderarchitektur an der<br />
Ostsee als Gegenstand von Tagung und<br />
Ausstellung<br />
Um 1800 entstanden die ersten<br />
Seebäder an der Ostseeküste, zunächst<br />
ohne Komfort, mit einfachen<br />
Badekarren und Kaltbädern.<br />
Die Badeeinrichtungen dienten der<br />
Heilung verschiedener Krankheiten,<br />
aber von Beginn an auch der<br />
Erholung und Unterhaltung. Schnell<br />
entwickelte sich die Infrastruktur<br />
der Bäder, Warmbadeanstalten<br />
entstanden, die Seestege wuchsen<br />
immer gewaltiger ins Meer. Spätestens<br />
mit Aufkommen der Eisenbahn<br />
wurden aus den ehemals kleinen<br />
Fischerorten Unterhaltungszentren,<br />
in denen sich die „Welt“ traf.<br />
Die Exklusivität des Kuraufenthalts<br />
wich dem Massentourismus. So<br />
entwickelte sich insbesondere in<br />
der zweiten Hälfte des 19. und zu<br />
Beginn des 20. Jahrhunderts eine<br />
spezifische Badekultur und eine<br />
charakteristische Bäderarchitektur.<br />
Obwohl diese Phänomene allgemein<br />
bekannt sind, so sind sie<br />
doch unter kunst- und kulturhistorischen<br />
Aspekten noch wenig<br />
untersucht, erst recht nicht in einem<br />
vergleichenden Blick über<br />
die Regionen und Staaten hinweg.<br />
Dieser Aufgabe widmete sich das<br />
Homburger Gespräch der M.C.A.<br />
Böckler – Mare Balticum-Stiftung,<br />
das in Kooperation mit dem <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> Marburg und der Werner<br />
Reimers Stiftung Bad Homburg v.<br />
d. Höhe vom 7. bis zum 9. Oktober<br />
in Bad Homburg und Marburg<br />
durchgeführt wurde. Unter dem Titel<br />
„Badeorte und Bäderkultur an<br />
der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
Architektur, gesellschaftliches<br />
Leben und ihre Darstellung in Bild<br />
und Wort“ wurde der Raum von<br />
Skandinavien über Deutschland<br />
und Polen bis zu den baltischen<br />
Ländern untersucht. In 15 Vorträgen<br />
von Kunsthistoriker/innen und<br />
Historiker/innen aus Deutschland,<br />
Estland, Lettland, Polen und Russland<br />
wurden teils in methodisch orientierten<br />
Überblicksdarstellungen,<br />
teils in Fallstudien verschiedene<br />
Aspekte der Architektur und der bildenden<br />
Kunst, der Denkmalpflege,<br />
der Kulturgeschichte sowie auch<br />
der Bildstrategien und des Marketing<br />
vorgestellt und diskutiert. Im<br />
Fokus stand die Entwicklung einzelner<br />
Orte wie etwa Travemünde,<br />
Vortrag von Ojars Sparitis bei der im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> durchgeführten Sektion<br />
des Homburger Gesprächs<br />
Heiligendamm, Jurata, Kemmern/<br />
Kemeri, Reval/Tallinn oder Pernau/<br />
Pärnu sowie verschiedener Regionen<br />
in Schweden, Polen, Lettland<br />
und dem Kalinigrader Gebiet und<br />
ihrer Charakteristika. Bauformen<br />
und Architekturstile sowie die aktuellen<br />
Fragen der Erhaltung des<br />
Kulturerbes wurden ebenso thematisiert<br />
wie die Geschichte der<br />
Badebekleidung. Zur Eröffnung der<br />
Tagung in Bad Homburg war ein öffentlicher<br />
Vortrag von PD Dr. Ulrike<br />
Wolff-Thomsen (Kiel) der bildenden<br />
Kunst in den Künstlerkolonien gewidmet.<br />
Die Besichtigung der Badeeinrichtungen<br />
in Bad Homburg<br />
bildete den Abschluss der dreitägigen<br />
Veranstaltung.<br />
Im Rahmen der im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
abgehaltenen Sektion am 8. Oktober<br />
fand zudem die Eröffnung der<br />
15<br />
Olga Kurilo beim<br />
Einführungsvortrag<br />
zur Ausstellungseröffnung
Ausstellung „Zoppot – Cranz – Rigaer<br />
Strand. Ostseebäder im 19.<br />
und 20. Jahrhundert“ statt, die in<br />
Zusammenarbeit mit dem Deutschen<br />
Kulturforum östliches Europa,<br />
Potsdam, und dem Lehrstuhl für<br />
Geschichte Osteuropas der Europa-Universität<br />
Viadrina, Frankfurt/<br />
Oder, realisiert wurde (<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
8. Oktober bis 23. Dezember<br />
2010, Europa-Universität Viadrina,<br />
13. Januar bis 25. Februar 2011,<br />
weitere Präsentationen in Vorbereitung).<br />
Sie zeichnet anhand der<br />
Neue Medien in den Geschichts- und Osteuropawissenschaften<br />
Internationale und interdisziplinäre Sommerakademie des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek München<br />
Die vernetzte digitale Datenverarbeitung<br />
ist aus dem Alltag der Geschichts-<br />
und Osteuropawissenschaftler<br />
nicht mehr wegzudenken.<br />
Dieses bringt weitreichende Konsequenzen<br />
mit sich: Die so genannten<br />
Neuen Medien verdichten<br />
und beschleunigen nicht nur die<br />
Kommunikation zwischen Wissenschaftlern,<br />
sondern verändern ihre<br />
Arbeitsmethodik, Formen der Repräsentation<br />
und Rezeption von<br />
Geschichte sowie die Konzepte<br />
der Didaktik. Studierende sind mit<br />
der Nutzung des neuen Mediums<br />
gut vertraut, gleichzeitig nehmen<br />
ihre Fertigkeiten des klassischen<br />
16<br />
drei Ostseebäder Zoppot/Sopot,<br />
Cranz/Selenogradsk und Rigaer<br />
Strand/J�rmala exemplarisch deren<br />
Entwicklung nach und stellt die<br />
Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten<br />
heraus. Dabei stehen die<br />
Themenbereiche Landschaft und<br />
allgemeine Geschichte, Gestaltung<br />
des öffentlichen Raumes, Badegäste,<br />
Freizeitgestaltung und Unterhaltung<br />
sowie Bäderarchitektur<br />
in den aufeinanderfolgenden Zeitperioden<br />
– 19. Jahrhundert, Zwischenkriegszeit,<br />
Zeit des National-<br />
Wissenszugangs ab. Der Wissenschaftsbetrieb<br />
sieht sich mit diesem<br />
Phänomen konfrontiert und<br />
sucht nach neuen Methoden, um<br />
der Entwicklung gerecht zu werden.<br />
Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> Marburg<br />
und die Bayerische Staatsbibliothek<br />
München haben im Rah-<br />
men des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
geförderten<br />
Programms „OstDok“ eine Gruppe<br />
aus neun Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
und -wissenschaftlern sowie<br />
erfahrene Forscherinnen und<br />
Forscher unterschiedlicher Disziplinen<br />
zu einer Sommerakademie eingeladen,<br />
um ihre Forschungspro-<br />
sozialismus und des Sozialismus/<br />
Kommunismus sowie nach der politischen<br />
Wende – im Vordergrund.<br />
Die Kuratorin der Ausstellung, PD<br />
Dr. Olga Kurilo (Frankfurt/Oder),<br />
erläuterte die dem Konzept zugrunde<br />
gelegte Fragestellung in einem<br />
Einführungsvortrag, wobei sie die<br />
transnationalen und interkulturellen<br />
Aspekte besonders hervorhob und<br />
die Perspektiven sowie Desiderate<br />
weiterer kulturwissenschaftlicher<br />
Forschungen herausstellte.<br />
jekte und -erkenntnisse zu diesem<br />
Thema vorzustellen sowie die mit<br />
ihnen verbundenen Chancen und<br />
Herausforderungen gemeinsam zu<br />
diskutieren. Impulsvorträge hielten<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger, Bertold<br />
Gillitzer (München), Dr. Rüdiger<br />
Hohls (Berlin), Prof. Dr. Vadim Oswalt<br />
(Gießen), Dr. Matija Ogrin (Laibach/Ljubljana)<br />
und Dr. Harald Müller<br />
(Heidelberg).<br />
Auffällig oft wurde das Problem<br />
mangelnder Medienkompetenz<br />
thematisiert. Deutlich wurde,<br />
dass insbesondere in Bezug auf<br />
die Generation der „Digital natives“<br />
unter zahlreichen Gesichtspunkten<br />
der Begriff „Digital naives“ zutreffender<br />
wäre: Die Onlinedienste<br />
Google und Wikipedia dominieren<br />
als Recherchemittel und Wissensquelle<br />
der Studierenden. Professionelle<br />
Angebote werden – sofern<br />
sie nicht in wenigen Schritten zufriedenstellende<br />
Ergebnisse liefern<br />
– als ineffizient betrachtet. Um die<br />
Neuen Medien als Werkzeug der<br />
Geschichts- und Osteuropawissenschaften<br />
effizienter zu gestalten,<br />
müssen daher nachhaltige Strategien<br />
in die Wege geleitet werden. Der<br />
bedeutendste Schritt dabei wäre<br />
die lehrinstitutionelle Verankerung
eines umfassenden didaktischen<br />
Programms zum Umgang mit Neuen<br />
Medien. Die Vermittlung einer<br />
fundierten und kritischen Rezeption<br />
ist unabdingbar und müsste<br />
bereits im Rahmen der einführenden<br />
methodischen Lehrveranstaltungen<br />
erfolgen. Die Neuen Medien<br />
charakterisiert ein großes Potential<br />
der Demokratisierung des Wissenszugangs,<br />
ihre Zeitnähe und<br />
Ortsunabhängigkeit sowie die Gestaltung<br />
neuer Vermittlungsformen.<br />
Bei nicht sachgemäßer Anwendung<br />
besteht jedoch die Gefahr,<br />
dass der Siegeszug des Internets<br />
zur Erosion und Verflachung des<br />
Wissens und der Wissenschaften<br />
beiträgt. Ein solches didaktisches<br />
Programm dürfte sich keineswegs<br />
auf die Recherchemöglichkeiten<br />
im Internet beschränken. Ebenso<br />
wichtig ist die Vermittlung eines kritischen<br />
Umgangs mit den gefundenen<br />
Inhalten und der Tatsache,<br />
dass die Neuen Medien nur einen<br />
Teil der Wissensbestände abbilden.<br />
Zum Programm müssen auch die<br />
gesellschaftlichen Folgen der Informatisierung<br />
gehören: unter anderem<br />
die Frage der Urheberrechte<br />
oder gesetzliche Aspekte des Publizierens.<br />
Auf der anderen Seite der Kommunikationskanäle<br />
müssen die<br />
Betreiber der Onlinedienste und<br />
-plattformen mehr Rücksicht auf<br />
die Bedürfnisse der Nutzer nehmen.<br />
Geeignete Lösungsansätze bietet<br />
Stipendien des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
bereits die Technologie des Web<br />
2.0 in Gestalt von personalisierten<br />
Webseiten, unterschiedlichen Sucheinstiegsmöglichkeiten<br />
oder der integrierten<br />
Suche. Ein isoliert auftretender,<br />
auf Spezialinteressen<br />
ausgerichteter Onlinedienst hat in<br />
der heutigen Unübersichtlichkeit<br />
des Internets kaum Chancen, einen<br />
nennenswerten Nutzerkreis zu<br />
etablieren. Aus diesem Grund ist<br />
eine effiziente Vernetzung und Integration<br />
fachverwandter Onlinedienste<br />
notwendig. Zur großen He-<br />
rausforderung bei der Konzeption<br />
gehört der Kompromiss zwischen<br />
Benutzerfreundlichkeit und wissenschaftlicher<br />
Effizienz. Da diese<br />
anhaltenden Prozesse mit Kosten<br />
verbunden sind, muss die gesellschaftliche<br />
und wissenschaftliche<br />
Bedeutung des informatischen<br />
Wandels stärker ins Bewusstsein<br />
der für die Bildungsfinanzierung<br />
verantwortlichen Akteure und <strong>Institut</strong>ionen<br />
rücken.<br />
Konrad Hierasimowicz<br />
Zur Förderung der historischen Ostmitteleuropa-Forschung vergibt das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> an Wissenschaftler/in-<br />
nen insbesondere aus ostmitteleuropäischen Ländern Stipendien bis zu einer Dauer von drei Monaten, um<br />
ihnen die Möglichkeit zu bieten, für wissenschaftliche Vorhaben die Bestände in den Sammlungen des <strong>Institut</strong>s<br />
zu benutzen und Kontakte zu Fachkolleginnen und -kollegen in Deutschland zu knüpfen.<br />
Förderungsberechtigt sind promovierte Wissenschaftler/innen, Graduierte und Doktoranden/Doktorandinnen,<br />
im Ausnahmefall auch fortgeschrittene Studierende, die mit einer auf Ostmitteleuropa bezogenen historischen<br />
Fragestellung befasst sind und bereits wissenschaftliche Leistungen erbracht haben. Die Bewerber müssen<br />
über ausreichende Kenntnisse der deutschen oder englischen Sprache verfügen.<br />
Über die Ausstattung der Stipendien, Bewerbungsvoraussetzungen und Antragsmodalitäten informiert ein<br />
Merkblatt des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s, das gemeinsam mit dem Antragsformular auch über die www-Adresse des Ins-<br />
tituts verfügbar ist. Anträge auf Gewährung eines Stipendiums sind an den Vorstand des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s e.V.,<br />
Gisonenweg 5-7, D-35037 Marburg zu richten.<br />
17<br />
Teilnehmende<br />
der Sommerakademie<br />
2010<br />
des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s
Ereignisse und Informationen<br />
„Allerley kleine Papiere ...“<br />
Die Lehrveranstaltung: „Sprachkontakt<br />
in multiethnischen Gesellschaften<br />
– Die deutsche Sprache<br />
im Baltikum“ der Justus-Liebig-<br />
Universität (<strong>Institut</strong> für Germanistik,<br />
Historische Sprachwissenschaft)<br />
fand im Sommersemester 2010 in<br />
Zusammenarbeit mit dem <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> Marburg statt.<br />
Ein Semester gemeinsamer Arbeit<br />
schloss am 7. Oktober 2010<br />
eine öffentliche Veranstaltung im<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> mit Projektpräsentationen<br />
der Studierenden ab. Unter<br />
der Leitung von Prof. Dr. Anja<br />
Voeste (Gießen) und der Gastwissenschaftlerin<br />
Dr. Ineta Balode<br />
(Riga) hatten die Studierenden<br />
entschieden, sich bei ihren Untersuchungen<br />
auf Texte aus einem<br />
Bestand aus der Dokumentesammlung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s zu<br />
konzentrieren: das Familienarchiv<br />
der livländischen Adelsfamilie von<br />
Campenhausen. Die Überlieferung<br />
in der Dokumentesammlung ist in<br />
zeitlicher und quantitativer Hinsicht<br />
eines der größten noch erhaltenen<br />
Familienarchive zur baltischen Ge-<br />
18<br />
schichte. Dr. Peter Wörster und<br />
Dorothee M. Goeze führten die Studierenden<br />
in die Überlieferungsgeschichte<br />
dieses reichen Archivbestandes<br />
ein.<br />
In fünf Gruppen wurden von den<br />
Studierenden Posterpräsentationen<br />
gezeigt – mit kenntnisreichen,<br />
ja geradezu souverän vorgetragenen<br />
Referaten zu den Themen, die<br />
eine große Bandbreite aufwiesen.<br />
„Allerley kleine Papiere“ hat der Se-<br />
nateur Balthasar von Campenhausen<br />
(1745-1800) im Jahre 1775 ein<br />
Dokument aus dem Familienarchiv,<br />
das eine Reihe von Unterlagen zusammenfügt,<br />
genannt (vgl. Abb.).<br />
In gleicher Weise, wie das so bescheiden<br />
benannte Konvolut hoch<br />
interessante Quellen bietet, haben<br />
die Studierenden des Seminars in<br />
akribischer Sorgfalt kleine Quellen<br />
einem großen wissenschaftlichen<br />
Zusammenhang zugeführt:<br />
Es gab eine sprachwissenschaftliche<br />
Untersuchung über<br />
„Komposita und Fugenelemente<br />
in der Mitte des 18. Jahrhunderts.<br />
Eine synchrone Betrachtung<br />
am Beispiel der Auswertung von<br />
Rechnungen, Inventarlisten und<br />
Auftragsbüchern aus der zweiten<br />
Hälfte des 18. Jahrhunderts und<br />
ein Vergleich der deutschen Sprache<br />
im Baltikum mit dem Deutsch<br />
im Mutterland“. Die hypothetische<br />
Frage „Deutsche Sprache im Baltikum<br />
als Insel mit Brücke zum Festland?“<br />
konnte klar im Sinne der<br />
Feststellung einer erstaunlichen<br />
Nähe des baltischen Deutsch zum<br />
Deutsch im Mutterland – in den untersuchten<br />
Phänomenen – beantwortet<br />
werden.<br />
Weiter wurden vier Briefe des<br />
sog. Reichscontrolleurs Balthasar<br />
von Campenhausen (1772-1823)<br />
an seine Eltern bzw. seinen Vater<br />
untersucht: so z.B. die Frage, welche<br />
Rolle die Wahl zwischen den<br />
Sprachen Deutsch, Französisch,<br />
Russisch und Latein spielte. Die<br />
Wortwahl an sich und selbstverständlich<br />
auch die Themen und<br />
die historischen Umstände, unter<br />
denen die Briefe entstanden,<br />
wurden ausführlich betrachtet: Als<br />
besonderes Dokument stellten die<br />
Studierenden eine Geldliste des<br />
11-jährigen Balthasar mit „Einnahmen“<br />
(meist Taschengeld), aber<br />
auch „Ausgaben“ (meist Strafgelder<br />
für Vergehen) vor.<br />
Anhand des Mediums Kalender<br />
oder Schreibkalender stellten die<br />
Bearbeiter eine weitere Art von<br />
Quelle vor, die die gedruckte Form<br />
des uns heute bekannten Kalenders<br />
mit handschriftlichen Eintragungen<br />
der Besitzer vereint. Hier wurden<br />
auch Sprache und Schreibweise<br />
des Generalleutnants Balthasar von<br />
Campenhausen (1689-1758) analysiert.<br />
Neben der regionalgeschichtlichen<br />
Bedeutung der Eintragungen<br />
eines Gutsbesitzers, der auf die<br />
üblichen landwirtschaftlichen Hinweise<br />
in einem solchen Kalender<br />
eingeht, entstand auch ein individuelles<br />
Bild eines Mannes, der in spä-
teren Zeiten seines Lebens immer<br />
mehr persönliche Dinge in solche<br />
Kalender eintrug.<br />
In einem weiteren Referat wurde<br />
die allgemein bekannte und weit<br />
verbreitete Quellengattung Stammbuch<br />
vorgestellt, im vorliegenden<br />
Fall geschrieben vom Reichscontrolleur<br />
und von seinem Vater, dem<br />
Senateur Balthasar von Campenhausen<br />
(1745-1800). Neben der<br />
historischen Einordnung der Quellengattung<br />
erläuterten die Referentinnen<br />
und Referenten die Sprachenwahl<br />
und den formalen Aufbau<br />
eines Stammbucheintrages, dazu<br />
aber auch inhaltliche Facetten: Studienorte,<br />
mögliche Kontakte des<br />
Schreibers etc. und als besonderes<br />
Kapitel die Einträge von Frauen und<br />
ihre Eigenarten.<br />
Zum Thema Selbst-Bildnis der<br />
Frau im 19. Jahrhundert wurden<br />
Thesen über die sprachlichen Äußerungen<br />
einer Frau in Briefen an<br />
ihren Ehemann vermittelt: Briefe<br />
von Dorothea (Doris) Gräfin von<br />
Keyserlingk (1779-1847) an ihren<br />
Mann Hermann Johann von Campenhausen<br />
(1773-1836), einen weiteren<br />
Sohn des Senateurs. Einige<br />
zitierte, sehr persönliche Äußerun-<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> im Bereich<br />
Chancengleichheit ausgezeichnet<br />
Am 4. November 2010 bekam das<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> für seine Maßnahmen<br />
im Bereich Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern das<br />
Total E-Quality-Prädikat verliehen.<br />
Die Festrede auf der feierlichen<br />
Veranstaltung in der Landesentwicklungsgesellschaft<br />
Thüringen<br />
in Erfurt hielt die thüringische Ministerpräsidentin<br />
Christiane Lieberknecht,<br />
des Weiteren bildete eine<br />
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion<br />
zum Thema „Selbstverpflichtung<br />
versus Quote“ das<br />
Rahmenprogramm, bevor die 60<br />
Prädikatsträger aus Wirtschaft und<br />
Wissenschaft ihre Urkunden erhielten,<br />
darunter viele prominente<br />
Unternehmen und Forschungseinrichtungen.<br />
Für das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
nahmen Direktor Prof. Dr. Peter<br />
Haslinger und die Gleichstellungsbeauftragte<br />
Dr. Elke Bauer sowie<br />
deren Stellvertreterin Katarína Köhler<br />
die Auszeichnung entgegen.<br />
Der Verleihung des Prädikats vorangegangen<br />
waren der Entschluss<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s und daran anschließende<br />
Entwicklungen, sich<br />
im Bereich der Chancengleichheit<br />
und der Vereinbarkeit von Familie<br />
und Beruf stärker zu engagieren. Im<br />
Jahr 2009 gingen alle <strong>Institut</strong>e der<br />
Leibnizgemeinschaft diesbezüglich<br />
eine Selbstverpflichtung ein mit der<br />
Maßgabe, bis 2013 die forschungsorientiertenGleichstellungsstandards<br />
der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
umzusetzen. Dazu<br />
gehört auch die Verpflichtung, sich<br />
entsprechend zertifizieren zu lassen.<br />
Zwei Verfahren werden dabei<br />
empfohlen: entweder das „Audit<br />
Beruf und Familie“ oder das „Total<br />
E-Quality-Verfahren“. Während sich<br />
gen zeigen die Rolle der Frau in<br />
ihrer Zeit als ̦Unterhalterin‘ und als<br />
Verantwortliche für die Aufrechterhaltung<br />
der Beziehung bzw. der<br />
Ehe. Themen wie Kindererziehung<br />
und die Haushaltspflichten zeigen<br />
ein sicher nicht untypisches Bild<br />
einer Frau Anfang des 19. Jahrhunderts.<br />
An der Veranstaltung im <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> am 7. Oktober nahm auch<br />
Herr Dr. Mark Frhr. v. Campenhausen<br />
(Troisdorf) teil, ein Vertreter der<br />
Familie, der das Familienarchiv gehört.<br />
Dorothee M. Goeze<br />
das Erste auf die Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie beschränkt, geht<br />
es beim Total E-Quality-Verfahren<br />
vor allem um die berufliche Perspektive,<br />
deren Verbesserung mit<br />
Maßnahmen im Bereich Beruf und<br />
Familie zwingend einhergehen.<br />
Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> entschied<br />
Verleihung des Total E-Quality-Prädikats am 4. November 2010 in der Landesentwicklungsgesellschaft<br />
Thüringen in Erfurt (v.l.n.r. Elke Bauer, Gleichstellungsbeauftragte<br />
des HI, Peter Haslinger, Direktor des HI, Birgit Reinhardt<br />
von der Deutschen Bahn AG, Vorstandsmitglied der Total E-Quality<br />
Deutschland e. V.)<br />
sich für das ein breiteres Themenspektrum<br />
abdeckende Verfahren<br />
der Total E-Quality Deutschland<br />
19
e.V. und bewarb sich im Mai 2010<br />
um das Prädikat. Das selbst gesteckte<br />
Ziel des Vereins ist, die<br />
Chancengleichheit von Frauen und<br />
Männern im Beruf zu etablieren und<br />
nachhaltig zu verankern. Besonderes<br />
Augenmerk liegt dabei auf der<br />
Förderung von Frauen in Führungspositionen.<br />
Hierzu gehören neben<br />
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie auch eine chancengerechte<br />
Personalbeschaffung<br />
und -entwicklung sowie die Förderung<br />
partnerschaftlichen Verhaltens<br />
am Arbeitsplatz und die Berücksichtigung<br />
von Chancengleichheit<br />
in den Unternehmensgrundsätzen<br />
(www.total-e-quality.de).<br />
In der Begründung der Jury wird<br />
dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> positiv angerechnet,<br />
Chancengleichheit als<br />
ein Element der Profil- und Leit-<br />
Besuch aus Israel im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Am 14. Juli 2010 besuchte Frau<br />
Prof. Dr. Tirza Cohen-Fraenkel aus<br />
Israel zusammen mit ihrer Tochter<br />
Frau Dr. Jiska Mansfield, geb. Cohen,<br />
und ihrem Enkelsohn Jonathan<br />
Mansfield das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
hier vor allem die Hensel-Villa. Für<br />
Frau Prof. Cohen-Fraenkel war<br />
dies die erste Begegnung mit dem<br />
Haus, in dem sie 1926 in Marburg<br />
geboren wurde. Ihr Vater, Prof. Abraham<br />
A. Fraenkel, war Schüler von<br />
Prof. Kurt Hensel, dem bekannten<br />
20<br />
bildentwicklung implementiert und<br />
konkrete Maßnahmen gestartet zu<br />
haben. So verfügt das <strong>Institut</strong> seit<br />
2007 über einen Gleichstellungsplan<br />
sowie über eine Vereinbarung<br />
mit dem Land Hessen, in der die<br />
Förderung der Chancengleichheit<br />
in Umsetzung der Ausführungsvereinbarung<br />
zur Rahmenvereinbarung<br />
Forschungsförderung über<br />
die Gleichstellung von Frauen und<br />
Männern bei der gemeinsamen<br />
Forschungsförderung (AvGlei) festgeschrieben<br />
ist. Darüber hinaus<br />
wählen die Mitarbeiterinnen alle<br />
vier Jahre eine Gleichstellungsbeauftragte,<br />
die aktiv an der <strong>Institut</strong>spolitik<br />
beteiligt ist, es wurden erste<br />
Schritte unternommen, die Anzahl<br />
der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen,<br />
das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> achtet bei<br />
der Stipendienvergabe und Nach-<br />
Professor für Mathematik der Universität<br />
Marburg, der für sich und<br />
seine Familie 1906 eine ansehnliche<br />
Villa am heutigen Gisonenweg<br />
hatte errichten lassen. In diese<br />
nahm er seinen begabten Schüler<br />
Fraenkel, seit 1919 Professor der<br />
Universität Marburg, mit seiner<br />
Ehefrau Wilhelmina/Wilma (Malka),<br />
geb. Prins, auf. Hier wurden dem<br />
jungen Paar vier Kinder geboren,<br />
so 1926 auch Tirza. Prof. Abraham<br />
A. Fraenkel folgte 1928 einem Ruf<br />
wuchsförderung auf ein ausgewogenes<br />
Geschlechterverhältnis, das<br />
<strong>Institut</strong> führte familienfreundliche<br />
Sitzungszeiten ein, die Angestellten<br />
werden bei individuellen Lösungen<br />
zur Vereinbarkeit von Familie<br />
und Beruf unterstützt. Zudem wird<br />
in Zukunft, wenn Bedarf angemeldet<br />
wird, bei Veranstaltungen eine<br />
Kinderbetreuung angeboten. In<br />
Kooperationen mit Partnern wie<br />
den Universitäten in Marburg und<br />
Gießen soll die Angebotspalette<br />
entsprechend den Bedürfnissen<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
noch weiter ausgebaut werden,<br />
denn in drei Jahren muss das Prädikat<br />
erneut beantragt werden und<br />
das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> wird dann an<br />
den umgesetzten Plänen gemessen<br />
werden.<br />
an die Universität Kiel, wo er seine<br />
Professur bis 1933 innehatte. Seit<br />
1929 hatte er einige Gastsemester<br />
an der Hebräischen Universität<br />
zu Jerusalem absolviert, wohin<br />
er angesichts der in Deutschland<br />
wachsenden Bedrohungssituation<br />
in bewusster Entscheidung 1933<br />
endgültig wechselte.<br />
Peter Wörster
Prof. Dr. Andrzej Tomaszewski 1934-2010<br />
Prof. Dr. Andrzej Tomaszewski, ein<br />
Pionier der deutsch-polnischen Zusammenarbeit<br />
bei der Erforschung<br />
und dem Schutz des gemeinsamen<br />
Kulturerbes, ist am 25. Oktober<br />
2010 überraschend verstorben.<br />
Wir verlieren mit ihm eine der<br />
herausragenden und der einflussreichsten<br />
Persönlichkeiten im Bereich<br />
der Kunstgeschichte und<br />
Denkmalpflege Polens und Mitteleuropas.<br />
Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> trauert<br />
um einen Inspirator, Begleiter<br />
und Mitherausgeber wichtiger Forschungs-<br />
und Editionsvorhaben; es<br />
verliert einen Freund und Kollegen,<br />
der die <strong>Institut</strong>sarbeit auf dem Gebiet<br />
der Kunst- und Kulturgeschichte<br />
Ostmitteleuropas wesentlich mitgeprägt<br />
hat.<br />
Der 1934 in Warschau geborene,<br />
dort aufgewachsene und an der<br />
Warschauer Universität sowie an<br />
der Technischen Universität (Politechnika<br />
Warszawska) ausgebildete<br />
Architekt, Kunst- und Architekturhistoriker<br />
sowie Denkmalpfleger<br />
hat mit seinem Wirken den Weg für<br />
eine neue Epoche der Versöhnung<br />
und der Kooperation geebnet. Gleichermaßen<br />
hat er Forschung und<br />
Praxis wesentlich gestaltet und gefördert:<br />
durch eine Vielzahl eigener<br />
Studien und Publikationen, durch<br />
Ausbildung des wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses in seiner Tätigkeit als<br />
Hochschullehrer (seit 1976), durch<br />
Initiierung und Begleitung denkmalpflegerischer<br />
Maßnahmen – oft<br />
als letzte Rettung von Monumenten<br />
in prekären Erhaltungszuständen<br />
– sowie nicht zuletzt durch seine<br />
Autorität, sein Engagement und<br />
seine persönliche Ausstrahlung als<br />
„Diplomat“ im Dienste des europäischen,<br />
ja des Weltkulturerbes.<br />
Prof. Tomaszewski bekleidete<br />
wichtige und einflussreiche Ämter<br />
als Generaldirektor des Internationalen<br />
Studienzentrums für die Erhaltung<br />
und Restaurierung von<br />
Kulturgut (ICCROM) in Rom (1988-<br />
1992), als Generalkonservator der<br />
Republik Polen (1995-1999) und<br />
Berater des polnischen Kulturministers,<br />
als Vorsitzender des polnischen<br />
ICOMOS-Komitees (Internationaler<br />
Rat für Denkmalpflege) und<br />
als Vertreter Polens im Komitee für<br />
Kulturerbe des Europarats sowie<br />
im UNESCO-Welterbe-Komitee.<br />
Er war Initiator der Eintragung verschiedener<br />
Kulturdenkmäler in die<br />
UNESCO-Welterbeliste: etwa der<br />
Marienburg/Malbork, der Altstadt<br />
von Thorn/Toruń, der schlesischen<br />
Friedenskirchen (Schweidnitz/<br />
Świdnica, Jauer/Jawor), der Jahrhunderthalle<br />
in Breslau/Wrocław<br />
und des gemeinsam von Deutschland<br />
und Polen nominierten Muskauer<br />
Landschaftsparks zu beiden<br />
Seiten der Neiße. Für seine besonderen<br />
Verdienste erhielt Prof. Tomaszewski<br />
eine Reihe von hohen<br />
Auszeichnungen und Anerkennungen<br />
in Polen wie im Ausland, so<br />
war er z.B. im Jahr 2003 der erste<br />
Träger des vom Deutschen Kulturforum<br />
östliches Europa in Potsdam<br />
verliehenen Dehio-Preises „für besondere<br />
Leistungen und Verdienste<br />
auf dem Gebiet der Erforschung,<br />
Bewahrung und Präsentation von<br />
Zeugnissen kulturellen Erbes, die<br />
Deutschland mit seinen östlichen<br />
Nachbarn verbinden“.<br />
Mit der Geschichte und Kultur<br />
Deutschlands sowie dessen Wissenschaftslandschaft<br />
war er sehr<br />
vertraut und eng verwoben. Neben<br />
Forschungs- und Studienaufenthalten<br />
in Poitiers und Rom gehörte<br />
Prof. Tomaszewski 1981-1983 zum<br />
ersten Fellow-Jahrgang des West-<br />
Berliner Wissenschaftskollegs und<br />
war 1986-1987 Gastprofessor an<br />
der Johannes-Gutenberg-Universität<br />
in Mainz. Zusammen mit dem<br />
Mainzer Kunsthistoriker Prof. Dr.<br />
Dethard von Winterfeld begründete<br />
er 1988 den Arbeitskreis deutscher<br />
und polnischer Kunsthistoriker und<br />
Denkmalpfleger „Das gemeinsame<br />
Kulturerbe“, der seit der Mitte der<br />
1990er Jahre jährliche Tagungen<br />
abwechselnd in Deutschland und in<br />
Polen veranstaltet. Dieser nicht ins-<br />
titutionalisierte Kreis ist eine außerordentlich<br />
lebendige und fruchtbare<br />
Plattform für den wissenschaftlichen<br />
Austausch von erfahreneren<br />
und jüngeren Kolleginnen und Kollegen<br />
unterschiedlichster Fachrichtungen<br />
aus beiden Ländern. Viele<br />
gemeinsame Forschungs-, Publikations-<br />
und Ausstellungsprojekte<br />
wurden hier erdacht und konzipiert.<br />
Herausragendes Produkt war das<br />
Ende der 1990er Jahre begründete<br />
Handbuch der Kunstdenkmäler<br />
zu Schlesien, das mit seinem Erscheinen<br />
in deutscher (2005) und<br />
polnischer (2006) Version in die unter<br />
Federführung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
erstellte Reihe des „Dehio-<br />
Handbuchs der Kunstdenkmäler in<br />
Polen“ gemündet ist – gegenwärtig<br />
mit Vorbereitung des Bandes zu<br />
Kleinpolen. Prof. Tomaszewski war<br />
Gründervater des Vorhabens und<br />
zugleich Berater und Mitherausgeber<br />
des Schlesien-Bandes.<br />
Seine jüngste Initiative war die<br />
Gründung der „Deutsch-polnischen<br />
Stiftung Kulturpflege und<br />
Denkmalschutz“ zusammen mit<br />
Prof. Dr. Gottfried Kiesow, dem<br />
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen<br />
Stiftung Denkmalschutz,<br />
im Jahr 2007, deren gegenwärtige<br />
Anstrengungen der Rettung des<br />
heute halbverfallenen, ehemaligen<br />
Schlosses der Familie von Lehndorf<br />
in Steinort/Sztynort in Ostpreußen<br />
gilt.<br />
21
Die auf seine Initiative in den<br />
1990er Jahren begonnene kontinuierliche<br />
Kooperation von polnischen<br />
und deutschen Kunsthistorikern,<br />
Museumsfachleuten und<br />
Denkmalpflegern mit einem besonderen<br />
Engagement für das gemeinsame<br />
Kulturerbe wird noch lange<br />
von der außerordentlichen Persönlichkeit<br />
Prof. Tomaszewskis und<br />
von seinem Wirken geprägt sein.<br />
Er war es, der die Begriffe „Baudenkmal<br />
mit doppelter Nationalität<br />
bzw. doppelter Identität“ und „ge-<br />
Personalien<br />
Dr. Heidi Hein-Kircher wird nach<br />
der Geburt ihrer Tochter in der Verlagsleitung<br />
vertreten durch Alexandra<br />
Schweiger. Frau Schweiger<br />
hat in Köln und Krakau Mittlere und<br />
Neuere Geschichte, Osteuropäische<br />
Geschichte und Lateinische<br />
Philologie studiert. Nach dem Studium<br />
war sie ein Jahr als Deutschlehrerin<br />
und drei Jahre als wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin im<br />
Deutschen Bundestag tätig. Parallel<br />
arbeitete sie an ihrer Doktorarbeit<br />
zum polnischen Ostdiskurs.<br />
Seit dem 1. April 2010 ist sie wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>.<br />
Frau Schweiger ist außerdem<br />
von Februar bis April 2011<br />
an die LOEWE-Geschäftsstelle im<br />
Hessischen Wissenschaftsministerium<br />
delegiert.<br />
Im Vorzimmer der Direktion wird<br />
Simone Cerwenka seit der Geburt<br />
ihrer Tochter noch bis Mai 2011<br />
von Heidi Becker vertreten. Frau<br />
Becker war als Verwaltungsfachangestellte<br />
lange Zeit in verschiedenen<br />
Bereichen der Stadtverwaltung<br />
Battenberg tätig. In den letzten<br />
Jahren arbeitete sie in Marburg bei<br />
der Lebenshilfe, einer Organisation<br />
für Menschen mit Behinderungen.<br />
Dort war sie für das Veranstaltungs-<br />
und Weiterbildungsmanagement<br />
zuständig.<br />
Aus der Elternzeit zurückgekehrt<br />
ist im Oktober Wiebke Rohrer, die<br />
gerade ihr Promotionsverfahren abschließt<br />
und im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> fortan<br />
für die Betreuung der Stipendiaten,<br />
22<br />
meinsames Kulturerbe“ einführte.<br />
Er bezog sie insbesondere auf das<br />
materielle Erbe in den historischen<br />
deutschen Ostgebieten und zielte<br />
darauf ab, dass sich die heutige<br />
polnische Bevölkerung in diesen<br />
Regionen die kulturelle Vergangenheit<br />
der Denkmäler bewusst macht<br />
und dass bei den ehemaligen deutschen<br />
Einwohnern ebenso wie bei<br />
allen Deutschen die Verantwortung<br />
für diese weiterhin wach gehalten<br />
werden müsse. Prof. Tomaszewski<br />
trat stets dafür ein, dieses ge-<br />
der Graduiertenschule und für das<br />
Fortbildungsmanagement zuständig<br />
ist. Neue Projektmitarbeiter sind seit<br />
2010 Agnes Laba und Dr. Vytautas<br />
Petronis. Frau Laba studierte Neuere<br />
und Neueste Geschichte und<br />
Neuere deutsche Literaturgeschichte<br />
an der Albert-Ludwigs-Universität<br />
in Freiburg. Sie forscht im Rahmen<br />
des Leibniz-Paktmittelprojekts „Demokratiegeschichte<br />
als Zäsurgeschichte“<br />
am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> über<br />
Grenzdiskurse in der Weimarer Republik.<br />
Herr Dr. Petronis wurde nach<br />
dem Studium in Kaunas und Turku<br />
in Stockholm mit einer Dissertation<br />
unter dem Titel „Constructing<br />
Lithuania. Ethnic mapping in Tsarist<br />
Russia ca. 1800-1914“ promoviert.<br />
Nach einer Zwischenstation an der<br />
Universität Glasgow bearbeitet er<br />
nun als Mitglied der DFG-Forschergruppe<br />
„Gewaltgemeinschaften“ ein<br />
Projektthema zur Geschichte eines<br />
litauischen paramilitärischen Verbandes<br />
zwischen 1918 und 1944.<br />
Justyna Turkowska, Dominika Piotrowska,<br />
Sylwia Werner, Konrad<br />
Hierasimowicz und Christian Lotz<br />
haben als Stipendiaten der Leibniz<br />
Graduate School 2010 ihre Arbeit<br />
am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> aufgenommen.<br />
Sie sind auf den vorderen Seiten dieses<br />
Heftes mit ihren Projekten vertreten.<br />
Dr. Norbert Kersken wurde<br />
zum 1. Juli 2010 als Gastwissenschaftler<br />
ans Deutsche Historische<br />
<strong>Institut</strong> in Warschau berufen.<br />
In der Bibliothek gab es mehrere<br />
Wechsel. Bereits seit einiger Zeit<br />
meinsame Kulturerbe, welches in<br />
objektiver Weise von der Geschichte<br />
polnischer und deutscher Grenzregionen<br />
zeuge, aus übernationaler<br />
Sicht zu erforschen und frei von<br />
Verfälschungen und Vorurteilen<br />
darzustellen, aber auch zu erhalten<br />
– im Hinblick auf zukünftige Generationen.<br />
Mögen sich die Fachleute<br />
der Kunstgeschichte und Denkmalpflege<br />
in Polen und Deutschland<br />
weiterhin von seinen Gedanken<br />
und Überzeugungen leiten lassen!<br />
Dietmar Popp<br />
neu bei uns ist Gabriela Niedballa.<br />
Frau Niedballa wurde an der TU<br />
Dresden ausgebildet und studierte<br />
Bibliothekswissenschaften an der<br />
FH Burgenland (Österreich). Nach<br />
Stationen in Homburg und Ingolstadt<br />
ist sie im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> als<br />
Bibliothekarin unter anderem für<br />
den Bereich Katalogisierung/Polen<br />
zuständig. Nora Weitzel wechselte<br />
im Herbst 2010 vom <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
auf eine neue Arbeitsstelle an der<br />
Bibliothek der Fachhochschule<br />
Gießen-Friedberg.<br />
Auch bei der Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung<br />
gibt es<br />
mehrere Veränderungen. Nach dem<br />
Abschied von Marco Wauker, der<br />
seit November 2002 im <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> arbeitete, übernahm Dr.<br />
Christoph Schutte im März 2010<br />
die Stelle des ZfO-Redakteurs.<br />
Herr Dr. Schutte studierte Osteuropäische<br />
Geschichte, Linguistik und<br />
Politikwissenschaft an der Freien<br />
Universität Berlin und ist seit 1999<br />
am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> beschäftigt, zunächst<br />
als Doktorand und seit 2005<br />
als Sachbearbeiter in der Abteilung<br />
Literaturdokumentation. 2006 promovierte<br />
er bei Klaus Zernack über<br />
die Königliche Akademie in Posen<br />
1903-1919. Schließlich wurden die<br />
<strong>Institut</strong>smitarbeiterinnen Dr. Heidi<br />
Hein-Kircher (Forum/Verlag) und<br />
Dr. Anna Veronika Wendland (Direktion)<br />
ins Herausgebergremium<br />
der ZfO berufen.
Gäste am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Die Stipendiaten des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
unter unseren Gästen werden<br />
mit dem Titel ihres Forschungsvorhabens<br />
vorgestellt:<br />
Agnes Flora, ClujNapoca (01.<br />
30.07.) „Notare und Notariat in mittelalterlichen<br />
und frühneuzeitlichen<br />
Städten“<br />
Katarzyna Szymankiewicz, Oborniki<br />
(01.07.<strong>31</strong>.08.) „Baltendeutsche<br />
im Warthegau (19391945)“<br />
Katarzyna Sliwinska, Poznań (05.<br />
30.07.) „Poetik(en) des Verlusts.<br />
‚Verlorene Heimat‘ und ‚Vertreibung‘<br />
in der deutschen und polnischen<br />
Literatur nach 1945“<br />
Piotr Kociumbas, Elbląg (19.<br />
30.07.) „Die Gelegenheitskantate im<br />
(ehemaligen) Königlichen Preußen<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
Elbings des 18. Jahrhunderts“<br />
Agata Rome-Dzida, Jelenia Góra<br />
(01.<strong>31</strong>.08.) „Das künstlerische Leben<br />
im Riesengebirge in den Jahren<br />
18801945“<br />
Sergey Medvetev, Voronež (01.08<br />
30.09.) „Das Russlandbild der deutschen<br />
Zivilverschleppten in sowjetischen<br />
Arbeitslagern 19441956“<br />
Pavel Shcherbinin, Tambov (02.<br />
<strong>31</strong>.08.) „Der Alltag von Kindern von<br />
Evakuierten und Flüchtlingen aus<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger –<br />
Anja Golebiowski:<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
� Flucht, Vertreibung und ethnische<br />
Säuberung im östlichen Europa<br />
1939-1950. Historische und<br />
literarische Zeugnisse<br />
Hauptseminar SS 2010, 2 SWS<br />
� Wissenschaftliche Kontroversen<br />
und Politik in Ostmitteleuropa im<br />
19. und 20. Jahrhundert<br />
Hauptseminar WS 2010/11, 2 SWS<br />
dem Westen des Zarenreiches in<br />
den zentralrussischen Gouvernements<br />
1915 bis 1924“<br />
Svetlana Knyazeva, Voronež<br />
(13.08.15.09.) „Integration der<br />
zwangsübersiedelten Frauen in die<br />
gesellschaftlichpolitische Struktur<br />
Deutschlands in den Jahren 1945<br />
1956“<br />
Natalia Lewko, Szczecin (01.<br />
30.09.) „Die Architektur der mittelalterlichen<br />
Stadtkirchen in Vor und<br />
Hinterpommern“<br />
Tomasz Majewski, Wrocław (01.<br />
30.09.) „Zur Geschichte der Breslauer<br />
Verlage. Graß, Barth & Co.<br />
als Zeitschriftenverleger in der Zeit<br />
der Weimarer Republik. Beispielfall<br />
‚Schlesische Monatshefte‘“<br />
Dr. Denis Lomtev, Moskva (01.09.<br />
30.11.) „Die Deutschen als Repräsentanten<br />
der Prager Komponistenschule<br />
im 20. Jahrhundert“<br />
Aleksandr Sologubov, Kaliningrad<br />
(01.<strong>31</strong>.10.) „Entwicklung der räumlichwirtschaftlichen<br />
Strukturen im<br />
Nordostpreussen. 2. Hälfte des XIX.<br />
Jahrhunderts – 1. Hälfte des XX.<br />
Jahrhunderts“<br />
Patryk Wasiak, Warszawa (01.10.<br />
30.11.) „Polish People’s Republic,<br />
computers and the discourse of<br />
modernization“<br />
Dr. Norbert Kersken:<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
� Kirchenorganisation und Staatsbildung.<br />
Die Erzbistümer im mittelalterlichen<br />
Europa<br />
Hauptseminar SS 2010, 2 SWS<br />
Dr. Anna Veronika Wendland:<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
� Visuelle Geschichte in und über<br />
Ostmitteleuropa<br />
Übung, SS 2010, 2 SWS<br />
Jan Daniluk, Gdańsk (04.23.10.)<br />
„Die kasernierte Stadt: Danzig als<br />
Garnison, Festung und militärischer<br />
Verwaltungs, Verpfl egungs<br />
und Produktionspunkt in den Jahren<br />
19391945“<br />
Jana Kosová, Praha (01.30.11.)<br />
„Abzug der Sowjetarmee aus<br />
Deutschland und der Tschechoslowakei“<br />
Ekaterina Yasinskaya, Kaliningrad<br />
(01.30.11.) „Die wirtschaftliche und<br />
politische Geschichte Ostpreußens<br />
in den Jahren des ersten Weltkrieges“<br />
Julia Mozdzeń, Toruń (11.22.12.)<br />
„Die Weltwahrnehmung der preußischen<br />
Stadtbürger im Spätmittelalter<br />
und in der Frühen Neuzeit“<br />
William Niven, Nottingham (09.<br />
17.08.) (AlexandervonHumboldt<br />
Stiftung/Dept. of History, Heritage<br />
and the Geography) „Die Darstellung<br />
von Flucht und Vertreibung in<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
und der DDR 19451990“<br />
David Smith / John Hiden, Glasgow<br />
(30.10.06.11.) (Universität<br />
Glasgow)<br />
Dr. Jan Lipinsky –<br />
Dr. Jürgen Warmbrunn:<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
� Medien- und Informationskompetenz<br />
für Historiker/innen – Datenbanken,<br />
Wissensportale, Online-<br />
Ressourcen<br />
Übung, WS 2010/11, 2 SWS<br />
23
Tagung der<br />
Historischen<br />
Kommission<br />
Schlesien<br />
Vorträge und Werkstattgespräche<br />
In dieser Rubrik finden Sie alle Vorträge<br />
unserer Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter sowie alle Vortragsveranstaltungen,<br />
die im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
stattfanden bzw. bei denen das<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> als Kooperationspartner<br />
aktiv war (2. Hj. 2010)<br />
7. Juli 2010<br />
Alexandra Schweiger (Marburg):<br />
„Polnische und deutsche Ostkonzepte<br />
im Vergleich“ [Kolloquium<br />
des Lehrstuhls für Osteuropäische<br />
Geschichte der Martin-Luther-Universität<br />
Halle-Wittenberg]<br />
9. Juli 2010<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Überlegungen zum ̦imperial<br />
turn‘ in der Geschichte (Ost-)Europas“<br />
[Zentrum für Europäische Studien<br />
der Universität zu Köln], Köln<br />
27. und 30. Juli 2010<br />
VIII World Congress 2010 „Eurasia:<br />
Prospects for Wider Cooperation“,<br />
Stockholm, Schweden<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg):<br />
„So near but yet so far – the library<br />
of the <strong>Herder</strong> <strong>Institut</strong> in the context<br />
of research on East Central Europe<br />
after 1945“<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg):<br />
„Digitisation of Collections: An Update“<br />
23. August 2010<br />
Jan Lipinsky (Marburg): „Der Hitler-Stalin-Pakt,<br />
seine Vorgeschichte<br />
und dessen unmittelbare Wir-<br />
24<br />
kungen auf die Völker Ost-, Mittel-<br />
und Südosteuropas“ [Vortrags- und<br />
Filmveranstaltung „Der Hitler-Stalin-Pakt<br />
am 23. August 1939“], Halle<br />
(Saale)<br />
<strong>31</strong>. August 2010<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Nationalstaatliche Karten – Darstellungsmodi<br />
und politischer Kontext“<br />
[III. Interdisziplinäre Sommerakademie<br />
„Politisches Kartieren –<br />
Kartengebrauch in Mittelalter und<br />
Neuzeit“], Westfälische Wilhelms-<br />
Universität Münster/<strong>Institut</strong> für vergleichende<br />
Stadtgeschichte, Münster<br />
3. September 2010<br />
Dariusz Gierczak (Marburg): „The<br />
Population of the Upper Silesian cities<br />
– between the Poles and the<br />
Germans“ [Xth International Conference<br />
of the European Association<br />
for Urban History: City & Society in<br />
European History. Panel S08, Sektion<br />
„Cities and Towns in Central Europe<br />
in the 19th and 20th century:<br />
̦Salad Bowl‘ or ̦Melting Pot‘ of Cultures?“],<br />
Gent, Belgien<br />
3. September 2010<br />
Wolfgang Kreft (Marburg): Sektion<br />
„Namen, Sprachen, Medizin“ [15.<br />
Kartographiehistorisches Colloquium],<br />
München<br />
3. September 2010<br />
Dietmar Popp / Peter Haslinger<br />
(Marburg): Eröffnungsrede zur Aus-<br />
stellung „Im Objektiv des Feindes.<br />
Die deutschen Bildberichterstatter<br />
im besetzten Warschau 1939-<br />
1945“, Wissenschaftliches Zentrum<br />
der Polnischen Akademie der Wissenschaften,<br />
Wien<br />
11. September 2010<br />
Dorothee M. Goeze (Marburg):<br />
„Hellmuth Weissi isiklik pärand <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Marburgis/Der Nachlass<br />
von Hellmuth Weiss im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Marburg“ [Seminar „Baltisakslased<br />
Eesti Vabariigis 1920.-1930.<br />
Aastail/Deutschbalten in der Estnischen<br />
Republik in den 1920er und<br />
1930er Jahren“], Tallin<br />
15. September 2010<br />
Dorothee M. Goeze (Marburg):<br />
„Eestlastest Saksa DP-laagrites/Über<br />
Esten in DP-Lagern in<br />
Deutschland“ [Õpetatud Eesti<br />
Selts/Gelehrte Estnische Gesellschaft],<br />
Tartu<br />
16. September 2010<br />
Elke Bauer (Marburg): „Zwischen<br />
Inszenierung und Authentizität:<br />
Kontextualisierung ausgewählter<br />
Bilderzeugnisse zum Alltagsleben<br />
der Deutschen in Ostmitteleuropa<br />
vor 1945“ [Jahrestagung „Blickpunkte.<br />
Fotografien als Quelle zur<br />
Erforschung der Kultur der Deutschen<br />
im und aus dem östlichen<br />
Europa. Teil 1“], Schlesisches Museum<br />
zu Görlitz<br />
Sommerakademie: Bertold Gillitzer und Gudrun Wirtz aus München
20. - 26. September 2010<br />
Internationale und interdisziplinäre<br />
Sommerakademie „Neue Medien<br />
in den Geschichts- und Osteuropawissenschaften“,<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Gudrun Wirtz (München): „Zukunft<br />
bücherlose Bibliothek oder bibliothekslose<br />
Bücher?“<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Transnationale Wissensvermittlung:<br />
Neue Medien in den area studies“<br />
Marc Friede (Marburg): „Auf dem<br />
Weg zu einem integrierten Fachinformationssystem<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s“<br />
Peter Wörster (Marburg): „Das<br />
online-Angebot der Dokumentesammlung<br />
(DSHI) als Baustein „auf<br />
dem Weg zu einem integrierten<br />
Fachinformationssystem des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s:<br />
Chancen und Grenzen<br />
eines fachspezifischen Webangebots“<br />
Kalina Szary (Poznań): „Die Großpolnische<br />
Digitale Bibliothek – Tätigkeit,<br />
Sammlungen und Perspektiven“<br />
Heidi Hein-Kircher / Alexandra<br />
Schweiger (Marburg): „Dokumente<br />
und Materialien zur ostmitteleuropäischen<br />
Geschichte – eine elektronische<br />
Quellenedition für die universitäre<br />
Lehre“<br />
Bertold Gillitzer (München): „Von<br />
alten Zöpfen in neuen Schläuchen<br />
oder warum Aristoteles schon alles<br />
wusste, aber erst google damit<br />
Geld verdient“<br />
Anna Sobczak (Gniezno): „Internetservices<br />
der Polnischen Staatsarchive<br />
– als Hilfsmittel für die geschichtliche<br />
Recherche“<br />
Rüdiger Hohls (Berlin): „Zur Kultur<br />
der wissenschaftlichen Diskussion<br />
und Mailinglisten“<br />
Vadim Oswalt (Gießen): „Geschichtsdidaktische<br />
Perspektiven“<br />
Kristine Greßhöner (Paderborn):<br />
„Online kooperieren, offline diskutieren.<br />
Wie Geschichtsstudierende<br />
mit Neuen Medien umgehen“<br />
Marcin Wilkowski (Warszawa):<br />
„Our past is in bits. The use of digital<br />
history in Poland“<br />
Bogumił Rudawski (Osieczna):<br />
„Die digitalisierte Sammlung des<br />
Posener Stadtarchivs und ihre Verwendung<br />
(am Beispiel des Kreises<br />
Pleschen)“<br />
Katarzyna Woniak (Stadtbergen):<br />
„Internetplattformen der deutschen<br />
Heimatvertriebenen als historische<br />
Quelle für erinnerungskulturelle Untersuchungen“<br />
Wolfgang Kreft / Marc Friede<br />
(Marburg): „Historisch-topographischer<br />
Atlas schlesischer Städte.<br />
Die Beispiele Oppeln/Opole (digital)<br />
und Görlitz/Zgorzelec (analog)“<br />
Matija Ogrin (Ljubljana): „Electronic<br />
Scholarly Editions“<br />
Friedla Rozenblat (Berlin): „Juden<br />
in Breslau und Wrocław: jüdisch-deutsche<br />
und jüdisch-polnische<br />
Lebenswelten 1918-1945 und<br />
1945-1968“<br />
Maciej Rynarzewski (Barczewo):<br />
„Digital rescue history: Recovering,<br />
preserving und presenting in the local<br />
past in the 2.0 era“<br />
Norbert Kunz (München) / Jürgen<br />
Warmbrunn (Marburg): „VifaOst<br />
und Ostdok“<br />
Konrad Hierasimowicz (Marburg):<br />
„Mediale Narration nationaler Identität:<br />
vom Druck bis zum Web 2.0.<br />
Eine Untersuchung zum belarussischen<br />
Fall“<br />
Harald Müller (Heidelberg): „Open<br />
Access und Urheberrecht“<br />
23. September 2010<br />
Dietmar Popp (Marburg): Buch-<br />
präsentation „Danzig im Luftbild<br />
der Zwischenkriegszeit“ [18. Tagung<br />
des Arbeitskreises deutscher<br />
und polnischer Kunsthistoriker und<br />
Denkmalpfleger „Stadtkultur des<br />
späten Mittelalters und der frühen<br />
Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre<br />
Renaissance im 19. Jh.“], Oldenburg<br />
25. September 2010<br />
Peter Wörster (Marburg): „Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Marburg, seine Dokumentesammlung<br />
und die Möglichkeiten<br />
für ost- und westpreußische<br />
Familienforscher“ [Jahrestagung<br />
des Vereins für Familienforschung<br />
in Ost- und Westpreußen], Kassel<br />
29. September 2010<br />
Jan Lipinsky (Marburg): „Digitalisierungsprojekte<br />
des <strong>Herder</strong>-Ins-<br />
tituts Marburg: Beispiel Zeitungsausschnitt-sammlung“<br />
[Workshop<br />
„Deutschsprachige Zeitungsbestände<br />
aus dem östlichen Europa –<br />
aktuelle Digitalisierungsprojekte“],<br />
Oldenburg<br />
1. Oktober 2010<br />
48. Deutscher Historikertag „Über<br />
Grenzen“, Humboldt-Universität zu<br />
Berlin<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen)<br />
/ Vadim Oswalt (Gießen): „Raumkonzepte,<br />
Wissenstransfer und die<br />
Karte als Medium von Geschichtskultur<br />
und Geschichtspolitik“<br />
25<br />
Tagung des <strong>Herder</strong>Forschungsrats
Ute Wardenga (Leipzig): „Gewinn<br />
durch Verlust und Verlust durch Gewinn<br />
– Wie wirklich ist die ‚Wirklichkeit‘<br />
im Medium der Karte?“<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Ikonographien des Raumbilds<br />
Ukraine: Eine europäische<br />
Wissenstransfergeschichte“<br />
Sebastian Bode (Gießen) / Mathias<br />
Renz (Gießen): „Grenzen in ostmitteleuropäischen<br />
konventionellen<br />
und digitalen Geschichtskarten“<br />
Vytautas Petronis (Marburg): „Die<br />
umkämpfte Stadt: Die Darstellung<br />
von Vilnius/Wilno/Wilna auf russländischen<br />
ethnographischen und<br />
litauisch nationalen Karten, 1840-<br />
1918“<br />
4. Oktober 2010<br />
Tagung „Schlesien digital – Neue<br />
Wege zu den Quellen“, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg):<br />
Vortrag „Vernetzung durch Digitalisierung<br />
– Digitalisierungsprojekte<br />
im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>“<br />
Dariusz Gierczak / Wolfgang<br />
Kreft (Marburg): „Schlesische<br />
Städte im Spiegel topographischer<br />
Karten. Ein multimediales Atlasprojekt<br />
zur Siedlungsentwicklung vom<br />
19.-21. Jahrhundert“<br />
Marc Friede (Marburg): „Silesiaca<br />
in der Kartensammlung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
und ihre Online-Verfügbarkeit“<br />
Thomas Urban (Marburg): „Der<br />
‚Bildkatalog‘, die Online-Datenbank<br />
des Bildarchivs und Digitalisierungsprojekte<br />
zu Schlesien“<br />
Dietmar Popp (Marburg): „Vom<br />
Dehio-Handbuch Schlesien zum<br />
Online-Informationssystem der<br />
Bau- und Kunstdenkmäler“<br />
Dorothee M. Goeze (Marburg):<br />
„Speichern – anzeigen – nutzen.<br />
Gedanken zu einem Archivportal<br />
Silesiaca“<br />
Peter Wörster (Marburg): „Ein früher<br />
sachthematischer Archivalienkatalog:<br />
Schlesien in der ̦Dülfer-<br />
Kartei‘“<br />
Wojciech Mrozowicz (Wrocław):<br />
„Digitalisierungsprojekte der Universitätsbibliothek<br />
Breslau und an<br />
schlesischen Archiven“<br />
26<br />
Dariusz Przybytek (Wrocław): „Georeferenzierung<br />
und Digitalisierung<br />
von kartografischen Sammlungen<br />
der Universität Breslau“<br />
7. Oktober 2010<br />
Abschlussveranstaltung/Projektpräsentation<br />
der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen, <strong>Institut</strong> für Germanistik,<br />
Historische Sprachwissenschaft,<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, DSHI, Marburg<br />
Anja Voeste (Gießen) / Ineta Balode<br />
(Riga) / Peter Wörster / Dorothee<br />
M. Goeze (Marburg): „Sprachkontakt<br />
in multiethnischen Gesellschaften<br />
– Die deutsche Sprache<br />
im Baltikum“<br />
7. - 10. Oktober 2010<br />
Homburger Gespräch der M.C.A.<br />
Böckler–Mare Baltikum-Stiftung/<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Dietmar Popp (Marburg): „Badeorte<br />
und Bäderkultur an der Ostseeküste<br />
im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
Architektur, Gesellschaftliches Leben<br />
und ihre Darstellung in Bild und<br />
Wort“, Bad Homburg und Marburg<br />
8. Oktober 2010<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Kritische Anmerkung zu Galizien<br />
als Referenzraum kultureller<br />
Interferenz“ [Tagung „Reflexion kultureller<br />
Interferenzräume. Beispiele<br />
aus Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert“<br />
des GWZO], Leipzig<br />
14. - 16. Oktober 2010<br />
Internationale Nachwuchstagung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s „Violence and<br />
Societies in East Central Europe,<br />
18th to 20th centuries“, Vilnius<br />
H. H. Bass (Bremen): „Quiet violence,<br />
violent excesses. The dynamics<br />
of violence in the mid-19th<br />
century subsistence crisis in Prussia“<br />
M. Kaszka: „Groups Using Force<br />
in 17th Century Polish-Lithuanian<br />
Commonwealth“<br />
Vytautas Petronis (Marburg):<br />
„Forms of Societal Coercion: The<br />
Case of the Lithuanian Paramilitary<br />
Organisation ̦Iron Wolf‘ (Late<br />
1920s)“<br />
D. Starchenko (Gießen): „The Cossack<br />
Uprising in 1637/38. Perception<br />
and Construction of Violence in Selected<br />
Contemporary Sources“<br />
M. Chvojka (Skopje): „Between Revolution<br />
and Stability. The Uprising<br />
in Galicia of 1846 and the Habsburg<br />
Province Moravia-Silesia“<br />
A. Mi�ins (Latvia): „Manifestations<br />
of Civil War on the Territory of Latvia<br />
1918-1920“<br />
T. Minnik (Tallinn): „Terror And Repressions<br />
During the Estonian War<br />
Of Independence 1918-1919“<br />
W. Dornik (Graz): „The 1918 Occupation<br />
of the Ukraine by the Central<br />
Powers“<br />
T. Buchen (Berlin): „Anti-Jewish Violence:<br />
Dynamics and Representations<br />
of the Galician ̦anti-Semitic<br />
Excesses‘ of 1889“<br />
K. Richter (Berlin): „ ̦Horrible Were<br />
the Avengers, but the Jews Were<br />
Horrible, too‘. Nationalistic Contempo-raries<br />
Interpret the Pogrom<br />
of Dusetos (1905)“<br />
E. Reder (Wien): „Pogroms in Poland<br />
1918-20 und 1945/46 in Comparison“<br />
S. Žemaityt� / L. Venclauskas<br />
(Kaunas): „From Word to Act: Anti-<br />
Semitic Rhetoric Influence on Jews<br />
and Lithuanians Everyday Relationship<br />
in 4th Decade of 20th Century“<br />
F. Grafl (Gießen): „Urban Violence<br />
in Barcelona in the Interwar Years“<br />
Ž. Mikailien� (Vilnius): „The Hippie<br />
Movement in Soviet Lithuania: The<br />
Tension Between Official and Unofficial<br />
Youth Culture and State Violence“<br />
A.-M. Kõll (Stockholm): „Violence<br />
in the Baltic sea region: The question<br />
of paramilitary groups 1917-<br />
1945“<br />
E. Gioielli (Budapest): „The Terror<br />
at Home: Mistresses, Maids,<br />
and ̦Domestic‘ Politics in Hungary,<br />
1919-1921“<br />
M. Becker (Frankfurt): „German<br />
Judges in Occupied Poland During<br />
the Second World War“<br />
D. Brewing (Stuttgart): „In the Shadow<br />
of Auschwitz: Mass Crimes<br />
Against Ethnic Poles, 1939-1945“<br />
V. Ivanauskas (Vilnius): „Local Intellectuals,<br />
Soviet Indoctrination
and ̦National‘ Question: Participation,<br />
Escape or Resistance“<br />
P. Kolar (Potsdam/Prag): „Capital<br />
Punishment and State Sovereignty<br />
in Late Socialism“<br />
I. Paslaviči�t� (Wien): „Violence in<br />
Post-Stalinist Everyday Life: Case<br />
Studies of the Petitions to the Central<br />
Committee of the Lithuanian<br />
Communist Party between 1953<br />
and 1964“<br />
S. Zehnle (Gießen): „The Materiality<br />
of Violence in 19th Century East<br />
Africa“<br />
G. Brumane (Riga): „Violence as<br />
Part of Political Agitation: the Example<br />
of Political Poster in Latvia,<br />
1920-1934“<br />
E. Kernbauer (Bern): „Violence,<br />
Memory and Narration in the Works<br />
of Deimantas Narkevičius“<br />
A. Griffante (Vilnius): „War, Self-<br />
Perception and the Nation. Some<br />
Reflections on Personal Diaries in<br />
Lithuania During World War“<br />
22. - 23. Oktober 2010<br />
Jahrestagung „Transnationale Regionen<br />
in der wissenschaftlichen<br />
Praxis“, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Markus Schroer (Kassel): „Zur Relevanz<br />
des Raums als soziologischer<br />
Kategorie“<br />
Reinhard Johler (Tübingen):<br />
„Raum als Kategorie der Europäischen<br />
Ethnologie“<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Spatial turn und historische Regionen“<br />
Markus Krzoska (Gießen): „Nationale<br />
widerstreitende Perspektiven<br />
auf regionale Kultur und Geschichte<br />
im diachronen und interregionalen<br />
Vergleich“<br />
Robert Luft (München): „Landesgeschichte<br />
von außen? Die böhmisch-mährische<br />
Geschichte im<br />
Dialog nationaler Wissenschaftskulturen“<br />
Ralph Tuchtenhagen (Berlin):<br />
„Raum oder historische Region<br />
‚Baltikum‘“<br />
Arno Mentzel-Reuters (München):<br />
„Mediävistische Landesforschung<br />
und Raumbegriffe der Moderne“<br />
Haik Thomas Porada (Leipzig):<br />
„Landesgeschichtliche und landes-<br />
kundliche Forschungen zum Land<br />
am Meer im 100. Jahr des Bestehens<br />
der Historischen Kommission<br />
für Pommern“<br />
Klaus Roth (München): „Regionalentwicklung<br />
und transnationale Regionen<br />
in Südosteuropa“<br />
Stefan Rohdewald (Passau): „Religiöse<br />
Erinnerungsorte (Projektvorstellung)“<br />
Ludger Udolph (Dresden): „Geopoetik?<br />
Literarische Raumproduktion<br />
und regionale Literaturen“<br />
Claudia Kraft (Erfurt): „Raus aus<br />
der blackbox. Nation in der Zeitgeschichte“<br />
Jörg Hackmann (Stettin): „Problem<br />
und Perspektiven der regionalkundlichenOstmitteleuropa-Forschung“<br />
29. - <strong>31</strong>. Oktober 2010<br />
Internationale Tagung „Historiografie<br />
und Landeskunde im deutschpolnischen<br />
Kontaktbereich. Reflexionen<br />
über 125 Jahre institutionelle<br />
historisch-landeskundliche<br />
Forschung in und über Posen“,<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Stefan Dyroff (Bern): „1885-1918<br />
– Streben nach Wissenschaftlichkeit<br />
im Spannungsfeld zwischen<br />
behördlichen Erwartungen, polnischer<br />
Konkurrenz und dem gesellschaftlichen<br />
Bedürfnis nach Dilletantismus,<br />
Geselligkeit und regionaler<br />
Identität“<br />
Christoph Schutte (Marburg):<br />
„Rodgero Prümers – Adolf Warschauer.<br />
Zwei Posener Archivare<br />
als Landeshistoriker“<br />
Olgierd Kiec (Grünberg/Zielona<br />
Góra): „1918-1945 – Aufgezwungene<br />
Kampfesstellung? Die deutschen<br />
Historiker und Heimatforscher<br />
in Polen“<br />
Matthias Barelkowski (Gießen):<br />
„Manfred Laubert und Wolfgang<br />
Kohte“<br />
Błażej Białkowski (Berlin): „Alfred<br />
Lattermann und Kurt Lück“<br />
Wolfgang Kessler (Herne): „1945-<br />
1990 – Ostforschung als Abwehr:<br />
Die Historisch-Landeskundliche<br />
Kommission für Posen und das<br />
Deutschentum in Polen als Gesinnungsgemeinschaft“<br />
Eike Eckert (Berlin): „Gotthold<br />
Rhode und Richard Breyer“<br />
Matthias Weber (Oldenburg) / Andreas<br />
Lawaty (Lüneburg) / Markus<br />
Krzoska (Gießen) / Jan Maria Piskorski<br />
(Szczecin): „Welche Zukunft<br />
hat die historisch-landeskundliche<br />
Forschung über die Geschichte der<br />
Deutschen in Polen?“<br />
3. November 2010<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Polnische Verwaltung und<br />
‚nichtpolnische‘ Staatsbürger in<br />
Südostpolen“ [Kooperationsveranstaltung<br />
„Minderheitenpolitik als<br />
Interaktion? Die staatlichen <strong>Institut</strong>ionen<br />
der Zweiten Polnischen<br />
Republik und die ‚nichtpolnischen‘<br />
Staatsbürger (1918-1939)“], Universität<br />
Leipzig und Polnisches <strong>Institut</strong>,<br />
Leipzig<br />
27<br />
Tagung der<br />
Historischen<br />
Kommission<br />
Posen
Tagung des <strong>Herder</strong><br />
Forschungsrats<br />
3. November 2010<br />
Vernetzungstreffen „Glasgow meets<br />
Giessen – cooperation day“, Justus-<br />
Liebig-Universität Gießen<br />
Master class „Language, identity,<br />
politics“<br />
Ada Regelmann (Glasgow): „Catch<br />
22 – the Impact of Minorities’ Activism<br />
on Integration”<br />
Markus Krzoska (Gießen): „The<br />
Politics and Dynamics of Ethnona-<br />
tional Escalation: the Example of<br />
Habsburg Bohemia in 1897“<br />
Ammon Cheskin (Glasgow):<br />
„The Discursive Construction of<br />
̦Russian-speakers‘: The Russian-<br />
Language Media and Demarcated<br />
Political Identities in Latvia“<br />
Ruth Bartholomä / Aksana Braun<br />
(Gießen): „Majority or Minority?<br />
Constructions of Identity in the Discourse<br />
about Language Policy of<br />
Russian-Turkic Speech Communities<br />
in the Republic of Kazakhstan<br />
and the Republic of Tatarstan (Russian<br />
Federation)“<br />
Marine Germane (Glasgow): „United<br />
Latvian National State – a Contradiction<br />
in terms?“<br />
Rayk Einax (Gießen): „Russification<br />
Measures in the Belorussian Soviet<br />
Republic (1950ies to 1970ies) and<br />
its Consequences“<br />
Keiji Sato (Glasgow): „Europeanisation<br />
and Confidence-Building Measures<br />
in the Transnistria Region“<br />
John Hiden / David Smith (Glasgow):<br />
„Nation State or State Com-<br />
28<br />
munity? Alternatives from Interwar<br />
Europe“<br />
4. November 2010<br />
Marc Friede (Marburg): „Historisch-topographischer<br />
Atlas schlesischer<br />
Städte“ [Treffen des Arbeitskreises<br />
Historische Kartographie],<br />
<strong>Institut</strong> für Europäische<br />
Geschichte, Mainz<br />
5. - 6. November 2010<br />
Wolfgang Kreft (Marburg): Präsentation<br />
des Städteatlas Schlesien im<br />
Rahmen einer Medienstation [Tagung<br />
„Menschen unterwegs. Die<br />
via regia und ihre Akteure“ zur Vorbereitung<br />
der 3. Sächsischen Landesausstellung],<br />
Schlesisches Museum,<br />
Görlitz<br />
6. November 2010<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg):<br />
„Kaszuby i Instytut im. <strong>Herder</strong>a w<br />
Marburgu“ [Ausstellung „Polen,<br />
Deutsche und Kaschuben. Alltag,<br />
Brauchtum und Volkskultur auf dem<br />
Gut Hochpaleschken in Westpreußen<br />
um 1900“], Haus der Begegnungen<br />
mit der Geschichte, Warschau<br />
8. November 2010<br />
Markus Roth (Gießen/Marburg):<br />
„Herrenmenschen. Nationalsozialistische<br />
Besatzungspolitik in Polen<br />
1939-1945 [Offene Akademie der<br />
Volkshochschule München], Kulturzentrum<br />
Gasteig, München<br />
9. November 2010<br />
Cordula Kalmbach (Freiburg):<br />
„Katyń als lieu de mémoire der polnischen<br />
Erinnerungskultur – fiktive<br />
Verwandte angesichts der menschlichen<br />
Katastrophe“, Justus-Liebig-<br />
Universität, Gießen<br />
9. November 2010<br />
Michael Zok (Marburg): „Der Holocaust<br />
im polnischen Fernsehen<br />
1968-1989. Zwischen Marginalisierung<br />
und Wiederentdeckung“ [Kolloquium<br />
der Abteilung für Osteuropäische<br />
Geschichte], Johannes-<br />
Gutenberg-Universität, Mainz<br />
19. November 2010<br />
42nd Annual Convention of the<br />
Association for Slavic, East European<br />
and Eurasian Studies (ASEE-<br />
ES), Los Angeles, USA / Sektion<br />
„Windows, Bridges, Gateways and<br />
More: Defining Baltic Space in the<br />
20th Century: Central, East, and<br />
North European Perspectives“<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Chair<br />
Vytautas Petronis (Marburg): Co-<br />
Referent<br />
Laimonas Briedis (Litauen): Co-<br />
Referent<br />
Jörg Hackmann (Polen): „Return<br />
to History? Conceptualizing Baltic<br />
Space in Political and Scholarly<br />
Discourses since the 1980s“<br />
Ralph Tuchtenhagen (Berlin):<br />
„ ̦Germanic Sea‘: The Baltic Sea<br />
Region as an Ethnic Space in German<br />
Humanities c. 1890-1950“<br />
Jan Hecker-Stampehl (Berlin):<br />
„Nordic Perspectives on the Baltic<br />
Sea Region“<br />
22. November 2010<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Buchpräsentation „Nation und Territorium<br />
im tschechischen politischen<br />
Diskurs 1880-1938“, Geisteswissenschaftliches<br />
Zentrum<br />
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas<br />
(GWZO), Leipzig<br />
23. November 2010<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Regionale Bewegungen in Ostmitteleuropa<br />
um 1900 zwischen Nati-
on, Staat und Dynastie“<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Städte als Arenen imperialer,<br />
nationaler und lokaler Projekte“<br />
[Workshop „Transnationale Geschichte<br />
Ostmitteleuropas: Territorialisierung<br />
in der zweiten Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts“ der Projektgruppe<br />
Ostmitteleuropa Transnational<br />
– Studien zur Verflechtungsgeschichte],Geisteswissenschaftliches<br />
Zentrum Geschichte und<br />
Kultur Ostmitteleuropas (GWZO),<br />
Leipzig<br />
6. Dezember 2010<br />
Feierliche Eröffnung der Leibniz<br />
Graduate School for Cultures of<br />
Knowledge in Central European<br />
Transnational Contexts, Alexandervon-Humboldt-Gästehaus<br />
der Justus-Liebig-Universität,<br />
Gießen<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Grenzüberschreitungen und<br />
Transformationen von Wissen in<br />
multikulturellen Räumen – Vorstellung<br />
der Leibniz Graduate School<br />
for Cultures of Knowledge in Central<br />
European Transnational Contexts“<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Die Entstehung<br />
von Ludwik Flecks Wissenschaftstheorie<br />
in der Wissenskultur<br />
der Lemberger Moderne“<br />
Justyna A. Turkowska (Marburg):<br />
„Wissenschaft als Konstrukt und<br />
Neue Veröffentlichungen und Vorschau<br />
Inszenierung: ein deutsch-polnischer<br />
Vernetzungsfall im Spiegel<br />
der Hygienediskurse“<br />
Dominika Piotrowska (Marburg):<br />
„Die neuzeitliche Residenzarchitektur<br />
in der Neumark“<br />
Christian Lotz (Marburg): „Die Erkundung<br />
des Vorrats. Wissenschaftler<br />
und Akademien in den<br />
Imperien Ostmitteleuropas und die<br />
Bestimmung der verfügbaren Holzressourcen<br />
(ca. 1870-1914)“<br />
Konrad Hierasimowicz (Marburg):<br />
„Mediale Narration nationaler Identität<br />
– vom Druck bis zum ̦Web<br />
2.0‘. Eine Untersuchung am belarussischen<br />
Fall“<br />
Patrick Harries (Basel): „Knowledge<br />
and Knowing: Managing and<br />
Measuring the New Across Space<br />
and Through Time“<br />
13. Dezember 2010<br />
Agnes Laba (Marburg): „Öffentliche<br />
Diskussion der Ostgrenzen<br />
in der frühen Weimarer Republik“<br />
[Kolloquium am International Graduate<br />
Centre for the Study of Culture<br />
(GCSC)], FB Geschichts- und<br />
Kulturwissenschaften, Justus-Liebig-Universität,<br />
Gießen<br />
14. Dezember 2010<br />
Workshop „Demokratiegeschichte<br />
des 20. Jahrhunderts als Zäsurgeschichte.<br />
Das Beispiel der frü-<br />
hen Weimarer Republik“ [Treffen<br />
des SAW-Projekts „Demokratiegeschichte<br />
des 20. Jahrhunderts als<br />
Zäsurgeschichte“], <strong>Institut</strong> für Deutsche<br />
Sprache (IDS), Mannheim<br />
Peter Haslinger (Gießen/Marburg):<br />
„Erinnerung und Diskurs. Die Aktualisierung<br />
von Vergangenheit im<br />
politischen Raum“<br />
Heidrun Kämper (Mannheim):<br />
Kommentar zum Vortrag Haslinger<br />
Uta Koppert-Maats (Mannheim):<br />
„Der Frauenrechte-Diskurs zu Beginn<br />
der Weimarer Republik“<br />
Agnes Laba (Marburg): „Die öffentliche<br />
Diskussion der Ostgrenzen in<br />
der frühen Weimarer Republik“<br />
Dominik Mauer (Mannheim): „Demokratische<br />
und antidemokratische<br />
Konzepte in der Satire der<br />
Weimarer Republik“ und Promotionsvorhaben<br />
„Grundlegung einer<br />
quantitativ-qualitativen Argumentationsanalyse<br />
als diskurslinguistische<br />
Methode“<br />
Jörn Retterath (München): „Volk<br />
im Umbruch zwischen Kaiserreich<br />
und Weimarer Republik. Ein Werkstattbericht<br />
zu Stand und Problemen<br />
der Zeitungsauswertung“<br />
Melanie Seidenglanz (Mannheim):<br />
„Die Funktion von Abdankungsurkunden<br />
im Demokratisierungsprozess<br />
der Weimarer Republik“<br />
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung<br />
Das neueste Heft 59/2 des zentralen<br />
Organs der internationalen Ostmitteleuropa-Forschung<br />
enthält<br />
neben einem umfangreichen Besprechungsteil<br />
folgende Beiträge:<br />
Erki Tammiksaar: Alexander Theodor<br />
von Middendorff und die Entwicklung<br />
der livländischen Gesellschaft<br />
in den Jahren 1860 bis 1885<br />
Pavel Marek: Zum politischen Profil<br />
von František Kordač<br />
Katharina Wessely: Die deutsch-<br />
sprachigen Provinztheater Böhmens<br />
und Mährens zwischen lokaler,<br />
regionaler und nationaler<br />
Identität<br />
29
Der Führer im Europa des 20. Jahrhunderts<br />
Forschungen zu Kult und Herrschaft der Führer-Regime in Mittel-, Ost-<br />
und Südosteuropa. Analysen, Konzepte und Vergleiche<br />
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
(1914-1945) brachte im Zuge<br />
der autoritären und totalitären Systeme<br />
eine Reihe von Führerkulten<br />
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa<br />
hervor. Mit der Personalisierung<br />
politischer Macht war die Prämisse<br />
verbunden, dass diese nicht in<br />
„abstrakten“ <strong>Institut</strong>ionen verfasst<br />
sein, sondern erst im Bild des „Führers“<br />
einen für die Wahrnehmung<br />
des Volkes greifbaren Ausdruck<br />
und für die Herrschaft durchgreifenden<br />
Effekt finden kann, so dass<br />
die Allgegenwart und Allmacht des<br />
„Führers“ nur durch umfassenden<br />
Einsatz der Massenmedien des 20.<br />
Jahrhunderts gewährleistet werden<br />
konnte.<br />
Die politischen Kulte des 20. Jahrhunderts<br />
waren bislang erstaunlich<br />
30<br />
selten Gegenstand ausführlicher<br />
und komparatistischer historischer<br />
Forschung. Die Beiträge des Ban-<br />
Loyalitäten im Staatssozialismus<br />
DDR, Tschechoslowakei, Polen<br />
Die allgemeine Vorstellung von<br />
staatssozialistischen Diktaturen ist<br />
trotz aller Fortschritte der historischen<br />
Forschung immer noch stark<br />
von einer Unterscheidung zwischen<br />
„Macht“ und „Gesellschaft“<br />
geprägt. Demnach beruhte das<br />
Handeln in solchen Regimen in erster<br />
Linie auf Zwang und Angst vor<br />
Repression. Doch ist es notwendig,<br />
genauer nach verschiedenen<br />
Motivationen und Formen systemkonformen<br />
und -stabilisierenden<br />
Handelns jenseits des Drucks von<br />
Partei und Staatssicherheit zu fragen.<br />
Aus diesem Grund betrachten<br />
die Autoren dieses Sammelbandes<br />
mit Hilfe der Analysekategorie<br />
„Loyalität“ am Beispiel von Themenbereichen<br />
wie Migration und<br />
Umverteilung nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg, Feindpropaganda, Sozi-<br />
al- und Konsumpolitik, Intellektuelle<br />
und Künstler sowie Kirche im Sozialismus<br />
verschiedene gesellschaftliche<br />
Aspekte der Funktionsweise<br />
der staatssozialistischen Systeme<br />
in der SBZ/DDR, der Tschechoslowakei<br />
und Polen in den Jahren<br />
1945 bis 1989.<br />
Loyalitäten im Staatssozialismus<br />
DDR, Tschechoslowakei, Polen<br />
Herausgegeben von Volker Zimmermann,<br />
Peter Haslinger und<br />
Tomáš Nigrin<br />
(Tagungen zur Ostmitteleuropa-<br />
Forschung, Bd. 28)<br />
Marburg 2010, VI, 366 S.<br />
€ 27,00<br />
ISBN 978-3-87969-364-1<br />
des stellen daher Führerkulte des<br />
20. Jahrhunderts, die in autoritären<br />
und totalitären Regimen entstanden<br />
sind, in vergleichender Perspektive<br />
dar.<br />
Der Führer im Europa des 20.<br />
Jahrhunderts<br />
Forschungen zu Kult und Herrschaft<br />
der Führer-Regime in Mittel-,<br />
Ost- und Südosteuropa. Analysen,<br />
Konzepte und Vergleiche<br />
Herausgegeben von Benno Ennker<br />
und Heidi Hein-Kircher<br />
(Tagungen zur Ostmitteleuropa-<br />
Forschung, Bd. 27)<br />
Marburg 2010, VIII, 382 S.<br />
€ 38,00<br />
ISBN 978-3-87969-359-7
Umgesiedelt – Vertrieben<br />
Deutschbalten und Polen 1939-1945 im<br />
Warthegau<br />
Der sogenannte „Hitler-Stalin-Pakt“<br />
vom August 1939 mit seinen geheimen<br />
Zusatzprotokollen über die<br />
Abgrenzung von Interessensphären<br />
zwischen NS-Deutschland und<br />
der Sowjetunion löste umfangreiche<br />
Grenzverschiebungen, Umsiedlungen<br />
und Vertreibungen in<br />
Europa aus. Den Anfang machte<br />
die gewaltsame Vertreibung der<br />
jüdischen und großer Teile der polnischen<br />
Bevölkerung aus den im<br />
Polenfeldzug der deutschen Wehrmacht<br />
besetzten Gebieten, um den<br />
von den NS-Behörden aus dem<br />
Baltikum und anderen deutschen<br />
Siedlungsgebieten im östlichen<br />
Europa umgesiedelten deutschen<br />
Volksgruppen Platz zu machen.<br />
Siebzig Jahre nach dem Beginn<br />
dieser Ereignisse trafen sich auf<br />
Initiative der Deutsch-Baltischen<br />
Terminvorschau<br />
22. Oktober 2010 - 1. Mai 2011<br />
Dokumentationszentrum Obersalzberg,<br />
Berchtesgaden<br />
18. Mai - 18. Juni 2011<br />
Kornhausforum, Bern<br />
10. Oktober - 15. November 2011<br />
Forschungsstelle Ostmitteleuropa,<br />
TU Dortmund<br />
Im Objektiv des Feindes – Die deutschen<br />
Bildberichterstatter im besetzten<br />
Warschau 1939-1945 /<br />
W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy<br />
w okupowanej Warszawie<br />
(1939-1945)<br />
Eine Wanderausstellung des Hauses<br />
der Begegnung mit der Geschichte<br />
in Warschau in Zusammenarbeit<br />
mit der Polnischen<br />
Akademie der Wissenschaften und<br />
dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in Marburg,<br />
dem Bundesarchiv sowie der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz mit<br />
Gesellschaft (Darmstadt) und des<br />
Instytut Zachodni (Poznań) im<br />
Oktober 2009 Wissenschaftler,<br />
Zeitzeugen und Interessierte aus<br />
Deutschland und Polen in Poznań,<br />
um sich über den Stand der wissenschaftlichen<br />
Erforschung der<br />
Geschehnisse zwischen 1939 und<br />
1945 im sogenannten „Warthegau“<br />
auszutauschen und anhand von<br />
Zeitzeugenberichten das damalige<br />
Erleben und die weiteren Schicksale<br />
der betroffenen Menschen<br />
gegenwärtig werden zu lassen. Der<br />
vorliegende Band vereint die Beiträge<br />
dieser Tagung.<br />
Umgesiedelt – Vertrieben<br />
Deutschbalten und Polen 1939-<br />
1945 im Warthegau<br />
Herausgegeben von Eckhart Neander<br />
und Andrzej Sakson<br />
der Bildagentur bpk und dem Museum<br />
Europäischer Kulturen –<br />
Staatliche Museen zu Berlin.<br />
3. Februar - 15. April 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Region und Nation. 125 Jahre deutschehistoriographisch-landeskundliche<br />
Beschäftigung mit der<br />
Geschichte der Deutschen in Posen<br />
und Polen<br />
Eine Ausstellung der Kommission<br />
für die Geschichte der Deutschen<br />
in Polen e.V.<br />
4. März - 27. April 2011<br />
Museum der Niederschlesischen<br />
Weberei, Landeshut/Kamienna Góra<br />
Zeit-Reisen. Schlesien-Ansichten<br />
aus der Graphiksammlung Haselbach<br />
/ Podróże w czasie. Dawne<br />
(Tagungen zur Ostmitteleuropa-<br />
Forschung, Bd. 29)<br />
Marburg 2010, VI, 130 S.<br />
€ 26,00<br />
ISBN 978-3-87969-367-2<br />
widoki Śląska na grafikach z kolekcji<br />
Haselbacha<br />
Eine Ausstellung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Marburg, des Schlesischen<br />
Museums zu Görlitz und des Kunstforums<br />
Ostdeutsche Galerie Regensburg,<br />
in Kooperation mit dem<br />
Architekturmuseum in Breslau<br />
22. - 23. März 2011<br />
Hessisches Staatsarchiv, Marburg<br />
Frühjahrstagung Adelsarchive in<br />
der historischen Forschung der<br />
Fachgruppe 4 des Verbands deutscher<br />
Archivarinnen und Archivare<br />
(Herrschafts- und Familienarchive)<br />
und des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
5. Mai 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
LOEWE-Workshop Prosopographisch<br />
Arbeiten. Inhalte – Metho-<br />
<strong>31</strong>
den – Erfahrungen – Desiderata<br />
(Eligiusz Janus)<br />
16. Mai 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
LOEWE-Workshop Raum virtuell.<br />
Theorien und Anwendungsperspektiven<br />
(Wolfgang Kreft)<br />
16. Mai 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Ausstellungseröffnung: Breslau im<br />
Luftbild der Zwischenkriegszeit<br />
Eine Ausstellung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Marburg in Zusammenarbeit<br />
mit der Stadtverwaltung Wrocław<br />
und dem Verlag VIA NOVA Wrocław<br />
(Ausstellung bis zum 30. September<br />
2011)<br />
17. Mai 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
LOEWE-Workshop Vom Katalog<br />
zum Wissensspeicher, von der Bestandserschließung<br />
zur Wissensgenerierung<br />
– Synergien/Rückkopplung<br />
von Grundlagenarbeit in den<br />
Sammlungen und wissenschaftlicher<br />
Forschung. Teil I: Grundlagenarbeit<br />
– Bild und Kontext (Elke Bauer)<br />
32<br />
27. - 29. Mai 2011<br />
Deutsches Historisches <strong>Institut</strong><br />
(DHI), Warschau<br />
Tagung Deutsch-polnische Wissenskulturen<br />
und Wissenschaftsbeziehungen<br />
/ Kultura wiedzy a<br />
polsko-niemieckie stosunki naukowe<br />
30. - <strong>31</strong>. Mai 2011<br />
Universität Södertörn, Stockholm<br />
Präsentation der Leibniz Graduate<br />
School am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
10. Juni 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Mitgliederversammlung<br />
16. - 18. Juni 2011<br />
Alexander von Humboldt-Gästehaus<br />
der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen und <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Tagung Migration und Religion.<br />
Interdisziplinäre Forschung und<br />
Umsetzung in deutschen und polnischen<br />
Schulbüchern der Gemeinsamen<br />
Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission<br />
24. - 25. Juni 2011<br />
Margarete-Bieber-Saal, Gießen<br />
Abschlussveranstaltung LOEWE-<br />
Schwerpunkt Kulturtechniken und<br />
ihre Medialisierung<br />
12. - 17. September 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Internationale und interdisziplinäre<br />
Sommerakademie des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
„Knowlegde in Flux“: Wissenskulturen<br />
und Diskursivität des Wissens<br />
angesichts von Differenzierungs-,<br />
Dynamisierungs- und Transnationalisierungsprozessen<br />
22. - 24. September 2011<br />
Deutsches Polen-<strong>Institut</strong>, Mainz<br />
Zweite Tagung Deutsche Polenforschung<br />
Die Mitte Europas. Kommunikation<br />
– Konstruktion – Kooperation<br />
11. Oktober - 23. Dezember 2011<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Schloss Friedrichstein in Ostpreußen<br />
und die Grafen Dönhoff<br />
Eine Ausstellung des Deutschen<br />
Kulturforums östliches Europa,<br />
Potsdam<br />
HERDER-INSTITUT e.V.<br />
Gisonenweg 5-7<br />
35037 Marburg,<br />
Tel. +49-6421-184-0<br />
Fax +49-6421-184-139<br />
mail@herder-institut.de<br />
www.herder-institut.de