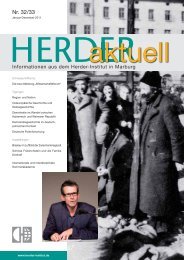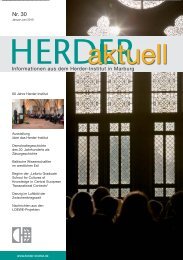Positive Bewertung des Herder-Instituts
Positive Bewertung des Herder-Instituts
Positive Bewertung des Herder-Instituts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Informationen aus dem <strong>Herder</strong>-Institut in Marburg<br />
<strong>Positive</strong> <strong>Bewertung</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong><br />
Dr. Jürgen Warmbrunn (l.) und Mitglieder der Evaluierungsgruppe<br />
In seiner Sitzung am 14. Juni hat<br />
der Senat der Wissenschaftsgemeinschaft<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz<br />
(WGL) die Arbeit <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Instituts</strong> uneingeschränkt positiv<br />
bewertet und die gemeinsame Weiterförderung<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> durch<br />
Bund und Länder für die nächsten<br />
sieben Jahre empfohlen.<br />
Grundlage für diese Empfehlung war<br />
die alle sieben Jahre stattfindende<br />
Evaluierung <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> als eines<br />
Mitglieds der Leibniz-Gemeinschaft.<br />
Dieser Verbund von Einrichtungen,<br />
die aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung<br />
und eines gesamtstaatlichen<br />
wissenschaftlichen Interesses an ihrer<br />
Arbeit im Rahmen der gemeinsamen<br />
Forschungsförderung nach Artikel 91b<br />
<strong>des</strong> Grundgesetzes von Bund und<br />
Ländern gefördert werden, besteht<br />
seit 1977 – ursprünglich unter dem<br />
Namen „Blaue Liste“. In einer Stellungnahme<br />
<strong>des</strong> Wissenschaftsrates<br />
vom November 2000 zur Systemevaluation<br />
der „Blauen Liste“ war der heutigen<br />
Leibniz-Gemeinschaft aufgegeben<br />
worden, die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit<br />
der Mitgliedseinrichtungen<br />
durch ihren extern besetzten<br />
Senat im Rahmen eines Evaluierungsvorhabens<br />
zu prüfen. Diese<br />
Evaluierungsverfahren sind strikt unabhängig<br />
und werden von einem<br />
eigens eingesetzten Senatsausschuss<br />
Evaluierung (SAE) durchgeführt, der<br />
jeweils <strong>Bewertung</strong>sgruppen aus international<br />
renommierten und unabhängigen<br />
Wissenschaftlern benennt.<br />
In dieser Ausgabe:<br />
Tagungen und Vorträge<br />
Nachwuchstagung Vilnius<br />
Workshop Städteatlas<br />
Neue Veröffentlichungen<br />
Leobschützer Rechtsbuch<br />
Bibliographie Geschichte<br />
Ost- und Westpreußens 1998<br />
Dehio Schlesien (polnisch)<br />
Namen und Nachrichten<br />
Wettbewerbsverfahren WGL<br />
Kooperationsvereinbarung mit JLU<br />
Projekt Sammlung Haselbach<br />
Archiv der Baltischen Ritterschaften<br />
Bibliographische Kooperation mit<br />
Budapest<br />
Ausstellung „Der Fotograf ist da!“<br />
Ausstellung Danziger Bürgerhäuser<br />
Parlamentarischer Abend der<br />
WGL in Berlin<br />
Archivtag<br />
Kulturausschuss <strong>des</strong><br />
Hessischen Lan<strong>des</strong>beirates<br />
Vorträge von Mitarbeitern<br />
Terminvorschau<br />
Nr. 22<br />
Januar -<br />
Juni 2006<br />
Zu Gast im <strong>Herder</strong>-Institut
Das <strong>Herder</strong>-Institut hatte für seine<br />
<strong>Bewertung</strong> im Juni 2005, basierend<br />
auf dem allgemeinen Fragenkatalog<br />
für die Evaluierung von Forschungsund<br />
Serviceeinrichtungen der Leibniz-<br />
Gemeinschaft, umfangreiche vorbereitende<br />
Materialien eingereicht. Auf<br />
der Grundlage dieser Unterlagen<br />
wurde von Seiten <strong>des</strong> SAE eine Darstellung<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> erstellt, die mit<br />
den zuständigen Ressorts <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Hessen und <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> abgestimmt<br />
wurde.<br />
Am 18. und 19. Oktober 2005 besuchte<br />
dann eine 13-köpfige <strong>Bewertung</strong>sgruppe<br />
das Institut, um sich einen<br />
unmittelbaren und direkten Eindruck<br />
vom Profil, der Aufgabenstellung und<br />
der Tätigkeit <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> zu verschaffen.<br />
Der Bericht dieser <strong>Bewertung</strong>sgruppe<br />
und die dazu erbetene Stellungnahme<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> bildeten danach<br />
die Grundlagen für den vom Senatsausschuss<br />
erarbeiteten Entwurf<br />
einer Senatsstellungnahme, die vom<br />
Senatsplenum abschließend erörtert<br />
und verabschiedet wurde.<br />
Die Leitung der Evaluierungsgruppe<br />
In seiner Beurteilung stellt der Senat<br />
der WGL einleitend fest, dass sich das<br />
<strong>Herder</strong>-Institut „in den letzten Jahren<br />
zu einer zentralen und unentbehrlichen<br />
Schaltstelle der nationalen und<br />
internationalen historischen Ostmitteleuropa-Forschung<br />
entwickelt“ habe<br />
und „seinen Serviceauftrag mit sehr<br />
guten Leistungen“ erfülle; das Institut<br />
habe seit der letzten Evaluierung<br />
durch den Wissenschaftsrat 1998 ein<br />
2<br />
deutlich verändertes zeitgemäßes<br />
Profil erhalten. Besonders hervorgehoben<br />
werden „die offensive Nutzung<br />
moderner Medien“, die „vielfältigen<br />
Vermittlungsaktivitäten <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
und nicht zuletzt das Engagement der<br />
hoch motivierten Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter“. Die Einzigartigkeit der<br />
Sammlungen an Literatur, Bildern und<br />
Karten wird unterstrichen und herausgehoben,<br />
dass die „Bibliothek zur<br />
Geschichte vor allem Polens, Tschechiens<br />
und der baltischen Staaten“<br />
„nicht nur in Deutschland, sondern<br />
auch international ihresgleichen“<br />
suche. Neben der Bereitstellung,<br />
systematischen Erweiterung, Erschließung<br />
und Konservierung von<br />
anderenorts nicht verfügbaren Spezialsammlungen<br />
erfülle das Institut<br />
auch durch die Erstellung grundlegender<br />
Hilfs- und Arbeitsmittel für die historische<br />
Ostmitteleuropa-Forschung,<br />
die Durchführung eigener programmgebundener<br />
Forschung sowie die Förderung<br />
der wissenschaftlichen Kommunikation<br />
auf seinem Arbeitsgebiet<br />
„eine wichtige Knotenpunkt- und Kata-<br />
lysatorfunktion für die Vernetzung von<br />
Forschungsaktivitäten“; die sehr effektiv<br />
eingesetzte Kombination dieser<br />
Schwerpunkte stelle „ein Alleinstellungsmerkmal“<br />
dar. Um diesen Aspekt<br />
noch zu fördern, empfiehlt der Senat<br />
der WGL dem <strong>Herder</strong>-Institut, „die<br />
Forschungsbasierung seiner Serviceleistungen“<br />
zu verstärken; am besten<br />
könne dies erreicht werden „durch<br />
eine Stärkung der Funktion <strong>des</strong> Insti-<br />
tuts als Forum der wissenschaftlichen<br />
Diskussion“ in enger Verflechtung von<br />
Service und Forschung. Konkret empfohlen<br />
wird ferner eine Verstärkung<br />
der personellen Ausstattung <strong>des</strong> EDV-<br />
Bereichs, nicht zuletzt vor dem Hintergrund<br />
der intensiven Vernetzung <strong>des</strong><br />
<strong>Instituts</strong> mit der „Informationswelt“,<br />
wie sie beispielsweise durch die Einbettung<br />
in das Virtuelle-Bibliotheks-<br />
Konzept erfolge. Hinsichtlich der Doktorandenausbildung<br />
wird ein gewisser<br />
Verbesserungsbedarf gesehen, ein<br />
weiterer Ausbau <strong>des</strong> Stipendienprogramms<br />
angeregt.<br />
Zusammenfassend stellt der Senat<br />
der WGL fest, das <strong>Herder</strong>-Institut sei<br />
„ein bedeuten<strong>des</strong> und wichtiges Institut<br />
für die historische Ostmitteleuropaforschung<br />
mit internationaler Ausstrahlung“,<br />
das ohne Einschränkungen<br />
die Anforderungen erfülle, die an<br />
Einrichtungen von überregionaler Bedeutung<br />
und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischen<br />
Interesse zu<br />
stellen seien. Mit diesem aus Sicht<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> außerordentlich erfreulichen<br />
Ergebnis werden seine positive<br />
Entwicklung, sein Profil und seine vielfältigen<br />
Leistungen und Aktivitäten<br />
eindrucksvoll bestätigt.<br />
�
Tagungen und Vorträge<br />
Nordosteuropa in Geschichte und<br />
Geschichtsschreibung<br />
Bereits zum vierten Mal konnte das<br />
<strong>Herder</strong>-Institut gemeinsam mit dem<br />
Litauischen Historischen Institut<br />
(Vilnius) und dem Nordost-Institut<br />
Lüneburg eine internationale Nachwuchstagung<br />
in der Hauptstadt<br />
Litauens durchführen. Gefördert<br />
wurde die Veranstaltung, für die<br />
sich inzwischen ein zweijährlicher<br />
Rhythmus herausgebildet hat, von<br />
der Robert Bosch Stiftung und vom<br />
Deutsch-Litauischen Forum.<br />
An der interdisziplinären Tagung mit<br />
dem Leitmotiv „Nordosteuropa in<br />
Geschichte und Geschichtsschreibung“,<br />
die vom 3. bis 7. Mai 2006<br />
unter der Leitung von Dr. Hans-Jürgen<br />
Bömelburg (Lüneburg), Dr. Heidi Hein<br />
(Marburg) und Dr. Darius Staliunas<br />
(Vilnius) stattfand, nahmen fünfzehn<br />
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
aus Deutschland, Estland,<br />
Kanada, Lettland, Litauen,<br />
Österreich, Polen und Weißrussland<br />
teil. Erstmals bei diesen gemeinsamen<br />
Nachwuchstagungen wurde der<br />
Schwerpunkt auf Forschungen zum<br />
Mittelalter und zur Frühen Neuzeit<br />
gelegt. Im Mittelpunkt <strong>des</strong> Programms<br />
standen die Präsentationen der laufenden<br />
Forschungsvorhaben der Teilnehmer,<br />
die überwiegend aus dem<br />
Bereich der allgemeinen Geschichte<br />
stammten, aber auch zwei musikhistorische<br />
Referate und ein archäologisches<br />
Thema umfassten.<br />
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit<br />
einem anregenden Vortrag von Prof.<br />
Dr. Alvydas Nik¾entaitis (Vilnius) über<br />
„das Mittelalter und die Frühe Neuzeit<br />
in Geschichtsschreibung und kulturellem<br />
Gedächtnis“, in dem die Rolle der<br />
Historiographie für die Bildung historischen<br />
Bewusstseins und nationaler<br />
Mythen herausgestellt wurde.<br />
In der ersten Sektion, die mediävistischen<br />
Themen gewidmet war und die<br />
Dr. Norbert Kersken (Marburg) mit<br />
Die Teilnehmer der Nachwuchstagung in Vilnius<br />
einem Impulsreferat über die Bedeutung<br />
von Kirchen, Orden, Städten und<br />
Land für die Gemeinschaftsbildung im<br />
mittelalterlichen Livland einleitete, wurden<br />
Arbeiten zur zeitgenössischen<br />
Wahrnehmung der frühstädtischen<br />
Siedlungen im Ostseeraum <strong>des</strong> 9. bis<br />
11. Jahrhunderts, zur „emotionalen“<br />
Geschichte der Europäisierung <strong>des</strong><br />
Ostseeküstenraums durch Mission<br />
und Kreuzzüge vom 10. bis 14. Jahrhundert,<br />
zum Verhältnis von Deutschem<br />
Orden, päpstlicher Kurie und<br />
lokaler Gewalt im ausgehenden Mittelalter<br />
am Beispiel Ösels, zur Siedlungs-,<br />
Sozial- und Verwaltungsgeschichte<br />
der Ordenskomturei Königsberg<br />
vom 13. bis 16. Jahrhundert (auf<br />
der Basis einer geographisch-historischen<br />
Datenbank), zur Musikgeschichte<br />
der Stadt Thorn bis 1600, zu spätmittelalterlichen<br />
Pilgerreisen im Ostseeraum,<br />
zur Geschichte der Hanse in<br />
Nordosteuropa sowie die Ergebnisse<br />
archäologischer Studien zu Spielen im<br />
ostbaltischen Raum zwischen dem<br />
13. und 17. Jahrhundert vorgestellt. In<br />
der Sektion mit Projekten zur frühneuzeitlichen<br />
Geschichte, die mit einem<br />
Impulsvortrag über „soziale und kulturelle<br />
Aspekte <strong>des</strong> frühneuzeitlichen<br />
Ostseeraums“ von Prof. Dr. Ralph<br />
Tuchtenhagen (Hamburg) eröffnet<br />
wurde, standen die polnische Herrschaft<br />
in Riga zwischen 1581 und<br />
1621, zeitgenössische Abstammungshypothesen<br />
am Beispiel von „Ursprung<br />
und Wanderungen der ‚undeutschen‘<br />
Livländer im Geschichtsverständnis<br />
der Frühen Neuzeit“, Hochzeitsmusik<br />
in Königsberg 1585-1645 und schließlich<br />
die Entwicklung der Zeitungslandschaft<br />
im Großfürstentum Litauen in<br />
der ersten Hälfte <strong>des</strong> 18. Jahrhunderts<br />
auf der Tagesordnung. Die abschließende<br />
dritte Sektion umfasste<br />
drei Projekte zur Geschichte <strong>des</strong><br />
19. und 20. Jahrhunderts: Konversionen<br />
in Kurland in der zweiten Hälfte<br />
<strong>des</strong> 19. Jahrhunderts, der Umgang mit<br />
Kulturgütern der Deutschbalten, die im<br />
Zuge der Vertreibung in Polen geblieben<br />
waren, und Herrenhäuser im ostelbischen<br />
Raum als Geschichtsorte zwischen<br />
1945 und 1999.<br />
Die recht heterogenen Vorträge der<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lenkten<br />
den Blick auf zumeist weniger<br />
beachtete Epochen und verdeutlichten<br />
auch, dass laufende historische<br />
Forschungen zur nordosteuropäischen<br />
Geschichte breitere, aktuelle Ansätze<br />
und Fragestellungen aufgreifen. Insgesamt<br />
zeigte sich, dass sich das<br />
Konzept von einer Mischung aus Vorträgen<br />
mit theoretischen Ansätzen<br />
und „praktischer Anwendung“ (Referate)<br />
bewährt hat.<br />
��<br />
3
Stadtentwicklung in Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Am 12. Mai kamen im <strong>Herder</strong>-Institut<br />
26 deutsche und polnische Historiker,<br />
Geographen, Kunsthistoriker<br />
und Kartographen, darunter<br />
Vertreter der Kooperationseinrichtungen<br />
in Breslau, Kattowitz und<br />
Münster, zusammen, um unter der<br />
Leitung von Dr. Dr. h.c. Winfried<br />
Irgang und Dipl.-Ing. Wolfgang<br />
Kreft über das Projekt „Historischtopographischer<br />
Städteatlas von<br />
Schlesien“ zu diskutieren. Im Vordergrund<br />
<strong>des</strong> von der DFG im Hinblick<br />
auf einen Förderantrag empfohlenen<br />
Workshops stand die<br />
abschließende Beratung über die<br />
Konzeption <strong>des</strong> Projekts und <strong>des</strong>sen<br />
Abgrenzung gegenüber herkömmlichenStädteatlas-Programmen<br />
sowie die endgültige Auswahl<br />
der zu bearbeitenden Städte.<br />
Nach einem einleitenden Bericht von<br />
Dr. Rafa³ Eysymontt (Breslau) über<br />
die Konzeption <strong>des</strong> „Atlas historyczny<br />
miast Polskich, T. IV: ¦l±sk“, in dem<br />
die stadtgeschichtliche Entwicklung<br />
vom Mittelalter bis in die jüngere<br />
Gegenwart behandelt wird und in <strong>des</strong>sen<br />
Rahmen bisher vier Hefte erschienen<br />
sind, stellte Wolfgang Kreft<br />
das Projekt „Historisch-topographischer<br />
Städteatlas von Schlesien“ vor,<br />
<strong>des</strong>sen Konzept insofern deutlich über<br />
diesen Forschungsansatz hinausgeht,<br />
als hier eine geographische Analyse<br />
(Topographie, Funktion, Infrastruktur,<br />
Planungsgeschichte u.a.) durchgeführt<br />
und eine Interpretation und Er-<br />
4<br />
Workshopteilnehmer im Vortragssaal <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong><br />
läuterung der neuzeitlichen, planungsbegleiteten<br />
Entwicklung im Industriezeitalter<br />
vorgenommen werden soll.<br />
Die gewählten Zeitschnitte 1830,<br />
1900, 1940 und 2000 werden erstmals<br />
eine vergleichende, synoptische<br />
Dokumentation der Städte vom Beginn<br />
<strong>des</strong> industriellen Zeitalters über<br />
die gründerzeitliche Stadterweiterung<br />
und den modernen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur<br />
sowie die Siedlungsentwicklung<br />
in der Zwischenkriegszeit<br />
bis zu den verschiedenen<br />
Formen <strong>des</strong> Wiederaufbaus und dem<br />
zunächst sozialistischen Funktionswandel<br />
der Beispielorte in der Zeit<br />
nach 1945 und dem aktuellen Transformationsprozess<br />
ermöglichen. Der<br />
Beitrag von Dr. Holger Gräf (Marburg)<br />
beschäftigte sich mit der „Bedeutung<br />
von Wachstumsphasenkarten in historischen<br />
Städteatlanten“ und den<br />
methodischen Problemen dieses speziellen<br />
Kartentyps, bei dem in der<br />
Regel die siedlungstopographische<br />
Entwicklung <strong>des</strong> 19. und 20. Jahrhun-<br />
derts bisher nahezu unbehandelt geblieben<br />
war. Am Beispiel der bereits<br />
entwickelten Demonstrations-CD zum<br />
Historisch-topographischen Städteatlas<br />
von Schlesien stellte schließlich<br />
Dr. Dariusz Przybytek (Breslau/Wiesbaden)<br />
„Möglichkeiten multimedialer<br />
Visualisierung in der Stadtgeschichte“<br />
vor, die neben der geplanten Printversion<br />
<strong>des</strong> Atlas einen erweiterten<br />
Zugriff auf die Forschungsergebnisse<br />
und eine moderne Vermarktung auch<br />
im Internet erlauben.<br />
In der sich anschließenden sehr lebhaften<br />
Diskussion wurde eine Liste<br />
von 29 Städten für den geplanten<br />
Städteatlas erstellt, wobei die Auswahl<br />
nach Kriterien raumprägender<br />
Wirkung städtischer Funktionen und<br />
nach idealtypischen Kategorien erfolgte.<br />
In der Abschlussrunde wurde<br />
der chronologische und methodische<br />
Ansatz <strong>des</strong> Projekts hervorgehoben,<br />
das sich von vornherein auf den gesamten<br />
Zeitraum <strong>des</strong> 19. und 20.<br />
Jahrhunderts bezieht und somit die<br />
Forschung zu aufschlussreichen Vergleichen<br />
und Diskussionen über die<br />
Konsequenz der Raumnutzung in Vergangenheit<br />
und Gegenwart anregen<br />
kann. Vor allem mit der gemeinsamen<br />
Erforschung der Stadtentwicklung<br />
nach 1945 betrete der Atlas Neuland.<br />
Er könne damit einen Beitrag zur konzeptionellen<br />
Weiterführung stadtgeographischer<br />
Darstellungen wie auch<br />
zur Grundlagenpräsentation für die<br />
weitere planvolle Stadtentwicklung<br />
und die örtliche Identität leisten.<br />
��
Neue Veröffentlichungen<br />
Edition eines spätmittelalterlichen Rechtsbuchs<br />
Die heute recht unbedeutende Kleinstadt<br />
Leobschütz (poln. G³ubczyce,<br />
tschech. Hlubèice) an der polnischtschechischen<br />
Grenze war während<br />
<strong>des</strong> Mittelalters eine der größten Städte<br />
<strong>des</strong> nordmährisch-oberschlesischen<br />
Raums. Besondere Bedeutung<br />
erlangte der Ort durch ein ihm eigentümliches<br />
Stadtrecht, das bereits im<br />
13. Jahrhundert an zahlreiche kleinere<br />
Orte im ländlichen Bereich weitergegeben<br />
wurde, wodurch Leobschütz<br />
bis in die Frühe Neuzeit hinein<br />
Rechtsvorort (Oberhof) einer eigenen<br />
Stadtrechtsfamilie wurde. Neben dem<br />
Magdeburger Recht und dem Halle-<br />
Neumarkter Recht ist das Leobschützer<br />
Recht somit das dritte eigenständige<br />
Recht in dieser Region gewesen.<br />
Dieses Leobschützer Willkürrecht sowie<br />
zwei besonders wichtige Urkunden<br />
<strong>des</strong> 13. Jahrhunderts und eine<br />
Version <strong>des</strong> Meißner Rechts wurden<br />
in einer prachtvoll gestalteten Pergamenthandschrift<br />
versammelt, deren<br />
Beendigung im Jahr 1421 einen Meilenstein<br />
der schlesischen Buchproduktion<br />
darstellt. Der Kodex wurde im<br />
Auftrag <strong>des</strong> Leobschützer Rates von<br />
dem Krakauer Stuhlschreiber Nicolaus<br />
Brevis sorgfältig geschrieben und<br />
von dem vermutlich Breslauer Illuminator<br />
Johannes von Zittau reich illus-<br />
triert. Er stellt dadurch auch ein<br />
Beispiel für ein wertvoll gestaltetes<br />
Rechtsbuch als Ausdruck stadtbürgerlicher<br />
Emanzipation dar. Nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg galt dieser Prachtkodex<br />
jahrzehntelang als verschollen,<br />
bis er zur großen Überraschung der<br />
Fachwelt vor wenigen Jahren in<br />
Privathand wieder auftauchte; seit<br />
Herbst 2002 steht er als Depositum<br />
der Fundacja Barbary Piaseckiej-<br />
Johnson im Staatsarchiv Oppeln/<br />
Archiwum Pañstwowe w Opolu der<br />
Forschung wieder zur Verfügung.<br />
Als Ergebnis eines von der DFG<br />
geförderten Projekts bietet die hier<br />
vorgelegte erstmalig vollständige Ausgabe<br />
nicht nur eine kritische Edition<br />
<strong>des</strong> gesamten ‘Leobschützer Rechtsbuches’<br />
nebst Einführungen in die<br />
Texte und deren Überlieferung durch<br />
die Münsteraner Germanistin Gunhild<br />
Roth, sondern in einem reichen Tafelteil<br />
auch alle Miniaturen der Handschrift.<br />
Außerdem wird in einem eigenen<br />
Teilprojekt der Versuch <strong>des</strong> Danziger<br />
Künstlers und Fotografen<br />
Krzysztof Izdebski dokumentiert, aus<br />
Schwarzweißaufnahmen den Farbwert<br />
verlorener Bildseiten zu rekomponieren.<br />
Dieses Verfahren konnte<br />
am Original überprüft und evaluiert<br />
werden.<br />
Bibliographie Ost- und Westpreußens 1998<br />
Im Frühjahr ist ein weiterer Band der<br />
seit dem Berichtsjahr 1994 wieder<br />
aufgenommenen bibliographischen<br />
Dokumentation der wissenschaftlichen<br />
Literatur zur Geschichte Ostund<br />
Westpreußens erschienen. Wie<br />
die vorherigen Bände entstand er in<br />
Kooperation mit der Universitätsbibliothek<br />
Thorn und in Verbindung mit der<br />
Wissenschaftlichen Gesellschaft in<br />
Thorn und der Historischen Kommission<br />
für Ost- und Westpreußische<br />
Lan<strong>des</strong>forschung. Die Bibliographie<br />
versteht sich als Auszug aus der<br />
umfassenden Literaturdokumentation<br />
zur Geschichte Ostmitteleuropas, die<br />
auf der homepage <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
zugänglich ist (http://www.litdok.de).<br />
Der Band beruht auf der Auswertung<br />
von etwa 600 laufenden Zeitschriften<br />
und weist 2435 einschlägige Publikationen<br />
nach, die durch ein Autorenregister,<br />
ein Personenregister, ein geographisches<br />
Register und ein Sachregister<br />
in deutscher und polnischer<br />
Sprache erschlossen werden.<br />
Das ‘Leobschützer Rechtsbuch’<br />
Bearbeitet und eingeleitet von Gunhild<br />
Roth, herausgegeben von Winfried<br />
Irgang (Quellen zur Geschichte<br />
und Lan<strong>des</strong>kunde Ostmitteleuropas,<br />
Bd. 5).<br />
Marburg 2006, XIV, 552 S.,<br />
37 Farbabb.<br />
€ 57,--<br />
ISBN 3-87969-327-7<br />
Bibliographie zur Geschichte Ostund<br />
Westpreußens/Bibliografia historii<br />
Pomorza Gdañskiego i Prus<br />
Wschodnich 1998. Bearbeitet von<br />
Csaba János Kenéz und Urszula<br />
Zaborska unter Mitarbeit von<br />
Gabriele Kempf (Bibliographien zur<br />
Geschichte und Lan<strong>des</strong>kunde Ostmitteleuropas,<br />
Bd. 38).<br />
Marburg 2006, LVII, 294 S.<br />
€ 33,--<br />
ISBN 3-87969-329-3<br />
��<br />
��<br />
5
Zabytki Sztuki w Polsce. ¦l±sk<br />
Reisehandbuch, Nachschlagewerk,<br />
wissenschaftlich fundierter und aktueller<br />
Überblick in deutscher und polnischer<br />
Sprache – „eine bedeutende<br />
kulturpolitische Tat zur Dokumentation<br />
<strong>des</strong> gemeinsamen Kulturerbes von<br />
Deutschen und Polen“. Das Dehio-<br />
Handbuch der Kunstdenkmäler in<br />
Polen. Schlesien (<strong>Herder</strong> aktuell 21,<br />
2005) wurde im Herbst 2005 vorgelegt<br />
und konnte nunmehr auch in der polnischen<br />
Version dem Publikum präsentiert<br />
werden. Der Band ist im Verlag<br />
<strong>des</strong> polnischen Kooperationspartners,<br />
dem Nationalen Zentrum zur<br />
Erforschung und Dokumentation der<br />
Denkmäler (Krajowy Orodek Badañ i<br />
Dokumentacji Zabytków) in Warschau<br />
erschienen. Beide nahezu identisch<br />
gestalteten Bände wurden mit mehreren<br />
Buchvorstellungen in Warschau,<br />
Breslau, Görlitz, Dresden usw. beworben<br />
und einer breiteren Öffentlichkeit<br />
präsentiert.<br />
Die ansprechende Dokumentation der<br />
wichtigsten Bau- und Kunstdenkmäler<br />
Schlesiens bildet den Auftakt der neu<br />
begründeten Reihe zu den polnischen<br />
Kunstdenkmälern. Sie wird mit dem<br />
Band zur historischen Region Kleinpolen<br />
in Kooperation mit dem Kunsthistorischen<br />
Institut der Jagiellonen-<br />
Universität Krakau fortgesetzt.<br />
6<br />
Namen und Nachrichten<br />
Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
der deutschen Forschung<br />
haben sich Bund und Länder im Jahr<br />
2005 auf ein Programm geeinigt, das<br />
neben der Förderung von Spitzenuniversitäten<br />
auch einen „Pakt für Forschung<br />
und Innovation“ umfasst, mit<br />
dem die gemeinsam institutionell<br />
geförderten Forschungseinrichtungen<br />
gestärkt werden sollen. Innerhalb der<br />
Leibniz-Gemeinschaft ist dazu ein<br />
eigenes internes Wettbewerbsverfah-<br />
Vorstellung <strong>des</strong> polnischen Dehio-Ban<strong>des</strong> durch den Direktor <strong>des</strong> Nationalen Zentrums<br />
zur Erforschung und Dokumentation der Denkmäler Jacek Rulewicz (links)<br />
und den Leiter <strong>des</strong> Bildarchivs Dr. Dietmar Popp<br />
Zabytki sztuki w Polsce – ¦l±sk,<br />
red. S³awomir Brzezicki i Christine<br />
Nielsen, wspó³praca Grzegorz Grajewski<br />
i Dietmar Popp. Krajowy Orodek<br />
Badañ i Dokumentacji Zabytków<br />
Warszawa 2006<br />
ISBN 83-922906-1-5<br />
(ul. Szwole¿erów 9,<br />
PL – 00-464 Warszawa;<br />
www.kobidz.pl)<br />
ren eingerichtet worden: Bis 2010<br />
können sich in jedem Jahr alle WGL-<br />
Einrichtungen mit einem Projekt in<br />
einer der sechs vorgegebenen Förderlinien<br />
um einen Aufwuchs <strong>des</strong> institutionellen<br />
Budgets (für ein bis drei<br />
Jahre) bewerben. Für das <strong>Herder</strong>-<br />
Institut hat diesmal das Bildarchiv im<br />
Bereich „Vernetzung“ einen Antrag für<br />
ein Pilotprojekt zur Digitalisierung und<br />
Dokumentation von Bildmaterialien<br />
gestellt und ist damit erfolgreich ge-<br />
Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler<br />
in Polen. Schlesien – im Auftrag<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> Marburg und der<br />
Dehio-Vereinigung in Verbindung mit<br />
dem Krajowy Orodek Badañ i Dokumentacji<br />
Zabytków Warszawa herausgegeben<br />
von Ernst Badstübner, Dietmar<br />
Popp, Andrzej Tomaszewski, Dethard<br />
von Winterfeld, bearbeitet von<br />
S³awomir Brzezicki und Christine Nielsen<br />
unter Mitarbeit von Grzegorz Grajewski<br />
und Dietmar Popp. Deutscher<br />
Kunstverlag München-Berlin 2005<br />
ISBN 3-422-03109-X<br />
Bildarchiv im Wettbewerbsverfahren erfolgreich<br />
wesen. Damit ist es gelungen, beachtliche<br />
zusätzliche Mittel für die Jahre<br />
2007-2009 einzuwerben.<br />
Das Projekt umfasst die Erschließung<br />
eines der zentralen historischen Bildbestände<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong>, <strong>des</strong> sog. Niederschlesischen<br />
Bildarchivs (NBA),<br />
und ermöglicht einen beträchtlichen<br />
Ausbau der bestehenden Infrastruktur<br />
(Digitalisierungsgeräte, Bildserver,<br />
Weiterentwicklung <strong>des</strong> bestehenden<br />
��
Datenbanksystems). Ziel <strong>des</strong> ambitionierten<br />
Gesamtvorhabens, zu dem<br />
dieses Pilotprojekt den Auftakt bilden<br />
soll, ist es, ein Netzwerk aus deutschen<br />
und polnischen Einrichtungen<br />
zum internetgestützten Nachweis von<br />
Informationen und Materialien zu<br />
Kunstdenkmälern in Polen aufzubauen.<br />
Der in den nächsten drei Jahren<br />
zu bearbeitende Bestand <strong>des</strong> ehemaligen<br />
Provinzialkonservators von Niederschlesien<br />
besteht aus ca. 17.000<br />
<strong>Positive</strong>n und ca. 3.000 Architekturplänen<br />
im <strong>Herder</strong>-Institut, aus ca.<br />
9.000 Glasplattennegativen im Kunstinstitut<br />
der Polnischen Akademie der<br />
Wissenschaften in Warschau (Instytut<br />
Sztuki PAN) und aus 1.165 <strong>Positive</strong>n<br />
im Staatsarchiv in Breslau (Archiwum<br />
Pañstwowe we Wroc³awiu) sowie aus<br />
kleineren Beständen in anderen Einrichtungen.<br />
In enger internationaler<br />
Zusammenarbeit soll diese in Folge<br />
<strong>des</strong> Zweiten Weltkriegs versprengte<br />
einmalige Sammlung, die das gemeinsame<br />
Kulturerbe in Schlesien<br />
dokumentiert und mittlerweile selbst<br />
zum Kulturerbe zu zählen ist, wissenschaftlich<br />
erschlossen und virtuell<br />
wieder zusammengeführt werden. Im<br />
Bildkatalog <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> werden<br />
die für die kulturhistorische For-<br />
Materialien aus dem Niederschlesischen Bildarchiv<br />
<strong>Herder</strong>-Institut und Justus-Liebig-Universität<br />
schließen Kooperationsvertrag<br />
Am 26. bzw. 28. April unterzeichneten<br />
der Präsident der Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen, Professor Dr. Stefan<br />
Hormuth, der Direktor <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Instituts</strong>, Dr. Dr. h.c. Winfried Irgang,<br />
und sein Stellvertreter, Dr. Jürgen<br />
Warmbrunn, eine Kooperationsvereinbarung,<br />
durch die die Weichen für<br />
eine enge Zusammenarbeit zwischen<br />
den beiden Einrichtungen in der Zukunft<br />
gestellt worden sind.<br />
Die Vereinbarung ist das Ergebnis<br />
intensiver, konstruktiv geführter Verhandlungen<br />
über Möglichkeiten einer<br />
Vertiefung der Zusammenarbeit auf<br />
dem Gebiet der Ostmitteleuropaforschung.<br />
Ausgangspunkt war der Plan<br />
<strong>des</strong> Hessischen Ministeriums für Wissenschaft<br />
und Kunst, zur Sicherstellung<br />
der Existenz kleinerer geisteswissenschaftlicher<br />
Fächer an den Universitäten<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> regionalwissenschaftliche<br />
Zentren zu schaffen.<br />
Nachdem sich schon relativ bald die<br />
Tendenz herauskristallisierte, ein<br />
Zentrum für Osteuropaforschung an<br />
der Justus-Liebig-Universität anzusiedeln,<br />
kam es im Sommer 2005 zu ersten<br />
Gesprächen, in denen die gemeinsame<br />
Berufung <strong>des</strong> Direktors <strong>des</strong><br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> und die Möglichkeiten<br />
der Kooperation <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> mit dem<br />
neu zu gründenden Zentrum im Mittelpunkt<br />
standen. Die erzielte Vereinbarung<br />
stellt eine wichtige Etappe auf<br />
dem Weg zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
dar.<br />
Nach dem Wortlaut <strong>des</strong> Vertrages soll<br />
die Zusammenarbeit ihren Ausdruck<br />
insbesondere im wissenschaftlichen<br />
Erfahrungsaustausch, in der Wahrnehmung<br />
von Lehraufgaben und der<br />
Förderung <strong>des</strong> wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses, der Durchführung gemeinsamer<br />
Vorhaben, der wechselseitigen<br />
Nutzung von Einrichtungen,<br />
der Förderung internationaler Kontakte<br />
sowie in der dienstrechtlichen Stel-<br />
schung sowie für Projekte der Denkmalpflege<br />
außerordentlich wichtigen<br />
Bilddokumente weltweit für Recherchen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
��<br />
lung und Berufung <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong>direktors<br />
finden. Darüber hinaus wird die<br />
Universität Gießen einen ständigen<br />
Sitz im Kuratorium <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong><br />
erhalten. Die ersten Erfahrungen<br />
im vergangenen Halbjahr, vor allem<br />
das zügig durchgeführte gemeinsame<br />
Berufungsverfahren für den neuen<br />
Direktor <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>, der<br />
gleichzeitig als Professor an der Universität<br />
Gießen mit einem Lehrdeputat<br />
von zwei Semesterwochenstunden<br />
an der universitären Lehre mitwirken<br />
wird, und die Einbindung <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
in die konzeptionellen Planungen für<br />
das Gießener Zentrum Östliches<br />
Europa, lassen bereits jetzt eine positive<br />
Entwicklung der neuen Zusammenarbeit<br />
erwarten, mit der das vielfältige<br />
Netz nationaler wie internationaler<br />
Kooperationsbeziehungen <strong>des</strong><br />
<strong>Instituts</strong> eine wichtige Verstärkung<br />
und Erweiterung erfährt.<br />
��<br />
7
Kooperationsprojekt zur Dokumentation und<br />
Präsentation einer Graphik-Sammlung<br />
Beispiele aus der Graphiksammlung Haselbach: Stadtansicht Patschkau<br />
Eine der bedeutendsten Sammlungen<br />
von Graphik zu und aus Schlesien, seit<br />
den 1960er Jahren in zwei Teilbeständen<br />
in Regensburg (Kunstforum Ostdeutsche<br />
Galerie) und zunächst in<br />
Würzburg, heute in Görlitz (Schlesisches<br />
Museum) aufbewahrt, wird unter<br />
Federführung <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> in<br />
einem deutsch-polnischen Kooperationsprojekt<br />
dokumentiert und präsentiert.<br />
Die in den 1920er/30er Jahren<br />
zusammengetragene Sammlung <strong>des</strong><br />
Namslauer Brauereibesitzers Albrecht<br />
Haselbach umfaßt über 4.000 Blätter<br />
in verschiedenen druckgraphischen<br />
Techniken sowie Zeichnungen seit dem<br />
Ende <strong>des</strong> 15. bis zum Anfang <strong>des</strong><br />
20. Jahrhunderts, mit einem deutlichen<br />
Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert.<br />
In dem 2005 bewilligten und aufgenommenen<br />
Pilotprojekt unter dem Dach <strong>des</strong><br />
§96 BVFG (gefördert vom Beauftragten<br />
der Bun<strong>des</strong>regierung für Kultur und<br />
Medien, dem Hessischen Sozialministerium<br />
und dem Sächsischen Staatsministerium<br />
<strong>des</strong> Innern) werden die Bestände<br />
zunächst in einer gemeinsamen<br />
zweisprachigen Datenbank beschrieben,<br />
mit digitalen Abbildungen verknüpft<br />
und im Bildkatalog <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<br />
8<br />
<strong>Instituts</strong> online recherchierbar gemacht.<br />
Die Sammlung wird nicht nur<br />
virtuell ihren Weg in die Öffentlichkeit<br />
finden, sondern auch in Ausstellungen<br />
in den Museen zu Regensburg und<br />
Görlitz, dem Architekturmuseum in<br />
Breslau sowie in Marburg und Kattowitz<br />
(beginnend im April 2007) zu sehen<br />
sein; begleitet soll sie werden von<br />
einem umfangreich illustrierten zwei-<br />
sprachigen Band mit Aufsätzen zu Themen<br />
der Kulturgeschichte Schlesiens.<br />
Die Stärke der Sammlung liegt in ihrem<br />
Reichtum an Ansichten aus der Zeit<br />
der Romantik und <strong>des</strong> Biedermeiers<br />
vor allem aus dem zweiten Drittel <strong>des</strong><br />
19. Jahrhunderts. In dieser Epoche<br />
setzte in Schlesien eine bedeutende,<br />
auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche<br />
Graphikproduktion ein, die eng verbunden<br />
war mit der Entdeckung <strong>des</strong> Riesengebirges<br />
als einer Kunst- und Reiselandschaft.<br />
Von besonderem Interesse<br />
sind frühe Industriedarstellungen<br />
aus diesem Zeitraum, etwa von Hüttenwerken<br />
in Oberschlesien. Die wissenschaftliche<br />
Relevanz <strong>des</strong> Materials<br />
liegt in der Vielfalt der Fragestellungen<br />
und Wissensgebiete begründet, für die<br />
diese Blätter hervorragende Dokumente<br />
darstellen: allgemeine Geschichte,<br />
Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte<br />
sowie Volkskunde, Wirtschafts-<br />
und Sozialgeschichte, Kirchengeschichte,<br />
Topographie und Lan<strong>des</strong>kunde<br />
Schlesiens. Die Graphiken<br />
sind damit der wohl dichteste Bestand<br />
an Bildquellen zu Schlesien vor dem<br />
Zeitalter der Fotografie (und damit zum<br />
Beispiel eine besonders wichtige Ergänzung<br />
zu den historischen Fotografien<br />
im „Niederschlesischen Bildarchiv“<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>). ��<br />
Stadtansicht<br />
Liegnitz
Wertvolle Erwerbung der Dokumentesammlung:<br />
Übernahme der Archive der Baltischen Ritterschaften<br />
Die Dokumentesammlung <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong><br />
(DSHI) hat mit der Übernahme<br />
der Archive der baltischen Ritterschaften<br />
aus dem Hessischen<br />
Staatsarchiv Marburg in diesem Frühjahr<br />
eine bedeutsame Erweiterung<br />
erfahren. Die Materialien (ca. 120 lfd.<br />
Regalmeter) sind Eigentum <strong>des</strong> Verban<strong>des</strong><br />
der Baltischen Ritterschaften<br />
und bilden in der Dokumentesammlung<br />
eine eigene Bestandsgruppe mit<br />
der Signatur „DSHI 190 Balt. Ritterschaften“;<br />
dennoch sind sie integraler<br />
Bestandteil der DSHI-Bestände und<br />
fügen sich nahtlos in diese ein.<br />
Die Ritterschaften können im Baltikum<br />
auf eine über siebenhundertjährige<br />
Geschichte zurückblicken und existieren<br />
bis heute als Zusammenschluss<br />
deutschbaltischer Adelsfamilien. Zu<br />
ihnen gehören die Ritterschaften von<br />
Estland, Livland, Kurland und Ösel,<br />
also jener historischen Provinzen, die<br />
seit 1918 die Territorien der Republiken<br />
Estland und Lettland bilden. Bei<br />
den übernommenen Archiven handelt<br />
es sich um die Materialien der genannten<br />
vier Ritterschaften sowie um<br />
Akten <strong>des</strong> Zentralverban<strong>des</strong> der Ritterschaften<br />
seit Ende <strong>des</strong> Zweiten<br />
Weltkriegs. Die Bestände stammen<br />
aus der Zeit von der Mitte <strong>des</strong> 14. Jh.s<br />
bis zur Gegenwart. Sie umfassen<br />
Urkunden (die älteste von 1347),<br />
Amtsbücher, Handschriften, Nachlässe,<br />
Familienarchive und anderes.<br />
Die Entscheidung der Baltischen Ritterschaften,<br />
die Bestände der Dokumentesammlung<br />
zu übergeben, lag<br />
nahe, konzentriert sich die DSHI<br />
doch seit den 1990er Jahren konsequent<br />
auf die baltische Region. Durch<br />
die Übernahme der ritterschaftlichen<br />
Archive wurde der baltische Schwerpunkt<br />
der Dokumentesammlung gestärkt<br />
und deren bewusste Profilbildung<br />
bestätigt. Durch die Konzentration<br />
von Archivgut zur Geschichte der<br />
baltischen Region an einer Stelle ergeben<br />
sich zum Nutzen der Forschung<br />
zahlreiche Synergieeffekte.<br />
Pacta Subiectionis – Siegel <strong>des</strong> Kgs.<br />
von Polen Sigismund II. August 1561<br />
(DSHI 190 Kurland V, 4, 1).<br />
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung<br />
Die jetzt erfolgte Übernahme ist Teil<br />
einer langfristigen Erwerbungsstrategie<br />
der Dokumentesammlung. Die<br />
entsprechenden Aktivitäten ließen in<br />
den letzten Jahren ein dichtes Netzwerk<br />
von Verbindungen entstehen,<br />
das immer öfter zu weiteren wertvollen<br />
Erwerbungen baltischen Archivguts<br />
führt.<br />
Wackenbuch von Palms 1805,<br />
in estnischer Sprache<br />
(DSHI 190 Estland 252, Titel)<br />
Vierteljahreshefte mit je 160 Seiten, Bildbeilagen und Karten<br />
Abo-Preis € 70,--, Einzelhefte € 22,--<br />
Das neueste Heft 55/2 <strong>des</strong> zentralen Organs der internationalen historischen Ostmitteleuropa-Forschung enthält neben<br />
einem umfangreichen Besprechungsteil folgende Beiträge:<br />
Aufsätze: Zygmunt Szultka: Die friderizianische Kolonisation Preußisch-Pommerns (1740-1786)<br />
Tobias Privitelli: Die Sowjetunion im öffentlichen Diskurs Litauens 1939-1940<br />
Literaturberichte: Andreas R. Hofmann: Zwangsmigration im östlichen Mitteleuropa. Neue Forschungen zum<br />
„Jahrhundert der Vertreibungen“; Pavel Koláø: Langsamer Abschied vom Totalitarismus-Paradigma? Neue<br />
tschechische Forschungen zur Geschichte der KPTsch-Diktatur<br />
Verlag <strong>Herder</strong>-Institut<br />
Gisonenweg 5-7, D-35037 Marburg, Tel. 06421/184-0, Fax 06421/184 210, herder@herder-institut.de<br />
��<br />
9
Bibliographische Kooperation mit Budapest<br />
Besonderes Merkmal der von der<br />
Abteilung Literaturdokumentation erstellten<br />
laufenden Literaturdatenbank<br />
zur Geschichte <strong>des</strong> östlichen Mitteleuropa<br />
(http://www.litdok.de) ist, dass sie<br />
international arbeitsteilig erstellt wird.<br />
Neben der Marburger Arbeitsgruppe<br />
sind an der Kooperation Partnerinstitute<br />
in Krakau, Prag, Pressburg, Thorn,<br />
Breslau, Posen und Wilna beteiligt. Im<br />
Der Fotograf ist da!<br />
Ein ganz besonderer Bestand wurde<br />
in den vergangenen Jahren im Bildarchiv<br />
<strong>des</strong> Kunstinstituts der Polnischen<br />
Akademie der Wissenschaften in Warschau<br />
in vorbildlicher Weise erschlossen.<br />
Dort liegen seit dem Zweiten<br />
Weltkrieg 6.600 Fotografien <strong>des</strong> ehemaligen<br />
Provinzialdenkmalamtes in<br />
Königsberg, die zwischen 1890 und<br />
1943 entstanden sind und gemäß<br />
dem Zweck <strong>des</strong> Amtes der Dokumentation<br />
von Bau- und Kunstdenkmälern<br />
in Ostpreußen dienten. Für den aufmerksamen<br />
Bildbetrachter bietet sich<br />
dennoch auch anekdotischer Genuss:<br />
Vereinzelt sieht man auf den Fotos<br />
Menschen in einer malerischen Szene<br />
eingefangen, ganz zufällig ins Bild<br />
10<br />
Bemühen um einen weiteren Ausbau<br />
der Kooperationsbeziehungen konnten<br />
im Frühsommer 2006 feste Absprachen<br />
mit der Ungarischen Nationalbibliothek<br />
in Budapest (Széchenyi Országos<br />
Könyvtár) getroffen werden.<br />
Durch die Erfassung der Literatur zur<br />
Geschichte der Slowakei wies die<br />
Datenbank auch bisher schon eine<br />
erhebliche Zahl von Hungarica nach.<br />
gelaufen oder als gewählte Staffage,<br />
um auf diese Weise die Größenverhältnisse<br />
<strong>des</strong> abgelichteten Objekts<br />
zu verdeutlichen. Manchmal entschied<br />
sich der Fotograf selbst, auf<br />
der anderen Seite <strong>des</strong> Objektivs Platz<br />
zu nehmen. Ein Fotograf in jenen kleinen<br />
Städtchen Ostpreußens – das<br />
war oftmals eine Sensation. Davon<br />
zeugen Aufnahmen von Gassen, auf<br />
denen Menschen, die soeben noch<br />
ihren Beschäftigungen nachgingen,<br />
für das Foto „Pose einnehmen“. Am<br />
häufigsten aber kamen Menschen<br />
und „idyllische Szenen“ ganz zufällig<br />
ins Bild, ohne dass der auf sein Objekt<br />
(ein Bauwerk oder Ensemble) konzentrierte<br />
Fotograf dies bemerkte.<br />
Die Vereinbarung mit der Ungarischen<br />
Nationalbibliothek sieht nun vor, dass<br />
das <strong>Herder</strong>-Institut alle wissenschaftlichen<br />
Veröffentlichungen zur Geschichte<br />
Ungarns in seinen historischen<br />
Grenzen erfasst, die in Deutschland,<br />
Westeuropa und Nordamerika publiziert<br />
werden, während die Nationalbibliothek<br />
alle in Ungarn erscheinenden<br />
Publikationen dokumentiert. Das gesamte<br />
Titelmaterial wird in der Literaturdatenbank<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> und<br />
in einem online-Katalog der Nationalbibliothek<br />
publiziert; eine gesonderte<br />
gedruckte Publikation ist nicht vorgesehen.<br />
Die Kooperation setzt mit dem<br />
Berichtsjahr 2006 ein. ��<br />
Arbeitstreffen in Budapest<br />
Die meisten Aufnahmen entstanden<br />
zudem ohne künstlerische Ambitionen.<br />
Diese „Zufallstreffer“ wurden zu<br />
Protagonisten der Ausstellung, die bis<br />
zum 5. Mai im <strong>Herder</strong>-Institut zu<br />
sehen war: Durch Ausschnittsvergrößerungen<br />
rückten die vergessenen<br />
Bewohner <strong>des</strong> alten Ostpreußen in<br />
den Mittelpunkt.<br />
Zur Ausstellungseröffnung am 6. März<br />
gab der Kurator Jan Przypkowski,<br />
Warschau, nicht nur eine Einführung<br />
in die Ausstellung, sondern er schilderte<br />
auch die Geschichte der Denkmalpflege<br />
in Ostpreußen. Als ausgewiesener<br />
Fachmann dieses Themas<br />
erläuterte er zudem das wegweisen-
de, von ihm betreute Projekt zur Dokumentation<br />
und Digitalisierung <strong>des</strong><br />
lange Zeit vergessenen Bildarchivs<br />
<strong>des</strong> Königsberger Provinzialdenkmalamtes<br />
mit der entstandenen zweisprachigen<br />
Bilddatenbank auf CD-ROM<br />
(zu erwerben beim Instytut Sztuki<br />
PAN Warszawa: www.ispan.pl;<br />
ispan@ispan.pl). Bezugsquelle für<br />
den deutsch-polnischen Ausstellungskatalog<br />
ist das Deutsche Kulturforum<br />
östliches Europa in Potsdam<br />
(www.kulturforum.info). ��<br />
Ausstellung zu den Danziger Bürgerhäusern<br />
Bürgerhäuser der Hanse-Städte stellen<br />
ein ganz besonderes städtebauliches<br />
und identitätsstiften<strong>des</strong> Charakteristikum<br />
der südlichen und östlichen<br />
Ostseeregion dar. Zu den herausragenden<br />
Beispielen gehörten die<br />
Ensembles von Profanbauten in Danzig,<br />
die seit dem späten Mittelalter das<br />
Stadtbild prägten: Ihre stilgeschichtliche<br />
Entwicklung, ihre vielfältigen Gestaltungsformen<br />
im Äußeren wie im<br />
Inneren, der Funktionswandel ihrer<br />
Teile der Dissertation von Otto Rollenhagen<br />
Jan Przypkowski bei seinem Einführungsvortrag<br />
Bauteile und ihrer Räume – all dies<br />
zeigt die Ausstellung „Gdañskie<br />
Kamienice Mieszczañski“. Die Schau<br />
wurde vom Uphagenhaus als Abteilung<br />
<strong>des</strong> Historischen Museums der<br />
Stadt Danzig (Muzeum Historyczne<br />
Miasta Gdañska) mit Unterstützung<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> vorbereitet und<br />
am 3. Juni in Danzig eröffnet. Dort ist<br />
sie bis März 2007 zu sehen, danach<br />
wird sie in Marburg präsentiert werden.<br />
Die im Zweiten Weltkrieg großflächig<br />
zerstörten Danziger Gebäudekomplexe<br />
werden mit historischen Fotografien,<br />
Bauplänen, Rekonstruktionszeichnungen,<br />
dreidimensionalen Modellen<br />
sowie instruktiven Texttafeln<br />
vor Augen geführt. Innenraumansichten<br />
geben dem Besucher eine Vorstellung<br />
von den Funktionen der Räume<br />
ebenso wie von ihrer beeindruckenden<br />
Ausstattung. Im Zentrum der Ausstellung<br />
und in einem Kabinett gesondert<br />
präsentiert, stehen die Bildmaterialien<br />
der vor 1945 verfassten, bislang<br />
unpublizierten Dissertation von Otto<br />
Rollenhagen, die im Bildarchiv <strong>des</strong><br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> liegen. Diese Arbeit<br />
dokumentiert die Zeit vor den Purifizierungen<br />
der 1920er/30er Jahre und<br />
vor den Kriegszerstörungen in rund<br />
100 Fotos und 68 großformatigen<br />
Bauzeichnungen bzw. Plänen. Die<br />
zweisprachige Edition der Dissertation<br />
wird in Zusammenarbeit von <strong>Herder</strong>-Institut<br />
und den Mitarbeitern <strong>des</strong><br />
Uphagenhauses für das Frühjahr<br />
2007 vorbereitet.<br />
��<br />
11
Präsentation auf dem Parlamentarischen Abend der<br />
WGL in Berlin<br />
Der diesjährige Parlamentarische<br />
Abend der Leibniz-Gemeinschaft<br />
stand unter dem Motto „Wasser – ein<br />
Meer von Forschungsthemen“. 27<br />
Leibniz-Institute präsentierten am 30.<br />
12<br />
Mai im Hotel Hilton am Gendarmenmarkt<br />
ihre vielfältigen Forschungsarbeiten<br />
vor etwa 200 Gästen aus Politik,<br />
Verwaltung und Wissenschaft.<br />
Nach einem Grußwort <strong>des</strong> Präsiden-<br />
Dr. Michael Roik (BKM) im Gespräch mit Dr. Jürgen Warmbrunn und Dipl.Ing.<br />
Wolfgang Kreft<br />
Archivtag<br />
Am 7. Mai 2006 fand der bun<strong>des</strong>weite<br />
„Tag der Archive“ statt, an dem sich<br />
auch die DSHI – Dokumentesammlung<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> – beteiligte. In Marburg<br />
hatten sich 18 Archive und archivische<br />
Sammlungen im Gebäude <strong>des</strong><br />
Hessischen Staatsarchivs zusammengefunden.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Gemeinschaftsprojekts<br />
„Marburg – Stadt der<br />
Archive“ präsentierten sich die einzelnen<br />
Einrichtungen mit ihren Beständen,<br />
Aufgaben und Arbeiten. Dorothee<br />
Goeze und Dr. Peter Wörster informierten<br />
insbesondere über das auf die baltische<br />
Region bezogene Sammlungsprofil<br />
der DSHI. Rechtzeitig zum „Tag<br />
der Archive“ erschien ein Postkartenset<br />
„Ausgewähltes – Motive aus den<br />
Beständen der Dokumentesammlung<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> Marburg“ mit 12<br />
verschiedenen Postkarten. ��<br />
ten der Leibniz-Gemeinschaft, Prof.<br />
Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel, führte<br />
der Wissenschaftliche Vizepräsident,<br />
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Bernhard Müller,<br />
in die große Bandbreite <strong>des</strong> Themenspektrums<br />
aus Natur- und Umweltwissenschaften,<br />
Wirtschafts- und Raumwissenschaften<br />
sowie Geisteswissenschaften<br />
mit Bezug zum Wasser ein,<br />
die sich in den Präsentationen der<br />
beteiligten Institute widerspiegelte.<br />
Das <strong>Herder</strong>-Institut präsentierte sich<br />
mit einem Posterbeitrag zum Thema<br />
„Wasserstraße oder Auenlandschaft?<br />
Die Wiederentdeckung der Oder als<br />
mitteleuropäische Kulturregion“, das<br />
nicht zuletzt mit dem Beitritt Polens<br />
und Tschechiens zur Europäischen<br />
Union 2004 wieder Eingang in die wissenschaftliche<br />
Diskussion gefunden<br />
hat. Zugleich konnte das <strong>Herder</strong>-Institut<br />
mit dem Poster auf die Forschungsrelevanz<br />
seiner zum Teil einzigartigen<br />
visuellen Quellen aus Bildarchiv<br />
und Kartensammlung aufmerksam<br />
machen.<br />
��
Kulturausschuss <strong>des</strong> Hessischen Lan<strong>des</strong>beirates für<br />
Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen<br />
Am 22. März tagte der Kulturausschuss<br />
<strong>des</strong> Hessischen Lan<strong>des</strong>beirates für<br />
Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen<br />
unter dem Vorsitz von<br />
Dr. Herfried Stingl (5.v.l.) in den Räumen<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> und ließ sich<br />
eingehend über die Arbeit <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
informieren. Begleitet wurden die Beiratsmitglieder<br />
vom Lan<strong>des</strong>beauftragten<br />
der Hessischen Lan<strong>des</strong>regierung<br />
für Heimatvertriebene und Spätaussiedler<br />
Rudolf Friedrich (5.v.r.), langjährigem<br />
Mitglied <strong>des</strong> Hessischen<br />
Landtags, und von Dirk Hummel vom<br />
Hessischen Sozialministerium (2.v.l.).<br />
Der Beirat zeigte sich sehr beeindruckt<br />
von der Vielzahl der Aufgaben und<br />
Arbeiten sowie der Reichhaltigkeit der<br />
Sammlungen <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> und regte<br />
die Abhaltung einer regulären Sitzung<br />
Neue Forschungen<br />
zur Schlesischen<br />
Geschichte<br />
Herausgegeben von<br />
Joachim Bahlcke und<br />
Norbert Conrads<br />
Eine Auswahl.<br />
Bd. 7: Carsten Rabe:<br />
Alma Mater Leopoldina.<br />
Kolleg und Universität der<br />
Jesuiten in Breslau<br />
1638–1811.<br />
1999. XII, 605 S. 8 s/w-Abb. auf<br />
8 Taf. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-00599-1<br />
ISBN 978-3-412-00599-1<br />
Bd. 8: Jörg Deventer:<br />
Gegenreformation<br />
in Schlesien.<br />
Die habsburgische Rekatholisierungspolitik<br />
in Glogau und<br />
Schweidnitz (1526–1707).<br />
2003. X, 433 S. 8 s/w-Abb. auf<br />
8 Taf. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-06702-4<br />
ISBN 978-3-412-06702-4<br />
<strong>des</strong> Unterausschusses <strong>des</strong> Hessischen<br />
Landtags für Heimatvertriebene,<br />
Bd. 9: Quellenbuch zur<br />
Geschichte der Universität<br />
Breslau 1702 bis 1811.<br />
Hg. v. Norbert Conrads unter<br />
Mitarb. v. Markus Müller und<br />
Carsten Rabe.<br />
2004. XXIII, 507 S. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-09802-7<br />
ISBN 978-3-412-09802-7<br />
Bd. 10: Claudia A. Zonta:<br />
Schlesische Studenten<br />
an italienischen Universitäten.<br />
Eine prosopographische<br />
Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte.<br />
2004. X, 539 S. 1 Frontispiz u.<br />
6 s/w-Abb. im Text. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-12404-4<br />
ISBN 978-3-412-12404-4<br />
Bd. 11: Historische<br />
Schlesienforschung.<br />
Themen, Methoden und<br />
Perspektiven zwischen traditionellerLan<strong>des</strong>geschichtsschreibung<br />
und moderner Kulturwissenschaft.<br />
Hg. v. Joachim Bahlcke.<br />
2005. XX, 740 S. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-20105-7<br />
ISBN 978-3-412-20105-7<br />
Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung<br />
im <strong>Herder</strong>-Institut an. ��<br />
Bd. 12: Aufbrüche in die<br />
Moderne. Frühparlamentarismus<br />
zwischen altständischer<br />
Ordnung und monarchischem<br />
Konstitutionalismus<br />
(1750–1850). Schlesien –<br />
Deutschland – Mitteleuropa.<br />
Hg. v. Roland Gehrke.<br />
2005. VIII, 344 S. 4 s/w-Abb. Gb.<br />
ISBN-10 3-412-20405-6<br />
ISBN 978-3-412-20405-6<br />
Bd. 13: Willy Cohn:<br />
Kein Recht, nirgends.<br />
Tagebuch vom Untergang <strong>des</strong><br />
Breslauer Judentums<br />
1933–1941.<br />
Hg. von Norbert Conrads.<br />
2006. 2 Bde. Bd. 1: XXX, 1-525 S.<br />
Bd. 2: V, 527-1121 S. 17 s/w-Abb.<br />
auf 16 Taf. 2 Karten auf Vorsatz. Gb.<br />
mit SU. ISBN-10 3-412-32905-3<br />
ISBN 978-3-412-32905-3<br />
Bd. 14: Horst Weigelt:<br />
Von Schlesien nach<br />
Amerika. Die Geschichte <strong>des</strong><br />
Schwenckfeldertums.<br />
2006. Ca. 288 S. Ca. 30 s/w-Abb.<br />
Gb.<br />
ISBN-10 3-412-07106-4<br />
ISBN 978-3-412-07106-6<br />
Böhlau Verlag GmbH & Cie Köln Weimar Wien Telefon (0 22 1) 91 39 00 Fax (0 22 1) 91 39 011 www.boehlau.de<br />
Böhlau<br />
Köln Weimar Wien<br />
13
Vorträge von Mitarbeitern<br />
S³awomir Brzezicki gab eine Einführung<br />
zum „Dehio-Handbuch der<br />
Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien“<br />
bzw. zur polnischsprachigen Version<br />
bei den Präsentationen im Schlesischen<br />
Museum zu Görlitz, 29. März,<br />
und im Kraszewski-Museum in Dresden,<br />
30. März, sowie im Muzeum<br />
Architektury we Wroc³awiu, 20. April.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Seminars „Displaced<br />
Persons. Flüchtlinge aus den baltischen<br />
Staaten in Deutschland“, das<br />
von der Academia Baltica gemeinsam<br />
mit der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte<br />
Malente und dem Honorarkonsulat<br />
der Republik Lettland in Schleswig-Holstein<br />
vom 24. bis 26. März<br />
2006 in Malente durchgeführt wurde,<br />
hielt Dorothee Goeze einen Vortrag<br />
mit dem Titel: Alltag estnischer DPs in<br />
Deutschland. Die Sammlung Hintzer<br />
im <strong>Herder</strong>-Institut Marburg.<br />
Dr. Norbert Kersken sprach am 22.<br />
März 2006 auf Einladung von Frau<br />
Prof. Dr. Marta Font an der Universität<br />
Pécs über Historiography and Mirrors<br />
of Princes. Aspects of the the social<br />
functions of medieval chronicles; auf<br />
der internationalen Nachwuchstagung<br />
<strong>des</strong> Nordostinstituts Lüneburg, <strong>des</strong><br />
<strong>Instituts</strong> für Litauische Geschichte Vilnius<br />
und <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> zum<br />
Thema „Nordosteuropa in Geschichte<br />
und Geschichtsschreibung“ in Vilnius<br />
referierte er am 4. Mai über Kirchen,<br />
Orden, Städte, Land. Gemeinschaftsbildung<br />
im mittelalterlichen Livland;im<br />
Rahmen der vom Forschungszentrum<br />
Europäische Aufklärung Potsdam<br />
veranstalteten internationalen Konferenz<br />
„Historiographie an europäischen<br />
Höfen (17.-18. Jh.)“ in Potsdam<br />
hielt er am 9. Juni 2006 einen Vortrag<br />
zum Thema Hofhistoriographen im<br />
östlichen Mitteleuropa: Personen,<br />
Höfe, Traditionen.<br />
Dr. Heidi Hein-Kircher hielt am<br />
9. Februar im Rahmen <strong>des</strong> Kolloquiums<br />
<strong>des</strong> Lehrstuhls für Osteuropäische<br />
Geschichte in Erfurt einen Vortrag<br />
über ihr Forschungsprojekt: Kommunale<br />
Verwaltung und nationale<br />
14<br />
Bewegung in einer Vielvölkerstadt.<br />
Lemberg im 19. Jahrhundert. Im<br />
Rahmen der Tagung „.hist2006 –<br />
Geschichte im Internet“ stellte sie am<br />
24. Februar das Projekt der Dokumente<br />
und Materialien zur ostmitteleuropäischen<br />
Geschichte im Internet<br />
vor. Bei der Jahrestagung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Osteuropakunde<br />
in Marburg thematisierte sie am 3.<br />
März die Erinnerungspolitik der frühen<br />
Dritten Polnischen Republik: Von der<br />
Volksrepublik zur Dritten Republik –<br />
Überlegungen zur Schaffung von Traditionen<br />
und Kontinuitäten in Polen<br />
nach 1989. Am 6. März wurde sie zu<br />
einem Vortrag über die Rytua³y<br />
zwi±zany z kultem Józefa Pi³sudskiego<br />
jako rodek tworzenia wiadomoci<br />
narodowej w II Rzeczypospolitej<br />
von der Towarzystwo Historyczny<br />
w Toruniu und dem Historischen und<br />
Archivwissenschaftlichen Institut der<br />
Nikolaus-Kopernikus-Universität nach<br />
Toruñ eingeladen; einen Tag später<br />
sprach sie über die Vorstellungen von<br />
Lemberg als Bollwerk gen Osten in<br />
einem Vortrag am Historischen Institut<br />
der Adam-Mickiewicz-Universität Poznañ.<br />
Am 8. März referierte sie am DHI<br />
in Warschau über ihr Forschungsprojekt<br />
zur kommunalen Verwaltung<br />
Lembergs im 19. Jahrhundert und<br />
über die Dokumente und Materialien<br />
zur ostmitteleuropäischen Geschichte.<br />
Im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung<br />
„Wileñska architektura sakralna<br />
doby baroku: dewastacja i restauracja.<br />
Kêstutis Sto¹kus – Fotografie,<br />
Muzeum Okrêgowe w Toruniu“,<br />
10. März, gab Dr. Dietmar Popp eine<br />
Einführung in das Ausstellungs- und<br />
Katalogprojekt zum Wilnaer Barock.<br />
Über das Projekt zum „Dehio-Handbuch<br />
der Kunstdenkmäler in Polen.<br />
Schlesien“ referierte er bei den Buchpräsentationen<br />
im Schlesischen Museum<br />
zu Görlitz, 29. März, und im<br />
Kraszewski-Museum in Dresden, 30.<br />
März, sowie zur Präsentation der polnischen<br />
Version gemeinsam mit dem<br />
Kooperationspartner Krajowy Orodek<br />
Badañ i Dokumentacji Zabytków<br />
am Sitz der Stowarzyszenie Historyków<br />
Sztuki w Warszawie, 13. März.<br />
Am 31. Juni sprach Wiebke Rohrer in<br />
einem Abendvortrag der Professur für<br />
Ur- und Frühgeschichte der Universität<br />
Leipzig über Archäologie und<br />
Propaganda. Ur- und Frühgeschichtliche<br />
Archäologie in Oberschlesien<br />
1918-1933.<br />
Dr. Jürgen Warmbrunn referierte am<br />
5. April auf der Jahrestagung <strong>des</strong><br />
„Council for Slavonic and East European<br />
Library and Information Services“<br />
in Henley on Thames zum<br />
Thema Present-day challenges for<br />
German Slavonic libraries – a case<br />
study from the <strong>Herder</strong>-Institute, Marburg.<br />
Am 17. Mai hielt er im Rahmen<br />
der 35. Wissenschaftlichen Arbeitsund<br />
Fortbildungstagung der ABDOS<br />
in Bautzen einen Vortrag mit dem Titel<br />
Auf dem Weg zum virtuellen Dienstleister:<br />
neue Dienstleistungen <strong>des</strong><br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>.<br />
Dr. Peter Wörster sprach beim Genealogentag<br />
der Deutschbaltischen<br />
Genealogischen Gesellschaft am<br />
18. März in Darmstadt über Das<br />
Lyceum in Riga und seine Matrikel<br />
und berichtete auf der Mitgliederversammlung<br />
der Baltischen Historischen<br />
Kommission in Göttingen am<br />
9. Juni über Die Übernahme der<br />
Archive der Baltischen Ritterschaften<br />
und ihre Bedeutung für die Dokumentesammlung<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>.
Terminvorschau<br />
Internationale Sommerakademie:<br />
Adel und Moderne in Mittel- und<br />
Osteuropa. Perspektiven historischer<br />
Adelsforschung. Marburg,<br />
10.-19. September 2006. Leitung:<br />
Dr. Heidi Hein-Kircher (Marburg) und<br />
Prof. Dr. Eckart Conze (Marburg).<br />
Ein trügerischer Ausgleich: Die<br />
deutsch-polnischen Beziehungen<br />
1933-1939. Dt.-poln. Workshop, veranstaltet<br />
vom <strong>Herder</strong>-Institut und der<br />
Universität Bonn, Marburg, 25.-28. September<br />
2006.<br />
Erinnerungskultur und ‚Versöhnungskitsch‘.<br />
Internationale Tagung<br />
<strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> Marburg, <strong>des</strong><br />
Germanistischen <strong>Instituts</strong> der Adam-<br />
Mickiewicz-Universität Poznañ und<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für Geschichte der<br />
Universität Oldenburg, Poznañ,<br />
25.-28. September 2006.<br />
Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen<br />
in Deutschland<br />
und Polen II: ab 1939. 13. Tagung<br />
<strong>des</strong> Arbeitskreises deutscher und<br />
polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger,<br />
veranstaltet vom Deutschen<br />
Polen-Institut Darmstadt und<br />
dem <strong>Herder</strong>-Institut Marburg, Darmstadt,<br />
27. September – 1. Oktober 2006.<br />
Nationale Freiheitskonzepte und Beziehungsgeschichte<br />
in Mittel- und<br />
Osteuropa. Kolloquium zu Ehren <strong>des</strong><br />
75. Geburtstages von Prof. Zernack,<br />
veranstaltet vom <strong>Herder</strong>-Institut, dem<br />
Nordost-Institut Lüneburg, dem Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrum Geschichte<br />
und Kultur Ostmitteleuropas<br />
Leipzig, der Universität Halle, der Historischen<br />
Kommission für Polen und dem<br />
Historischen Institut der Polnischen<br />
Akademie der Wissenschaften Warschau,<br />
Gießen, 6.-8. Oktober 2006.<br />
Stipendien <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong><br />
Tagung der ‚Homburger Gespräche‘<br />
der Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung<br />
in Kooperation mit dem <strong>Herder</strong>-Institut<br />
zum Thema Kurland, Bad Homburg<br />
und Marburg, 18.-22. Oktober 2006.<br />
Baltische Graphik aus der Sammlung<br />
Erich Böckler. Ausstellung im<br />
Rahmen der ‚Homburger Gespräche‘<br />
der Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung<br />
in Kooperation mit dem <strong>Herder</strong>-Institut,<br />
Marburg, Ausstellungseröffnung:<br />
20. Oktober 2006 (die Ausstellung ist<br />
bis 22.12.2006 im <strong>Herder</strong>-Institut zu<br />
sehen).<br />
Zur Förderung der historischen Ostmitteleuropa-Forschung vergibt das <strong>Herder</strong>-Institut an<br />
Wissenschaftler/-innen insbesondere aus ostmitteleuropäischen Ländern Stipendien bis zu<br />
einer Dauer von drei Monaten, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, für wissenschaftliche<br />
Vorhaben die Bestände in den Sammlungen <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> zu benutzen und Kontakte zu<br />
Fachkolleginnen und -kollegen in Deutschland zu knüpfen.<br />
Förderungsberechtigt sind promovierte Wissenschaftler/innen, Graduierte und Doktoranden/Doktorandinnen,<br />
im Ausnahmefall auch fortgeschrittene Studierende, die mit einer auf<br />
Ostmitteleuropa bezogenen historischen Fragestellung befasst sind und bereits wissenschaftliche<br />
Leistungen erbracht haben. Die Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse<br />
der deutschen oder englischen Sprache verfügen.<br />
Über die Ausstattung der Stipendien, Bewerbungsvoraussetzungen und Antragsmodalitäten<br />
informiert ein Merkblatt <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>, das gemeinsam mit dem Antragsformular auch<br />
über die www-Adresse <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> verfügbar ist. Anträge auf Gewährung eines Stipendiums<br />
für das 1. Halbjahr 2007 können bis zum 30. September 2006 gestellt werden.<br />
Sie sind zu richten an den Vorstand <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong> e.V., Gisonenweg 5-7,<br />
D-35037 Marburg.<br />
15
2. Halbjahr 2006<br />
Dr. Muntis Auns, Riga („Besiedlung<br />
Kurlands im 18. Jahrhundert“).<br />
Romas Baronas, Wilna/Vilnius („Die<br />
ersten sieben Pfarrkirchen: Zur Topik<br />
der Darstellung <strong>des</strong> Jan D³ugosz von<br />
der Bekehrung Litauens im Jahr 1387“).<br />
Dr. Ella Chmielewska, Edinburgh<br />
(Buchprojekt „,Urban Logos‘“ – Reading<br />
the Iconosphere of Warsaw“).<br />
Marta Chociej, Breslau/Wroc³aw<br />
(„Alexander Freiherr von Minutoli“).<br />
Katarzyna Grysiñska, Bromberg/<br />
Bydgoszcz („Bogdan Graf von Hutten-<br />
Czapski (1851-1937). Soldat, Politiker<br />
und Diplomat“).<br />
Dr. Agnieszka Gut, Stettin/Szczecin<br />
(„Das Urkundenwesen der polnischen<br />
Herzöge im 13. Jahrhundert“).<br />
Dr. Krzysztof A. Janicki, Danzig/<br />
Gdañsk („Deutsch-Balten und Polen<br />
im 20. Jh. (bis zum Ersten Weltkrieg).<br />
Wechselwirkungen – Kontakte – Stereotypen“).<br />
Dr. Tomasz Kamusella, Oppeln/<br />
Opole („The Politics of Language and<br />
16<br />
Zu Gast im <strong>Herder</strong>-Institut<br />
Osteuropa aktuell im BWV<br />
Manfred Sapper,<br />
Volker Weichsel,<br />
Andrea Huterer (Hrsg.)<br />
Mythos Europa<br />
Prostitution, Migration,<br />
Frauenhandel<br />
Am Anfang war der Mythos von<br />
Sex, Entführung und Gewalt: Zeus,<br />
in einen Stier verwandelt, raubt<br />
die phönizische Königstochter Europa.<br />
Seit dem Fall <strong>des</strong> Eisernen<br />
Vorhangs hat dieser Mythos eine<br />
beklemmende Aktualität gewonnen. Der transnationale<br />
west-östliche Prostitutionsmarkt entlang der innereuropäischen<br />
Wohlstandsgrenze findet im Grau bereich von Tabuisierung,<br />
Schattenwirtschaft und Kriminalität statt. Aufgabe<br />
einer wissenschaftlichen Zeitschrift wie Osteuropa ist es,<br />
Fakten und nüchterne Analysen gegen Weltbilder zu setzen,<br />
die Prostitution einerseits als moderne Sklaverei oder<br />
andererseits lediglich als Form der Arbeitsmigration interpretieren.<br />
2006, 336 S., kart., 16 Abb., 15,– Euro, ISBN 3-8305-1123-X<br />
OSTEUROPA 6/2006<br />
Nationalisms in Central Europe during<br />
the 19th and 20th Centuries“).<br />
Dr. Olga Keller, Minsk („Die Beeinflussung<br />
osteuropäischer Rechtsordnungen<br />
durch das deutsche Recht“).<br />
Prof. Dr. Mati Laur, Dorpat/Tartu<br />
(„Die Statthalterschaftszeit (1783-1796)<br />
in Liv- und Estland“).<br />
Dr. Anna Mañko-Matysiak, Breslau/Wroc³aw<br />
(„Auf den Spuren schlesischer<br />
Kulturdenkmäler. Quellenbuch<br />
zur Kulturgeschichte einer ostmitteleuropäischen<br />
Region von den Anfängen<br />
bis 1740“).<br />
Dr. Jaroslav Miller, Olmütz/Olomouc<br />
(„Zwischen Mittelalter und Neuzeit:<br />
Die Stadtgesellschaft in Ostmitteleuropa,<br />
1500-1700“).<br />
Jan Przypkowski, Instytut Sztuki Polskiej<br />
Akademii Nauk Warschau/Warszawa<br />
(„Die Geschichte der Denkmalpflege<br />
in Ostpreußen“).<br />
Algo Rämmer, Dorpat/Tartu („Estnisch-lettische<br />
Zusammenarbeit in<br />
den 1920er und 1930er Jahren aus<br />
der Sicht der Universität Tartu“).<br />
Anna Sobecka, Thorn/Toruñ („Die<br />
Kultur <strong>des</strong> Gegenstan<strong>des</strong>. Das Stillle-<br />
ben und der Kunstgeschmack im frühneuzeitlichen<br />
Danzig“).<br />
Anna Barbara Ziemlewska, Thorn/<br />
Toruñ („Riga in Polen – Litauen (1581-<br />
1621)“).<br />
Impressum<br />
„<strong>Herder</strong> aktuell“ erscheint halbjährlich und<br />
wird herausgegeben vom<br />
HERDER-INSTITUT e.V.<br />
35037 Marburg, Gisonenweg 5-7,<br />
Tel. 06421/184-0<br />
Fax 06421/184-139<br />
herder@herder-institut.de<br />
www.herder-institut.de<br />
Direktor: Dr. Dr. h.c. Winfried Irgang<br />
(V.i.S.d.P.)<br />
Layout und Satz: Jeanette Lang, Käthe<br />
Theiß, Susanne Grotzer<br />
Verlag <strong>Herder</strong>-Institut<br />
Umschlagentwurf/Fotos: Wolfgang<br />
Schekanski<br />
Druck: Werbedruck Schreckhase,<br />
Spangenberg<br />
Alle Bilddokumente befinden sich in den<br />
Sammlungen <strong>des</strong> <strong>Herder</strong>-<strong>Instituts</strong>.<br />
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet,<br />
Beleg erbeten.<br />
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:<br />
30. Juni 2006<br />
Jutta Günther, Dagmara Jajes´niak-Quast (Hrsg.)<br />
Willkommene Investoren oder nationaler Ausverkauf?<br />
Ausländische Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert<br />
2006, 380 S., kart., 55,– Euro, ISBN 3-8305-1186-8<br />
Dagmara Jajes´niak-Quast,Torsten Lorenz, Uwe Müller, Katarzyna Stoklosa (Hrsg.)<br />
Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa<br />
Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag<br />
2006, 210 S., kart., 29,– Euro, ISBN 3-8305-1209-0<br />
Torsten Lorenz (ed.)<br />
Cooperatives in Ethnic Conflicts:<br />
Eastern Europe in the 19 th and early 20 th Century<br />
2006, 384 S., geb., engl., 58,– Euro, ISBN 3-8305-1204-X<br />
Mark Boguslawskij, Alexander Trunk (Hrsg.)<br />
Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten<br />
Legal Issues of Foreign Investment in Transition Countries<br />
Festgabe für Prof. Dr. Wolfgang Seiffert zum 80. Geburtstag<br />
2006, 543 S., kart., dt./engl./russ., 98,– Euro, ISBN 3-8305-1199-X<br />
Helga Schultz, Eduard Kubu˚ (eds)<br />
History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe<br />
2006, 327 S., geb., 51,– Euro, ISBN 3-8305-1174-4<br />
BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG<br />
Axel-Springer-Str. 54 b • 10117 Berlin • Tel. 030 / 841770-0 • Fax 030 / 841770-21<br />
E-mail: bwv@bwv-verlag.de • Internet: http://www.bwv-verlag.de