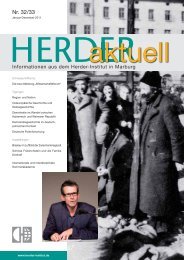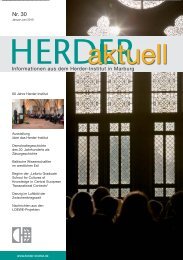Ausgabe - Herder-Institut
Ausgabe - Herder-Institut
Ausgabe - Herder-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 34<br />
Januar-Juni 2012<br />
HERDER aktuell<br />
Informationen aus dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in Marburg<br />
Schwerpunktthema:<br />
Evaluierung<br />
Lesungen am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Kartografie-Workshop<br />
Alltagsleben unter deutscher Besatzung<br />
Generation und Gewalt<br />
www.herder-institut.de<br />
1
Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
Editorial<br />
Die turnusmäßig alle sieben Jahre<br />
stattfindende Evaluierung des „<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
für historische Ostmitteleuropaforschung<br />
– <strong>Institut</strong> der<br />
Leibniz-Gemeinschaft“ (unser neuer<br />
offizieller Name) fand am 19. und<br />
20. Januar statt. Die ersten Rückmeldungen,<br />
nach denen die Evaluierung<br />
durchaus erfolgreich verlief, haben die<br />
fast einjährige Vorbereitung und die<br />
Anspannung in den Wochen zuvor<br />
rasch vergessen lassen. Auf die detaillierten<br />
Ergebnisse, die im November<br />
2012 offiziell veröffentlicht werden,<br />
können wir dennoch gespannt<br />
sein, werden sie doch den Kurs des<br />
<strong>Institut</strong>s in den kommenden sieben<br />
Jahren wesentlich bestimmen.<br />
Neben den bereits laufenden Drittmittelprojekten<br />
konnte im ersten<br />
Halbjahr ein ganz besonderes Editionsprojekt<br />
anlaufen, das für die neue<br />
Internationalisierungsstrategie des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s steht. Zum Thema<br />
deutscher Besatzung in Europa im<br />
Zweiten Weltkrieg arbeitet seitdem<br />
ein Netzwerk von 17 europäischen<br />
Partnerinstitutionen, von Norwegen<br />
bis Griechenland und von Estland<br />
bis Italien. Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung<br />
wurde das Projekt am<br />
31. Mai im Dokumentationszentrum<br />
„Topographie des Terrors“ in Berlin<br />
bereits der Fachöffentlichkeit vorgestellt.<br />
Zu den Herausgebern der<br />
Gesamtedition zählen neben den<br />
beiden Projektleitern (Prof. Peter<br />
Haslinger / Prof. Tatjana Tönsmeyer)<br />
die Zeithistoriker Prof. Włodzimierz<br />
Borodziej und Dr. Stefan Martens<br />
vom Deutschen Historischen <strong>Institut</strong><br />
in Paris, das als Projektpartner<br />
für Frankreich fungiert.<br />
Neue Wege beschritt das <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> im vergangenen halben Jahr<br />
aber auch in Hinblick auf die Präsenz<br />
im Raum Marburg und die Nutzung<br />
sozialer Netzwerke für die Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Neben den publikumswirksamen<br />
Ausstellungen konnte mit<br />
den Lesungen erfolgreich ein neues<br />
Veranstaltungsformat am <strong>Institut</strong> eingeführt<br />
werden, das eine ungeahnte<br />
Breitenwirkung erzielte. Durchaus<br />
2<br />
hilfreich war hier der neue facebook-<br />
Auftritt des <strong>Institut</strong>s. Über diesen<br />
sollen zukünftig auch die übrigen<br />
Veranstaltungen beworben werden,<br />
etwa die wieder aktivierten Werkstattgespräche,<br />
die nun unter dem<br />
neuen Titel <strong>Herder</strong>-Kolloqium auch<br />
der Präsentation der Qualifikationsarbeiten<br />
dienen, die am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
entstehen.<br />
Wir hoffen schließlich, dass auch<br />
die neue Strategie der Nachwuchsförderung<br />
bei der Evaluierung Anerkennung<br />
gefunden hat. Und wir hoffen,<br />
dass wir den Weg, den das <strong>Institut</strong> in<br />
den letzten Jahren gegangen ist, um<br />
das <strong>Institut</strong> bestmöglich im nationalen<br />
wie internationalen Forschungs-<br />
und Infrastrukturumfeld zu positionieren,<br />
durch das Ergebnis unterstützt<br />
fortsetzen werden können. Allen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern, die<br />
durch ihre Teamleistung und einen<br />
unermüdlichen Arbeitseinsatz ganz<br />
maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen<br />
haben, sei an dieser Stelle<br />
noch einmal ganz herzlich gedankt.<br />
Inhalt Seite<br />
Ein Jahr Vorbereitung, zwei<br />
Tage höchste Konzentration 3<br />
Tagungen, Ausstellungen<br />
und Lesungen 5<br />
Ereignisse und<br />
Informationen 12<br />
Nachrichten aus den<br />
LOEWE-Projekten 19<br />
Personalien 21<br />
Gäste am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> 23<br />
Lehrveranstaltungen<br />
WS 2011/12, SS 2012 24<br />
Vorträge, Workshops und<br />
Tagungen 24<br />
Neue Veröffentlichungen 29<br />
Terminvorschau 31<br />
Titelbild:<br />
Gutachterin Marie-Janine<br />
Calic im Gespräch mit<br />
Alexandra Schweiger<br />
Impressum<br />
„<strong>Herder</strong> aktuell“ erscheint halbjährlich<br />
und wird herausgegeben vom<br />
HERDER-INSTITUT für historische Ostmitteleuropaforschung<br />
–<br />
<strong>Institut</strong> der Leibniz-Gemeinschaft<br />
35037 Marburg, Gisonenweg 5-7<br />
Tel. +49-6421-184-0<br />
Fax +49-6421-184-139<br />
mail@herder-institut.de<br />
www.herder-institut.de<br />
Abonnementsverwaltung:<br />
Simone Cerwenka, +49-6421-184-101<br />
Direktor: Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
(V.i.S.d.P.)<br />
Redaktion: Dr. Anna Veronika Wendland<br />
Layout/Satz: Wolfgang Schekanski<br />
Verlag <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Fotos: Wolfgang Schekanski,<br />
Claudia Junghänel u. a.<br />
Druck: Jürgen Haas Print Consulting,<br />
Gladenbach<br />
Alle Bilddokumente befinden sich in den<br />
Sammlungen des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s.<br />
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet,<br />
Beleg erbeten.<br />
Auflage: 2850 Stück<br />
Redaktionsschluss dieser <strong>Ausgabe</strong>:<br />
29. Juni 2012
Ein Jahr Vorbereitung, zwei Tage höchste<br />
Konzentration<br />
Am 19. und 20. Januar 2012 wurde das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> durch die<br />
Leibniz-Gemeinschaft evaluiert<br />
Das neue Jahr begann für die Belegschaft<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s spannend,<br />
stand doch am 19. und 20.<br />
Januar die große, alle sieben Jahre<br />
stattfi ndende, externe Evaluierung<br />
durch die Leibniz-Gemeinschaft ins<br />
Haus. Die Leibniz-Gemeinschaft ist<br />
ein Zusammenschluss von inzwischen<br />
86 <strong>Institut</strong>en, die sich in fünf<br />
Sektionen aufteilen. Diese fünf Sektionen<br />
– Geisteswissenschaften und<br />
Bildungsforschung, Umweltwissenschaften,<br />
Mathematik, Ingenieur- und<br />
Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften,<br />
Sozial-, Raum- und Wirtschaftswissenschaften<br />
– zeigen das<br />
breit gefächerte Spektrum des Forschungsverbunds.<br />
Namhafte <strong>Institut</strong>ionen<br />
wie das Deutsche Museum,<br />
das Germanische Nationalmuseum<br />
oder die Senckenberg Gesellschaft<br />
für Naturforschung fi nden sich in der<br />
Leibniz-Gemeinschaft. Das <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> gehört der geisteswissenschaftlichen<br />
Sektion A an, und sein<br />
Direktor Peter Haslinger ist derzeit<br />
Sprecher dieser Sektion. Einigend<br />
trotz Themenvielfalt sind die überregionale<br />
Bedeutung und das gesamtstaatliche<br />
wissenschaftliche Interesse<br />
an der Arbeit der Leibniz-<strong>Institut</strong>e<br />
im Rahmen der gemeinsamen Forschungsförderung<br />
von Bund und Ländern<br />
nach Artikel 91b des Grundge-<br />
setzes. Die externe Evaluierung, die in<br />
einer Stellungnahme des Senats der<br />
Leibniz-Gemeinschaft mündet, ist die<br />
Grundlage für Bund und Länder, in der<br />
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz<br />
die weitere Förderwürdigkeit der<br />
<strong>Institut</strong>e regelmäßig zu überprüfen.<br />
Bereits im Laufe der letzten Jahre<br />
wurden die Empfehlungen des letzten<br />
Evaluierungsberichts von 2006 institutsintern<br />
erörtert und systematisch<br />
umgesetzt. Als gutes Instrument, die<br />
Themen breit zu diskutieren, erwies<br />
sich die seit 2008 jährlich stattfi ndende<br />
Klausurtagung des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s, zu der alle Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter eingeladen sind.<br />
Die einzige Evaluierungsvorgabe,<br />
die nach einer internen Evaluierung<br />
nicht umgesetzt wurde, war das „Outsourcing“<br />
des hauseigenen Verlags.<br />
Vieles sprach dafür, den Verlag im<br />
Haus zu behalten, was sich auch bei<br />
der Vorbereitung zur Evaluierung als<br />
Glücksfall erwies.<br />
Die intensive Phase der Vorbereitung<br />
begann im Frühjahr letzten Jahres,<br />
denn bereits im August 2011<br />
mussten beim Senatsausschuss Evaluierung<br />
(SAE) der Leibniz-Gemeinschaft<br />
die umfangreichen schriftlichen<br />
Unterlagen eingereicht werden,<br />
welche die Entwicklung der letzten<br />
sieben und insbesondere der letz-<br />
ten drei Jahre darstellen. Es galt die<br />
vielen großen und kleinen Erfolge,<br />
die Alltagsarbeit und besonderen<br />
Ereignisse zu bündeln, strukturiert<br />
darzustellen und in das große Ganze<br />
einzubinden. Neben den umfangreichen<br />
Texten mussten zahlreiche Statistiken<br />
und Tabellen erstellt werden.<br />
Parallel zur Erarbeitung der Schriftform<br />
bildeten sich Arbeitsgruppen,<br />
welche die zweitägige Begehung<br />
durch die Bewertungsgruppe im Januar<br />
2012 vorbereiteten. Diese vom<br />
SAE einberufene zwölfköpfi ge Gruppe<br />
ist mit internationalen Expertinnen<br />
und Experten sowie mit fachfremden<br />
Gutachterinnen und Gutachtern besetzt.<br />
Neben der Beurteilung der forschungsbasierten<br />
Dienstleistungen<br />
Die Poster-Ausstellung im Foyer des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s bot viele Ansätze für Gespräche der Gutachtergruppe mit den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern<br />
3<br />
Markus Roth<br />
präsentiert den<br />
Gutachtern das<br />
LOEWE-Projekt<br />
zur Digitalisierung<br />
der Lodzer Gettochronik
Vorstellung der<br />
Wissenschaftlichen<br />
Sammlungen<br />
Gutachterin Michaela<br />
Marek (vorne rechts)<br />
im Gespräch mit<br />
Stipendiatinnen und<br />
Stipendiaten der<br />
Leibniz Graduate<br />
School<br />
und der wissenschaftlichen Arbeit<br />
einer Einrichtung werden auch die internationale<br />
Sichtbarkeit, die Wirkung<br />
der Arbeit in die breite Öffentlichkeit,<br />
die Kooperationen mit anderen <strong>Institut</strong>ionen,<br />
wie z.B. Hochschulen, die<br />
wissenschaftliche Nachwuchsförderung<br />
sowie der Umgang mit dem<br />
Thema Gleichstellung und Chancengleichheit<br />
von Männern und Frauen<br />
evaluiert. Begutachtet wird dabei<br />
sowohl die Entwicklung der vergangenen<br />
Jahre als auch die Planung<br />
für die Zukunft.<br />
Eine eintägige Klausursitzung sowie<br />
zwei Generalproben fanden im<br />
Vorfeld dieser Begehung statt. Erstere<br />
diente unter anderem dem ge-<br />
genseitigen besseren Kennenlernen<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />
Schließlich ist das <strong>Institut</strong> in den letzten<br />
Jahren, dank erfolgreicher Drittmitteleinwerbung,<br />
stark gewachsen.<br />
Im Laufe der Monate entstand so das<br />
notwendige Wir-Gefühl auch unter<br />
4<br />
den „Neuen“. Während der Generalproben,<br />
die unter Beteiligung so<br />
genannter „Critical friends“ stattfanden,<br />
wurden die halbstündige Präsentation<br />
des gesamten <strong>Institut</strong>s sowie<br />
die Präsentationen der einzelnen<br />
Arbeitsbereiche ausgefeilt.<br />
Viel Arbeit und Einsatz der gesamten<br />
Belegschaft erforderten die Poster,<br />
die während der Begehung die<br />
Wände des Sammlungs- und Bibliotheksgebäudes<br />
zierten und über die<br />
Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder<br />
des <strong>Institut</strong>s Auskunft gaben. Sie waren<br />
vor allem als Gesprächseinstieg<br />
für die Bewertungsgruppe mit den<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
gedacht, die vor den Postern Rede<br />
und Antwort standen. Hatte man sich<br />
zunächst für eine Aufteilung der Poster<br />
nach Abteilungen entschieden,<br />
wurde dieser Ansatz nach der ersten<br />
Sichtung der Poster zur Klausur im<br />
September 2011 nochmals komplett<br />
verworfen. Die Arbeitsaufgaben und<br />
die Vernetzung innerhalb des Hauses<br />
sollten im Vordergrund stehen. Die<br />
Zuordnung der Poster zu einzelnen<br />
Abteilungen und Querschnittsaufgaben<br />
geschah nur noch durch ein<br />
Farbsystem, während die Poster sich<br />
in thematische Blöcke gliederten:<br />
Organisation, forschungsbasierte Infrastruktur,<br />
Service, Forschung, Vernetzung<br />
und Transfer in den öffentlichen<br />
Raum waren die Themen.<br />
Ein solch massiver kurzfristiger Eingriff<br />
in das Konzept war nur möglich,<br />
weil der Verlag die Poster gestaltete<br />
und somit kurze Wege zwischen<br />
Text- und Bildproduktion sowie der<br />
Gestaltung der Poster gegeben waren.<br />
Parallel zu den Postern wurde<br />
eine Broschüre als Wegweiser und<br />
Überblick für die Bewertungsgruppe<br />
erstellt. Büchertische mit Verlagspublikationen,<br />
Belegexemplaren und Publikationen<br />
der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter sowie Stationen, an denen<br />
Onlineangebote wie der „Historischtopographische<br />
Atlas schlesischer<br />
Städte“ oder das Erinnerungsportal<br />
„Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt<br />
– Das letzte Jahr“ in Augenschein<br />
genommen werden konnten,<br />
rundeten das Bild ab. Zudem konnten<br />
die Abteilungen in jeweils 50-minütigen<br />
Präsentations- und Diskussionsrunden<br />
die Bewertungsgruppe<br />
von ihrer Arbeit überzeugen. Auch<br />
dies wollte gut vorbereitet sein. Zum<br />
Schluss war alles organisiert, bis hin<br />
zu den Regenschirmen mit <strong>Herder</strong>-<br />
Logo. Diese waren Mitte Januar auch<br />
dringend nötig, damit niemand auf<br />
dem Weg zwischen den Gebäuden<br />
nass wurde. Doch all die Mühe hatte<br />
sich gelohnt. Der Teamgeist war an<br />
beiden Tagen des Besuchs der Bewertungsgruppe<br />
zu spüren. An beiden<br />
Tagen herrschte eine konzentrierte,<br />
aber sehr angenehme Stimmung.<br />
Der Bericht der Bewertungsgruppe,<br />
der neben der Analyse der Einrichtung<br />
hinsichtlich Qualität und Bedeutung<br />
auch Anregungen und Empfehlungen<br />
für die zukünftige Entwicklung<br />
enthält, und die Stellungnahme des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s zu diesem Bericht<br />
werden nun die Grundlage für den<br />
Entwurf einer Stellungnahme seitens<br />
des Senatsausschusses Wettbewerb<br />
der Leibniz-Gemeinschaft<br />
bilden. Dieser wird schließlich im November<br />
2012 in einer Senatssitzung<br />
der Leibniz-Gemeinschaft erörtert<br />
und zur Verabschiedung kommen.<br />
Die erste Resonanz fi el sehr positiv<br />
aus, aber erst am Ende dieses Jahres<br />
wird das Team des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
mit letzter Sicherheit erfahren,<br />
ob die Mühen der Vorbereitung die<br />
erhofften Früchte getragen haben.<br />
Elke Bauer
Tagungen, Ausstellungen und Lesungen<br />
Unser neues Format: Lesungen am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Anfang März nahm das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
den Tod der polnischen Lyrikerin<br />
Wisława Szymborska zum Anlass,<br />
um ein schon lange geplantes Format<br />
zu erproben: „Lesungen am <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>“. Magda Szych (Gießen) und<br />
Jan Lipinsky (Marburg) trugen ausgewählte<br />
Gedichte der Nobelpreisträgerin<br />
jeweils auf Deutsch und Polnisch<br />
vor und führten das Publikum<br />
„Schloss-Kaffee“-Atmosphäre im Vortragssaal<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s: eine Lesung<br />
erinnerte an das ehemalige Ausflugslokal<br />
im vollbesetzten Lesesaal der Bibliothek<br />
in das Leben der Lyrikerin ein.<br />
Der Übersetzer und Autor Klaus-<br />
Jürgen Liedtke setzte Mitte April die<br />
Reihe fort. Liedtke las aus seinem<br />
Buch „Die versunkene Welt. Ein ostpreußisches<br />
Dorf in Erzählungen der<br />
Leute“. Der Autor begab sich 1987<br />
auf Spurensuche nach dem Leben<br />
seines Großvaters, der dem Hörensagen<br />
nach ein Heimatdichter war –<br />
ein Heimatdichter, dessen Gedichte<br />
die Zeit nicht überdauerten. Diese<br />
Spurensuche sollte über 20 Jahre<br />
dauern. Liedtke machte alle noch<br />
lebenden Einwohnerinnen und Einwohner<br />
des kleinen ostpreußischen<br />
Dorfes Neu Kermuschienen ausfindig,<br />
aus dem sein Großvater stammte.<br />
Er fügte die vielen, zum Teil auch<br />
widersprüchlichen Erzählungen der<br />
ehemaligen Einwohnerschaft Neu<br />
Kermuschienens, das von den Nazis<br />
in Kermenau umbenannt wurde,<br />
zu einer außergewöhnlichen Dorf-<br />
geschichte zusammen, die das Publikum<br />
in eine verloren gegangene<br />
Welt entführte.<br />
Die dritte Lesung Anfang Mai gewährte<br />
einen beklemmenden Einblick<br />
in den Alltag des Gettolebens<br />
in Lodz/Litzmannstadt. Dies war das<br />
zweitgrößte Getto, das die deutschen<br />
Besatzer in Ostmitteleuropa errichteten.<br />
Über 200.000 Menschen waren<br />
hier unter katastrophalen Bedingungen<br />
auf engstem Raum zusammengepfercht,<br />
die meisten wurden in<br />
den Vernichtungslagern Kulmhof und<br />
Auschwitz ermordet. Der am Berliner<br />
<strong>Institut</strong> für Zeitgeschichte tätige<br />
Historiker Ingo Loose gab Passagen<br />
aus dem von ihm übersetzten<br />
und herausgegebenen Tagebuch Jakob<br />
Poznańskis wieder. Poznański<br />
und seine Familie gehörten zu den<br />
wenigen Überlebenden des Gettos,<br />
sie überdauerten das Ende der Naziherrschaft<br />
versteckt in einem Erdloch.<br />
Poznańskis Aufzeichnungen<br />
gehören zu den wenigen Zeitzeugendokumenten,<br />
die auch die Zeit<br />
nach der endgültigen „Räumung“<br />
des Gettos durch die Nazis bis zur<br />
Befreiung schildern. Vor der eigentlichen<br />
Lesung gab Markus Roth (Marburg)<br />
einen Einblick in den virtuellen<br />
Erinnerungsort „Chronik des Gettos<br />
Lodz/Litzmannstadt – Das letzte Jahr“<br />
(www.getto-chronik.de) und ordnete<br />
damit das Tagebuch Poznańskis in<br />
einen größeren Kontext ein.<br />
Die vierte Lesung widmete sich<br />
schließlich einem ganz anderen The-<br />
ma. Sie war nicht dem Arbeitsgebiet<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s geschuldet, sondern<br />
dem Genius loci. Der heutige<br />
Vortragsbereich des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
entstand nämlich 1927 in Zusammenhang<br />
mit der 400-Jahr-Feier<br />
der Philipps-Universität Marburg.<br />
Der Architekt Karl Rumpf entwarf ein<br />
Ausflugslokal auf dem Marburger<br />
Schlossberg mit großer Freiterrasse,<br />
das auch für kulturelle Veranstaltungen<br />
wie Premierenfeiern der nahe gelegenen<br />
Schlossparkbühne gedacht<br />
war. Klaus-Dieter Spangenberg, ein<br />
Urenkel des ersten Betreibers des<br />
Schloss-Kaffees, hat die Geschichte<br />
des traditionsreichen Marburger<br />
„Café Spangenberg“ geschrieben,<br />
zu dem eben auch die Lokalität auf<br />
dem Schlossberg gehörte. Am 31.<br />
Mai verwandelte sich deswegen der<br />
Vortragssaal des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s mit<br />
kleinen Tischgruppen und Originaltischdecken<br />
wieder in jenes einst sehr<br />
beliebte Marburger Ausflugsziel. Bei<br />
Kaffee und Kuchen sowie Gitarrenklängen<br />
lauschten rund 100 Gäste<br />
den Anekdoten des Autors. Eine<br />
kleine Ausstellung zur Geschichte<br />
des „Schloss-Kaffees“ rundete die<br />
Veranstaltung ab.<br />
Die große Resonanz auf die vier<br />
bisher stattgefundenen Lesungen<br />
hat uns ermuntert, das Format im<br />
Herbst fortzuführen. Als nächster<br />
Vortragender ist der Gießener Ostmitteleuropa-Historiker<br />
Hans-Jürgen<br />
Bömelburg angefragt, der ein viel<br />
beachtetes Buch über Friedrich den<br />
Großen geschrieben hat. Mit seinem<br />
Vortrag wollen wir eine kleine Ausstellung<br />
von Friedrich-Autografen aus<br />
den Beständen des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
eröffnen, die im Oktober und November<br />
zu sehen sein wird.<br />
Elke Bauer<br />
5<br />
Ingo Loose,<br />
Klaus-Jürgen<br />
Liedtke<br />
und<br />
Klaus-Dieter<br />
Spangenberg
Postkartenansicht<br />
des Lemberger<br />
Rathauses<br />
Ein Mini-Workshop über Lemberg / L’viv im<br />
20. Jahrhundert<br />
2011 vereinbarte das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
mit dem Leipziger Geisteswissenschaftlichen<br />
Zentrum Geschichte<br />
und Kultur Ostmitteleuropas (GW-<br />
ZO) einen Austausch von Gastwissenschaftler/inne/n.<br />
In diesem Rahmen<br />
besuchte Vita Susak, die als<br />
Kuratorin in der Lemberger Nationalgalerie<br />
arbeitet, am 18. April das<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>. Im <strong>Institut</strong> entstand<br />
die Idee, Frau Susaks Vortrag „The<br />
National Gallery of Arts in Lviv. Collection<br />
History as a Reflection of Ci-<br />
6<br />
ty History (1907-2012)“ in einen breiteren<br />
Kontext aktueller Forschungen<br />
zu Lemberg einzubetten. So organisierten<br />
wir einen kurzen Workshop<br />
zum Thema „Lemberg/Ľviv/Lwów<br />
um 1900 – Aktuelle Forschungen“,<br />
dessen Beiträge zum Teil aber auch<br />
über die Jahrhundertwende hinauswiesen.<br />
Heidi Hein-Kircher führte<br />
in ihrem Vortrag in die kommunalpolitischen<br />
Rahmenbedingungen<br />
und Prägungen kulturellen Lebens<br />
in Lemberg um 1900 ein. An diesen<br />
Einstieg schloss sich der Gastvortrag<br />
Vita Susaks an. Sylvia Werner,<br />
Stipendiatin der Leibniz-Graduiertenschule<br />
am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, stellte die<br />
Wissenskultur der „Lemberger Moderne“<br />
am Beispiel des Netzwerkes<br />
des Philosophen Ludwik Fleck vor.<br />
Katharina Kreuder-Sonnen stellte<br />
Lemberg als internationales Zentrum<br />
der medizinischen Forschung in den<br />
1930er Jahren vor. Hinter ihrem Vortrag<br />
mit dem irritierenden Titel „Die<br />
Welt lernt das Läuse-Füttern“ verbarg<br />
sich die Geschichte der Bekämpfung<br />
des Fleckfieber-Erregers, bei<br />
der Lemberger Mikrobiologen in der<br />
Zwischenkriegszeit eine bedeutende<br />
Rolle spielten. Alle Vorträge und die<br />
lebhafte Diskussion zeigten nicht nur,<br />
dass die vielfältige Geschichte der<br />
multiethnischen Metropole Lemberg-<br />
L’viv ein Ausgangspunkt für zahlreiche,<br />
methodisch vielfältige Studien<br />
ist, sondern dass es noch viele Desiderate<br />
historischer Forschung gibt,<br />
die nach weiteren (Mikro-)Studien<br />
zur Geschichte Lembergs verlangen.<br />
Heidi Hein-Kircher<br />
Kollaborativer Karten-Slam und das Spiel<br />
mit Kartografie<br />
Ein Atlas im eigentlichen Sinne ist eine<br />
Sammlung von Karten, die in unterschiedlichen<br />
Kontexten als Wissensspeicher<br />
eingesetzt wird. Vielen dürfte<br />
der Diercke-Weltatlas als klassisches<br />
Instrumentarium zur Vermittlung geografischer<br />
Grundkenntnisse in der<br />
Schule noch gut in Erinnerung sein.<br />
Was häufig nicht offensichtlich wird,<br />
ist die dahintersteckende Intention,<br />
durch die Erstellung von Karten „die<br />
Natur zu einem sicheren Gegenstand<br />
der Wissenschaft zu machen“, wie<br />
Lorraine Daston und Peter Galison<br />
es formuliert haben („Das Bild der<br />
Objektivität“, in: Peter Geimer, Ordnungen<br />
der Sichtbarkeit, Frankfurt/M.<br />
2004, S. 36). Karten sind Konstrukte<br />
mit einer spezifischen Aussage<br />
und Botschaft, und als solche auch,<br />
möglicherweise ideologisch gefärbte,<br />
Visualisierungen von Raumbildern.<br />
Notwendig ist also ein kritischer<br />
Umgang mit kartografischen<br />
Darstellungen. Hier setzt der Digitale<br />
Atlas politischer Raumbilder an,<br />
indem er beispielsweise durch Verfremdungen,Kartenanalysebeispiele<br />
und die Verdeutlichung typischer<br />
und untypischer Darstellungsmuster<br />
eingespielte Sehgewohnheiten bricht.<br />
Durch den Einsatz neuer Medien soll<br />
er zugleich Visualisierungsformen erproben,<br />
die alternative Formen des<br />
Umgangs mit Raumbildern erlauben.<br />
Das dritte Treffen des Projektverbundes<br />
im Tübinger <strong>Institut</strong> für Wissensmedien,<br />
welches die erste konzeptionelle<br />
Arbeitsphase abschloss und<br />
das zweite Projektjahr einläutete, war<br />
dem gemeinsamen Austausch der<br />
Projektpartner und der Diskussion<br />
erster Quellenerhebungen sowie deren<br />
möglicher Nutzung innerhalb des<br />
Atlas gewidmet. Hierzu fanden drei<br />
kollaborativ angelegte Workshops zu<br />
Kartensprachen, Kartenkarrieren und<br />
„Kartenhybriden“ (Karten, in denen<br />
auch Text und Bild eine große Rolle<br />
spielen) statt. Dieser Teil der Tagung<br />
hatte – ein seltenes Phänomen auf
wissenschaftlichen Konferenzen –<br />
etwas Experimentelles und Spielerisches,<br />
denn jede der Arbeitsgruppen<br />
wurde bei einem „Karten-Slam“ an<br />
großen Tischen mit Originalmaterial<br />
aus der Kartensammlung des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s konfrontiert. Das lebhafte<br />
Diskutieren, das Hin- und Herblättern<br />
und Vergleichen der Karten gehörte<br />
genauso dazu wie die spontane Formulierung<br />
von Eindrücken. Dies war<br />
ausdrücklich erwünscht, weil es im<br />
Konzept der Tagung zum Erkenntnisprozess<br />
beitragen sollte – ein Erkenntnisprozess<br />
insbesondere über<br />
die unterschiedlichen Seh- und Lesegewohnheiten<br />
von Historiker/inne/n,<br />
Geograf/inn/en und Kognitionspsycholog/inn/en.<br />
Alle diese Disziplinen<br />
sind am Projekt beteiligt, und ihre<br />
unterschiedlichen Perspektiven auf<br />
ausgewählte kartographische Quellen<br />
wurden anschließend mit Blick auf die<br />
Konzeption und Implementierung des<br />
„Digitalen Atlas“ diskutiert. Intensiv<br />
debattierten die Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler die politische<br />
Aussage und die psychologischen<br />
Aspekte von Farbgebungen,<br />
beispielsweise der Darstellung jüdischer<br />
Bevölkerungsgruppen durch<br />
gelbe Einfärbung im Atlas östliches<br />
Mitteleuropa von 1957.<br />
Die eingangs erwähnte Logik einer<br />
Naturalisierung von Räumen durch<br />
Karten behandelte auch der Geograf<br />
Hans Dietrich Schulz (Berlin) in<br />
seinem Abendvortrag zum Thema<br />
„Grenzen suchen, finden, setzen“. Er<br />
stellte den klassischen Ansätzen zur<br />
Geschichte der Nationalstaatsbildung<br />
im Sinne einer staatsbürgerlichen<br />
Willensbekundung (französisches<br />
Modell) oder kulturell-sprachlichen<br />
Abgrenzung (mitteleuropäisches Modell)<br />
ein weiteres zur Seite, nämlich<br />
jenes der Grenzfindung. Er argumentierte,<br />
dass von frühen Vorkämpfern<br />
der Natio-nalbewegungen bis hin zu<br />
führenden (Natur-)Wissenschaftlern<br />
des 20. Jahrhunderts die Vorstellung<br />
natürlicher Grenzen, zumeist Flüsse<br />
oder Gebirge, eine zentrale Rolle<br />
spielte. Peter Weichhart (Wien) beschäftigte<br />
sich in seinem Vortrag vor<br />
allem mit dem für das Projekt zentralen<br />
Begriff des Raumbilds. Dieser<br />
erscheine im Alltag unproblematisch,<br />
stelle sich jedoch bei genauerer Betrachtung<br />
als „bösartiges Wortungeheuer“<br />
heraus, mit hohem Potenzial<br />
zum Missverständnis. Für die Auseinandersetzung<br />
mit Raumbildern<br />
in Bezug auf Karten schlug Weichhart<br />
eine Unterscheidung zwischen<br />
jenen Raumbildern vor, die sich an<br />
individuellen Bewusstseinszuständen<br />
orientieren, und anderen, die in<br />
Bezug zu sozialen Interaktionsprozessen<br />
stehen. Darüber hinaus gebe<br />
es Raumbilder, die zum Zweck<br />
der Verwirklichung eines bestimm-<br />
ten Raumes intentional entworfen<br />
werden. Insbesondere Letztere verweisen<br />
auf den bereits erwähnten<br />
Konstruktcharakter, aber auch auf<br />
die hinter Karten steckende Absicht.<br />
Die mittlerweile häufig zur Visualisierung<br />
von komplexen Informationen<br />
(z.B. Verkehrsnetze, Wahlergebnisse,<br />
Produktionsabläufe) eingesetzten interaktiven<br />
Infografiken und Karten zog<br />
Frank Heidmann (Potsdam) in seinem<br />
Vortrag über „Tangible Maps“ als Beispiel<br />
heran. Solche medialen Formen<br />
stünden für den Trend einer beschleunigenden<br />
Gesellschaft, mit kreativen<br />
Mitteln und Vereinfachungsverfahren<br />
Prozesse und Strukturen zu visualisieren.<br />
Im Zuge einer bewussten Ästhetisierung<br />
gewinnt der Gegenstand<br />
zugleich an Attraktivität, Zugänglichkeit<br />
und Überzeugungskraft. Gerade<br />
aufgrund der Dominanz der Ästhetik<br />
über den Inhalt – als gestalterisch<br />
„gut“ empfundene Internetpräsentationen<br />
werden gleichzeitig auch<br />
als objektiver wahrgenommen – sei<br />
auch hier ein kritischer Blick auf die<br />
visuelle Darstellung der Informationen<br />
unabdingbar.<br />
Je früher dieser kritische Blick<br />
entwickelt wird, desto besser: Der<br />
Geschichtsdidaktiker Vadim Oswalt<br />
(Gießen) plädierte dafür, von Anfang<br />
an, also beginnend mit dem ersten<br />
Gebrauch der Schulatlanten, Schülerinnen<br />
und Schülern nicht mit einem<br />
simplizistischen und „fertigen“<br />
Raumbild zu konfrontieren, sondern<br />
die notwendige Raumreflexion als<br />
zentrale Kompetenz zu schulen. Peter<br />
Jordan (Wien) beschäftigte sich<br />
7<br />
Noch<br />
aufgeräumt:<br />
An mehreren<br />
solcher Kartentische<br />
arbeiteten<br />
die Workshop-<br />
Teilnehmer mit<br />
Originalmaterialien<br />
aus dem<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>
Der Wiener Slavist<br />
Stefan Michael<br />
Newerkla hielt den<br />
Einführungsvortrag<br />
mit der Rolle geografischer Namen<br />
als Ausdruck menschlicher Raumaneignung<br />
und -strukturierung. Auf<br />
diese Weise unterstützen sie raumbezogene<br />
Identitäten und helfen,<br />
zwischen dem „Eigenen“ und dem<br />
„Anderen“ zu differenzieren. Eine<br />
Anekdote aus dem Vortrag seines<br />
Wiener Kollegen Weichhart vermag<br />
dies zu illustrieren: Weichharts Kindheitsfreunden<br />
diente ein Baugelände<br />
als Treffpunkt und Spielplatz, das sie<br />
„die Wüste“ nannten. Die Benennung<br />
dieses zeitweiligen Niemandslandes<br />
Sprache, Wissen und Translationsprozesse<br />
Workshop der Leibniz-Graduiertenschule am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Die Konditionen der Mehrsprachigkeit<br />
und des Kulturkontakts stehen<br />
seit einigen Jahren wieder im Zentrum<br />
historischer Forschungen. Am<br />
23. Mai fand dazu im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
ein Workshop der Leibniz Graduate<br />
School for Cultures of Knowledge<br />
in Central European Transnational<br />
Contexts in Kooperation mit dem<br />
Gießener Graduate Centre for the<br />
Study of Culture (GCSC) statt. Er<br />
widmete sich der Frage des Wissenstransfers<br />
und der Übersetzung<br />
von Wissensbeständen anhand<br />
des slavisch-deutschen Kontaktraums.<br />
Neben der Herausbildung<br />
neuer Wissenschaftssprachen sind<br />
hier die Stabilisierung und die Akzeptanz<br />
(respektive die Folgen der<br />
Ablehnung) der neuen sprachlichen<br />
8<br />
inmitten von Wien war gleichzeitig<br />
eine individuelle Form der Raumaneignung,<br />
so Weichhart. Analog zu<br />
diesem Beispiel kann man feststellen,<br />
dass auch hinter vermeintlich „neutralen“<br />
geografischen Bezeichnungen<br />
auf kartografischen Darstellungen<br />
Absichten, Motive und benennende<br />
Subjekte stecken.<br />
Der Versuch, sowohl theoretische<br />
als auch praktische Perspektiven aus<br />
unterschiedlichen Blickrichtungen<br />
anzusprechen und produktiv miteinander<br />
zu verbinden, stellte sich<br />
und medialen Formen<br />
der Wissensvermittlung<br />
durch<br />
die Wissenschaftsgemeinschaft<br />
im<br />
Zentrum der Überlegungen.<br />
So wurde<br />
etwa das Schaffen<br />
der „nationalen“<br />
Fachsprachen bei<br />
gleichzeitigem zwischensprachlichen<br />
Austausch ebenso<br />
diskutiert wie die<br />
Folgen der Übernahme<br />
von Konzepten<br />
über kulturelle und<br />
soziale Grenzen hinweg.<br />
In seiner keynote speech unterstrich<br />
der Wiener Slavist Stefan<br />
Michael Newerkla den Beitrag der<br />
Geschichts- und Sprachwissenschaft<br />
zur Erhellung sprachlicher<br />
Transferprozesse. Besonders wertvoll<br />
sei das Wissen über soziokulturelle,<br />
wirtschaftliche sowie politische<br />
Strukturen und Prozesse, die<br />
einen bedeutenden Einfluss auf<br />
sprachliche Entwicklungen einer<br />
Gesellschaft ausübten. Newerkla<br />
warnte dabei vor Falschinterpretationen:<br />
Nicht alles, was lange Zeit<br />
für eine Übertragung aus einem<br />
geografisch oder sozial benachbarten<br />
Sprachraum gehalten worden<br />
ist, war auch tatsächlich eine.<br />
In der Forschungsgeschichte sind<br />
insgesamt als gelungen, gleichwohl<br />
als sehr ambitioniert heraus. Der<br />
„Digitale Atlas“ ist ein ebenso innovatives<br />
wie kreatives Vorhaben. Er kann<br />
als Instrument dienen, dem breiten<br />
Spektrum möglicher Fragestellungen<br />
an Raumbilder ein entsprechendes<br />
Spielfeld zu geben.<br />
Lucas Frederik Garske<br />
Johanna Schnabel<br />
Anna Veronika Wendland<br />
bereits zahlreiche Schein-Translationen<br />
aufgedeckt worden, die ohne<br />
,externen‘ Transfer zu Stande gekommen<br />
sind oder deren Wurzeln<br />
in deutlich früheren sprachlichen<br />
Entwicklungs- und Ausdifferenzierungsphasen<br />
liegen, als bisher angenommen<br />
wurde. Newerkla plädierte<br />
deshalb für ein geschärftes<br />
Bewusstsein historischer Zusammenhänge,<br />
Kontinuitäten und Brüche<br />
bei der Erforschung des Kultur-<br />
und Wissenstransfers. Die<br />
Reduktion der Forschungsprozesse<br />
auf rein linguistische Analysen<br />
führe keineswegs zur Beantwortung<br />
aller Fragen des sprachkulturellen<br />
Transfers.<br />
Den zweiten Vortrag mit dem Titel<br />
„Wissenschaft, Sprache und<br />
Différance: Überlegungen zur<br />
Wissenschaftssprache(n) und Wissenstransfer“<br />
hielt der Gaststipendiat<br />
der Leibniz Graduate School<br />
Jan Surman. Der Referent stellte<br />
die Hypothese auf, dass in der ersten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts im<br />
tschechisch-, polnisch- und ukrainischsprachigen<br />
Raum der Habsburgermonarchie<br />
der Purismus als<br />
eine linguistische Strategie dazu<br />
diente, mittels „différanten“ (Derrida)<br />
Wortkonstruktionen abgeschlossene<br />
wissenschaftliche Kommunikationsräume<br />
zu schaffen.<br />
Erst gegen die Jahrhundertwende<br />
mehrten sich Stimmen gegen den
Purismus, der zunehmend als eine<br />
den wissenschaftlichen Transfer<br />
verhindernde Praxis wahrgenommen<br />
wurde. Dennoch hat die Phase<br />
des Sprachpurismus nicht nur<br />
auf die jeweiligen Sprachen selbst,<br />
sondern auch auf die wissenschaftlichen<br />
Klassifikationen und Prämissen<br />
der Theoriebildung tiefgreifend<br />
eingewirkt. Anhand des Beispiels<br />
der Wortschöpfungsprozesse für<br />
die Benennung der Elemente Sauerstoff<br />
und Stickstoff in einzelnen<br />
slavischen Sprachen der Habsburger<br />
Monarchie verdeutlichte Surman,<br />
wie langwierig, sorgfältig und<br />
subtil die Bildung und Akzeptanz<br />
neuer Begriffe sein kann.<br />
Im Kommentar zu den Vorträgen<br />
hob Peter Haslinger die Bedeutung<br />
der metaphorischen Ebene von<br />
Sprache hervor und verdeutlichte,<br />
dass Sprachbildungsprozesse<br />
stets Informationen über ihre Konstrukteure,<br />
ihre Intentionen und Entscheidungen<br />
beinhalten. Deshalb<br />
ist es für den Forschenden von Bedeutung<br />
zu erkennen, wo bewusste<br />
ideologische Entscheidungen<br />
und wo unbewusste Klassifizierungen<br />
oder unausgesprochene Vermutungen<br />
zum Tragen gekommen<br />
sind. Haslinger betonte die Bedeutung<br />
der Publikumsakzeptanz für<br />
den Erfolg von Sprachstrategien.<br />
Auch die emotionalen Komponenten<br />
des Sprachgebrauchs müssten<br />
berücksichtigt werden, so die<br />
mit Sprache verbundenen nonverbalen<br />
Erfahrungen und Erinnerungen.<br />
Dieser Faktor spiele insbesondere<br />
in Fragen der Fremdakzeptanz<br />
bei sprachlichen Neuerungen eine<br />
Rolle.<br />
Während der Diskussion wurde<br />
unter anderem angesprochen, dass<br />
unter den germanischen Sprachen<br />
neben dem Deutschen auch<br />
das Jiddische einen bedeutenden<br />
Einfluss auf den ostmitteleuropäischen<br />
Sprachraum ausübte.<br />
In Bezug auf die Erforschung von<br />
Sprach- und Kulturtransfer sollten<br />
stets die schul- und bildungssystembedingtenSprachnormierungen<br />
ins Bewusstsein gerufen<br />
werden. Betont wurden auch die<br />
unterschiedlichen Verhältnisse von<br />
Dialekt und Hochsprache. Während<br />
im polnischsprachigen Raum<br />
die Unterschiede zwischen gesprochener<br />
und geschriebener Sprache<br />
verhältnismäßig gering ausfielen,<br />
seien sie im Tschechischen und<br />
österreichischen Deutschen deutlich<br />
tiefgreifender.<br />
Konrad Hierasimowicz<br />
Peter Haslinger<br />
Generations of Violence<br />
Age Groups, Generation Gaps and the Significance of Violence<br />
Inwieweit beeinflussen gesellschaftliche<br />
und generationelle Kontexte<br />
die Ausübung von Gewalt?<br />
Inwieweit beeinflusst Gewalt Gesellschaften<br />
bzw. einzelne Generationen?<br />
Diese Fragestellungen<br />
standen im Zentrum des internationalen<br />
Workshops, der am 7. Juni<br />
2012 im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> stattfand.<br />
Er wurde von der DFG-Forschergruppe<br />
Gewaltgemeinschaften gemeinsam<br />
mit dem Centre for Historical<br />
Research and Documentation<br />
on War and Contemporary Society<br />
(Brüssel), dem UCD Centre for War<br />
Studies (Dublin), dem NIOD Instituut<br />
voor Oorlogs-, Holocaust- en<br />
Genocidestudies (Amsterdam) und<br />
dem EUCOWAS network (European<br />
Cooperation on War Studies)<br />
durchgeführt.<br />
Aktuelle Forschungsprojekte zum<br />
Thema wurden in Kurzvorträgen<br />
vorgestellt und boten eine Grundlage<br />
für die weiterführende Diskussion.<br />
Anhand von Beispielen wurde<br />
die Thematik veranschaulicht. Sascha<br />
Reif (Kassel) referierte über<br />
Generationskonflikte und Gewalt<br />
im östlichen Afrika im 19. Jahrhundert,<br />
Tamir Libel (Dublin) über die<br />
sogenannte „zweite“ Generation<br />
von Intifada-Führern im Zweiten Libanon-Krieg.<br />
Weitere im Workshop<br />
vorgestellte Projekte erforschen<br />
Verbrecherkulturen Barcelonas in<br />
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
(Florian Grafl, Gießen) oder<br />
Vater-Sohn-Generationenbezie-<br />
hungen in der litauischen militanten<br />
Rechten der Zwischenkriegszeit<br />
(Vytautas Petronis, Marburg).<br />
Als Kommentatoren und Moderatoren<br />
traten Antoon Vrints (Gent), Rudi<br />
van Doorslaer (Brüssel), Friedrich<br />
Lenger (Gießen), Robert Gerwarth<br />
(Dublin) und Peter Haslinger (Gießen/Marburg)<br />
auf.<br />
In der Diskussion ging es vor allem<br />
um den Generationsbegriff,<br />
9
Tatjana Tönsmeyer<br />
(links) und Peter<br />
Haslinger (rechts) bei<br />
der Vorstellung des<br />
Editionsprojekts<br />
seine Präzisierung und seine für<br />
verschiedene Formen von „Gewaltgemeinschaften“<br />
unterschiedliche<br />
Bedeutung. Eine allgemeingültige<br />
Definition, auf die sich historische<br />
Untersuchungen stützen könnten,<br />
gibt es nicht, vielmehr können in jeder<br />
Gesellschaft, Generation bzw.<br />
Auftakttagung des Editions- und Forschungsprojekts<br />
„World War II –<br />
Everyday Life Under German Occupation“<br />
Am 31. Mai und 1. Juni 2012 fand in<br />
Berlin die Auftaktveranstaltung des<br />
Editions- und Forschungsprojekts<br />
„World War II – Everyday Life Under<br />
German Occupation“ statt. An<br />
dem gemeinsamen Verbundprojekt<br />
sind unter der Leitung von Prof. Dr.<br />
Peter Haslinger, Direktor des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s,<br />
und Prof. Dr. Tatjana<br />
Tönsmeyer, Bergische Universität<br />
Wuppertal, ausgewiesene Expertinnen<br />
und Experten aus insgesamt<br />
15 europäischen Ländern beteiligt.<br />
Finanziert wird das Projekt durch<br />
den Pakt für Forschung und Innovation<br />
im Rahmen des Verfahrens<br />
des Senatsausschuss Wettbewerb<br />
(SAW) der Leibniz-Gemeinschaft.<br />
Ziel der Veranstaltung war vorrangig<br />
der Informationsaustausch der<br />
Kooperationspartner, jedoch wur-<br />
10<br />
in unterschiedlichen politischen<br />
Kontexten ganz unterschiedliche<br />
Formen von Gewalt festgestellt<br />
werden, die sich in einer individuellen<br />
Legitimierung, Organisation<br />
und Ausführung ausdrücken. Der<br />
Workshop lieferte einen wichtigen<br />
Beitrag zur Diskussion über die<br />
de das Treffen durch die<br />
öffentliche Vorstellung<br />
des Projekts im DokumentationszentrumTopographie<br />
des Terrors<br />
am 31. Mai erweitert.<br />
Unter dem Titel „Von<br />
der Tätergeschichte<br />
zur Geschichte lokaler<br />
Bevölkerungen unterBesatzungsbedingungen.<br />
Neue Wege in<br />
der Historiographie des<br />
Zweiten Weltkriegs“ referierte<br />
Prof. Dr. Tatjana<br />
Tönsmeyer über<br />
Schwerpunkte und Defizite<br />
in der einschlägigen<br />
Forschung und Dokumentation.<br />
Sie konstatierte, dass die Geschichte<br />
des Zweiten Weltkriegs<br />
bislang vor allem als Tätergeschichte<br />
geschrieben wurde, wohingegen<br />
die Situation der lokalen<br />
Zivilbevölkerungen unter den<br />
Bedingungen der Besatzung weitgehend<br />
unerforscht geblieben ist.<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger stellte<br />
daraufhin das Editions- und Forschungsprojekt<br />
„World War II –<br />
Everyday Life Under German Occupation“<br />
vor und betonte, dass<br />
die geplante Quellenedition angesichts<br />
ihrer komparativen Ausrichtung<br />
die ideale Gelegenheit biete,<br />
der Komplexität von Besatzungssituationen<br />
in gesamteuropäischer<br />
Weise gerecht zu werden und ein<br />
Themenfeld zu dokumentieren,<br />
das für die europäische Erinne-<br />
Beziehung von Generationen und<br />
Kollektivgewalt und förderte die<br />
internationale Vernetzung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
mit einschlägig arbeitenden<br />
<strong>Institut</strong>ionen.<br />
Lisa Schröer<br />
rungs- und Geschichtspolitik nach<br />
wie vor zentral sei.<br />
In der anschließenden regen Diskussion<br />
stieß der Begriff der „Alltagsgeschichte“<br />
im Zusammenhang<br />
mit dem Zweiten Weltkrieg auf<br />
großes Interesse. Diskutiert wurden<br />
die Definition von „Alltag“, die Unterscheidung<br />
zwischen „Krieg“ und<br />
„Besatzung“ sowie die Abgrenzungen<br />
zu verwandten Themengebieten<br />
wie der Holocaust-Forschung<br />
und der Geschichte des Widerstandes.<br />
Dabei wurde deutlich, dass<br />
es keine gemeinsame europäische<br />
Sichtweise auf Phänomene des<br />
Kriegsgeschehens gibt und gerade<br />
hierin die Herausforderungen des<br />
Projekts liegen.<br />
Am zweiten Tag trafen sich die<br />
Tagungsteilnehmer im Dokumentationszentrum<br />
Topographie des<br />
Terrors. Nach der Begrüßung und<br />
einem Resümee der bisherigen Gespräche<br />
für den erweiterten Teilnehmerkreis<br />
durch Prof. Dr. Peter<br />
Haslinger stellten die Kooperationspartner<br />
das Land, das sie vertreten,<br />
mit Blick auf die historiografische<br />
Situation und die Archivlage<br />
vor. Daran anschließend diskutierte<br />
der Teilnehmerkreis Struktur und Inhalte<br />
der geplanten Editionsbände,<br />
besprach die Arbeitsgänge sowie<br />
den avisierten Zeitplan des Projekts<br />
und nahm weitere gemeinsame<br />
Veranstaltungen in den Blick.<br />
Insgesamt sind für die Quellenedition<br />
vier Themenschwerpunkte<br />
mit jeweils mehreren Teilbänden<br />
vorgesehen, denen keine länder
spezifische, sondern eine thematische<br />
Gliederung zugrunde liegt.<br />
Im Fokus steht die Dokumentation<br />
von Mangelerfahrungen der Lokalbevölkerungen,<br />
Formen von Herrschaft<br />
und Gewalt sowie Zwangsarbeit,<br />
Ausbeutung, Vertreibung<br />
und Verfolgung. Neben der gedruckten<br />
<strong>Ausgabe</strong>, deren erster<br />
Band bis 2015 erscheinen soll, wird<br />
es auch ein Onlineportal geben, das<br />
die Quellen nicht nur in englischer<br />
Übersetzung, sondern auch in der<br />
Originalsprache, teilweise unterstützt<br />
durch Faksimiles, abbilden<br />
wird. Im Rahmen des Editions- und<br />
Forschungsprojekts sind diverse<br />
Workshops und Tagungen geplant,<br />
die dem wissenschaftlichen Austausch<br />
und der Vernetzung dienen<br />
sollen. Die nächste Tagung mit den<br />
Herausgebern und Länder-Exper-<br />
Demokratiekonzepte der<br />
frühen Weimarer Republik<br />
Am 21. und 22. Juni 2012 hatte<br />
das <strong>Institut</strong> für Deutsche Sprache<br />
in Mannheim (IDS) die beiden Projektpartner<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> (HI) und<br />
<strong>Institut</strong> für Zeitgeschichte (IfZ) zum<br />
letzten Arbeitstreffen des Verbundprojekts<br />
„Demokratiegeschichte<br />
des 20. Jahrhunderts als Zäsurgeschichte.<br />
Das Beispiel der frühen<br />
Weimarer Republik“ geladen. Das<br />
Arbeitstreffen diente zum einen dazu,<br />
eine Bilanz der Projektarbeit der<br />
letzten zweieinhalb Jahre zu ziehen<br />
und organisatorische Angelegenheiten<br />
bezüglich des geplanten<br />
Sammelbandes und des Diskurswörterbuchs<br />
zu besprechen. Zudem<br />
wurde es durch einen öffentlichen<br />
Tagungsteil ergänzt, bei dem<br />
sich vier externe Referenten dem<br />
Themenkomplex „Demokratiekonzepte<br />
der frühen Weimarer Republik“<br />
widmeten.<br />
Intern standen inhaltliche Ausrichtung<br />
und organisatorische Fragen<br />
des für 2013 geplanten Sammelbandes<br />
und die Konzeption<br />
des Diskurswörterbuchs „Demokratiegeschichte“,<br />
das in gedruckter<br />
und in digitaler Onlineversion erscheinen<br />
soll, im Vordergrund. Der<br />
Sammelband, der sowohl methodische<br />
als auch empirische Ergebnisse<br />
des Projekts beinhalten soll,<br />
wird außerdem um Beiträge der zu<br />
den Projekttagungen eingeladenen<br />
externen Referenten ergänzt. Ein<br />
einleitendes Theorie- und Methodenkapitel<br />
wird von allen Projektteilnehmern<br />
gemeinsam verfasst<br />
werden und soll so die gemeinsam<br />
erarbeiteten theoretischen Zugänge<br />
zum Gegenstand „Demokratiegeschichte“<br />
widerspiegeln, die für<br />
diese interdisziplinäre Projektarbeit<br />
grundlegend waren. Das Diskurswörterbuch„Demokratiegeschichte“,<br />
das methodisch auf die<br />
Vorarbeit vorheriger Diskurswörterbücher<br />
des IDS („Schulddiskurs<br />
1945-1955“ und „Protestdiskurs<br />
1967/68“) aufbaut, unterscheidet<br />
sich in seiner Konzeption grundlegend<br />
von Standardwörterbüchern,<br />
indem es speziell auf den konkreten<br />
Wortschatz der gegebenen Diskursarena<br />
fokussiert, um innere Zusammenhänge<br />
und Abhängigkeiten<br />
herauszustellen.<br />
Im öffentlichen Teil des Arbeitstreffens<br />
widmeten sich vier geladene<br />
Referenten der Auseinandersetzung<br />
mit demokratischen<br />
Konzepten in unterschiedlichen<br />
gesellschaftlichen Bereichen der<br />
Weimarer Republik. Michael Fahlbusch<br />
(Basel) beschäftigte sich mit<br />
dem völkischen Diskurs zum The-<br />
ten wird im Januar 2013 in Berlin<br />
stattfinden.<br />
Daniela Kraus<br />
menkomplex „Volk ohne Raum –<br />
Raum ohne Volk“ und verdeutlichte<br />
am Beispiel der völkisch geprägten<br />
Geowissenschaften, wie Politik und<br />
Wissenschaft gegenseitig in Interaktion<br />
traten. Vor allem generationell<br />
bestimmte soziale Netzwerke<br />
hätten hier ihre Bedeutung entfaltet.<br />
Inwiefern ein „völkischer Demokratiebegriff“<br />
überhaupt existiert<br />
habe, erörterte Anja Lobenstein-<br />
Reichmann (Heidelberg/Mannheim)<br />
in ihrem instruktiven Beitrag,<br />
der auf Werken von Julius<br />
Langbehn, Houston S. Chamberlain<br />
und Alfred Rosenberg basiert.<br />
Im nationalkonservativen Milieu der<br />
Zwischenkriegszeit müsse ein Demokratiediskurs<br />
immer im Zusammenhang<br />
mit einem rassischen Diskurs<br />
analysiert werden, der nicht<br />
erst nach dem Ersten Weltkrieg eingesetzt<br />
habe, dann aber einem Versuch<br />
der praktischen Umsetzung<br />
des Theorems unterworfen worden<br />
sei.<br />
Martin Geyer (München) referierte<br />
über Korruptionsdebatten in<br />
der frühen Weimarer Republik und<br />
veranschaulichte diese am Beispiel<br />
des so genannten Barmat-<br />
Skandals. Hierbei betrachtete er<br />
Skandale grundsätzlich als Kristal-<br />
11
lisationspunkte, in denen Normverfehlungen<br />
verhandelt werden und<br />
letztlich somit auch die Weimarer<br />
Demokratie selbst.<br />
Abschließend fächerte Kathrin<br />
Groh (München) aus juristischer<br />
Perspektive das Spektrum verschiedener<br />
Demokratiekonzepte führender<br />
deutscher Staatsrechtslehrer zu<br />
Beginn der Weimarer Republik auf.<br />
Ausgehend vom ̦Vater‘ der Weimarer<br />
Reichsverfassung Hugo Preuß<br />
über Georg Anschütz, Richard Tho-<br />
Ereignisse und Informationen<br />
Am 12. Juni 2012 war das <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> Gastgeber einer Masterclass<br />
mit Professor Miloš Havelka<br />
(Karls-Universität Prag), die im<br />
Rahmen des Projekts „Digitaler Atlas<br />
Politischer Raumbilder zu Ostmitteleuropa“<br />
stattfand. Die etwa<br />
20 anwesenden Mitarbeiter, Stipendiaten<br />
und Doktoranden des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s befassten sich mit<br />
den „wissensgeschichtlichen Verortungen<br />
Ostmitteleuropas“. Das<br />
einleitende Referat von Miloš Havelka<br />
skizzierte Grundlinien der historischen<br />
Soziologie und der Wissensgeschichte.<br />
Er erörterte dabei<br />
zunächst den Diskurswandel, den<br />
Einteilungen Europas im Laufe der<br />
Geschichte durchlebten: Von Diskursen<br />
einer Nord-Süd-Trennung<br />
12<br />
ma, Hans Kelsen und Hermann Heller<br />
betonte Groh, dass nur die Unabdingbarkeit<br />
der parlamentarischen<br />
Ordnung als Minimalkonsens jener<br />
Exponenten anzusehen sei.<br />
Das Ende der Projektlaufzeit des<br />
durch den Pakt für Forschung und<br />
Innovation im Rahmen des Verfahrens<br />
des Senatsausschusses Wettbewerb<br />
der Leibniz-Gemeinschaft<br />
finanzierten Modellprojekts steht<br />
mit Januar 2013 bevor. Die Projektteilnehmer<br />
haben sich jedoch be-<br />
Die Verortung Ostmitteleuropas<br />
in der Geschichte Europas<br />
Publizieren im Verlag des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
zur Zeit der Antike hin zu einer Ost-<br />
West-Trennung des Kontinents in<br />
der Geschichte der Neuzeit. Anschließend<br />
reflektierte Miloš Havelka<br />
die Positionen mehrerer soziologischer<br />
„Klassiker“, u.a. Georg<br />
Simmel und Karl Mannheim, die<br />
sich mit (räumlichen) Ordnungen<br />
des Wissens befasst haben. Impulse<br />
für die folgende Debatte gingen<br />
besonders vom Simmel'schen<br />
Zitat aus: „Die Grenze ist nicht eine<br />
räumliche Tatsache mit soziologischen<br />
Wirkungen, sondern eine<br />
soziologische Tatsache, die sich<br />
räumlich formt“ (Georg Simmel: Soziologie.<br />
Untersuchungen über die<br />
Form der Vergesellschaftung, Berlin<br />
1983 [Erstausgabe 1908], S. 467).<br />
Die Diskussion im Plenum drehte<br />
reits darauf verständigt, die Zusammenarbeit<br />
über die Projektlaufzeit<br />
hinaus aufrechtzuerhalten, was sich<br />
unter anderem in dem vom IDS initiierten<br />
Tagungs- und Diskussionsnetzwerk<br />
„Diskurs-interdisziplinär“<br />
äußert. Eine Zusammenarbeit in anderen<br />
Projektzusammenhängen, so<br />
der Grundtenor der Arbeitstagung,<br />
wird von den Projektpartnern nicht<br />
ausgeschlossen.<br />
Konstantin Rometsch<br />
Agnes Laba<br />
sich zunächst um soziale Konstruktionen<br />
von Raumbildern, um „Mental<br />
Maps“ und um die verschiedenen<br />
sozialwissenschaftlichen und<br />
historiografischen Herangehensweisen<br />
an Raumkonzepte. Daran<br />
anschließend widmete sich die<br />
Masterclass einer Lektüreauswahl,<br />
die Miloš Havelka in Vorbereitung<br />
der Masterclass zusammengestellt<br />
hatte, darunter klassische Texte<br />
von Oskar Halecki (Europa – Grenzen<br />
und Gliederungen seiner Geschichte)<br />
und Paul Hazard (Krise<br />
des europäischen Geistes) sowie<br />
neuere Arbeiten von Larry Wolff (Inventing<br />
Eastern Europe), Jörg Döring<br />
und Tristan Thielemann (Spatial<br />
Turn).<br />
Christian Lotz<br />
Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> in Marburg ist eine der zentralen Einrichtungen der historischen und kulturwissenschaftlichen<br />
Ostmitteleuropaforschung in Deutschland.<br />
Zu den Tätigkeiten des <strong>Institut</strong>s zählt die Herausgabe mehrerer Schriftenreihen (Monografien, Tagungsbände,<br />
Quelleneditionen, Bibliografien, Bildmaterialien) in einem eigenen Verlag.<br />
Vor allem jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihre Promotionsschriften veröffentlichen möchten,<br />
können von der besonderen Nähe des Verlags zur Fachwissenschaft profitieren.<br />
Ihre Vorteile bei einer Veröffentlichung im Verlag des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s auf einen Blick:<br />
■ erhöhtes Renommee Ihres Werkes durch Aufnahme in eine international angesehene Schriftenreihe<br />
■ professionelles Lektorat und qualifizierte Beratung bei der Überarbeitung Ihrer Doktorarbeit für den Druck<br />
■ größtmögliche Wahrnehmung Ihres Werkes in der Fachwelt dank zielgruppen-spezifischer Werbung und<br />
aktiver Unterstützung des Open Access durch das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> und seinen Verlag<br />
■ geringe Druckkostenzuschüsse aufgrund der nicht-kommerziellen Ausrichtung des Verlags
„Gefällt mir“<br />
Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
bei Facebook<br />
Social Media-Angebote wie Facebook<br />
werden zunehmend auch von<br />
<strong>Institut</strong>ionen und Unternehmen genutzt,<br />
um sich zu präsentieren und<br />
mit Nutzerinnen und Nutzern in<br />
Kontakt zu treten.<br />
Um das Netzwerk ebenfalls als<br />
Kommunikations- und Werbemittel<br />
zu nutzen, ist das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
seit diesem Jahr mit einer<br />
Facebook-Fanpage präsent (www.<br />
facebook.com/<strong>Herder</strong><strong>Institut</strong>). Aktuelles<br />
kann hier gelesen, kommentiert<br />
und „geteilt“ werden. Wir<br />
informieren über unsere Veranstaltungen<br />
und Ausstellungen, und unsere<br />
Plakate und Broschüren können<br />
eingestellt werden. So prangte<br />
das <strong>Herder</strong>-Plakat zur Fußball-EM<br />
im Juni nicht nur in etlichen Marburger<br />
Kneipen, sondern auch auf<br />
unserer facebook-Seite.<br />
Die Seite ist öffentlich und somit<br />
auch für Interessierte ohne Facebook-Account<br />
einsehbar. Mit der<br />
Fanpage soll eine weitere Möglichkeit<br />
geschaffen werden, die<br />
Serviceangebote des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
wahrzunehmen und mit uns<br />
in Kontakt zu treten. Alle aktuellen<br />
Informationen und eine umfassende<br />
Vorstellung der <strong>Institut</strong>sangebote<br />
finden Sie natürlich auch weiterhin<br />
auf unserer <strong>Institut</strong>s-Homepage<br />
(www.herder-institut.de).<br />
Mandy Barke<br />
Städteatlas Schlesien:<br />
3D-Trailer bei YouTube<br />
Der mediale Wandel seit dem späten<br />
20. Jahrhundert eröffnet am<br />
Bildschirm neue gestalterische und<br />
kommunikative Formen. Im Falle<br />
unseres Historisch-topographischen<br />
Atlas schlesischer Städte ist<br />
es vor allem die zeitdynamische Visualisierung<br />
von Stadtentwicklung,<br />
die sich nun attraktiv darstellen<br />
lässt. Seit 2009 ist der Atlas online.<br />
Auf die oberschlesische Woiwodschaftshauptstadt<br />
Oppeln/Opole,<br />
unsere erste Stadt im Netz, folgte<br />
im März 2012 die Europastadt<br />
Görlitz/Zgorzelec. Neben der integrierten<br />
Verknüpfung von Karten,<br />
Bildern und Textdokumenten präsentieren<br />
wir hier Zeitungsartikel zur<br />
Stadtentwicklung nach 1945 aus<br />
dem Pressearchiv des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s.<br />
Außerdem fanden erstmals<br />
auch Filmausschnitte Eingang in<br />
das Atlasprojekt, so zum Oberlausitzer<br />
Sechsstädtebund, über die<br />
Gründerzeitviertel der Stadt und<br />
über den Görlitzer Vertrag von 1950<br />
zur neuen Grenze an Oder und Neiße.<br />
Ein in Zusammenarbeit mit dem<br />
<strong>Institut</strong> für Raumdarstellung (Frankfurt<br />
am Main) entwickelter 3D-animierter<br />
Trailer, der die Stadtentwicklung<br />
von Görlitz/Zgorzelec<br />
konzis zusammenfasst, führt eindrucksvoll<br />
in die Anwendung ein.<br />
Schicht um Schicht lassen sich<br />
auf der Grundlage der Topografie<br />
die Etappen der Stadtgeschichte<br />
vom 19.-21. Jahrhundert besonders<br />
anschaulich freilegen. Um diese<br />
Form der Visualisierung, die eine<br />
hohe Suggestionskraft auch für<br />
die wissenschaftliche Verwendung<br />
entfaltet, nun einem breiten Publikum<br />
zuzuführen und gleichzeitig<br />
die Bekanntheit des Atlasprojekts<br />
weiter zu erhöhen, wurde der Trailer<br />
unter dem Titel „Görlitz/Zgorzelec<br />
– Stadtentwicklung bis ins<br />
21. Jahrhundert“ im April auf dem<br />
Internet-Videoportal YouTube zunächst<br />
in deutscher Fassung eingestellt.<br />
Inzwischen wurde der Trailer<br />
in Kooperation mit dem Kulturhistorischen<br />
Museum der Stadt Görlitz<br />
weiterentwickelt. Seit dem 20. Juli<br />
wird er in polnischer, tschechischer<br />
und englischer Sprache in der neuen<br />
Dauerausstellung des Museums<br />
zur Geschichte der Stadt im<br />
Rahmen einer Medienstation präsentiert.<br />
So gehört er bereits zum<br />
festen Repertoire didaktischer Vermittlung<br />
von Stadtgeschichte.<br />
Wolfgang Kreft<br />
www.youtube.com/<br />
watch?v=NRmV1ZP4WIc<br />
www.herder-institut.de/staedteatlas-schlesien<br />
Wolfgang Kreft und Dariusz Gierczak<br />
während der Atlaspräsentation im Literaturcafé<br />
des Verlags Via Nova in Breslau<br />
am 24. April.<br />
13<br />
3D-Trailer zur<br />
Stadtentwicklung<br />
vom 12.–21. Jahrhundert<br />
als Einstieg<br />
in die Onlineanwendung<br />
zur Atlasstadt<br />
Görlitz/<br />
Zgorzelec
Bei der Onlinestellung<br />
von Bildern gehen die<br />
Kontextinformationen,<br />
wie z.B. Beschriftungen<br />
und Informationen<br />
auf Untersatzkartons,<br />
häufig verloren. Die<br />
Fotografie als eigenständiges<br />
Artefakt verschwindet.<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Bildarchiv, Slg. Drost,<br />
Inv.-Nr. 204436 und<br />
204437.<br />
Visual History. <strong>Institut</strong>ionen und Medien<br />
des Bildgedächtnisses<br />
Im Mai begann das durch die<br />
Leibniz-Gemeinschaft aus Mitteln<br />
des Pakts für Forschung und In-<br />
novation finanzierte Verbundprojekt<br />
„Visual History. <strong>Institut</strong>ionen<br />
und Medien des Bildgedächtnisses“.<br />
Gemeinsam mit dem federführenden<br />
Zentrum für Zeithistorische<br />
Forschung Potsdam, dem<br />
Georg-Eckert-<strong>Institut</strong> für internationale<br />
Schulbuchforschung<br />
in Braunschweig und dem Deutschen<br />
Museum in München wird<br />
nun während dreier Jahre Grundlagenforschung<br />
zu verschiedenen<br />
14<br />
<strong>Institut</strong>ionen des modernen Bildwesens<br />
betrieben.<br />
Die Einzelprojekte widmen sich<br />
der Frage nach der Rolle und Bedeutung<br />
staatlicher und privater<br />
bzw. privatwirtschaftlicher <strong>Institut</strong>ionen<br />
für die Konstitution kollektiver<br />
Bildgedächtnisse. Ihr gemeinsames<br />
Ziel ist es, nicht die „Gegenstände“<br />
kollektiven Bildwissens zu<br />
erforschen, sondern die <strong>Institut</strong>ionen,<br />
die diese Bilder generieren,<br />
verwalten, verwerten, archivieren<br />
und/oder publizieren bzw. die Produktion<br />
und Verbreitung bestimmter<br />
Bilder verhindern. Darüber hinaus<br />
soll unter www.visual-history.<br />
de ein Onlineportal eingerichtet<br />
werden, das als Informations- und<br />
Vernetzungsplattform fungiert und<br />
enzyklopädisches Wissen zu den<br />
<strong>Institut</strong>ionen des modernen Bildwesens<br />
bereitstellt.<br />
Das Teilprojekt am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
beschäftigt sich mit den Chancen<br />
und Problemen historischer<br />
Bildarchive im digitalen Zeitalter.<br />
Denn der sich durch die massenhafte<br />
Digitalisierung von Bildern<br />
und deren Bereitstellung im Internet<br />
rasant wandelnde Umgang mit<br />
Bildquellen in der Geschichts- und<br />
Kulturwissenschaft stellt Bildarchive<br />
vor neue Herausforderungen.<br />
So ersetzt die uneingeschränkte<br />
Verfügbarkeit von Bildern im<br />
Netz zunehmend den Gang ins<br />
„analoge“ Archiv. Durch die Präsentation<br />
von Bildsammlungen<br />
im Internet und die Bildung eines<br />
digitalen Bildkanons geraten jedoch<br />
nichtdigitalisierte Materialien<br />
in den Archiven zunehmend<br />
aus dem Blickfeld. Daher müssen<br />
die Auswahlkriterien für die Digitalisierung<br />
kritisch reflektiert werden.<br />
Hinzu kommt, dass das Bereitstellen<br />
von Bildmaterial im Internet die<br />
Bildvorlage als Artefakt zunächst<br />
in den Hintergrund drängt, denn<br />
meistens ist zunächst nur das Motiv<br />
für die Nutzerinnen und Nutzer<br />
eines Onlineangebots sichtbar. Die<br />
Rückseiten beispielsweise mit ihren<br />
Beschriftungen werden unsichtbar.<br />
Ebenso verschwindet die<br />
Größe und die Haptik der digitalisierten<br />
Vorlage – Postkarte und<br />
großformatige Grafik nähern sich<br />
an. Dabei fordert die Wissenschaft<br />
seit einigen Jahren genau das Gegenteil:<br />
Die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte<br />
von Bildern<br />
ist wichtig, um sie als ernstzunehmende<br />
historische Quelle zu nutzen.<br />
Das Projekt soll untersuchen,<br />
wie Bildarchive/-sammlungen, die<br />
ihre Bestände online bereitstellen,<br />
mit der Problematik umgehen. Es<br />
soll Möglichkeiten eruieren, wie die<br />
Bilder auch im Netz als Artefakte<br />
wahrzunehmen sind und wie die<br />
Informationen, die ein herkömmlicher<br />
Archivbesuch bietet (Beschriftungen,<br />
fachliche Beratung,<br />
Verweise auf weitere Bestände),<br />
im Onlinearchiv kompensiert bzw.<br />
zu neuen Informationsangeboten<br />
ausgebaut werden können.<br />
Elke Bauer<br />
Projektstart „World War II – Everyday Life<br />
Under German Occupation“<br />
Im Mai 2012 erfolgte der offizielle<br />
Start des auf drei Jahre angelegten<br />
Forschungs- und Editionsprojekts<br />
„World War II – Everyday Life Under<br />
German Occupation. Der Zweite<br />
Weltkrieg – Alltag unter deutscher<br />
Besatzung“. Ziel des Projekts ist<br />
eine forschungsgestützte Edition<br />
von Quellen zur Alltagsgeschichte<br />
der Lokalbevölkerungen in den von<br />
der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg<br />
besetzten Gebieten. Das von<br />
der Leibniz Gemeinschaft geförderte<br />
Projekt vereinigt unter der Leitung<br />
von Prof. Dr. Peter Haslinger,<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, und Prof. Dr. Tatjana<br />
Tönsmeyer, Bergische Universität<br />
Wuppertal, Kooperationspart-
ner aus insgesamt 15 europäischen<br />
Ländern, die sich schwerpunktmäßig<br />
oder ausschließlich mit der Geschichte<br />
des Zweiten Weltkriegs<br />
befassen.<br />
Kurz nach dem offiziellen Projektstart<br />
fand in Berlin eine Auftakttagung<br />
statt, zu der alle Herausgeber<br />
und Länder-Expert/inn/en eingeladen<br />
waren, um über konzeptionelle<br />
und organisatorische Fragen<br />
zu diskutieren und der öffentlichen<br />
Vorstellung des Projekts im Dokumentationszentrum<br />
Topographie<br />
des Terrors beizuwohnen (siehe<br />
unseren Bericht auf Seite 10 ). Die<br />
Quellenedition wird sich in mehrere<br />
Bände mit thematischen Schwerpunkten<br />
gliedern, die die strukturellen<br />
Rahmenbedingungen des<br />
Alltags in den besetzten Gebieten<br />
sowie die daraus resultierenden Erfahrungen<br />
der Lokalbevölkerungen<br />
dokumentieren sollen. Die Edition<br />
wird in englischer Sprache erscheinen.<br />
Neben der Printausgabe ist<br />
auch eine digitale Edition geplant,<br />
die die Quellen sowohl in englischer<br />
Übersetzung als auch in der jeweiligen<br />
Originalsprache präsentiert.<br />
Die Quellenedition wird Defizite in<br />
der Forschung und Dokumentation<br />
beheben und neue Wege in der Historiografie<br />
des Zweiten Weltkriegs<br />
aufzeigen.<br />
Daniela Kraus<br />
HerBalt – Hereditas Baltica:<br />
Ein deutsch-estnisches Archivprojekt<br />
und seine Fortschritte<br />
„HerBalt – Virtueller Lesesaal für<br />
baltisches Archivgut“ ist ein Projekt<br />
aus der Dokumentesammlung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s und zielt auf<br />
eine virtuelle Zusammenführung<br />
von Archivalien und deren Bereitstellung<br />
im Internet, um so neue<br />
Möglichkeiten für Forschungen zu<br />
eröffnen und auch gemeinsame<br />
Forschungsvorhaben ortsunabhängig<br />
durchzuführen.<br />
Unter Federführung des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s wirken auf deutscher Seite<br />
die Deutschbaltische Genealogische<br />
Gesellschaft (Darmstadt),<br />
weitere private Förderer sowie der<br />
Bundesbeauftragte für Kultur und<br />
Medien zusammen. Vertragspartner<br />
auf estnischer Seite ist das Estnische<br />
Historische Staatsarchiv in<br />
Tartu.<br />
Das Projekt wurde im Rahmen<br />
der Feiern zum 90. Geburtstag des<br />
Estnischen Historischen Archivs im<br />
Mai 2011 (vgl. <strong>Herder</strong>-aktuell Nr.<br />
32/33, S. 10) gestartet. Dabei wurde<br />
auf zwei wichtige Beweggründe<br />
für dieses Projekt hingewiesen:<br />
Es geht 1. um die Bewahrung und<br />
Pflege des kulturellen Erbes durch<br />
Schonung der archivischen Originale<br />
und 2. um die Möglichkeit, den<br />
Zugang zu diesem kulturellen Erbe<br />
unabhängig vom Ort des Bearbeiters<br />
leicht und rasch zu gewähren.<br />
Konkret wurden im Berichtszeitraum<br />
im Historischen Archiv in Tartu<br />
ca. 45.000 Blatt digitalisiert. Das<br />
Archiv stellte die Digitalisate nach<br />
und nach in das weltweit recherchierbare<br />
Archivportal „Saaga“ mit<br />
Hinweis auf „HerBalt“ ein. Die Digitalisate<br />
werden in Tartu daneben<br />
auch für die in Archiven<br />
übliche Langzeitarchivierung<br />
bearbeitet.<br />
Im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> wurde<br />
begonnen, die Verzeichnungstexte<br />
aus<br />
Estland in die DSHI-<br />
Archiv-Datenbank einzugeben,<br />
dabei aber,<br />
wo möglich und sinnvoll,<br />
mit Informationen<br />
anzureichern (Ergänzungen<br />
der Titel, Angaben<br />
zu Laufzeit und<br />
Umfang). Dies war bei<br />
einem ersten Arbeitstreffen<br />
der beiden deutschen<br />
und beiden estnischen<br />
Projektleiter im November<br />
2011 im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> als Ziel vereinbart<br />
worden. In der Dokumentesammlung<br />
wurden jene Materialien<br />
herausgesucht, die Ende 2012 und<br />
Anfang 2013 aus den Beständen<br />
der DSHI digitalisiert werden sollen.<br />
Sie kommen aus dem Bestand<br />
der Landtagsprotokolle der Estländischen<br />
Ritterschaft (19. Jh.). Es ist<br />
vorgesehen, bei einem zweiten Arbeitstreffen<br />
im Oktober 2012 in Tartu<br />
eine erste Bilanz zu ziehen und<br />
einige Fragen für den letzten Teil<br />
der Projektlaufzeit zu besprechen.<br />
Insbesondere dient das Treffen der<br />
Vorbereitung der abschließenden<br />
Fachtagung, die im Frühjahr 2013<br />
in Alatskivi bei Tartu stattfinden<br />
wird. Sie soll die Erfahrungen aus<br />
der gemeinsamen Arbeit in einem<br />
allgemeinen archivwissenschaftlichen<br />
und archivgeschichtlichen<br />
Rahmen diskutieren – unter Einbeziehung<br />
von Forschern, die sich in<br />
ihren Recherchen auf das genannte<br />
Material bezogen haben oder noch<br />
beziehen wollen.<br />
Dorothee M. Goeze<br />
15<br />
Eingangsseite zum<br />
sog. Törnearchiv<br />
in Saaga
Seite aus dem neu<br />
erworbenen Fotoalbum<br />
Hans Friedrich<br />
Hübners<br />
Propagandapostkarte<br />
über den<br />
Danziger Korridor<br />
aus der Sammlung<br />
Jaworski<br />
Zugänge wichtiger zeithistorischer<br />
Bildmaterialien im Bildarchiv<br />
Seinem Erwerbungskonzept entsprechend<br />
hat sich das Bildarchiv<br />
im zurückliegenden Jahrzehnt stärker<br />
um die Übernahme jüngerer,<br />
zeithistorischer Materialien sowie<br />
– neben kunsthistorischen und landeskundlichen<br />
Motiven – auch alltagsgeschichtlich<br />
relevanter Bildquellen<br />
bemüht. So ergab sich in<br />
jüngster Zeit mehrfach die Möglichkeit<br />
zum Erwerb verschiedener<br />
hoch interessanter Bestände aus<br />
Privatbesitz.<br />
Von Prof. Rudolf Jaworski (Kiel)<br />
etwa konnte eine Kollektion von<br />
870 wertvollen historischen Postkarten<br />
aus dem frühen 20. Jahrhundert<br />
(Schwerpunkt Zwischenkriegszeit)<br />
übernommen werden,<br />
die eine Ergänzung zu dem bereits<br />
in 2010 von ihm abgegebenen<br />
Konvolut von rund 1000 Karten<br />
darstellt. Die Motive der sehr<br />
gezielt gesammelten, hervorragend<br />
erhaltenen Postkarten aus Polen,<br />
der Tschechoslowakei und Ungarn<br />
sowie auch aus Deutschland zeigen<br />
politische Ikonografie und vor<br />
allem rivalisierende nationale Propaganda<br />
aus der Zeit des Ersten<br />
Weltkriegs, der Ersten Tschechoslowakischen<br />
Republik sowie der<br />
Zweiten Polnischen Republik. Themen<br />
sind nationale Symbole und<br />
Wappen, Ereignisse und Gedenktage,<br />
Persönlichkeiten und Patrone,<br />
Vereine, Monumente. Einen besonderen<br />
Teilbestand bilden deutsche<br />
16<br />
Revisionskarten sowie Postkarten<br />
mit propagandistischen politischen<br />
Landkartenmotiven. Dieses junge<br />
Massenmedium war mit seiner<br />
künstlerisch-visuellen und sprachlichen<br />
Argumentation und Rhetorik<br />
ein besonders erfolgreiches<br />
Kommunikationsmittel – gerade im<br />
Kontext politisch-gesellschaftlicher<br />
Agitation der ersten Jahrzehnte des<br />
20. Jahrhunderts.<br />
Durch Vermittlung von Prof. Jaworski<br />
konnten des Weiteren ein<br />
Fotoalbum mit privaten Aufnahmen<br />
des 1939 am „Polenfeldzug“ beteiligten<br />
Leutnants der Wehrmacht<br />
Hans Friedrich Hübner sowie Teile<br />
eines Fotoalbums mit Aufnahmen<br />
derselben Person aus Südmähren<br />
1938 angekauft werden (zusammen<br />
111 Fotos und 4 Postkarten); beide<br />
Bildserien sind mit handschriftlichen<br />
Erläuterungen versehen.<br />
Durch diese aus privater Perspektive<br />
aufgenommenen Fotografien<br />
werden Verlauf der Eroberungen<br />
und Kriegshandlungen in besonde-<br />
rer Weise erfahrbar – außerhalb der<br />
offiziellen NS-Kriegspropaganda. In<br />
ähnlicher Weise zeigt ein von Dr.-<br />
Ing. Paul-Georg Custodis (Mainz)<br />
dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> überlassener<br />
Bestand von über 1000 Tag genau<br />
datierten Aufnahmen (30 KB-Filme,<br />
sechs Alben mit Abzügen und<br />
Postkarten) aus der Produktion seines<br />
Vaters Dr. August Custodis das<br />
Alltagsleben in Ungarn von 1941-<br />
43. Der deutsche Geologe hat im<br />
Auftrag der Firma Seismos GmbH<br />
Hannover auf der Suche nach Erdöl-<br />
und Erdgasvorkommen das<br />
Land bereist und für sich unter unterschiedlichsten<br />
Gesichtspunkten<br />
fotografisch dokumentiert, was ergänzt<br />
werden kann um persönliche<br />
Berichte aus den erhaltenen Briefen<br />
an die Familie.<br />
Neben diesen sehr seltenen<br />
Quellen ist noch eine größere Zahl<br />
von Fotografien und vor allem von<br />
Postkarten aus ehemaligen Heimatsammlungen<br />
an das Bildarchiv<br />
abgegeben worden, von denen
die 225 historischen Ansichtskarten<br />
zu Lodz, Mittelpolen und Galizien<br />
(Sammlung Effenberger) sowie<br />
die 265 Fotos und Postkarten<br />
zu Schlesien (aus dem Archiv des<br />
Heimatkreises Lüben) besonders<br />
erwähnenswert sind. Diese Bildmaterialien<br />
sind Zeugnisse des kollektiven<br />
Bildgedächtnisses ehemaliger<br />
Bewohner der historischen deutschen<br />
Ost- und Siedlungsgebiete,<br />
Im März 2012 wurde der wissenschaftliche<br />
Nachlass der im Oktober<br />
2011 überraschend verstorbenen<br />
Schlesienforscherin Dr. h.c.<br />
Angelika Marsch (Hamburg) ins<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> übernommen. Es<br />
handelt sich um die Bibliothek sowie<br />
um umfangreiche Arbeitsmaterialien,<br />
die allen ihren Forschungsgebieten,<br />
insbesondere aber der<br />
Kulturgeschichte Schlesiens und<br />
der Ansichtengrafik gewidmet sind<br />
(originale historische Grafik, Fotos,<br />
Postkarten, Reproduktionen und<br />
Kopien aller Art, Bücher, darunter<br />
Rara, Manuskripte und Typoskripte,<br />
Dateien, Datenbanken sowie<br />
Digitalisate). Ihre bedeutendsten<br />
Publikationen der jüngeren Zeit waren<br />
die Reisebilder des Pfalzgrafen<br />
Ottheinrich (2001) und der Corpusband<br />
zum topografischen Werk von<br />
Friedrich Bernhard Werner (2010).<br />
Die sehr heterogenen wissenschaftlichen<br />
Materialien von Frau<br />
Marsch werden gegenwärtig gesichtet<br />
und verzeichnet sowie die<br />
unter konservatorischen Gesichtspunkten<br />
als besonders sensibel zu<br />
bezeichnenden Einheiten (etwa Negative,<br />
Diapositive, Rara) separiert,<br />
um eine sachgerechte Aufbewahrung<br />
zu gewährleisten. Mit der Dokumentation<br />
und Aufbereitung des<br />
Nachlasses soll mittelfristig auch<br />
die Nutzung der Materialien für Forschungszwecke<br />
ermöglicht werden.<br />
Ergebnis der ersten Schritte der<br />
Erschließung soll zudem ein Konzept<br />
für die weitere Bearbeitung<br />
die nach der Vertreibung den Heimatverlust<br />
durch Anlegen solcher<br />
Sammlungen (oft im Rahmen von<br />
landmannschaftlich organisierten<br />
Heimatstuben) in Teilen kompensiert<br />
haben. Derartige Materialien<br />
sind inzwischen unter dem Gesichtspunkt<br />
der Erinnerungskultur<br />
ebenso ein wichtiger Gegenstand<br />
kulturwissenschaftlicher Forschungen<br />
wie die privaten Fotoalben<br />
Nachlass von Dr. Angelika Marsch<br />
ins <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> übernommen<br />
des Nachlasses mit Schwerpunkt<br />
auf den Bildmaterialien sowie den<br />
historischen Ansichten zu Schlesien<br />
sein. Von besonderer Bedeutung<br />
ist hier ein Vorhaben, das seinerzeit<br />
unter maßgeblicher Mitwirkung<br />
von Angelika Marsch vorbereitet<br />
und durchgeführt<br />
wurde. Dieses Projekt<br />
zu historischen Ansichten<br />
aus der Grafiksammlung<br />
Haselbach<br />
wurde in den Jahren<br />
2005-2007 vom <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
dem Schlesischen<br />
Museum, dem<br />
Kunstforum Ostdeutscher<br />
Galerie Regensburg<br />
sowie dem Architekturmuseum<br />
Breslau<br />
getragen. Frau Dr.<br />
Marschs lang gehegter<br />
Wunsch war ein Folgeprojekt<br />
über die gesamten<br />
in der Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
sowie nach Möglichkeit<br />
auch in Polen nachweisbaren<br />
Bestände an<br />
topografischen Ansichten<br />
zu Schlesien. Mehrfach<br />
hatte sie dieses Vorhaben an<br />
das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> und das Schlesische<br />
Museum zu Görlitz herangetragen.<br />
Von Seiten des Schlesien-<br />
Museums sollten dabei die bereits<br />
früher in Zusammenarbeit mit Frau<br />
Marsch erstellten und auf ihren Vorarbeiten<br />
beruhenden Datensätze<br />
zur topografischen Schlesiengrafik<br />
eingebracht werden. Die Bear-<br />
einzelner Personen bzw. Familien.<br />
Das Bildarchiv des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
verfügt inzwischen über eine ganze<br />
Reihe solcher in Art um Umfang<br />
sehr unterschiedlichen Sammlungen.<br />
Ein besonderer Fall ist dabei<br />
das in 2011 abgegebene, komplett<br />
aufbereitete Bildarchiv des Heimatkreises<br />
Pyritz e.V., zu dem in jüngster<br />
Zeit noch Ergänzungen gemacht<br />
wurden.<br />
beitung und Onlinepräsentation der<br />
historischen Ansichten sollte unter<br />
Federführung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
erfolgen.<br />
Ausgehend von den laufenden<br />
Sichtungsarbeiten werden dann<br />
auch die wissenschaftliche Aus-<br />
wertung und weitere (digitale) Aufbereitung<br />
des für die historische<br />
Schlesienforschung hochinteressanten<br />
Bestandes in Zusammenarbeit<br />
mit dem Schlesischen Museum<br />
zu Görlitz und der Historischen<br />
Kommission für Schlesien geplant.<br />
Dietmar Popp<br />
17<br />
Kolorierte<br />
Radierung von<br />
Schloss Freyhan<br />
bei Militsch aus<br />
einem Sammelblatt<br />
von<br />
F.B. Werner, Mitte<br />
18. Jh., aus der<br />
Privatsammlung<br />
von Angelika<br />
Marsch
Käte Machts,<br />
1919-2010<br />
Wertvolle Neuerwerbungen von Archivgut<br />
Im ersten Halbjahr 2012 konnte die<br />
Dokumentesammlung, das klassische<br />
Archiv im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, wieder<br />
zahlreiche Neuerwerbungen tätigen,<br />
von denen viele als Geschenk,<br />
andere als Deposita (Dauerleihgaben)<br />
übergeben wurden. An dieser<br />
Stelle soll auf die größten und bedeutendsten<br />
Bestände hingewiesen<br />
werden, die aus Privatbesitz angekauft<br />
werden konnten. Dazu gehören<br />
die Archive zweier deutschbaltischer<br />
Adelsfamilien und der Nachlass eines<br />
Ostpreußen- und Königsberg-<br />
Forschers:<br />
Da ist einmal das Familienarchiv<br />
Nothelffer/Rautenfeld. Während die<br />
Familie v. Rautenfeld bis in die Gegenwart<br />
„blüht“, gilt die Familie v.<br />
Nothelffer als eine „erloschene“ Familie,<br />
umso wichtiger sind die nun in<br />
der DSHI verfügbaren Teile des Familienarchivs.<br />
Die Familie Nothelffer<br />
stammte ursprünglich aus der Pfalz<br />
und kam im 17. Jh. nach Livland –<br />
meist als Pastoren, später auch in<br />
zivilen wie militärischen Ämtern.<br />
Die Familie erwarb 1785 bei Kaiser<br />
Josef II. in Wien das Adelsdiplom.<br />
Danach musste sie sich in der Heimat<br />
um Anerkennung bemühen:<br />
1786 erfolgte die Eintragung in das<br />
Livländische Gouvernements-Adels-<br />
Geschlechtsbuch, 1797 – nach nur<br />
Vorbildliches Mäzenatentum<br />
Das Vermächtnis von Käte Machts (1919-2010) aus Ostpreußen<br />
Einer testamentarischen Verfügung<br />
ist zu danken, dass die Dokumentesammlung<br />
(DSHI) im Berichtszeitraum<br />
das deutschbaltische Familienarchiv<br />
Nothelffer/Rautenfeld<br />
und den Nachlass des Königsbergforschers<br />
Herbert Meinhard Mühlpfordt<br />
ankaufen konnte (vgl. unseren<br />
Bericht in diesem Heft). Möglich<br />
wurden diese Ankäufe (weitere können<br />
in den nächsten zwei Jahren<br />
noch folgen) durch ein großzügiges<br />
Vermächtnis von Frau Käte Machts,<br />
geb. Quehl, die 1919 in Tiefen, Kr.<br />
18<br />
elf Jahren Wartezeit – folgte das livländische<br />
Indigenat, die höchste<br />
mögliche Rangerhöhung im Baltikum.<br />
Die archivische Überlieferung<br />
der Familie v. Nothelffer gelangte<br />
durch eine 1809 erfolgte Heirat an<br />
die Familie v. Rautenfeld.<br />
Wappen der Familie von Nothelffer<br />
(DSHI 110 Nothelffer/Rautenfeld 01)<br />
Da ist zum anderen das Familienarchiv<br />
Tiesenhausen, von dem einige<br />
Teile angekauft werden konnten. Dazu<br />
gehören überwiegend Nachlasssachen<br />
von Pastoren aus der Familie<br />
v. Tiesenhausen, aber auch genealogische<br />
Materialien, Porträts, Lebensbilder<br />
und Unterlagen aus der Arbeit<br />
des Familienverbandes. Beide Familienarchive<br />
werden noch verzeichnet<br />
und archivtechnisch bearbeitet.<br />
Lötzen (Ostpreußen) geboren wurde<br />
und die 2010 in Lahntal bei Marburg<br />
gestorben ist. Seit langer Zeit<br />
war es ihr ein besonderes Anliegen,<br />
dass die persönlichen Unterlagen<br />
von Familien und Einzelpersonen<br />
aus den ehemaligen deutschen<br />
Ostgebieten vor Vernichtung oder<br />
Zerstreuung bewahrt würden – zum<br />
Nutzen künftiger Forschung. Aus<br />
diesem Grunde nahm Käte Machts<br />
seit den 1980er Jahren regen Anteil<br />
an der Arbeit der Dokumentesammlung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Als Drittes ist der 173 Archivalieneinheiten<br />
umfassende Nachlass<br />
von Herbert Meinhard Mühlpfordt zu<br />
nennen, der 1893 in Königsberg/Pr.<br />
geboren wurde und 1982 in Lübeck<br />
starb. Von Beruf Arzt, trat er nach<br />
seiner Pensionierung als Schriftsteller,<br />
vor allem aber als Heimatforscher<br />
für seine Heimatstadt Königsberg<br />
hervor. Neben umfangreichen<br />
Materialsammlungen und eigenen<br />
Manuskripten sind insbesondere<br />
seine ausgedehnten Briefwechsel<br />
mit nach 1945 noch lebenden Zeitzeugen<br />
hervorzuheben, wodurch<br />
unendlich viele Gegebenheiten in<br />
Königsberg vor dem Vergessen bewahrt<br />
wurden. Mühlpfordt nutzte<br />
diese Quellen schon selbst für seine<br />
Artikel und Bücher, die zu den Standardwerken<br />
der Königsbergliteratur<br />
gehören.<br />
Mit diesen Neuerwerbungen hat<br />
die Dokumentesammlung wertvolle<br />
primäre Forschungsmaterialien gesichert<br />
und an zentraler Stelle zugänglich<br />
gemacht. Der Ankauf der beiden<br />
deutschbaltischen Familienarchive<br />
dient zudem dem weiteren Ausbau<br />
des Sammlungs- und Arbeitsprofils<br />
„baltische Geschichte im Archiv“.<br />
Peter Wörster<br />
und förderte deren Arbeit schon zu<br />
Lebzeiten. Diese Förderung hat sie<br />
selbst durch ihre testamentarische<br />
Verfügung um ein Vielfaches übertroffen.<br />
Zum Dank werden alle Archivalieneinheiten,<br />
die aus Mitteln<br />
dieser Erbschaft erworben werden<br />
können, mit einem entsprechenden<br />
Aufdruck versehen, um so das Andenken<br />
an die edle Spenderin auch<br />
späteren Generationen, die diese<br />
Bestände benutzen werden, zu bewahren.<br />
Peter Wörster
Der „Tag der Archive“ in Marburg:<br />
Feuer, Wasser, Krieg und<br />
andere Katastrophen<br />
Unter dem zitierten Motto trafen<br />
sich am 4. März 2012 insgesamt<br />
16 Archive und archivische Einrichtungen<br />
im Hessischen Staatsarchiv<br />
zu dem alle zwei Jahre regelmäßig<br />
stattfindenden „Tag der Archive“.<br />
Die Archive, zu denen auch die<br />
Dokumentesammlung des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s (DSHI) gehört, gaben Einblick<br />
in ihre Bestände und ihre laufenden<br />
Aufgaben und Arbeiten. Dorothee<br />
M. Goeze M.A. und Dr. Peter<br />
Wörster berichteten den mehr als<br />
400 Besuchern über die Arbeit des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s und das von ihnen<br />
betreute größte Archiv zur baltischen<br />
Geschichte in Deutschland,<br />
das jährlich von zahlreichen<br />
Benutzern – nicht zuletzt auch aus<br />
den baltischen Staaten Estland und<br />
Lettland – aufgesucht wird.<br />
Nachrichten aus den LOEWE-Projekten<br />
Dorothee M. Goeze und Peter Wörster am Stand der Dokumentesammlung im Gespräch<br />
mit Besuchern<br />
„Lesen, Schreiben,<br />
Erzählen – digital und vernetzt“<br />
Abschlusskonferenz des LOEWE-Schwerpunkts<br />
„Kulturtechniken und ihre Medialisierung“<br />
Seit bald vier Jahren untersucht der<br />
LOEWE-Schwerpunkt „Kulturtechniken<br />
und ihre Medialisierung“, wie<br />
sich kommunikative Kulturtechniken<br />
im 20. und 21. Jahrhundert<br />
durch moderne, insbesondere digitale<br />
Medien verändern. Zum Ende<br />
des vierten und letzten Förderjahres<br />
fand vom 28.-30. Juni 2012<br />
im Senatssaal der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen die Abschlusstagung<br />
des LOEWE-Schwerpunkts<br />
statt. Diese stellte die kommunikativen<br />
Kulturtechniken des Lesens,<br />
Schreibens und Erzählens ins Zentrum.<br />
Wie sich diese Kulturtechniken<br />
durch mediale Transformati-<br />
onen als Prozesse verändern und<br />
wie sich diese Veränderungen auf<br />
die kulturellen Produkte auswirken,<br />
untersuchte die Tagung in drei<br />
Sektionen: „Lesen und Schreiben“,<br />
„Lehren und Lernen“, „Erzählen –<br />
faktual und fiktional“. Die einzelnen<br />
Sektionen widmeten sich dabei folgenden<br />
Fragen: Wie verändern digitale<br />
Medien Lese-, Schreib- und<br />
Erzählprozesse? Wie verändern<br />
sich Lese-, Schreib- und Erzählformen<br />
unter dem Einfluss digitaler<br />
Medien? Welche medial bedingten<br />
neuen Formen entstehen? Wie<br />
lassen sich Lese- und Schreiberwerbsprozesse<br />
medial unterstützen<br />
bzw. medienspezifische Schreib-<br />
und Lesekompetenzen vermitteln?<br />
Den Auftaktvortrag gestaltete<br />
Olaf Breidbach (Jena) über „Wissen<br />
im Netz“. Entgegen gängigen Vorstellungen<br />
von der unbegrenzten<br />
Freiheit und freier Assoziierbarkeit<br />
des Wissens im Netz vertrat er die<br />
Auffassung, dass dieses Wissen<br />
nur scheinbar „frei“ sei. Der Begrifflichkeit<br />
der offenen Wissensgesellschaft<br />
stand er skeptisch gegenüber.<br />
Er verwies auf Kontinuitäten<br />
und Traditionen von logischen Zuordnungen,<br />
die auch im Netzzeitalter<br />
wirksam seien und Innovationen<br />
eher entgegenwirkten.<br />
19
Die Sektion über „Lesen und<br />
Schreiben“ begann mit Annina Klappert<br />
(Erfurt), die sich mit „Schreiben<br />
mit Zettel und Link“, d.h. Schreibprozessen<br />
vor dem Schreiben beschäftigte.<br />
Für die exzerpierenden<br />
und sortierenden Vorarbeiten werden<br />
heute vielfach elektronische<br />
Systeme wie Citavi oder Bibliografix<br />
verwendet. Für die Auswahl solcher<br />
Vorvertextungshilfen sei es sinnvoll,<br />
vergleichend auch analoge Systeme<br />
wie das Prinzip des Zettelkastens<br />
von Niklas Luhmann genau zu<br />
studieren, da man sich doch beim<br />
wissenschaftlichen wie auch literarischen<br />
Schreiben auf mehrere Jahre<br />
festlege.<br />
Maja Bärenfänger (Gießen) referierte<br />
zu „Leser(brief)kommunikation<br />
im digitalen Wandel“. Dabei ging<br />
sie der Frage nach, ob die Kommunikation<br />
durch die Nutzung digitaler<br />
Medien dialogischer geworden<br />
ist. Während Leserbriefe immer<br />
noch eine in die Pressekommunikation<br />
eingebundene kommunikative<br />
Funktion darstellen, bei der mit<br />
zeitlicher Verzögerung eine gefilterte<br />
Reaktion veröffentlicht wird, sind<br />
Leserkommentare kurzfristige Reaktionen<br />
auf Beiträge anderer Leser.<br />
Zeitungsredaktionen schalten<br />
sich kaum in die Leserkommentarfunktionen<br />
ein, zumindest geben<br />
sie sich nicht so leicht als solche<br />
zu erkennen, denn eine Klarnamenpflicht<br />
wie beim gedruckten Leserbrief<br />
bestehe hier nicht.<br />
Jana Klawitter (Gießen) stellte<br />
„Kategorisierungen in webbasierter<br />
Wissenschaftskommunikation:<br />
Metaphernkonzepte und Denkkollektive“<br />
vor. Sie zeigte das Potential<br />
der Konzeptuellen Metapherntheorie<br />
sowie der Idealized Cognitive<br />
Models (ICM) zur Aufdeckung von<br />
wissenschaftlichen Denkkollektiven<br />
anhand von Kategorisierungen in<br />
webbasierter Wissenschaftskommunikation.<br />
Modelle und Theorien<br />
der Kognitiven Semantik wurden<br />
hierfür mit der wissenschaftstheoretischen<br />
Methodologie der Denkstile<br />
und Denkkollektive nach Ludwik<br />
Fleck (1896-1961) in Beziehung<br />
gesetzt.<br />
20<br />
„Volltextsuche und der philologische<br />
Habitus“ waren Gegenstand<br />
des Vortrages von Mirco Limpinsel<br />
(Berlin). Die Philologie als „Erkenntnis<br />
des Erkannten“ steht mit ihrer<br />
selektionslosen Neugier am Lesbaren<br />
und der enzyklopädischen Bildung<br />
dem technisch Möglichen der<br />
Volltextsuche im Computer grundsätzlich<br />
entgegen. Fraglich bleibt<br />
hier, wie der philologische Habitus,<br />
der sich auf Taktgefühl, Spürsinn<br />
und weitere nicht erlernbare Kompetenzen<br />
bezieht, auf die Anforderungen<br />
des digitalen Zeitalters reagieren<br />
wird.<br />
Die zweite Sektion „Erzählen –<br />
faktual und fiktional“ führte Peter<br />
Hoeres (Gießen) an. Sein Beitrag<br />
„Public History online – Geschichte<br />
digital erzählen“ berichtete aus einem<br />
Seminar, in dem Studierende<br />
historische Artikel für wikipedia verfassten<br />
und bestehende Artikel änderten<br />
bzw. zu ändern versuchten.<br />
An die Grenzen stieß das Projekt<br />
bei prominent besetzten Themen,<br />
die ein änderungsresistentes Autorenteam<br />
unter sich aufgeteilt zu haben<br />
scheint. Wachsende Zugriffsrechte<br />
entstehen, so die Erfahrung,<br />
nicht durch qualitativ hochwertige<br />
und dem neusten Forschungsstand<br />
entsprechende Artikel, sondern<br />
durch die schiere Menge des<br />
ins Netz Gestellten.<br />
Rebecca Hagelmoser und Jonas<br />
Ivo Meyer (beide Gießen) referierten<br />
gemeinsam über „Corporate Identity<br />
und Storytelling auf Social Network<br />
Sites. Wie sich Marketingstrategien<br />
und -techniken durch das<br />
Aufkommen von Social Media verändern“.<br />
Die Technik des Corporate<br />
Storytelling hat sich mit dem<br />
Eintritt in Social Media stark verändert<br />
und die zunehmende Wichtigkeit<br />
von Social Media führt zu einer<br />
notwendigen Anpassung der<br />
Marketingstrategien und Techniken<br />
von Unternehmen an die digitale<br />
Medienumgebung. Gab es bisher<br />
noch den kurzen Werbefilm oder<br />
die Anzeige, benötigt man heute<br />
schon Gewinnspiele, eingebettet in<br />
witzige Geschichten, oder interaktive<br />
Anwendungen, um von den Re-<br />
zipienten „geliked“ und geteilt, also<br />
an „Freunde“ weiterempfohlen<br />
zu werden.<br />
Der Plenarvortrag von Roberto<br />
Simanowski (Basel) über „Elektronische<br />
Bücher und digitale Helden:<br />
Zum produktions- und rezeptionsästhetischen<br />
Umbau des Narrativen<br />
in neuen Medien“ beendete die<br />
zweite Sektion der Tagung. Mit der<br />
Vorstellung von „Twitteratur“ bis zur<br />
Timeline bei facebook, dem „Tagebuch<br />
des 21. Jahrhunderts“, präsentierte<br />
sich ein breites Spektrum<br />
an Lesemöglichkeiten in den neuen<br />
Medien, die alle dazu beitragen<br />
können und auch werden, von einer<br />
konzentrierten und unabgelenkten<br />
Lektüre eines Textes abzukommen.<br />
Zum Abschluss des zweiten<br />
Konferenztages fand eine „ZMI-<br />
Wissenschaftslounge“ statt, ein<br />
Diskussionsformat zum Thema<br />
„Interdisziplinarität im Übermaß?<br />
Aktuelle Perspektiven und Herausforderungen<br />
interdisziplinärer<br />
Forschung“. Das Gießener Zentrum<br />
für Medien und Interaktivität<br />
(ZMI) stellte dabei die Frage:<br />
„Hat interdisziplinäres Forschen im<br />
deutschen Wissenschaftsbetrieb<br />
überhandgenommen?“ Moderiert<br />
wurde die Veranstaltung von dem<br />
Gießener Literaturwissenschaftler<br />
Prof. Joachim Jacob. Seine Gäste<br />
waren die Psychologin und Linguistin<br />
Prof. Gisela Klann-Delius<br />
(Freie Universität Berlin), der Techniksoziologe<br />
und Wissenschaftsphilosoph<br />
Prof. Wolfgang Krohn<br />
(Universität Bielefeld), der Politikwissenschaftler<br />
Prof. Claus Leggewie<br />
(Kulturwissenschaftliches <strong>Institut</strong><br />
Essen), die Philosophin Dr.<br />
Lisa Herzog (Universität St. Gallen)<br />
und Dr. Vera Szöllösi-Brenig, Referentin<br />
der Volkswagenstiftung. Sie<br />
diskutierten von ihrem jeweiligen<br />
Standpunkt in der Wissenschaftsforschung,<br />
der wissenschaftlichen<br />
Praxis und der Forschungsförderung<br />
diese kontroverse Frage.<br />
Am dritten Tag stand die Konferenz<br />
im Zeichen der dritten Sektion<br />
über „Lehren und Lernen“. Mit der<br />
Frage nach „Copy/paste a shat-
tered history? Das Erstellen von<br />
Geschichtsreferaten unter den Bedingungen<br />
narrativer Fragmentierung“<br />
bildete Jan Hodel (Aarau) den<br />
Auftakt. Seine Ausführungen stellen<br />
sich am Beispiel von zwei Abiturienten<br />
dar, die eine Hausarbeit<br />
über den Kalten Krieg erstellen sollen<br />
und sich dazu verschiedener<br />
digital möglicher Mittel bedienen.<br />
„Die Sprach(un)abhängigkeit von<br />
Textproduktionskompetenz: Trans-<br />
Personalien<br />
lation als Werkzeug der Schreibprozessforschung<br />
und Schreibdidaktik“<br />
war Thema des Referates<br />
von Susanne Göpferich und Bridgit<br />
Nelezen (beide Gießen). In einem<br />
Versuch wurde überprüft, wie sich<br />
die deutschsprachigen Versionen<br />
von englischen Texten, die Anglistik-Studierende<br />
selbst erstellt haben,<br />
von der textlinguistisch-rhetorischen<br />
Qualität der Ausgangstexte<br />
unterscheiden.<br />
Universität Wrocław ehrt leitende<br />
Mitarbeiter des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung<br />
„200 Jahre Universität<br />
Breslau – Uniwersytet Wrocławski<br />
1811-2011“ am 23. Februar 2012 in<br />
der Universitätsbibliothek Marburg<br />
wurde neben anderen deutschen<br />
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern<br />
dem Direktor des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s,<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger,<br />
und dem Leiter der Abteilung<br />
„Wissenschaftliche Sammlungen“,<br />
Dr. Dietmar Popp, die Bronzemedaille<br />
für besondere Verdienste<br />
um die Zusammenarbeit verliehen.<br />
Prof. Dr. Dr. Jan Harasimowicz,<br />
Professor für Kunstgeschichte und<br />
Direktor des Universitätsmuseums<br />
in Wrocław, bedankte sich damit,<br />
auch im Namen des Rektors Prof.<br />
Dr. Marek Bojarski, für die langjährige<br />
und erfolgreiche Kooperation<br />
mit dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>. Neben einer<br />
Reihe von gemeinsam durchgeführten<br />
Tagungen und Projekten,<br />
darunter vor allem das „Dehio-<br />
Handbuch der Kunstdenkmäler in<br />
Polen. Schlesien“ (2005/06) und der<br />
„Historisch-topographische Städteatlas<br />
von Schlesien“ mit seinen<br />
verschiedenen Bänden (seit 2010<br />
erscheinend), wurde von ihm auch<br />
die Förderung von Forschungsaufenthalten<br />
durch das <strong>Herder</strong>-Stipendienprogramm<br />
und die gemeinsame<br />
Betreuung einer Doktorandin<br />
der Kunstgeschichte hervorgeho-<br />
ben. Ein weiteres Beispiel erfolgreicher<br />
Kooperation sei die von Prof.<br />
Harasimowicz mit seinen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern aus dem<br />
Kunsthistorischen <strong>Institut</strong> vorbereitete<br />
Ausstellung „Das Bild von<br />
Wrocław/Breslau im Lauf der Geschichte“<br />
im Jahr 2009 in Marburg<br />
und Wiesbaden gewesen. Neben<br />
den ausgezeichneten und vielfältigen<br />
Kontakten des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
zu seinem <strong>Institut</strong> bestehen noch<br />
besonders enge Beziehungen zum<br />
Historischen <strong>Institut</strong>, zum Germanistischen<br />
<strong>Institut</strong>, zur Universitätsbibliothek<br />
und insbesondere zum<br />
Bereich der Spezialsammlungen<br />
(auf der Sandinsel) sowie schließlich<br />
zum Willy-Brandt-Zentrum für<br />
Deutschland- und Europastudien<br />
an der Universität Wrocław.<br />
Ansicht der bronzenen<br />
Verdienstmedaille der<br />
Universität Wrocław<br />
Insgesamt zeigte die Tagung in einem<br />
breiten Spektrum die innovativen<br />
Möglichkeiten der medialisierten<br />
Kulturtechniken Lesen,<br />
Schreiben und Erzählen auf. Sie<br />
lotete die Potenziale, aber auch<br />
die Grenzen der digitalen und vernetzten<br />
Lektüre, Erzählkultur und<br />
Schreibkompetenz aus.<br />
Antje Coburger<br />
21
Dietmar Popp<br />
Dietmar Popp zum Mitglied der<br />
Dehio-Vereinigung gewählt<br />
Am 19. Mai 2012 wurde der Leiter<br />
der Abteilung „Wissenschaftliche<br />
Sammlungen“ sowie Projektleiter<br />
des „Dehio-Handbuchs<br />
der Kunstdenkmäler in Polen“,<br />
Dr. Dietmar Popp, in die Dehio-Vereinigung<br />
(Wissenschaftliche Vereinigung<br />
zur Fortführung des kunsttopographischen<br />
Werkes von<br />
Georg Dehio e.V.) aufgenommen.<br />
Dieser seit 1958 als gemeinnütziger<br />
Verein für die Herausgabe (und<br />
sukzessive Überarbeitung) des von<br />
dem Kunsthistoriker und Denkmalpfleger<br />
Georg Dehio begründeten<br />
„Handbuchs der Deutschen Kunstdenkmäler“<br />
setzt sich aus Hochschullehrern,<br />
Landeskonservatoren<br />
und Fachleuten für Inventarisation<br />
an den deutschen und österreichischen<br />
Denkmalämtern zusammen.<br />
Aus dem Kreis der Mitglieder wer-<br />
22<br />
den die jeweiligen Redaktionsausschüsse<br />
gebildet, von denen die<br />
in Bearbeitung befindlichen Bände<br />
betreut werden. Die Vereinigung<br />
trägt die wissenschaftliche Gesamtverantwortung<br />
für das Handbuch,<br />
das im Deutschen Kunstverlag<br />
erscheint.<br />
Mit der Aufnahme in die Dehio-<br />
Vereinigung wurden die langjährigen<br />
Bemühungen von Dr. Popp<br />
und seinem Team im <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
um den „Dehio Polen“ anerkannt,<br />
dessen Pilotprojekt Schlesien galt<br />
(deutsche Version 2005, polnische<br />
Version 2006 erschienen) und dessen<br />
zweites Teilprojekt gegenwärtig<br />
der historischen Region Kleinpolen<br />
gewidmet ist, durchgeführt in Zusammenarbeit<br />
mit dem Kunsthistorischen<br />
<strong>Institut</strong> der Jagiellonen-Universität<br />
Kraków. Wie Herr Popp vor<br />
der Mitgliederversammlung ausführte,<br />
soll nach dem für 2013/14<br />
vorgesehenen Erscheinen dieses<br />
zweiten Bandes das langfristig angelegte<br />
Vorhaben in vier weiteren<br />
Etappen zu den übrigen Regionen<br />
Polens fortgeführt werden. Die Vorstellung<br />
des Konzepts und der Bericht<br />
über die Erfahrungen mit der<br />
deutsch-polnischen Kooperation<br />
wurde von den Mitgliedern ebenso<br />
positiv aufgenommen wie der<br />
Ausblick auf den geplanten digitalen<br />
Dehio, der als ein Online-Informationssystem<br />
der Kunstdenkmäler<br />
in Polen mit Verknüpfungen von<br />
Texten und Bildquellen sowie weiteren<br />
Materialien vorgesehen ist.<br />
Durch die Dehio-Vereinigung wurde<br />
die uneingeschränkte Unterstützung<br />
dieser wegweisenden Pionierarbeit<br />
zugesagt.<br />
Neues aus dem Team des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Alexandra Schweiger, seit Mai<br />
2011 mit einer halben Stelle als Koordinatorin<br />
für das Projekt „Digitaler<br />
Atlas Politischer Raumbilder<br />
zu Ostmitteleuropa“ (DAPRO) tätig<br />
und außerdem für die Onlineedition<br />
„Dokumente und Materialien zur<br />
ostmitteleuropäischen Geschichte“<br />
zuständig, ist seit 1. März 2012 in<br />
Elternzeit. Sie wird von Johanna<br />
Schnabel vertreten. Susanne Krüger,<br />
die bisherige Mediengestalterin<br />
im Verlag des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s,<br />
trat nach beinahe 34 Dienstjahren<br />
am 1. April 2012 in den Ruhestand<br />
ein. In der Bibliothek ist die<br />
Stelle des Fachangestellten für Medien-<br />
und Informationsdienste, die<br />
Alexander Handge bekleidet hat,<br />
zum 31. Januar 2012 ausgelaufen.<br />
Zum 1. Juli 2012 wird diese Aufgabe<br />
im Bereich Erwerbung von Peggy<br />
Semper wahrgenommen. Frau<br />
Semper hat ihre Ausbildung in der<br />
Stadtbibliothek Eilenburg absolviert<br />
und war bis zu ihrer Einstellung<br />
am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> dort als<br />
Mitarbeiterin tätig. Als Projektkoor-<br />
dinatorin im Forschungs- und Editionsprojekt<br />
„Der Zweite Weltkrieg.<br />
Alltag unter deutscher Besatzung“<br />
hat Daniela Kraus am 1. Mai ihre<br />
Arbeit aufgenommen. Frau Kraus<br />
hat Europäische Kulturgeschichte<br />
und Geschichte Westeuropas<br />
an den Universitäten Augsburg,<br />
Pisa, Kassel und Bern studiert.<br />
Nach einer medienwissenschaftlichen<br />
Masterarbeit verfasste sie eine<br />
noch unveröffentlichte Dissertation<br />
zur medialen Darstellung von<br />
Rechtspraktiken und Rechtsverständnis<br />
vom Beginn der Neuzeit<br />
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.<br />
Vor ihrer Einstellung am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
war sie beim Internationalen<br />
Suchdienst in Bad Arolsen mit der<br />
Durchführung eines internationalen<br />
Erschließungsprojekts der Konzentrationslagerbestände<br />
betraut.<br />
Anna Veronika Wendland ist zum<br />
1. Mai nach einem einjährigen Fellowship<br />
am Imre Kertész Kolleg in<br />
Jena an ihren Arbeitsplatz in der <strong>Institut</strong>sdirektion<br />
zurückgekehrt. Frau<br />
Wendland hat in Jena am Manu-<br />
skript ihrer Habilitationsschrift „Urbanität<br />
im Zeitalter der Extreme“<br />
gearbeitet, in deren Mittelpunkt die<br />
Städte Lemberg und Wilna im 20.<br />
Jahrhundert stehen, und Vorarbeiten<br />
zu ihrem neuen zeithistorischen<br />
Forschungsvorhaben über die<br />
„Atomstädte“ in der Ukraine, Russland<br />
und Litauen durchgeführt. Elke<br />
Bauer, die sie während der Freistellung<br />
vertreten hat, ist ebenfalls<br />
seit Anfang Mai Wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin im neu angelaufenen<br />
Projekt „Visual History. <strong>Institut</strong>ionen<br />
und Medien des Bildgedächtnisses“,<br />
wo sie sich mit den Strategien<br />
von Bildarchiven im Zeitalter<br />
der Online-Bereitstellung von Bildbeständen<br />
beschäftigt. Seit 6. Juni<br />
2012 befindet sich Wiebke Rohrer<br />
in Mutterschutz. Ihre Stelle im Wissenschaftsforum<br />
als Geschäftsführerin<br />
der Leibniz Graduate School<br />
for Cultures of Knowledge in Central<br />
European Transnational Contexts<br />
wird zum 1. September 2012<br />
neu besetzt.
Ehrung für Leiter der Forschungsbibliothek<br />
Dr. Jürgen Warmbrunn, Leiter der<br />
Forschungsbibliothek des <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>s, ist am 24. Mai 2012 durch<br />
die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft<br />
der Spezialbibliotheken<br />
(ASpB) / Sektion 5 im<br />
Deutschen Bibliotheksverband zu<br />
ihrem neuen Ehrenmitglied gewählt<br />
worden. Bereits am Tage zuvor war<br />
er in den Beirat der Arbeitsgemeinschaft<br />
kooptiert worden, dem er<br />
zuvor bereits einmal von 2003 bis<br />
2004 angehört hatte. Insbesondere<br />
durch seine Wahl zum Ehrenmitglied<br />
wurde seine achtjährige<br />
Tätigkeit – von 2004 bis 2012<br />
– als Vorsitzender der ASpB / Sektion<br />
5 im DBV gewürdigt. In dieser<br />
Zeit zeichnete er mit seinen beiden<br />
Vorstandskollegen für die Geschicke<br />
des größten Zusammenschlusses<br />
von Spezialbibliotheken<br />
Gäste am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Die Stipendiaten des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
unter unseren Gästen werden<br />
mit dem Titel ihres Forschungsvorhabens<br />
vorgestellt:<br />
<strong>Herder</strong>-Stipendiaten:<br />
Dr. Piotr Birecki, Chełmża (01.-<br />
28.02.) „Architektur der evangelischen<br />
Kirchen in Westpreußen 1772-1920“<br />
Zoltán Gyalókay M.A. Kraków (01.-<br />
28.02.) „Die Bildschnitzerei des 14.<br />
Jahrhunderts in Kleinpolen“<br />
Dr. Radoslav Štefančík, Senec<br />
(01.02.-31.03.) „Deutsche Antwort<br />
auf die Emigration aus der ,kommunistischen<br />
Hölle‘. Tschechische und<br />
slowakische Emigranten in Deutschland<br />
zwischen 1948-1989“<br />
Dr. Olga Sveshnikova, Bremen<br />
(01.02.-31.03.) „Archäologie und<br />
Gesellschaft: Vergleich der sowjetischen<br />
und ostmitteleuropäischen<br />
Erfahrungen“<br />
im deutschsprachigen Raum und<br />
der zweitgrößten Sektion des Deutschen<br />
Bibliotheksverbandes verantwortlich.<br />
In seinem Amt war er<br />
maßgeblich an der Organisation<br />
und der inhaltlichen Konzeptionierung<br />
der alle zwei Jahre stattfindenden,<br />
national wie international stark<br />
wahrgenommenen Arbeitstagungen<br />
der ASpB mit jeweils rund 250<br />
bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
beteiligt.<br />
Die ASpB bildet gemeinsam mit<br />
der Sektion 5 (Spezialbibliotheken)<br />
des Deutschen Bibliotheksverbandes<br />
den größten Zusammenschluss<br />
wissenschaftlicher Spezialbibliotheken<br />
in Deutschland.<br />
Ursprünglich hervorgegangen aus<br />
der im Jahre 1946 gegründeten Arbeitsgemeinschafttechnisch-wissenschaftlicher<br />
Bibliotheken, bildet<br />
Dr. Pauli Heikkilä, Turku (01.-31.03.)<br />
„Europa der baltischen Emigranten.<br />
Hermann Graf Keyserlink und Hjalmar<br />
Mäe“<br />
Joanna Wiesler (Kowalik), Neumarkt<br />
(01.-31.03) „Familienpolitik und Familienrecht<br />
in der DDR und in der<br />
Volksrepublik Polen“<br />
Dr. Rasa Pārpuce, Rīga (01.03.-30.<br />
04.) „Das Problem der baltischen Kulturgüter<br />
im Kontext der Umsiedlung<br />
der Deutschbalten“<br />
Dr. Dominik Pick, Berlin (01.-30.04.)<br />
„Polen als Teil des ‚Schwarzen Triangel‘.<br />
Umweltschutz in Polen 1945-<br />
1990 im Vergleich zu DDR und Tschechoslowakei“<br />
Katarzyna Anna Wojtczak M.A.,<br />
Rzepnica (01.-30.04.) „Der Architekt<br />
Julius Albert Gottlieb Licht und die<br />
Transformation der Stadt Danzig in<br />
den Jahren 1857 bis 1892“<br />
die ASpB heute die zentrale Vertretung<br />
von Spezialbibliotheken aller<br />
Fachrichtungen und aller Größen<br />
in Deutschland – von sogenannten<br />
„One-Person-Libraries“ bis zu<br />
den großen Bibliotheken technischer<br />
Universitäten und den zentralen<br />
Fachbibliotheken. Insofern<br />
ist es nicht überraschend, dass in<br />
der ASpB auch viele der Spezialbibliotheken<br />
an <strong>Institut</strong>en aller vier<br />
deutschen Wissenschaftsgemeinschaften<br />
vertreten sind, wobei den<br />
Bibliotheken der Mitgliedseinrichtungen<br />
der Leibniz-Gemeinschaft<br />
aufgrund ihrer Größe, Bedeutung<br />
und der dort besonders engen Verzahnung<br />
zwischen Infrastruktur und<br />
Forschung eine besondere Bedeutung<br />
zukommt.<br />
Prof. Marek Andrzejewski, Gdańsk<br />
(01.-15.05.) „Das Kulturerbe in der<br />
Freien Stadt Danzig“<br />
Justyna Jurkowska M.A., Wien (01.<br />
05.-30.06.) „Die polnischen parlamentarischenVerfassungskonzeptionen<br />
der Zwischenkriegszeit 1918-<br />
1939“<br />
Prof. Gvido Straube, Rīga (01.05.-<br />
30.06.) „Bauernbildung und Bauernschulen<br />
im Baltikum im 17. und 18.<br />
Jahrhundert“<br />
Stipendiaten anderer Förderer:<br />
Irina Semenikhina, Woronesch,<br />
(14.05.-15.06.) „Die Umsiedlung der<br />
Deutschbalten“ mit einem Stipendium<br />
der Zeit-Stiftung (Hamburg) zum<br />
Studium archivischer Quellen und zur<br />
Sichtung der Literatur<br />
Gäste mit eigenen Mitteln:<br />
Vera Adam, Marburg (Januar-Juni)<br />
„Burgen und Schlösser in Böhmen<br />
/ Heraldik“<br />
23<br />
Jürgen Warmbrunn
Heinrich Mrowka, Langenstein (Januar-Juni)<br />
„Schweidnitz / Ostpreußen<br />
19. Jh.“<br />
Oliver-Frank Hornig, Wiesbaden<br />
(Januar-Juni) „Schlesien“<br />
Lehrveranstaltungen<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Quellen zur Problematik nationaler<br />
und religiöser Minderheiten in Ostmitteleuropa<br />
Übung WS 2011/12, 2 SWS<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
Prof Dr. Hans-Jürgen Bömelburg<br />
Prof. Dr. Thomas Bohn<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Osteuropäische Geschichte<br />
Oberseminar WS 2011/12, 2 SWS<br />
Dr. Heidi Hein-Kircher<br />
Philipps-Universität Marburg<br />
■ Vom ‚Völkerfrühling‘ zu Nationalitätenkonfl<br />
ikten am Vorabend des<br />
Ersten Weltkriegs. Die Habsburgermonarchie<br />
1848-1914<br />
Übung (Blockveranstaltung) WS<br />
2011/12, 2 SWS<br />
Dr. Peter Wörster<br />
Dorothee Goeze M.A.<br />
Philipps-Universität Marburg<br />
■ Gelehrte Netzwerke der frühen<br />
Neuzeit: Das Beispiel der Briefsammlung<br />
Gadebusch (18. Jahrhundert)<br />
aus Livland<br />
Übung WS 2011/12, 2 SWS<br />
Vorträge, Workshops und Tagungen<br />
In dieser Rubrik finden Sie alle Vorträge<br />
unserer Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter sowie alle Vortragsveranstaltungen,<br />
die am <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
stattfanden bzw. bei denen das<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> als Kooperationspartner<br />
aktiv war.<br />
11. Januar 2012<br />
Kolloquium der Leibniz Graduate<br />
School for Cultures of Knowledge<br />
in Central European Transnational<br />
Contexts, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
24<br />
Klaus-Peter Friedrich, Marburg (Januar-Juni)<br />
„Juden in Polen 1941-1945“<br />
Dr. Dr. h.c. Winfried Irgang, Weimar<br />
(Lahn) (Januar-Juni) „Schlesien“<br />
Dr. Jürgen Warmbrunn<br />
Dr. Jan Lipinsky<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Informations- und Medienkompetenz<br />
für HistorikerInnen – Datenbanken,<br />
Wissensportale, Online-Ressourcen<br />
Übung WS 2011/12, 2 SWS<br />
Dr. Christian Lotz<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Das deutsche Reich in Europa.<br />
Facetten internationaler Verfl echtung<br />
1871-1914<br />
Proseminar WS 2011/2012, Blockveranstaltung<br />
Dr. des. Sylwia Werner<br />
Universität Konstanz<br />
■ Wissenssoziologie und Literatur in<br />
osteuropäischen Zentren der Moderne<br />
Proseminar WS 2011/2012, Blockveranstaltung<br />
Prof. Dr. Peter Haslinger<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Alltagserfahrung unter deutscher<br />
Besatzung: Europa im Zweiten Weltkrieg<br />
Hauptseminar SS 2012, 2 SWS<br />
Christian Lotz (Marburg): „Raum<br />
und Zeit als unberechenbare Variable?<br />
Zukunftsplanungen zur Nutzung<br />
europäischer Holzressourcen unter<br />
dem Eindruck industrialisierter Beschleunigung<br />
und Entgrenzung (ca.<br />
1870-1914)“<br />
11. Januar 2012<br />
<strong>Herder</strong>-Kolloquium, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Antje Coburger (Marburg): „Sammlungsgeschichte<br />
als Baustein einer<br />
Agnes Laba M.A.<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Der Versailler Vertrag und die territoriale<br />
Neuordnung Ostmitteleuropas<br />
Quellenkundliche Übung SS 2012,<br />
2 SWS<br />
Justyna A. Turkowska M.A.<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
■ Inszenierter Fortschritt. Welt- und<br />
Hygieneausstellungen von 1850 bis in<br />
die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts<br />
Übung SS 2012, 2 SWS<br />
Dr. Peter Wörster<br />
Dorothee M. Goeze M.A.<br />
Philipps-Universität Marburg<br />
■ Verfassung und Bevölkerung: Geschichte<br />
Kurlands im 18. und 19.<br />
Jh. Archivquellen in der Dokumentesammlung<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Übung SS 2012, 2 SWS<br />
<strong>Institut</strong>sgeschichte. Das <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
und seine Sammlungen"<br />
29. Januar 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
„Nach der Zeitzeugenschaft – Holocausterinnerung<br />
heute“, Gedenkveranstaltung,<br />
„Gedenkveranstaltung<br />
zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus“,<br />
City Kirche Elberfeld,<br />
Wuppertal
31. Januar 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Jena/<br />
Marburg): „Wozu Umweltgeschichte<br />
in Ost- und Ostmitteleuropa?“, Kolloquium,<br />
Imre Kertész Kolleg, Jena<br />
2. Februar 2012<br />
Masterclass „Wissen, Diskurse und<br />
Erinnerung“, Research Area 8, Graduate<br />
Centre for the Study of Culture<br />
(GCSC), Justus-Liebig-Universität,<br />
Gießen<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Leitung<br />
3. Februar 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Jena/<br />
Marburg): „Urbanität im Zeitalter der<br />
Extreme: Lemberg im 20. Jahrhundert“,<br />
Filmvorführung, Ausstellung<br />
und Podiumsdiskussion „Gespiegelte<br />
Zeit. Die vielen Gesichter L’vivs“,<br />
Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig<br />
8. Februar 2012<br />
Kolloquium der Leibniz Graduate<br />
School for Cultures of Knowledge<br />
in Central European Transnational<br />
Contexts, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Konrad Hierasimowicz (Marburg):<br />
„Von zweimal Belarus zu Belarus 2.0?<br />
Mediale Narration nationaler Vergangenheit<br />
und Identität im Übergang<br />
von Printmedien zu Social Media“<br />
Justyna A. Turkowska (Marburg):<br />
„Wissen als Konstrukt und Inszenierung:<br />
Hygienepopularisierung in der<br />
Provinz Posen“<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Die Entstehung<br />
von Ludwik Flecks Wissenschaftstheorie<br />
im Kontext der<br />
Lemberger Moderne. Plurale Wirklichkeitsentwürfe<br />
in Wissenschaft,<br />
Philosophie, Literatur und Kunst“<br />
8. Februar 2012<br />
<strong>Herder</strong>-Kolloquium, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Dariusz Gierczak (Marburg): „Alte<br />
Quartiere im Wandel. Konsequenzen<br />
der demographischen Entwicklung<br />
im Oberschlesischen Industrierevier<br />
seit 1989. Untersucht an Beispielen<br />
aus Bytom (Beuthen) und Gliwice<br />
(Gleiwitz)“<br />
Dietmar Popp, Leiter der Wissenschaftlichen Sammlungen, hielt den Einführungsvortrag<br />
zur Ausstellung „Im Objektiv des Feindes“ im Mahnmal St. Nikolai in Hamburg<br />
9. - 11. Februar 2012<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Kommentar zu: „Fest und Konflikt: Die<br />
Wahrnehmung der ungarischen Millenniumsdenkmäler<br />
im Jahre 1896“<br />
von Balint Varga-Kuna M.A., Tagung<br />
„Von Schwedisch-Pommern bis zur<br />
DDR – Fallbeispiele politischer Integration<br />
vom 18.-20. Jahrhundert“, Johannes-Gutenberg-Universität,<br />
Mainz<br />
15. Februar 2012<br />
Dietmar Popp: (Marburg): Eröffnungsrede<br />
zur Ausstellung: „Im Objekt<br />
des Feindes – Die deutschen<br />
Bildberichterstatter im besetzten<br />
Warschau 1939-1945. W obiektywie<br />
wroga. Niemieccy fotoreporterzy w<br />
okupowanej Warszawie (1939-1945)“,<br />
Mahnmal St. Nikolai, Hamburg<br />
23. Februar 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen): Podiumsgespräch<br />
und Lesung: „Friedrich<br />
Kellner ,Verdunkelt, vernebelt<br />
sind alle Hirne‘“, Buchvorstellung,<br />
„Lebenszeugnisse“, Literaturforum<br />
im Brecht-Haus, Berlin<br />
28. Februar 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
Vortrag und Lesung: „Die Tagebücher<br />
Friedrich Kellners“, öffentlicher<br />
Abendvortrag, Lambertus-Saal der<br />
Lambertikirche, Oldenburg<br />
29. Februar 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen): Podiumsgespräch:<br />
„Das haben wir nicht<br />
gewusst!“, Gemeindehaus der Ev.-<br />
Luth. Kirchengemeinde, Oldenburg<br />
7. März 2012<br />
<strong>Herder</strong>-Kolloquium, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Dr. Radoslav Štefančík (Senec): „Die<br />
deutsche Antwort auf die Emigration<br />
aus der ‚kommunistischen Hölle‘.<br />
Tschechische und slowakische<br />
Emigranten in Deutschland zwischen<br />
1948-1989“<br />
9. März 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Jena/<br />
Marburg): „(Re-)Inventing the Atomograd.<br />
Nuclear as a Way of Life<br />
in Eastern Europe Before and After<br />
Chernobyl, 1970-2011“, Internationale<br />
Konferenz „Comparing Fukushima<br />
and Chernobyl: Social and Cultural<br />
Dimensions of the Two Nuclear<br />
Catastrophes“, Goethe-Universität,<br />
Frankfurt am Main<br />
14. März 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
„‚Volk ohne Hirn‘ – Friedrich Kellner<br />
und seine Chronik des Alltags, der<br />
Propaganda und der Verbrechen des<br />
NS-Regimes“, öffentlicher Abendvortrag<br />
im Rahmen der Woche der<br />
Brüderlichkeit, Geschichtsort Villa<br />
ten Hompel, Münster<br />
25
Die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer des<br />
Workshops „Wissenskulturen“<br />
15. - 16. März 2012<br />
Elke Bauer (Marburg): „Gleichstellung<br />
ist Arbeit. Mögliche Arbeitsfelder<br />
der Gleichstellungsbeauftragten“,<br />
Jahrestagung „Chancengleichheit“<br />
der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin-<br />
Kleinmachnow<br />
19. - 21. März 2012<br />
Workshop „Wissenskulturen“,<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong> Marburg<br />
Diskussion von Schlüsselkonzepten<br />
und Sekundärliteratur sowie der Beiträge<br />
des Tagungsbandes zur Sommerakademie<br />
2011<br />
Peter Bugge (Universität Aarhus):<br />
„Wissensregimes über das östliche<br />
Europa seit 1989 – neue Raumbilder,<br />
neue Deutungen?“<br />
21. März 2012<br />
Marc Friede / Dariusz Gierczak<br />
(Marburg): „Stadtentwicklung multimedial.<br />
Der historisch-topographische<br />
Atlas schlesischer Städte“, Treffen<br />
der Sektion Hessen der Deutschen<br />
Gesellschaft für Kartographie,<br />
Bundesamt für Kartographie und<br />
Geodäsie, Frankfurt am Main<br />
21. März 2012<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Gestaltsehen<br />
und -denken. Ludwik Flecks<br />
Theorie der Art-Fakte“, Kulturwissenschaftliches<br />
Kolloquium, Universität<br />
Luzern<br />
26<br />
25. März 2012<br />
Dorothee M. Goeze (Marburg): „Die<br />
Suche / Frage nach einem sinnvollen<br />
Verbleib für baltische Dokumente.<br />
Die Dokumentesammlung des<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s antwortet gern“,<br />
22. Tagung der baltischen ritterschaftlichen<br />
Familienverbände im Verband<br />
der Baltischen Ritterschaften e.V.“,<br />
Schloss Höhnscheid<br />
30. März 2012<br />
Christian Lotz (Marburg): „Experten<br />
an den Grenzen der Imperien. Erkundungsreisenforstwissenschaftlicher<br />
Experten nach Nordeuropa“,<br />
Konferenz „Weltgestalter und Welterklärer.<br />
Experten in der technischen<br />
Moderne“, Technische Universität<br />
Dresden<br />
11. April 2012<br />
Kolloquium der Leibniz Graduate<br />
School for Cultures of Knowledge<br />
in Central European Transnational<br />
Contexts, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Karrierewege für wissenschaftlichen<br />
Nachwuchs“<br />
11. April 2012<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Eröffnungsrede zur Ausstellung: „Im<br />
Objektiv des Feindes – Die deutschen<br />
Bildberichterstatter im besetzten<br />
Warschau 1939-1945. W obiektywie<br />
wroga. Niemieccy fotoreporterzy<br />
w okupowanej Warszawie (1939-<br />
1945)“, Landtag Rheinland-Pfalz,<br />
Mainz<br />
18. April 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Internationaler Workshop „Lemberg/<br />
Ľviv/Lwów um 1900 – Aktuelle Forschungen“<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Begrüßung<br />
Heidi Hein-Kircher (Marburg): Vortrag:<br />
„Kommunalpolitische Prägungen<br />
kulturellen Lebens in Lemberg<br />
um 1900“<br />
Vita Susak (Ľviv/Leipzig): „The Ľviv<br />
National Gallery of Arts (1907-2012).<br />
Collection History as the Reflection<br />
of City History“<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Von Ameisen,<br />
Affen und Menschen. Betrachtungen<br />
fremder Welten im Lemberg<br />
der Zwischenkriegszeit“<br />
Katharina Kreuder-Sonnen (Gießen):<br />
„Die Welt lernt das Läuse-<br />
Füttern. Lemberg als internationales<br />
Zentrum der Fleckfieberforschung in<br />
den 1930er Jahren“<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Kommentar<br />
19. April 2012<br />
Stanislava Kolková (Marburg): „Die<br />
Zips im kulturellen und wissenschaftlichen<br />
Diskurs der Slowakei von 1945-<br />
1948“, Tagung „Region – Staat –<br />
Europa. Regionale Identitäten unter
den Bedingungen von Diktatur und<br />
Demokratie in Mittel- und Osteuropa“,<br />
Botschaft der Slowakischen Republik,<br />
Berlin<br />
20. April 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Jena/<br />
Marburg): Kommentar und Zusammenfassung<br />
der Arbeitsergebnisse,<br />
Tagung „Drittes Projekttreffen des<br />
Projektverbundes ‚Digitaler Atlas<br />
politischer Raumbilder zu Ostmitteleuropa<br />
im 20. Jahrhundert (DA-<br />
PRO)‘“, <strong>Institut</strong> für Wissensmedien,<br />
Tübingen<br />
24. April 2012<br />
Dariusz Gierczak / Wolfgang Kreft<br />
(Marburg) / Grzegorz Strauchold<br />
(Wrocław): „Historycznotopograficzny<br />
atlas miast śląskich“, Präsentation<br />
im Verlag Via Nova, Wrocław<br />
24. April 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen): Vortrag<br />
und Podiumsgespräch: „Friedrich<br />
Kellner ,Vernebelt, verdunkelt<br />
sind alle Hirne‘“, Buchpräsentation,<br />
„Topographie des Terrors“, Berlin<br />
28. April 2012<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Chair / Discussant, „HISTORY<br />
AND MEMORY VII: Nationalization<br />
of Space and Society“, The Global<br />
Baltics: The Next Twenty Years,The<br />
23rd biannual conference of the Association<br />
for the Advancement of<br />
Baltic Studies (AABS), University of<br />
Illinois, Chicago<br />
28. April 2012<br />
Vytautas Petronis (Marburg): „Aspects<br />
of the Emergence and Transformation<br />
of the Early Lithuanian<br />
Far Right Movement (1922-1927)“,<br />
The Global Baltics: The Next Twenty<br />
Years,The 23rd biannual conference<br />
of the Association for the Advancement<br />
of Baltic Studies (AABS), University<br />
of Illinois, Chicago<br />
28. April 2012<br />
Tomaš Nenartovič (Marburg): „Territorial<br />
Concepts and Geopolitics in<br />
Northeastern Europe 1890-1939“,<br />
The Global Baltics: The Next Twenty<br />
Years, The 23rd biannual conference<br />
of the Association for the Advancement<br />
of Baltic Studies (AABS), University<br />
of Illinois, Chicago<br />
4. Mai 2012<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Relativistische<br />
Wahrnehmungskonzepte<br />
in der Lemberger Moderne“, Internationaler<br />
Workshop „Gestalt und<br />
Ritus. Ludwik Fleck im Kontext der<br />
Ethnologie und Gestaltpsychologie<br />
seiner Zeit“, Universität Konstanz<br />
7. - 12 Mai 2012<br />
Stanislava Kolková (Marburg): „Textualisierung<br />
und Kontextualisierung<br />
von ‚Nation‘ und ‚Staat‘. Die kulturellen<br />
und wissenschaftlichen Eliten als<br />
Wissensimporteure und Wissensexporteure<br />
in der Slowakei von 1938 bis<br />
1948“, DAAD Sommerseminar: „Intellektuelle<br />
Eliten in Ost- und Westeuropa<br />
in Geschichte und Gegenwart“,<br />
Universität Passau<br />
8. Mai 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
„Zwischen Trivialisierung und Popularisierung<br />
– Der Holocaust in populären<br />
Medien“, Veranstaltung des<br />
<strong>Institut</strong>s für kulturwissenschaftliche<br />
Deutschlandstudien an der Universität<br />
Bremen und der Landeszentrale<br />
für politische Bildung Bremen, Villa<br />
Ichon, Bremen<br />
9. Mai 2012<br />
Jan Lipinsky (Marburg): „Die Internet-Aktivitäten<br />
des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s“,<br />
6. Tagung der AG landesgeschichtliche<br />
und landeskundliche Internet-<br />
Portale in Deutschland, AG Regionalportale<br />
Deutschland, Stuttgart<br />
14. - 16. Mai 2012<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg): Eröffnungsvortrag:<br />
41. ABDOS-Tagung<br />
„Das Internet als Ort der wissenschaftlichen<br />
Information und Diskussion“,<br />
Bayerische Staatsbibliothek,<br />
München<br />
18. Mai 2012<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„Imperial disintegration and national<br />
confrontation in East-Central Euro-<br />
pe, 1918-1920“, Tagung „The Greater<br />
War – Imperial Mobilization, Demobilization,<br />
and Unrest in the Era<br />
of the First World War“, University<br />
College Dublin<br />
22. Mai 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
Vortrag und Lesung: „Friedrich Kellner:<br />
,Vernebelt, verdunkelt sind alle<br />
Hirne‘“, Buchpräsentation, Von der<br />
Heydt-Museum, Wuppertal<br />
23. Mai 2012<br />
Workshop „Sprache(n), Wissen und<br />
Translationsprozesse“ der Leibniz<br />
Graduate School for Cultures<br />
of Knowledge in Central European<br />
Transnational Contexts, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Stefan Michael Newerkla (Wien):<br />
„Kultur- und Wissenstransfer in slawischdeutschen<br />
Kontakträumen –<br />
Sprachwandel und Translation“<br />
Jan Jakub Surman (Wien/Warszawa)<br />
„Wissenschaft, Sprache<br />
und Différance: Überlegungen zu<br />
Wissenschaftssprache(n) und Wissenstransfer“<br />
Peter Haslinger: (Marburg/Gießen):<br />
Kommentar<br />
30. Mai 2012<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
„The break up of Czechoslovakia – an<br />
experience to share?“, The Centre for<br />
Historical Research and Documentation<br />
on War and Contemporary Society<br />
(Ceges-Soma), Brüssel<br />
1. Juni 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Urbanisierung und Urbanität als Forschungsproblem<br />
in der Geschichte<br />
Ost- und Ostmitteleuropas“, Tagung<br />
„Urbanisierung und Urbanität in Ost-<br />
und Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert“,<br />
Technische Universität, Berlin<br />
27
2. Juni 2012<br />
Dorothee M. Goeze (Marburg): „Kulturvermittlung<br />
in Zeiten des Kalten<br />
Krieges. Otto A. Webermann – eine<br />
Biographie zwischen Estland und<br />
Deutschland“, 65. Baltisches Historikertreffen,<br />
Universität Göttingen<br />
2. Juni 2012<br />
Markus Roth (Marburg/Gießen):<br />
„Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt“,<br />
Workshop „Militärgeschichte<br />
Editionen heute: Neue Anforderungen,<br />
alte Probleme?“, Militärgeschichtliches<br />
Forschungsamt,<br />
Potsdam<br />
4. Juni 2012<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Die<br />
Lemberger Schule der Medizin. Von<br />
Władysław Szumowski zu Ludwik<br />
Fleck“, <strong>Institut</strong> für Geschichte der<br />
Medizin, Justus-Liebig-Universität,<br />
Gießen<br />
6. Juni 2012<br />
<strong>Herder</strong>-Kolloquium, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Justyna A. Jurkowska (Wien): „Ideelle<br />
Grundlagen der Aprilverfassung<br />
und ihre Realisierung“<br />
7. - 8. Juni 2012<br />
Workshop „Generations of Violence<br />
– Age Groups, Generation Gaps, and<br />
the Significance of Violence“ der Forschergruppe<br />
Gewaltgemeinschaften<br />
in Zusammenarbeit mit dem <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong>, Marburg, gemeinsam mit dem<br />
Centre for War Studies am University<br />
College Dublin, dem Centre for<br />
Historical Research and Documentation<br />
on War and Contemporary<br />
Society Bruxelles und dem Instituut<br />
voor oorlogs-, holocaust-, en genocidestudies,<br />
Amsterdam<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Opening<br />
Antoon Vrints (Ghent): Panel I Chair<br />
Sascha Reif (Gießen): „‚here was<br />
Considerable Friction between the<br />
Young Dandies [...] and the Elders<br />
[...]‘ Generational Conflict & Violence<br />
in 19th Century Eastern Africa“<br />
Tamir Libel (Dublin) „The Greatest<br />
Generation? The Failure of IDF’s Second<br />
Intifada Commanders in the<br />
28<br />
Second Lebanon War“<br />
Rudi Van Doorslaer (Brüssel): Comment<br />
Friedrich Lenger (Gießen): Panel<br />
II Chair<br />
Florian Grafl (Gießen): „Forms of<br />
Violence and Generations of Perpetrators<br />
in Barcelona during the First<br />
Half of the 20th Century“<br />
Stefan Dölling (Berlin): „Generation<br />
‚Volkstumskampf‘“<br />
Vytautas Petronis (Marburg): „Fathers<br />
and Sons: Generational Aspect<br />
in Early Lithuanian Right-Wing<br />
Movement (1918-1927)“<br />
Robert Gerwarth (Dublin): Comment<br />
Peter Haslinger (Marburg/Gießen):<br />
Summary and General Discussion<br />
„Generations of Violence“<br />
11. Juni 2012<br />
Materclass „Ost und West als kulturhistorische<br />
Konstrukte“ der Leibniz<br />
Graduate School for Cultures<br />
of Knowledge in Central European<br />
Transnational Contexts und der DA-<br />
PRO-DoktorandInnen, <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>,<br />
Marburg<br />
Miloš Havelká (Praha): Einführungsvortrag<br />
zu „Ost und West als kulturhistorische<br />
Konstrukte“<br />
15. Juni 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„East Central European Modernity<br />
and the Urban Experience“, Imre Kertész<br />
Kolleg Annual conference 2012<br />
„Challenges of Modernity – Spatial<br />
Integration and Communication in<br />
20th Century Central and Eastern<br />
Europe“, Akademie věd České republiky,<br />
Praha<br />
17. Juni 2012<br />
Anna Veronika Wendland (Marburg):<br />
„Challenges of Modernity in Eastern<br />
Europe: Environment“, Autorenworkshop<br />
im Rahmen der Annual conference<br />
2012 Imre Kertés Kolleg Jena<br />
„Challenges of Modernity – Spatial<br />
Integration and Communication in<br />
20th Century Central and Eastern<br />
Europe“, Univerzita Karlova, Praha<br />
22. Juni 2012<br />
3. Arbeitstagung des SAW-Projekts<br />
„Demokratiegeschichte des 20. Jahr-<br />
hunderts als Zäsurgeschichte“: „Demokratiekonzepte<br />
der frühen Weimarer<br />
Republik“,<br />
<strong>Institut</strong> für Deutsche Sprache, Mannheim<br />
Heidrun Kämper (Mannheim): Moderation<br />
Michael Fahlbusch (Basel): Vortrag:<br />
„Volk ohne Raum – Raum ohne Volk.<br />
Zum völkischen Diskurs der zwanziger<br />
Jahre“<br />
Anja Lobenstein-Reichmann (Heidelberg/Mannheim):<br />
Vortrag: „Gibt<br />
es einen ‚völkischen‘ Demokratiebegriff?“<br />
Udo Wengst (Mannheim): Moderation<br />
Martin Geyer (München): Vortrag:<br />
„Korruptionsdebatten in der frühen<br />
Weimarer Republik“<br />
Kathrin Groh (München): Vortrag:<br />
„Demokratiekonzepte führender<br />
deutscher Staatsrechtler zu Beginn<br />
der Weimarer Republik“<br />
22. Juni 2012<br />
Dr. Jürgen Warmbrunn (Marburg):<br />
„Raum 2.0 – Beispiele für transnationale<br />
Wissensvermittlung zur Region<br />
Ostmitteleuropa“, Workshop<br />
„Strategischer Forschungsverbund<br />
Science 2.0“, Wissenschaftszentrum<br />
für Sozialforschung Berlin<br />
28. Juni 2012<br />
Jürgen Warmbrunn (Marburg): „The<br />
new open access repository for East<br />
European ‚OstDok‘ – a new role for<br />
libraries in high-quality publishing in<br />
East European studies“, COSEELIS-<br />
Konferenz, Oxford<br />
29. Juni 2012<br />
Sylwia Werner (Marburg): „Science<br />
oder Fiction? Stanisław Lems Erzählwerk<br />
im Lichte seiner Philosophie der<br />
Technik“, 1. Internationale Tagung<br />
zur Trivial- und Unterhaltungsliteratur,<br />
Universidad de Sevilla<br />
28. - 30. Juni 2012<br />
LOEWE-Abschlusstagung „Lesen –<br />
Schreiben – Erzählen – digital und<br />
vernetzt“,<br />
Justus-Liebig-Universität, Gießen<br />
Henning Lobin (Gießen): Begrüßung<br />
Olaf Breidbach (Jena): Vortrag: „Wissen<br />
im Netz“
Annina Klappert (Erfurt): Vortrag:<br />
„Schreiben mit Zettel und Link“<br />
Maja Bärenfänger (Gießen): Vortrag:<br />
„Leser(brief)kommunikation im digitalen<br />
Wandel“<br />
Andrew Patten (Berlin): Vortrag: „The<br />
Quality of Quantity: (Pre)Reading<br />
Work, Network, and Extratextuality“<br />
Jana Klawitter (Gießen): Vortrag:<br />
„Kategorisierungen in webbasierter<br />
Wissenschaftskommunikation: Metaphernkonzepte<br />
und Denkkollektive“<br />
Mirco Limpinsel (Berlin): Vortrag:<br />
„Volltextsuche und der philologische<br />
Habitus“<br />
Peter Hoeres (Gießen): Vortrag: „Public<br />
History Online – Geschichte digital<br />
erzählen“<br />
John David Seidler (Rostock): Vortrag:<br />
„Digitale Detektive: VerschwörungstheoretischeGeschichtsschreibung<br />
im Internet“<br />
Rebecca Hagelmoser, Jonas Ivo<br />
Meyer (Gießen): Vortrag: „Corporate<br />
Identity und Storytelling auf So-<br />
Neue Veröffentlichungen<br />
cial Network Sites. Wie sich Marketingstrategien<br />
und -techniken durch<br />
das Aufkommen von Social Media<br />
verändern“<br />
Alexander Scherr (Gießen): Vortrag:<br />
„Die ‚livingnovel‘ im Cyberspace?<br />
– Aspekte der ästhetischen Illusionsbildung<br />
im Browsergame ,Twin-<br />
Komplex‘“<br />
Roberto Simanowski (Basel): Vortrag:<br />
„Elektronische Bücher und digitale<br />
Helden: Zum produktions- und<br />
rezeptionsästhetischen Umbau des<br />
Narrativen in neuen Medien“<br />
Joachim Jacob (Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen): Moderation<br />
Podiumsdiskussion zum Thema „Interdisziplinarität<br />
im Übermaß? Aktuelle<br />
Perspektiven und Herausforderungen<br />
interdisziplinärer Forschung“<br />
Jan Hodel (Aarau): Vortrag: „Copy/paste<br />
a shattered history? Das<br />
Erstellen von Geschichtsreferaten<br />
unter den Bedingungen narrativer<br />
Fragmentierung“<br />
Annika Dix, Lisa Schüler, Jan Weisberg<br />
(Gießen): Vortrag: „Strategien<br />
der computergestützten Textproduktion:<br />
Überlegungen zum Zusammenhang<br />
von Ordnungsprozessen und<br />
Schreibflüssigkeit beim wissenschaftlichen<br />
Schreiben“<br />
Susanne Göpferich, Bridgit Nelezen<br />
(Gießen): Vortrag: „Die Sprach(un)abhängigkeit<br />
von Textproduktionskompetenz:<br />
Translation als Werkzeug<br />
der Schreibprozessforschung<br />
und Schreibdidaktik“<br />
Florian Radvan (Bochum): Vortrag:<br />
„Besser schreiben mit dem Computer?<br />
Eine komparative Lehrwerksanalyse<br />
zur Vermittlung medial gestützten<br />
Schreibens“<br />
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung<br />
Die neuesten Hefte 60/4 und 61/1 der<br />
führenden Zeitschrift der internationalen<br />
Ostmitteleuropaforschung enthalten<br />
neben einem umfangreichen<br />
Besprechungsteil folgende Beiträge:<br />
Karsten Brüggemann / Vytautas<br />
Petronis: Introduction<br />
Daria Starčenko: Kosaken zwischen<br />
Tatendrang und Rechtfertigungsdruck.<br />
Ordnungsvorstellungen einer<br />
Gewaltgemeinschaft im Kontext von<br />
Konkurrenz und Gewaltkultur<br />
Emily R. Gioielli: The Enemy at the<br />
Door: Revolutionary Struggle in the<br />
Hungarian Domestic Sphere, 1919-<br />
1926<br />
Ginta Brūmane-Gromula: Violence<br />
as Political Agitation: the Example of<br />
Political Posters in Latvia, 1920-1934<br />
Eva Reder: Im Schatten des polnischen<br />
Staates: Pogrome 1918-1920<br />
und 1945/46 – Auslöser, Bezugspunkte,<br />
Verlauf<br />
Živilė Mikailienė: The Hippie Movement<br />
in Soviet Lithuania. Aspects of<br />
Cultural and Political Opposition to<br />
the Soviet Regime<br />
Stephan Lehnstaedt: Das Militärgeneralgouvernement<br />
Lublin: Die<br />
„Nutzbarmachung“ Polens durch Österreich-Ungarn<br />
im Ersten Weltkrieg<br />
Patryk Wasiak: The Video Boom in<br />
Socialist Poland<br />
29
Geschichte der Deutschen in Ungarn<br />
Das zweibändige Handbuch fasst<br />
die Geschichte der Deutschen in<br />
Ungarn vom Mittelalter bis heute<br />
zusammen. Zeitlich wird die von<br />
West nach Ost verlaufene Siedlungsmigration<br />
von ihren Anfängen<br />
unter König Stephan I. bis zu ihrem<br />
Höhepunkt im 18. Jahrhundert behandelt<br />
und die Geschichte der in<br />
Ungarn ansässig gewordenen einzelnen<br />
deutschen Siedlergruppen<br />
bis zur Auflösung des historischen<br />
Ungarns 1918 näher untersucht.<br />
Von 1918 bis zur Gegenwart, das<br />
heißt bis zu den Parlaments- und<br />
Kommunalwahlen 2006, steht die<br />
Geschichte der Ungarndeutschen<br />
im Mittelpunkt. Die Darstellung<br />
sucht ein Narrativ der Gruppengeschichte<br />
der Deutschen in Ungarn<br />
zu entwickeln, das sowohl die interethnischen<br />
Beziehungen zu den<br />
Magyaren als auch die Verflechtung<br />
mit anderen Minderheiten berücksichtigt<br />
und somit eine multiethnische<br />
Perspektive einnimmt.<br />
Am Beispiel der Deutschen wird<br />
die Geschichte des Zusammenle-<br />
30<br />
bens sprachlich, ethnisch oder religiös<br />
unterschiedlicher Gruppen im<br />
historischen Kontext, in Zeit und<br />
Raum verdeutlicht. Gruppen wie<br />
die Deutschen in Ungarn benötigen<br />
ihre eigene Geschichtsschreibung.<br />
Dieses historische Narrativ formuliert<br />
ein Identitätsangebot durch die<br />
reflektierte und selbstkritische Aufarbeitung<br />
ihrer Vergangenheit. Die<br />
Darstellung auch umstrittener Geschichtsperioden<br />
wie beispiels-<br />
Architektura Kaliningrada<br />
In diesem Buch<br />
wird das sowjetische<br />
Kaliningrad<br />
untersucht, genauer:<br />
seine Architektur,<br />
seine Stadtgestalt<br />
und seine<br />
Metamorphosen.<br />
Das frühere deutsche<br />
Königsberg,<br />
das von seinen Eroberern<br />
wie für ein<br />
geheimes Experimentjahrzehntelang<br />
abgeriegelt<br />
und dem Blick der<br />
Weltöffentlichkeit entzogen worden<br />
war, machte eine durch sein<br />
Schicksal einzigartige Verwandlung<br />
durch, die hier zum ersten Mal in<br />
Wort und Bild vollständig geschildert<br />
wird. Abgetrennt und isoliert<br />
von seinen früheren Bewohnern,<br />
von seinen politischen, ökonomischen<br />
und kulturellen Zusammenhängen<br />
und in einen neuen Kontext<br />
katapultiert, entstand hinter<br />
dem Eisernen Vorhang eine verbotene<br />
Stadt, deren verborgenes<br />
Werden hier nun Schritt für Schritt<br />
nachvollzogen wird. Kaliningrad ist<br />
eine gleichzeitig typische wie ungewöhnliche,<br />
in Armut und Eile aufgebaute,<br />
sowjetische Provinzmetropole<br />
mit wie zufällig in ihr urbanes<br />
Gewebe eingestreuten Relikten<br />
preußisch-deutscher Zivilisation,<br />
deren architektonische Formen<br />
und räumliche Bezüge in Planung<br />
und Wirklichkeit Gegenstand dieser<br />
Forschung sind. Überdies werden<br />
die langfristigen physischen und<br />
geistigen Formungsprozesse innerhalb<br />
Kaliningrads urbanem Orga-<br />
weise der NS-Zeit oder der Vertreibung<br />
soll vor diesem Hintergrund<br />
zur Überwindung von Traumata<br />
und Tabuisierungen beitragen. Es<br />
geht hier um eine transnationale,<br />
auf die Prozesse der gesamteuropäischen<br />
Geschichte hin geöffnete<br />
Geschichtsschreibung, die eine<br />
Einordnung der Gruppengeschichte<br />
in größere historische Zusammenhänge<br />
gewährleistet und die<br />
Besonderheiten der Gruppe herausstellt.<br />
Gerhard Seewann<br />
Geschichte der<br />
Deutschen in Ungarn<br />
Band 1:<br />
Vom Frühmittelalter bis 1860<br />
Marburg 2012, XVI, 540 S.<br />
€ 39,–<br />
ISBN 978-3-87969-373-3<br />
Band 2: 1860 bis 2006<br />
€ 39,–<br />
ISBN 978-3-87969-374-0<br />
Komplettpreis € 70,–<br />
nismus erkennbar gemacht. Dieses<br />
Buch macht die Formen der Kaliningrader<br />
Architektur aus ihren jeweiligen<br />
historischen Bedingungen<br />
und Absichten verständlich, bietet<br />
Deutungen ihres Ausdrucks und<br />
lässt ihre räumlichen Zusammenhänge<br />
lesbar und damit erlebbar<br />
werden; den oft verklärten und verdammten,<br />
jedoch weitgehend unbekannten<br />
Erbauern der Stadt werden<br />
in Architektura Kaliningrada ein<br />
Gesicht und eine Stimme gegeben.<br />
Markus Podehl<br />
Architektura Kaliningrada<br />
Wie aus Königsberg<br />
Kaliningrad wurde<br />
Marburg 2012<br />
€ 52,–<br />
ISBN 978-3-87969-375-7
Der Bund der Vertriebenen in der Bundesrepubik<br />
Deutschland und Polen (1957-2004)<br />
Im Zentrum der Dissertationsschrift<br />
steht die Frage nach der Selbst-<br />
und Fremddarstellung des Bundes<br />
der Vertriebenen (BdV) in der<br />
Bundesrepublik und in Polen zwischen<br />
1957 und 2004. Die Untersuchung<br />
konzentriert sich auf die Frage<br />
nach dem öffentlichen Bild des<br />
BdV in beiden Ländern. Zum einen<br />
wird danach gefragt, welches Bild<br />
der Vertriebenenverband von sich<br />
selbst der Öffentlichkeit zu vermitteln<br />
versuchte. Zum anderen wird<br />
der Frage nachgegangen, wie der<br />
BdV von den (west)deutschen und<br />
polnischen Medien dargestellt wurde.<br />
Die Arbeit geht von der These<br />
aus, dass die Selbst- und Fremddarstellung<br />
des BdV in der Bundesrepublik<br />
und in Polen im engen Zusammenhang<br />
mit dem politischen<br />
Wandel in beiden Ländern steht,<br />
Terminvorschau<br />
19. - 25. August 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Internationale und interdisziplinäre<br />
Sommerakademie des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
Migration und Integration in europäischen<br />
Gesellschaften des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts<br />
17. Juli - 12. September 2012<br />
Dokumentationszentrum, Prora<br />
25. September - 25. November 2012<br />
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände<br />
Nürnberg<br />
Im Objektiv des Feindes – Die deutschen<br />
Bildberichterstatter im besetzten<br />
Warschau 1938-1945 / W obiektywie<br />
wroga. Niemieccy fotoreporterzy<br />
w okupowanej Warszawie (1939-1945)<br />
Eine Wanderausstellung des Hauses<br />
der Begegnung mit der Geschichte<br />
in Warschau in Zusammenarbeit<br />
mit der Polnischen Akademie der<br />
Wissenschaften und dem <strong>Herder</strong>-<br />
<strong>Institut</strong> in Marburg, dem Bundesarchiv<br />
sowie der Stiftung Preußischer<br />
Kulturbesitz mit der Bildagentur bpk<br />
genauso wie sie eng mit dem Oder-<br />
Neiße- und dem (west)deutschen<br />
Opferdiskurs verbunden ist. Die<br />
Untersuchung stützt sich auf (west)<br />
deutsches und polnisches Pressematerial.<br />
In die Analyse wurden<br />
und dem Museum Europäischer Kulturen<br />
– Staatliche Museen zu Berlin.<br />
29. – 31. August 2012<br />
Tallinn<br />
Tagung Turning Points in Baltic and<br />
Central East European Food History<br />
– Knowledge, Consumption, and Production<br />
in Changing Environments /<br />
Nahrungsgeschichte im Ostseeraum<br />
und Ostmitteleuropa – Wissen, Produktion,<br />
Austausch und Konsum im<br />
Wandel in Kooperation mit dem Historischen<br />
<strong>Institut</strong> der Akademie der<br />
Wissenschaften in Tallinn<br />
6. - 8. September 2012<br />
Wierzba, Masuren<br />
Kooperationstagung der Leibniz-Gemeinschaft<br />
und der Polnischen Akademie<br />
der Wissenschaften in Zusammenarbeit<br />
mit dem <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong><br />
Wissenschaftsdialog – grenzüberschreitend.<br />
Potenziale und Herausforderungen<br />
für die Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
Artikel aus dem „Deutschen Ostdienst“,<br />
der „Zeit“, dem „Spiegel“,<br />
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“<br />
sowie der „Trybuna Ludu“,<br />
„Rzeczpospolita“, „Polityka“ und<br />
„Tygodnik Powszechny“ einbezogen.<br />
Die Dissertationsschrift versucht,<br />
einen Beitrag zur Verbandsgeschichte,<br />
Mediengeschichte und<br />
zur Geschichte der deutsch-polnischen<br />
Beziehungen zu leisten.<br />
Anna Jakubowska<br />
Der Bund der Vertriebenen in der<br />
Bundesrepubik Deutschland und<br />
Polen (1957-2004)<br />
Selbst- und Fremddarstellung eines<br />
Vertriebenenbandes<br />
Marburg 2012<br />
€ 34,–<br />
ISBN 978-3-87969-372-6<br />
21. September - 21. Oktober 2012<br />
Heimatmuseum, Reutlingen<br />
Zeit-Reisen. Schlesien-Ansichten aus<br />
der Graphiksammlung Haselbach<br />
Eine Ausstellung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s,<br />
Marburg, des Schlesischen Museums<br />
zu Görlitz und des Kunstforums<br />
Ostdeutsche Galerie Regensburg, in<br />
Kooperation mit dem Architekturmuseum<br />
in Breslau, gefördert vom Beauftragten<br />
der Bundesregierung für<br />
Kultur und Medien, dem Hessischen<br />
Sozialministerium, dem Sächsischen<br />
Staatsministerium des Innern und<br />
der Stiftung für deutsch-polnische<br />
Zusammenarbeit. Die Ausstellung<br />
wird präsentiert vom Deutschen Kulturforum<br />
östliches Europa, Potsdam.<br />
25. - 28 September 2012<br />
Mainz<br />
49. Deutscher Historikertag an der<br />
Johannes-Gutenberg-Universität<br />
Themenraum: Östliches Europa<br />
31
Fortsetzung der Terminvorschau<br />
3. - 6. Oktober 2012<br />
Dresden und Bautzen<br />
11. Deutscher Slavistentag, veranstaltet<br />
vom Deutschen Slavistenverband,<br />
dem <strong>Institut</strong> für Slavistik der Technischen<br />
Universität Dresden und dem<br />
Sorbischen <strong>Institut</strong> e.V. in Bautzen<br />
8. - 11. Oktober 2012<br />
Vilnius<br />
Nachwuchstagung Representing the<br />
Past in Architecture / Gebaute Geschichte<br />
in Zusammenarbeit mit dem<br />
Nordostinstitut Lüneburg, dem <strong>Institut</strong><br />
für Geschichte Litauens in Vilnius<br />
11. - 14. Oktober 2012<br />
Rīga<br />
Tagung Urban History in the Baltic:<br />
Theoretical Aspects and Current Research<br />
in Kooperation mit der Fakultät<br />
für Geschichte und Philosophie der<br />
Universität Lettlands in Rīga<br />
16. Oktober 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Workshop Wandel im Publizieren in<br />
den Osteuropa- und Geschichtswissenschaften.<br />
Rankings, Internationalisierung<br />
und Bibliometrie als Herausforderung?<br />
in Kooperation mit<br />
dem IOS Regensburg / Redaktion<br />
der Jahrbücher für Geschichte Osteuropas<br />
32<br />
18. – 19. Oktober 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Second Annual Conference of the<br />
Leibniz Graduate School for Cultures<br />
of Knowledge in Central European<br />
Transnational Contexts Nomadic<br />
Concepts. Biological concepts<br />
and their careers beyond biology in<br />
cooperation with the Department of<br />
History, Central European University<br />
in Budapest<br />
22. - 24. November 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Tagung Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa<br />
(1400-1700). Kommunikative<br />
Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen<br />
Städten und Verbänden<br />
in Kooperation mit der Justus-Liebig<br />
Universität Gießen<br />
24. Oktober 2012<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Lesung und Ausstellungseröffnung<br />
im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche<br />
"Treffpunkt Bibliothek":<br />
Prof. Hans-Jürgen Bömelburg liest<br />
aus seinem neuen Buch "Friedrich II.<br />
zwischen Deutschland und Polen".<br />
Begleitend zeigen wir eine Ausstellung<br />
mit Friedrich-Autografen aus<br />
der Dokumentesammlung des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
28. - 30. November 2012<br />
Berlin<br />
Jahrestagung der Leibniz-Gemeinschaft<br />
6. - 7. Dezember 2012<br />
Braunschweig<br />
Viertes Projekttreffen des Projektverbundes<br />
„Digitaler Atlas politischer<br />
Raumbilder zu Ostmitteleuropa im<br />
20. Jahrhundert“ (DAPRO) des <strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>s<br />
gemeinsam mit dem <strong>Institut</strong><br />
für Wissensmedien (Tübingen),<br />
dem <strong>Institut</strong> für Länderkunde (Leipzig)<br />
sowie dem Georg-Eckert-<strong>Institut</strong> für<br />
Internationale Schulbuchforschung<br />
(Braunschweig)<br />
17. - 18. Januar 2013<br />
<strong>Herder</strong>-<strong>Institut</strong>, Marburg<br />
Erster Teil der Doppeltagung Mobilisierungsparteien<br />
in Krisenphasen:<br />
Ostmittel- und Südosteuropa seit dem<br />
19. Jahrhundert in Kooperation mit<br />
dem <strong>Institut</strong> für Ost- und Südosteuropaforschung,<br />
Regensburg<br />
14. - 17. März 2013<br />
Leipziger Buchmesse<br />
HERDER-INSTITUT e.V.<br />
Gisonenweg 5-7<br />
35037 Marburg,<br />
Tel. +49 6421 184-0<br />
Fax +49 6421 184-139<br />
mail@herder-institut.de<br />
www.herder-institut.de