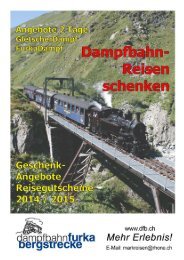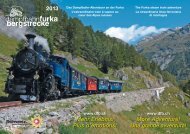Abschlussbericht - dfb
Abschlussbericht - dfb
Abschlussbericht - dfb
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Abschlussbericht</strong><br />
Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Auftraggeberin<br />
Präsidentenkonferenz Furka-Bergstrecke<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Robert Frech, Präsident Zentralvorstand Verein Furka-Bergstrecke<br />
Oskar Laubi, Verwaltungsratspräsident DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG<br />
Peter Riedwyl, Präsident Stiftungsrat Furka-Bergstrecke<br />
Auftragnehmerin<br />
Arbeitsgruppe Leitbild<br />
− Walter Benz, Stiftungsrat Furka-Bergstrecke<br />
− Robert Frech, Präsident Zentralvorstand Verein Furka-Bergstrecke<br />
− Jean-Pierre Dériaz, Verwaltungsrat DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG<br />
− Max Graf, Stiftungsrat Furka-Bergstrecke<br />
− Pepi Helg, Mitglied Zentralvorstand Verein Furka-Bergstrecke<br />
− Hans Tribolet, Verwaltungsrat DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG (bis 25. Juni 2011)<br />
9. Februar 2012
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Management Summary<br />
In diesem <strong>Abschlussbericht</strong> stellt die Arbeitsgruppe Leitbild ihren Vorschlag für ein Leitbild vor, das<br />
für den Verein Furka-Bergstrecke, die DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG und die Stiftung<br />
Furka-Bergstrecke gemeinsam gelten soll. Der Bericht informiert über den Prozess der Leitbildentwicklung<br />
wie auch über die dabei erworbenen Erkenntnisse. Die Arbeit erfolgte im Auftrag der Präsidentenkonferenz.<br />
Der Verein Furka-Bergstrecke, die DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG und die Stiftung Furka-<br />
Bergstrecke sichern als juristisch eigenständige Organisationen gemeinsam den Erhalt und den<br />
Betrieb des Kulturgutes Furka-Bergstrecke. Diese Aufgabe lösen sie mit einer arbeitsteiligen und<br />
zugleich koordinierenden Vorgehensweise. Dadurch verhalten sie sich als Ganzes wie eine Organisation<br />
und können deshalb als Gruppe Furka-Bergstrecke bezeichnet werden.<br />
Der Managementprozess lässt sich in die Handlungsebenen normatives, strategisches und operatives<br />
Management unterteilen. Für die Gruppe Furka-Bergstrecke sind für eine gemeinsame Ausrichtung<br />
der drei Teilorganisationen das normative und das strategische Management wichtig. Das<br />
normative Management dient dem Aufbau von unternehmerischen Verständigungspotenzialen, das<br />
strategische Management dem Aufbau von (Markt-)Erfolgspotenzialen. Das Leitbild kann als Teil<br />
des normativen Managements betrachtet werden.<br />
Um mehr Personen in den Prozess der Leitbildentwicklung zu involvieren, wurden Inputs zur externen<br />
Analyse, zur internen Analyse und zu den individuellen Wertvorstellungen mit einer Online-<br />
Befragung bei den Mitgliedern des Zentralvorstandes des Vereins, bei den Verwaltungs- und Stiftungsräten<br />
eingeholt. Weiter wurde an einem ganztägigen Workshop (World-Café) mit Teilnehmenden<br />
aus dem erwähnten Personenkreis zu Fragestellungen der Leitbildentwicklung diskutiert.<br />
Der Vorschlag für das Leitbild Furka-Bergstrecke besteht aus den Teilen Vision, Mission und Kernwerte.<br />
Die einzelnen Aussagen des Leitbildes sind, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen,<br />
mit Erläuterungen versehen. Der <strong>Abschlussbericht</strong> schliesst mit Empfehlungen der Arbeitsgruppe<br />
an die Auftraggeberin für das weitere Vorgehen ab.<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung .................................................................................................................................. 4<br />
2 Grundlagen ............................................................................................................................... 4<br />
2.1 Organisationstheorie .......................................................................................................... 4<br />
2.2 Managementlehre ............................................................................................................... 6<br />
2.3 Leitbild als Instrument ......................................................................................................... 8<br />
2.4 Organisatorische Differenzierung und Integration Gruppe Furka-Bergstrecke ................. 10<br />
3 Methodik, Vorgehen und Ergebnisse ...................................................................................... 11<br />
3.1 Externe Analyse ............................................................................................................... 11<br />
3.2 Interne Analyse ................................................................................................................. 13<br />
3.3 Anspruchsgruppenanalyse ............................................................................................... 14<br />
3.4 Analyse der Wertvorstellungen ......................................................................................... 15<br />
3.5 World-Café ....................................................................................................................... 15<br />
4 Leitbild Furka-Bergstrecke ...................................................................................................... 19<br />
4.1 Vision ................................................................................................................................ 20<br />
4.2 Mission ............................................................................................................................. 20<br />
4.3 Kernwerte ......................................................................................................................... 22<br />
5 Empfehlungen für das weitere Vorgehen ................................................................................ 25<br />
6 Literaturverzeichnis ................................................................................................................. 26<br />
m Seite 2 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Darstellung von Aktiengesellschaft, Verein und Stiftung mit Gesamtauftrag 5<br />
Abbildung 2: Das neue St. Galler Management-Modell im Überblick 8<br />
Abbildung 3: Prozesse Gruppe Furka-Bergstrecke 10<br />
Abbildung 4: Entwicklung Leitbild Gruppe Furka-Bergstrecke 11<br />
Abbildung 5: Online-Befragung - wo Chancen gesehen werden 12<br />
Abbildung 6: Online-Befragung - wo Gefahren erwartet werden 12<br />
Abbildung 7: Online-Befragung - wo Stärken wahrgenommen werden 13<br />
Abbildung 8: Online-Befragung - wo Schwächen wahrgenommen werden 13<br />
Abbildung 9: Anspruchsgruppematrix 14<br />
Abbildung 10: Ausschnitt Wertvorstellungsprofil 15<br />
Abbildung 11: Gesammelte Erkenntnisse am Beispiel der Frage 1 in Runde 2 16<br />
Abbildung 12: Kontinuum unterschiedlicher Führungsstile 22<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Die drei Handlungsebenen des Management 7<br />
Tabelle 2: Gemeinsame Ziele von DFB, VFB und SFB 17<br />
Tabelle 3: Änderungen am bisherigen Vorgehen 17<br />
Tabelle 4: Abstimmung der Aktivitäten 17<br />
Tabelle 5: Worüber man gemeinsam stolz ist 17<br />
Tabelle 6: Was ist am gemeinsamen Wirken zu bemängeln 18<br />
Tabelle 7: Wer hat einen starken Einfluss 18<br />
Tabelle 8: Führungsstruktur für die Gesamtorganisation 18<br />
Tabelle 9: Kultur-Faktoren 19<br />
Tabelle 10: Originalgetreu versus Ökologie und Ökonomie 19<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
AG<br />
Aktiengesellschaft<br />
DFB<br />
DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG<br />
HSG<br />
Hochschule St. Gallen<br />
ITC<br />
Informatik Telekommunikation Communication<br />
KWO<br />
Kraftwerke Oberhasli AG<br />
MGB<br />
Matterhorn Gotthard Bahn AG<br />
NGO<br />
Non-Governmental Organization<br />
RHB<br />
Rhätische Bahn AG<br />
SBB<br />
Schweizerische Bundesbahnen<br />
SFB<br />
Stiftung Furka-Bergstrecke<br />
SH<br />
Stakeholder<br />
SWOT engl. Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities<br />
(Chancen) und Threats (Gefahren / Bedrohungen)<br />
VFB<br />
Verein Furka-Bergstrecke<br />
vgl.<br />
vergleich<br />
m Seite 3 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
1 Einleitung<br />
Der Verein Furka-Bergstrecke (VFB), die DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG (DFB) und die<br />
Stiftung Furka-Bergstrecke (SFB) sichern zusammen den Erhalt und den Betrieb des Kulturgutes<br />
Furka-Bergstrecke. Diese Auffassung entspricht dem allgemeinen Verständnis der Angehörigen<br />
der drei Organisationen. Sie bildete somit die Grundlage für die Entwicklung eines Leitbildes, das<br />
für alle drei Organisationen gelten soll.<br />
Mit der Erarbeitung dieses Leitbildes beauftragte die Präsidentenkonferenz eine Arbeitsgruppe mit<br />
Vertretern aller drei Organisationen. Der vorliegende <strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe dient dem<br />
Zweck, über das Vorgehen bei der Entwicklung des Leitbildes, die dabei gemachten Überlegungen<br />
und erhaltenen Erkenntnisse zu informieren. Damit soll Verständnis bei der Leserschaft des Berichts<br />
geschaffen werden, für die Botschaften, die mit dem Leitbild vermittelt werden.<br />
2 Grundlagen<br />
Der VFB, die DFB und die SFB sind juristisch eigenständige Organisationen. Wie lässt sich ein<br />
gemeinsames Leitbild, immerhin ein Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik und damit<br />
der Strategieentwicklung, für diese drei Organisationen begründen Die Beschäftigung mit den<br />
Grundlagen der Organisationstheorie und der Managementlehre soll uns ermöglichen, diese Frage<br />
zu beantworten.<br />
2.1 Organisationstheorie<br />
Bereits vor der Industrialisierung löste man komplexe Aufgaben bei Kirche, Militär und Staat mit<br />
einer arbeitsteiligen und zugleich koordinierenden Vorgehensweise. Damit ist bereits das Dualproblem<br />
der organisatorischen Gestaltung angesprochen:<br />
− Zunächst ist das Problem der Arbeitsteilung (organisatorische Differenzierung) zu lösen. Hier<br />
stellt sich die Frage nach der zielwirksamsten art- und mengenmässigen Zerlegung der Gesamtaufgabe<br />
in Teilaufgaben und nach der Bildung von Leistungsfähigen Organisationseinheiten.<br />
− Die aus der Arbeitsteilung resultierende Aufgabendifferenzierung und die Spezialisierung der<br />
Aufgabenträger erzeugen Komplexität und werfen zwangsläufig das Problem auf, die getrennt<br />
erledigten Teilaufgaben wieder zielgerichtet zu einer geschlossenen Leistungseinheit zusammenzuführen<br />
(organisatorische Integration).<br />
Die Gestaltungsaufgabe der Arbeitsteilung und der Arbeitsvereinigung sind untrennbar miteinander<br />
verbunden. Je stärker eine Gesamtaufgabe differenziert wird, umso mehr Anstrengungen müssen<br />
unternommen werden, um die Einzelaktivitäten wieder sinnvoll zusammenzufassen (vgl. Vahs,<br />
2007, S. 51).<br />
In der Darstellung der drei Organisationen VFB, DFB und SFB in Abbildung 1 lässt sich leicht erkennen,<br />
dass sie ihre gemeinsame Gesamtaufgabe untereinander aufgeteilt haben. Entsprechend<br />
dem Dualproblem der organisatorischen Gestaltung ist daher eine gezielte Integration nötig, um die<br />
Gesamtaufgabe erfolgreich bewältigen zu können.<br />
m Seite 4 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Abbildung 1: Darstellung von Aktiengesellschaft, Verein und Stiftung mit Gesamtauftrag<br />
Die drei Organisationen DFB, VFB und SFB verhalten sich als Ganzes gesehen ebenfalls wieder<br />
wie eine Organisation. Diese Organisation wird im Folgenden als Gruppe Furka-Bergstrecke 1 bezeichnet<br />
Sie entspricht den Merkmalen, die in der Literatur den meisten Definitionen des Begriffs<br />
Organisation gemeinsam sind.<br />
Merkmal 1: Organisationen sind zielgerichtet<br />
Die Eigenschaft der Zielgerichtetheit oder Zweckbezogenheit ist fast allen Definitionen des Organisationsbegriffs<br />
ein Merkmal, das besonders betont wird. Die Organisation ist einerseits ein Instrument,<br />
um die angestrebten Zustände zu erreichen. Andererseits bedeutet die Zielausrichtung, dass<br />
Organisationen „eigene“ Ziele haben, die sie erreichen wollen.<br />
Nun können wir uns die Frage stellen, ob eine Organisation wie die Gruppe Furka-Bergstrecke Ziele<br />
bilden und verfolgen kann. Als abstraktes Gebilde wohl nicht. Eine Organisation wird von Personen<br />
gebildet, die ihre persönlichen Ziele verfolgen, die sie alleine nicht erreichen können. Die Wiederinbetriebnahme<br />
der Furka-Bergstrecke ist ein schönes Beispiel dafür.<br />
Die Ziele für die Organisation sind zunächst einmal keine Ziele der Organisation. Erst wenn sich die<br />
Organisationsmitglieder in einem formal festgeschriebenen Prozess auf bestimmte Ziele geeinigt<br />
haben, liegen Ziele der Organisation (Organisationsziele) vor. Dabei sind Ziele, wie sie zum Beispiel<br />
in einem Unternehmensplan stehen, auf Dauer ausgelegt (vgl. Vahs, 2007, S. 11-12).<br />
Merkmal 2: Organisationen sind offene soziale Systeme<br />
Die Kennzeichnung Organisationen als „soziale Systeme“ nimmt einen unmittelbaren Bezug auf die<br />
„menschlichen Elemente“ von derartigen Systemen. Dies können beispielsweise die Personen<br />
sein, die sich in der Gruppe Furka-Bergstrecke engagieren. Die Benennung „offene Systeme“<br />
bringt zum Ausdruck, dass zwischen den Elementen des Systems und der Umwelt wechselseitige<br />
Beziehungen bestehen.<br />
Aus der Tatsache heraus, dass Organisationen aus Menschen mit eigenständigen Zielen, Wertvorstellungen<br />
und Verhaltensweisen bestehen, muss eine Lösung gefunden werden, wie sich die Individualziele<br />
und die Organisationsziele bestmöglich harmonisieren lassen (vgl. Vahs, 2007, S. 13).<br />
1 Der Bezeichnung Dampfbahn wird in der Bezeichnung für die Gruppe nicht verwendet, weil nur die Aktiengesellschaft in<br />
ihrem Namen diese Bezeichnung nutzt. Dies, obwohl sie gemäss ihrem Zweckbeschrieb im Handelsregister neben<br />
Dampf auch andere Traktionsarten einsetzen kann.<br />
m Seite 5 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Die Gruppe Furka-Bergstrecke, als soziales System, begrenzt also zunächst einmal den Möglichkeitsreichtum<br />
seiner Mitglieder. Auf der anderen Seite kann die Organisation als Ganzes nur überleben,<br />
solange gewisse überindividuelle Strukturmuster und Prozesse gewährleistet sind (vgl. Willke,<br />
2011, S. 19).<br />
Merkmal 3: Organisationen weisen eine formale Struktur auf<br />
Um eine zielgerichtete Zusammenarbeit der Organisationsmitglieder zu ermöglichen, bedarf es<br />
eines festen und in Regeln formalisierten Beziehungsgefüges. Diese organisatorischen Regeln<br />
können als Ordnung bezeichnet werden.<br />
Am Beispiel der Gruppe Furka-Bergstrecke kann gezeigt werden, dass man es als notwendig erachtete,<br />
zur Bewältigung der Gesamtaufgabe eine formale Struktur zu schaffen mit Aktiengesellschaft,<br />
Verein und Stiftung. Damit können die Zuständigkeiten für die einzelnen Funktionen verbindlich<br />
geregelt werden. Mit entsprechenden formalen Regeln lässt sich Zusammenarbeit innerhalb<br />
der Gruppe Furka-Bergstrecke festlegen (vgl. Vahs, 2007, S. 14).<br />
Fazit: Der Verein Furka-Bergstrecke, die DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG und die Stiftung<br />
Furka-Bergstrecke lösen in einer arbeitsteiligen und zugleich koordinierenden Vorgehensweise<br />
eine gemeinsame Aufgabe<br />
Die drei Organisationen zeigen als Ganzes die wesentlichen Merkmale einer Organisation,<br />
die fortan als Gruppe Furka-Bergstrecke bezeichnet wird<br />
Die Gruppe Furka-Bergstrecke bedarf eines formellen Prozesses zur Festlegung ihrer Ziele<br />
sowie organisatorischen Regeln für die zielgerichtete Zusammenarbeit ihrer Teile<br />
2.2 Managementlehre<br />
Der Begriff Management leitet sich aus dem Lateinischen „manum agere“ ab und bedeutet „an der<br />
Hand führen“, konkret ein Pferd an der Hand führen. Heute geht es darum, ein Unternehmen zu<br />
führen. Dabei wird durch aktives Handeln und unter Nutzung von Ressourcen ein vorgegebenes<br />
Ergebnis erzielt. Der Begriff Management hat zwei Bedeutungen. Einerseits wird er personenbezogen<br />
verwendet und bezeichnet die Gruppe von Führungspersonen in Unternehmen (Management<br />
als Institution). Andererseits wird er ausführend und handelnd verwendet (Management als Funktion).<br />
Wie bereits erläutert, handelt es sich bei Organisationen um offene soziale Systeme. Für das Verständnis<br />
von funktionalem Management ist es dienlich, sich darüber Gedanken zu machen, aus<br />
welchen Hauptelementen soziale Systeme bestehen (vgl. Senn, 2010, S. 42 ff.).<br />
I Ganzheitlichkeit<br />
Soziale Systeme sind ein Ganzes mit Sinn und Zweck und einem Input (Ressourcen) und einem<br />
Output (Leistungen)<br />
II Systemumwelt<br />
Sie haben eine Umwelt, die das soziale System in einen Anpassungs- (Einpassungs-)druck<br />
bringen kann<br />
III Vernetztheit<br />
Sie sind vernetzt und haben eine Eigendynamik<br />
IV Komplexität<br />
Vernetztheit und Eigendynamik verursachen Komplexität<br />
m Seite 6 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
V Gestaltung und Lenkung<br />
Soziale Systeme werden von aussen mitbestimmt und somit (indirekt) auch gesteuert. Soziale<br />
Systeme sind aber auch geschlossen und haben damit die Möglichkeit, eine eigene Systemsteuerung<br />
aufzuziehen (Selbststeuerung)<br />
VI Ordnung<br />
Sie haben eine Ordnung mit entsprechenden Strukturen und Prozessen und mit Selbstorganisation<br />
VII Entwicklung<br />
Soziale Systeme entwickeln sich über Lernen<br />
Die Aufzählung der Hauptelemente sozialer Systeme macht deutlich, dass es nicht genügen kann,<br />
den Prozess des Organisierens darin zu sehen, Aufgaben und Funktionen klar festzulegen und<br />
deren Erfüllung durch Handlungsanweisungen, festgelegte Kommunikations-, Entscheidungs-,<br />
Koordinations- und Kontrollsysteme zu gewährleisten. Ein solches Vorgehen wäre dann erfolgreich,<br />
wenn Aufgaben und Funktionen klar vorhersehbar sind, die Umwelt stabil ist, Produkte und Dienstleistungen<br />
standardisierbar sind und sich die Menschen in der Organisation in vorgesehener Weise<br />
verhalten. Dass dem nicht so ist, ist allgemein bekannt. Neben dem heute oftmals vorherrschenden<br />
analytischen linearen Denken müssen Manager 2 fähig sein, die zahlreichen Wirkungszusammenhänge<br />
bei der Führung von Unternehmen zu berücksichtigen. Wer zum Beispiel eine Unternehmensstrategie<br />
formuliert, muss neben ökonomischen auch an ökologische und kulturelle Folgen<br />
denken. Es sind die Interessen verschiedener Anspruchsgruppen zu berücksichtigen.<br />
Die Unterteilung des Managementprozesses entsprechend dem „Neuen St. Galler Management-<br />
Modells“ 3 in die Handlungsebenen normatives, strategisches und operatives Management ermöglicht<br />
es, die Führung auf die unterschiedliche Kriterien auszurichten. Sind es auf normativer Ebene<br />
Kriterien wie Sinn und Legitimität, so sind es auf strategischer Ebene Effektivitätskriterien, wie<br />
Wettbewerbsfähigkeit und Struktur. Auf der operativen Ebene ist das Effizienzkriterium im Sinn von<br />
Produktivität und Wirtschaftlichkeit wegleitend (vgl. Senn, 2010, S. 67 ff).<br />
Konflikte zwischen<br />
Interessengruppen<br />
Komplexität und<br />
Ungewissenheit<br />
der Marktbedingungen<br />
Knappheit der<br />
Produktionsfaktoren<br />
Normatives Management<br />
Legitimationsdruck<br />
(Konsensproblem)<br />
Strategisches Management<br />
Innovationsdruck<br />
(Steuerungsproblem)<br />
Operatives Management<br />
Kostendruck<br />
(Effizienzproblem)<br />
Aufbau<br />
unternehmenspolitischer<br />
Verständigungspotenzialen<br />
Aufbau<br />
geschäftsstrategischer<br />
(Markt-)Erfolgspotenziale<br />
Aufbau betrieblicher<br />
Produktivitätspotenziale<br />
Tabelle 1: Die drei Handlungsebenen des Management (Dubs, Euler, Rüegg-Stürm & Wyss, 2004, S. 2/25)<br />
2 Bezeichnung gilt für Personen beiderlei Geschlechts<br />
3 Das St. Galler Management-Modell ist ein in den 1960er Jahren an der Universität entwickelter Management-<br />
Bezugsrahmen. Das überarbeitete Modell ist seit 2002 als „Neues St. Galler Management-Modell oder auch als „HSG-<br />
Ansatz einer integrierten Managementlehre“ bekannt<br />
m Seite 7 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
In Abbildung 2 ist das neue St. Galler Management-Modell dargestellt. Ohne auf Details einzugehen,<br />
sieht man, in welchem Kontext die Begriffskategorie 4 „Prozesse“ steht.<br />
Abbildung 2: Das neue St. Galler Management-Modell im Überblick (Dubs, Euler, Rüegg-Stürm & Wyss, 2004, S. 1/70)<br />
Fazit: Die Vernetztheit und Dynamik offener sozialen Systeme führt zu Komplexität<br />
Soziale Systeme zu führen setzt die Fähigkeit voraus, komplexe Systeme zu gestalten, zu<br />
lenken und zu Entwickeln<br />
Die Unterteilung des Managementprozesses in normatives, strategisches und operatives<br />
Management ermöglicht es, die Führung auf unterschiedliche Kriterien auszurichten<br />
2.3 Leitbild als Instrument<br />
Das Leitbild ist ein Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik und ist damit Teil des normativen<br />
Managements. Der Begriff normativ bezieht sich, wie wir bereits gesehen haben, auf die<br />
ethische Legitimation der unternehmerischen Tätigkeit. Im Vordergrund stehen dabei ein hohes<br />
Mass an Responsiveness 5 im Hinblick auf die gesellschaftliche Wertorientierungen und die Anerkennung<br />
moralischer Eigenwerte.<br />
In der Literatur existieren verschieden Ansätze zur Darstellung des Leitbildes. Für die Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
entscheiden wir uns für ein Leitbild mit den Bestandteilen Vision, Mission und<br />
4 Das neue St. Galler Management-Modell kennt folgende zentrale Begriffskategorien: Umweltsphären, Anspruchsgruppen,<br />
Interaktionsthemen, Ordnungsmomente, Prozesse und Entwicklungsmodi (vgl. Dubs, Euler, Rüegg-Stürm & Wyss,<br />
2004, S. 1/69 ff.)<br />
5 Übersetzung der Arbeitsgruppe: Soziale Empfindlichkeit<br />
m Seite 8 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Kernwerte. Unabhängig von der Darstellungsform soll das Leitbild folgenden Nutzen schaffen (vgl.<br />
Lombriser & Abplanalp, 2005, S.229):<br />
− Als Orientierungsraster Klarheit für die in der Organisation tätigen Personen schaffen<br />
− Problembewusstsein schaffen und Veränderungsanstösse geben<br />
− Ein höhere Verbindlichkeit und Beständigkeit schaffen<br />
− Die Kommunikation und Koordination zwischen den Teilbereichen fördern<br />
− Der Organisation eine Identität verschaffen<br />
− Als „Leitstern des Handelns“ dienen<br />
Vision<br />
Die Vision beschreibt die Vorstellung davon, wie das Unternehmen in Zukunft aussehen soll. Dabei<br />
gibt sie langfristige Ziele vor, die herausfordernd sind und von denen eine motivierende Wirkung<br />
ausgeht. Man erinnert sich leicht an sie. Je solider eine Vision ausgearbeitet ist, desto mehr Zeit<br />
kann später durch die Vermeidung von Einzelfragen gespart werden. In der Vision sollte Antworten<br />
auf folgende Fragen gegeben werden (vgl. Kerth & Asum, 2008, S. 271 ff.):<br />
− Wo sieht die Unternehmensführung das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren<br />
− Wo sollen die Schwerpunkte liegen<br />
− Was soll die das Unternehmen in Zukunft kennzeichnen und prägen<br />
− Was soll das Unternehmen erreichen<br />
Mission<br />
Die Mission beschreibt die grundsätzlichen, vom Unternehmen zu verfolgenden Aufgaben. Sie definiert,<br />
warum die Organisation überhaupt existiert und erläutert den damit verbundenen Beitrag zur<br />
Gesellschaft. Die Mission sollte, in einfachen Worten formuliert, die Identität und Persönlichkeit des<br />
Unternehmens repräsentieren. Dabei sollte sie mindestens zwei zentrale Elemente umfassen: Unternehmenszweck<br />
und Strategien. Dadurch wird neben der Bedeutung für die Gesellschaft auch für<br />
die im Unternehmen tätigen Menschen verdeutlicht, warum sie als begabte und motivierte Menschen<br />
ihr Talent in genau dieser Organisation einbringen. Die Mission sollte Antworten auf folgende<br />
Fragen geben (vgl. Kerth & Asum, 2008, S. 272):<br />
− Woher kommt das Unternehmen, wo sind die Wurzeln<br />
− Welche Traditionen hat das Unternehmen<br />
− Wie ist die geschichtliche Entwicklung<br />
− Was ist die Aufgabe des Unternehmens<br />
− Was ist der Sinn in der Tätigkeit<br />
− Was macht das Unternehmen erfolgreich<br />
− Welches sind die Kernkompetenzen<br />
− Wo bestehen Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz<br />
Kernwerte<br />
Die Kernwerte ist die Beschreibung der Grundsätze, nach denen sich die in dem Unternehmen tätigen<br />
Menschen verhalten. Die Elemente, aus denen die Kernwerte zu formen sind, sind Verhaltensnormen<br />
und zentrale Werte, an die das Unternehmen glaubt. Dabei gelten die Kernwerte sowohl<br />
für das Miteinander zwischen den Menschen im Unternehmen als auch für die Handlungen zu externen<br />
Gruppen (vgl. Kerth & Asum, 2008, S. 272.):<br />
m Seite 9 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Was ist das Selbstverständnis<br />
Welche Wertvorstellungen vertritt das Unternehmen<br />
Wer ist das Unternehmen<br />
Welche Eigenschaften zeichnen das Unternehmen und die Produkte aus<br />
Fazit: Das Leitbild ist ein Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik und ist damit Teil des<br />
normativen Managements.<br />
Das Leitbild der Gruppe Furka-Bergstrecke besteht aus den Teilen Vision, Mission und<br />
Kernwerte.<br />
2.4 Organisatorische Differenzierung und Integration Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
Kommen wir auf die anfangs gestellte Frage zurück, wie sich ein gemeinsames Leitbild für die drei<br />
Organisationen DFB, VFB und SFB begründen lässt<br />
Die drei Organisationen lösen bereits heute mit einer arbeitsteiligen und zugleich koordinierenden<br />
Vorgehensweise eine Gesamtaufgabe. Dabei zeigt sich, dass besonders bei der organisatorischen<br />
Integration ein grosses Konfliktpotenzial besteht und der Prozess optimaler gestaltet werden könnte.<br />
Trotzdem zeigen die drei Organisationen als Ganzes die wesentlichen Merkmale einer Organisation.<br />
Organisationen sind zielgerichtet, stellen ein offenes soziales System dar und weisen eine<br />
formale Struktur auf. Für die Gruppe Furka-Bergstrecke bedarf es somit eines formellen Prozesses<br />
zur Festlegung ihrer übergeordneten Ziele sowie organisatorischen Regeln für die zielgerichtete<br />
Zusammenarbeit ihrer Teile.<br />
Ein möglicher Lösungsansatz zur organisatorischen Differenzierung und Integration bei der Gruppe<br />
Furka-Bergstrecke ist in Abbildung 3 dargestellt. Dabei führen DFB, VFB und SFB den normativen<br />
Orientierungsprozess und den strategischen Entwicklungsprozess auf der Ebene Gruppe Furka-<br />
Bergstrecke gemeinsam durch. Die notwendigen Leistungen zum Erreichen der gemeinsam vereinbarten<br />
übergeordneten Ziele sind durch die einzelnen Organisationen der Gruppe Furka-<br />
Bergstrecke zu erbringen.<br />
Abbildung 3: Prozesse Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
m Seite 10 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
3 Methodik, Vorgehen und Ergebnisse<br />
In der Literatur findet man zwei grundsätzliche Auffassungen, wie ein Leitbild entwickelt wird. Ein<br />
Leitbild kann durch „visionäre“ Führungspersönlichkeiten geschaffen werden oder das Resultat<br />
eines kollektiven Prozesses innerhalb einer Organisation sein. Ohne den Stellenwert der visionären<br />
Führungspersönlichkeiten zu unterschätzen, ohne sie wäre eine nostalgische Bahnfahrt über die<br />
Furka heute nicht möglich, wählen wir bei unserem Vorgehen den kollektiven Prozess der Leitbildentwicklung.<br />
„Plans are nothing, planning is everything“. Damit drückte US-Präsident Dwight Eisenhower einst<br />
aus, dass die während der Prozessarbeit geführten Diskussionen und Auseinandersetzungen unter<br />
den Beteiligten mindestens ebenso wichtig sind wie der entstandene Output. Dies gilt im besonders<br />
bei der Erarbeitung eines Leitbildes. Damit das Leitbild nicht zu einem toten Alibi-Papier wird, müssen<br />
sich die Mitglieder der Organisation in dessen Entwicklungsprozess einbringen können. Dabei<br />
darf auch einmal, im positiven Sinne, gestritten werden. Hauptsächlich die Machtpromotoren müssen<br />
die Leitbildentwicklung aktiv mittragen und unterstützen. Andernfalls zeigt die Erfahrung, dass<br />
wichtige Entscheidungen durch die Machtverhältnisse in Unternehmen viel stärker beeinflusst werden,<br />
als durch die Vorgaben, wie sie im Leitbild stehen.<br />
In Abbildung 4 sind die einzelnen Phasen in der Entwicklung des Leitbildes Furka-Bergstrecke 6<br />
dargestellt. Daraus ist bereits jetzt ersichtlich, dass die Arbeitsgruppe Leitbild der Auftraggeberin<br />
einen Vorschlag übergeben wird. Die Auftraggeberin wird entscheiden, wie aus dem Vorschlag das<br />
verabschiedete Leitbild der Gruppe Furka-Bergstrecke werden soll.<br />
Abbildung 4: Entwicklung Leitbild Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
3.1 Externe Analyse<br />
Methodik<br />
Mit der externen Analyse versuchen wir herauszufinden, welche Entwicklungen im Umfeld der<br />
Gruppe Furka-Bergstrecke in den kommenden fünf Jahren eine potenzielle Chance oder Gefahr<br />
bedeuten. Die Gruppe Furka-Bergstrecke hat selbst keinen Einfluss auf die Umweltentwicklungen.<br />
6 Mit „Leitbild Furka-Bergstrecke“ wird das Leitbild der Gruppe Furka-Bergstrecke bezeichnet<br />
m Seite 11 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Vorgehen<br />
Die in den letzten Jahren erstellten Unterlagen der DFB, des VFB und der SFB, soweit sie der Arbeitsgruppe<br />
Leitbild zur Verfügung standen, wurden nach Aussagen zu Chancen und Gefahren<br />
gesichtet. Das Ergebnis wurde in einem Excel-Dokument festgehalten 7 . Mit einer Online-Befragung<br />
wurden die Mitglieder aus Verwaltungsrat DFB, Zentralvorstand VFB und Stiftungsrat gebeten, jeweils<br />
drei Chancen und Gefahren zu benennen.<br />
Ergebnisse<br />
In Abbildung 5 und Abbildung 6 sind die Ergebnisse aus der Online-Befragung dargestellt.<br />
Abbildung 5: Online-Befragung - wo Chancen gesehen werden<br />
Abbildung 6: Online-Befragung - wo Gefahren erwartet werden<br />
7 Das Dokument „Aussagen bisheriger SWOT-Analysen“ kann bei Max Graf (max.graf@<strong>dfb</strong>.ch) angefordert werden.<br />
m Seite 12 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
3.2 Interne Analyse<br />
Methodik<br />
Mit der internen Analyse versuchen wir Kenntnisse über die heutigen Stärken und Schwächen der<br />
Gruppe Furka-Bergstrecke zu erhalten. Sie soll aufzeigen, wo wir gegenüber der Konkurrenz Stärken<br />
(strategische Erfolgspositionen bzw. Wettbewerbsvorteile) und wo Schwächen aufweisen.<br />
Vorgehen<br />
Die in den letzten Jahren erstellten Unterlagen der DFB, des VFB und der SFB, soweit sie der Arbeitsgruppe<br />
Leitbild zur Verfügung standen, wurden nach Aussagen zu Stärken und Schwächen<br />
gesichtet. Das Ergebnis wurde in einem Excel-Dokument 8 festgehalten. Mit der Online-Befragung<br />
wurden die Befragungsteilnehmenden gebeten, jeweils drei Stärken und Schwächen zu benennen.<br />
Ergebnisse<br />
In Abbildung 7 und Abbildung 8 sind die Ergebnisse aus der Online-Befragung dargestellt.<br />
Abbildung 7: Online-Befragung - wo Stärken wahrgenommen werden<br />
Abbildung 8: Online-Befragung - wo Schwächen wahrgenommen werden<br />
8 Das Dokument „Aussagen bisheriger SWOT-Analysen“ kann bei Max Graf (max.graf@<strong>dfb</strong>.ch) angefordert werden.<br />
m Seite 13 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
3.3 Anspruchsgruppenanalyse<br />
Methodik<br />
Damit ein Unternehmen seine eigenen Ziele erreichen kann, ist es in einem dauernden Leistungsaustausch<br />
mit seinen Anspruchsgruppen (Stakeholders). Anspruchsgruppen können Mitarbeitende,<br />
Kunden, Kapitalgeber, Lieferanten, der Staat und die Öffentlichkeit (Medien, NGOs) sein. Gewisse<br />
Modelle, wie das „Neue St. Galler Management-Modell“, zählen auch die Gruppe der Konkurrenten<br />
zu den Anspruchsgruppen. Die Anspruchsgruppenanalyse bezweckt die Identifikation der wesentlichen<br />
Anspruchsgruppen und die Erkenntnis darüber, wie stark die Abhängigkeit zwischen dem<br />
Unternehmen und den einzelnen Anspruchsgruppen ist. Diese Abhängigkeiten lassen sich zusätzlich<br />
noch als Chancen und Gefahren darstellen. Bei der Anspruchsgruppenanalyse der Gruppe<br />
Furka-Bergstrecke hat die Arbeitsgruppe Leitbild auf diese zusätzliche Auswertemöglichkeit verzichtet.<br />
Vorgehen<br />
Eine Anspruchsgruppenanalyse wurde durch die Arbeitsgruppe Leitbild durchgeführt. In der Analyse<br />
sind die Anspruchsgruppen aufgeführt und der gegenseitige Leistungsaustausch zwischen den<br />
einzelnen Anspruchsgruppen und der Furka-Bergstrecke beschrieben. Zusätzlich wurde eine Einflussmatrix<br />
erstellt.<br />
Ergebnisse<br />
Die Anspruchsgruppenanalyse steht als Arbeitsdokument 9 zu Verfügung. Die daraus abgeleitete<br />
Anspruchsgruppenmatrix ist in Abbildung 9 dargestellt.<br />
Abbildung 9: Anspruchsgruppematrix<br />
9 Das Dokument „Anspruchsgruppenanalyse“ kann bei Max Graf (max.graf@<strong>dfb</strong>.ch) angefordert werden.<br />
m Seite 14 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
3.4 Analyse der Wertvorstellungen<br />
Methodik<br />
Die Wertvorstellungen der obersten Führungskräfte wirken sich auf das Unternehmen aus. Damit<br />
das Unternehmen kongruent auf seine Anspruchsgruppen wirken kann, sind die individuellen Wertvorstellungen<br />
innerhalb des Führungsteams zu erfassen und explizit zu machen sowie in einem<br />
Wertvorstellungsprofil für das Unternehmen zu harmonisieren. Abbildung 10 zeigt einen Ausschnitt<br />
aus einem Wertvorstellungsprofil mit den drei Faktoren Risikoneigung, Innovationsneigung und<br />
Führungsstil.<br />
Abbildung 10: Ausschnitt Wertvorstellungsprofil<br />
Vorgehen<br />
Eine Liste mit mehr als 60 möglichen Faktoren für das Wertvorstellungsprofil wurde durch die Arbeitsgruppe<br />
Leitbild erstellt. In der Online-Befragung wurden die Teilnehmenden schlussendlich<br />
noch zu den folgenden Faktoren befragt:<br />
− Führung der Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
− Führungsstil<br />
− Mission<br />
− Umgang mit Wissen innerhalb der Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
− Kommunikation innerhalb der Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
− Kommunikation nach aussen<br />
− Anzahl Mitglieder<br />
− Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Zielen beim Neuaufbau von Lokomotiven<br />
− Traktionsarten auf der Strecke Gletsch - Oberwald<br />
Ergebnisse<br />
Ergebnisse der Online-Befragung sind dem Bericht 10 „Ergebnisse aus der Befragung der Mitglieder<br />
des Stiftungsrates SFB, des Verwaltungsrates DFB AG und des Zentralvorstandes VFB vom 3. Bis<br />
27. Juni 2011 durch die Arbeitsgruppe Leitbild“ zu entnehmen. Eine Harmonisierung der individuellen<br />
Wertvorstellungen zu einem Wertvorstellungsprofil der Gruppe Furka-Leitbild erfolgte nicht.<br />
3.5 World-Café<br />
Methodik<br />
Die World-Café-Veranstaltung dient dazu, die Ergebnisse der Online-Befragung in einem erweiterten<br />
Kreis zu diskutieren. Die Gespräche sollen dabei in einer entspannten Atmosphäre stattfinden<br />
und das Ziel verfolgen, neue Perspektiven, Denkweisen und Handlungsoptionen für die Gruppe<br />
Furka-Bergstrecke aufzuzeigen.<br />
10 Der Bericht kann bei Max Graf (max.graf@<strong>dfb</strong>.ch) angefordert werden.<br />
m Seite 15 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Vorgehen<br />
In drei Gesprächsgruppen, die jeweils um einen Tisch sitzen, wird während 15 Minuten eine durch<br />
den Moderator gestellte Frage diskutiert. Die Ergebnisse werden dabei auf das Tischtuch geschrieben<br />
und gezeichnet. Nach jeweils drei Fragen werden die Tischtücher durch die Gruppen im Plenumsraum<br />
aufgehängt. Danach bleibt der Gruppe noch Zeit, die wesentlichen Erkenntnisse aus<br />
den Diskussionen auf ein Flipchart (Abbildung 11) zu übertragen, auf dem die Erkenntnisse aller<br />
drei Gesprächsgruppen zu jeweils einer Frage gesammelt werden. Danach werden die Erkenntnisse<br />
durch alle Teilnehmende angeschaut. Bei dieser Gelegenheit können Verständnisfragen gestellt<br />
werde.<br />
Abbildung 11: Gesammelte Erkenntnisse am Beispiel der Frage 1 in Runde 2<br />
Gesamthaft werden drei Gesprächsrunden durchgeführt mit unterschiedlicher Zusammensetzung<br />
der Teilnehmenden. Für die Gespräche gelten die folgenden Spielregeln:<br />
− Lege den Fokus auf das, was wichtig ist<br />
− Höre hin, um wirklich zu verstehen<br />
− Rede über das, was Dich gerade bewegt<br />
− Lasse andere an Deinen Erfahrungen teilhaben<br />
− Trage eigene Ansichten bei<br />
− Horche auf Zwischentöne<br />
− Sammle Ideen und verknüpfe sie zu einem grösseren Ganzen<br />
− Entdecke neue Erkenntnisse und tiefer gehende Fragen<br />
− Visualisiere Erkenntnisse und Einsichten<br />
− Schreibe und male auf die Tischdecke<br />
− Habe Spass<br />
m Seite 16 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Ergebnisse<br />
Die wesentlichen Erkenntnisse der World-Café-Veranstaltung vom 29. Oktober 2011sind nachfolgend<br />
zusammengestellt:<br />
Welches sind die gemeinsamen Ziele, die von den drei Organisationen VFB, DFB und SFB verfolgt<br />
werden<br />
Gemeinsame Ziele<br />
Nennungen<br />
Erhalt des Kulturgutes 3<br />
Nachhaltigkeit sicherstellen 2<br />
Freiwilligenarbeit 1<br />
Zusammenarbeit 1<br />
Tabelle 2: Gemeinsame Ziele von DFB, VFB und SFB<br />
Wie wurden bislang die gemeinsamen Ziele für die drei Organisationen VFB, DFB und SFB erarbeitet<br />
und was sollte allenfalls am bisherigen Vorgehen verändert werden<br />
Änderungen am bisherigen Vorgehen<br />
Nennungen<br />
Koordination und engere Zusammenarbeit bei der Festlegung der übergeordneten<br />
Ziele, Vernetzung, breite Basis<br />
6<br />
Professionalisierung der Supportfunktionen 1<br />
„Graue Eminenzen“ einbinden 1<br />
Tabelle 3: Änderungen am bisherigen Vorgehen<br />
Wie erfolgte bislang die Abstimmung der Aktivitäten der drei Organisationen VFB, DFB und SFB im<br />
Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele und was sollte allenfalls am bisherigen Vorgehen<br />
verändert werden<br />
Abstimmung der Aktivitäten<br />
Nennungen<br />
Kommunikation partnerschaftlich und als Dialog 2<br />
Rolle der einzelnen Organisationen im „Ganzen“ erkennen, speziell nachdem<br />
2<br />
Oberwald erreicht ist<br />
Umsetzung der Strategie durch Geschäftsleitung DFB mit Ressourcenanträge an 1<br />
VFB und SFB<br />
Die Abstimmung untereinander ist zu formalisieren 1<br />
Tabelle 4: Abstimmung der Aktivitäten<br />
Worauf können die drei Organisationen VFB, DFB und SFB gemeinsam stolz sein<br />
Worüber man gemeinsam Stolz ist<br />
Nennungen<br />
Pioniere, die mit Widerstand und Ausdauer mit der Inbetriebnahme der Bergstrecke<br />
mit historischem Rollmaterial ihre Ziele erreichten<br />
5<br />
Schaffen eines anerkannten Bahnunternehmens mit hohem Bekanntheitsgrad<br />
5<br />
und hoher Akzeptanz<br />
Auf das grosse Netzwerk von Menschen mit dem Furka-Virus, die freiwillig für die 4<br />
Bahn arbeiten und / oder spenden<br />
Nutzen für die Region 2<br />
Tabelle 5: Worüber man gemeinsam stolz ist<br />
m Seite 17 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Was gibt es für die drei Organisationen VFB, DFB und SFB in ihrem gemeinsamen Wirken zu bemängeln<br />
Mängel im gemeinsamen Wirken<br />
Nennungen<br />
Wirken geprägt durch die Kultur der Pioniere, zeigt sich durch Eigenmächtigkeiten,<br />
Rivalitäten, zu wenig Transparenz und mangelndes gegenseitiges Verständ-<br />
7<br />
nis<br />
Historisch gewachsene Organisation ist im Umbruch, mittel- und langfristige Planung<br />
fehlt<br />
3<br />
Eigentumsverhältnisse als Folge von Sponsoren-Vorgaben 2<br />
Tabelle 6: Was ist am gemeinsamen Wirken zu bemängeln<br />
Welche Gruppen oder Einzelpersonen haben einen starken Einfluss auf die drei Organisationen<br />
VFB, DFB und SFB und was macht deren Macht aus<br />
Einzelpersonen oder Gruppen<br />
Nennungen<br />
„Unersetzliche“ und „Insider“, Abhängigkeit von deren Wissen, Kompetenzen und 3<br />
Erfahrungen<br />
Präsidenten, wegen deren Funktion 2<br />
Geschäftsleiter 1<br />
Bausektion, wegen den Personen 1<br />
Lokgruppe, wegen den Personen 1<br />
Matterhorn Gotthard Bahn AG 1<br />
Kunden 1<br />
Tabelle 7: Wer hat einen starken Einfluss<br />
Die drei Organisationen VFB, DFB und SFB bilden ein Ganzes. Wie sollte die Führungsstruktur für<br />
die Gesamtorganisation aussehen<br />
Führungsstruktur<br />
Nennungen<br />
Regelmässige gemeinsame Koordination und Abstimmung der Gesamtausrichtung<br />
auf normativer und strategischer Ebene<br />
4<br />
Innerhalb der Leitplanken der normativen und strategischen Gesamtausrichtung 1<br />
bestimmen die einzelnen Organisationen ihre normative Orientierung, ihre strategische<br />
Entwicklung und ihr operatives vorgehen<br />
Die DFB AG bereitet die mittelfristige Planung vor 1<br />
Es soll keine Gesamtorganisation gebildet werden 1<br />
Es darf keine Könige geben 1<br />
Tabelle 8: Führungsstruktur für die Gesamtorganisation<br />
m Seite 18 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Kultur kann als die Summe aller Überzeugungen definiert werden, die eine Gemeinschaft im Laufe<br />
der Zeit entwickelt hat, um mit Problemen der internen Integration (Zusammenhalt) sowie externen<br />
Anpassungen (Überleben) fertig zu werden. Welche Kultur-Faktoren werden für den Erfolg der<br />
Dampfbahn Furka-Bergstrecke künftig entscheidend sein<br />
Kultur-Faktoren<br />
Nennungen<br />
Freiwilligenarbeit, Freude an der Zusammenarbeit, erleben von Respekt, offene<br />
5<br />
Kommunikation<br />
Nostalgie 2<br />
Nutzen für Region und Partner 2<br />
Dampfbetrieb 1<br />
Eigene Geschichte 1<br />
Professionalisierung 1<br />
Einheitliches Erscheinungsbild 1<br />
Erlebnis 1<br />
Tabelle 9: Kultur-Faktoren<br />
Die Wiederherstellung eines originalgetreuen Zustandes der Bergstrecke und des Rollmaterials<br />
unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Aspekten ist schwierig.<br />
Wie soll mit dieser Problematik umgegangen werden<br />
Originalgetreu versus Ökologie und Ökonomie<br />
Nennungen<br />
Wirkung auf Zielgruppen beachten 4<br />
Vorgaben durch Gesetze, Arbeitssicherheits- und Umweltbestimmungen sowie<br />
2<br />
Vorgaben des Bundesamtes für Verkehr sind zwingend einzuhalten<br />
Möglichst originalgetreue Instandsetzung anstreben, wegen Ökonomie und Ökologie<br />
eventuell andere Techniken nutzen (z.B. Elektro statt Dampf)<br />
1<br />
Vom Wünschbaren zum Machbaren 1<br />
Tabelle 10: Originalgetreu versus Ökologie und Ökonomie<br />
4 Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
In den Vorschlag Leitbild Furka-Bergstrecke der Arbeitsgruppe Leitbild sind die aus den Analysen,<br />
der Online-Befragung und dem World-Café erhaltenen Informationen eingeflossen. Direkt beteiligt<br />
an der Formulierung des Leitbildes waren jedoch nur die Mitglieder der Arbeitsgruppe. Das Leitbild<br />
basiert somit auf dem Wissen 11 von sechs Personen. Damit ist erklärt, wieso die Arbeitsgruppe der<br />
Auftraggeberin nur einen Vorschlag für ein Leitbild Furka-Bergstrecke übergeben kann. Die Auftraggeberin<br />
hat zu entscheiden, wie aus dem Vorschlag das verbindliche Leitbild der Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
wird. Dabei hat sie den Aspekt zu berücksichtigen, dass ein Leitbild in der Regel<br />
dann gelebt wird, wenn die Menschen in der Organisation es akzeptieren. Dies geschieht nur,<br />
wenn die Führungskräfte Vorbilder sind für die Umsetzung der Werte, der ethischen Grundsätze<br />
und der Verhaltensweisen, die mit dem Leitbild kommuniziert werden. Einen möglichen Weg stellt<br />
die Arbeitsgruppe Leitbild in Abbildung 3 auf Seite 10 vor.<br />
Wie bereits im Kapitel 2.3, Leitbild als Instrument, erklärt, besteht das Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
aus den Teilen Vision, Mission und Kernwerte. Mit „Wir“ ist die Gruppe Furka-Bergstrecke gemeint,<br />
also der Verein, die Aktiengesellschaft und die Stiftung.<br />
11 Wissen entsteht im Kopf des Menschen als Produkt des Lernprozesses, wenn er die Information verarbeitet, indem er<br />
sie mit den vorhandenen Wissensverständnissen vernetzt (Hasler Roumois, 2010, S.43).<br />
m Seite 19 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
4.1 Vision<br />
Wir - die Gruppe Furka-Bergstrecke, bestehend aus Verein, Aktiengesellschaft und Stiftung - wollen<br />
mit dem Kulturgut Furka-Bergstrecke eine exklusive touristische Attraktion in der Mitte der<br />
Schweizer Alpen an der Furka sein.<br />
Erläuterung: Damit sagen wir aus, dass die Sicherung des Kulturgutes Furka-Bergstrecke<br />
nicht einem Selbstzweck dient. Wir wollen mit dem Betrieb der Bahn eine touristische<br />
Funktion mit hoher Anziehungskraft erfüllen.<br />
Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gotthard Regionen,<br />
insbesondere des Urserentals und des Goms leisten.<br />
Erläuterung: Wir wollen mit einer guten Reputation den Bekanntheitsgrad der Gotthard Regionen<br />
mit einer touristischen Perle stärken. Über diesen Hebel wollen wir zur wirtschaftlichen<br />
Entwicklung der Gotthard Regionen beitragen.<br />
Wir wollen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Altersstufen von der Furka-Bergstrecke<br />
begeistern, damit sie sich uns anschliessen und mithelfen, den Erhalt und den Betrieb unserer<br />
Nostalgie-Bahn für kommende Generationen zu sichern.<br />
Erläuterung: „Unterschiedlicher Herkunft“ bezieht sich auf die Nationalität und den Beruf. Mit<br />
„unterschiedlicher Altersstufen“ setzen wir uns das Ziel, vermehrt jüngere Menschen<br />
für die Furka-Bergstrecke zu begeistern. Der VFB hat sich zum Ziel gesetzt,<br />
von heute rund 8‘000 Mitgliedern bis zum Jahr 2015 auf 9‘500 Mitglieder<br />
anzuwachsen.<br />
4.2 Mission<br />
Wir erinnern uns dankbar unserer Pioniere, die gegen alle Widerstände und mit Beharrlichkeit die<br />
Wiederinbetriebnahme der Furka-Bergstrecke erreichten, das Kulturgut retteten und damit Geschichte<br />
schrieben.<br />
Erläuterung: Mit der Inbetriebnahme der Strecke Gletsch-Oberwald fand die Pionierphase der<br />
Furka-Bergstrecke ihren Abschluss. Das Ziel, die Wiederinbetriebnahme der<br />
Bergstrecke, war erreicht.<br />
Momentan befindet sich die Gruppe Furka-Bergstrecke in einer Phase der Neuorientierung,<br />
bestimmte Elemente der bisherigen Kultur werden sich ändern müssen.<br />
Dies führt zu Ängsten und Widerständen vornehmlich bei den Personen, die<br />
sich bisher am stärksten und am längsten für die Wiederinbetriebnahme der<br />
Bergstrecke engagiert haben.<br />
Die Pionierphase mit ihren Menschen und ihren Projekten soll im kollektiven Gedächtnis<br />
der Gruppe Furka-Bergstrecke lebendig gehalten werden, damit sollen<br />
die Pioniere Wertschätzung erfahren. Gleichzeitig sollen so die später zur Gruppe<br />
Furka-Bergstrecke dazu gestossenen Mitglieder sich den Wurzeln ihrer Organisation<br />
bewusst werden können.<br />
m Seite 20 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Wir bestehen aus Verein, Aktiengesellschaft und Stiftung und bilden ein grosses Netzwerk von<br />
Menschen, die mit mehrheitlich freiwilliger Arbeit, mit Naturalien und finanziellen Mitteln die Furka-<br />
Bergstrecke unterstützen. Das Zusammenwirken dieser Menschen auf ein gemeinsames Ziel hin,<br />
ist die eigentliche Kernkompetenz der Gruppe Furka-Bergstrecke.<br />
Erläuterung: Die von der Gruppe Furka-Bergstrecke zu erbringenden Leistungen können erbracht<br />
werden, weil Personen freiwillig und unentgeltlich oder für eine symbolische<br />
Entschädigung arbeiten. Freiwillige sind eine ganz andere Mitarbeiterkategorie<br />
als Angestellte, und der Umgang mit ihnen verlangt viel Fingerspitzengefühl<br />
und spezielle Kompetenzen. Werden Freiwillige enttäuscht oder kommen sie<br />
nicht mehr auf ihre Rechnung, steigen sie einfach aus. Ebenso schwierig für eine<br />
Organisation wie die Gruppe Furka-Bergstrecke sind unfähige oder „schlechtarbeitende“<br />
Freiwillige, da sie für Fehler nicht einfach sanktioniert oder gar entlassen<br />
werden können. Im Umgang mit freiwilligen Mitarbeitenden sind zwei Dinge<br />
entscheidend: Erstens sind sie ausschliesslich intrinsisch 12 motiviert (die Mitarbeit<br />
an der „guten Sache“ gibt ein gutes Gefühl) und der Pflege ihrer Motivation muss<br />
daher grosse Beachtung geschenkt werden. Die Leistungen der Gruppe Furka-<br />
Bergstrecke sind dann gut, wenn die einzelnen freiwilligen Mitarbeitenden Leistungen<br />
erbringen können, an denen sie wachsen, die sie befriedigen und erfüllen,<br />
was auch ihre intrinsische Motivation erhält. Zweitens dürfen ihre Arbeitsressourcen<br />
nicht vergeudet werden, nur weil sie „gratis“ arbeiten.<br />
Wir stellen den Erhalt und Betrieb des Kulturgutes Furka-Bergstrecke, bestehend aus Bergstrecke,<br />
Bahninfrastruktur und Rollmaterial sicher. Primär wird der Betrieb mit Dampftraktion gewährleistet.<br />
Erläuterung: Der Erhalt und der Betrieb des Kulturgutes Furka-Bergstrecke stellen gleichwertige<br />
Ziele dar. Dies, obwohl der Erhalt des Kulturgutes Voraussetzung ist für dessen<br />
Betrieb. Falls betriebliche, ökonomische oder ökologische Gründe dafür<br />
sprechen, können bei der Furka-Bergstrecke neben der Dampftraktion noch andere<br />
Traktionsarten genutzt werden.<br />
Wir bieten unseren Gästen ein umfassendes, emotionales Erlebnis mit nostalgischer Bahnfahrt,<br />
attraktiven kulturellen Angeboten in einzigartiger Natur und begeisternder Ambiance an. Wir sind<br />
glücklich, wenn unsere Fahrgäste wiederkommen, uns weiter empfehlen oder sich sogar selber<br />
bei uns engagieren.<br />
Erläuterung: Die Gäste der Furka-Bergstrecke sind nicht in erster Linie an einem Transport<br />
ihrer Person zwischen den Orten Realp, Gletsch und Oberwald interessiert. Sie<br />
möchten etwas erleben. Im Mittelpunkt steht also der Erlebniswert, den die Furka-Bergstrecke<br />
mit ihren Dienstleistungen bietet. Erlebnisse sind:<br />
− abhängig von der einzigartigen Lebensgeschichte dessen, der sie erlebt,<br />
− selbstbezügliche, "innere" Ereignisse, die bildhaft wahrgenommen werden<br />
und vorerst nur subjektiv eine Bedeutung haben,<br />
− gesteigertes Erleben, gründen in lust- oder unlustvollen Affekten und sind<br />
deshalb einprägsam,<br />
− selbstwertsteigernd, denn wer viele Erlebnisse hat, lebt kein banales Leben,<br />
− unwillkürlich: sie werden eher passiv erduldet als aktiv hergestellt,<br />
− unbezweifelbar wahr und richtig, denn über Erlebnisse lässt sich nicht streiten,<br />
− noch keine Erfahrungen, denn Erfahrung gewinnt man durch wiederholte,<br />
reflektierte und damit verarbeitete Erlebnisse.<br />
12 „Intrinsisch“ bedeutet von innen her, aus eigenem Antrieb erfolgend. Das Antonym dazu ist „extrinsisch“, was von aussen<br />
her bestimmt, gesteuert und angeregt meint.<br />
m Seite 21 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Erlebnisse setzen Ereignisse voraus, die aber erst durch Erkenntnisse zur persönlichen<br />
Erfahrung werden. Daraus ergeben sich die vier „E“ der Erlebnisgesellschaft:<br />
Ereignis ► Erlebnis ► Erkenntnis ► Erfahrung.<br />
Das bedeutet, dass Erlebnisse noch nicht mit Erfahrungen gleichzusetzen sind.<br />
Erfahrungen erlangt man durch eine bewusste Reflexion über die Erlebnisse.<br />
Erlebnisse und Erfahrungen sind subjekt-spezifisch. Hingegen können Ereignisse<br />
und Erkenntnisse aktiv inszeniert werden, damit Erlebnisse resp. Erfahrungen<br />
entstehen können. Als Akteur im Tourismus hat die Furka-Bergstrecke mit ihren<br />
Partnern somit zwei Einwirkungsbereiche: Sie kann Ereignisse schaffen, die<br />
wünschbare Erlebnisse begünstigen und sie kann mithelfen (zum Beispiel mit<br />
einer Mitgliedschaft im VFB), Erlebnisse zu reflektieren, damit daraus Erfahrungen<br />
werden (vgl. Müller & Scheurer, 2004, S. 2).<br />
4.3 Kernwerte<br />
Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil.<br />
Erläuterung:<br />
Je nach Führungssituation, dies zeigen empirische Studien, können unterschiedliche<br />
Führungsstile erfolgreich sein. Das Bekenntnis der Gruppe Furka-Bergstrecke<br />
zum kooperativen Führungsstil zeigt, dass sowohl die Aufgaben- wie auch die<br />
Mitarbeiterorientierung für die Organisation wichtig sind. Das Erbringen von Leistungen<br />
im Rahmen der Organisationsziele und die Berücksichtigung der Bedürfnisse<br />
und Erwartungen der Mitarbeitenden sind gleichermassen zu berücksichtigen.<br />
Damit soll erreicht werden, dass eine Beziehung von Vertrauen und Respekt<br />
entsteht.<br />
Abbildung 12 zeigt den kooperativen Führungsstil im Kontinuum unterschiedlicher<br />
Führungsstile.<br />
Abbildung 12: Kontinuum unterschiedlicher Führungsstile (Weber, 1993, S. 257)<br />
m Seite 22 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Wir legen die übergeordneten Ziele der Furka-Bergstrecke in einem rollenden Unternehmensplan<br />
mit einem Zeithorizont von mindestens fünf Jahren gemeinsam fest. Dieser wird jährlich auf seine<br />
Aktualität überprüft und gegebenenfalls angepasst.<br />
Erläuterung Die DFB, der VFB und die SFB sichern den Erhalt und den Betrieb des Kulturgutes<br />
Furka-Bergstrecke. Diese Aufgabe lösen sie, wie wir bereits in Abschnitt 2.1<br />
gesehen haben, mit einer arbeitsteiligen und zugleich koordinierenden Arbeitsweise.<br />
Unter Koordination ist somit die Abstimmung der Einzelaktivitäten im Hinblick<br />
auf die Erfüllung der übergeordneten Gesamtaufgabe zu verstehen. Dabei wird<br />
unterschieden zwischen der vorausschauenden Abstimmung von Aktivitäten (Vorauskoordination)<br />
oder der Reaktion auf Störungen (Ad-hoc-Koordination) unterschieden.<br />
Dieser Kernwert bezieht sich auf die Vorauskoordination. Instrumente der Vorauskoordination<br />
sind Planung und Standardisierung. Im Rahmen der Koordination<br />
sind die übergeordneten Ziele in einem schrittweisen Prozess zu koordinieren, bis<br />
verbindliche aufeinander abgestimmte Massnahmen vorliegen (zum Beispiel der<br />
Unternehmensplan). Im Rahmen der Standardisierung sind sich häufig wiederholende,<br />
gleiche oder ähnliche Sachverhalte durch organisatorische Regelungen,<br />
zum Beispiel in Richtlinien und Handbüchern dauerhaft zu regeln. Unter der Prämisse,<br />
dass keine Störungen auftreten, reicht die Vorauskoordination zur Abstimmung<br />
aller Aktivitäten aus. Dies ist in der Praxis allerdings selten der Fall. (vgl.<br />
Vahs, 2007, S. 107 ff.).<br />
Wir betrachten die Pflege der strategischen Partner als Führungsaufgabe.<br />
Erläuterung: Die Führungskräfte der Gruppe Furka-Bergstrecke müssen wissen, welche Anspruchsgruppen<br />
von Wichtigkeit sind. Sie haben gemeinsam Vorgehensweisen zu<br />
entwickeln, um deren verschiedene Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen,<br />
zu antizipieren und ihnen Rechnung zu tragen.<br />
Wir setzen den Unternehmensplan um, indem Verein, Aktiengesellschaft und Stiftung entsprechend<br />
ihrem Grundauftrag, Aufgaben übernehmen und diese in eigener Verantwortung und Kompetenz<br />
erledigen.<br />
Erläuterung:<br />
Im Unternehmensplan wird die zeitliche Abfolge der wichtigsten Umsetzungsmassnahmen<br />
zum Erreichen der übergeordneten Ziele festgelegt in Abstimmung<br />
mit der Finanzplanung.<br />
Die mit der Umsetzung der Massnahmen zu erbringenden Leistungen werden als<br />
Aufträge den einzelnen Organisationen Verein, Aktiengesellschaft und Stiftung<br />
übertragen.<br />
Wir streben bei unseren Projekten Ausgewogenheit zwischen nostalgischen, ökologischen und<br />
ökonomischen Werten an.<br />
Erläuterung:<br />
Im Rahmen der gesetzlichen Freiräume soll immer wieder von neuem festgelegt<br />
werden, wo in strategischen Projekten die ideale Ausgewogenheit zwischen nostalgischen,<br />
ökologischen und ökonomischen Werten liegt. Die jeweiligen Anspruchsgruppen<br />
sollen sich dabei einbringen können. Die Entscheidung darf nicht<br />
von einzelnen Personen oder einzelnen Anspruchsgruppen getroffen werden<br />
m Seite 23 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Wir sehen in der Verwirklichung unserer Mission eine Aufgabe, die den Menschen, die sich dafür<br />
engagieren, Sinn, Anerkennung und dadurch Zufriedenheit bietet. Wir begegnen einander mit Offenheit,<br />
Respekt und Wertschätzung.<br />
Erläuterung: Mit der Verwirklichung unserer Mission ermöglichen wir den Menschen, die sich<br />
für die Furka-Bergstrecke engagieren, ihr Tun in einen grösseren Handlungs- und<br />
Sinnzusammenhang integrieren zu können. Solche Arbeit macht zufrieden. Zufriedenheit<br />
ist denn auch nicht Voraussetzung für Leistung, sondern sie stellt sich<br />
im Gegenteil ein, wenn wir Leistungen erbringen, wenn wir „einen guten Job machen“<br />
können (vgl. Anker, 2010, S. 17).<br />
Je offener und respektvoller der Dialog in der Gruppe Furka-Bergstrecke ist, je<br />
grösser ist die Anerkennung als Mensch, desto stärker ist bei den Menschen, die<br />
sich für die Furka-Bergstrecke einsetzen, das Gefühl des Commitments entwickelt:<br />
Wer die Freiheit hat, sich einzubringen, das heisst zu partizipieren, hat auch<br />
Verantwortung von dem Moment an, wo von er oder sie von dieser Freiheit<br />
Gebrauch macht (vgl. Anker, 2010, S. 113).<br />
Wir schaffen günstige Bedingungen, damit der Gruppe Furka-Bergstrecke das benötigte Wissen<br />
zur Verfügung steht.<br />
Erläuterung:<br />
Wissen besteht im Kopf des Menschen als Produkt des Lernprozesses, wenn er<br />
Informationen (für ihn relevante Daten) verarbeitet, indem er sie mit den vorhandenen<br />
Wissensbeständen vernetzt. Die kognitiven Aspekte des Wissens umfassen<br />
Wissensinhalte, die durch Denkprozesse bewusstgemacht werden können,<br />
dadurch können sie durch den Wissensträger expliziert werden und anderen Personen<br />
wieder als potenzielle Informationen zu eigenen Wissensproduktion verwendet<br />
werden. Der operative Aspekt des Wissens (Können) umfasst Wissensbestände,<br />
die durch handelnde Erfahrungen erworben wurden und deshalb demonstrierbar,<br />
aber schlecht artikulierbar sind.<br />
Wenn Wissen in der Gruppe Furka-Bergstrecke eine wichtige ökonomische Ressource<br />
darstellt, muss das Handling dieser Ressource, nämlich Wissen produzieren<br />
(entwickeln, generieren, erwerben), Wissen nutzen (anwenden, verteilen, verkaufen,<br />
weiterentwickeln) und Wissen bewahren (identifizieren, speichern, verfügbar<br />
machen), zu einer Kernkompetenz werden. Mit dem klassischen Managementprozess<br />
Analyse–Planung Umsetzung–Controlling lässt sich die Ressource<br />
Wissen aber nicht steuern, weil sie ja ausschliesslich personengebunden ist.<br />
Für das Wissensmanagement in einer Organisation stehen folglich zwei Fragen<br />
im Fokus:<br />
− Welche Daten und Informationen braucht es für eine bestimmte Wissensproduktion<br />
− Wie kann dieses Wissen in Handeln umgewandelt und wirtschaftlich erfolgreich<br />
genutzt werden<br />
(vgl. Hasler Roumois, 2010, S. 40)<br />
m Seite 24 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
Wir treten mit einem einheitlichen Erscheinungsbild auf.<br />
Erläuterung: Im Rahmen der integrierten Kommunikation 13 werden mit der formalen Integration<br />
formale Vereinheitlichungen vorgenommen. Mit der formale Integration soll der<br />
Wiedererkennungswert der Marke „Furka-Bergstrecke“ erhöht werden. Die formale<br />
Abstimmung der Kommunikationsmittel wird mit Hilfe von Gestaltungsprinzipien<br />
wie zum Beispiel der Verwendung einheitlicher Markenzeichen realisiert (Logos,<br />
Schriften, Farben etc.). Der einheitliche formale Auftritt der Furka-Bergstrecke ist<br />
in einem Corporate-Design-Handbuch verbindlich festzulegen.<br />
Wir informieren bei Ereignissen von öffentlichem Interesse koordiniert und zeitgerecht.<br />
Erläuterung: Im Rahmen der integrierten Kommunikation 13 soll mit der inhaltlichen und der zeitlichen<br />
Integration sichergestellt werden, dass einheitliche Botschaften, auch über<br />
verschiedene Kommunikationsinstrumente erfolgen in zeitlicher Abstimmung der<br />
unterschiedlichen Kommunikationsmassnahmen.<br />
Wir kommunizieren offen und transparent nach innen und aussen. Dabei bevorzugen wir den Dialog.<br />
Erläuterung:<br />
Echte, menschliche Kommunikation kann nur auf dem Weg des Dialogs im direkten<br />
Gespräch der Menschen miteinander stattfinden. Die heutigen Kommunikationstechnologien<br />
wie etwa Web 2.0 (soziale Medien) können zweiseitige Kommunikationsprozesse<br />
sowohl organisationsintern wie auch zwischen aussen und innen<br />
unterstützen.<br />
5 Empfehlungen für das weitere Vorgehen<br />
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Leitbild für das weitere Vorgehen sind nicht im Sinne einer<br />
Handlungsanweisung gedacht. Sie sollen vielmehr bewusst machen, wo mögliche Stolpersteine bei<br />
der Umsetzung des Leitbildes Furka-Bergstrecke sein könnten.<br />
1) Die oberste Führung der drei Organisationen VFB, DFB und SFB soll die weitere Leitbildentwicklung<br />
aktiv unterstützen und mittragen. Diese Aufgabe ist nicht delegierbar.<br />
2) Angehörige der Gruppe Furka-Bergstrecke in unterschiedlicher Hierarchiestufen, verschiedener<br />
Aufgaben- und Funktions-Bereiche sowie Alters und Geschlecht sind in den weiteren Entwicklungs-<br />
und Umsetzungs-Prozess einzubeziehen.<br />
3) Die Erkenntnisse aus den Umsetzungsprozessen des Leitbildes in den einzelnen Organisations-,<br />
Aufgaben- und Funktionsbereichen der Gruppe Furka-Bergstrecke sollen dazu genutzt<br />
werden, das Leitbild der Gruppe Furka-Bergstrecke gegebenenfalls zu optimieren.<br />
13 Integrierte Kommunikation ist ein Prozess der Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle, der darauf ausgerichtet<br />
ist, aus differenzierten Quellen der internen und externen Kommunikation von Unternehmen eine Einheit herzustellen,<br />
um ein für die Zielgruppen der Kommunikation konsistentes Erscheinungsbild des Unternehmens zu vermitteln (vgl.<br />
Bruhn, 2009, S. 242)<br />
m Seite 25 von 26
<strong>Abschlussbericht</strong> der Arbeitsgruppe Leitbild Furka-Bergstrecke<br />
6 Literaturverzeichnis<br />
Anker, H. (2010). Balanced Valuecard. Leistung statt Egoismus. Bern: Haupt Verlag.<br />
Bruhn, M. (2009). Marketing. Grundlagen für Studium und Beruf. Wiesbaden: Gabler | GWV Fachverlag<br />
GmbH.<br />
Dubs, R., Euler, D., Rüegg-Stürm, J., Wyss, E. (2004). Einführung in die Managementlehre. Bern:<br />
Haupt Verlag.<br />
Hasler Roumois, U. (2010). Studienbuch Wissensmanagement. Zürich: Orell Füssli<br />
Kerth, K., Asum, H. (2008). Die besten Strategietools in der PraxVerlag AG.is. Welche Werkzeuge<br />
brauche ich wann Wie wende ich sie an Wo liegen die Grenzen München: Carl Hanser<br />
Verlag.<br />
Lombriser, R., Abplanalp, P.A. (2005).Strategisches Management. Visionen entwickeln. Strategien<br />
umsetzen. Erfolgspotenziale aufbauen. Zürich: Versus Verlag AG.<br />
Müller, H., Scheurer, R. (2004). Angebotsinszenierung in Tourismus-Destinationen. Bern: Universität<br />
Bern.<br />
Senn, P. (2010). Führung heute. General Management at the top. Zürich: Verlag Neue Zürcher<br />
Zeitung.<br />
Vahs, D. (2007). Organisation. Einführung in die Organisationstheorie und -praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel<br />
Verlag.<br />
Weber, J. (1993). Einführung in das Controlling. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.<br />
Willke, H. (2011). Einführung in das systemische Wissensmanagement. Heidelberg: Carl-Auer<br />
Verlag GmbH.<br />
m Seite 26 von 26