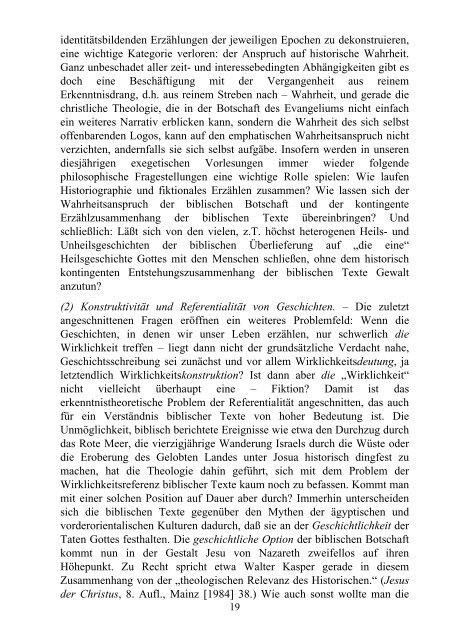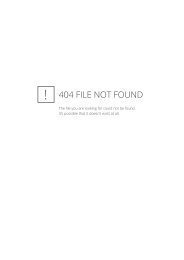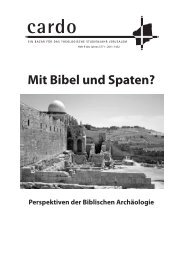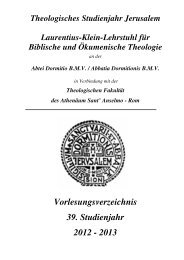Gedächtnis und Geschichte(n) - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Gedächtnis und Geschichte(n) - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Gedächtnis und Geschichte(n) - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
identitätsbildenden Erzählungen der jeweiligen Epochen zu dekonstruieren,<br />
eine wichtige Kategorie verloren: der Anspruch auf historische Wahrheit.<br />
Ganz unbeschadet aller zeit- <strong>und</strong> interessebedingten Abhängigkeiten gibt es<br />
doch eine Beschäftigung mit der Vergangenheit aus reinem<br />
Erkenntnisdrang, d.h. aus reinem Streben nach – Wahrheit, <strong>und</strong> gerade die<br />
christliche Theologie, die in der Botschaft des Evangeliums nicht einfach<br />
ein weiteres Narrativ erblicken kann, sondern die Wahrheit des sich selbst<br />
offenbarenden Logos, kann auf den emphatischen Wahrheitsanspruch nicht<br />
verzichten, andernfalls sie sich selbst aufgäbe. Insofern werden in unseren<br />
diesjährigen exegetischen Vorlesungen immer wieder folgende<br />
philosophische Fragestellungen eine wichtige Rolle spielen: Wie laufen<br />
Historiographie <strong>und</strong> fiktionales Erzählen zusammen? Wie lassen sich der<br />
Wahrheitsanspruch der biblischen Botschaft <strong>und</strong> der kontingente<br />
Erzählzusammenhang der biblischen Texte übereinbringen? Und<br />
schließlich: Läßt sich von den vielen, z.T. höchst heterogenen Heils- <strong>und</strong><br />
Unheilsgeschichten der biblischen Überlieferung auf „die eine“<br />
Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen schließen, ohne dem historisch<br />
kontingenten Entstehungszusammenhang der biblischen Texte Gewalt<br />
anzutun?<br />
(2) Konstruktivität <strong>und</strong> Referentialität von <strong>Geschichte</strong>n. – Die zuletzt<br />
angeschnittenen Fragen eröffnen ein weiteres Problemfeld: Wenn die<br />
<strong>Geschichte</strong>n, in denen wir unser Leben erzählen, nur schwerlich die<br />
Wirklichkeit treffen – liegt dann nicht der gr<strong>und</strong>sätzliche Verdacht nahe,<br />
Geschichtsschreibung sei zunächst <strong>und</strong> vor allem Wirklichkeitsdeutung, ja<br />
letztendlich Wirklichkeitskonstruktion? Ist dann aber die „Wirklichkeit“<br />
nicht vielleicht überhaupt eine – Fiktion? Damit ist das<br />
erkenntnistheoretische Problem der Referentialität angeschnitten, das auch<br />
für ein Verständnis biblischer Texte von hoher Bedeutung ist. Die<br />
Unmöglichkeit, biblisch berichtete Ereignisse wie etwa den Durchzug durch<br />
das Rote Meer, die vierzigjährige Wanderung Israels durch die Wüste oder<br />
die Eroberung des Gelobten Landes unter Josua historisch dingfest zu<br />
machen, hat die Theologie dahin geführt, sich mit dem Problem der<br />
Wirklichkeitsreferenz biblischer Texte kaum noch zu befassen. Kommt man<br />
mit einer solchen Position auf Dauer aber durch? Immerhin unterscheiden<br />
sich die biblischen Texte gegenüber den Mythen der ägyptischen <strong>und</strong><br />
vorderorientalischen Kulturen dadurch, daß sie an der Geschichtlichkeit der<br />
Taten Gottes festhalten. Die geschichtliche Option der biblischen Botschaft<br />
kommt nun in der Gestalt Jesu von Nazareth zweifellos auf ihren<br />
Höhepunkt. Zu Recht spricht etwa Walter Kasper gerade in diesem<br />
Zusammenhang von der „theologischen Relevanz des Historischen.“ (Jesus<br />
der Christus, 8. Aufl., Mainz [1984] 38.) Wie auch sonst wollte man die<br />
19