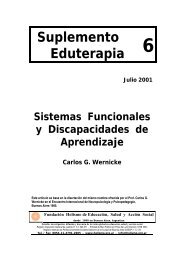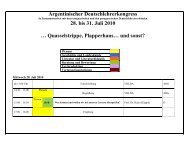Arbeit mit der Lebensgeschichte - Goethe Schule
Arbeit mit der Lebensgeschichte - Goethe Schule
Arbeit mit der Lebensgeschichte - Goethe Schule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Carlos Wernicke<br />
DIE LEBENSGESCHICHTE ALS BASISDOKUMENTATION FÜR<br />
DIE DIAGNOSTISCHE ARBEIT IN DER<br />
KINDERPSYCHOPATHOLOGIE<br />
4. Internationale Woche Erziehungs- und Bildungswissenschaften: Sociological<br />
and Psychological Aspects of Education: Bodies of Knowledge and Methods of<br />
Practice 27.- 31.5.2002<br />
Universität Bremen - Fachbereich 12, Erziehungs- und Bildungswissenschaften<br />
Erstveröffentlichung in: Rea<strong>der</strong> - Internationale Woche 2002, Universität Bremen 2002.<br />
Die Kin<strong>der</strong>psychopathologie umfaβt alle während <strong>der</strong> Kindheit von <strong>der</strong> sozial<br />
erstellten Norm abweichende als psychologisch betrachtete objektive sowie<br />
subjektive individuelle persönlichen Merkmale, d.h. sozial bestimmte ¨Zeichen¨ und<br />
¨Symptome¨.<br />
Zwischen Klient und diagnostizieren<strong>der</strong> Fachkraft wird nach dem Kontakt eine<br />
Interaktion konstruiert, aus <strong>der</strong> eine ¨therapeutische¨ Beziehung werden soll. Die<br />
formelle diagnostische <strong>Arbeit</strong> <strong>der</strong> Fachkraft hilft nicht nur, minuziös Daten zu<br />
sammeln, was in sich von groβer Wichtigkeit ist, son<strong>der</strong>n diese einmalige Bindung<br />
zu schaffen. Während des Prozesses soll die diagnostische informelle <strong>Arbeit</strong> von<br />
Seiten des Klienten nicht vergessen werden, vielmehr soll die Fachkraft sie<br />
stimulieren.<br />
Weil <strong>der</strong> Mensch sich <strong>mit</strong>tels integrierter funktioneller Systeme kommuniziert,<br />
und die Persönlichkeit als ein einziges, allintegrierendes funktionelles System<br />
betrachtet werden kann, ist die Psychopathologie als die Studie <strong>der</strong> Desadaptation<br />
dieses persönliches Systems in Bezug zu an<strong>der</strong>en zu betrachten. In seltenen Fällen<br />
liegt dieser Fehlanpassung eine biologische (anatomische und/o<strong>der</strong> biologischfunktionelle)<br />
Ursache zu Grunde, in den meisten Fällen sind es die fehlerhaften<br />
(¨pathologisierenden¨) Umweltstimuli, die eine abnormale Interaktion <strong>mit</strong> <strong>der</strong><br />
Umwelt provozieren. Der individuelle Klient zeigt im pathologischen Fall sicherlich<br />
interaktionelle und manchesmal auch echt biologische Symptome. Der körperliche<br />
Ausdruck <strong>der</strong> interaktionellen Symptome erschwert <strong>der</strong>en Verständnis als<br />
interaktionell und verschärft die biologistische Sicht, man sollte sie körperlich (und<br />
dann fast immer chemisch) therapieren.<br />
Die diagnostische <strong>Arbeit</strong> sollte von Seiten <strong>der</strong> Fachkraft die Erforschung von<br />
ungesättigten Grundbedürfnissen, Grundgefühlen, Denkweisen und Verhaltensweisen<br />
beinhalten, da diese Elemente unter sich streng verbunden sind.<br />
Weil <strong>der</strong> Mensch ein Lebewesen ist, und deswegen sich stetig und andauernd<br />
modifiziert, hat die diagnostische <strong>Arbeit</strong> auch kein Ende. Längst nach <strong>der</strong> offiziellen<br />
1
Erstellung <strong>der</strong> diagnostischen Formulierung gibt es weiter von beiden Seiten die<br />
Suche nach Neuigkeiten, die das bekannte Bild des An<strong>der</strong>en (und ihrer Beziehung)<br />
bestätigen o<strong>der</strong> än<strong>der</strong>n.<br />
Einführung<br />
R. Lempp erschlieβt, daβ es drei unterschiedliche Ausgangspunkte für die<br />
Bestimmung von Behin<strong>der</strong>ung gibt:<br />
- Die ¨objektive¨ Feststellung <strong>der</strong> Tatsache,<br />
- die subjektiv empfundene Beziehungsstörung als Folge<br />
- und die subjektive Erfahrung des eigenen Behin<strong>der</strong>tseins [Neumann 1].<br />
Gut betrachtet ist diese Einteilung generell für alle Menschen gültig, denn von uns<br />
allen wird von auβen her etwas festgestellt (¨diagnostisiert¨), in uns allen hat unsere<br />
biologische, emotionelle, intellektuelle Struktur (und wenn sie genug verschieden<br />
und umschrieben ist bekommt diese Struktur einen ¨diagnostischen¨ Namen)<br />
bestimmte Beziehungsarten (und wenn sie an<strong>der</strong>sartig genug sind, werden sie<br />
¨Störungen¨ genannt) als Folge, und je<strong>der</strong> von uns hat eine eigene subjektive<br />
Erfahrung (eine eigene ¨Diagnose¨) von sich selbst, also des eigenen Seins bzw.<br />
An<strong>der</strong>sseins, Behin<strong>der</strong>tseins... die wie<strong>der</strong>um eine bestimmte Beziehungsart als Folge<br />
hat.<br />
Der Mensch kommt zur Welt, also wird aus einer bestimmten weiblichen und einer<br />
bestimmen männlichen Zelle konzipiert, <strong>mit</strong> einer für diesen Menschen bestimmten,<br />
sehr umfangreichen Palette von Potenzialen. Am Anfang des intrauterinen Lebens<br />
eigene, aber gleich sogar während <strong>der</strong> Schwangerschaft auch und progressiv mehr<br />
und mehr die Umweltstimuli <strong>mit</strong> denen dieses Organismus interagiert, erlauben, daβ<br />
manche dieser Potenziale sich zu Fähigkeiten entwickeln. Daβ <strong>der</strong> Mensch nicht<br />
fertiggebaut konzipiert wird, läβt uns diese Potenziale auch als Grundbedürfnisse<br />
beschreiben, die von den Stimuli ¨gesättigt¨ werden [Wernicke 2].<br />
Nur manche dieser vielen Fähigkeiten werden tatsächlich trainiert und entwickeln<br />
sich zu Fertigkeiten. So z.B. hat das Kind es fertiggebracht zu lesen, weil seine<br />
Fähigkeiten trainiert wurden, in diesem Fall unter an<strong>der</strong>en die sprachlichen <strong>der</strong><br />
Kultur in <strong>der</strong> es konzipiert wurde [3]: Es erwarb dazu zuerst eine Fähigkeit, die<br />
gemeinschaftliche Grundsprache (die ¨lingua¨ nach Quirós [Quirós 4]). Die<br />
partikuläre Sprache kann wie<strong>der</strong>um nur erlernt werden, wenn es dazu die genügenden<br />
Potenziale gibt, die in bestimmtem Maβ und in <strong>der</strong> bestimmten Zeit von den nötigen,<br />
jedoch ganz verschiedenen Stimuli gegossen werden.<br />
Der / die DiagnostikerIn kann potentielle Grundbedürfnisse, verhältnismäβig viel<br />
mehr Fähigkeiten und/o<strong>der</strong> eine unendliche Zahl von Fertigkeiten eruieren<br />
Der Sammelbegriff ¨Behin<strong>der</strong>ung¨ kann also heiβen: a. Das Fehlen von bestimmten<br />
Potenzialen, die das Individuum nicht <strong>mit</strong> zur Welt brachte (¨Dis-potential)¨; b. Das<br />
Fehlen / Defizit von Stimuli während <strong>der</strong> ersten Lebenszeit (Frühför<strong>der</strong>ung), wo<strong>mit</strong><br />
das Individuum manche Fähigkeiten nicht o<strong>der</strong> nicht ganz entwickelt<br />
2
(¨Unfähigkeiten¨); c. Eine schlechte späte Stimulierung (Training) dieser Fertigkeiten<br />
(¨Unfertigkeiten¨) [Wernicke 3].<br />
Das einmalige Spiel zwischen Potenzial und Umfeld läβt einmalige Resultate<br />
erscheinen, die man gut ¨funktionelle Systeme¨ nennen könnte, also Systeme die<br />
nicht mehr dem Individuum noch <strong>der</strong> Umwelt gehören, son<strong>der</strong>n dieser einmaligen<br />
Wechselwirkung, aus <strong>der</strong> das Individuum eben eine Person wird. Die meisten<br />
ärztlichen und alle nicht ärztlichen Untersuchungen testen in Wirklichkeit lediglich<br />
funktionelle Systeme und nicht Eigenfunktionen des Nervensystems selbst.<br />
Die Persönlichkeit könnte als ein einziges funktionelles System betrachtet werden,<br />
das alle an<strong>der</strong>en, untergeordneten, beinhaltet. Nur aus didaktischen Gründen kann sie<br />
also in verschiedenen Dimensionen fragmentiert werden: Der Mensch kann als ein<br />
molekulares, biologisches, emotionelles, intellektuelles, spirituelles Ganzes<br />
betrachtet werden. Jede Dimension wird von verschiedenen Disziplinen studiert, die<br />
für diese Dimension rationell logische Antworten finden.<br />
So könnten in <strong>der</strong> Medizin z.B. mehrere richtige Antworten auf die Frage nach <strong>der</strong><br />
Ursache eines Zwölffingerdarmulkus gefunden werden: Es handele sich um eine<br />
Störung <strong>der</strong> Protonpumpe, einen chemischen Fehler, einen emotionellen ungelösten<br />
Konflikt in <strong>der</strong> Kindheit, eine gestörte kognitive Antwort auf die Auβenwelt, ein<br />
spirituelles Flimmern. Die Forscher <strong>der</strong> verschiedenen Disziplinen werden sich<br />
üblicherweise nicht einig. Je<strong>der</strong> denkt, die von ihm untersuchte Dimension sei eben<br />
die wichtige, sogar die einzig wissenschaftliche, und verachtet alle an<strong>der</strong>en... <strong>mit</strong> den<br />
besten vernünftigen Gründen.<br />
Von einem holistischen, also ganzheitlichen Gesichtspunkt, handelt es sich eben<br />
nicht um Dimensionen, son<strong>der</strong>n um Betrachtungsweisen eines/r jeden ¨objektiven¨<br />
Diagnostikers /Diagnostikerin. Jede(r) DiagnostikerIn hält eine bestimmte Lupe in<br />
<strong>der</strong> Hand und glaubt, was er sieht sei die ¨richtige¨ und vollkommene Karte, ¨das<br />
Ganze¨ einer viel komplizierteren Realität. Die Realität ist we<strong>der</strong> molekular noch<br />
biologisch noch emotionell noch intellektuell noch spirituell, son<strong>der</strong>n gleichzeitig all<br />
das. Meistens unbewuβt wähle ich als DiagnostikerIn ein Teil dieser umfangreichsten<br />
Realität. Diese Wahl bestimmt meine Nosographie, deswegen die Diagnose und<br />
so<strong>mit</strong> die vorgeschlagene Therapie.<br />
3. In <strong>der</strong> zwischenmenschlichen Kommunikation gibt es auβerdem verschiedene<br />
Interaktionsebenen, u.z. den Austausch von Verhaltensweisen, Gedanken, Gefühlen,<br />
Grundbedürfnissen. Das Denken übernimmt allmählich seine deiktische Funktion,<br />
und seitdem agiert es als Filter zwischen den meist unbewuβten ursächlichen<br />
Gefühlen und den resultierenden Verhaltensweisen. Das Gefühlsleben, an<strong>der</strong>s als die<br />
Kognition, ist die immeranwesende Antwort -schon in <strong>der</strong> ersten intrauterinen Zeitauf<br />
die richtige, mangelnde o<strong>der</strong> fehlende Sättigung <strong>der</strong> Grundbedürfnisse. ¨Die<br />
entscheidende Frage nach <strong>der</strong> Entstehung von menschlichen Grundbedürfnissen wird<br />
von <strong>der</strong> gegenwärtigen Entwicklungspsychologie nur unzureichend beantwortet¨<br />
[Hüther 5]. Eine Liste von Grundbedürfnissen gibt Tabelle 1 wie<strong>der</strong> [Wernicke 2].<br />
Tabelle 1<br />
Unumgänglich zu sättigende Grundbedürfnisse (Wernicke [6])<br />
3
I. Zu vollendende Bedürfnisse<br />
1 Zugehörigkeit<br />
2. Sicherheit<br />
3. Liebe<br />
4. Begleitung<br />
5. Akzeptiertwerden<br />
6. Wertschätzung<br />
7. Wissen<br />
II. Zu entfaltende Bedürfnisse<br />
8. Ausdruck<br />
9. Selbstverteidigung<br />
10. Selbstbehauptung<br />
11. Reifen<br />
12. Expansion<br />
Jede tiefere Ebene hat auf die oberflächlichere (also Grundbedürfnisse Gefühle <br />
Gedanken Verhalten) eine ¨Operatorenwirkung¨ [Ciompi 7], ist also Basis <strong>der</strong><br />
nächsten.<br />
Jede Interaktionsebene kann als die wichtigere o<strong>der</strong> sogar als die einzige Interaktion<br />
zwischen zwei Individuen betrachtet werden. Aber es handelt sich auch in diesem<br />
Fall um eine Lupe, dem Bewuβtsein, welche nicht die ganze son<strong>der</strong>n ein Fragment<br />
<strong>der</strong> ganzen Interaktion zeigt. In Wirklichkeit interagieren die Menschen nicht von<br />
Grundbedürfniss zu Grundbedürfniss, von Gefühl zu Gefühl, von Gedanke zu<br />
Gedanke, von Verhalten zu Verhalten. Meistens unbewuβt wähle ich, als<br />
DiagnostikerIn <strong>der</strong> Situation, ob ich besser (o<strong>der</strong> ausschlieβlich) die Interaktion als<br />
Austausch von Gefühlen o<strong>der</strong> von Gedanken betrachte. Die wirkliche Interaktion<br />
spielt sich aber gleichzeitig auf allen Ebenen.<br />
So kommt es, daβ auch wenn in meiner Disziplin mein konkretes Ziel z.B. wäre, das<br />
Lesenlernen eines Kindes zu beeinflussen, ich simultan und ohne Zweifel auch seine<br />
Grundbedürfnisse sättigen, seine Gefühle auffangen, sein körperliches Verhalten<br />
än<strong>der</strong>n würde. Wenn ich bewuβt glauben würde, wir tauschen Gefühle aus, so geben<br />
wir uns gegenseitig simultan auch Moleküle o<strong>der</strong> Gedanken.<br />
Ich interagiere <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Realität <strong>mit</strong> all meinen Dimensionen, <strong>mit</strong> all meinen<br />
Interaktionsebenen. Nur, mein Bewuβtsein beleuchtet ein Teil davon. Und bei<br />
meinem Nächsten ist es genau so. Der Konflikt taucht auf wenn meine bewuβte<br />
Betrachtung nicht <strong>mit</strong> <strong>der</strong> bewuβten Betrachtung des an<strong>der</strong>en übereinstimmt.<br />
Nach dem Kontakt fängt zwischen den Individuen eine Interaktion an. Je<strong>der</strong> bringt<br />
<strong>mit</strong> sich seinen physikalischen, biologischen, emotionellen, intellektuellen,<br />
spirituellen Zustand, seine Grundbedürfnisse, sein Verhalten. So auch ich. Nun wird<br />
diese Interaktion so eng, daβ mein (erzieherischer, therapeutischer) Einfluβ auf den<br />
an<strong>der</strong>en wichtig werden kann. Die Interaktion wurde zur Beziehung, es ist eine<br />
Bindung entstanden. Unsere Emotionen und unsere Körper können sich annähern,<br />
unsere Molekülen vermischen sich, und so auch unsere Emotionen. Ein neues<br />
Ganzes, eine neue Gestalt, ein neues funktionelle System, das Wir, ist entstanden.<br />
Auch diese Bindung kann verschieden, je nach Lupe, gelesen werden, und in unserem<br />
Bewuβtsein behaupten wir, unsere Beziehung sei z.B. nur intellektuell, nur spirituell,<br />
nur körperlich.<br />
4
Weil wir aber <strong>mit</strong> Menschen arbeiten, so daβ wir sie zum Guten irgendwie<br />
beeinflussen wollen, können wir uns nicht leisten, weiter fragmentarisch zu glauben,<br />
daβ unsere Disziplin nur diese Interaktionen anbietet, die wir bewuβt aufbauen. Zu<br />
unserer <strong>Arbeit</strong> gehört die Erweiterung unseres Bewuβtseins, um <strong>mit</strong> uns selbst besser<br />
zu interagieren, eine Bindung <strong>mit</strong> uns selbst aufbauen zu können. Sonst bricht <strong>der</strong><br />
Konflikt in uns auf.<br />
Eine Geschichte<br />
Die Mutter von Konrad geht aus. Er soll da bleiben, und ordentlich und fromm sein<br />
bis sie zurückkommt. Und vor allem soll er nicht den Daumen lutschen. Sonst, mahnt<br />
die Mutter, käme geschwind <strong>der</strong> Schnei<strong>der</strong> <strong>mit</strong> <strong>der</strong> Schere und würde ihm die<br />
Daumen abschneiden.<br />
Doch die Mutter geht fort und Konrad tut den Daumen in den Mund. Der Schnei<strong>der</strong><br />
springt plötzlich in das Zimmer hinein und schneidet Konrad die Daumen. Konrad<br />
schreit sehr.<br />
Als die Mutter zurückkommt, sieht Konrad traurig aus und steht da, ohne Daumen.<br />
[Hoffmann 8, Wernicke 9].<br />
Die Kin<strong>der</strong>psychopathologie umfaβt alle objektive und subjektive individuellen<br />
persönlichen Merkmale eines Kindes, die von <strong>der</strong> sozial erstellten Norm als<br />
abweichend betrachtet werden, d.h. sozial bestimmte ¨Zeichen¨ und ¨Symptome¨. Die<br />
DiagnostikerInnen würden also verschiedene Listen aufstellen, die von <strong>der</strong><br />
Zugehörigkeit <strong>der</strong> Fachkraft zu einer gewissen Disziplin, <strong>der</strong> sozialpolitischen<br />
Ideologie <strong>der</strong> Gesellschaft, <strong>der</strong> Gemeinschaft und sogar <strong>der</strong> Abteilung wo die<br />
Fachkraft tätig ist, den persönlichen Lebens- und professionellen Erfahrungen, <strong>der</strong><br />
diagnostischen <strong>Arbeit</strong> gewidmeten Zeit, usw. beeinfluβt werden.<br />
Versuchen wir aber, die Daten dieser Struwwelpeter-Geschichte auf zwei<br />
Datenlisten, die des Kindes und die seiner Umwelt, aufzustellen.<br />
Kind<br />
• Alleingelassenes Kind<br />
• Aktives Daumenlutschen<br />
• Schreiendes Kind<br />
• Laut eines früheren Beobachters,<br />
traurig aussehendes Kind<br />
Umwelt<br />
• Mahnende Mutter<br />
• Drohende Mutter<br />
• Ungeklärte plötzliche Anwesenheit<br />
des Schnei<strong>der</strong>s<br />
• Schnei<strong>der</strong> praktiziert ohne<br />
Psychoprophylaxe und ohne<br />
Betäubung die Amputation von<br />
zwei Fingern<br />
5
Daβ dieses zum ersten Mal in 1845 erschienenes Buch des Struwwelpeters weiter gut<br />
verkauft wird zeigt, wie viele fest daran glauben, das Vorlesen dieses Bildes sei für<br />
an<strong>der</strong>e Kin<strong>der</strong> erzieherisch, sogar therapeutisch. Die von ihnen gestellte Diagnose<br />
könnte etwa lauten ¨Unaustehliches Kind, reagierende Umwelt¨. Für sie wäre die<br />
darauffuβende Therapie eben erfolgreich gewesen: Die Daumen wurden tatsächlich<br />
nicht mehr gelutscht.<br />
Mit denselben Daten, würden an<strong>der</strong>e aber genau das Gegenteil meinen. Die Diagnose<br />
könnte nun heiβen ¨Ungesättigtes Kind, angsterregende Umwelt¨, und daraus würde<br />
man Umweltberatung (wenigstens <strong>der</strong> Mutter und des Schnei<strong>der</strong>s) und<br />
Psychotherapie des Kindes herausschlieβen, denn die Aktion <strong>der</strong> Umwelt blieb<br />
vollkommen erfolglos, da die Grundbedürfnisse des Kindes ungesättigt blieben, seine<br />
Gefühle notwendigerweise negativ, seine Gedanken deswegen auch negativ waren<br />
und sein kompensatorisches Verhalten als sozial unangepaβt angesehen werden<br />
könnte.<br />
Diese <strong>Lebensgeschichte</strong> zeigt, wie wichtig es ist, sehr viele Daten <strong>mit</strong> viel Detail zu<br />
sammeln, bevor man eine Diagnose stellt. Mit wenigen Daten ist nämlich das Risiko,<br />
falsche Folgerungen zu ziehen, zu hoch. Da Diagnosen das Resultat von Fakten sind,<br />
die aus sehr verschiedenen Fel<strong>der</strong>n / Dimensionen / Ebenen zu prüfen sind, ist einzig<br />
die professionelle Haltung, während viel Zeit so viele Daten des Individuums und<br />
seiner Umgebung zu erfassen wie möglich, diejenige, die das Interesse des<br />
Individuums am besten beschützt. Lei<strong>der</strong> widmen viele Fachkräfte <strong>der</strong> diagnostischen<br />
<strong>Arbeit</strong> und Verarbeitung wenig Zeit und/o<strong>der</strong> erstellen die Diagnose <strong>mit</strong>tels<br />
Methoden, die nur nützlich sind, um ihre diagnostische Vermutung zu bestätigen,<br />
eine Vermutung, die aber von Fakten abhängig ist, die dann zu sehr <strong>mit</strong> <strong>der</strong><br />
Persönlichkeit des/r Diagnostikers / Diagnostikerin zu tun haben.<br />
Notwendigerweise soll eine Diagnose immer die Daten aus <strong>der</strong> Vergangenheit, und<br />
nicht nur die <strong>der</strong> tagtäglichen Gegenwart, beinhalten.<br />
Von Konrad möchte ich nämlich z.B. noch gerne wissen:<br />
• Wie alt ist er Hat er Geschwister Ist es ein erstes Kind<br />
• Ist es üblich, das er alleingelassen wird Wenn ja, seit welchem Alter<br />
• Seit wann lutscht er den Daumen Wie war das Daumenlutschen am Anfang Wie<br />
haben die Eltern darauf reagiert Wie hat sich ihre Reaktion im Laufe <strong>der</strong> Zeit<br />
geän<strong>der</strong>t<br />
• Schreit das Kind sehr oft, o<strong>der</strong> nur, wenn ein Schnei<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Luft auftaucht<br />
und nur, wenn es amputiert wird<br />
• Was fühlt Konrad eigentlich Angst Panische Angst Wut Was liegt unter<br />
dieser Traurigkeit<br />
• Versteht Konrad, was die Mutter sagt, o<strong>der</strong> ahnt er nur nach dem Ton, was ihm<br />
gesagt wird<br />
• Wie ist <strong>der</strong> Schnei<strong>der</strong> hereingekommen<br />
und vieles an<strong>der</strong>e mehr.<br />
Eine <strong>Lebensgeschichte</strong><br />
6
Pauls Vater hat bei mir angerufen, er möchte eine Stunde, um über seinen Sohn zu<br />
sprechen. Ich fragte wie üblich, wie sich die Eltern besser fühlen würden, ob alleine<br />
o<strong>der</strong> vom Kind begleitet, und <strong>der</strong> Vater wählte, nur <strong>mit</strong> seiner Frau zu kommen. Die<br />
Mutter ist Zahnärztin, obwohl sie nicht mehr tätig ist, seitdem das erste Kind geboren<br />
wurde. Der Vater ist Ackerbauingeneur, und verläβt das Haus alle 14 Tage für mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger eine Woche.<br />
Sie haben 3 Kin<strong>der</strong>, einen 13jährigen Jungen, ein 11jähriges Mädchen und Paul,<br />
8jährig. Ich schlage vor, Daten zu sammeln, die ich mir von den Eltern während<br />
praktisch zwei Stunden übergeben lasse. Da<strong>mit</strong> wird von mir ein Anamnesebuch<br />
ausgefüllt.<br />
Diese Datensammlung dauert üblicherweise 3 Sitzungen. Danach lernte ich das Kind<br />
kennen, in diesem Fall von den Eltern begleitet, und versuchte, <strong>mit</strong> dem Kind auf die<br />
verschiedenen Ebenen zu interagieren.<br />
Eine diagnostische Testarbeit war <strong>mit</strong> diesem Kind unmöglich. Ich erstellte einen<br />
diagnostischen Satz <strong>mit</strong> hierarchisch geordnet mehreren Teildiagnosen. Wenn nötig<br />
werden Berichte und an<strong>der</strong>e Studien im Einzelfall noch verlangt. Ein<br />
Therapieprogramm wird erstellt, und die Eltern werden zu einer Sitzung gerufen, wo<br />
sie meine Information bekommen. Dann fängt die Therapie an.<br />
Während diesen ersten 3 Sitzungen werde ich, das bin ich mir sicher, von den Eltern<br />
genau beobachtet. Sie leisten auch eine diagnostische <strong>Arbeit</strong>, denn sie wollen auch<br />
aus dieser Interaktion eine Bindung aufbauen... o<strong>der</strong> rasch wegfliehen. Während <strong>der</strong><br />
ersten diagnostischen Sitzung <strong>mit</strong> Paul werde ich auch von ihm beobachtet, u.z. nach<br />
seinem pekuliären Stil: Er schaut mich nicht an, aber hört genau zu, was ich sage, vor<br />
allem, was ich von ihm sage, wie ich ihn anfasse, was ich mache, wenn er sehr<br />
geschickt ein Blatt aus einer Pflanze abreiβt und anfängt, daran zu kauen.<br />
Die Eltern haben schon Neurologen und Kin<strong>der</strong>psychiater besucht. Paul wird<br />
Thioridazin gegeben, doch ohne Einfluβ auf das Zeichen, das die Eltern zu mir<br />
bringt: die Autoaggression. Die Verarbeitung <strong>der</strong> Datensammlung ergibt jedoch eine<br />
viel längere Liste von gegenwärtigen Zeichen und Symptomen, wie folgt:<br />
7
Kind<br />
• Down-Syndrom<br />
• Sieht sehr schlecht, benutzt aber das<br />
Sehen<br />
• Sehr unruhig<br />
• Schläft auch unruhig<br />
• Kann am Tisch nicht ruhig bleiben<br />
• Aggrediert sich selbst, Anfang vor 2<br />
Jahren; versucht, sich zu kontrollieren,<br />
wenn Eltern es verlangen, und sucht dann<br />
Körperkontakt <strong>mit</strong> den Eltern<br />
• In <strong>der</strong> letzten Zeit hat er mehr Kontakt<br />
zur Umwelt<br />
• Mundatmung<br />
• Wie<strong>der</strong>holte Schnupfen<br />
• Bronchospasmen<br />
• Zähneknirschen während des Schlafes<br />
• Mangelnde Konzentration<br />
• Langsames Lernen<br />
• Hat noch keine Kontrolle <strong>der</strong> Harnund<br />
Stuhlentleerung<br />
• Kotet mehr als einmal täglich ein<br />
• Versucht, immer ein Objekt in <strong>der</strong><br />
Hand zu haben<br />
• Kann nur 1-Wort-Sätze sprechen<br />
• Kann nicht so gut wie an<strong>der</strong>e Kin<strong>der</strong><br />
laufen<br />
• Feinmotorische Schwierigkeiten<br />
• Sehr vorsichtig<br />
Umwelt<br />
• Mutter unterbricht Bronchospasmen,<br />
und deswegen hat das Kind nur noch sehr<br />
wenige; sie ist stolz darauf<br />
• Eltern geben Essen in den Mund,<br />
kleiden und baden das Kind<br />
• Nach Indikation eines Kin<strong>der</strong>arztes<br />
vor mehreren Jahren wird einmal im Jahr<br />
die Schilddrüse geprüft<br />
• Wenn das Kind aufwacht, trägt es die<br />
Mutter zur Toilette, wo sie ihm beibringt,<br />
das Klosett zu benutzen; dazu muβ das<br />
Kind schauen, was es gemacht hat und<br />
auf den Knopf drücken<br />
• Während es noch am Klosett sitzt, gibt<br />
ihm gleichzeitig die Mutter Frühstück<br />
und Medikation, ¨um Zeit zu sparen¨<br />
• Mutter und Son<strong>der</strong>schule berichten<br />
sich gegenseitig, ob und wie oft das Kind<br />
am Klosett gesessen hat<br />
• Die Mutter ¨wird ernst¨, da<strong>mit</strong> das<br />
Kind fleiβig akzeptiert, in die <strong>Schule</strong><br />
hineinzugehen<br />
• Eltern, vor allem <strong>der</strong> Vater, sehr<br />
korrekt und streng als Lebenshaltung,<br />
• Das Kind wurde nur einmal wegen<br />
schlechtem Verhalten vom Vater<br />
eingesperrt, die Eltern sind sich über die<br />
emotionellen Konsequenzen für das Kind<br />
nicht einig, <strong>der</strong> Vater glaubt, das Kind<br />
hätte Angst gehabt, die Mutter denkt, es<br />
hätte Abneigung gefühlt<br />
• Der Vater wird ¨sehr nervös¨ wenn<br />
sich das Kind schlägt<br />
• Die Schwester behandelt das Kind, als<br />
wäre es eine Puppe.<br />
Einige Erfahrungen in seiner <strong>Lebensgeschichte</strong>, die wichtig sind, um die<br />
Zusammenhänge zwischen diesen Zeichen und Symptomen besser zu verstehen:<br />
• Während <strong>der</strong> Schwangerschaft erhöhte sich das Gewicht <strong>der</strong> Mutter weniger als 9<br />
kg<br />
• Das Kind wurde 15 Tage früher geboren<br />
• Es wurde während den ersten Tagen ikterisch und blieb wegen einer Blutstörung<br />
und einer Darmperforation, die im ersten Monat operativ geschlossen wurde, für<br />
einen Monat im Inkubator unter intensiver Behandlung<br />
• Beide Augenlinsen wurden wegen Starr im Säuglingsalter operativ entfernt<br />
8
• Während den ersten 5 Jahren blieb es in sich verschlossen, <strong>mit</strong> wenig bis keinem<br />
okularen Kontakt. Nach Anfang einer Therapie <strong>mit</strong> einer an<strong>der</strong>en Frühför<strong>der</strong>in fing<br />
es allmählich an, sich <strong>mit</strong> mehr Körper- und Augenkontakt zu kommunizieren.<br />
So wie bei Konrad, bleibt auch bei Paul wichtig, welche Lupe(n) <strong>der</strong> / die<br />
DiagnostikerIn benutzt bzw. benutzen kann. Die Persönlichkeitsstruktur des/r<br />
Diagnostikers / Diagnostikerin (die ihrerseits von seiner/ihrer eigenen Erziehung<br />
abhängig ist), die vorherige Information und Bildung, die Fachdisziplin als solche<br />
und die Umwelt, wo diese Disziplin entwickelt wird (Land, Stadt, Abteilung) sind<br />
alles Fakten, die meist unbewuβt die Wahl <strong>der</strong> für die Diagnose wichtige Daten<br />
bestimmen.<br />
Derjenige, <strong>der</strong> nur von Medikation versteht (und manchmal fest daran glaubt, die<br />
Medizin sei lediglich Gabe von Medikamenten), <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e, <strong>der</strong> glaubt, nur das<br />
Biologische, o<strong>der</strong> nur das Emotionelle, o<strong>der</strong> nur das Kognitive seien das Wichtige,<br />
ein dritter, <strong>der</strong> versucht, die bösen Geiste zu beschwören, haben gemeinsam, daβ sie<br />
nur eine einzige Nosographie, die eigene, benutzen. Sie haben ein therapeutisches<br />
Programm, und suchen eine Diagnose, die sich an dieses Programm anpaβt.<br />
Doch letztlich haben wir alle eine gewisse Karte <strong>der</strong> Realität. Eine ¨objektive¨<br />
Interpretation des Klienten wird es nie geben. Wie können wir aber die diagnostische<br />
<strong>Arbeit</strong> bessern<br />
Indem wir a. versuchen, so viele Daten aus allen Dimensionen und Ebenen zu<br />
erörtern wie möglich und b. diese Daten aus verschiedenen Gesichtspunkten<br />
verarbeiten.<br />
So gibt es sicherlich für diese Liste eine biologische und eine emotionelle und eine<br />
kognitive Antwort.<br />
Jede(r) DiagnostikerIn muβ auβerdem innerliche Klarheit in sich haben: Will ich<br />
eine statische o<strong>der</strong> eine dynamische Diagnose erstellen Denn die statische Diagnose<br />
erlaubt das gegenwärtige Bild zu photographieren, während <strong>der</strong> dynamische Ansatz<br />
dagegen einen ganzen Film anbietet.<br />
Sowie im deutschen Sprachraum das Multiaxiale Klassifikationsschema nach <strong>der</strong><br />
ICD-10 <strong>der</strong> WHO [10], arbeitet auch das DSM-IV [11] nach Achsen, die versuchen<br />
zu garantieren, daβ die Diagnose so sehr das Individuum respektiert und reflektiert<br />
wie möglich.<br />
Die Achsen sind wie folgend:<br />
Achse I<br />
Achse II<br />
Achse III<br />
Achse IV<br />
Achse V<br />
Klinische Störung o<strong>der</strong><br />
An<strong>der</strong>e Probleme, die klinische Behandlung benötigen könnten<br />
Persönlichkeitsstörungen o<strong>der</strong><br />
Geistige Behin<strong>der</strong>ung<br />
Nicht psychiatrische Krankheitsbil<strong>der</strong><br />
Psychosoziale und umweltbezogene Probleme<br />
Prüfung <strong>der</strong> globalen Intensität<br />
9
Daraus kann man folgende wichtige diagnostischen Fragen ableiten:<br />
• I) Was ist <strong>der</strong> klinischen Aufmerksamkeit wert<br />
• II) Welche basale Persönlichkeitsstruktur o<strong>der</strong> Funktionsart steht im Hintergrund<br />
<strong>der</strong> Störung<br />
• III) Welche simultane nicht psychiatrische Krankheitsbil<strong>der</strong> zeigt das Individuum<br />
• IV) Welche psychosoziale und umweltbezogene Probleme umrahmen das Leben<br />
des Individuums<br />
• V) Mit welcher Intensität drückt sich die Störung aus<br />
K. Wilber erkennt vier Aspekte <strong>der</strong> Realität, wie<strong>der</strong> vier Betrachtungsweisen, die<br />
jede für sich bewertet werden sollte [Wilber 12]:<br />
1. Subjektivität: Welche Diagnose stellt Paul von sich selbst<br />
2. Objektivität: Was sehen wir in Paul Paul wird von auβen her (also aus <strong>der</strong><br />
gemeinsamen Realität und nicht aus seiner eigenen ¨Nebenrealität¨ [Lempp<br />
13] geschätzt)<br />
3. Intersubjektivität o<strong>der</strong> Kultur: Wie sind die Interaktionen / Bindungen, die<br />
Paul <strong>mit</strong>erlebt<br />
4. Interobjektivität o<strong>der</strong> Gesellschaft: Welcher Rahmen steht im strukturellen<br />
Hintergrund dieser Ereignisse<br />
Doch es handelt sich um statische Versuche, die Diagnose zu erstellen. Das<br />
Individuum erlebt sich selbst jedoch subjektiv. So muβ ich mich die Fragen stellen,<br />
die es sich bewuβt o<strong>der</strong> unbewuβt während seines ganzen Lebens gestellt hat, um<br />
versuchsweise zur seiner dynamischen Autodiagnose zu gelangen: Wie würde ich<br />
mich fühlen, wenn ich <strong>mit</strong> diesen Potenzen und Dispotenzen zur Welt gekommen<br />
wäre und eine solche alltägliche <strong>Lebensgeschichte</strong> hinter mir hätte und eine solche<br />
Gegenwart erleben würde<br />
Denn es handelt sich nicht um ein jedes Zähneknirschen, gleich wie das von allen,<br />
die die Zähne knirschen. Mein Zähneknirschen hat ja <strong>mit</strong> meinen an<strong>der</strong>en<br />
Persönlichkeitsmerkmalen, unter denen meinen Zeichen und Symptomen <strong>der</strong><br />
Gegenwart, <strong>mit</strong> meiner eigenen <strong>Lebensgeschichte</strong>, darunter meiner / meinen<br />
Pathologie(n), <strong>mit</strong> meiner jetzigen und vorherigen familiären Subkultur (und ihrer /<br />
ihren Pathologie(n)), <strong>mit</strong> <strong>der</strong> gegenwärtigen und vergangenen Struktur <strong>der</strong> Umwelt<br />
zu tun. Mein Zähneknirschen muβ also im Rahmen meiner ganzen Person verstanden<br />
werden. Die Diagnose(n) muβ / müssen, um daraus ein personalisiertes<br />
Therapieprogramm ableiten zu können, dynamisch personalisiert werden.<br />
Sammelbegriffe und Sammeldiagnosen sind nicht nützlich, um mich <strong>mit</strong> Paul zu<br />
verstehen, um Therapie(n) für ihn und <strong>mit</strong> ihm zu gestalten.<br />
Schlieβlich modifizieren wir uns alle stetig und andauernd. Die diagnostische <strong>Arbeit</strong>,<br />
sowohl von Seiten des/r offiziellen Diagnostikers / Diagnostikerin wie von seiten des<br />
Klienten, hat also auch kein Ende. Längst nach <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> ersten<br />
diagnostischen Formulierung gibt es weiter von beiden Seiten die Suche nach<br />
Neuigkeiten, die das bekannte Bild des An<strong>der</strong>en, die Beziehung, die objektive Eigenund<br />
soziale Struktur bestätigen o<strong>der</strong> än<strong>der</strong>n.<br />
10
Literatur<br />
1] Neumann, J. (Hrsg.): Behin<strong>der</strong>ung. Attempto Verlag Tübingen 1995<br />
2] Wernicke, C.G.: Therapie des Kindes: Sättigung <strong>der</strong> Grundbedürfnisse,<br />
Dokumentation 1. Internationaler Kongreβ Festhalten, Regensburg.<br />
Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung des Festhaltens (Hrsg.), Stuttgart 1989<br />
3] Wernicke, C.G.: Pedagogía y diversidad humana [Pädagogik und menschliche<br />
Verschiedenheit], Vorwort <strong>der</strong> spanischen Ausgabe von L. Wise und C. Glass:<br />
¨Teaching and Learning with Hanna¨, Ed. Méd. Panamericana, Buenos Aires<br />
2001.<br />
4] Quirós, J.B. de, und Schrager, O.: Fundamentos neuropsicológicos en las<br />
discapacidades de aprendizaje. Ed. Méd. Panamericana, Buenos Aires 1980<br />
5] Hüther, G.: Biologie <strong>der</strong> Angst. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997<br />
6] Wernicke, C.G.: Las necesidades básicas [Die Grundbedürfnisse]. Tiempo de Integración<br />
IV nº 18, Buenos Aires 1990.<br />
7] Ciompi, L.: Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Vandenhoeck & Ruprecht,<br />
Göttingen, 1997<br />
8] Hoffmann, H.: Der Struwwelpeter, Siebert Verlag, Waldkirchen. Orig. 1845<br />
9] Wernicke, C.G.: Castigo y pedagogía [Bestrafung und Pädagogik]. Ca<strong>der</strong>nos<br />
Pestalozzi II n° 3, Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, Brasilien<br />
2000.<br />
10] Remschmidt, H., et al.: Multiaxiales Klassifikationsschema, Huber V. 2001<br />
11] DSM-IV. Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disor<strong>der</strong>s, American<br />
Psychiatric Association USA 1994<br />
12] Wilber, K.: Sex, Ecology, Spirituality. Ken Wilber, USA 1995<br />
13] Lempp, R.: Vom Verlust <strong>der</strong> Fähigkeit, sich selbst zu betrachten. Huber 1992<br />
11