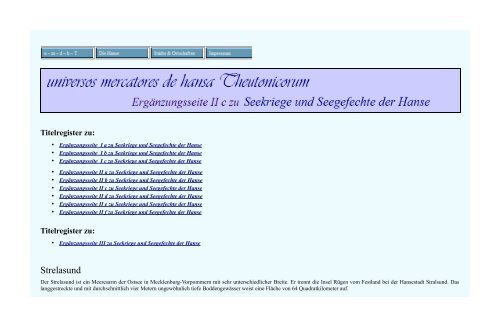Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Titelregister</strong> <strong>zu</strong>:<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I a <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I b <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I c <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II a <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II b <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II c <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II d <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II e <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II f <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
<strong>Titelregister</strong> <strong>zu</strong>:<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite III <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
Strelasund<br />
Der Strelasund ist ein Meeresarm <strong>de</strong>r Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern mit sehr unterschiedlicher Breite. Er trennt die Insel Rügen vom Festland bei <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund. Das<br />
langgestreckte und mit durchschnittlich vier Metern ungewöhnlich tiefe Bod<strong>de</strong>ngewässer weist eine Fläche von 64 Quadratkilometer auf.
Entstehung<br />
Die letzte Eiszeit und ihre vor 13.000 Jahren in dieser Region abgeschmolzenen Eismassen hinterließen eine leicht hügelige Geschiebemergellandschaft. Vor 7.000 Jahren befand sich hier<br />
wahrscheinlich noch ein bewal<strong>de</strong>tes Tal mit einem tief eingeschnittenen Flusslauf, <strong>de</strong>r durch das Abschmelzen <strong>de</strong>s eiszeitlichen Eispanzers entstan<strong>de</strong>n war. Später drang von bei<strong>de</strong>n Seiten<br />
das Meer in <strong>de</strong>n Flusslauf, was eine Flutung <strong>de</strong>r Ufer auslöste. Das Ufer <strong>de</strong>s Strelasunds ist auf Rügener Seite sowohl durch Steilufer als auch flache Ufer mit Schilfgürtel geprägt, das<br />
Festlandufer ist dagegen überwiegend flach.<br />
Informationen über die Entstehung <strong>de</strong>s Strelasunds wer<strong>de</strong>n im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund gezeigt.<br />
Geschichte<br />
Im Strelasund fan<strong>de</strong>n 1362 und 1369 Schlachten zwischen <strong>de</strong>m dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV. und <strong>de</strong>r Flotte <strong>de</strong>r Hanse statt. Als Ergebnis <strong>de</strong>r zweiten Schlacht wur<strong>de</strong> 1370 <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n<br />
von Stralsund geschlossen. In <strong>de</strong>n Jahren 1678 und 1715 war <strong>de</strong>r Strelasund Schauplatz von Kämpfen <strong>de</strong>r mit Dänemark verbün<strong>de</strong>ten Preußen gegen die Schwe<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>ren Ergebnis<br />
jeweils die schwedische Herrschaft in diesem Teil Schwedisch-Pommerns kurzzeitig unterbrochen wur<strong>de</strong>. Bei<strong>de</strong> Male wur<strong>de</strong>n die Schwe<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Landung dänischer und<br />
bran<strong>de</strong>nburgischer bzw. preußischer Truppen auf Rügen über <strong>de</strong>n Strelasund nach Stralsund <strong>zu</strong>rückgedrängt.<br />
Über <strong>de</strong>n Strelasund führt – als einzige feste Verbindung <strong>de</strong>r Insel Rügen <strong>zu</strong>m Festland – seit 1936 <strong>de</strong>r Rügendamm, er stellt eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnverbindung her. Seit<br />
2004 wur<strong>de</strong> an einer neuen Strelasundquerung gearbeitet, die seit Oktober 2007 als Hochbrücke mit einer Schiffsdurchfahrtshöhe von 42 Meter <strong>de</strong>n alten Rügendamm entlastet.<br />
Ein Sportereignis, das einmal jährlich durchgeführt wird, ist das Sundschwimmen, ein Schwimmwettbewerb über eine Strecke von 2,3 Kilometern zwischen Altefähr und Stralsund.<br />
Weithin bekannt ist <strong>de</strong>r Strelasund auch als guter Fanggrund für Hecht- und Zan<strong>de</strong>rangler. Im Brackwasser gibt es eine große Nahrungsvielfalt, weshalb die Raubfische schnell groß<br />
wer<strong>de</strong>n. Angelei und Berufsfischerei zehren jedoch kräftig am Bestand.<br />
In Stralsund stießen im Jahr 2002 Bauleute auf die Einbäume von Stralsund, drei 6000 bis 7000 Jahre alte Einbäume.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>n<br />
Der Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>n ist ein Randgewässer <strong>de</strong>r südlichen Ostsee mit einer Fläche von 514 km².<br />
Die Wasserfläche ist umgeben von <strong>de</strong>r Insel Rügen im Nor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m Festland im Westen und Sü<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Öffnung <strong>zu</strong>r Ostsee mit <strong>de</strong>n kleinen Inseln Ru<strong>de</strong>n und Greifswal<strong>de</strong>r Oie im<br />
Osten. Südöstlich liegt die Insel Usedom.<br />
Im Westen <strong>de</strong>s Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>ns bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Strelasund eine weitere Verbindung <strong>zu</strong>r Ostsee. Der Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Bod<strong>de</strong>ns wird auch Rügischer Bod<strong>de</strong>n genannt. Die Küstenlinie <strong>de</strong>s<br />
Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>ns ist stark geglie<strong>de</strong>rt. Die Halbinseln Zudar, Struck und Teile <strong>de</strong>r Halbinsel Mönchgut reichen weit in das Gewässer hinein. Diese teilen <strong>de</strong>n Bod<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>rum in<br />
Buchten, die <strong>zu</strong>m Teil tief eingeschnitten sind (im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Having mit <strong>de</strong>m Selliner See und die Hagensche Wiek, im Westen die Schoritzer Wiek und im Sü<strong>de</strong>n die Dänische Wiek).
Zu <strong>de</strong>n Inseln im Osten <strong>de</strong>s Bod<strong>de</strong>ns kommen die Inseln Vilm, Riems, Koos und die ehemalige Insel Stubber hin<strong>zu</strong>.<br />
Die durchschnittliche Wassertiefe beträgt 5,6 m (max. 13,5 m). Das Wasser <strong>de</strong>s Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>ns setzt sich aus Süßwasser <strong>de</strong>s mün<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Flusses Ryck, <strong>de</strong>m schwach salzigen<br />
Wasser <strong>de</strong>s Peenestroms und <strong>de</strong>m salzhaltigen Wasser <strong>de</strong>r Ostsee <strong>zu</strong>sammen und wird als Brackwasser bezeichnet.<br />
Ehemalige Bohrplattformen<br />
Im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Greifswal<strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>ns am Übergang <strong>zu</strong>r Dänischen Wiek befin<strong>de</strong>n sich drei verlassene Bohrplattformen. Auf ihnen waren in <strong>de</strong>n 1970er Jahren Probebohrungen durch <strong>de</strong>n<br />
VEB Erdöl Grimmen vorgenommen wur<strong>de</strong>n, durch die jedoch keine ergiebigen Erdöllagerstätten aufgefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n.<br />
Wassersportgebiet <strong>zu</strong> Zeiten <strong>de</strong>r DDR<br />
Zu DDR-Zeiten war <strong>de</strong>r Bod<strong>de</strong>n im Gegensatz <strong>zu</strong>r restlichen Ostsee <strong>zu</strong>gängliches Wassersportgebiet, da die Ausgänge <strong>zu</strong>r Ostsee wirksam überwacht wer<strong>de</strong>n konnten, um<br />
Republikfluchten <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Sundhagen - Stahlbro<strong>de</strong> (Ortsteil von Sundhagen)<br />
Sundhagen ist eine Gemein<strong>de</strong> im Landkreis Nordvorpommern. Sie ist Teil <strong>de</strong>s Amtes Miltzow. Der Name leitet sich vom Strelasund ab, an <strong>de</strong>ssen südöstlichem En<strong>de</strong> sie sich befin<strong>de</strong>t.<br />
Geografie<br />
Die Gemein<strong>de</strong> grenzt südöstlich an die Hansestadt Stralsund und liegt im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns am Strelasund, einem Meeresarm <strong>de</strong>r Ostsee zwischen <strong>de</strong>m Festland und<br />
<strong>de</strong>r Insel Rügen. Die maximalen Gelän<strong>de</strong>höhen im Gemein<strong>de</strong>gebiet erreichen 32 Meter über <strong>de</strong>m Meeresspiegel. Größere Waldgebiete existieren westlich von Wilmshagen und<br />
südwestlich von Kirchdorf.<br />
Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>rung<br />
Sundhagen besteht aus <strong>de</strong>n Ortsteilen Ahrendsee, Groß-Behnkenhagen, Hil<strong>de</strong>brandshagen, Klein-Behnkenhagen, Behnkendorf, Groß-Miltzow, Mid<strong>de</strong>lhagen, Neuhof, Nie<strong>de</strong>rhof,<br />
Schönhof, Wüstenfel<strong>de</strong>, Brandshagen, Horst, Jager, Ger<strong>de</strong>swal<strong>de</strong>, Segeba<strong>de</strong>nhau, Wendorf, Tremt, Jeeser, Kirchdorf, Reinkenhagen, Mannhagen, Engelswacht, Hankenhagen, Klein<br />
Miltzow, Miltzow, Oberhinrichshagen, Falkenhagen, Dömitzow, Stahlbro<strong>de</strong>, Reinberg, Bremerhagen und Wilmshagen.<br />
Geschichte<br />
Der Ortsteil Bremerhagen wur<strong>de</strong> 1323 erstmals urkundlich erwähnt.
Sundhagen wur<strong>de</strong> am 7. Juni 2009 durch <strong>de</strong>n Zusammenschluss <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n Behnkendorf, Brandshagen, Horst, Kirchdorf, Miltzow, Reinberg und Wilmshagen gebil<strong>de</strong>t.<br />
Das Gemein<strong>de</strong>gebiet war bis 1952 Teil <strong>de</strong>s Landkreises Grimmen und gehörte danach bis 1994 <strong>zu</strong>m Kreis Grimmen im Bezirk Rostock. Seit 1990 gehört die Region <strong>zu</strong>m Land<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Verkehr<br />
Durch die Gemein<strong>de</strong> führen die Bun<strong>de</strong>sstraße 96 von Stralsund nach Berlin, die Bun<strong>de</strong>sstraße 105 von Stralsund nach Greifswald sowie die Bahnstrecke Angermün<strong>de</strong>–Stralsund. Letztere<br />
besitzt in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Haltepunkte o<strong>de</strong>r Bahnhöfe in Wüstenfel<strong>de</strong>, Miltzow und Jeeser.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
• Albert Georg Schwartz (1687–1755), Theologe, Historiker und Philosoph, wur<strong>de</strong> im Ortsteil Horst geboren.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt - Bevölkerungsentwicklung <strong>de</strong>r Kreise und Gemein<strong>de</strong>n 2009 (PDF; 522 KB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Wolgast<br />
Wolgast ist eine Stadt im äußersten Nordosten Deutschlands. Sie gehört <strong>zu</strong>m Landkreis Ostvorpommern und ist Sitz <strong>de</strong>s Amtes Am Peenestrom, <strong>de</strong>m weitere neun Gemein<strong>de</strong>n angehören.<br />
Sie ist eines <strong>de</strong>r 18 Mittelzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Geografie<br />
Geografische Lage<br />
Wolgast liegt <strong>zu</strong>m größten Teil am Westufer <strong>de</strong>s Peenestroms, eines Meeresarms <strong>de</strong>r Ostsee, <strong>de</strong>r die Insel Usedom vom Festland trennt. Der Ortsteil Mahlzow liegt östlich <strong>de</strong>s<br />
Peenestroms auf <strong>de</strong>r Insel. Da diese über zwei Wolgaster Brücken mit <strong>de</strong>m Festland verbun<strong>de</strong>n ist, wird die Stadt auch als Tor <strong>zu</strong>r Insel Usedom bezeichnet.<br />
Etwa drei Kilometer südwestlich <strong>de</strong>r Stadt, in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Ziesabergs, mün<strong>de</strong>t die von Westen aus <strong>de</strong>m Ziesebruch kommen<strong>de</strong> Ziese in <strong>de</strong>n Peenestrom.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung
Zu Wolgast gehören die Ortsteile:<br />
• Altstadt<br />
• Mahlzow (auf <strong>de</strong>r Insel Usedom)<br />
• Tannenkamp<br />
• Wei<strong>de</strong>hof<br />
• Wolgast-Nord<br />
• Wolgast-Süd<br />
Geschichte<br />
Name<br />
Der Name Wolgast könnte ein altpolabischer Personenname Voligost gewesen sein, <strong>de</strong>ssen zweiter Namensteil gość die Be<strong>de</strong>utung Gast, auch Freund hat. Der Name bezeichnet somit<br />
jeman<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r einen größeren/besseren Freund hat.[2] Wilhelm Ferdinand Ga<strong>de</strong>busch ging ebenfalls von „groß“ als Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r ersten Silbe („woly“) aus, „gast“ soll jedoch als<br />
„Dickicht“ o<strong>de</strong>r „Hain“ <strong>zu</strong> <strong>de</strong>uten sein, woraus er „Großer Hain“ ableitete.[3]<br />
Der Ortsname verän<strong>de</strong>rte sich von Hologosta (1165) <strong>zu</strong> Woligost und urkundlich 1140 <strong>zu</strong> Wologost sowie <strong>zu</strong> Wolegast (1229) o<strong>de</strong>r Wolgust (1250) <strong>zu</strong>m heutigen germanisierten Wolgast<br />
(1250, 1331).[4]<br />
Mittelalter<br />
Die Gegend von Wolgast gehörte <strong>zu</strong>m Siedlungsgebiet <strong>de</strong>r wendischen Liutizen, später <strong>zu</strong>m Herzogtum Pommern. Der Ort wur<strong>de</strong> urkundlich erstmals im Jahr 1123 als eine Han<strong>de</strong>ls- und<br />
Zollstelle erwähnt. Hier befand sich <strong>de</strong>r Tempel <strong>de</strong>s slawischen Gottes Jarovit. Dieser wur<strong>de</strong> durch Bischof Otto von Bamberg auf seiner zweiten Missionsreise im Jahre 1128 zerstört. Er<br />
legte vermutlich an dieser Stelle die St.-Petri-Kirche an. Der Kirchbau und <strong>de</strong>r südlich davon gelegene wendische Rundling waren <strong>de</strong>r Ursprung <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Wolgast erhielt 1282 durch Herzog Bogislaw IV. eine Bestätigung <strong>de</strong>s Lübischen Stadtrechts. Die erstmalige Verleihung <strong>de</strong>s Stadtrechts wird zwischen 1250 und 1259 erfolgt sein.[5] Es<br />
ist davon aus<strong>zu</strong>gehen, dass sich die Stadtrechtsverleihung auf eine neue <strong>de</strong>utsche Stadt bezog, die mit regelmäßigem Straßennetz neben <strong>de</strong>n bisherigen wendischen Siedlungen Kronwiek,<br />
Bauwiek und Fischerwiek angelegt wur<strong>de</strong>.[5]<br />
Von 1296 bis 1625 war die Stadt nach <strong>de</strong>r Teilung <strong>de</strong>s Herzogtums Pommern in Pommern-Stettin und Pommern-Wolgast Sitz <strong>de</strong>r Herzöge <strong>de</strong>r Wolgaster Linie. Ihre Resi<strong>de</strong>nz, das Schloss<br />
Wolgast, war einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten nord<strong>de</strong>utschen Renaissancebauten. Es befand sich auf einer kleinen, <strong>de</strong>r Stadt vorgelagerten Insel im Peenestrom zwischen <strong>de</strong>m Festland und <strong>de</strong>r<br />
Insel Usedom, die bis in die Gegenwart als „Schlossinsel“ bezeichnet wird. Um 1820 verschwan<strong>de</strong>n die letzten Überreste <strong>de</strong>s Schlosses aus <strong>de</strong>m Stadtbild. Sehenswert aus dieser Zeit sind<br />
die Petrikirche mit <strong>de</strong>r herzoglichen Gruft und die Gertru<strong>de</strong>nkapelle auf <strong>de</strong>m alten Friedhof, ein architektonisches Kleinod.<br />
Wolgast war Mitglied <strong>de</strong>r Hanse, innerhalb dieses Städtebun<strong>de</strong>s jedoch nie von größerer Be<strong>de</strong>utung. Die durch die Resi<strong>de</strong>nz vermittelte Nähe <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrn führte da<strong>zu</strong>, dass die Stadt<br />
nicht die Unabhängigkeit und Selbständigkeit an<strong>de</strong>rer Städte dieser Zeit erreichen konnte.[5]<br />
16. bis 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Der schwedische König Gustav II. Adolf lan<strong>de</strong>te im Dreißigjährigen Krieg mit seiner Armee unweit <strong>de</strong>s Stadtgebietes. Ebenso erfolgte nach seinem Tod die Rückführung seines<br />
Leichnams nach Schwe<strong>de</strong>n von Wolgast aus.<br />
Vom En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges 1648 bis <strong>zu</strong>m Wiener Kongress 1815 befand sich die Stadt, wie das gesamte Gebiet Vorpommerns, unter schwedischer Herrschaft und versank in<br />
die Be<strong>de</strong>utungslosigkeit, profitierte aber von <strong>de</strong>n Zoll- und Steuervergünstigungen. Das herzogliche Schloss verfiel und wur<strong>de</strong> als Baumaterial für innerstädtische Häuser verwandt. Im
Jahr 1713 ließ <strong>de</strong>r russische Zar Peter I. die Stadt im Großen Nordischen Krieg nie<strong>de</strong>rbrennen. Dabei wur<strong>de</strong>n das Resi<strong>de</strong>nzschloss endgültig und große Teile <strong>de</strong>r Stadt fast völlig zerstört.<br />
Daher basiert das heutige Stadtbild von Wolgast in wesentlichen Teilen auf barocker Architektur, mit <strong>de</strong>m historischen Rathaus als herausragen<strong>de</strong>m Beispiel, bei weitgehend<br />
mittelalterlichem Straßengrundriss. Zu <strong>de</strong>n wenigen in diesem Brand nicht zerstörten und damit noch heute verbliebenen Resten gotischer Baukunst zählt die Kirche St. Petri.<br />
Seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam es <strong>zu</strong> neuem Aufschwung durch Han<strong>de</strong>l und Industrie. Es entstan<strong>de</strong>n Speicher- und Han<strong>de</strong>lshäuser. Um die Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts verfügten<br />
die in Wolgast vertretenen Ree<strong>de</strong>r über 20 Han<strong>de</strong>lsschiffe.[6]<br />
Beson<strong>de</strong>rs sehenswert als gut erhaltene Fachwerkbauten waren die bei<strong>de</strong>n großen Getrei<strong>de</strong>speicher am Stadthafen, <strong>de</strong>r eine aus <strong>de</strong>m Jahr 1836. In ihnen sollen die letzten Steine <strong>de</strong>s<br />
Schlosses verbaut sein. Der in unmittelbarer Nähe <strong>zu</strong>r Peene-Werft stehen<strong>de</strong>, 1843 für <strong>de</strong>n Getrei<strong>de</strong>großhändler Wilhelm Homeyer errichtete Speicher wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Nacht vom 6. <strong>zu</strong>m 7.<br />
Juni 2006 durch einen auf Brandstiftung beruhen<strong>de</strong>n Großbrand vollständig zerstört.<br />
Ab 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Die Weltkriege überstand Wolgast ohne nennenswerte Zerstörungen. Dies ist vor allem auf die kampflose Übergabe <strong>de</strong>r Stadt im Zweiten Weltkrieg am 30. April 1945 <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen.<br />
Zu Zeiten <strong>de</strong>r DDR wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadt die Peene-Werft errichtet. Sie war auf Militärschiffbau ausgerichtet und hatte ca. 3.500 Beschäftigte. Daneben wur<strong>de</strong> Wolgast <strong>zu</strong>m<br />
Marinestützpunkt. Administrativ wur<strong>de</strong> Wolgast Kreisstadt <strong>de</strong>s Kreises Wolgast im Bezirk Rostock. Die Einwohnerzahl stieg bis 1989 auf etwa 17.000.<br />
Nach <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n ab 1991 <strong>de</strong>r historische Stadtkern und die Schlossinsel im Rahmen <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung gründlich saniert; das Stadtbild mit seinem mo<strong>de</strong>rnisierten<br />
Rathaus und <strong>de</strong>n Speichergebäu<strong>de</strong>n hat sich stark verbessert. Durch Stadtumbau und Wohnumfeldverbesserungen wur<strong>de</strong>n die benachbarten großen Wohngebiete saniert.<br />
Nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung wur<strong>de</strong>n die Marinestreitkräfte abgezogen. Im Zuge <strong>de</strong>r Kreisgebietsreform <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 1994 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kreis Wolgast-<br />
Land <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Kreisen Anklam-Land und Greifswald-Land <strong>zu</strong>m Landkreis Ostvorpommern <strong>zu</strong>sammengefasst, <strong>de</strong>ssen Kreissitz die Stadt Anklam ist. Aufgrund von<br />
Abwan<strong>de</strong>rung, vorwiegend in an<strong>de</strong>re Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r aufgrund <strong>de</strong>r angespannten Arbeitsmarktsituation in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch durch Stadtflucht in kleinere<br />
Umlandgemein<strong>de</strong>n, hat Wolgast seit Beginn <strong>de</strong>r 1990er Jahre <strong>de</strong>utlich an Einwohnern verloren.<br />
Politik<br />
Bürgermeister <strong>de</strong>r Stadt Wolgast ist seit 2008 <strong>de</strong>r parteilose Stefan Weigler, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Partei Die Linke nominiert wor<strong>de</strong>n war und in einer Stichwahl gegen <strong>de</strong>n langjährigen<br />
Amtsinhaber Jürgen Kanehl von <strong>de</strong>r SPD gewann. Der aus 25 Abgeordneten bestehen<strong>de</strong>n Stadtvertretung gehören seit 2009 acht Abgeordnete <strong>de</strong>r Linken, fünf Abgeordnete <strong>de</strong>r CDU,<br />
fünf Abgeordnete <strong>de</strong>r Wählervereinigung „Bürger für Wolgast“, vier Abgeordnete <strong>de</strong>r SPD, ein Abgeordneter <strong>de</strong>r NPD und zwei unabhängige Einzelbewerber an.<br />
Wappen<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>r Nr. 52 <strong>de</strong>r Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert.<br />
Blasonierung: „In Gold auf grünem Bo<strong>de</strong>n ein roter Zinnenturm mit abwechselnd von Blau und Gold senkrecht gestreiftem Kuppeldach und geschlossenem gol<strong>de</strong>nen Tor zwischen zwei<br />
goldbewehrten, einan<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gewen<strong>de</strong>ten schwarzen Greifen, die auf <strong>de</strong>n Bärten zweier senkrecht stehen<strong>de</strong>r abgewen<strong>de</strong>ter schwarzer Schlüssel stehen und mit einer Pranke <strong>de</strong>n Turm und<br />
mit <strong>de</strong>n Fängen die Kuppel ergreifen.“<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> 1997 neu gezeichnet.<br />
Flagge<br />
Die Flagge <strong>de</strong>r Stadt Wolgast ist längs gestreift von Gold (Gelb), Rot und Gold (Gelb), die gol<strong>de</strong>nen (gelben) Streifen nehmen jeweils ein Sechstel, <strong>de</strong>r rote Streifen nimmt zwei Drittel<br />
<strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>s Flaggentuches ein. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s roten Streifens liegt das Stadtwappen, fünf Sechstel <strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>s roten Streifens einnehmend. Die Länge <strong>de</strong>s Flaggentuchs verhält sich
<strong>zu</strong>r Höhe wie 5:3.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Partnerstädte von Wolgast sind We<strong>de</strong>l in Schleswig-Holstein, Nexø auf Bornholm in Dänemark, Sölvesborg in Schwe<strong>de</strong>n und Karlino in Polen.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Museen<br />
• Das städtische Museum Kaffeemühle ist ein zweigeschossiger quadratischer Fachwerkbau auf Feldsteinsockel aus <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt mit einem reizvollen Zeltdach.<br />
• Das Rungehaus ist das Geburtshaus <strong>de</strong>s Malers Philipp Otto Runge.<br />
Bauwerke<br />
• Recht gut erhalten ist die inzwischen sanierte mittelalterliche Innenstadt von Wolgast. Von <strong>de</strong>n Bauten auf <strong>de</strong>r herzoglichen Schlossinsel sind hingegen kaum Reste erhalten.<br />
• Die Petrikirche wur<strong>de</strong> von 1280 bis 1350 im gotischen Stil errichtet und bis <strong>zu</strong>m Anfang <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> einer dreischiffigen Basilika umgestaltet. In <strong>de</strong>r Gruft von 1587<br />
befin<strong>de</strong>n sich die Särge <strong>de</strong>r letzten sieben Angehörigen <strong>de</strong>r Herzogsfamilie von Pommern-Wolgast. Nach einem Brand wur<strong>de</strong> die Kirche 1713 wie<strong>de</strong>rhergestellt. Vom Kirchturm<br />
aus bietet sich ein guter Überblick über die Stadt. Die Besichtigung <strong>de</strong>r Gruft ist möglich.<br />
• Die Herz-Jesu-Kirche wur<strong>de</strong> 1910 errichtet und ist das Gotteshaus <strong>de</strong>r in Wolgast ansässigen Katholiken, die <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Katholiken <strong>de</strong>r Stadt Anklam von <strong>de</strong>r<br />
Kirchengemein<strong>de</strong> Salvator betreut wer<strong>de</strong>n.<br />
• Das historische Rathaus ist ein zweigeschossiger Backsteinbau, <strong>de</strong>ssen heutige Erscheinung durch die Wie<strong>de</strong>rherstellung von 1718 bis 1724 bestimmt wird. Die<br />
Laternentürmchen am barocken Marktgiebel stammen von 1780. Spätgotische Reste sind am hinteren Giebel erhalten.<br />
• Die Gertru<strong>de</strong>nkapelle ist eine Kirche vom Anfang <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Die gotische Kapelle wur<strong>de</strong> als zwölfeckige Zentralbau aus Backsteinen errichtet und soll an das Heilige<br />
Grab in Jerusalem erinnern. Sie steht südlich <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sstraße 111 (Chausseestraße, B 111) auf <strong>de</strong>m Alten Friedhof und gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten erhaltenen Gebäu<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Herzog Wartislaw IX. von Pommern ließ das Gebäu<strong>de</strong> um 1420 als Hospitalkapelle außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern errichten.<br />
• Die Kapelle St. Jürgen aus <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt ist ein einschiffiger Backsteinbau.<br />
• Das spätgotische Wohnhaus Burgstraße 9 stammt aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
• Denkmal aus <strong>de</strong>n 1950er Jahren oberhalb <strong>de</strong>r Bahnhofstraße für die Opfer <strong>de</strong>s Faschismus, unter <strong>de</strong>nen sich Sozial<strong>de</strong>mokraten, Kommunisten und Ju<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt befin<strong>de</strong>n.<br />
• Der Wassermühlen-Brunnen ist eine bespielbare Brunnenskulptur, die im Jahre 2001 im Rahmen einer Kontakt-Kunst-Aktion <strong>de</strong>r Bildhauer Hans-Werner Kalkmann und Jens<br />
Kalkmann unter Beteiligung <strong>de</strong>r Bürgerinnen und Bürger entstand. Kulturgeschichtlicher Hintergrund ist die Mahlsteinsammlung im Mühlen-Stein-Park in <strong>de</strong>r Dr.-Theodor-<br />
Neubauer-Straße.<br />
• Das Bankgebäu<strong>de</strong> am Rathausplatz 2 wur<strong>de</strong> von Hans Poelzig, <strong>de</strong>m Architekten <strong>de</strong>s I.G.-Farben-Hauses in Frankfurt am Main und <strong>de</strong>s Berliner Hauses <strong>de</strong>s Rundfunks,<br />
entworfen.<br />
• Der historische Brunnen vor <strong>de</strong>m alten Rathaus zeigt auf zwölf Bil<strong>de</strong>rn die Geschichte Wolgasts.<br />
Freizeiteinrichtungen<br />
• Im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt liegt <strong>de</strong>r Tierpark Tannenkamp.<br />
• Zwischen <strong>de</strong>r Schlossinsel und <strong>de</strong>m Fischmarkt befin<strong>de</strong>t sich ein Museumshafen, <strong>de</strong>ssen Hauptattraktion die über 100 Jahre alte und bis nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> eingesetzte<br />
Eisenbahnfähre „Stralsund“ ist.
• Am Ufer <strong>de</strong>s Peenestroms befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Dreilin<strong>de</strong>ngrund, <strong>de</strong>r vor allem als städtische Ba<strong>de</strong>stelle genutzt wird.<br />
Vergessene Orte<br />
Sport<br />
• Der alte Jüdische Friedhof am Paschenberg hinter <strong>de</strong>m Krankenhaus ist 2008 verwil<strong>de</strong>rt und unkenntlich. Der jüdischen Opfer <strong>de</strong>r Shoa wird dort mit <strong>de</strong>m Denkmal für die Opfer<br />
<strong>de</strong>s Nationalsozialismus gedacht.<br />
Der größte und bekannteste Sportverein <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r SV Motor 1949 Wolgast, <strong>de</strong>ssen Sportler unter <strong>de</strong>m Vereinsnamen BSG Motor Wolgast bis 1990 vor allem in <strong>de</strong>n Sportarten Judo<br />
und Kegeln sowie im Boxen bei DDR-Meisterschaften in Einzel- und Mannschaftswettbewerben erfolgreich waren. Die im Jahr 2001 als FC Rot-Weiß Wolgast ausgeglie<strong>de</strong>rte<br />
Fußballmannschaft erreichte 1963, 1977 und 1980 dreimal <strong>de</strong>n Aufstieg in die DDR-Liga, die zweithöchste Klasse im Spielbetrieb <strong>de</strong>s Deutschen Fußballverband <strong>de</strong>r DDR. Im Bereich<br />
<strong>de</strong>s Motorsports ist <strong>de</strong>r MC Wolgast aktiv, <strong>de</strong>r ebenfalls bei DDR-Meisterschaften erfolgreich war und bis in die Gegenwart auf <strong>de</strong>r vereinseigenen Rennstrecke am Ziesaberg jährlich<br />
stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Motocross-Wettkämpfe mit internationaler Beteiligung organisiert. Der Sportclub Wolgast hat unter <strong>de</strong>m Namen Wolgast Vandals seit 2006 eine American-Football-<br />
Mannschaft, die in <strong>de</strong>r Verbandsliga Ost spielt. Weitere aktive Sportvereine in <strong>de</strong>r Stadt bestehen unter an<strong>de</strong>rem in <strong>de</strong>n Bereichen Angeln, Handball, Kanusport, Reitsport, Ru<strong>de</strong>rn,<br />
Schwimmen, Sportschießen, Segeln, Tanzen und Tauchen.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Wolgast ist Sitz <strong>de</strong>s Amtes Am Peenestrom und gilt als Mittelzentrum in <strong>de</strong>r Region. In <strong>de</strong>r Stadt befin<strong>de</strong>n sich ein Amtsgericht, ein Arbeitsamt, eine Dienststelle <strong>de</strong>r Sozialagentur <strong>de</strong>s<br />
Landkreises Ostvorpommern, das Kreiskrankenhaus Wolgast in Trägerschaft <strong>de</strong>s Universitätsklinikums Greifswald, ein Ärztehaus, eine Musikschule und eine Außenstelle <strong>de</strong>r<br />
Volkshochschule Ostvorpommern, eine städtische Bibliothek, eine Berufsschule und ein Gymnasium, sowie ein Polizeirevier und eine Inspektion <strong>de</strong>r Wasserschutzpolizei. Das ehemalige<br />
Finanzamt Wolgast wur<strong>de</strong> mit Wirkung vom 1. August 2009 mit <strong>de</strong>m Finanzamt Greifswald am Standort Greifswald <strong>zu</strong>sammengelegt.<br />
Die Wirtschaft wird geprägt von <strong>de</strong>r Peene-Werft mit ihren rund 800 Beschäftigten und diversen Zulieferbetrieben. Die Stadt besitzt weiterhin ein Existenzgrün<strong>de</strong>rzentrum sowie einen<br />
Stadthafen und einen Südhafen für Binnen- und Hochseeschifffahrt.<br />
Verkehrsanbindung<br />
Wolgast liegt an <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sstraße 111, welche von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sautobahn 20 kommend die Stadt durchquert und auf <strong>de</strong>r Insel Usedom bis nach Ahlbeck an die polnische Grenze führt. Der<br />
Bau einer Ortsumgehung <strong>zu</strong>r Entlastung vom Durchgangsverkehr, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n touristisch wichtigen Sommermonaten, ist seit Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre geplant.<br />
Die 1934 fertiggestellte Peenebrücke über <strong>de</strong>n Peenestrom wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Sprengung gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges neu aufgebaut und 1950 wie<strong>de</strong>r eröffnet. Ab 1996 begannen<br />
die Bauarbeiten für einen kompletten Neubau, <strong>de</strong>r 1998 als Straßen- und 2001 als kombinierte Eisenbahnbrücke fertiggestellt wur<strong>de</strong>. Heute nennt man diese Brücke das „Blaue Wun<strong>de</strong>r“.<br />
Heute erfolgt über die seit 1863 bestehen<strong>de</strong> Bahnstrecke Züssow–Wolgast Hafen und die seit 1876 bestehen<strong>de</strong> Bahnstrecke Ducherow–Heringsdorf–Wolgaster Fähre ein direkter<br />
Bahnverkehr auf die Insel Usedom bis nach Świnoujście (Swinemün<strong>de</strong>) in Polen. Für <strong>de</strong>n regionalen Bahnbetrieb ist auf diesem Gleisnetzbereich die private Usedomer Bä<strong>de</strong>rbahn (UBB)<br />
<strong>zu</strong>ständig. Hin<strong>zu</strong> kommen an <strong>de</strong>n Sommerwochenen<strong>de</strong>n Fernzüge <strong>de</strong>r Deutschen Bahn AG aus Köln über Potsdam in das Seebad Heringsdorf.<br />
Literatur<br />
• Gustav Kratz: Die Städte <strong>de</strong>r Provinz Pommern. Abriß ihrer Geschichte, <strong>zu</strong>meist nach Urkun<strong>de</strong>n. Berlin 1865; Nachdruck: Sändig Reprint Verlag, Vaduz 1996 ISBN 3-253-<br />
02734-1, S. 541-547 (Digitalisat).<br />
• Joachim Wächter: Wolgast im Mittelalter. Erst wendisches Zentrum, dann <strong>de</strong>utsche Stadt. In: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte. Heft 4/2007, ISSN 0032-4167, S.<br />
18–23.
• Karl Heller: Chronik <strong>de</strong>r Stadt Wolgast, Greifswald 1829. (Digitalisat).<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt - Bevölkerungsentwicklung <strong>de</strong>r Kreise und Gemein<strong>de</strong>n 2009 (PDF; 522 KB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ Oskar Beyersdorf: Ueber die Slavischen Städtenamen Pommerns. In: Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskun<strong>de</strong> (Hrsg.): Baltische Studien. Band 25, Heft 1,<br />
Stettin 1874, S. 100<br />
3. ↑ Wilhelm Ferdinand Ga<strong>de</strong>busch: Chronik <strong>de</strong>r Insel Usedom. W. Dietze, Anklam 1863, S. 243. (Digitalisat)<br />
4. ↑ Ernst Eichler und Werner Mühlmer: Die Namen <strong>de</strong>r Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Ingo Koch Verlag, Rostock 2002, ISBN 3-935319-23-1<br />
5. ↑ a b c Joachim Wächter: Wolgast im Mittelalter. In: Pommern. Zeitschrift für Kultur und Geschichte. Heft 4/2002, S. 18–23.<br />
6. ↑ Übersicht <strong>de</strong>r Preußischen Han<strong>de</strong>lsmarine (E. Wendt & Co., Hrsg.), Stettin 1848, S. 29.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremen<br />
Die Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen ist die Hauptstadt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Freie Hansestadt Bremen (meist kurz auch „Bremen“). Zu diesem Zwei-Städte-Staat gehört neben <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen<br />
noch die 60 Kilometer nördlich gelegene Stadtgemein<strong>de</strong> Bremerhaven. Bremen ist die zehntgrößte Stadt Deutschlands. Die Stadt gehört <strong>zu</strong>r Europäischen Metropolregion<br />
Bremen/Ol<strong>de</strong>nburg, einer von insgesamt elf Europäischen Metropolregionen in Deutschland.<br />
Geographie<br />
Bremen liegt <strong>zu</strong> bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Weser, etwa 60 Kilometer vor <strong>de</strong>ren Mündung in die Nordsee bzw. <strong>de</strong>ren Übergang in die Außenweser bei Bremerhaven. In Höhe <strong>de</strong>r Bremer Altstadt<br />
geht die Mittelweser in die Unterweser über, die ab <strong>de</strong>m Bremer Hafengebiet <strong>zu</strong>r Seeschifffahrtsstraße ausgebaut ist. Die von <strong>de</strong>r Ochtum durchzogene Landschaft links <strong>de</strong>r Unterweser<br />
wird als Wesermarsch bezeichnet, die Landschaft rechts <strong>de</strong>r Unterweser gehört <strong>zu</strong>m Elbe-Weser-Dreieck. Die Lesum, mit ihren Quellflüssen Wümme und Hamme, die Schönebecker und<br />
die Blumenthaler Aue bil<strong>de</strong>n von hier aus die Zuflüsse <strong>de</strong>r Weser.<br />
Das Stadtgebiet ist etwa 38 Kilometer lang und 16 Kilometer breit. Die Länge <strong>de</strong>r Stadtgrenze beträgt 136,5 Kilometer. Bremen ist nach Fläche (siehe: Liste <strong>de</strong>r flächengrößten Städte<br />
und Gemein<strong>de</strong>n Deutschlands) und Einwohnern (siehe: Liste <strong>de</strong>r Großstädte in Deutschland) die zehntgrößte Stadt Deutschlands, nach Hamburg die zweitgrößte Nord<strong>de</strong>utschlands und<br />
die größte Stadt in Nordwest<strong>de</strong>utschland. Des Weiteren liegt Bremen in <strong>de</strong>r Liste <strong>de</strong>r größten Städte Europas auf Platz 74 und in <strong>de</strong>r EU auf Platz 44.<br />
Bremen liegt etwa 50 Kilometer östlich von Ol<strong>de</strong>nburg (Ol<strong>de</strong>nburg), 110 Kilometer südwestlich von Hamburg, 120 Kilometer nordwestlich von Hannover, 100 Kilometer nördlich von<br />
Min<strong>de</strong>n und 105 Kilometer nordöstlich von Osnabrück.<br />
Nachbargemein<strong>de</strong>n
Die Stadt Bremen (547.685 Einwohner) ist ganz von nie<strong>de</strong>rsächsischem Staatsgebiet umschlossen (mit Ausnahme <strong>de</strong>r Exklave Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven, die<br />
vom Stadtgebiet Bremerhavens umgeben ist). Im Westen grenzen die kreisfreie Stadt Delmenhorst (75.672 Einwohner) sowie <strong>de</strong>r Landkreis Wesermarsch (93.725 Einwohner) mit <strong>de</strong>n<br />
Gemein<strong>de</strong>n Lemwer<strong>de</strong>r, Berne und Elsfleth an, im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Landkreis Osterholz (112.587 Einwohner) mit <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n Schwanewe<strong>de</strong>, Ritterhu<strong>de</strong> und Lilienthal, im Osten <strong>de</strong>r<br />
Landkreis Ver<strong>de</strong>n (134.084 Einwohner) mit <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n Ottersberg, Oyten, Achim und im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Landkreis Diepholz (215.648 Einwohner) mit <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n Weyhe und Stuhr.<br />
Diese Ansammlung von Gemein<strong>de</strong>n wird als „Speckgürtel“ bezeichnet, da ein Großteil ihrer Einwohner Einkünfte im Bun<strong>de</strong>sland Bremen bezieht, aber Einkommensteuer, Grundsteuer<br />
und an<strong>de</strong>re Abgaben an <strong>de</strong>n Staat in Nie<strong>de</strong>rsachsen bezahlt. Die nächstgrößeren Städte im Umkreis von etwa 50 km sind im Westen die Stadt Ol<strong>de</strong>nburg (160.279 Einwohner) und im<br />
Nor<strong>de</strong>n die Seestadt Bremerhaven (114.506 Einwohner). Aus <strong>de</strong>m Raum um Bremen, einer Agglomeration von 1.511.198 Einwohnern (858.488 im Verdichtungsraum), pen<strong>de</strong>ln etwa<br />
115.000 Arbeitnehmer[2] täglich nach Bremen, das sind etwa 48 % <strong>de</strong>r in Bremen Beschäftigten. Umgekehrt pen<strong>de</strong>ln tausen<strong>de</strong> Bremer <strong>zu</strong> und von ihren Arbeitsplätzen in die<br />
Gewerbegebiete im nie<strong>de</strong>rsächsischen Umland.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Das Stadtgebiet Bremens ist in fünf Stadtbezirke eingeteilt. Von <strong>de</strong>n insgesamt 89 Ortsteilen sind fünf direkt einem Stadtbezirk <strong>zu</strong>geordnet, die an<strong>de</strong>ren sind in <strong>de</strong>n 18 Stadtteilen<br />
<strong>zu</strong>sammengefasst, die ihrerseits <strong>de</strong>n Stadtbezirken <strong>zu</strong>geordnet sind. Die Namen <strong>de</strong>r Stadt- und Ortsteile gehen weitgehend auf historisch gewachsene Bezeichnungen <strong>zu</strong>rück. Für<br />
bestimmte örtliche Verwaltungsaufgaben sind 17 Ortsämter <strong>zu</strong>ständig, davon vier als gemeinsame Ortsämter für jeweils mehrere Stadt- bzw. Ortsteile.<br />
Für die Stadtteile und selbständigen Ortsteile ist auf kommunalpolitischer Ebene jeweils ein Beirat <strong>zu</strong>ständig. Ausnahme: Die Ortsteile <strong>de</strong>s Stadtteils Häfen wer<strong>de</strong>n aufgrund <strong>de</strong>r geringen<br />
Einwohnerzahl von an<strong>de</strong>ren Beiräten betreut. Die 22 Beiräte wer<strong>de</strong>n alle vier Jahre von <strong>de</strong>n Bürgern direkt gewählt und tagen mehrmals im Jahr öffentlich. Die Befugnisse <strong>de</strong>s Beirats<br />
sind ähnlich beschränkt wie bei <strong>de</strong>r Bezirksversammlung o<strong>de</strong>r Bezirksverordnetenversammlung an<strong>de</strong>rer Stadtstaaten.<br />
Zur Stadt Bremen gehört auch das etwa 8 km² große stadtbremische Überseehafengebiet, für das jedoch die Stadt Bremerhaven auf Grund eines Vertrages mit <strong>de</strong>r Stadt Bremen als<br />
Gemein<strong>de</strong>verwaltung <strong>zu</strong>ständig ist. Dies wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Verfassung für die Stadt Bremerhaven (§ 8 VerfBrhv) verankert.<br />
Gewässer<br />
Die Bun<strong>de</strong>swasserstraße <strong>de</strong>r Weser, die durch die Innenstadt fließt, stellt eine geschichtlich gewachsene Grenze dar: So wird noch heute in vielen Bezeichnungen unterschie<strong>de</strong>n zwischen<br />
„links <strong>de</strong>r Weser“ (südliches Stadtgebiet) und „rechts <strong>de</strong>r Weser“. Geographisch, historisch und für das Alltagsleben be<strong>de</strong>utsam ist die Grenze zwischen Bremen-Stadt und Bremen-Nord<br />
entlang <strong>de</strong>r Lesum, einem Nebenfluss <strong>de</strong>r Weser. Südlich <strong>de</strong>r Lesum ist Marsch, das Wer<strong>de</strong>rland, nördlich davon Geest, die Bremer Schweiz. Die politische Grenze <strong>de</strong>s Stadtbezirks<br />
Bremen-Nord liegt allerdings etwas weiter südlich. Ein weiterer Nebenfluss <strong>de</strong>r Weser, die Ochtum, bil<strong>de</strong>t die natürliche südliche Grenze <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen. Die Wümme fließt<br />
durch Borgfeld und ist dann Grenzfluss bis <strong>zu</strong>r Mündung (<strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Hamme) in die Lesum.<br />
Naturschutzgebiete<br />
In <strong>de</strong>r Stadt Bremen gibt es insgesamt 17 Naturschutzgebiete. Zu <strong>de</strong>n größten gehören die Borgfel<strong>de</strong>r Wümmewiesen (677 ha), die Ochtumnie<strong>de</strong>rung (375 ha), das Hollerland (293 ha)<br />
und das Wer<strong>de</strong>rland (242 ha).<br />
Erhebungen in Bremen<br />
Die Innenstadt liegt auf einer Weserdüne, die am Bremer Dom eine natürliche Höhe von 11,5 m ü. NN erreicht; <strong>de</strong>r höchste Punkt mit 14 m ü. NN liegt östlich davon in <strong>de</strong>n Wallanlagen<br />
auf <strong>de</strong>m ehemaligen künstlich angelegten Theaterberg.[3] Die mit 32,5 m ü. NN höchste natürliche Erhebung in <strong>de</strong>r heutigen Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen befin<strong>de</strong>t sich dagegen im<br />
Frie<strong>de</strong>horstpark <strong>de</strong>s nordwestlich gelegenen Stadtteils Burglesum. Noch höher ist nur <strong>de</strong>r Hügel <strong>de</strong>r Müll<strong>de</strong>ponie in Bremen-Blockland mit 49 m ü. NN.<br />
Klima<br />
Bremen liegt in <strong>de</strong>r gemäßigten Zone mit <strong>de</strong>utlichen maritimen Einflüssen. Der wärmste Monat ist <strong>de</strong>r Juli mit durchschnittlich 16,8 °C und <strong>de</strong>r kälteste <strong>de</strong>r Januar mit 0,8 °C. Die
Nie<strong>de</strong>rschläge fallen über das ganze Jahr verteilt. Im Laufe eines Jahres fallen durchschnittlich 693,9 mm Nie<strong>de</strong>rschlag, wobei die Abweichungen recht ausgeprägt sind. So fielen<br />
zwischen 1961 und 1990 in Farge 638,8 mm, in Strom hingegen 753,2 mm pro Jahr[4], meist als Regen. Die Nie<strong>de</strong>rschlagsmengen in Form von Schnee sind hingegen eher gering.<br />
Bremen gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schneeärmsten Städten Deutschlands; im Durchschnitt liegt an weniger als fünf Tagen im Jahr Schnee, dabei wur<strong>de</strong> 1979 mit fast 700 mm die höchste gemessene<br />
Schneehöhe erreicht.[5] Im Herbst kann es <strong>zu</strong> Stürmen und Unwettern kommen, dabei können auch Sturmfluten auftreten, wie 1976 o<strong>de</strong>r 1990.<br />
Geschichte<br />
Von <strong>de</strong>n ersten Siedlungen bis <strong>zu</strong>r Christianisierung<br />
Zwischen <strong>de</strong>m 1. und <strong>de</strong>m 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt n. Chr. entstan<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r Weser erste Siedlungen, die auf einer langen Düne Schutz vor Hochwasser und gleichzeitig guten Zugang <strong>zu</strong> einer Furt<br />
boten. Bereits 150 n. Chr. erwähnte <strong>de</strong>r alexandrinische Geograph Claudius Ptolemaeus eine dieser Siedlungen (Fabiranum, auch Phabiranum geschrieben).<br />
Bistum<br />
Als Bischofsstadt und Kaufmannssiedlung reicht Bremens Geschichte bis ins 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>rück.[6] Sie war aber <strong>zu</strong>nächst noch unsicheres Missionsgebiet. So schrieb <strong>de</strong>r Missionar<br />
Willehad 782: „… hat man uns aus Bremen vertrieben und zwei Priester erschlagen.“ Die Stadt wur<strong>de</strong> 787 von Karl <strong>de</strong>m Großen <strong>zu</strong>m Bischofssitz erhoben<br />
Seit 845 Erzbistum, erlangte Bremen unter Erzbischof Adalbert von Bremen (1043–1072) erstmals Einfluss auf Reichsebene.<br />
Reichsfreiheit und Hanse<br />
Mit <strong>de</strong>m Gelnhauser Privileg Kaiser Friedrich Barbarossas von 1186 wur<strong>de</strong> Bremen Reichsstadt (im Volksmund freie Reichsstadt), nicht jedoch reichsunmittelbar.<br />
1260 trat die Stadt <strong>de</strong>r Hanse bei, war in ihr aber zeitweise ein unsicherer Bündnispartner. Die <strong>zu</strong> wirtschaftlicher Be<strong>de</strong>utung gelangen<strong>de</strong> Stadt schüttelte teilweise die weltliche Herrschaft<br />
<strong>de</strong>s Bistums Bremen ab und errichtete als Zeichen ihrer Freiheit <strong>de</strong>n Roland (1404) und ihr Rathaus (1409) auf <strong>de</strong>m Bremer Marktplatz.<br />
Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>r Stadt, Versuch einer territorialen Expansion<br />
Zum Schutz <strong>de</strong>s zwischen 1574 und 1590 angelegten Weserhafens wur<strong>de</strong> am Westufer <strong>de</strong>r Weser die befestigte Neustadt angelegt. Die Weser versan<strong>de</strong>te jedoch <strong>zu</strong>nehmend und für die<br />
Han<strong>de</strong>lsschiffe wur<strong>de</strong> es immer schwieriger, an <strong>de</strong>r seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt als Hochseekai genutzten Schlachte an<strong>zu</strong>legen. Von 1619 bis 1623 bauten <strong>de</strong>shalb im flussabwärts gelegenen<br />
Vegesack nie<strong>de</strong>rländische Konstrukteure <strong>de</strong>n ersten künstlichen Hafen Deutschlands.<br />
Reichsunmittelbarkeit<br />
Während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges, konnte Bremen die Anerkennung seiner Reichsunmittelbarkeit durch das Linzer Diplom erreichen, das von Kaiser Ferdinand III. ausgestellt wur<strong>de</strong>.<br />
Diese Reichsunmittelbarkeit blieb <strong>de</strong>nnoch bedroht. So musste Bremen durch Konzessionen 1741 im 2. Sta<strong>de</strong>r Vergleich mit <strong>de</strong>m Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg eine Einigung<br />
über die Herrschaftsansprüche und das Kontributionsrecht erreichen.<br />
1783 begannen Bremer Kaufleute einen direkten Transatlantikhan<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n USA. 1802 beauftragte die Stadt <strong>de</strong>n Landschaftsgärtner Isaak Altmann, die frühere Stadtbefestigung in die<br />
heutigen Wallanlagen um<strong>zu</strong>gestalten.<br />
Französische Beset<strong>zu</strong>ng, En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Torsperre, Erwerb Bremerhavens<br />
1811 ließ Napoleon Bremen besetzen und integrierte es als Hauptstadt <strong>de</strong>s Départements <strong>de</strong>s Bouches du Weser in <strong>de</strong>n französischen Staat. Nach ihrer Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>n<br />
Befreiungskriegen verließen die französischen Truppen 1814 Bremen.
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatte Bremen wesentlichen Anteil an <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Überseehan<strong>de</strong>ls. Auf <strong>de</strong>r Werft von Johann Lange wur<strong>de</strong> 1817 das erste von Deutschen gebaute<br />
Dampfschiff gebaut. Der Raddampfer Die Weser verkehrte als Passagier- und Postschiff zwischen Bremen, Vegesack, Elsfleth und Brake, später auch Geestemün<strong>de</strong> bis 1833. Wegen <strong>de</strong>r<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n Versandung <strong>de</strong>r Weser wur<strong>de</strong> 1827 die Siedlung Bremerhaven als Außenposten auf einem vom Königreich Hannover angekauften Grund angelegt. Den Vertrag <strong>zu</strong>m Erwerb<br />
<strong>de</strong>s Hafengelän<strong>de</strong>s unterzeichneten am 11. Januar 1827 für Hannover Friedrich von Bremer und <strong>de</strong>r Bremer Bürgermeister Johann Smidt.[7]<br />
Die Aufhebung <strong>de</strong>r Torsperre 1848 schaffte Raum für die industrielle Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt. Seit 1847 erhielt sie Anschluss an die Königlich Hannoversche Staatsbahn. 1853 begann –<br />
nach großzügiger Ein<strong>de</strong>ichung <strong>de</strong>s umliegen<strong>de</strong>n Marschlan<strong>de</strong>s – die bis ins 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt für Bremen typische Reihenhausbebauung <strong>de</strong>r Vorstädte mit sogenannten Bremer Häusern.<br />
Industrialisierung<br />
Lag die Einwohnerzahl 1812 noch bei rund 35.000, so überschritt diese 1875 die Grenze von 100.000, wodurch Bremen <strong>zu</strong> einer Großstadt wur<strong>de</strong>. 1911 hatte die Stadt bereits 250.000<br />
Einwohner. 1857 erfolgte die Gründung <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Lloyds, später auch an<strong>de</strong>rer Schifffahrtgesellschaften. 1867 wur<strong>de</strong> Bremen Gliedstaat <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s und 1871<br />
Bun<strong>de</strong>sstaat im Deutschen Kaiserreich. Auf Grund <strong>de</strong>r Seehäfen blieben die Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck auch nach 1870/71 <strong>zu</strong>nächst noch Zollausland. Sie traten erst<br />
1888 <strong>de</strong>m Deutschen Zollverein bei. Die Freihäfen von Bremen und Hamburg blieben aber danach außerhalb <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Zollgebiets. 1886 bis 1895 wur<strong>de</strong> durch eine großzügige<br />
Korrektur <strong>de</strong>r Fahrrinne die Schiffbarkeit <strong>de</strong>r Weser für Seeschiffe bis Bremen gesichert. Die Stadt entwickelte sich <strong>zu</strong>m Umschlagplatz für vielerlei Waren. 1890 fand auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Bürgerparks die Nordwest<strong>de</strong>utsche Gewerbe- und Industrieausstellung statt. Die wirtschaftliche Entwicklung Bremens schritt in <strong>de</strong>r Weimarer Republik fort. Auf <strong>de</strong>m Flughafen<br />
begannen 1920 Linienflüge. 1928 wur<strong>de</strong> die Columbuskaje in Bremerhaven eingeweiht. Von hier ausgehend gewann das Passagierschiff Bremen <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Lloyd das Blaue<br />
Band für die schnellste Atlantiküberquerung. Mit <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utung wuchs auch die Einwohnerzahl beträchtlich.<br />
1939 verlor Bremen die Stadt Bremerhaven, das mit <strong>de</strong>m preußisch-hannoverschen Wesermün<strong>de</strong> vereinigt wur<strong>de</strong>.[8] Das stadtbremische Gebiet wur<strong>de</strong> dafür um Bremen-Nord (dort<br />
gehörte nur Vegesack schon vorher <strong>zu</strong> Bremen), Hemelingen, Arbergen und Mahndorf vergrößert.<br />
Diktatur und Zweiter Weltkrieg<br />
Im Zweiten Weltkrieg erlitten Bremen und Wesermün<strong>de</strong> (Bremerhaven) schwere Zerstörungen. Insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Bremer Westen mit seiner Werftindustrie und <strong>de</strong>m Flugzeugbau war<br />
häufig Ziel alliierter Luftangriffe. Insgesamt wur<strong>de</strong>n bei 173 Luftangriffen auf die Stadt 62 % <strong>de</strong>r städtebaulichen Substanz zerstört, rund 4.000 Einwohner kamen ums Leben.<br />
Die jüdische Gemein<strong>de</strong> zählte Anfang 1933 1.438 Mitglie<strong>de</strong>r.[9] Im Pogrom von 1938 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r jüdische Friedhof verwüstet, Geschäfte und Privathäuser wur<strong>de</strong>n geplün<strong>de</strong>rt und bei<strong>de</strong><br />
Synagogen wur<strong>de</strong>n von SA-Männern zerstört. Fünf Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n ermor<strong>de</strong>t, hun<strong>de</strong>rte verhaftet. Bis 1941 gelang es etwa 930 Bremer Ju<strong>de</strong>n Deutschland <strong>zu</strong> verlassen. Im Herbst 1941<br />
wur<strong>de</strong>n 50 Kin<strong>de</strong>r während eines „Schulausflugs“ in ein Konzentrationslager verschleppt. Am 18. November 1941 wur<strong>de</strong>n 440 Ju<strong>de</strong>n [10] ins Ghetto Minsk <strong>de</strong>portiert und am 28. o<strong>de</strong>r<br />
29. Juli 1942 wur<strong>de</strong>n 434 von ihnen ermor<strong>de</strong>t.[11].<br />
Schon 1933 wur<strong>de</strong> das erste Arbeitslager Mißler errichtet, in <strong>de</strong>m <strong>zu</strong>nächst 170 Häftlinge interniert wur<strong>de</strong>n, meist Kommunisten und Sozial<strong>de</strong>mokraten. Spätere Lager waren für<br />
Zwangsarbeiter vorgesehen, wie etwa das Lager Farge, für <strong>de</strong>ssen Bau ab Oktober 1943 13.000 polnische, französische und sowjetische Gefangene eingesetzt wur<strong>de</strong>n. Hin<strong>zu</strong> kamen<br />
Konzentrationslager im Umkreis von Bremen, wie das KZ Bahrsplate.<br />
1945 besetzten US-amerikanische Streitkräfte die Stadt. Bremen mit Bremerhaven wur<strong>de</strong> amerikanische Exklave im Küstengebiet <strong>de</strong>r britischen Besat<strong>zu</strong>ngszone. Von 1945 bis 1965 war<br />
Wilhelm Kaisen Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats. 1947 gaben sich die Bremer Bürger die Verfassung <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen. 1949 wur<strong>de</strong> Bremen ein Land <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland.<br />
Bun<strong>de</strong>sland, Verluste historischer Bausubstanz<br />
Die Vergangenheit konnte sich im Baubestand durch Restaurierung o<strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufbau nur bedingt gegenüber <strong>de</strong>m mo<strong>de</strong>rnen Städtebau behaupten. Vor allem um <strong>de</strong>n Marktplatz sind<br />
repräsentative alte Gebäu<strong>de</strong> erhalten geblieben o<strong>de</strong>r restauriert wor<strong>de</strong>n. Den Eindruck eines mittelalterlichen Altstadtquartiers vermittelt nur noch <strong>de</strong>r Schnoor, das einstige Fischerviertel.<br />
2004 wur<strong>de</strong>n das Rathaus und das Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r steinerne Bremer Roland, <strong>zu</strong>m UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Bevölkerungswachstums<br />
1969 erreichte die Einwohnerzahl mit 607.184 ihren historischen Höchststand. Bis En<strong>de</strong> 1986 ging die Zahl <strong>de</strong>r Erstwohnsitze auf 521.976 <strong>zu</strong>rück. Im Zuge <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung wuchs<br />
die Bevölkerung schnell auf 554.377 im Dezember 1992. Bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts sank die Zahl <strong>de</strong>r Erstwohnsitze wie<strong>de</strong>r auf 540.330. Am 1. Januar 2010 waren 547.685 Einwohner<br />
gemel<strong>de</strong>t<br />
Politik<br />
Die Volksvertretung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Bremen ist die Bremer Bürgerschaft, welche von <strong>de</strong>n Bürgern auf vier Jahre gewählt wird. Die Wahl erfolgt dabei nach <strong>de</strong>m Verhältniswahlrecht in zwei<br />
getrennten Wahlbereichen, wobei 68 Abgeordnete in Bremen und 15 Abgeordnete in Bremerhaven gewählt wer<strong>de</strong>n. Die im Wahlbereich Bremen gewählten Abgeordneten bil<strong>de</strong>n<br />
gleichzeitig das Kommunalwahlparlament <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen, die Stadtbürgerschaft[12], während die Stadtgemein<strong>de</strong> Bremerhaven ein separates Kommunalparlament wählt.<br />
An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Stadt und Lan<strong>de</strong>sverwaltung steht die Bremer Lan<strong>de</strong>sregierung, <strong>de</strong>r Senat. Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats und Bürgermeister ist seit <strong>de</strong>m 8. November 2005 Jens Böhrnsen (SPD).<br />
Auch <strong>de</strong>r Stellvertreter <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats wird als Bürgermeister bezeichnet. Dem Bremer Senat als Lan<strong>de</strong>sregierung gehören gegenwärtig sieben Mitglie<strong>de</strong>r (5 SPD, 2 Bündnis<br />
90/Die Grünen) an.<br />
Die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Senats (Senatoren) sind sowohl <strong>de</strong>n Ministern <strong>de</strong>r Flächenlän<strong>de</strong>r wie auch <strong>de</strong>n Dezernenten an<strong>de</strong>rer Großstädte vergleichbar. Sie leiten für das Land ihre<br />
Lan<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n und für die Stadt Bremen die ihrem Fachbereich <strong>zu</strong>gehörigen kommunalen Behör<strong>de</strong>n.<br />
Wappen<br />
Das Wappen <strong>de</strong>r Hansestadt Bremen zeigt auf rotem Grund einen schräg nach rechts aufgerichteten, mit <strong>de</strong>m Bart nach links gewandten silbernen Schlüssel gotischer Form („Bremer<br />
Schlüssel“). Auf <strong>de</strong>m Schild ruht eine gol<strong>de</strong>ne Krone, welche über <strong>de</strong>m mit E<strong>de</strong>lsteinen geschmückten Reif fünf Zinken in Blattform zeigt („Mittleres Wappen“). Beim Kleinen Wappen<br />
wird lediglich <strong>de</strong>r Schlüssel ohne Krone abgebil<strong>de</strong>t. Das große Wappen hingegen hat darüber hinaus noch eine Konsole beziehungsweise ein bandartiges Fußgestell, auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Schild<br />
ruht. Der Schild wird von zwei aufgerichteten rückwärts schauen<strong>de</strong>n Löwen mit <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rpranken gehalten.<br />
Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Wappens<br />
Der Schlüssel ist das Attribut <strong>de</strong>s Apostels Petrus, <strong>de</strong>s Schutzpatrons <strong>de</strong>s Bremer Doms. Er taucht als Wappensymbol bereits 1366 im Stadtsiegel Bremens auf. Im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte<br />
verän<strong>de</strong>rte sich die Form <strong>de</strong>s Schlüssels mehrmals. Auch zeigte das Stadtwappen teilweise <strong>de</strong>n Heiligen Petrus mit <strong>de</strong>m Schlüssel. Die Formen außerhalb <strong>de</strong>s Wappenschil<strong>de</strong>s verän<strong>de</strong>rten<br />
sich ebenfalls mehrmals. So erscheinen etwa die Löwen erstmals 1618 auf <strong>de</strong>m großen Wappen. In seiner heutigen Form geht das Wappen auf die Wappenordnung von 1891 <strong>zu</strong>rück.<br />
Im Bremer Volksmund wird eine Verbindung <strong>zu</strong>m Wappen <strong>de</strong>r Stadt Hamburg hergestellt, in<strong>de</strong>m spöttisch gesagt wird: „Hamburg ist das Tor <strong>zu</strong>r Welt, aber Bremen hat <strong>de</strong>n Schlüssel<br />
da<strong>zu</strong>.“<br />
Flagge<br />
Die Bremer Flagge ist min<strong>de</strong>stens achtmal rot und weiß gestreift und am Flaggenstock gewürfelt. Sie wird umgangssprachlich auch als Speckflagge bezeichnet.<br />
Die Staatsflagge enthält in <strong>de</strong>r Mitte das Flaggenwappen mit Schlüssel und drei Löwen. Die Dienstflagge führt nur das Schlüsselwappen. Die Flagge Bremens trägt die Farben <strong>de</strong>r Hanse,<br />
Rot und Weiß. Siehe auch da<strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Hauptartikel Hanseflagge.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Bremen unterhält aktive Städtepartnerschaften mit:[13]
• Danzig, Polen, ist seit 1976 die älteste Partnerschaft<br />
• Riga, damals Sowjetunion, heute Lettland, 1985<br />
• Dalian, Volksrepublik China, 1985<br />
• Rostock, (damals DDR), 1987<br />
• Haifa, Israel, 1988<br />
• İzmir, Türkei, 1995.<br />
Derzeit ruhen<strong>de</strong> Partnerschaften bestehen <strong>zu</strong>:<br />
• Bratislava, damals Tschechoslowakei, heute Hauptstadt <strong>de</strong>r Slowakei, 1989<br />
• Corinto, Nicaragua, 1989.<br />
Informelle Beziehungen pflegt Bremen <strong>zu</strong>:<br />
• Windhoek, Namibia, 2001<br />
• Durban, Südafrika, 2003<br />
• Dudley, Großbritannien<br />
• Pune, Indien<br />
• Tamra, eine rein arabische Nachbargemein<strong>de</strong> Haifas in Israel.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Wirtschaft<br />
Die Han<strong>de</strong>lskammer Bremen vertritt die Interessen <strong>de</strong>r Bremer Kaufmannschaft. Sie hat ihren Sitz im Schütting.<br />
Beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung hatte für Bremen immer schon <strong>de</strong>r Außenhan<strong>de</strong>l. Auch wenn <strong>de</strong>r Schwerpunkt <strong>de</strong>s Warenumschlags in <strong>de</strong>r Hafengruppe Bremen/Bremerhaven inzwischen in<br />
Bremerhaven liegt, hat Bremen daran durch das stadtbremische Überseehafengebiet Bremerhaven noch Anteil. Die Palette <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Han<strong>de</strong>lsgüter, die hier im- und exportiert<br />
wer<strong>de</strong>n, erstreckt sich von Fisch-, Fleisch- und Molkereiprodukten über traditionelle Rohstoffe wie die an <strong>de</strong>r Bremer Baumwollbörse gehan<strong>de</strong>lte Baumwolle, Tee, Reis und Tabak bis hin<br />
<strong>zu</strong> Wein und Zitrusfrüchten. Während <strong>de</strong>r Hafenumschlag von <strong>de</strong>r halbstaatlichen BLG Logistics Group vorgenommen wird, sind in <strong>de</strong>n Kontoren Großhändler wie C. Melchers, Otto<br />
Stadtlan<strong>de</strong>r und Atlanta <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Bremen ist ein wichtiger Standort <strong>de</strong>r Automobil-, Schiffbau-, Stahl-, Elektronik- und Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen Daimler AG ist <strong>de</strong>r<br />
größte private Arbeitgeber <strong>de</strong>r Stadt und fertigt in seinem Merce<strong>de</strong>s-Benz-Werk in Bremen, das bis 1963 <strong>de</strong>r Borgward GmbH gehörte, unter an<strong>de</strong>rem die Automo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>r C-Klasse, das<br />
T-Mo<strong>de</strong>ll und <strong>de</strong>n Roadster SL. Darüber hinaus haben sich zahlreiche Zulieferunternehmen in unmittelbarer Nähe angesie<strong>de</strong>lt. Das größte von ihnen ist die Hella Fahrzeugkomponenten<br />
GmbH aus <strong>de</strong>r Hella-Gruppe.<br />
Schiffbau- und Stahlindustrie haben in <strong>de</strong>n vergangenen Jahrzehnten einen Strukturwan<strong>de</strong>l durchgemacht. Viele Unternehmen, darunter die bei<strong>de</strong>n großen Werften AG Weser und Bremer<br />
Vulkan, haben ihn nicht überlebt; die Stahlwerke Bremen wur<strong>de</strong>n von Arcelor (seit 2006: ArcelorMittal) übernommen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie hingegen hat sich mit gewan<strong>de</strong>lt<br />
und prägt heute Bremen als Dienstleistungs- und High-Tech-Standort. So entwickelte sich an <strong>de</strong>r Universität in <strong>de</strong>n letzten Jahren einer <strong>de</strong>r größten <strong>de</strong>utschen Technologieparks, in <strong>de</strong>m<br />
aktuell rund 6.000 überwiegend hochqualifizierte Menschen Beschäftigung fin<strong>de</strong>n. Bremen ist international bekannt als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Luftfahrt- und Weltraumtechnologiestandort. Die<br />
Endmontage <strong>de</strong>r Airbusflügel fin<strong>de</strong>t in Bremen statt, bei Unternehmen <strong>de</strong>r EADS- und OHB-Technology-Gruppen entstehen Module und Bauteile für weltraumtaugliche Laboratorien,<br />
Trägerraketen und Satellitensysteme. Rheinmetall und Atlas Elektronik entwickeln in Bremen Elektronik für militärische und zivile Anwendungen. Außer<strong>de</strong>m befin<strong>de</strong>n sich in<br />
Sebaldsbrück ein Merce<strong>de</strong>s-Werk und ein großes Bahnwerk <strong>de</strong>r Deutschen Bahn.<br />
Bremen hat eine führen<strong>de</strong> Position in <strong>de</strong>r Lebensmittelbranche. Neben <strong>de</strong>r bekannten Brauerei Beck & Co. haben hier Kellogg’s und Kraft Foods inkl. Milka eine Nie<strong>de</strong>rlassung,
Vitakraft, Nordmilch und <strong>de</strong>r Schokola<strong>de</strong>nhersteller Hachez ihren Hauptsitz.<br />
Gewerbe- und Industriegebiete<br />
Die größten Gewerbe- und Industriegebiete sind:<br />
• Der ganze Stadtteil Häfen beidseitig an <strong>de</strong>r Weser gelegen mit<br />
• <strong>de</strong>m Bremer Industrie-Park im Ortsteil Industriehäfen mit ca. 140 ha Fläche.<br />
• Die Innenstadt als Einkaufs-, Han<strong>de</strong>ls-, Banken-, Verwaltungs- und Medienzentrum mit um die 1.300 ha Fläche.<br />
• Das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) in <strong>de</strong>r Neustadt mit ca. 472 ha Fläche.<br />
• Der Überseestadt im Stadtteil Walle mit ca. 290 ha Fläche.<br />
• Die Gewerbegebiete in <strong>de</strong>r Neustadt an <strong>de</strong>r Neuenlan<strong>de</strong>r Straße - Ol<strong>de</strong>nburger Straße (B 75) mit über 210 ha Fläche, mit <strong>de</strong>r Airport-Stadt am Flughafen Bremen, mit Airbus<br />
Bremen (3.000 Beschäftigte) und Astrium Bremen, mit <strong>de</strong>m Gewerbegebiet Ochtum, mit <strong>de</strong>r Nordmilch-Zentrale und mit <strong>de</strong>r Bremer Straßenbahn.<br />
• Der Technologiepark Bremen um die Universität Bremen mit ca. 172 ha Fläche.<br />
• Der Gewerbepark Hansalinie in Hemelingen mit ca. 155 ha Fläche.<br />
• Das Gewerbegebiet Merce<strong>de</strong>s-Benz-Werke Bremen in Sebaldsbrück mit ca. 70 ha Fläche.<br />
• Das Industrie- und Gewerbegebiet Bremer Vulkan in Vegesack mit ca. 50 ha Fläche.<br />
• Das Gewerbegebiet Bayernstraße in Findorff mit ca. 60 ha Flächen.<br />
• Das Gewerbegebiet Bremer-Kreuz in Osterholz mit ca. 50 ha Fläche.<br />
• Das Gewerbegebiet Alte Neustadt direkt an <strong>de</strong>r Weser mit ca. 40 ha Fläche, mit u. a. <strong>de</strong>r Brauerei Beck & Co. und Kraft Foods.<br />
• Der Weserpark in Osterholz mit ca. 25 ha Fläche, mit <strong>de</strong>m Einkaufszentrum <strong>de</strong>r Metro Group.<br />
• Das Gewerbegebiet Farge-Ost in Farge mit ca. 22 ha Fläche.<br />
Verkehr<br />
Schifffahrt<br />
Die Schifffahrt hatte in Bremen über Jahrhun<strong>de</strong>rte hinweg eine prägen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung. Trotz <strong>de</strong>s Strukturwan<strong>de</strong>ls stellt sie auch heute noch einen wichtigen Wirtschafts- und<br />
Arbeitsmarktfaktor dar. Zu <strong>de</strong>n stadtbremischen Häfen zählen neben <strong>de</strong>m Neustädter Hafen, die durch die Nähe <strong>zu</strong>m Güterverkehrszentrum noch regelmäßig genutzt wer<strong>de</strong>n, auch die<br />
Han<strong>de</strong>lshäfen, <strong>de</strong>r Hohentorshafen, die Industriehäfen und die stadtbremischen Häfen in Bremerhaven. Für <strong>de</strong>n Binnenschiffsverkehr existieren noch, vom Stadtzentrum aus<br />
flussaufwärts, <strong>de</strong>r Werra-, <strong>de</strong>r Fulda- und <strong>de</strong>r Allerhafen. Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s verfüllten Überseehafens und auf <strong>de</strong>n Industriebrachen rundherum entsteht ein neues Viertel, die<br />
Überseestadt. Um auch bei immer größer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schiffen weiter am Seehan<strong>de</strong>l teilhaben <strong>zu</strong> können, beteiligt sich Bremen <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Land Nie<strong>de</strong>rsachsen am Projekt<br />
Ja<strong>de</strong>WeserPort in Wilhelmshaven, einem Hafen für größte Containerschiffe.<br />
Bremen-Nord ist über drei Autofähren mit <strong>de</strong>m Landkreis Wesermarsch in Nie<strong>de</strong>rsachsen auf <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren Weserufer verbun<strong>de</strong>n.<br />
Luftverkehr<br />
Im Sü<strong>de</strong>n Bremens befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r internationale Flughafen Bremen (BRE). Dieser Luftverkehrsstandort ist seit <strong>de</strong>m Jahre 1909 dort angesie<strong>de</strong>lt. Um das Terminalgebäu<strong>de</strong> entstand seit<br />
1995 ein Airport-Center mit zahlreichen Nie<strong>de</strong>rlassungen von teilweise internationalen Unternehmen. Ein neues Flughafen-Terminal wur<strong>de</strong> nach Plänen <strong>de</strong>s Architekten Gert Schulze<br />
2001 eingeweiht. Das Passagieraufkommen lag im Jahre 2006 bei 1,7 Millionen Fluggästen. Zugleich sank die Zahl <strong>de</strong>r Flüge 2006 mit 40.419 auf <strong>de</strong>n niedrigsten Wert seit 1988. Eine<br />
Steigerung wur<strong>de</strong> durch die Fluggesellschaft Ryanair erzielt, die von Bremen aus neue Ziele in Europa direkt anfliegt. Im Jahr 2008 wur<strong>de</strong>n 2,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Durch
Einsatz größerer Maschinen und bessere Kapazitätsplanung ist die Zahl <strong>de</strong>r Flüge trotz steigen<strong>de</strong>r Passagierzahlen seit 1965 nie über 60.000 im Jahr gestiegen. Es besteht nur ein<br />
beschränkter Nachtbetrieb, das letzte Flugzeug lan<strong>de</strong>t planmäßig um 23 Uhr. Die Stoßzeiten sind morgens und abends. Der Flughafen kann über die Bun<strong>de</strong>sautobahn 281 erreicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Vom Hauptbahnhof führt eine Straßenbahn <strong>de</strong>r Linie 6 direkt <strong>zu</strong>m Terminal. Am Bremer Flughafen befin<strong>de</strong>t sich außer<strong>de</strong>m die Pilotenausbildung <strong>de</strong>r Luft<strong>hansa</strong>.<br />
Eisenbahn<br />
Bremen ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Am Hauptbahnhof treffen die Hauptstrecken von Hamburg ins Ruhrgebiet, nach Bremerhaven, nach Hannover, nach Vegesack und nach Ol<strong>de</strong>nburg<br />
(–Leer) aufeinan<strong>de</strong>r. Bremen ist über die ICE-Linie Bremen–München sowie über die IC-Linien Hamburg–Köln / Rollbahn und Ol<strong>de</strong>nburg–Leipzig in das Fernverkehrsnetz <strong>de</strong>r DB<br />
eingebun<strong>de</strong>n.<br />
Der Rangierbahnhof im Stadtteil Gröpelingen wur<strong>de</strong> am 12. Juni 2005 als solcher stillgelegt, <strong>de</strong>r örtliche Güterverkehr Bremens wird in <strong>de</strong>ssen noch betriebenen Resten sowie an <strong>de</strong>n<br />
Hafenbahnhöfen und am Werksbahnhof <strong>de</strong>r Klöckner-Hütte (ArcelorMittal Bremen) abgefertigt. Der ehemalige nordwestlich <strong>de</strong>s Hauptbahnhofes gelegene Güterbahnhof ist abgebrochen<br />
wor<strong>de</strong>n. Durch <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>s Container-Terminals in Bremerhaven ist jedoch wie<strong>de</strong>r eine Zunahme <strong>de</strong>s Güterverkehrs <strong>zu</strong> verzeichnen.<br />
Im Regionalverkehr besteht ein S-Bahn-ähnlicher Vorortverkehr bis Bremerhaven, Vegesack und Farge, Rotenburg (Wümme), Twistringen, Ol<strong>de</strong>nburg, Nor<strong>de</strong>nham und Ver<strong>de</strong>n. Die<br />
Einrichtung einer S-Bahn ist geplant. Ferner bestehen schnelle RegionalExpress-Verbindungen nach Bremerhaven, Hannover, Hamburg, Osnabrück und Ol<strong>de</strong>nburg–Nord<strong>de</strong>ich Mole und<br />
eine RegionalBahn-Verbindung durch die Lüneburger Hei<strong>de</strong> nach Uelzen (über Langwe<strong>de</strong>l, Visselhöve<strong>de</strong> und Soltau).<br />
Der 1958 stark reduzierte und 1961 eingestellte Personenverkehr auf <strong>de</strong>r 10 km langen Strecke <strong>de</strong>r Farge-Vegesacker Eisenbahn in Bremen-Nord wur<strong>de</strong> im Dezember 2007 wie<strong>de</strong>r<br />
aufgenommen. Hier verkehren Dieseltriebwagen <strong>de</strong>r Betreiberin NordWestBahn im Halbstun<strong>de</strong>ntakt. Nach ihrer Elektrifizierung wer<strong>de</strong>n auf dieser Strecke durchgehen<strong>de</strong> S-Bahnen von<br />
Bremen-Farge nach Ver<strong>de</strong>n verkehren. Gegenwärtig sind insgesamt 19 Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für <strong>de</strong>n Personenverkehr in Betrieb. Die Trassen <strong>de</strong>r Haupteisenbahnstrecken in<br />
Bremen haben nach Angaben <strong>de</strong>s Eisenbahnbun<strong>de</strong>samtes eine Gesamtlänge von 24 km.[14]<br />
Straße<br />
Auch an das Fernstraßennetz ist Bremen gut angebun<strong>de</strong>n.<br />
Insgesamt beträgt die Länge <strong>de</strong>r Autobahnen auf <strong>de</strong>m Gebiet von Bremen (Stadt) ca. 50 bis 60 km.<br />
Das südliche Stadtgebiet Bremens wird von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sautobahn 1 Ruhrgebiet - Hamburg berührt. Im Südosten <strong>de</strong>r Stadt, am Bremer Kreuz, wird die A 1 von <strong>de</strong>r A 27 Hannover<br />
(Walsro<strong>de</strong>) – Bremerhaven bzw. Cuxhaven gekreuzt. Diese Autobahn führt durch das östliche Stadtgebiet von Südosten nach Nordwesten. Im Nor<strong>de</strong>n zweigt die A 270 von <strong>de</strong>r A 27 in<br />
Ihlpohl ab und führt auf einer Länge von 10 km bis nach Bremen-Farge. In Gröpelingen ist <strong>de</strong>r erste Teil <strong>de</strong>r A 281 vom Dreieck Bremen-Industriehäfen bis Bremen-Burg-Grambke<br />
fertiggestellt. Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Weserseite wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Abschnitt vom Güterverkehrszentrum bzw. Neustädter Hafen bis <strong>zu</strong>m Flughafen bzw. bis <strong>zu</strong>r Airport-Stadt im Januar 2008 <strong>de</strong>m<br />
Verkehr übergeben. Wahrzeichen <strong>de</strong>r neuen Autobahnverbindung ist eine Schrägseilbrücke mit 50 m hohen Pylonen in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Flughafens. Bis 2013 sollen die bei<strong>de</strong>n Teilstücke mit<br />
einem unter <strong>de</strong>r Weser entlang führen<strong>de</strong>n Tunnel verbun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, außer<strong>de</strong>m ist die Verlängerung bis <strong>zu</strong>r A 1 vorgesehen. Damit wäre <strong>de</strong>r Autobahnring um Bremen geschlossen, <strong>de</strong>r<br />
die innerörtlichen Straßen von Durchgangsverkehr entlasten soll. Im Westen führt die A 28 nach Ol<strong>de</strong>nburg, außer<strong>de</strong>m bin<strong>de</strong>t sie <strong>de</strong>n Stadtteil Huchting an die A 1 an.<br />
Die A 1 ist auf gesamter Länge sechsspurig ausgebaut und soll im weiteren Bedarf achtspurig ausgebaut wer<strong>de</strong>n. Die A 27 ist zwischen Bremen-Überseestadt (B 6) und Bremen-Nord (A<br />
270) ebenfalls sechsspurig ausgebaut. Der Abschnitt zwischen Bremen-Überseestadt und <strong>de</strong>m Bremer Kreuz ist vierspurig und soll im weiteren Bedarf sechsspurig ausgebaut wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Bun<strong>de</strong>sautobahnen 270 und 281 sind durchgehend vierspurig. Auf <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sautobahnen 270 und 281 gilt - in erster Linie aus Lärmschutzgrün<strong>de</strong>n - durchgehend ein Tempolimit von 80<br />
km/h. Auf <strong>de</strong>r A 1 wird <strong>de</strong>r Verkehr durch eine automatische Verkehrsbeeinflussungsanlage gesteuert. Je nach Verkehrsbelastung beträgt die <strong>zu</strong>gelassene Höchstgeschwindigkeit 60, 80,<br />
100 o<strong>de</strong>r 120 km/h (auf <strong>de</strong>r Weserbrücke max. 100 km/h aufgrund <strong>de</strong>r provisorischen Achtstreifigkeit und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Einengung <strong>de</strong>r einzelnen Fahrstreifen). Schneller als<br />
120 km/h bzw. keine Begren<strong>zu</strong>ng wer<strong>de</strong>n nie angezeigt, auch nachts nicht, da Bremen als erstes Bun<strong>de</strong>sland eine allgemeine maximale Tempobegren<strong>zu</strong>ng von 120 km/h eingeführt hat.<br />
Entsprechend gilt auf <strong>de</strong>r A 27 in Bremen durchgängig ein Tempolimit von 120 km/h.
Außer<strong>de</strong>m führen die Bun<strong>de</strong>sstraßen 6 (in Nord-Süd-Richtung), B 74 und B 75 (in West-Ost-Richtung) durch Bremen. Die B 6/B 75 war zwischen <strong>de</strong>r A 27 und A 28 einst als A 282<br />
geplant. Ein Ausbau dieses Abschnitts <strong>zu</strong>r vollwertigen Autobahn ist <strong>de</strong>rzeit aber eher unwahrscheinlich. Gleichwohl kann Bremen seit <strong>de</strong>r Fertigstellung <strong>de</strong>r Autobahndreiecke Stuhr und<br />
Delmenhorst auf Autobahnen und Schnellstraßen kreu<strong>zu</strong>ngsfrei umrun<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r Vollendung <strong>de</strong>r A 281 wird es auch einen geschlossenen Autobahnring um Bremen geben. Im<br />
Zuge <strong>de</strong>r Fertigstellung <strong>de</strong>r A 281 erhält auch die B 212 eine neue Streckenführung: Sie wird künftig im Westen Bremens an <strong>de</strong>r A 281 en<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Landkreis Wesermarsch besser mit<br />
Bremen verbin<strong>de</strong>n.<br />
Der Plan aus <strong>de</strong>n 1970er Jahren, die A 5 von nördlich Gießen (bzw. Frankfurt am Main) über Bremen Richtung Nor<strong>de</strong>nham <strong>zu</strong> verlängern, wur<strong>de</strong> endgültig aufgegeben. Die A 5 sollte die<br />
B 75 zwischen Huchting und Grolland kreuzen.<br />
Die Hauptverbindungsstraßen <strong>de</strong>r Stadtteile für <strong>de</strong>n Autoverkehr sind die im Jahre 1914 durch Beschluss <strong>de</strong>r Bürgerschaft in Heerstraßen umbenannten Chausseen.<br />
Die Deutsche Märchenstraße ist eine Ferienstraße, die von Hanau nach Bremen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Bremer Stadtmusikanten führt.<br />
ÖPNV<br />
Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) innerhalb <strong>de</strong>s Stadtgebiets bedienen acht Straßenbahn- und 44 Buslinien <strong>de</strong>r Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Die meisten Ortsteile<br />
Bremens und einzelne nie<strong>de</strong>rsächsische Vororte sind mit einem dichten Takt an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Für <strong>de</strong>n Verkehr zwischen Bremen-Stadt und Bremen-Nord hat die<br />
Eisenbahn hohe Be<strong>de</strong>utung. Es gibt Bestrebungen, Straßenbahnlinien bis in das Umland <strong>zu</strong> verlängern und auf <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong>n Eisenbahnstrecken <strong>de</strong>n Takt <strong>zu</strong> verdichten, um die Vororte<br />
besser an<strong>zu</strong>bin<strong>de</strong>n.<br />
Der Regionalverkehr wird durch Buslinien an<strong>de</strong>rer Verkehrsbetriebe beziehungsweise Unternehmen betrieben. Sowohl Stadt- als auch Regionalverkehrsunternehmen haben sich im<br />
Verkehrsverbund Bremen/Nie<strong>de</strong>rsachsen (VBN) <strong>zu</strong>sammengeschlossen.<br />
Ab Dezember 2010 wird die Nordwestbahn (NWB) im Auftrag <strong>de</strong>s Verkehrsverbund Bremen/Nie<strong>de</strong>rsachsen (VBN) die ersten drei Regio-S-Bahn Bremen-Linien in <strong>de</strong>r Metropolregion<br />
Bremen/Ol<strong>de</strong>nburg in Betrieb nehmen (RS 2 - Bremerhaven-Lehe, Bremerhaven-Hbf, Bremen-Hbf, Twistringen; RS 3 - Bad Zwischenahn, Ol<strong>de</strong>nburg-Hbf, Hu<strong>de</strong>, Delmenhorst, Bremen-<br />
Hbf; RS 4 - Nor<strong>de</strong>nham, Hu<strong>de</strong>, Delmenhorst, Bremen-Hbf). Ab Dezember 2011 wird dann auch die letzte Regio-S-Bahn-Linie in Betrieb gehen (RS 1 - Bremen-Farge, Bremen-Vegesack,<br />
Bremen-Hbf, Ver<strong>de</strong>n/Aller).<br />
Fahrrad<br />
Bremen wird durch die Radfernwege Radfernweg Hamburg-Bremen, Bremen–Osnabrück (Brückenradweg) und Wümme-Radweg erreicht. Zu<strong>de</strong>m ist die Stadt eine wichtige Station auf<br />
<strong>de</strong>m Weserradweg, <strong>de</strong>r die Weser von ihrem Entstehungsort bis nach Bremerhaven begleitet und ein beliebtes Urlaubsprogramm darstellt.<br />
Unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Städten mit über 500.000 Einwohnern hat Bremen mit über 22 % <strong>de</strong>r Wege <strong>de</strong>n größten Radverkehrsanteil, weswegen Bremen als Fahrradstadt gilt. Der<br />
Radfahrtradition entsprechend hat es auch die meisten Radwegkilometer pro Einwohner unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Großstädten, viele davon jedoch schlecht unterhalten o<strong>de</strong>r in Straßen mit<br />
geringem Autoverkehr, so in Tempo-30-Zonen, wo Verkehrswissenschaftler heute Radwege ablehnen.[15]<br />
Medien<br />
Bremen ist Sitz von Radio Bremen, <strong>de</strong>r kleinsten Rundfunkanstalt <strong>de</strong>r ARD. Radio Bremen produziert diverse Fernsehsendungen im „Radio Bremen TV“ und betreibt vier Hörfunkwellen<br />
– eine davon gemeinsam mit <strong>de</strong>m NDR (Nordwestradio), eine weitere mit <strong>de</strong>m WDR und <strong>de</strong>m RBB (Funkhaus Europa). Als privates Pendant ist Energy Bremen in <strong>de</strong>r Hansestadt mit<br />
einem Radioprogramm ansässig; <strong>zu</strong>sätzlich gibt es im Sen<strong>de</strong>gebiet die Radiosen<strong>de</strong>r Radio ffn und Hit-Radio Antenne Bremen. Außer<strong>de</strong>m unterhalten die privaten Fernsehsen<strong>de</strong>r RTL und<br />
Sat1 Korrespon<strong>de</strong>ntenbüros in Bremen und produzieren von hier aus ein halbstündiges Regionalmagazin für Bremen und Nie<strong>de</strong>rsachsen. Beim Bürgerrundfunk Bremen können<br />
Bürgerinnen und Bürger aus Bremen kostenlos eigene Radio- und TV-Sendungen gestalten. Seit Anfang September 2007 gibt es in Bremen <strong>de</strong>n privaten Fernsehsen<strong>de</strong>r center.tv. Dieser<br />
produziert täglich zwei Stun<strong>de</strong>n aktuelle Live-Sendungen aus Bremen.
Als Tageszeitungen erscheinen <strong>de</strong>r Weser-Kurier und die fast i<strong>de</strong>ntischen Bremer Nachrichten, letztere ist, <strong>de</strong>m Titel nach, die drittälteste noch erscheinen<strong>de</strong> Tageszeitung Deutschlands.<br />
Montags und Donnerstags liegt <strong>de</strong>m Weser-Kurier und <strong>de</strong>r Bremer Nachrichten jeweils <strong>de</strong>r Stadtteil-Kurier (Sechs Ausgaben: Nordost, Südost, Mitte, Links <strong>de</strong>r Weser, West und<br />
Huchting) bei. In Bremen-Nord erscheint von Montag bis Sonnabend die Regionalausgabe Die Nord<strong>de</strong>utsche, die als eigenständige Tageszeitung seit 1885 unter <strong>de</strong>m Namen<br />
Nord<strong>de</strong>utsche Volkszeitung erscheint. Mit einer eigenständigen Ausgabe für <strong>de</strong>n Großraum Bremen erscheint außer<strong>de</strong>m die Bild. Die eigenständige Bremen-Ausgabe <strong>de</strong>r tageszeitung<br />
(taz) wur<strong>de</strong> aus finanziellen Grün<strong>de</strong>n eingestellt und in die taz nord eingeglie<strong>de</strong>rt; diese umfasst neben <strong>de</strong>r Mantelzeitung drei Seiten allgemeinen Regionalteil und eine Wechselseite<br />
jeweils für die Län<strong>de</strong>r Bremen und Hamburg.<br />
In Bremen erscheinen ferner drei Wochenblätter: <strong>de</strong>r Bremer Anzeiger als Anzeigenblatt von Weser-Kurier und Bremer Nachrichten, <strong>de</strong>r Weser-Report sowie in Bremen-Nord „Das<br />
BLV“. Mit „Bremer“, „Prinz Bremen“, „Bremen-Magazin“, <strong>de</strong>m Stadtmagazin „Mix“, „BIG Bremen“ und „Bremborium“ und <strong>de</strong>m Nordanschlag in Bremen-Nord erscheinen außer<strong>de</strong>m<br />
eine Reihe unabhängiger Stadtmagazine. Hin<strong>zu</strong> kommen die Kultur- und Gesellschaftszeitschriften „Foyer“ und „Brillant“ sowie zahlreiche kleinere Publikationen mit stark lokalem<br />
Charakter in einzelnen Stadtteilen.<br />
Ferner sind alle großen Nachrichtenagenturen und die meisten großen Tageszeitungen Nordwest<strong>de</strong>utschlands sowie zahlreiche Radiosen<strong>de</strong>r mit Korrespon<strong>de</strong>ntenbüros o<strong>de</strong>r<br />
Regionalredaktionen vertreten.<br />
Gesundheitswesen<br />
Die vier staatlichen Krankenhäuser sind durch <strong>de</strong>n Klinikverbund Gesundheit Nord gGmbH organisiert:<br />
• Klinikum Bremen-Mitte<br />
• Klinikum Bremen-Nord<br />
• Klinikum Bremen-Ost<br />
• Klinikum Links <strong>de</strong>r Weser<br />
Darüber hinaus bestehen weitere Krankenhäuser:<br />
• Diakonissen-Krankenhaus Gröpelingen (evangelisch)<br />
• St.-Joseph-Stift in Schwachhausen (katholisch)<br />
• Rotkreuzkrankenhaus in <strong>de</strong>r Neustadt<br />
Kleinere Spezialkliniken sind unter an<strong>de</strong>ren die Roland-Klinik, die Kurfürstenklinik und die Klinik Dr. Heines.<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Die meisten regional geglie<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>utschen Organisationen haben eine Nie<strong>de</strong>rlassung in Bremen. Bedingt durch die Be<strong>de</strong>utung für <strong>de</strong>n Außenhan<strong>de</strong>l sind in Bremen auch etwa 40<br />
Konsulate und Honorarkonsulate <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Eine ungewöhnliche Einrichtung ist die Arbeitnehmerkammer Bremen, welche die Interessen <strong>de</strong>r abhängig Beschäftigten wahrnehmen soll<br />
und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r es außer im Saarland in keinem an<strong>de</strong>ren Bun<strong>de</strong>sland eine Entsprechung gibt.<br />
Als bun<strong>de</strong>sweit tätige Organisationen mit Zentrale in Bremen sind die Deutsche Gesellschaft <strong>zu</strong>r Rettung Schiffbrüchiger und <strong>de</strong>r Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club <strong>zu</strong> nennen. Weitere<br />
öffentliche Einrichtungen sind:<br />
Körperschaften <strong>de</strong>s öffentlichen Rechts<br />
• Römisch-katholische Kirche in Bremen<br />
• Bremische Evangelische Kirche
• Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein<strong>de</strong>n im Lan<strong>de</strong> Bremen<br />
• Arbeitnehmerkammer Bremen<br />
• Kassenärztliche Vereinigung Bremen<br />
• Kassenzahnärztliche Vereinigung Bremen<br />
• Steuerberaterkammer Bremen<br />
• Tierärztekammer Bremen<br />
• Ärztekammer Bremen<br />
Anstalten <strong>de</strong>s öffentlichen Rechts<br />
• Radio Bremen (Radio Bremen TV, Bremen Eins, Bremen Vier, Nordwestradio)<br />
• Bremische Lan<strong>de</strong>smedienanstalt<br />
Gerichte<br />
• Staatsgerichtshof <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen<br />
• Hanseatisches Oberlan<strong>de</strong>sgericht Bremen<br />
• Oberverwaltungsgericht <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen<br />
• Lan<strong>de</strong>sarbeitsgericht Bremen<br />
• Lan<strong>de</strong>ssozialgericht Nie<strong>de</strong>rsachsen-Bremen (Zweigstelle)<br />
• Finanzgericht Bremen<br />
• Landgericht Bremen<br />
• Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven<br />
• Verwaltungsgericht <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen<br />
• Sozialgericht Bremen<br />
• Amtsgerichte Bremen und Bremen-Blumenthal<br />
Bildung, Wissenschaft und Forschung<br />
Universitäten und Hochschulen<br />
In Bremen gibt es die staatliche Universität Bremen, die staatliche Hochschule Bremen, eine staatliche Hochschule für Künste sowie die private Jacobs University Bremen. Darüber<br />
hinaus existieren zahlreiche außeruniversitäre Institutionen und Forschungseinrichtungen. Bremen wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>sammen mit Bremerhaven vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft<br />
<strong>zu</strong>r „Stadt <strong>de</strong>r Wissenschaft 2005“ (bei 36 <strong>de</strong>utschen Städten als Mitbewerber) gewählt.<br />
Universitäten<br />
• Die Universität Bremen ist mit ca. 20.000 Studieren<strong>de</strong>n und über 1.500 Wissenschaftlern die größte Hochschule <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Bremen. Zum Wintersemester 1971/72 nahm sie<br />
ihren Betrieb auf. Die Grundsteinlegung erfolgte am 11. November 1970. 1973 wur<strong>de</strong> die Pädagogische Hochschule integriert, daher lag <strong>de</strong>r Schwerpunkt <strong>de</strong>r Universität<br />
<strong>zu</strong>nächst in <strong>de</strong>r Lehrerausbildung. Heute gibt es beinahe alle Fachbereiche (außer Medizin und Theologie), sowie diverse Son<strong>de</strong>rforschungsbereiche. Zum Beispiel lässt <strong>de</strong>r<br />
Bremer Fallturm als europaweit größte <strong>de</strong>rartige Einrichtung Untersuchungen und Forschungen in simulierter Schwerelosigkeit <strong>zu</strong>. Ein Indikator für die Wertschät<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r
Forschungsleistungen ist <strong>de</strong>r hohe Anteil <strong>de</strong>r eingeworbenen Drittmittel. Die Qualität <strong>de</strong>r Universität Bremen zeigt das gute Abschnei<strong>de</strong>n dieser Alma Mater bei <strong>de</strong>r im Jahre<br />
2006 erstmals abgeschlossenen Exzellenzinitiative <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r. Hier wur<strong>de</strong> die Universität Bremen für ihre „Zukunftskonzepte <strong>zu</strong>r universitären<br />
Spitzenforschung“ als möglicherweise för<strong>de</strong>rungswürdig mit beson<strong>de</strong>ren Mitteln <strong>de</strong>r Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet – als einzige Hochschule<br />
Nord<strong>de</strong>utschlands. Die Universität Bremen hat drei Exzellenzeinrichtungen vor<strong>zu</strong>weisen, die durch die Exzellenzinitiative geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
• Die Jacobs University Bremen (bis 2007: International University Bremen) ist eine private Hochschule, gegrün<strong>de</strong>t 1999 nach US-amerikanischem Vorbild. Sie befin<strong>de</strong>t sich auf<br />
einem Gelän<strong>de</strong> einer ehemaligen Ausbildungskaserne <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>swehr in Vegesack, Ortsteil Grohn. Die Lehrsprache ist Englisch. Im November 2006 gab <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Schweiz<br />
leben<strong>de</strong> Bremer Kaufmann Klaus J. Jacobs bekannt, dass seine Stiftung <strong>de</strong>r Universität insgesamt bis <strong>zu</strong> 200 Millionen Euro <strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n wird; ein europaweit bisher einmaliger<br />
Geldbetrag. Infolge<strong>de</strong>ssen trägt die Hochschule seit Frühjahr 2007 <strong>de</strong>n Namen Jacobs University Bremen.<br />
Hochschulen<br />
• Die Hochschule Bremen entstand 1982 durch die Fusion von vier Hochschulen; Hochschule für Wirtschaft, Hochschule für Technik, Hochschule für Sozialwissenschaften und<br />
<strong>de</strong>r Hochschule für Nautik. Die älteste Vorläufer-Aka<strong>de</strong>mie wur<strong>de</strong> bereits 1799 gegrün<strong>de</strong>t. Die Drittmitteleinwerbung ist insbeson<strong>de</strong>re im technischen Fachbereich enorm, es ist<br />
die höchste aller technischen Fachbereiche in Deutschland. Internationalität ist ein weiteres Kennzeichen <strong>de</strong>r Hochschule Bremen. Mit über 250 Universitäten und Hochschulen<br />
gibt es weltweit Kooperationsabkommen, mit verschie<strong>de</strong>nsten sogar Doppeldiplom-Abkommen (je vier Semester Studium an <strong>de</strong>r Hochschule Bremen, vier an einer<br />
ausländischen Partnerhochschule). Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hochschule befin<strong>de</strong>t sich die Walter-Stein-Sternwarte und ein Studienzentrum <strong>de</strong>r Fachhochschule für Oekonomie &<br />
Management.<br />
• Die Hochschule für Künste Bremen ist eine staatliche Kunst- und Musikhochschule mit 70 Professoren und ca. 900 Stu<strong>de</strong>nten, darunter ca. 300 Stu<strong>de</strong>nten aus <strong>de</strong>m Ausland. Die<br />
älteste Vorläuferinstitution wur<strong>de</strong> 1873 gegrün<strong>de</strong>t. An <strong>de</strong>r HfK Bremen gibt es <strong>de</strong>n Fachbereich Kunst und Design, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>r Überseestadt befin<strong>de</strong>t, sowie <strong>de</strong>n Fachbereich<br />
Musik in <strong>de</strong>r Dechanatstraße in <strong>de</strong>r Altstadt. Damit ist sie außer <strong>de</strong>r UdK Berlin die einzige Hochschule in Deutschland, die Musik- und Kunsthochschule unter einem Dach<br />
vereint.<br />
Institute<br />
• Mit <strong>de</strong>m Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) und <strong>de</strong>m Fraunhofer-Institut für bildgestützte Medizin (MeVis) sind in Bremen<br />
gleich zwei von insgesamt 57 Forschungsinstituten <strong>de</strong>r Fraunhofer-Gesellschaft ansässig. Das IFAM betreibt Angewandte Forschung und Entwicklung auf <strong>de</strong>n Gebieten<br />
Formgebung und Funktionswerkstoffe sowie Klebtechnik und Oberflächen mit Schwerpunkten in <strong>de</strong>n Bereichen Pulvermetallurgie und Pulvertechnologie, Gießerei- und<br />
Schäumtechnologie, Industrielle Klebtechnik, Funktionsintegrieren<strong>de</strong> Bauweisen sowie Plasma- und Oberflächentechnologie. Das MeVis entwickelt workflow-orientierte<br />
Softwareassistenten für die effiziente Visualisierung und quantitative Analyse medizinischer Bilddaten. Dabei konzentriert man sich auf epi<strong>de</strong>miologisch be<strong>de</strong>utsame<br />
Erkrankungen <strong>de</strong>s Herz-Kreislaufsystems, <strong>de</strong>s Gehirns, <strong>de</strong>r Leber und Lunge sowie auf Krebserkrankungen.<br />
• Mit <strong>de</strong>m Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie (MPI-MM) ist die Max-Planck-Gesellschaft, die zweite große Forschungsgesellschaft in Deutschland, in Bremen<br />
vertreten. Das <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen<strong>de</strong> Institut führt Untersuchungen <strong>zu</strong>m Stoffkreislauf <strong>de</strong>r Elemente in <strong>de</strong>n Meeren und <strong>de</strong>n beteiligten Mikroorganismen durch.<br />
Mit <strong>de</strong>m Thema „System Er<strong>de</strong>“ gehört Bremen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n zehn <strong>de</strong>utschen Städten <strong>zu</strong>m Treffpunkt <strong>de</strong>r Wissenschaft im Wissenschaftsjahr 2009.<br />
Bibliotheken<br />
• Die Stadtbibliothek Bremen im Forum Am Wall ist als Eigenbetrieb <strong>de</strong>r Stadt Bremen eine kommunale, öffentliche Bibliothek mit einem Gesamtbestand von 514.000 Bän<strong>de</strong>n,<br />
mit rund 1,3 Mio Besuchern und rund 3,5 Mio Ausleihen. Sie ist eine <strong>de</strong>r größten kommunalen Bibliotheken in Nord<strong>de</strong>utschland. Zum Bibliotheksnetz gehören weiterhin sechs<br />
Stadtteilbibliotheken, neun Jugend- und Schulbibliotheken, die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, die Busbibliothek, die Bibliotheken in <strong>de</strong>r Justizvoll<strong>zu</strong>gsanstalt und die<br />
Bibliothek im Zentralkrankenhaus Ost.<br />
• Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB) auf <strong>de</strong>m Campus <strong>de</strong>r Universität ist die wissenschaftliche Bibliothek <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r Universität Bremen. Im Jahr
2007 haben rund 38.000 aktive Benutzer die Bibliothek aufgesucht und es gab 1.972.247 Entleihungen inkl. Verlängerungen, bei einem Bestand von 3.198.948 Bän<strong>de</strong>n (Bücher,<br />
Zeitungen), 240.132 Dissertationen, 6.438 Karten, 13.596 Raritäten, 184 Inkunabeln, 66.963 Noten, 96.680 AV-Materialien, 8.257 laufend bezogene gedruckte Zeitschriften und<br />
21.003 laufend bezogene elektronische Zeitschriften.<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Traditionell war Bremen in allen Bereichen <strong>de</strong>r Ver- und Entsorgung weitgehend autonom. Steigen<strong>de</strong> Anfor<strong>de</strong>rungen an die Versorgungsqualität haben diese Autonomie nach 1945<br />
<strong>zu</strong>nächst verbessert und nach 1995 erneut beschränkt.<br />
• Trinkwasserversorgung<br />
Die Entnahme von Trinkwasser aus <strong>de</strong>r Weser wur<strong>de</strong> mit <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>r allgemeiner Verschmut<strong>zu</strong>ng und wegen starker Einleitung von Abraumsalz (NaCl) in die Werra im Laufe <strong>de</strong>r 70er<br />
Jahre eingestellt. Heute kommt das Trinkwasser ausschließlich aus lokalen Tiefbrunnen (Blumenthal), aus Brunnen <strong>de</strong>r Harzwasserwerke (Ristedt) sowie über weitere Brunnen von<br />
Wasserversorgern im Nord<strong>de</strong>utschen Raum. Brauwasser für die berühmten lokalen Biere kommt mit eigener Leitung ausschließlich aus <strong>de</strong>r Harzversorgung. Vorübergehend konnte von<br />
1935 bis in die 1960er Jahre auch Wasser aus <strong>de</strong>r Sösetalsperre vom Harz über eine Fernleitung bis nach Bremen geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
• Brauchwasserentsorgung<br />
Infolge <strong>de</strong>r Siedlung in Überflutungsgebieten konnte die Volkswirtschaft seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt lediglich eine Mischwasser-Kanalisation leisten. In <strong>de</strong>n alten Siedlungsgebieten wird<br />
Abwasser aus Brauchwasser und Trinkwasser gemeinsam mit oberflächlich gesammeltem Regenwasser abgeführt. Das hat allemal <strong>de</strong>n Vorteil guter Spülung <strong>de</strong>r Kanäle nach<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>r Sparsamkeit beim Wasserverbrauch. In neuen Siedlungsgebieten erfolgt die Entsorgung getrennt.<br />
• Regenwasserentsorgung<br />
Große Teile <strong>de</strong>s Stadtgebiets abseits <strong>de</strong>r Domdüne und <strong>de</strong>r Dünenkette an Weser und Lesum liegen unter <strong>de</strong>m Hochwasserpegel <strong>de</strong>r Weser. Die Regenwasserentsorgung erfolgt daher seit<br />
<strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt durch Abpumpen. Nach Starkregen ergießt sich ein Teil <strong>de</strong>s Wasseraufkommens ungeklärt in die Überläufe an Ochtum und Wümme.<br />
• Bauschuttentsorgung<br />
Das Aufkommen an Bauschutt aus <strong>de</strong>n Kriegszerstörungen kann bei je<strong>de</strong>r Tiefbaustelle wahrgenommen wer<strong>de</strong>n, kaum ein Bo<strong>de</strong>naushub ist frei von Ziegelresten. Heute wird das gesamte<br />
Aufkommen an Baustellenabfällen getrennt und verwertet. Sperrige brennbare Anteile wer<strong>de</strong>n in einer geregelten Deponie verklappt o<strong>de</strong>r gebrochen und verfeuert.<br />
• Hausmüllentsorgung<br />
Frühzeitig wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1970er Jahren eine Müllverbrennungsanlage errichtet, <strong>de</strong>ren Benennung mehrere politisch motivierte Än<strong>de</strong>rungen durchlaufen hat. Heute wird <strong>de</strong>r Müll vor <strong>de</strong>r<br />
Verbrennung durch Mischen auf konstanten Heizwert konditioniert. Die Universität Bremen wird komplett aus Müll beheizt.<br />
• Energieversorgung<br />
Die Stadtwerke Bremen waren vor <strong>de</strong>r Veräußerung an ein privates Energieversorgungsunternehmen lediglich durch zwei Speisepunkte mit <strong>de</strong>m übrigen Verbundnetz verknüpft<br />
(Neuenlan<strong>de</strong> und Farge). Heute existieren weitere Speisepunkte, um die Versorgungssicherheit <strong>zu</strong> erhöhen. Den Großteil <strong>de</strong>r thermischen und elektrische Energie produzieren die swb-<br />
Kraftwerke Hafen, Hastedt, Mittelsbüren sowie die Müllverbrennungsanlage. Das Kraftwerk Mittelsbüren, das mit Gichtgas <strong>de</strong>r Bremer Stahlhütte befeuert wird, erzeugt <strong>zu</strong><strong>de</strong>m<br />
wesentliche Energiemengen <strong>de</strong>s Bahnstromverbrauchs (16,7 Hz) in <strong>de</strong>r nord<strong>de</strong>utschen Tiefebene. Darüber hinaus steht in Bremen-Nord noch das Kraftwerk Farge, das 2009 von GDF<br />
Suez übernommen wur<strong>de</strong>. Bis <strong>zu</strong>r Fertigstellung <strong>de</strong>s Weserkraftwerks beschränkt sich die Erzeugung erneuerbarer Energien auf einige Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen.<br />
• Frischluftversorgung
In Zeiten <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>ren Aufmerksamkeit für Luftverschmut<strong>zu</strong>ng gewinnt ein Merkmal an Be<strong>de</strong>utung: Die Umgebungsluft in Bremen wird <strong>zu</strong>nächst fortlaufend durch die üblich<br />
vorherrschen<strong>de</strong> Westwindlage bereinigt. Außer<strong>de</strong>m erfolgt durch <strong>de</strong>n täglichen Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht nach Sonnenuntergang eine abendliche Einströmung warmer<br />
Meeresluft, welche die Luftqualität bis <strong>zu</strong>m Morgen wie<strong>de</strong>r auf Spitzenwerte bringt.<br />
• Sonneneinstrahlung<br />
Mit ansteigen<strong>de</strong>r durchschnittlicher Erwärmung im Nordseebereich erweitert sich die Schönwetterzone bei Hochdrucklagen <strong>zu</strong>nehmend von Ostfriesland und Ol<strong>de</strong>nburg <strong>zu</strong>nehmend nach<br />
Osten, so dass eine leichte Zunahme <strong>de</strong>s Jahresmittels <strong>de</strong>r täglichen Sonnenstun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> verzeichnen ist (plus eine Stun<strong>de</strong> seit 1980).<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Bauwerke<br />
Rund um <strong>de</strong>n Marktplatz<br />
Der Roland ist Mittelpunkt und Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt. Der originale Kopf <strong>de</strong>s Roland ist im Focke-Museum ausgestellt. Während <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong> er aus Furcht vor<br />
Zerstörung durch Bombenangriffe durch eine Kopie ersetzt. Sein Blick ist auf <strong>de</strong>n Dom St. Petri gerichtet, <strong>de</strong>r für Besucher das Dom-Museum und <strong>de</strong>n Bleikeller bereithält. Neben <strong>de</strong>m<br />
Roland steht das Rathaus, in <strong>de</strong>ssen Ratskeller Wein serviert und verkauft wird. Roland und Rathaus gehören <strong>zu</strong>m UNESCO-Welterbe. An <strong>de</strong>r Westmauer <strong>de</strong>s Rathauses sind die Bremer<br />
Stadtmusikanten, ebenfalls ein Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt, <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Hier en<strong>de</strong>t die Deutsche Märchenstraße. Es schließt sich die ehemalige Ratskirche Unser Lieben Frauen an.<br />
Auf <strong>de</strong>r gegenüberliegen<strong>de</strong>n Seite <strong>de</strong>s Marktplatzes befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Schütting, das Haus <strong>de</strong>r Kaufleute. Die Ostseite <strong>de</strong>s Platzes nimmt das Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bremischen Bürgerschaft ein, an<br />
<strong>de</strong>r Westseite steht eine Reihe von vier Gebäu<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m 18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Zwischen <strong>de</strong>m Schütting und <strong>de</strong>r Bremer Baumwollbörse öffnet sich die Böttcherstraße, ein zwischen<br />
1922 und 1931 entstan<strong>de</strong>nes Gesamtkunstwerk. Sie führt <strong>zu</strong>r Martinikirche an <strong>de</strong>r Weser.<br />
Die Kirchen in <strong>de</strong>r Altstadt<br />
Von <strong>de</strong>n Bremer Kirchen aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Gotik ist durch <strong>de</strong>n Zweiten Weltkrieg nur die Ansgarikirche nicht erhalten.<br />
• Am Marktplatz steht <strong>de</strong>r evangelische Bremer Dom als teils romanische, teils früh- und schließlich spätgotische dreischiffige Hallenkirche. Sie war <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r Erzbischöfe vom<br />
Bistum Bremen.<br />
• Direkt neben <strong>de</strong>m Bremer Rathaus befin<strong>de</strong>t sich die evangelische Liebfrauenkirche, die 1229 im frühgotischen Stil errichtet wur<strong>de</strong>. Der Turmhelm <strong>de</strong>r Ratskirche hat eine<br />
außergewöhnliche Höhe.<br />
• In <strong>de</strong>r Altstadt, direkt an <strong>de</strong>r Weser, steht die evangelische Martinikirche, ein wie<strong>de</strong>r aufgebauter spätgotischer Backsteinbau, <strong>de</strong>r 1384 <strong>zu</strong>r Hallenkirche umgebaut wur<strong>de</strong>.<br />
• Zwischen Domshof und Schnoor befin<strong>de</strong>t sich die katholische Propsteikirche St. Johann, eine dreischiffige Hallenkirche aus <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt, ehemalige Klosterkirche <strong>de</strong>r<br />
Franziskaner und die einzige noch erhaltene Klosterkirche in Bremen.<br />
• In <strong>de</strong>r Katharinenpassage zwischen Sögestraße und Domshof sind noch die Reste <strong>de</strong>s Dominikanerklosters mit <strong>de</strong>r Kirche St. Katharinen <strong>zu</strong> sehen.<br />
• Im Stephaniviertel, am westlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r bremischen Altstadt, wur<strong>de</strong> die evangelische Pfarrkirche St. Stephani gebaut. Sie ist eine gotische Hallenkirche aus <strong>de</strong>m 14.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt mit einem rund 75 m hohen neugotischen Südturm.<br />
Am Weserufer<br />
In Höhe <strong>de</strong>r Martinikirche beginnt die Schlachte, die in <strong>de</strong>n 1990er Jahren sanierte historische Uferpromena<strong>de</strong> mit zahlreichen gastronomischen Angeboten. Gegenüber auf <strong>de</strong>r Halbinsel<br />
zwischen <strong>de</strong>r Weser und <strong>de</strong>r Kleinen Weser liegt <strong>de</strong>r Teerhof, auf <strong>de</strong>m sich neben <strong>de</strong>m Museum Weserburg und <strong>de</strong>r Gesellschaft für aktuelle Kunst (GAK) in <strong>de</strong>n 1990er Jahren errichtete<br />
Wohnbebauung befin<strong>de</strong>t. Einige Kilometer flussabwärts war <strong>de</strong>r Space Park im Stadtteil Gröpelingen <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r im Dezember 2003 auf <strong>de</strong>m ehemaligen Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Werft AG Weser
eröffnet und nach einem Jahr wie<strong>de</strong>r geschlossen wur<strong>de</strong>. Dessen Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> als Einkaufszentrum „Waterfront“ umgebaut.<br />
Das Schnoorviertel<br />
Der Schnoor ist ein mittelalterliches Gängeviertel in <strong>de</strong>r Altstadt Bremens und wahrscheinlich <strong>de</strong>r älteste Siedlungskern. Das Quartier verdankt seine Bezeichnung <strong>de</strong>m alten<br />
Schiffshandwerk. Die Gänge zwischen <strong>de</strong>n Häusern stan<strong>de</strong>n oft in Zusammenhang mit Berufen o<strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong>n: So gab es einen Bereich, in welchem Seile und Taue hergestellt<br />
wur<strong>de</strong>n (Schnoor = Schnur), und einen benachbarten Bereich, in <strong>de</strong>m Draht und Ankerketten gefertigt wur<strong>de</strong>n (Wieren = Draht). Zahlreiche Häuser aus <strong>de</strong>m 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt sind<br />
noch erhalten und vermitteln einen romantischen Eindruck vom Leben in früheren Zeiten. In <strong>de</strong>n Jahren 1856/57 wur<strong>de</strong> hier das Dienstgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Landherren errichtet, und erst am 19.<br />
September 1945 wur<strong>de</strong> die Stellung <strong>de</strong>s Landherren aufgehoben.<br />
Die Weserrenaissance und die Neorenaissance<br />
Aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Weserrenaissance sind in Bremen eine Anzahl von Gebäu<strong>de</strong>n erhalten geblieben, u. a. zählen da<strong>zu</strong>: Das Bremer Rathaus (Kernbau aus <strong>de</strong>r Gotik) von 1612 und <strong>de</strong>r<br />
Schütting von 1538 – bei<strong>de</strong> am Markt, die Stadtwaage von 1587 und das Essighaus von 1618 – bei<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Langenstraße – und das Gewerbehaus am Angariikirchhof von 1620.<br />
Im 19./20. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n u. a. historisierend im Stil <strong>de</strong>r Neorenaissance das Postamt 1 an <strong>de</strong>r Domshei<strong>de</strong> (1879), die Bremer Baumwollbörse (1902) und die Bremer Bank am<br />
Domshof (1905) errichtet.<br />
Weitere beson<strong>de</strong>rs bemerkenswerte Bauwerke<br />
Weitere beson<strong>de</strong>rs sehenswürdige und auch ungewöhnliche Bauwerke sind u. a. das ehemalige Wasserwerk (1873) auf <strong>de</strong>m Stadtwer<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r als Kolonial<strong>de</strong>nkmal errichtete „Elefant“<br />
(heute Antikolonial<strong>de</strong>nkmal) im Stadtteil Schwachhausen, das Haus <strong>de</strong>s Reichs (1930) in <strong>de</strong>r Bahnhofsvorstadt, das Aalto-Hochhaus (1962) in <strong>de</strong>r Neuen Vahr, die Stadthalle (1964/2005)<br />
auf <strong>de</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong>, und im Bereich <strong>de</strong>r Universität Bremen <strong>de</strong>r Fallturm (1990) <strong>de</strong>s ZARMs und das Science Center Universum. Das Gebäu<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m höchsten Aussichtspunkt ist mit<br />
80 Metern <strong>de</strong>r Wesertower (2009) in <strong>de</strong>r Überseestadt.<br />
Das Bremer Haus<br />
Das Bremer Haus ist ein Reihenhaustyp, <strong>de</strong>r in England seine Wurzeln hat. Es war, in verschie<strong>de</strong>nen Größen, für alle sozialen Bevölkerungsgruppen gedacht und bestimmte seit <strong>de</strong>r Mitte<br />
<strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts bis in die 1930er Jahre <strong>de</strong>n Wohnungsbau in Bremen. In <strong>de</strong>n Stadtteilen Schwachhausen, Steintor, Ostertor und <strong>de</strong>r Neustadt fin<strong>de</strong>t man hauptsächlich <strong>de</strong>n großen<br />
Typ, <strong>de</strong>r für wohlhaben<strong>de</strong>re Bürger errichtet wur<strong>de</strong>. In Arbeitervierteln wie Walle und Gröpelingen <strong>de</strong>n kleinsten mit 1-2 vollen Etagen und niedrigeren Geschosshöhen.<br />
Bremen-Nord<br />
Als Bau<strong>de</strong>nkmäler in Bremen-Nord sind unter an<strong>de</strong>rem in Vegesack das Havenhaus am Vegesacker Hafen sowie einige Packhäuser aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, darunter das Kitohaus, <strong>zu</strong><br />
nennen. Am Vegesacker Ufer <strong>de</strong>r Lesum liegt außer<strong>de</strong>m das Schulschiff Deutschland. Sehenswert sind weiter das Schloss Schönebeck, die Wasserburg Haus Blomendal sowie <strong>de</strong>r U-<br />
Boot-Bunker Valentin im Ortsteil Farge.<br />
Auch sehenswert ist die 'Skyline' von Blumenthal: die Türme <strong>de</strong>r katholischen Kirche St. Marien, <strong>de</strong>r evangelisch-lutherischen Martin-Luther-Kirche und <strong>de</strong>r evangelisch-reformierten<br />
Kirche und <strong>de</strong>r Wasserturm, alle im Zeitalter <strong>de</strong>s neugotischen Bauens im Stil <strong>de</strong>r Backsteingotik entstan<strong>de</strong>n.<br />
Theater<br />
Das Theater Bremen ist ein städtisches Theater <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen mit Aufführungen von Opern, Operetten, Musicals, Schauspielen und Tanztheater. Es besteht aus mehreren<br />
Spielstätten – das größte unter ihnen ist das Theater am Goetheplatz im Viertel. 2007 wur<strong>de</strong> das Theater Bremen unter Klaus Pierwoß <strong>zu</strong>m „Opernhaus <strong>de</strong>s Jahres“ gewählt.<br />
Darüber hinaus besitzt Bremen eine vielfältige Theaterszene mit zahlreichen, etablierten Theatern in freier o<strong>de</strong>r privater Trägerschaft. Bei <strong>de</strong>r bremer shakespeare company im Theater am
Leibnizplatz ist <strong>de</strong>r Name Programm. Das Travestietheater von Madame Lothár im Schnoor war eine bremische Institution. Inszenierungen mo<strong>de</strong>rner Stücke sind im Jungen Theater <strong>zu</strong><br />
sehen. Als Kin<strong>de</strong>r- und Jugendtheater ist das Theaterhaus Schnürschuh bekannt gewor<strong>de</strong>n. 1976 gegrün<strong>de</strong>t, fin<strong>de</strong>n dort außer<strong>de</strong>m Lesungen und Musikveranstaltungen statt.<br />
Museen<br />
Die Museumslandschaft in Bremen ist vielfältig<br />
Musik<br />
• Das Überseemuseum ist eines <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten völkerkundlichen Museen Europas mit über 100-jähriger Tradition und umfangreichen Sammlungen <strong>zu</strong> Ozeanien, Asien, Afrika,<br />
Amerika, Naturkun<strong>de</strong> und Han<strong>de</strong>lskun<strong>de</strong> sowie wechseln<strong>de</strong>n Son<strong>de</strong>rausstellungen.<br />
• Die Kunsthalle, von Bürgern <strong>de</strong>r Stadt gegrün<strong>de</strong>te, wur<strong>de</strong> nach Plänen von Lü<strong>de</strong>r Rutenberg 1849 gebaut. Der Bestand umfasst heute europäische Kunstwerke vom Mittelalter bis<br />
<strong>zu</strong>r Gegenwart.<br />
• Im Neuen Museum Weserburg ist die Mo<strong>de</strong>rne Kunst ausgestellt.<br />
• Die Kunstsammlungen Böttcherstraße mit <strong>de</strong>m Paula-Mo<strong>de</strong>rsohn-Becker-Haus und <strong>de</strong>m Museum im Roselius-Haus<br />
• Das Gerhard-Marcks-Haus und das Wilhelm-Wagenfeld-Haus Am Wall in Bremen-Mitte<br />
• Die Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) präsentiert internationale, zeitgenössische Kunst.<br />
• Das Künstlerhaus Bremen und die Städtische Galerie Bremen in <strong>de</strong>r Neustadt<br />
• Das Focke-Museum ist das Lan<strong>de</strong>smuseum für Kunst und Kulturgeschichte<br />
• Das Heimatmuseum Schloss Schönebeck stellt Kultur- und Heimatgeschichte <strong>de</strong>r Umgebung aus.<br />
• Das Dom-Museum und <strong>de</strong>r Bleikeller im St.-Petri-Dom<br />
• Das Universum ist ein mo<strong>de</strong>rnes Science Center auf <strong>de</strong>m Universitätsgelän<strong>de</strong>.<br />
• Das Hafenmuseum wur<strong>de</strong> 2004 eröffnet Es behan<strong>de</strong>lt die Entwicklung <strong>de</strong>r stadtbremischen Häfen.<br />
• Das Antikenmuseum im Schnoor ist ein 2005 eröffnetes Spezialmuseum für griechische Vasen aus <strong>de</strong>r Zeit von 560 bis 350 v. Chr.<br />
Klassik<br />
Die Bremer Philharmoniker wur<strong>de</strong>n 1825 von <strong>de</strong>r Gesellschaft für Privatkonzerte, heute Philharmonische Gesellschaft Bremen, gegrün<strong>de</strong>t und sind das offizielle Orchester <strong>de</strong>r Freien<br />
Hansestadt Bremen. Ihr Tätigkeitsspektrum umfasst neben <strong>de</strong>r Bespielung <strong>de</strong>s Musiktheaters im Theater Bremen die Veranstaltung einer Serie von Abonnementkonzerten und diverser<br />
Son<strong>de</strong>r- und Benefizkonzerte sowie ein weitreichen<strong>de</strong>s Engagement im Bereich <strong>de</strong>r musikalischen Nachwuchsför<strong>de</strong>rung. Seit 2002 ist das Orchester als erste <strong>de</strong>utsche Orchester-GmbH<br />
mit privater Mehrheitsbeteiligung aufgestellt, Gesellschafter sind die Philharmonische Gesellschaft Bremen (26 %) und die Orchestermusiker, organisiert im Bremer Philharmoniker e. V.<br />
(26 %) sowie die Freie Hansestadt Bremen (26 %) und das Theater Bremen (22 %). Intendant <strong>de</strong>r Bremer Philharmoniker ist Christian Kötter-Lixfeld, Generalmusikdirektor ist seit 2007<br />
Markus Poschner.<br />
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die seit 1992 ihren Sitz in Bremen hat, gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n weltweit führen<strong>de</strong>n Kammerorchestern. Künstlerischer Leiter ist seit 2004 <strong>de</strong>r<br />
estnische Dirigent Paavo Järvi. Räumlich ist das Kammerorchester seit März 2007 in <strong>de</strong>r Gesamtschule Bremen-Ost untergebracht, wo es unter an<strong>de</strong>rem über mehrere<br />
Gruppenproberäume und einen Konzertsaal für bis <strong>zu</strong> 450 Zuhörer verfügt.<br />
Der Haupt-Veranstaltungsort für klassische Musik in Bremen ist das 1928 erbaute Haus Die Glocke neben <strong>de</strong>m Dom. Herbert von Karajan zählte die Glocke <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n drei besten<br />
Konzerthäusern Europas.<br />
Im Theater am Goetheplatz fin<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>r Regie <strong>de</strong>s Theater Bremen regelmäßige Opern- und Operettenaufführungen statt.
Der Fachbereich Musik <strong>de</strong>r Hochschule für Künste Bremen leistet neben <strong>de</strong>r künstlerischen Ausbildung durch zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen im Konzertsaal und in <strong>de</strong>r Galerie<br />
einen wichtigen Beitrag <strong>zu</strong>m vielfältigen kulturellen Leben <strong>de</strong>r Hansestadt.<br />
Musicaltheater<br />
Im Musical Theater Bremen fin<strong>de</strong>t man die Kombination aus Musik und Theater.<br />
Populäre Musik<br />
Aus Bremen kommen die Deutschrock-Band Wolfsmond (Wie <strong>de</strong>r Wind so frei), die Indie-Rock Band Trashmonkeys, die sich inzwischen auch in England einen Namen gemacht hat,<br />
sowie die Sixties-Beatgruppe Yankees (Halbstark).<br />
Der <strong>de</strong>utsche Schlagersänger Ronny (Oh my Darling, Caroline), <strong>de</strong>r sich auch als Ent<strong>de</strong>cker und Produzent <strong>de</strong>s holländischen Kin<strong>de</strong>rstars Heintje (Mama) in <strong>de</strong>n 1960er Jahren einen<br />
Namen gemacht hat, kommt ebenfalls aus Bremen. Hier lebt auch <strong>de</strong>r Textdichter dieser und vieler weiterer berühmter Interpreten, Hans Hee.<br />
Bei Radio Bremen produzierte Michael Leckebusch ab 1965 mit <strong>de</strong>m Beat-Club eine <strong>de</strong>r ersten richtungsweisen<strong>de</strong>n TV-Musiksendungen <strong>de</strong>r Nachkriegszeit. Die Mo<strong>de</strong>ratoren Uschi<br />
Nerke und Gerd Augustin erzielten regelmäßig am Sen<strong>de</strong>termin am Samstagnachmittag hohe Einschaltquoten bei jugendlichen Zuschauern. Die Sendung entwickelte sich in einem nicht<br />
unerheblichen Maße <strong>zu</strong> einem Phänomen <strong>de</strong>r Jugendkultur im Deutschland. Im Anschluss an <strong>de</strong>n Beat-Club wur<strong>de</strong> u. a. <strong>de</strong>r Musikla<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Extratour produziert.<br />
Avantgar<strong>de</strong><br />
In <strong>de</strong>r Jazz- und Avantgar<strong>de</strong>musik erlangte <strong>de</strong>r Trompeter Uli Beckerhoff Bekanntheit.<br />
Diskotheken<br />
Es gibt in Bremen eine ganze Reihe an Diskotheken, z. B. das StuBu, das Tivoli, das Aladin, die Lila Eule und das Mo<strong>de</strong>rnes.<br />
Parks<br />
wichtigsten Anlagen:[16]<br />
Der Bürgerpark ist <strong>de</strong>r größte privat finanzierte Stadtpark in Deutschland. Er schließt sich hinter <strong>de</strong>m Bahnhof direkt an die Bürgerwei<strong>de</strong> an und geht in <strong>de</strong>n Stadtwald über, mit <strong>de</strong>m<br />
<strong>zu</strong>sammen er 202 Hektar umfasst. Der Bürgerpark wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1860er Jahren vom Landschaftsgärtner Wilhelm Benque angelegt.<br />
Der Stadtwald ist vom Bürgerpark durch eine Eisenbahnlinie getrennt. Die Finnbahn bringt täglich bis <strong>zu</strong> 500 Läufer auf Trab.<br />
Der Unisee, die Uniwildnis und das Universum Bremen schließen nördlich direkt an <strong>de</strong>n Stadtwald an.<br />
Die Bremer Wallanlagen sind nach Plänen von Isaak Altmann ab 1805 hervorgegangen aus <strong>de</strong>r bis <strong>zu</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt erbauten Bremer Stadtmauer und <strong>de</strong>r dann folgen<strong>de</strong>n<br />
Befestigungsanlagen. Sie sind nicht nur Bremens älteste, son<strong>de</strong>rn auch die erste öffentliche Parkanlage in Deutschland, die durch eine bürgerliche Volksvertretung realisiert wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r<br />
Windmühle befin<strong>de</strong>t sich heute ein Restaurant. Die meisten Bremer Windmühlen sind Stationen <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rsächsischen Mühlenstraße.<br />
Die Neustadtswallanlagen auf <strong>de</strong>r linken Weserseite sind ab 1805 auf <strong>de</strong>r Befestigungsanlage <strong>de</strong>r Neustadt entstan<strong>de</strong>n. Geblieben ist davon nur eine nicht durchgängige 16 Hektar große<br />
Parkanlage vom Hohentorshafen bis <strong>zu</strong>r Piepe.[17] Der markante Centaurenbrunnen steht seit 1958 gegenüber <strong>de</strong>r Schule am Leibnizplatz.<br />
Der Rhodo<strong>de</strong>ndron-Park bietet auf einer Fläche von 46 Hektar eine einzigartige Sammlung an Rhodo<strong>de</strong>ndren und Azaleen. 500 von <strong>de</strong>n weltweit 1.000 verschie<strong>de</strong>nen<br />
Rhodo<strong>de</strong>ndronwildarten wachsen in diesem Park und <strong>de</strong>m hier stehen<strong>de</strong>n grünen Science-Center Botanika. Der Park wur<strong>de</strong> um 2000 durch einen Themenpark erweitert.
Der Botanische Garten ist 3,2 Hektar groß und liegt im Rhodo<strong>de</strong>ndron-Park. Er ist 1937 an diesem Standort neu aufgebaut wor<strong>de</strong>n.<br />
Der Park links <strong>de</strong>r Weser, fast 300 Hektar groß, entstand auf Grund <strong>de</strong>r Initiative <strong>de</strong>s gleichnamigen Vereins zwischen Huchting und Grolland als Landschaftspark erst ab 1975. Der<br />
Flusslauf <strong>de</strong>r Ochtum, die wegen <strong>de</strong>s Flughafens verlegt wur<strong>de</strong>, stellt das wichtigste Element dieses Parks dar.<br />
Der Park am So<strong>de</strong>nmattsee ist 1960 in Huchting entstan<strong>de</strong>n, als Sand für <strong>de</strong>n Straßenbau benötigt wur<strong>de</strong>. Heute ist <strong>de</strong>r Park 19 Hektar groß.<br />
Die Pauliner Marsch ist mit 54 Hektar Bremens größter Sportpark und liegt direkt an <strong>de</strong>r Weser östlich vom Weserstadion. Hier ist auch die Heimat von Wer<strong>de</strong>r Bremen.<br />
Der Weseruferpark - eine 22 Hektar große maritime Meile - liegt direkt an <strong>de</strong>r linken Weserseite und erstreckt sich von Rablinghausen bis <strong>zu</strong>m Lankenauer Höft.<br />
Die Oberneulan<strong>de</strong>r Parks sind <strong>zu</strong>meist Grünanlagen im englischen Stil um die Herrenhäuser verschie<strong>de</strong>ner Landgüter. Da<strong>zu</strong> zählen Höpkens Ruh mit 7 Hektar Fläche und daneben<br />
Muhle's Park, dann Heinekens Park mit 2,7 Hektar und Ichons Park - bei<strong>de</strong> nach Plänen von Gottlieb Altmann, Menke Park, Park Gut Ho<strong>de</strong>nberg nach Plänen von Gartenarchitekt<br />
Christian Roselius, Hasses Park nach Plänen von Wilhelm Benque sowie <strong>de</strong>r Park Holdheim.<br />
Der Achterdiekpark in Oberneuland entstand ab 1969. Der Park selbst ist 8 Hektar groß und umfasst sieben Teiche. Der Achterdiekpark e. V. betreut die Anlage. Die anschließen<strong>de</strong>n<br />
Grünflächen am Achterdieksee und <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sautobahn 27 entstan<strong>de</strong>n beim Bau <strong>de</strong>r Vahr in <strong>de</strong>n 1960er Jahren. Sie sind 31 Hektar groß. Eine Golfanlage befin<strong>de</strong>t direkt neben <strong>de</strong>n<br />
Grünzonen.<br />
Das Blockland ist nicht nur ein Ortsteil, son<strong>de</strong>rn ein 30 Quadratkilometer großes Landschaftsgebiet <strong>de</strong>r Wümmenie<strong>de</strong>rung mit Naturschutzgebieten an <strong>de</strong>r linken Seite <strong>de</strong>r Wümme, mit<br />
<strong>de</strong>m Wümme-Radweg und vielen Ausflugslokalen.<br />
Im Stadtbezirk Bremen-Nord<br />
Knoops Park in St. Magnus (Bremen-Nord) am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bremer Schweiz aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, stammt von Wilhelm Benque. Der 60 Hektar große Park ist eine Mischung aus<br />
englischem Park und italienischem Renaissance-Garten.<br />
Wätjens Park in Blumenthal ist 40 Hektar groß. Er entstand ab 1850 als Park um Wätjens Schloss für <strong>de</strong>n Ree<strong>de</strong>r Wätjen nach Plänen von Isaak Altmann. Der Park verkam und wird seit<br />
1999 saniert.<br />
Der Naturpark um Schloss Schönebeck in Vegesack mit malerischen Wegen im Tal <strong>de</strong>r Schönebecker Aue umfasst 30 Hektar. Mittendrin die bremische Ökologiestation.<br />
Die Weserpromena<strong>de</strong> Vegesack wird als Garten am Fluss bezeichnet. Nur 2 Hektar groß hat er eine fast 1 Kilometer lange maritime Promena<strong>de</strong> mit auch exotischen Gehölzen, die von <strong>de</strong>r<br />
Strandlust bis <strong>zu</strong>m ehemaligen Werftgelän<strong>de</strong> vom Bremer Vulkan führt.<br />
Friedhöfe in Bremen<br />
Der Riensberger Friedhof und <strong>de</strong>r Waller Friedhof<br />
Nach <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utsch-französischen Krieg (1870–1871) wur<strong>de</strong>n, als Ersatz für die bei<strong>de</strong>n stadtnahen Friedhöfe am Doventor und am Her<strong>de</strong>ntor, eine gute Stun<strong>de</strong> Wegzeit vor <strong>de</strong>n Toren<br />
Bremens zwei neue Friedhöfe angelegt. Der Riensberger Friedhof im heutigen Stadtteil Schwachhausen und als westliche Ergän<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Waller Friedhof. Bei<strong>de</strong> Friedhöfe wur<strong>de</strong>n am 1.<br />
Mai 1875 eröffnet. Auf bei<strong>de</strong>n Friedhöfen fin<strong>de</strong>t man noch heute viele künstlerisch gestaltete Grabmäler, darunter auch größere Mausoleen.<br />
Der Osterholzer Friedhof<br />
Als <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts bei<strong>de</strong> Friedhöfe nicht mehr ausreichend freie Flächen <strong>zu</strong>r Verfügung hatten, schrieb <strong>de</strong>r Senat einen Wettbewerb für einen neuen kommunalen<br />
Zentralfriedhof für <strong>de</strong>n östlichen Teil Bremens aus. Der erste Abschnitt <strong>de</strong>r Anlage wur<strong>de</strong> im Oktober 1916 fertiggestellt – mitten im Ersten Weltkrieg. Die Einweihung fand 1920 statt.<br />
Die Ruhestätte für <strong>de</strong>rzeit mehr als 100.000 Verstorbene ist mit 79,5 ha Bremens größter Friedhof.
Der Jüdischer Friedhof Deichbruchstraße, wur<strong>de</strong> seit 1796 belegt und ist seit 1803 offizieller jüdischer Friedhof von Bremen.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Im Laufe <strong>de</strong>s Jahres wechseln sich auf <strong>de</strong>n Plätzen in <strong>de</strong>r Stadtmitte die Losbu<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bürgerpark-Tombola und Fahrgeschäfte <strong>de</strong>r Osterwiese, <strong>de</strong>s Freimarktes, <strong>de</strong>r so genannten 5.<br />
Jahreszeit und <strong>de</strong>s Weihnachtsmarktes ab. Beim Freimarkt han<strong>de</strong>lt es sich um eines <strong>de</strong>r ältesten Volksfeste Deutschlands, das erstmals im Jahr 1035 abgehalten wur<strong>de</strong>. Der „Kleine<br />
Freimarkt“ fin<strong>de</strong>t vor <strong>de</strong>m Rathaus zeitgleich mit <strong>de</strong>m „großen“ Freimarkt auf <strong>de</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong> statt. Je einmal im Monat verkehren die Museumsstraßenbahn-Linien 15 und 16.[18]<br />
Be<strong>de</strong>utend sind die Bremer Eiswette am Dreikönigstag und das Bremer Schaffermahl im Februar. Aus <strong>de</strong>r Vielzahl <strong>de</strong>r kulturellen Veranstaltungen ragen <strong>de</strong>r Bremer Karneval im Februar,<br />
das Freiluftfestival Breminale, das Internationale Literaturfestival sowie das Musikfest Bremen im September heraus. Eine viele Besucher anlocken<strong>de</strong> Veranstaltung mit sportlichem<br />
Hintergrund ist das stets im Januar stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Bremer Sechstagerennen. September 2009 fand erstmals die Maritime Woche an <strong>de</strong>r Weser statt.<br />
Kulturpreise<br />
zeitlich geordnet<br />
Die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft wur<strong>de</strong> seit 1938 und erneut seit 1952 vom Bremer Senat verliehen.<br />
Der Literaturpreis <strong>de</strong>r Stadt Bremen wur<strong>de</strong> von 1954 bis 1960 vom Senat und seit 1962 durch die vom Senat erfolgte Gründung <strong>de</strong>r Rudolf-Alexan<strong>de</strong>r-Schrö<strong>de</strong>r-Stiftung vergeben.<br />
Zusätzlich wird seit 1977 ein För<strong>de</strong>rpreis verliehen.<br />
Der Bremer Kunstpreis wird seit 1955 an Künstler im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum verliehen. Er hieß bis 1983 Kunstpreis <strong>de</strong>r Böttcherstraße. Der Stifterkreis ist seit 1983 ein<br />
Zusammenschluss von Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Kunstvereins Bremen.<br />
Der Kultur- und Frie<strong>de</strong>nspreis <strong>de</strong>r Villa Ichonwird seit 1983 von <strong>de</strong>m Verein <strong>de</strong>r Freun<strong>de</strong> und För<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>r Villa Ichon jährlich verliehen für Werk o<strong>de</strong>r Wirken als Bekenntnis <strong>zu</strong>m<br />
Frie<strong>de</strong>n und von hohem kulturellem Rang.<br />
Der Hannah-Arendt-Preis wird seit 1995 von <strong>de</strong>r Heinrich-Böll-Stiftung und <strong>de</strong>m Bremer Senat vergeben für Personen die <strong>zu</strong> öffentlichem, politischen Denken und Han<strong>de</strong>ln beitragen.<br />
Der Kurt-Hübner-Preis wird seit 1996 vom Verein Bremer Theaterfreun<strong>de</strong> verliehen an Ensemblemitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Theater Bremens für beson<strong>de</strong>re künstlerische Leistungen.<br />
Der Bremer Musikfest-Preis wird seit 1998 für herausragen<strong>de</strong> Musikkünstler vergeben. Zusätzlich wird <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Deutschlandfunk <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rpreis Deutschlandfunk für begabte<br />
Nachwuchskünstler verliehen.<br />
Der Bremer Filmpreis wird seit 1999 für langjährige Verdienste um <strong>de</strong>n europäischen Film von <strong>de</strong>r Kunst- und Kultur-Stiftung <strong>de</strong>r Sparkasse Bremen vergeben.<br />
Der Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis wur<strong>de</strong> seit 2000 vom Bremer Kulturverein Freizeit 2000 uns seit 2007 vom Freun<strong>de</strong>skreis „Dat Huus op’n Bulten“ an Personen und Institutionen<br />
verliehen, die sich beson<strong>de</strong>rs um <strong>de</strong>n Erhalt <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utschen Sprache verdient gemacht haben.<br />
Der Radio Bremen Krimipreis wird seit 2001 für Autoren qualitativ herausragen<strong>de</strong>r Werke <strong>de</strong>r Kriminalliteratur von Radio Bremen auf <strong>de</strong>m Krimifestival verliehen.<br />
In <strong>de</strong>r Mall of Fame, als inoffizieller Name einer Fußgängerzone in Bremen, wer<strong>de</strong>n seit 2003 die Handabdrücke verschie<strong>de</strong>ner Prominenter eingelassen.<br />
Der private Feature-Preis <strong>de</strong>s Bremer Hörkinos für Autoren besteht seit 2007.<br />
Der Bremer Stadtmusikantenpreis wird seit 2009 verliehen. Der undotierte Preis wird in <strong>de</strong>n vier Kategorien Bürgerschaftliches Engagement (Senat), Medien (Radio Bremen und Weser-<br />
Kurier), Kultur (Internationalen Kulturform) und Tourismus/Stadtmarketing (Verkehrsverein Bremen) vergeben.<br />
Bremensien
Als Bremensien wer<strong>de</strong>n auch Begebenheiten und Bräuche in Bremen bezeichnet wie <strong>de</strong>r Bremer Freimarkt (seit 1035), die Schaffermahlzeit (seit 1545), die Bremer Eiswette (seit 1829),<br />
das Kohl- und Pinkelessen, das Domtreppenfegen (seit etwa 1890), die Große Mahlzeit <strong>de</strong>r Januargesellschaft (seit <strong>de</strong>m 15. Jh.) o<strong>de</strong>r das Bremer Tabak-Collegium (seit Anfang <strong>de</strong>r<br />
1950er Jahre)<br />
Weitere beson<strong>de</strong>re, neuere Bremer Begebenheiten sind:<br />
Der Bremer Kunstpreis (seit 1985), <strong>de</strong>r Bremer Karneval (seit 1986), die Breminale (seit 1987), <strong>de</strong>r Bremer Solidaritätspreis (seit 1988), <strong>de</strong>r Bremer Musikfest-Preis (seit 1998), <strong>de</strong>r<br />
Bremer Filmpreis (seit 1999) und <strong>de</strong>r Bremen-Marathon (seit 2005).<br />
Nachtleben<br />
Vor allem am Wochenen<strong>de</strong> tummeln sich in <strong>de</strong>r Innenstadt Einheimische und Touristen, Jugendliche und Stu<strong>de</strong>nten in zahlreichen Diskotheken, Clubs, Bars und Lounges.<br />
Hauptanlaufpunkte sind dabei die Altstadt mit <strong>de</strong>m Weserufer Schlachte, wo im Sommer zahlreiche Biergärten entlang <strong>de</strong>r Weser geöffnet sind, das sogenannte Viertel – ein Gebiet <strong>de</strong>r<br />
Stadtteile "Steintor" und "Ostertor" mit hoher Kneipendichte, sowie die Bahnhofsvorstadt mit <strong>de</strong>r Discomeile, die jedoch in <strong>de</strong>n letzten Jahren wie<strong>de</strong>rholt wegen hier auftreten<strong>de</strong>r<br />
Gewaltkriminalität und Drogen<strong>de</strong>likten in <strong>de</strong>n Schlagzeilen war. Um <strong>de</strong>m entgegen <strong>zu</strong> wirken, trat im Februar 2009 ein Waffenverbot in <strong>de</strong>r Zeit von 20:00-08:00 auf <strong>de</strong>r Discomeile in<br />
Kraft.<br />
Sport<br />
Bremen beheimatet als Großverein <strong>de</strong>n Fußballbun<strong>de</strong>sligisten Wer<strong>de</strong>r Bremen, <strong>de</strong>r auch eine starke Schach- und Tischtennis-Abteilung hat.<br />
Der Grün-Gold-Club Bremen ist Welt- und Europameister im Formationstanzen Latein.<br />
Für <strong>de</strong>n Freizeitsport bieten sich <strong>de</strong>r Bürgerpark mit <strong>de</strong>m Stadtwald, das Wer<strong>de</strong>rgebiet an bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Weser, <strong>de</strong>r Park links <strong>de</strong>r Weser sowie zahlreiche Wassersportanlagen auf <strong>de</strong>n<br />
Nebenarmen <strong>de</strong>r Weser und auf <strong>de</strong>m Stadtwaldsee an.<br />
Die Stadthalle ist als Veranstaltungsort <strong>de</strong>s Bremer Sechstagerennens bekannt. Die Stadthalle ist Austragungsort weiterer Sportwettkämpfe, auch manche Heimspiele <strong>de</strong>r Handball-<br />
Zweitligamannschaft SG Achim/Ba<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Nachbarstadt Achim fan<strong>de</strong>n hier in <strong>de</strong>r Saison 2007/08 statt. In <strong>de</strong>r Stadthalle spielt außer<strong>de</strong>m regelmäßig <strong>de</strong>r Basketballzweitligist<br />
Bremen Roosters.<br />
Seit 1907 gibt es in Bremen-Vahr an <strong>de</strong>r Vahrer Straße eine Galopp-Rennbahn mit einem Trainingszentrum für Pfer<strong>de</strong> und Reiter.<br />
Religion<br />
Im Jahr 2005 sind im Lan<strong>de</strong> Bremen 43,8 % <strong>de</strong>r Bürger in <strong>de</strong>n Protestantischen Kirchen, 12,4 % in <strong>de</strong>r Römisch-katholischen Kirche und 43,9 % <strong>de</strong>r Bürger sind konfessionslos o<strong>de</strong>r in<br />
sonstigen Gemeinschaften.[19] Eine aktuelle Übersicht <strong>de</strong>r Religionsgemeinschaften bietet <strong>de</strong>r Bremer Stadtplan <strong>de</strong>r Religionen.[20]<br />
Christentum<br />
Evangelische Lan<strong>de</strong>skirche<br />
Die Einzelgemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt sind relativ autonom und haben eine sehr unterschiedliche Tradition und Ausprägung. Dem trägt die Bremische Evangelische Kirche (BEK) Rechnung,<br />
in<strong>de</strong>m sie ihrer Verfassung <strong>de</strong>n Grundsatz <strong>de</strong>r „Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit“ vorangestellt hat (→ Präambel <strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>r BEK). Die Bremische Evangelische Kirche ist<br />
ein freiwilliger Zusammenschluss <strong>de</strong>r meisten bremischen Einzelgemein<strong>de</strong>n und fungiert als Körperschaft <strong>de</strong>s öffentlichen Rechts als „Dach“ jener Einzelgemein<strong>de</strong>n. An ihrer Spitze steht<br />
auch kein Bischof, wie in <strong>de</strong>n meisten an<strong>de</strong>ren Lan<strong>de</strong>skirchen, son<strong>de</strong>rn ein „Präsi<strong>de</strong>nt“, bzw. eine „Präsi<strong>de</strong>ntin <strong>de</strong>s Kirchenausschusses“ (ein Nicht-Theologe, bzw. -Theologin) und ein<br />
„Schriftführer <strong>de</strong>s Kirchenausschusses“ (ein Theologe). Dem Kirchenausschuss obliegen zentrale verwaltungs- und dienstrechtliche Aufgaben. Er wird vom Kirchentag, <strong>de</strong>r
parlamentarischen Vertretung aller Mitgliedsgemein<strong>de</strong>n (Syno<strong>de</strong>) für jeweils sechs Jahre gewählt. Der Bremischen Evangelischen Kirche gehören 242.386 Mitglie<strong>de</strong>r an (En<strong>de</strong> 2005). Zur<br />
Bremischen Evangelischen Kirche gehört neben <strong>de</strong>n meisten stadtbremischen Gemein<strong>de</strong>n auch die Vereinigte Protestantische Gemein<strong>de</strong> Bremerhaven. Der 32. Deutsche Evangelische<br />
Kirchentag hat vom 20. bis 24. Mai 2009 in Bremen stattgefun<strong>de</strong>n.<br />
Römisch-Katholische Kirche<br />
Nach <strong>de</strong>n Umbrüchen <strong>de</strong>r Reformation entstand ab 1648 in Bremen auch wie<strong>de</strong>r eine römisch-katholische Gemein<strong>de</strong>, die 1931 Sitz eines Dekanats wur<strong>de</strong>. Das Dekanat Bremen (Südlich<br />
<strong>de</strong>r Lesum) gehört <strong>zu</strong>m Bistum Osnabrück, das Dekanat Bremen-Nord gehört <strong>zu</strong>m Bistum Hil<strong>de</strong>sheim. Als „Dach“ aller katholischen, übergemeindlichen Einrichtungen fungiert <strong>de</strong>r<br />
Katholische Gemein<strong>de</strong>verband Bremen. Er unterhält aus Spen<strong>de</strong>n mehrere katholische Schulen und Kin<strong>de</strong>rtagesstätten. Mit <strong>de</strong>m „Apostolat <strong>de</strong>s Meeres“, <strong>de</strong>r katholischen<br />
Seemannsmission Stella Maris, richtet sich <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>verband an die Seeleute <strong>de</strong>r Hafenstadt Bremen. Ein katholisches Krankenhaus besteht mit <strong>de</strong>m St.-Joseph-Stift. Im Jahr 2002<br />
wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Birgittenkloster Bremen <strong>de</strong>r erste Schwesternkonvent seit <strong>de</strong>r Reformation in <strong>de</strong>r Hansestadt gegrün<strong>de</strong>t. Die Katholische Kirche umfasst 62.300 Mitglie<strong>de</strong>r (11,42 %).<br />
Freikirchen<br />
1845 kam es <strong>zu</strong>r Gründung <strong>de</strong>r ersten Bremer Baptisten als Baptistengemein<strong>de</strong>. Heute gibt es auf <strong>de</strong>m Gebiet in Bremen sechs Evangelisch-Freikirchliche Gemein<strong>de</strong>n, darunter auch eine<br />
englischsprachige internationale Baptistengemein<strong>de</strong>. Eine Brü<strong>de</strong>rgemein<strong>de</strong> ist in <strong>de</strong>r Wilhelm-Busch-Siedlung in <strong>de</strong>r Vahr angesie<strong>de</strong>lt.<br />
Ab 1849 entstand in Bremen auch eine bischöfliche Methodistenkirche, die von hier aus eine reiche Missionstätigkeit in ganz Deutschland ausübte. Heute befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Sitz dieser<br />
Freikirche in Frankfurt am Main.<br />
Rückwan<strong>de</strong>rer aus Amerika sammelten sich ab 1896 <strong>zu</strong> einer lutherischen Gemein<strong>de</strong>, eine <strong>de</strong>r Wurzeln <strong>de</strong>r heutigen evangelisch-lutherischen Bethlehemsgemein<strong>de</strong>, die <strong>zu</strong>m<br />
Kirchenbezirk Nie<strong>de</strong>rsachsen-West in <strong>de</strong>r Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehört.<br />
In <strong>de</strong>n 50er Jahren <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts trennte sich die Bremer Elim-Gemein<strong>de</strong> vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein<strong>de</strong>n und schloss sich <strong>de</strong>r Pfingstbewegung an. Die<br />
Gemein<strong>de</strong>, die heute über drei Gemein<strong>de</strong>zentren im Bremer Stadtgebiet verfügt, ist Trägerin <strong>de</strong>s Sozialwerks Grambke. Neben verschie<strong>de</strong>nen Sozialeinrichtungen betreibt dieses<br />
Sozialwerk auch eine Schule.<br />
Neben <strong>de</strong>n genannten Freikirchen gibt es eine Reihe weiterer freikirchlicher Gemeinschaften, unter an<strong>de</strong>rem eine Mennonitengemein<strong>de</strong>, Siebenten-Tags-Adventisten, eine Gemein<strong>de</strong><br />
Gottes, eine Freie evangelische Gemein<strong>de</strong> und eine Gemein<strong>de</strong> im Mülheimer Verband.<br />
Viele lan<strong>de</strong>skirchliche und freikirchliche Gemein<strong>de</strong>n arbeiten in Bremen sehr intensiv auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Evangelischen Allianz <strong>zu</strong>sammen und betreiben auf dieser Grundlage<br />
verschie<strong>de</strong>ne diakonische Einrichtungen: <strong>zu</strong>m Beispiel das Mutter-Kind-Haus Bremen-Findorff und das Seelsorgezentrum an <strong>de</strong>r Martini-Kirche.<br />
Weitere christliche Religionsgemeinschaften<br />
Auch die Altkatholiken, die Apostolische Gemeinschaft, die Christengemeinschaft (Michael-Kirche am Rembertiring), die Kirche Jesu Christi <strong>de</strong>r Heiligen <strong>de</strong>r Letzten Tage, die<br />
Neuapostolische Kirche, die Russisch-Orthodoxe Kirche (Gottesdienste in <strong>de</strong>r kath. St. Bonifatius-Kirche in Findorff) sowie die Zeugen Jehovas sind mit Gemein<strong>de</strong>n im Stadtgebiet<br />
vertreten.<br />
Ju<strong>de</strong>ntum<br />
Die jüdische Gemein<strong>de</strong> hat eine Synagoge und ein Gemein<strong>de</strong>zentrum in <strong>de</strong>r Schwachhauser Heerstraße. Die alte Synagoge stand bis <strong>zu</strong> ihrer Zerstörung während <strong>de</strong>r Novemberpogrome<br />
1938 in <strong>de</strong>r Dechanatstraße hinter <strong>de</strong>m Postamt 1. Der Friedhof <strong>de</strong>r israelitischen Gemein<strong>de</strong> in Bremen liegt in <strong>de</strong>r Deichbruchstraße im Ortsteil Hastedt.<br />
Islam
Die Muslime sind in mehreren Gemein<strong>de</strong>n organisiert. Ihre größte Moschee ist die Fatih-Moschee in Gröpelingen.<br />
Sonstige<br />
Schließlich leben in Bremen Angehörige asiatischer Religionsgemeinschaften in weniger festgefügten Organisationsformen, <strong>zu</strong>m Beispiel Buddhisten und Hindus.<br />
Mundarten/Sprachen<br />
In Bremen wird Hoch<strong>de</strong>utsch gesprochen, daneben nur noch selten Platt<strong>de</strong>utsch. Das Bremer Platt als eigene Mundart ist nicht mehr in seiner Reinform <strong>zu</strong> hören, da es sich inzwischen<br />
mit <strong>de</strong>m Platt <strong>de</strong>s Umlan<strong>de</strong>s gemischt hat.<br />
In die in Bremen gesprochene Umgangssprache haben viele Elemente <strong>de</strong>s „Bremer Snak“ Eingang gefun<strong>de</strong>n. Der „Bremer Snak“ ist <strong>de</strong>r bremische Dialekt <strong>de</strong>s Missingsch, eines<br />
Hoch<strong>de</strong>utschen mit nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utschem Einschlag.<br />
Kulinarische Spezialitäten<br />
Eine <strong>de</strong>r bekanntesten Bremer Spezialitäten ist Kohl und Pinkel. In Bremen wird <strong>de</strong>r Grünkohl als „Braunkohl“ bezeichnet, weil die regional angebaute Kohlsorte rote Pigmente in <strong>de</strong>n<br />
Blättern hat. Deshalb erhält <strong>de</strong>r Kohl durch das Kochen eine bräunliche Färbung und schmeckt würziger.<br />
Ein beliebtes Bremer Wintergebäck ist <strong>de</strong>r Klaben. Dieses „urbremische Gebäck“ ist ein schwerer Stollen, das Wort „Klaben“ weist auf die gespaltene Form hin. Er wird <strong>zu</strong>meist Anfang<br />
Dezember gebacken, und zwar in solchen Mengen, dass er bis Ostern reicht. Im Gegensatz <strong>zu</strong>m Stollen wird Klaben nach <strong>de</strong>m Backen nicht mit Butter bestrichen und ge<strong>zu</strong>ckert.<br />
Weitere beliebte Süssigkeiten sind Bremer Babbeler (ein langes Lutschbonbon) und Bremer Kluten (Zucker mit Pfefferminz und Schokola<strong>de</strong>).<br />
Persönlichkeiten<br />
Ehrenbürger<br />
Zu <strong>de</strong>n bekanntesten Ehrenbürgern <strong>de</strong>r Stadt Bremen gehören u. a. <strong>de</strong>r Reichskanzler Otto von Bismarck, <strong>de</strong>r Verleger Anton Kippenberg, <strong>de</strong>r Nachkriegspräsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats Wilhelm<br />
Kaisen und <strong>de</strong>r Dichter, Übersetzer und Architekt Rudolf Alexan<strong>de</strong>r Schrö<strong>de</strong>r. Zuletzt wur<strong>de</strong>n am 6. September 2005 Annemarie Mevissen und Barbara Grobien ausgezeichnet.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt Bremen<br />
Als Bremer weit über ihren Geburtsort hinaus bekannt gewor<strong>de</strong>n sind (Alphabetisch geordnet)<br />
• <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>spräsi<strong>de</strong>nt Karl Carstens<br />
• <strong>de</strong>r Manager Klaus Kleinfeld<br />
• <strong>de</strong>r Kabarettist Piet Klocke<br />
• <strong>de</strong>r Geiger Georg Kulenkampff<br />
• <strong>de</strong>r Schauspieler und Fernsehmo<strong>de</strong>rator Hans-Joachim Kulenkampff<br />
• <strong>de</strong>r Bandlea<strong>de</strong>r, Komponist und Musikproduzent James Last (Hans Last)<br />
• <strong>de</strong>r Kolonialkaufmann Franz Adolf Eduard Lü<strong>de</strong>ritz<br />
• <strong>de</strong>r Pastor Joachim Nean<strong>de</strong>r<br />
• <strong>de</strong>r Astronom und Mathematiker Wilhelm Olbers (1758–1840)<br />
• <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>nsnobelpreisträger Ludwig Quid<strong>de</strong>
• <strong>de</strong>r Schriftsteller und Musiker Sven Regener<br />
• <strong>de</strong>r Afrikaforscher Gerhard Rohlfs<br />
• <strong>de</strong>r Verleger Ernst Rowohlt<br />
• die Fernsehmo<strong>de</strong>ratorin Bärbel Schäfer<br />
• <strong>de</strong>r ehemalige Bun<strong>de</strong>sumweltminister Jürgen Trittin<br />
• <strong>de</strong>r Designer Wilhelm Wagenfeld<br />
Sonstiges<br />
• Robinson Crusoe ist <strong>de</strong>r berühmteste Bremer in <strong>de</strong>r Weltliteratur: Daniel Defoe lässt nämlich in seinem erstmals 1719 erschienenen Reisebericht <strong>de</strong>n 1632 geborenen Robinson<br />
Crusoe schreiben: „My Father being a foreigner of Bremen, who settled first at Hall: He got a good Estate by Merchandise“; In York heiratete er eine Robinson aus einer sehr<br />
guten Familie „and from whom I was called Robinson Kreuznaer; But by the usual Corruption of Words in England, we… write our name Crusoe.“<br />
• Der amerikanische Weltbestseller-Autor Mario Puzo („Der Pate“) hat auch einen Bremen-Roman geschrieben: „The Dark Arena“, London (Heinemann) 1973, <strong>de</strong>r Bremen unter<br />
amerikanischer Besat<strong>zu</strong>ng mit Schwarzhan<strong>de</strong>l u. a. schil<strong>de</strong>rt.<br />
Literatur<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-X.<br />
• Werner Kloos: Bremer Lexikon. Ein Schlüssel <strong>zu</strong> Bremen. Bremen 1980, 378 S. o. Abb., ISBN 3-920699-31-9.<br />
• Bae<strong>de</strong>kers Bremen Bremerhaven. Stadtführer. Ostfil<strong>de</strong>rn-Kemnat / München 1992, 126 S. m. 13 Karten u. Plänen u. 28 Zeichnungen, ISBN 3-87954-060-8.<br />
• Hanswilhelm Haefs: Siedlungsnamen und Ortsgeschichten aus Bremen. Anmerkungen <strong>zu</strong>r Geschichte von Hafenstadt und Bun<strong>de</strong>sland Bremen sowie <strong>de</strong>s Erzbistums<br />
einschließlich Holler-Kolonieen. Nor<strong>de</strong>rstedt 2006, ISBN 3-8334-2313-7.<br />
• Claudia Dappen und Peter Fischer (Illustrationen): Bremen ent<strong>de</strong>cken & erleben. Das Lese-Erlebnis-Mitmachbuch für Kin<strong>de</strong>r und Eltern. Bremen 2006, 112 S. m. zahlr. Abb.,<br />
ISBN 3-86108-565-8.<br />
• Ra<strong>de</strong>k Krolczyk und Jörg Sun<strong>de</strong>rmeier: „Bremenbuch“. Verbrecher Verlag, Berlin 2007.<br />
• Konrad Elmshäuser: Geschichte Bremens. Verlag C.H.Beck, München 2007, ISBN 3-406-55533-0.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Statistisches Lan<strong>de</strong>samt Bremen - Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung (monatlich)<br />
2. ↑ Quelle und Zeitangabe <strong>zu</strong> ergänzen!<br />
3. ↑ Laut amtlichen Angaben von Geoinformation Bremen http://www.xxx<br />
4. ↑ Klimadaten Nie<strong>de</strong>rsachsen und Bremen - Mittlerer Nie<strong>de</strong>rschlag (1961-1990) - Jahr. Im Einzelnen nannten die Messstationen Bremen Farge 638,8 mm; Bremen (Flgh) 693,8;<br />
Mittelsbüren 700,2; Ritterhu<strong>de</strong>r Heerstr. 700,9; Bürgerpark 712,8; Blumenthal 719,1; Warturmer Heerstr. 719,6; Bayernstr. 722,5; Osterholz 740,2; Strom 753,2 mm.<br />
5. ↑ klimanews<br />
6. ↑ Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verfassungs- und Rechtsgeschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 313 ff..<br />
7. ↑ Son<strong>de</strong>rausgabe Nordsee-Zeitung „150 Jahre Bremerhaven“ Juni 1977<br />
8. ↑ Bremerhaven Online<br />
9. ↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, 2003, ISBN 3-86108-693-X, S. 442.<br />
10.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, 2003, ISBN 3-86108-693-X, S. 443.
11.↑ Alfred Gottwald, Diana Schulle: Die Ju<strong>de</strong>n<strong>de</strong>portationen aus <strong>de</strong>m Deutschen Reich 1941–1945. Wiesba<strong>de</strong>n 2005, ISBN 3-86539-059-5, S. 95.<br />
12.↑ Wegen <strong>de</strong>s Kommunalwahlrechts für Bürger <strong>de</strong>r Europäischen Union können sich jedoch minimale Unterschie<strong>de</strong> in Umfang und Beset<strong>zu</strong>ng zwischen Lan<strong>de</strong>s- und<br />
Kommunalparlament ergeben.<br />
13.↑ * Internationale Beziehungen. Senatskanzlei Bremen, abgerufen am 31. Oktober 2009.<br />
14.↑ Laut amtlichen Angaben http://www.xxx<br />
15.↑ Nationaler Radverkehrsplan – Aktuelle Stän<strong>de</strong> in Sachen Radverkehr<br />
16.↑ Bremen Marketing: Parks in Bremen; Bremen 2008<br />
17.↑ Grünanlage an <strong>de</strong>r Piepe (PDF). Stand: 22. Februar 2006. Stadtgrün Bremen. Abgerufen am 25. Juni 2009.<br />
18.↑ Homepage <strong>de</strong>r „Freun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bremer Straßenbahn e.V.“<br />
19.↑ EKD 2007 in Fischer Weltalmanach 2008, Seite 139<br />
20.↑ Bremer Stadtplan <strong>de</strong>r Religionen<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Bremen<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen ist von <strong>de</strong>r Hanse, vom Han<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>r Seefahrt sowie vom Streben nach Selbständigkeit geprägt.<br />
Ursprünge<br />
Gelän<strong>de</strong>situation<br />
Das ältere Bremen liegt auf einem von Nordwest nach Südost verlaufen<strong>de</strong>n zirka 11 km langen Dünen<strong>zu</strong>g, <strong>de</strong>r von Bremen Burg bis Mahndorf und bis <strong>zu</strong>r Achimer Geest reicht und <strong>de</strong>r<br />
beim Bremer Domshof eine Höhe von 13,2 m ü. NN hat. Nördlich <strong>de</strong>r Lesum befin<strong>de</strong>t sich an <strong>de</strong>r Lesum und Weser mit <strong>de</strong>r Vegesacker und <strong>de</strong>r Rekumer Geest ein Geestrücken, <strong>de</strong>r von<br />
Burglesum bis Rekum reicht. Weitere eiszeitliche Geestfläche sind die Huchtinger Geest mit einer maximalen Höhe am Hohen Horst von 5,5 m ü. NN, eine sandig-kiesige Kuppe in<br />
Habenhausen mit 4,7 m ü. NN und <strong>de</strong>r Hexenberg bei Borgfeld. Zwischen diesen höheren Zonen befin<strong>de</strong>n sich im so genannten Bremer Becken mit durchschnittlichen Höhen um 3,3 m<br />
ü. NN (<strong>de</strong>rzeitige durchschnittliche Höhe <strong>de</strong>r Weser bei Bremen-Mitte) die Marschenlandschaft <strong>de</strong>r Bremer Wesermarsch und <strong>de</strong>r Weser-Aller-Aue (bei<strong>de</strong> links <strong>de</strong>r Weser), das<br />
Blockland, die Borgfel<strong>de</strong>r Wümmenie<strong>de</strong>rung und im Bereich Osterholz, Oberneuland und Borgfeld eine Wesersandterrasse.<br />
Frühe Besiedlungen<br />
Es kann angenommen wer<strong>de</strong>n, dass auch im Bremer Raum Nean<strong>de</strong>rtaler aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Pleistozäns, also vor 150.000 bis 30.000 Jahren in <strong>de</strong>r Altsteinzeit, als Jäger und Sammler das
Gebiet aufgesucht haben. Erst in <strong>de</strong>r Jungsteinzeit, im Neolithikum, seit rund 25.000 bis 3000 Jahre v. Chr. breitet sich die Kultur sesshafter Bauern aus.<br />
Fun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Steinzeit<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n früheren Jahrtausen<strong>de</strong>n unterschiedlichen Wasserhöhen <strong>de</strong>r Weser und seiner Nebenflüsse konnten weitgehend nur auf <strong>de</strong>n geestigen Gebieten steinzeitliche Fun<strong>de</strong><br />
nachgewiesen wer<strong>de</strong>n. Durch Weserbaggerfun<strong>de</strong> vor Bremen-Mitte und Blumenthal gibt es Steinwerkzeuge aus <strong>de</strong>r mittleren Altsteinzeit (Mittelpaläolithikum). Durch Lesefun<strong>de</strong> im<br />
Bremer Dünen<strong>zu</strong>g sind mittelsteinzeitliche Schlagplätze, Kernbeile o<strong>de</strong>r ein Scheibenbeil belegt. Einige Fun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Jungsteinzeit, <strong>de</strong>r Kupfersteinzeit und <strong>de</strong>r Bronzezeit belegen erste<br />
Besiedlungen aus dieser Zeit auf <strong>de</strong>n etwas höher gelegenen Flächen von Bremen.[1]<br />
Eisenzeit<br />
Um 650 v. Chr. verbreitet sich die Eisenzeit in <strong>de</strong>n Nord<strong>de</strong>utschen Raum zwischen Weser, Elbe und westlichem Holstein. Fun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Jastorfkultur von etwa 600 v. Chr. bis <strong>zu</strong>r<br />
Zeitenwen<strong>de</strong> sind nachgewiesen. Die Verhältnisse von Wirtschaft und Kultur verän<strong>de</strong>rn sich stark. Um 250 v. Chr. dringen Sachsen in diesen Raum und vermischen sich mit <strong>de</strong>n bereits<br />
ansässigen Chauken.<br />
Chauken und Sachsen<br />
Aber erst ab 100 v. Chr. fin<strong>de</strong>t für die Siedler in diesem Bereich <strong>de</strong>r Begriff Nordseegermanen Verwendung, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen die Angeln, Chauken, Friesen, Sachsen und Warnen gehören. Sie<br />
bil<strong>de</strong>ten später – etwa ab 300 n.Chr. – <strong>de</strong>n Großstamm <strong>de</strong>r Sachsen.<br />
Im Gebiet um Bremen sie<strong>de</strong>lte um die Zeitenwen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r germanische Stamm <strong>de</strong>r Chauken. Ab <strong>de</strong>m 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt n. Chr. ist die Bezeichnung Sachsen nachweisbar. Ob sich die Chauken<br />
teils <strong>de</strong>n Sachsen und teils <strong>de</strong>n Friesen angeschlossen haben, o<strong>de</strong>r ob Chauken und Sachsen eventuell verschie<strong>de</strong>ne Bezeichnungen für ein und dasselbe Volk waren, konnte bisher nicht<br />
geklärt wer<strong>de</strong>n.<br />
In Seehausen wur<strong>de</strong>n Reste eines kleinen römischen Flottenstützpunktes ausgegraben, angelegt nach <strong>de</strong>r Varusschlacht.<br />
Zwischen <strong>de</strong>m ersten und <strong>de</strong>m achten Jahrhun<strong>de</strong>rt nach Christus entstan<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r Weser mit ihren verschie<strong>de</strong>n Unterläufen erste Siedlungen, gelegen auf <strong>de</strong>r 20–30 Kilometer langen<br />
Bremer Düne, die Schutz vor Hochwasser und gleichzeitig guten Zugang <strong>zu</strong> einer Furt über <strong>de</strong>n Fluss bot.<br />
Bereits im Jahr 150 n. Chr. erwähnte <strong>de</strong>r alexandrinische Geograph Claudius Ptolemaeus eine dieser Siedlungen (Fabiranum, auch Phabiranum geschrieben). Der spätere Name Bremen –<br />
lateinisch Brema – könnte soviel be<strong>de</strong>uten wie „am Ran<strong>de</strong> liegend“ (altsächsisch Bremo be<strong>de</strong>utet „Rand“ bzw. „Umfassung“) und bezieht sich möglicherweise auf <strong>de</strong>n Rand <strong>de</strong>r Düne.[2]<br />
Der Dünenrücken am rechten Weserufer war im heutigen Bereich <strong>de</strong>s Bremer Doms zirka 10 Meter hoch, steil abfallend <strong>zu</strong>r Balge, die zirka 3 bis 4 Meter über <strong>de</strong>r Weser lag. Die<br />
Siedlung auf <strong>de</strong>m Dünenrücken war <strong>de</strong>shalb vor <strong>de</strong>n häufigeren Überschwemmungen <strong>de</strong>s Bereiches an <strong>de</strong>r Balge gesichert. Fun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Balge, vom Marktplatz und <strong>de</strong>r Domdüne<br />
belegen Siedlungen aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung. Nach <strong>de</strong>m sich eine Fährstelle an <strong>de</strong>r unbesie<strong>de</strong>lten Tiefer (Tiefer = „Tie-vere“ = Fähre <strong>zu</strong>m Tie, also <strong>zu</strong>m Platz o<strong>de</strong>r Thing)<br />
entwickelte wur<strong>de</strong> die Siedlung auf <strong>de</strong>r Düne in <strong>de</strong>r karolingischen Zeit ein Dorf, das als Fähr- und Etappenort vom Durchgangsverkehr lebte, aber <strong>zu</strong>nächst auch noch von <strong>de</strong>r<br />
Viehlandwirtschaft.[3]<br />
Mittelalter<br />
Bremen wird Stadt; von 780 bis 1300<br />
Die erste urkundliche Siedlung<br />
Bremen wird Bischofssitz
Während <strong>de</strong>r mittelalterlichen Christianisierung Nor<strong>de</strong>uropas durch Karl <strong>de</strong>n Großen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Missionar Willehad 780 in die Weserregion geschickt. 782 erwähnte dieser Bremen <strong>zu</strong>m<br />
ersten Mal urkundlich in einem Brief mit <strong>de</strong>n Worten:<br />
„… hat man uns aus Bremen vertrieben und zwei Priester erschlagen …“<br />
Erschlagen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Priester Gerwal und an<strong>de</strong>re, aber 787 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Aufstand nie<strong>de</strong>rgeschlagen und Willehad <strong>zu</strong>m ersten Bischof <strong>de</strong>s Bistums Bremen ernannt. Die Stiftungsurkun<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Bistumsgründung von 788 als zweite Urkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Existenz Bremens entpuppte sich später übrigens als eine Fälschung. Bremen ist <strong>zu</strong> dieser Zeit ein sehr kleiner Ort zwischen <strong>de</strong>m<br />
Wesernebenarm – <strong>de</strong>r Balge (Schiffsfund von 802) – und <strong>de</strong>m Markt. 789 soll <strong>de</strong>r erste Dom aus Holz auf <strong>de</strong>m höchsten Punkt <strong>de</strong>r Düne entstan<strong>de</strong>n sein. Man weihte ihn auf <strong>de</strong>n Namen<br />
<strong>de</strong>s Apostels Petrus, <strong>de</strong>ssen Attribut, <strong>de</strong>r Schlüssel, <strong>zu</strong>m Bremer Wappen gewor<strong>de</strong>n ist. 805 wur<strong>de</strong> das Bistum Bremen <strong>de</strong>m Erzbistum Köln unterstellt. Aufgrund <strong>de</strong>r großen Entfernung<br />
hatten die Bremer aber relativ freie Hand.<br />
Durch die Lage an <strong>de</strong>r Weser etablierte sich Bremen schon bald als Umschlagplatz für friesische Händler, die mit ihren seetauglichen Schiffen an <strong>de</strong>n Küsten und großen Flüssen<br />
han<strong>de</strong>lten. Die Balge diente als natürlicher Hafen. Auch viele aktive und ehemalige Bauern ließen sich nahe <strong>de</strong>r sächsischen Siedlung nie<strong>de</strong>r. Man lebt von <strong>de</strong>r Landwirtschaft, vom<br />
Fischfang, vom Handwerk und vom Han<strong>de</strong>l. Eine Furt o<strong>de</strong>r Fähre ist von strategischer Be<strong>de</strong>utung.<br />
Der Erzbischof von Hamburg, Ansgar, verlegte 848/849, nach <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung Hamburgs durch die Normannen, seinen Sitz nach Bremen, wo <strong>de</strong>r Bischofssitz gera<strong>de</strong> vakant war. Es<br />
entstand das Erzbistum Bremen. Um 850 (an<strong>de</strong>re Quellen um 858) wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste Dom von dänischen Wikingern zerstört. Ansgar ließ danach einen steinernen Dom errichten. Um <strong>de</strong>n<br />
hölzernen wie <strong>de</strong>n steinernen Dom entstand die Domburg mit eigenen Wällen, Gräben, Mauern und Toren. Der Dombezirk blieb viele Jahrhun<strong>de</strong>rte ein geschlossener, selbständiger,<br />
geistlicher Bezirk. Um <strong>de</strong>n Dombezirk entwickelte sich die Siedlung. An <strong>de</strong>r Balge und <strong>de</strong>r Langenstraße entstand <strong>zu</strong><strong>de</strong>m eine dauerhafte Händlersiedlung und mit <strong>de</strong>r Zeit wuchsen bei<strong>de</strong><br />
Siedlungen <strong>zu</strong>sammen.<br />
Um 994 entstand <strong>de</strong>r erste Wall um die Domburg, <strong>de</strong>m 1032 eine erste Stadtmauer folgte.<br />
Markt- und Münzrecht für Bremen<br />
888 erlangte Erzbischof Rimbert vom Kaiser Arnulf von Kärnten das Markt-, Münz- und Zollrecht. Dieser Markt, als periodische Zusammenkunft <strong>de</strong>r Händler, lag als abgesteckte Fläche<br />
westlich vom Dom, also noch nicht an seinem heutigen Ort, da diese Gelän<strong>de</strong> damals noch <strong>zu</strong>r Weser hin ein starkes Gefälle hatte. Er war die Keimzelle <strong>de</strong>r späteren Stadt. Zunächst war<br />
es ein Jahrmarkt, <strong>de</strong>r sich mit <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>m Bedarf dann <strong>zu</strong>m Wochenmarkt entwickelte. Rimbert ließ im 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt die ersten erzbischöflichen bremischen Münzen prägen, jedoch<br />
erst aus <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts sind die ersten Münzen aus Bremen überliefert.<br />
Otto I. stellte die kleine Stadt 937 unter königlichen Schutz und übertrug seinen Grundbesitz in Bremen an <strong>de</strong>n Erzbischof. Er erteilte ihr am 10. August 965 erneut das Markt-, Münz-<br />
und Zollrecht. Drei Jahre später erhielt Bremen die Erlaubnis jährlich zwei Märkte ab<strong>zu</strong>halten; einen acht Tage vor Pfingsten und einen Anfang November. Aus letzterem entwickelte sich<br />
<strong>de</strong>r Bremer Freimarkt.<br />
Der Dom<br />
Vom Bistum Bremen gingen unter <strong>de</strong>n Bischöfen Ansgar, Adaldag und Adalbert wichtige Impulse aus. In <strong>de</strong>n ersten Jahren <strong>de</strong>r Amtszeit von Bischof Adalbrand (auch „Bezelin“ genannt)<br />
(1035 bis 1043) begannen <strong>de</strong>r Umbau <strong>zu</strong>m salischen Dom. Der Bau ist die romanische Kernzelle <strong>de</strong>s heutigen Bremer Doms. Noch vor <strong>de</strong>r Vollendung fiel das Gotteshaus jedoch – wie<br />
auch <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>r übrigen Stadtbebauung – im Jahre 1041 <strong>de</strong>r Feuersbrunst <strong>de</strong>s Bremer Bran<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>m Opfer. Mit <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau, vor allem unter För<strong>de</strong>rung von Erzbischof<br />
Adalbert (1043–1072), wur<strong>de</strong> sofort wie<strong>de</strong>r begonnen.<br />
Gräfin Emma und die Bürgerwei<strong>de</strong><br />
Gräfin Emma von Lesum (um 975–1038) war eine mildtätige Gutsbesitzerin und erste namentlich nachweisbare Bremerin. Um die Stiftung einer Wei<strong>de</strong> im Jahr 1032 geht es in einer <strong>de</strong>r<br />
schönsten Volkssagen <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts: damals wollte sie <strong>de</strong>n Bürgern eine Wiese schenken von <strong>de</strong>r Fläche, die ein Mann in einer Stun<strong>de</strong> umrun<strong>de</strong>n konnte. Ihr Schwager und Erbe,
Herzog Benno von Sachsen erhöhte die Zeit auf einen Tag, aber er suchte einen Mann ohne Beine aus. Der „Krüppel“ aber entwickelte ungeahnte Kräfte und umrun<strong>de</strong>te ein Gebiet,<br />
größer als die heutige Bürgerwei<strong>de</strong>.<br />
Bremen wächst<br />
Eine Feuersbrunst zerstörte 1041 Bremen. Nach <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau folgte in <strong>de</strong>n Jahren 1043 bis 1072 ein wirtschaftlicher Aufschwung unter Erzbischof Adalbert, <strong>de</strong>r insbeson<strong>de</strong>re auf<br />
<strong>de</strong>m Han<strong>de</strong>l mit Norwegen, England und <strong>de</strong>n nördlichen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n sowie mit <strong>de</strong>m Hinterland an <strong>de</strong>r Weser, in Sachsen und Teilen Westfalens beruhte. Bremen wur<strong>de</strong> ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
Han<strong>de</strong>lsort und Warenumschlagplatz und<br />
„gleich Rom namhaft und <strong>zu</strong> einem Sammelpunkt <strong>de</strong>r Völker <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns.“<br />
Aber nicht nur <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l brachte Erfolge. Das sumpfige Land – das Hollerland östlich von Bremen – wur<strong>de</strong> mit Hilfe holländischer Siedler (Vertrag von 1106 mit Privilegien für die<br />
Siedler) entwässert, durch Deiche geschützt und urbar gemacht. Ab 1171 entwickelte sich nach „Hollän<strong>de</strong>rrecht“ auch am linken Weserufer – also in Huchting, Weyhe, Brinkum und im<br />
Stedinger Land – eine stetig wachsen<strong>de</strong> landwirtschaftliche Besiedlung. Bald folgten 1181 u. a. das Blockland, Arsten, Hasbergen, Horn und Oberneuland.<br />
1050 kamen, durch Erzbischof Adalbert geför<strong>de</strong>rt, die ersten Mönche – die Benediktiner – nach Bremen und bauten das Paulskloster vor die Tore <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Die civitas und das Barbarossaprivileg<br />
Das Barbarossaprivileg<br />
Mit <strong>de</strong>m wirtschaftlichen Aufschwung wuchs auch <strong>de</strong>r Einfluss <strong>de</strong>r Bürger in <strong>de</strong>r Stadt. 1139 wur<strong>de</strong> in bischöflichen Urkun<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r civitas geschrieben. Um 1157 wur<strong>de</strong> von einem<br />
Bürgerausschuss als Interessenvertreter <strong>de</strong>r Stadt berichtet. 1186 verbriefte Kaiser Friedrich I. Barbarossa im sogenannten Gelnhauser Privileg das erste bürgerliche Gesetz. Es besagte,<br />
dass nicht mehr die Kirche, son<strong>de</strong>rn nur noch <strong>de</strong>r Kaiser und <strong>de</strong>r Senat Regierungsgewalt über die Stadt ausüben konnten. Bremen war nun formal freie Reichsstadt. Faktisch musste die<br />
Unabhängigkeit <strong>de</strong>n Erzbischöfen noch abgerungen wer<strong>de</strong>n. Erneute Bedrohungen <strong>de</strong>r städtischen Eigenständigkeit in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Absolutismus erfor<strong>de</strong>rten im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Bestätigungen <strong>de</strong>r Reichsunmittelbarkeit wie das Linzer Diplom von 1646, das manchmal irrtümlich für <strong>de</strong>ren Beginn angesehen wird.<br />
Das Gelnhauser Privileg<br />
Das Gelnhauser Privileg von 1186 enthielt <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Klausel Stadtluft macht frei. 1200 trat die Bürgerschaft Bremens dann nach außen in Erscheinung, in<strong>de</strong>m sie mit <strong>de</strong>r Grafschaft<br />
Altena einen Vergleich schloss. In einer als concordia bezeichneten Übereinkunft mit Erzbischof Gerhard I. stehen sich die Stadt und das Erzbistum dann 1217 erstmals gleichberechtigt<br />
gegenüber.<br />
Die Stadtmauer<br />
Aus <strong>de</strong>n ersten Stadtmauern und Schutzwällen von 1032 und 1157 war um 1229 eine <strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong> Stadtmauer – die murus civitatis – gewor<strong>de</strong>n, welche die gesamte Altstadt mit<br />
wenigen Teilen <strong>de</strong>s Stephaniviertels landseitig umfasste. Zur befestigten Stadt gehörte ein Gebiet rechts <strong>de</strong>r Weser, das von <strong>de</strong>r heutigen Hutfilterstraße bis <strong>zu</strong>m Schnoor und <strong>de</strong>n<br />
Wallanlagen reichte. Bereits 1244 führte die erste Brücke über die Weser. Ab 1307 wur<strong>de</strong> in die Stadtmauer <strong>de</strong>r Altstadt auch das restliche Stephaniviertel einbezogen. Die Stadt konnte<br />
landseitig durch Stephanitor, Doventor, Ansgariitor, Her<strong>de</strong>ntor, Ostertor und über die Weser durch das Brückentor erreicht wer<strong>de</strong>n. Viele weitere Tore und Pforten führten <strong>zu</strong><strong>de</strong>m <strong>zu</strong>r<br />
Schlachte o<strong>de</strong>r in das Umfeld. Zwischen Ansgariistadt und Stephanistadt verblieb bis 1657 die vorhan<strong>de</strong>ne Stadtmauer, die durch ein Tor – die Natel – verbun<strong>de</strong>n war. Dieses<br />
Befestigungssystem wur<strong>de</strong> um 1512 bis 1514 verstärkt durch vertiefte Gräben, Erdwälle, Zwingertürme (Auf <strong>de</strong>r Herrlichkeit die so genannte Braut, Ostertor und Stephanitor) und<br />
Kanonenbestückung.[4]<br />
Beginn <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts
Mit seinen 10.000 bis 15.000 Einwohnern war Bremen am Anfang <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts rechtlich und tatsächlich eine Stadt mit Selbstverwaltung, Befestigung und Markt gewor<strong>de</strong>n, in<br />
<strong>de</strong>r die Bürger, die Geistlichen sowie die Einwohner ohne Bürgerrechte lebten.<br />
1220 spannte <strong>de</strong>r Erzbischof Gebhard II. eine Eisenkette über die Weser und verlangte von <strong>de</strong>n Schiffen für die Durchfahrt Abgaben. Die Bremer begehrten aber gegen diese Regelung<br />
auf, sodass sie schnell wie<strong>de</strong>r abgeschafft wur<strong>de</strong>. 1223 ging <strong>de</strong>r hamburgische Erzbischofstitel erneut auf Bremen über. 1225 wur<strong>de</strong>n sieben consules als Rat <strong>de</strong>r Stadt eingesetzt. Der Rat<br />
hatte seine eigenen Siegel, die <strong>de</strong>n eigenen Machtanspruch ver<strong>de</strong>utlichten, auch wenn die Macht <strong>de</strong>s Territorialfürsten, <strong>de</strong>s Erzbischofs, respektiert wur<strong>de</strong>.<br />
1229 wird erstmals ein Rathaus erwähnt, welches Ecke Obernstraße/Sögestraße lag.<br />
Stadtrecht<br />
Anlässlich <strong>de</strong>s Streits mit <strong>de</strong>n Stedinger Bauern bestätigte Erzbischof Gebhard II. Bremen 1233 seine eigenständigen Rechte und das Stadtrecht. Die Stadt entwickelte sich damit<br />
<strong>zu</strong>nehmend <strong>zu</strong> einer vom Stadtherrn unabhängigen Reichsstadt.<br />
Bremen im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Der allgemeine Wohlstand in Bremen wuchs. Das Stephaniviertel wur<strong>de</strong> 1305 in <strong>de</strong>n Stadtmauerring einbezogen.<br />
Rechtsunsicherheit und <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Konflikte zwischen <strong>de</strong>m Rat und <strong>de</strong>n herrschen<strong>de</strong>n Familien mit Grund- und Rentenbesitz – kurz „Geschlechter“ genannt – führten da<strong>zu</strong>, dass von<br />
1303 bis 1308 das Bremer Stadtrecht erstmals kodifiziert, also schriftlich nie<strong>de</strong>rgelegt, und danach ständig erweitert wur<strong>de</strong>. Das Stadtrecht umfasste Bestimmungen über <strong>de</strong>n Rat, über die<br />
Bürgerrechte und <strong>zu</strong> allen Bereichen <strong>de</strong>s Zivil-, Han<strong>de</strong>ls-, Gewerbe- und Strafrechts. Trotz dieser Entwicklung kam es <strong>zu</strong> weiteren Konflikten. 1304 wird mit Arnd von Gröpelingen ein<br />
Mitglied <strong>de</strong>r Oberschicht ermor<strong>de</strong>t. Die „anständigen“ Ratsherren und Bürger vertrieben die „Geschlechter“. 1305 konnte ein für Bremen vorteilhafter Frie<strong>de</strong> erreicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Stadt wird nun in vier Pfarrsprengel geteilt (s.u.). Die angesehenen Familien und Zunftmeister haben die Bürgerrechte. Sie wählen die „Wittheit“ von drei mal zwölf Männern, die<br />
je<strong>de</strong>s dritte Jahr als Rat im Amt waren. Schied ein Ratsmitglied aus wählte die Wittheit einen Nachfolger. Um 1330 wur<strong>de</strong>n die auf Lebenszeit gewählten Ratsmitglie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einer<br />
exklusiven Gruppe. Jahrelang fan<strong>de</strong>n keine Neuwahlen statt und die Anzahl <strong>de</strong>r Ratsherren reduzierte sich drastisch. Man einigte sich über die Vorausset<strong>zu</strong>ngen, unter <strong>de</strong>nen sich<br />
Anwärter um das Amt eines Ratsmitglie<strong>de</strong>s bewerben konnten:<br />
„Freie und eheliche Geburt, ein Min<strong>de</strong>stalter von vierundzwanzig Jahren, Besitz von Stadtgrundwert in <strong>de</strong>r Min<strong>de</strong>sthöhe von zweiunddreißig Mark, die Möglichkeit, <strong>de</strong>m Amt<br />
ein Pferd im Werte von drei Mark <strong>zu</strong>r Verfügung <strong>zu</strong> stellen sowie <strong>zu</strong>r Abtragung von städtischer Rentenschuld eine Mark ein<strong>zu</strong>zahlen“.<br />
Hoyaer Feh<strong>de</strong><br />
Die Erzbischofsfeh<strong>de</strong> von 1348 bis 1350 mit <strong>de</strong>r Doppelwahl von Gottfried von Arnsberg (<strong>de</strong>r später Erzbischof wur<strong>de</strong>) und Graf Moritz von Ol<strong>de</strong>nburg führte <strong>zu</strong> Krieg und Unruhen.<br />
Da<strong>zu</strong> erreichte um 1350 Bremen die Pest. Ihr erlagen angeblich allein in einem Jahr 7.000 Menschen bei einer Einwohnerzahl von ca. 15.000. Unmittelbar danach folgte die Hoyaer<br />
Feh<strong>de</strong> von 1351 bis 1359 mit bremischen Nie<strong>de</strong>rlagen und Kosten für die Gefangenenauslösungen. Bremen war pleite. Hohe Vermögenssteuern waren danach erfor<strong>de</strong>rlich. Zu dieser Zeit<br />
führte 1358 die Hanse einen Boykott gegen Flan<strong>de</strong>rn durch. Bremen, damals zwischenzeitlich nicht Mitglied <strong>de</strong>r Hanse und finanziell durch die Hoyaer Feh<strong>de</strong> geschwächt, musste<br />
<strong>de</strong>shalb in Lübeck sehr <strong>de</strong>mütig um Wie<strong>de</strong>raufnahme in die Hanse bitten und sodann <strong>de</strong>n Flan<strong>de</strong>rn-Boykott und Hamburg bei <strong>de</strong>r Bekämpfung <strong>de</strong>r Seeräuber in <strong>de</strong>r Elbe unterstützen.<br />
Der Aufstand von 1365 bis 1366<br />
Von <strong>de</strong>n 15.000 Einwohnern <strong>de</strong>r Stadt waren nur die wenigsten auch Bürger. Eine kleine Oberschicht von etwa 30 Familien beherrschte die wirtschaftlichen Grundlagen. Sie stellten ein<br />
Ratsdrittel. Das Ratsherrenamt behielten sie lebenslänglich. Auch die an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n „Ratsdrittel“, die Wittheit und die Meenheit waren gut situierte Bürger. Die Pest, die Hoyaer Feh<strong>de</strong><br />
und die <strong>de</strong>shalb erfor<strong>de</strong>rliche kostspielige Auslösung von Gefangenen verschärften die sozialen Spannungen.<br />
Im sogenannten Bannerlauf protestierten im September 1365 einige Handwerker (16–18) aus <strong>de</strong>m Ratsdrittel <strong>de</strong>r Meenheit – das Bremer Banner tragend gegen die ungerechte Verteilung
<strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rlichen hohen Geldzahlungen. Sie drangen in einige Häuser von Ratsherren und <strong>de</strong>s Bürgermeisters Albert Donel<strong>de</strong>y und beschimpften diese als „Verräter und Hurensöhne“.<br />
Im Gegen<strong>zu</strong>g wur<strong>de</strong>n die Führer <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>m To<strong>de</strong> verurteilt, ihr Eigentum eingezogen und ihre Frauen und Kin<strong>de</strong>r verbannt. Die meisten <strong>de</strong>r Aufständischen konnten jedoch<br />
entkommen.[5]<br />
1365 versuchte Erzbischof Albert II. von Braunschweig-Lüneburg die Stadt <strong>zu</strong> beherrschen mit Hilfe dieser ausgewichenen Handwerker als Bürgerpartei. In <strong>de</strong>r Nacht vom 28. auf <strong>de</strong>n<br />
29. Mai 1366 jedoch überrumpelten geflohene Aufrührer mit Hilfe <strong>de</strong>r Kriegsknechte <strong>de</strong>s Erzbischofs die Stadt. Die Kriegsknechte verbrannten <strong>de</strong>n noch hölzernen Roland, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m<br />
Marktplatz stand. Einige Wittheitsmitglie<strong>de</strong>r und Ratsmitglie<strong>de</strong>r flohen nach Delmenhorst. Die von <strong>de</strong>r Hanse geächteten Aufrührer regierten die Stadt nur kurzzeitig. Eine Neuordnung<br />
<strong>de</strong>r Ratswahlen wur<strong>de</strong> eingeführt, bei <strong>de</strong>r die Gruppe <strong>de</strong>r Meenheit – die einfachen Handwerker – und die <strong>de</strong>r Zünfte dominieren sollten. Der neue Rat konnte nicht <strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rlichen<br />
Rückhalt <strong>de</strong>r Bürger erwerben. Am 24. Juni ächtete die Hanse <strong>de</strong>n neuen Rat als „Verräter“, um die Rechte <strong>de</strong>r freien Stadt gegenüber <strong>de</strong>m Erzbischof <strong>zu</strong> stärken. Die ausgewichenen<br />
alten Ratsherren konnten mit Hilfe von Konrad II. von Ol<strong>de</strong>nburg am 27. Juni 1366 Bremen <strong>zu</strong>rück erobern und diesen sozialen Aufstand been<strong>de</strong>n. Die „Verräter“ wur<strong>de</strong>n im<br />
Kampfgetümmel erschlagen, o<strong>de</strong>r danach, erhängt, geköpft o<strong>de</strong>r gerä<strong>de</strong>rt. Der <strong>zu</strong>rückgekehrte Rat restaurierte die alten Machtansprüche <strong>de</strong>r Oberschichten und arrangierte sich mit <strong>de</strong>n<br />
Zünften.<br />
Nachbetrachtung: Das Bündnis <strong>de</strong>r Meenheit mit <strong>de</strong>m Bischof führte zwar da<strong>zu</strong>, dass die einfacheren Handwerker im Rat angemessen vertreten waren, aber nur für <strong>de</strong>n Preis einer<br />
Unterordnung <strong>de</strong>r Stadt unter <strong>de</strong>n Bischof, also <strong>zu</strong> Lasten <strong>de</strong>r Reichsfreiheit. Nach diesen Krisen hat sich Bremen gut erholt und eine aktive Machtpolitik verfolgt mit territorialen<br />
Zugewinnen.<br />
Kirchen und Klöster im Mittelalter<br />
Das römisch-katholische Bistum Bremen bestand von 787 bis 1648. Es war ein Suffragan von Köln, wur<strong>de</strong> dann aber selbst Metropolit. Die Resi<strong>de</strong>nz war <strong>zu</strong>nächst Bücken, dann Burg<br />
Vör<strong>de</strong>, (heute Bremervör<strong>de</strong>). In Bremen blieb nur die Domfreiheit unter erzbischöflicher Hoheit. Nach <strong>de</strong>r Reformation ab 1566 konnte man von einem evangelischen Erzstift sprechen.<br />
Die Stadt Bremen blieb im Gegensatz <strong>zu</strong>m lutherischen Territorium <strong>de</strong>s Erzbistums calvinistisch. Aus <strong>de</strong>m weltlichen Besitz <strong>de</strong>s Bistums, <strong>de</strong>m „Stift“, wur<strong>de</strong> das Herzogtum Bremen,<br />
welches das Elbe-Weser-Dreieck umfasste.<br />
Der Bremer Dom<br />
789 entstand <strong>de</strong>r erste Dom aus Holz. Man weihte ihn auf <strong>de</strong>n Namen <strong>de</strong>s Apostels Petrus. Die Arbeiten am salischen Dom, <strong>de</strong>r romanischen Kernzelle <strong>de</strong>s heutigen Doms, begannen<br />
unter Erzbischof Bezelin (1035–1043). Seit 1223 war <strong>de</strong>r Dom Metropolitankathedrale. Durch Umbauten erhielt die dreischiffige Hallenkirche ein gotisches Rippengewölbe, eine<br />
Doppelturmfassa<strong>de</strong> mit Rosenfenster, und die Seitenschiffe sowie Ost- und Westchor erhielten eine gotische Gestaltung. Um 1500 wur<strong>de</strong> unter Erzbischof Johann III. Ro<strong>de</strong> von Wale das<br />
nördliche Seitenschiff <strong>de</strong>s Bremer Doms durch einen großen Saal mit Netzgewölbe ersetzt.<br />
Die Pfarrkirche Unser Lieben Frauen<br />
Sie wur<strong>de</strong> nordwestlich <strong>de</strong>s Marktplatzes <strong>zu</strong>nächst im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichtet und ab 1229 <strong>zu</strong>r frühgotischen Hallenkirche umgebaut. Sie war die Kirche <strong>de</strong>s Rates, später auch<br />
Garnisonkirche. Die romanische Krypta stammt noch von <strong>de</strong>r früheren St.-Veit-Kirche von 1013 bis 1029. Die Westfassa<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> 1881 historisierend restauriert und <strong>de</strong>r Turmhelm 1964<br />
nach Plänen von Dieter Oesterlen auf <strong>de</strong>n Nordturm gesetzt.<br />
Die St.-Martini-Kirche<br />
Sie wur<strong>de</strong> 1229 in <strong>de</strong>r Altstadt an <strong>de</strong>r Weser als frühgotische dreischiffige Basilika errichtet und 1384 <strong>zu</strong>r spätgotischen Hallenkirche umgebaut. 1944 erlitt <strong>de</strong>r Backsteinbau schwerste<br />
Zerstörungen, die in <strong>de</strong>n 1950er Jahren beseitigt wur<strong>de</strong>n.<br />
Die St.-Ansgarii-Kirche<br />
Sie wur<strong>de</strong> ab 1227 bis 1250 als frühgotische Basilikakirche gebaut und im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>r Hallenkirche umgewan<strong>de</strong>lt. Sie ist nach ihrer Zerstörung von 1944 nicht erhalten. Ein
Denkmal erinnert an die Kirche. Die St.-Ansgarii-Kirchgemein<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich heute in Schwachhausen.<br />
Die Pfarrkirche St. Stephani<br />
Sie wur<strong>de</strong> um 1050 von Erzbischof Adalbert von Bremen vor <strong>de</strong>n westlichen Toren <strong>de</strong>r Stadt gegrün<strong>de</strong>t und 1139 <strong>zu</strong>r Stifts- und Pfarrkirche erhoben. Die dreischiffige romanische<br />
Basilika wur<strong>de</strong> En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>r hochgotischen Hallenkirche umgebaut. Die Pfarrkirche wur<strong>de</strong> 1944 stark beschädigt und nur das Mittelschiff zwischen 1947 und 1959<br />
erneuert.<br />
Die Kirche St. Johann<br />
Die Johanneskirche ist heute noch eine katholische Propsteikirche. Sie wur<strong>de</strong> im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt beim heutigen Schnoor als Klosterkirche <strong>de</strong>s Franziskaneror<strong>de</strong>ns erbaut; <strong>zu</strong>nächst als<br />
Basilika, bald danach neu als dreischiffig gewölbte Hallenkirche. Sie ist ein prägnanter Vertreter <strong>de</strong>r Backsteingotik.<br />
Pfarrsprengel<br />
Die Kirche teilte sich im 13. Jh. in vier Pfarrsprengel auf: Liebfrauen, Stephani, Angarii und Martini. Seit 1050 waren die Benediktiner in Bremen. 1225 kamen die Dominikaner und die<br />
Franziskaner und 1230 die Deutschen Or<strong>de</strong>nsritter nach Bremen.<br />
Klöster<br />
Die Klöster in Bremen sind nicht erhalten. Historisch gab es in Bremen das Benediktiner-Kloster St. Paul von 1050 bis 1523, das Dominikaner-Kloster St. Katharinen von 1253 bis 1528,<br />
das Franziskaner-Kloster St. Johannis von 1258 bis 1528 und die Komturei <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns von 1230 bis 1564. Bauliche Reste <strong>de</strong>r Klosterbauten sind erhalten vom<br />
Katharinenkloster unter <strong>de</strong>r gleichnamigen Hochgarage, die Kirche St. Johannis vom Franziskanerkloster und von <strong>de</strong>r Komturei ein Teil <strong>de</strong>r Unterkirche im Gerichtsgebäu<strong>de</strong>.<br />
Bremen und die Hanse<br />
Bremen war vier Mal Mitglied <strong>de</strong>r Hanse.[6] Insgesamt summiert sich die Mitgliedszeit auf 252 Jahre. Die einzelnen Mitgliedszeiten:<br />
• 1260–1285<br />
• 1358–1427<br />
• 1438–1563<br />
• 1576–1669<br />
Die erste Mitgliedschaft en<strong>de</strong>te nach nur 25 Jahren. Der Grund dafür war ein Konflikt zwischen <strong>de</strong>n bremischen Kaufleuten, welche weiterhin ein Interesse an <strong>de</strong>m seit <strong>de</strong>m 11.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt vorherrschen<strong>de</strong>n Nord-Süd-Han<strong>de</strong>lsverkehr hatten, und <strong>de</strong>n Hansestädten an <strong>de</strong>r Ostsee. Die wendische Städteversammlung hatte in Wismar eine Blocka<strong>de</strong> Norwegens<br />
beschlossen, um <strong>de</strong>n West-Ost-Han<strong>de</strong>l <strong>zu</strong> stärken. Bremer Kaufleute verweigerten sich diesem Beschluss. Daraufhin wur<strong>de</strong> Bremen aus <strong>de</strong>r Hanse ausgeschlossen.<br />
Ein weiterer Grund <strong>de</strong>r Schwierigkeiten Bremens mit <strong>de</strong>r Hanse war sein lasches Vorgehen gegenüber Seeräubern. Bremen wollte seine Beziehungen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Friesen Butjadingens nicht<br />
ver<strong>de</strong>rben in <strong>de</strong>r Hoffnung, die territoriale Herrschaft über das Land an <strong>de</strong>r Wesermündung <strong>zu</strong> gewinnen.<br />
In einer Schwächeperio<strong>de</strong> Bremens wur<strong>de</strong> die Stadt 1358 gezwungen wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Hanse bei<strong>zu</strong>treten (s.o.). Bremens Interesse an <strong>de</strong>r Hanse war oft sehr eigennützig. Hatten die Kaufleute<br />
Vorteile durch <strong>de</strong>n Städtebund, nutzten sie ihn, machten aber auch gerne Geschäfte, die <strong>de</strong>n Interessen <strong>de</strong>r Hanse entgegenstan<strong>de</strong>n. Aber bei <strong>de</strong>n Hanse-Versammlungen in Lübeck<br />
for<strong>de</strong>rte Bremen immer – oft erfolglos – einen hohen Rang.<br />
1427 wur<strong>de</strong> Bremen aus <strong>de</strong>r Hanse ausgeschlossen, nach<strong>de</strong>m Bürgermeister Herbort Duckel 1425 auf Grund innerer Unstimmigkeiten wegen bremischer Anleihen aus Bremen floh und<br />
die Hanse gegen Bremen mobilisieren konnte. 1438 wur<strong>de</strong> Bremen wie<strong>de</strong>r in die Hanse aufgenommen. Es nahm an <strong>de</strong>n Kaperkriegen gegen Burgund – wo<strong>zu</strong> auch Holland gehörte – teil
und schloss 1446 Frie<strong>de</strong>n mit Burgund. Zwischen 1449 und 1530 fan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r nun hoch geachteten Hansestadt sechs hanseatische „Tagfahrten“ (Fahrten um <strong>zu</strong> tagen, also um <strong>zu</strong><br />
verhan<strong>de</strong>ln) statt, zwei davon, 1493 und 1494 als Hansetag aller Mitglie<strong>de</strong>r. Der Han<strong>de</strong>l bremischer Kaufleute mit u. a. Getrei<strong>de</strong>, Fisch, Stein, Holz und Bier orientierte sich auf die<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, England, Norwegen, die Oberweser, Westfalen aber auch auf die Ostseestädte. Der Machtverlust <strong>de</strong>r Hanse begann mit <strong>de</strong>m Erstarken <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sherrlichen<br />
Territorialgewalten im Ostseeraum. Auch musste die Hanse 1441 die wirtschaftliche Gleichberechtigung <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r anerkennen. Die Hanse verlor weiter an Be<strong>de</strong>utung, da sich<br />
durch die Ent<strong>de</strong>ckung Amerikas 1492 neue Han<strong>de</strong>lsmöglichkeiten erschlossen.<br />
Die Bremer Bergenfahrergesellschaft erstarkte mit <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Bergenfahrt <strong>de</strong>r Wendischen Hansestädte unter Führung Lübecks. Beginnend um die Mitte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
stieg Bremen im Bergener Kontor Bryggen <strong>zu</strong>r neuen Führungsmacht auf.<br />
Von 1563 bis 1576 war Bremen wegen <strong>de</strong>s Religionsstreites zwischen orthodoxen Lutheranern und Reformierten wie<strong>de</strong>r einmal von <strong>de</strong>r Hanse ausgeschlossen wor<strong>de</strong>n. (s. bei von Büren)<br />
Mit Beginn <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts war <strong>de</strong>r stolze und mächtige Städtebund <strong>de</strong>r Hanse nur noch <strong>de</strong>m Namen nach ein Bündnis. Der Dreißigjährige Krieg, 1618–1648, brachte die völlige<br />
Auflösung. Auf <strong>de</strong>n Hansetagen 1629 und 1641 wur<strong>de</strong>n Hamburg, Bremen und Lübeck beauftragt, das Beste <strong>zu</strong>m Wohle <strong>de</strong>r Hanse <strong>zu</strong> wahren.<br />
Das Fahrwasser <strong>de</strong>r Weser erlaubte oft nicht, dass die Koggen bis Bremen fahren konnten. Sie wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>shalb im Blexer Tief o<strong>de</strong>r bei Brake in Eken (Weserschiffe) umgela<strong>de</strong>n und an<br />
<strong>de</strong>r Schlachte o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Balge (Wesernebenarm) entla<strong>de</strong>n. Koggen hingegen wur<strong>de</strong>n in Bremen gebaut. Aus <strong>de</strong>m Jahr 1380 stammt das Wrack einer Hanse-Kogge, das verhältnismäßig<br />
gut erhalten 1962 bei Hafenerweiterungsarbeiten im Schlamm <strong>de</strong>r Weser gefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> und sich heute im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven befin<strong>de</strong>t.<br />
Die Bremer Han<strong>de</strong>lsflotte hatte um 1560 um die 65 Schiffe mit einer Gesamttragfähikeit von über 4.000 Lasten was etwa 8.000 Tonnen entspricht. Die Anzahl <strong>de</strong>r Schiffe nimmt <strong>zu</strong>m<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jh. auf 107 Schiffe <strong>zu</strong>.[7]<br />
15. und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Zunächst expandierte Bremen. Um 1400 sind Butjadingen, das Stadtland an <strong>de</strong>r linken Wesermündung, die Herrschaft Be<strong>de</strong>rkesa, Lehe, Land Wühr<strong>de</strong>n, Blumenthal, Nie<strong>de</strong>r- und<br />
Obervieland, Huchting, Blockland, Borgfeld und Hollerland bremische Territorien. In <strong>de</strong>n Jahren 1405 bis 1410 entstand auf Initiative <strong>de</strong>s Bürgermeisters Johann Hemeling am Bremer<br />
Marktplatz das gotische Rathaus. Bereits 1404 war ein neuer steinerner Roland errichtet. Er drückte die Befreiung <strong>de</strong>r Bremer von <strong>de</strong>r Macht <strong>de</strong>r Kirche aus. Aus diesem Grund schaute<br />
und schaut er direkt auf das Portal <strong>de</strong>s Domes.Von 1404 bis 1407 baute die Stadt die Frie<strong>de</strong>burg (heute Nor<strong>de</strong>nham) <strong>zu</strong>r Sicherung <strong>de</strong>s Stadtlan<strong>de</strong>s. Durch gefälschte Urkun<strong>de</strong>n sollte<br />
<strong>zu</strong><strong>de</strong>m ein erhöhter Rechtsstatus belegt wer<strong>de</strong>n; Bremen wollte freie Reichsstadt sein, wird es aber erst 1646 (Linzer Diplom). Es hatte sich <strong>zu</strong>r Sicherung <strong>de</strong>r Weserschifffahrt in<br />
Rüstringen gegen verschie<strong>de</strong>ne friesische Häuptlinge und die Grafschaft Ol<strong>de</strong>nburg durchgesetzt. Es war <strong>de</strong>r Höhepunkt Bremens im Mittelalter.<br />
Bald darauf erlebte Bremen machtpolitisch jedoch erhebliche Rückschläge. 1424 wur<strong>de</strong> Bremen von einer Koalition <strong>de</strong>r Rüstringer Friesenhäuptlinge wie<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>n nördlichen linken<br />
Wesergebieten vertrieben. Es kam in Bremen <strong>zu</strong> Unruhen und <strong>zu</strong>m Umsturz. Die Bürgerschaft wählte einen neuen Rat. Bürgermeister Herbort Duckel floh 1425 und mobilisierte die<br />
Hanse, welche Bremen 1427 aus <strong>de</strong>m Städtebund ausschloss. 1428 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb das Stadtrecht neu gefasst mit einem differenzierten Ratswahlrecht, welches die Beteiligung <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong>viertel, Kaufmannsgil<strong>de</strong>, Handwerksämter im Wechselrhythmus festlegte. Aber auch weiterhin konnten nur vermögen<strong>de</strong> Bürger in <strong>de</strong>n Rat gewählt wer<strong>de</strong>n. Der Streit blieb<br />
aber, so dass sogar 1429 bis 1436 die Reichsacht über die Stadt verhängt wur<strong>de</strong>. Schwierige Jahrzehnte folgten.<br />
Ab 1452 beeinträchtigte <strong>de</strong>r Graf Gerd von Ol<strong>de</strong>nburg durch Land- und Seeräuberei <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l. 1464 verloren Bremen und die friesischen Verbün<strong>de</strong>ten ein Gefecht, und <strong>de</strong>r Graf Gerd<br />
versuchte nun Bremen an<strong>zu</strong>greifen. Erst 1474 konnte durch eine Koalition von Fürsten und Städten in einem wechselhaften Krieg bis 1482 <strong>de</strong>r Graf besiegt wer<strong>de</strong>n.<br />
Nach diesen Feh<strong>de</strong>n konnten Bremen und sein Han<strong>de</strong>l sich vorteilhaft entwickeln. Viele reich geschmückte gotische Giebelhäuser entstan<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren hegte <strong>de</strong>r Rat<br />
Pläne, einen Unterweserstaat <strong>zu</strong> schaffen (Dominium Visurgis). Aber diese Bestrebungen waren nicht erfolgreich. Das Stadtland und Butjadingen gingen verloren, das „Pfand“<br />
Landwür<strong>de</strong>n fiel an Ol<strong>de</strong>nburg <strong>zu</strong>rück, die Herrschaft Be<strong>de</strong>rkesa war strittig.<br />
Bremer Kaufmannschaft
Der Bremer Rath bestand aus Kaufleuten, Renteninhabern und Grun<strong>de</strong>igentümern, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen später Juristen hin<strong>zu</strong>kamen.<br />
1451 hatten sich die „Elterleute“ <strong>de</strong>r bremischen Kaufmannschaft eine Sat<strong>zu</strong>ng gegeben. Mit <strong>de</strong>n Statuten für die „kopmann tho Bremen“ begann die organisierte Selbstverwaltung <strong>de</strong>r<br />
bremischen Wirtschaft, aus <strong>de</strong>r dann 1849 die Han<strong>de</strong>lskammer Bremen hervorging. Die Kaufmannschaft hatte ihren Sitz im Schütting (von Schossen = Aufbringen <strong>de</strong>r Steuern). Das<br />
ehemalige Gil<strong>de</strong>- und Kosthaus <strong>de</strong>r Kaufleute befand sich <strong>zu</strong>nächst in <strong>de</strong>r Langenstraße. Es wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Zeitpunkt <strong>de</strong>s Rathausbaues (1405–1410) <strong>zu</strong>m Marktplatz verlegt. Von 1537 bis<br />
1538 ließen die Bremer Kaufleute einen feingliedrigen Renaissance-Neubau errichten. Dieser dritte Schütting ist seit 1849 Sitz <strong>de</strong>r Bremer Han<strong>de</strong>lskammer. 1895/99 erhielt das<br />
Prunkportal ein bremisches Motto, die platt<strong>de</strong>utsche Inschrift: „buten un binnen – wagen un winnen“<br />
Bremer Münzhoheit von 1541 bis 1872<br />
Ursprünglich hatte im Mittelalter seit <strong>de</strong>m 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt nur <strong>de</strong>r Erzbischof das Münzrecht. Die Münzprägeanstalt (kurz auch Münze o<strong>de</strong>r Munte genannt) in Bremen wur<strong>de</strong> ab 1369<br />
vom Erzbischof mehrfach an die Stadt verpfän<strong>de</strong>t. 1469 en<strong>de</strong>te die Münzpfändung an die Stadt. 1541 erhielt auch die Stadt Bremen durch eine Urkun<strong>de</strong> von Kaiser Karl V. das<br />
Münzrecht, also die Befugnis, Bremische Münzen <strong>zu</strong> prägen und in Umlauf <strong>zu</strong> bringen. Grote und Schwaren (<strong>de</strong>r sware = schwere Pfennig) in verschie<strong>de</strong>nen Werten waren trotz<br />
vereinzelter späterer Prägungen von Goldgul<strong>de</strong>n bis 1872 die gängigen bremischen Münzsorten.Reichsmünzordnung aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt geprägt. Am 1. Juli 1872 verlor Bremen<br />
seine Münzhoheit im Zuge <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s Deutschen Kaiserreichs.<br />
Reformation in Bremen<br />
Im Mittelalter bil<strong>de</strong>te das Domgebiet <strong>de</strong>s Erzbischofs eine eigene kirchliche „Immunität“, es war kein Stadtgebiet. Die Pfarrrechte übten die vier Kirchen St. Stephan, St. Ansgarii, St.<br />
Martin und Liebfrauen aus. Da<strong>zu</strong> gab es die Klöster <strong>de</strong>r Dominikaner mit St. Katharinen und <strong>de</strong>r Franziskaner mit St. Johann. Mit Martin Luther aber verän<strong>de</strong>rten sich in Europa die<br />
Glaubensrichtungen radikal. Bis 1521 gab es in dieser Kaufmannstadt keine religiösen Konflikte. Erst 1522 kam <strong>de</strong>r Lutherische Augustinermönch Heinrich von Zütphen durch Bremen<br />
und predigte in <strong>de</strong>r Ansgariikirche. Bei <strong>de</strong>m nun folgen<strong>de</strong>n Streit mit <strong>de</strong>m Erzbischof Christoph schützte <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>n Mönch. Erst 1524 wur<strong>de</strong> er in Dithmarschen als Ketzer verbrannt.<br />
Der lutherische Glaube setzte sich aber <strong>zu</strong>nehmend in Bremen durch.<br />
Der ehemalige Augustinerprior von Antwerpen, Jakob Probst wur<strong>de</strong> um 1524 an Unser-Lieben-Frauen in Bremen berufen, ihm folgte kurze Zeit später Johann Timann. Bremen trat durch<br />
Vermittlung <strong>de</strong>s Herzogs Ernst I. von Braunschweig-Lüneburg 1531 <strong>de</strong>m Schmalkaldischen Bund bei.<br />
1528 wur<strong>de</strong> die freie „Schola Bremensis“ – aus <strong>de</strong>r später das Alte Gymnasium wur<strong>de</strong> – als Lateinschule gegrün<strong>de</strong>t und die bis dahin für die Bildung <strong>zu</strong>ständigen Klosterschulen<br />
aufgelöst. 1562 – <strong>zu</strong>r Zeit Bürgermeisters Daniel von Bürens – erweiterte die Schule ihr Lehrangebot auch für <strong>de</strong>n naturwissenschaftlichen Bereich.<br />
Der Aufstand <strong>de</strong>r 104 Männer war eine Revolte im Jahre 1532, die sich an <strong>de</strong>r Nut<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong> entzün<strong>de</strong>te, wohl aber stark von <strong>de</strong>n I<strong>de</strong>en <strong>de</strong>r Reformation mit <strong>de</strong>r<br />
Gleichberechtigung aller Menschen beeinflusst war. Der Komtur <strong>de</strong>s Deutschritteror<strong>de</strong>ns, von <strong>de</strong>m behauptet wur<strong>de</strong>, er verstecke die Dokumente <strong>de</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong>, und seine Knechte<br />
wur<strong>de</strong>n ermor<strong>de</strong>t. Der Rat wur<strong>de</strong> bedroht mit <strong>de</strong>r „Reise <strong>de</strong>s Komturs“ und gezwungen, ein gewähltes Gremium von 104 Männern an <strong>de</strong>r Regierung <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> beteiligen. Vier<br />
Bürgermeister und sechs Ratsherren zogen nach Be<strong>de</strong>rkesa. Das Domkapitel musste nach Ver<strong>de</strong>n fliehen. Im Dom durfte nur noch evangelisch gepredigt wer<strong>de</strong>n. Die 104 enteigneten<br />
Anfang 1532 schließlich <strong>de</strong>n Schütting. Aber dann zerstritten sich die 104. Schließlich gelang es <strong>de</strong>m Rat, die Macht wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> erlangen. 1532 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sprecher <strong>de</strong>r 104, Johann Dove,<br />
trotz Amnestie unter fa<strong>de</strong>nscheinigen Grün<strong>de</strong>n verurteilt und hingerichtet. 1533 erhielten die Kaufleute ihren Schütting <strong>zu</strong>rück, und 1534 kam es <strong>zu</strong> einer „Neuen Eintracht“ und damit <strong>zu</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r alten rechtlichen Verhältnisse. Der Erzbischof kehrte zwar <strong>zu</strong>rück, aber Bremen blieb <strong>de</strong>r evangelischen Sache mit einer neuen Kirchenordnung verbun<strong>de</strong>n.<br />
Zwischendurch, so<strong>zu</strong>sagen als Episo<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> Bremen 1538/39 von <strong>de</strong>m Seeräuber und Junker Balthasar von Esens bedroht. 1539 führte Bremen einen erfolgreichen Kaperkrieg an <strong>de</strong>r<br />
friesischen Küste; 81 Gefangene wur<strong>de</strong>n hingerichtet. 1540 belagerte ein Bremer Heer <strong>de</strong>n Ort Esens; <strong>de</strong>r Junker starb (seine Rüstung ist im Focke-Museum ausgestellt), und die Gefahr<br />
für die Schifffahrt war beseitigt.<br />
Im Schmalkaldischen Krieg wur<strong>de</strong> auch Bremen tangiert. 1547 drangen die katholischen Kaiserlichen bis vor die verstärkten Festungswälle von Bremen vor, und da die Belagerer<br />
Versorgungsschwierigkeiten hatten, mussten sie sich <strong>zu</strong>rückziehen. Auch eine zweite Belagerung <strong>de</strong>s Herzogs Erich II. <strong>zu</strong> Braunschweig-Lüneburg musste abgebrochen wer<strong>de</strong>n, da ein
Entsatzheer die Kaiserlichen vertrieb.<br />
Ab 1599 wur<strong>de</strong> nach Plänen <strong>de</strong>r Festungsbauer Johan van Rijswijck und Johan van Valckenburgh die Stadt durch Bastionen stärker befestigt (siehe da<strong>zu</strong>: Bremer Stadtmauer) und ab<br />
1623 – <strong>de</strong>r Dreißigjährige Krieg hatte begonnen – wur<strong>de</strong>n die Anlagen links <strong>de</strong>r Weser in <strong>de</strong>r nun entstehen<strong>de</strong>n Bremer Neustadt in Angriff genommen und 1627 vollen<strong>de</strong>t. Erst 1660 bis<br />
1664 konnten die vorhan<strong>de</strong>nen Bollwerksanlagen auf <strong>de</strong>r Altstadtseite mo<strong>de</strong>rnisiert und weiter gebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Zwischen 1547 und 1661 stritten sich in Bremen die „Reformierten“ und die „Lutheraner“ um die neue Glaubensrichtung. Albert Rizäus Har<strong>de</strong>nberg, ein reformierter Prediger, verlor die<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng: die Lutheraner obsiegten <strong>zu</strong>nächst. Bürgermeister Daniel von Büren <strong>de</strong>r Jüngere stand – wenn auch als Teil einer Ratsmin<strong>de</strong>rheit – nach wie vor <strong>zu</strong>r reformierten<br />
Partei. 1562 setzten er und die aufbegehren<strong>de</strong>n Bürger sich gegen die Mehrheit im Rat durch. Diese Ratsmitglie<strong>de</strong>r und fünf weitere Priester verließen Bremen. Sie versuchten Kaiser und<br />
Fürsten gegen Bremen <strong>zu</strong> mobilisieren. Auch wird erneut Bremen 1563 aus <strong>de</strong>r lutheranisch orientierten Hanse ausgeschlossen. 1568 schließlich wur<strong>de</strong> die Augsburger Konfession von<br />
<strong>de</strong>n streiten<strong>de</strong>n Parteien anerkannt. Der Persönlichkeit von Büren gelang dann jedoch die Aussöhnung. 1576 wur<strong>de</strong> Bremen wie<strong>de</strong>r Mitglied <strong>de</strong>r Hanse. Die reformierte Kirchendiziplin<br />
setzte sich um 1580 bis 1586 durch; Bildwerke und Altäre in <strong>de</strong>n Kirchen wur<strong>de</strong>n entfernt.<br />
Im Jahr 1648 kam es dann durch <strong>de</strong>n Westfälischen Frie<strong>de</strong>n endgültig <strong>zu</strong>r Säkularisation <strong>de</strong>s Erzstiftes Bremen, welches als Herzogtum Bremen <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m ebenfalls<br />
säkularisierten Herzogtum Ver<strong>de</strong>n als Territorium Bremen-Ver<strong>de</strong>n an Schwe<strong>de</strong>n kam.<br />
17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Beson<strong>de</strong>rs verdient haben sich Bürgermeister Heinrich Krefting und später sein Neffe und Bremer Syndicus Johann Wachmann <strong>de</strong>r Ältere um eine Weiterentwicklung <strong>de</strong>s Stadtrechtes um<br />
1600 bzw. um 1635 gemacht.<br />
Im 16. Jh. hatte man schon die Befestigungsanlagen um die Altstadt weiter entwickelt. Ab 1602 und dann aber erst von 1660 bis 1664 wur<strong>de</strong> die Befestigung um die Altstadt mit<br />
Wallgräben und Wällen <strong>de</strong>n Festungsbedingungen <strong>de</strong>r Zeit angepasst. 1615 erfolgte <strong>de</strong>r Ausbau von Bastionen am Ostertor. Erst von 1623 bis 1628 wur<strong>de</strong> nach ersten Anregungen <strong>de</strong>s<br />
holländischen Festungsbaumeisters Johann von Rijswijk (1601) und Plänen seines Schülers Johan van Valckenburgh (1614) auch links <strong>de</strong>r Weser die Neustädter Befestigung mit 7<br />
Bastionen erstellt und <strong>de</strong>r Wall mit Wallgraben angelegt und 1664 mit <strong>de</strong>r 8. Bastion auf <strong>de</strong>m Stadtwer<strong>de</strong>r ergänzt.<br />
Die Weser versan<strong>de</strong>te <strong>zu</strong>nehmend. Für die Han<strong>de</strong>lsschiffe <strong>de</strong>r Bremer Kaufleute wur<strong>de</strong> es immer schwieriger, in <strong>de</strong>r Stadtmitte an <strong>de</strong>r Schlachte an<strong>zu</strong>legen.<br />
Von 1619 bis 1623 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb im flussabwärts gelegenen Vegesack von holländischen Konstrukteuren <strong>de</strong>r erste künstliche Hafen Deutschlands angelegt, bezahlt und verwaltet vom<br />
Haus Seefahrt. Seit 1624 erhob für zwei Jahrhun<strong>de</strong>rte Graf Anton Günther von Ol<strong>de</strong>nburg an <strong>de</strong>r Unterweser einen umstrittenen Weserzoll bei Elsfleth. 1638 stürzte <strong>de</strong>r niedrigere<br />
Südturm <strong>de</strong>s Domes ein.<br />
Lateinschule, Gymnasium und Bibliothek<br />
Lateinschule<br />
Mit <strong>de</strong>r Einführung <strong>de</strong>s neuen Glaubens durch die Reformation sollten sich die Obrigkeiten – so die Auffor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Reformators Martin Luther – um die Erziehung und Bildung <strong>de</strong>r<br />
Jugend kümmern.<br />
„Anno 1528 is tho Bremen ein frey Schole angerichtet dorch <strong>de</strong>n erbaren Radt“ – so lautet die Nachricht über die Gründung <strong>de</strong>r Schola Bremensis, <strong>de</strong>r ersten Lateinschule. Die<br />
Gelehrtenschule befand sich in <strong>de</strong>n Räumen <strong>de</strong>s ehemaligen Dominikanerklosters St.- Katharinen. Damit begann die Geschichte <strong>de</strong>s Alten Gymnasiums in Bremen.<br />
1584 erweiterte Christoph Pezel - ein Vertrauter Daniel von Bürens - die Schule um eine Oberstufenklasse als aka<strong>de</strong>mischen Oberbau, eine Vorstufe <strong>zu</strong>m Gymnasium illustre.<br />
Gymnasium illustre
1610 wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r sechsklassigen Basisschule, <strong>de</strong>m Paedagogeum, das darauf aufbauen<strong>de</strong> Gymnasium illustre für ein Hochschulstudium mit <strong>de</strong>n Fakultäten Theologie, Jura, Medizin<br />
und Philosophie eingerichtet. Der Vorläufer <strong>de</strong>r Universität Bremen bestand von 1610 bis 1810.<br />
Bibliotheka Bremensis<br />
1628 hinterließ <strong>de</strong>r Syndicus Gerlach Buxdorff <strong>de</strong>r Stadt seine Bücher. 1646 kaufte <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt die 2000 Bücher und Handschriften <strong>de</strong>s verstorbenen Gelehrten Melchior Goldast.<br />
1660 wur<strong>de</strong> aus diesen Bestän<strong>de</strong>n die Bibliotheka Bremensis, die erste wissenschaftliche, öffentliche Bibliothek im Katharinenkloster eingerichtet; dieses war <strong>de</strong>r Vorläufer <strong>de</strong>r heutigen<br />
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen.<br />
Dreißigjähriger Krieg und seine Folgen<br />
Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) war Bremen am Anfang neutral. Erst 1632 unterstützte Bremen – jedoch ohne Truppenkontingente – die Schwe<strong>de</strong>n. In dieser Zeit (1638) öffnete<br />
Erzbischof Friedrich II., Prinz von Dänemark, <strong>de</strong>r spätere König von Dänemark und Norwegen, <strong>de</strong>n Dom für lutherische Gottesdienste. 1643/44 stieß <strong>de</strong>r schwedische General Hans<br />
Christoph von Königsmarck nach Nor<strong>de</strong>n in die Bistümer Bremen und Ver<strong>de</strong>n vor. Bremen öffnete jedoch nicht seine Tore und <strong>de</strong>r General musste abrücken. In <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>de</strong>s<br />
dreißigjährigen Krieges machte Schwe<strong>de</strong>n Ansprüche auf das Bistum Bremen und das Bistum Ver<strong>de</strong>n geltend, welche Dänemark 1645 im Frie<strong>de</strong>n von Brömsebro abgetreten hatte.<br />
In diesen Jahren gefähr<strong>de</strong>ten die Bremer ihre Reichsunmittelbarkeit, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Rat 1637 <strong>de</strong>m 1635 gewählten Erzbischof Friedrich II. huldigte, einem Mitglied <strong>de</strong>s dänischen<br />
Königshauses. 1637 war die Bestätigung <strong>de</strong>r Privilegien als Freie Reichsstadt durch Kaiser Ferdinand III. noch leicht <strong>zu</strong> erlangen, 1646 (Linzer Diplom) nur gegen eine hohe Gebühr.<br />
Bestrebungen Bremens ihren Machtbereich weserabwärts aus<strong>zu</strong><strong>de</strong>hnen (siehe da<strong>zu</strong>: Dominium Visurgis) misslangen, obwohl ihnen schon vor 1646 Butjadingen und Stadland am linken<br />
Weserufer und Gebiete um Stuckenborstel bis Rotenburg (Wümme) gehörten. Nur die Wümmewiesen und Hemelingen verblieben bei Bremen.<br />
Schon längere Zeit vorher nahmen die Erzbischöfe ihren Aufenthalt <strong>zu</strong>nehmend außerhalb <strong>de</strong>r Stadt, zeitweise in Bücken, schließlich überwiegend in Bremervör<strong>de</strong>. Im Jahr 1648 kam es<br />
dann durch <strong>de</strong>n Westfälischen Frie<strong>de</strong>n endgültig <strong>zu</strong>r Säkularisation <strong>de</strong>s Erzstiftes, welches als Herzogtum Bremen <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m ebenfalls säkularisierten Herzogtum Ver<strong>de</strong>n als<br />
Territorium Bremen-Ver<strong>de</strong>n an Schwe<strong>de</strong>n kam.<br />
Den Ersten Bremisch-Schwedische Krieg von 1654 um die Vorherrschaft im Gebiet <strong>de</strong>s Herzogtums Bremen-Ver<strong>de</strong>n verlor Bremen durch die Kapitulation an <strong>de</strong>r Burger Schanze. Im<br />
Ersten Sta<strong>de</strong>r Vergleich wur<strong>de</strong> am 28. November 1654 been<strong>de</strong>t. Das Kirchspiel Lehe und die Herrschaft Be<strong>de</strong>rkesa sowie die Burger Schanze verblieben bei Schwe<strong>de</strong>n; Vegesack und<br />
Blumenthal verblieben bei Bremen. Schwe<strong>de</strong>n anerkannte nicht die Reichsunmittelbarkeit von Bremen als freie Reichsstadt.<br />
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Bremisch-Schwedischen Krieg erkannte 1666 auch Schwe<strong>de</strong>n die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Stadt Bremen im Frie<strong>de</strong>n von Habenhausen an.<br />
18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Nach <strong>de</strong>m Übergang <strong>de</strong>s Herzogtums Bremen an das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg im Jahr 1715/19 stellte jedoch Kurhannover die Reichsunmittelbarkeit <strong>de</strong>r Stadt Bremen<br />
wie<strong>de</strong>r in Frage. Ab 1733 wur<strong>de</strong> darüber verhan<strong>de</strong>lt. Im Zweiten Sta<strong>de</strong>r Vergleich [8] waren <strong>de</strong>r von 1741 musste die Stadt Bremen allerdings be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Teile ihres Landgebietes<br />
abtreten, damit <strong>de</strong>r nun mächtigste Nachbar ihre Reichsunmittelbarkeit anerkannte. Bremen behielt in diesen Gebieten das Kirchenpatronat und die Gerichtsbarkeit.<br />
Vorübergehend folgte eine friedlichere Perio<strong>de</strong>. Bremer Kaufleute begannen 1783 mit einem direkten Transatlantikhan<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n USA.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
1800 bis 1850<br />
Die Stadt beauftragte 1802 <strong>de</strong>n Landschaftsgärtner Isaak Altmann, die frühere Stadtbefestigung (siehe Bremer Stadtmauer) in die heutigen Wallanlagen um<strong>zu</strong>gestalten. Doch bereits 1811<br />
wur<strong>de</strong> Bremen erneut <strong>zu</strong>m Schauplatz militärischer Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen. Napoleon ließ Bremen besetzen und integrierte es als Hauptstadt <strong>de</strong>s Départements <strong>de</strong>s Bouches du Weser in
<strong>de</strong>n französischen Staat und setzte Philipp Karl Graf von Arberg 1811 als Präfekt ein. Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>n Befreiungskriegen verließen die französischen Truppen 1814 Bremen.<br />
Die Stadt Bremen entsandte 1815 ihren Bürgermeister Johann Smidt als diplomatischen Vertreter Bremens <strong>zu</strong>m Wiener Kongress. Er erreichte, dass Bremen als souveräner Staat in <strong>de</strong>n<br />
Deutschen Bund aufgenommen wur<strong>de</strong>.<br />
1804 eröffnete Bremen sein eigenes Postamt, das Bremer Stadtpostamt sowie Postämter in <strong>de</strong>n Exklaven Bremerhaven (1846) und in Vegesack (1847). 1855 wur<strong>de</strong>n die ersten<br />
Briefmarken in Bremen eingeführt (siehe da<strong>zu</strong> die Postgeschichte und Briefmarken Bremens).<br />
1810 wur<strong>de</strong> von Martin Heinrich Wilkens die Bremer Silberwaren Fabrik (BSF) gegrün<strong>de</strong>t. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jh. wur<strong>de</strong> die Fertigung in das <strong>zu</strong> dieser Zeit noch preußische Hemelingen<br />
verlegt.<br />
Bürgermeister Nonnen grün<strong>de</strong>te mit an<strong>de</strong>ren Kaufleuten, Bürgermeistern und Senatoren 1825 die Sparkasse Bremen.<br />
Auf <strong>de</strong>r Werft von Johann Lange wur<strong>de</strong> 1816/17 das erste in Deutschland von Deutschen gebaute Dampfschiff hergestellt.[9] Der Raddampfer Die Weser verkehrte als Passagier- und<br />
Postschiff zwischen Bremen, Vegesack, Elsfleth und Brake, später auch Geestemün<strong>de</strong> bis 1833. Die Wirtschaftlichkeit <strong>de</strong>s Schiffes wur<strong>de</strong> allerdings durch die fortschreiten<strong>de</strong> Versandung<br />
<strong>de</strong>r Weser beeinträchtigt. Um sich <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong>m Seehan<strong>de</strong>l <strong>zu</strong> erhalten, erwarb Bremen 1827 vom Königreich Hannover ein Gelän<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Wesermündung von 89,5 Hektar Größe<br />
und grün<strong>de</strong>te Bremerhaven. Für die Gründung war vor allem <strong>de</strong>r bremische Bürgermeister Johann Smidt verantwortlich. Der neue Hafen wur<strong>de</strong> nach Plänen <strong>de</strong>s holländischen<br />
Wasserbaumeisters Jacobus Johannes van Ronzelen gebaut und 1830 fertiggestellt. Im neuen Hafen florierte neben <strong>de</strong>m Warenumschlag auch die Personenbeför<strong>de</strong>rung. Zwischen 1832<br />
und 1960 verließen über sieben Millionen Auswan<strong>de</strong>rer über Bremen und Bremerhaven die „Alte Welt“, ab 1847 wur<strong>de</strong> Bremerhaven Ausgangspunkt <strong>de</strong>r ersten Dampferlinie von Europa<br />
nach Amerika. Nach<strong>de</strong>m sich rund 4.000 Bewohner rund um <strong>de</strong>n Hafen nie<strong>de</strong>rgelassen hatten, wur<strong>de</strong> Bremerhaven 1851 <strong>zu</strong>r eigenständigen Stadt innerhalb <strong>de</strong>s bremischen Staates<br />
erhoben. Die Ree<strong>de</strong>rei Nord<strong>de</strong>utscher Lloyd wur<strong>de</strong> 1857 von H. H. Meier und Eduard Crüsemann in Bremen gegrün<strong>de</strong>t. Sie bediente <strong>zu</strong>nächst die Schifffahrtsverbindungen von Bremen<br />
nach Bremerhaven, <strong>de</strong>n Seebä<strong>de</strong>rn und England, <strong>de</strong>hnte dann aber die Fracht- und Passagierdienste weltweit aus und stieg neben <strong>de</strong>r HAPAG <strong>zu</strong>r größten <strong>de</strong>utschen Ree<strong>de</strong>rei auf.<br />
Eine Gruppe von <strong>zu</strong>nächst 34 kunstinteressierten Kaufleuten um Senator Hieronymus Klugkist grün<strong>de</strong>ten 1823 <strong>de</strong>n Kunstverein. Durch verschie<strong>de</strong>ne Stiftungen und an<strong>de</strong>re Mäzene<br />
konnte <strong>de</strong>r Verein 1849 die von Lü<strong>de</strong>r Rutenberg geplante Kunsthalle Bremen am Ostertor eröffnen.<br />
Bei <strong>de</strong>r Märzrevolution von 1848 stellte sich ein Bürgerverein in Bremen an die Spitze <strong>de</strong>r Revolution. Im März 1848 wur<strong>de</strong>n Allgemeines Wahlrecht, ein Bürgerparlament,<br />
Pressefreiheit, Gewaltenteilung und unabhängigen Gerichte gefor<strong>de</strong>rt. Die früheren Kopfsteuern wur<strong>de</strong>n durch ein Einkommensteuergesetz – das erste in Deutschland – abgelöst. Eine<br />
verfassungsgeben<strong>de</strong> Versammlung wur<strong>de</strong> gewählt und eine von Ferdinand Donandt geprägte Verfassung 1848 beschlossen und 1849 in Kraft gesetzt, die 1852 einseitig vom Senat<br />
aufhoben wur<strong>de</strong>.<br />
1850 bis 1899<br />
Neue Verfassung: Zur Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>mokratischen Bewegung von 1848 bis 1850 hatte <strong>de</strong>r Senat alle Machtmittel angewandt. Immerhin gelang es <strong>de</strong>m Senat nicht, alle alten<br />
Privilegien <strong>de</strong>r vergangenen 300 Jahre wie<strong>de</strong>r durch<strong>zu</strong>setzen. Eine neue Verfassung wur<strong>de</strong> 1854 verabschie<strong>de</strong>t, die bis <strong>zu</strong>r Revolution von 1918 gültig blieb. Das allgemeine, gleiche<br />
Wahlrecht konnte dabei nicht durchgesetzt wer<strong>de</strong>n. Von <strong>de</strong>n 150 Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Bürgerschaft mussten die Hälfte alle drei Jahre ausschei<strong>de</strong>n; eine Wie<strong>de</strong>rwahl war aber möglich.<br />
Wahlberechtigt waren nur alle männlichen Bürger, die <strong>de</strong>n Bremer Bürgereid abgelegt hatten (die Geschworenen). Gewählt wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m 8-Klassen-Wahlrecht. Die Wahlberechtigten<br />
konnten ab 1854 bzw. ab 1894 je nach Klasse unterschiedlich viele Bürgerschaftsmitglie<strong>de</strong>r wählen:<br />
• Klasse Wahlberechtigte 1854 1894<br />
•<br />
• 1. Klasse Wähler mit aka<strong>de</strong>mischer Vorbildung 16 14<br />
• 2. Klasse Kaufleute mit Han<strong>de</strong>lskammerwahlrecht 48 40<br />
• 3. Klasse Gewerbetreiben<strong>de</strong> mit Gewerbekammerwahlrecht 24 20<br />
• 4. Klasse Übrige Wähler; bis 1894 gestaffelt nach Einkommen:
• über 500 Taler, 250 Taler bis 500 und unter 250 Taler je 10 Abgeordnete 30 48<br />
• 5. Klasse Wähler in Vegesack wohnhaft 6 4<br />
• 6. Klasse Wähler in Bremerhaven wohnhaft 6 8<br />
• 7. Klasse Wähler mit Landwirtschaftskammerwahlrecht 10 8<br />
• 8. Klasse Wähler im übrigen Landgebiet wohnhaft 10 8<br />
Da die 4. Klasse in ihrem Wahlrecht so drastisch eingeschränkt war, blieb die Herrschaft <strong>de</strong>r Oberschicht gesichert. Die Senatoren wur<strong>de</strong>n weiterhin auf Lebenszeit gewählt. In <strong>de</strong>r Praxis<br />
konnten <strong>zu</strong><strong>de</strong>m viele ärmere Einwohner wegen <strong>de</strong>r Registraturgebühr das Bürgerrecht nicht erwerben und hatten somit auch kein Wahlrecht. Damit waren breite Bevölkerungsschichten in<br />
Bremen bis 1918 nicht am parlamentarischen Prozess <strong>de</strong>r politischen Mitgestaltung beteiligt – noch 1911 war nicht einmal ein Drittel <strong>de</strong>r Reichstagswähler bei <strong>de</strong>n Bürgerschaftswahlen<br />
stimmberechtigt.[10] Die Gruppierung und politische Arbeit <strong>de</strong>r Abgeordneten innerhalb <strong>de</strong>r Bürgerschaft über die politischen Parteien war, bis auf einen gewissen Einfluss <strong>de</strong>r SPD, bis<br />
1918 weitgehend unbekannt.[11]<br />
Deutsches Reich: Im Zuge <strong>de</strong>r nationalstaatlichen Bestrebungen in Mitteleuropa trat nach <strong>de</strong>m Deutschen Krieg von 1866 Bremen <strong>de</strong>m Nord<strong>de</strong>utschen Bund bei. Dann wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m<br />
Sieg <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r verbün<strong>de</strong>ten süd<strong>de</strong>utschen Staaten im Deutsch-Französischen Krieg 1871 das Deutsche Kaiserreich gegrün<strong>de</strong>t. Bremen erhielt <strong>de</strong>n<br />
verfassungsmäßigen Namen Freie Hansestadt Bremen und hatte eine Stimme im Bun<strong>de</strong>srat. Durch <strong>de</strong>n Beitritt <strong>zu</strong>m Deutschen Reich wur<strong>de</strong> das Bremer Stadtrecht Partikularrecht und<br />
schließlich durch das Recht <strong>de</strong>s Reiches weitgehend ersetzt (Strafrecht ab 1871, Privatrecht (BGB) 1900, Ratsverfassung 1920). 1888 schloss Bremen sich <strong>de</strong>m Deutschen Zollverein an<br />
und eröffnete <strong>de</strong>n ersten Freihafen.<br />
Zur Erschließung <strong>de</strong>r neuen Häfen begradigte Ludwig Franzius zwischen 1875 und 1895 die Weser (siehe auch Weserkorrektion).<br />
Arbeiterbewegung: 1864 nahm <strong>de</strong>r Allgemeine Arbeiterverein für Bremen unter Leitung von Gustav Deckwitz seine Arbeit auf. Bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1870er Jahre waren mehrere Gruppen <strong>de</strong>r<br />
Arbeiterbewegung in Bremen entstan<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>r kleine Arbeiterverein von Deckwitz, <strong>de</strong>r große Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) unter Führung von Wilhelm Frick, <strong>de</strong>r Verein<br />
Vorwärts und die von August Kühn geführte Sozial<strong>de</strong>mokratische Arbeiterpartei (SDAP). Der ADAV verlegte 1874 sogar seinen Hauptsitz von Berlin nach Bremen. 1875 vereinigten sich<br />
die Gruppen <strong>zu</strong>r Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die heutige SPD war entstan<strong>de</strong>n. 1878 traf das Verbot <strong>de</strong>r SAP auch die Arbeiterbewegung in Bremen. Trotz<strong>de</strong>m<br />
wur<strong>de</strong> erstmals ein SAP-Vertreter 1881 in die Bürgerschaft gewählt, und 1884 waren es dann schon 5 Abgeordnete. Erst 1890 wur<strong>de</strong>n mit Julius Bruhns und 1903 mit Hinrich Schmalfeldt<br />
(1930 Ehrenbürger von Bremerhaven) erstmals Bremer Sozial<strong>de</strong>mokraten in <strong>de</strong>n Reichstag gewählt. Sogleich entstand als Sprachrohr 1890 die Bremer Bürgerzeitung. Als prominente<br />
Mitglie<strong>de</strong>r wirkten damals in und für Bremen Wilhelm Hasenclever, Wilhelm Liebknecht, Hermann Rhein, Wilhelm Pieck und Friedrich Ebert.<br />
Die Gewerkschaften konnten sich in Bremen nach <strong>de</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r Verbote von 4.554 (1894) bis 1900 auf 10.341 und bis <strong>zu</strong>m Ersten Weltkrieg auf 36.085 Mitglie<strong>de</strong>r steigern.[12]<br />
Der Nord<strong>de</strong>utsche Lloyd: Hermann Henrich Meier und Eduard Crüsemann grün<strong>de</strong>ten 1857 in Bremen die Ree<strong>de</strong>rei Nord<strong>de</strong>utscher Lloyd. Sie entwickelte sich <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendsten <strong>de</strong>utschen Schifffahrtsunternehmen und för<strong>de</strong>rte nachhaltig die wirtschaftliche Entwicklung von Bremen und Bremerhaven. Mit <strong>de</strong>n Schiffen Kaiser Wilhelm <strong>de</strong>r Große,<br />
Kronprinz Wilhelm, Kaiser Wilhelm II, Bremen und Europa konnte die Ree<strong>de</strong>rei zwischen 1898 und 1930 fünfmal das Blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung erringen.<br />
Bürgerpark: Am 28. Juni 1866, ein Jahr nach <strong>de</strong>m Zweiten Deutschen Bun<strong>de</strong>sschießen auf <strong>de</strong>m baumlosen Gelän<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> nach einem Plan von Wilhelm Benque <strong>de</strong>r erste Teil <strong>de</strong>s<br />
Bürgerparks durch <strong>de</strong>n Bürgerparkverein (auf Initiative Hermann Hollers und unter Vorsitz von Justin Löning) angelegt und in <strong>de</strong>n nächsten Jahrzehnten bis auf eine Größe von 202<br />
Hektar – einschließlich Stadtwald – erweitert. Franz Ernst Schütte hat <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>s Parks maßgeblich unterstützt.<br />
Baumwollbörse: Die Bremer Baumwollbörse wur<strong>de</strong> 1872 gegrün<strong>de</strong>t. Sie hat ihren Sitz in <strong>de</strong>r alten Börse.<br />
Werften: 1872 wur<strong>de</strong> die Werft Aktien-Gesellschaft „Weser“ – AG Weser – in Bremen-Gröpelingen gegrün<strong>de</strong>t. Zeitweise waren bis <strong>zu</strong> 20.000 Mitarbeiter bei <strong>de</strong>r Werft beschäftigt. Viele<br />
Torpedoboote, U-Boote, Frachter, Passagierschiffe (u. a. 1929 die Bremen IV) und später Großtanker wur<strong>de</strong>n durch sie gebaut. 1983 wur<strong>de</strong> die Werft geschlossen. 1893 wur<strong>de</strong> in Bremen-<br />
Nord die Werft Bremer Vulkan AG gegrün<strong>de</strong>t. Sie entwickelte sich <strong>zu</strong> einer Großwerft mit bis <strong>zu</strong> 4.000 Mitarbeitern, die über 1.000 Schiffe baute, u. a. viele für <strong>de</strong>n Nord<strong>de</strong>utschen<br />
Lloyd. Nach <strong>de</strong>r Insolvenz von 1996 stellte sie 1997 <strong>de</strong>n Schiffbau ein.
Von 1872 bis 1875 wird die „Große Weserbrücke“ <strong>zu</strong> Entlastung <strong>de</strong>s Verkehrs gebaut. Sie trägt bis 1919 <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>n Namen Kaiserbrücke. Nach <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau von 1950 bis 1952<br />
heißt sie Bürgermeister-Smidt-Brücke.<br />
Eisenbahn: Der erste Bahnhof Bremens wur<strong>de</strong> nach Plänen von Mohr und Alexan<strong>de</strong>r Schrö<strong>de</strong>r 1847 nach Eröffnung <strong>de</strong>r Bahnstrecke Bremen – Hannover bereits an <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>s<br />
heutigen Hauptbahnhofes erbaut. In <strong>de</strong>r Neustadt wur<strong>de</strong> im neugotischen Stil <strong>de</strong>r Neustädter-Bahnhof gebaut. Die Cöln-Min<strong>de</strong>ner Eisenbahn errichtete 1870–1873, nach Eröffnung <strong>de</strong>r<br />
Strecke Wanne – Hamburg, am heutigen Standort <strong>de</strong>r Stadthalle (heute „Bremen Arena“) <strong>de</strong>n Venloer Bahnhof. Weiterhin entstand um diese Zeit <strong>de</strong>r Weserbahnhof (nördlich <strong>de</strong>s<br />
Stephaniviertels). 1890 wird <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>n Plänen <strong>de</strong>s Architekten Prof. Hubert Stier erbaute Bremer Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Um 2000 erfolgte ein grundlegen<strong>de</strong>r Umbau <strong>de</strong>s<br />
Bahnhofs.<br />
Straßenbahn: 1876 wur<strong>de</strong> die Actiengesellschaft Bremer Pfer<strong>de</strong>bahn (ab 1890 Bremer Straßenbahn) gegrün<strong>de</strong>t. Dem Antrag <strong>de</strong>s Ingenieurs Carl Westenfeld die „projectirte Pfer<strong>de</strong>bahn<br />
vom Heer<strong>de</strong>nthore bis <strong>zu</strong>r Horner Brücke“ betreiben <strong>zu</strong> dürfen wur<strong>de</strong> entsprochen. Am 4. Juni 1876 eröffnet eine Bahnlinie vom Her<strong>de</strong>ntor via Vahrster Brücke und 1877 weiter nach<br />
Horn. 1883 erfolgte die Verlängerung in die Stadt. Das Konkurren<strong>zu</strong>nternehmen Große Bremer Pfer<strong>de</strong>bahn begann 1879 eine Linie von Hastedt nach Walle (heute Linie 2). Die<br />
Gesellschaften bauten ihre Netze aus: Zum Freihafen (1888), <strong>zu</strong>m Hohentor (1889) und <strong>zu</strong>m Arsterdamm (1880/1884).<br />
1890 wur<strong>de</strong> anlässlich <strong>de</strong>r Nordwest<strong>de</strong>utschen Gewerbe- und Industrieausstellung im Bürgerpark die Strecke von <strong>de</strong>r Börse <strong>zu</strong>m Ausstellungsgelän<strong>de</strong> probeweise elektrifiziert. Das<br />
System hatte sich bewährt, so dass die Umstellung <strong>de</strong>s Netzes von 1892 bis 1913 durchgeführt wur<strong>de</strong>. Die Bremer Straßenbahn AG übernahm 1899 die Große Bremer Pfer<strong>de</strong>bahn.<br />
Ausstellung: 1890 fand auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Bremer Bürgerparks die Nordwest<strong>de</strong>utsche Gewerbe-, Industrie-, Han<strong>de</strong>ls-, Marine-, Hochseefischerei und Kunst-Ausstellung statt, eine mit<br />
<strong>de</strong>m Großherzogtum Ol<strong>de</strong>nburg und <strong>de</strong>r preußischen Provinz Hannover gemeinsam organisierte Leistungsschau.<br />
Das Landgericht Bremen befand und befin<strong>de</strong>t sich im sogenannten Alten Gerichtshaus zwischen Buchtstraße, Violenstraße und Ostertorstraße in <strong>de</strong>r Altstadt Bremens. Das Alte<br />
Gerichtshaus für das Landgericht wur<strong>de</strong> 1895 nach <strong>de</strong>n Entwürfen <strong>de</strong>r Ol<strong>de</strong>nburger Architekten Weber und Klingenberg im Stile <strong>de</strong>s Historismus an <strong>de</strong>r Domshei<strong>de</strong> errichtet. Das bis<br />
dahin unbebaute Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Bistums Bremen gehörte erst seit mit <strong>de</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss von 1803 <strong>zu</strong>r Stadt Bremen. Das Alte Gerichtshaus konnte trotz schwerer<br />
Bombenschä<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r bremischen Innenstadt <strong>de</strong>n Zweiten Weltkrieg weitgehend unbescha<strong>de</strong>t überstehen.<br />
Bremer Haus: Zwischen <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>n 1930er Jahren entwickelte sich das sogenannte Bremer Haus, ein englischer Haustyp, <strong>de</strong>r viele Stadtteile wie<br />
Schwachhausen, Ostertor und Steintor sowie die Neustadt prägte.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
1900 bis 1933<br />
Durch Staatsverträge von 1904 und 1905 tauschte Bremen mit Preußen Gebiete im Nor<strong>de</strong>n, Osten und Westen Bremerhavens, die fortan <strong>zu</strong> Bremen gehörten, gegen Gebiete an <strong>de</strong>r<br />
Wümme, die nun an Preußen gingen. Später versuchte sich Bremen unter Berufung auf die clausula rebus sic stantibus in einem Verfahren vor <strong>de</strong>m Staatsgerichtshof für das Deutsche<br />
Reich von einigen belasten<strong>de</strong>n Auflagen aus <strong>de</strong>n Staatsverträgen <strong>zu</strong> befreien, unterlag jedoch 1925.<br />
Am 6. November 1918 erreichte die Novemberrevolution Bremen. Adam Frasunkiewicz verkün<strong>de</strong>te vom Balkon <strong>de</strong>s Rathauses die geplante Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates.<br />
Das liberale Bürgertum wi<strong>de</strong>rsetzte sich und organisierte sich in einem „Bürgerausschuss“, <strong>de</strong>ssen Vorsitz <strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong>r Friedrich Adolph Vinnen am 9. Dezember 1918 übernahm. Am 10.<br />
Januar 1919 wur<strong>de</strong> die „Bremer Räterepublik“ ausgerufen. 600 Freiwillige eines sogenannten „Freikorps Caspari“ zerschlugen im Auftrage <strong>de</strong>r Reichsregierung und in Übereinkunft mit<br />
bürgerlichen Kräften in Bremen mit militärischer Gewalt am 4. Februar 1919 die Räterepublik. 1920 wur<strong>de</strong> unter maßgeblichen Einfluss von Senator Dr. Theodor Spitta eine Verfassung<br />
erarbeitet. Während die entschie<strong>de</strong>ne „Linke“ einen „Sozialistischen Freistaat“ anstrebten mit Elementen <strong>de</strong>r Räterepublik, setzte sich mehrheitlich (SPD und Bürgerparteien) eine 1920<br />
beschlossene parlamentarische Verfassung durch, die bis 1933 galt. Mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Weimarer Republik wur<strong>de</strong> Bremen ein Bun<strong>de</strong>sland <strong>de</strong>r Republik.<br />
Als Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats fungierten von 1919 bis 1920 Karl Deichmann (SPD) und dann bis 1933 Dr. Martin Donandt.<br />
Von 1904 bis 1934 wur<strong>de</strong> die frühere „Hellingstraße“ nunmehr als Böttcherstraße weitgehend mit Mitteln <strong>de</strong>s Kaufmanns Ludwig Roselius (Kaffee HAG) nach Plänen von Bernhard
Hoetger erbaut und nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bis 1954 wie<strong>de</strong>r hergestellt.<br />
In <strong>de</strong>r Weimarer Republik schritt die wirtschaftliche Entwicklung Bremens fort. Der Flughafen öffnete 1920 für Linienflüge. 1928 wur<strong>de</strong> die Columbuskaje in Bremerhaven eingeweiht.<br />
Von hier ausgehend gewann später das Passagierschiff Bremen <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Lloyd das Blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung.<br />
1924 bzw. 1929 wur<strong>de</strong> die Autofabrik Borgward durch Carl F. W. Borgward gegrün<strong>de</strong>t. En<strong>de</strong> 1950 arbeiteten 20.000 Menschen in <strong>de</strong>n Werken von Bremen-Sebaldsbrück und Bremen-<br />
Hemelingen. 1961 musste <strong>de</strong>r Betrieb schließen.<br />
Das Haus <strong>de</strong>s Reichs wur<strong>de</strong> 1928–1931 von <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utschen Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei (Nordwolle) erbaut. Architekten waren die Brü<strong>de</strong>r Hermann und Eberhard<br />
Gil<strong>de</strong>meister. Kurz vor Fertigstellung <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s ging die Firma in Konkurs. 1934 übernahm das Deutsche Reich das Haus. Es war <strong>zu</strong>nächst das Lan<strong>de</strong>sfinanzamt Weser-Ems, dann<br />
Sitz <strong>de</strong>s NSDAP-„Reichsstatthalters“ und NS-Gauleiters. Nach 1945 wur<strong>de</strong> es Sitz <strong>de</strong>r amerikanischen Militärregierung für Bremen. Ab 1947 nahm die bremische Finanzverwaltung das<br />
Gebäu<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r in Benut<strong>zu</strong>ng.<br />
1933 bis 1945<br />
Bei <strong>de</strong>n Reichstagswahlen 1930 stimmten in Bremen ca. 12 % <strong>de</strong>r Wähler für die NSDAP, 1932 bereits 21,2 % und 1933 schon 32,6 % und damit erstmals etwas mehr als für die SPD.<br />
Schon einen Tag nach <strong>de</strong>n Reichstagswahlen, am 6. März 1933, mussten die Senatoren <strong>de</strong>r SPD Wilhelm Kaisen, Wilhelm Klemann und Emil Sommer <strong>zu</strong>rücktreten. Reichsinnenminister<br />
Wilhelm Frick ernannte Richard Markert <strong>zu</strong>m kommissarischen Polizeisenator. Der Senat kündigte seinen Rücktritt an und abends wehte die Hakenkreuzfahne vom Rathaus. Das<br />
Stimmenverhältnis in <strong>de</strong>r Bürgerschaft wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Ergebnis <strong>de</strong>r Reichstagswahlen angeglichen. Die KPD-Abgeordneten wur<strong>de</strong>n dabei von <strong>de</strong>r Bürgerschaft ausgeschlossen. Am 18. März<br />
1933 traten Bürgermeister Dr. Martin Donandt und die weiteren vier Senatoren <strong>zu</strong>rück und die NSDAP übernahm die Regierungsgewalt.<br />
Im Mai 1933 ernannte Innenminister Frick <strong>de</strong>n Gauleiter <strong>de</strong>r NSDAP Carl Röver schließlich <strong>zu</strong>m Reichsstatthalter für Bremen und Ol<strong>de</strong>nburg. Damit hatte das Land Bremen seine<br />
Unabhängigkeit verloren. Nach <strong>de</strong>m Tod Rövers folgte 1942 Paul Wegener als Gauleiter. Kreisleiter <strong>de</strong>r NSDAP wur<strong>de</strong> ab März 1933 Wegener, ihm folgte im Juli 1934 Berhard Blanke<br />
und 1942 Max Schümann.<br />
Bürgermeister in dieser Zeit waren Dr. Ernst Otto Richard Markert (1933/34), Karl Hermann Otto Hei<strong>de</strong>r (1934–1937), Johann Heinrich Böhmcker (1937–1944) und Dr. Richard<br />
Duckwitz (1944/45, kom.). Ansonsten siehe die Liste <strong>de</strong>r Senatoren von 1933 bis 1945.<br />
1937 verlor Bremen die Stadt Bremerhaven, das mit <strong>de</strong>m preußisch-hannoverschen Wesermün<strong>de</strong> vereinigt wur<strong>de</strong>, an Preußen. Das stadtbremische Gebiet wur<strong>de</strong> dafür infolge <strong>de</strong>r Vierten<br />
Verordnung über <strong>de</strong>n Neuaufbau <strong>de</strong>s Reichs <strong>zu</strong>m 1. November 1939 um Lesum, Grohn, Schönebeck, Aumund, Blumenthal, Farge, Hemelingen und Mahndorf sowie Vegesack und die<br />
Gemein<strong>de</strong>n Büren, Grambkermoor und Lesumbrok <strong>de</strong>s Landkreises Bremen vergrößert.[13]<br />
Wie im gesamten Deutschen Reich wur<strong>de</strong> auch in Bremen jeglicher Wi<strong>de</strong>rstand unterdrückt. Die 1438 Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n entrechtet, verfolgt, <strong>de</strong>portiert und ermor<strong>de</strong>t. Politische Gefangene<br />
wur<strong>de</strong>n in die Konzentrationslager <strong>de</strong>s Reichs transportiert. Seit 1940 eingerichtete Son<strong>de</strong>rgerichte beugten das Recht. In <strong>de</strong>n Lagern Mißler, KZ Farge, Blumenthal, Neuenland,<br />
Obernhei<strong>de</strong>, Osterort, Schützenhof, Uphusen und <strong>de</strong>m Borgward-Lager mussten die Häftlinge Zwangsarbeit verrichten; über tausend von ihnen verloren ihr Leben. In <strong>de</strong>r Endphase <strong>de</strong>s<br />
Zweiten Weltkriegs häuften sich die Verbrechen an Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.<br />
Im Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong>n viele Ortsteile Bremens stark zerstört. Insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Bremer Westen mit seiner Werftenindustrie war ein oft getroffenes Ziel <strong>de</strong>r Alliierten. Der 132. und<br />
schwerste Bombenangriff auf Bremen erfolgte in <strong>de</strong>r Nacht vom 18. auf <strong>de</strong>n 19. August 1944. Beteiligt waren 500 Bomber, die 68 Minenbomben, 2323 Spreng-, 10.800 Phosphor- und<br />
108.000 Stabbrandbomben abwarfen. Es gingen bei diesem Angriff 25.000 Wohnungen verloren, insgesamt wur<strong>de</strong>n vollständig zerstört: 8.248 Wohngebäu<strong>de</strong>, 34 öffentliche Gebäu<strong>de</strong>, 37<br />
Industriegebäu<strong>de</strong>, 80 Wirtschaftsgebäu<strong>de</strong>. Es wur<strong>de</strong>n 1.054 Tote, 72 Schwer- und 677 Leichtverletzte, sowie 49.100 Obdachlose infolge dieses Luftangriffs gezählt. Insgesamt wur<strong>de</strong>n auf<br />
Bremen 173 Luftangriffe geflogen, bei <strong>de</strong>nen 62 % <strong>de</strong>r städtebaulichen Substanz zerstört wur<strong>de</strong>n. Am 26. April wird Bremen von <strong>de</strong>n Briten erobert, die dann weiter nach Nordosten<br />
ziehen.<br />
1945 bis 1999
Ära Wilhelm Kaisen<br />
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong>n Bremen und Bremerhaven <strong>zu</strong>nächst britische Besat<strong>zu</strong>ngszone und ab 1947 wegen ihrer Häfen eine amerikanische Besat<strong>zu</strong>ngszone als US-Exklave<br />
im britisch besetzten Umland. Das Kfz-Kennzeichen war <strong>de</strong>m<strong>zu</strong>folge von 1948 bis 1956: „AE“ = „Amerikanische Exklave“. Die amerikanischen Streitkräfte beanspruchten Bremen für<br />
sich, um Zugang <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Seehäfen (port of embarkation) <strong>zu</strong> erlangen. Dies erleichterte es Bremen, seine Selbständigkeit gegenüber <strong>de</strong>m nie<strong>de</strong>rsächsischen Umland <strong>zu</strong> erhalten. Durch<br />
eine Übereinkunft <strong>de</strong>r britischen und amerikanischen Besat<strong>zu</strong>ngsbehör<strong>de</strong>n vom 22. Januar 1947 und durch die Proklamation Nr. 3 <strong>de</strong>r amerikanischen Militärregierung vom 21. Januar<br />
1947 wur<strong>de</strong>n das Stadt- und Landgebiet Bremens sowie <strong>de</strong>r Stadtkreis Wesermün<strong>de</strong>, einschließlich Bremerhavens, rückwirkend <strong>zu</strong>m 1. Januar 1947 <strong>zu</strong> einem als Land <strong>zu</strong> bezeichnen<strong>de</strong>n<br />
Verwaltungsgebiet erklärt.<br />
Von 1945 bis 1965 war Wilhelm Kaisen (SPD) als Regieren<strong>de</strong>r Bürgermeister und ab 1948 als Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats und Bürgermeister die prägen<strong>de</strong> Führungspersönlichkeit <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
(siehe Senat Kaisen I, II, III, IV, V, VI, VII).<br />
Am 21. Oktober 1947 trat die von Bürgermeister Theodor Spitta (BVP/FDP) entworfene und von <strong>de</strong>r Bremer Bürgerschaft am 15. September 1947 beschlossene und durch<br />
Volksabstimmung am 12. Oktober 1947 angenommene Lan<strong>de</strong>sverfassung <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen in Kraft. 1949 wur<strong>de</strong> Bremen ein Land <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland.<br />
Die Zeit danach war von einer wirtschaftlichen Umstrukturierung und vom Drang, als Stadtstaat selbstständig <strong>zu</strong> bleiben, gekennzeichnet. So versuchte man nach <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r<br />
Werftenindustrie (AG-Weser, Bremer Vulkan), <strong>de</strong>m Konkurs von Borgward und <strong>de</strong>m Be<strong>de</strong>utungsrückgang <strong>de</strong>r stadtbremischen Häfen, weitere wirtschaftliche Standbeine <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n (u. a.<br />
Merce<strong>de</strong>s Benz) und das Profil als Wissenschaftsstandort mit Schwerpunkt in <strong>de</strong>r Luft- und Raumfahrttechnik <strong>zu</strong> schärfen.<br />
Die Einwohnerzahl wuchs rapi<strong>de</strong>. Während 1945 Bremen nur noch rund 370.000 Einwohner aufwies, waren es 1966 um 600.000 Bürger. Durch die Kriegszerstörungen, Zuwan<strong>de</strong>rungen,<br />
Geburtenüberschüsse und durch einen erhöhten Wohnflächenbedarf pro Einwohner musste ein großer Wohnraumbedarf in kurzer Zeit befriedigt wer<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong>n von Mitte <strong>de</strong>r 1950er<br />
bis Mitte <strong>de</strong>r 1970er Jahre durch <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau wie in Walle und Gröpelingen und <strong>de</strong>n Bau vieler neuer Großwohnsiedlungen – wie u. a. in <strong>de</strong>r Vahr, in Osterholz-Blockdiek,<br />
Huchting, Grohn (Grohner Düne), Kattenturm und Osterholz-Tenever sowie durch die Siedlungsergän<strong>zu</strong>ngen wie beispielsweise in Blumenthal, Habenhausen o<strong>de</strong>r Neustadt-Huckelrie<strong>de</strong><br />
– in kurzer Zeit (1945–1975) bis <strong>zu</strong> 170.000 Wohnungen geschaffen, viele davon im sozialen Wohnungsbau.<br />
Bis 1954 konnte die im Krieg zerstörte Böttcherstraße durch <strong>de</strong>n Bremer Kaffeekaufmann Ludwig Roselius junior (Kaffee HAG) größtenteils in ihren ursprünglichen Zustand<br />
wie<strong>de</strong>rhergestellt wer<strong>de</strong>n. Die Sparkasse Bremen kaufte 1989 alle Gebäu<strong>de</strong>, bis auf das Haus Atlantis, das bereits an einen Hotel-Konzern veräußert war.<br />
In <strong>de</strong>n 1960er Jahren wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r linken Weserseite <strong>de</strong>r Neustädter Hafen mit Becken II, Lankenauer Hafen und Wen<strong>de</strong>becken realisiert und mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Güterverkehrszentrums<br />
begonnen. Beim Bau <strong>de</strong>s Hafenbeckens konnte eine Kogge von 1380 im Weserschlick gefun<strong>de</strong>n und sichergestellt wer<strong>de</strong>n, die sich im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven<br />
befin<strong>de</strong>t.<br />
Die Sturmflut 1962 in <strong>de</strong>r Nacht vom 16. auf <strong>de</strong>n 17. Februar an <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Nordseeküste war eine Katastrophe, die auch Bremen traf und im Bereich links <strong>de</strong>r Weser <strong>zu</strong><br />
Überschwemmungen führte.<br />
Das rasante Wachstum führte aber auch <strong>zu</strong> spekulativen Grundstückshan<strong>de</strong>l und <strong>zu</strong>m Baulandskandal von 1969. Im Hollerland in Horn-Lehe kauften auf Grund von Informationen <strong>de</strong>s<br />
SPD-Fraktionsvorsitzen<strong>de</strong>n Richard Boljahn nicht nur die bremische Grundstücksgesellschaft Weser son<strong>de</strong>rn auch die Wohnungsgesellschaft Neue Heimat (Boljahn war im Aufsichtsrat)<br />
und <strong>de</strong>r Makler Willi Lohmann spekulativ riesige Flächen, die später einer Bebauung <strong>zu</strong>geführt wer<strong>de</strong>n sollten. Bausenator Wilhelm Blase (SPD) und Boljahn verloren ihre Ämter. Erst<br />
25 Jahre später wur<strong>de</strong> ein kleinerer Teilbereich <strong>de</strong>s Hollerlan<strong>de</strong>s dann tatsächlich bebaut.<br />
Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r Weserbrücken<br />
1945 wur<strong>de</strong>n im Krieg die Weserbrücken gesprengt. Die östliche Lü<strong>de</strong>ritzbrücke von 1895 (benannt nach Adolf Lü<strong>de</strong>ritz) wur<strong>de</strong> bis 1948 durch die 147 m lange Memorial-Brig<strong>de</strong> und die<br />
westliche Kaiserbrücke von 1918 durch die 120 m lange Trumann-Brig<strong>de</strong> (1946–1947, benannt nach US-Präsi<strong>de</strong>nt Harry S. Truman) als Notbrücken ersetzt.<br />
Für die Kaiserbrücke entstand von 1950 bis <strong>zu</strong>m 28. Juni 1952 (an<strong>de</strong>re Quellen 30. Juni 1952) die 220 m lange Bürgermeister-Smidt-Brücke (benannt nach Bürgermeister Johann Smidt)
aus Stahl.<br />
Das gesprengte Mittelteil <strong>de</strong>r östlichen Lü<strong>de</strong>ritzbrücke wur<strong>de</strong> bis <strong>zu</strong>m Herbst 1947 wie<strong>de</strong>r eingesetzt. Als neue Große Weserbrücke entstand von 1958 bis <strong>zu</strong>m 22. Dezember 1960<br />
daneben die 151 m lange und 30 m breite Brücke aus Beton. Sie erhielt 1980 <strong>de</strong>n Namen Wilhelm-Kaisen-Brücke nach <strong>de</strong>m ersten Nachkriegsbürgermeister.<br />
Die 1903 gebaute Kleine Weserbrücke über die Kleine Weser, die auch Brautbrücke (die Braut war ein Wehrturm <strong>de</strong>r Bremer Stadtmauer) genannt wird, war im Krieg nur leicht<br />
beschädigt wor<strong>de</strong>n. Das Neustadtsportal wur<strong>de</strong> 1953 entfernt. Von 1958 bis 1960 wur<strong>de</strong> diese Brücke durch einen Neubau ersetzt.<br />
Ergänzend <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Weserbrücken im Zentrum entstand von 1966 bis <strong>zu</strong>m 15. Juni 1970 die Wer<strong>de</strong>rbrücke, die von <strong>de</strong>r Östlichen Vorstadt nach Obervieland führt. Sie wird im Volksmund<br />
Erdbeerbrücke genannt. 1999 erhielt sie <strong>de</strong>n Namen Karl-Carstens-Brücke (Karl Carstens, Bun<strong>de</strong>spräsi<strong>de</strong>nt 1979-1984).<br />
Mit <strong>de</strong>r Autobahnbrücke <strong>de</strong>r BAB 1 wur<strong>de</strong> um 1969 eine weitere sechs- bis achtspurige Brücke am östlichen Stadtrand über die Weser geführt. Ein Wesertunnel im Westen unter <strong>de</strong>r<br />
Weser soll das Autobahnsystem um Bremen mit <strong>de</strong>r BAB 281 um 2012/14 abschließen.<br />
Koschnick als Präsi<strong>de</strong>nt<br />
18 Jahre lang prägte Hans Koschnick (SPD) von 1967 bis 1985 als Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats die politischen Geschicke <strong>de</strong>r Stadt (siehe Senat Koschnick I, II III, IV, V), wobei die SPD von<br />
1971 bis 1985 ohne Koalition mit einer an<strong>de</strong>ren Partei regierte.<br />
Die durch Preiserhöhungen ausgelösten Straßenbahnunruhen <strong>de</strong>r Schüler in Bremen vom Januar 1968 lösten für zwei Wochen in Bremen erhebliche Proteste auf <strong>de</strong>r Domshei<strong>de</strong> aus. Die<br />
Polizei ging mit unangemessener Härte gegen die jugendlichen Schienenbesetzer vor. Die Bevölkerung solidarisierte sich <strong>zu</strong>nehmend mit <strong>de</strong>n Schülern. Bürgermeisterin Annemarie<br />
Mevissen versuchte mutig <strong>zu</strong> beruhigen. Bürgermeister Koschnick nahm die Preiserhöhungen schließlich wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück. Deshalb konnten erst 1976/1977 wie<strong>de</strong>r Preiserhöhungen für <strong>de</strong>n<br />
öffentlichen Personennahverkehr in Bremen durchgesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Bremische Bürgerschaft – Stadt- und Lan<strong>de</strong>sparlament – tagte von 1946 bis 1966 im Rathaus. Sie erhielt 1966 am Markt ihr Haus <strong>de</strong>r Bürgerschaft, gebaut nach <strong>de</strong>n heftig umstritten<br />
Plänen <strong>de</strong>s Architekten Wassili Luckhardt.<br />
Die Stadthalle Bremen wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Jahren 1961 bis 1964 aufgrund eines Wettbewerbes nach einem Entwurf <strong>de</strong>s Wiener Architekten Roland Rainer errichtet. Der Entwurf beinhaltet mit<br />
einer Hängeseilkonstruktion ein seltenes Tragwerk, welches im Zuge <strong>de</strong>s Umbaus entfernt wur<strong>de</strong>. Die Wi<strong>de</strong>rlager <strong>de</strong>r Hängeseile, die auch ein wichtiges Wahrzeichen von Bremen sind,<br />
sind erhalten geblieben. 2001/02 wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Anbau <strong>de</strong>r Halle 7 sowie nachfolgend weitere Hallen <strong>de</strong>r Ausstellungbereich vergrößert. 2004 erfolgte <strong>de</strong>r Umbau <strong>de</strong>r Stadthalle, die<br />
seit 2009 Bremen-Arena heißt.<br />
Der Luft<strong>hansa</strong>-Flug 005 stürzte am 28. Januar 1966 in Bremen-Huchting nahe <strong>de</strong>r Ochtum ab. Alle 46 Insassen wur<strong>de</strong>n Opfer <strong>de</strong>s Absturzes.<br />
Der im stadtbremischen Überseehafengebiet liegen<strong>de</strong> Containerterminal in Bremerhaven, mit <strong>de</strong>r längsten Stromkaje <strong>de</strong>r Welt (knapp 5 km), wur<strong>de</strong> seit 1975 abschnittsweise ausgebaut.<br />
Der Seegüterumschlag betrug über 50 Millionen Tonnen im Jahr 2007.<br />
Nach <strong>de</strong>m Konkurs <strong>de</strong>r Automobilwerke Borgward (1961) und <strong>de</strong>r Übernahme <strong>de</strong>r Hanomag-Werke durch die Daimler AG (1971) baute Daimler in Sebaldsbrück von 1979 bis 1982 ein<br />
neues Merce<strong>de</strong>s-Werk in <strong>de</strong>m bis <strong>zu</strong> 18.000 Mitarbeiter beschäftigt wur<strong>de</strong>n.<br />
1985 bis 2000<br />
Von 1985 bis 1995 war Klaus We<strong>de</strong>meier (SPD) Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Senats. Von 1991 bis 1995 bestand <strong>de</strong>r Senat We<strong>de</strong>meier III aus einer so genannte Ampelkoalition (SPD, FDP und Bündnis<br />
90/Die Grünen).<br />
1992 entschied das Bun<strong>de</strong>sverfassungsgericht wegen <strong>de</strong>r extremen Haushaltsnotlage, dass das Land Bremen Anspruch habe auf Haushaltsnothilfen durch <strong>de</strong>n Bund und die Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r.<br />
Rund 16 Mrd. Mark wur<strong>de</strong>n Bremen in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren bis 2004 dafür gewährt. Das Ziel <strong>de</strong>r Sanierung <strong>de</strong>r extremen Haushaltsnotlage wur<strong>de</strong> nicht erreicht, da <strong>de</strong>r SPD/CDU –
Koalitionssenat von 1995 bis 2005 unter Führung von Dr. Henning Scherf erhebliche Anteile <strong>de</strong>r Finanzhilfen nicht <strong>zu</strong>r Entschuldung son<strong>de</strong>rn für neue Investitionen verwandte und die<br />
für die Stadtstaaten ungerechte Steuerverteilung nicht geän<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>.[14]<br />
Neuere Stadtentwicklung<br />
Der Bau eines inneren Ringes einer Stadtautobahn, <strong>de</strong>r durch das Ostertor (Mozarttrasse) und die Neustadt (Kirchweg) führen sollte, scheiterte in <strong>de</strong>n 1970er Jahren am Protest <strong>de</strong>r Bürger<br />
und die Straße en<strong>de</strong>t am Rembertiring. Das Ostertorviertel (genannt das Viertel) und das Steintorviertel wur<strong>de</strong>n hingegen mit Mitteln <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung von 1970 bis 1990<br />
grundlegend saniert.<br />
In Vegesack wur<strong>de</strong> das Fährquartier und <strong>de</strong>r Fußgängerbereich zwischen Vegesacker Bahnhof/Hafen und Sedanplatz im Zeitraum zwischen 1970 und 1990 saniert und städtebaulich<br />
erbeblich aufgewertet.<br />
Die Strukturen <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong>n ab 1985 bis 2005 <strong>de</strong>utlich verbessert. Das Fußgängersystem mit Obernstraße, Sögestraße, Langestraße, Papenstraße, Piperstraße,<br />
Knochenhauerstraße, Markt, Domshof und Liebfrauenkirchhof etc. wur<strong>de</strong> ausgeweitet und vollkommen neu gestaltet. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>r Nord-Süd-Achse entstan<strong>de</strong>n eine Kette von<br />
überdachten Passagen (Von Nord nach Süd: Ansgari-, Lloyd-, Katharinen- und Domshofs-Passage) und Am Wall eine gläserne Überdachung. Auch das System <strong>de</strong>r Hochgaragen in <strong>de</strong>r<br />
Innenstadt wur<strong>de</strong> erheblich erweitert. 1986 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fernmel<strong>de</strong>turm Bremen fertiggestellt.<br />
Von 1990 bis 1995 wur<strong>de</strong> die kriegszerstörte Teerhofinsel zwischen Altstadt und Neustadt nach einem internationalen Wettbewerb wie<strong>de</strong>r aufgebaut und über eine Fußgängerbrücke mit<br />
<strong>de</strong>r Altstadt verbun<strong>de</strong>n. Die Weserpromena<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Schlachte wur<strong>de</strong> von 1992 bis 2001 neu gestaltet. Die Schlachte wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong> einer beliebten Zone <strong>de</strong>r Gastronomie (Fressmeile).<br />
Auf <strong>de</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong>, <strong>de</strong>m Ort <strong>de</strong>s Bremer Freimarkts, wur<strong>de</strong>n zwischen 1990 und 2002 die Stadthalle vergrößert, ein Congresszentrum gebaut und mehrere Messehallen erstellt. Der<br />
Hauptbahnhof erhielt im Rahmen eines Umbaus (1995, 1998–2001) einen Ostausgang und damit durch eine Passage eine Fußgängerverbindung <strong>zu</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong>. Der Bahnhofsvorplatz<br />
wur<strong>de</strong> ebenfalls neu gestaltet.<br />
Hochschulentwicklung<br />
Die Universität Bremen wur<strong>de</strong> 1971 gegrün<strong>de</strong>t. Sie ist eine <strong>de</strong>r jüngeren Universitäten Deutschlands und hat ca. 20.000 Studieren<strong>de</strong> und über 1.500 Wissenschaftler. Die Gründungsphase<br />
verlief sehr kontrovers und führte <strong>zu</strong>r Beendigung <strong>de</strong>r Bremer Koalition zwischen SPD und FDP. 1973 wur<strong>de</strong> die Pädagogische Hochschule integriert. Gründungsrektor war von 1970 bis<br />
1974 Prof. Thomas von <strong>de</strong>r Vring. Das Bremer Mo<strong>de</strong>ll brachte <strong>de</strong>r Uni Bremen <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>n Ruf einer „roten Ka<strong>de</strong>rschmie<strong>de</strong>“ ein. Dieses Bild hat sich nach 1990 entschie<strong>de</strong>n gewan<strong>de</strong>lt.<br />
1982 entstand die Hochschule Bremen als eine Fachhochschule, durch die Fusion <strong>de</strong>r Hochschulen für Wirtschaft, für Technik, für Sozialpädagogik und Sozialökonomie und für Nautik.<br />
Sie hat rund 8000 Studieren<strong>de</strong> verteilt auf drei Standorte in Bremen-Neustadt.<br />
Von 1979 bis 1988 fand <strong>de</strong>r Integrationsprozess <strong>de</strong>r früheren Kunst- und <strong>de</strong>r Musikhochschule statt, die <strong>zu</strong>r Hochschule für Künste Bremen (HfK Bremen) vereinigt wur<strong>de</strong>n. Die älteste<br />
Vorläuferinstitution stammte von 1873. Mit <strong>de</strong>n Standorten im Speicher XI in <strong>de</strong>r Überseestadt und in <strong>de</strong>r Dechanatstraße (Bremen-Altstadt) hat sie rund 900 Studieren<strong>de</strong> und 300<br />
Mitarbeiter<br />
1999 wur<strong>de</strong> in Bremen-Grohn die Jacobs University Bremen (bis 2007: International University Bremen) als private Hochschule durch die Stadt Bremen, die Universität Bremen und die<br />
Rice University, Houston, Texas gegrün<strong>de</strong>t. Sie hat um 1100 Studieren<strong>de</strong> und 280 Mitarbeiter.<br />
21. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
2000 beschloss <strong>de</strong>r Senat die Umstrukturierung <strong>de</strong>r Alten Hafenreviere. 2003 entstand <strong>de</strong>r „Masterplan Überseestadt“. Das Gebiet wur<strong>de</strong> verstärkt erschlossen. Seit 2006 durchfährt die<br />
neue Straßenbahnlinie 3 Teile <strong>de</strong>s Gebiets. Angesie<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Großmarkt, im Speicher XI das Hafenmuseum sowie Bereiche <strong>de</strong>r Hochschule für Künste Bremen und gewerbliche<br />
Gebäu<strong>de</strong>. Im Quartier Überseepark sollen Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäu<strong>de</strong> entstehen. Im sogenannten Weser Quartier soll <strong>de</strong>r Weser Tower als höchstes Bürogebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt
gebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Brauerei Beck & Co wur<strong>de</strong> 2002 durch <strong>de</strong>n belgischen Konzern Interbrew (heute: InBev) übernommen.<br />
2004 wur<strong>de</strong>n das Rathaus und das Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r steinerne Bremer Roland, <strong>zu</strong>m UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.<br />
Eingemeindungen<br />
Wie die meisten ehemaligen Freien Reichsstädte konnte auch Bremen im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte neben <strong>de</strong>m eigentlichen Stadtgebiet umliegen<strong>de</strong> Dörfer für sich gewinnen. Das<br />
„Staatsgebiet“ <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt Bremen bestand daher aus <strong>de</strong>m eigentlichen Stadtgebiet, <strong>de</strong>m sog. „Landgebiet“, also einer Vielzahl von Landgemein<strong>de</strong>n, die später als Landkreis<br />
Bremen bezeichnet wur<strong>de</strong>n, und <strong>de</strong>r Stadt Vegesack, die sich aus einem alten Dorf nach Anlegung <strong>de</strong>s Hafens <strong>zu</strong> einem Flecken (ab 1794) und schließlich <strong>zu</strong> einer Kleinstadt (Stadtrecht<br />
seit 1850) entwickelt hatte. Von 1827 bis 1939 und dann wie<strong>de</strong>r ab 1947 gehörte Bremerhaven <strong>zu</strong>m Bremer Staatsgebiet also <strong>zu</strong>m Land Freie Hansestadt Bremen. Der Freihafen in<br />
Bremerhaven ist gleichzeitig eine Exklave <strong>de</strong>r Stadt Bremen, also ein Ortsteil <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> Bremen. Die Städte Bremerhaven und Vegesack sowie die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Bremer<br />
Landgebiets hatten mehr o<strong>de</strong>r weniger eine eigene Verwaltung beziehungsweise die Bürger dieser Gemein<strong>de</strong>n hatten an<strong>de</strong>re Rechte als die Bürger <strong>de</strong>r Stadt Bremen.<br />
Das eigentliche Stadtgebiet Bremens umfasste bis Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts nur die sogenannte Altstadt, die Neustadt (links <strong>de</strong>r Weser) und die außerhalb <strong>de</strong>r Wallanlagen gelegenen<br />
Vorstädte. Ab 1849 wur<strong>de</strong>n in mehreren Abschnitten benachbarte Landgemein<strong>de</strong>n in das Stadtgebiet eingeglie<strong>de</strong>rt. Dadurch verkleinerte sich <strong>de</strong>r Landkreis Bremen stetig, bis er 1945<br />
vollständig aufgelöst und seine Gemein<strong>de</strong>n in die Stadt Bremen eingeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n. Ab 1945 waren damit <strong>zu</strong>nächst Staatsgebiet und Stadtgebiet Bremens i<strong>de</strong>ntisch. Bremerhaven hieß<br />
<strong>zu</strong> jener Zeit Wesermün<strong>de</strong> und gehörte <strong>zu</strong>r preußischen Provinz Hannover. Erst seit 1947, als Bremerhaven wie<strong>de</strong>r in das Bremische Staatsgebiet <strong>zu</strong>rückgeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>, besteht das<br />
Land Freie Hansestadt Bremen (wie<strong>de</strong>r) aus zwei Städten.<br />
Im Einzelnen wur<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong>n in die Stadt Bremen eingeglie<strong>de</strong>rt (in Klammer <strong>de</strong>r Flächen<strong>zu</strong>wachs <strong>de</strong>s Stadtgebiets in Hektar):<br />
• 1. Januar 1849: Pagentorn, Utbremen, Pauliner Marsch, Stephanikirchwei<strong>de</strong> und Bürgerviehwei<strong>de</strong> (1.212 Hektar)<br />
• 3. Februar 1872: Stadtwer<strong>de</strong>r (205 Hektar)<br />
• 1875: Teile <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong>n Neuenland (Buntentor) und Woltmershausen (342 Hektar)<br />
• 1885: Teil <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Walle (28 Hektar)<br />
• 21. Oktober 1892: Teile <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong>n Walle und Gröpelingen (256 Hektar)<br />
• 1. April 1902: Landgemein<strong>de</strong>n: Bremen-Schwachhausen, Hastedt sowie Teile <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong>n Walle, Gröpelingen und Woltmershausen (2.770 Hektar)<br />
• 1. April 1921: Landgemein<strong>de</strong>n Oslebshausen, Neuenland sowie Teile <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong>n Oberneuland-Rockwinkel, Osterholz, Horn, Grambke, Arsten, Habenhausen und<br />
Rablinghausen (3.490 Hektar)<br />
• 1923: Teil <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Oberneuland/Rockwinkel (21 Hektar)<br />
• 1. April 1938: Hafengebiet <strong>de</strong>r Stadt Bremerhaven<br />
• 1. November 1939: Landgemein<strong>de</strong>n Büren, Grambkermoor und Lesumbrok sowie Stadt Vegesack (<strong>zu</strong>sammen 2.106 Hektar) und die <strong>zu</strong>r preußischen Provinz Hannover<br />
gehörigen Landgemein<strong>de</strong>n Aumund, Blumenthal, Farge, Grohn, Lesum und Schönebeck (alle Landkreis Osterholz) sowie Hemelingen, Arbergen und Mahndorf (bei<strong>de</strong> Landkreis<br />
Ver<strong>de</strong>n + Altkreis Achim) (<strong>zu</strong>sammen 6.787 Hektar). Die Kirchengemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ortsteils Achim-Bollen gehört <strong>zu</strong>r Kirche Arbergen und somit <strong>zu</strong>r Bremischen Lan<strong>de</strong>skirche.<br />
• 1. Dezember 1945: Landgemein<strong>de</strong>n Osterholz, Rockwinkel, Borgfeld, Lehester<strong>de</strong>ich, Blockland, Strom, Seehausen, Lankenau, Huchting, Arsten und Habenhausen<br />
Die damit erfolgte Auflösung <strong>de</strong>s Landkreises Bremen mit <strong>zu</strong>sammen 13.977 Hektar war eine Verwaltungsform innerhalb <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Bremen und nicht eine Erweiterung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
Bremen in das hannoversche/preußische Umland.<br />
Einwohnerentwicklung<br />
1350 hatte Bremen rund 20.000 Einwohner. Im Mittelalter und <strong>de</strong>r frühen Neuzeit wuchs die Bevölkerung <strong>de</strong>r Stadt nur langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und
Hungersnöte immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück.<br />
Mit Beginn <strong>de</strong>r Industrialisierung hatte Bremen 28.000 Einwohner (1748). Danach setzte in Bremen ein starkes Bevölkerungswachstum ein. Lag die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt 1812 noch<br />
bei nur 35.000, so überschritt diese schon 1875 die Grenze von 100.000, wodurch Bremen <strong>zu</strong> einer Großstadt wur<strong>de</strong>.<br />
1911 hatte die Stadt 250.000 Einwohner. 1939 stieg die Bevölkerungszahl durch die Eingemeindung von Vegesack und weiterer Gemein<strong>de</strong>n um 68.515 Personen. Bis 1956 wur<strong>de</strong>n es<br />
mehr als eine halbe Million Einwohner. 1969 erreichte die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt mit 607.184 ihren historischen Höchststand. Seit<strong>de</strong>m ist die Bevölkerungszahl wie<strong>de</strong>r gesunken. Seit<br />
wenigen Jahren hat sich dieser Trend aber wie<strong>de</strong>r gekehrt. Am 31. Dezember 2005 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ 546.852, am 1. November 2006 dann 548.477 Einwohner.<br />
Literatur<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Geschichte <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen. Band I bis V. Edition Temmen, Bremen 1995, ISBN 3-86108-283-7.<br />
• Konrad Elmshäuser: Geschichte Bremens. In: Beck'sche Reihe 2605, C. H. Beck Wissen. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55533-6.<br />
• Erich Keyser (Hrsg.): Nie<strong>de</strong>rsächsisches Städtebuch. Nie<strong>de</strong>rsachsen und Bremen. Kohlhammer, Stuttgart 1952 (ohne ISBN).<br />
• Werner Kloos, Reinhold Thiel: Bremer Lexikon. Ein Schlüssel <strong>zu</strong> Bremen. 3., überarbeitete Auflage. Hauenschild, Bremen 1997 (Erstausgabe 1977), ISBN 3-931785-47-5.<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. In zwei Bän<strong>de</strong>n. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-X<br />
(Erstausgabe 2002, Ergän<strong>zu</strong>ngsband A–Z 2008, ISBN 978-3-86108-986-5).<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Führer <strong>zu</strong> vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern. Band 2 – Bremen, Ver<strong>de</strong>n, Hoya. 1965, S. 22 ff<br />
2. ↑ Rudolf Stein: Romanische, gotische und Renaissance-Baukunst in Bremen. S. 17<br />
3. ↑ Erich Keyser: Die Entstehung von Bremen. In: Bremisches Jahrbuch Nr. 45. 1957<br />
4. ↑ Karolin Bubke: Die Bremer Stadtmauer, Staatsarchiv Bremen, 2007, ISBN 978-3-925729-48-5<br />
5. ↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: „Bannerlauf“ und „Verrat“ in Bremen 1365–1366, in Bremisches Jahrbuch, Band 53, 1975<br />
6. ↑ Philippe Dollinger: Die Hanse, Stuttgart, 1998, ISBN 3-520-37105-7<br />
7. ↑ Hartmut Müller: Untersuchungen <strong>zu</strong>r bremischen Ree<strong>de</strong>rei im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt, in Bremisches Jahrbuch, Band 53, 1975<br />
8. ↑ Diese Infragestellung und mühsam erkaufte Neubestätigung <strong>de</strong>r Reichsunmittelbarkeit durch benachbarte Flächenstaaten war in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Absolutismus nicht<br />
außergewöhnliches, vgl. Gottorper Vergleich zwischen Hamburg und Dänemark 1768.<br />
9. ↑ Das erste in Deutschland gebaute Dampfschiff war die Prinzessin Charlotte von Preußen, die 1816 auf <strong>de</strong>r Werft von John Barnett Humphreys in Pichelsdorf bei Spandau vom<br />
Stapel lief.<br />
10.↑ Peter Kuckuck: Kein roter Stern über Bremen: Ursachen, Entwicklung und Folgen einer Revolution. In: Karin Kuckuk: Im Schatten <strong>de</strong>r Revolution. Lotte Kornfeld - Biografie<br />
einer Vergessenen (1896 - 1974). Mit einem Geleitwort von Hermann Weber, einem Beitrag von Peter Kuckuk und einem Briefroman Lotte Kornfelds, Donat, Bremen 2009,<br />
ISBN 978-3-938275-48-1, S. 110.<br />
11.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Band 1: A–K. 2. aktualisierte, überarbeitete und erweiterte Auflage, Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-<br />
X, S. 156.<br />
12.↑ Christian Paulmann: Die Sozial<strong>de</strong>mokraten in Bremen, 1864-1964, Verlag Schmalfeldt, Bremen, 1964<br />
13.↑ Vierte Verordnung über <strong>de</strong>n Neuaufbau <strong>de</strong>s Reichs vom 28. September 1939<br />
14.↑ Günter Dannemann, Stefan Luft (Hrsg.): Die Zukunft <strong>de</strong>r Stadtstaaten, Kellnerverlag, 2006, Bremen
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Gelnhauser Privileg<br />
Das Gelnhauser Privileg[1] o<strong>de</strong>r Barbarossaprivileg ist ein Privileg, mit <strong>de</strong>m Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Jahre 1186 die Stadt Bremen als politische Körperschaft anerkannte, ihren<br />
Schutz und die Rechte ihrer Bürger – <strong>de</strong>r cives Bremensis civitatis (<strong>de</strong>r „Bürger <strong>de</strong>r Bremer Bürgerschaft“) – garantierte.[2]<br />
Das Gelnhauser Privileg, das mit Zustimmung von Bischof Hartwig II. ausgestellt wur<strong>de</strong>, legte fest, dass die Regierungsgewalt in <strong>de</strong>r Stadt nur mehr vom Kaiser und <strong>de</strong>r Bürgerschaft<br />
ausgehen sollte, nicht mehr von <strong>de</strong>r Kirche. Die Stadt unterstand somit direkt <strong>de</strong>m Kaiser und war formal eine freie Reichsstadt. Des Weiteren enthielt das Dokument Bestimmung über<br />
die Freiheit von Leibeigenen, die sich gemäß <strong>de</strong>m Rechtsgrundsatz Stadtluft macht frei ein Jahr und einen Tag in <strong>de</strong>r Stadt aufgehalten hatten, sowie Klauseln über <strong>de</strong>n Schutz von Erb-<br />
und Grun<strong>de</strong>igentum.<br />
Die Bestimmungen <strong>de</strong>s Privilegs beziehen sich auf Rechte, die vorgeblich bereits Karl <strong>de</strong>r Große auf Veranlassung von Bischof Willehad <strong>de</strong>r Stadt Bremen gewährt haben soll.[3]<br />
Literatur<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-X.<br />
• Thomas Hill: Die Stadt und ihr Markt. VSWG – Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Beihefte Nr. 172, Franz Steiner Verlag, Bremen 2004, ISBN 3-515-080-<br />
68-6.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Der Name bezieht sich auf die Kaiserpfalz Gelnhausen in <strong>de</strong>r es ausgestellt wur<strong>de</strong>.<br />
2. ↑ D F.I. 955<br />
3. ↑ Siehe Thomas Hill: Die Stadt und ihr Markt. VSWG – Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Beihefte Nr. 172, Franz Steiner Verlag, Bremen 2004, ISBN 3-<br />
515-080-68-6, S. 235<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Bremer Stadtmauer<br />
Die Bremer Stadtmauer entstand im Mittelalter und umschloss die Altstadt von Bremen<br />
Wie die meisten an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>utschen Städte <strong>de</strong>s Mittelalters hatte Bremen eine Stadtmauer, von <strong>de</strong>r jedoch nur Reste eines Halbturms erhalten sind, eingebun<strong>de</strong>n in das Haus Marterburg<br />
45.<br />
Im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt war nur <strong>de</strong>r Dombezirk ummauert, als so genannte Domburg. Ab 1229 wur<strong>de</strong> um die gesamte Altstadt eine Ringmauer gebaut, <strong>zu</strong>r Landseite hin halbkreisförmig. Im<br />
13. Jahrhun<strong>de</strong>rt weitete sich Bremen in Richtung Westen aus. Die neue Stephanivorstadt erhielt ab 1307 eine nur landseitige Mauer. Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>r ersten Backsteinphase <strong>de</strong>r<br />
Bremer Baugeschichte, wur<strong>de</strong> die Stadtmauer auf <strong>de</strong>r Weserseite in <strong>de</strong>n Hafenbereichen von Schlachte und Tiefer sukzessive durch die Giebelseiten gemauerter Speicherhäuser ersetzt, so<br />
dass an <strong>de</strong>r Schlachte von <strong>de</strong>r ursprünglichen Mauer nur noch die Schlachtpforten übrig blieben. Das Stephaniviertel erhielt an<strong>de</strong>rerseits erst Mitte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine Mauer auf<br />
<strong>de</strong>r Weserseite. Danach konnte 1551 die Mauer zwischen alten Stadtteilen und Stephaniviertel fallen. Zusätzliche Landwehren – sowohl rechts wie auch links <strong>de</strong>r Weser – sollte die Stadt<br />
im äußeren Vorfel<strong>de</strong> sichern. Durch die zehn Stadttore konnte kontrolliert die Stadt betreten wer<strong>de</strong>n. Zur Weserseite führten eine Vielzahl von Pforten durch die Mauer. Mauer- und<br />
Pulvertürme sollten die Stadtbefestigung sichern und Vorräte aufnehmen.<br />
Die Befestigung wur<strong>de</strong> landseitig um 1512 bis 1514 verstärkt. Die möglichen Belagerungskriege mit stärker wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kanonen machte es ab 1602 erfor<strong>de</strong>rlich, das Bremer<br />
Befestigungssystem mit neun Bollwerken vollkommen um<strong>zu</strong>bauen. Die Neustadt am linken Weserufer wur<strong>de</strong> ab 1620 mit sieben, dann acht Bastionen und zwei Toren in das<br />
Festungswerk einbezogen. Erst 1664 waren alle Bollwerksanlagen ausgebaut.<br />
Die Befestigungsanlagen wur<strong>de</strong>n in Ermangelung eines militärischen Wertes ab 1803 beseitigt und die Bremer Wallanlagen entstan<strong>de</strong>n bis 1811.<br />
Die ersten Befestigungen<br />
Die erste Befestigung in Bremen war die Domburg, die nur <strong>de</strong>n Dom und seine nächste Umgebung schützte. Deren Ummauerung wur<strong>de</strong> schon im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt unter Bischof Adalbert<br />
I. großenteils wie<strong>de</strong>r abgerissen, um Material für einen Ausbau <strong>de</strong>s Doms <strong>zu</strong> gewinnen. Ein Teil <strong>de</strong>s Verlaufes <strong>de</strong>r Mauer ist im Pflaster mitten auf <strong>de</strong>m Domshof erkennbar.<br />
Im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt gab es zeitweise keine leistungsfähigen Befestigungsanlagen. Vor einer Invasion Heinrichs <strong>de</strong>s Löwen flüchtete die Bevölkerung 1166/67 in umliegen<strong>de</strong> Sumpfgebiete.<br />
Aus dieser Zeit stammen jedoch die ersten Hinweise auf eine Stadtbefestigung. 1157 wur<strong>de</strong> ein Grundstück <strong>de</strong>s Bürgers Eccahard an das Domkapitel übertragen, welches da<strong>zu</strong> dienen<br />
sollte, einen vorhan<strong>de</strong>nen Befestigungswall (secus vallum) an <strong>de</strong>r Westseite <strong>de</strong>r Altstadt am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Obernstraße weiterführen <strong>zu</strong> können. Eine westliche Holz-Er<strong>de</strong>-Mauer mit<br />
vorgelagertem Graben quer über <strong>de</strong>n Bremer Dünenrücken fehlte offensichtlich noch, um Bremen vor Angriffen <strong>zu</strong> schützen. Vermutet wird, dass landseitig um die Altstadt ein<br />
Palisa<strong>de</strong>nzaun aus Holzplanken mit vorgelagertem Graben bereits bestand. Die Formulierung „muren un<strong>de</strong> planken“ im Bremer Stadtrecht von 1308/09 verweist auf auch<br />
Palisa<strong>de</strong>nwän<strong>de</strong>, die dann möglicherweise noch teilweise bis <strong>zu</strong>m Anfang <strong>de</strong>s 14. Jh. bestan<strong>de</strong>n haben könnten. [1] Verschie<strong>de</strong>ne archäologische Holzfun<strong>de</strong> im Bereich <strong>de</strong>r Stadtmauer<br />
belegen auch <strong>de</strong>n Palisa<strong>de</strong>nzaun.<br />
Die Stadtmauer nach 1229<br />
1229 wur<strong>de</strong>n Stadtmauern als „muros civitatis“ (Akk.) in einer Urkun<strong>de</strong> erwähnt; allerdings nur an <strong>de</strong>r Nordseite. [2] [3] Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Mauer im Westen an <strong>de</strong>r Weser beim<br />
Ethelin<strong>de</strong>nstein wird in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s späteren Fangturms vermutet. Zur Weser hin gab es noch keine Mauer. Auf <strong>de</strong>r Ostseite <strong>de</strong>r Altstadt wur<strong>de</strong> 1238 das Ostertor erwähnt. An <strong>de</strong>r<br />
Schlachte an <strong>de</strong>r Weser wur<strong>de</strong>n aber Reste von Rundpalisa<strong>de</strong>n gefun<strong>de</strong>n. In Konflikten zwischen Stadt und Erzbischof ließ <strong>de</strong>r Erzbischof um 1300 Teile <strong>de</strong>r Mauer wie<strong>de</strong>r abreißen. die<br />
Lücke wur<strong>de</strong> aber von <strong>de</strong>n Bürgern alsbald wie<strong>de</strong>r geschlossen. Die Befestigungsanlage verlief also um das Kirchspiel St. Ansgarii herum. Das Kirchspiel „sancti Stephani“ war danach<br />
nur <strong>zu</strong> einem geringeren Teil umschlossen.<br />
Zur befestigten Stadt gehörte also ein Gebiet rechts <strong>de</strong>r Weser, das von <strong>de</strong>r heutigen Hutfilterstraße bis <strong>zu</strong>m Schnoor und von <strong>de</strong>n Wallanlagen <strong>zu</strong>r Weser reichte. Mit seinen 10.000 bis
15.000 Einwohnern war Bremen am Anfang <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts rechtlich und tatsächlich eine Stadt mit Selbstverwaltung, Befestigung und Markt gewor<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r die Bürger, die<br />
Geistlichen sowie die Einwohner ohne Bürgerrechte lebten.<br />
An <strong>de</strong>r Weserseite zwischen <strong>de</strong>r Martinikirche und <strong>de</strong>m Fangelturm stand am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jh. ebenfalls zeitweise eine Mauer. 1297 wur<strong>de</strong> ein Grundstück erwähnt, auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Eigner<br />
ein Stück <strong>de</strong>r Stadtmauer dort selbst bauen sollte. Auch <strong>zu</strong>m Haus Werve an <strong>de</strong>r Schlachte gibt es in einer Urkun<strong>de</strong> Angaben <strong>zu</strong>r Lage <strong>de</strong>r Mauer. [4] Archäologische Fun<strong>de</strong> belegen<br />
Mauerreste südlich <strong>de</strong>r Langenstraße, wonach aber die Martinikirche außerhalb dieser Befestigungsanlage <strong>zu</strong>r Weser hin gelegen hat. [5]<br />
Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>r ersten Backsteinphase <strong>de</strong>r Bremer Baugeschichte, wur<strong>de</strong> die Stadtmauer auf <strong>de</strong>r Weserseite in <strong>de</strong>n Hafenbereichen von Schlachte und Tiefer nach und nach durch<br />
die Giebelseiten gemauerter Speicherhäuser ersetzt, so dass an <strong>de</strong>r Schlachte von <strong>de</strong>r ursprünglichen Mauer nur noch die Schlachtpforten übrig blieben.<br />
Das Stephaniviertel wird einbezogen<br />
Im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt weitete sich Bremen in Richtung Westen kräftig aus. Die Stadt bestand inzwischen aus vier Kirchspielen (Pfarrsprengeln): Liebfrauen, Stephani, Ansgarii und Martini.<br />
1304 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ratsherr Arnd von Gröpelingen ermor<strong>de</strong>t. Die „anständigen“ Ratsherren und Bürger vertrieben die „Geschlechter“, die ihrerseits dann Bremen belagerten. Deshalb wur<strong>de</strong><br />
danach das Stephaniviertel in die Stadtbefestigung einbezogen. Belegt ist ein Baubeginn wo die „stadtmure begundt umme sunte Steffens“ von 1307. Im westlichsten Teil war <strong>de</strong>r<br />
Mauerring nicht vollständig o<strong>de</strong>r nicht ausreichend.<br />
Deshalb blieb die vorhan<strong>de</strong>ne Mauer zwischen Altstadt und Stephaniviertel aus Sicherheitsgrün<strong>de</strong>n bestehen. Bei<strong>de</strong> Stadtteile waren nur über ein Tor – die Natel – miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n.<br />
Man unterschied im Bremer Stadtrecht zwischen unser stad muren (die alte Mauer) und <strong>de</strong>r stadmuren umme sunte Stephans.<br />
Die Mauer zwischen bei<strong>de</strong>n Stadtteilen wur<strong>de</strong> erst 1551 abgerissen, nach <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r westliche Mauerteil endgültig geschlossen wer<strong>de</strong>n konnte und da sie schnelle Truppenbewegungen im<br />
Inneren erschwerte. Teile <strong>de</strong>s Fundaments <strong>de</strong>r Stadtmauer zwischen Altstadt und Stephaniviertel sind im Hotel Überfluss zwischen Langenstraße und Schlachte erhalten.[6]<br />
Landwehren und Vorposten<br />
Weit vor <strong>de</strong>r Stadtmauer gab es Außenbefestigungen, sogenannten Landwehren, die teilweise natürliche Gegebenheiten nutzten. Die Verteidigungslinien rechts <strong>de</strong>r Weser und links <strong>de</strong>s<br />
Stromes waren nicht systematisch aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmt.<br />
Rechts <strong>de</strong>s Stroms gab es stadtnah weserabwärts <strong>de</strong>n Kumpfgraben und weseraufwärts <strong>de</strong>n Dobben („Dobben“ ist ein Synonym für „Graben“). Am Dobben stan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Pagenturm und<br />
<strong>de</strong>r Steinturm.<br />
Der Pagenturm mit einer Zugbrücke über <strong>de</strong>n Graben Dobben hieß früher Pagenthorn, was soviel wie Pfer<strong>de</strong>turm be<strong>de</strong>utete. Er wur<strong>de</strong> erstmals 1410 erwähnt. Das umliegen<strong>de</strong> Gebiet<br />
wur<strong>de</strong> vorher Ostendorf und Jerichow genannt, später dann nach <strong>de</strong>m Turm Pagentorner Dorf.<br />
Der Steinturm („Steenthorn“) wur<strong>de</strong> 1309 erbaut. Er stand am Übergang <strong>de</strong>r alten Heerstraße – heute Ostertorsteinweg – über <strong>de</strong>n Dobben. Er gab <strong>de</strong>r Straße Außerm Steintor <strong>de</strong>n<br />
Namen, die 1855 in Steintorssteinstraße und ab 1870 in Vor <strong>de</strong>m Steintor umbenannt wur<strong>de</strong>. So leitet sich auch <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>s Steintorviertes von diesem Turm ab. Er wur<strong>de</strong><br />
wahrscheinlich im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt abgerissen.<br />
Eine äußere Verteidigungslinie rechts <strong>de</strong>r Weser bil<strong>de</strong>ten die Lesum, <strong>de</strong>ren Übergang mit <strong>de</strong>r Burg in Burg-Grambke gesichert war, die Wümme, an <strong>de</strong>r eine Burg in Borgfeld stand, sowie<br />
im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine befestigte Landwehr in Horn und in Osterholz<br />
Links <strong>de</strong>r Weser bil<strong>de</strong>te die Ochtum die wichtigste äußere Verteidigungslinie. Zur Sicherung ihrer Übergänge dienten <strong>de</strong>r Warturm (heute Gasthaus „Storchennest“) im Westen und <strong>de</strong>r<br />
Kattenthorn (Kattenturm) im Sü<strong>de</strong>n. Auch die Varreler Bäke und <strong>de</strong>r Stellgraben können als Landwehr gedient haben.<br />
Die Landwehren verschwan<strong>de</strong>n im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt.
Die Konstruktion<br />
Die ersten Befestigungsanlagen bestan<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Mauer, <strong>de</strong>m äußeren Stadtgraben und einem da<strong>zu</strong>gehören<strong>de</strong>n unbebautem Feld. Die Mauer wur<strong>de</strong> als Zweischalen-Backsteinmauer aus<br />
Ziegeln im Klosterformat auf einem Findlingsfundament (Höhe 80–90 cm) errichtet. Sie war unten bis <strong>zu</strong> 1,0–1,3 m und oben bis <strong>zu</strong> 0,9–1 m stark. Eine übliche Höhe von 4,50 bis 6,50<br />
m kann wie <strong>de</strong>r Kranz aus Schießscharten und <strong>de</strong>r Wehrgang sicherlich angenommen wer<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>r Ausgrabung „Marterburg 53/54“ von 1950 sind alle 6 Meter etwa 1,50 m<br />
vorspringen<strong>de</strong> aussteifen<strong>de</strong> Strebepfeiler belegt wor<strong>de</strong>n. Es wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Mauer- und Mauerturmreste an verschie<strong>de</strong>n Stellen bei Ausgrabungen gefun<strong>de</strong>n. [7]<br />
Die neuere, massive Mauer um Stephani grün<strong>de</strong>te nur auf Sand. Sie war unten um 1,80–2,2 m und oben bis <strong>zu</strong> 1,2 m dick. Auch von <strong>de</strong>r neuen Stadtmauer und seinen Türmen wur<strong>de</strong>n<br />
durch Ausgrabungen Reste gefun<strong>de</strong>n. [8]<br />
Die Stadttore<br />
Die Stadttore entstan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Stadtmauer, <strong>zu</strong>nächst also um 1229 und dann bei <strong>de</strong>r Einbeziehung <strong>de</strong>r Stephanistadt in das Befestigungssystem, also ab 1307. Die folgen<strong>de</strong>n<br />
Stadttore wur<strong>de</strong>n erstmals erwähnt:<br />
• 1229 das Her<strong>de</strong>ntor als „portam gregum“ im Nor<strong>de</strong>n, als Weg <strong>de</strong>r Viehher<strong>de</strong>n (heute Her<strong>de</strong>ntorsteinweg) <strong>zu</strong>r Bürgerwei<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> 1664 erweitert. Der Turmabriss erfolgte<br />
1802/04, <strong>de</strong>r Restabriss 1826.<br />
• 1238 das Ostertor als „valvam orientalem civitatis nostre“ im Osten wur<strong>de</strong> um 1512/14 <strong>zu</strong>m Osterzwinger ausgebaut. Der Torturm aus <strong>de</strong>m 14. Jh. wur<strong>de</strong> 1624 teilweise und 1828<br />
ganz abgerissen. Um 1644 erfolgte die Erweiterung um eine zweite Toranlage. 1802/04 erfolgten Abrisse und <strong>de</strong>r Bau von einem kleinen Wachhaus. Die bei<strong>de</strong>n heute noch<br />
bestehen<strong>de</strong>n Torgebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n 1849 im Bereich <strong>de</strong>r Kunsthalle gebaut. Das Ostertorviertel und <strong>de</strong>r Ostertorsteinweg erinnern an das Tor<br />
• 1247 das Fischertor als „porta“ „piscatoriam“ bzw. „Vischerporten“ ist ein Durchgang an <strong>de</strong>r 1. Schlachtpforte <strong>zu</strong>r Schlachte.<br />
• 1274 das Bischofstor o<strong>de</strong>r die Bischofsna<strong>de</strong>l als „Acus episcopi“ war ein enger Durchgang für die Geistlichkeit im Nordosten; Abriss 1802/04, 1838 erfolgte <strong>de</strong>r Bau eines<br />
kleinen Wachhauses mit gusseiserner Toranlage in <strong>de</strong>n Wallanlagen, welches heute ein Verkaufshaus ist. Die heutige kleine Straße Bischofsna<strong>de</strong>l führte <strong>zu</strong>m Tor.<br />
• 1284 das Stephanitor, <strong>zu</strong>nächst als Steintor als „portam lapi<strong>de</strong>am“ bzw. 1299 dann als Stephanitor – „portam sancti Stephani“ – im Westen. Dieses Tor könnte sich in <strong>de</strong>r Mauer<br />
um die St. Stephanikirche befun<strong>de</strong>n haben, ist also kein Stadttor. Das Stephanitor als Stadttor wur<strong>de</strong> nach 1307 in das erweiterte Befestigungssystem einbezogen. Zwei<br />
Rundtürme mit Kegeldach flankierten das Tor. Ein Giebel- und Turmabriss erfolgte 1547. Nach 1602 wird die Toranlage weiter nach Außen verlegt um Teil <strong>de</strong>r neuen<br />
Wallanlagen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n. Ein Ausbau <strong>de</strong>r Toranlage erfolgte 1660, die dann 1802/04 abgebrochen wur<strong>de</strong>. Heute zeugen noch <strong>de</strong>r Stephanitorsteinweg o<strong>de</strong>r die Straße Stephanitor<br />
von <strong>de</strong>m Bauwerk.<br />
• 1299 das Ansgariitor als „portam sancti Anscharii“ im Nord-Westen; auch Schuldturm <strong>de</strong>r Stadt; Torabriss um 1802/04, Turmabriss 1831. Die Ansgaritorstraße erinnert an das<br />
Tor.<br />
• 1324 das Abbentor als „portam Abonis“ bzw. „abendtore“ im Nordwesten an <strong>de</strong>r heutigen Abbentorstraße entstand <strong>zu</strong>nächst als Pforte um 1200; es wur<strong>de</strong> nach 1305 in die<br />
erweiterte Befestigungsanlage einbezogen. Die Turmbauten wur<strong>de</strong>n 1547 abgerissen.<br />
• 1366 das Brückentor als „brughedor“ im Sü<strong>de</strong>n. Ein Tor musste es aber schon 1244 nach <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r ersten Weserbrücke gegeben haben. 1554 wur<strong>de</strong> hier ein neues Brückentor<br />
gebaut.<br />
• Die „Natel“ („<strong>de</strong> Natlen“) – das älteste Stephanitor – war ein Tor im Westen nördlich vom Kornhaus und vom Fangturm am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Langestraße, welches um o<strong>de</strong>r bald nach<br />
1229 entstan<strong>de</strong>n sein muss (Archäologische Fun<strong>de</strong> von 1955). Nach Ergän<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadtmauer um die Stephanistadt war dieses Tor die einzige Verbindung zwischen Altstadt und<br />
Stephanstadt. Es wur<strong>de</strong> 1657/59 abgerissen.<br />
• 1367 das Doventor, das um 1307 entstand, als das Stephaniviertel in die Befestigungsanlagen einbezogen wur<strong>de</strong>. Ein Giebelabriss erfolgte 1547. Danach zierte eine Windmühle<br />
<strong>de</strong>n Torturm. Das Tor wur<strong>de</strong> 1802/04 abgebrochen und es erfolgte <strong>de</strong>r Bau zweier Wachhäuser für Wache und Akzise-Meister, die bei<strong>de</strong> 1944 zerstört wur<strong>de</strong>n. Die Doventorstraße<br />
führte <strong>zu</strong>m ehemaligen Tor. Das Stadtteilquartier Dovetor sowie <strong>de</strong>r Doventorsteinweg und <strong>de</strong>r Doventors<strong>de</strong>ich erinnern an das Tor.<br />
In <strong>de</strong>r Neustadt gab es bei <strong>de</strong>m Ausbau <strong>de</strong>s Befestigungssystems auf <strong>de</strong>r linken Weserseite um 1620 nur zwei Durchlässe durch <strong>de</strong>n Wall, das Hohentor und das Buntentor
• Das Hohentor im Westen <strong>de</strong>r Neustadt entstand um 1620. Es hieß <strong>zu</strong>nächst Westertor und auch Delmenhorster Tor. Den hohen Giebel schmückte das Bremer Wappen und<br />
darunter sechs Ratsherrenwappen. Die in <strong>de</strong>r Grünanlage aufgestellte Justitia soll das Torhaus geschmückt haben. Um 1810 entstan<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r Festungsanlagen<br />
hier zwei Wachtore. Es entstan<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>m Tor ein Wach- und ein Akzisehaus im klassizistischen Stil mit vier vorgezogenen dorischen Säulen. 1844 wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r<br />
Aufhebung <strong>de</strong>r Torsperren die Wachhäuser als Wohnhäuser genutzt. Um 1825 wur<strong>de</strong> das Tor abgerissen und die Wachhäuser 1944 zerbombt. Der Ortsteil Hohentor, die Straße<br />
Am Hohentorsplatz und <strong>de</strong>r Hohentorsplatz erinnern an das Tor.<br />
• Das Buntentor gehörte auch <strong>zu</strong>r Neustadter Befestigungsanlage aus <strong>de</strong>r Zeit um 1620. Es hieß <strong>zu</strong>erst Sü<strong>de</strong>rtor. Es war <strong>zu</strong>nächst ein schmuckloses Tor. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts entstand ein Tor mit einem Dreiecksgiebel mit <strong>de</strong>m Bremer Wappen wie im Hohentor. 1819 entstan<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>m Tor wie beim Hohentor ein Wach- und ein<br />
Akzisehaus. Das Tor wur<strong>de</strong> 1861 abgerissen und die Wachhäuser 1944 durch Bomben zerstört. Der Ortsteil Buntentor und <strong>de</strong>r Buntentorsteinweg sind nur noch Hinweise auf das<br />
Tor. Die Bastionsstraße erinnert an die Bastion.<br />
Die Pforten<br />
Neben <strong>de</strong>n Toren führten nach und nach eine Vielzahl von Pforten durch die Mauer <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n davor liegen<strong>de</strong>n Gärten o<strong>de</strong>r – wo es <strong>zu</strong>r Weser hin keine Stadtmauer gab – durch die<br />
Häuserfront an <strong>de</strong>n Weserhafen, die Schlachte und die Weser.<br />
• Die nachfolgen<strong>de</strong>n Schlachtpforten führten <strong>zu</strong>m Schlachtehafen: 1. Schlachtpforte, Josephsgang, Ulenstein, 2. Schlachtpforte, Heimlichenpforte, Ansgaritränkpforte, Kranpforte,<br />
Düsternpforte, Zingelpforte, Letzte Schlachtpforte. Die Pforten schlossen <strong>zu</strong>r Weser bündig mit <strong>de</strong>n angrenzen<strong>de</strong>n Häusern an <strong>de</strong>r Schlachte ab.<br />
• Die zwei Holz-Pforten (Holtporten und kleine Holtporten) führten im östlichen Bereich <strong>zu</strong>m Hol<strong>zu</strong>mschlageplatz an <strong>de</strong>r Tiefer.<br />
• Weitere Pforten waren u.a. die Adams-Pforte mit <strong>de</strong>m Adamsturm zwischen Stephani- und Dovetor, sowie die Hasen-Pforte und die Nagels-Pforte und weitere private<br />
Durchgänge.<br />
• Die kleine Pforte Brill (= Loch, Abortöffnung) befand sich an <strong>de</strong>r Ecke Faulenstraße/Wenkenstraße/Hankenstraße und gab <strong>de</strong>m heutigen Platz und <strong>de</strong>r Straße Am Brill und <strong>de</strong>r<br />
Straße Hinterm Brill seinen Namen.<br />
14 kleine Brücken verban<strong>de</strong>n die Wege von <strong>de</strong>n Toren und Pforten <strong>zu</strong>r Wasserseite.<br />
Die Türme<br />
Die Mauertürme<br />
Zur Sicherung <strong>de</strong>r Maueranlage wur<strong>de</strong>n eine Reihe von Türmen und Türmchen gebaut. In <strong>de</strong>n Überlieferungen – <strong>zu</strong>m Beispiel im Rats<strong>de</strong>nkelbuch – wur<strong>de</strong>n einige <strong>de</strong>r Türme auch<br />
namentlich benannt. In alten Auflistungen sind alleine 19 Türme benannt wor<strong>de</strong>n wie etwa <strong>de</strong>r „Schepels thorn“, <strong>de</strong>r „lange thorn“, „<strong>de</strong> thorn by <strong>de</strong>r holtporthen“ und „<strong>de</strong> thorn<br />
darbaven“, <strong>de</strong>r „blin<strong>de</strong>n thorn“. Bekannter waren:<br />
• Der halbrun<strong>de</strong> „Adams thurm“ bei <strong>de</strong>r Adamspforte in <strong>de</strong>r Mauer um Stephanistadt in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Doventors wur<strong>de</strong> auch als Pulverturm genutzt.<br />
• Der halbrun<strong>de</strong> „Rabenturm“ nahe beim Ostertor, <strong>de</strong>r 1900 freigelegt und 1903 abgerissen wur<strong>de</strong> und <strong>de</strong>r um 1870 noch erreichbar gewesen seien soll.<br />
Die Pulvertürme<br />
Als Pulvertürme bezeichnete man seit <strong>de</strong>m Mittelalter drei große Rundtürme, in <strong>de</strong>nen die für <strong>de</strong>n Kriegsfall benötigten Pulvervorräte, Waffen und Munitionen gelagert wur<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n<br />
Erdgeschossen <strong>de</strong>r Pulvertürme wur<strong>de</strong> auch Gefangene inhaftiert, wodurch die Türme oftmals auch als Zwinger bezeichnet wur<strong>de</strong>n. Es gab<br />
• <strong>de</strong>n Ostertorzwinger, <strong>de</strong>r kleinste Pulverturm von 1514, <strong>de</strong>r am östlichen Tor stand (explodiert 1624, wie<strong>de</strong>rerrichtet),<br />
• <strong>de</strong>n Stephanitorzwinger (Bräutigam), <strong>de</strong>r größere Turm von 1525 bis 1534, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Stephanitores stand und <strong>de</strong>r Bräutigam genannt wur<strong>de</strong> (explodiert 1647) und<br />
• <strong>de</strong>n Herrlichkeitzwinger (Braut), <strong>de</strong>r größte Turm von 1522, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Herrlichkeit, einer Halbinsel zwischen <strong>de</strong>r großen und <strong>de</strong>r kleinen Weser stand und <strong>de</strong>r die Braut genannt
wur<strong>de</strong> (explodiert 1739).<br />
Ausbau <strong>de</strong>s Befestigungssystems<br />
Die Befestigungen wur<strong>de</strong>n Anfang <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter Bürgermeister Daniel von Büren <strong>de</strong>m Älteren ausgebaut und <strong>de</strong>n neuesten wehrtechnischen Bedingungen angepasst.<br />
Landseitig erfolgte die Verstärkung zwischen 1512 bis 1514 durch vertiefte Gräben, durch <strong>zu</strong>sätzliche Erdwälle und Zwingertürme (<strong>de</strong>m Ostertorzwinger und auf <strong>de</strong>r Herrlichkeit die so<br />
genannte „Braut“) und durch verbesserte Kanonenbestückung. An <strong>de</strong>r Weser wur<strong>de</strong> 1535 <strong>de</strong>r Stephanizwinger (auch „Bräutigam“ genannt) – ein in <strong>de</strong>n Fluss vorspringen<strong>de</strong>s Bollwerk –<br />
gebaut, <strong>de</strong>r mit Geschützen diesen Stadtteil mit seiner wasserseitigen Mauer bis <strong>zu</strong>m Fangturm schützen sollte. Ansonsten war die Weserseite <strong>zu</strong>r Altstadt weitgehend offen, also eine<br />
Schwachstelle im Befestigungssystem. Erst 1547 wur<strong>de</strong>, auf Grund <strong>de</strong>r Belagerungen <strong>de</strong>s kaiserlichen Heers im Schmalkaldischen Krieg, ein Ausbau <strong>de</strong>r Anlage eilig durchgeführt.<br />
Zugleich mussten auch einige Tore <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r Kriegstechnik angepasst wer<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong>n die Türme von Stephani-, Doven- und Abbentor abgerissen, um feindlichem<br />
Kanonenbeschuss kein Ziel <strong>zu</strong> bieten.<br />
Einige Bürger protestierten gegen <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>s Befestigungssystems, wahrscheinlich weil die Stadt lange von kriegerischen Ereignissen verschont geblieben war. Die akuten<br />
Gefährdungen aber veranlassten die Stadtoberen, zwischen Fangturm und Stephanibollwerk eine Mauer <strong>zu</strong>r Weser hin errichten <strong>zu</strong> lassen.<br />
Der Stadtplan von Franz Hogenberg zeigt die Stadtbefestigung um 1598: Zur Landseite ist die Altstadt außer von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Mauer von einem Wall und ange<strong>de</strong>uteten<br />
Rundbastionen und <strong>de</strong>m noch geradlinigen Graben umschlossen. Zur Weser hin gibt es nur vor <strong>de</strong>r Stephanistadt und <strong>de</strong>m Schnoor eine Stadtmauer. Die Schlachte ist zwischen Fangturm<br />
und <strong>de</strong>r Mauer <strong>de</strong>s Martinikirchhofs abgesehen von <strong>de</strong>n Schlachtpforten ohne militärische Sicherung. Am Tiefer und in einem Teil <strong>de</strong>r Stephanistadt stehen Han<strong>de</strong>lshäuser mit Fenstern<br />
<strong>zu</strong>m Fluss direkt am Weserufer. Die fünf großen Stadttore Stephani-, Doven-, Ansgari-, Her<strong>de</strong>n- und Ostertor führen mit Brücken über <strong>de</strong>n Graben ins Lan<strong>de</strong>sinnere. Die Bischofspforte<br />
(heute Bischofsna<strong>de</strong>l) gibt es anscheinend noch nicht. Im Sü<strong>de</strong>n befin<strong>de</strong>t sich in Verlängerung <strong>de</strong>r Balgebrückstraße die Weserbrücke mit einem Tor auf <strong>de</strong>r Altstadtseite und <strong>de</strong>m<br />
Wehrturm „Braut“ zwischen Weser und Kleiner Weser. Die Braut ist durch eine Wallbastion und einen Graben gesichert, <strong>de</strong>r gleichzeitig <strong>de</strong>n Teerhof vom Stadtwer<strong>de</strong>r trennt. Auf <strong>de</strong>r<br />
Südseite <strong>de</strong>r Kleinen Weser gibt es noch keine Befestigung; die Neustadt ist noch nicht angelegt.<br />
Die Befestigung mit Bastionen<br />
Die möglichen Belagerungskriege <strong>de</strong>r Zeit um 1600 mit stärker wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kanonen machte es erfor<strong>de</strong>rlich, das Bremer Befestigungssystem vollkommen um<strong>zu</strong>bauen. Die bisherigen<br />
kleineren Ron<strong>de</strong>lle als Vorsprünge in <strong>de</strong>r Mauer reichten nicht aus. Sie hatte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m <strong>zu</strong> große, nicht einsehbare „tote“ Winkel. Mo<strong>de</strong>rne Verteidigungsanlagen und Festungen benötigten<br />
aber vorgezogene Verteidigungspunkt, die Bastionen. Als Bastion wird so ein aus <strong>de</strong>m Hauptwall hervorspringen<strong>de</strong>s, nach hinten offenes Festungswerk mit in <strong>de</strong>r Regel fünfeckigem<br />
Grundriss bezeichnet. Die Schusslinien <strong>de</strong>r postierten Geschütze von <strong>de</strong>n benachbarten Werken vermie<strong>de</strong>n so einen toten Winkel. Erste Bastionen wur<strong>de</strong>n En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
bereits in Italien erbaut.<br />
Ab 1599 bemühte sich <strong>de</strong>r Rat um erfahrene Festungsbauer. Wilhelm Ludwig, Graf von Nassau-Dillenburg schlägt <strong>de</strong>m Rat dafür (General) Johan van Rijswijk aus Mid<strong>de</strong>lburg vor, <strong>de</strong>r<br />
gera<strong>de</strong> in Lippero<strong>de</strong> Festungspläne entwickelt hatte und dort noch tätig war, so dass er erst 1601 beginnen konnte. Rijswijck beschrieb die vorhan<strong>de</strong>nen Mängel und sprach sich für eine<br />
Befestigungsanlage „mitt sieben Bollwerken“ auf <strong>de</strong>r Neustadtseite aus, und für einen totalen Umbau <strong>de</strong>r Anlagen vor <strong>de</strong>r Altstadt. 1602 begann man mit <strong>de</strong>n Baumaßnahmen im Westen<br />
zwischen Weser bis <strong>zu</strong>m Dovetor und nach Unterbrechungen im Bereich Ostertor bis Her<strong>de</strong>ntor. 1611 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländische Rijswijck-Schüler Johan van Valckenburgh (* um 1575,<br />
† 1625) erstmals und nur zeitweise als Planer <strong>de</strong>r Festungsanlagen in Bremen tätig. Erst 1623 – <strong>de</strong>r Dreißigjährige Krieg hatte begonnen – wur<strong>de</strong>n die Anlagen links <strong>de</strong>r Weser auf <strong>de</strong>r<br />
Basis <strong>de</strong>r Pläne von Rijswijck und Valckenburgh in Angriff genommen und 1627 vollen<strong>de</strong>t. Die Bremer Neustadt wur<strong>de</strong> weniger aus Platzbedarf angelegt, <strong>de</strong>nn um Bremen und seinen<br />
Hafen ringsherum durch Befestigungsanlagen <strong>zu</strong> schützen. Merian zeigt in seinem Plan von 1638/41 bereits fünf Fünfeckbastionen im Westen und Osten <strong>de</strong>r Altstadtseite, wovon die<br />
östlichen <strong>de</strong>m alten Graben vorgelagert sind. Auf <strong>de</strong>r Neustadtseite (die kleine Weser ist einbezogen) befand sich nun eine mo<strong>de</strong>rne Stadtbefestigung aus Wällen mit acht Bastionen. Mit<br />
<strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Anlagen waren die finanziellen Möglichkeiten Bremens beinahe erschöpft.<br />
Erst 1660 bis 1664 konnten die vorhan<strong>de</strong>nen Bollwerksanlagen auf <strong>de</strong>r Altstadtseite mo<strong>de</strong>rnisiert und weiter ausgebaut wer<strong>de</strong>n. Der Plan von Kupferstecher Caspar Schultze und Rektor<br />
Gerhard Meier aus <strong>de</strong>m Jahre 1664 zeigt <strong>de</strong>n Abschluss <strong>de</strong>s Umbaus <strong>de</strong>r Befestigungsanlagen. neun Bastionen auf <strong>de</strong>r Altstadtseite und eine kleine Torbastion vor <strong>de</strong>m Ostertor sowie
acht Bastionen auf <strong>de</strong>r Neustadtseite.<br />
Diese Befestigungsanlage hatte nur eine Bewährungsprobe <strong>zu</strong> bestehen, als 1666 die Schwe<strong>de</strong>n die Stadt erfolglos auf <strong>de</strong>r linken Weserseite belagerten. Dieser Krieg konnte durch <strong>de</strong>n<br />
Habenhauser Frie<strong>de</strong>n beigelegt wer<strong>de</strong>n.<br />
Liste <strong>de</strong>r Bastionen<br />
(Von Osten nach Westen)<br />
Altstadtseite:<br />
• Ostertorbastion<br />
• Junkernbastion<br />
• Bischofsna<strong>de</strong>lbastion<br />
• Her<strong>de</strong>ntorbastion<br />
• Gießhausbastion<br />
• Ansgariibastion<br />
• Doventorbastion<br />
• Sanddünenbastion<br />
• Stephanibastion<br />
Neustadtseite:<br />
• Wer<strong>de</strong>rbastion<br />
• Schulortbastion<br />
• Buntebrückebastion<br />
• Schwarzpottbastion<br />
• Hohentorbastion (Ost)<br />
• Hohentorbastion (West)<br />
• Stein-Corps-<strong>de</strong>-Gar<strong>de</strong>-Bastion<br />
• Weserbastion<br />
Überreste, weitere Entwicklung<br />
Neue Durchgänge wur<strong>de</strong>n genehmigt, die Häuserbebauung rückte auch näher an die Mauern und einige Bürger bezogen die Mauer – erlaubt o<strong>de</strong>r nicht erlaubt – in ihre Bauten mit ein.<br />
Hier und dort wur<strong>de</strong> die Mauer auch baufällig und <strong>de</strong>r hohe Senat hatte <strong>zu</strong> wenig Geld, um zeitgerecht Renovierungen durchführen <strong>zu</strong> lassen. Die Mauerteile wur<strong>de</strong>n oft als Teile <strong>de</strong>r<br />
vorhan<strong>de</strong>nen Bebauungen umbaut. Im Wallbereich stan<strong>de</strong>n inzwischen sieben Mühlen. 1792 wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Junkernbastion am Ostertor ein Schauspielhaus gebaut.<br />
Am 27. September 1796 beschlossen <strong>de</strong>r Rat und die Bürgerschaft die Abtragung <strong>de</strong>s Brautwalles mit seiner die Weser sichern<strong>de</strong>n Bastion auf <strong>de</strong>r Weserhalbinsel zwischen <strong>de</strong>r Alt- und<br />
<strong>de</strong>r Neustadt. Damit war ein erster Schritt <strong>zu</strong>r Entfestigung Bremens eingeleitet. Die Stadt verfolgte damit <strong>de</strong>n Überlegungen, dass er sinnvoller seien könnte, Bremen <strong>de</strong>n<br />
Festungscharkter <strong>zu</strong> nehmen, damit an<strong>de</strong>re Mächte sich nicht in Bremen dauerhaft festsetzen könnten.[9]<br />
Die Abtragung <strong>de</strong>r Wälle erfolgte ab 1802/03. Von 1802 bis 1804 wur<strong>de</strong>n viele Teile <strong>de</strong>r Mauer, die Brustwehren und die Tore abgerissen (s. o.). Statt<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong>n klassizistische<br />
Wachhäuser errichtet, erhalten am Ostertor, an <strong>de</strong>r Bischofsna<strong>de</strong>l und am Ansgaritor. Die Anlage aus Gräben und Bastionen wur<strong>de</strong>n nach Plänen von Christian Ludwig Bosse und Isaak
Altmann von 1803 bis 1811 <strong>zu</strong> einem englischen Park umgestaltet, bei <strong>de</strong>r – wenn auch abgerun<strong>de</strong>t – die Zick-Zack-Form <strong>de</strong>r Bollwerke gut erkennbar sind. Teile dieser Wallanlagen<br />
fielen – vor allem im Westen – <strong>de</strong>n Verkehrsbauten nach und nach – <strong>zu</strong>letzt 2006/07 – <strong>zu</strong>m Opfer.<br />
Von <strong>de</strong>r Stadtmauer sind nur noch Reste eines Halbturms erhalten, eingebun<strong>de</strong>n in das Haus Marterburg 45 im Schnoor. Des Weiteren sind die archäologischen Befun<strong>de</strong> und Erkenntnisse<br />
durch die Ausgrabungen bei <strong>de</strong>r Bebauung vieler Häuser Am Wall bis <strong>zu</strong>m Schnoor gesichert.<br />
Literatur und Pläne<br />
Literatur<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-X.<br />
• Karolin Bubke: Die Bremer Stadtmauer. Schriftliche Überlieferung und archäologische Befun<strong>de</strong> eines mittelalterlichen Befestigungsbauwerks. Staatsarchiv Bremen, Bremen<br />
2007, ISBN 978-3-925729-48-5 (Veröffentlichungen aus <strong>de</strong>m Staatsarchiv <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen Bd. 68).<br />
• Manfred Rech: Gefun<strong>de</strong>ne Vergangenheit – Archäologie <strong>de</strong>s Mittelalters in Bremen. Der Lan<strong>de</strong>sarchäologe Bremen, Bremen 2004, ISBN 3-7749-3233-6 (entstan<strong>de</strong>n als<br />
Begleitband <strong>zu</strong> einer Ausstellung <strong>de</strong>s Fockemuseums, dort weiterhin erhältlich).<br />
• Friedrich Prüser: Die Schlachte. Bremens alter Uferhafen. Verlag Robert Bargmann, Bremen 1957.<br />
Historische Pläne mit Stadtmauer bzw. Befestigungsanlage<br />
• Hans Weigel († um 1578): weserseitige Bremer Stadtansicht von 1550/1564<br />
• Franz Hogenberg (1535–1590): Plan Brema von 1574 bzw. 1588/89<br />
• Jürgen Landwehr (1580-1646): Ölgemäl<strong>de</strong> im Rathaus von 1602 o<strong>de</strong>r 1617<br />
• Matthäus Merian d. Ält. (1593–1650): Vogelschauplan von Bremen von 1640/1641<br />
• Johann Landwehr: Stadtansicht aus <strong>de</strong>r Vogelperspektive mit Neustadt und Altstadt von 1661<br />
• Caspar Schultze (1635–1715): Plan von Bremen von 1664 und 1690<br />
• Johann Daniel Heinbach (1694–1764), Stadtpläne von 1734 und 1757<br />
• Carl Ludwig Murtfeldt (1745–1820 und Georg Heinrich Tischbein (1753–1848): Murtfeldtsche Karte von Bremen von 1796<br />
• Christian Adolf Eltzner (1816–1891): Plan von Bremen aus <strong>de</strong>r Vogelperspektive von Südosten, Leipzig 1851<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Manfred Rech: Gefun<strong>de</strong>ne Vergangenheit – Archäologie <strong>de</strong>s Mittelalters in Bremen, S. 86f<br />
2. ↑ Karolin Bubke: Die Bremer Stadtmauer, S. 24, S. 32f<br />
3. ↑ Manfred Rech: Gefun<strong>de</strong>ne Vergangenheit – Archäologie <strong>de</strong>s Mittelalters in Bremen, S. 87f<br />
4. ↑ Manfred Rech: Gefun<strong>de</strong>ne Vergangenheit – Archäologie <strong>de</strong>s Mittelalters in Bremen, S. 89, 90<br />
5. ↑ Karolin Bubke: Die Bremer Stadtmauer, S. 296<br />
6. ↑ Foto: http://www.xxx<br />
7. ↑ (Altenwall 18, 24; Am Wall 115–117, 127–134, 166/167, 187/188, 200; Ostertorwallstraße 15, 40/42; Her<strong>de</strong>ntorwallstraße 2; Spitzenkiel 5-8, Langenstraße 42/44, 68, 76,<br />
Jacobistr. 20; Schlachte 34/36<br />
8. ↑ u.a.: Grafenstraße 11, Faulenstraße 107<br />
9. ↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Geschichte <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen. Band I , S. 520. Edition Temmen, Bremen 1995, ISBN 3-86108-283-7.
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremer Wallanlagen<br />
Die Bremer Wallanlagen sind hervorgegangen aus <strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt erbauten Befestigungsanlagen und heute eine beliebte Parkanlage am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bremer Altstadt. Sie sind<br />
nicht nur Bremens älteste, son<strong>de</strong>rn auch die erste öffentliche Parkanlage in Deutschland, die durch eine bürgerliche Volksvertretung realisiert wur<strong>de</strong>.<br />
Geschichte<br />
Anfänge <strong>de</strong>r Stadtbefestigung<br />
Bremen war als klassisches Runddorf vermutlich seit Anfang an, also seit 782, durch einen Holzwall geschützt. Dieser wur<strong>de</strong> spätestens um 1229 durch eine auf Findlingen gebaute<br />
Backsteinmauer ersetzt. Einige Quellen sprechen auch davon, dass die erste Stadtmauer schon um 1032 errichtet wur<strong>de</strong>. Zu<strong>de</strong>m zog man einen ersten Stadtgraben außerhalb dieser Mauer,<br />
<strong>de</strong>r in die Weser mün<strong>de</strong>te. Um 1250 hatte die Stadt sechs Tore:<br />
• Ostertor<br />
• Bischofstor<br />
• Her<strong>de</strong>ntor<br />
• Ansgariitor<br />
• Brückentor<br />
• Natel<br />
Ein halbes Jahrhun<strong>de</strong>rt später, 1305, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Befestigungsring erweitert und um das Stephaniviertel gezogen. Die Stadtmauer hatte <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt eine Dicke von 1,20 Metern<br />
und eine Höhe von fünf Metern. Sie besaß einen hölzernen Laufgang, Schießscharten, sowie 22 Türme.<br />
Ausbau<br />
Im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt bis 1664 wur<strong>de</strong>n die Bremer Befestigungsanlagen nach <strong>de</strong>n Plänen <strong>de</strong>s nie<strong>de</strong>rländischen Festungsbaumeisters Johan van Valckenburgh ausgebaut. Er entwickelte ein<br />
Konzept, das einen zackenförmigen Wassergraben um die gesamte Stadt, einschließlich <strong>de</strong>r neu gegrün<strong>de</strong>ten Neustadt am linken Weserufer, vorsah. Die Realisierung erfolgte in <strong>de</strong>r<br />
Neustadt bereits von 1623 bis 1628. Die Altstadt folgte 1660 bis 1664.
Der Aushub aus <strong>de</strong>m zirka 3,30 Meter tiefen Graben wur<strong>de</strong> dahinter als Wall aufgeschüttet. Die Ausbuchtungen innerhalb <strong>de</strong>s Wasserringes wur<strong>de</strong>n mit Kanonen besetzt und fungierten<br />
als Bastionen. Die Stadtmauer, welche allerdings nur in <strong>de</strong>r Altstadt existierte und dort noch hinter <strong>de</strong>m Erdwall lag, wur<strong>de</strong> verstärkt. Sie besaß um 1750 fünf Tore:<br />
• Stephanitor<br />
• Doventor<br />
• Ansgaritor<br />
• Her<strong>de</strong>ntor<br />
• Ostertor<br />
In <strong>de</strong>r Neustadt gab es nur zwei Durchlässe durch <strong>de</strong>n Wall:<br />
• Hohentor<br />
• Buntentor<br />
Der einzige wirkliche Angriff, <strong>de</strong>n die Befestigungsanlagen aushalten mussten, war die Belagerung durch die Schwe<strong>de</strong>n 1666 im Zweiten Bremisch-Schwedischen Krieg.<br />
Umgestaltung<br />
Doch schon im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt war <strong>de</strong>r militärische Wert <strong>de</strong>r Anlagen relativ gering gewor<strong>de</strong>n, da die Zeitalter <strong>de</strong>r großen Belagerungen und Angriffskriege vorbei war. Die Bastionen<br />
wur<strong>de</strong>n mehr und mehr zweckentfrem<strong>de</strong>t. Man baute Windmühlen auf ihnen, bepflanzte sie mit Bäumen und legte Gärten und Pfa<strong>de</strong> <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Wasserstellen an. So wur<strong>de</strong> 1802 beschlossen,<br />
die Brustwehren ab<strong>zu</strong>bauen und die Wälle <strong>zu</strong> einem englischen Landschaftsgarten um<strong>zu</strong>gestalten.<br />
Mit <strong>de</strong>r Durchführung <strong>de</strong>r Arbeiten wur<strong>de</strong>n die Gärtner Christian Ludwig Bosse (1802) und Isaak Altmann (ab 1803) beauftragt. Der erste Bauabschnitt wur<strong>de</strong> 1803 zwischen Weser und<br />
Her<strong>de</strong>ntor begonnen, die gesamte Anlage 1811 fertig gestellt. Die Wälle wur<strong>de</strong>n etwas abgeflacht, Fußwege angelegt und die sieben Windmühlen in <strong>de</strong>n Park integriert. Die gezackte<br />
Form <strong>de</strong>s Wallgrabens wur<strong>de</strong> abgerun<strong>de</strong>t. Unter <strong>de</strong>m ersten Bremer Gartenbaudirektor Paul Freye wur<strong>de</strong>n die Wallanlagen im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch einmal verän<strong>de</strong>rt, ihre<br />
charakteristische Form mit <strong>de</strong>m zickzackförmigen Stadtgraben ist aber im wesentlichen bis heute erhalten geblieben. Lediglich im westlichen Teil <strong>de</strong>r Anlage ergaben sich mit <strong>de</strong>r<br />
Errichtung <strong>de</strong>r Eisenbahnlinie nach Ol<strong>de</strong>nburg im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt und <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Stephanibrücke samt Zubringerstraße Verän<strong>de</strong>rungen. Unter an<strong>de</strong>rem wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Wallgraben in diesem<br />
Bereich <strong>zu</strong>geschüttet und die Grünanlage <strong>zu</strong>gunsten von Straßen- und Bahnflächen erheblich reduziert.<br />
Im Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> das 1843 errichtet Stadttheater auf <strong>de</strong>m „Theaterberg“ (<strong>de</strong>r Bischoffsna<strong>de</strong>l-Bastion) zerstört und die Reste <strong>de</strong>r Ruine 1965 abgerissen. Der Bereich wur<strong>de</strong><br />
anschließend gärtnerisch neugestaltet. Der Theaterbetrieb wur<strong>de</strong> im Theater am Goetheplatz wie<strong>de</strong>raufgenommen. In <strong>de</strong>r Nachkriegszeit befand sich zwischenzeitlich mit <strong>de</strong>r Kunst-<br />
Krypta eine Sehenswürdigkeit im alten Bunker am Theaterberg, die 1968 <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Gartenneugestaltung abgerissen wur<strong>de</strong>.<br />
In <strong>de</strong>n 1950er Jahren wur<strong>de</strong> das Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s kriegszerstörten Focke-Museums nach seiner gärtnerischen Neugestaltung als Focke-Garten in die Wallanlagen miteinbezogen, so dass sich<br />
diese auch an ihrem westlichen Abschluss wie<strong>de</strong>r bis an die Weser erstrecken.<br />
Heutige Nut<strong>zu</strong>ng<br />
Die Wallanlagen umschließen noch heute fast die ganze Altstadt. Sie erstrecken sich von <strong>de</strong>r Weser am Oster<strong>de</strong>ich im Osten bis <strong>zu</strong>m Doventorswall im Stephani-Viertel, wo sie von <strong>de</strong>r<br />
Ol<strong>de</strong>nburger Straße (Bun<strong>de</strong>sstraße 6) unterbrochen wer<strong>de</strong>n und weiter bis <strong>zu</strong>m Focke-Garten.<br />
Die Trennung <strong>zu</strong>m Stadtzentrum bil<strong>de</strong>t die Straße Am Wall, eine verkehrsreiche Straße mit Geschäften in <strong>zu</strong>m Teil alten ansehnlichen Gebäu<strong>de</strong>n mit einem herrlichen Blick auf die<br />
Parkanlage und die jenseits <strong>de</strong>r Wallanlagen verlaufen<strong>de</strong> Contrescarpe.<br />
Vier große Kreu<strong>zu</strong>ngen unterbrechen die langgestreckte Parkanlage:
• die <strong>zu</strong>m Ostertorviertel führen<strong>de</strong> Straße Am Wall mit <strong>de</strong>r Kunsthalle und <strong>de</strong>m nahen Theater am Goetheplatz<br />
• <strong>de</strong>r vom Hauptbahnhof kommen<strong>de</strong> Her<strong>de</strong>ntorsteinweg, mit Blick auf die Wallmühle am Her<strong>de</strong>ntor<br />
• die in die Neustadt führen<strong>de</strong> Bürgermeister-Smidt-Straße<br />
• die Doventorstraße am Doventor<br />
In <strong>de</strong>r Neustadt existiert heute mit <strong>de</strong>r Piepe, welche früher als Holzhafen genutzt wur<strong>de</strong>, nur noch ein kleiner See als Rest <strong>de</strong>s Stadtgrabens. Grünzonen markieren hier ansonsten <strong>de</strong>n<br />
früheren Wasserlauf.<br />
Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n Feierlichkeiten anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens im Jahre 2002 wur<strong>de</strong>n die seit 1976 unter Denkmalschutz stehen<strong>de</strong>n Wallanlagen von 1998 bis 2002<br />
unter <strong>de</strong>r Leitung von „Stadtgrün Bremen“ nach garten<strong>de</strong>nkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Dabei wur<strong>de</strong>n Wege saniert o<strong>de</strong>r neu angelegt und Neupflan<strong>zu</strong>ngen<br />
vorgenommen. Über die Funktion einer „grünen Lunge“ hinaus wer<strong>de</strong>n die Anlagen für viele Veranstaltungen genutzt, die in <strong>de</strong>n vergangenen Jahren mehr als 100.000 Besucher hatten.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Olbers-Denkmal am Ostertor, eingeweiht am 11. Oktober 1850, für <strong>de</strong>n Arzt und Astronom Wilhelm Olbers<br />
• Steinhäuser-Vase am Her<strong>de</strong>ntor, enthüllt am 30. August 1856, mit <strong>de</strong>m Motiv Klosterochsen<strong>zu</strong>g (Verlosung eines Ochsen <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>s Krankenhauses im Johanniskloster)<br />
• Kriegerehrenmal „Altmannshöhe“ (Entwurf Ernst Gorsemann), eingeweiht am 13. Oktober 1935. Die Skulptur Mutter mit Kin<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong> vor Kriegsen<strong>de</strong> durch Bombensplitter<br />
beschädigt. Gorsemann schuf eine neue Plastik, die am 27. Mai 1963 aufgestellt wur<strong>de</strong><br />
• Kriegsgefangenen-Ehrenmal am Fuß <strong>de</strong>r Altmannshöhe, eingeweiht am 14. Oktober 1934<br />
• „Figur 1963“ am Her<strong>de</strong>ntor, 1962, soll die Großstadtballung Bremens symbolisieren<br />
• Skulptur „Das Böse“ am Her<strong>de</strong>ntor (vor <strong>de</strong>m Marriott-Hotel), 1988, 5 m hohe Granitplatte<br />
• Die Her<strong>de</strong>ntorsmühle wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m letzten Brand 1892 im alten Stil wie<strong>de</strong>r aufgebaut und war noch bis 1942 in Betrieb. Der Mühlenkopf wur<strong>de</strong> 1998 restauriert und in <strong>de</strong>r<br />
Mühle ein Café eingerichtet<br />
Literatur<br />
• Stadtgrün Bremen (Hrsg.): Zwischen Lust und Wan<strong>de</strong>ln – 200 Jahre Bremer Wallanlagen. Edition Temmen, Bremen 2002, ISBN 3-86108-670-0<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, 2003, ISBN 3-86108-693-X<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremer Pulvertürme<br />
Als Bremer Pulvertürme bezeichnete man seit <strong>de</strong>m späten Mittelalter drei große Rundtürme in Bremen, in <strong>de</strong>nen die für <strong>de</strong>n Kriegsfall benötigten Pulvervorräte, Waffen und Munitionen
gelagert wur<strong>de</strong>n. Daneben wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Erdgeschossen <strong>de</strong>r Pulvertürme aber auch Gefangene festgehalten sowie Straftäter inhaftiert und gefoltert, wodurch die Türme oftmals auch als<br />
Zwinger bezeichnet wur<strong>de</strong>n.<br />
Ostertorzwinger<br />
Der in <strong>de</strong>n Jahren 1512 bis 1514 nach <strong>de</strong>n Plänen <strong>de</strong>s Architekten Jacob Bockes van Vollenhoff erbaute Ostertorzwinger stand am östlichen Tor <strong>de</strong>r Stadt an <strong>de</strong>r befestigten Mauer und<br />
war <strong>de</strong>r kleinste <strong>de</strong>r drei Türme. Das Gebäu<strong>de</strong> verfügte vermutlich über eine kupferne Kuppel und Schießscharten für Kanonen.<br />
Am 9. Juni 1624 entzün<strong>de</strong>ten sich die eingelagerten Sprengstoffe durch einen Blitzschlag, woraufhin 80 Tonnen Pulver und 30 Tonnen Salpeter explodierten und <strong>de</strong>r Turm bis auf die<br />
Grundmauern zerstört wur<strong>de</strong>. Bei <strong>de</strong>r Explosion starben 12 Menschen, die meisten von ihnen waren Gefangene aus <strong>de</strong>m Zwinger. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n etwa ein dutzend Häuser beschädigt.<br />
Zwei Jahre später wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ostertorzwinger in Stän<strong>de</strong>rwerktechnik wie<strong>de</strong>rhergestellt und mit einer Kuppel aus Schiefer versehen. Ab 1720 diente <strong>de</strong>r Turm nicht mehr als Pulverlager,<br />
das Gefängnis blieb aber erhalten. Im Jahre 1826 brach man das Gebäu<strong>de</strong> endgültig ab. Die Inhaftierten wur<strong>de</strong>n in an<strong>de</strong>re Gefängnisse verlegt.<br />
Herrlichkeitzwinger (Braut)<br />
Der größte Pulverturm <strong>de</strong>r Stadt entstand im Jahre 1522 auf <strong>de</strong>r Herrlichkeit, einer Halbinsel zwischen <strong>de</strong>r großen und <strong>de</strong>r kleinen Weser. Auch dieser Turm wur<strong>de</strong> nach Plänen Jacob<br />
Bockes van Vollenhoffs gebaut und im Erdgeschoss als Zwinger genutzt. Er besaß eine zinnenbekränzte Plattform, auf <strong>de</strong>r Geschütze aufgestellt wer<strong>de</strong>n konnten. Zu<strong>de</strong>m war er von einer<br />
Bastion (Propugnaculum Pontis) umgeben. Im Jahre 1614 erhielt er über <strong>de</strong>r Plattform eine gewölbte Haube.<br />
Der Herrlichkeitzwinger hatte riesige Ausmaße: Mit einer Höhe von 55 Metern war er hinter <strong>de</strong>m Dom und <strong>de</strong>r Ansgarii-Kirche das dritthöchste Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt. Außer<strong>de</strong>m hatte er<br />
einen Durchmesser von 30 Metern und eine Mauerstärke von vier Metern. In <strong>de</strong>r „Braut“ wur<strong>de</strong>n neben Pulver und Munition auch Sturm- und Pechkränze, Licht- und Brandkugeln sowie<br />
Handgranaten gelagert. Die Bremer nannten <strong>de</strong>n Pulverturm liebevoll „Braut“, da die Stadt <strong>de</strong>m Turm wie einer Braut <strong>zu</strong> Füßen lag.<br />
Doch auch die „Braut“ ereilte das gleiche Schicksal wie <strong>de</strong>n Ostertorzwinger. Am 22. September 1739 gegen 1:20 Uhr schlug während eines Gewitters ein Blitz in die Haube ein. Das<br />
Dach wur<strong>de</strong> von einer Feuersäule emporgerissen und durch die nachfolgen<strong>de</strong> ungeheure Detonation zerbarsten die meterdicken Wän<strong>de</strong>. Brennen<strong>de</strong> Trümmer wur<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Feuerball<br />
geschleu<strong>de</strong>rt und setzten die Gebäu<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Herrlichkeit sowie mehrere Straßenzüge auf <strong>de</strong>r Altstadtseite <strong>de</strong>r Weser in Brand. Die anschließen<strong>de</strong> Feuersbrunst vernichtete etwa ein<br />
Sechstel <strong>de</strong>r Stadt, bevor ein anhalten<strong>de</strong>r Regenschauer die Brän<strong>de</strong> löschte. Noch Tage nach <strong>de</strong>m Unglück lag eine dichte Wolke aus Rauch und Schwefeldämpfen über <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Insgesamt fielen <strong>de</strong>r Explosion 32 Menschen <strong>zu</strong>m Opfer, <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r Akzisemeister mit seiner Frau und seinen fünf Kin<strong>de</strong>rn. Das Schicksal <strong>de</strong>s Herrlichkeitzwingers wur<strong>de</strong> in<br />
vielen Gedichten verarbeitet.<br />
Die „Braut“ wur<strong>de</strong> nie wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Heut<strong>zu</strong>tage erinnern noch die Brautstraße und die kleine Brautbrücke an die Stelle, wo <strong>de</strong>r Zwinger einst stand.<br />
Stephanitorzwinger (Bräutigam)<br />
Der Stephanitorzwinger stand im Westen Bremens in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Stephanitores. Er wur<strong>de</strong> von 1525 bis 1534 errichtet und hatte somit die längste Bauphase aller Bremer Pulvertürme.<br />
Der Turm stand <strong>zu</strong>r Hälfte in <strong>de</strong>r Weser und hatte im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n Zwingern ein spitzes kegelförmiges Dach. In Anlehnung an die „Braut“ wur<strong>de</strong> dieser Pulverturm<br />
„Bräutigam“ genannt.<br />
Am 4. August 1647 gegen 16:00 Uhr wur<strong>de</strong> dieser Zwinger durch Blitzschlag zerstört, als sechs Tonnen Pulver explodierten. Dabei wur<strong>de</strong>n viele Häuser in <strong>de</strong>n umliegen<strong>de</strong>n Straßen <strong>zu</strong>m<br />
Teil schwer beschädigt. Angaben über Opfer wur<strong>de</strong>n nie gemacht.<br />
Verweise<br />
Literatur
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon Band 1 (A–K). 2. Auflage; Edition Temmen, 2003<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon Band 2 (L–Z). 2. Auflage; Edition Temmen, 2003<br />
• Regina Bruss (Hrsg.): Bremen / Bremerhaven Geschichte + Geschichten, 1. Auflage; Verlag Eilers + Schünemann Bremen, 1980<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremer Wappen<br />
Die Freie Hansestadt Bremen führt heute <strong>de</strong>n Bremer Schlüssel als kleines, ein mittleres und ein großes Wappen.<br />
Beschreibung<br />
Das Wappen <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen zeigt auf rotem Grund einen schräg nach rechts aufgerichteten, mit <strong>de</strong>m Bart nach links gewandten silbernen Schlüssel gotischer Form mit<br />
Vierpassreite („Bremer Schlüssel“). Auf <strong>de</strong>m Schild ruht eine gol<strong>de</strong>ne Krone, welche über <strong>de</strong>m mit E<strong>de</strong>lsteinen geschmückten Reif fünf Zinken in Blattform zeigt. („Mittleres Wappen“).<br />
Beim Kleinen Wappen wird lediglich <strong>de</strong>r Schlüssel ohne Krone abgebil<strong>de</strong>t. Das große Wappen hingegen hat darüber hinaus noch eine Konsole beziehungsweise ein bandartiges<br />
Fußgestell, auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Schild ruht. Der Schild wird von zwei aufgerichteten rückwärts schauen<strong>de</strong>n Löwen mit <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rpranken gehalten.<br />
Geschichte<br />
Die früheste Überlieferung von Siegeln stammt aus <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt, erstmals urkundlich erwähnt wur<strong>de</strong> es 1229, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit existierte bereits einige Zeit<br />
früher ein Siegel. Diese waren im Laufe <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt entstan<strong>de</strong>n, als <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r jungen Stadt (<strong>de</strong>r ist erstmals 1225 in einer Urkun<strong>de</strong> belegt) eigenständig Verträge schließen<br />
wollte, so mit <strong>de</strong>n Rüstringer Friesen 1220.<br />
Zu sehen ist darauf links ein Bischof mit Bischofsmütze und in <strong>de</strong>r Rechten ein Krummstab (seit 780 war die Stadt Sitz <strong>de</strong>s Bischofs), sowie rechts ein Kaiser mit Krone und Reichsapfel<br />
in <strong>de</strong>r Linken, die über sich <strong>de</strong>n Bremer Dom halten. Zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n ist die zinnenbewehrte Stadtmauer <strong>zu</strong> sehen mit <strong>de</strong>m Tordurchlass in <strong>de</strong>r Mitte. Es wird vermutet, dass es sich<br />
bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n um Willehad und Karl <strong>de</strong>n Großen han<strong>de</strong>lt, da die mittelalterliche Überlieferung ihnen <strong>de</strong>n Ursprung <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>s Doms <strong>zu</strong>schreibt. Die Umschrift <strong>de</strong>s Siegels lautet<br />
SIGILLVM BREMENSIS CIVITATIS (Siegel <strong>de</strong>r Stadt Bremen). In <strong>de</strong>r Folge von Konflikten zwischen Rat und Zünften innerhalb <strong>de</strong>r Stadt, aber auch mit Albert II. von Braunschweig-<br />
Lüneburg, <strong>de</strong>m damaligen Erzbischof von Bremen, <strong>de</strong>r am 28. Juni 1366 von <strong>de</strong>r Bürgerschaft und Graf Konrad von Ol<strong>de</strong>nburg hinausgeworfen wur<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stempel dieses ersten<br />
Siegels (wahrscheinlich) 1366 zerstört. Der Rat hielt über <strong>de</strong>n 9. August 1366 fest: „Un<strong>de</strong> dat inghezegel lete wy ok enttwey slan, do it erst in unse wolt wed<strong>de</strong>r quam“ (das Siegel ließen<br />
wir auch entzweischlagen, als es wie<strong>de</strong>r in unsere Gewalt kam).<br />
Unmittelbar nach <strong>de</strong>r Zerstörung <strong>de</strong>s alten wur<strong>de</strong> 1366 ein neues Siegel eingeführt. Darauf saß nun links <strong>de</strong>r Kaiser mit Krone, Zepter und Reichsapfel und rechts <strong>de</strong>r Heilige Petrus mit<br />
<strong>de</strong>r Tiara, <strong>de</strong>m Papsthut, in <strong>de</strong>r rechten Hand ein Schwert und in <strong>de</strong>r linken einen Schlüssel. Diese Darstellung ist auf zwei Grün<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rückführbar. Einerseits existierte ein 3. in dieser Zeit<br />
gebräuchliches Siegel <strong>de</strong>s Bremer Domkapitals mit <strong>de</strong>r Maria mit Kind und Petrus, die gemeinsam auf einer Bank sitzen. An<strong>de</strong>rerseits kommt das Freiheitsstreben <strong>de</strong>r Bremer in dieser<br />
Zeit durch die Abwendung vom Bischof <strong>de</strong>utlich <strong>zu</strong>m Ausdruck: Der Kaiser nimmt links <strong>de</strong>n wichtigeren Platz ein und <strong>de</strong>r Bischof, <strong>de</strong>r für die alten, erzbischöflichen Stadtherren stand,
ist ersetzt durch <strong>de</strong>n Schutzheiligen Petrus als Jünger Jesu, Vorgänger <strong>de</strong>r späteren Päbste. Dieses Siegel wur<strong>de</strong> über 460 Jahre lang verwen<strong>de</strong>t, in <strong>de</strong>r Neuzeit vornehmlich <strong>zu</strong>r<br />
Besiegelung von Immobiliengeschäften, bis es durch <strong>de</strong>n Erlass einer neuen Erbe- und Handfestenordnung vom 19. Dezember 1833 seine Aufgabe ganz verlor und vom Obergericht an<br />
das Staatsarchiv abgegeben wur<strong>de</strong>. Es befin<strong>de</strong>t sich heute im Archiv.[2]<br />
Während die großen Siegel immer Bischof und Herrscher zeigten, war auf <strong>de</strong>n kleinen Petrus mit <strong>de</strong>m Schlüssel <strong>zu</strong> sehen. Bereits auf <strong>de</strong>m seit 1366 benutzten kleinen Sekretsiegel ist<br />
Petrus thronend über einem Wappenschild mit einem gotischen Schlüssel <strong>zu</strong> sehen. Seit 1369 erscheint <strong>de</strong>r Schlüssel auch auf Bremer Münzen und auf Darstellungen <strong>de</strong>r Stadt.[3] Etwa<br />
200 Jahre später erschien er auch auf <strong>de</strong>r Hanseflagge Bremens, einem Banner, das vom Heck <strong>de</strong>r Schiffe wehte.<br />
Dieser Bremer Schlüssel spielt für das kleinste <strong>de</strong>utsche Bun<strong>de</strong>sland Bremen eine beson<strong>de</strong>re Rolle. Er stammt als Attribut von Petrus, <strong>de</strong>m Schutzpatron <strong>de</strong>s Bremer Doms. Es han<strong>de</strong>lt<br />
sich also um einen Himmelsschlüssel, hergeleitet aus <strong>de</strong>m Bibelzitat „Ich will Dir <strong>de</strong>s Himmelreiches Schlüssel geben“[4]. Das Wort Schlüssel steht dabei im Plural. In vielen Wappen,<br />
die sich auf die Schlüssel <strong>de</strong>s Petrus beziehen, wird ein gol<strong>de</strong>ner und ein silberner Schlüssel verwen<strong>de</strong>t, so auch im Wappen <strong>de</strong>r Vatikanstadt. Der traditionellen Interpretation nach ist<br />
einer <strong>zu</strong>m „Bin<strong>de</strong>n“ und einer <strong>zu</strong>m „Lösen“.<br />
Schon immer waren die Farben <strong>de</strong>s Wappens die Farben <strong>de</strong>r Hanse: rot und weiß. Schildträger fin<strong>de</strong>n sich meist erst ab <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt, aber Engel als Schildträger wur<strong>de</strong>n schon<br />
1405 in <strong>de</strong>r Petruswange <strong>de</strong>s Ratsgestühls dargestellt[5]. In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong>n die bis dahin verwen<strong>de</strong>ten Engel nach und nach durch Löwen ersetzt[6]. 1617<br />
wur<strong>de</strong> außer<strong>de</strong>m ein Helm hin<strong>zu</strong>gefügt, <strong>de</strong>r nie offizieller Bestandteil <strong>de</strong>s Wappens war, aber noch heute auf <strong>de</strong>m Flaggenwappen vorhan<strong>de</strong>n ist. Die Krone auf <strong>de</strong>m Wappen stammt aus<br />
<strong>de</strong>m späten 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt[7].<br />
Grundlegend verän<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> das Wappen 1811 durch Napoleon. Dieses ist das einzige Bremer Wappen, in welchem sich die Farben von <strong>de</strong>n historischen unterschie<strong>de</strong>n. Es zeigte in<br />
einem roten Schildhaupt drei gol<strong>de</strong>ne Bienen, darunter in Gold ein schwarzer Schlüssel. Napoleon I. hatte 1804 die Biene <strong>zu</strong> seinem Wappentier gemacht, um damit seine fränkische<br />
Tradition dar<strong>zu</strong>stellen. Darstellungen von Bienen waren 1653 in Tournal am Grab Chil<strong>de</strong>rich I. gefun<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r 457 die Merowingerdynastie begrün<strong>de</strong>te. Sie gelten darum als<br />
ältestes Symbol Frankreichs und stehen für Unsterblichkeit und Wie<strong>de</strong>rgeburt. Bremen musste sich mit 50 an<strong>de</strong>ren Städten in diese "Auszeichnung", die viel Geld kostete, fügen.[8][9]<br />
Außer<strong>de</strong>m sind rot und gold die Farben <strong>de</strong>s Wappens <strong>de</strong>r Familie Buonaparte.[10]<br />
Mit <strong>de</strong>r Wappenverordnung von 1891 wird das Bremer Wappen beschrieben als „durch einen schräg nach rechts aufgerichteten, mit <strong>de</strong>m Barte linkshin gewandten silbernen Schlüssel<br />
gotischer Form in einem roten Schil<strong>de</strong>“.[11]<br />
Bremen führt heute also sowohl ein kleines, mittleres, als auch großes Wappen. Letzteres fin<strong>de</strong>t sich beispielsweise auf <strong>de</strong>n Ärmeln <strong>de</strong>r Bremer Polizeibeamten.[12] Außer<strong>de</strong>m existiert<br />
ein Flaggenwappen. In dieser Form war es das Große Wappen Bremens im Deutschen Reich. Heute ist es nur noch auf Flaggen sowie im Siegel <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats <strong>zu</strong> sehen.<br />
Offizielles Wappen ist es nicht.<br />
Gebrauchsschutz<br />
Wappen sind allgemein für <strong>de</strong>n freien Gebrauch geschützt, d.h. ihre Verwendung bedarf einer beson<strong>de</strong>ren Genehmigung. Dieser Schutz hatte einmal da<strong>zu</strong> geführt, dass die in Hamburg<br />
erscheinen<strong>de</strong> Wochenzeitung Die Zeit <strong>de</strong>n Bremer Schlüssel auf ihrem Signet auf <strong>de</strong>r Titelseite verwen<strong>de</strong>te, da Berichten <strong>zu</strong>folge die Freie und Hansestadt Hamburg bei <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r<br />
Zeitung sich geweigert hatte, die Erlaubnis <strong>zu</strong>r Verwendung <strong>de</strong>s Hamburger Wappens <strong>zu</strong> geben. Bremen erlaubte es. Die Zeit verwen<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Bremer Schlüssel noch heute.<br />
Heute gestalten viele Städte und Län<strong>de</strong>r sogenannte Wappenzeichen, welche nicht diesem beson<strong>de</strong>ren Schutz unterstehen, son<strong>de</strong>rn frei verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n dürfen. So existiert auch eines<br />
für die Freie Hansestadt Bremen. Diese Wappenzeichen haben allerdings nicht <strong>de</strong>n Status eines Wappens.<br />
Schlüssel und Wappen als Symbol <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />
• Kaiserbrauerei Beck & Co: Ab 1876 verwen<strong>de</strong>te die damalige Kaiserbrauerei Beck & Co (Beck’s) <strong>de</strong>n Bremer Schlüssel aus <strong>de</strong>m Wappen als Markenzeichen. Später wan<strong>de</strong>lte<br />
das Unternehmen das Logo ab und verwen<strong>de</strong>t heute ein Markenzeichen, welches nicht <strong>de</strong>r Blasonierung <strong>de</strong>s Bremer Wappens entspricht. Der Schlüssel hat darauf keine gotische<br />
Form mehr und ist aus Sicht <strong>de</strong>s Betrachters nach rechts gekippt (heraldisch ausgedrückt also schräg nach links aufgerichtet mit <strong>de</strong>m Bart nach rechts).
• Nord<strong>de</strong>utscher Lloyd: Nach links gekippt wie auf <strong>de</strong>m Originalwappen fin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Schlüssel in <strong>de</strong>n Logos <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Lloyd[13] und <strong>de</strong>r Wochenzeitschrift Die Zeit.<br />
• Beilken: Die Segelmacherei Beilken benutzt seit <strong>de</strong>r Gründung 1919 <strong>de</strong>n „Bremer Schlüssel“ als Firmensymbol.[14]<br />
• Zeitung: Der Bremer Schlüssel war darüber hinaus <strong>de</strong>r Name einer Zeitung, welche Friedrich Ludwig Mallet (1792–1865) gegrün<strong>de</strong>t hatte.<br />
• Hymne: En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab es ein Lied Der Bremer Schlüssel, in <strong>de</strong>m man wohl auch eine Bremer Hymne sehen wollte. Offiziell ist das Lied nie <strong>zu</strong>m Hymne<br />
gewor<strong>de</strong>n, im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt geriet es in Vergessenheit[15].<br />
• Abgren<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> Hamburg: Das Stadtwappen von Hamburg wird oft als Tor <strong>zu</strong>r Welt bezeichnet, in Bremen erwi<strong>de</strong>rt man darauf nur: "Und Bremen hat <strong>de</strong>n Schlüssel da<strong>zu</strong>".<br />
Literatur<br />
• Verfassung <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen: Artikel 68: „Die Freie Hansestadt Bremen führt ihre bisherigen Wappen und Flaggen.“<br />
• Dienstsiegelerlass (DienstSErl) von Bremen mit Geltung ab 1. Januar 2001; Aus<strong>zu</strong>g:<br />
• § 2: Das große bremische Siegel ist ein Prägesiegel und zeigt das große bremische Wappen mit <strong>de</strong>n für das Flaggenwappen vorgesehenen Abweichungen (§ 6 <strong>de</strong>r<br />
Bekanntmachung, betreffend Vorschriften über das bremische Staatswappen). Das große bremische Siegel wird vom Senat als <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sregierung und von <strong>de</strong>m<br />
Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats geführt. Des großen Siegels kann sich auch <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Bürgerschaft bedienen.<br />
• § 3: Im übrigen führen alle Behör<strong>de</strong>n das kleine bremische Siegel. Dieses wird als Prägesiegel, Siegelmarke o<strong>de</strong>r Farbdruckstempel (aus Metall o<strong>de</strong>r Gummi) benutzt.<br />
Das kleine Siegel soll einen Durchmesser von 3 ½ cm haben.<br />
• Hermann Tar<strong>de</strong>l: Der Bremer Schlüssel. Zur Geschichte <strong>de</strong>s Wahrzeichens. Bremer Schlüssel Verlag Hans Kasten, Bremen 1946.<br />
• Fritz Lohmann: Das Bremer Wappen. Vom Himmelsschlüssel <strong>zu</strong>m Stadtsignet. Edition Temmen, Bremen 2010. ISBN 978-3-8378-1008-0<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ nach Wilhelm von Bippen, Die Entwickelung <strong>de</strong>s bremischen Wappens, in: Jahrbuch <strong>de</strong>r bremischen Sammlungen, Band 4, S. 11, Bremen 1911.<br />
2. ↑ Staatsarchiv Bremen: Bremer Stadtsiegel. Abgerufen am 7. Mai 2008.<br />
3. ↑ Siehe: Historische Landkarten von Bremen<br />
4. ↑ Siehe: Matthäus 16, Vers 19<br />
5. ↑ Lohmann, Fritz a.a.O., Seite 36<br />
6. ↑ Lohmann, Fritz a.a.O. Seite 38 zeigt das Wappen mit Engeln als Schildhalter in <strong>de</strong>r oberen Rathaushalle, 1570<br />
7. ↑ Lohmann, Fritz a.a.O., Seite 53, zeigt die Krone auf <strong>de</strong>m Bremer Thaler von 1650<br />
8. ↑ Wappen von Frommhausen: www.xxx<br />
9. ↑ Das Wappen Napoleons: www.xxx<br />
10.↑ Siehe: Wappen <strong>de</strong>r Familie Buonaparte<br />
11.↑ Die Beschreibung eines Wappens wird allgemein – und so auch hier – gemäß <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r Blasonierung vorgenommen, also aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>s Wappenträgers und nicht aus<br />
<strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>s Betrachters.<br />
12.↑ Siehe: Bremer Polizei-Ärmelwappen<br />
13.↑ Zu <strong>de</strong>n Flaggen <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Lloyds: www.xxx<br />
14.↑ http://www.xxx<br />
15.↑ Lohmann,Fritz a.a.O., Seiten 116-123<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong>
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Flagge Bremens<br />
Die Bremische Flagge ist die offizielle Flagge und Hoheitszeichen <strong>de</strong>r Stadt Bremen und <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Freie Hansestadt Bremen. Sie ist min<strong>de</strong>stens achtmal rot und weiß gestreift<br />
und am Flaggenstock gewürfelt und wird in Bremen umgangssprachlich – allerdings auch von offiziellen Stellen – als „Speckflagge“ bezeichnet. [1] Die Staatsflagge enthält in <strong>de</strong>r Mitte<br />
das Flaggenwappen mit Schlüssel und drei Löwen. Die Behör<strong>de</strong>n greifen als Dienstflagge meist auf eine Flagge mit Schlüsselwappen <strong>zu</strong>rück.<br />
Die Flagge Bremens trägt die Farben <strong>de</strong>r Hanse, Rot und Weiß. Siehe auch da<strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Hauptartikel Hanseflagge.<br />
Als <strong>de</strong>r SV Wer<strong>de</strong>r Bremen Anfang <strong>de</strong>r 1970er keinen Trikotsponsor fand, half die Stadt Bremen aus und sprang dafür ein, so dass die Spieler von 1971 an fast drei Jahre in <strong>de</strong>n<br />
Trikotfarben <strong>de</strong>r Speckflagge spielten. [2]<br />
Aussehen<br />
• Aus<strong>zu</strong>g aus <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sverfassung:<br />
• „Die Freie Hansestadt Bremen führt ihre bisherigen Wappen und Flaggen.“ [3]<br />
• Aus<strong>zu</strong>g aus <strong>de</strong>r Bekanntmachung, betreffend Vorschriften über das bremische Staatswappen vom 17. November 1891 (Bremische Staatswappenbekanntmachung, StaatsWBek)<br />
[4]:<br />
• § 1 – „Das große bremische Wappen wird gebil<strong>de</strong>t durch einen schräg nach rechts aufgerichteten, mit <strong>de</strong>m Barte linkshin gewandten silbernen Schlüssel gotischer Form<br />
in einem roten Schil<strong>de</strong>. Auf <strong>de</strong>m Schil<strong>de</strong> ruht eine gol<strong>de</strong>ne Krone, welche über <strong>de</strong>m mit E<strong>de</strong>lsteinen geschmückten Reife fünf (sichtbare) Zinken in Blattform zeigt. Der<br />
Schild ruht auf einer Konsole o<strong>de</strong>r auf einem bandartigen Fußgestell und wird von zwei aufgerichteten rückwärts schauen<strong>de</strong>n Löwen mit <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rpranken gehalten.<br />
Das mittlere Wappen wird gebil<strong>de</strong>t durch <strong>de</strong>n gleichen Schlüssel im roten, mit <strong>de</strong>r gol<strong>de</strong>nen Krone gekrönten Schil<strong>de</strong>. Das kleine Wappen wird lediglich durch <strong>de</strong>n<br />
gleichen Schlüssel ohne Schild gebil<strong>de</strong>t.“ […]<br />
• § 6 – „Die Staatsflagge ist von Rot und Weiß min<strong>de</strong>stens achtmal gestreift und längs <strong>de</strong>s Flaggenstocks mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Streifen entsprechen<strong>de</strong>n Zahl abwechselnd roter und<br />
weißer Würfel in zwei Reihen gesäumt. Die Zahl <strong>de</strong>r roten und die <strong>de</strong>r weißen Streifen soll stets eine gera<strong>de</strong> sein. In <strong>de</strong>r Mitte hat die Flagge ein viereckiges weißes Feld,<br />
in welchem, falls sie min<strong>de</strong>stens zwölfmal gestreift ist, das in § 1 geschil<strong>de</strong>rte große Wappen dargestellt ist, jedoch mit <strong>de</strong>r Abän<strong>de</strong>rung, daß an Stelle <strong>de</strong>r Krone ein<br />
gekrönter Helm mit rot und weißer Helm<strong>de</strong>cke tritt; die Helmzier bil<strong>de</strong>t ein nach rechts gewandter wachsen<strong>de</strong>r Löwe, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n Pranken <strong>de</strong>n Wappenschlüssel, <strong>de</strong>n<br />
Bart nach links gekehrt, senkrecht hält. Wenn die Flagge nur achtmal gestreift ist, so erhält das Mittelfeld das in § 1 geschil<strong>de</strong>rte mittlere Wappen.“<br />
Einzelnachweise
1. ↑ Internetpräsenz <strong>de</strong>s Bremer Rathauses<br />
2. ↑ Online-Artikel <strong>de</strong>s SV Wer<strong>de</strong>r Bremen über die Trikotfarben<br />
3. ↑ Artikel 68 <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sverfassung <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen vom 21. Oktober 1947 (Brem.GBl. S. 251)<br />
4. • als PDF (364 KB, bei bremische-buergerschaft.<strong>de</strong>), als Quellentext bei Wikisource.<br />
5. ↑ § 1 und § 6 Absatz 1 und 2 <strong>de</strong>r Bekanntmachung, betreffend Vorschriften über das bremische Staatswappen vom 17. November 1891 (Bremische<br />
Staatswappenbekanntmachung, StaatsWBek), Brem.GBl. S. 124<br />
Literatur<br />
• E. Grohne, Zur Geschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen und bremischen Hoheitszeichen, im Brem. Jb. 46, 1957, 26-29<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremer Stadtrecht<br />
Das Bremer Stadtrecht war das im Laufe <strong>de</strong>s Hochmittelalters entwickelte, 1303 erstmals kodifizierte Stadtrecht <strong>de</strong>r Hansestadt Bremen. Es blieb bis <strong>zu</strong>r Ablösung im Zusammenhang mit<br />
<strong>de</strong>n Entwicklungen nach <strong>de</strong>r Französischen Revolution und <strong>de</strong>n Befreiungskriegen im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt trotz Än<strong>de</strong>rungen und Weiterentwicklungen in Kraft. Letzte Reste <strong>de</strong>s Stadtrechts<br />
wur<strong>de</strong>n erst in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Novemberrevolution und <strong>de</strong>r Bremer Räterepublik mit <strong>de</strong>r Verfassung von 1920 beseitigt. Das Bremer Stadtrecht galt im Gebiet einer, im Vergleich <strong>zu</strong><br />
an<strong>de</strong>ren Stadtrechtsfamilien, z. B. insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Lübischen Rechtes, kleinen Stadtrechtsfamilie. Es wur<strong>de</strong> sicher übernommen in <strong>de</strong>n Städten Delmenhorst, Ol<strong>de</strong>nburg, Ver<strong>de</strong>n und<br />
Wil<strong>de</strong>shausen sowie für das Weichbild Harpstedt. Der Bremer Stadtrechtsfamilie <strong>zu</strong><strong>zu</strong>rechnen gewesen sein könnte Neustadt am Rübenberge.<br />
Entwicklung <strong>de</strong>s Bremer Rechts im Mittelalter<br />
Entwicklung bis <strong>zu</strong>r Entstehung <strong>de</strong>s Stadtrechtes<br />
Bei <strong>de</strong>r Entwicklung bis <strong>zu</strong>r Kodifizierung <strong>de</strong>s Stadtrechtes sind Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt Bremen <strong>zu</strong> einer Stadt, die selbstständig Recht setzen konnte, und die Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>s<br />
Rechtes in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> unterschei<strong>de</strong>n. Ersteres ist die Vorausset<strong>zu</strong>ng, damit es <strong>zu</strong> einem eigenen Stadtrecht kommen konnte. Die innere Entwicklung, die daneben ablief, bestimmte dann<br />
weitgehend <strong>de</strong>n Inhalt <strong>de</strong>r Kodifikation.<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Gemein<strong>de</strong> mit eigener Rechtset<strong>zu</strong>ng<br />
Spätestens 789 wur<strong>de</strong> Bremen Sitz eines Bischofs im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Missionierung <strong>de</strong>r Sachsen. 848 übernahm Bischof Ansgar das Bremer Bistum und vereinigte die Bistümer<br />
Bremen und Hamburg nach Überfällen <strong>de</strong>r Wikinger auf Hamburg. So bil<strong>de</strong>te sich das Erzbistum Bremen, das die Rolle <strong>de</strong>s Feudalherrn in Bremen übernahm. Am 9. Juni 888 erlangte<br />
<strong>de</strong>r damalige Erzbischof Rimbert vom Kaiser Arnulf von Kärnten das Markt-, Münz- und Zollrecht.[1] Hierdurch stand später <strong>de</strong>r bremischen Bürgerschaft nur das Bistum und nicht noch
weitere weltliche Herrschaften gegenüber. 965 wur<strong>de</strong> durch Otto I. ohne Rückgriff auf die Urkun<strong>de</strong> Arnulfs an das Bistum erneut das Marktrecht verliehen;[2] diese Verleihung wur<strong>de</strong> 988<br />
durch Otto III. bestätigt.[3] Aus diesen Urkun<strong>de</strong>n lässt sich aber bereits herauslesen, dass die ansässige Kaufmannschaft nicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Hörigen <strong>de</strong>s Bistums gehörte, son<strong>de</strong>rn sich in einem<br />
an<strong>de</strong>ren, die Gerichtsbarkeit einschließen<strong>de</strong>n Rechtsverhältnis befun<strong>de</strong>n haben muss.<br />
Für das 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt lässt sich dann die Herausbildung einer <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st sprachlich vom Bistum abgegrenzten Stadt (civitas) nachweisen. 1139 wird in zwei bischöflichen Urkun<strong>de</strong>n<br />
von <strong>de</strong>r civitas und von cives (Bürgern) gesprochen; 1157 kam es <strong>zu</strong> einer Schenkung an das Domkapitel eines secus vallum in platea superiori civitatis, also eines am Wall <strong>de</strong>r<br />
Obernstraße <strong>de</strong>r Stadt gelegenen Hauses; <strong>de</strong>r sogenannte Wei<strong>de</strong>brief <strong>de</strong>s Erzbischofs von 1159 regelt die Abgren<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Viehwei<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bürgerschaft <strong>zu</strong> erzbischöflichen Kolonisten. Der<br />
Brief wur<strong>de</strong> einem Bürgerausschuss übergeben, <strong>de</strong>r damit als Interessenvertreter <strong>de</strong>r Stadt angesehen wer<strong>de</strong>n kann. In Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Heinrich <strong>de</strong>m Löwen trat die Stadt dann<br />
als Partei auf, auch wenn sie sich genötigt sah auf die Vermittlung <strong>de</strong>s Erzbistums <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>greifen. Nach <strong>de</strong>m Sturz Heinrichs gelangte 1180 <strong>de</strong>r Erzbischof Siegfried I. von Anhalt auf<br />
<strong>de</strong>n Bischofsstuhl. Siegfried verzichtete 1181 ausdrücklich <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r universitas civitates nostre auf Hafengebühren, Schutz- und Frie<strong>de</strong>nsgel<strong>de</strong>r.<br />
Siegfrieds Nachfolger Hartwig II. erwirkte 1186 ein Privileg Friedrich I. Barbarossas (Gelnhauser Privileg), in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Stadt dann Weichbildrechte verliehen wur<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r Verleihung<br />
dieser Rechte war offiziell eine eigenständige Entwicklung eine bremischen Stadtrechtes überhaupt erst möglich. Bremen rief dann später aufgrund dieser Urkun<strong>de</strong> sogar erfolgreich<br />
Barbarossa um Hilfe gegen Bedrängung durch Erzbischof Hartwig an. Um 1200 trat die Bürgerschaft Bremens dann nach außen in Erscheinung, in<strong>de</strong>m sie mit <strong>de</strong>r Grafschaft Altena einen<br />
Vergleich schloss. In einer als concordia bezeichneten Übereinkunft mit Erzbischof Gerhard I. stehen sich die Stadt und das Erzbistum dann 1217 erstmals als gleichberechtigt gegenüber.<br />
In dieser Urkun<strong>de</strong> wird vom Erzbischof unter an<strong>de</strong>rem bestätigt, dass zwei Bürger bei Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen ihm als Stadtherren und <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> das gelten<strong>de</strong> Recht als<br />
ihr Recht bestätigen dürfen. Unter seinem Nachfolger Gebhard II. konnte die Stadt dann erhebliche Fortschritte in ihrer rechtlichen Selbstständigkeit erzielen. 1225 wer<strong>de</strong>n in einer<br />
Urkun<strong>de</strong> dieses Erzbischofs erstmals sieben consules als Vertreter <strong>de</strong>r Stadt genannt. 1233 konnte sich Bremen die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng Gebhards mit <strong>de</strong>n Stedinger Bauern <strong>zu</strong> Nutze<br />
machen. Der Erzbischof gestand Bremen als verfasster Gemeinschaft seine eigenständigen Rechte und das Stadtrecht <strong>zu</strong>; im Gegen<strong>zu</strong>g erhielt er militärische Unterstüt<strong>zu</strong>ng. Allerdings<br />
mussten 1246 die consules Bremenses et communetotius civitates Bremensis in Lesum erklären, Regelungen (wilcore) <strong>zu</strong> Lasten <strong>de</strong>s Erzbischofes nur in Einvernehmen mit <strong>de</strong>m Bistum<br />
<strong>zu</strong> erlassen (sogenannte Gebharhardsche Reversalen). Gleichzeitig wur<strong>de</strong> das durch einen Vogt <strong>de</strong>s Bischofs besetzte bischöfliche Gericht als das einzige Gericht anerkannt. Dieser<br />
Verzicht wur<strong>de</strong> 1248 teilweise wie<strong>de</strong>r aufgehoben und später durch Verpfändung <strong>de</strong>s Vogteirechtes praktisch negiert.[4]<br />
Faktisch entwickelte sich die Stadt damit in Richtung einer vom Lehnsherrn unabhängigen Reichsstadt. Verbrieft wur<strong>de</strong> dieser Status allerdings erst viel später durch das Linzer Diplom<br />
von 1648. Erst 1666 erkannte das Königreich Schwe<strong>de</strong>n als Rechtsnachfolger <strong>de</strong>s Erzbischofs im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Habenhausen diesen Status an.<br />
Innere Entwicklung <strong>de</strong>s bremischen Rechts vor <strong>de</strong>r Kodifikation<br />
Im Laufe <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts und dann verstärkt im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt kam es <strong>zu</strong>nehmend <strong>zu</strong>r Aufzeichnung und schließlich <strong>zu</strong>r Kodifikation von Stadtrechten im<br />
Heiligen Römischen Reich. Hintergrund hierfür war <strong>zu</strong>m einen, dass im <strong>zu</strong>nehmend komplexeren sozialen Leben in <strong>de</strong>n Städten die Notwendigkeit für immer ausdifferenzierte<br />
Regelungen bestand, die schließlich von Einzelnen kaum noch vollständig behalten wer<strong>de</strong>n konnten. Weiterer Grund war, dass <strong>zu</strong>nehmend auch gefor<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>, dass das Bestehen o<strong>de</strong>r<br />
Nichtbestehen von Rechten auch <strong>zu</strong> beweisen sei.[5] Auch die Kodifizierung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes ist Teil dieser Entwicklung.[6] Hierbei ist allerdings das mittelalterliche Weltbild <strong>zu</strong><br />
berücksichtigen. Danach konnte Recht nicht durch gesetzgeberische Eingriffe gestaltet wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nach diesem theozentrischen Weltbild war Recht letztlich durch die göttliche<br />
Ordnung vorgegeben. Es musste lediglich „gefun<strong>de</strong>n“ und gegebenenfalls aufgezeichnet wer<strong>de</strong>n.[7] Es han<strong>de</strong>lte sich nach <strong>de</strong>m Verständnis <strong>de</strong>r damaligen Zeit vor allem um eine<br />
Kodifizierung <strong>de</strong>s vorher bestehen<strong>de</strong>n Gewohnheitsrechts, wobei dies auch die Einbeziehung von Traditionen <strong>de</strong>s römischen Rechtes einschloss.[8] In <strong>de</strong>n Stadtrechten nie<strong>de</strong>rgelegte<br />
Regelungen hatten grundsätzlich zwei Quellen: Zunächst die vom Feudalherren verliehenen Rechte und <strong>zu</strong>m zweiten die Willküren als aus <strong>de</strong>r Rechtspraxis, etwa aus früheren Urteilen<br />
o<strong>de</strong>r aus Beschlüssen <strong>de</strong>s Rates übernommenes o<strong>de</strong>r beschlossenes Recht. Wobei die Grenzen dieser Quellen fließend sein konnte – Privilegien konnten als Willküren übernommen<br />
wer<strong>de</strong>n, Willküre aber auch per Privileg bestätigt wer<strong>de</strong>n. [9]<br />
Das Stadtrecht sollte auf ältere lan<strong>de</strong>sherrliche Regelungen <strong>zu</strong>rückgreifen. Von <strong>de</strong>n gewährten Privilegien ist das Gelnhauser Privileg von 1186 das älteste verliehene Recht, auf das<br />
<strong>zu</strong>rückgegriffen wur<strong>de</strong>, in<strong>de</strong>m ähnliche Regelungen <strong>zu</strong>m Bürgerrecht übernommen wur<strong>de</strong>n. Auch etwa die 1206 erzbischöfliche Regelung <strong>zu</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r Gera<strong>de</strong> im Erbrecht fin<strong>de</strong>t<br />
sich im Stadtrecht wie<strong>de</strong>r.[10] An<strong>de</strong>rerseits waren Ten<strong>de</strong>nzen <strong>zu</strong>r willkürlichen Set<strong>zu</strong>ng von Recht – etwa durch die Gebharhardsche Reversalen von 1246- unterbun<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Diese<br />
verwahrten sich ausdrücklich gegen Rechtsset<strong>zu</strong>ngen durch die Stadt im Bereich <strong>de</strong>r durch Strafzahlungen lukrativen Kriminalgerichtsbarkeit.[4]
Kodifikation <strong>de</strong>s Bremer Rechts 1303–1308<br />
Die Personengruppe, die in Bremen die Kodifizierung in Angriff nahm, ist in <strong>de</strong>r Stadtrechtsurkun<strong>de</strong> von 1303 namentlich genannt. Dort wird erwähnt, dass alle 14 Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Rates<br />
eine Nie<strong>de</strong>rlegung <strong>de</strong>s Stadtrechtes vereinbart hätten, nach diesen Vereinbarungen bestimmten <strong>de</strong>r Rat und mene Stad 16 weitere Personen aus <strong>de</strong>n 16 Stadtvierteln, die die Kodifikation<br />
durch<strong>zu</strong>führen hatten. Der Rat <strong>de</strong>r Stadt und die <strong>zu</strong>sätzlichen Sechzehn formulierten dann das Stadtrecht. Die Ratsherren und die Vertreter <strong>de</strong>r Stadtviertel gehörten alle <strong>de</strong>n damals<br />
führen<strong>de</strong>n und ratsfähigen Familien <strong>de</strong>r Stadt an. Diese Familien entstammten vielfach entwe<strong>de</strong>r selbst <strong>de</strong>n Ministerialengeschlechtern <strong>de</strong>s Bremer Erzbistums, o<strong>de</strong>r waren eng mit <strong>de</strong>n<br />
Ministerialen verbun<strong>de</strong>n. Kaufleute gehörten diesen Familien noch nicht an.[11] Darüber hinausgehen<strong>de</strong> Hintergrün<strong>de</strong> lassen sich nur vermuten, da die Quellen insoweit schweigen.<br />
Gesichert ist, dass die Kodifizierung vor <strong>de</strong>m Hintergrund erheblicher Spannungen in <strong>de</strong>r bremischen Oberschicht stattfand, von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Anstoß <strong>zu</strong>r Kodifikation ausging. 1304 kam es <strong>zu</strong>r<br />
Ermordung <strong>de</strong>s angesehenen Bürgers Arnd von Gröpelingen durch Söhne aus angesehenen Familien in seinem Haus. Es folgten erhebliche Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen über die Bestrafung <strong>de</strong>r<br />
Täter, die schließlich <strong>zu</strong>r Ausweisung zahlreicher Familien führte. Betroffen waren auch Familien, <strong>de</strong>ren Mitglie<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Kodifizierung mitgewirkt hatten.[12] Schwarzwäl<strong>de</strong>r zieht<br />
hieraus <strong>de</strong>n Schluss, dass die obsiegen<strong>de</strong>n Familien sich das kodifizierte Recht <strong>zu</strong>nutze machten;[13][14] von an<strong>de</strong>rer Seite wird vertreten, dass die Kodifizierung <strong>de</strong>r Versuch gewesen sei<br />
<strong>de</strong>n Spannungen entgegen<strong>zu</strong>wirken.[15] Die erste Kodifikation <strong>de</strong>s Stadtrechtes erfolgte insgesamt über einen Zeitraum vom 1. Dezember 1303 bis <strong>zu</strong>m 21. Dezember 1308. Der<br />
Kernbestand <strong>de</strong>s Stadtrechtes war hierbei allerdings bereits im Laufe <strong>de</strong>s Jahres 1305 fertiggestellt.[16]<br />
Weiterentwicklungen<br />
In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong> die Stadtrechtskodifikation durch Novellen und or<strong>de</strong>le (Urteilssprüche) <strong>de</strong>s Rates stetig erweitert und ergänzt. Beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung hatten die Ergän<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong>r<br />
Ratsverfassung. Das ursprüngliche Stadtrecht schwieg sich gera<strong>de</strong> <strong>zu</strong> dieser Frage weitgehend aus. Grundlegend war dann die Festset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Ratsfähigkeit und nach welchen Regeln <strong>de</strong>r<br />
Rat <strong>zu</strong> ergänzen sei von 1330. Ein ratsfähiger Mann musste <strong>de</strong>mnach frei und ehelich geboren sein, min<strong>de</strong>stens 24 Jahre alt sein und Grundstücke im Wert von 32 Mark Silber besitzen.<br />
[17]<br />
Neukodifikationen von 1428 und 1433<br />
Das auch machtpolitisch nach außen expandieren<strong>de</strong> Bremen erlebte im ersten Drittel <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts erhebliche Rückschläge. Hatte es sich <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>r Sicherung <strong>de</strong>r<br />
Weserschifffahrt in Rüstringen gegen verschie<strong>de</strong>ne friesische Häuptlinge und auch gegen die Grafschaft Ol<strong>de</strong>nburg durchgesetzt, wur<strong>de</strong> Bremen von einer Koalition <strong>de</strong>r Rüstringer<br />
Friesenhäuptlinge wie<strong>de</strong>r vertrieben. In <strong>de</strong>r Folge kam es innerhalb Bremens <strong>zu</strong> erheblichen Unruhen, die schließlich <strong>zu</strong>m Umsturz in <strong>de</strong>r Stadt führten. Der Rat wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Rücktritt<br />
gezwungen, die Bürgerschaft wählte aus ihrer Mitte einen neuen Rat. In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong> Bremen 1427 aus <strong>de</strong>r Hanse ausgeschlossen und die Reichsacht über die Stadt verhängt. 1428<br />
kam es in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>s Umsturzes schließlich <strong>zu</strong> einer Neukodifikation <strong>de</strong>s Stadtrechtes.[18] Inhaltlich wer<strong>de</strong>n die alten Regelungen weitgehend übernommen, allerdings neu geglie<strong>de</strong>rt,<br />
lediglich die Ratsverfassung wur<strong>de</strong> völlig neu gefasst.[10] Hierbei wird erstmals <strong>de</strong>r Versuch unternommen die Einzelregelungen thematisch <strong>zu</strong> glie<strong>de</strong>rn. Erfasst wird nur das<br />
ursprüngliche Stadtrecht ohne spätere Novellen, dieses bleibt in <strong>de</strong>r Sache allerdings unverän<strong>de</strong>rt. Be<strong>de</strong>utsam ist allerdings die Neuregelung <strong>de</strong>r Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates, die aller<br />
Wahrscheinlichkeit <strong>de</strong>r wirkliche Grund für die erneute Kodifikation war. Die inneren Unruhen hielten allerdings an und führten schließlich <strong>zu</strong>r Hinrichtung <strong>de</strong>s Bürgermeisters Johann<br />
Vasmer. In <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Hinrichtung verbün<strong>de</strong>ten sich Anhänger Vasmers und Angehörige <strong>de</strong>r ehemaligen Ratsfamilien mit umliegen<strong>de</strong>n Mächten. Es gelingt ihnen die Stadt<br />
ein<strong>zu</strong>nehmen und die Macht wie<strong>de</strong>r an sich <strong>zu</strong> nehmen. In <strong>de</strong>r Folge kommt es erneut <strong>zu</strong> einer Neukodifikation. Diese berücksichtigt nun die Novellen, wenn auch nicht alle, und glie<strong>de</strong>rt<br />
<strong>de</strong>n Text erneut um. Die „neue“ Glie<strong>de</strong>rung greift allerdings weitgehend die alte Glie<strong>de</strong>rung von 1303 wie<strong>de</strong>r auf, die Abschnitte III. (Statuten) und IV (Or<strong>de</strong>len/Urteile) fin<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r<br />
Kodifikation wie<strong>de</strong>r. Es wird 1433 wie<strong>de</strong>r auf die alte Ratsverfassung <strong>zu</strong>rückgegriffen und die Ratsordnung von 1398 im Wesentlichen wie<strong>de</strong>r in Kraft gesetzt und in das Stadtrecht<br />
integriert. Diese Fassung sollte dann <strong>de</strong>n Abschluss <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes darstellen und weitergelten.[19] Nach <strong>de</strong>r Rückkehr <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n alten Verhältnissen wur<strong>de</strong> Bremen wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r<br />
Hanse aufgenommen und konnte gegen nicht unerhebliche Sühneleistungen gegenüber Vasmers Erben auch die Reichsacht wie<strong>de</strong>r von sich abwen<strong>de</strong>n.[20]<br />
Weiterentwicklungen in <strong>de</strong>r Neuzeit<br />
Weiterentwicklungen durch die Kundigen Rollen<br />
Durch die Fassung von 1433 galt die Kodifizierung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts als letztlich abgeschlossen. Die weitere Entwicklung erfolgte durch die Praxis <strong>de</strong>r Rechtsprechung, die in
weiten Teilen beim Rat lag und durch Verordnungen und Sat<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>s Rates. Bekanntgegeben wur<strong>de</strong>n die Neuregelungen auf einer jährlich <strong>zu</strong> Laertare (3. Sonntag vor Ostern) vor <strong>de</strong>m<br />
Bremer Rathaus einberufenen Bürgerversammlung („Bursprake“). Bei dieser Versammlung wur<strong>de</strong>n die gelten<strong>de</strong>n Sat<strong>zu</strong>ngen und Verordnungen verlesen. Die Verlesung fand <strong>zu</strong>nächst von<br />
<strong>de</strong>r Rathauslaube statt. Diese Laube befand sich über <strong>de</strong>m heutigen Eingang <strong>zu</strong>m Ratskeller. Später erfolgte sie von <strong>de</strong>r Gül<strong>de</strong>nkammer <strong>de</strong>s Rathauses aus. Wur<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r „Bursprake“<br />
<strong>zu</strong>nächst alle Regelungen verlesen, so entstand im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Praxis, nur noch Polizeiverordnungen <strong>zu</strong> verlesen. Es wird angenommen, dass bereits im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt alle<br />
<strong>de</strong>rartigen Regelungen eigenständig gesammelt wur<strong>de</strong>n. Im Rats<strong>de</strong>nkelbuch ist eine Abschrift von 147 Verordnungen und Sat<strong>zu</strong>ngen von 1450 erhalten. Das Denkelbuch war 1395 vom<br />
Rat angelegt wor<strong>de</strong>n, um für die Stadt wichtige Schriftstücke ein<strong>zu</strong>tragen. Benannt wur<strong>de</strong> dieser Abschnitt <strong>zu</strong>nächst mit „De ol<strong>de</strong> kundich breff“ überschrieben, später wur<strong>de</strong> diese<br />
Überschrift durch „o<strong>de</strong>r Rulle“ ergänzt. 1489 wur<strong>de</strong> eine erneute Aufzeichnung begonnen. Hierbei wur<strong>de</strong>n Pergamentblätter aneinan<strong>de</strong>r genäht, so dass eine Rolle entstand. Insgesamt<br />
enthielt diese Rolle nach und nach 225 Artikel. Die letzte Ergän<strong>zu</strong>ng stammt von 1513. Bei einer Breite von etwa 15 cm wies die gesamte Rolle eine Länge von <strong>zu</strong>m Schluss 6,93 m auf.<br />
Diese Rechtssammlung wur<strong>de</strong> als „Kundige Rolle“ (bzw. „Kundige Rulle“) bezeichnet.[21] Insgesamt kann davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass auf Grund <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-rechtlichen<br />
Ausprägung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes die Bekanntgabe von Rechtsnormen für die Wirksamkeit <strong>de</strong>s Rechtes nicht von Be<strong>de</strong>utung war. Dies unterschied das nord<strong>de</strong>utsch-sächsische Bremer<br />
Stadtrecht von süd<strong>de</strong>utschen Stadtrechtsfamilien, die über oberitalienische Einflüsse stärker von <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>s römischen Rechts beeinflusst waren.[22]<br />
Zwar war die Kundige Rolle, die <strong>zu</strong>r Verlesung <strong>de</strong>s gelten<strong>de</strong>n Rechts genutzt wur<strong>de</strong>, das grundlegen<strong>de</strong> Rechtsdokument, aber nicht alle Rechtsän<strong>de</strong>rungen sind auf ihr vermerkt. Vielmehr<br />
dienten hier<strong>zu</strong> Abschriften als Kanzleiexemplare in Form von Heften. Das älteste erhaltene Kanzleiexeolar enthält die Än<strong>de</strong>rungen bis 1549. Ein zweites Kanzleiexemplar dann die<br />
Än<strong>de</strong>rungen aus <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Es folgten eine Abschrift mit <strong>de</strong>n Än<strong>de</strong>rungen von 1606 bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>zu</strong>letzt ein Exemplar mit<br />
Än<strong>de</strong>rungen zwischen 1656 und 1756. In <strong>de</strong>r Praxis war <strong>de</strong>r Rat auch da<strong>zu</strong> übergegangen Verordnungen und „Proklame“ schriftlich <strong>zu</strong> veröffentlichen. Dies war durch die in <strong>de</strong>r folge <strong>de</strong>r<br />
Reformation eingerichteten Kirchschulen und die damit einhergehen<strong>de</strong> gestiegene Alphabetisierung <strong>de</strong>r Bevölkerung möglich gewor<strong>de</strong>n. Die älteste überlieferte Verordnung <strong>de</strong>s Rates,<br />
die in gedruckter Form verbreitet wur<strong>de</strong>, war die Bremer Kirchenordnung , die durch Johann Timann in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Ereignisse von 1530/1532 erarbeitet und vom Rat als Verordnung<br />
erlassen wor<strong>de</strong>n war. Diese wur<strong>de</strong> allen Pastoren in Bremen ab 1588 in gedruckter Form übergeben. Die erste gedruckte Proklamation <strong>de</strong>s Rates stammt ebenfalls aus <strong>de</strong>m Jahr 1588 und<br />
betraf die Einrichtung von Wochenmärkten in <strong>de</strong>n damals <strong>zu</strong> Bremen gehören<strong>de</strong>n Orten Lehe und Neuenkirchen. Allerdings gerieten die Ordnungen und Proklame häufiger durch<br />
Nichtwie<strong>de</strong>rholung in Vergessenheit o<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong>n nicht mehr als verbindlich betrachtet. 151 folgte daher <strong>de</strong>r Druck einer, allerdings nicht offiziellen „’’Sammlung verschie<strong>de</strong>ner<br />
Verordnungen, welche in Handlungs- Schiffahrts- und Policey-Sachen <strong>de</strong>r Kayserl. Freyen Reichs-Stadt Bremen so in älteren als neueren Zeiten ausgegangen’’“ durch die Ratsdruckerei.<br />
Die Verlesung <strong>de</strong>r Kundigen Rolle in <strong>de</strong>r ’’Bursprak’’ war mittlerweile unpraktisch gewor<strong>de</strong>n und wur<strong>de</strong> 1756 endgültig vom Rat aufgegeben. Vielmehr ließ dieser 1756 eine Ausgabe <strong>de</strong>r<br />
Kundigen Rolle drucken, <strong>de</strong>r auch die Neue Eintracht von 1534 beigegeben wur<strong>de</strong>. 1810 erfolgte die erneute Veröffentlichung <strong>de</strong>r seither ergangenen und noch gültigen Verordnungen.<br />
Ab 1813 sollte dann jährlich eine „Sammlung <strong>de</strong>r Verordnungen und Proclame <strong>de</strong>s Senats <strong>de</strong>r freyen Hansestadt Bremen“ erfolgen. Ab 1849 in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Märzrevolution von 1848,<br />
wur<strong>de</strong>n dann die Gesetzesblätter <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen jährlich veröffentlicht.[23]<br />
Reformen und Reformversuche<br />
1532 war es kurzzeitig mit <strong>de</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r 104 Männer <strong>zu</strong> einem revolutionären Umsturz gekommen, die Macht hatte ein neuer Rat von 104 Männern an sich genommen. Im<br />
Gegensatz <strong>zu</strong> 1429 wur<strong>de</strong> jetzt aber kein neues Stadtrecht formuliert. Das neue Regime hielt sich letztlich auch nicht lange. Bereits 1534 kam es <strong>zu</strong> einer „Neuen Eintracht“ und damit <strong>zu</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r alten Verhältnisse. Zwar galt das Bremer Stadtrecht mit <strong>de</strong>r Kodifikation von 1433 als abgeschlossen, was in <strong>de</strong>r „Neuen Eintracht“ auch betont wur<strong>de</strong>, aber<br />
spätestens nach <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r 104 Männer 1530–1532 und <strong>de</strong>r „Neuen Eintracht“ von 1534 galt das Stadtrecht im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt als überarbeitungsbedürftig.<br />
Beson<strong>de</strong>rs verdient haben sich <strong>de</strong>r Bürgermeister Heinrich Krefting und sein Neffe und Bremer Syndicus Johann Wachmann <strong>de</strong>r Ältere um eine Weiterentwicklung <strong>de</strong>s Stadtrechtes<br />
gemacht. Krefting hatte 1590 noch als Professor an <strong>de</strong>r Universität Hei<strong>de</strong>lberg eine Schrift <strong>zu</strong>r Reformierung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes („Dispositio et Commentatio statutorum reipublicae<br />
Bremensis“) verfasst. Im Dezember 1591 wur<strong>de</strong> er dann <strong>zu</strong>m Ratsmitglied gewählt und schließlich 1605 sogar <strong>zu</strong>m Bremer Bürgermeister. Nach <strong>de</strong>m Eintritt in <strong>de</strong>n Rat hat Krefting die<br />
Reformierung in Angriff genommen. Der erste Erfolg war hierbei 1592 die Reformierung <strong>de</strong>r Abschnitte <strong>zu</strong>m Strafrecht. Dieses wur<strong>de</strong> an die 1532 in Kraft getretene Peinlichen<br />
Halsgerichtsordnung (Constitutio Criminalis Carolina) Karls V. angepasst. Die von ihm angestrebte große Reformierung kam in<strong>de</strong>ssen nicht <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>.<br />
Krefting und <strong>de</strong>r mit ihm <strong>zu</strong>sammenarbeiten<strong>de</strong> Johann Almers, gingen davon aus, dass das sächsische Recht stets nur insoweit gegolten habe, wie es ausdrücklich übernommen wur<strong>de</strong>.<br />
Ansonsten sei von <strong>de</strong>r praktischen Anwendung <strong>de</strong>s vom römischen Recht stark beeinflussten gemeinen Rechts aus<strong>zu</strong>gehen. Auf dieser Annahme basierte <strong>de</strong>r Entwurf eines „Verbeter<strong>de</strong>n<br />
Stadtbooks“, <strong>de</strong>r von Krefting initiiert, durch seine „Dispositio et Commentatio“ theoretisch beeinflusst und in <strong>de</strong>r konkreten Ausführung von Almers erstellt wur<strong>de</strong>. Der Entwurf sah eine
vollständige Neuglie<strong>de</strong>rung und Überarbeitung auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit mo<strong>de</strong>rnsten Erkenntnisse vor. In <strong>de</strong>n Debatten mit <strong>de</strong>r Wittheit als Gesamtheit aller Räte und Bürgermeister<br />
konnte sich Krefting <strong>zu</strong>nächst in weiten Teilen trotz erheblicher konservativer Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> durchsetzen. Als aber <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gezogene Bürgerausschuss sich für getrennte Debatten nach<br />
Kirchspielen aussprach und sich dabei erheblicher Wi<strong>de</strong>rstand an<strong>de</strong>utete, zog <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>n Entwurf <strong>de</strong>s neuen Stadtrechtes <strong>zu</strong>rück. Krefting und im geringeren Umfang Almers verfassten<br />
daraufhin als Glossatoren eine Glosse <strong>zu</strong>m Stadtrecht von 1433, in <strong>de</strong>r sie auf eine teilweise Novellierung wenigstens dreier Teilbereiche drängten: Die Regelungen <strong>zu</strong>r<br />
Zahlungsunfähigkeit und <strong>zu</strong>r Schuldknechtschaft sollten entsprechend <strong>de</strong>r allgemein in <strong>de</strong>r Hanse gelten<strong>de</strong>n Vorschriften gemil<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n; die von <strong>de</strong>r Reichspolizeiordnung von 1577<br />
vorgesehene obrigkeitliche Aufsicht über Vormün<strong>de</strong>r sollte eingeführt wer<strong>de</strong>n; die Regelungen <strong>zu</strong>m Ehebruch sollten entsprechend <strong>de</strong>r Reichspolizeiordnung verschärft wer<strong>de</strong>n und nicht<br />
mehr als bloße Ordnungswidrigkeit verfolgt wer<strong>de</strong>n. Die Reformversuche wur<strong>de</strong>n durch Kreftings Tod 1611 unterbrochen, später aber durch <strong>de</strong>n Neffen Kreftings, Johann Wachmann<br />
<strong>de</strong>m Älteren, wie<strong>de</strong>r aufgegriffen und in Glossen fortgeführt. Angefangen hatte Wachmann hierbei 1625. Gedacht war die Arbeit ursprünglich als Gedächtnisschrift für seinen geschätzten<br />
Onkel. Er fasste die Glossen Kreftings <strong>zu</strong>m „Verbeter<strong>de</strong>n Stadtbooks“ <strong>zu</strong>nächst mit <strong>de</strong>m „Verbeter<strong>de</strong>n Stadtbooks“ <strong>zu</strong>sammen; die entsprechen<strong>de</strong> Arbeit vollen<strong>de</strong>te er 1634. In späteren<br />
Ausgaben dieses „Co<strong>de</strong>x Glossatus“ vermehrte er dies durch eigene Glossen und nach Almers Tod auch noch durch Glossen Almers. Dieses Werk ist in vielen Abschriften erhalten, was<br />
auf eine erhebliche Nut<strong>zu</strong>ng in <strong>de</strong>r rechtlichen Praxis hin<strong>de</strong>utet.[24]<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt: Entwicklung und Ablösung<br />
Napoleonische Kriege<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erloschen gemäß § 27 <strong>de</strong>s Reichs<strong>de</strong>putationshauptschlusses alle Rechte <strong>de</strong>s Domkapitels in Bremen. Bremen war neben Augsburg, Lübeck, Nürnberg,<br />
Frankfurt und Hamburg eine <strong>de</strong>r wenigen verbleiben<strong>de</strong>n Reichsstädte.[25] Mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reichs 1806 wur<strong>de</strong> Bremen <strong>zu</strong>m souveränen Staat. Damit ergab sich<br />
für das Stadtrecht <strong>de</strong>r Hansestadt, dass es sich vom Partikularrecht <strong>zu</strong>m Recht eines souveränen Staates wan<strong>de</strong>lte. Bereits 1808 wur<strong>de</strong> Bremen allerdings durch Frankreich unter Napoléon<br />
Bonaparte gezwungen <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong> Napoléon ein<strong>zu</strong>führen, <strong>de</strong>r im Privatrecht das alte Stadtrecht damit ablöste. Am 13. Dezember 1810 annektierte Frankreich dann Bremen, trotz <strong>de</strong>r vorher<br />
verfolgten Politik <strong>de</strong>r Neutralität. Bremen wur<strong>de</strong> damit <strong>zu</strong>nächst eine französische Provinzstadt, für die vollständig das französische Recht galt. Die Beset<strong>zu</strong>ng wur<strong>de</strong> am 15. Oktober<br />
1813 durch <strong>de</strong>n Einmarsch General Tettenborns been<strong>de</strong>t. Von <strong>de</strong>n Än<strong>de</strong>rungen durch <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong> Napoléon blieb die Enführung eines Stan<strong>de</strong>samtes, das für die Registrierung von<br />
persönlichen Angelegenheiten (Geburt, Heirat, Tod) <strong>zu</strong>ständig war. Es entstan<strong>de</strong>n ein Han<strong>de</strong>lsgericht, die Han<strong>de</strong>lskammer und eine Han<strong>de</strong>lsbörse. [26]<br />
Restauration <strong>de</strong>s Stadtrechtes<br />
Bereits am 6. November 1813 konstituierte sich <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt neu und führte das alte Recht wie<strong>de</strong>r ein. Der Rat berief sich hierbei auf die von Johann Smidt entwickelte<br />
Kontinuitätstheorie, nach <strong>de</strong>r das Bremer Recht alt<strong>de</strong>utsch und auf <strong>de</strong>m bremischen Bo<strong>de</strong>n gewachsen sei; die erzwungenen Än<strong>de</strong>rungen Napoléons seien nur eine vorübergehen<strong>de</strong><br />
Räubertat ohne Be<strong>de</strong>utung gewesen. Der Rat sagte allerdings <strong>zu</strong>, „baldmöglichst“ Vorschläge für Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Bremer Rechts vorlegen <strong>zu</strong> wollen. Smidt konnte als Unterhändler <strong>de</strong>r<br />
Stadt auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress erreichen, dass die Souveränität Bremens anerkannt wur<strong>de</strong>. Damit hatte sich <strong>zu</strong>nächst die Restauration durchgesetzt, jedoch hatte sich auch ein<br />
Reformpartei formiert, die vor allem auf verfassungsrechtliche Än<strong>de</strong>rungen drängte. Die vom Rat vorgeschlagenen Än<strong>de</strong>rungen wur<strong>de</strong>n vom traditionell nach Kirchspielen getrennt<br />
beraten<strong>de</strong>n Bürgerkonvent allerdings abgelehnt. Es wur<strong>de</strong> von einer Vorbereitungskommission für die Constitutionsverhandlungen vielmehr ein Gegenvorschlag erarbeitet. Dieser<br />
Vorschlag sah eine Abkehr vom überkommenen Kommunalismus und die Bildung eines Zweikammerparlaments, Gewaltenteilung mit <strong>de</strong>utlicher Trennung von Judikative, Legislative<br />
und Exekutive vor, <strong>de</strong>r Rat sollte nur noch exekutive Funktion haben. Bereits 1814 bil<strong>de</strong>te sich dann eine gemischte Verfassungs<strong>de</strong>putation, die über eventuelle zeitgemäße Än<strong>de</strong>rungen<br />
beraten sollte. Mit <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sakte hatte sich Bremen auch verpflichtet, sogenannte „landständische Verfassungen“ <strong>zu</strong> schaffen. Allerdings sahen auch die Vertreter <strong>de</strong>r Reformpartei nicht<br />
ein allgemeines Wahlrecht vor, auch wenn ein Drittel <strong>de</strong>r Bürgerschaft gewählt wer<strong>de</strong>n sollte. Das Wahlrecht sollte vielmehr auch weiter ständisch orientiert sein, lediglich sollte es nun<br />
auch auf Handwerker ausge<strong>de</strong>hnt wer<strong>de</strong>n. Insgesamt setzten sich aber in <strong>de</strong>r Deputation die auf die Restauration bedachten Kräfte durch, die Reformkräfte verzettelten sich in<br />
Einzelproblemen. Der Hauptbericht <strong>de</strong>r Deputation vom 1814 sah zwar eine schärfere Abgren<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Kompetenzen <strong>de</strong>s Rates und <strong>de</strong>r Bürgerschaft vor, ansonsten blieb es im<br />
wesentlichen bei <strong>de</strong>r alten Konstitution. In <strong>de</strong>r Folge kam es zwar – etwa in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Julirevolution 1830 in Frankreich – immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einer Verfassungs<strong>de</strong>batte, diese Debatten<br />
verliefen aber ergebnislos. Immerhin kam es 1837 <strong>zu</strong>r Erarbeitung eines neuen Verfassungsentwurfes.[27]<br />
Konnte auch eine Verfassungsän<strong>de</strong>rung politisch nicht durchgesetzt wer<strong>de</strong>n, so führte die Debatte um die Verfassung <strong>zu</strong>r wissenschaftlichen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng mit <strong>de</strong>r Rechtsgeschichte
Bremens. Der Rechtsanwalt Ferdinand Donandt (1803–1872) verfasste sein zweiteiliges Werk „Versuch einer Geschichte <strong>de</strong>s Bremischen Stadtrechts“ 1830. Diese Arbeit stand in <strong>de</strong>r<br />
Tradition <strong>de</strong>r Historischen Rechtsschule und stützte sich auf die mittelalterlichen Urkun<strong>de</strong>n. Donandt war ein Vertreter <strong>de</strong>r liberalen Reformkräfte. Zweck <strong>de</strong>s Werkes sollte es sein, bei<br />
Verfassungsentwürfen über das notwendige Wissen für eine Neugestaltung <strong>de</strong>r Verfassung <strong>zu</strong> verfügen und nicht <strong>zu</strong> überstürzt <strong>zu</strong> han<strong>de</strong>ln.[28]<br />
Revolution von 1848 und erneute Restauration<br />
Schon im Vorfeld <strong>de</strong>r Märzrevolution von 1848 hatte sich in Bremen eine Mittelstandsbewegung gebil<strong>de</strong>t. Getragen wur<strong>de</strong> diese <strong>zu</strong>nächst von Handwerksmeistern und Lehrern. Im<br />
November 1847 wur<strong>de</strong> von 204 Personen in diesem Zusammenhang ein „Bürgerverein gegrün<strong>de</strong>t“, <strong>de</strong>r sich die Verfassungsän<strong>de</strong>rung <strong>zu</strong>m Ziel setzte. Innerhalb weniger Monate wuchs<br />
<strong>de</strong>r Verein, als erste formell gegrün<strong>de</strong>te Partei Bremens, vor allem durch <strong>de</strong>n Eintritt von Juristen und Kaufleuten auf 1320 Mitglie<strong>de</strong>r an. Der Bürgerverein stellte sich in Bremen an die<br />
Spitze <strong>de</strong>r Revolution von 1848. In einer Märzpetition vom 5. März 1848 wur<strong>de</strong> das Allgemeine Wahlrecht, die Einrichtung eines Bürgerparlaments und Pressefreiheit gefor<strong>de</strong>rt. Ergänzt<br />
wur<strong>de</strong> die mit For<strong>de</strong>rungen nach Gewaltenteilung, unabhängigen Gerichten und <strong>de</strong>r Einführung von Geschworenengerichten. Die Petition wur<strong>de</strong> von 2.100 Bürgern unterzeichnet. In <strong>de</strong>r<br />
Folge kam es <strong>zu</strong>r Bildung einer verfassungsgeben<strong>de</strong>n Versammlung nach einer allgemeinen Wahl. Die daraufhin formulierte Verfassung war stark von Ferdinand Donandt geprägt, <strong>de</strong>r<br />
1848 Vizepräsi<strong>de</strong>nt und 1852 schließlich Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Bürgerschaft und damit <strong>de</strong>s Parlamentes wer<strong>de</strong>n sollte. Mit <strong>de</strong>r „Verfassung <strong>de</strong>s Bremischen Staates“ vom 21. März 1849 wur<strong>de</strong><br />
die im alten Stadtrecht vorgesehene Ratsverfassung abgelöst.<br />
Insgesamt war die Verfassung aber eine Verbindung neuer und alter Elemente. So sah die Verfassung einen Dualismus im Bereich <strong>de</strong>r Legislative vor, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Senat, <strong>de</strong>ssen Mitglie<strong>de</strong>r<br />
lebenslänglich im Amt blieben, neben <strong>de</strong>r Bürgerschaft <strong>zu</strong>r Gesetzgebung befugt sein sollte. Der Senat war dabei von Donandt als ein „Element <strong>de</strong>r Ruhe“ angesehen wor<strong>de</strong>n.<br />
Zusammengesetzt sein sollte <strong>de</strong>r Senat aus fünf Juristen und fünf Kaufleuten.<br />
Am 29. März 1852 verfügte <strong>de</strong>r Senat einseitig die Aufhebung <strong>de</strong>r Verfassung. Berufen konnte er sich auf eine möglicherweise drohen<strong>de</strong> Intervention <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s, insbeson<strong>de</strong>re Preußens,<br />
und vom Bund gefor<strong>de</strong>rte Strukturän<strong>de</strong>rungen. Es wur<strong>de</strong> schließlich ein Achtklassenwahlrecht für die Bürgerschaft eingeführt, um <strong>de</strong>n ständischen Kräften eine Stärkung <strong>zu</strong> verleihen.<br />
Der Senat erhielt im wesentlichen die alten Rechte <strong>zu</strong>rück. Befürworter dieser Än<strong>de</strong>rung beriefen sich hierbei darauf, dass die Aufgabe <strong>de</strong>r Seestädte die Sicherstellung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen<br />
Außenhan<strong>de</strong>ls sei, was nur unter gebühren<strong>de</strong>r Berücksichtigung <strong>de</strong>r kaufmännischen Elemente möglich sei. Diese Staatsverfassung wur<strong>de</strong> letztlich erst nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>r<br />
Bremer Räterepublik durch die „Verfassung <strong>de</strong>r freien Hansestadt Bremen“ vom 18. Mai 1920 abgeschafft.[29] Die Verfassung von 1920, wie auch die Lan<strong>de</strong>sverfassung <strong>de</strong>r Freien<br />
Hansestadt Bremen von 1947, stärkten bewusst die Stellung <strong>de</strong>r Bremer Bürgerschaft als Parlament entgegen <strong>de</strong>r traditionell starken Stellung <strong>de</strong>s Rates nach <strong>de</strong>r alten Ratsverfassung.[30]<br />
Ablösung <strong>de</strong>s Straf- und Zivilrechtes durch Reichsrecht<br />
Bremen wur<strong>de</strong> Mitglied <strong>de</strong>s 1866 gegrün<strong>de</strong>ten Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s und trat 1871 <strong>de</strong>m Deutschen Reich bei. Die Gesetzgebung <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s verdrängte bereits teilweise<br />
die älteren Bestimmungen <strong>de</strong>s Stadtrechtes. Durch <strong>de</strong>n Beitritt <strong>zu</strong>m Deutschen Reich wur<strong>de</strong> das Bremer Stadtrecht erneut Partikularrecht und wur<strong>de</strong> durch die Kodifikationen <strong>de</strong>s Reiches<br />
schließlich weitgehend ersetzt.<br />
Zunächst <strong>zu</strong> nennen ist die Gewerbeordnung <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s von 1869. Durch die Gewerbeordnung wur<strong>de</strong> das Recht <strong>de</strong>r gewerblichen Angestellten <strong>de</strong>r Mitgliedsstaaten <strong>de</strong>s<br />
Bun<strong>de</strong>s durch mo<strong>de</strong>rnere, am Liberalismus <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts orientierte Regelungen ersetzt. Arbeitsverhältnisse waren nun bei Angestellten <strong>de</strong>r Wirtschaft normale schuldrechtliche<br />
Verträge. § 152 <strong>de</strong>r Gewerbeordnung erlaubte ausdrücklich die Bildung von Gewerkschaften als Vertreter <strong>de</strong>r Arbeiterschaft. Ergänzt wur<strong>de</strong> dies später durch Vorschriften <strong>de</strong>s Reiches <strong>zu</strong>r<br />
Sozialversicherung und <strong>zu</strong>r Arbeitssicherheit.[31]<br />
Bereits am 15. Mai 1871 wur<strong>de</strong> das Reichsstrafgesetzbuch verabschie<strong>de</strong>t und damit eine einheitliche Regelung <strong>de</strong>s Strafrechts im gesamten Deutschen Reich herbeigeführt. Die<br />
strafrechtlichen Bestimmungen <strong>de</strong>s Stadtrechtes verloren daher mit <strong>de</strong>m Inkrafttreten <strong>de</strong>s Strafgesetzbuches am 1. Januar 1872 ihre Be<strong>de</strong>utung. Es folgten die Reichsjustizgesetze, die am<br />
1. Oktober 1879 in Kraft traten. Durch diese Gesetze wur<strong>de</strong>n eine einheitliche Gerichtsstruktur und einheitliches Prozessrecht geschaffen.[32] Die bisherige Gerichtsordnung Bremens<br />
wur<strong>de</strong> durch die Gründung <strong>de</strong>s Landgerichts Bremen und <strong>de</strong>s Amtsgerichts Bremen abgelöst, die sich nach <strong>de</strong>n neuen Prozessordnungen <strong>zu</strong> richten hatten.[33]<br />
Durch die Kodifikation <strong>de</strong>s Privatrechtes im Bürgerlichen Gesetzbuch wur<strong>de</strong>n die übrigen zivilrechtlichen Bestimmungen <strong>de</strong>s Partikularrechtes <strong>zu</strong>m 1. Januar 1900 ersetzt.[34]
Mit Ausnahme <strong>de</strong>r schließlich 1920 ersetzten Ratsverfassung war das Bremer Stadtrecht damit abgelöst wor<strong>de</strong>n.<br />
Inhaltliche Gestaltung <strong>de</strong>s Stadtrechtes<br />
Verfasst ist das Bremer Stadtrecht von 1303 in einer frühen Form <strong>de</strong>s Mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utschen.[35]<br />
Inhaltlich ging Eckhardt[36] davon aus, dass das Bremer Stadtrecht im wesentlichen eine Aufzeichnung bereits vorher bestehen<strong>de</strong>n Rechtes darstelle. Allerdings sind entgegen dieser<br />
Annahme etwa ein Viertel aller Bestimmungen direkte Übernahmen aus <strong>de</strong>m Hamburger Stadtrecht, <strong>de</strong>m sogenannten Or<strong>de</strong>lbook (etwa 1270) unter an<strong>de</strong>rem ein Block von 45<br />
Vorschriften. Das Hamburger Recht hatte seinerseits erhebliche Anleihen beim Sachsenspiegel Eike von Repgows gemacht. So waren 23 <strong>de</strong>r genannten 45 Vorschriften ihrerseits bereits<br />
im Sachsenspiegel enthalten.[37]<br />
Der Sachsenspiegel selbst erhob zwar <strong>de</strong>n Anspruch das Recht <strong>de</strong>s gesamten Sachsen (etwa heute das Gebiet <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nie<strong>de</strong>rsachsen und <strong>de</strong>n<br />
westfälischen Teil Nordrhein-Westfalens) ab<strong>zu</strong>bil<strong>de</strong>n, es bestan<strong>de</strong>n aber erhebliche Lücken, die von <strong>de</strong>n Stadtrechten aufgearbeitet wer<strong>de</strong>n mussten. So fehlte im Sachsenspiegel <strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>n Städten wichtige Bürgerstand etwa vollständig. Dies war ein wesentlicher Gesichtspunkt, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Kodifizierung <strong>de</strong>r Stadtrechte aufgegriffen wer<strong>de</strong>n musste.[38]<br />
Geglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> das Stadtrechtsbuch in vier Abschnitte, wobei die Abschnitte IV und ein erheblicher Teil <strong>de</strong>s Abschnittes III Übernahmen aus <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>lbook Hamburgs und damit<br />
teilweise Rezeptionen <strong>de</strong>s Sachsenspiegels sind. Allerdings wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Übernahmen erkennbar eine Auswahl getroffen. Der Abschnitt I enthielt Regelungen <strong>zu</strong>m Güter-,<br />
Vormundschafts- und Erbrecht, <strong>de</strong>r zweite Abschnitt, <strong>de</strong>r mit „Not-Wehre“ überschrieben ist, strafrechtliche Bestimmungen. Der erste Abschnitt weist viele Bezüge <strong>zu</strong>m<br />
Gewohnheitsrecht auf und greift einige ältere Rechtssätze auf. Der dritte Abschnitt („Statuten“) weist eine Mischung von älteren Bestimmungen und solchen auf, die erst im 13. und<br />
beginnen<strong>de</strong>n 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt gebil<strong>de</strong>t sein können. Der vierte (und längste) Abschnitt ist mit „Or<strong>de</strong>len“ (Urteile) überschrieben und umfasst aus <strong>de</strong>r gerichtlichen Praxis stammen<strong>de</strong><br />
Bestimmungen <strong>zu</strong>r Gerichtsordnung, <strong>zu</strong>m Beweisrecht sowie einzelne Bestimmungen <strong>zu</strong>m Privat- und <strong>zu</strong>m Vertragsrecht.[39] Der Abschnitt II weist hierbei Ursprünge im Corpus iuris<br />
civilis und damit <strong>de</strong>m römischen Recht auf, die sich mit Gedanken aus <strong>de</strong>m älteren Gewohnheitsrecht (z. B. <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>zu</strong>r Vergewaltigung) vermischten.[40]<br />
Ratsverfassung<br />
Die städtische Gemein<strong>de</strong> hatte sich im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt als Rechtskörperschaft herausgebil<strong>de</strong>t. Spätestens mit <strong>de</strong>m Barbarossa-Privileg von 1186 konnten Männer und Frauen, die ein Jahr<br />
und einen Tag ein Grundstück besaßen sich auf <strong>de</strong>n Grundsatz „Stadtluft macht frei“ berufen und auf eigene Bürgerrechte verweisen. Zur Organisation dieser Gemeinschaft <strong>de</strong>r Bürger<br />
fin<strong>de</strong>n sich erstmals in einer Zollbefreiungsurkun<strong>de</strong> Erzbischof Gebhard II. von 1225 Hinweise, da dort sieben consules <strong>de</strong>r Stadt namentlich als solche aufgeführt wer<strong>de</strong>n. Diese consules<br />
treten allerdings nicht als Rat auf, können aber wohl aber als Mitglie<strong>de</strong>r einer solchen Institution gedacht wer<strong>de</strong>n.[41]<br />
Es hatte sich bereits vor <strong>de</strong>r Kodifikation eine faktische Ratsverfassung entwickelt, auch wenn diese noch nicht schriftlich nie<strong>de</strong>rgelegt war. Die soziale Oberschicht <strong>de</strong>r Bürgerschaft<br />
bil<strong>de</strong>ten wenige Patriziergeschlechter, die allein ratsfähig waren. Hatte sich <strong>de</strong>r Rat <strong>zu</strong>nächst aus Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r gesamten Bürgerschaft gebil<strong>de</strong>t, ergänzte er sich mittlerweile im<br />
wesentlichen selbst. Die Fassung <strong>de</strong>s Stadtrechtes von 1303 enthielt aber kaum Regelungen über die Verfassung <strong>de</strong>s Rates. Der Rat bestand zwischen 1289 und 1304 aus vierzehn<br />
Personen, was unter an<strong>de</strong>rem aus <strong>de</strong>r Einleitung <strong>zu</strong>m Stadtrecht von 1303 ersichtlich ist. Ferner wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Stadtrecht eine Liste <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Unruhen von 1304 vertriebenen<br />
Geschlechter beigefügt. Ab 1304 bestand <strong>de</strong>r Rat aus 36 Mitglie<strong>de</strong>rn, wobei jeweils nur ein Drittel im jährlichen Turnus das Amt ausübte. 1330 kam es dann <strong>zu</strong>r ersten schriftlichen<br />
Regelung <strong>de</strong>r Ergän<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates und <strong>de</strong>r Ratsfähigkeit. Diese Bestimmungen wur<strong>de</strong>n in das Stadtrecht nachträglich aufgenommen. Hierbei wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rat mit Bestimmungen <strong>zu</strong>m<br />
Min<strong>de</strong>stvermögen und <strong>de</strong>m Verbot, während <strong>de</strong>r Mitgliedschaft im Rat ein Handwerk aus<strong>zu</strong>üben, nur auf die wohlhaben<strong>de</strong>n Schichten beschränkt. 1398 wur<strong>de</strong> diese Ratsordnung<br />
novelliert. Danach bil<strong>de</strong>ten 4 Bürgermeister und 20 Ratsherren die Wittheit o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Rat. Der jeweils regieren<strong>de</strong> Rat wur<strong>de</strong> aus jeweils zweien <strong>de</strong>r Bürgermeister und zehn Ratsherren<br />
gebil<strong>de</strong>t.[42]<br />
Mit <strong>de</strong>m Umsturz 1428 wur<strong>de</strong> die Ratsverfassung umgestaltet, aber mit <strong>de</strong>r Restauration von 1433 wie<strong>de</strong>r hergestellt und hierbei auch in das Stadtrecht integriert. Von <strong>de</strong>r Verfassung von<br />
1428 blieb lediglich eine Regelung erhalten, nach <strong>de</strong>r eine <strong>zu</strong> nahe Verwandtschaft <strong>zu</strong> einem Ratsmitglied <strong>de</strong>r Aufnahme entgegenstehen konnte.[43]<br />
Gerichtsbarkeit, insbeson<strong>de</strong>re Kriminalgerichtsbarkeit
Die Gerichtspraxis in Bremen zeichnete sich durch eine gewisse Zweigleisigkeit bei <strong>de</strong>r Gerichtsbarkeit aus. Neben <strong>de</strong>r Gerichtsbarkeit durch <strong>de</strong>n Rat bestand lange, letztlich sogar über<br />
das Bestehen <strong>de</strong>s Bistum Bremen hinaus, eine Gerichtsbarkeit durch <strong>de</strong>n Vogt <strong>de</strong>s Erzbischofs. Die Gerichtsbarkeit <strong>de</strong>s Bischofs war mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>s Bistums entstan<strong>de</strong>n.<br />
Spätestens seit <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt war sie Hochgerichtsbarkeit und verfügte über <strong>de</strong>n Königsbann. Der Bischof ließ sich, da ihm als Geistlichem keine weltliche Gerichtsbarkeit <strong>zu</strong>kam,<br />
als Lehnsherr für die weltliche Gerichtsbarkeit durch seinen Vogt vertreten. Mit <strong>de</strong>m Barbarossa-Privileg von 1186 bil<strong>de</strong>ten sich dann allmählich die städtischen Institutionen heraus, die<br />
in Konkurrenz <strong>zu</strong>r Gerichtsbarkeit <strong>de</strong>s Bischofs treten sollten. Mit <strong>de</strong>r Zunahme <strong>de</strong>r Selbstständigkeit <strong>de</strong>r consules <strong>de</strong>r Stadt im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird dann verstärkt auf eine Beteiligung<br />
<strong>de</strong>r städtischen Organe an <strong>de</strong>r Rechtsprechung hingearbeitet und schließlich für Streitigkeiten zwischen <strong>de</strong>n Bürgern auch erreicht. Dies umfasste nicht nur das Privatrecht im heutigen<br />
Sinn, son<strong>de</strong>rn auch innere Angelegenheiten <strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>r Bürgerschaft o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Polizeirechts. Die Gebhardschen Reversalen von 1248 wandten sich dann auch vor allem dagegen,<br />
dass die städtischen Institutionen sich <strong>zu</strong>sätzlich einseitig strafrichterliche Funktionen <strong>zu</strong>gelegt hatten. Allerdings ergibt sich aus <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> auch, dass die Vögte bei ihrer<br />
Gerichtsbarkeit bereits <strong>zu</strong>vor auf die Sachkenntnis und die Mitwirkung von Ratsmitglie<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong>rückgegriffen hatten. Der Vogt urteilte hiernach in privat- und in strafrechtlichen<br />
Angelegenheiten, in zivilrechtlichen Sachen allerdings stets unter Mitwirkung von Vertretern <strong>de</strong>s Rates. In <strong>de</strong>m Stadtrecht von 1303 wird betont, dass die Gerichtsbarkeit <strong>de</strong>s Erzbischofs<br />
durch das Stadtrecht nicht gemin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n solle. Allerdings wird <strong>zu</strong>gleich die Zuständigkeit <strong>de</strong>s Rates für streitige Rechtsangelegenheiten unterstrichen. Diese Zuständigkeit <strong>de</strong>hnte sich<br />
dann auch wie<strong>de</strong>r in strafrechtliche Bereiche aus und verdrängte mit ihren mo<strong>de</strong>rneren Formen die umständlichere Gerichtsbarkeit <strong>de</strong>r Vögte. Für 1330 ist dann ein Fall von Bigamie<br />
überliefert, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Vogt das Verfahren vollständig an <strong>de</strong>n Rat verwies. Die parallelen Gerichtswege führten da<strong>zu</strong>, dass bis in das 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt Strafprozesse <strong>zu</strong>weilen vor bei<strong>de</strong>n<br />
Gerichtswegen anhängig waren. Das Nebeneinan<strong>de</strong>r dieser Gerichtswege wur<strong>de</strong> erst 1541 durch ein Privileg Karl V. been<strong>de</strong>t.[44] Es wur<strong>de</strong> danach ein Nie<strong>de</strong>rgericht für Streitfälle unter<br />
200 Gul<strong>de</strong>n und ein Obergericht für Streitfälle über 200 Gul<strong>de</strong>n eingerichtet. Es blieb aber auch nach <strong>de</strong>m Privileg bei einer Zuständigkeit <strong>de</strong>r bischöflichen Gerichtsbarkeit für<br />
Angehörige <strong>de</strong>r Domimmunität und für die Blut- und Halsgerichtbarkeit. Zumin<strong>de</strong>st eine Beteiligung <strong>de</strong>s Vogtes war daher bei Fällen <strong>de</strong>r Blut- und Halsgerichtbarkeit notwendig. Hier<br />
hatte <strong>de</strong>r Rat nie auf eine Zuständigkeit gedrängt. Erst im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss wur<strong>de</strong> auf die letzten Reste <strong>de</strong>r Vogtgerichtsbarkeit verzichtet. Das<br />
erste mit einer To<strong>de</strong>sstrafe en<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Verfahren, dass <strong>de</strong>r Rat alleine durchführte, fand dann auch erst nach <strong>de</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss statt. Es war <strong>de</strong>r Mordprozess gegen Gesche<br />
Gottfried von 1828 bis 1831.[45]<br />
Das Gericht <strong>de</strong>r Vögte fand unter freiem Himmel statt, <strong>de</strong>r Rat beriet seine Rechtsfälle unter Ausschluss <strong>de</strong>r Öffentlichkeit im Ratsgestühl <strong>de</strong>s Bremer Rathauses. Das Vogtgericht tagte<br />
<strong>zu</strong>nächst auf <strong>de</strong>m Markt, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nächst südlich <strong>de</strong>s Kirchhofes <strong>de</strong>r Liebfrauenkirche stattfand. Grund hierfür war, dass mit <strong>de</strong>r Gerichtsbarkeit auch das Marktgericht verbun<strong>de</strong>n war. In<br />
Urkun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts wird <strong>de</strong>r Gerichtsort <strong>de</strong>r Vögte als „die vier Bänke“ bezeichnet. Aus Erwähnungen in Quellen aus <strong>de</strong>m 13. und <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts lässt sich schließen,<br />
dass in dieser Zeit <strong>de</strong>r Gerichtsort <strong>de</strong>r Vogtei etwa an <strong>de</strong>r Westseite <strong>de</strong>s heutigen Ratshauses lag. Auch die Bezeichnung „Schoppensteel“ für <strong>de</strong>n Platz zwischen <strong>de</strong>m heutigen Rathaus<br />
und <strong>de</strong>r Liebfrauenkirche weist auf einen Gerichtsort dort hin. Vollstreckungsstätten, wie etwa <strong>de</strong>r Pranger o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Richtpfahl, befan<strong>de</strong>n sich in unmittelbarer Nähe. Mit <strong>de</strong>m Neubau <strong>de</strong>s<br />
Rathauses 1405 musste <strong>de</strong>r Gerichtsort <strong>de</strong>r Vögte ausweichen. Fortan fan<strong>de</strong>n die Gerichtssit<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r Vögte im zweiten Bogen <strong>de</strong>r Rathausarka<strong>de</strong>n statt. Das Vogtsgericht tagte<br />
regelmäßig dreimal im Jahr (ungebotenes Ding) o<strong>de</strong>r bei Bedarf durch anstehen<strong>de</strong> Rechtsfälle (gebotenes Ding).[46]<br />
Das Strafverfahren folgte in Bremen <strong>de</strong>n Grundsätzen <strong>de</strong>s Inquisitionsverfahrens, selbst noch im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, als dieses Verfahren durch mo<strong>de</strong>rnere Formen in an<strong>de</strong>ren Staaten<br />
abgelöst wor<strong>de</strong>n war. Erst im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Prozess um die Giftmör<strong>de</strong>rin Gesche Gottfried wur<strong>de</strong>n erstmals die Grundsätze <strong>de</strong>r Freien Beweiswürdigung eingeführt.<br />
An<strong>de</strong>rerseits hatte Bremen als erstes <strong>de</strong>utsches Territorium, bereits im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt, die Freiheitsstrafe eingeführt und ein Zucht- und Arbeitshaus nach <strong>de</strong>m Vorbild von Amsterdam<br />
eingeführt, sowie faktisch auf die Folter verzichtet.[47]<br />
Strafrecht<br />
Die strafrechtlichen Bestimmungen <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes sahen im Vergleich <strong>zu</strong>m früheren Strafrecht <strong>de</strong>s Früh- und Hochmittelalters in Bremen eine <strong>de</strong>utliche Strafverschärfung vor.<br />
Während im früheren Recht <strong>de</strong>r Bußgeldzahlung <strong>de</strong>r Vor<strong>zu</strong>g gegeben wur<strong>de</strong>, was auch eine Einnahmequelle <strong>de</strong>r Vögte und Bischöfe war, sah das mo<strong>de</strong>rnere Stadtrecht als To<strong>de</strong>sstrafen<br />
Enthauptung, Erhängen, Rä<strong>de</strong>rn, Sie<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Verbrennen vor. Als Körperstrafen waren vorgesehen: Abhauen <strong>de</strong>r rechten Hand, Einbrennen eines Schlüssels in die Wange, Durchstoßen<br />
<strong>de</strong>r Hand mit einem Messer und Stäupen mit Ruten.[46] Grundsätzlich musste Anklage gegen Straftäter geführt wer<strong>de</strong>n (Akkusationsprinzip), erst mit <strong>de</strong>r erneuten Kodifikation <strong>de</strong>s<br />
Stadtrechtes 1433 wur<strong>de</strong>n zwischen die Abschnitte III und IV einige Bestimmungen <strong>zu</strong>m Bruch <strong>de</strong>s Bürgerfrie<strong>de</strong>ns eingefügt. Dies waren Totschlag, tätliche Misshandlung, <strong>de</strong>r Angriff<br />
und die Verlet<strong>zu</strong>ng mit scharfen Waffen. Für diese Delikte wur<strong>de</strong> mit diesen Vorschriften erstmals bestimmt, dass die Strafverfolgung von Amts wegen <strong>zu</strong> erfolgen habe.[48]<br />
Eine Anpassung an spätere Rechtsentwicklungen erfolgte auf Veranlassung Heinrich Kreftings 1592. Hierbei wur<strong>de</strong>n das Straf- und das Strafprozessrecht an die 1532 in Kraft getretene
Peinliche Halsgerichtsordnung Karl V. angepasst. Die Carolina war an römisch-rechtlichen Vorbil<strong>de</strong>rn orientiert. So wur<strong>de</strong> durch die Reformierung <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Abschnitte die<br />
Körperverlet<strong>zu</strong>ng und die Beleidigung, die bisher als gegen die Allgemeinheit gerichtetes Unrecht begriffen wur<strong>de</strong>n, Privatklage<strong>de</strong>likte. Das hatte <strong>zu</strong>r Folge, dass an die Stadt eine Buße<br />
und gleichzeitig eine Wie<strong>de</strong>rgutmachung an <strong>de</strong>n Geschädigten <strong>zu</strong> zahlen war. Eine Körperstrafe für das bloße Zücken einer scharfen Waffe unterblieb; nunmehr wur<strong>de</strong> hierfür eine<br />
Geldbuße und eine Verweisung aus <strong>de</strong>r Stadt für Jahr und Tag vorgesehen. Strafprozessual wur<strong>de</strong> die überkommene Regelung gestrichen sich durch Unschuldseid vom erbrachten<br />
Augenscheinsbeweis <strong>zu</strong> befreien.[24]<br />
Hexerei<br />
Im Sachsenspiegel gab es eine Bestimmung <strong>zu</strong>m Umgang mit Hexen. Diese wur<strong>de</strong> mit einer beweisrechtlich be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Einschränkung in das Hamburger Stadtrecht und über dieses in<br />
das Bremer Stadtrecht übernommen: Die Hexe musste auf frischer Tat ertappt wor<strong>de</strong>n sein. Insgesamt war mit dieser einzigen Bestimmung im Bremer Stadtrecht <strong>zu</strong>r Hexerei aber nur <strong>de</strong>r<br />
Scha<strong>de</strong>nszauber unter Strafe gestellt. In Bremen kam es daher während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Hexenverfolgung nur <strong>zu</strong> relativ wenigen Hexenprozessen. Zwar bestand <strong>de</strong>r doppelte Rechtsweg vor<br />
<strong>de</strong>m Rat und <strong>de</strong>m Vogteigericht, faktisch überwies <strong>de</strong>r Vogt aber <strong>de</strong>rartige Prozesse regelmäßig an <strong>de</strong>n Rat wegen <strong>de</strong>r Schwierigkeit <strong>de</strong>r Rechtsmaterie. Dort galt, wie aus zwei<br />
Rechtsbelehrungen an die Stadt Ol<strong>de</strong>nburg ersichtlich ist, das Akkusationsprinzip, das heißt, es war erfor<strong>de</strong>rlich, dass vom Geschädigten o<strong>de</strong>r einer an<strong>de</strong>ren Person Anklage erhoben<br />
wur<strong>de</strong>. Die sonst aus <strong>de</strong>r Umgebung Bremens überlieferte Wasserprobe als Gottesbeweis wegen Hexerei unterblieb und wur<strong>de</strong> teilweise ausdrücklich abgelehnt. Eine Ausweitung <strong>de</strong>r<br />
Kriminalgerichtsbarkeit fand nach <strong>de</strong>m Erlass <strong>de</strong>r Constitutio Criminalis Carolina 1532 statt, da diese als Reichsrecht erhebliche Bestimmungen gegen Hexerei enthielt.[49][50]<br />
Familien- und Erbrecht<br />
Das Bremer Recht zeigt etwa im Ehegüterrecht eine erkennbar geringere Differenziertheit als <strong>de</strong>r Sachsenspiegel, beispielsweise das Nut<strong>zu</strong>ngsrecht <strong>de</strong>r (auch geschie<strong>de</strong>nen) Ehefrau am<br />
Eigentum <strong>de</strong>s Ehemannes. Ein Unterschied betrifft das im Hamburger Recht vorgesehene Verbot, die im Kindsbett liegen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r schwangere Witwe aus <strong>de</strong>m Gut <strong>de</strong>s Mannes <strong>zu</strong><br />
vertreiben; im Bremer Recht geht es ausschließlich um die Ehefrau, <strong>de</strong>r Hinweis auf die Witwenschaft unterbleibt. Hier ist allerdings unklar, ob <strong>de</strong>r Schutz <strong>de</strong>r Schwangeren auf die<br />
Ehefrauen ausge<strong>de</strong>hnt wer<strong>de</strong>n soll. Ein Versehen wird allerdings ausgeschlossen, da dieser Passus unverän<strong>de</strong>rt 1428 und 1433 übernommen wur<strong>de</strong>.[51]<br />
Das ursprüngliche Erbrecht in Bremen sah eine ungeteilte Gesamthandsgemeinschaft von Vätern und Söhnen vor. Dieses Recht wur<strong>de</strong> jedoch bereits unter Erzbischof Adaldag (937–988)<br />
<strong>zu</strong>gunsten einer Kopfteilsgemeinschaft aufgelöst, die schließlich auch die Ehefrau und die Töchter einbezog. Das Stadtrecht sah daher Abson<strong>de</strong>rungsrechte für die Kopfteile <strong>de</strong>r Ehefrau<br />
und <strong>de</strong>s Ehemannes vor. Es bestand aber kein Abteilungsanspruch <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r gegen <strong>de</strong>n Vater. Töchter und Söhne wur<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Kopfteilsberechnung gleichberechtigt behan<strong>de</strong>lt. Vom<br />
allgemein üblichen sächsischen Recht wich das bremische insofern ab, als dass die Gera<strong>de</strong> als Son<strong>de</strong>rerbfolge <strong>de</strong>r Frauen nicht vorgesehen war. Dies ging auf eine bereits 1206 erfolgte<br />
Aufhebung <strong>zu</strong>rück.[52]<br />
Dienst- und Gesin<strong>de</strong>recht<br />
Bleibt das Eherecht und auch das Erbrecht hinter <strong>de</strong>m Sachsenspiegel und <strong>de</strong>m Hamburger Stadtrecht <strong>zu</strong>rück, so ist das Gesin<strong>de</strong>- und Dienstbotenrecht wesentlich weiter ausgearbeitet.<br />
Dies lässt sich darauf <strong>zu</strong>rückführen, dass im städtischen Leben mit <strong>de</strong>r differenzierteren Wirtschaft <strong>de</strong>m was heute Individualarbeitsrecht genannt wird, eine erheblichere Be<strong>de</strong>utung hatte<br />
als im allgemeinen sozialen Leben <strong>de</strong>s Mittelalters.<br />
Der Sachsenspiegel verzichtete im Abschnitt über das Lehnsrecht ausdrücklich auf eine ausführliche Darstellung, da es <strong>zu</strong> unterschiedliche Ausprägungen geben wür<strong>de</strong>. Allerdings fin<strong>de</strong>n<br />
sich in <strong>de</strong>n Ausführungen <strong>zu</strong>m Landrecht Vorschriften <strong>zu</strong>r Lohnfortzahlung, <strong>zu</strong> Lohnrückzahlungen, <strong>zu</strong>r Haftung <strong>de</strong>s Herren für von seinen Knechten angerichtete Schä<strong>de</strong>n und für<br />
Spielschul<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Knechte. Diese Abschnitte wur<strong>de</strong>n über das Or<strong>de</strong>elbook übernommen. Das Bremer Stadtrecht sah aber Ergän<strong>zu</strong>ngen und Abweichungen vor: So konnte nach <strong>de</strong>m<br />
Bremer Recht ein Knecht bei Kündigung <strong>de</strong>n vollen Lohn for<strong>de</strong>rn, soweit er die Kündigung nicht selbst verschul<strong>de</strong>t hatte. An<strong>de</strong>rerseits musste er bei eigener Kündigung Scha<strong>de</strong>nsersatz<br />
für die entgangenen Dienste ab Beendigung <strong>de</strong>s Dienstverhältnisses leisten, was beim Sachsenspiegel noch das Doppelte <strong>de</strong>ssen war, was <strong>de</strong>r Dienstherr als Entlohnung in Aussicht<br />
gestellt hatte. In Bremen und Hamburg wur<strong>de</strong>n die dienstrechtlichen Bestimmungen auch auf Frauen ausge<strong>de</strong>hnt und diese in Bremen dienst- und gesin<strong>de</strong>rechtlich sogar gleichbehan<strong>de</strong>lt.<br />
Es wer<strong>de</strong>n Regelungen <strong>zu</strong> Min<strong>de</strong>stlöhnen (mênasle) in Höhe von vier Schillingen getroffen. Ferner fin<strong>de</strong>n sich Regelungen für <strong>de</strong>n Fall <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Dienstherren o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Angestellten.<br />
[53] Die Regelung im Bremer Stadtrecht, dass Gesellen von ihren Meistern sowohl in ihrer Gesundheit <strong>zu</strong> unterhalten und auch in <strong>de</strong>r Krankheit <strong>zu</strong> versorgen waren, stellte eine Vorstufe
in <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>zu</strong>m heutigen Arbeitsrecht dar.[54]<br />
Schiffs- und Seerecht<br />
Für eine Seehan<strong>de</strong>lsstadt besteht naturgemäß ein gewisses Interesse an <strong>de</strong>r Regelung schiffs- und seerechtlicher Fragen. In <strong>de</strong>n mittelalterlichen Stadtrechten war eine abweichen<strong>de</strong><br />
Regelung vom allgemeinen Recht im Seerecht durchaus üblich. So sah dass allgemeine Recht etwa vor, dass <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r einen Scha<strong>de</strong>n verursacht, diesen Aus<strong>zu</strong>gleichen hat. Ein<br />
Verschul<strong>de</strong>n spielte hierbei keine Rolle. Im Schiffs- und Seerecht war eine Scha<strong>de</strong>nsteilung zwischen Kaufleuten und Ree<strong>de</strong>rn beziehungsweise Schiffsführern üblich – und etwa im<br />
bremischen Recht auch vorgesehen. In <strong>de</strong>r bremischen Stadtrechtskodifizierung fin<strong>de</strong>n sich allerdings nur drei Regelungen mit entsprechen<strong>de</strong>m Be<strong>zu</strong>g. Eine war bereits in <strong>de</strong>r<br />
ursprünglichen Fassung vorhan<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren han<strong>de</strong>lte es sich um frühe Novellen. Damit ist das bremische Seerecht relativ <strong>zu</strong>m Seerecht in an<strong>de</strong>ren nord<strong>de</strong>utschen<br />
Seehan<strong>de</strong>lsstädten unterentwickelt. Das Stadtrecht von Schleswig (um 1200 entstan<strong>de</strong>n) enthielt neun Bestimmungen, das Stadtrecht Flensburgs von 1284 acht, das Lübecker Stadtrecht<br />
dreizehn und auch das hamburgische Stadtrecht wohl dreizehn Regelungen. Die Regelungen im Bremer Recht waren ten<strong>de</strong>nziell günstiger für <strong>de</strong>n Schiffsführer. So sah das bremische<br />
Recht vor, dass das Frachtrisiko zwischen Schiffsführer und Kaufmann <strong>zu</strong> teilen war. Das Frachtgeld war <strong>zu</strong> Fahrtbeginn <strong>zu</strong>r Hälfte <strong>zu</strong> errichten und <strong>zu</strong>r an<strong>de</strong>ren Hälfte nach <strong>de</strong>r<br />
erfolgreichen Durchführung <strong>de</strong>r Fahrt. Nach späteren hansischen Gepflogenheiten trug <strong>de</strong>r Schiffsführer das Risiko vollständig, da er erst nach erfolgreicher Durchführung entlohnt<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Allerdings ist eine zwischen 1335 und 1349 datierbare Abschrift <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes überliefert, die unter an<strong>de</strong>ren als Anhang eine größere Anzahl seerechtlicher Rechtssätze<br />
umfasst. Diese Sätze stellen insgesamt ein voll entwickeltes Seerecht dar. Dieses Seerecht ist weitestgehend vom Hamburger Seerecht entliehen. Nach Bremen gelangten diese<br />
Rechtssätze auf <strong>de</strong>m Umweg über <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l mit Flan<strong>de</strong>rn, in <strong>de</strong>m Hamburg führend war. Die bremischen Kaufleute griffen auf die vorhan<strong>de</strong>nen Hamburger Einrichtungen <strong>zu</strong>rück und<br />
mussten sich dabei an das hamburgische Recht anpassen. Dabei war dieses Hamburger Recht <strong>zu</strong>nächst nur das Recht und <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsgebrauch <strong>de</strong>r Hamburger Flan<strong>de</strong>rnfahrer, die es<br />
entwickelten. Diese Anpassung an frem<strong>de</strong>s Rechts wur<strong>de</strong> dann in die bremische Praxis übernommen. Erleichtert wur<strong>de</strong> dies auch dadurch, dass das Seerecht insgesamt auch weniger ein<br />
örtlich gebun<strong>de</strong>nes Stadtrecht, son<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong>m großen Teil eher internationales Verkehrsrecht ist und auch damals entsprechend gesehen wur<strong>de</strong>. Allerdings wur<strong>de</strong> das ursprünglich<br />
hamburgische Recht erst mit <strong>de</strong>r Übernahme von gesamthansischen Seerecht 1378 auch offiziell Bremer Stadtrecht.<br />
Mit <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s gesamthansischen Schiffsrechtes und <strong>de</strong>m Rückgang <strong>de</strong>r Vorrangstellung Hamburgs im Flan<strong>de</strong>rnhan<strong>de</strong>l geriet dieses Seerecht allerdings <strong>zu</strong>nehmend<br />
außer Gebrauch. Mit <strong>de</strong>r gesamthansischen Schiffsordnung von 1482 verloren partikulare stadtrechtliche Regelungen schließlich weitgehend ihre Be<strong>de</strong>utung. 1575 erließ die Bremer<br />
Schiffergesellschaft allerdings eine eigenständige Schiffsordnung. Diese wur<strong>de</strong> als „Ordonatie“ übernommen. 1614 wur<strong>de</strong>n Teile dieser Regelungen in das gesamthansische Recht<br />
übernommen.[55]<br />
Die Stadtrechtsfamilie<br />
Von <strong>de</strong>n Ortschaften, die <strong>de</strong>r Stadtrechtsfamilie <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen sein könnten, hatten nur vier (Delmenhorst, Ol<strong>de</strong>nburg, Ver<strong>de</strong>n und Wil<strong>de</strong>shausen) im Mittelalter bereits <strong>de</strong>n Status einer<br />
Stadt. Bei Nienburg ist im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt bereits <strong>de</strong>r Stadtstatus nachweisbar, welcher Stadtrechtsfamilie Nienburg <strong>zu</strong>gerechnet wer<strong>de</strong>n kann, ist allerdings unklar. Von <strong>de</strong>r Lage her wäre<br />
eine Zugehörigkeit <strong>zu</strong>r Bremer Stadtrechtsfamilie möglich. Auch bei Hoya und Rotenburg (Wümme) wäre eine Zugehörigkeit <strong>zu</strong> dieser Stadtrechtsfamilie <strong>de</strong>nkbar, ist aber nicht<br />
nachweisbar. Für Neustadt am Rübenberge liegt ein nicht näher datiertes Anschreiben an <strong>de</strong>n Bremer Rat vor, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Rat Neustadts um Rechtsbelehrung bat. Damit sind Beziehungen<br />
nachweisbar, die auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit für sich haben. Sicher ist dies allerdings nicht, da Rechtsrat auch unabhängig von <strong>de</strong>r Zugehörigkeit <strong>zu</strong><br />
einem Rechtskreis eingeholt wer<strong>de</strong>n konnte. Die Ortschaften, für die die Zugehörigkeit nachweisbar ist, liegen in einem relativ kleinen Bereich um die Hansestadt Bremen. Die Größe <strong>de</strong>s<br />
Gebietes umfasst von Nord nach Süd etwa 40 km und von West nach Ost etwa 80 km. Angrenzen<strong>de</strong> Stadtrechtsbereiche waren im Nor<strong>de</strong>n und Osten das vom Soester Stadtrecht<br />
inspirierte Lübische Recht und die Hamburger Stadtrechtsfamilie, ferner die Stadtrechtsfamilien Lüneburgs und Braunschweigs. Im Sü<strong>de</strong>n befan<strong>de</strong>n sich die Rechtskreise <strong>de</strong>r<br />
westfälischen Stadtrechtsfamilien Dortmunds und Münsters. Im Westen schließlich grenzte das Gebiet Frieslands mit eigener Rechtstradition an dieses Gebiet <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts.[56]<br />
[57]<br />
Ver<strong>de</strong>n (ab 1259)
Ver<strong>de</strong>n, als Sitz <strong>de</strong>s Bischofs von Ver<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> durch ein Privileg <strong>de</strong>s Bischofs vom 12. März 1259 Stadtrecht verliehen. Zuvor hatte sich <strong>de</strong>r Ort <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts hin <strong>zu</strong>r<br />
Stadt entwickelt. Aus <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> lässt sich allerdings ableiten, dass bereits <strong>zu</strong>vor ein Stadtrecht in Ver<strong>de</strong>n bestan<strong>de</strong>n haben muss. Die Urkun<strong>de</strong> enthält unter an<strong>de</strong>rem eine Regelung <strong>zu</strong>m<br />
Rechtsgrundsatz „Stadtluft macht frei“, in <strong>de</strong>r es um die Anfechtung <strong>de</strong>r Freiheit eines Bürgers nach diesem Grundsatz geht. Be<strong>zu</strong>gspunkt für diese Regelung soll laut <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> eine<br />
For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Stadtrechtes sein. Die Handhabung und die Formulierung <strong>de</strong>r Ver<strong>de</strong>ner Urkun<strong>de</strong> weisen <strong>de</strong>utliche Ähnlichkeiten mit <strong>de</strong>r Ausformulierung im bremischen<br />
Barbarossa-Privileg von 1186 auf. Haase[58] schließt hieraus, dass die Möglichkeit einer Beeinflussung <strong>de</strong>s Stadtrechtes <strong>de</strong>s nahen Ver<strong>de</strong>ns durch die bremische Rechtspraxis<br />
möglicherweise schon länger vorhan<strong>de</strong>n war. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n die Ver<strong>de</strong>ner für Rechtsbelehrungen an <strong>de</strong>n Rat in Bremen verwiesen:[59] Ein typisches Merkmal für die<br />
Zugehörigkeit <strong>zu</strong> einer Stadtrechtsfamilie.[60] Darüber hinausgehen<strong>de</strong> direkte Hinweise auf eine Zuordnung <strong>zu</strong>r Stadtrechtsfamilie gibt es nicht. Es ist lediglich eine Bitte um eine<br />
rechtliche Belehrung von 1511 überliefert. Allerdings ist eine Praxis <strong>de</strong>r mündlichen Einholung von Belehrungen aus <strong>de</strong>m nahen Bremen wahrscheinlich.[61]<br />
Am 1. Mai 1330 wur<strong>de</strong> vom Rat <strong>de</strong>r Stadt in Zusammenarbeit mit einem Ausschuss <strong>de</strong>r Bürger <strong>de</strong>r Stadt eine Statutensammlung erlassen. Diese Sammlung stellte eine eigene<br />
Rechtsset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadt dar. Die Sammlung zeigt allerdings keinen unmittelbaren Be<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong>m bremischen Recht. Lediglich in drei Artikeln fin<strong>de</strong>n sich Übereinstimmungen; zwei <strong>de</strong>r<br />
Artikel können aber auch gemeinsame landrechtliche Ursprünge haben, <strong>de</strong>r dritte betrifft ein auch sonst verbreitetes Statut. Aus einer Dreiteilung <strong>de</strong>s Rates, wie sie für die Städte <strong>de</strong>r<br />
bremischen Rechtsfamilie typisch, sonst in Nordwest<strong>de</strong>utschland aber sehr ungewöhnlich ist, lassen sich aber trotz<strong>de</strong>m Einflüsse <strong>de</strong>s Bremer Rechts erkennen.[62][63] Im Ver<strong>de</strong>ner<br />
Stadtrechtsbuch von 1433 fin<strong>de</strong>t sich nur ein Artikel mit erkennbarem Be<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong>m Bremer Stadtrecht.[64] An<strong>de</strong>rs verhält es sich mit <strong>de</strong>n Ver<strong>de</strong>ner Statuten von 1582. Diese weisen<br />
erhebliche Übereinstimmungen mit <strong>de</strong>m Bremer Stadtrecht von 1433 auf. So ähnelt die „Statuta Ver<strong>de</strong>nsis“ <strong>de</strong>m bremischen Stadtrecht von 1433 im Aufbau. Von <strong>de</strong>n insgesamt 182<br />
Artikeln entsprechen 113 Artikel <strong>de</strong>n Bestimmungen <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes o<strong>de</strong>r zeigen nur geringfügige Abweichungen. Bei 69 kann eine Herkunft aus <strong>de</strong>m bremischen Recht zwar<br />
nicht nachgewiesen wer<strong>de</strong>n, aber selbst von diesen weisen fünf eine erhebliche Ähnlichkeit <strong>zu</strong> bremischen Bestimmungen auf.[65]<br />
Wil<strong>de</strong>shausen (1270–1529)<br />
Die Gegend <strong>de</strong>s heutigen Wil<strong>de</strong>shausen befand sich im 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Besitz von Nachkommen Widukinds. Einer dieser Nachkommen, Graf Waltbert, errichtete eine Kirche und 851<br />
wur<strong>de</strong>n die Gebeine <strong>de</strong>s Heiligen Alexan<strong>de</strong>r von Rom in diese Kirche überführt. Waltbert grün<strong>de</strong>te dann 872 auf Grund dieser Kirche ein Hauskloster und schenkte hierbei auch die<br />
„villa“ Wil<strong>de</strong>shausen <strong>de</strong>m Kloster. 980 wur<strong>de</strong> das Kloster mit <strong>de</strong>r Siedlung durch Otto II. an das Bistum Osnabrück übertragen. Der weitere Verbleib <strong>de</strong>s Ortes Wil<strong>de</strong>shausens ist unklar.<br />
Adam von Bremen berichtet allerdings, dass Erzbischof Adalbert von Bremen versuchte, einseitig seine Machtsphäre aus<strong>zu</strong><strong>de</strong>hnen, in<strong>de</strong>m er beabsichtigte, in Wil<strong>de</strong>shausen ein<br />
Suffraganbistum <strong>zu</strong> grün<strong>de</strong>n. Nach Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Welfen und <strong>de</strong>m Bistum Bremen kam es 1219 <strong>zu</strong> einer Vereinbarung zwischen Erzbischof Gerhard II.<br />
und <strong>de</strong>m Pfalzgraf Heinrich <strong>de</strong>m Älteren, unter an<strong>de</strong>rem wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Vereinbarung die Propstei Wil<strong>de</strong>shausen an das Bistum Bremen abgetreten. 1228 verzichtet auch das Haus <strong>de</strong>r<br />
Askanier auf Ansprüche auf Wil<strong>de</strong>shausen. Wil<strong>de</strong>shausen gehörte allerdings weiterhin kirchenrechtlich <strong>zu</strong>r Diözese Osnabrück, die Vogtei befand sich in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Grafen von<br />
Wil<strong>de</strong>shausen-Ol<strong>de</strong>nburg. Als 1270 das Grafenhaus ausstarb, zog Erzbischof Hil<strong>de</strong>bold dann die Propstei Wil<strong>de</strong>shausen endgültig an das Erzbistum Bremen. Allerdings waren die<br />
Herrschaftsverhältnisse über die Stadt Wil<strong>de</strong>shausen ungeklärt. Der Erzbischof gewährte in diesem Zusammenhang Wil<strong>de</strong>shausen 1270 das Stadtrecht nach Bremer Recht.[66] Die<br />
Urkun<strong>de</strong> von 1270 enthält allerdings keine Hinweise auf einen vorgesehenen Rechts<strong>zu</strong>g nach Bremen. Auch sind keine entsprechen<strong>de</strong>n Gesuche erhalten. Es wird allerdings vermutet,<br />
dass Rechtsanfragen auf mündlichen Wege erfolgten und möglicherweise vorhan<strong>de</strong>ne Urkun<strong>de</strong>n im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n Ereignissen <strong>de</strong>s Jahres 1529 vernichtet wor<strong>de</strong>n sein könnten.<br />
[67]<br />
Das einzige erhaltene Stadtbuch <strong>de</strong>r Stadt Wil<strong>de</strong>shausen aus <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt umfasst 30 Statuten, die nur geringe Be<strong>zu</strong>gspunkte <strong>zu</strong>m Bremer Stadtrecht aufweisen. Soweit<br />
Ähnlichkeiten (etwa die Dreiteilung <strong>de</strong>s Rates) vorhan<strong>de</strong>n sind, können diese auch auf die verwandten städtischen Lebensverhältnisse, ähnliches überkommenes Recht o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Zeitgeist<br />
<strong>zu</strong>rückgeführt wer<strong>de</strong>n. Die Bestimmungen <strong>de</strong>s Wil<strong>de</strong>shauser Stadtbuches stehen jedoch in keinem Wi<strong>de</strong>rspruch <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Bestimmungen im Bremer Stadtrecht. Allerdings wird <strong>zu</strong> Beginn<br />
einer Regelung, die Scha<strong>de</strong>nsersatz- und Schuldfragen bei Feuersbrünsten betrifft, die Gemeinsamkeit mit <strong>de</strong>m Bremer Recht ausdrücklich betont.[68]<br />
Wil<strong>de</strong>shausen wur<strong>de</strong> vom Bistum Bremen häufig verpfän<strong>de</strong>t, es erfreute sich durch diese Verpfändungenund <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Unsicherheiten über die Herrschaftsverhältnisse<br />
sowie einer gewissen Randlage <strong>zu</strong> verschie<strong>de</strong>nen Machfaktoren einer sehr großen Selbstständigkeit. 1429 war eine Verpfändung an das Bistum Münster erfolgt, dieses hatte Wil<strong>de</strong>shausen<br />
seinerseits weiterverpfän<strong>de</strong>t an <strong>de</strong>n eigenen Vasallen, <strong>de</strong>n Amtmann von Harpstedt Wilhelm von <strong>de</strong>m Busche. 1509 versuchte das Bistum Bremen Wil<strong>de</strong>shausen wie<strong>de</strong>r an sich <strong>zu</strong> ziehen,<br />
die Wil<strong>de</strong>shausener verweigerten Erzbischof Johann III. von Bremen allerdings die Huldigung. Gleichzeitig setzte insgesamt in Wil<strong>de</strong>shausen vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Reformation eine<br />
priester- und kirchenfeindliche Bewegung ein. Schließlich überfielen die Wil<strong>de</strong>shausener Untertanen <strong>de</strong>s Bistum Münster, wobei ein Priester <strong>de</strong>r Diözese getötet wur<strong>de</strong>. Über
Wil<strong>de</strong>shausen wur<strong>de</strong> daraufhin die Reichsacht verhängt. Der Bischof von Münster wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Durchführung <strong>de</strong>r Reichsacht ermächtigt. Im Rahmen <strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt Wil<strong>de</strong>shausen<br />
alle Hoheitsrechte entzogen, die bisherige Stadt wur<strong>de</strong> (vorübergehend) <strong>zu</strong>m Flecken abgestuft und alle bisherigen Rechte <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st vorübergehend auf das Gogericht auf <strong>de</strong>m Desum<br />
(bei Emstek) übertragen. Die Hauptfahrt <strong>zu</strong>r Einholung von Rechtsrat nach Bremen wur<strong>de</strong> ausdrücklich untersagt. Damit en<strong>de</strong>te die Zugehörigkeit Wi<strong>de</strong>shausens <strong>zu</strong>r bremischen<br />
Stadtrechtsfamilie.[69][70]<br />
Ol<strong>de</strong>nburg (1345)<br />
Ol<strong>de</strong>nburg entstand um die wahrscheinlich schon 1108 bestehen<strong>de</strong> Burg <strong>de</strong>r Grafen von Ol<strong>de</strong>nburg. Der Ort war dann durch das Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit Sitz <strong>de</strong>r Grafen und<br />
nahm damit <strong>de</strong>n typischen Charakter einer Resi<strong>de</strong>nzstadt an. Ein Markt lässt sich in Ol<strong>de</strong>nburg erst 1243 nachweisen, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Grafen dann aber geför<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>, um vom Han<strong>de</strong>l<br />
zwischen Bremen und Friesland beziehungsweise Westfalen <strong>zu</strong> profitieren. Zunächst macht sich ein Einfluss <strong>de</strong>s westfälischen Stadtrechtes bemerkbar. So wer<strong>de</strong>n in einer Urkun<strong>de</strong> von<br />
etwa 1299 Schöffen erwähnt, die für die nie<strong>de</strong>rsächsischen Stadtrechte untypisch sind, wohl aber in <strong>de</strong>n westfälischen Stadtrechten vorkommen. In späteren Urkun<strong>de</strong>n wird allerdings von<br />
„consules“ gesprochen; Schöffen wer<strong>de</strong>n nicht mehr erwähnt. Es lässt sich dann eine allmähliche Übernahme <strong>de</strong>s Bremer Rechts feststellen, so wur<strong>de</strong> Bremer Stadtrecht für das erste<br />
Ol<strong>de</strong>nburger Stadtbuch abgeschrieben, vermutlich war Bremen auch das Vorbild für die ol<strong>de</strong>nburger Ratsverfassung von 1300. 1345 erteilte <strong>de</strong>r Graf von Ol<strong>de</strong>nburg schließlich ein<br />
Privileg, in <strong>de</strong>m er Ol<strong>de</strong>nburg städtische Freiheiten verleiht und die Stadt unter das Bremer Recht stellt. Die Urkun<strong>de</strong> nennt aber eine Vielzahl von Vorbehalten. So behält sich <strong>de</strong>r Graf die<br />
Abhaltung eines Gerichtes durch einen Vogt und an<strong>de</strong>re Regalien vor. Der Stadt wur<strong>de</strong>n selbstständige Bündnisse mit Dritten untersagt. Gleichzeitig teilte <strong>de</strong>r Graf <strong>de</strong>n Räten von<br />
Osnabrück und Dortmund mit, dass er Ol<strong>de</strong>nburg <strong>zu</strong>r freien Stadt erhoben habe, sie unter bremisches Recht gestellt und ihr sieben Messen erlaubt habe. Damit wird <strong>de</strong>utlich, dass es vor<br />
allem um eine För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls durch einen Abbau <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsbeschränkungen und durch Schaffung von Rechtssicherheit für die Kaufleute ging. 1429 und 1463 wird das Bremer<br />
Stadtrecht, allerdings <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Einschränkungen, bestätigt.[71][70]<br />
1433 betonte <strong>de</strong>r Graf von Ol<strong>de</strong>nburg in Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m Rat Ol<strong>de</strong>nburgs, dass er keinesfalls alle Rechte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes verliehen habe, insbeson<strong>de</strong>re die<br />
peinliche (das heißt strafrechtliche) Gerichtsbarkeit behielt er sich ausdrücklich vor. Danach konnte in zivilrechtlichen Streitigkeiten Rechtsrat in Bremen eingeholt wer<strong>de</strong>n; Strafsachen<br />
gehörten nicht vor ein Gericht <strong>de</strong>r Stadt o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Rat, son<strong>de</strong>rn ausschließlich vor die gräflichen Gerichte. Wie <strong>de</strong>r Instanzen<strong>zu</strong>g in Zivilsachen und Angelegenheiten <strong>de</strong>r freiwilligen<br />
Gerichtsbarkeit im einzelnen verlief, lässt sich im Einzelnen nur vermuten. Sicher bestand ein Rechts<strong>zu</strong>g vom Ol<strong>de</strong>nburger Rat an <strong>de</strong>n Bremer Rat als Oberhof. Rechtsanfragen von<br />
ol<strong>de</strong>nburgischen Untergerichten direkt an <strong>de</strong>n Rat in Bremen konnten allerdings bislang nicht nachgewiesen wer<strong>de</strong>n.[72] Einen überlieferten Son<strong>de</strong>rfall stellt <strong>de</strong>r Rechtsstreit zwischen<br />
<strong>de</strong>m Grafen von Ol<strong>de</strong>nburg und Alf Langwar<strong>de</strong>n dar, einem abgesetzten Bürgermeister Ol<strong>de</strong>nburgs. Auf Ersuchen Langwar<strong>de</strong>ns wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bremer Rat vom Kaiser <strong>zu</strong>r<br />
Rechtsentscheidung bevollmächtigt.[72][73] Strittig bewertet wird, wie die Tätigkeit <strong>de</strong>s Bremer Rates in diesem, letztlich in einem Vergleich en<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Prozess <strong>zu</strong> werten sei. Haase<br />
interpretierte das Verhalten <strong>de</strong>s Rates als Versuch sich gegenüber <strong>de</strong>m Grafen die Rolle eines Obergerichtes <strong>zu</strong> erschleichen[74]; Eckhardt[75] interpretiert <strong>de</strong>n Vorgang lediglich als die<br />
Einset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Bremer Rates als Stellvertreter <strong>de</strong>s Kaisers im Einzelfall. Auch 1575 wur<strong>de</strong> von Seiten <strong>de</strong>r Grafen von Ol<strong>de</strong>nburg nochmals klargestellt, dass die Gerichtshoheit bei ihnen<br />
läge und insbeson<strong>de</strong>re die Privilegien <strong>de</strong>r Stadt Bremen nicht für Ol<strong>de</strong>nburg gelten wür<strong>de</strong>n, es gelte lediglich das materielle Bremer Privatrecht. Zur Begründung für diese Position bezog<br />
sich <strong>de</strong>r Graf unter an<strong>de</strong>rem darauf, dass Bremen mit seinen Stadtbefestigungen für seinen Schutz selbst aufkommen müsse, da <strong>de</strong>r Erzbischof nichts leiste, er aber die Verteidigung<br />
Ol<strong>de</strong>nburgs sicherstelle.[76]<br />
Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes für Ol<strong>de</strong>nburg bewirkte, dass <strong>de</strong>r erste Druck <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes im Auftrag <strong>de</strong>s königlich-dänischen Justiz- und ol<strong>de</strong>nburgischen<br />
Regierungsrat Johann Christoph von Oetken erfolgte. Der Druck erschien 1722 unter <strong>de</strong>m Titel „Corpus Constitutionum Ol<strong>de</strong>nburgicarum“.[77]<br />
Delmenhorst (1371)<br />
Wie Ol<strong>de</strong>nburg war Delmenhorst Resi<strong>de</strong>nzstadt. Hier residierte die jüngere Linie <strong>de</strong>s Hauses Ol<strong>de</strong>nburg, die Grafen von Ol<strong>de</strong>nburg-Delmenhorst. Die Resi<strong>de</strong>nz war eine bereits 1259<br />
bestehen<strong>de</strong> Burg. Um 1300 wur<strong>de</strong> eine Ortschaft bei <strong>de</strong>r Burg erwähnt. 1311 verpflichteten sich die Grafen die Straße von Delmenhorst nach Huchting instand <strong>zu</strong> halten. 1371 war <strong>de</strong>r Ort<br />
soweit gediehen, dass die Delmenhorster Grafen das Stadtrecht nach bremischen Recht verliehen; allerdings unter ähnlichen Einschränkungen, wie die Verwandten in Ol<strong>de</strong>nburg. Trotz<br />
<strong>de</strong>r Verleihung <strong>de</strong>s Stadtrechtes blühte Delmenhorst nicht auf. Zurück<strong>zu</strong>führen ist dies vor allem auf die <strong>zu</strong> große Nähe <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m großen Han<strong>de</strong>lsplatz Bremen, <strong>de</strong>r Delmenhorst bis in das<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt kaum wirtschaftlichen Raum für eine eigene Entwicklung ließ. Erst für 1577 lässt sich überhaupt eine Nie<strong>de</strong>rgerichtsbarkeit in Delmenhorst nachweisen, die auch erst
1699 an die Stadt übertragen wur<strong>de</strong>.[78][79]<br />
Harpstedt (1396)<br />
Für Harpstedt ist eine Urkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Grafen Otto von Hoya und Bruchhausen vom 5. März 1396 überliefert. In <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> wird die Absicht <strong>de</strong>s Grafen kundgetan ein Weichbild <strong>zu</strong><br />
begrün<strong>de</strong>n und dieses bremischem Recht <strong>zu</strong> unterstellen. Haase[80] geht davon aus, dass es sich hierbei um einen abgebrochenen Versuch einer Stadtgründung han<strong>de</strong>lte und dass entgegen<br />
<strong>de</strong>r Darstellung älterer Autoren kein weiterer Hinweis auf die Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes vorliege. Dem<strong>zu</strong>folge sei von einer Geltung dieses Rechtes in Harpstedt nicht<br />
aus<strong>zu</strong>gehen. Eckhardt[81][82] weist <strong>de</strong>mgegenüber nach, dass eine abschriftlich überlieferte Urkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Bürgermeisters und <strong>de</strong>s Rates <strong>de</strong>s Wigbolds und Bleks <strong>zu</strong> Harpstedt nach<br />
Bremer rechte von 1607 bestehe, die auch mit unse wychbol<strong>de</strong> nach Bremer rechte und Harpste<strong>de</strong>schen Siegel beglaubigt wur<strong>de</strong>. Ferner ist die Existenz dieses Weichbil<strong>de</strong>s nachweisbar.<br />
Auch berief sich Harpstedt noch im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt auf die Urkun<strong>de</strong>.<br />
Rechtsanfragen aus Harpstedt sind allerdings nicht nach<strong>zu</strong>weisen, ein Oberhofverhältnis <strong>zu</strong> Bremen ist aber nicht aus<strong>zu</strong>schließen.[82]<br />
An<strong>de</strong>re Orte<br />
Für Neustadt am Rübenberge ist ein nicht näher datiertes Schreiben an <strong>de</strong>n Rat von Bremen überliefert, in <strong>de</strong>m um Rechtsbelehrung in drei Fällen gebeten wird. Darüber hinaus liegt noch<br />
ein etwa aus <strong>de</strong>rselben Zeit stammen<strong>de</strong>s Schreiben vor, das ein Hilfeersuchen <strong>de</strong>s Neustädter Rates in Be<strong>zu</strong>g auf einen Bremer Bürger an <strong>de</strong>n Rat in Bremen umfasst. Haase[83] meint<br />
hieraus die Vermutung ableiten <strong>zu</strong> können, dass in Neustadt am Rübenberge und wahrscheinlich auch in Nienburg das Bremer Stadtrecht gegolten haben könnte. Eine Urkun<strong>de</strong> über die<br />
Verleihung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes liegt allerdings nicht vor. Auch sonst setzt eine Anfrage und Bitte um eine Rechtsbelehrung nicht zwingend die Geltung <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes<br />
voraus. Weitere Belege für eine entsprechen<strong>de</strong> Rechtsbeziehung sind nicht bekannt.[84]<br />
Die Urkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Bremer Stadtrecht<br />
Stadtrechtsbücher für das Stadtrecht von 1303/1308<br />
Für das Stadtrechtsbuch von 1303/1308 lassen sich direkt o<strong>de</strong>r indirekt min<strong>de</strong>stens sechs Abschriften und eine Originalfassung belegen. In <strong>de</strong>n bremischen Archiven erhalten haben sich<br />
bis heute hiervon allerdings nur vier Bücher.[85]<br />
Zunächst ist das Originalstadtrechtsbuch <strong>zu</strong> nennen. Dieses Rechtsbuch umfasst 108 Pergamentblätter im Format von 33,7 mal 22,7 cm.. Verwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> für diese Urkun<strong>de</strong> braune<br />
Tinte. Für das Register, Zählungen, Überschriften und Auszeichnungsstücke wur<strong>de</strong> rote; für Zierinitialen wur<strong>de</strong> abwechselnd rote und blaue Tinte verwen<strong>de</strong>t. Vereinzelt fin<strong>de</strong>n sich<br />
Initialen in Blattgold. Das Buch ist zweizeilig. Dieses Stadtbuch ist gekennzeichnet durch einen relativ breiten Raum, <strong>de</strong>n die drei nachweislichen Schreiber <strong>de</strong>r ursprünglichen Fassung<br />
für Ergän<strong>zu</strong>ngen und Novellierungen gelassen haben und eine Vielzahl von solchen Nachträgen bis 1424, die <strong>de</strong>n ursprünglichen Text weitgehend überwuchern. Diese Ergän<strong>zu</strong>ngen und<br />
Än<strong>de</strong>rungen füllten im Laufe <strong>de</strong>r Zeit fast <strong>de</strong>n gesamten vorgesehenen Freiraum. Der ursprüngliche Text war in einer gotischen Buchminuskel <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts gestaltet. Die späteren<br />
Ergän<strong>zu</strong>ngen von etwa drei Dutzend unterschiedlichen Hän<strong>de</strong>n verfassten Ergän<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n weniger in Buch-, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Regel jeweils in zeittypischen Kanzlei- und<br />
Urkun<strong>de</strong>nschriftformen verfasst. Das Buch weist insgesamt starke Gebrauchsspuren auf und wur<strong>de</strong> wohl in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts in einen aus Schweinsle<strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
Renaissanceeinband nach einer Restaurierung neu gebun<strong>de</strong>n.[86]<br />
Die älteste überlieferte Abschrift <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts von 1303/1308 wur<strong>de</strong> wahrscheinlich für <strong>de</strong>n privaten Nutzen durch einen <strong>de</strong>r Ratsherren verfasst, fand sich dann in <strong>de</strong>r<br />
Dombibliothek und gelangte dann unter unbekannten Umstän<strong>de</strong>n in die Archive <strong>de</strong>r Stadt Bremen. Die Abschrift umfasst 88 Blätter, ist mit brauner Tinte und für Auszeichnungstexte,<br />
Überschriften und Zählungen in roter sowie für Zierinitalen in roter und blauer Tinte gestaltet. Datieren lässt sich die Handschrift durch das letzte aufgenommene Urteil <strong>de</strong>s Rates auf<br />
etwa das Jahr 1332. Verfasst ist die Abschrift in Mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch, lediglich die Datierung und die Eingangsformel sind in lateinischer Sprache.mit 20,5 mal 15,5 cm ist diese Abschrift<br />
sehr kleinformatig.[87]<br />
Die zweitälteste überlieferte Abschrift umfasst 93 Blätter aus Pergament mit einer Höhe von 34 cm und einer Breite von 23,5 cm. Diese Abschrift wur<strong>de</strong> lange für das Original gehalten,<br />
erst Oelrich wies durch Schriftvergleich wie<strong>de</strong>r nach, dass es sich um eine Abschrift han<strong>de</strong>lte. Datieren lässt sich das Buch in <strong>de</strong>r Haupthand auf eine Zeit um 1335, die Ergän<strong>zu</strong>ngen in
dieser Abschrift bis etwa 1420. Verfasst ist diese Abschrift im Wesentlichen in mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Sprache, lediglich das Kalendarium, die Eingangsformel, die Datierung und sakrale<br />
Texte wur<strong>de</strong>n latinisiert. Auch diese Abschrift ist zweizeilig gehalten und ursprünglich in Form <strong>de</strong>r gotischen Buchminuskel geschrieben wor<strong>de</strong>n. Die Abschrift wur<strong>de</strong> einheitlich von<br />
einer Hand gestaltet. Beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung hat diese Abschrift durch drei größere Nachträge, die weniger Novellen als Erweiterungen beziehungsweise Durchbrechungen <strong>de</strong>s<br />
ursprünglichen Stadtrechts darstellen. Zunächst sind die sakrale Texte (Auszüge aus <strong>de</strong>r Genesis, <strong>de</strong>m Johannesevangelium und Heiligengeschichten) <strong>de</strong>m Stadtrecht vorangestellt.<br />
Rechtlich nennenswert ist das mit vier Seiten angehängte Hamburger Schiffs- und Seerecht, was das im ursprünglichen Bremer Stadtrecht nur unvollständig entwickelte Schiffs- und<br />
Seerecht erheblich ergänzte. Ferner wur<strong>de</strong> ein Namensregister an- und ein Kalendarium vorgehängt.[88]<br />
Die dritte erhaltene Abschrift lässt sich auf das letzte Viertel <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts datieren und basiert ihrerseits auf ein nicht überlieferte Abschrift <strong>zu</strong>rück, die ihrerseits vor 1330 angelegt<br />
wur<strong>de</strong>. Diese Abschrift ist die am wenigsten sorgfältig verfasste Abschrift und weist zahlreiche Fehler und Auslassungen auf. Das kleine Format von 20,5 mal 15 cm <strong>de</strong>utet auf einen<br />
privaten Auftraggeber hin. Ergän<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n nicht vorgenommen, Notizen auf freien Blättern <strong>de</strong>r Handschrift <strong>de</strong>uten aber daraufhin, dass dieses Exemplar noch im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
herangezogen wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r Neuzeit wur<strong>de</strong> diese Abschrift mit einer Abschrift <strong>de</strong>s Stadtrechtes von 1433 aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt und <strong>de</strong>s ersten gedruckten Proklams, <strong>de</strong>r „Hochzeits-,<br />
Kin<strong>de</strong>lbier- und Begräbnisordnung“ von 1587, <strong>zu</strong>sammengefasst.[89]<br />
Drucke <strong>de</strong>s Stadtrechtes<br />
Durch die Vielzahl <strong>de</strong>r Abschriften <strong>de</strong>r Glossen, die auf Krefting, Wichmann und Almers <strong>zu</strong>rückgingen, und divergieren<strong>de</strong> kursieren<strong>de</strong> Abschriften <strong>de</strong>s Stadtrechtes war es im Laufe <strong>de</strong>r<br />
17. Jahrhun<strong>de</strong>rts kaum möglich, an einen verbindlichen Rechtstext <strong>zu</strong> gelangen. Bis 1828 erfolgte sogar die Vereidigung <strong>de</strong>r Ratsherren nicht auf <strong>de</strong>m authentischen Original, son<strong>de</strong>rn auf<br />
einer Abschrift. Die fehlen<strong>de</strong> Einigung über einen verbindlichen Rechtstext und seine Kommentierung – Kreftings, Almers und Wichmanns Glossen kamen einer solchen Anerkennung<br />
als Kommentierung noch am nächsten – bewirkte, dass es von privater Seite erst spät <strong>zu</strong> einer Drucklegung kam. Von offizieller Seite unterblieb sie <strong>zu</strong>nächst ganz.<br />
Der erste Druck <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechtes erfolgte im Auftrag <strong>de</strong>s königlich-dänischen Justiz- und ol<strong>de</strong>nburgischen Regierungsrat Johann Christoph von Oetkene. Der Druck erschien 1722<br />
unter <strong>de</strong>m Titel „Corpus Constitutionum Ol<strong>de</strong>nburgicarum“. Zugrun<strong>de</strong> lag dieser Ausgabe allerdings nicht das Stadtrecht von 1303 (das formell in Ol<strong>de</strong>nburg das ausschlaggeben<strong>de</strong> war)<br />
und nicht die Fassung von 1433, son<strong>de</strong>rn die von Krefting überarbeitete Version <strong>de</strong>s frühen 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts, einschließlich Kreftings Glossen. Diese Verbindung von Gesetzestext und<br />
Kommentierungen führte allerdings da<strong>zu</strong>, dass das Werk in <strong>de</strong>r Praxis <strong>zu</strong>nächst nicht angenommen wur<strong>de</strong>, da die Abgren<strong>zu</strong>ng zwischen Gesetz und Kommentar aus damaliger Sicht nicht<br />
erkennbar war. Es folgte ein Abdruck im Appendix <strong>de</strong>s zweiten 1748 erschienenen Ban<strong>de</strong>s von Friedrich Esaias Pufendorfs Observationes juris universi. Er hatte hier<strong>zu</strong> mehrere<br />
Abschriften herangezogen und auch die Ver<strong>de</strong>ner Statuten und das Hamburger und das Sta<strong>de</strong>r Stadtrecht als Vergleichsmaterial hin<strong>zu</strong>gezogen. Gleichwohl gilt <strong>de</strong>r Abdruck noch als nicht<br />
originalgetreu. Der Abdruck <strong>de</strong>r Kundigen Rolle sollte auch un<strong>zu</strong>treffen<strong>de</strong>rweise von 1539 stammen. Die mangeln<strong>de</strong> Genauigkeit wur<strong>de</strong> schon von Zeitgenossen bemängelt. Auch die<br />
1765 in Christian Nettelblatts Greinir ... o<strong>de</strong>r Nachlese von alten, neuen, frem<strong>de</strong>n und eigenen ... Abhandlungen' von 1765 enthaltene Druckfassung galt als untauglich, da sie zahlreiche<br />
Lücken und Un<strong>zu</strong>länglichkeiten aufwies.[90]<br />
Den ersten Druck, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Rechtspraxis als brauchbar angenommen wur<strong>de</strong>, ging von <strong>de</strong>m Juristen und Syndikus <strong>de</strong>r bremischen Kaufmannschaft Gerhard Oelrichs aus. Dieser<br />
veröffentlichte <strong>zu</strong>nächst 1767 einen Glossar <strong>zu</strong>m Bremer Stadtrecht („Glossarium ad Statuta Bremensium“, erschienen in Frankfurt am Main). Oelrichs wandte sich dann aber an <strong>de</strong>n<br />
Senat um Einsichtnahme in das Originalsstadtrecht und an<strong>de</strong>re Originalurkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Bremer Stadtrecht. 1771 erschien dann seine „Volstaendige Sammlung alter und neuer Gesetz-<br />
Bücher <strong>de</strong>r kaiserlichen und <strong>de</strong>s heil. römischen Reichs freien Stadt Bremen aus Original-Handschriften“. Oelrich hatte <strong>de</strong>n Druck selbst unter <strong>de</strong>r Aufnahme von Hypotheken und <strong>de</strong>r<br />
Ausstellung von Handfesten finanziert. Der Preis für eine Ausgabe lag bei 4 Reichstalern. Enthalten in <strong>de</strong>m Buch waren auf 934 Seiten: Die Stadtrechtsfassungen von 1303, 1428, 1433,<br />
die Kundigen Rollen von 1450 und 1498, das Ol<strong>de</strong>nburger Stadtrecht von 1345, soweit Abweichungen <strong>zu</strong>m Bremer Recht vorlagen, und einige Land- und Deichrechte <strong>de</strong>s Umlan<strong>de</strong>s. Der<br />
Absatz <strong>de</strong>s Buches war allerdings ein wirtschaftlicher Fehlschlag, doch wur<strong>de</strong> sein Werk bereits von <strong>de</strong>n Zeitgenossen anerkannt. Der Rat Bremens schenkte Oelrich für sein Werk<br />
vermutlich einen 1997 von einem seiner Nachfahren bei Sotheby’s <strong>zu</strong>r Versteigerung gegebenen silbernen Tafelaufsatz. Die Ausgabe Oelrichs verdrängte die alten Abschriften und blieb<br />
in <strong>de</strong>r bremischen Rechtspraxis bis weit in das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein das maßgebliche Werk, trotz vorhan<strong>de</strong>ner Lese- und Druckfehler.[91]<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong>n im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Die Stadtrechtsurkun<strong>de</strong>n lagerten im Bremer Staatsarchiv. Im Laufe <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong>n die Stadtrechtsurkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Schutz vor Bombenangriffen ausgelagert. In <strong>de</strong>r Folge
fielen sie in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Roten Armee und wur<strong>de</strong>n als Beutekunst in die Sowjetunion verbracht.Der größte Teil <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong>n kehrte 1991 aus Moskau und 2001 aus Armenien <strong>zu</strong>rück.<br />
[92]<br />
Literatur<br />
• Konrad Elmshäuser/Adolf E. Hofmeister (Hrsg.), 700 Jahre Bremer Recht, Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Staatsarchivs Bremen Bd. 66, Selbstverlag <strong>de</strong>s Staatsarchivs Bremen, 2003,<br />
ISBN 3-925729-34-8, ISSN 0172-7877<br />
• Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter, Veröffentlichungen aus <strong>de</strong>m Staatsarchiv <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen, Heft 21, Carl-<br />
Schünemann-Verlag, 1953<br />
• Ferdinand Donandt, Versuch einer Geschichte <strong>de</strong>s Bremischen Stadtrechts, 1. Teil: Verfassungsgeschichte, Bremen 1830<br />
• Ferdinand Donandt, Versuch einer Geschichte <strong>de</strong>s Bremischen Stadtrechts, 2. Teil: Rechtsgeschichte, Bremen 1830<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Urkun<strong>de</strong> Nr. 27 in: Monumenta Germaniae Historica. Paul Kehr (Hrsg.): Diplomata 10: Die Urkun<strong>de</strong>n Arnolfs (Arnolfi Diplomata). Berlin 1940, S. 39–40 (Digitalisat)<br />
2. ↑ Urkun<strong>de</strong> Nr. 307 in: Monumenta Germaniae Historica. Theodor Sickel (Hrsg.): Diplomata 12: Die Urkun<strong>de</strong>n Konrad I., Heinrich I. und Otto I. (Conradi I., Heinrici I. et Ottonis<br />
I. Diplomata). Hannover 1879, S. 422–423 (Digitalisat)<br />
3. ↑ Urkun<strong>de</strong> Nr. 40 in: Monumenta Germaniae Historica. Theodor Sickel (Hrsg.): Diplomata 13: Die Urkun<strong>de</strong>n Otto <strong>de</strong>s II. und Otto <strong>de</strong>s III. (Ottonis II. et Ottonis III. Diplomata).<br />
Hannover 1893, S. 439–440 (Digitalisat)<br />
4. ↑ a b Dieter Hägermann, Recht und Verfassung im mittelalterlichen Bremen in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 17–26<br />
5. ↑ Ulrich Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Auflage, C.H. Beck München 1999, ISBN 3-406-45308-2, Randnummer 73 ff.<br />
6. ↑ Ruth Schmidt-Wiegand, Das geschriebene Recht in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 18 (22)<br />
7. ↑ Timo Holzborn, Die Geschichte <strong>de</strong>r Gesetzespublikation- insbeson<strong>de</strong>re von <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s Buchdrucks um 1450 bis <strong>zu</strong>r Einführung von Gesetzesblättern im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
(Diss. 2003) Juristische Reihe Tenea Bd. 39, Berlin 2003, ISBN 3-86504-005-5, S. 9<br />
8. ↑ Ruth Schmidt-Wiegand, Das geschriebene Recht in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 18<br />
9. ↑ Evamaria Engel, Die <strong>de</strong>utsche Stadt im Mittelalter, Albatros Verlag, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96135-1, S. 82.<br />
10.↑ a b Walter Barkhausen, Zur Entwicklung <strong>de</strong>s bremischen Rechts bis <strong>zu</strong>r jüngsten Stadtrechtsfassung von 1433, Bremisches Jahrbuch, Bd. 83 (2004), S. 39 (40)<br />
11.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r, Bremen um 1300 und sein Stadtrecht von 1303, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 29 ff.<br />
12.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r, Bremen um 1300 und sein Stadtrecht von 1303, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 29 (S. 40 ff)<br />
13.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r, Bremen um 1300 und sein Stadtrecht von 1303, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 29 (S. 42, 43 ff.)<br />
14.↑ Stephan Laux, Rezension <strong>zu</strong> 700 Jahre Bremer Recht<br />
15.↑ Ruth Schmidt-Wiegand, Das geschriebene Recht in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 18 (29)<br />
16.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen 1303, 1428, 1433, in: 700 Jahr Bremer Recht, S. 46–73<br />
17.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen von 1303, 1428 und 1433, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 62 f.<br />
18.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r, Bremer Geschichte, Döll-Verlag, Bremen 1993, ISBN 3-88808-202-1, S. 40 ff.<br />
19.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 65, 66<br />
20.↑ http://www.xxx<br />
21.↑ Adolf E. Hofmeister, Von <strong>de</strong>r Kundigen Rolle <strong>zu</strong>r Sammlung <strong>de</strong>s bremischen Rechts, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 267 ff.
22.↑ Timo Holzborn, Die Geschichte <strong>de</strong>r Gesetzepublikation – insbeson<strong>de</strong>re von <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s Buchdrucksum 1450 bis <strong>zu</strong>r Einführungvon Gesetzesblätternim 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt,<br />
Diss. 2003, Juristische Reihe Tenea, Berlin 2003, ISBN 3-86504-005-5, insb. S. 49.<br />
23.↑ Adolf E. Hofmeister, Von <strong>de</strong>r Kundigen Rolle <strong>zu</strong>r Sammlung <strong>de</strong>s bremischen Rechts, in: Konrad Elmshäuser/Adolf E. Hofmeister (Hrsg.), 700 Jahre Bremer Recht, S. 267–<br />
278.<br />
24.↑ a b Walter Barkhausen, Der Entwurf eines Verbeter<strong>de</strong>n Stadtbooks und die Glossen <strong>zu</strong>m Stadtrecht von 1433, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 200 ff.<br />
25.↑ Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss vom 25. Februar 1803.<br />
26.↑ Bremens Geschichte, Ein Streif<strong>zu</strong>g durch die Jahrhun<strong>de</strong>rte – Neunzehntes Jahrhun<strong>de</strong>rt (1789–1914)<br />
27.↑ Andreas Schulz, Die Ablösung <strong>de</strong>s mittelalterlichen Stadtrechts im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 250–259.<br />
28.↑ Andreas Schulz, Die Ablösung <strong>de</strong>s mittelalterlichen Stadtrechts im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 257, 258.<br />
29.↑ Andreas Schulz, Die Ablösung <strong>de</strong>s mittelalterlichen Stadtrechts im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 259–265.<br />
30.↑ Alfred Rinken, „Bremer Recht“ – Kontinuitäten und Dikontinuitäten, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 33 (34 ff.).<br />
31.↑ Ulrich Eisenhart, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Auflage, München 1999, Rdnr. 585, 588.<br />
32.↑ Ulrich Eisenhart, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Auflage, München 1999, Rdnr. 569.<br />
33.↑ Richter, Walter, 100 Jahre Gerichtshaus in Bremen, Der Senator für Justiz und Verfassung <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen (Hrsg.), WMIT-Druck-u.-Verlag-GmbH, 1998, ISBN<br />
3-929542-11-0<br />
34.↑ Ulrich Eisenhart, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Auflage, München 1999, Rdnr. 574–582b.<br />
35.↑ Vgl. im Einzelnen hier<strong>zu</strong>: Ute Siewerts, Die Sprache <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts von 1303, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 97 ff.<br />
36.↑ Karl August Eckhardt, Die mittelalterlichen Rechtsquellen <strong>de</strong>r Stadt Bremen, Schriften <strong>de</strong>r Bremer wissenschaftlichen Gesellschaft, Bremen 1931, S. 14–25<br />
37.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen von 1303, 1428 und 1433 in: 700 Jahr Bremer Recht, S. 48, 60<br />
38.↑ Clausdieter Schott, Sachsenspiegel und Mag<strong>de</strong>burger Stadtrecht: Impuls und Fundament <strong>de</strong>r Rechtsentwicklung in Europa, forum historiae iuris. Dort insb. <strong>zu</strong>m Mag<strong>de</strong>burger<br />
Stadtrecht.<br />
39.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen von 1303, 1428, 1433, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 46- 60<br />
40.↑ Ruth Schmidt-Wiegand, Das geschriebene Recht in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt, Bremisches Jahrbuch, Bd. 83 (2004), S. 18 (25 f.).<br />
41.↑ Dieter Hägermann, Recht und Verfassung im mittelalterlichen Bremen 800–1300, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 17–27.<br />
42.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen von 1303, 1428, 1433, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 46–64<br />
43.↑ Walter Barkhausen, Zur Entwicklung <strong>de</strong>s bremischen Rechts bis <strong>zu</strong>r jüngsten Stadtrechtsfassung von 1433, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 39 (45).<br />
44.↑ Vgl. <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Hintergrün<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Zustan<strong>de</strong>kommen dieses Privilegs Hartmut Müller, Karl V., Bremen und die Kaiserdiplome von 1541, Bremisches Jahrbuch Bd. 79 (2000), S.<br />
13 (22)<br />
45.↑ Konrad Elmshäuser, Die Vogtei- und Kriminalgerichtsbarkeit in Bremen, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 212 ff.<br />
46.↑ a b Konrad Elmshäuser, Die Vogtei- und Kriminalgerichtsbarkeit in Bremen, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 215–220<br />
47.↑ Johannes Feest/Christian Marzahn, Bremer Strafjustiz im Übergang, in: Wiltrud Ulrike Drechsel/Hei<strong>de</strong> Gerstenberger/Christian Marzahn (Hrsg.), Criminalia – Bremer<br />
Strafjustiz 1810–1850 (Beiträge <strong>zu</strong>r Sozialgeschichte Bremens, Heft 11), ISBN 3-88722-173-7, S. 5 (6)<br />
48.↑ Walter Backhausen, Zur Entwicklung <strong>de</strong>s bremischen Rechts bis <strong>zu</strong>r jüngeren Stadtrechtsfassung 1433, Bremisches Jahrbuch Bd. 83 (2004), S. 39 (45).<br />
49.↑ Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r, Die Geschichte <strong>de</strong>s Zauber- und Hexenglaubens in Bremen. Erster Teil. in: Bremisches Jahrbuch, Band 46 (1959), S. 156-233.<br />
50.↑ Ivette Nuckel, 'Hexenprozesse während <strong>de</strong>s 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Ein Vergleich zwischen Bremen und Ol<strong>de</strong>nburg o<strong>de</strong>r "Als auf <strong>de</strong>m Jodutenberge die Feuer schwelten...'<br />
Magisterarbeit an <strong>de</strong>r Universität Bremen, Januar 2004
51.↑ Dagmar Hüpper, Das Rechtsbuch <strong>de</strong>r Stadt Bremen, das Hamburger Recht und <strong>de</strong>r Sachsenspiegel, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 152 (155, 156)<br />
52.↑ Walter Barkhausen, Zur Entwicklung <strong>de</strong>s bremischen Rechts bis <strong>zu</strong>r jüngsten Stadtrechtsfassung von 1433, Bremisches Jahrbuch, Bd. 83 (2004), S. 39 (40)<br />
53.↑ Dagmar Hüpper, Das Rechtsbuch <strong>de</strong>r Stadt Bremen, das Hamburger Recht und <strong>de</strong>r Sachsenspiegel, in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 152 (157–161)<br />
54.↑ [1]<br />
55.↑ Ulrich Weidinger, Schiffs- und Seerecht im Bremer Stadtrecht in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 112–134<br />
56.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 13 f.<br />
57.↑ Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht<br />
58.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S.77 ff.<br />
59.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S.79/80<br />
60.↑ Ulrich Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte 3. Aufl. Verlag C.H.Beck, München 1999, 75<br />
61.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S.81, 82<br />
62.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 82 ff.<br />
63.↑ vgl. auch Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 136, 137.<br />
64.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 86–91<br />
65.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 92–98.<br />
66.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 100–115.<br />
67.↑ Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 138<br />
68.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 115–118.<br />
69.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 122–125<br />
70.↑ a b Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 138, 139.<br />
71.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 127–133<br />
72.↑ a b Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 140, 141.<br />
73.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 136–140<br />
74.↑ Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 139 f.<br />
75.↑ Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 141<br />
76.↑ Albrecht Eckhardt, Bremer Stadtrechtsfamilie und Oberhof, in Stadt Ol<strong>de</strong>nburg (Hrsg.), Der sassen speyghel: Sachsenspiegel – Recht – Alltag, Bd. 1, Ol<strong>de</strong>nburg 1995, S. 249,<br />
256<br />
77.↑ Adolf E. Hofmeister, Das Bremer Stadtrecht im Druck, in 700 Jahre Bremer Recht, S. 224.<br />
78.↑ Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 142<br />
79.↑ Carl Haase, Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 141, 142<br />
80.↑ Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter S. 143, mit Nachweisen <strong>zu</strong> älteren Autoren.<br />
81.↑ Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 143, 144<br />
82.↑ a b Albrecht Eckhardt, Bremer Stadtrechtsfamilie und Oberhof in: Ol<strong>de</strong>nburg (Hrsg.), Der sassen speyghel: Sachsenspiegel – Recht – Alltag Bd. 1, Ol<strong>de</strong>nburg 1995, S. 249,<br />
255.<br />
83.↑ Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Bremer Stadtrechts im Mittelalter, S. 213. Dies nimmt Martin C. Lockert in Die nie<strong>de</strong>rsächsischen Stadtrechte zwischen Aller und Weser :<br />
Vorkommen u. Verflechtungen, Diss. Hamburg 1978, ISBN 3-261-02699-5, auf.
84.↑ Albrecht Eckhardt, Der Bremer Stadtrechtskreis, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 144, 145.<br />
85.↑ Konrad Elmshäuser, Die Handschriften <strong>de</strong>r Bremer Stadtrechtskodifikationen von 1303, 1428 und 1433 in: 700 Jahre Bremer Recht, S. 46 (61).<br />
86.↑ Konrad Elmshäuser, Katalog <strong>de</strong>r mittelalterlichen Bremer Stadtrechts-Handschriften, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 74 (75–77).<br />
87.↑ Konrad Elmshäuser, Katalog <strong>de</strong>r mittelalterlichen Bremer Stadtrechts-Handschriften, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 74 (81–83).<br />
88.↑ Konrad Elmshäuser, Katalog <strong>de</strong>r mittelalterlichen Bremer Stadtrechts-Handschriften, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 74 (78–81).<br />
89.↑ Konrad Elmshäuser, Katalog <strong>de</strong>r mittelalterlichen Bremer Stadtrechts-Handschriften, in: 700 Jahre Bremer Recht S. 74 (83–84).<br />
90.↑ Adolf E. Hofmeister, Das Bremer Stadtrecht im Druck, in 700 Jahre Bremer Recht, S. 223 ff.<br />
91.↑ Adolf E. Hofmeister, Das Bremer Stadtrecht im Druck, in 700 Jahre Bremer Recht, S. 227–230.<br />
92.↑ wwwxxx<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bremer Kirchengeschichte<br />
Bremen war seit 787 Sitz eines Missionsbistums und Zentrum <strong>de</strong>r Missionstätigkeiten <strong>de</strong>s angelsächsischen Bischofs Willehad. Nach <strong>de</strong>m letzten Sachsenaufstand <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 9.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> Bremen unter Bischof Willerich dann <strong>zu</strong>m regulären Bistum. Nach <strong>de</strong>r Vertreibung Ansgars durch die dänischen Wikinger aus Hamburg wur<strong>de</strong> Bremen <strong>zu</strong>m Sitz eines<br />
Missionserzbistums mit <strong>de</strong>r Aufgabe, Skandinavien <strong>zu</strong> missionieren. Durch die Reformation wur<strong>de</strong> die Stadt mehrheitlich protestantisch, jedoch fand seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Dreißigjährigen<br />
Krieges im Schutze <strong>de</strong>s Kaiserlichen Kommissars und späteren Kaiserlichen Resi<strong>de</strong>nten wie<strong>de</strong>r römisch-katholischer Gottesdienst statt, <strong>zu</strong>nächst in einer alten Domkurie und später<br />
meistens im gemieteten Haus <strong>de</strong>s Kaiserlichen Resi<strong>de</strong>nten.<br />
Vor <strong>de</strong>r Reformation<br />
Bremen wur<strong>de</strong> 787 Sitz eines Bistums, das <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>m Erzbistum Köln unterstellt war. Seit 845 war <strong>de</strong>r aus Hamburg vertriebene Missionerzbischof Ansgar auch Bischof von Bremen.<br />
Die Bistümer Hamburg und Bremen wur<strong>de</strong>n 893 <strong>zu</strong> einem Erzbistum vereinigt. Es behielt in <strong>de</strong>r Folge zwei Dome und zwei Domkapitel, jeweils in Bremen und Hamburg. Danach<br />
versuchte das Bistum mehrmals, sein Herrschaftsgebiet auf <strong>de</strong>n Nor<strong>de</strong>n Europas aus<strong>zu</strong><strong>de</strong>hnen. 1223 ging <strong>de</strong>r Erzbischofstitel von Hamburg auf Bremen über. Hauptkirche war danach <strong>de</strong>r<br />
Bremer Dom. Im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> im Schnoor ein Franziskanerkloster errichtet. Erste Pfarrkirche wur<strong>de</strong> die Veits- beziehungsweise Liebfrauenkirche. Auf Veranlassung von Papst<br />
Gregor IX. kam es 1229 durch <strong>de</strong>n Bremer Erzbischof Gerhard II. <strong>zu</strong>r Neufestset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Kirchspielgrenzen, wodurch neben <strong>de</strong>r Liebfrauenkirche die neuen Sprengel St. Ansgarii und St.<br />
Martini entstan<strong>de</strong>n. Die erste evangelische Predigt wur<strong>de</strong> in Bremen 1522 von <strong>de</strong>m Augustinermönch Heinrich von Zütphen in einer Kapelle <strong>de</strong>r St. Ansgarii Kirche gehalten. Danach zog<br />
die Reformation Zug um Zug ein und wur<strong>de</strong> 1532 auch im Dom erzwungen. Die Klöster in Bremen wur<strong>de</strong>n von 1523 bis 1528 geschlossen und die Komturei ging 1564 an Bremen über.
Evangelische Kirche<br />
1534 erhielt Bremen eine neue Kirchenordnung. Wegen innerkirchlicher Streitigkeiten wur<strong>de</strong> 1561 <strong>de</strong>r (lutherische) Dom geschlossen. In <strong>de</strong>r Stadt herrschte danach überwiegend das<br />
reformierte Bekenntnis vor. 1567 wur<strong>de</strong> in Bremen ein protestantischer Erzbischof eingesetzt. Anfang <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts öffnete sich die Stadt durch Teilnahme an <strong>de</strong>r Dordrechter<br />
Syno<strong>de</strong> mehr <strong>de</strong>m reformierten Bekenntnis. Doch wur<strong>de</strong> das lutherische Bekenntnis ab 1639 als gleichberechtigt anerkannt, nach<strong>de</strong>m 1638 <strong>de</strong>r Dom wie<strong>de</strong>r für (lutherische)<br />
Gottesdienste geöffnet wor<strong>de</strong>n war. Er blieb aber lange Zeit die einzige lutherische Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt und wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss 1803 <strong>de</strong>r Stadt eingeglie<strong>de</strong>rt.<br />
Danach verlor sich das reformierte Bekenntnis mehr und mehr, als die Gemein<strong>de</strong>n teilweise auch lutherische Prediger beriefen. Neue Gemein<strong>de</strong>n entstan<strong>de</strong>n und wur<strong>de</strong>n nicht mehr<br />
zwischen „lutherisch“ und „reformiert“ unterschie<strong>de</strong>n.<br />
Als Freie Reichsstadt konnte Bremen seine kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln. So wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Beispiel 1860 die Grenzen <strong>de</strong>r Pfarrgemein<strong>de</strong>n aufgelöst. Die einzelnen Gemein<strong>de</strong>n<br />
erhielten ein weitgehen<strong>de</strong>s Selbstbestimmungsrecht. Nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg erhielt die Bremische Evangelische Kirche eine neue Kirchenverfassung, wonach an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s vom<br />
Kirchentag (Syno<strong>de</strong>) gewählten Kirchenausschusses <strong>de</strong>r Bremischen Evangelischen Kirche ein Präsi<strong>de</strong>nt steht, <strong>de</strong>r kein Theologe ist. Als Theologe steht ihm <strong>de</strong>r „Schriftführer <strong>de</strong>s<br />
Kirchenausschusses“ <strong>zu</strong>r Seite (kein Bischof o.ä.). Während <strong>de</strong>s Kirchenkampfes in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus stand von 1934 bis <strong>zu</strong>r Suspendierung 1941 ein vom Reichsbischof<br />
eingesetzter Lan<strong>de</strong>sbischof an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>skirche. Nach 1945 wur<strong>de</strong> die Rechtsstellung von 1920 wie<strong>de</strong>rhergestellt.<br />
Zur Bremischen Evangelischen Kirche gehört neben <strong>de</strong>n stadtbremischen Gemein<strong>de</strong>n auch die Vereinigte Protestantische Gemein<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche in<br />
Bremerhaven. Das ehemalige Stadtgebiet <strong>de</strong>r vormals hannoverschen Stadt Wesermün<strong>de</strong>, das heute <strong>zu</strong> Bremerhaven gehört, verblieb im Bereich <strong>de</strong>r Evangelischen Lan<strong>de</strong>skirche<br />
Hannovers.<br />
Katholische Kirche<br />
Ab 1648 gab es in Bremen auch wie<strong>de</strong>r katholisches Leben. Der Jesuit Johannes Zweenbrüggen begann mit katholischen Gottesdiensten. Später konnten Katholiken in Bremen im Hause<br />
<strong>de</strong>s Kaiserlichen Resi<strong>de</strong>nten an <strong>de</strong>n Gottesdiensten teilnehmen, die die bei<strong>de</strong>n Jesuiten als „Hauskapläne“ <strong>de</strong>s Resi<strong>de</strong>nten lasen. Sie kümmerten sich ein wenig außerhalb <strong>de</strong>r<br />
Bestimmungen <strong>de</strong>s Westfälischen Frie<strong>de</strong>ns um die katholischen Bediensteten in Bremen. Bürgerrecht konnten Katholiken nur erwerben, wenn sie einen Beruf hatten, <strong>de</strong>n es in Bremen<br />
nicht gab. Aber erst ab 1807 wur<strong>de</strong> die katholische Kirche in Bremen als gleichberechtigt neben <strong>de</strong>r lutherischen und <strong>de</strong>r reformierten Kirche anerkannt. Mit <strong>de</strong>r Überlassung <strong>de</strong>r<br />
ehemaligen Franziskanerkirche St. Johann erhielt die Gemein<strong>de</strong> 1816 wie<strong>de</strong>r ein eigenes Gotteshaus und weihte es 1823 ein, nach<strong>de</strong>m man <strong>zu</strong>vor <strong>de</strong>n Fußbo<strong>de</strong>n wegen <strong>de</strong>r<br />
Weserüberschwemmungen um 3 Meter angehoben hatte. 1819 nahm die angrenzen<strong>de</strong> St.-Johannis-Schule ihren Betrieb auf. 1920 wur<strong>de</strong> die Pfarrgemein<strong>de</strong> eine Körperschaft <strong>de</strong>s<br />
öffentlichen Rechts und 1931 wur<strong>de</strong> Bremen Sitz eines Dekanats <strong>de</strong>s Bistums Osnabrück. Die Dekanate Bremen-Nord und Bremerhaven gehören <strong>zu</strong>m Bistum Hil<strong>de</strong>sheim. Im Jahr 2002<br />
wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Birgittenkloster Bremen das erste Kloster seit <strong>de</strong>m Mittelalter in <strong>de</strong>r Stadt gegrün<strong>de</strong>t. Die Katholiken bil<strong>de</strong>n heute eine 11,5% <strong>de</strong>r bremer Bevölkerung umfassen<strong>de</strong><br />
Min<strong>de</strong>rheit. Sie besteht aus Mitglie<strong>de</strong>rn von 120 Nationen.<br />
Freikirchen<br />
Ab Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts entstan<strong>de</strong>n auch in Bremen freikirchliche Gemein<strong>de</strong>n. Bereits seit 1845 existiert in Bremen eine baptistische Gemein<strong>de</strong>. Johann Gerhard Oncken taufte<br />
damals 10 Personen in <strong>de</strong>r Weser und begrün<strong>de</strong>te so die baptistische Gemein<strong>de</strong>arbeit in <strong>de</strong>r Hansestadt. Die Bremer Baptisten glie<strong>de</strong>rn sich heute in sechs autonome Gemein<strong>de</strong>n in<br />
Bremen und Bremerhaven mit insgesamt ca. 1100 getauften Mitglie<strong>de</strong>rn.<br />
Im Jahr 1849 grün<strong>de</strong>te sich neben <strong>de</strong>n Baptisten auch eine Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Methodisten, die von Bremen aus eine starke Missionstätigkeit entfalteten. Im Laufe <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts kamen<br />
weitere Freikirchen wie die Elim-Gemein<strong>de</strong>, die Freie evangelische Gemein<strong>de</strong>, die Gemein<strong>de</strong> Gottes, die Mennoniten, eine Gemein<strong>de</strong> im Mülheimer Verband, die SELK und die<br />
Siebenten-Tags-Adventisten hin<strong>zu</strong>. Einige <strong>de</strong>r freikirchlichen Gemein<strong>de</strong>n entstan<strong>de</strong>n erst nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg. Die Bremer Mennonitengemein<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> beispielsweise 1947, die<br />
Freie evangelische Gemein<strong>de</strong> (Christus-Gemein<strong>de</strong>) erst 1998 gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Literatur
• Wilhelm Tacke: St. Johann in Bremen – Eine über 600jährige Geschichte – von <strong>de</strong>n Bettelbrü<strong>de</strong>rn bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Pröpsten. Bremen 2006, ISBN 3-86108-583-6.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Klöster in Bremen<br />
Die Klöster in Bremen sind nicht erhalten. Historisch gab es in Bremen das Kloster St. Paul, das Dominikanerkloster St. Katharinen, das Franziskanerkloster St. Johannis und die<br />
Komturei <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns. Seit 2002 besteht das Birgittenkloster. 1522 kam <strong>de</strong>r Lutherische Augustiner Heinrich von Zütphen durch Bremen und predigte in <strong>de</strong>r Ansgariikirche.<br />
Die dann folgen<strong>de</strong> Reformation in Bremen führte da<strong>zu</strong>, dass sich in Bremen <strong>de</strong>r lutherische Glauben durchsetzte und die Klöster <strong>de</strong>shalb aufgelöst wur<strong>de</strong>n.<br />
Kloster St. Paul<br />
Das ehemalige Kloster St. Paul <strong>de</strong>r Benediktiner im westlichen Teil <strong>de</strong>s heutigen Ostertorsteinviertels ist nicht erhalten. Es bestand von 1050 bis 1523.<br />
Dominikanerkloster St. Katharinen<br />
Die Dominikaner ließen sich 1225 in Bremen nie<strong>de</strong>r. Sie grün<strong>de</strong>n das Kloster St. Katharinen.<br />
Um 1253 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Klosterbau in <strong>de</strong>r Altstadt zwischen Sögestraße, Unser-Lieben-Frauen-Kirchhof und Domshof begonnen. Das Kloster bestand aus <strong>de</strong>r dreischiffigen<br />
Hallenkirche, <strong>de</strong>m Klosterhof mit <strong>de</strong>m Kreuzgang, <strong>de</strong>m Wirtschaftshof, <strong>de</strong>m Remter, <strong>de</strong>m Refektorium und <strong>de</strong>n weiteren Aufenthalts- und Wirtschaftsräumen. Die Reste <strong>de</strong>s gotischen<br />
Klosters, die Katharinenstraße, <strong>de</strong>r Katharinenklosterhof und die Katharinenpassage erinnern an das Kloster. 1524 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r Reformation die ersten Dominikaner – u. a. <strong>de</strong>r<br />
Abt und <strong>de</strong>r Lesemeister – ausgewiesen. Das Kloster wur<strong>de</strong> 1528 geschlossen.<br />
In ihren Räumen wird die Lateinschule (siehe bei Altes Gymnasium) und ab 1898 das Historische Museum (siehe bei Focke-Museum) eingerichtet. Das Kirchengebäu<strong>de</strong> war danach<br />
Zeughaus <strong>de</strong>r Stadt. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt war die Kirche auch Lagerhaus. Nach einem Teilabrisse <strong>de</strong>r Kirche blieben Reste bis <strong>zu</strong>r endgültigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bestehen.<br />
Die Reste <strong>de</strong>s Klosters – u. a. <strong>de</strong>r Remter – sind heute durch die Katharinen-Hochgarage und die Katharinen-Passage überbaut.<br />
Franziskanerkloster St. Johannis<br />
Die Franziskaner ließen sich wahrscheinlich auch 1225 in Bremen nie<strong>de</strong>r. Das Kloster befand sich in <strong>de</strong>r Altstadt. Die Klosterkirche St. Johann, die Klosterkirchenstraße und die<br />
Klosterortstraße erinnern an das Kloster.<br />
Mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Klosters wur<strong>de</strong> um 1258 begonnen. Es bestand aus <strong>de</strong>r heute erhaltenen dreischiffigen gotischen Kirche St. Johann aus <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt, die im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>r<br />
Hallenkirche vergrößert wur<strong>de</strong>. Hin<strong>zu</strong> kamen die südseitig liegen<strong>de</strong>n, heute nicht erhaltenen, Klostergebäu<strong>de</strong> und Höfe.<br />
Um die 20 bis 30 Franziskaner lebten im 14. bis 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Kloster. Das Kloster wur<strong>de</strong> 1528 nach <strong>de</strong>r Reformation geschlossen. Die Klostergebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n danach für die<br />
Unterbringung von geistig Schwachen genutzt (Irrenhaus). 1834 erfolgte <strong>de</strong>r Abriss <strong>de</strong>r inzwischen maro<strong>de</strong>n Klostergebäu<strong>de</strong> und Wohnbauten entstan<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong>. Die Kirche
war u. a. Krankenhauskirche und bis 1801 Kirche reformierter („französischer“) Kirchgemein<strong>de</strong>n.<br />
1823 wur<strong>de</strong> die Kirche St. Johann nach einer gründlichen Sanierung als erste römisch-katholische Pfarrkirche Bremens nach <strong>de</strong>r Reformation wie<strong>de</strong>r geweiht.<br />
1856 kommen die ersten katholischen Or<strong>de</strong>nsfrauen <strong>zu</strong>r St.-Johannis-Gemein<strong>de</strong> und unterrichten in <strong>de</strong>r St.-Johannis-Schule bis 1803. Sie verlassen Bremen, da sie hier nicht mehr im<br />
Or<strong>de</strong>nshabit unterrichten dürfen. Die Franziskanerinnen von Thuine übernehmen die Schuldienste und die Betreuung eines St.-Johannis-Kin<strong>de</strong>rgarten in Walle.<br />
Die Franziskanerinnen von Mauritz übernehmen 1869 die Pflege- und Betreuungsdienste im neu gegrün<strong>de</strong>ten St.-Joseph-Stift.<br />
Außer<strong>de</strong>m besteht in direkter Nachbarschaft <strong>zu</strong>r Propsteikirche St. Johann ein Konvent <strong>de</strong>r Franziskanerinnen.<br />
Komturei <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns<br />
Der beim Dritten Kreuz<strong>zu</strong>g von Kreuzfahrern aus Bremen und Lübeck bei <strong>de</strong>r Belagerung von Akkon (1189–1191) gegrün<strong>de</strong>te Deutsche Or<strong>de</strong>n errichtete schon 1230 eine Komturei in<br />
Bremen. Eine kleine einschiffige Kirche mit nur zwei Jochen und ein angefügtes Or<strong>de</strong>nshaus entstan<strong>de</strong>n beim Spittal. Das vorhan<strong>de</strong>ne Heiliggeist-Spital wur<strong>de</strong> übernommen und bald als<br />
„Deutsches Haus“ bezeichnet. 1426 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hospitalbetrieb eingestellt und 1519 das Haus letztmalig erwähnt. Die Komturei befand sich am Ostertor in <strong>de</strong>r Altstadt. Die Komturstraße<br />
erinnert an <strong>de</strong>n Standort.<br />
Auch die Ritter <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns beteiligten sich 1234 am „Kreuz<strong>zu</strong>g“ gegen die Stedinger im Stedingerkrieg.<br />
Nur wenige Or<strong>de</strong>nsbrü<strong>de</strong>r befan<strong>de</strong>n sich in Bremen und nur ein bis zwei Or<strong>de</strong>nspriester waren bis 1450 tätig. Der Or<strong>de</strong>n wan<strong>de</strong>lte sich <strong>zu</strong>m wohlhaben<strong>de</strong>n Wirtschaftsbetrieb. Obwohl<br />
<strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n sich während <strong>de</strong>r Reformation beginnt <strong>zu</strong> wan<strong>de</strong>ln wird 1531 <strong>de</strong>r Komtur Rolf von Bar<strong>de</strong>wisch und vier seiner Kriegsknechte von <strong>de</strong>n aufgebrachten Bremer Bürgern beim<br />
Beginn <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r 104 Männer getötet. 1564 erwarb Bremen die Komturei und die 31 da<strong>zu</strong>gehören<strong>de</strong>n Bauernhöfe. Der letzte lutherische Komtur wohnt und verwaltet das<br />
Anwesen noch bis 1583.<br />
Ab 1674 war die Kirche dann nur noch Lager und Packhaus. Die Gebäu<strong>de</strong>reste wur<strong>de</strong>n im Zweiten Weltkrieg zerbombt und 1956 teilweise abgerissen. Die Unterkirche blieb unter <strong>de</strong>m<br />
Gerichtsgebäu<strong>de</strong> – ab 1976 als Restaurant „Komturei“ – erhalten.<br />
Die Jesuiten<br />
Von 1648 bis 1788 – also kurz nach <strong>de</strong>m Verbot <strong>de</strong>r Jesuiten im Jahr 1773 – wirken die Jesuiten in Bremen, davon einige Patres als „Hofkapläne“ <strong>de</strong>s kaiserlichen Resi<strong>de</strong>nten. Sie wirken<br />
aber auch inoffiziell für die Bürger und Arbeiter <strong>de</strong>s katholischen Glaubens, in einer Zeit, da die katholische Kirche nicht in Bremen vertreten ist. Ihr Haus befand sich <strong>zu</strong>nächst in <strong>de</strong>r<br />
Altstadt und ab 1651 in <strong>de</strong>r Neustadt. Die Jesuiten wirken erst 1963 wie<strong>de</strong>r in Bremen im „Peter-Faber-Haus“ mit einer Kapelle in Schwachhausen am Schwachhauser-Ring 151. 1990<br />
wur<strong>de</strong> ihre Nie<strong>de</strong>rlassung aufgelöst.<br />
Nonnen und Beginen in Bremen<br />
Im mittelalterlichen Bremen gab es nur wenige Nonnen o<strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsschwestern.<br />
• Beginen und Beginenhöfe: Beginen sind seit Beginn <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts in Lilienthal und dann seit 1258 bei St. Katharinen tätig und so <strong>de</strong>m Dominikaneror<strong>de</strong>n seelsorgerisch<br />
verbun<strong>de</strong>n. Ein weiteres Beginenhaus war bei <strong>de</strong>r St. Nikolaikirche, die 1260/70 erbaut und um 1650 teilweise abgerissen wur<strong>de</strong>. Die Beginnen,unverheiratete Frauen aus<br />
bürgerlichen Oberschichten, überstan<strong>de</strong>n – inzwischen lutherisch – die Reformation in Bremen. Sie lebten in Häusern in <strong>de</strong>r Hutfilter Straße und danach am Schüsselkorb. Ab<br />
1828 gab es das Katharinenstift, welches 1912 in die Parkallee umzog. Nach <strong>de</strong>n Beginen wur<strong>de</strong> die Straße „Auf <strong>de</strong>m Beginenlan<strong>de</strong>“ benannt.<br />
• Der Beginenhof in <strong>de</strong>r Neustadt war seit 2001 lediglich eine genossenschaftliche Wohngemeinschaft, ebenso wie das Projekt in Horn an <strong>de</strong>r Nernstraße.<br />
• Birgittenkloster: 2002 wird für die Nonnen <strong>de</strong>s Birgittenor<strong>de</strong>ns das Birgittenkloster geweiht.
An<strong>de</strong>re katholische Or<strong>de</strong>nstätigkeiten<br />
• Das katholische St. Theresienhaus in Vegesack wur<strong>de</strong> von 1927 bis 1989 von <strong>de</strong>n Missionsschwestern vom Heiligen Namen Mariens, auch nach <strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>s Mutterhauses <strong>de</strong>r<br />
Or<strong>de</strong>nsgemeinschaft in Osnabrück-Nette als „Netter Schwestern“ bekannt, betreut. Einige Schwestern waren noch bis 1999 im katholischen St.-Elisabeth-Haus in Schwachhausen<br />
tätig.<br />
• Von 1959 bis 2003 wirkten Frauen <strong>de</strong>s Säkular-Instituts St. Bonifatius in Bremen und betreuen das Altenzentrum St. Michael in <strong>de</strong>r Neustadt an <strong>de</strong>r Kornstraße.<br />
• Holländische Patres betreuen ab 1963 die St.-Pius-Gemein<strong>de</strong> in Huchting.<br />
• Im Stadtteil Gartenstadt Vahr (Rethemer Straße) existiert seit <strong>de</strong>m Jahr 2000 ein Kloster <strong>de</strong>r Marthaschwestern, die in <strong>de</strong>r Caritas und Seniorenbetreuung tätig sind.<br />
Literatur<br />
• Wilhelm Tacke: Klöster in Bremen. Edition Temmen, Bremen 2005, ISBN 3-86108-545-3.<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Das Große Bremen-Lexikon. Edition Temmen, Bremen 2003, ISBN 3-86108-693-X.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Hoyaer Feh<strong>de</strong> - Bremen<br />
Die Hoyaer Feh<strong>de</strong> war ein politischer und kriegerischer Konflikt von 1351 bis 1359 zwischen <strong>de</strong>r Hansestadt Bremen und <strong>de</strong>n Grafen von Hoya aber auch zwischen <strong>de</strong>m Erzbischof vom<br />
Bistum Bremen Gottfried von Arnsberg und Graf Moritz von Ol<strong>de</strong>nburg.<br />
Konflikte vor <strong>de</strong>r Feh<strong>de</strong><br />
Streit um <strong>de</strong>n Erzbischof<br />
Erzbischof Otto I. Graf von Ol<strong>de</strong>nburg wur<strong>de</strong> 1344 Erzbischof vom Bistum Bremen. Da er kränkelte, führte <strong>de</strong>r Dom<strong>de</strong>kan Moritz von Ol<strong>de</strong>nburg die Geschäfte. 1348 verstarb Otto.<br />
Zwei Kandidaten stan<strong>de</strong>n als Nachfolger <strong>zu</strong>r Wahl an: Moritz von Ol<strong>de</strong>nburg und Gottfried von Arnsberg (1285–1363), bis 1349 Bischof von Osnabrück. Moritz wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Mehrheit<br />
<strong>de</strong>r Domherren gewählt. Gottfried wur<strong>de</strong>, unterstützt von <strong>de</strong>r Familie <strong>de</strong>r Grafen von Hoya und vom Avignon-Papst Clemens VI., <strong>zu</strong>m Erzbischof von Bremen ernannt. Die Bremer<br />
Bürgerschaft schwankte zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Lagern verschie<strong>de</strong>ntlich hin und her. Die Ratsmehrheit war einerseits auf <strong>de</strong>r Seite von Moritz und schloss ein Landfrie<strong>de</strong>nsbündnis.<br />
Gottfried konnte aber an<strong>de</strong>rerseits einige Sprecher <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> für sich gewinnen und <strong>de</strong>r Rat musste nachgeben. Am 6. Januar 1350 zog Gottfried in Bremen ein, bestätigte die<br />
Privilegien, während Moritz die Stadt verlassen musste.<br />
Krieg zwischen <strong>de</strong>n Parteien
Gottfried beschloss nun mit Hilfe seiner Anhänger aus <strong>de</strong>m Domkapitel und <strong>de</strong>r Stadt Bremen eine Burg in Lesum <strong>zu</strong> bauen. Die Gegner, Moritz, einige erzbischöfliche Ministerialien,<br />
dann vor allem die Grafen von Ol<strong>de</strong>nburg, die Bauern von Ostersta<strong>de</strong> und Wursten sowie auch die Herzöge Otto III. und Wilhelm II. von Braunschweig-Lüneburg, waren jedoch weit<br />
überlegen. 1350 sammelte Moritz 900 Mann bei Ritterhu<strong>de</strong> und hatte gegen Bremen erste Erfolge an <strong>de</strong>r Landwehr beim Rembertihospital und in <strong>de</strong>n dörflichen Gebieten vor <strong>de</strong>m<br />
Ostertor. Durch eine Pest in Bremen starben bei einer Einwohnerzahl von zirka 15.000 über 7.000 Menschen. Das lähmte die Verteidigungsbereitschaft <strong>de</strong>r Stadt, die aufgeben musste.<br />
Am 13. Juli 1350 einigten sich die Gegner auf einen Waffenstillstand, klärten in einem Schiedsgerichtsverfahren die Differenzen und schlossen sogar am 12. September 1350 ein Bündnis.<br />
Gottfried blieb nominell Erzbischof aber Moritz übte als Amtmann <strong>de</strong>s Erzstiftes die Macht aus.<br />
Die Feh<strong>de</strong> von 1351 bis 1359<br />
Gottfried hielt sich nun <strong>zu</strong>meist in <strong>de</strong>r Hauptburg <strong>de</strong>s Grafen von Hoya auf und war von diesem vollständig abhängig. Das einwohnergeschwächte Bremen ließ mehrer Jahre erheblich<br />
mehr Zuwan<strong>de</strong>rungen aus <strong>de</strong>m Umland <strong>zu</strong> und frühere Leibeigene erwarben nach einem Jahr in Bremen ihre Bürgerfreiheit. Ein Konflikt zwischen Bremen und Hoya entwickelte sich.<br />
1356 beanspruchte <strong>de</strong>r Graf von Hoya für einige seiner umgezogenen Eigenleute – nunmehr freien Bürger – die Auslieferung, da diese in seinem ebenfalls durch die Pest geschwächten<br />
Gebieten in <strong>de</strong>r Landwirtschaft fehlten. Den in ihrer Freiheit bedrohten Neubürgern gelang es, dass Bremen <strong>de</strong>m Auslieferungsbegehren von Hoya nicht entsprach.<br />
Bei <strong>de</strong>r daraus sich entwickeln<strong>de</strong>n Feh<strong>de</strong> war Bremen verbün<strong>de</strong>t mit Moritz, <strong>de</strong>m Amtmann <strong>de</strong>s Erzstiftes; dagegen stan<strong>de</strong>n die Grafschaft Hoya, die als Verbün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n starken, gera<strong>de</strong><br />
<strong>zu</strong>m Herzog von Jülich erhoben Wilhelm I. gewann. Am 20. Juni 1358 verlor Bremen in einem Gefecht an <strong>de</strong>r Aller. 150 Bürger, darunter acht von zwölf Ratsherren, gerieten in<br />
Gefangenschaft. Hohe Auslösesummen musste Bremen an Hoya zahlen.<br />
Die Kosten für <strong>de</strong>n Krieg und für die Gefangenenauslösungen führten <strong>zu</strong> einer Pleite von Bremen. Hohe Vermögenssteuern (Schoss) waren danach erfor<strong>de</strong>rlich. Zu dieser Zeit führte 1358<br />
die Hanse einen Boykott gegen Flan<strong>de</strong>rn durch. Bremen war damals zwischenzeitlich nicht Mitglied <strong>de</strong>r Hanse. Bremer Kaufleute witterten gute Geschäfte mit Flan<strong>de</strong>rn und<br />
durchbrachen <strong>de</strong>n Boykott. Die Hanse protestierte, verlangte eine Rechtfertigung und drohte mit Sanktionen gegen Bremen. Die Bremer Kaufleute for<strong>de</strong>rten nun vom Rat <strong>de</strong>r Stadt<br />
Bremen ein Einlenken. Das finanziell geschwächte Bremen musste <strong>de</strong>shalb durch zwei Vertreter <strong>de</strong>r Wittheit (Vertreter <strong>de</strong>r Kaufmannschaft) in Lübeck sehr <strong>de</strong>mütig um Wie<strong>de</strong>raufnahme<br />
in die Hanse bitten und sodann <strong>de</strong>n Flan<strong>de</strong>rn-Boykott und Hamburg bei <strong>de</strong>r Bekämpfung <strong>de</strong>r Seeräuber in <strong>de</strong>r Elbe unterstützen. Erst im Juni 1359 kehrten einige <strong>de</strong>r gefangenen<br />
Ratsherren von Hoya nach Bremen <strong>zu</strong>rück.<br />
Literatur<br />
• Herbert Schwarzwäl<strong>de</strong>r: Geschichte <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Bremen. Band I. Edition Temmen, Bremen 1995, ISBN 3-86108-283-7.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Dänemark<br />
Das Königreich Dänemark (dänisch Kongeriget Danmark) ist ein Staat in Nor<strong>de</strong>uropa, <strong>de</strong>ssen Staatsgebiet zwischen <strong>de</strong>r Skandinavischen Halbinsel und Mitteleuropa etwa 43.000 km²<br />
Fläche umfasst, von <strong>de</strong>r ungefähr ein Drittel auf die insgesamt 443 namentlich genannten Inseln (davon: 72 bewohnte)[2] entfällt (insgesamt: 1419 Inseln über 100 m² Fläche).[3]
Dänemark gehört seit 1973 <strong>zu</strong>r EU. Neben <strong>de</strong>m eigentlichen Staatsgebiet gehören die innenpolitisch autonomen Gebiete Grönland und die Färöer <strong>zu</strong>m Königreich Dänemark und <strong>zu</strong>r<br />
NATO, jedoch nicht <strong>zu</strong>r EU. Sie führen eigene Flaggen und haben eigene Amtssprachen.<br />
Die einzige Landgrenze hat Dänemark <strong>zu</strong> Deutschland. Im dortigen, ehemals dänischen Südschleswig lebt eine relativ starke dänische Min<strong>de</strong>rheit. In Dänemark gibt es dagegen im<br />
ehemals <strong>de</strong>utschen Nordschleswig eine <strong>de</strong>utsche Min<strong>de</strong>rheit.<br />
Geographie<br />
Dänemarks Staatsgebiet umfasst (ohne Färöer und ohne Grönland) eine Fläche von 43.094 km², es ist damit größer als die Schweiz o<strong>de</strong>r die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, aber kleiner als Estland.<br />
Dänemark misst von Nord nach Süd 368 km und von Ost nach West 452 km. Nördlichster Punkt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist Grenen, <strong>de</strong>r südlichste Punkt liegt bei Gedser im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Insel Falster.<br />
Westlichster Punkt ist Blåvandshuk in Jütland, gelegen im ehemaligen Ribe Amt, östlichster Punkt liegt bei <strong>de</strong>n Erbseninseln (dänisch Ertholmene), 18 Kilometer nordöstlich von<br />
Bornholm.<br />
Wegen seiner Inseln und <strong>de</strong>r zerklüfteten Buchten verfügt das flächenmäßig kleine Land über eine enorme Küstenlänge von 7314 km. Dänemarks einzige Landgrenze besteht im Sü<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><br />
Deutschland (Grenzlänge: 67 km), <strong>de</strong>s Weiteren wird das Land durch die Nordsee, das Skagerrak, das Kattegat und die Ostsee begrenzt.<br />
Landschaftsbild<br />
Mit <strong>de</strong>m nördlichen Teil <strong>de</strong>r Halbinsel Jütlands und seinen Inseln bil<strong>de</strong>t Dänemark <strong>de</strong>n Übergang von Mitteleuropa nach Skandinavien. Obwohl <strong>de</strong>r Festlandsanteil fast 30.000 km²<br />
beträgt, sehen die Einwohner ihr Land als Inselreich. Die größte Insel <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist Seeland mit 7.031 km², gefolgt von Vendsyssel-Thy (Nordjütland) mit 4.685 km² (das aber nicht als<br />
Insel wahrgenommen wird) und Fünen mit einer Größe von 2.985 km². Seeland, in <strong>de</strong>ssen östlichen Teil die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wird durch <strong>de</strong>n Großen Belt von <strong>de</strong>r Insel<br />
Fünen getrennt, die wie<strong>de</strong>rum durch <strong>de</strong>n Kleinen Belt von Jütland getrennt ist. Die dritte Meeresstraße in <strong>de</strong>r Region ist <strong>de</strong>r Öresund zwischen Seeland und <strong>de</strong>r Südspitze Schwe<strong>de</strong>ns.<br />
Die Eiszeiten <strong>de</strong>s Pleistozäns prägten die Landschaften Dänemarks maßgeblich. Überfuhren Elster- und Saale-Kaltzeit die dänische Halbinsel noch komplett unter Ablagerung von<br />
Grundmoränenmaterial, so reichte die Weichsel-Kaltzeit vor rund 20.000 Jahren nur bis etwa <strong>zu</strong>r Mitte Dänemarks. Heute lässt sich diese teilweise Vergletscherung noch anhand <strong>de</strong>r<br />
Hauptstillstandslinie <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Stadiale <strong>de</strong>r Weichsel-Eiszeit nachvollziehen. Sie teilt Dänemark in das charakteristische Ost- und Westjütland. In Westjütland dominieren<br />
ertragsarme San<strong>de</strong>rflächen, in Ostjütland fin<strong>de</strong>n sich vorwiegend Grundmoränen- und Geschiebematerial. Die Stillstandslinie verläuft etwa vom Südrand <strong>de</strong>s Limfjords <strong>zu</strong>r Mitte Jütlands<br />
und von dort nach Sü<strong>de</strong>n bis Schleswig-Holstein. Das Land bil<strong>de</strong>t eine Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utschen Tiefebene, die ebenfalls aus Ablagerungen aus <strong>de</strong>r Eiszeit besteht. Insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r<br />
Westteil Jütlands ist sehr flach, nach Osten wird es hügeliger, Moränen aus <strong>de</strong>r Eiszeit gestalten die Landschaft. Hier liegt auch die höchste natürliche Erhebung Dänemarks, <strong>de</strong>r Møllehøj<br />
mit 170,86 m über NN. [4][5] Auch die Inseln sind durch ein Wechselspiel von Hügel- und Flachland geprägt. Einzige Ausnahme ist die weit im Osten liegen<strong>de</strong> Insel Bornholm, die nicht<br />
aus Ablagerungen besteht, son<strong>de</strong>rn aus Granit, Schiefer und Sandstein aufgebaut ist.<br />
Der Verlauf <strong>de</strong>r Nordseeküste Jütlands ist relativ ausgeglichen, die Küstenlinie <strong>de</strong>r vorgelagerten Inseln ist sehr viel kürzer als die in <strong>de</strong>r Ostsee. Der Mangel an Buchten und großen<br />
Dünenfel<strong>de</strong>rn steht einem Hafenbau entgegen und so wur<strong>de</strong> erst im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt mit Esbjerg <strong>de</strong>r einzige be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Hafen an <strong>de</strong>r Westküste Dänemarks gebaut. Der Limfjord im<br />
Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist nicht, wie <strong>de</strong>r Name vermuten ließe, ein Fjord, son<strong>de</strong>rn ein etwa 180 km langer Meeresarm, <strong>de</strong>r Jütland fast komplett von Westen nach Osten durchschnei<strong>de</strong>t.<br />
Die Ostseeküste Jütlands ist hingegen formenreich. Meeresbuchten, die För<strong>de</strong>n, reichen weit ins Land hinein; an ihnen liegen einige Hafenstädte, die <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten Siedlungsplätzen<br />
Dänemarks gehören.<br />
Klima<br />
Trotz <strong>de</strong>r Lage Dänemarks an zwei Meeren, Nord- und Ostsee, ist die jährliche Nie<strong>de</strong>rschlagsmenge mit 700 bis 800 mm im Westen mo<strong>de</strong>rat und im Osten mit 500 bis 600 mm für<br />
mitteleuropäische Verhältnisse sogar niedrig. Auch die Temperaturen sind ausgeglichen: An <strong>de</strong>r Nordsee wer<strong>de</strong>n im Juli durchschnittlich 16 °C gemessen, im Osten von Seeland sind es<br />
sogar 18 °C. Am Tage liegen die Temperaturen in <strong>de</strong>r Regel über 20 °C, nachts sind es um 13 °C. Im Winter macht sich <strong>de</strong>r mil<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Einfluss <strong>de</strong>s Golfstroms bzw. seines Ablegers, <strong>de</strong>s<br />
Nordatlantikstroms, bemerkbar: Lan<strong>de</strong>sweit herrschen dann Temperaturen um <strong>de</strong>n Gefrierpunkt (tagsüber um 2 °C, nachts um −3 °C). Die Wassertemperaturen an <strong>de</strong>n Küsten schwanken
zwischen 3 °C im Winter und 17 °C im Sommer.<br />
Wichtige Städte<br />
Die dänische Gesellschaft ist stark urbanisiert, über 86 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung leben in Städten[6]. In <strong>de</strong>r Stadt (Gemein<strong>de</strong>) Kopenhagen leben 509.861 Einwohner (Stand: 1. Januar<br />
2008), im Großraum 1.401.883 Menschen. Damit ist Seeland das dichteste Besiedlungszentrum Dänemarks; rund 40 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung leben auf <strong>de</strong>r Insel. Weitere wichtige Städte<br />
sind <strong>de</strong>r Seehafen Århus mit 228.123 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2007) im Osten Jütlands, O<strong>de</strong>nse mit 158.453 Einwohner (Stand: 1. Januar 2007), bis 2007 <strong>de</strong>r Verwaltungssitz <strong>de</strong>s<br />
Amtes Fyn (Provinz Fünen), Aalborg mit 121.610 Einwohner (Stand: 1. Januar 2007) im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und Hauptstadt <strong>de</strong>r Region Nordjylland. Esbjerg im Westen Jütlands ist <strong>de</strong>r<br />
wichtigste Nordseehafen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und mit 71.129 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2007) fünftgrößte Stadt in Dänemark. Zu beachten ist, dass die Städte (dän: byer; sing.: by) seit <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong>reform vom 1. April 1970 und <strong>de</strong>r Reduzierung <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n von 1098 auf 277 und ab 1974 auf 275 Gemein<strong>de</strong>n keine Verwaltungseinheiten sind, son<strong>de</strong>rn<br />
lediglich statistische o<strong>de</strong>r geographische Einheiten. Seit <strong>de</strong>r Kommunalreform 2007 gibt es nun 98 Gemein<strong>de</strong>n in Dänemark.<br />
• Stadt Region Einwohner Einwohner<br />
• 1. Januar 2000 1. Januar 2007<br />
•<br />
• Hovedstadsområ<strong>de</strong>t Hovedsta<strong>de</strong>n 1.075.851 1.145.804<br />
• Århus Midtjylland 217.260 228.123<br />
• O<strong>de</strong>nse Syddanmark 145.062 158.453<br />
• Aalborg Nordjylland 119.617 121.610<br />
• Esbjerg Syddanmark 73.341 71.129<br />
• Ran<strong>de</strong>rs Midtjylland 55.761 59.391<br />
• Kolding Syddanmark 53.447 55.407<br />
• Horsens Midtjylland 48.730 51.112<br />
• Vejle Syddanmark 47.930 49.943<br />
• Roskil<strong>de</strong> Sjælland 43.100 46.071<br />
• Herning Midtjylland 29.216 44.481<br />
• Silkeborg Midtjylland 37.088 41.619<br />
• Næstved Sjælland 39.408 41.510<br />
• Fre<strong>de</strong>ricia Syddanmark 36.573 39.356<br />
• Køge Sjælland 32.996 34.735<br />
• Viborg Midtjylland 32.258 34.522<br />
• Helsingør Hovedsta<strong>de</strong>n 34.494 34.339<br />
• Holstebro Midtjylland 31.200 33.548<br />
• Hørsholm Hovedsta<strong>de</strong>n 35.261 33.528<br />
• Slagelse Sjælland 31.259 31.914<br />
• Taastrup Hovedsta<strong>de</strong>n 30.934 31.461<br />
• Hillerød Hovedsta<strong>de</strong>n 27.675 29.382<br />
• Søn<strong>de</strong>rborg Syddanmark 26.757 27.371
• Svendborg Syddanmark 27.499 27.263<br />
• Holbæk Sjælland 23.426 25.987<br />
• Hjørring Nordjylland 24.829 24.729<br />
• Fre<strong>de</strong>rikshavn Nordjylland 24.680 23.499<br />
• Ha<strong>de</strong>rslev Syddanmark 21.114 21.182<br />
• Skive Midtjylland 20.639 20.556<br />
Gewässer<br />
Aufgrund von umfassen<strong>de</strong>n Begradigungen folgt kaum einer von Dänemarks Flüssen und Bächen noch seinem natürlichen Lauf. Längster Fluss <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist die Gu<strong>de</strong>nå mit 160<br />
Kilometern, welche während <strong>de</strong>r letzten Eiszeit durch die Glazialströme entstand. Die Kongeå (<strong>de</strong>utsch: Königsau) war zwischen 1864 und 1920 Grenzfluss zwischen <strong>de</strong>m Deutschen<br />
Reich und Dänemark. Weitere Flüsse in Dänemark sind die O<strong>de</strong>nse Å, die Vidå und die Skjern Å.<br />
Das Land umfasst zahlreiche kleinere und größere Seen. Der größte See ist <strong>de</strong>r Arresø mit einer Fläche von etwa 40 km² – er liegt östlich von Fre<strong>de</strong>riksværk. Zweitgrößter See <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
ist Stadil Fjord (19 km²) auf Jütland und drittgrößter <strong>de</strong>r Esromsee mit einer Fläche von 17,36 km² – er liegt, wie auch Arresø, teilweise in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Hillerød in <strong>de</strong>r Region<br />
Hovedsta<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Insel Seeland.<br />
Umwelt<br />
Die Umwelt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s hat nach Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>r Abhol<strong>zu</strong>ng und Zerstörung von Wei<strong>de</strong>flächen schwere Schä<strong>de</strong>n erlitten. Insgesamt befin<strong>de</strong>n sich rund 20 Prozent <strong>de</strong>s Ackerlan<strong>de</strong>s auf<br />
Meereshöhe o<strong>de</strong>r knapp darüber und ein Großteil davon in ökologisch anfälligen Feuchtgebieten, die durch Abpumpen von Wasser anbaufähig gemacht wur<strong>de</strong>n.<br />
Flora und Fauna<br />
Etwa 12 Prozent Dänemarks sind von Bäumen be<strong>de</strong>ckt, doch alte Waldbestän<strong>de</strong> sind eher selten. Es han<strong>de</strong>lt sich größtenteils um Laubwald, in <strong>de</strong>m Buche und Eiche vorherrschen.<br />
Außer<strong>de</strong>m fin<strong>de</strong>t man Ulmen, Haselsträucher, Ahornbäume, Kiefern, Birken, Espen, Lin<strong>de</strong>n und Kastanien. Dänemarks größtes <strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong>s Waldgebiet ist Rold Skov, ein 77<br />
km² großer Forst, <strong>de</strong>r für die Öffentlichkeit <strong>zu</strong>gänglich ist. In <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s westlichen Jütland sind vereinzelt Hochmoore erhalten geblieben. Daneben gibt es die für Mitteleuropa<br />
typische Vegetation <strong>de</strong>r Dünen und Hei<strong>de</strong>n.<br />
Das größte wild leben<strong>de</strong> Tier Dänemarks ist <strong>de</strong>r Rothirsch, <strong>de</strong>r über 200 kg schwer wer<strong>de</strong>n kann. Man trifft auch auf Reh, Damhirsche, Hasen, Eichhörnchen und Igel. Zu <strong>de</strong>n<br />
landbewohnen<strong>de</strong>n Raubtieren gehören Füchse, Dachse, Mar<strong>de</strong>r, Waschbären und Mar<strong>de</strong>rhund. An <strong>de</strong>n Küsten von Nord- und Ostsee leben Seehun<strong>de</strong>. In Dänemark gibt es fast 400<br />
Vogelarten, von <strong>de</strong>nen Elstern, Tauben, Blässhühner, Gänse und Enten am weitesten verbreitet sind. Durch die lange Küstenlinie ist auch die wasserbewohnen<strong>de</strong> Vogelwelt mit Möwen,<br />
Seetauchern und Seeschwalben äußerst vielfältig. In <strong>de</strong>n Meeren rund um Dänemark leben zahlreiche Meeresfische, vor allem Dorsche, Lachse, Heringe und Schollen bil<strong>de</strong>n die<br />
Grundlage <strong>de</strong>r Fischerei.<br />
Bevölkerung<br />
Bevölkerungsstruktur<br />
Die Bevölkerung Dänemarks ist sehr homogen, über 90 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung sind Dänen. Größere Min<strong>de</strong>rheiten sind Angehörige an<strong>de</strong>rer skandinavischer Völker sowie Türken und<br />
die <strong>de</strong>utsche Min<strong>de</strong>rheit. Letztere hat genau wie die dänische Min<strong>de</strong>rheit im <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>sland Schleswig-Holstein eine Son<strong>de</strong>rstellung. Die meisten <strong>de</strong>r etwa 15.000 – 25.000 sich<br />
selbst als Deutsche Volksgruppe Bezeichnen<strong>de</strong>n leben dicht an <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong> Deutschland, ihr Bevölkerungsanteil beträgt im Gebiet Nordschleswig (entsprach bis <strong>zu</strong>r Gebietsreform
2007 <strong>de</strong>m Amt Søn<strong>de</strong>rjylland) ca. 6 – 10 %. 1955 regelten Deutschland und Dänemark die Rechtsfragen in zwei Grundsatzerklärungen, <strong>de</strong>n Bonn-Kopenhagener Erklärungen: Die<br />
jeweilige Min<strong>de</strong>rheit erhielt u. a. För<strong>de</strong>rungen für ihre Schulen, Büchereien, Pfarrämter etc. sowie die Anerkennung <strong>de</strong>r eigenen Schulabschlüsse und auch politische Privilegien.<br />
Sprache<br />
Die Amtssprache Dänemarks ist Dänisch. Als Min<strong>de</strong>rheitensprache ist in Nordschleswig (im dänischen Teil Schleswigs bzw. Südjütlands) auch Deutsch anerkannt. Daneben haben in<br />
einigen Lan<strong>de</strong>steilen auch Dialekte wie Søn<strong>de</strong>rjysk und Bornholmsk eine relativ starke Verankerung. Auf <strong>de</strong>n Färöern und in Grönland sind neben <strong>de</strong>m Dänischen Färöisch bzw.<br />
Grönländisch offizielle Amtssprachen.<br />
Die dänische Sprache gehört <strong>zu</strong>sammen mit Isländisch, Färöisch, Norwegisch und Schwedisch <strong>zu</strong>m nordgermanischen Zweig <strong>de</strong>r Indogermanischen Sprachen. Bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Wikingerzeit unterschie<strong>de</strong>n sich die skandinavischen Mundarten nur unwesentlich voneinan<strong>de</strong>r. Älteste gemeinsame Zeugnisse sind die Runeninschriften aus <strong>de</strong>m 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt, die von<br />
Jütland bis Südschwe<strong>de</strong>n gefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Erst ab <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird die Abspaltung <strong>de</strong>s Dänischen <strong>de</strong>utlich. Als auffälligstes lautliches Merkmal entwickelte sich <strong>de</strong>r Stoßlaut<br />
bei betonten Silben: durch kurzzeitigen Stimmlippenverschluss wird <strong>de</strong>r Luftstrom und somit <strong>de</strong>r Laut für einen Augenblick unterbrochen. Geschrieben wird mit <strong>de</strong>m um drei Buchstaben<br />
erweiterten Alphabet. Den <strong>de</strong>utschen Umlauten ä und ö entsprechen im Dänischen æ bzw. ø; da<strong>zu</strong> kommt <strong>de</strong>r Buchstabe å, <strong>de</strong>r bis 1948 aa geschrieben wur<strong>de</strong>.<br />
Der dänische Wortschatz enthält viele mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche Lehnwörter. Mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch war die traditionelle lingua franca <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns und <strong>de</strong>r Hanse, zeitweise auch die Sprache<br />
<strong>de</strong>r dänischen Könige und <strong>de</strong>s Hofes, sowie die Kommandosprache <strong>de</strong>r Armee. Heute ist Englisch die wichtigste Fremdsprache in Dänemark, aber auch das Deutsche und Französische<br />
haben noch immer einen nicht unerheblichen Einfluss. Ca. 90 % <strong>de</strong>r Schüler lernen <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st zeitweise Deutsch als zweite Fremdsprache.<br />
Religion<br />
Die Religionsfreiheit wird durch das Grundgesetz Dänemarks garantiert.<br />
Wie in <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren skandinavischen Län<strong>de</strong>rn ist auch hier Protestantismus bestimmend: Die große Mehrheit (80,9 %; Stand 1. Januar 2010)[10] <strong>de</strong>r Dänen gehört <strong>zu</strong>r staatlich<br />
verankerten evangelisch-lutherischen Volkskirche (Folkekirken) 0,6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr und 4 Prozentpunkte weniger als 2000, die in <strong>de</strong>r Reformationszeit (siehe<br />
Reformation in Dänemark) bruchlos und unter Beibehaltung vieler Traditionen und Zeremonien aus <strong>de</strong>n katholischen Bistümern <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s entstand. Die dänische Volkskirche ist die<br />
einzige Glaubensgemeinschaft, die vom Staat unterstützt wird. Die Leitung liegt in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Folketings als <strong>de</strong>r gesetzgeben<strong>de</strong>n Instanz. Oberhaupt <strong>de</strong>r Kirche ist die dänische<br />
Königin, höchste administrative Instanz ist <strong>de</strong>r Kirchenminister.<br />
Katholiken (Diözese Kopenhagen) (0,6 %) und Muslime (3 %) sowie Angehörige an<strong>de</strong>rer religiöser Min<strong>de</strong>rheiten stammen größtenteils aus Einwan<strong>de</strong>rerfamilien. Genauso wie in<br />
Norwegen, Island und Liechtenstein fin<strong>de</strong>t sich in Dänemark keine institutionelle Trennung zwischen Kirche und Staat.<br />
• Folkekirken<br />
•<br />
• Jahr Bevölkerung Mitglie<strong>de</strong>r Prozent<br />
• 1984 5.113.500 4.684.060 91,6%<br />
• 1990 5.135.409 4.584.450 89,3%<br />
• 2000 5.330.500 4.536.422 85,1%<br />
• 2005 5.413.600 4.498.703 83,3%<br />
• 2007 5.447.100 4.499.343 82,6%<br />
• 2008 5.475.791 4.494.589 82,1%<br />
• 2009 5.511.451 4.492.121 81,5%
• 2010 5.534.738 4.479.214 80,9%<br />
•<br />
• Zahlen und Fakten 1984–2002[7],<br />
• 1990–2009[8] und 2010[9], Quelle Kirkeministeriet<br />
Geschichte<br />
Das Volk <strong>de</strong>r Dänen soll im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt aus Schonen nach Jütland und auf die westlichen Ostseeinseln, wo es an<strong>de</strong>re germanische Stämme verdrängte, gekommen sein. Im 10.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt vereinigte Gorm <strong>de</strong>r Alte († 950) die einzelnen Kleinkönigreiche unter seiner Herrschaft. Sein Sohn Harald Blauzahn nahm um 960 <strong>de</strong>n christlichen Glauben an. Bis 1035, als<br />
Knut <strong>de</strong>r Große starb, gelang <strong>de</strong>n dänischen Königen die Eroberung weiter Teile <strong>de</strong>r britischen Inseln, Norwegens und <strong>de</strong>r von 975 bis 1026 fränkischen Mark Schleswig (zwischen Ei<strong>de</strong>r<br />
und Schlei). Bis weit in das 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n u. a. die Dänen, Schwe<strong>de</strong>n und Norweger als Wikinger bezeichnet, welche in ganz Europa Kolonien grün<strong>de</strong>ten und Han<strong>de</strong>l trieben,<br />
aber auch ganze Län<strong>de</strong>r und Landstriche plün<strong>de</strong>rten und Kriege führten. Nach einer kurzen Phase <strong>de</strong>r Schwäche begann mit Wal<strong>de</strong>mar I. ein erneuter Aufstieg. Große Teile <strong>de</strong>r südlichen<br />
Küstenregionen fielen an Dänemark, 1219 sogar Estland. Der Besitz dieser Gebiete war allerdings nicht von langer Dauer, da die Deutschen Dänemark 1227 bei Bornhöved schlugen,<br />
Estland 1346 an <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n verkauft wur<strong>de</strong> und Dänemark 1370 die Vorherrschaft <strong>de</strong>r Hanse in <strong>de</strong>r Ostsee anerkennen musste. Die dänischen Herrscher richteten ihren Blick<br />
nun nach Nor<strong>de</strong>n: 1397 wur<strong>de</strong>n Dänemark, Norwegen, Island, Schwe<strong>de</strong>n und Finnland in <strong>de</strong>r Kalmarer Union vereint, die unter dänischer Vorherrschaft stand. Der Verbund existierte, bis<br />
1523 Schwe<strong>de</strong>n seine Unabhängigkeit <strong>zu</strong>rück erlangte.<br />
Bis ins 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein blieben die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Schwe<strong>de</strong>n bestimmend, da bei<strong>de</strong> Königreiche um die Oberherrschaft in Skandinavien und im baltischen Raum<br />
kämpften. Schonen, Blekinge und Halland (Teile <strong>de</strong>s heutigen Schwe<strong>de</strong>ns) waren das eigentliche Herkunftsgebiet <strong>de</strong>r Dänen und fielen erst 1658 an Schwe<strong>de</strong>n. Das Geistesleben jener<br />
Zeit war von <strong>de</strong>r Reformation bestimmt, die 1536 von Christian III. eingeführt wur<strong>de</strong>. Fre<strong>de</strong>rick III. ersetzte 1660/1661 das bestehen<strong>de</strong> Wahlkönigtum <strong>zu</strong>gunsten einer Erbmonarchie. Die<br />
Reformminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, Johann Friedrich Struensee und Andreas Peter von Bernstorff mo<strong>de</strong>rnisierten das Land zwischen 1751 und 1797 im Sinne <strong>de</strong>r<br />
Aufklärung, wobei vor allen Dingen die Bauernbefreiung von 1788 be<strong>de</strong>utsam war. Während <strong>de</strong>r napoleonischen Zeit blieb Dänemark bis <strong>zu</strong>r zweiten Seeschlacht von Kopenhagen<br />
neutral, kooperierte danach mit Frankreich und musste nach <strong>de</strong>ssen Nie<strong>de</strong>rgang bereits im Frie<strong>de</strong>n von Kiel 1814 Helgoland an Großbritannien und Norwegen an Schwe<strong>de</strong>n abtreten.<br />
Island, die Färöer, Grönland und Dänisch-Westindien (bis 1917) verblieben jedoch bei Dänemark.<br />
Die Dänische Nationalbewegung und die Liberalen begannen in <strong>de</strong>n 1830er Jahren an Macht <strong>zu</strong> gewinnen, und nach <strong>de</strong>n europäischen Revolutionen um 1848 (vergleiche Märzrevolution)<br />
etablierte sich Dänemark 1849 <strong>zu</strong> einer konstitutionellen Monarchie unter <strong>de</strong>r Linie Glücksburg <strong>de</strong>s Hauses Ol<strong>de</strong>nburg: Es erhielt seine erste Verfassung. Eine wichtige Rolle spielte in<br />
dieser Zeit <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> dänische Theologe, Pädagoge, Dichter und Politiker N.F.S. Grundtvig.<br />
Die I<strong>de</strong>en <strong>de</strong>r Französischen Revolution hatten auch in Dänemark <strong>de</strong>n Nationalgedanken gestärkt, und damit <strong>de</strong>n Gegensatz zwischen Dänen und Deutschen, die um <strong>de</strong>n Sü<strong>de</strong>n von<br />
Jütland in Form <strong>de</strong>s Herzogtums Schleswig (auch Südjütland) konkurrierten. Dänemark unterlag in zwei Dänisch-Deutschen Kriegen 1848–1851 und 1864, Schleswig und Holstein<br />
wur<strong>de</strong>n 1871 Teil <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Reiches. Diese Nie<strong>de</strong>rlagen bewirkte tiefe Einschnitte in die Entwicklung <strong>de</strong>r nationalen I<strong>de</strong>ntität Dänemarks. Hieran erinnert heute noch die nationale<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätte bei <strong>de</strong>n Düppeler Schanzen, wo je<strong>de</strong>s Jahr am 18. April <strong>de</strong>r Jahrestag <strong>de</strong>r verlorenen Entscheidungsschlacht begangen wird. Die Außenpolitik <strong>de</strong>r Nation nahm einen strikten<br />
Neutralitätskurs an, wobei <strong>de</strong>r große <strong>de</strong>utsche Nachbar nicht provoziert wer<strong>de</strong>n sollte. Diese Politik wur<strong>de</strong> im Prinzip bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs beibehalten. Das ging sehr<br />
weit: Bei einer wichtigen Abstimmung <strong>de</strong>s Völkerbundsrates am 17. April 1935 gegen die <strong>de</strong>utsche Wie<strong>de</strong>rbewaffnung enthielt Dänemark sich als einziger von 17 Staaten <strong>de</strong>r Stimme.<br />
[11]<br />
Im Ersten Weltkrieg blieb das Land neutral. 1920 fiel nach einer Volksabstimmung im nördlichen und mittleren Schleswig (dän. auch Søn<strong>de</strong>rjylland / Südjütland) <strong>de</strong>ssen nördlicher Teil -<br />
Nordschleswig - an Dänemark. Der mittlere und südliche Teil - Südschleswig - blieb bei Deutschland. Die so gezogene Grenze bil<strong>de</strong>t noch heute <strong>de</strong>n Grenzverlauf. Obwohl sich<br />
Dänemark auch im Zweiten Weltkrieg neutral verhielt, wur<strong>de</strong> das Land am 9. April 1940 von Deutschland im Rahmen <strong>de</strong>s Unternehmen Weserübung kampflos besetzt und blieb bis En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs unter <strong>de</strong>utscher Kontrolle. Der Wi<strong>de</strong>rstand vieler Dänen gegen <strong>de</strong>n Holocaust war vorbildlich. Im Oktober 1943 kam es <strong>zu</strong> einer beispiellosen Tat, <strong>de</strong>r Rettung <strong>de</strong>r
dänischen Ju<strong>de</strong>n. Allerdings sympathisierten auch viele Dänen mit <strong>de</strong>n Deutschen, etwa 6000 von ihnen traten <strong>de</strong>r Waffen-SS bei und kämpften bis Kriegsen<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>utscher Seite. Etwa<br />
25 % <strong>de</strong>r dänischen Freiwilligen kamen aus <strong>de</strong>n Reihen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit in Nordschleswig.<br />
Nach <strong>de</strong>r Befreiung 1945 war Dänemark Mitbegrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r UNO, <strong>de</strong>r NATO, <strong>de</strong>s Europarats 1949 sowie <strong>de</strong>s Nordischen Rates 1952. 1960 trat es <strong>de</strong>r EFTA bei, wechselte 1973 aber <strong>zu</strong>r<br />
EG. Die Volksabstimmung über <strong>de</strong>n Vertrag von Maastricht, <strong>de</strong>r die EG <strong>zu</strong>r EU umwan<strong>de</strong>lte, brachte erst im zweiten Anlauf 1993 ein positives Votum, <strong>de</strong>r Beitritt <strong>zu</strong>r Eurozone scheiterte<br />
nach einer Abstimmung 2000.<br />
Am 30. September 2005 veröffentlichte die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten eine Serie von zwölf Karikaturen, die <strong>de</strong>n islamischen Propheten und Religionsstifter Mohammed <strong>zu</strong>m<br />
Thema haben. Die bildliche Darstellung <strong>de</strong>s Gesichts Mohammeds ist im Islam nach verbreiteter Ansicht verboten und stellt in <strong>de</strong>n Augen vieler Muslime eine Herabwürdigung <strong>de</strong>s<br />
Propheten dar. Anfang 2006 erstellten die dänischen Imame Ahmad Abu Laban und Ahmed Akkari ein Dossier, in <strong>de</strong>m neben <strong>de</strong>n originalen zwölf Karikaturen auch solche abgebil<strong>de</strong>t<br />
waren, die nicht aus <strong>de</strong>r Jyllands-Posten stammten und beleidigend-obszönen Inhalts waren, und die angeblich Abu Laban <strong>zu</strong>geschickt wur<strong>de</strong>n. Unter an<strong>de</strong>rem wur<strong>de</strong> ein beten<strong>de</strong>r<br />
Muslim dargestellt, <strong>de</strong>r während <strong>de</strong>s Gebetes von einem Hund bestiegen wur<strong>de</strong>. Daraufhin kam es <strong>zu</strong> weltweiten Protesten muslimischer Organisationen, die vom Boykott dänischer<br />
Produkte bis hin <strong>zu</strong> gewalttätigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen, die mehr als 140 Menschenleben kosteten, reichten. Der Vorfall führte weltweit <strong>zu</strong> einer Diskussion über die Religions, Presse,<br />
Kunst und Meinungsfreiheit. Der Begriff „Karikaturenstreit“ erreichte bei <strong>de</strong>r Wahl <strong>zu</strong>m Wort <strong>de</strong>s Jahres 2006 <strong>de</strong>n dritten Rang.<br />
Politik<br />
Staatsaufbau<br />
Nach <strong>de</strong>r Verfassung von 1953 ist Dänemark eine parlamentarisch-<strong>de</strong>mokratische Monarchie. Das Staatsoberhaupt, das jedoch nur repräsentative Funktionen wahrnimmt, ist die Königin<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r König. Derzeitiges Staatsoberhaupt ist Königin Margrethe II. Das dänische Parlament, das Folketing, besteht aus 179 Abgeordneten, die alle vier Jahre gewählt wer<strong>de</strong>n. Unter<br />
<strong>de</strong>n 179 Volksvertretern befin<strong>de</strong>n sich zwei Abgeordnete aus Grönland und zwei von <strong>de</strong>n Färöer-Inseln.<br />
Exekutive<br />
Formell liegt die ausführen<strong>de</strong> Gewalt bei <strong>de</strong>r dänischen Königin, in <strong>de</strong>r Praxis wird sie jedoch vom Kabinett ausgeübt, das <strong>de</strong>m Regierungschef unterstellt ist, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Titel Staatsminister<br />
trägt. Dieser wird vom König ernannt, muss jedoch die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>s Parlaments haben.<br />
Seit <strong>de</strong>m 20. November 2001 wird Dänemark von einer Min<strong>de</strong>rheitsregierung (seit 2009 unter <strong>de</strong>r Leitung von Lars Løkke Rasmussen) aus <strong>de</strong>r rechtsliberalen Partei Venstre und <strong>de</strong>r<br />
Konservativen Volkspartei mit Duldung durch die Dänische Volkspartei regiert.<br />
Legislative<br />
Die gesetzgeben<strong>de</strong> Gewalt liegt beim Einkammerparlament, <strong>de</strong>m Folketing. Gesetze können nur durch gemeinsamen Beschluss <strong>de</strong>s Königs und <strong>de</strong>s Folketing erlassen wer<strong>de</strong>n. Ebenso<br />
erfor<strong>de</strong>rn Kriegserklärungen und die Unterzeichnung eines Frie<strong>de</strong>nsabkommens die Zustimmung <strong>de</strong>s Königs und <strong>de</strong>s Parlaments. Die Legislaturperio<strong>de</strong> ist auf vier Jahre beschränkt. Die<br />
179 Abgeordneten <strong>de</strong>s Folketing wer<strong>de</strong>n durch allgemeine Wahlen bestimmt. Das Wahlsystem Dänemarks basiert auf <strong>de</strong>r Verhältniswahl. Alle Bürger ab <strong>de</strong>m 18. Lebensjahr haben<br />
sowohl aktives als auch passives Wahlrecht. Ein Drittel <strong>de</strong>r Abgeordneten können vom Parlament verabschie<strong>de</strong>te Gesetze <strong>zu</strong>r Volksabstimmung bringen. Bei einer Volksabstimmung muss<br />
eine Mehrzahl von Nein-Stimmen min<strong>de</strong>stens 30 Prozent <strong>de</strong>r stimmberechtigten Wähler umfassen, um das Gesetz <strong>zu</strong> Fall <strong>zu</strong> bringen (Grundgesetz § 42).<br />
Neben <strong>de</strong>n dänischen Parteien sind auch Parteien aus <strong>de</strong>n autonomen Territorien Grönland und Färöer mit <strong>zu</strong>sammen vier Sitzen im Parlament vertreten.<br />
Judikative<br />
In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Absolutismus in Dänemark von 1661 bis 1849 hatte <strong>de</strong>r König formal <strong>de</strong>n Vorsitz am höchsten Gericht <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>m Obersten Gerichtshof, <strong>de</strong>r 1661 eingerichtet<br />
wor<strong>de</strong>n war. 1849 schließlich wur<strong>de</strong>n dann unabhängige Gerichte eingerichtet. Die Gerichte wur<strong>de</strong>n in ihren Funktionen unabhängig, aber die Richter wur<strong>de</strong>n weiterhin vom König (bis
heute) berufen. Die Verfassung stellte die Einführung von Geschworenen in größeren Strafverfahren und politischen Strafverfahren in Aussicht, ein Versprechen, das erst mit <strong>de</strong>m<br />
Rechtspflegegesetz von 1916 eingelöst wur<strong>de</strong>.<br />
Nach <strong>de</strong>r Verfassung von 1953 ist die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Richter in ihrem Amt durch § 64 gewährleistet, wonach die Richter sich in ihrem Amt ausschließlich nach <strong>de</strong>m Gesetz <strong>zu</strong><br />
richten haben. Im Gegensatz <strong>zu</strong> an<strong>de</strong>rem staatlichen Personal sind Richter gegen administrative Entlassung geschützt und können nur per Gerichtsurteil entlassen wer<strong>de</strong>n.<br />
Fälle wer<strong>de</strong>n im Allgemeinen in erster Instanz von einem Amtsgericht behan<strong>de</strong>lt, und gegen das Urteil <strong>de</strong>s Amtsgerichts kann bei einem <strong>de</strong>r zwei Landgerichte Berufung eingelegt<br />
wer<strong>de</strong>n. Einzelne größere Verfahren sowie Fälle, die Fragen <strong>de</strong>r Verwaltung betreffen, wer<strong>de</strong>n von einem <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Landgerichte in erster Instanz abgewickelt. Die höchste Instanz ist<br />
<strong>de</strong>r Oberste Gerichtshof, (Højesteret) <strong>de</strong>r ausschließlich Fälle bearbeitet, die <strong>zu</strong>vor von einem <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Landgerichte behan<strong>de</strong>lt wor<strong>de</strong>n sind.<br />
Militär<br />
Nach <strong>de</strong>r Befreiung von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Beset<strong>zu</strong>ng im Zweiten Weltkrieg im Mai 1945 musste die dänische Verteidigung mit <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r Streitkräfte nahe<strong>zu</strong> von Grund auf neu<br />
beginnen. 1950 starteten die USA ihr Waffenhilfsprogramm, u. a. für Dänemark, und im selben Jahr kam es <strong>zu</strong> einer Reorganisation <strong>de</strong>r militärischen und politischen Führung <strong>de</strong>r<br />
Verteidigung. Erst hiernach erreichten die Streitkräfte schrittweise die Truppenstärke und das Bereitschaftsniveau, die sich <strong>de</strong>r regelmäßig festgelegten Sollstärke <strong>de</strong>r NATO annäherten.<br />
Die Truppenstärke Dänemarks lag in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Kalten Krieges jedoch stets an <strong>de</strong>r unteren Grenze <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Allianz. Die Verteidigungsvereinbarungen zwischen Regierung<br />
und Opposition, die die finanzielle und politische Grundlage für die Aufgaben <strong>de</strong>r Verteidigung bil<strong>de</strong>n, sind von einer breiten Mehrheit im Folketing traditionell unterstützt wor<strong>de</strong>n.<br />
Zurzeit sind 550 dänische Soldaten im Irak und 360 Soldaten sind in Afghanistan stationiert. Dänemark stellt auch 380 Soldaten für die KFOR.[12]<br />
Heer<br />
Das Heer (dän.: Hæren) hat eine Stärke von etwa 15.000 Mann. Die Führung von Heeresoperationen liegt beim Heeresführungskommando in Karup sowie im logistischen Bereich beim<br />
Heeresunterstüt<strong>zu</strong>ngskommando in Hjørring. Das Heer besteht aus 17 Regimentern <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Waffengattungen, die die Soldaten bis <strong>zu</strong>r Einheitsebene (Kompanie u. a.)<br />
ausbil<strong>de</strong>n. Die Ausbildung <strong>zu</strong>m Gefecht <strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>nen Waffen erfolgt in <strong>de</strong>m jeweils übergeordneten Großverband <strong>de</strong>r Briga<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r militärischen Region, in die sie eingeglie<strong>de</strong>rt sind.<br />
Dies sind u.a. drei Panzergrenadierbriga<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Dänischen Division. Eine vierte Panzerinfanteriebriga<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> als Dänische Internationale Briga<strong>de</strong> (DIB) aufgestellt. Der Briga<strong>de</strong><br />
gehören 4.500 Mann als aktive Soldaten und Reservisten an. Etwa ein Drittel davon kann im Rahmen <strong>de</strong>r UN o<strong>de</strong>r OSZE außer Lan<strong>de</strong>s eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Die Zahl entspricht in etwa <strong>de</strong>r,<br />
die Dänemark Mitte 1995 primär in <strong>de</strong>n Dienst <strong>de</strong>r UN stellte. Die DIB ist Teil <strong>de</strong>r schnellen Eingreiftruppe <strong>de</strong>r NATO.<br />
Marine<br />
Die Marine (dän.: Kongelige Danske Marine) hat eine Mannstärke von etwa 4.500 Mann. Die Leitung ihrer Operationen liegt beim Flottenkommando in Århus, beim Grönland-<br />
Kommando und beim Färöer-Kommando sowie im übergeordneten logistischen Bereich beim Marineunterstüt<strong>zu</strong>ngskommando in Kopenhagen. Die Hauptbasen sind die<br />
Marinestützpunkte in Korsør und Fre<strong>de</strong>rikshavn. Die Hauptfarbe <strong>de</strong>r Marine ist grau (Tarnung).<br />
Die täglichen Operationen fin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Geschwa<strong>de</strong>rn statt, die sich im Prinzip aus Schiffen <strong>zu</strong>sammensetzen, die ein und <strong>de</strong>nselben Auftrag haben. Zu <strong>de</strong>n Geschwa<strong>de</strong>rn gehören<br />
Patrouillenfregatten, Korvetten, Flugkörperschnellboote, Minenleger sowie verschie<strong>de</strong>ne kleinere Schiffe. Darüber hinaus verfügt die Marine über mobile landgestützte Seezielflugkörper-<br />
Batterien. Die meisten <strong>de</strong>r kleineren Schiffe gehören <strong>zu</strong>r STANDARD FLEX 300-Klasse, einem auf Modulbauweise basieren<strong>de</strong>n Schiffstyp. Er kann je nach Ausrüstung und Ausbildung<br />
<strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ng als Überwachungsboot, U-Jagdboot und Minenleger/Minenräumboot eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Über ihre Unterstüt<strong>zu</strong>ngsfunktionen hinaus gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>r<br />
Marinestützpunkte die Überwachung <strong>de</strong>r dänischen Gewässer, verteilt auf drei Marineabschnittskommandos sowie Ausbildungseinrichtungen an Land. Die Marine hat fest stationierte<br />
Einheiten <strong>zu</strong>r Fischereiüberwachung und <strong>zu</strong>r Wahrung <strong>de</strong>r Souveränitätsrechte vor Grönland und <strong>de</strong>n Färöern. Zur Teilnahme an frie<strong>de</strong>nsför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Operationen hat die Marine<br />
regelmäßig eine Korvette an die NATO <strong>de</strong>legiert. Nach Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r US-Truppen vom Inselstaat Island übernimmt die dänische Marine die isländische Küstenverteidigung gemeinsam mit<br />
<strong>de</strong>r isländischen Küstenwache.<br />
Luftwaffe
Die Luftwaffe (dän.: Flyvevåbnet) hat eine Mannstärke von etwa 6.000 Mann. Die Leitung ihrer Operationen liegt beim Luftwaffenführungskommando in Karup bzw. im übergeordneten<br />
logistischen Bereich beim Luftwaffenunterstüt<strong>zu</strong>ngskommando in Brabrand, westlichen Århus und Karup. Die Fliegerverbän<strong>de</strong> verteilen sich auf die Jagd- und Jagdbombergeschwa<strong>de</strong>r<br />
mit F-16-Jagdflugzeugen auf <strong>de</strong>n Luftwaffenstützpunkten Skrydstrup und Ålborg sowie auf die Transport- und Rettungsgeschwa<strong>de</strong>r mit Maschinen vom Typ C-130 Hercules und<br />
Gulfstream III auf Aalborg und S-61 Sea King-Helikoptern auf <strong>de</strong>m Luftwaffenstützpunkt Karup. Die Radarstationen <strong>de</strong>r Kontroll- und Frühwarngruppe überwachen ständig <strong>de</strong>n<br />
Luftraum über Dänemark und können <strong>zu</strong>r unmittelbaren Abwehr und Luftverteidigung Jagdflugzeuge einsetzen, im Kriegsfall, auf Befehl <strong>de</strong>s Luftwaffenführungskommandos, <strong>zu</strong>sätzlich<br />
Luftabwehrraketen.<br />
Heimwehr<br />
Die Heimwehr (dän.: Hjemmeværnet) besteht aus rund 56.000 Freiwilligen[13] , <strong>de</strong>ren Leitung in Frie<strong>de</strong>nszeiten in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Heimwehr-Kommandos liegt. Zu <strong>de</strong>r Truppe gehört<br />
die Heeresheimwehr, die in territorial abgegrenzten Heimwehrkompanien organisiert ist, welche das gesamte Land ständig überwachen und im Kriegsfall <strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>r Militärregionen<br />
<strong>de</strong>s Heeres <strong>zu</strong>geordnet sind, die Marineheimwehr, die die Marine unterstützt, und schließlich die Luftwaffenheimwehr, die die Kontroll- und Frühwarngruppe <strong>de</strong>r Luftwaffe durch<br />
Überwachung <strong>de</strong>s Luftraums in niedrigen Höhen, bei Bewachungsaufgaben unterstützt.<br />
Außengebiete<br />
Die Färöer und Grönland sind Außengebiete mit weitgehen<strong>de</strong>n Selbstbestimmungsrechten (die Färöer seit 1949, Grönland seit 1979). Bei<strong>de</strong> Territorien gehören nicht <strong>zu</strong>r EU, und in<br />
bei<strong>de</strong>n Gebieten gibt es starke Unabhängigkeitsbewegungen.<br />
Außenpolitik<br />
Beziehungen <strong>zu</strong>r EU<br />
Dänemark ist seit 1973 Mitglied in <strong>de</strong>r Europäischen Union. Gemäß <strong>de</strong>r dänischen Verfassung muss je<strong>de</strong> Übertragung von Souveränitätsrechten durch eine Volksabstimmung entschie<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n. Demnach stimmte das dänische Volk bereits fünfmal in EU-Fragen ab. 1992 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r EU-Vertrag von Maastricht im Rahmen eines Referendums abgelehnt. Ein zweiter Anlauf<br />
1993 brachte dann die Zustimmung aufgrund von mehreren „Opt-outs“ in <strong>de</strong>r Wirtschafts- und Währungsunion, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Justiz- und Innenpolitik und <strong>de</strong>r<br />
EU-Bürgerschaft. Die „Opt-outs“ wer<strong>de</strong>n seit<strong>de</strong>m immer wie<strong>de</strong>r in Frage gestellt, weil sie einer weiteren Integration in die EU entgegen stehen. Mit <strong>de</strong>m Inkrafttreten <strong>de</strong>s EU-<br />
Reformvertrages wer<strong>de</strong>n sie sogar noch vergrößert. Es ist vorgesehen in <strong>de</strong>n nächsten Jahren erneut Referen<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n einzelnen Politikbereichen durch<strong>zu</strong>führen.<br />
Das dänische Parlament hat im April 2008 für <strong>de</strong>n EU-Reformvertrag von Lissabon gestimmt.<br />
Verwaltungsglie<strong>de</strong>rung<br />
Heutige Regionen<br />
Seit <strong>de</strong>m 1. Januar 2007 ist das Mutterland Dänemark in die folgen<strong>de</strong>n fünf Regionen mit insgesamt 98 Kommunen aufgeteilt:<br />
• Region Verwaltungssitz Bevölkerung Fläche (in km²) Bevölkerungsdichte (pro km²)<br />
• Region Nordjylland Aalborg 578.839 7.927 73<br />
• Region Midtjylland Viborg 1.237.041 13.142 94<br />
• Region Syddanmark Vejle 1.194.659 12.191,2 98<br />
• Region Hovedsta<strong>de</strong>n Hillerød 1.645.825 2.561 643
• Region Sjælland Sorø 819.427 7.273 113<br />
Ehemalige Ämter<br />
Bis En<strong>de</strong> 2006 bestand eine Einteilung in 16 Ämter (Amtsbezirke) und 270 Kommunen.<br />
Amtsbezirke<br />
• Århus Amt,<br />
• Fre<strong>de</strong>riksborg Amt,<br />
• Fyns Amt (Fünen)<br />
• Københavns Amt (Kopenhagen),<br />
• Nordjyllands Amt (Nordjütland),<br />
• Ribe Amt,<br />
• Ringkjøbing Amt,<br />
• Roskil<strong>de</strong> Amt,<br />
• Søn<strong>de</strong>rjyllands Amt (Südjütland, Nordschleswig),<br />
• Storstrøms Amt,<br />
• Vejle Amt,<br />
• Viborg Amt und<br />
• Vestsjællands Amt (Westseeland),<br />
Gemein<strong>de</strong>n<br />
Die drei folgen<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n bil<strong>de</strong>ten eigene Ämter:<br />
• Bornholms Regionskommune,<br />
• Fre<strong>de</strong>riksberg Kommune,<br />
• Københavns Kommune.<br />
Medien<br />
In Dänemark beträgt <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Tageszeitungsleser 347,1 Leser pro 1000 Einwohner.[14] 81% <strong>de</strong>r Bevölkerung verfügte 2007 über einen Internetanschluss; die<br />
Breitbandverbreitungsquote lag bei 36%.[15]<br />
Infrastruktur<br />
Straßenverkehr<br />
Dänemark verfügt über ein Straßennetz von 71.347 km inklusive 1010 km Schnellstraßen. 1998 wur<strong>de</strong> die Storebælt-Brücke eingeweiht, im Sommer 1998 wur<strong>de</strong> die Brücke für <strong>de</strong>n<br />
Straßenverkehr als gebührenpflichtige Autobahn (die Mautstelle befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>r seeländischen Seite) freigegeben. Der Preis für eine Überfahrt mit einem PKW beträgt 220 DKK
(Stand September 2010, ca. 30 EUR). Zwei Jahre später wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Öresundverbindung die skandinavische Halbinsel angeschlossen, die Europastraße 20 führt über die Brücke.<br />
Schienenverkehr<br />
Das dänische Schienennetz war im Jahr 2000 etwa 2875 Kilometer (wovon 508 km Strecke von Privatbahnen betrieben wer<strong>de</strong>n) lang. Neben <strong>de</strong>m staatlichen Eisenbahnunternehmen<br />
Danske Statsbaner wer<strong>de</strong>n speziell die Nebenstrecken häufig von Privatbahnen befahren. 2000 wur<strong>de</strong> die Öresundbrücke eröffnet, sie verbin<strong>de</strong>t Kopenhagen mit <strong>de</strong>r südschwedischen<br />
Stadt Malmö. Es gibt eine Bahnverbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen über die Lillebæltsbro (über <strong>de</strong>n Kleinen Belt) und über die Storebælt-Brücke (über <strong>de</strong>n Großen Belt),<br />
die vom Nacht<strong>zu</strong>g genutzt wird, während am Tag die Eisenbahnfähre von Puttgar<strong>de</strong>n nach Rødby genutzt wird.<br />
Flugverkehr<br />
Das Land verfügt mit <strong>de</strong>m Kastrup Airport in Kopenhagen, sowie weiteren Flughäfen in Billund, Aalborg, Esbjerg und Århus über fünf internationale Flughäfen.<br />
Wichtige Verkehrsbestimmungen<br />
In Dänemark herrscht Anschnallpflicht und auch bei Tag muss mit Abblendlicht gefahren wer<strong>de</strong>n. Telefongespräche sind während <strong>de</strong>r Fahrt nur mit Freisprechanlage gestattet. Es gilt die<br />
Vorfahrtsregel „rechts vor links“, jedoch be<strong>de</strong>uten kleine weiße Dreiecke auf <strong>de</strong>r Fahrbahn an Kreu<strong>zu</strong>ngen „Vorfahrt gewähren!“.<br />
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt innerorts 50 km/h, außerorts und auf Schnellstraßen 80 km/h und auf Autobahnen 130 km/h. Für Gespanne und Wohnmobile über 3,5 t gilt eine<br />
Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, auf Autobahnen 80 km/h. Die Promillegrenze liegt bei 0,5.<br />
Wirtschaft<br />
Allgemein<br />
Dänemark wird von Reformern gerne als Beispiel für einen <strong>de</strong>regulierten Arbeitsmarkt angeführt, weil das Land über keinen mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Regelung vergleichbaren<br />
Kündigungsschutz verfügt. Allerdings liegt <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r öffentlich Beschäftigten mit ca. 28 % (800.000) (2006) aller Erwerbstätigen (ca. 2.800.000) etwa doppelt so hoch wie in<br />
Deutschland. Umgerechnet nach Vollzeitbeschäftigung steigt diese öffentliche Anteil auf über 38 % von insgesamt über 2,3 Millionen Vollzeitbeschäftigten.[16] Unter <strong>de</strong>m Motto<br />
„Flexicurity“ wer<strong>de</strong>n liberale Beschäftigungsregelungen, hohe soziale Absicherung und eine aktive Arbeitsmarktpolitik miteinan<strong>de</strong>r kombiniert. Arbeitslose erhalten eine wesentlich<br />
höhere Arbeitslosenhilfe als in Deutschland und wer<strong>de</strong>n umfassend für neue Stellen qualifiziert.<br />
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist extrem hoch (über 75 %). Tarifverhandlungen fin<strong>de</strong>n zentralisiert zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften statt. Zwar besitzt Dänemark<br />
keinen gesetzlich festgelegten Min<strong>de</strong>stlohn, aber Min<strong>de</strong>stentgelte wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel durch Tarifverträge normiert und von <strong>de</strong>n Betrieben eingehalten. Die Gewerkschaften haben das<br />
Recht, <strong>zu</strong>m Boykott gegen Arbeitgeber auf<strong>zu</strong>rufen, die sich nicht an die Tarifregelungen halten. Obwohl das dänische System <strong>de</strong>n Arbeitgebern hohe Zugeständnisse abverlangt, wird es<br />
im Allgemeinen von allen Beteiligten akzeptiert, weil es sich in <strong>de</strong>n vergangenen 100 Jahren als sehr erfolgreich erwiesen hat.<br />
In internationalen Vergleichen schnei<strong>de</strong>t Dänemark <strong>zu</strong>meist sehr gut ab. Die Beschäftigungsquote - auch bei älteren Arbeitnehmern - ist die höchste in <strong>de</strong>r EU. Trotz <strong>de</strong>r extrem hohen<br />
Steuer- und Abgabenquote (<strong>de</strong>r Mehrwertsteuersatz beträgt 25 %, dies gilt ebenfalls für Bücher und Lebensmittel, <strong>de</strong>r Spitzensteuersatz <strong>de</strong>r Einkommensteuer liegt bei 59 %) gilt das<br />
Land als sehr flexibel und wettbewerbsfähig. Der Lebensstandard <strong>de</strong>r Dänen ist einer <strong>de</strong>r höchsten in <strong>de</strong>r Welt, die Staatsverschuldung vergleichsweise niedrig. Im Vergleich mit <strong>de</strong>m BIP<br />
<strong>de</strong>r EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht Dänemark einen In<strong>de</strong>x von 126 (EU-27:100) (2006).[17] Mit Haushaltsüberschüssen von 4,9 % und 4,2 % <strong>de</strong>s Bruttosozialprodukts<br />
war Dänemark in <strong>de</strong>n Jahren 2005 und 2006 Spitzenreiter in <strong>de</strong>r EU.<br />
Arbeitslosigkeit<br />
Im Oktober 2008 betrug die Zahl <strong>de</strong>r Arbeitslosen 47.700 (1,7 % Saisonkorrigiert; Vollzeitpersonen) was ein Plus von 1.800 im Vergleich <strong>zu</strong>m Vormonat be<strong>de</strong>utete. Es ist dabei <strong>zu</strong>
eachten, dass die neue Arbeitslosenstatistik - mit <strong>de</strong>n neuen Zahlen ab 2000 - etwa arbeitslose Menschen in <strong>de</strong>n Ferien - insbeson<strong>de</strong>re Neuausgebil<strong>de</strong>te - nicht erfasst.[18] Das sind rund<br />
15.000 Vollzeitarbeitslose.[19] Nach <strong>de</strong>r Statistik von Eurostat ist die Arbeitslosenzahl 3,2 % (Oktober 2008). [20] 2007 lag die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt bei 94.000 Personen (alte<br />
Statistikmetho<strong>de</strong>), was ein Minus von 30.400 Personen im Vergleich <strong>zu</strong>m Vorjahr be<strong>de</strong>utete.<br />
In <strong>de</strong>n vergangenen Jahren hat die Arbeitslosenquote stark abgenommen:<br />
• 1993 = 12,4 %<br />
• 1994 = 12,3 %<br />
• 1995 = 10,4 %<br />
• 1996 = 8,9 %<br />
• 1997 = 7,9 %<br />
• 1998 = 6,6 %<br />
• 1999 = 5,7 %<br />
• 2000 = 5,4 %<br />
• 2001 = 5,2 %<br />
• 2002 = 5,2 %<br />
• 2003 = 6,2 %<br />
• 2004 = 6,4 %<br />
• 2005 = 5,7 %<br />
• 2006 = 4,5 %[21]<br />
• 2007 = 3,4 %[22]<br />
Industrie und Dienstleistung<br />
Dänemark ist ein hochindustrialisiertes Land, mehr als drei Viertel seiner Exporte sind Industriegüter o<strong>de</strong>r Maschinen.[23] Die Industrie und auch die meisten Dienstleistungsfirmen<br />
konzentrieren sich vor allem im Großraum Kopenhagen, wohingegen Jütland relativ wenig industrialisiert ist. Die Industrie <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s trägt etwa 24,9 % <strong>zu</strong>m BIP bei und beschäftigt<br />
ungefähr 24 % aller Arbeitnehmer, während <strong>de</strong>r Dienstleistungssektor mit 71,5 % <strong>de</strong>n größten Teil <strong>zu</strong>m BIP beiträgt und mit 73 % die meisten Arbeitnehmer beschäftigt.[24]<br />
Die gemessen an ihrem Umsatz wichtigsten Zweige <strong>de</strong>s produzieren<strong>de</strong>n Gewerbes in Dänemark sind die Lebensmittel- und die metallverarbeiten<strong>de</strong> Industrie sowie das Druck- und<br />
Verlagswesen, <strong>de</strong>r Maschinenbau und die Produktion von Elektronikartikeln und Transportmaschinen (vor allem Dieselmotoren für Schiffe und Lokomotiven). Schon seit Beginn <strong>de</strong>s 20.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts sind dänische Möbel in <strong>de</strong>r ganzen Welt gefragt. Von Be<strong>de</strong>utung sind weiterhin die Stahlindustrie, <strong>de</strong>r Schiffbau, das Brauwesen, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die<br />
Produktion von Zement sowie die Herstellung von chemischen Erzeugnissen und Arzneimitteln. Darüber hinaus wer<strong>de</strong>n Keramikgegenstän<strong>de</strong>, Porzellan, Öfen, Fahrrä<strong>de</strong>r und Papier<br />
hergestellt.<br />
Landwirtschaft<br />
Die Landwirtschaft in Dänemark ist eine hochmechanisierte Branche. Sie trägt ungefähr 2,3 % <strong>zu</strong>m BIP bei und beschäftigt ungefähr 3 % aller Arbeitnehmer.[24]<br />
Mehr als die Hälfte <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sfläche – Grönland und Färöer nicht eingeschlossen – wer<strong>de</strong>n landwirtschaftlich genutzt. Von Natur aus sind die Bö<strong>de</strong>n relativ nährstoffarm; ihre Qualität<br />
wur<strong>de</strong> jedoch durch intensive Düngung verbessert. Die dänische Regierung för<strong>de</strong>rt kleine landwirtschaftliche Betriebe. Der Zusammenschluss kleiner Betriebe <strong>zu</strong> großen Gütern wird<br />
gesetzlich erschwert. Rund 85 Prozent <strong>de</strong>r dänischen Bauernhöfe sind Familienbetriebe mit weniger als 50 Hektar.<br />
Auf 60 Prozent <strong>de</strong>r Anbaufläche von circa 2,5 Millionen Hektar wird Getrei<strong>de</strong> angebaut; das Spektrum umfasst Gerste, Hafer, Weizen und Roggen. Die restliche Fläche wird mit
Futterpflanzen, Flachs, Hanf, Hopfen und Tabak bepflanzt. Über 50 Prozent <strong>de</strong>r Gesamtfläche wer<strong>de</strong>n als Ackerland genutzt. Die überwiegend exportorientierte Fleisch- und<br />
Milchwirtschaft spielt eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle. Dänemark ist weltweit einer <strong>de</strong>r größten Produzenten von Schweinefleischprodukten.[25] Der Viehbestand umfasst vor allem Schweine,<br />
Rin<strong>de</strong>r und Pfer<strong>de</strong>.<br />
Eine Beson<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r dänischen Landwirtschaft ist <strong>de</strong>r große Einfluss <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Genossenschaften. Sie dominieren die Produktion von Molkereierzeugnissen und<br />
Schinken. Ein hoher Prozentsatz <strong>de</strong>r Agrarerzeugnisse wird über die Genossenschaften vermarktet. Die meisten Genossenschaften gehören nationalen Verbän<strong>de</strong>n an, die wie<strong>de</strong>rum<br />
Mitglie<strong>de</strong>r im Agrarausschuss sind. Dieses Zentralorgan <strong>de</strong>r Genossenschaften verhan<strong>de</strong>lt mit <strong>de</strong>r Regierung, <strong>de</strong>r Industrie o<strong>de</strong>r mit ausländischen Han<strong>de</strong>lspartnern.<br />
1805 erklärte die Regierung alle Wäl<strong>de</strong>r (welche heute ungefähr 12 Prozent <strong>de</strong>r Gesamtfläche Dänemarks ausmachen) <strong>zu</strong> Naturschutzgebieten. Die große Fischereiflotte Dänemarks spielt<br />
in <strong>de</strong>r Wirtschaft <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle. Es han<strong>de</strong>lt sich bei <strong>de</strong>n gefangenen Fischen größtenteils um Meeresfische, unter <strong>de</strong>nen Heringe, Lachse und Dorsche die kommerziell<br />
be<strong>de</strong>utendsten Arten sind. Der überwiegen<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r Fanggrün<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Nordsee. Bei Fisch wer<strong>de</strong>n hohe Ausfuhrüberschüsse erzielt.<br />
Seit 1. August 2000 ist Dänemark von <strong>de</strong>r EU auch als Weinbaugebiet anerkannt. Seither darf dänischer Wein <strong>zu</strong> kommerziellen Zwecken angebaut und verkauft wer<strong>de</strong>n. (Mehr darüber<br />
beim Wiki Zunft[wissen][26])<br />
Energie<br />
Durch die Erdöl- und Erdgasför<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r Nordsee sowie durch Energiesparmaßnahmen kann Dänemark mittlerweile über die Hälfte seines Energiebedarfs selbst <strong>de</strong>cken. Ein großer<br />
Teil <strong>de</strong>r Brennstoffverbrauchs (ungefähr 82 %[27]) <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s wird in Wärmekraftwerken durch die Verbrennung von Kohle und Öl erzeugt. Dänemark ist auch eines <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n<br />
Län<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Energiegewinnung durch Win<strong>de</strong>nergie, durch die <strong>de</strong>rzeit etwa 20 % <strong>de</strong>s Strombedarfs ge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n.<br />
Im September 1997 kündigte die dänische Regierung <strong>de</strong>n Bau ausge<strong>de</strong>hnter Windparks auf See an. Vor <strong>de</strong>r dänischen Küste sollen Windparks mit insgesamt rund 500<br />
Win<strong>de</strong>nergieanlagen von je 90 Meter Höhe gebaut wer<strong>de</strong>n. Durch diesen Beschluss sollen bis <strong>zu</strong>m Jahr 2008 insgesamt 15 % <strong>de</strong>s dänischen Bedarfs an Elektrizität durch Win<strong>de</strong>nergie<br />
ge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n. Nach Angaben <strong>de</strong>s Umweltministeriums ist ein Anstieg auf 50 % für das Jahr 2030 geplant. Mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Windparks, die auf Nord- und Ostsee verteilt wer<strong>de</strong>n,<br />
wur<strong>de</strong>n dänische Elektrizitätsunternehmen beauftragt. Dieser Plan <strong>de</strong>r Regierung ist allerdings umstritten. Vertreter <strong>de</strong>r Wirtschaft und <strong>de</strong>r Stromversorger befürchten Preiserhöhungen.<br />
Nach Meinung von Biologen stellen die Großanlagen eine Gefährdung für <strong>de</strong>n Vogelbestand an <strong>de</strong>n betroffenen Küstenabschnitten dar.<br />
Bo<strong>de</strong>nschätze<br />
Das Land verfügt nur über wenige Bo<strong>de</strong>nschätze. Im begrenzten Umfang wer<strong>de</strong>n mineralische Rohstoffe abgebaut, vor allem Kaolin und Granit. Alle Bo<strong>de</strong>nschätze sind im Besitz <strong>de</strong>r<br />
öffentlichen Hand. Auf Bornholm gibt es Kaolinvorkommen, die allerdings von min<strong>de</strong>rer Qualität sind und hauptsächlich <strong>zu</strong>r Produktion von Tongeschirr sowie <strong>zu</strong>r Herstellung von<br />
Ziegeln verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Kommerziell genutzt wer<strong>de</strong>n auch die Mineralien Limonit, Kryolith, Kalk, Krei<strong>de</strong> und Mergel. Auf Jütland wur<strong>de</strong>n große Salzvorkommen ent<strong>de</strong>ckt. Seit <strong>de</strong>n<br />
siebziger Jahren wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Nordsee Erdöl und Erdgas geför<strong>de</strong>rt. Dänemark ist ein Exportland für Erdöl, trotz<strong>de</strong>m bleibt es selbst Energieimporteur. Die Steigerung <strong>de</strong>r Erdöl- und<br />
Erdgasproduktion soll die Abhängigkeit von <strong>de</strong>n Energieimporten ausgleichen.<br />
Währung und Bankwesen<br />
Die Währung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist die Dänische Krone <strong>zu</strong> 100 Øre. Dänemark ist Teil von ERM II, ein seit 1999 zwischen verschie<strong>de</strong>nen EU-Län<strong>de</strong>rn im Rahmen <strong>de</strong>s Europäischen<br />
Währungssystem II bestehen<strong>de</strong>s Wechselkurs-Abkommen. Die dänische Nationalbank (gegrün<strong>de</strong>t 1818) ist Notenbank und Finanzzentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Ihre Zentrale befin<strong>de</strong>t sich in<br />
Kopenhagen. Einige große Geschäftsbanken haben in ganz Dänemark Zweigstellen. Daneben gibt es noch über 90 Sparkassen. Seit <strong>de</strong>n siebziger Jahren ist die Zahl <strong>de</strong>r Banken aufgrund<br />
einer ganzen Reihe von Fusionen rückläufig. Vor allem Anfang <strong>de</strong>r neunziger Jahre fan<strong>de</strong>n mehrere Zusammenschlüsse statt.<br />
Spätestens mit Beginn <strong>de</strong>r dritten Stufe <strong>de</strong>r Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) im Januar 1999 gab es in Dänemark eine heftige politische Debatte darum, ob das<br />
Land <strong>de</strong>r EWWU beitreten und <strong>de</strong>n Euro als Einheitswährung annehmen solle. In einer Volksabstimmung am 28. September 2000 stimmten 53,1 Prozent <strong>de</strong>r dänischen Bevölkerung<br />
gegen <strong>de</strong>n Euro – 46,9 Prozent waren für eine Abschaffung <strong>de</strong>r Dänischen Krone. Mit diesem Ergebnis wur<strong>de</strong> auch <strong>de</strong>r Beitritt <strong>zu</strong>r EWWU abgelehnt. Eine neuerliche Volksabstimmung
über die Euro-Einführung wur<strong>de</strong> im November 2007 angekündigt, fand aber nie statt. [28].<br />
Außenhan<strong>de</strong>l<br />
Mitte <strong>de</strong>r 1960er Jahre verdrängte die Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland das Vereinigte Königreich als wichtigsten Han<strong>de</strong>lspartner Dänemarks. Dennoch ist Großbritannien immer noch einer<br />
<strong>de</strong>r größten Abnehmer dänischer Produkte. Auch Schwe<strong>de</strong>n, Norwegen, Frankreich und die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> sind be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lspartner. Der Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn in Osteuropa hat in<br />
<strong>de</strong>n letzten Jahren stark <strong>zu</strong>genommen, insbeson<strong>de</strong>re mit Polen. Außerhalb Europas sind die USA und Japan die wichtigsten Han<strong>de</strong>lspartner. Die Han<strong>de</strong>lsbilanz ist positiv, d.h. die<br />
Ausfuhren übersteigen die Importe.<br />
Bis <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>r sechziger Jahre stellten Fleisch- und Milchprodukte <strong>de</strong>n Großteil <strong>de</strong>r Exportgüter dar. Seither stiegen die Exporte von Industriegütern stetig und haben seit 1961 einen<br />
größeren Anteil am Gesamtexportvolumen als die landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Im Vor<strong>de</strong>rgrund stehen dabei chemische und pharmazeutische Erzeugnisse sowie Fahrzeuge. Die<br />
wichtigsten dänischen Importgüter sind Maschinen, Rohmetalle, Metallwaren, Transportausrüstungen, Brenn- und Schmierstoffe sowie verschie<strong>de</strong>ne Konsumgüter.<br />
Tourismus<br />
Der Tourismus boomt in Dänemark seit Jahren: 1999 kamen mehr als zwei Millionen Besucher, die meisten aus skandinavischen Län<strong>de</strong>rn wie Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n sowie aus<br />
Deutschland. Schwedische und norwegische Touristen besuchen aufgrund <strong>de</strong>r Nähe häufig die Hauptstadt Kopenhagen. Außer<strong>de</strong>m lockt viele <strong>de</strong>r vergleichsweise preiswerte und einfache<br />
Zugang <strong>zu</strong> alkoholischen Getränken in das Land. Neben <strong>de</strong>n Touristen aus Skandinavien ist Dänemark auch bei <strong>de</strong>utschen Touristen sehr beliebt, rund eine Million Deutsche besuchten<br />
das Land 1999. Die Einnahmen aus <strong>de</strong>m Tourismus betrugen in <strong>de</strong>m Jahr 3,31 Milliar<strong>de</strong>n US-Dollar.<br />
Staatshaushalt<br />
Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 170,7 Mrd. US-Dollar, <strong>de</strong>m stan<strong>de</strong>n Einnahmen von umgerechnet 162,1 Mrd. US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich ein<br />
Haushalts<strong>de</strong>fizit in Höhe von 2,8 % <strong>de</strong>s BIP.[24]<br />
Die Staatsverschuldung betrug 2009 117,5 Mrd. US-Dollar o<strong>de</strong>r 38,1 % <strong>de</strong>s BIP.[24]<br />
2006 betrug <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Staatsausgaben (in % <strong>de</strong>s BIP) folgen<strong>de</strong>r Bereiche:<br />
• Gesundheit:[29] 10,8 %<br />
• Bildung:[24] 8.3 % (2005)<br />
• Militär:[24] 1,3 % (2007)<br />
Schulsystem<br />
In Dänemark existieren private und öffentliche Schulen. Private Schulen wur<strong>de</strong>n im Jahr 2006 von 24% <strong>de</strong>r Schüler besucht und haben einen Leistungsvorsprung vor <strong>de</strong>n öffentlichen<br />
Schulen. Dieser Leistungsvorsprung ist jedoch durch <strong>de</strong>n familiären und sozioökonomischen Hintergrund <strong>de</strong>r Schülerschaft <strong>zu</strong> erklären und kein wirklicher Effekt <strong>de</strong>r Privatschule.[30]<br />
Die Schulbildung beginnt in Dänemark mit <strong>de</strong>r neunjährigen Volksschule (Folkeskole), die mit <strong>de</strong>r Abschlussprüfung FSA (Folkeskolens Afgangsprøve) en<strong>de</strong>t. Eine Trennung <strong>de</strong>r Schüler<br />
vor <strong>de</strong>r 9. Klasse fin<strong>de</strong>t nicht statt, es besteht insofern eine neunjährige Gemeinschaftsschule. Nach <strong>de</strong>r Abschlussprüfung, die einem anspruchsvollen Hauptschulabschluss gleich<strong>zu</strong>setzen<br />
ist, bieten sich <strong>de</strong>n Schülern je nach Eignung mehrere Wege an.<br />
Zunächst gibt es die Möglichkeit, nach <strong>de</strong>r 9. Klasse noch ein Jahr auf die Folkeskole <strong>zu</strong> gehen und die Erweiterte Abschlussprüfung <strong>zu</strong> absolvieren (die sogenannte FS10, vormals FSU).<br />
Diese entspricht etwa <strong>de</strong>r Mittleren Reife (Realschulabschluss). Da viele Folkeskolen keine 10. Klasse anbieten, wählen viele Schüler ein Jahr auf einer sogenannten Efterskole <strong>zu</strong><br />
absolvieren. Dies sind Internate, in <strong>de</strong>nen die Jugendlichen neben <strong>de</strong>n Fächern <strong>de</strong>r 10. Klasse vor allem soziale, künstlerische, sportliche o<strong>de</strong>r musikalische Kompetenzen weiter<br />
entwickeln sollen, wobei <strong>de</strong>r Schwerpunkt bei je<strong>de</strong>r Efterskole an<strong>de</strong>rs gelegt wird. Aufgrund <strong>de</strong>r relativ niedrigen Kosten ist es für praktisch alle Eltern möglich, ihre Kin<strong>de</strong>r auf eine
Efterskole <strong>zu</strong> schicken. Oftmals wird dies gemacht, wenn Schüler noch nicht als reif für das Gymnasium betrachtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Weiterführen<strong>de</strong> Schulen nach <strong>de</strong>r Folkeskole sind das Gymnasium, das Han<strong>de</strong>lsgymnasium (HHX) sowie das technische Gymnasium (HTX). Das Gymnasium ist mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen<br />
Gymnasium vergleichbar und en<strong>de</strong>t mit <strong>de</strong>m dänischen Abitur (Allgemeine Hochschulreife), <strong>de</strong>m sogenannten Stu<strong>de</strong>ntereksamen. Vom Niveau und vom Umfang <strong>de</strong>r Hochschulreife her<br />
entspricht das Stu<strong>de</strong>ntereksamen <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Abitur, das heißt es ist mit <strong>de</strong>m Stu<strong>de</strong>ntereksamen möglich, alle Studiengänge in Dänemark <strong>zu</strong> studieren, wobei es für bestimmte<br />
Studiengänge jedoch erfor<strong>de</strong>rlich ist, bestimmte Kurse im Abitur belegt <strong>zu</strong> haben. Es gibt am Gymnasium zwei Linien, die sprachliche „sproglig linje“ und die mehr mathematischnaturwissenschaftlich<br />
orientierte „matematisk linje“. Da die mathematische Linie jedoch auch viele sprachliche Fächer enthält und neben zwei Jahren Englisch auch eine zweite<br />
Fremdsprache über zwei Jahre genommen wer<strong>de</strong>n muss, bietet die matematisk linje praktisch <strong>de</strong>utlich mehr Möglichkeiten, so dass sie von mehr Schülern gewählt wird.<br />
Der Besuch <strong>de</strong>s Gymnasiums dauert drei Jahre, entspricht also <strong>de</strong>r gymnasialen Oberstufe. Je nach<strong>de</strong>m, ob man nach <strong>de</strong>r 9. o<strong>de</strong>r 10. Klasse auf das Gymnasium geht, dauert es also 12<br />
o<strong>de</strong>r 13 Jahre bis <strong>zu</strong>m Abitur. Da ein Leistungsunterschied zwischen <strong>de</strong>n Schülern, die aus <strong>de</strong>r 9. Klasse kommen im Vergleich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen, die nach <strong>de</strong>r 10. Klasse kommen, nicht<br />
einwandfrei festgestellt wer<strong>de</strong>n kann, ist ein Abitur in Dänemark insofern nach zwölf Jahren problemlos möglich.<br />
Es gibt für die belegten Kurse drei Niveau-Arten: das A-, B- und C-Niveau. Das A-Niveau entspricht <strong>de</strong>utschem Leistungskursniveau, B-Niveau <strong>de</strong>utschem Grundkursniveau und C-<br />
Niveau einer grundlegen<strong>de</strong>n Einführung. Kurse, die nur ein Jahr belegt wer<strong>de</strong>n, entsprechen <strong>de</strong>m C-Niveau (beispielsweise Musik sowie Kunst, Latein, Sport, Religion, klassische<br />
Altertumskun<strong>de</strong>), zweijährige Kurse B-Niveau (Beispielsweise Englisch bei <strong>de</strong>r matematisk linie, Deutsch) und dreijährige Kurse entsprechen <strong>de</strong>m A-Niveau (Dänisch, Geschichte,<br />
Mathematik, Französisch, Spanisch, Russisch). Je<strong>de</strong>r Schüler muss drei Jahre Geschichte und Dänisch belegen, so dass diese bei<strong>de</strong>n Kurse automatisch A-Niveau erhalten. Ferner müssen<br />
<strong>zu</strong>sätzlich min<strong>de</strong>stens zwei, maximal drei an<strong>de</strong>re A-Niveau-Fächer hin<strong>zu</strong>gewählt wer<strong>de</strong>n, beispielsweise Physik, Chemie, Mathematik o<strong>de</strong>r mehrere Sprachen.<br />
Die A-Niveau-Fächer wer<strong>de</strong>n nach drei Jahren schriftlich geprüft, <strong>zu</strong>sätzlich noch drei mündliche Fächer, wobei die Fächer ausgelost wer<strong>de</strong>n. Ganz Dänemark hat ein Zentralabitur, die<br />
schriftlichen Übungsaufgaben sind insofern in ganz Dänemark i<strong>de</strong>ntisch. Die mündlichen Prüfungen wer<strong>de</strong>n vom jeweiligen Lehrer abgenommen, <strong>zu</strong>sätzlich sitzt ein neutraler „Censor“<br />
im Raum, <strong>de</strong>r von einer an<strong>de</strong>ren Schule kommt und gleichberechtigt mit <strong>de</strong>m Lehrer über die mündliche Note entschei<strong>de</strong>t.<br />
Seit <strong>de</strong>m Schuljahr 2007/2008 besteht das dänische Notensystem aus einer 7-stufigen Skala mit Zensurpunkten zwischen −3 und +12 rsp. 12. Für bestan<strong>de</strong>ne Leistungen wer<strong>de</strong>n 12, 10, 7,<br />
4 o<strong>de</strong>r 2 Punkte vergeben; nicht bestan<strong>de</strong>ne Leistungen erhalten 0 o<strong>de</strong>r −3 Punkte. Die dazwischenliegen<strong>de</strong>n Werte wer<strong>de</strong>n für die Zensierung einzelner Leistungen nicht vergeben, fin<strong>de</strong>n<br />
jedoch bei <strong>de</strong>r Berechnung von Durchschnittszensuren aus mehreren Einzelleistungen Anwendung. Grün<strong>de</strong> für die Reformierung <strong>de</strong>r Notenskala waren unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Wunsch nach<br />
klaren Abgren<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Zensuren und die Ermöglichung einer einfacheren internationalen Vergleichbarkeit.[31] Die folgen<strong>de</strong> Tabelle bietet einen Überblick über<br />
die einzelnen Zensurschritte mit <strong>de</strong>r jeweiligen Definition vom dänischen Bildungsministerium sowie einen Vergleich mit ECTS-Noten und <strong>de</strong>r sechsstufigen <strong>de</strong>utschen Schulnotenskala.<br />
• dänische Zensur Definition[32] entsprechend(e) ECTS-Note entspr. <strong>de</strong>utscher Zensur<br />
•<br />
• 12 „herausragen<strong>de</strong> Leistung“ A 1+ (15 Punkte)<br />
• 10 „ausgezeichnete Leistung“ B 1 bis 2 (11–14 Punkte)<br />
• 7 „gute Leistung“ C 2 bis 3+ (9–11 Punkte)<br />
• 4 „mäßige Leistung“ D 3 bis 3- (7–8 Punkte)<br />
• 2 „ausreichen<strong>de</strong> Leistung“ E 4+ bis 4 (5–6 Punkte)<br />
• 0 „un<strong>zu</strong>reichen<strong>de</strong> Leistung“ Fx 4- bis 5 ([1/]2–4 Punkte)<br />
• -3 „völlig unakzeptable Leistung“ F 6 (0 Punkte)<br />
Zuvor war das dänische Notensystem auf einer 13-Punkte-Skala aufgeteilt, wobei 00 bzw. 0 die schlechteste und 13 die beste Zensur darstellte. Verglichen mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen System
stellte es sich so dar (die Noten 1, 2, 4 sowie 12 gab es nicht): (dänische Noten = äquivalente <strong>de</strong>utsche Noten) (00 = 6; 03 = 5–6, 05 = 5, 06 = 4; 07 = 3–4; 08 = 3; 09 = 2−; 10 = 1–2; 11 =<br />
1; 13 = 1+).<br />
Alle dänischen Studiengänge unterliegen einem Numerus clausus, eine Zentralstelle vergibt die Studienplätze nach <strong>de</strong>m Notendurchschnitt (sogenanntes Kvote-1-Verfahren). Ferner wird<br />
ein gewisser Prozentsatz <strong>de</strong>r Studienplätze nach Sozialkriterien vergeben, wobei man hier seine Chancen durch soziale Arbeit verbessern kann (so genanntes Kvote-2-Verfahren). Ähnlich<br />
wie in Deutschland sind einige Fächer sehr überlaufen, so dass es schwer ist, einen Platz <strong>zu</strong> bekommen (<strong>zu</strong>m Beispiel Medizin, Medienwissenschaften, Psychologie, Jura), während<br />
an<strong>de</strong>re Fächer einen sehr niedrigen Schnitt verlangen, so dass dort je<strong>de</strong>r Bewerber aufgenommen wird.<br />
Neben <strong>de</strong>m oben genannten Stu<strong>de</strong>ntereksamen gibt es in Dänemark noch zwei an<strong>de</strong>re Examensarten, das Han<strong>de</strong>lsschulexamen HHX (Højere Han<strong>de</strong>lseksamen) sowie das technische<br />
Abitur HTX. Während ersteres vor allem für jene interessant ist, die eine Tätigkeit in <strong>de</strong>r Wirtschaft anstreben, ist das HTX vor allem für Schüler interessant, die später einen<br />
Ingenieurberuf anstreben. Jedoch können diese Berufe auch von Absolventen <strong>de</strong>s Stu<strong>de</strong>ntereksamens ergriffen wer<strong>de</strong>n, manchmal wird dann jedoch ein längeres Berufspraktikum<br />
verlangt. Das HHX und HTX sind also fachgebun<strong>de</strong>ne Hochschulreifen, die nicht an die Flexibilität <strong>de</strong>s Stu<strong>de</strong>ntereksamens heranreichen, dafür jedoch in Ihrem Fachbereich <strong>zu</strong> einer<br />
intensiveren Vorbildung führen.<br />
Es besteht auch die Möglichkeit, nach <strong>de</strong>r 9. Klasse statt <strong>de</strong>s Besuchs einer weiterführen<strong>de</strong>n Schule eine Lehre <strong>zu</strong> absolvieren. Hierfür gibt es ebenfalls Berufsschulen, bei <strong>de</strong>nen Theorie<br />
und Praxis kombiniert wer<strong>de</strong>n. Das dänische Schulsystem differenziert daher bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Folkeskole überhaupt nicht, danach jedoch sehr stark. Oftmals wird <strong>de</strong>r Niveausprung von<br />
<strong>de</strong>r Folkeskole <strong>zu</strong>m Gymnasium als sehr drastisch empfun<strong>de</strong>n, was erklärt, wieso sich viele Dänen für die 10. Klasse entschei<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r öffentlichen Diskussion wird <strong>de</strong>r<br />
Niveauunterschied zwischen <strong>de</strong>r Folkeskole und <strong>de</strong>m darauffolgen<strong>de</strong>n Gymnasium oftmals diskutiert, jedoch ist grundsätzlicher Konsens, dass an <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r späten Differenzierung<br />
festgehalten wer<strong>de</strong>n soll. Eine frühe Trennung <strong>de</strong>r Schüler, wie sie in Deutschland nach <strong>de</strong>r Grundschule stattfin<strong>de</strong>t, wird abgelehnt.<br />
Kultur<br />
Dänemark hat versucht, sein Kulturerbe im Kulturkanon 2006 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>finieren.<br />
Literatur<br />
Das hässliche Entlein, Des Kaisers neue Klei<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r Die Prinzessin auf <strong>de</strong>r Erbse, alle diese Märchen wur<strong>de</strong>n von Hans Christian An<strong>de</strong>rsen geschrieben, <strong>de</strong>r damit einen <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendsten dänischen Beiträge <strong>zu</strong>r Weltliteratur gemacht hat. Im Hafen von Kopenhagen erinnert eine Skulptur an <strong>de</strong>n Schriftsteller, eine Nixe, die Hauptfigur aus seinen Märchen Die<br />
kleine Meerjungfrau. Weltbekannt ist auch <strong>de</strong>r Theologe, Philosoph und Schriftsteller Søren Kierkegaard, einer <strong>de</strong>r Vorläufer <strong>de</strong>s Existentialismus. Zentral für sein Werk, das vom<br />
philosophischen Roman bis <strong>zu</strong>r theologischen Streitschrift reicht, sind die Begriffe Existenz und Angst sowie die Frage, wie <strong>de</strong>r Mensch damit um<strong>zu</strong>gehen vermag. Ebenfalls weltweit<br />
bekannt ist <strong>de</strong>r Dichter Ludvig Holberg (geboren als Norweger), er schrieb vornehmlich Komödien und einen satirischen Roman, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m trat er als Geschichtsschreiber hervor.<br />
Im 1937 erschienenen autobiographischen Roman Jenseits von Afrika erzählt die Schriftstellerin Karen Blixen (in Deutschland unter ihrem Pseudonym Tania Blixen verlegt) über ihr<br />
Leben als Kaffee-Farmerin in Kenia. 1985 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Roman mit Meryl Streep und Robert Redford in <strong>de</strong>n Hauptrollen verfilmt und gewann bei <strong>de</strong>r Oscar-Verleihung 1985 sieben<br />
Aca<strong>de</strong>my Awards.<br />
Dänische Literaturnobelpreisträger sind Karl Gjellerup und Henrik Pontoppidan, die sich 1917 <strong>de</strong>n Preis teilten und Johannes Vilhelm Jensen, <strong>de</strong>ssen Roman Kongens Fald (dt: Des<br />
Königs Fall) 1999 von be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n dänischen Tageszeitungen <strong>zu</strong>m (dänischen) Buch <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts gewählt wur<strong>de</strong>. Ein weiterer wichtiger dänischer Schriftsteller ist Herman Bang,<br />
<strong>de</strong>r als Schöpfer <strong>de</strong>s dänischen Impressionismus gilt.<br />
Über teilweise zerrissene Existenzen schreibt <strong>de</strong>r zeitgenössische Autor Peter Høeg in seinen Romanen. Sein internationaler Bestseller Fräulein Smillas Gespür für Schnee wur<strong>de</strong> 1997<br />
vom dänischen Regisseur und Oscar-Preisträger Bille August mit Julia Ormond in <strong>de</strong>r Hauptrolle verfilmt.<br />
Architektur und Design
Die dänische Baukunst entwickelte sich im Mittelalter nach französischen und <strong>de</strong>utschen Vorbil<strong>de</strong>rn, wie die Dombauten in Ribe, Viborg, Århus, Ringsted, Roskil<strong>de</strong> und Kalundborg<br />
belegen. Typische Bauten <strong>de</strong>r Backsteingotik sind die im 13. bzw. 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt entstan<strong>de</strong>ne St. Knud-Kirche in O<strong>de</strong>nse, die Peterskirche in Næstved o<strong>de</strong>r St. Olai-Kirche in Helsingør.<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Zeugnisse <strong>de</strong>r dänischen Baukunst <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Renaissance entstan<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>r Regentschaft von König Friedrich II. und König Christian IV. sind Schloss Kronborg in<br />
Helsingør, Schloss Fre<strong>de</strong>riksborg in Hillerød und die Kopenhagener Börse.<br />
Bemerkenswerte Barockbauten sind Schloss Amalienborg (seit 1794 Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r dänischen Könige), Schloss Charlottenborg und Schloss Christiansborg. Einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten<br />
Architekten <strong>de</strong>s Klassizismus ist Christian Fre<strong>de</strong>rik Hansen, <strong>de</strong>r in Kopenhagen das Gerichtsgebäu<strong>de</strong> und die Liebfrauenkirche erbaute. Historische Bauten stammen von Theophil Edvard<br />
Freiherr von Hansen, Martin Nyrop und Michael Gottlieb Bin<strong>de</strong>sbøll. Herausragen<strong>de</strong> Repräsentanten <strong>de</strong>r dänischen Architektur im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt sind Arne Jacobsen, <strong>de</strong>r neben<br />
mehreren Rathäusern und <strong>de</strong>r Nationalbank auch das SAS Royal Hotel entwarf, Pe<strong>de</strong>r Vilhelm Jensen Klint, Jørn Utzon, <strong>de</strong>r die berühmte Oper von Sydney entwarf, sich aber nicht an<br />
<strong>de</strong>r Realisation beteiligte, Erik Møller und Johan Otto von Spreckelsen.<br />
Georg Arthur Jensen prägte durch seine Silberschmie<strong>de</strong>arbeiten im funktionellen Stil das Industrie<strong>de</strong>sign <strong>de</strong>r skandinavischen Län<strong>de</strong>r. Ebenfalls ein gelernter Silberschmied war Kay<br />
Bojesen, berühmt wur<strong>de</strong> er aber für sein Holzspielzeug, sein Besteck und Geschirr. Ein weiterer bekannter Silberschmied war Svend Weihrauch, <strong>de</strong>r mit seinen klaren, ornamentfreien<br />
Silberschmie<strong>de</strong>arbeiten einer <strong>de</strong>r herausragen<strong>de</strong>n Vertreter <strong>de</strong>s Funktionalismus war. Auch die Lampen von Poul Henningsen und die Möbel von Hans Jørgen Wegner, Poul Kjærholm,<br />
Kaare Klints und Arne Jacobsens – seine Entwürfe Ei, Schwan und Serie 7 gelten als Designklassiker – fan<strong>de</strong>n Anerkennung.<br />
Film<br />
In <strong>de</strong>r Epoche <strong>de</strong>s Stummfilms war Dänemark <strong>de</strong>r größte Filmproduzent nach <strong>de</strong>n USA, Deutschland und Frankreich.<br />
Bemerkenswerte Beiträge <strong>zu</strong>r Filmkunst boten die dänische Schauspielerin Asta Nielsen, die Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter <strong>de</strong>r Regie von Urban Gad <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r ersten Stars <strong>de</strong>s<br />
Stummfilms aufstieg mit Filmen wie Afgrun<strong>de</strong>n (1910; auf dt.: Abgrün<strong>de</strong>). Auch <strong>de</strong>r Regisseur Carl Theodor Dreyer, <strong>de</strong>r mit seinen ästhetisch anspruchsvollen Arbeiten wie La passion<br />
<strong>de</strong> Jeanne d’Arc (1928; auf dt.: Die Passion <strong>de</strong>r Jungfrau von Orleans) o<strong>de</strong>r Vampyr – Der Traum <strong>de</strong>s Allan Gray (1932), setzte Maßstäbe. International beliebt war auch das Komikerduo<br />
Pat & Patachon, das zwischen 1921 und 1940 etwa 50 gemeinsame Filme drehte. Die dänische Produktionsfirma Nordisk Film gehörte in <strong>de</strong>r Zeit vor <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
größten und produktivsten Filmstudios <strong>de</strong>r Welt. Wenngleich die Position <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s auf <strong>de</strong>m internationalen Filmmarkt mit <strong>de</strong>m Aufkommen <strong>de</strong>s Tonfilms <strong>zu</strong>sammenbrach, fan<strong>de</strong>n<br />
anspruchsvolle Produktionen weltweit Beachtung.<br />
In <strong>de</strong>n neunziger Jahren <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts sorgte Lars von Trier international für Diskussionen durch sein gegen <strong>de</strong>n Kommerzfilm gerichtetes filmästhetisches Programm Dogma 95,<br />
nach<strong>de</strong>m er sich bereits vorher durch ambitionierte Filme Ansehen verschafft hatte. Im Rahmen dieses umstrittenen Konzepts entstan<strong>de</strong>n von Triers Idioterne (1998; auf dt.: Idioten) und<br />
Thomas Vinterbergs Festen (1998; auf dt.: Das Fest) und Lone Scherfigs Italiensk for begyn<strong>de</strong>re (2000; auf dt.: Italienisch für Anfänger). Weitere bekannte dänische Regisseure sind Erik<br />
Balling (Die Olsenban<strong>de</strong>), Lasse Spang Olsen (In China essen sie Hun<strong>de</strong>), An<strong>de</strong>rs Thomas Jensen (Adams Äpfel, Dänische Delikatessen), Susanne Bier (Brothers - Zwischen Brü<strong>de</strong>rn)<br />
und Lars Hesselholdt.<br />
Ausländische Filme wer<strong>de</strong>n in Dänemark nicht synchronisiert, son<strong>de</strong>rn lediglich mit Untertiteln versehen. Einzige Ausnahme bil<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rfilme.<br />
Musik<br />
Die Herausbildung dänischer Musik setzte unter <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>utscher, italienischer und englischer Musikkultur während <strong>de</strong>r Regentschaft von König Christians IV. in <strong>de</strong>r zweiten<br />
Hälfte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein. Ausländische Komponisten wie John Dowland, Heinrich Schütz, <strong>de</strong>r längere Zeit königlicher<br />
Oberkapellmeister in Kopenhagen war, o<strong>de</strong>r Dietrich Buxtehu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r mehrere Jahre als Organist in Helsingör verbrachte, wirkten am dänischen Hof und traten dort in Kontakt mit<br />
dänischen Komponisten.<br />
Erste markante Beiträge <strong>zu</strong>r dänischen Musik stammen allesamt von in Deutschland geborenen Komponisten: Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen mit seiner Oper Holger Danske (1787),<br />
Christoph Ernst Friedrich Weyse mit seiner Oper Ludams Hule (1816) und Friedrich Kuhlau, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m auch heute noch populären Stück Elverhøy (1828) die Musik schrieb. Dänische
Vertreter <strong>de</strong>r Romantik sind Niels Wilhelm Ga<strong>de</strong>, Johann Peter Emilius Hartmann und Peter Arnold Heise.<br />
Im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt folgten Carl Nielsen, <strong>de</strong>r als be<strong>de</strong>utendster Komponist Dänemarks gilt und <strong>de</strong>ssen Sinfonien und Opern sich auch im Ausland im Repertoire durchsetzten konnten,<br />
Poul Schierbeck, Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herman David Koppel, Vagn Holmboe und Niels Viggo Bentzon. Weitere wichtige dänische Komponisten sind Louis<br />
Glass, Paul von Klenau, Ludolf Nielsen, Hakon Børresen und Rued Langgaard.<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r populären Musik ist in Deutschland vor allem Gitte Hænning durch ihre Schlager bekannt und die Olsen Brothers, die Gewinner <strong>de</strong>s Eurovision Song Contest 2000.<br />
Ebenfalls bekannt ist die Band Aqua, welche im Bereich Eurodance an<strong>zu</strong>sie<strong>de</strong>ln war und von 1989 bis 2001 bestand. Lars Ulrich, <strong>de</strong>r Schlagzeuger <strong>de</strong>r Band Metallica, stammt ebenfalls<br />
aus Dänemark. Weitere bekannte Musiker und Bands aus Dänemark sind Niels-Henning Ørsted Pe<strong>de</strong>rsen, Carpark North, Saybia, Kashmir, Nephew, Outlandish, D-A-D, Pretty Maids,<br />
Thulla, Poul Krebs, Kim Larsen, TV-2, Sorten Muld, Volbeat, Jakob Sveistrup, Sort Sol, King Diamond, Red Warszawa, Natasha Thomas, Laid Back, Hanne Boel, Anna David, Junior<br />
Senior, Un<strong>de</strong>r Byen, Raunchy, The Raveonettes und Trentemøller. Bekannte dänische Plattenfirmen sind Cope Records und Kick Music.<br />
Malerei und Bildhauerei<br />
Angeregt durch Vorbil<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>n Nachbarlän<strong>de</strong>rn, erhielt <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts die dänische Malerei neue Impulse durch Künstler wie Nicolai Abildgaard, Jens Juel o<strong>de</strong>r<br />
Christoffer Wilhelm Eckersberg, die sich vor allem <strong>de</strong>r Landschaftsmalerei widmeten. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt folgten Christen Købke, Peter Severin Krøyer, Anna Ancher und Viggo<br />
Johansen, im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt die abstrakten Expressionisten Richard Mortensen, Else Alfelt, Ejler Bille, Asger Jorn, <strong>de</strong>r 1948 die Gruppe CoBrA ins Leben rief, und Per Kirkeby, <strong>de</strong>r auch<br />
als Bildhauer arbeitet.<br />
Zwei bekannte, in Dänemark tätige Bildhauer, waren Bernt Notke, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Altar <strong>de</strong>s Doms <strong>zu</strong> Århus schuf und Claus Berg, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Altar <strong>de</strong>r St. Knud-Kirche in O<strong>de</strong>nse schuf. Einer <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendsten dänischen Bildhauer war Bertel Thorvaldsen, er gilt neben <strong>de</strong>m Italiener Antonio Canova als wichtigster Bildhauer <strong>de</strong>s Klassizismus. Zur selben Zeit arbeiteten Hermann<br />
Vilhelm Bissen und Jens Adolph Jerichau. Berühmte Bildhauer im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt waren Kai Nielsen, Robert Jacobsen und Gunnar Westmann.<br />
Weltkulturerbe<br />
In Dänemark kann man drei Weltkulturerbestätten fin<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>n Dom <strong>zu</strong> Roskil<strong>de</strong>, das Schloss Kronborg in Helsingør und die Runensteine von Jelling.<br />
Sport<br />
• Der Dom <strong>zu</strong> Roskil<strong>de</strong> ist die älteste Kirche Dänemarks im Stil <strong>de</strong>r Backsteingotik. Um 1170 begannen die von französischer Architektur geprägten Arbeiten am Dom, <strong>de</strong>r heute<br />
die größte Kirche Skandinaviens ist. Das westlich von Kopenhagen gelegene Roskil<strong>de</strong> war vom 11. bis <strong>zu</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt Königsresi<strong>de</strong>nz und ist bis heute Grablege <strong>de</strong>r<br />
Monarchen. In <strong>de</strong>r Kirche liegen die Gräber von 20 dänische Königen und 17 Königinnen, darunter Margarethe I., Christian IV. und Friedrich IX.. Seit 1995 ist die Kirche<br />
Weltkulturerbe.<br />
• Das Schloss Kronborg ist eine Festung in Helsingør auf <strong>de</strong>r dänischen Insel Seeland. Das Schloss ist ein Beispiel <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und Deutschland aus beeinflussten<br />
Renaissancestils. Außer<strong>de</strong>m ist das Schloss im Stück Hamlet von William Shakespeare Ort <strong>de</strong>s Geschehens. Seit <strong>de</strong>m 30. November 2000 ist Schloss Kronborg Weltkulturerbe.<br />
• Die Runensteine von Jelling sind zwei <strong>de</strong>r wenigen Steine, die dänischen Königen gewidmet sind und ihre Taten thematisieren. Sie entstan<strong>de</strong>n Mitte bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts. Zusammen mit <strong>de</strong>m Grabhügel und <strong>de</strong>r Kirche von Jelling wer<strong>de</strong>n sie von <strong>de</strong>r UNESCO seit 1994 als Teil <strong>de</strong>s Weltkulturerbes geführt.<br />
Die beliebteste Sportart in Dänemark ist Fußball. Insgesamt hat die Dänische Fußballnationalmannschaft siebenmal an Fußball-Europameisterschaften teilgenommen: 1964 bei <strong>de</strong>r<br />
zweiten Fußball-Europameisterschaft sowie stets von 1984 bis 2004, wo sie auch ihren größten Erfolg feiern konnte, <strong>de</strong>n Gewinn <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft 1992 in Schwe<strong>de</strong>n<br />
durch ein 2:0 über Deutschland.<br />
Für eine Fußball-Weltmeisterschaft konnte sich die Nationalmannschaft viermal qualifizieren, und zwar für die 13. Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, für die 16. Fußball-<br />
Weltmeisterschaft in Frankreich, für die 17. Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan und für die 19. Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Größter Erfolg war hier das<br />
Erreichen <strong>de</strong>s Viertelfinales <strong>de</strong>r Fußball-Weltmeisterschaft 1998, wo man gegen Brasilien mit 3:2 ausschied. Bei <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren WM-Teilnahmen erreichte man jeweils das
Achtelfinale. Ein weiterer Erfolg <strong>de</strong>r Dänen war <strong>de</strong>r Gewinn <strong>de</strong>s Konfö<strong>de</strong>rationen-Pokal 1995. Bei Olympischen Spielen konnte man bislang vier Medaillen erringen, drei Silbermedaillen<br />
(1908, 1912 und 1960) und eine Bronzemedaille (1948).<br />
Die Dänische Fußballnationalmannschaft <strong>de</strong>r Frauen konnte sich bei fünf Frauenfußball-Weltmeisterschaften viermal qualifizieren, wobei das beste Ergebnis die zweimalige Teilnahme<br />
am Viertelfinale war (1991 und 1995). Bei neun Frauenfußball-Europameisterschaften konnte man sich achtmal qualifizieren und erreichte zweimal <strong>de</strong>n dritten Platz.<br />
Eine weitere beliebte Sportart ist Handball. Die Dänische Frauen-Handballnationalmannschaft gilt momentan als eine <strong>de</strong>r stärksten Frauennationalmannschaften im Handballsport. Sie<br />
konnten bislang eine Weltmeisterschaft (1997), drei olympische Goldmedaillen (1996, 2000 und 2004) und drei Europameisterschaften (1994, 1996, 2002) gewinnen. Die Dänische<br />
Männer-Handballnationalmannschaft kann zwar nicht an die Erfolge <strong>de</strong>r Damen anknüpfen, gehört aber <strong>de</strong>nnoch <strong>zu</strong>r Weltspitze im Handball. Die Dänische Herren-Mannschaft konnte<br />
ihren größten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft im Jahre 1967 verbuchen, wo <strong>de</strong>r Ein<strong>zu</strong>g in das Finale gelang. Jedoch unterlag man mit 11:14 <strong>de</strong>m Nationalteam <strong>de</strong>r ČSSR. Bei <strong>de</strong>r<br />
letzten Weltmeisterschaft belegte Dänemark <strong>de</strong>n dritten Rang. 2008 siegte die Dänische Herrenmannschaft bei <strong>de</strong>r Handball-Europameisterschaft und wur<strong>de</strong> Europameister.<br />
Auch im Badminton können dänische Sportler seit langem Erfolge feiern. Einer <strong>de</strong>r bekanntesten Spieler <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist Peter Ga<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r von 1998 bis 2001 die Weltrangliste anführte und<br />
je<strong>de</strong>s große internationale Turnier gewann. Weitere bekannte Badminton-Spieler und -Spielerinnen aus Dänemark sind Jens Eriksen, Morten Frost, Pernille Har<strong>de</strong>r, Poul-Erik Høyer<br />
Larsen, Martin Lundgaard Hansen, Camilla Martin und Mette Schjoldager.<br />
Bei Olympischen Spielen konnte Dänemark 165 Medaillen erringen und liegt damit auf <strong>de</strong>m 24. Platz <strong>de</strong>s Ewigen Medaillenspiegels. Dabei errang das Land 39 Gold-, 63 Silber- und 63<br />
Bronzemedaillen. Mit einer Ausnahme wur<strong>de</strong> alle diese Medaillen bei Olympischen Sommerspielen gewonnen. Die einzige Medaille bei Winterspielen war eine Silbermedaille 1998 in<br />
Nagano im Curling. Aber auch im Tischtennis waren sie sehr erfolgreich, so wur<strong>de</strong>n sie 2006 im eigenen Land Tischtenniseuropameister.<br />
Küche<br />
Der bekannteste dänische Beitrag im kulinarischen Bereich ist wahrscheinlich das Smørrebrød. Übersetzt be<strong>de</strong>utet das Wort einfach Butterbrot. Ein Smørrebrød besteht aus einer Scheibe<br />
Brot (Vollkorn, Mischbrot o<strong>de</strong>r Weizen), bestrichen mit einer dünnen Schicht Butter und <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Zutaten. Häufig wird das Butterbrot reichlich mit Fisch belegt, aber auch alle<br />
Arten von Käse, Wurst, Fleisch, Eiern und Soßen wer<strong>de</strong>n gerne reichlich verwen<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r miteinan<strong>de</strong>r kombiniert. Ebenfalls bekannt ist <strong>de</strong>r Hot Dog, <strong>de</strong>r in Dänemark mit roten<br />
Würstchen (pølser) – kogt (gekocht) o<strong>de</strong>r ristet (gebraten) – und ohne Mayonnaise gegessen wird. Außer<strong>de</strong>m wird <strong>de</strong>r dänische Hot Dog traditionell mit Röstzwiebeln und süß-sauer<br />
eingelegten Gewürzgurken-Scheiben garniert. Ein ebenfalls bekanntes Gericht ist <strong>de</strong>r Skipperlabskovs, eine dänische Variante <strong>de</strong>s nord<strong>de</strong>utschen Labskaus. Remoula<strong>de</strong> wird oft<br />
<strong>zu</strong>sammen mit Pommes frites gegessen, und auch mit Fisch, Salami, Frühlingsrollen u.a.<br />
Als Nationalgericht gilt <strong>de</strong>r klassische, bei niedriger Temperatur stun<strong>de</strong>nlang mit Schwarte im Ofen gegarte Schweinebraten (Flæskesteg).<br />
Zu Weihnachten wird oft <strong>zu</strong>m Dessert ris à l´aman<strong>de</strong> (Man<strong>de</strong>lreis) gegessen. Er besteht aus <strong>zu</strong>sammengerührtem, kaltem Milchreis und Schlagsahne mit Vanillegeschmack und nur einer<br />
versteckten Man<strong>de</strong>l, die ein kleines Geschenk (man<strong>de</strong>lgave) auslöst.[34]<br />
Bei <strong>de</strong>n alkoholischen Getränken ist beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r Aquavit berühmt (Aalborg Jubiläumsakvavit), das dänische Bier (dän. Øl) (bekannteste Marken Carlsberg, Tuborg, Faxe) und Gløgg.<br />
Eine Beson<strong>de</strong>rheit in Dänemark sind die Weihnachtsbiere, ein essentieller Bestandteil <strong>de</strong>r juletid, <strong>de</strong>r Vorweihnachtszeit. Angestoßen wird hierbei mit <strong>de</strong>m Trinkspruch Skål. Im<br />
Unterschied <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren skandinavischen Län<strong>de</strong>rn ist in Dänemark <strong>de</strong>r Verkauf von Alkohol nicht einem staatlichen Monopol unterstellt, wie etwa im schwedischen Systembolaget.<br />
Dennoch sind die Steuern hoch und alkoholische Getränke im europäischen Vergleich entsprechend teuer.<br />
Feiertage<br />
Die gesetzlichen Feiertage <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s sind Neujahr (1. Januar), Ostern (Gründonnerstag bis Ostermontag), <strong>de</strong>r Store Be<strong>de</strong>dag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag sowie Weihnachten<br />
(25. Dezember). Der Tag <strong>de</strong>r dänischen Verfassung am 5. Juni ist dagegen kein gesetzlicher Feiertag, jedoch haben Geschäfte und öffentliche Gebäu<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Regel geschlossen.[35]<br />
Eine dänische Beson<strong>de</strong>rheit ist <strong>de</strong>r Store Be<strong>de</strong>dag. Anstatt im Frühling mit vielen Feiertagen verschie<strong>de</strong>ner Heiliger <strong>zu</strong> ge<strong>de</strong>nken, begehen die Dänen am vierten Freitag nach Ostern <strong>de</strong>n
Store Be<strong>de</strong>dag, mit <strong>de</strong>m sie alle Heiligen und Geistlichen ehren. Dieser Feiertag wur<strong>de</strong> im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Graf Johann Friedrich von Struensee eingeführt.<br />
Homosexualität<br />
Homosexualität ist in Dänemark gesetzlich und gesellschaftlich weitgehend akzeptiert. 1989 hat Dänemark als erstes Land <strong>de</strong>r Welt zivilrechtliche Partnerschaften für Homosexuelle<br />
eingeführt.<br />
Quellen<br />
1. ↑ Human Development Report 2009, abgerufen am 13. November 2009<br />
2. ↑ Statistikbanken.dk/Tabelle BEF4<br />
3. ↑ [1]Inseln (dänisch)<br />
4. ↑ http://www.xxx<br />
5. ↑ http://www.xxx<br />
6. ↑ http://dst.dk bef44(PDF)<br />
7. ↑ 1984–2002 vom Kirkeministeriet<br />
8. ↑ 1990–2009 Kirkeministeriet<br />
9. ↑ [http://www.xxx<br />
10.↑ 1990–2009 Statistiken <strong>de</strong>s Kirkeministeriet (dänisch)<br />
11.↑ Walter Truckenbrodt, Deutschland und <strong>de</strong>r Völkerbund, 1941, Seite 169<br />
12.↑ Antal udsendte (number of soldiers in foreign countries)<br />
13.↑ [2]<br />
14.↑ Hallin & Mancini<br />
15.↑ http://www.xxx<br />
16.↑ http://www.xxx<br />
17.↑ Kommentar: Ledighe<strong>de</strong>n i juli 2008 (28. august 2008)[3]<br />
18.↑ Arbejdsløshe<strong>de</strong>n (månedlig) Nyt fra Danmarks Statistik [4]. Statistikbanken.dk/Tabellen auf01+02, aup01, aus01+02 Arbeitsmarkt; Arbeitslosigkeit - neue Metho<strong>de</strong><br />
19.↑ Eurostat Harmonisierte Arbeitslosenquote - Insgesamt - Saisonbereinigt<br />
20.↑ Arbeitslosigkeit 2006(dänisch) [5]<br />
21.↑ Arbeitslosigkeit 2007(dänisch) [6]<br />
22.↑ http://www.xxx<br />
23.↑ a b c d e f CIA World Factbook: Dänemark (englisch)<br />
24.↑ http://www.xxx<br />
25.↑ http://www.xxx<br />
26.↑ http://www.xxx<br />
27.↑ Dänemark setzt zweites Referendum <strong>zu</strong>m Euro an<br />
28.↑ Der Fischer Weltalmanach 2010: Zahlen Daten Fakten, Fischer, Frankfurt, 8. September 2009, ISBN 978-3-596-72910-4<br />
29.↑ Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: "PISA 2006 - Schulleistungen im internationalen Vergleich - Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die
Welt von Morgen". 2007. Bertelsmann Verlag, S. 269<br />
30.↑ Hinweise <strong>zu</strong>r Notenskala – Welche Anfor<strong>de</strong>rungen wer<strong>de</strong>n an die neue Notenskala gestellt? Information <strong>de</strong>s dänischen Bildungsministeriums<br />
31.↑ Die 7-Schritte-Skala. Information <strong>de</strong>s dänischen Bildungsministeriums<br />
32.↑ Weltfilmproduktionsbericht (Aus<strong>zu</strong>g), Screen Digest, Juni 2006, S. 205–207 (eingesehen am 15. Juni 2007)<br />
33.↑ Lene An<strong>de</strong>rsen:Grantræet.Det An<strong>de</strong>rsenske Forlag.32 Seiten.(www.xxx) ISBN 87-990456-1-3<br />
34.↑ Ingeniørforeningen, IDA: Grundlovsdag<br />
• Liane Schuh: Das dänische Sozialsystem. In: RV aktuell, Jg. 52(2006), 7, S. 266–274<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte Dänemarks<br />
Steinzeit<br />
Die ältesten menschlichen Spuren stammen aus einer Warmzeit vor 70.000 Jahren, während <strong>de</strong>r letzten Eiszeit. Sie wur<strong>de</strong>n in einer Kiesgrube bei Hollerup, nordwestlich von Langå<br />
ent<strong>de</strong>ckt. Die nacheiszeitliche Besiedlung Dänemarks, das bei 100 m tieferem Meeresspiegel in <strong>de</strong>r Nordsee eine weitaus größere Fläche als heute be<strong>de</strong>ckt, beginnt mit <strong>de</strong>r noch<br />
paläolithischen Bromme-Kultur (10.000-7.400 v. Chr.), <strong>de</strong>ren Vertreter in <strong>de</strong>r Tundra noch Elch, Moschus, Pferd und Rentier jagten. Sie ist nach einem Fundort bei Sorø auf Seeland<br />
benannt. Der Spiegel <strong>de</strong>r Ostsee, die noch ein Süsswasserbecken war, lag 50 m höher als <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Nordsee. Die vermutlich nur saisonalen Aufenthalte <strong>de</strong>r Brommeleute hinterließen<br />
Spuren (Werkzeuge). Sie fin<strong>de</strong>n sich beson<strong>de</strong>rs an <strong>de</strong>n Seen und Flüssen (auf Djursland und bei Langå). Ihr folgt die Maglemose-Kultur (7.400–6000 v. Chr.), die nach <strong>de</strong>m großen Moor<br />
bei Mullerup (Seeland) benannt wur<strong>de</strong>. Die Kultur ist außer im späteren Nordkreis auch in England (Broxburne, Star Carr) und in ganz Nordrussland (dort als Kunda-Kultur bezeichnet)<br />
bis jenseits <strong>de</strong>s Ural verbreitet. Der südlichste Fundplatz ist Haltern (Nordrhein-Westfalen) In <strong>de</strong>r Maglemose-Kultur bil<strong>de</strong>ten sich schon wegen <strong>de</strong>r weiten Verbreitung Gruppen heraus.<br />
Die Kongemose-Kultur (6.000-5.200 v. Chr.) wur<strong>de</strong> ebenfalls nach einen Moor auf Seeland benannt und tritt auch in Gruppen auf (Gu<strong>de</strong>nå und Ahrensburg, das <strong>de</strong>n Ursprung <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n<br />
scheint). Die Jagd auf Rotwild und Wildschweine wur<strong>de</strong> wesentlich durch Beeren, Fische, Nüsse, Schalentiere, Vögel und Wurzeln ergänzt. Die letzte mesolithische Kultur die Ertebølle-<br />
Kultur wird auch im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum Ertebølle-Ellerbek-Kultur genannt (5.200-4.000 v. Chr.). Sie wur<strong>de</strong> nach Fundplätzen auf <strong>de</strong>r Kimbrischen Halbinsel benannt. Ihnen folgt<br />
die neolithische Trichterbecherkultur, die erste Ackerbauernkultur.<br />
Eisenzeit<br />
113 v. Chr. wur<strong>de</strong>n die in und südlich von Jütland sie<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Kimbern und Teutonen erstmals erwähnt. Vom 2. bis 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt fin<strong>de</strong>n sich Spuren eines Vorläufers einer Großsiedlung
mit zentralem Charakter und weitreichen<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsbeziehungen im Osten von Fünen bei Gudme. Während <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt tauchen plötzlich in gotischen,<br />
fränkischen und byzantinischen Quellen Hinweise auf die Existenz und die kriegerischen Taten von Dänen auf.[1] Da<strong>zu</strong> gehört auch die Schil<strong>de</strong>rung Prokops über die Wan<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
Heruler vom Donauraum nach Nor<strong>de</strong>n. Als eines <strong>de</strong>r Völker, <strong>de</strong>ssen Gebiet sie berührten, wer<strong>de</strong>n die Danoi genannt. Jordanes schreibt in seiner Gotengeschichte von Konflikten<br />
zwischen Dänen und Herulern. Dabei meint er, dass die Dänen von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n abstammten. Gregor von Tours bezeichnet <strong>de</strong>n König Chlochilaicus als „Dänenkönig“. Der Dichter<br />
Venantius Fortunatus feiert in seinen Preisgedichten auf die Frankenkönige Chlothar I. und Chilperich <strong>de</strong>ren Siege über die Dänen. Ganz überwiegend wird die Urheimat <strong>de</strong>r Dänen in<br />
Südschwe<strong>de</strong>n, beson<strong>de</strong>rs in Schonen und Halland vermutet.<br />
Wikingerzeit<br />
Christianisierung<br />
Um 700 versuchte <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Missions-Erzbischof geweihte Willibrord vergeblich, <strong>de</strong>n damaligen Dänenkönig Ongendus <strong>zu</strong> bekehren. Unter Karl <strong>de</strong>m Großen unterblieben weitere<br />
Missionsversuche, da er eine Missionierung nicht unterworfener Gebiete ablehnte. Dies hing mit seiner I<strong>de</strong>e von <strong>de</strong>r Zusammengehörigkeit von Reich und Kirche <strong>zu</strong>sammen und än<strong>de</strong>rte<br />
sich erst unter Ludwig <strong>de</strong>m Frommen.<br />
Unter Ludwig <strong>de</strong>m Frommen wur<strong>de</strong> auf Betreiben <strong>de</strong>r Erzbischöfe Agobard von Lyon und Ebo von Reims die Mission über die Nordgrenze <strong>de</strong>s Reiches wie<strong>de</strong>r aufgenommen. Diesem<br />
Plan kam entgegen, dass <strong>de</strong>r dänische Wikingerkönig Gudfred (Göttrik) 810 ermor<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n war. Dessen Söhne vertrieben <strong>de</strong>n Kronpräten<strong>de</strong>nten Harald Klak, worauf dieser Vasall<br />
König Ludwigs wur<strong>de</strong>. Mit <strong>de</strong>m Missionsauftrag <strong>de</strong>s Kaisers reiste Ebo nach Rom, um <strong>de</strong>n päpstlichen Missionsauftrag <strong>zu</strong> erhalten. Dieser Auftrag wur<strong>de</strong> 822 o<strong>de</strong>r 823 mit einer<br />
Papstbulle von Papst Paschalis I. erteilt. Das Missionsgebiet wur<strong>de</strong> dabei nicht näher umschrieben (ubique).[2] Ebo unternahm 823 seine erste Missionsreise nach Dänemark. Der Papst<br />
schärfte ihm dabei ein, in allen Zweifelsfragen beim Papst rück<strong>zu</strong>fragen, wie es schon für Bonifatius gegolten hatte. Damit begann sich <strong>de</strong>r Missionsauftrag <strong>de</strong>r Kirche allmählich von <strong>de</strong>r<br />
Reichskirche <strong>zu</strong> emanzipieren. Mit dieser Bulle wur<strong>de</strong> Ebo Missionsvikar und Missionslegat <strong>de</strong>s Papstes nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>s Bonifatius.<br />
831 wur<strong>de</strong> auf einer Syno<strong>de</strong> von Kaiser Ludwig das Erzbistum Hamburg errichtet. Der Erzbischof erhielt das Recht, im skandinavischen Bereich Bischöfe ein<strong>zu</strong>setzen und Priester<br />
dorthin ab<strong>zu</strong>ordnen. Die politische Absicht dahinter war, <strong>de</strong>n Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Reichskirche ein<strong>zu</strong>glie<strong>de</strong>rn, was nur mit einem Erzbischofssitz im Reiche möglich war. Zum ersten Erzbischof<br />
wur<strong>de</strong> Ansgar vom Erzbischof Drogo von Metz geweiht. 831/832 erhielt Ansgar das Pallium und eine Urkun<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r ihm die Legation erteilt wur<strong>de</strong>. Gleichzeitig wur<strong>de</strong> die Errichtung<br />
<strong>de</strong>s Missions-Erzbistums Hamburg bestätigt. Die Mission geriet aber nach <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung Hamburgs durch die Dänen 845 ins Stocken, da alle Ressourcen vernichtet waren. 864 kam es<br />
dann <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s Erzbistums Hamburg-Bremen durch eine Bulle Papst Nikolaus I.. Ansgar trat 843 und / o<strong>de</strong>r 847 mit Horik I. von Dänemark <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n<br />
Gesandtschaften Ludwig <strong>de</strong>s Deutschen in Verbindung. Dessen Taufe erreichte er zwar nicht, aber die Erlaubnis, in Schleswig eine Kirche <strong>zu</strong> bauen. Horik geriet 850 in<br />
Thronstreitigkeiten mit seinen Neffen und fiel 854 in einem Bürgerkrieg und mit ihm alle Ansgar wohlgesinnten Berater. Von seiner Sippe blieb nur sein Neffe Horik II. übrig. Er stand<br />
anfangs unter <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>s mächtigen und christenfeindlichen Jarls Hovi von Schleswig. Horik II. entledigte sich aber bald seiner Ratgeber und wandte sich Ansgar <strong>zu</strong>, bat ihn um<br />
Priester, schenkte <strong>de</strong>r Kirche in Ripen einen Bauplatz für eine Kirche und erlaubte die Anwesenheit eines Priesters. Auch Horik II. ließ sich nicht taufen, übersandte aber 864 Geschenke<br />
an Papst Nikolaus I. Während <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen um die Entstehung <strong>de</strong>s Erzbistums Hamburg-Bremen mit <strong>de</strong>m Erzbischof von Köln gingen die Missionsversuche in Dänemark<br />
wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück. Erst Erzbischof Unni von Hamburg nahm sie wie<strong>de</strong>r auf und schickte erneut Priester nach Dänemark. Dabei wur<strong>de</strong> er von Harald Blauzahn unterstützt. Dessen Vater,<br />
Gorm <strong>de</strong>r Alte, hatte Dänemark geeint, war aber betont heidnisch eingestellt und hat wahrscheinlich die Kirche in Schleswig zerstört.<br />
Harald Blauzahn grün<strong>de</strong>te nach seinem Regierungsantritt um 940 drei Bistümer in Dänemark: Schleswig, Ripen und Århus. In <strong>de</strong>n 980er Jahren kam noch O<strong>de</strong>nse auf Fünen hin<strong>zu</strong>. 965<br />
wur<strong>de</strong> alle dänischen Bistümer durch kaiserliches Privileg von <strong>de</strong>n Abgaben an <strong>de</strong>n Kaiser und <strong>de</strong>m Eingriffsrecht kaiserlicher Vögte befreit. Ein Eingriff in die Hoheitsrechte <strong>de</strong>s<br />
dänischen Königs sollte damit ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n. Damit war <strong>de</strong>r Hamburger Erzbischof die einzige Verbindung zwischen Dänemark und <strong>de</strong>m Reich. Dem dänischen König blieb die<br />
Ausstattung <strong>de</strong>r dänischen Bistümer überlassen, die dänischen Bischöfe waren aber Suffragane <strong>de</strong>s Hamburger Erzbischofs und damit Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Reichskirche. Bald machten sich in<br />
<strong>de</strong>n skandinavischen Kirchen auch unter Einfluss <strong>de</strong>r englischen Kirche Bestrebungen bemerkbar, sich von <strong>de</strong>r Reichskirche <strong>zu</strong> lösen. Mit Zunahme <strong>de</strong>r Autorität <strong>de</strong>s Papsttums begannen<br />
die Lan<strong>de</strong>skirchen über die Reichsinstanzen hinweg unmittelbaren Kontakt mit <strong>de</strong>m Papst auf<strong>zu</strong>nehmen. Für die Kurie war allerdings für eine auch von ihr gewünschte Verselbständigung<br />
<strong>de</strong>r skandinavischen Kirchen unabdingbare Vorausset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Abschluss <strong>de</strong>r Missionierung. Als Indikatoren wur<strong>de</strong> dafür angesehen: Der Übertritt <strong>de</strong>s Herrscherhauses und <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n<br />
Schichten und <strong>de</strong>s überwiegen<strong>de</strong>n Teils <strong>de</strong>s Volkes <strong>zu</strong>m Christentum, außer<strong>de</strong>m eine wenigstens ansatzweise fest<strong>zu</strong>stellen<strong>de</strong> Institutionalisiserung kirchlichen Lebens durch Klöster und
eine Diözesan- und Pfarrorganisation und <strong>zu</strong>letzt die nationale Unabhängigkeit und Fixierbarkeit <strong>de</strong>s Territoriums.<br />
Auf Dänemark angewandt ergab sich folgen<strong>de</strong>s: Harald Blauzahn ließ sich um 965 mitsamt seinem hirð taufen. Entschei<strong>de</strong>nd dafür sei das Poppowun<strong>de</strong>r gewesen. Sven Gabelbart ließ<br />
englische Missionare kommen. Er holte Bischof Gotebald aus England und entsandte ihn nach Schonen. Auch <strong>de</strong>r dänische Klerus setzte sich mehr und mehr aus Einheimischen<br />
<strong>zu</strong>sammen. Die dänische Kirche begann sogar selbst <strong>zu</strong> missionieren. Propst Oddar, ein Verwandter Sven Gabelbarts, erlitt bei <strong>de</strong>r Missionierung <strong>de</strong>r Elbslaven 1018 <strong>de</strong>n Märtyrertod.<br />
Der Nachfolger Sven Gabelbarts Knut <strong>de</strong>r Große betrieb gegenüber <strong>de</strong>r englischen Kirche eine offene Allianzpolitik.[3] Diese Politik geht auf Erzbischof Lyfing von Canterbury <strong>zu</strong>rück,<br />
<strong>de</strong>r wahrscheinlich <strong>de</strong>n ersten Peterspfennig Knuts nach Rom brachte und <strong>de</strong>ssen Anerkennung als König erwirkte. Papst Benedikt VIII. schrieb <strong>zu</strong>m ersten Mal seit Papst Nikolaus I.<br />
einen Brief unmittelbar an einen Dänen. Die Bestrebungen, sich vom Hamburger Erzbistum <strong>zu</strong> lösen, kommen auch darin <strong>zu</strong>m Ausdruck, dass Erzbischof Aethelnod von Canterbury drei<br />
Bischöfe für Dänemark weihte: Gerbrand für Roskil<strong>de</strong>, Bernhard für Schonen und Reginbert für Fünen. Damit wur<strong>de</strong> Lund von Roskil<strong>de</strong> abgetrennt. Damit kam Knut in Konflikt mit <strong>de</strong>m<br />
Hamburger Erzbischof Unwan (1013–1029). Er fing um 1022 Gerbrand auf seiner Reise von England nach Dänemark ab und überzeugte ihn von <strong>de</strong>n Vorrechten <strong>de</strong>s Erzbistums Hamburg<br />
über Dänemark. Es gelang ihm in <strong>de</strong>r Folgezeit die Weiherechte für Dänemark <strong>zu</strong>r Geltung <strong>zu</strong> bringen und Erzbischof Libentius (Libizo, Liäwizo) von Hamburg weihte 1029 Avoco <strong>zu</strong>m<br />
Nachfolger Gerbrands in Roskil<strong>de</strong>. Knut führte auch <strong>de</strong>n Peterspfennig in Dänemark ein.<br />
Frühmittelalter<br />
Um 730 errichteten die Dänen <strong>zu</strong>m Schutz gegen die südlich sie<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Sachsen das Danewerk bei Haithabu in <strong>de</strong>r Nähe von Schleswig. Etwa um 800 entführte ein lokaler dänischer<br />
König die internationale Kaufmannschaft aus <strong>de</strong>m damals slawischen Ort Rerik (bei <strong>de</strong>r Insel Poel) und sie<strong>de</strong>lte sie statt<strong>de</strong>ssen in Haithabu an. Fast alle dänischen Dörfer stammen aus<br />
<strong>de</strong>r Wikingerzeit bzw. sind älter als 800 Jahre. Dörfer mit <strong>de</strong>m Suffix -heim, ing(e), lev, løse und sted gehören <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten. Sie sind bereits aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung bekannt.<br />
Suffixe mit torp und toft(e) sind vermutlich im 8. und 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt aus England nach Dänemark gelangt, die auf -by aus Schwe<strong>de</strong>n. Die Suffixe -rød, rud, tved, holt, skov, have und<br />
løkke stehen für Rodungen, die im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt erfolgten.<br />
Um 884 fielen die Dänen in England ein, besetzten einen Teil <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, und for<strong>de</strong>rten von <strong>de</strong>n englischen Königen Tribut in Form <strong>de</strong>s Danegelds. Im Jahre 924 hatte <strong>de</strong>r englische<br />
König Eduard <strong>de</strong>r Ältere das gesamte Danelag wie<strong>de</strong>r unter englische Kontrolle gebracht.<br />
In <strong>de</strong>n Jahrzehnten nach 900 stand Dänemark nicht unter einer einheitlichen Herrschaft, vielmehr gab es min<strong>de</strong>stens zwei, wenn nicht drei Machtzentren. Südjütland mit <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsstadt<br />
Haithabu war in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n schwedischer Erobererkönige, die durch Adam von Bremen und zwei <strong>de</strong>r Runensteine von Haithabu bekannt sind. Schwe<strong>de</strong>n saßen auf Lolland.[4] In Jelling<br />
südlichen Nördlichen Jütland hatte ein an<strong>de</strong>res Königsgeschlecht seinen Sitz, das nach Adam von Bremen um 900 aus Norwegen gekommen war. Unsicher ist, ob Håkon <strong>de</strong>r Gute<br />
Seeland und die schonische Küste unterwarf.[5] Die schwedische Herrschaft in Haithabu wur<strong>de</strong> 934 von Heinrich <strong>de</strong>m Vogler besiegt. König Knut I. musste sich taufen lassen. Damit<br />
en<strong>de</strong>ten die Wikingerzüge aus <strong>de</strong>r Ei<strong>de</strong>rmündung auf friesisches Gebiet bis 980. Die dänischen Wikinger scheinen sich statt<strong>de</strong>ssen nach Osten gewandt <strong>zu</strong> haben; <strong>de</strong>nn ein Runenstein aus<br />
dieser Zeit ehrt einen Krieger, <strong>de</strong>r in Schwe<strong>de</strong>n umgekommen war.[6] Nach <strong>de</strong>n Annalen von Corvey <strong>zu</strong>m Jahre 934 hatte sich Heinrich „die Dänen“ unterworfen. Wie weit damit Jütland<br />
eingeschlossen ist, ist nicht fest<strong>zu</strong>stellen.<br />
Überhaupt ist umstritten, was die Zeitgenossen unter Dänemark verstan<strong>de</strong>n haben. Die Nie<strong>de</strong>rschrift Alfreds <strong>de</strong>s Großen über die Fahrten Ottars und Wulfstans, das früheste Zeugnis<br />
da<strong>zu</strong>, bezeichnete als „Dänemark“ das heutige Südschwe<strong>de</strong>n einschließlich Schonen, die Inseln Falster, Lolland, Langeland und wahrscheinlich auch Seeland und die übrigen<br />
ostdänischen Inseln. Erst <strong>de</strong>r nordjütische Skivum-Stein aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Jelling-Steins rechnete auch Nordjütland <strong>zu</strong> Dänemark, möglicherweise eine Folge <strong>de</strong>r Einigung unter Harald<br />
Blauzahn. Unter diesem Gesichtspunkt wür<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Jellingstein berichtet, dass Harald Ostdänemark erobert habe.[7] Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite bezeichnet Gregor von Tours, dass ein<br />
„dänischer“ König Chlochilaich Anfang <strong>de</strong>s 6. Jahrhun<strong>de</strong>rts in Gallien eingefallen sei. [8] Wenn aber die Vermutung richtig ist, dass Chlochilaich <strong>de</strong>r Hygelac <strong>de</strong>s Beowulf-Lie<strong>de</strong>s ist,<br />
dann war er danach aus <strong>de</strong>m Stamm <strong>de</strong>r Geaten, die mit Gauten und Goten in Verbindung gebracht wur<strong>de</strong>n und irgendwo östlich von Jütland lokalisiert wer<strong>de</strong>n, was wie<strong>de</strong>r mit Ottars<br />
Beobachtungen im Einklang stün<strong>de</strong>.<br />
Dänemark wur<strong>de</strong> bereits vor 960 von Gorm (<strong>de</strong>m Alten) o<strong>de</strong>r seinem Sohn Harald Blauzahn erstmals geeint. Die Königsgewalt war allerdings noch nicht weit entwickelt, von einer<br />
„Regierung“ in heutigem Sinne kann noch nicht gesprochen wer<strong>de</strong>n. Das zeigen auch die regellosen Wikingerzüge bis in die Regierungszeit Sven Gabelbarts hinein, die teilweise sogar<br />
Gebiete unter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>s eigenen Königs betrafen. Bis weit in das 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n die Dänen als Wikinger bezeichnet, welche in ganz Europa Kolonien grün<strong>de</strong>ten und<br />
Han<strong>de</strong>l trieben, aber auch ganze Län<strong>de</strong>r und Landstriche plün<strong>de</strong>rten und Kriege führten. Um 1115 setzte <strong>de</strong>r dänische König Niels Knud Lavard als Grenzjarl in Südjütland ein. Aus <strong>de</strong>m
Jarltum entstand später das Herzogtum Schleswig als dänisches Lehen.<br />
Unter <strong>de</strong>r Herrschaft Knuts <strong>de</strong>s Großen erreichte Dänemark eine enorme territoriale Aus<strong>de</strong>hnung. So gehörten neben Dänemark auch Teile Schwe<strong>de</strong>ns, Norwegen und erneut England<br />
<strong>zu</strong>m Reich Knuts <strong>de</strong>s Großen. Nach ihm übernahm Magnus <strong>de</strong>r Gute von Norwegen die Herrschaft über Dänemark.<br />
Hochmittelalter<br />
Ab <strong>de</strong>r Zeit Knut <strong>de</strong>s Heiligen nimmt das dänische Königtum erheblich am Reichtum <strong>zu</strong>, was bei eingehen<strong>de</strong>r Betrachtung an enger Verbun<strong>de</strong>nheit mit <strong>de</strong>r Kirche liegt. Beispiel hierfür<br />
ist die Schenkungsurkun<strong>de</strong>, die für die Domkirche in Lund erlassen wird. Das Geld, welches <strong>de</strong>m Kirchenbau <strong>zu</strong>gedacht ist und größtenteils von Bußen für Landsfrie<strong>de</strong>nbruch und Bruch<br />
<strong>de</strong>r Ledingspflicht stammt, ist auch <strong>zu</strong>m Teil <strong>de</strong>m König versprochen. Knut <strong>de</strong>s Heiligen Versuche, die königliche Gewalt <strong>zu</strong> vergrößern und <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>s dänischen Königtums <strong>zu</strong><br />
stählen wer<strong>de</strong>n mancherorts vom Volk missbilligt. So wird er in <strong>de</strong>r Sankt Albans-Kirche <strong>zu</strong> O<strong>de</strong>nse von Aufständischen erschlagen. Später sollte er kanonisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Königtum und Kirche betreiben weiter gemeinsame Wachstumspläne, da bei<strong>de</strong> Parteien das Errichten einer zentralen Macht anstreben. 1104 wird ein Bistum ergrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r gesamte<br />
Nor<strong>de</strong>n unterliegt. Im selben Jahr wird eine Umwan<strong>de</strong>lung <strong>de</strong>r Hofämter unter König Niels eingeführt, die <strong>de</strong>n Inhabern einst kleinerer Rollen <strong>de</strong>s königlichen Hofs mehr Macht und<br />
Verantwortung <strong>zu</strong>räumt. Mundschenke wer<strong>de</strong>n beispielsweise <strong>zu</strong> Drosten beför<strong>de</strong>rt und verwalten Reichsangelegenheiten, Marschälle befin<strong>de</strong>n sich <strong>zu</strong>nehmend mit <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s<br />
Militärs beschäftigt. Die Zunahme <strong>de</strong>r Inhaber königlicher Ämter ist in dieser Zeit beträchtlich groß. Wer Treue zeigt, kann oft auf einen königlichen Titel hoffen. Aufstän<strong>de</strong> gegen die<br />
wachsen<strong>de</strong> Macht wer<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> von König und Kirche ausgelöscht, die ja gemeinsame Interessen haben. In <strong>de</strong>n späten Jahren von Niels Herrschaft wird eine Bewegung unternommen,<br />
<strong>de</strong>n Zölibat mit Gewalt durch<strong>zu</strong>setzen. Aus <strong>de</strong>m Konflikt geht eine gesetzliche Beson<strong>de</strong>rheit hervor: <strong>de</strong>r Kirche hat man das privilegium fori gewährt, also Unabhängigkeit von<br />
Thinggerichten.<br />
Als Knud Lavard, Herzog Südjütlands die Wen<strong>de</strong>nstämme im Westen als Reichslehen bekommt, wur<strong>de</strong> er als Anwärter auf <strong>de</strong>n dänischen Thron angesehen, und somit <strong>zu</strong>m Konkurrenten<br />
von Prinz Magnus. Bei einer Zusammenkunft <strong>de</strong>r Kontrahenten bei Ringstedt wird Knud Lavard am 7. Januar 1131 ermor<strong>de</strong>t. Infolge<strong>de</strong>ssen nimmt sein Halbbru<strong>de</strong>r Erik II. <strong>de</strong>n Kampf<br />
gegen Magnus auf. Dies glückt ihm dank <strong>de</strong>r erhaltenen Hilfe <strong>de</strong>r seeländischen A<strong>de</strong>ligen <strong>de</strong>r Hvi<strong>de</strong>. 1134 fin<strong>de</strong>t die Schlacht von Fotevig in Schonen statt, in welcher Prinz Magnus und<br />
fünf Bischöfe fallen. König Niels überlebt das Gefecht, um jedoch kurz danach in Schleswig von Gil<strong>de</strong>brü<strong>de</strong>rn erschlagen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n.<br />
Noch 1134 wird Erik II. <strong>zu</strong>m König gekrönt. Während seiner Herrschaft widmet Erik viel Mühe <strong>de</strong>r Heiligsprechung seines ermor<strong>de</strong>ten Bru<strong>de</strong>rs. Der Erzbischof von Lund, Asker, scheint<br />
<strong>de</strong>m Wunsch nachkommen <strong>zu</strong> wollen, allerdings ist sein Nachfolger Eskil diesem Anliegen nicht so wohlgesinnt. Aufflammen<strong>de</strong> Bürgerkriege lenken ebenfalls von diesem Vorhaben ab.<br />
Um 1157 unterliegen Wal<strong>de</strong>mar, <strong>de</strong>m Sohn Knud Lavards, alle Gegner im Thronfolgestreit. Als Alleinherrscher erhält König Wal<strong>de</strong>mar I. die päpstliche Aufmerksamkeit und Gunst, die<br />
nötig ist, um Knud Lavard heiligsprechen <strong>zu</strong> lassen. In einer Doppelueremonie im Jahr 1170 wird <strong>de</strong>r längst ermor<strong>de</strong>te Herzog kanonisiert und Wal<strong>de</strong>mars siebenjähriger Sohn, Knut VI.,<br />
von Erzbischof Eskil <strong>zu</strong>m König gekrönt. Hernach wird das Verhältnis zwischen Erzbischof und König oft zwieträchtig. Bei<strong>de</strong> Parteien stehen sich im Laufe folgen<strong>de</strong>r Jahreeinan<strong>de</strong>r<br />
mehrmals gegenüber. König Wal<strong>de</strong>mar leistet <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Kaiser Friedrich Barbarossa 1162 die Lehnshuldigung und verspricht diesem somit seine Treue. Angesichts heftiger<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>m dänischen König geht Erzbischof Eskil 1177 ins Exil, worauf Bischof Absalon, ein Mitglied <strong>de</strong>s Hvi<strong>de</strong>-Geschlechts, <strong>de</strong>ssen führen<strong>de</strong> geistliche Position<br />
übernimmt. Während dieser Zeit genießt König Wal<strong>de</strong>mar gute Verhältnisse <strong>zu</strong>m Papst Alexan<strong>de</strong>r III. In Betracht <strong>de</strong>r päpstlichen Gunst versöhnt sich Erzbischof Eskil mit <strong>de</strong>m König und<br />
kehrt nach einigen Jahren <strong>zu</strong>rück. Zusammen ordnen König und Kirche die Verzierung dänischer Kirchen und die Errichtung vieler Klöster an. Der Zisterzienseror<strong>de</strong>n erhält beson<strong>de</strong>re<br />
Zuneigung und genießt bald viele Sitze und Einfluss im Land.<br />
Infolge etlicher dänischer Kreuz<strong>zu</strong>gsunterfangen gegen die Wen<strong>de</strong>n wird 1168 das slawische Kulturzentrum Arkona auf Rügen erobert. Dies wird auch von <strong>de</strong>n Dänen als größter<br />
Vergeltungsschlag gegen viele Jahre slawischer Piratenzüge und Plün<strong>de</strong>rungen angesehen. Der Siegesrausch dient als einen<strong>de</strong>s Gemeinsamkeitsgefühl unter <strong>de</strong>m vom Bürgerkrieg<br />
zerrissenen Volk. Als Rügen in das Bistum Roskil<strong>de</strong> eingeführt wird, entstehen erhebliche Aufstän<strong>de</strong> gegen die dänische Herrschaft vonseiten <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n darauffolgen<strong>de</strong>n<br />
Kriegen erlangt Dänemark Besitz von Estland. 1219 ereignet sich die Schlacht von Lydanisse, welche die göttliche Zuneigung gegenüber Dänemarks belegen soll. Auf die Gebete <strong>de</strong>s<br />
Erzbischofs Andreas Sunesen soll Gott gehört und <strong>de</strong>n Dänen <strong>de</strong>n Sieg geschenkt haben. Durch dieses sagenumwobene Ereignis ist das Vertrauen <strong>de</strong>s Volkes gegenüber König und einer<br />
starken Kirche nur noch mehr gewachsen.<br />
Während <strong>de</strong>r frühen Jahre <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts folgen weitere militärische Errungenschaften für Dänemark. Die Grafschaft Holstein, einst unter Herrschaft <strong>de</strong>r Schauenburger, wird von
Dänemark 1200/1201 erobert. 1202 wird ebenfalls Lübeck unter dänische Kontrolle gebracht, behält allerdings sehr viel Eigenständigkeit in vielen geschäftlichen und politischen<br />
Bereichen. Diese Selbstständigkeit befin<strong>de</strong>t sich später, nach Lübecks Vorbild, in vielen Verfassungen späterer dänischer Städte.<br />
Wal<strong>de</strong>marzeit<br />
Nach gewaltsamen und erfolgreichen Siegen über das aufständische Volk, welches gegen das zentralistisch veranlagte, großmächtige Königtum und eine ebenfalls zentralisierte, gewaltige<br />
Kirche gefochten hatte, ge<strong>de</strong>iht das Wal<strong>de</strong>margeschlecht. Eine Wal<strong>de</strong>mar-Dynastie entsteht, <strong>de</strong>ren Macht und Einfluss sich mit <strong>de</strong>r Gunst Gottes Willens gerechtfertigen. Diese Zeit, die<br />
"Val<strong>de</strong>marernes Storhedstid" (Großmachtzeit <strong>de</strong>r Wal<strong>de</strong>mardynastie) bezieht sich auf die frühen Jahre <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts, in welchen Dänemark eine führen<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lsmacht ist und im<br />
eigenen Land viel Wachstum <strong>de</strong>r Landwirtschaft genießt. Eine neue dänische A<strong>de</strong>lsschicht tritt hierbei auch <strong>zu</strong>tage, die Steuerfreiheit genießt, sich dafür jedoch unausweichlich <strong>zu</strong>m<br />
Kriegsdienst verpflichtet und militärisch völlig befasst ist. Holzbauten verschwin<strong>de</strong>n und wer<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>meist durch Stein ersetzt, Kirchen nehmen romanische Stile an. Eine Großzahl junger<br />
Dänen besucht in dieser Zeit wohl angesehene Universitäten mittelalterlichen Europas. Ein Drang nach Bildung und Gelehrtheit flammt auf, in <strong>de</strong>m Erzbischof Andreas Sunesen <strong>de</strong>m<br />
Volk Mut <strong>zu</strong>spricht, Latein ohne klassische Texte <strong>zu</strong> lernen.<br />
1202 wird Wal<strong>de</strong>mar II., jüngerer Sohn von Wal<strong>de</strong>mar I., <strong>zu</strong>m König gekrönt, was die Wal<strong>de</strong>mar-Dynastie festigt. Dann allerdings wird 1223 Wal<strong>de</strong>mar II. mit seinem Sohn Wal<strong>de</strong>mar<br />
während <strong>de</strong>r Jagd durch <strong>de</strong>n Grafen von Schwerin gefangen und erst 1225 nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Mölln und Zahlung eines hohen Lösegelds freigelassen. Infolge <strong>de</strong>ssen büßt Dänemark<br />
seine nord<strong>de</strong>utschen Territorien ein und gewinnt sie auch nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r Schlacht von Bornhöved im Jahr 1227 nicht wie<strong>de</strong>r.<br />
Reichsauflösung, Spätmittelalter<br />
Die Nie<strong>de</strong>rlage von Bornhöved schlägt Expansionsgedanken aus <strong>de</strong>m Kopf Wal<strong>de</strong>mars II. Statt Reichserweiterung betreibt er nun die Sicherung seiner herrschaftlichen Macht. Dies tut er,<br />
in<strong>de</strong>m er Abkommen mit politischen Gegnern trifft. Reval wird in das Erzbistum von Lund eingeglie<strong>de</strong>rt. 1232 wird Erik IV. Mitkönig, nach<strong>de</strong>m sein älterer Bru<strong>de</strong>r Wal<strong>de</strong>mar stirbt.<br />
Frie<strong>de</strong>n soll in dieser Zeit zwischen Schleswig und Holstein geschmie<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m sich Herzog Abel mit <strong>de</strong>r schauenburgischen Grafentochter Mechthild von Holstein verehelicht.<br />
1231 erscheint das "Landbuch <strong>de</strong>s Königs Wal<strong>de</strong>mar". Das Werk, welches dienlich bei Steuererhebungen sein soll, dauert Jahrzehnte vollen<strong>de</strong>t <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n und gewährt heute viel Einblick<br />
in das Finanz- und Steuersystem <strong>de</strong>s Mittelalters.<br />
Die Reichseinigkeit, die unter Wal<strong>de</strong>mar I. (Dänemark) entstan<strong>de</strong>n ist, währt aber nicht ewig. Vor seinem Tod hat Wal<strong>de</strong>mar II. Grenzprovinzen seinen Söhnen überlassen. Abel wird<br />
Herzog von Südjütland, Christoph wird Herzog von Lolland-Falster und zwei außerhalb <strong>de</strong>r Ehe erzeugte Söhne, Niels und Knut, bekommen Halland und Blekinge. Obwohl jene Lehen<br />
gar nicht als erblicher Besitz vorgesehen sind, sorgen sie für Unruhe hinsichtlich <strong>de</strong>r Reichseinheit. Verschie<strong>de</strong>nheiten führen <strong>zu</strong> Zwist und Ha<strong>de</strong>r. König Erik IV. (Erik Plovpenning) sieht<br />
sich in vielen Angelegenheiten seinen Brü<strong>de</strong>rn gegenübergestellt, am öftesten Herzog Abel. Die Kirche bleibt von folgen<strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen nicht verschont und droht sogar mit<br />
Bann. Als Erik IV. Steuerabgaben für je<strong>de</strong>n im Einsatz befindlichen Pflug Dänemarks for<strong>de</strong>rt, entflammen Unruhen und Aufstän<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>m Volk. Der König ist gezwungen <strong>zu</strong> fliehen.<br />
Nach Angriffen von Seiten Herzog Abels zieht Erik IV. nach Schleswig, um <strong>de</strong>n Herzog im Gefecht <strong>zu</strong> bezwingen. Obwohl <strong>de</strong>r König obsiegt, wird er hinterhältig an <strong>de</strong>r Schlei<br />
gemeuchelt, möglicherweise auf Geheiß <strong>de</strong>s schlesischen Herzogs.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Eriks IV. lässt sich Herzog Abel auf einem Thing <strong>zu</strong> Viborg <strong>zu</strong>m König ernennen und wird daraufhin gekrönt. Während seiner nicht all<strong>zu</strong> langen Herrschaft gewährt er<br />
dänischen Han<strong>de</strong>lsleuten, aber vor allem ausländischen Kaufleuten, viele Privilegien. Diese han<strong>de</strong>lsfreundliche Politik erweist sich als kritisch in <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Machtbekämpfung<br />
gegen die stets wachsen<strong>de</strong> <strong>de</strong>utsche Hanse. Um das Land noch mehr <strong>zu</strong> zentralisieren und somit "verwaltbarer" <strong>zu</strong> machen, wird die "Abel-Christoffersche Verordnung" erlassen, die<br />
Christoph I. die Pflicht <strong>de</strong>r Weiterführung <strong>de</strong>s Reichs <strong>zu</strong>spricht. Aufgrund von drei Kriegen an drei Fronten fällt ihm diese Aufgabe schwer. Als Abel stirbt und sein ältester Sohn sich in<br />
Gefangenschaft <strong>de</strong>s Erzbischofs von Köln befin<strong>de</strong>t, wird Christoph <strong>zu</strong>m König erhoben. Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n drohen das Reich an<strong>zu</strong>greifen, während Abels Witwe Mechthild von<br />
Holstein sich darum bemüht, ihren Söhnen die Krone <strong>zu</strong> sichern. Den Nor<strong>de</strong>n beschwichtigt Christoph I. mit Scha<strong>de</strong>nersatz. Nur mit Nachkommen a<strong>de</strong>liger Bestrebungen nach Macht<br />
kann <strong>de</strong>r König ermöglichen, dass <strong>de</strong>r königliche Hof das Obergericht <strong>de</strong>s dänischen Reichs wird. Streit entbrannt zwischen Kirche und König, als Erzbischof Jakob Erlandsen versucht,<br />
alle dänischen und weltlichen Untergebenen <strong>de</strong>r Kirche unter Kirchenjurisdiktion <strong>zu</strong> bringen. Als <strong>de</strong>r König <strong>de</strong>m entgegenschreitet, bleibt <strong>de</strong>r Erzbischof 1252 <strong>de</strong>m Hof fern. In Vejle<br />
wird während einer Kirchenversammlung entschlossen, alle Gottesdienste <strong>zu</strong> unterlassen, sollten Bischöfe in königliche Haft genommen wer<strong>de</strong>n.
Kalmarer Union<br />
1397 wur<strong>de</strong> die Kalmarer Union unter Fe<strong>de</strong>rführung <strong>de</strong>r dänischen Königin Margrete I. gegrün<strong>de</strong>t. 1460 entstand die Personalunion mit Schleswig und Holstein. 1482 druckt Johann Snell<br />
in O<strong>de</strong>nse das erste Buch Dänemarks; 1495 erschien, gedruckt in <strong>de</strong>r Offizin Gottfried von Ghemens in Kopenhagen, das erste Buch in dänischer Sprache. 1500 besiegten die<br />
Dithmarscher unter Wulf Isebrand in <strong>de</strong>r Schlacht bei Hemmingstedt das dänisch-schleswig-holsteinische Heer unter König Johann, in Personalunion König von Dänemark, Norwegen<br />
und Schwe<strong>de</strong>n und Herzog in <strong>de</strong>n königlichen Anteilen Schleswigs und Holsteins, und seinem Bru<strong>de</strong>r Friedrich, Herzog in <strong>de</strong>n gottorfschen Anteilen Schleswigs und Holsteins. Die<br />
Bauern konnten das vor allem aus einer im Marschenkrieg spezialisierten Infanterietruppe, <strong>de</strong>r aus Landsknechten <strong>zu</strong>sammengesetzten „Schwarzen Gar<strong>de</strong>“, sowie einigen adligen<br />
Reitereinheiten bestehen<strong>de</strong>, aber schlecht geführte Heer überraschend vernichten. Der nächste, gründlich vorbereitete Einmarsch dänisch-schleswig-holsteinischer Truppen unter <strong>de</strong>m<br />
Feldherrn Johann Rantzau, die so genannte Letzte Feh<strong>de</strong>, konnte dann allerdings 1559 von <strong>de</strong>n Dithmarschern nicht mehr aufgehalten wer<strong>de</strong>n. 1523 schied Schwe<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Wahl eines<br />
eigenen Königs (Gustav I. Wasa) endgültig aus <strong>de</strong>r Kalmarer Union aus, wodurch ein langandauern<strong>de</strong>r Konflikt um die politische Führung im Ostseeraum ausgelöst wur<strong>de</strong>.<br />
Neuzeit bis <strong>zu</strong>m Wiener Kongress<br />
1537 wur<strong>de</strong> die Reformation durchgeführt. 1620 erwarb Dänemark die Jungferninseln als Kolonie (Dänisch-Westindien). Im Dreißigjährigen Krieg unterlag Christian IV. im Jahr 1626<br />
<strong>de</strong>n kaiserlichen Truppen unter Tilly. Von 1563 bis 1720 führte Dänemark verschie<strong>de</strong>ne Kriege mit Schwe<strong>de</strong>n um die Vorherrschaft im Ostseeraum. Im Zuge dieser Kriege verlor<br />
Dänemark mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> 1658 Schonen, Blekinge und Halland (Skåneland, <strong>de</strong>n südlichsten Teil <strong>de</strong>s heutigen Schwe<strong>de</strong>ns). Nur knapp konnte Hans von Schack<br />
Kopenhagen, das von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n belagert wur<strong>de</strong>, vor <strong>de</strong>r Eroberung und Dänemark davor bewahren, <strong>zu</strong> einer schwedischen Provinz <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n. Zwischen 1720 und 1807 wur<strong>de</strong> die<br />
Schollengebun<strong>de</strong>nheit <strong>de</strong>r Bauern aufgehoben.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>r Empirezeit blieb Dänemark neutral, sowohl gegenüber Frankreich als auch gegenüber Großbritannien. Trotz (o<strong>de</strong>r wegen) dieser bewaffneten Neutralität verweigerte das<br />
Land die Durchfahrt britischer Schiffe in die Ostsee. Darauf reagierte 1801 die britischer Flotte mit <strong>de</strong>m aggressiven Angriff auf Kopenhagen. Als nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Tilsit<br />
Großbritannien einen Bündnisabschluss for<strong>de</strong>rte und Dänemark zögerte, dieses Ultimatum <strong>zu</strong> akzeptieren, griff es 1807 erneut Kopenhagen an, nahm die Stadt nach dreitägigem Beschuss<br />
am 5. September ein, wobei die Briten prächtige Teile <strong>de</strong>r Altstadt zerstörten und die dänische Flotte raubten. „Es war <strong>de</strong>r härteste Schlag, <strong>de</strong>r Dänemark seit <strong>de</strong>n schwedischen<br />
Eroberungen vor hun<strong>de</strong>rtfünfzig Jahren traf“ (Kjeersgaard, Geschichte 54). Der darauf folgen<strong>de</strong> Seekrieg mit Großbritannien bis 1810 bewog Dänemark, Napoléon Bonaparte <strong>zu</strong><br />
unterstützten. Dies hatte jedoch <strong>zu</strong>r Folge, dass auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress und im Frie<strong>de</strong>n von Kiel beschlossen wur<strong>de</strong>, dass Dänemark Norwegen an Schwe<strong>de</strong>n ab<strong>zu</strong>treten habe, dies war<br />
das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r dänisch-norwegischen Personalunion. Grönland, Island, die Färöer und Dänisch-Westindien verblieben jedoch bei Dänemark. [9]<br />
Nationalismus und Liberalismus<br />
Die Dänische Nationalbewegung und die Liberalen begannen in <strong>de</strong>n 1830er Jahren, an Macht <strong>zu</strong> gewinnen, und nach <strong>de</strong>n europäischen Revolutionen um 1848 (vgl. Märzrevolution)<br />
etablierte sich Dänemark 1840 <strong>zu</strong> einer konstitutionellen Monarchie unter <strong>de</strong>r Linie Glücksburg <strong>de</strong>s Hauses Ol<strong>de</strong>nburg: Das heute noch gelten<strong>de</strong> Grundgesetz Dänemarks tritt in Kraft.<br />
Eine wichtige Rolle spielt in dieser Zeit <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> dänische Theologe, Pädagoge, Dichter und Politiker N.F.S. Grundtvig.<br />
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Schleswigschen Krieg 1864 war Dänemark gezwungen, Schleswig an Preußen und Holstein an Österreich-Ungarn ab<strong>zu</strong>treten. Hieran erinnert heute noch die nationale<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätte bei <strong>de</strong>n Düppeler Schanzen, wo je<strong>de</strong>s Jahr am 18. April <strong>de</strong>r Jahrestag <strong>de</strong>r verlorenen Entscheidungsschlacht begangen wird.<br />
Diese Nie<strong>de</strong>rlage bewirkte tiefe Einschnitte in <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r nationalen I<strong>de</strong>ntität Dänemarks, die Innenpolitik erfuhr einen Linksruck, die Außenpolitik <strong>de</strong>r Nation nahm einen<br />
strikten Neutralitätskurs an und behielt diesen bis nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg bei.<br />
1871 formierte sich unter Louis Pio die dänische Arbeiterbewegung. Die Gründung <strong>de</strong>r dänischen Sozial<strong>de</strong>mokraten erfolgte im selben Jahr. 1898 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gewerkschaftsbund<br />
Landsorganisationen i Danmark gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Erster Weltkrieg<br />
Im Ersten Weltkrieg blieb Dänemark neutral. 1917 verkaufte es Dänisch-Westindien an die USA. 1920 fiel nach einer Volksabstimmung im nördlichen und mittleren Teil Schleswigs (dän.
auch Søn<strong>de</strong>rjylland / Südjütland) <strong>de</strong>ssen nördlicher Teil - Nordschleswig - an Dänemark. Der mittlere und südliche Teil - Südschleswig - blieb bei Deutschland. Die so gezogene Grenze<br />
bil<strong>de</strong>t noch heute <strong>de</strong>n Grenzverlauf. Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Vereinigung mit Nordschleswig, das 56 Jahre lang durch preußische bzw. <strong>de</strong>utsche Verwaltung geprägt war, wur<strong>de</strong>n im<br />
südlichen (<strong>de</strong>utschen) und nördlichen (dänischen) Teil Schleswigs die Rechte <strong>de</strong>r jeweiligen Minoritäten beson<strong>de</strong>rs gestärkt. Die Rechte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit in Nordschleswig und<br />
<strong>de</strong>r dänischen Min<strong>de</strong>rheit in Schleswig-Holstein sind auch politisch von beson<strong>de</strong>rer Be<strong>de</strong>utung.<br />
Zweiter Weltkrieg<br />
Unter Missachtung seiner Neutralität und ohne Kriegserklärung wur<strong>de</strong> Dänemark im Rahmen <strong>de</strong>r Operation Weserübung ab <strong>de</strong>m 9. April 1940 von <strong>de</strong>r Wehrmacht <strong>de</strong>s Deutschen Reiches<br />
besetzt. Es blieb bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs unter <strong>de</strong>utscher Kontrolle. Deutschland respektierte formell die dänische Souveränitat und Neutralität. Deshalb blieben im Gegensatz <strong>zu</strong><br />
an<strong>de</strong>ren besetzten Län<strong>de</strong>rn sowohl das Staatsoberhaupt, König Christian X., wie auch die dänische Regierung im Lan<strong>de</strong>. Mit einer Zusammenarbeits- und Verhandlungspolitik versuchte<br />
die dänische Regierung von Stauding mit <strong>de</strong>m Außenminister Scavenius die Privilegien eines souveränen Staates <strong>zu</strong> erhalten. Nazi-Deutschland verzichtete darauf, an<strong>de</strong>rs als etwa<br />
gegenüber Belgien und Frankreich, die 1919/20 abgetretenen Reichsgebiete wie<strong>de</strong>ran<strong>zu</strong>glie<strong>de</strong>rn, Nordschleswig blieb dänisch. En<strong>de</strong> 1941 trat Dänemark sogar <strong>de</strong>m faschistischen<br />
Antikominternpakt bei.<br />
Nach <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Deutschen verlorenen Schlachten in Stalingrad und El Alamein En<strong>de</strong> 1942/Anfang 1943 stiegen <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand und damit auch Sabotageaktionen in Dänemark stark.<br />
Die Wahlen im März 1943, die Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit über die <strong>de</strong>utsche Besat<strong>zu</strong>ng und auch <strong>de</strong>r Eindruck, dass Deutschland <strong>de</strong>n Krieg nicht gewinnen kann, führten <strong>zu</strong> großen zivilen Unruhen<br />
und Streiks im Lan<strong>de</strong>. Die <strong>de</strong>utsche Besat<strong>zu</strong>ngsmacht verlangte, die To<strong>de</strong>sstrafe ein<strong>zu</strong>führen und <strong>de</strong>n Ausnahme<strong>zu</strong>stand <strong>zu</strong> erklären, was von <strong>de</strong>r Regierung abgelehnt wur<strong>de</strong>. Die<br />
Regierung rief statt<strong>de</strong>ssen alle Beamten <strong>zu</strong>r „Nicht<strong>zu</strong>sammenarbeit“ auf. Dies führte am 29. August 1943 <strong>zu</strong>r Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r dänischen Regierung. Die Verwaltung wur<strong>de</strong> jetzt von <strong>de</strong>n<br />
Abteilungsleitern <strong>de</strong>r Ministerien übernommen. Die Verhandlungen mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Reichsbevollmächtigen Werner Best führte nun ab <strong>de</strong>m Zeitpunkt <strong>de</strong>r Leiter <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s<br />
Außenministeriums Niels Svenningsen. Das dänische Heer wur<strong>de</strong> durch die Besat<strong>zu</strong>ngsmacht aufgelöst, die Flotte versenkte sich selbst.<br />
Im Oktober 1943 kam es <strong>zu</strong>r Rettung <strong>de</strong>r dänischen Ju<strong>de</strong>n: Von 7500 Ju<strong>de</strong>n konnten 7300 über <strong>de</strong>n Öresund nach Schwe<strong>de</strong>n gebracht wer<strong>de</strong>n. Der Preis für die Überfahrt betrug 2000<br />
Kronen pro Kopf. Arme Flüchtlinge wur<strong>de</strong>n kostenlos beför<strong>de</strong>rt[10]. Auch waren Werner Best, <strong>de</strong>r Statthalter <strong>de</strong>r Deutschen, und <strong>de</strong>r Schifffahrtssachverständige <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Botschaft,<br />
Georg Ferdinand Duckwitz, sehr gut über die Rettung informiert; sie hatten dänische Politiker vor <strong>de</strong>r geplanten <strong>de</strong>utschen Aktion gegen die dänischen Ju<strong>de</strong>n gewarnt; so ermöglichten sie<br />
die Rettungsaktion.<br />
Nach einem falschen Luftalarm in <strong>de</strong>n großen Städten am 19. September 1944 wur<strong>de</strong>n die Polizei und Grenztruppen entwaffnet und aufgelöst; Polizisten wur<strong>de</strong>n inhaftiert und einige in<br />
Konzentrationslager geschickt. 1960 dänische Polizisten wur<strong>de</strong>n als Repressionsmaßnahme in das KZ Neuengamme <strong>de</strong>portiert, weil die Regierung nicht die gefor<strong>de</strong>rten Maßnahmen<br />
durch die Polizei gegen die dänische Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung sicherstellen wollte. Später kamen sie in das Gefangenenlager Mühlberg[11].<br />
Die große Mehrheit <strong>de</strong>r Dänen sympathisierte im Zweiten Weltkrieg mit <strong>de</strong>r Sache <strong>de</strong>r Alliierten, stützte aber an<strong>de</strong>rerseits die eigene Regierung im Bemühen um eine <strong>de</strong>fensive<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Besatzern, die von manchen Historikern aber auch als Kollaboration charakterisiert wur<strong>de</strong>. Die Sympathien für die nationalsozialistische<br />
Weltanschauung und die <strong>de</strong>utschen Kriegsziele <strong>de</strong>r Neuordnung Europas waren in Dänemark ausgesprochen gering, <strong>de</strong>r dänische NSDAP-Ableger DNSAP erreichte bei <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n<br />
Nationalsozialisten gedul<strong>de</strong>ten, <strong>de</strong>mokratischen Parlamentswahlen im März 1943 nur einen Stimmanteil von 2,1 %. Insbeson<strong>de</strong>re nach <strong>de</strong>m Überfall auf die Sowjetunion stellten sich<br />
etwa 7.000 Dänen (etwa 1.000 davon Angehörige <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit) <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kriegsmaschinerie <strong>zu</strong>r Verfügung. Sie traten als Freiwillige <strong>de</strong>r Waffen-SS bei und kämpften<br />
<strong>zu</strong>m Teil bis Kriegsen<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>utscher Seite.<br />
1944 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung <strong>de</strong>s seit 1940 von britischen, später us-amerikanischen Truppen besetzten Island, das seit 1918 in Personalunion mit Dänemark verbun<strong>de</strong>n<br />
gewesen war. Die Färöer-Inseln, die auch <strong>zu</strong> Dänemark gehörten, wur<strong>de</strong>n ebenso 1940 von britischen Truppen besetzt und stan<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs unter<br />
Selbstverwaltung.<br />
Am 4. Mai 1945 kapitulierten die <strong>de</strong>utschen Truppen in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n, in Nordwest<strong>de</strong>utschland und Dänemark vor <strong>de</strong>n britischen Truppen, so dass am 5. Mai 1945 Dänemark von <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>utschen Besat<strong>zu</strong>ng befreit war. Dies galt auch für die Häftlinge <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen KZ in Dänemark in Frøslev (offiziell „Polizeigefangenenlager Fröslee“). Bornholm wur<strong>de</strong> nach heftigen<br />
Bombardierungen <strong>de</strong>r Städte Rønne und Neksø am 7. und 8. Mai 1945 einige Tage später von <strong>de</strong>r Sowjetarmee besetzt; die <strong>de</strong>utsche Inselgarnison kapitulierte erst am 11. Mai 1945. Die
Sowjets räumten die Insel erst wie<strong>de</strong>r am 5. April 1946.<br />
Nachkriegszeit<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg war Dänemark 1949 Gründungsmitglied <strong>de</strong>r NATO und wur<strong>de</strong> am 1. Januar 1973 nach einer Volksabstimmung Mitglied <strong>de</strong>r Europäischen Gemeinschaft. Seit <strong>de</strong>m 1.<br />
Mai 1979 besitzt Grönland die Selbstverwaltung. 1989 führte Dänemark als erstes Land <strong>de</strong>r Welt zivilrechtliche Partnerschaften für Homosexuelle ein. 1998 wur<strong>de</strong> die Brücke über <strong>de</strong>n<br />
Großen Belt eröffnet, im Jahr 2000 erfolgte die Einweihung <strong>de</strong>r Öresundbrücke, welche die bei<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Öresund getrennten Wirtschaftszentren Dänemarks (Kopenhagen) und<br />
Schwe<strong>de</strong>ns (Malmö) verbin<strong>de</strong>t.<br />
Zeittafel<br />
• Um 200–500 rücken Skandinavier aus Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n Richtung Sü<strong>de</strong>n und Südwesten nach Jütland vor.<br />
• Um 400–500 kommen Jüten <strong>zu</strong>sammen mit Sachsen, Angeln und Friesen über die Nordsee nach Britannien in das Gebiet <strong>de</strong>s nördlichen England.<br />
• Um 600 ist die kimbrische Halbinsel bis <strong>zu</strong>r Ei<strong>de</strong>r vorwiegend dänisch besie<strong>de</strong>lt.<br />
• Um 800 beginnt die so genannte Wikingerzeit. Einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Orte <strong>de</strong>r dänischen Wikinger ist Haithabu, gegrün<strong>de</strong>t 808.<br />
• 865 erobert ein dänisches Wikingerheer Teile von East Anglia.<br />
• 876 verteilt <strong>de</strong>r dänische Wikingerheerführer Halfdan Land in Northumbria an seine Leute <strong>zu</strong>r Besiedlung.<br />
• 877 sie<strong>de</strong>ln die Dänen auch im Königreich Mercia.<br />
• 879 Ostanglien wird dänisch besie<strong>de</strong>lt. Der Nordosten Englands ist nun stark von dänischer Besiedlung geprägt, es gilt dänisches Recht (Danelag).<br />
• 936 Jelling in Jütland wird Königssitz.<br />
• 960 <strong>de</strong>r Dänische König Harald Blauzahn lässt sich laut Legen<strong>de</strong> am Poppostein in Südjütland taufen. Die Dänen wer<strong>de</strong>n Christen.<br />
• 1000 Sven Gabelbart schlägt Olaf I. Trygvasson. Teile Norwegens wer<strong>de</strong>n dänisch.<br />
• 1016 wird <strong>de</strong>r dänische König Knut <strong>de</strong>r Große König von England.<br />
• 1076 berichtet Adam von Bremen ausführlich über die Dänen.<br />
• 1168 Eroberung von Rügen und Christianisierung <strong>de</strong>r Ranen unter Absalon von Lund<br />
• Um 1200 zeichnet Saxo Grammaticus die Geschichte <strong>de</strong>r Dänen auf.<br />
• 1201 Dänemark besetzt Lübeck.<br />
• 1227 Schlacht von Bornhöved.<br />
• Ab 1350 rafft die Pest große Teile <strong>de</strong>r dänischen Bevölkerung dahin.<br />
• Erster Hanse-Dänemark-Krieg been<strong>de</strong>t durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Vordingborg (1365).<br />
• 1367 Kölner Konfö<strong>de</strong>ration <strong>de</strong>r Hansestädte gegen Dänemark<br />
• 1370 Frie<strong>de</strong>n von Stralsund<br />
• 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Sü<strong>de</strong>n Südjütlands (Schleswig) zwischen Ei<strong>de</strong>r und Schlei wird <strong>zu</strong>nehmend sächsisch besie<strong>de</strong>lt.<br />
• 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt Kopenhagen und Seeland wer<strong>de</strong>n immer be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r.<br />
• 1429 Einführung <strong>de</strong>s Sundzoll<br />
• 1460 Vertrag von Ripen<br />
• 1512 Frie<strong>de</strong> von Malmö<br />
• 1523 En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kalmarer Union<br />
• 1534 Grafenfeh<strong>de</strong>
• 1536 Reformation in Dänemark. Die Dänen wer<strong>de</strong>n evangelisch-lutherisch.<br />
• 1570 Frie<strong>de</strong>n von Stettin<br />
• 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt Zu Dänemark zählen <strong>zu</strong> dieser Zeit Schonen, Halland und Blekinge. Südjütland bzw. das Schleswig war als dänisches Lehen ein eigenes Herzogtum und noch<br />
größtenteils dänischsprachig. Regiert wur<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>n genannten Regionen weiter Norwegen Gotland, Ösel und Holstein. Dänische Adlige und dänische Verwaltung prägen<br />
diese Län<strong>de</strong>r, Dänen sie<strong>de</strong>ln sich an und vermischen sich mit <strong>de</strong>r ortsansässigen Bevölkerung. Die dänische Sprache hinterlässt Spuren in <strong>de</strong>n lokalen Sprachen.<br />
• 1629 Lübecker Frie<strong>de</strong>n<br />
• 1645 Frie<strong>de</strong>n von Brömsebro, Halland wird auf 30 Jahre an Schwe<strong>de</strong>n verpachtet<br />
• 1658 Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong>, Dänemark verliert Schonen, Blekinge und Halland an Schwe<strong>de</strong>n<br />
• 1666 Dänemark grün<strong>de</strong>t Kolonien in <strong>de</strong>r Karibik, Saint Thomas, Saint Croix, Saint John. Dänen sie<strong>de</strong>ln sich als Farmer und Kaufleute an. 1917 wer<strong>de</strong>n die Kolonien an die USA<br />
verkauft.<br />
• 1683 Ein einheitliches dänisches Rechtsbuch (Danske Lov) löst am 15. April 1683 die alten Landschaftsrechte (Jütisches Recht und Seeländisches Recht) ab. Das Schonische<br />
Recht wird im gleichen Jahr vom einheitlichen Schwedischen Recht abgelöst. Das Jütische Recht bleibt noch bis 1900 in Schleswig/Südjütland bestehen.<br />
• 1722 grün<strong>de</strong>t Hans Ege<strong>de</strong> die erste Kolonie auf Grönland. Später sie<strong>de</strong>ln sich immer mehr Dänen in Grönland an.<br />
• 1772 wird per Dekret verfügt, dass im multinationalen Dänemark die dänische Sprache Amtssprache ist (vorher von Deutsch dominiert).<br />
• 1773 Vertrag von Zarskoje Selo mit Russland über Gebietstausch in Holstein.<br />
• 1788 Agrarreform. Beendigung <strong>de</strong>r Leibeigenschaft <strong>de</strong>r Bauern.<br />
• März 1848 Revolution. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r absoluten Monarchie. Bürgerkrieg zwischen dänischer und <strong>de</strong>utscher Bevölkerung im Herzogtum Schleswig (Südjütland)<br />
• 1849 erstes Parlament und Verfassung.<br />
• 1864 nach <strong>de</strong>r Erstürmung <strong>de</strong>r Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg innenpolitische Krise unter <strong>de</strong>m rechten Ministerpräsi<strong>de</strong>nten Estrup. Linksruck in <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung.<br />
• 1901 Verfassungsreform. Rolle <strong>de</strong>s Parlaments wird aufgewertet.<br />
• 1920 Nach einer Volkskabstimmung in Südjütland (Schleswig) wird Nordschleswig dänisch, Südschleswig bleibt bei Deutschland.<br />
• 1930er Jahre Die regieren<strong>de</strong>n Sozial<strong>de</strong>mokraten entwickeln <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen dänischen Wohlfahrtsstaat.<br />
• Oktober 1943 unter Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Nationalsozialisten: Weitgehen<strong>de</strong> Rettung <strong>de</strong>r dänischen Ju<strong>de</strong>n.<br />
• Nach 1945 Regelung <strong>de</strong>r Min<strong>de</strong>rheitenfrage bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>r Grenze mit <strong>de</strong>n Deutschen. Vorbildfunktion in Europa.<br />
• 1972 Referendum <strong>zu</strong>m Betritt in die Europäische Gemeinschaft. Die Mehrheit <strong>de</strong>r Dänen stimmt mit Ja.<br />
• 2000 Referendum über Einführung <strong>de</strong>s Euro. Die Mehrheit <strong>de</strong>r Dänen entschei<strong>de</strong>t sich entgegen <strong>de</strong>r Parlamentsmehrheit <strong>de</strong>r etablierten Parteien für Nej (Nein).<br />
Literatur<br />
• Norman Berdichevsky: The Danish-German bor<strong>de</strong>r dispute, 1815–2001: aspects of cultural and <strong>de</strong>mographic politics. Bethesda; Dublin; London. 2002. – ISBN 1-930901-34-8<br />
• Robert Bohn: Dänische Geschichte. München: Beck, 2001. – (Beck'sche Reihe; 2162). – ISBN 3-406-44762-7<br />
• Steen Bo Frandsen: Dänemark – <strong>de</strong>r kleine Nachbar im Nor<strong>de</strong>n. Aspekte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-dänischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Darmstadt 1994. – ISBN 3-534-11712-3<br />
• Eva Heinzelmann / Stefanie Robl / Thomas Riis (Hrsg.): Der dänische Gesamtstaat, Verlag Ludwig, Kiel 2006, ISBN 978-3-937719-01-6.<br />
• Lars Hermanson: Släkt, vänner och makt: en studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, Göteborg 2000. (= Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg;<br />
24), Zusammenfassung in englischer Sprache (Zugl.: Göteborg, Univ., Diss., 2000), ISBN 91-88614-30-1<br />
• Erich Hoffmann: „Der heutige Stand <strong>de</strong>r Erforschung <strong>de</strong>r Geschichte Skandinaviens in <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rungszeit im Rahmen <strong>de</strong>r mittelalterlichen Geschichtsforschung.“ In: Der<br />
historische Horizont <strong>de</strong>r Götterbild–Amulette aus <strong>de</strong>r Übergangsepoche von <strong>de</strong>r Spätantike <strong>zu</strong>m Frühmittelalter. Göttingen 1992. S. 143–182.<br />
• Jørgen Kühl / Robert Bohn: Ein europäisches Mo<strong>de</strong>ll? Nationale Min<strong>de</strong>rheiten im <strong>de</strong>utsch-dänischen Grenzland 1945–2005. Bielefeld 2005. – ISBN 3-89534-541-5
• Arndt Ruprecht: Die ausgehen<strong>de</strong> Wikingerzeit im Lichte <strong>de</strong>r Runeninschriften. Göttingen 1958.<br />
• Therkel Stræ<strong>de</strong>: Dänemark: Die schwierige Erinnerung an Kollaboration und Wi<strong>de</strong>rstand. – In: Mythen <strong>de</strong>r Nationen: 1945 – Arena <strong>de</strong>r Erinnerungen. / hrsg. von Monika Flacke.<br />
– Mainz 2004. – ISBN 3-8053-3298-X – S. 123–144<br />
• Ottmer, Hans-Martin: “Weserübung”. Der <strong>de</strong>utsche Angriff auf Dänemark und Norwegen im April 1940. München 1994. ISBN 3-486-56092-1<br />
• Barfod, Jörgen H..: The Holocaust failed in Denmark. Kopenhagen 1985.<br />
• Buckser, Andrew: After the Rescue. Jewish I<strong>de</strong>ntity and Community in Contemporary Denmark. ORT 2003.<br />
• Fin<strong>de</strong>isen, Jörg-Peter: Dänemark. Von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Regensburg 1999.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Hoffmann S. 159.<br />
2. ↑ Die Erwähnung Norwegens, <strong>de</strong>r Färöer, Islands und Grönlands, dann Helsingjalands und <strong>de</strong>r Skridfinnen an die Hamburger Erzdiözese in <strong>de</strong>r kaiserlichen Stiftungs- und die<br />
päpstlichen Bestätigungsurkun<strong>de</strong> (Hamb. Urk.-Buch Nr. 8 u. 9) sind auf eine durchgreifen<strong>de</strong> spätere Interpolierung ursprünglich echter Texte <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen.(Maurer S. 22)<br />
3. ↑ Seegrün S. 47.<br />
4. ↑ Ruprecht S. 17.<br />
5. ↑ Davon wird in <strong>de</strong>r Hákonardrápa <strong>de</strong>s Skal<strong>de</strong>n Guthorm sindri berichtet.<br />
6. ↑ Ruprecht S. 18.<br />
7. ↑ Herbert Jankuhn und an<strong>de</strong>re: Völker und Stämme Südostschleswigs im frühen Mittelalter. Schleswig 1952. S. 151 ff.<br />
8. ↑ Gregor von Tours III, 3.<br />
9. ↑ Eva Heinzelmann / Thomas Riis / Stefanie Robl. (Hrsg.), Der dänische Gesamtstaat – Ein unterschätztes Weltreich? / The Ol<strong>de</strong>nbourg Monarchy – An Un<strong>de</strong>restimated Empire?,<br />
dt./engl., Kiel (Ludwig) 2005, ISBN 3-937719-01-6<br />
10.↑ „Herbert Pundik: Die Flucht <strong>de</strong>r dänischen Ju<strong>de</strong>n 1943 nach Schwe<strong>de</strong>n, Seite 22<br />
11.↑ „Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945.“ Published 2002. Page 367 (dän.)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Öresund<br />
Der Öresund (dänische Schreibweise: Øresund; historische <strong>de</strong>utsche Bezeichnung: Sund) ist die Meerenge zwischen Seeland (Dänemark) und Schonen (Schwe<strong>de</strong>n), die die Ostsee mit<br />
<strong>de</strong>m Kattegat verbin<strong>de</strong>t. Im Öresund liegen die Inseln Ven (<strong>zu</strong> Schwe<strong>de</strong>n) sowie Amager, Saltholm und die künstliche Insel Peberholm (alle <strong>zu</strong> Dänemark). Von 1429–1857 erhob<br />
Dänemark für die Durchfahrt von Schiffen einen Sundzoll. Bis <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> 1658 gehörte auch das schonische Ufer <strong>de</strong>s Öresunds <strong>zu</strong> Dänemark.
Die bei<strong>de</strong>n größten Städte am Öresund sind Kopenhagen und Malmö, die durch die Öresundverbindung miteinan<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Öresundregion verbun<strong>de</strong>n sind. Die kürzeste Fährverbindung<br />
über <strong>de</strong>n Öresund ist zwischen <strong>de</strong>m dänischen Helsingør und <strong>de</strong>m schwedischen Helsingborg. Dort, nördlich von Kopenhagen und Malmö, befin<strong>de</strong>t sich mit ca. 4 km die schmalste Stelle<br />
<strong>de</strong>r Meerenge.<br />
Vor ca. 8.000 Jahren begann <strong>de</strong>r Skandinavische Schild – von <strong>de</strong>r Last <strong>de</strong>s eiszeitlichen Eises befreit – <strong>zu</strong> kippen. Er hob sich im Nor<strong>de</strong>n und senkte sich im Sü<strong>de</strong>n. Das Nordseewasser<br />
drang vom Nor<strong>de</strong>n her in <strong>de</strong>n Ostseeraum ein, überflutete das ehemalige Festland und schuf in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrtausen<strong>de</strong>n die dänischen Inseln und Sun<strong>de</strong>.<br />
Pläne für eine feste Verbindung über <strong>de</strong>n Öresund gab es bereits im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Ein Eisenbahntunnel zwischen Helsingborg und Helsingør sollte gebaut wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n 1960er-Jahren<br />
kam <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Verpackungskonzerns Tetra-Pak, Ruben Rausing, sogar auf die I<strong>de</strong>e, die Wasserstraße trockenlegen <strong>zu</strong> lassen und auf <strong>de</strong>m Gebiet Ørestad <strong>zu</strong> bauen. Die Ölkrise<br />
verhin<strong>de</strong>rte diesen kühnen Plan endgültig.<br />
Mittlerweile ist die neue Öresundverbindung fertiggestellt und befahrbar. Sie verbin<strong>de</strong>t Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n erstmals direkt und wur<strong>de</strong> am 1. Juli 2000 durch Königin Margrethe II.<br />
von Dänemark und König Carl XVI. Gustaf von Schwe<strong>de</strong>n feierlich eröffnet.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Frie<strong>de</strong>n von Kopenhagen (1441)<br />
Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Kopenhagen, einem besseren Waffenstillstandsvertrag, en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Hansisch-nie<strong>de</strong>rländische Krieg von 1438 bis 1441.<br />
Der Vertrag wur<strong>de</strong> im Jahr 1441 in Kopenhagen von <strong>de</strong>n Städten <strong>de</strong>r Hanse unter Führung von Lübecks Bürgermeister Johann Lüneburg und <strong>de</strong>n Hollän<strong>de</strong>rn unterzeichnet. Der Krieg<br />
hatte im Mai 1438 mit <strong>de</strong>r Kaperung von zwölf Salzfrachtern <strong>de</strong>r Hanse auf <strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong> von Brest begonnen, was <strong>zu</strong> einer sofortigen Blocka<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Öresunds durch Lübeck und seine<br />
Verbün<strong>de</strong>ten führte. Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss wur<strong>de</strong> das Monopol <strong>de</strong>r Hanse in Schifffahrt und Han<strong>de</strong>l im Ostseeraum aufgeweicht. Durch die Öffnung <strong>de</strong>r Ostsee für die Schiffe <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r, die größer waren als die <strong>de</strong>r Hanseaten, entstand wirksamer Wettbewerb. Im Vertrag verpflichteten sich die nie<strong>de</strong>rländischen Städte <strong>zu</strong>m Ersatz beziehungsweise <strong>zu</strong>r<br />
Rückgabe von 22 Schiffen <strong>de</strong>r preußischen und livländischen Hansestädte. Die Hollän<strong>de</strong>r zahlten weiterhin 5.000 Gul<strong>de</strong>n an König Christoph III. von Dänemark und verpflichteten sich<br />
gegenüber <strong>de</strong>n Wendischen Städten <strong>de</strong>r Hanse, allen diesen entstan<strong>de</strong>nen Scha<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> ersetzen.<br />
Literatur<br />
• Philippe Dollinger: Die Hanse. 5. Auflage, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-37105-7.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Burgund<br />
Burgund (französisch Bourgogne) ist eine Region im Zentrum Frankreichs. Es hat eine Fläche von 31.741 km² und ca. 1,61 Mio. Einwohner. Regionalhauptstadt ist Dijon.<br />
Geographie<br />
Im Osten grenzt Burgund an die Region Franche-Comté, im Nor<strong>de</strong>n an Champagne-Ar<strong>de</strong>nne und Île-<strong>de</strong>-France. Westlich liegt die Region Centre, während im Sü<strong>de</strong>n die Regionen<br />
Auvergne und Rhône-Alpes angrenzen.<br />
Burgund hat mit <strong>de</strong>m Morvan, einem Ausläufer <strong>de</strong>s Zentralmassivs Anteil an <strong>de</strong>n alten Kristallingebieten. Ansonsten bil<strong>de</strong>n mesozoische Sedimente (<strong>zu</strong>meist aus <strong>de</strong>m Jura) <strong>de</strong>n<br />
Gesteinsuntergrund. An <strong>de</strong>r Ostflanke leiten Bruchstufen <strong>zu</strong>r Saône-Furche über.<br />
Geschichte<br />
Frühgeschichte<br />
Die heutige Region Burgund war schon im Palaeolithikum von Menschen besie<strong>de</strong>lt. Fun<strong>de</strong> am Felsen von Solutré weisen schon für die Zeit um 15.000 v. Chr. eine dichte Besie<strong>de</strong>lung<br />
nach.<br />
Vom 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. bis <strong>zu</strong>r Ankunft <strong>de</strong>r Römer ist die keltische Kultur <strong>de</strong>r Gallier vorherrschend, vor allen Dingen vertreten durch die Haeduer und die Mandubier, die auch in<br />
Caesars De bello gallico Erwähnung fin<strong>de</strong>n. Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Ansiedlungen <strong>de</strong>r Stämme waren Bibracte in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s heutigen Autun und Alesia nahe Dijon.<br />
Römische Zeit<br />
Um 59 v. Chr. besiegten die Römer unter Julius Caesar die Helvetier und an<strong>de</strong>re gallische Stämme bei Bibracte (heute Saint-Léger-sous-Beuvray), auf <strong>de</strong>m Mont Beuvray, zwischen<br />
Autun und Le Creusot. Im Jahr 52 v. Chr. schlugen die Römer, wie<strong>de</strong>rum unter Caesar, bei Alesia, <strong>de</strong>m heutigen Alise-Sainte-Reine, <strong>de</strong>n gallischen Aufstand unter Vercingetorix nie<strong>de</strong>r.<br />
Es folgte die Einglie<strong>de</strong>rung Galliens in das Römische Reich und die langsame sprachliche und kulturelle Romanisierung seiner Einwohner.<br />
Um 43 v. Chr. wur<strong>de</strong> Augustodunum (Autun) gegrün<strong>de</strong>t<br />
Um 280 begann <strong>de</strong>r Weinbau <strong>de</strong>r Region.<br />
Das Reich <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>r 443–532<br />
Der im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung an <strong>de</strong>n Oberrhein gelangte germanische Stamm <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r zwischenzeitlich <strong>de</strong>n Status eines römischen Foe<strong>de</strong>raten erlangt hatte, wur<strong>de</strong> nach<br />
erneuten Konflikten und Nie<strong>de</strong>rlage gegen die Römer 443 von diesen im Bereich <strong>de</strong>r heutigen Westschweiz und Savoyens angesie<strong>de</strong>lt. Da die Burgun<strong>de</strong>r jedoch <strong>de</strong>r ansässigen<br />
keltoromanischen Bevölkerung zahlenmäßig stark unterlegen waren, konnten sie zwar eine um ihren König vereinte Herrenschicht bil<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n jedoch bald romanisiert.<br />
Im Laufe <strong>de</strong>s 5. Jahrhun<strong>de</strong>rts gingen die noch bestehen<strong>de</strong>n Reste <strong>de</strong>r römischen Verwaltung in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Königreichs <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>r auf, und um 507 ist erstmals <strong>de</strong>r Name Burgundia als<br />
Bezeichnung <strong>de</strong>s neuen Reiches belegt. Die Burgun<strong>de</strong>r eroberten nach <strong>de</strong>m Zusammenbruch <strong>de</strong>s Weströmischen Reiches weitere Gebiete um ihr Kernland, nördlich bis in die Gegend von<br />
Troyes, westlich bis an die Loire, südlich bis Orange und im Osten bis an <strong>de</strong>n Alpenkamm bzw. an <strong>de</strong>n Rhein und die Aare.<br />
Das fränkische Teilreich Burgund
Im Jahr 534 unterwarfen die ebenfalls germanischen Franken die Burgun<strong>de</strong>r. Im 6. und 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt entstand bei Erbteilungen zweimal ein fränkisches Teilreich Burgund, das aber<br />
bei<strong>de</strong> Male wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Gesamtreich vereint wur<strong>de</strong>. Innerhalb <strong>de</strong>s Frankenreiches blieb Burgund weiterhin als Reichsteil bestehen. Als 843 das Fränkische Reich im Vertrag von<br />
Verdun erneut geteilt wur<strong>de</strong>, fand die territoriale Einheit <strong>de</strong>r alten Burgundia ein En<strong>de</strong>: Die östlich <strong>de</strong>r Saône liegen<strong>de</strong>n Gebiete fielen <strong>de</strong>m Reich Lothars <strong>zu</strong>, die westlich liegen<strong>de</strong>n, die<br />
etwa <strong>de</strong>r heutigen Region Bourgogne entsprechen, kamen <strong>zu</strong>m westfränkischen Reich. Diese Grenze blieb langfristig bestehen.<br />
Nach weiteren Teilungen und Grenzverschiebungen (Teilung von Prüm, Vertrag von Meersen, Vertrag von Ribemont, Erwerbung Italiens durch Karl <strong>de</strong>n Kahlen von Westfranken nach<br />
<strong>de</strong>m Tod Ludwigs II.) löste sich nach <strong>de</strong>m Tod Kaisers Karl <strong>de</strong>s Kahlen 877 <strong>zu</strong>nächst Nie<strong>de</strong>rburgund unter <strong>de</strong>m Buvini<strong>de</strong>n Boso von Vienne, <strong>de</strong>r 879 König wur<strong>de</strong>, vom Frankenreich.<br />
Nach <strong>de</strong>r Abset<strong>zu</strong>ng 887 <strong>de</strong>s ostfränkischen Königs und Kaisers Karl <strong>de</strong>s Dicken ließ sich 888 <strong>de</strong>r Welfe Rudolf <strong>zu</strong>m König von Hochburgund wählen. Diese bei<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Karolingern<br />
unabhängigen Herrschaften wur<strong>de</strong>n 930/951 unter Rudolf II. und Konrad III. von Hochburgund im Königreich Arelat vereint. Arelat ging 1033 durch Erbfall an das Heilige Römische<br />
Reich, wo es trotz formell <strong>zu</strong>nächst einheitlicher Verwaltung durch das Rektorat von Burgund <strong>zu</strong>nehmend in selbständige Grafschaften zerfiel, unter ihnen die Grafschaft Burgund, die<br />
später <strong>zu</strong>r Pfalz-, dann Freigrafschaft wur<strong>de</strong>.<br />
Der Teil Burgunds, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>s Westfränkischen Reiches verblieben war, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>erst noch als Regnum Burgundiae bezeichnet. In Vertretung <strong>de</strong>s karolingischen<br />
Königtums begrün<strong>de</strong>te Richard <strong>de</strong>r Gerichtsherr 918 ein <strong>zu</strong>erst persönliches Herzogtum in seiner Familie. Erst seit 1075 ist ein gebietsbezogenes Herzogtum Burgund nachweisbar.[1]<br />
Hoch- und Spätmittelalter: Herzogtum und Freigrafschaft Burgund<br />
910 wur<strong>de</strong> das Benediktinerkloster Cluny gegrün<strong>de</strong>t.<br />
1016 besiegte <strong>de</strong>r französische König Robert II. die Erben <strong>de</strong>s Herzogs Heinrich <strong>de</strong>s Großen. 1031 wur<strong>de</strong> das Herzogtum Burgund Robert, <strong>de</strong>m zweiten Sohn <strong>de</strong>s französischen Königs<br />
Robert II. aus <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Kapetinger, als Apanage <strong>zu</strong>gewiesen. 1031 bis 1361 regierten die Kapetinger-Herzöge im Herzogtum Burgund.<br />
1131 wur<strong>de</strong> die große Klosterkirche von Cluny geweiht.<br />
Der Pestepi<strong>de</strong>mie von 1348 fiel etwa die Hälfte <strong>de</strong>r Bewohner Burgunds <strong>zu</strong>m Opfer [2].<br />
Nach<strong>de</strong>m die Dynastie <strong>de</strong>r Kapetinger-Herzöge mit Philipp I. 1361 erloschen war, verlieh König Johann <strong>de</strong>r Gute das Herzogtum 1363 seinem jüngsten Sohn Philipp <strong>de</strong>m Kühnen. Dieser<br />
verheiratete sich mit <strong>de</strong>r Witwe seines Vorgängers, <strong>de</strong>r Erbtochter <strong>de</strong>s Grafen von Flan<strong>de</strong>rn und brachte damit neben Flan<strong>de</strong>rn auch die <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich gehören<strong>de</strong><br />
Freigrafschaft Burgund in seinen Besitz. Er wur<strong>de</strong> so <strong>de</strong>r Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Hauses Burgund, einer Seitenlinie <strong>de</strong>s französischen Königshauses <strong>de</strong>r Valois und einer <strong>de</strong>r mächtigsten<br />
Dynastien <strong>de</strong>s Spätmittelalters, die im französisch-<strong>de</strong>utschen Grenzraum einen großen Län<strong>de</strong>rkomplex aufbaute, aus <strong>de</strong>ssen nördlichem Teil, <strong>de</strong>n Burgundischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n, später die<br />
heutigen Benelux-Län<strong>de</strong>r hervorgingen. Im Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg zwischen <strong>de</strong>n Herrscherhäusern Englands und Frankreichs trieben Philipp († 1404) und seine drei Nachfolger eine<br />
eigenständige Politik, in<strong>de</strong>m sie sich <strong>zu</strong> ihrem Vorteil mal mit <strong>de</strong>r einen, mal mit <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite, meist aber mit <strong>de</strong>n Englän<strong>de</strong>rn verbün<strong>de</strong>ten.<br />
1404-1419 regierte Herzog Johann Ohnefurcht, 1419-1467 Herzog Philipp <strong>de</strong>r Gute, 1467-1477 Herzog Karl <strong>de</strong>r Kühne.<br />
Die Herzöge Philipp <strong>de</strong>r Kühne und Johann Ohnefurcht verstan<strong>de</strong>n sich selbst vor allem als mächtige französische Fürsten und Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s französischen Königshauses, als welche sie<br />
sich <strong>zu</strong>r Regierungszeit <strong>de</strong>s geistesgestörten Königs Karls VI. wie selbstverständlich in innerfranzösische Angelegenheiten einmischten. Dies än<strong>de</strong>rte sich unter <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n nächsten und<br />
letzten Burgun<strong>de</strong>rherzögen, die sich als faktisch souveräne Herrscher betrachteten und verhielten.<br />
Während Philipp <strong>de</strong>r Gute sein Territorium, vor allem im Bereich <strong>de</strong>r jetzigen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, mit viel politischem Geschick <strong>zu</strong> arrondieren und <strong>zu</strong> konsolidieren verstan<strong>de</strong>n hatte und <strong>zu</strong>letzt<br />
über einen reichen und mächtigen Staat regierte, in <strong>de</strong>m Brüssel in die Rolle <strong>de</strong>r Hauptstadt hineinwuchs, versuchte sein Nachfolger Karl, die Expansion mit militärischer Gewalt<br />
fort<strong>zu</strong>setzen. 1474-1477 führte er Kriege mit <strong>de</strong>r Schweizer Eidgenossenschaft. 1475 ließ er seine Truppen das Herzogtum Lothringen besetzen, das seine nördlichen und die südlichen<br />
Gebiete voneinan<strong>de</strong>r trennte. 1477 wur<strong>de</strong> er in <strong>de</strong>r Schlacht bei Nancy von <strong>de</strong>n verbün<strong>de</strong>ten Eidgenossen und Lothringern geschlagen, er selber fiel in <strong>de</strong>r Schlacht.<br />
1477 heiratete Karls Tochter und Alleinerbin, Maria von Burgund, <strong>de</strong>n späteren römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser Maximilian von Habsburg. Der französische König Ludwig XI. erklärte<br />
daraufhin das Herzogtum Burgund, das Mâconnais, das Auxerrois und das Charolais <strong>zu</strong> heimgefallenen Lehen und besetzte die Gebiete. Maximilians Versuche, die Gebiete militärisch
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen (1513 z.B. wur<strong>de</strong> Dijon durch kaiserliche Truppen belagert), blieben letztlich erfolglos.<br />
Neuzeit<br />
Nach <strong>de</strong>r Französischen Revolution von 1789 wur<strong>de</strong> Frankreich 1790 in Départements aufgeteilt. Damit wur<strong>de</strong> das Herzogtum Burgund als politische Einheit aufgelöst und durch die<br />
heutigen vier Départements ersetzt.<br />
1794 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Canal du Centre zwischen Saône und Loire eröffnet.<br />
Bei <strong>de</strong>r Einteilung Frankreichs in Programmregionen im Jahre 1956 wur<strong>de</strong> die Region Burgund (Bourgogne) in ihren heutigen Grenzen gebil<strong>de</strong>t, die die vier Départements umfasst. 1972<br />
erhielt die Region <strong>de</strong>n Status eines Établissements public unter Leitung eines Regionalpräfekten. Durch die Dezentralisierungsgesetze von 1982 erhielten die Regionen <strong>de</strong>n Status von<br />
Collectivités territoriales (Gebietskörperschaften), wie ihn bis dahin nur die Gemein<strong>de</strong>n und die Départements besessen hatten. 1986 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Regionalrat <strong>de</strong>r Region Burgund erstmals<br />
in Direktwahl gewählt. Seit<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n die Befugnisse <strong>de</strong>r Region gegenüber <strong>de</strong>r Zentralregierung in Paris schrittweise erweitert.<br />
Politische Glie<strong>de</strong>rung<br />
Die Region Bourgogne unterglie<strong>de</strong>rt sich in 4 Départements.<br />
• Département Präfektur ISO 3166-2 Arrondissements Kantone Gemein<strong>de</strong>n Einwohner (Jahr) Fläche (km²) Dichte (Einw./km²)<br />
• Côte-d’Or Dijon FR-21 3 43 707 519.143 (2007) 8.763 59,2<br />
• Nièvre Nevers FR-58 4 32 312 221.488 (2007) 6.817 32,5<br />
• Saône-et-Loire Mâcon FR-71 5 57 573 551.842 (2007) 8.575 64,4<br />
• Yonne Auxerre FR-89 3 42 454 341.418 (2007) 7.427 46<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Burgund ist eine landwirtschaftliche Region, die vor allem für ihre Rotweine aus <strong>de</strong>n Regionen an <strong>de</strong>r Côte <strong>de</strong> Nuits und <strong>de</strong>r Côte <strong>de</strong> Beaune sowie für die Weißweine von <strong>de</strong>r Côte-d'Or<br />
und aus <strong>de</strong>m Chablis weltbekannt ist, außer<strong>de</strong>m wird in Burgund auch Vieh<strong>zu</strong>cht betrieben, vor allem die Zucht <strong>de</strong>r regionstypischen Charolais-Rin<strong>de</strong>r und Bressehühner. In Südburgund<br />
an <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong>r Auvergne, trifft man auch noch einige alte Ölmühlen für Nuss- und Pflanzenöle an, darunter die älteste, historische Ölmühle Jean Leblanc, die sich heute noch in<br />
Betrieb befin<strong>de</strong>t.<br />
Die Industrie Burgunds ist trotz seiner günstigen Lage nur gering ausgeprägt und konzentriert sich vor allem im Gebiet um Dijon. Die im 19. Jhd. blühen<strong>de</strong> Metallindustrie um le Creusot<br />
ist be<strong>de</strong>utungslos gewor<strong>de</strong>n. Heute fin<strong>de</strong>n sich viele mittlere Betriebe <strong>de</strong>r Kunststoffverarbeitung im Gebiet um Dijon aufgrund <strong>de</strong>r Nähe <strong>zu</strong> einem großen Chemiewerk in Tavaux,<br />
welches selbst aber <strong>zu</strong>r Region Franche-Comté gehört. In Chalon-sur-Saone fin<strong>de</strong>t sich Elektroindustrie und erstaunlicherweise ein beachtlicher Schiffbau, u.a. sogar U-Bootbau. Die<br />
Schiffe fin<strong>de</strong>n über die Saone und die Rhone <strong>de</strong>n Weg <strong>zu</strong>m Meer.<br />
Im Vergleich mit <strong>de</strong>m BIP <strong>de</strong>r Europäischen Union ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte die Region 2006 einen In<strong>de</strong>x von 94,8 (EU-27 = 100).[3]<br />
Die Hauptverkehrsrouten für <strong>de</strong>n überregionalen Straßenverkehr sind die Autobahnen Paris-Burgund-Provence, Metz-Nancy-Burgund-Lyon und Mülhausen-Burgund-Lyon, die<br />
wichtigste überregionale Bahnstrecke ist Paris-Dijon-Lyon. Es gibt über 1000 km schiffbare Wasserwege.<br />
Tourismus<br />
Kultur<strong>de</strong>nkmäler<br />
In Burgund gibt es eine große Zahl von Kirchen, Klöstern und ehemaligen Klöstern, die eine Besichtigung lohnen. Darunter fin<strong>de</strong>n sich:
• Ancienne Abbaye Les Ursulines, Autun, Département Saône-et-Loire<br />
• Abtei Saint-Fortunat, Charlieu<br />
• Kloster Cîteaux, nahe Dijon, Département Côte-d'Or<br />
• Cluny (Abtei), Cluny, Département Saône-et-Loire<br />
• Fontenay (Abtei), 60 km nordwestlich von Dijon<br />
• Kloster Pontigny, etwa 21 km nordöstlich von Auxerre, 15 km nördlich von Chablis, im Département Yonne<br />
• Vézelay, im Département Yonne<br />
In <strong>de</strong>r Nähe (ca. 10 km nördlich) von Cluny liegt <strong>de</strong>r Ort Taizé, wo sich die Gemeinschaft von Taizé befin<strong>de</strong>t.<br />
Neben <strong>de</strong>n zahlreichen Sakralbauten fin<strong>de</strong>n sich in Burgund auch viele Burgen und Schlösser, die im eher ländlich geprägten Herz Frankreichs weit verstreut sind. Ihre genaue Anzahl ist<br />
schwer in Erfahrung <strong>zu</strong> bringen, <strong>de</strong>nn Angaben da<strong>zu</strong> schwanken zwischen 400 und 700. Beson<strong>de</strong>rs bekannte A<strong>de</strong>lsresi<strong>de</strong>nzen sind:<br />
• das Schloss Ancy-le-Franc<br />
• die Ruine <strong>de</strong>r Burg Brancion<br />
• das Schloss Bussy-Rabutin<br />
• das Schloss Châteauneuf<br />
• das Schloss Commarin<br />
• das Schloss Cormatin<br />
• <strong>de</strong>r Herzogspalast von Dijon<br />
• <strong>de</strong>r Herzogspalast von Nevers<br />
• das Schloss Sully<br />
Rezeption<br />
Burgund wird mit zahlreichen, teils historisch inspirierten Figuren im Nibelungenlied erwähnt. Dort ist jedoch nicht die hier beschriebene Region Burgund gemeint, son<strong>de</strong>rn das<br />
Burgun<strong>de</strong>nreich.<br />
Literatur<br />
• Klaus Bußmann: Burgund. Kunst, Geschichte, Landschaft. Burgen, Klöster und Kathedralen im Herzen Frankreichs... 12. Auflage. DuMont, Köln 1992, ISBN 3-7701-0846-9.<br />
• Ulrich Erdmann: Römische Spuren in Burgund. Ein archäologischer Reiseführer. Reichert, Wiesba<strong>de</strong>n 2004, ISBN 3-89500-352-2.<br />
• Heinz-Joachim Gund: Burgund. Artemis, München, Zürich 1987, ISBN 3-7608-0795-X.<br />
• Hermann Kamp: Burgund. Geschichte und Kultur. München 2007, ISBN 3-406-53614-X.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Lexikon <strong>de</strong>s Mittelalters, Bd. 2, Spalte 1066.<br />
2. ↑ Zivilstan<strong>de</strong>sregister von Givry (Saône-et-Loire) 1334-1357<br />
3. ↑ Eurostat Pressemitteilung 23/2009: Regionales BIP je Einwohner in <strong>de</strong>r EU27 (PDF-Datei; 360 kB)
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Brest (Finistère)<br />
Brest ist eine französische Hafenstadt in <strong>de</strong>r Bretagne mit 142.722 Einwohnern (Stand 1. Januar 2007). Sie gehört <strong>zu</strong>m Département Finistère. Aufgrund ihrer geschützten Lage an <strong>de</strong>r<br />
Ra<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brest, einer tief ins Land ragen<strong>de</strong>n Bucht <strong>de</strong>s Atlantiks, sowie <strong>de</strong>s natürlichen Hafens im Bereich <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>s Flüsschens Penfeld ist Brest seit Jahrhun<strong>de</strong>rten ein<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Marinehafen Frankreichs. Noch heute ist Brest, auch „Cité du Ponant“ genannt, Stützpunkt <strong>de</strong>r französischen Atlantikflotte und ein wichtiger Han<strong>de</strong>lshafen.<br />
Als größte Stadt <strong>de</strong>r westlichen Bretagne ist Brest ein wichtiger Industrie- und Han<strong>de</strong>lsstandort. Die Stadt ist Sitz <strong>de</strong>r Universität Université <strong>de</strong> Bretagne Occi<strong>de</strong>ntale (kurz UBO), sowie<br />
weiterer Hochschulen und Forschungsinstitute.<br />
Geografie<br />
Klima<br />
Das Klima von Brest ist ein gemäßigtes Seeklima, das vom Golfstrom beeinflusst wird. Charakteristisch für dieses Klima sind kühle Sommer und mil<strong>de</strong> Winter. Frost tritt selten auf, Wind<br />
dagegen fast ständig. Die Stadt gehört in eine Klimazone <strong>de</strong>s Typs Cfb (nach Köppen und Geiger): Warmgemäßigtes Regenklima (C), vollfeucht (f), wärmster Monat unter 22 °C,<br />
min<strong>de</strong>stens vier Monate über 10 °C (a).<br />
Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 10,8 °C; <strong>de</strong>r kälteste Monat ist mit 6,2 °C <strong>de</strong>r Februar, <strong>de</strong>r wärmste mit 16,0 °C <strong>de</strong>r August. Die jährliche Nie<strong>de</strong>rschlagsmenge beträgt<br />
1085 mm; am trockensten mit 46 mm ist es im Juli, die höchste Nie<strong>de</strong>rschlagsmenge fällt mit 137 mm im Dezember.<br />
Geschichte<br />
An <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>s heutigen Brest befand sich <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Römer seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 3. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein befestigter Stützpunkt, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Küstenschutz diente und Gesocribate genannt wur<strong>de</strong>. Im<br />
5. Jahrhun<strong>de</strong>rt wan<strong>de</strong>rten von England her britische Stämme ein, nach <strong>de</strong>nen das Land Bretagne genannt wur<strong>de</strong>. Später wur<strong>de</strong> hier ein Kastell gegen die Angriffe <strong>de</strong>r Normannen errichtet.<br />
Mit <strong>de</strong>r Bretagne kam auch Brest im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt unter die Oberhoheit <strong>de</strong>r Englän<strong>de</strong>r, 1202 aber wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück unter französische Lehnsherrschaft.<br />
Mit Beginn <strong>de</strong>r Neuzeit erlebte die Stadt durch <strong>de</strong>n Überseehan<strong>de</strong>l einen Aufschwung. 1593 erhielt Brest durch König Heinrich IV. das Stadtrecht. 1631 machte Kardinal Richelieu Brest<br />
<strong>zu</strong>m Militärhafen und ließ dort das Marinearsenal für die Flotte du Ponant erbauen. 1683 wur<strong>de</strong> die Anlage von Vauban <strong>zu</strong>r Festung ausgebaut. Am 18. Juni 1686 traf hier eine Delegation<br />
aus Siam ein, die <strong>zu</strong> König Ludwig XIV. nach Versailles weiterreiste, ein Ereignis, an das bis heute <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r wichtigsten Hauptstraße <strong>de</strong>r Stadt, die Rue <strong>de</strong> Siam, erinnert. Um 1750<br />
wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Baumeister Choquet <strong>de</strong> Lindu das Zuchthaus von Brest errichtet, das 300 Sträflinge aufnehmen konnte und vor allem wegen seiner mächtigen Kanonen bekannt wur<strong>de</strong> –<br />
von diesen leitet sich auch die französische Re<strong>de</strong>wendung tonnerre <strong>de</strong> Brest (soviel wie: mächtiges Donnerwetter) ab. 1752 wur<strong>de</strong> in Brest eine Marineaka<strong>de</strong>mie eingerichtet.<br />
1789 war die Brester Bevölkerung <strong>zu</strong>nächst begeistert für die Französische Revolution. Ihre Sympathien galten dann aber vermehrt <strong>de</strong>n Girondisten bzw. einem fö<strong>de</strong>ralen Staatsaufbau,<br />
was ihr <strong>de</strong>n Unmut <strong>de</strong>r Jakobiner einbrachte, die 70 Bürger unter die Guillotine schickten. Nach <strong>de</strong>m Sturz Robespierres wur<strong>de</strong> die Stadt dann wie<strong>de</strong>r von Girondisten verwaltet. Der<br />
Hafen verlor allerdings bald durch die Kontinentalblocka<strong>de</strong> an Be<strong>de</strong>utung, <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l lag brach und eine Wirtschaftskrise war die Folge, die die Stadt <strong>zu</strong>rückwarf. Unter Napoleon wur<strong>de</strong>
mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s schiffbaren Canal <strong>de</strong> Nantes à Brest begonnen, mit <strong>de</strong>m die Seeblocka<strong>de</strong> umgangen wer<strong>de</strong>n sollte. Mit <strong>de</strong>r Industrialisierung fand man wie<strong>de</strong>r Anschluss an die<br />
wirtschaftliche Entwicklung, etwa durch <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>r Brücke über <strong>de</strong>n Penfeld 1856 o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>s Brester Bahnhofs 1865; die Stadt lag damals 18 Zugstun<strong>de</strong>n von Paris entfernt. Das<br />
Zuchthaus wur<strong>de</strong> 1858 aufgegeben, statt<strong>de</strong>ssen verfrachtete man die Insassen von Bor<strong>de</strong>aux aus direkt auf Sträflingsinseln in Übersee.<br />
Während <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs war Brest wichtiger Hafen für <strong>de</strong>n Nachschub <strong>de</strong>r US-Truppen in Europa. Der Hafen wur<strong>de</strong> unter<strong>de</strong>ssen stetig erweitert, 1930 kamen die Hafenanlagen<br />
von Plougastel hin<strong>zu</strong>. Im Zweiten Weltkrieg marschierten die Deutschen am 19. Juni 1940 ein und machten Brest <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r wichtigsten Stützpunkte <strong>de</strong>s Atlantikwalls, wo auch die 1.<br />
U-Flottille und mehrere Schlachtschiffe stationiert waren. Zum Schutz <strong>de</strong>r U-Boote wur<strong>de</strong> unmittelbar vor <strong>de</strong>r ehemaligen Ecole Navale, <strong>de</strong>ren Gebäu<strong>de</strong> jetzt als Hauptquartier <strong>de</strong>r U-<br />
Boot-Flottille diente, ein gigantischer U-Boot-Bunker gebaut, <strong>de</strong>r 192 Meter breit, 333 Meter lang und 17 Meter hoch war. Die Deckenstärke betrug 6,20 Meter.<br />
Nach <strong>de</strong>r Landung in <strong>de</strong>r Normandie wur<strong>de</strong> Brest dann 43 Tage von <strong>de</strong>n Alliierten belagert, ehe es im September 1944 befreit wur<strong>de</strong>. Allerdings war die Stadt durch die Kämpfe und<br />
Bombardierungen <strong>de</strong>r Alliierten stark zerstört und musste von Grund auf, nach <strong>de</strong>n Plänen von Jean-Baptiste Mathon, neu aufgebaut wer<strong>de</strong>n. 1961 war <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufbau im wesentlichen<br />
abgeschlossen.<br />
Da von <strong>de</strong>r historischen Bausubstanz wenig übrigblieb, macht Brest heute eher <strong>de</strong>n Eindruck einer weitgehend gesichtslosen Planstadt mit Betonbauten. Wirtschaftlich musste man sich<br />
auch umorientieren, da die Be<strong>de</strong>utung als Marinehafen <strong>zu</strong>rückging; statt<strong>de</strong>ssen erlebten nunmehr die Dienstleistungsbranche und mo<strong>de</strong>rne Industrien sowie die Meeresforschung einen<br />
Aufschwung. Zur Be<strong>de</strong>utung als Bildungszentrum trug auch die Gründung <strong>de</strong>r Universität <strong>de</strong>r westlichen Bretagne im Jahre 1960 bei.<br />
Politik<br />
Verwaltung<br />
Brest ist Sitz <strong>de</strong>r Unterpräfektur <strong>de</strong>s Arrondissements Brest sowie Chef-lieu von zehn Kantonen, die großteils aus Stadtteilen bestehen, teils auch Nachbarorte einschließen.<br />
• Brest-Bellevue (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest, Bohars, Guilers)<br />
• Brest-Centre (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-Kerichen (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-L'Hermitage-Gouesnou (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest, Gouesnou)<br />
• Brest-Lambezellec (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-Plouzané (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest, Plouzané)<br />
• Brest-Recouvrance (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-Saint-Marc (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
• Brest-Saint-Pierre (Teil <strong>de</strong>r Stadt Brest)<br />
Städtepartnerschaften<br />
Brest unterhält Städtepartnerschaften mit<br />
• Denver in <strong>de</strong>n Vereinigten Staaten, seit 1956<br />
• Plymouth in Großbritannien, seit 1963<br />
• Kiel in Schleswig-Holstein, seit 1964<br />
• Tarent in Italien, seit 1964<br />
• Yokosuka in Japan seit 1970
• Dun Laoghaire in Irland, seit 1984<br />
• Cádiz in Spanien, seit 1986<br />
• Saponé in Burkina Faso, seit 1989<br />
• Constanța in Rumänien, seit 1993<br />
Ein Freundschaftsabkommen besteht mit <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Bejaia in Algerien, seit 1995<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Bauwerke<br />
• Das Château, eine stattliche Festung über <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Penfeld, bietet einen guten Überblick über die Ree<strong>de</strong> und <strong>de</strong>n Marinehafen. Einer <strong>de</strong>r Türme beherbergt das Musée <strong>de</strong><br />
la Marine mit einer Sammlung <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Hafens und <strong>de</strong>r Marine.<br />
• Océanopolis, ein Erlebnispark <strong>zu</strong>m Thema Ozeane mit 42 Meerwasser-Aquarien unterschiedlicher Größe und einem Schwerpunkt auf Flora und Fauna <strong>de</strong>r bretonischen Küste.<br />
• Verschie<strong>de</strong>ne Überreste <strong>de</strong>r Festungsbauwerke von Vauban.<br />
• Im mittelalterlichen Turm Tour Tanguy am rechten Ufer <strong>de</strong>r Penfeld-Mündung befin<strong>de</strong>t sich ein kleines Museum mit Mo<strong>de</strong>llen und historischen Dokumenten <strong>zu</strong>m Aussehen <strong>de</strong>r<br />
Stadt Brest vor <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg.<br />
• Der 1940 bis 1944 von <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Besatzern errichtete U-Boot-Bunker, <strong>de</strong>r insgesamt Platz für 13 U-Boote bot.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
• Seit 1992 fin<strong>de</strong>t alle vier Jahre im Monat Juli ein internationales Festival <strong>de</strong>s Meeres und <strong>de</strong>r Matrosen statt (Brest 92, Brest 96, Brest 2000, Brest 2004 usw.).<br />
• Die städtische Bühne Le Quartz ist über die Grenzen <strong>de</strong>s Départements hinaus bekannt.<br />
• Je<strong>de</strong>s Jahr im Herbst fin<strong>de</strong>t das Kurzfilmfestival Festival européen du film court <strong>de</strong> Brest statt.<br />
• Das Musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts stellt eine kleine Sammlung europäischer Malerei vom 16.–21. Jahrhun<strong>de</strong>rt aus.<br />
• Seit einigen Jahren lockt das Festival Astropolis französische und internationale Größen elektronischer Musik nach Brest (meist Anfang August).<br />
• Seit 1891 ist Brest <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>punkt <strong>de</strong>s Radrennens Paris-Brest-Paris (Brevet), das alle vier Jahre stattfin<strong>de</strong>t, und <strong>de</strong>s Radrennens Paris-Brest-Paris (Audax), welches alle fünf<br />
Jahre stattfin<strong>de</strong>t<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Ansässige Unternehmen<br />
Die 1966 gegrün<strong>de</strong>te Firma SMDO Industries, <strong>de</strong>r weltweit drittgrößte Hersteller von Stromgeneratoren, hat ihren Hauptsitz in Brest.<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Eric Berthou, Radrennfahrer<br />
• Pierre Brice, 1929 in Brest geborener Schauspieler
• Béatrice Dalle, 1964 in Brest geborene Schauspielerin<br />
• Claire <strong>de</strong> Duras, Autorin dreier Romane<br />
• Victor Hémery, französischer Rennfahrer<br />
• Louis Hémon, französischer Schriftsteller<br />
• Roparz Hemon, bretonischer Schriftsteller und Nationalist<br />
• Christophe Miossec, 1964 in Brest geborener Musiker<br />
• Alain Robbe-Grillet, französischer Agraringenieur, Filmemacher und Schriftsteller<br />
• Yann Tiersen, 1970 in Brest geborener Musiker<br />
• Tanguy Viel, 1973 in Brest geborener Schriftsteller<br />
• Gonzalo Higuaín, 1987 in Brest geborener argentinischer Fußballspieler<br />
Literatur<br />
• Francois Peron Brest sous l'occupation Rennes: Ouest France, 1981 ISBN 2-85882-457-6<br />
• Lothar-Günther Buchheim: Die Festung, 1995 ISBN 3-455-00733-3<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Polen<br />
Polen (poln. Polska (amtlich Rzeczpospolita Polska, dt. Republik Polen) ist ein Staat in Mitteleuropa. Die Hauptstadt und <strong>zu</strong>gleich größte Stadt ist Warschau. Es ist auf die Fläche<br />
bezogen das siebtgrößte Land Europas und steht auf Platz 62 <strong>de</strong>r größten Län<strong>de</strong>r weltweit. Der Staat ist größtenteils ein Flachland, nur im Sü<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>n sich Gebirge. Die Katholiken<br />
bil<strong>de</strong>n die mit Abstand größte Konfession <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Seit <strong>de</strong>m 1. Mai 2004 ist das Land Mitgliedstaat <strong>de</strong>r Europäischen Union. Das Land ist ebenfalls Mitglied <strong>de</strong>r UNO, <strong>de</strong>r OECD, <strong>de</strong>r NATO sowie <strong>de</strong>r OSZE.<br />
Lan<strong>de</strong>sname<br />
Der vollständige Name <strong>de</strong>s heutigen Polens lautet Rzeczpospolita Polska, auf Deutsch Republik Polen. Der Name Polen leitet sich vom westslawischen Stamm <strong>de</strong>r Polanen (poln.<br />
Polanie) ab, die sich im 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Gebiet <strong>de</strong>r heutigen Woiwodschaft Großpolen um Posen (poln. Poznań) und Gniezno, zwischen <strong>de</strong>n Flüssen O<strong>de</strong>r und Weichsel, nie<strong>de</strong>rließen.<br />
Die Polanen waren ein <strong>zu</strong>m größtenteil Ackerbauern, die Bezeichnung Polanen entwickelte sich aus <strong>de</strong>m Wort pole, <strong>de</strong>utsch Feld.[5] Die Bezeichnung Polanen trat erst um das Jahr 1000<br />
auf.[6]<br />
Geographie
Polens Staatsgebiet be<strong>de</strong>ckt eine Fläche von 312.679 km².[7] Im Nor<strong>de</strong>n grenzt es an die Ostsee und Russland, im Osten an Litauen, Weißrussland und die Ukraine, im Sü<strong>de</strong>n an die<br />
Slowakei und Tschechien und im Westen an Deutschland. Insgesamt hat Polen 3.583 Kilometer Staatsgrenze, 524 Kilometer davon in <strong>de</strong>r Ostsee und auf 1.221 Kilometer verläuft die<br />
Grenze an Flüssen.[8]<br />
Nördlichster Punkt Polens ist das Kap Rozewie, südlichster <strong>de</strong>r Gipfel <strong>de</strong>s Opołonek in <strong>de</strong>n Bieszczady. Die Entfernung zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Punkten beträgt 649 Kilometer. Der<br />
westlichste Punkt ist die Stadt Cedynia das östliche Pendant ist das Knie <strong>de</strong>s Bug in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Horodło, 689 Kilometer entfernt. Der Gradnetzmittelpunkt liegt bei Ozorków, <strong>de</strong>r<br />
Schwerpunkt weicht geringfügig davon ab.[9]<br />
• Grenze mit Länge[7]<br />
•<br />
• Russland 210 km<br />
• Seegrenze <strong>zu</strong> Russland 22 km<br />
• Litauen 104 km<br />
• Weißrussland 418 km<br />
• Ukraine 535 km<br />
• Slowakei 541 km<br />
• Tschechien 796 km<br />
• Deutschland 467 km<br />
• Seegrenze <strong>zu</strong> Deutschland 22 km<br />
• Ostsee[10] 440 km<br />
• Summe 3.511 km<br />
Das Gebiet Polens kann in sechs geographische Räume eingeteilt wer<strong>de</strong>n. Von Nord nach Süd sind dies: die Küstengebiete, die Rückenlandschaften, das Tiefland, die Hochlän<strong>de</strong>r, die<br />
Vorgebirge und die Gebirge.[11] Die Übergänge zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Gebieten sind dabei fließend und wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Literatur jeweils leicht abweichend abgegrenzt.<br />
Die Küstenlinie verläuft im Nor<strong>de</strong>n Polens an <strong>de</strong>r Ostsee. Die Küstennie<strong>de</strong>rungen sind schmal und um das Stettiner und das Frische Haff <strong>zu</strong>ngenförmig ausgeweitet. Die Landschaften<br />
bestehen aus flachen, breiten Tälern und ausge<strong>de</strong>hnten Grundmoränenplatten. Vor allem sandige, lehmhaltige und Moorbö<strong>de</strong>n dominieren die Bo<strong>de</strong>narten.[12]<br />
Die Rückenlandschaft ist während <strong>de</strong>r Eiszeiten entstan<strong>de</strong>n was sich durch die Gestaltung durch End- und Grundmoränen zeigt. Davon setzt sich <strong>de</strong>utlich die San<strong>de</strong>rfläche im<br />
südöstlichen Teil ab.<br />
Zu <strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong>n Tieflandgebieten zählen das Warschauer Becken und das Tiefland Podlachiens.[13]<br />
Die polnischen Hochlän<strong>de</strong>r können in zwei Hauptteile unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, das Kleinpolnische (Wyżyna Małopolska) und das Lubliner Hochland (Wyżyna Lubelska).[14]<br />
Zu <strong>de</strong>n Vorgebirgslandschaften zählen das schlesische Tiefland, die Beckenlandschaft <strong>de</strong>r Vorkarpaten.[15]<br />
Im Sü<strong>de</strong>n Polens befin<strong>de</strong>n sich die polnischen Mittelgebirge, <strong>de</strong>s Krakauer-Tschenstochauer Jura, das Heiligkreuzgebirge, die Beski<strong>de</strong>n, die Waldkarpaten und die Su<strong>de</strong>ten. Die höchste<br />
Erhebung, die Hohe Tatra, ist ein geologisch sehr vielseitiges Hochgebirge.<br />
Geologie<br />
Der tiefere Untergrund Polens wird von einem Mosaik verschie<strong>de</strong>ner Krustensegmente unterschiedlicher Herkunft und Zusammenset<strong>zu</strong>ng aufgebaut. Zwar treten die älteren Bestandteile<br />
nur in <strong>de</strong>n südlichen Randbereichen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s auf, weil große Flächen in Nord- und Zentralpolen von jungen Sedimenten be<strong>de</strong>ckt sind, durch Tiefbohrungen ist aber auch in diesen<br />
Bereichen <strong>de</strong>r Aufbau <strong>de</strong>s Untergrun<strong>de</strong>s bekannt.
Grundgebirge<br />
Nordöstlich einer Linie, die durch die Orte Ustka an <strong>de</strong>r Ostsee und Lublin markiert wird, stehen im Untergrund Gesteine an, welche die südwestliche Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kontinents Baltica<br />
bil<strong>de</strong>n. Es han<strong>de</strong>lt sich um hochmetamorphe Gneise und Granulite, die während <strong>de</strong>r Svekofennidischen Orogenese vor 1,8 Milliar<strong>de</strong>n Jahren letztmalig <strong>de</strong>formiert wur<strong>de</strong>n. Diese Gesteine<br />
wur<strong>de</strong>n vor 1,5 Milliar<strong>de</strong>n Jahren von Anorthositen und Rapakivi-Graniten intrudiert und unterlagen in <strong>de</strong>r Folgezeit einer langsamen Abtragung. Ab <strong>de</strong>m Kambrium war dieser alte<br />
Kraton, <strong>de</strong>r Baltische Schild, von einem Flachmeer be<strong>de</strong>ckt, <strong>de</strong>ssen geringmächtige Ablagerungen sich bis ins Silur nachweisen lassen.<br />
Südwestlich an <strong>de</strong>n Baltischen Schild schließt sich die 100 bis 200 km breite Zone <strong>de</strong>r Kaledoni<strong>de</strong>n an. Die Grenzzone zwischen <strong>de</strong>n Kaledoni<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Baltischen Schild, die<br />
Tornquistzone, lässt sich von Dänemark bis in die Dobrudscha verfolgen. Die Gesteine <strong>de</strong>s kaledonischen Gebirgs<strong>zu</strong>ges entstan<strong>de</strong>n am Nordrand Gondwanas und wur<strong>de</strong>n von diesem am<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kambriums als langgestreckter, schmaler Mikrokontinent mit <strong>de</strong>m Namen Avalonia abgespalten. Der als Tornquist-Ozean bezeichnete Meeresraum zwischen Avalonia und<br />
Baltica wur<strong>de</strong> bis <strong>zu</strong>m Oberordovizium subduziert, wodurch es <strong>zu</strong>r Kollision und Gebirgsbildung kam. Im nördlichen Heiligkreuzgebirge (Lysagori<strong>de</strong>n) fin<strong>de</strong>t man kaledonisch<br />
<strong>de</strong>formierte Schelfsedimente <strong>de</strong>s Baltischen Schil<strong>de</strong>s, wohingegen <strong>de</strong>r südliche Teil (Kielci<strong>de</strong>n) präkambrische Gesteine enthält, die ursprünglich Teile Gondwanas waren. Auch das<br />
Małopolska-Massiv im Südwesten <strong>de</strong>s Heiligkreuzgebirges ist gondwanidischen Ursprungs, allerdings driftete es unabhängig von Avalonia nach Nor<strong>de</strong>n und gelangte erst im Rahmen von<br />
Seitenverschiebungen bei <strong>de</strong>r jüngeren, variszischen Orogenese in seine heutige Position.<br />
Die dritte große Baueinheit wird von <strong>de</strong>n variszisch <strong>de</strong>formierten Su<strong>de</strong>ten gebil<strong>de</strong>t. Im frühen Ordovizium löste sich eine weitere Gruppe von Mikrokontinenten vom Nordrand<br />
Gondwanas und driftete durch die Subduktion <strong>de</strong>s Rheischen Ozeans auf Baltica <strong>zu</strong>. Diese Kleinkontinente, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen die Böhmische Masse und das Saxothuringikum gehören,<br />
kollidierten im Mittel- und Ober<strong>de</strong>von mit <strong>de</strong>m Südrand Balticas. Dabei entstan<strong>de</strong>n auf polnischen Gebiet die Westsu<strong>de</strong>ten (auch Lugikum genannt), mit ihren hochgradig metamorphen<br />
Paragneis-Folgen, in die die Granite <strong>de</strong>s Iser- und Riesengebirges eindrangen. Schon im Karbon wur<strong>de</strong>n abgesunkene Teile <strong>de</strong>s variszischen Gebirges von ausge<strong>de</strong>hnten,<br />
baumbestan<strong>de</strong>nen Nie<strong>de</strong>rmooren eingenommen, die heute in <strong>de</strong>n Flözen <strong>de</strong>s Oberschlesischen Steinkohlereviers dokumentiert sind.<br />
Das jüngste Gebirge ist im südlichen Polen in <strong>de</strong>n Karpaten aufgeschlossen. Im Eozän hatte sich die Tethys geschlossen und die Adriatische Platte, ein Sporn Gondwanas, kollidierte mit<br />
<strong>de</strong>m Südrand Europas. Im polnischen Anteil <strong>de</strong>r Karpaten wur<strong>de</strong>n Sedimentgesteine <strong>de</strong>s Mesozoikums und <strong>de</strong>s Paläogens nach Nor<strong>de</strong>n auf das ältere Grundgebirge überschoben.<br />
Deckgebirge<br />
Im Perm begann im heutigen Zentralpolen eine kontinuierliche Absenkung <strong>de</strong>s gefalteten Untergrun<strong>de</strong>s, so dass dort bis <strong>zu</strong> 10 km mächtige Sedimentgesteinsschichten abgelagert wur<strong>de</strong>n.<br />
Im Rotliegen<strong>de</strong>n enthalten die Ablagerungen noch Gesteine vulkanischen Ursprungs, aber ab <strong>de</strong>m Zechstein herrschten marine Bedingungen vor; in abgeschnürten Lagunen kam es auch<br />
<strong>zu</strong>r Bildung von Steinsalz. Im Buntsandstein zog sich das Meer <strong>zu</strong>rück und es wur<strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong> 1.400 m kontinentale San<strong>de</strong> abgelagert. Danach wur<strong>de</strong> das Gebiet bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Mesozoikums vorwiegend von einem Flachmeer be<strong>de</strong>ckt, in <strong>de</strong>m Kalksteine und Tone <strong>zu</strong>r Ablagerung kamen. Auch das ältere Grundgebirge (Heiligkreuzgebirge und Su<strong>de</strong>ten) war bis<br />
<strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Krei<strong>de</strong> von diesen jungen Sedimenten be<strong>de</strong>ckt. Erst <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Paläogens von 55 Millionen Jahren kam es <strong>zu</strong> einer Heraushebung <strong>de</strong>r alten Gebirgsmassive. In<br />
Zentralpolen wur<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>s Paläogens und Neogens wur<strong>de</strong>n nur etwa 250 m San<strong>de</strong> und Tone abgelagert. Weite Bereiche <strong>de</strong>s polnischen Tieflan<strong>de</strong>s liegen unter einer nahe<strong>zu</strong><br />
geschlossenen Decke von Moränenmaterial, sowie Kiesen und San<strong>de</strong>n, die von <strong>de</strong>n Gletschern <strong>de</strong>r letzten Eiszeit aus Skandinavien herantransportiert wur<strong>de</strong>n.<br />
Flüsse<br />
Die längsten Flüsse sind die Weichsel (Wisła) mit 1.022 km, <strong>de</strong>r Grenzfluss O<strong>de</strong>r (Odra) mit 840 km, die Warthe (Warta) mit 795 km und <strong>de</strong>r Bug mit 774 km.[7] Der Bug verläuft<br />
entlang <strong>de</strong>r polnischen Ostgrenze. Die Weichsel und die O<strong>de</strong>r mün<strong>de</strong>n, wie zahlreiche kleinere Flüsse in Pommern, in die Ostsee. Die bei<strong>de</strong>n Flüsse bestimmen das hydrographischfluviatile<br />
Gefüge Polens.[16] Die Alle (pln. Łyna) und die Angerapp (pln. Węgorapa) fließen über <strong>de</strong>n Pregel und die Hańcza über die Memel in die Ostsee. Daneben entwässern einige<br />
kleinere Flüsse, wie die Iser in <strong>de</strong>n Su<strong>de</strong>ten, über die Elbe in die Nordsee. Die Arwa aus <strong>de</strong>n Beski<strong>de</strong>n fließt über die Waag und die Donau (pln. Dunaj), genauso wie einige kleinere<br />
Flüsse aus <strong>de</strong>n Waldkarpaten, über <strong>de</strong>n Dnister ins Schwarze Meer. Pro Jahr fließen 58,6 km² Wasser ab, davon 24,6 als Oberflächenabfluss.[17]<br />
Die polnischen Flüsse wur<strong>de</strong>n schon sehr früh <strong>zu</strong>r Schifffahrt genutzt. Bereits die Wikinger befuhren während ihrer Raubzüge durch Europa mit ihren Langschiffen die Weichsel und die<br />
O<strong>de</strong>r. Im Mittelalter und <strong>de</strong>r Neuzeit, als Polen-Litauen die Kornkammer Europas war, gewann die Verschiffung von Agrarprodukten auf <strong>de</strong>r Weichsel Richtung Danzig (poln. Gdańsk)
und weiter nach Westeuropa eine sehr große Be<strong>de</strong>utung, wovon noch viele Renaissance- und Barockspeicher in <strong>de</strong>n Städten entlang <strong>de</strong>s Flusses zeugen.<br />
Seen<br />
Polen gehört mit 9.300 geschlossenen Gewässern, <strong>de</strong>ren Fläche einen Hektar überschreitet,[18] <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n seenreichsten Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Welt. In Europa weist nur Finnland mehr Seen pro km²<br />
als Polen auf. Die größten Seen mit über 100 km² Fläche sind Śniardwy (Spirdingsee) und Mamry (Mauersee) in Masuren sowie das Jezioro Łebsko (Lebasee) und das Jezioro Drawsko<br />
(Dratzigsee) in Pommern. Neben <strong>de</strong>n Seenplatten im Nor<strong>de</strong>n (Masuren, Pommern, Kaschubei, Großpolen) gibt es auch eine hohe Anzahl an Bergseen in <strong>de</strong>r Tatra, von <strong>de</strong>nen das Morskie<br />
Oko <strong>de</strong>r flächenmäßig größte ist. Der mit über 100 m tiefste See ist <strong>de</strong>r Hańcza-See in <strong>de</strong>r Seenplatte von Wigry, östlich von Masuren in <strong>de</strong>r Woiwodschaft Podlachien. Gefolgt wird er<br />
von <strong>de</strong>m Bergsee Wielki Staw Polski (dt. Großer Polnischer See) im „Tal <strong>de</strong>r fünf polnischen Seen“. Die tiefsten Seen sind <strong>de</strong>r Hańcza, 108 m und <strong>de</strong>r Drawsko, 83 m.[19] Zu <strong>de</strong>n ersten<br />
Seen, <strong>de</strong>ren Ufer besie<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n, gehören die <strong>de</strong>r Großpolnischen Seenplatte. Die Pfahlbausiedlung von Biskupin, die von mehr als 1.000 Menschen bewohnt wur<strong>de</strong>, grün<strong>de</strong>ten bereits<br />
vor <strong>de</strong>m 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. Angehörige <strong>de</strong>r Lausitzer Kultur. Die Vorfahren <strong>de</strong>r heutigen Polen, die Polanen, bauten ihre ersten Burgen auf Seeinseln (pln. ostrów). Der legendäre Fürst<br />
Popiel soll im 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Kruszwica am Goplosee regiert haben. Der erste historisch belegte Herrscher Polens, Herzog Mieszko I., hatte seinen Palast auf einer Wartheinsel in<br />
Posen.<br />
Küste<br />
Die polnische Ostseeküste ist 528 km lang und erstreckt sich von Swinemün<strong>de</strong> (pln. Świnoujście) auf <strong>de</strong>n Inseln Usedom und Wolin im Westen bis nach Krynica Morska auf <strong>de</strong>r Frischen<br />
Nehrung (auch Weichselnehrung genannt) im Osten. Die polnische Küste ist <strong>zu</strong>m großen Teil eine sandige Ausgleichsküste die durch die stetige Bewegung <strong>de</strong>s San<strong>de</strong>s aufgrund <strong>de</strong>r<br />
Strömung und <strong>de</strong>s Win<strong>de</strong>s von West nach Ost charakterisiert wird. Dadurch bil<strong>de</strong>n sich viele Kliffe, Dünen und Nehrungen, die nach <strong>de</strong>m Auftreffen auf Land viele Binnengewässer<br />
schaffen, wie z. B. das Jezioro Łebsko im Slowinzischen Nationalpark bei Łeba. Die bekanntesten Nehrungen sind die Halbinsel Hel und die Frische Nehrung. Die größte polnische<br />
Ostseeinsel ist Wolin. Die größten Hafenstädte sind Gdynia, Danzig (pln. Gdańsk), Stettin (pln. Szczecin) und Swinemün<strong>de</strong> (pln. Świnoujście). Die bekanntesten Ostseebä<strong>de</strong>r sind Sopot,<br />
Międzyzdroje, Kolberg (pln. Kołobrzeg), Łeba, Władysławowo und Jurata.<br />
Gebirge<br />
Die drei wichtigen Gebirgszüge Polens sind von West nach Ost die Su<strong>de</strong>ten, die Karpaten und das Heiligkreuzgebirge. Alle drei glie<strong>de</strong>rn sich wie<strong>de</strong>rum in kleinere Gebirge. Das Gebirge<br />
mit <strong>de</strong>r höchsten Reliefenergie sind die Su<strong>de</strong>ten, gefolgt vom Heiligkreuzgebirge, bei<strong>de</strong> mit Werten von teilweise über 600 m/km².[20]<br />
Charakteristisch für die Su<strong>de</strong>ten sind sanfte gleichmäßige Oberflächen in <strong>de</strong>n Höhenlagen und schroffe Ausformungen in <strong>de</strong>n Tallagen. Der höchste Teil <strong>de</strong>r Su<strong>de</strong>ten ist das<br />
Riesengebirge. Der ursprünglich das Gebirge be<strong>de</strong>cken<strong>de</strong> Mischwald wur<strong>de</strong> von Fichtenwäl<strong>de</strong>rn verdrängt.[21] Ab 1.250 Metern beginnt die Krummholzzone.[22]<br />
Die polnischen Karpaten haben größtenteils <strong>de</strong>n Charakter eines Mittelgebirges, nur in <strong>de</strong>r Tatra ist das Gebirge als Hochgebirge ein<strong>zu</strong>stufen. In <strong>de</strong>n äußeren Bereichen <strong>de</strong>r Karpaten<br />
herrschen weiche Formen vor, im inneren Bereich ist ein eher alpiner Bereich mit Karren, Hörnern, Hang- und Trogtälern.[23] Die Tatra gehört größtenteils <strong>zu</strong>r Slowakei in welcher auch<br />
die höchsten Erhebungen liegen.[24]<br />
Polen hat 21 Berge mit über 2.000 m Höhe, die sich alle in <strong>de</strong>r Tatra befin<strong>de</strong>n. Mit 2.499 m sind die Rysy mit <strong>de</strong>m Meerauge (pln. Morskie Oko), einem Bergsee, <strong>de</strong>r höchste Gipfel.<br />
Weitere Gipfel sind Mięguszowiecki Szczyt (2.438 m), Świnica (2.301 m) und Wołowiec (2064 m).[7] Die zweithöchste Gebirgskette in Polen sind die Beski<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Babia Góra<br />
(1.723 m) als höchstem Gipfel.[7] Gefolgt wer<strong>de</strong>n sie vom Riesengebirge, <strong>de</strong>ssen Schneekoppe (pln. Śnieżka) mit 1.602 m die höchste Erhebung <strong>de</strong>r Su<strong>de</strong>ten darstellt.[7]<br />
Der mit 2 m unter <strong>de</strong>m Meeresspiegel am tiefsten gelegene Punkt Polens befin<strong>de</strong>t sich bei Raczki Elbląskie in <strong>de</strong>r Nähe von Elbląg (Elbing) im Weichsel<strong>de</strong>lta.<br />
Bo<strong>de</strong>nnut<strong>zu</strong>ng<br />
27 Prozent <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s sind von Wald be<strong>de</strong>ckt.[25] Kiefern- und Buchenwäl<strong>de</strong>r dominieren in weiten Teil Polens.[26] Nordwestpolen wird dabei von Buchen dominiert, Richtung<br />
Nordosten treten verstärkt Fichten auf. In <strong>de</strong>n Gebirgen Südpolens fin<strong>de</strong>n sich vor allem Eichenmisch- und Tonnen-Buchenwäl<strong>de</strong>r.[26]
Über die Hälfte <strong>de</strong>r Fläche Polens wird landwirtschaftlich genutzt, wobei allerdings die Gesamtfläche <strong>de</strong>r Äcker <strong>zu</strong>rückgeht und gleichzeitig die verbliebenen intensiver bewirtschaftet<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Vieh<strong>zu</strong>cht ist insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Bergen weit verbreitet. Über ein Prozent <strong>de</strong>r Fläche (3.145 km²) wer<strong>de</strong>n in 23 Nationalparks geschützt. In dieser Hinsicht nimmt Polen <strong>de</strong>n<br />
ersten Platz in Europa ein. Drei weitere sollen in Masuren, im Krakauer-Tschenstochauer Jura und in <strong>de</strong>n Waldkarpaten neu geschaffen wer<strong>de</strong>n. Die meisten polnischen Nationalparks<br />
befin<strong>de</strong>n sich im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Zu<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n Sumpfgebiete an Flüssen und Seen in Zentralpolen geschützt, sowie Küstengebiete im Nor<strong>de</strong>n. Hin<strong>zu</strong> kommen zahlreiche Reservate<br />
und Schutzgebiete.<br />
Flora und Fauna<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r Tier- und Pflanzenarten ist in Polen europaweit am höchsten, ebenso die Anzahl <strong>de</strong>r bedrohten Arten.[27] So leben hier etwa noch Tiere, die in Teilen Europas bereits<br />
ausgestorben sind, etwa <strong>de</strong>r Wisent (poln. Żubr) im Urwald von Białowieża und in Podlachien sowie <strong>de</strong>r Braunbär in Białowieża, in <strong>de</strong>r Tatra und in <strong>de</strong>n Waldkarpaten, <strong>de</strong>r Wolf und <strong>de</strong>r<br />
Luchs in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Waldgebieten, <strong>de</strong>r Elch in Nordpolen, <strong>de</strong>r Biber in Masuren, Pommern und Podlachien. In <strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>rn trifft man auch auf Nie<strong>de</strong>r- und Hochwild (Rotwild,<br />
Rehwild und Schwarzwild). Zu<strong>de</strong>m gibt es im Osten Polens auch Urwäl<strong>de</strong>r, die nie von Menschen gero<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, wie <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>vor erwähnte Urwald von Białowieża. Große Waldgebiete<br />
gibt es auch in <strong>de</strong>n Bergen, Masuren, Pommern und Nie<strong>de</strong>rschlesien.<br />
Polen ist das wichtigste Brutgebiet <strong>de</strong>r europäischen Zugvögel. Ein Viertel aller Zugvögel, die im Sommer nach Europa kommen, brütet in Polen, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Seenplatten und <strong>de</strong>n<br />
Sumpfgebieten <strong>de</strong>r Biebrza, <strong>de</strong>s Narew und <strong>de</strong>r Warthe (pln. Warta), die jeweils durch einen Nationalpark geschützt wer<strong>de</strong>n.<br />
Klima<br />
Das Klima Polens ist ein gemäßigtes Übergangsklima. Hier trifft die trockene Luft aus <strong>de</strong>m eurasischem Kontinent mit <strong>de</strong>r feuchten Luft <strong>de</strong>s Atlantiks <strong>zu</strong>sammen. Im Nor<strong>de</strong>n und Westen<br />
herrscht vor allem ein gemäßigtes Seeklima, im Osten und Südosten Kontinentalklima.[28] Als Trennlinie gilt die Achse zwischen oberer Warthe und unterer Weichsel.[29]<br />
Im Juli bis September wehen die Win<strong>de</strong> meist aus westlicher Richtung, im Winter, beson<strong>de</strong>rs im Dezember und Januar, dominieren Win<strong>de</strong> aus Osten. Im Frühjahr und Herbst wechseln<br />
die Windrichtungen zwischen West und Ost. Die Windgeschwindigkeit liegt an <strong>de</strong>r Ostsee in <strong>de</strong>r Regel zwischen 2 bis 10 m/s, in <strong>de</strong>n Bergen treten auch Win<strong>de</strong> von über 30 m/s auf. In<br />
<strong>de</strong>r Tatra treten Föhnwin<strong>de</strong> auf.[28]<br />
An 120 bis 160 Tagen beträgt die Bewölkung über 80 Prozent, an 30 bis 50 Tagen ist die Bewölkung unter 20 Prozent.[28] Mit 1.700 mm pro Jahr im mehrjährigen Mittel fallen in <strong>de</strong>r<br />
Tatra die höchsten Nie<strong>de</strong>rschläge, die geringsten Nie<strong>de</strong>rschläge fallen mit unter 500 mm nördlich von Warschau, am Goplosee, westlich von Posen und bei Bydgoszcz. Weiter nördlich<br />
steigen die Nie<strong>de</strong>rschläge wie<strong>de</strong>r auf 650 bis teilweise 750 mm.[30] Die nie<strong>de</strong>rschlagreichsten Monate sind <strong>de</strong>r April und <strong>de</strong>r September.[31] Im unteren O<strong>de</strong>r-Warthe-Gebiet fällt an etwa<br />
30 Tagen Schnee, im Nordosten, <strong>de</strong>n Karpaten und in <strong>de</strong>n Beski<strong>de</strong>n sind es 100 bis 110 Tage. In <strong>de</strong>n Gebirgen bleibt <strong>de</strong>r Schnee 200 o<strong>de</strong>r mehr Tage liegen.[32]<br />
Die Jahresmitteltemperatur beträgt 5 bis 7 °C auf <strong>de</strong>n Anhöhen <strong>de</strong>r Pommerschen und Masurischen Seenplatte sowie auf <strong>de</strong>n Hochebenen. In <strong>de</strong>n Tälern <strong>de</strong>s Karpatenvorlands, <strong>de</strong>r<br />
Schlesischen und Großpolnischen Tiefebene beträgt sie 8 bis 10 °C. In <strong>de</strong>n höheren Gebieten <strong>de</strong>r Karpaten und Su<strong>de</strong>ten liegt die Temperatur bei 0 °C .[28] Der wärmste Monat ist <strong>de</strong>r Juli<br />
mit Mitteltemperaturen zwischen 16 und 19 °C. Dabei beträgt sie auf <strong>de</strong>n Gipfeln von Tatra und Su<strong>de</strong>ten 9 °C, an <strong>de</strong>r Küste 16 °C und in Zentralpolen 18 °C. Der kälteste Monat ist <strong>de</strong>r<br />
Januar. Frost gibt es von November bis März. An <strong>de</strong>r unteren O<strong>de</strong>r und <strong>de</strong>r Küste an durchschnittlich 25 Tagen und bis <strong>zu</strong> 65 Tagen im Nordosten um Suwałki.[28]<br />
Bevölkerung<br />
Einwohner und Ethnien<br />
Polen hat mit etwa 38 Millionen Einwohnern die achtgrößte Bevölkerungszahl in Europa und die sechstgrößte in <strong>de</strong>r Europäischen Union. Die Bevölkerungsdichte beträgt 122 Einwohner<br />
pro Quadratkilometer. Die Geburtenrate betrug 2008 1,31 Kin<strong>de</strong>r pro Frau.[33]<br />
Polen ist ethnisch betrachtet ein äußerst homogener Staat, was ein Novum in <strong>de</strong>r polnischen Geschichte darstellt. Nach <strong>de</strong>r Volkszählung von 2002 stellen die Polen mit 96,74 % die<br />
Mehrheitsbevölkerung.[34] Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg gehört es <strong>zu</strong> einem Ziel <strong>de</strong>s Staats Homogenität durch Vertreibung und Assimilation <strong>zu</strong> erreichen. In <strong>de</strong>r Verfassung von 1947
wur<strong>de</strong> Gleichheit <strong>de</strong>r Bürger ohne Ansehen <strong>de</strong>r Nationalität garantiert, beson<strong>de</strong>re Rechte für Min<strong>de</strong>rheiten wur<strong>de</strong>n aber erst 1960 ermöglicht.[35] Seit 1997 befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r<br />
Verfassung die Erwähnung <strong>de</strong>s Schutzes von Min<strong>de</strong>rheiten.[36]<br />
Nationale Min<strong>de</strong>rheiten sind die Deutschen mit 0,4 %, Weißrussen mit 0,13 %, Ukrainer mit 0,08 %, Roma mit 0,03 %, Russen, Lemken, und Litauer mit je 0,02 %. Zu <strong>de</strong>n Min<strong>de</strong>rheiten<br />
ohne formalen Anerkennung gehören die Schlesier, welche 0,45 % und die Kaschuben, die 0,01 % <strong>de</strong>r Bevölkerung Polens repräsentieren.[34] Das Gesetz über die nationalen und<br />
ethnischen Min<strong>de</strong>rheiten sowie über die Regionalsprache wur<strong>de</strong> 2005 erlassen. In diesem wird unter an<strong>de</strong>rem geregelt, dass in Gemein<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen mehr als 20 % <strong>de</strong>r Einwohner einer<br />
Min<strong>de</strong>rheit angehören, <strong>de</strong>ren Sprache als Hilfssprache genutzt wer<strong>de</strong>n kann. Einzige anerkannte Regionalsprache ist Kaschubisch.[35]<br />
Unter <strong>de</strong>n ausländischen Staatsangehörigen stellen Vietnamesen die größte ethnische Gruppe, gefolgt von Griechen und Armeniern.<br />
Die Zahl <strong>de</strong>r Auslandspolen weltweit wird auf 20 Millionen geschätzt.<br />
Sprache<br />
Polnisch ist die Lan<strong>de</strong>ssprache Polens. Zu <strong>de</strong>n 38 Millionen Polnischsprechern in Polen kommen noch ca. 15–18 Millionen im Ausland. Es gibt größere Sprecherzahlen in Russland,<br />
Litauen, Weißrussland, <strong>de</strong>r Ukraine und <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Nachfolgestaaten <strong>de</strong>r Sowjetunion sowie in Tschechien, aber auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland. Viele<br />
Polnischsprachige gibt es nicht nur in Europa, son<strong>de</strong>rn vor allem auch in <strong>de</strong>n Vereinigten Staaten, wo Schät<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong>folge etwa 6–10 Millionen Polnischsprachige leben, sowie in<br />
Kanada, Brasilien, Argentinien und Australien, was auf die vielen Auswan<strong>de</strong>rungswellen in <strong>de</strong>r polnischen Geschichte <strong>zu</strong>rückgeht.[37]<br />
Nach Russisch ist Polnisch die am häufigsten gesprochene slawische Sprache weltweit.<br />
Die polnische Sprache ist eng mit <strong>de</strong>m Tschechischen, <strong>de</strong>m Slowakischen <strong>de</strong>m Kaschubischen und <strong>de</strong>m Sorbischen verwandt.<br />
Die ältesten heute bekannten polnischen Schriftzeugnisse sind Namen und Glossen in lateinischen Schriftstücken, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Bulle von Gnesen <strong>de</strong>s Papstes Innozenz II. von<br />
1136, in <strong>de</strong>r fast 400 einzelne polnische Namen von Ortschaften und Personen auftauchen. Den ersten geschriebenen vollständigen Satz fand man dagegen in <strong>de</strong>r Chronik <strong>de</strong>s Kloster<br />
Heinrichau bei Breslau. Unter <strong>de</strong>n Einträgen <strong>de</strong>s Jahres 1270 fin<strong>de</strong>t sich eine Auffor<strong>de</strong>rung eines Mannes <strong>zu</strong> seiner mahlen<strong>de</strong>n Frau. „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj“, was in <strong>de</strong>r<br />
Überset<strong>zu</strong>ng lautet: „Lass mich jetzt mahlen, und du ruh dich aus.“<br />
Die mo<strong>de</strong>rne polnische Literatursprache entwickelte sich im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt auf <strong>de</strong>r Grundlage von Dialekten, die in <strong>de</strong>r Gegend von Posen im Westen Polens gesprochen wur<strong>de</strong>n. Im 16.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt erreichte die polnische Sprache einen Stand, <strong>de</strong>r sie wegen ihres Reichtums und ihrer Geschmeidigkeit <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wichtigsten Sprachen Mitteleuropas aufsteigen ließ. Die<br />
Gebil<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>r Renaissance kämpften um die weitere Entwicklung <strong>de</strong>s Polnischen und seine Durchset<strong>zu</strong>ng gegenüber <strong>de</strong>m Latein. „Die Völker außerhalb aber sollen wissen, dass die<br />
Polen keine Gänse sind, dass sie ihre eigene Sprache haben!“[38] lautete die berühmte Maxime <strong>de</strong>s als Vater <strong>de</strong>r polnischen Literatur gelten<strong>de</strong>n Mikołaj Rej aus <strong>de</strong>m Jahre 1562.<br />
Religion<br />
Seit <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg und <strong>de</strong>r Westverschiebung Polens ist das Land größtenteils katholisch. Fast 90 % sind römisch-katholisch, davon etwa 70 % praktizierend. 1,3 % <strong>de</strong>r Polen<br />
sind polnisch-orthodox, 0,3 % Zeugen Jehovas, 0,2 % griechisch-katholisch, 0,2 % evangelisch-lutherisch. Kleinere Min<strong>de</strong>rheiten bil<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem die Altkatholischen Mariaviten,<br />
die Polnisch-Katholischen, Pfingstler, Adventisten, Ju<strong>de</strong>n und Muslime (unter an<strong>de</strong>rem die Tataren bei Białystok). Die heute polnischen Regionen Nie<strong>de</strong>rschlesien, Lebus (Ost-<br />
Bran<strong>de</strong>nburg), Westpreußen, Hinterpommern und das südliche Ostpreußen waren vor <strong>de</strong>r Vertreibung <strong>de</strong>r ansässigen Bevölkerung nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg mehrheitlich evangelischlutherisch.<br />
Die ab 1945 aus Oberschlesien und <strong>de</strong>m Ermland vertriebenen <strong>de</strong>utschen Bevölkerungsteile waren <strong>de</strong>mgegenüber ebenso wie die dort bereits ansässige und neuangesie<strong>de</strong>lte<br />
polnische Bevölkerung mehrheitlich katholisch.<br />
Ein beson<strong>de</strong>rs hohes Ansehen in Polen besitzt <strong>de</strong>r verstorbene Papst Johannes Paul II. (1920–2005), <strong>de</strong>r vor seiner Papstwahl als Karol Wojtyła Erzbischof von Krakau war und eine<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> politische Rolle während <strong>de</strong>s Zusammenbruchs <strong>de</strong>s Ostblocks innehatte.<br />
Die polnischen Stämme waren ursprünglich Hei<strong>de</strong>n und hatten, ähnlich wie an<strong>de</strong>re Westslawen, ein polytheistisches Religionssystem, <strong>de</strong>ssen Hauptgott <strong>de</strong>r vierköpfige Świętowit war,
<strong>de</strong>ssen Statuen zwischen Pommern (z. B. bei Kap Arkona auf Rügen) und <strong>de</strong>r Ukraine (z. B. <strong>de</strong>r „Antichrist aus <strong>de</strong>m Zburz“) gefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Diese Religion konnte sich teilweise bis<br />
ins 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt behaupten. Insbeson<strong>de</strong>re im Nordosten wur<strong>de</strong> auch ein Ahnenkult gepflegt, <strong>de</strong>r teilweise bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt überdauerte und in <strong>de</strong>r Romantik unter an<strong>de</strong>rem von<br />
Adam Mickiewicz in seinem Drama Totenfeier wie<strong>de</strong>r aufgegriffen wur<strong>de</strong>.<br />
Die polnischen Stämme kamen wahrscheinlich im 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt über das Großmährische Reich mit <strong>de</strong>m christlichen Glauben erstmals in Kontakt. Die Wislanen in Kleinpolen wur<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r byzantinischen Slawenapostel Kyrill und Method von <strong>de</strong>n Herrschern <strong>de</strong>s Großmährischen Reiches unterworfen. Mährischen Chronisten <strong>zu</strong>folge soll bereits <strong>zu</strong> dieser Zeit<br />
das Christentum nach slawischem Ritus in <strong>de</strong>r Region um Krakau eingeführt wor<strong>de</strong>n sein. Im Jahre 965 heiratete <strong>de</strong>r Herzog von Polen, Mieszko I., die böhmische Prinzessin christlichen<br />
Glaubens Dubrawka und ließ sich im folgen<strong>de</strong>n Jahr nach lateinischem Ritus taufen. Damit hatten auch seine Untertanen <strong>de</strong>n neuen Glauben an<strong>zu</strong>nehmen. Polen war jedoch im<br />
Mittelalter nie religiös homogen. Noch bevor sich <strong>de</strong>r christliche Glaube endgültig durchsetzen konnte, wan<strong>de</strong>rten in <strong>de</strong>n nächsten Jahrhun<strong>de</strong>rten, begünstigt durch das Toleranzedikt von<br />
Kalisz von 1265 Ju<strong>de</strong>n aus Westeuropa und Hussiten aus Böhmen nach Polen ein. Durch die Union mit Litauen 1386 und 1569 kamen viele weißrussisch- und ukrainischsprachige<br />
orthodoxe Christen unter die Herrschaft <strong>de</strong>r polnischen Könige. Das Luthertum fand seit <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt beson<strong>de</strong>rs bei <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung in <strong>de</strong>n nordpolnischen Städten<br />
viele Anhänger, während <strong>de</strong>r Kalvinismus beim Kleina<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>r Szlachta, beliebt war. Es bil<strong>de</strong>te sich auch eine polnische Sekte <strong>de</strong>r arianischen Polnischen Brü<strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Leitung von<br />
Fausto Sozzini, die in Raków sogar eine eigene Universität grün<strong>de</strong>te. Der Sejm von 1555 <strong>de</strong>battierte über die Einführung einer protestantischen Nationalkirche in Polen. Diese wur<strong>de</strong><br />
zwar nicht eingeführt, doch die Warschauer Konfö<strong>de</strong>ration und die Articuli Henriciani von 1573 sicherten die individuelle Glaubensfreiheit in <strong>de</strong>r polnischen Verfassung, daher kam es in<br />
Polen nie <strong>zu</strong> Religionskriegen. 1596 wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Kirchenunion von Brest die griechisch-katholische Kirche gegrün<strong>de</strong>t. Im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt vermochte die Gegenreformation jedoch die<br />
meisten „An<strong>de</strong>rsgläubigen“ auf die katholische Seite <strong>zu</strong> ziehen.<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts sie<strong>de</strong>lte <strong>de</strong>r polnische König Jan Sobieski muslimische Tataren in Podlachien an. Eine relativ große muslimische Min<strong>de</strong>rheit lebte auch um Kamieniec<br />
Podolski in Podolien, das zwischen 1672 und 1699 <strong>zu</strong>m Osmanischen Reich gehörte.<br />
Die polnischen Ju<strong>de</strong>n sind seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt in zwei dominieren<strong>de</strong> Glaubensrichtungen getrennt, die aufgeklärten Haskalen und die orthodoxen Chassi<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte<br />
Frühgeschichte und Gründung<br />
Die Römer erwähnten bereits um Christi Geburt die Städte Kalisz und Truso. Germanische Stämme sie<strong>de</strong>lten einige Zeit vor 200 v. Chr. in großen Teilen <strong>de</strong>s heutigen Polens. Textquellen<br />
berichten über Goten, Vandalen, Lugier und Burgun<strong>de</strong>r. Archäologische Spuren sind die Przeworsker Kultur (ab 250 o<strong>de</strong>r 200 v. Chr.) und die Wielbark-Kultur (ab etwa 100 v. Chr.).<br />
Zwischen 200 n. Chr. und 450 n. Chr. zogen die Ostgermanen weiter ins heutige Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Tunesien und vermischten sich mit <strong>de</strong>n dortigen<br />
Bevölkerungen. Gleichzeitig kamen während <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung an<strong>de</strong>re Völker, darunter die Balten und Slawen in das heutige Polen. Dauerhaft sie<strong>de</strong>lten seit <strong>de</strong>m 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt die<br />
Westslawen im polnischen Gebiet. Vor <strong>de</strong>r Staatsgründung unternahmen die Wikinger, Ungarn und Mährer Raubzüge nach Polen. Mit dieser Zeit verbin<strong>de</strong>t man auch die Sagen um die<br />
ersten Urfürsten Polens Popiel, Piast, Lech und Siemowit.<br />
Polen, <strong>de</strong>ssen Name sich vom westslawischen Stamm <strong>de</strong>r Polanen ableitet, ist als Herzogtum im frühen 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Poznań (Posen) und Gniezno (Gnesen) aus gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n.<br />
Es wur<strong>de</strong> von 960 bis 992 von Herzog Mieszko I. aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Piasten regiert, <strong>de</strong>r nach und nach die an<strong>de</strong>ren westslawischen Stämme zwischen O<strong>de</strong>r und Bug unterwarf.<br />
966 ließ sich Mieszko I. nach römisch-katholischem Ritus taufen. Das Territorium erreichte durch Eroberungen unter Mieszko I. und seinem Sohn Bolesław <strong>de</strong>m Tapferen Grenzen, die<br />
<strong>de</strong>n heutigen Staatsgrenzen sehr nahe kamen. Um 997 schloss Polen ein enges politisch-militärisches Bündnis mit <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich, während <strong>de</strong>s Staatsakts <strong>zu</strong> Gnesen im<br />
Jahr 1000 wur<strong>de</strong> die Übereinkunft vom polnischen Herrscher Bolesław I. und Kaiser Otto III. bestätigt. Mit <strong>de</strong>r Krönung Bolesławs im Jahr 1025 wur<strong>de</strong> Polen in <strong>de</strong>n Stand eines<br />
Königreiches erhoben.<br />
Mittelalter und Neuzeit<br />
Während <strong>de</strong>r Regentschaft <strong>de</strong>s Piasten Kazimierz I., wur<strong>de</strong> die Hauptstadt 1040 von Gnesen nach Krakau verlegt. Nach <strong>de</strong>m Tod von Bolesław III. Schiefmund 1138 wur<strong>de</strong> die
Senioratsverfassung eingeführt, nach welcher die Söhne von Bolesław III. als Juniorherzöge unter <strong>de</strong>m Seniorat <strong>de</strong>s jeweils Ältesten <strong>de</strong>r Dynastie die ihnen unterstehen<strong>de</strong>n einzelnen<br />
Lan<strong>de</strong>steile regierten. Bis 1295 dauerte diese feudale Zersplitterung in Polen an. Dieser sogenannte Partikularismus führte <strong>zu</strong> einer starken politischen Schwächung Polens im 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt. Polen zerfiel 1138 in sechs unabhängige Herzogtümer: Kleinpolen, Großpolen, Pommern, Pommerellen, Schlesien und Masowien, das sogenannte „Seniorat Polen“. Die<br />
Jahre bis <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung waren durch feudalistische Territorialzersplitterung geprägt. Das im Osten gelegene Gebiet Kleinpolens zerfiel in das A<strong>de</strong>lsterritorium Sandomierz, das<br />
östliche Großpolen in die Herzogtümer Łęczyca und Sieradz, das westliche Masowien in das Herzogtum Kujawy. Zwei lehnsabhängige Fürstentümer trennten sich unter einheimischen<br />
Herrscherhäusern ganz vom Reichsverband und gingen ihre eigenen Wege, so Pommern 1181 unter <strong>de</strong>n Greifen und Pommerellen 1227 unter <strong>de</strong>n Sambori<strong>de</strong>n. Schlesien wur<strong>de</strong> 1348 im<br />
Vertrag von Namslau endgültig ein Teil Böhmens und damit <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches. Hin<strong>zu</strong> kamen in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten Eroberungen verschie<strong>de</strong>ner Staaten (Kgr.<br />
Böhmen, Mgf. Bran<strong>de</strong>nburg, Deutscher Or<strong>de</strong>n). Auch <strong>de</strong>r Mongolensturm <strong>de</strong>s Jahres 1241, und die nachfolgen<strong>de</strong>n großen Plün<strong>de</strong>rungszüge <strong>de</strong>r Tataren ließen die Bevölkerungszahl in<br />
<strong>de</strong>n polnischen Teilfürstentümern schrumpfen.<br />
Anfang <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> Polen unter <strong>de</strong>r Regentschaft von Władysław I. Ellenlang wie<strong>de</strong>rvereinigt. Sein Sohn, Kasimir <strong>de</strong>r Große, setzte <strong>de</strong>n väterlichen Kampf um die Einheit<br />
fort und leitete erfolgreich soziale und wirtschaftliche Reformen ein, die Polen <strong>zu</strong> einer machtvollen Position in Mitteleuropa verhalfen. 1386 heiratete <strong>de</strong>r litauische Großfürst Jagiełło<br />
die polnische Königin Jadwiga. Er, Władysław II. Jagiełło, nunmehr <strong>zu</strong>gleich litauischer Großfürst und polnischer König, schuf <strong>de</strong>n mächtigen Doppelstaat Polen-Litauen, <strong>de</strong>r für die<br />
nächsten 400 Jahre die Geschicke Mittel- und Osteuropas entschei<strong>de</strong>nd beeinflusste. Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, nach <strong>de</strong>r politischen Ausschaltung <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns in Preußen, stieg das<br />
aus Polen und Litauen hervorgegangene Großreich <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n Kontinentalmächte und war lange Zeit <strong>de</strong>r größte Staat Europas mit Einflusssphären vom Baltischen- <strong>zu</strong>m<br />
Schwarzen Meer und von <strong>de</strong>r Adria bis an die Tore Moskaus. Auf Betreiben <strong>de</strong>s letzten polnischen Königs aus <strong>de</strong>r Jagiellonen-Dynastie, Zygmunt August, wur<strong>de</strong> die Personalunion<br />
zwischen Polen und Litauen in Lublin im Jahr 1569 in eine Realunion umgewan<strong>de</strong>lt. Polen und Litauen bil<strong>de</strong>ten seit 1569 die sogenannte A<strong>de</strong>lsrepublik und damit <strong>de</strong>n ersten mo<strong>de</strong>rnen<br />
Staat Europas mit einem a<strong>de</strong>lsrepublikanischen System und einer Gewaltenteilung.<br />
Teilungen – Unterdrückung und Unabhängigkeitskampf<br />
Die A<strong>de</strong>lsrepublik stürzte im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt in eine dauerhafte Krise, die durch zahlreiche Kriege (mit Schwe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m Osmanischen Reich, Russland, Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen und<br />
Siebenbürgen), fehlen<strong>de</strong> politische Reformen und innere Unruhen gekennzeichnet war. Es kam <strong>zu</strong>r Bildung von Magnaten (sogenannten Konfö<strong>de</strong>rationen gegen die Interessen <strong>de</strong>s Staates<br />
und <strong>de</strong>s Königs), Kosakenaufstän<strong>de</strong>n und dauerhaften Konfrontationen mit <strong>de</strong>n Krim-Tataren in <strong>de</strong>n südöstlichen Woiwodschaften. Beson<strong>de</strong>rs die Wahl ausländischer Dynasten <strong>zu</strong><br />
polnischen Königen (sie verfügten über keine Hausmacht in Polen und waren vom Wohlwollen <strong>de</strong>s Hocha<strong>de</strong>ls abhängig) und die Uneinigkeit innerhalb <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls, <strong>de</strong>r Szlachta<br />
und Oligarchen, schwächten <strong>de</strong>n Staat beträchtlich. Insbeson<strong>de</strong>re die so genannte Sachsenzeit wird dabei aus polnischer Sicht als negativ für <strong>de</strong>n weiteren Bestand <strong>de</strong>s polnischen Staates<br />
eingestuft.<br />
Auch die Ratifizierung einer Verfassung 1791, <strong>de</strong>r ersten mo<strong>de</strong>rnen Verfassung Europas überhaupt, konnte <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik nicht stoppen. In <strong>de</strong>n drei Teilungen Polens<br />
1772, 1793 und 1795 wur<strong>de</strong> Polens innere Schwäche von seinen Nachbarn Preußen, Österreich und Russland ausgenutzt, welche Polen gleichzeitig überfielen und am En<strong>de</strong> unter sich<br />
aufteilten. Polen wur<strong>de</strong> damit seiner Souveränität beraubt und in drei unterschiedliche Staaten zerrissen.<br />
Auf Drängen <strong>de</strong>s französischen Kaisers Napoleon entstand 1807, im Rahmen <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns von Tilsit, aus <strong>de</strong>n preußischen Erwerbungen <strong>de</strong>r Zweiten und Dritten Teilung ein relativ<br />
kleines Herzogtum Warschau, als Vasallenstaat Frankreichs, <strong>de</strong>m es 1809 gelang, Teile Kleinpolens (Westgalizien) von Österreich <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern. Aufgrund <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlagen <strong>de</strong>r<br />
polnisch-französischen Allianz im Russlandfeld<strong>zu</strong>g 1812 und in <strong>de</strong>r Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813 kam es <strong>zu</strong> keiner Wie<strong>de</strong>rherstellung Polens und das Herzogtum wur<strong>de</strong> auf<br />
<strong>de</strong>m durch die Teilungsmächte dominierten Wiener Kongress aufgeteilt. Große Teile Großpolens fielen als Provinz Posen wie<strong>de</strong>r an Preußen. Krakau wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Stadtstaat, <strong>de</strong>r Republik<br />
Krakau. Der Rest, das sogenannte „Kongresspolen“, wur<strong>de</strong> als „Königreich Polen“ 1815 in Personalunion mit <strong>de</strong>m Zarenreich verbun<strong>de</strong>n, war also formal bis auf <strong>de</strong>n gemeinsamen<br />
Herrscher von Russland unabhängig. Bis 1831 genoss dieses polnische Staatswesen weitgehen<strong>de</strong> Autonomie. Mit <strong>de</strong>m Aufkommen <strong>de</strong>s Nationalismus beim Übergang von <strong>de</strong>r<br />
Feudalgesellschaft <strong>zu</strong>m Kapitalismus wur<strong>de</strong> durch die zaristische Verwaltung versucht, diese Autonomie Schritt für Schritt ab<strong>zu</strong>schaffen.<br />
Dadurch kam es <strong>zu</strong>m fehlgeschlagenen Novemberaufstand von 1830, in <strong>de</strong>m die Polen versuchten, die russische Fremdherrschaft und Dominanz ab<strong>zu</strong>schütteln. Mit <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage wur<strong>de</strong><br />
die polnische Bevölkerung seit 1831 in <strong>de</strong>n preußischen und russischen Besat<strong>zu</strong>ngszonen einer verstärkten Germanisierung – <strong>de</strong>n preußischen Volkszählungen <strong>zu</strong>folge ohne größere<br />
Auswirkungen auf die Bevölkerungsverhältnisse – und Russifizierung unterzogen, die nach <strong>de</strong>m zweiten, gescheiterten Aufstand, <strong>de</strong>m Januaraufstand von 1863, beson<strong>de</strong>rs forciert wur<strong>de</strong>.
Die Bezeichnung Polen wur<strong>de</strong> verboten und das Land durch die russische Obrigkeit in Weichselland umbenannt. Ähnlich verfuhren auch die Hohenzollern in Pommerellen und<br />
Großpolen: In Volkszählungen tauchen Polen als Nationalität auf, aber als zeitgenössischer geografischer Begriff wird Polen in preußischen Schulbüchern und allen <strong>de</strong>utschsprachigen<br />
Kartenwerken auf <strong>de</strong>n russischen Teil beschränkt. Nur im von Österreich besetzten polnischen Galizien konnten die Polen durch die politischen Reformen <strong>de</strong>s Hauses Habsburg-<br />
Lothringen in <strong>de</strong>r Donaumonarchie seit 1867 <strong>de</strong>r geistig-nationalen Unterdrückung in <strong>de</strong>n von Preußen und Russland dominierten Teilen Polens entkommen, das von da ab das<br />
Fundament <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgeburt Polens nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg bil<strong>de</strong>te.<br />
Unabhängigkeit und die Zweite Republik (1918–1939)<br />
Während <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges beschlossen die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn die Gründung eines selbständigen polnischen Staates auf <strong>de</strong>m Territorium<br />
Kongresspolens. Dies war aber eher eine gegen Russland gerichtete Maßnahme als eine Anerkennung <strong>de</strong>s Rechts aller Polen auf Eigenstaatlichkeit. Durch die Kriegsereignisse bedingt,<br />
hatte <strong>de</strong>r Beschluss keine praktischen Auswirkungen. 1916 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>nnoch das in Analogie <strong>zu</strong>m Entschluss <strong>de</strong>s Wiener Kongresses benannte Königreich Polen durch das Deutsche Reich<br />
ausgerufen.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Teilungsmächte erlangte Polen nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg seine Souveränität 1918 <strong>zu</strong>rück. Im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Versailles wur<strong>de</strong> die Unabhängigkeit<br />
Polens 1919 im internationalen Rahmen bestätigt. Polen war damit Gründungsmitglied <strong>de</strong>s Völkerbun<strong>de</strong>s.<br />
Durch die Siegermächte wur<strong>de</strong>n in Osteuropa Grenzen nach Bevölkerungsmehrheiten vorgesehen. Fe<strong>de</strong>rführend war dabei <strong>de</strong>r britische Außenminister Lord George Nathaniel Curzon.<br />
Die Weimarer Republik war gezwungen, die preußischen Provinzen Westpreußen und Posen auf<strong>zu</strong>geben, die im Rahmen <strong>de</strong>r Polnischen Teilungen vom Königreich Preußen annektiert<br />
wor<strong>de</strong>n waren. Unmittelbar danach verließen 200.000 Deutsche die <strong>de</strong>r Republik Polen <strong>zu</strong>gesprochene Gebiete.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r unklaren politischen Verhältnisse nach <strong>de</strong>m Zusammenbruch <strong>de</strong>r Hohenzollern- und Romanow-Monarchien kam es während <strong>de</strong>r ersten Konsolidierungsphase <strong>de</strong>s neuen<br />
Staates <strong>zu</strong> Konflikten mit <strong>de</strong>n Nachbarstaaten, <strong>zu</strong>m Beispiel mit Deutschland um Oberschlesien in <strong>de</strong>r Schlacht um St. Annaberg o<strong>de</strong>r um die Stadt Vilnius (pln. Wilno) im heutigen<br />
Litauen.<br />
Bereits im August 1920 überrannte die Rote Armee während <strong>de</strong>s Polnisch-Sowjetischen-Krieges weite Gebiete <strong>de</strong>s neuen Staates. Nach <strong>de</strong>m Sieg Marschall Józef Piłsudskis gegen die<br />
Bolschewiken an <strong>de</strong>r Weichsel wur<strong>de</strong> im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Riga am 18. März 1921 Polens Ostgrenze etwa 250 km östlich <strong>de</strong>r Curzon-Linie festgelegt.<br />
Die Curzon-Linie markierte die östliche Grenze <strong>de</strong>s geschlossenen polnischen Siedlungsgebietes, während die östlichen Gebiete eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus Polen,<br />
Ukrainern, Weißrussen, Litauern, Ju<strong>de</strong>n und Deutschen aufwiesen, wobei Polen in vielen Städten und die an<strong>de</strong>ren Bevölkerungsgruppen auf <strong>de</strong>m Land dominierten. Während die<br />
Bevölkerungsmehrheit <strong>de</strong>r Städte meist römisch-katholisch o<strong>de</strong>r jüdisch war, war die Landbevölkerung überwiegend orthodox. Gleichwohl verfehlte Piłsudski sein Ziel, die Ukraine als<br />
unabhängigen „Pufferstaat“ zwischen Polen und Sowjetrussland <strong>zu</strong> etablieren. In Riga erkannte Polen die Ukraine als Teil <strong>de</strong>r späteren Sowjetunion unter Mykola Skrypnyk an. In <strong>de</strong>n<br />
von Sowjetrussland Polen <strong>zu</strong>gesprochenen Gebieten, östlich <strong>de</strong>s Westlichen Bugs, bil<strong>de</strong>ten die Polen 1919 25 % <strong>de</strong>r Bevölkerung, 1939, nach einer Ansiedlungspolitik mit Bevor<strong>zu</strong>gung<br />
von Polen während <strong>de</strong>r Amtszeit Piłsudskis, waren es bereits etwa 38 %. Polnische Sprachinseln im je nach Region mehrheitlich ukrainisch, weißrussischen o<strong>de</strong>r litauischen Umland,<br />
waren die Regionen Vilnius (poln. Wilno) und Lemberg (poln. Lwów). Insgesamt waren in <strong>de</strong>m Gebiet 1939 von 13,5 Millionen Einwohnern etwa 3,5 Millionen Polen.<br />
Die innere Konsolidierung <strong>de</strong>s neuen Staates wur<strong>de</strong> erschwert durch die Zersplitterung <strong>de</strong>r politischen Parteien, die in <strong>de</strong>r Teilungszeit entstan<strong>de</strong>nen unterschiedlichen Wirtschafts-,<br />
Bildungs-, Justiz- und Verwaltungssysteme sowie durch die Existenz starker ethnischer Min<strong>de</strong>rheiten (31 % <strong>de</strong>r Gesamtbevölkerung). Außenpolitisch war Polen <strong>zu</strong>nächst in das<br />
französische Allianzsystem einbezogen. Eine restriktive Politik gegenüber <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit, die <strong>zu</strong>r Emigration etwa einer Million <strong>de</strong>utschsprachiger Staatsbürger führte, die<br />
Weigerung <strong>de</strong>r Regierung Stresemann, die neue <strong>de</strong>utsche Ostgrenze an<strong>zu</strong>erkennen, ein „Zollkrieg“ um die oberschlesische Kohle sowie <strong>de</strong>r politisch-weltanschauliche Gegensatz <strong>zu</strong>m<br />
Sowjetsystem schlossen eine Kooperation Polens mit seinen bei<strong>de</strong>n größten Nachbarn aus.<br />
Am 12. Mai 1926 gewann Marschall Piłsudski nach einem Staatsstreich die Macht (1926–1928 und 1930 als Ministerpräsi<strong>de</strong>nt, 1926–1935 als Kriegsminister). Zur außenpolitischen<br />
Absicherung wur<strong>de</strong>n Nichtangriffsverträge mit <strong>de</strong>r Sowjetunion (1932) und <strong>de</strong>m Deutschen Reich (1934) geschlossen. Außenminister Józef Beck strebte <strong>de</strong>n Aufstieg Polens <strong>zu</strong>r<br />
ostmitteleuropäischen Hegemonialmacht im Rahmen eines neuen Europa von <strong>de</strong>r Ostsee bis <strong>zu</strong>r Adria an, seine Pläne scheiterten jedoch aufgrund <strong>de</strong>r geopolitischen Lage.
Kurz bevor Polen selbst vom nationalsozialistischen Deutschland angegriffen wur<strong>de</strong>, stellte es im Zuge <strong>de</strong>s Münchener Abkommens territoriale For<strong>de</strong>rungen an die Tschechoslowakei. Im<br />
Oktober 1938 annektierte Polen, gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>r tschechischen Regierung, das Olsagebiet, welches 1919 von <strong>de</strong>r Tschechoslowakei besetzt, mehrheitlich aber von Polen bewohnt<br />
wur<strong>de</strong>. Am 1. September 1939 wur<strong>de</strong> Polen vom Deutschen Reich und <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Vasallenstaat Slowakei, unter Jozef Tiso, angegriffen. Zunächst besetzten Truppen <strong>de</strong>s Deutschen<br />
Reichs und <strong>de</strong>r Slowakei die westlichen Teile <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und am 17. September folgte, unter <strong>de</strong>m Vorwand <strong>de</strong>s „Schutzes“ <strong>de</strong>r weißrussisch-ukrainischen Bevölkerung, die sowjetische<br />
Beset<strong>zu</strong>ng Ostpolens. Die Annexion und Aufteilung <strong>de</strong>s polnischen Staatsgebietes war <strong>zu</strong>vor in einem geheimen Zusatzprotokoll <strong>zu</strong>m Hitler-Stalin-Pakt von <strong>de</strong>n Diktatoren beschlossen<br />
wor<strong>de</strong>n. Damit nahm <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg seinen Anfang, in <strong>de</strong>m sechs Millionen polnische Staatsbürger, darunter fast die Hälfte jüdischer Abstammung, ihr Leben verlieren sollten.<br />
Zweiter Weltkrieg (1939–1945)<br />
Mit <strong>de</strong>m Angriff Deutschlands am 1. September auf Polen begann <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg. Am 17. September 1939 marschierte die Roten Armee in Ostpolen ein. Anschließend wur<strong>de</strong> die<br />
polnische Regierung am 17./18. September 1939 über das neutrale Rumänien nach Paris, später nach London evakuiert und organisierte von dort aus die Streitkräfte und <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand<br />
neu. An<strong>de</strong>rs als im Westen machte Hitler schon vorher klar, dass er die „Liquidierung <strong>de</strong>s führen<strong>de</strong>n Polentums“ (Reinhard Heydrich) ins Auge fasste. Allein in <strong>de</strong>n ersten vier Monaten<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Besat<strong>zu</strong>ngsherrschaft wur<strong>de</strong>n mehrere 10.000 Personen erschossen. Bereits Anfang <strong>de</strong>r 1940er-Jahre errichteten die Nationalsozialisten mehrere Konzentrationslager auf<br />
<strong>de</strong>m Gebiet Polens, unter an<strong>de</strong>ren Auschwitz, Majdanek und Treblinka. Die Besat<strong>zu</strong>ngszeit hatte für große Teile <strong>de</strong>r polnischen Zivilbevölkerung katastrophale Folgen. In manchen Fällen<br />
beteiligten sich allerdings auch die Polen an <strong>de</strong>r Unterdrückung und Ausrottung <strong>de</strong>r polnischen Ju<strong>de</strong>n. Polen wur<strong>de</strong> gemäß <strong>de</strong>s Hitler-Stalin-Paktes im Westen von <strong>de</strong>r Wehrmacht und im<br />
Osten von <strong>de</strong>r Roten Armee besetzt.<br />
Zu <strong>de</strong>n übergreifen<strong>de</strong>n Zielen <strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ngspolitik im gesamten Gebiet gehörte erstens die Ausschaltung und Vernichtung <strong>de</strong>r polnischen Ju<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r polnischen Intelligenz, zweitens<br />
die Vorverlegung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Ostgrenze und die Erweiterung <strong>de</strong>s „Lebensraums im Osten“ und drittens die Stärkung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kriegswirtschaft durch Ausbeutung <strong>de</strong>s<br />
Arbeitskräftepotenzials <strong>de</strong>r Zwangsarbeiter und <strong>de</strong>r materiellen Ressourcen Polens. Großpolen, die 1919 an Polen abgetretenen Teile Westpreußens sowie Ostoberschlesien wur<strong>de</strong>n direkt<br />
von Deutschland annektiert. Kleinpolen, Masowien und Galizien mit etwa 10 Millionen Menschen wur<strong>de</strong>n als sogenanntes „Generalgouvernement“ <strong>de</strong>m Reichsminister Hans Frank<br />
unterstellt, <strong>de</strong>r vom Königssitz <strong>de</strong>r frühen polnischen Könige, <strong>de</strong>m Wawel in Krakau, die Vernichtungspolitik leitete.<br />
Auch die Polen, die unter sowjetische Herrschaft gerieten, waren von Gewaltmaßnahmen betroffen. Man schätzt, dass ungefähr 1,5 Millionen ehemalige polnische Bürger <strong>de</strong>portiert<br />
wur<strong>de</strong>n. 300.000 polnische Soldaten gingen in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nur 82.000 von ihnen überlebten. Ein Großteil <strong>de</strong>r Offiziere, etwa 30.000 Personen, wur<strong>de</strong> durch<br />
sowjetische Truppen 1940 im Massaker von Katyn und in <strong>de</strong>n Kriegsgefangenenlagern von Starobilsk, Koselsk und Ostaschkow ermor<strong>de</strong>t.<br />
1941 entstand im Hinterland <strong>de</strong>r Sowjetunion aus polnischen Soldaten die „An<strong>de</strong>rs-Armee“ in Stärke von sechs Divisionen. Mangels Ausrüstung und Verpflegung wur<strong>de</strong>n diese Einheiten<br />
jedoch bereits 1942 über Persien in <strong>de</strong>n Nahen Osten verlegt, wo sie <strong>de</strong>m britischen Nahostkommando unterstellt wur<strong>de</strong>n. Später kämpften sie als 2. Polnisches Korps in Italien.<br />
Polnische Soldaten kämpften auf Seiten <strong>de</strong>r Alliierten an allen Fronten <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges von <strong>de</strong>r Luftschlacht um England, in Afrika, <strong>de</strong>r Sowjetunion, bis <strong>zu</strong>r Invasion in <strong>de</strong>r<br />
Normandie und in Italien. Die polnischen Soldaten stellten damit noch vor <strong>de</strong>n Franzosen die viertgrößte Armee <strong>de</strong>r Alliierten auf <strong>de</strong>m europäischen Kontinent. Polnische<br />
Partisanengruppen, die die größte Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung im besetzten Europa darstellten, leisteten auch in Polen selbst Wi<strong>de</strong>rstand. Nach<strong>de</strong>m die Rote Armee im Januar 1944 die<br />
polnische Grenze von 1939 überschritten hatte, wur<strong>de</strong>n die Truppen <strong>de</strong>r Heimatarmee vom NKWD entwaffnet, ihre Offiziere erschossen o<strong>de</strong>r in einen Gulag geschickt. Der Kampf<br />
einzelner Untergrun<strong>de</strong>inheiten dauerte jedoch bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1940er Jahre an.<br />
Am 1. August 1944 begann auf Befehl <strong>de</strong>r Londoner Exilregierung <strong>de</strong>r Warschauer Aufstand. Die Sowjetunion, <strong>de</strong>ren Truppen bereits am Ostufer <strong>de</strong>r Weichsel stan<strong>de</strong>n, hatte kein<br />
Interesse, die Einheiten <strong>de</strong>r Heimatarmee <strong>zu</strong> unterstützen. Die große Entfernung machte eine Hilfe <strong>de</strong>r Westalliierten unmöglich. So konnten <strong>de</strong>utsche Truppen die größte europäische<br />
Erhebung gegen die Okkupanten nie<strong>de</strong>rschlagen. Die Zahl <strong>de</strong>r Toten wird auf 180.000 bis 250.000 geschätzt. Dabei wur<strong>de</strong> die Innenstadt Warschaus unter großem Einsatz an<br />
Sprengmaterial nahe<strong>zu</strong> vollständig zerstört.<br />
Volksrepublik – Sozialismus und Solidarność (1945–1989)<br />
Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges 1945 wur<strong>de</strong>n die Grenzen <strong>de</strong>s ehemaligen polnischen Staatsgebietes gemäß <strong>de</strong>m Potsdamer Abkommen nach Westen verschoben. Polen verlor
das ethnisch gemischte, mehrheitlich von Ukrainern und Weißrussen bevölkerte Drittel seines bisherigen Staatsgebietes an die Sowjetunion. Die dort ansässige polnische Bevölkerung,<br />
etwa 1,5 Millionen Menschen, wur<strong>de</strong> repatriiert. Aus <strong>de</strong>m heutigen Ostpolen wur<strong>de</strong>n etwa eine Million Ukrainer in die Sowjetunion und in die West- und Nordgebiete Polens<br />
zwangsumgesie<strong>de</strong>lt. Bereits in <strong>de</strong>n Jahren 1943–1944 waren Zehntausen<strong>de</strong> Polen in <strong>de</strong>n Massakern in Wolhynien ermor<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n, viele mussten flüchten.<br />
Im Westen und Nor<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n Polen die <strong>de</strong>utschen Gebiete östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r und Lausitzer Neiße („O<strong>de</strong>r-Neiße-Linie“) <strong>zu</strong>gesprochen. Etwa fünf Millionen Deutsche waren gegen<br />
Kriegsen<strong>de</strong> von dort geflohen und wur<strong>de</strong>n durch Einreiseverbot an einer Rückkehr gehin<strong>de</strong>rt. Aus <strong>de</strong>n Ostgebieten wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Krieg weitere fünf Millionen Menschen aus ihrer<br />
Heimat vertrieben.<br />
Die Gebiete wur<strong>de</strong>n später überwiegend mit Bürgern aus Zentralpolen (drei Millionen), darunter etwa eine halbe Million von Polen zwangsumgesie<strong>de</strong>lte Ukrainer, und mit Repatrianten<br />
aus <strong>de</strong>n ehemaligen polnischen Ostgebieten (etwa zwei Millionen) besie<strong>de</strong>lt. Einige Oberschlesier, Masuren und Deutsche blieben als Min<strong>de</strong>rheit <strong>zu</strong>rück.<br />
Die neuen Grenzen wur<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Potsdamer Konferenz im August 1945 geregelt. Mit <strong>de</strong>m Görlitzer Abkommen zwischen <strong>de</strong>r neu entstan<strong>de</strong>nen DDR und Polen vom 6. Juli 1950 wur<strong>de</strong><br />
diese Grenzziehung von <strong>de</strong>r DDR und durch <strong>de</strong>n in Warschau geschlossenen Vertrag vom 7. Dezember 1970 von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland anerkannt.<br />
Auf die <strong>de</strong>utsche Besat<strong>zu</strong>ng während <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges folgte die kommunistische Diktatur. Das Land kam in <strong>de</strong>n Einflussbereich <strong>de</strong>r Sowjetunion und wur<strong>de</strong> als Volksrepublik<br />
Polen Teil <strong>de</strong>s Ostblocks. Ab 1956 kam es nach Aufstän<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> einer Entstalinisierung unter <strong>de</strong>m Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r kommunistischen Partei Władysław Gomułka. Polen wur<strong>de</strong> bis 1989 in<br />
<strong>de</strong>n Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und <strong>de</strong>n Warschauer Pakt eingebun<strong>de</strong>n. Durch mehrere Aufstän<strong>de</strong> äußerte die polnische Bevölkerung immer wie<strong>de</strong>r ihren Unmut gegenüber <strong>de</strong>r<br />
kommunistischen Führung (z. B. im Posener Aufstand). 1968 beteiligte sich die VR Polen an <strong>de</strong>r militärischen Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>s Prager Frühlings. In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m 21. August 1968<br />
besetzten polnische Truppen gemeinsam mit Truppen <strong>de</strong>r Sowjetunion, Bulgariens und Ungarns die ČSSR und schlugen die Demokratiebewegung nie<strong>de</strong>r.<br />
Erst die Gründung <strong>de</strong>r Gewerkschaft Solidarność unter Lech Wałęsa führte schließlich <strong>zu</strong> einem gesellschaftlich-politischen Umschwung im Land und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n revolutionären Ereignissen<br />
von 1980 bis 1989, die <strong>zu</strong>erst in <strong>de</strong>r Verhängung <strong>de</strong>s Kriegsrechts und schließlich in <strong>de</strong>n ersten freien Wahlen im Ostblock am 4. und 18. Juni 1989 mün<strong>de</strong>ten. An <strong>de</strong>ren En<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
sogenannte Ostblock und anschließend auch die Sowjetunion aufgelöst und das kommunistische Regime durch eine <strong>de</strong>mokratische Regierungsform ersetzt.<br />
Dritte Republik – Marktwirtschaft und parlamentarische Demokratie (seit 1989)<br />
Bei <strong>de</strong>n Parlamentswahlen vom 4. und 18. Juni 1989 gewann das „Bürgerkomitee Solidarność“, die politische Organisation <strong>de</strong>r Gewerkschaft Solidarność, sämtliche 160 (von 460)<br />
freigewählten Sitzen im Abgeordnetenhaus und 99 von 100 Sitzen im neugebil<strong>de</strong>ten Senat. Ta<strong>de</strong>usz Mazowiecki wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m ersten nichtkommunistischen Ministerpräsi<strong>de</strong>nten Polens seit<br />
1945 (sowie <strong>zu</strong>m ersten nichtkommunistischen Regierungschef im Warschauer Pakt) gewählt, von <strong>de</strong>n 23 Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Regierung waren nur vier Kommunisten. Seit 1989 wur<strong>de</strong> die<br />
polnische Wirtschaft nach <strong>de</strong>m Balcerowicz-Plan mit schnellen Schritten in eine funktionieren<strong>de</strong> Marktwirtschaft umgewan<strong>de</strong>lt. Im Dezember 1990 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ehemalige Solidarność-<br />
Vorsitzen<strong>de</strong> Lech Wałęsa in einer Volkswahl <strong>zu</strong>m Staatspräsi<strong>de</strong>nten gewählt. 1991 en<strong>de</strong>te die Mitgliedschaft im Warschauer Pakt durch Auflösung <strong>de</strong>s Militärbündnisses.<br />
Im Dezember 1995 wur<strong>de</strong> Aleksan<strong>de</strong>r Kwaśniewski <strong>zu</strong>m Nachfolger Wałęsas als Staatspräsi<strong>de</strong>nt gewählt. Während Kwaśniewskis Amtszeit trat Polen 1999 <strong>de</strong>r NATO und 2004 <strong>de</strong>r<br />
Europäischen Union bei.<br />
Am 1. Mai 2004 wur<strong>de</strong> Polen, <strong>zu</strong>sammen mit neun weiteren Staaten, Mitglied <strong>de</strong>r Europäischen Union. Polen ist unter <strong>de</strong>n mittlerweile 15 neuen Mitgliedstaaten das<br />
bevölkerungsreichste und flächenmäßig größte Land.<br />
Während <strong>de</strong>s Konfliktes um die Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen im Nachbarstaat Ukraine im November und Dezember 2004 engagierte sich <strong>de</strong>r polnische Präsi<strong>de</strong>nt Aleksan<strong>de</strong>r Kwaśniewski als<br />
Vermittler zwischen <strong>de</strong>n Konfliktparteien, während die polnische Öffentlichkeit und die Medien in beson<strong>de</strong>rs hohem Ausmaß Solidarität mit <strong>de</strong>r Ukraine und ihrem neuen Präsi<strong>de</strong>nten<br />
Wiktor Juschtschenko übten.<br />
Im Herbst 2005 konnte die nationalkonservative Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS, dt. Recht und Gerechtigkeit) die sehr schlecht frequentierten Sejm- und Senatswahlen sowie ihr<br />
Kandidat Lech Kaczyński die Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen gewinnen. Einer Min<strong>de</strong>rheitsregierung unter Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Kazimierz Marcinkiewicz wur<strong>de</strong> am 10. November 2005 das<br />
Vertrauen <strong>de</strong>s Sejm ausgesprochen. Am 5. Mai 2006 bil<strong>de</strong>te er mit <strong>de</strong>r klerikal-nationalistischen Liga Polskich Rodzin (LPR, dt. Liga Polnischer Familien) und <strong>de</strong>r linkspopulistischen<br />
Bauernpartei Samoobrona (dt. Selbstverteidigung) eine Koalition, die im Sejm über eine Mehrheit verfügte. Am 7. Juli 2006 kündigte Marcinkiewicz jedoch seinen Rücktritt als
Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Polens an, welcher am 10. Juli 2006 erfolgte. Das politische Komitee <strong>de</strong>r PiS empfahl <strong>de</strong>n Zwillingsbru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Staatspräsi<strong>de</strong>nten, Jarosław Kaczyński, für die<br />
Nachfolge, <strong>de</strong>r anschließend Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Polens wur<strong>de</strong>.<br />
Am 10. April 2010 starb <strong>de</strong>r amtieren<strong>de</strong> Staatspräsi<strong>de</strong>nt Lech Kaczyński bei einem Flugzeugabsturz in Russland.[39] Wie in <strong>de</strong>r polnischen Verfassung vorgesehen, übernahm Bronisław<br />
Komorowski in seiner Funktion als Sejmmarschall die Amtsgeschäfte <strong>de</strong>s verstorbenen Präsi<strong>de</strong>nten.<br />
Bei <strong>de</strong>r vorgezogenen Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahl am 20. Juni 2010 erreichte Bronisław Komorowski <strong>de</strong>n höchsten Stimmenanteil aller Kandidaten, verpasste aber die absolute Mehrheit. Aus<br />
<strong>de</strong>r damit nötigen Stichwahl gegen <strong>de</strong>n Zweitplatzierten Jarosław Kaczyński, <strong>de</strong>n Zwillingsbru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s verstorbenen Staatspräsi<strong>de</strong>nten, ging er erfolgreich hervor.<br />
Politik<br />
Politisches System<br />
Die Republik Polen ist eine parlamentarische Demokratie. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, Sejm (460 Abgeordnete) und Senat (100 Senatoren). Der polnische Sejm gehört <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n ältesten Parlamenten <strong>de</strong>r Welt; er existiert in verschie<strong>de</strong>nen Formen und mit Unterbrechungen seit 1493. Er hat, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Senat, die Legislative inne. Die im Parlament<br />
vertretenen polnischen Parteien gruppieren sich als Fraktionen in eine Regierung und die Opposition. Die Exekutive wird von einem Ministerpräsi<strong>de</strong>nten (pln. Prezes Rady Ministrów,<br />
kurz Premier) und einem Ministerrat ausgeführt, die vom Staatspräsi<strong>de</strong>nten ernannt wer<strong>de</strong>n und mit diesem gewisse Kompetenzen (Lan<strong>de</strong>sverteidigung, Außenpolitik) teilen, aber <strong>de</strong>m<br />
Parlament verantwortlich sind. Der Präsi<strong>de</strong>nt wird alle fünf Jahre vom Volk direkt gewählt. Einmalige Wie<strong>de</strong>rwahl ist möglich.<br />
Die Innenpolitik war in <strong>de</strong>n 1990er-Jahren von einem sich dynamisch verän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Parteienwesen geprägt. Mittlerweile haben sich feste Parteistrukturen aus <strong>de</strong>n zerfallen<strong>de</strong>n politischen<br />
Kräften <strong>de</strong>r Solidarność-Bewegung und <strong>de</strong>r kommunistischen Partei herausgebil<strong>de</strong>t. Das Augenmerk <strong>de</strong>r Innenpolitik fokussiert häuptsächlich auf <strong>de</strong>n Reformen die das Land im<br />
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig machen und erhalten sollen. Enttäuscht von einer dramatisch angestiegenen Arbeitslosigkeit und Verarmung eines großen Teils <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung sowie einer übermäßigen Vetternwirtschaft <strong>de</strong>r alten kommunistischen Eliten in Politik und Wirtschaft, <strong>de</strong>monstrierten viele polnische Bürger ihren Unmut mit einer<br />
Wahlenthaltung bei Europaparlament-, Sejm- und Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen bis 2005.<br />
Zu <strong>de</strong>n im Sejm vertretenen Parteien gehören seit <strong>de</strong>r Parlamentswahl am 21. Oktober 2007 die liberalkonservative Platforma Obywatelska (PO, dt. Bürgerplattform), die<br />
rechtskonservative Prawo i Sprawiedliwość (PiS, dt. Recht und Gerechtigkeit), das sozial<strong>de</strong>mokratisch und linksliberal orientierte Mitte-Links-Bündnis Lewica i Demokraci (LiD, dt.<br />
Linke und Demokraten) und die älteste durchgängig existieren<strong>de</strong> Partei Polens, die bereits im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt und in <strong>de</strong>r „Zweiten Republik“ eine wichtige Rolle spielte, die<br />
proeuropäisch gestimmte und sozialkonservative Bauernpartei Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, dt. Polnische Volkspartei). Alle an<strong>de</strong>ren Parteien sind bei <strong>de</strong>r Parlamentswahl im<br />
Oktober 2007 an <strong>de</strong>r 5-%-Hür<strong>de</strong> gescheitert. Die PO wur<strong>de</strong> hierbei stärkste Kraft und bil<strong>de</strong>t seit<strong>de</strong>m <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r PSL eine Koalitionsregierung unter <strong>de</strong>m PO-Vorsitzen<strong>de</strong>n Donald<br />
Tusk als Ministerpräsi<strong>de</strong>nt.<br />
Verwaltungsglie<strong>de</strong>rung<br />
Seit <strong>de</strong>m 1. Januar 1999 ist Polen in 16 Woiwodschaften (województwo) eingeteilt.<br />
Da Polen ein Zentralstaat ist, weisen die Woiwodschaften im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn keine Staatsqualität auf.<br />
Je<strong>de</strong> Woiwodschaft besitzt als Selbstverwaltungsorgane eine eigene Volksvertretung – Woiwodschaftssejmik (sejmik województwa) und einen von ihnen gewählten<br />
Woiwodschaftsvorstand (zarząd województwa) unter <strong>de</strong>m Woiwodschaftsmarschall (marszałek województwa) als Vorsitzen<strong>de</strong>m. Der Woiwo<strong>de</strong> (wojewoda) ist hingegen ein Vertreter <strong>de</strong>r<br />
Zentralregierung in Warschau und für Kontrolle <strong>de</strong>r Selbstverwaltung <strong>de</strong>r Woiwodschaften, Landkreise (powiat) und Gemein<strong>de</strong>n (gmina) <strong>zu</strong>ständig.<br />
Nächstkleinere Selbstverwaltungseinheit ist <strong>de</strong>r Powiat (Landkreis) mit 379 Einheiten welche sich wie<strong>de</strong>r in insgesamt 2.497 Gemein<strong>de</strong>n (gmina) unterteilen (Stand 1. Januar 2010).<br />
• Deutscher Name Polnischer Name Deutscher Name Polnischer Name<br />
•
• Ermland-Masuren Warmińsko-Ma<strong>zu</strong>rskie Lublin Lubelskie<br />
• Großpolen Wielkopolskie Masowien Mazowieckie<br />
• Heiligkreuz Świętokrzyskie Nie<strong>de</strong>rschlesien Dolnośląskie<br />
• Karpatenvorland Podkarpackie Oppeln Opolskie<br />
• Kleinpolen Małopolskie Podlachien Podlaskie<br />
• Kujawien-Pommern Kujawsko-Pomorskie Pommern Pomorskie<br />
• Lebus Lubuskie Schlesien Śląskie<br />
• Łódź (Lodsch) Łódzkie Westpommern Zachodniopomorskie<br />
Die größten Ballungszentren sind das Oberschlesische Industriegebiet, die Ballungsräume um Warschau und Łódź sowie das Weichsel<strong>de</strong>lta um die sogenannte „Dreistadt“ mit Danzig,<br />
Sopot und Gdynia. Eine Übersicht über die Städte bietet die Liste <strong>de</strong>r Städte in Polen, für die Gemein<strong>de</strong>n die Liste <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n in Polen.<br />
Außenpolitik<br />
Die Außenpolitik <strong>de</strong>r Dritten Polnischen Republik wird von <strong>de</strong>r Geschichte und <strong>de</strong>r geopolitischen Lage <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s bestimmt. Verantwortlich zeichnet <strong>de</strong>r Außenminister, <strong>de</strong>rzeit<br />
Radosław Sikorski, unterstützt vom Staatspräsi<strong>de</strong>nten.<br />
Die polnische Außenpolitik ist bis <strong>zu</strong> einem gewissen Grad an <strong>de</strong>n eigenen Vorstellungen von internationaler Position und möglichst uneingeschränkter Souveränität ausgerichtet. In <strong>de</strong>r<br />
EU sucht man ein hohes Maß an Eigenständigkeit. In Osteuropa sieht sich Polen als Anwalt <strong>de</strong>r Ukraine in Beziehungen <strong>zu</strong> NATO und EU.<br />
Zu <strong>de</strong>n ehemaligen Ostblock-Bündnispartnern versucht die polnische Regierung stabile, freundschaftliche, für die polnische Wirtschaft günstige Beziehungen aufrecht<strong>zu</strong>erhalten und<br />
aus<strong>zu</strong>bauen. Allerdings haben <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>r Ostseepipeline o<strong>de</strong>r die Errichtung eines Raktenabwehrprogrammes <strong>de</strong>r USA die Beziehungen Polens <strong>zu</strong> Russlands belastet.<br />
Lan<strong>de</strong>sverteidigung<br />
Der Präsi<strong>de</strong>nt ist oberster Befehlshaber über die polnischen Streitkräfte (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej). Unmittelbar untersteht das Militär jedoch <strong>de</strong>m Verteidigungsminister<br />
und besteht aus <strong>de</strong>n Landstreitkräften (Wojska Lądowe), <strong>de</strong>r Marine (Marynarka Wojenna) und <strong>de</strong>r Luftwaffe (Siły Powietrzne).<br />
In <strong>de</strong>n Zeiten <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik bestand die Wehrpflicht nur für die Szlachta <strong>zu</strong>m Verteidigungskrieg (pospolite ruszenie). Bekannt sind in <strong>de</strong>r Geschichte beson<strong>de</strong>rs die polnische<br />
Hussaria und die Ulanen, die sich in <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n- und Türkenkriegen auszeichneten.<br />
Die mo<strong>de</strong>rne polnische Armee entstand 1918 in <strong>de</strong>r Zweiten Republik mit anfangs über 800.000 Soldaten. In <strong>de</strong>r Volksrepublik unterstan<strong>de</strong>n die polnischen Streitkräfte im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Warschauer Paktes <strong>de</strong>r sowjetischen Führung.<br />
Nach 1989 wur<strong>de</strong> das Militär reformiert, die Zahl <strong>de</strong>r Soldaten von über 500.000 auf 150.000 Soldaten (plus 450.000 Reservesoldaten) reduziert und die Ausrüstung mo<strong>de</strong>rnisiert. Die<br />
polnischen Streitkräfte verfügen über neuestes Waffenmaterial, wie z. B. die amerikanischen F-16, die israelischen ATGM und die finnischen Patria AMV 8x8. Daneben wur<strong>de</strong>n die<br />
polnischen Waffenproduzenten durch Offset-Investitionen <strong>de</strong>r Amerikaner auf <strong>de</strong>n neuesten Stand gebracht und exportieren erfolgreich schweres Kriegsgerät weltweit. Eine neue<br />
Eliteeinheit, die GROM, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1990er Jahren eingeführt.<br />
Im März 1999 trat Polen <strong>de</strong>r NATO bei, nach<strong>de</strong>m es seit 1994 in <strong>de</strong>ren Programm „Partnerschaft für <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n“ mitgearbeitet hatte.<br />
Am 13. November 2006 wur<strong>de</strong> gemeinsam mit Deutschland, Lettland, Litauen und <strong>de</strong>r Slowakei ein Abkommen <strong>zu</strong>r Bildung einer gemeinsamen EU-Einsatztruppe unterzeichnet. Polen<br />
soll dabei das Oberkommando übernehmen und 750 Soldaten <strong>zu</strong>r Verfügung stellen.<br />
Bis 2008 bestand in Polen Wehrpflicht für Männer. Polnische Militäreinheiten waren 2010 im Ausland im Afghanistan (2.600 Soldaten), im Kosovo (320), in Bosnien und Herzegowina<br />
(204) und im Irak (20) im Einsatz.
Wirtschaft<br />
Die Wirtschaft Polens ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt – 430.197 Mio. USD[40] die 21. Größte <strong>de</strong>r Welt, bzw. mit 688.761 Mio. USD[41] die 20. Größte <strong>de</strong>r Welt nach<br />
Kaufkraftparität.<br />
Die Inflation betrug 2009 3,5 %.<br />
Bruttoinlandsprodukt<br />
• Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Bruttoinlandsprodukts (BIP)<br />
• in % gegenüber <strong>de</strong>m Vorjahr<br />
•<br />
• Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
• Verän<strong>de</strong>rung in % gg. Vj. 4,8 4,1 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,0 1,7<br />
•<br />
• Quelle: GUS[42]<br />
Das Bruttoinlandsprodukt ist regional sehr unterschiedlich verteilt. Die reichsten Regionen sind Masowien (133 % <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sdurchschnitts) und Nie<strong>de</strong>rschlesien (114 %). Die ärmsten<br />
Regionen sind Lublin (68 % <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sdurchschnitts), Karpatenvorland (71 %) und Heiligkreuz (74 %).[43]<br />
Arbeitsmarkt<br />
Im Juni 2004 lag die Arbeitslosenquote noch bei 19,5 %,[44] im Juni 2008 bei 9,6 %,[45] was ungefähr 1,5 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter ausmachte. Die Arbeitslosigkeit in<br />
Polen ist regional sehr unterschiedlich verteilt. In <strong>de</strong>n Städten Posen und Warschau liegt die Arbeitslosigkeit unter 3%, in <strong>de</strong>n ländlichen Regionen Masurens liegt sie hingegen bei über 20<br />
%.<br />
Außenwirtschaft<br />
Der Export umfasste im Jahre 2009 134,7 Mrd. USD und <strong>de</strong>r Import 141,7 Mrd. USD.[46] Mit 24,4 % <strong>de</strong>r Exporte und 28 % <strong>de</strong>r Importe stellte Deutschland <strong>de</strong>n größten Han<strong>de</strong>lspartner<br />
dar. Weitere wichtige Han<strong>de</strong>lspartner sind die EU-Staaten Italien, Frankreich, Großbritannien, Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> und die Tschechische Republik, sowie Russland, Volksrepublik China und die<br />
USA.<br />
Staatshaushalt<br />
Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 95,9 Mrd. USD, <strong>de</strong>m stan<strong>de</strong>n Einnahmen von umgerechnet 87,9 Mrd. USD gegenüber. Daraus ergibt sich ein<br />
Haushalts<strong>de</strong>fizit in Höhe von 1,8 % <strong>de</strong>s BIP.[46]<br />
Die Staatsverschuldung betrug 2009 199 Mrd. US-Dollar o<strong>de</strong>r 46,5 % <strong>de</strong>s BIP.[46]<br />
2006 betrug <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Staatsausgaben (in % <strong>de</strong>s BIP) folgen<strong>de</strong>r Bereiche:<br />
• Gesundheit:[47] 6,2 %<br />
• Bildung:[46] 5,5 % (2005)<br />
• Militär:[46] 1,7 % (2005)
Infrastruktur<br />
Verkehrswesen<br />
Polen ist ein wichtiges Transitland von Nor<strong>de</strong>uropa nach Sü<strong>de</strong>uropa und von Westeuropa nach Osteuropa. Bereits in <strong>de</strong>r Antike und im Mittelalter führten wichtige Han<strong>de</strong>lsstraßen durch<br />
das heutige Polen, wie z. B. die Bernsteinstraßen, <strong>de</strong>r europäische Abschnitt <strong>de</strong>r Sei<strong>de</strong>nstraße, die Han<strong>de</strong>lsroute von Westeuropa nach Asien.<br />
Straßenverkehr<br />
Das Straßennetz wird ständig ausgebaut, es fehlen aber zahlreiche Autobahnverbindungen. Das polnische Autobahnverkehrsnetz ist 2,5 Mal kleiner als das <strong>de</strong>r Schweiz (Stand 2007). Bis<br />
2020 soll <strong>de</strong>r Aufbau <strong>de</strong>s Autobahnnetzes vollständig abgeschlossen und über 2.000 km lang sein. Weitere 5.287 km Straßennetz sollen <strong>zu</strong> autobahnähnlichen Schnellstraßen (droga<br />
ekspresowa) ausgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
18.368 km Lan<strong>de</strong>sstraßen (droga krajowa) dienen – ähnlich wie die <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>sstraßen – <strong>de</strong>m nationalen und internationalen Verkehr. Zum 1. Januar 1999 wur<strong>de</strong>n 28.444 km<br />
Lan<strong>de</strong>sstraßen <strong>zu</strong> Woiwodschaftsstraßen (droga wojewódzka) herabgestuft. Daneben gibt es noch 128.870 km Kreisstraßen (droga powiatowa) und 203.773 km Gemein<strong>de</strong>straßen (droga<br />
gminna)[48]<br />
In Polen sind über 12 Mio. Pkw und zwei Mio. Lkw und an<strong>de</strong>re Nutzfahrzeuge registriert. Insgesamt waren En<strong>de</strong> 2007 383 Pkw je 1.000 Einwohner registriert, im EU-Durchschnitt sind<br />
es 486.[49]<br />
Dem in Polen trotz wachsen<strong>de</strong>m Individualverkehr immer noch sehr be<strong>de</strong>utsamen öffentlichen Verkehr dient ein ausge<strong>de</strong>hntes Überlandbusnetz.<br />
2004 starben in Polen 5.700 Menschen bei Verkehrsunfällen, das be<strong>de</strong>utet eine viermal höhere Rate als im Durchschnitt <strong>de</strong>r EU.[50] Dies ist aber bereits eine Verringerung <strong>de</strong>r Zahl, 1999<br />
waren es noch 6.730 Tote und 1998 – 7.080[51]. Stellen mit einer hohen Unfallrate wer<strong>de</strong>n häufig durch einen sogenannten Schwarzen Punkt (czarny punkt) gekennzeichnet.<br />
Es besteht seit 14. April 2007 die ganztägige und -jährliche Lichtpflicht für Pkw und Lkw, wobei Abblend- o<strong>de</strong>r Tagfahrlicht vorgeschrieben sind. Seit <strong>de</strong>m 1. Juni 2007 gilt beim Fahren<br />
von Kraftfahrzeugen ein absolutes Alkoholverbot, nach<strong>de</strong>m bis dahin eine Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille erlaubt war.<br />
Schienenverkehr<br />
Die polnische Eisenbahngesellschaft PKP gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n größten europäischen Eisenbahngesellschaften mit über 23.420 km Schienennetz. An <strong>de</strong>r polnischen Ostgrenze trifft das<br />
europäische Normalspurnetz auf das breitere russische Gleissystem, was Polen <strong>zu</strong>m Drehkreuz <strong>de</strong>s Ost-West-Schienenverkehrs macht.<br />
Flugverkehr<br />
Polen hat zehn internationale Flughäfen, <strong>de</strong>n Frédéric-Chopin-Flughafen in Warschau, <strong>de</strong>n Flughafen Johannes Paul II. in Krakau, <strong>de</strong>n Flughafen Kattowitz, <strong>de</strong>n Lech-Wałęsa-Flughafen<br />
Danzig, <strong>de</strong>n Flughafen Breslau, <strong>de</strong>n Flughafen Posen-Ławica, <strong>de</strong>n Flughafen Rzeszów-Jasionka, <strong>de</strong>n Władysław-Reymont-Flughafen Łódź, <strong>de</strong>n Flughafen Stettin-Goleniów, <strong>de</strong>n Ignacy-<br />
Jan-Pa<strong>de</strong>rewski-Flughafen Bydgoszcz, 123 nationale Flugplätze und drei Hubschrauberbasen. Die Anzahl <strong>de</strong>r Fluggäste steigt seit <strong>de</strong>r Öffnung <strong>de</strong>s polnischen Luftverkehrs für die<br />
Niedrigpreisfluglinien rasant.<br />
Seeverkehr<br />
Polen besitzt fast 4.000 Kilometer schiffbare Flüsse und Kanäle. Die Überseehan<strong>de</strong>lsflotte besteht aus über 100 Schiffen. Wichtigste Seehäfen sind Szczecin (Stettin), Gdynia (Gdingen),<br />
Gdańsk (Danzig), Świnoujście (Swinemün<strong>de</strong>), Ustka (Stolpmün<strong>de</strong>), Kołobrzeg (Kolberg) sowie im Binnenland Warszawa (Warschau), Gliwice (Gleiwitz) und Wrocław (Breslau).<br />
Bildung
Schulbildung<br />
Mit sieben Jahren wer<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>r in Polen eingeschult. Nach einem Beschluss <strong>de</strong>s Sejm wird dieses Alter ab 2012 auf sechs gesenkt.[52] Nach <strong>de</strong>r Bildungsreform 1999 besteht in Polen<br />
Schulpflicht bis <strong>zu</strong>m 18. Lebensjahr. Das neue Schulsystem hat drei Stufen.<br />
Obligatorisch und für alle Kin<strong>de</strong>r gemeinsam sind:<br />
• Szkoła podstawowa Grundschule sechs Jahre vergleichbar mit Volksschule<br />
• Gimnazjum Gymnasium drei Jahre vergleichbar mit Mittelstufe<br />
Danach wer<strong>de</strong>n die Schüler getrennt. Es stehen folgen<strong>de</strong> Möglichkeiten <strong>zu</strong>r Wahl:<br />
• Szkoła zawodowa Berufsschule zwei-drei Jahre Berufsausbildung<br />
• Liceum ogólnokształcące Allgemeinbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Lyzeum drei Jahre Abitur<br />
• Technikum Berufliches Lyzeum vier Jahre Abitur und Berufsausbildung<br />
• Liceum profilowane Profiliertes Lyzeum drei Jahre Abitur und beruflich orientierte Grundbildung<br />
Das Bestehen <strong>de</strong>r Abiturprüfung ist Vorausset<strong>zu</strong>ng für das Studium an einer Hochschule.<br />
Weit verbreitet ist auch die berufsbegleiten<strong>de</strong> Ausbildung am Wochenen<strong>de</strong>. In Polen gibt es ein Notensystem mit Noten von 6 bis 1. Die 5 ist dabei die beste Note, die 1 die schlechteste.<br />
Eine 6 wird äußerst selten an Schüler vergeben, die sich Kenntnisse über <strong>de</strong>n Unterrichtsstoff hinaus aneignen und reproduzieren. Dies soll sie da<strong>zu</strong> anregen, selbstständig das erlernte<br />
Wissen durch Eigenstudium <strong>zu</strong> vertiefen, um sie so auf die universitäre Ausbildung vor<strong>zu</strong>bereiten. Die polnischen Schüler schnitten beim PISA-Test mittelmäßig ab, wobei allerdings eine<br />
<strong>de</strong>utliche Steigerung nach <strong>de</strong>r Reform 1999 <strong>zu</strong> verzeichnen war. Dies vermag allerdings nicht über <strong>de</strong>n qualitativen Einbruch <strong>de</strong>r polnischen Schulbildung in <strong>de</strong>n 1990er-Jahren<br />
hinweg<strong>zu</strong>täuschen.<br />
Hochschulbildung<br />
In Polen studieren fast zwei Millionen Stu<strong>de</strong>nten. Die staatlichen Hochschulen haben dabei in <strong>de</strong>n letzten 10 Jahren vermehrt Konkurrenz durch private Hochschulen bekommen. Der<br />
Zugang <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Hochschulen wird fast überall durch eine Eingangsprüfung geregelt. Bachelor- und Magisterstudiengänge gibt es in letzter Zeit immer mehr. Die polnischen Hochschulen<br />
sind Mitglie<strong>de</strong>r im Sokrates-Programm. Stipendien wer<strong>de</strong>n von polnischen und ausländischen Stiftungen vergeben, z. B. Śnia<strong>de</strong>cki-Stiftung, DAAD o<strong>de</strong>r Robert-Bosch-Stiftung.<br />
• Universität Stadt Gründung<br />
•<br />
• Jagiellonen-Universität Krakau 1364<br />
• Universität Breslau Breslau 1702<br />
• Universität Warschau Warschau 1816<br />
• Adam-Mickiewicz-Universität Posen 1919<br />
• Katholische Universität Lublin Lublin 1918<br />
• Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin 1944<br />
• Universität Łódź Łódź 1945<br />
• Universität Thorn Toruń 1945<br />
• Schlesische Universität Kattowitz 1968<br />
• Universität Danzig Danzig 1970
• Universität Stettin Stettin 1984<br />
• Universität Oppeln Oppeln 1994<br />
• Universität Białystok Białystok 1997<br />
• Universität Ermland-Masuren Olsztyn 1999<br />
• Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau 1999<br />
• Universität Zielona Góra Zielona Góra 2001<br />
• Universität Rzeszów Rzeszów 2001<br />
• Kasimir-<strong>de</strong>r-Große-Universität Bydgoszcz Bydgoszcz 2005<br />
Wissenschaft<br />
Bereits mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Bistümer im Jahr 1000 wur<strong>de</strong>n nach und nach Kirchenschulen an <strong>de</strong>n Bischofssitzen eröffnet. Mit <strong>de</strong>m Zisterzienser-Or<strong>de</strong>n kam auch die abendländische<br />
Wissenschaft nach Polen. Bereits 1364 grün<strong>de</strong>te Casimir <strong>de</strong>r Große die Krakauer Universität, die die zweitälteste Alma Mater in Mitteleuropa ist. Sie war<br />
die erste Universität, die eine eigenständige Professur für Mathematik und Astronomie hatte. Ihr Rektor Paweł Włodkowic – einer <strong>de</strong>r wichtigsten<br />
Völkerrechtler jener Zeit – stellte auf <strong>de</strong>m Konzil von Konstanz 1415 die These auf, dass heidnische Völker ein Recht auf einen eigenen Staat hätten und<br />
nicht mit <strong>de</strong>m Schwert christianisiert wer<strong>de</strong>n dürften. Dass er nicht das Schicksal seines Prager Kollegen Jan Hus teilen musste, verdankte er <strong>de</strong>r<br />
zahlreichen polnischen Ritterschaft, die beim Konzil anwesend war.<br />
Die Wissenschaft in Polen erreichte in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Humanismus ihre Blüte. Einer <strong>de</strong>r Krakauer Stu<strong>de</strong>nten war Nikolaus Kopernikus, <strong>de</strong>r das<br />
heliozentrische Weltbild erschuf. Wichtige Astronomen und Mathematiker jener Zeit waren auch Marcin Król, Marcin Bylica, Martin Biem, Johann von<br />
Glogau und Albert <strong>de</strong> Brudzewo. In <strong>de</strong>r (Al)Chemie und Medizin waren damals Adam von Bochinia und Maciej Miechowita führend. Neue Universitäten<br />
wur<strong>de</strong>n in Zamość, Raków, Wilna, Posen und Lemberg gegrün<strong>de</strong>t, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m kamen die zahlreichen Schulen <strong>de</strong>r Jesuiten. Nach <strong>de</strong>n Kriegen <strong>de</strong>s 17.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt verfiel die polnische Wissenschaft jedoch <strong>zu</strong>sehends und erreichte in <strong>de</strong>r sächsischen Zeit ihren Tiefpunkt. Eine Ausnahme bil<strong>de</strong>te das 1740<br />
von <strong>de</strong>n Piaristen in Warschau gegrün<strong>de</strong>te Collegium Nobilium.<br />
Mit <strong>de</strong>m Amtsantritt Stanisław August Poniatowskis begann in <strong>de</strong>r Aufklärung die Neuorganisation <strong>de</strong>r polnischen Universitäten durch Hugo Kołłątaj im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Kommission für nationale Erziehung, <strong>de</strong>m ersten Bildungsministerium <strong>de</strong>r Welt. Als einer <strong>de</strong>r wichtigsten Wissenschaftler und Industrieller dieser Zeit gilt Stanisław Staszic,<br />
<strong>de</strong>r um 1800 in Warschau eine Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaft ins Leben rief. 1817 wur<strong>de</strong> die Warschauer Universität gegrün<strong>de</strong>t. Auf dieser Grundlage konnte sich<br />
die polnische Wissenschaft im 19. Jh. entwickeln. Um 1850 ent<strong>de</strong>ckte Ignacy Łukasiewicz eine Metho<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Destillation von Erdöl und schuf damit die<br />
Ölindustrie, die ihren Ausgangspunkt in Galizien nahm, wo heute noch die ältesten Ölför<strong>de</strong>rtürme <strong>de</strong>r Welt stehen. Napoleon Cybulski und Władysław<br />
Szymonowicz schufen die mo<strong>de</strong>rne Endokrinologie. Zygmunt Wróblewski und Karol Olszewski gelang es erstmals, Sauerstoff und Stickstoff <strong>zu</strong> verflüssigen.<br />
Stefan Banach und Hugo Steinhaus begrün<strong>de</strong>ten die Funktionalanalyse in <strong>de</strong>r Mathematik. Der Arzt Kazimierz Funk ent<strong>de</strong>ckte die Vitamine. Marie Curie-<br />
Skłodowska entwickelte die Radiologie und ent<strong>de</strong>ckte das Polonium und das Radium. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt, und gleichzeitig <strong>de</strong>r<br />
erste Mensch <strong>de</strong>m zwei <strong>zu</strong>erkannt wur<strong>de</strong>n (Physik und Chemie). Eugeniusz Kwiatkowski entwickelte die polnischen Wirtschaftswissenschaften, die er nach <strong>de</strong>r<br />
Unabhängigkeit Polens als Wirtschaftsminister in die Praxis umsetzten konnte.<br />
In <strong>de</strong>r Zweiten Republik wur<strong>de</strong> die polnische Sprache an <strong>de</strong>n polnischen Universitäten wie<strong>de</strong>r eingeführt und die Lehre und Wissenschaft florierten. Einer <strong>de</strong>r<br />
größten polnischen Juristen Roman Longchamps <strong>de</strong> Berrier vereinheitlichte das polnische Zivilrechtssystem, dass 1918 noch aus fünf Rechtsordnungen<br />
bestand. Sein Schuldrechtgesetzbuch gilt als eines <strong>de</strong>r besten <strong>de</strong>r Welt.<br />
Der Zweite Weltkrieg war ein Desaster für die polnische Wissenschaft, <strong>de</strong>nn die Nationalsozialisten wollten die polnischen Kulturschaffen<strong>de</strong>n vernichten.<br />
Bereits in <strong>de</strong>n ersten Kriegswochen wur<strong>de</strong>n hun<strong>de</strong>rte polnischer Professoren ermor<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r in Konzentrationslager <strong>de</strong>portiert. Insoweit erlangte die<br />
Son<strong>de</strong>raktion Krakau traurige Berühmtheit. Im Krieg wur<strong>de</strong>n auch die polnischen Universitätsbibliotheken ausgeraubt und ihre Bestän<strong>de</strong> zielgerichtet vernichtet, sodass 1945 ein völliger
Neuanfang bevorstand. Zu<strong>de</strong>m flohen viele <strong>de</strong>r überleben<strong>de</strong>n Wissenschaftler vor <strong>de</strong>n Kommunisten ins westliche Ausland und die überleben<strong>de</strong>n polnischen Ju<strong>de</strong>n emigrierten nach<br />
Israel. Die polnische Wissenschaft erholte sich nur langsam. Die polnischen Restaurateure konnten schon bald wie<strong>de</strong>r Weltruhm genießen, doch <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Wissenschaften fehlte <strong>de</strong>r<br />
Austausch mit <strong>de</strong>n bereits führen<strong>de</strong>n US-amerikanischen Universitäten. Dies än<strong>de</strong>rte sich erst nach 1989. Im Jahr 2001 wur<strong>de</strong>n die Erfolge <strong>zu</strong> Entwicklungen <strong>zu</strong>m Blauen Lasers in <strong>de</strong>r<br />
praktischen Medizin vorgestellt. 2004 gab Polen insgesamt 1,1 Millionen US-Dollar, etwa 0,7 Prozent <strong>de</strong>s Bruttoinlandsprodukts für die Wissenschaft aus. Damit lag das Land unter <strong>de</strong>m<br />
OECD-Durchschnitt von 2,3 Prozent und auch unter <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r EU von 1,99 Prozent.[53]<br />
Kultur<br />
Die polnische Kultur ist sehr vielfältig und resultiert aus <strong>de</strong>r wechselvollen Geschichte <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Im Mittelalter und <strong>de</strong>r Neuzeit war die multikulturelle A<strong>de</strong>lsrepublik ein Schmelztiegel<br />
verschie<strong>de</strong>ner Kulturen und Religionen, die alle ihren Einfluss auf das polnische Kulturerbe hatten und noch immer haben. Nach <strong>de</strong>n Teilungen Polens versuchten polnische Künstler<br />
immer wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Kampf um die Unabhängigkeit Polens unter <strong>de</strong>m Schlagwort „Zur Hebung <strong>de</strong>r Herzen“ <strong>zu</strong> unterstützen. Als Beispiele hierfür können die Gedichte und Epen von Adam<br />
Mickiewicz, die Prosawerke eines <strong>de</strong>r ersten Literaturnobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz, die Historienmalerei von Jan Matejko o<strong>de</strong>r die Ma<strong>zu</strong>rkas, Polkas, Krakowiaks und<br />
Polonaisen von Fry<strong>de</strong>ryk Chopin genannt wer<strong>de</strong>n.<br />
Heute ist die breit gefächerte Kultur Polens, ähnlich wie aller westlicher Staaten, von Globalisierungsten<strong>de</strong>nzen betroffen, an<strong>de</strong>rerseits kann sie, gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Kulturszene größerer Städte<br />
und auf <strong>de</strong>m Land eine eigene I<strong>de</strong>ntität erhalten. Beson<strong>de</strong>rs be<strong>de</strong>utend ist <strong>de</strong>r polnische Symbolismus und die polnische Plakatmalerei. Plakate polnischer Künstler mit ihren sehr<br />
spezifischen Eigenschaften sind auf <strong>de</strong>r ganzen Welt bekannt. Auch <strong>de</strong>r polnische Film mit hervorragen<strong>de</strong>n Regisseuren, wie Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski,<br />
Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland und Jerzy Hoffman fin<strong>de</strong>t weltweit Anerkennung.<br />
Polnische Literatur<br />
Das älteste erhaltene polnische Schriftstück ist das Dagome-Iu<strong>de</strong>x-Regest aus <strong>de</strong>m Jahr 991. Wie fast alle polnischen Werke <strong>de</strong>s Mittelalters ist es in Latein geschrieben. Zu diesen<br />
gehören vor allem die Chroniken von Gallus Anonymus, Wincenty Kadłubek, Janko aus Czarnków, Jan Długosz und Jan Łaski sowie die Heiligkreuz-Jahrbücher als auch die<br />
A<strong>de</strong>lsprivilegien (siehe oben Verfassungsgeschichte) und religiöse Texte <strong>de</strong>r Heilig-Kreuz-Predigten (die ältesten Schriftstücke auf Polnisch), die Königin Zofias Bibel (erste<br />
Bibelüberset<strong>zu</strong>ng ins Polnische), <strong>de</strong>r Puławy-Psalter, <strong>de</strong>r Davids-Psalter, die erste polnische Nationalhymne Bogurodzica sowie diverse Gebete und Heiligengeschichten. 1488 wur<strong>de</strong> die<br />
welterste Dichterbru<strong>de</strong>rschaft Nadwiślańskie Bractwo Literackie von <strong>de</strong>m Deutschen Conrad Celtis und <strong>de</strong>m Italiener Kallimachus an <strong>de</strong>r Universität in Krakau gegrün<strong>de</strong>t, wo sich<br />
bereits die erste polnische Druckerei befand.<br />
Die polnische Sprache setzte sich in <strong>de</strong>r Renaissance durch, obwohl viele Autoren auch noch in Latein o<strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Sprachen veröffentlichten. Der erste nur polnischschreiben<strong>de</strong> Dichter<br />
war Mikołaj Rej, <strong>de</strong>r als Vater <strong>de</strong>r polnischen Sprache gilt. Der größte polnische Renaissancedichter war jedoch Jan Kochanowski, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m ersten polnischen Drama „Die Abfertigung<br />
<strong>de</strong>r griechischen Gesandten“ und zahlreichen Gedichten Weltruhm erlangte. Gleichzeitig galt Klemens Janicki als talentiertester lateinischschreiben<strong>de</strong>r Poet <strong>de</strong>r Renaissance in Europa.<br />
An<strong>de</strong>re wichtige Renaissanceschriftsteller waren Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Szymonowic, Łukasz Górnicki, Piotr Skarga, Andrzej Krzycki, Mikołaj Hussowski Hussowczyk,<br />
Biernat z Lublina, Mikołaj Sęp-Szarzyński und Johannes Dantiscus. Der polnische Barock ist aufgrund <strong>de</strong>r vielen vernichten<strong>de</strong>n Kriege <strong>de</strong>m Motto memento mori treu und bringt im<br />
Gegensatz <strong>zu</strong>m Harmoniebestreben <strong>de</strong>r polnischen Renaissance die Unruhe <strong>de</strong>r damaligen Zeit <strong>zu</strong>m Ausdruck. Hervor<strong>zu</strong>heben sind hier die Liebesbriefe <strong>de</strong>s Dichterkönigs Jan Sobieski<br />
sowie die Kriegsmemoiren von Jan Chryzostom Pasek. Weitere wichtige Vertreter dieser Epoche waren Wacław Potocki, Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski, Krzysztof Zawisza<br />
und Benedykt Chmielowski.<br />
Die Aufklärung brachte vor allem politische Literaten, die mit <strong>de</strong>n Reformen König Poniatowskis verbun<strong>de</strong>n waren. Viele engagierten sich für die Verfassung vom 3. Mai 1791.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Wojciech Bogusławski, Franciszek Bohomolec, Franciszek Salezy Jezierski, Franciszek Karpiński, Franciszek Dionizy Kniaźnin,<br />
Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarski, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Stanisław Trembecki und Franciszek Zabłocki sind hier <strong>zu</strong> nennen.<br />
Nach <strong>de</strong>r letzten Teilung Polens entstan<strong>de</strong>n zwei gegensätzlich poetische Richtungen, die Klassik und die Romantik. Das Jahr 1822, als Adam Mickiewicz seinen ersten Gedichtband<br />
herausbrachte, gilt als endgültiger Sieg von letzterer. Die polnische Romantik, die in <strong>de</strong>r Zeit zwischen <strong>de</strong>m Novemberaufstand 1830 und Januaraufstand 1863 ihren Zenit erreichte, hat<br />
sehr viele hervorragen<strong>de</strong> Poeten hervorgebracht. Neben Mickiewicz allen voran Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński und Cyprian Kamil Norwid. Nicht unerwähnt bleiben dürfen aber
auch Stanisław Bogusławski, Adam Jerzy Czartoryski, Aleksan<strong>de</strong>r Fredro, Klementyna Hoffmanowa, Józef Ignacy Kraszewski, Wincenty Pol, Henryk Rzewuski und Kornel Ujejski.<br />
Viele Literaturkritiker sehen in <strong>de</strong>r polnischen Romantik die Epoche, die <strong>de</strong>n polnischen Nationalgeist am meisten beeinflusst hat und am meisten auf die an<strong>de</strong>ren Richtungen einwirkte.<br />
Nach <strong>de</strong>r Ernüchterung <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage von 1864 kam die Zeit <strong>de</strong>s Positivismus, die sich von <strong>de</strong>r Dichtung <strong>zu</strong>r Prosa wandte, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>m realistischen Roman. Ihre wichtigsten<br />
Vertreter waren Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Adolf Dygasiński, Wiktor Gomulicki, Maria Rodziewiczówna, Henryk Sienkiewicz, Gabriela Zapolska, Stefan<br />
Żeromski und Adam Asnyk.<br />
Als neoromantische Reaktion entwickelte sich ab 1890 das Junge Polen, <strong>de</strong>ren wichtigste Dichter Ta<strong>de</strong>usz Boy-Żeleński, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Mieczysława<br />
Przybylska-Łuczyńska, Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Leopold Staff und das Allroundgenie Stanisław Wyspiański. Das Junge Polen zeichnete sich durch eine <strong>de</strong>m<br />
Symbolismus folgen<strong>de</strong> Mystifizierung <strong>de</strong>r Wirklichkeit aus. Das wichtigste Werk ist Wyspiańskis „Hochzeit“.<br />
In <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit hatte Polen eine Reihe von hervorragen<strong>de</strong>n Literaten, die in verschie<strong>de</strong>nen Richtungen experimentierten und verschie<strong>de</strong>ne Dichtervereinigungen (Salaman<strong>de</strong>r,<br />
Grüner Ballon, etc.) bil<strong>de</strong>ten. Zu diesen gehörten Jan Brzechwa, Zofia Charszewska, Józef Czechowicz, Bruno Jasieński, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Kuncewiczowa, Bolesław<br />
Leśmian, Kornel Makuszyński, Czesław Miłosz, Stanisław Młodożeniec, Zofia Nałkowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Bruno Schulz, Andrzej Strug, Julian Tuwim, Stanisław<br />
Ignacy Witkiewicz und Aleksan<strong>de</strong>r Wat. Während <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges schuf die junge Generation <strong>de</strong>r sogenannten Kolumbusse Krzysztof Kamil Baczyński, Ta<strong>de</strong>usz Borowski und<br />
Ta<strong>de</strong>usz Gajcy, die alle sehr jung starben und diese Vorahnung in ihren Gedichten thematisierten.<br />
Die polnische Nachkriegsliteratur ist sehr mannigfaltig. Sie reicht vom Sozrealismus (Jerzy Andrzejewski) bis <strong>zu</strong>r Science Fiction (Stanisław Lems). Zunächst war Hauptthema die<br />
Verarbeitung <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges, später wandten sich die Kulturschaffen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r neuen Wirklichkeit <strong>zu</strong>.<br />
Wichtige Vertreter <strong>de</strong>r Nachkriegsliteratur sind Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek, Miron Białoszewski, Kazimierz Brandys, Ernest Bryll, Zbigniew Herbert, Marek Hłasko, Paweł<br />
Huelle, Ewa Lipska, Jan Parandowski, Jerzy Pilch, Julian Przyboś, Ta<strong>de</strong>usz Różewicz, Andrzej Szczypiorski, Wisława Szymborska, Władysław Terlecki, Jan Twardowski, Ryszard<br />
Kapuściński, Stefan Chwin, Leszek Kołakowski, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarc<strong>zu</strong>k, Dorota Masłowska und Jerzy Prokopiuk, sowie auch <strong>de</strong>r als Papst Johannes Paul II. bekannte Karol<br />
Wojtyła.<br />
Bisher erhielten polnische Schriftsteller viermal <strong>de</strong>n Literaturnobelpreis: 1905 (Henryk Sienkiewicz), 1924 (Władysław Reymont), 1980 (Czesław Miłosz) und 1996 (Wisława<br />
Szymborska).<br />
Musik<br />
Der erste namentlich bekannte Musiker Polens ist <strong>de</strong>r Dominikaner Wincenty aus Kielce, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts lebte und die Hymne „Gau<strong>de</strong> mater Polonia“<br />
schrieb. Dagegen ist <strong>de</strong>r Autor <strong>de</strong>s ältesten bekannten polnischen Lie<strong>de</strong>s Bogurodzica unbekannt. Neben Hymnen zeichnete sich die mittelalterliche polnische Musik durch Tänze aus.<br />
Mikołaj aus Radom schrieb diese am Anfang <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts auf. In <strong>de</strong>r Renaissance kamen viele italienische Musiker an <strong>de</strong>n polnischen Königshof. Mikołaj Gomółka war <strong>de</strong>r<br />
bekannteste polnische Komponist <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Er schrieb Kompositionen unter an<strong>de</strong>rem <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Gedichten von Jan Kochanowski („Melodie na Psałterz polski“). An<strong>de</strong>re wichtige<br />
Renaissancekomponisten am polnischen Königshof waren Wacław z Szamotuł und Mikołaj Zieleński.<br />
1628 wur<strong>de</strong> in Warschau die erste Oper außerhalb Italiens aufgeführt: Galatea. Die italienischen Opernkomponisten Luca Marenzio, Giovanni Francesco Anerio, and Marco Scacchi<br />
waren <strong>zu</strong>r Barockzeit in Warschau tätig. Während <strong>de</strong>r relativ kurzen Regentschaft von Władysław IV. Wasa von 1634 bis 1648 wur<strong>de</strong>n in Warschau mehr als zehn Opern aufgeführt,<br />
womit Warschau <strong>zu</strong> dieser Zeit <strong>zu</strong>m wichtigsten Opernzentrum außerhalb Italiens wur<strong>de</strong>. Die erste Opernkomponistin <strong>de</strong>r Welt, Francesca Caccini, schrieb ihre erste Oper La liberazione<br />
di Ruggiero dall’isola d’Alcina für <strong>de</strong>n polnischen König, als dieser noch ein Prinz war. Die polnischen Barockkomponisten komponierten vor allem Kirchenmusik, allen voran ihr<br />
bekanntester Schöpfer Adam Jarzębski. Zu dieser Zeit entstand auch die Polonaise als Tanz an polnischen Höfen, während die bäuerliche Gesellschaft regional unterschiedliche Tänze wie<br />
die Ma<strong>zu</strong>rkas, Krakowiaks und Chodzony und die auch in Tschechien bekannten Polkas entwickelte. Die wichtigsten Polonaise-Komponisten im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt waren Michał Kleofas<br />
Ogiński, Karol Kurpiński, Juliusz Zarębski, Henryk Wieniawski, Mieczysław Karłowicz und Joseph Elsner. Gleichwohl sollte erst Fry<strong>de</strong>ryk Chopin in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt diese Musikart <strong>zu</strong>r Vollendung bringen. Er gilt als einer <strong>de</strong>r größten polnischen Komponisten.
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt entwickelte Stanisław Moniuszko die mo<strong>de</strong>rne polnische Oper, <strong>de</strong>ren berühmtestes Werk Halka ist. Oskar Kolberg begann <strong>zu</strong> dieser Zeit die polnische Folkloremusik<br />
<strong>zu</strong> sammeln und nie<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>schreiben. Seinen Werken verdanken die Folkloreensembles Mazowsze, Słowianki und Śląsk ihr Entstehen. Karol Szymanowski, <strong>de</strong>r sich in Zakopane<br />
nie<strong>de</strong>rließ, ent<strong>de</strong>ckte die traditionelle Musik <strong>de</strong>r Goralen in Podhale, die er im 19 Jahrhun<strong>de</strong>rt weiter entwickelte. Berühmte Komponisten <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit waren Arthur<br />
Rubinstein, Ignacy Jan Pa<strong>de</strong>rewski, Grażyna Bacewicz, Zygmunt Mycielski, Michał Spisak and Ta<strong>de</strong>usz Szeligowski. Die zeitgenössische polnische Musik wird von Stanisław<br />
Skrowaczewski, Roman Palester, Andrzej Panufnik, Ta<strong>de</strong>usz Baird, Bogusław Schaeffer, Włodzimierz Kotoński, Witold Szalonek, Krzysztof Pen<strong>de</strong>recki, Witold Lutosławski, Wojciech<br />
Kilar, Kazimierz Serocki, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Meyer, Paweł Szymański, Krzesimir Dębski, Hanna Kulenty, Eugeniusz Knapik und Jan A. P. Kaczmarek repräsentiert.<br />
Bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst<br />
Zur heidnischen Zeit schufen die westslawischen Künstler Steinfiguren von Światowit und an<strong>de</strong>ren Gottheiten. Mit <strong>de</strong>m Übergang <strong>zu</strong>m Christentum behielt die Kunst <strong>zu</strong>nächst ihren<br />
rituellen Charakter. Zu <strong>de</strong>n ersten be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n und erhaltenen Kunstwerken gehören die monumentalen Bronzetüren <strong>de</strong>r Kathedralen von Gnesen und Płock im Stil <strong>de</strong>r Romanik. Die erst<br />
stellt die Lebensgeschichte <strong>de</strong>s Heiligen Adalbert (Wojciech) dar. Die zweite wur<strong>de</strong> später an die Stadt Nowgorod in Russland geschenkt. Daneben waren in <strong>de</strong>n romanischen Kirchen<br />
Steinfiguren und Reliefs sehr beliebt. In <strong>de</strong>r Gotik entwickelte sich die Holzschnitzerei, die Bronzegießerei, die Bildhauerei und die Malerei. Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Künstler aus <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen<br />
Raum, wie Veit Stoß, Hans Dürer, Peter Vischer kamen an <strong>de</strong>n Hof <strong>de</strong>r polnischen Könige auf <strong>de</strong>m Wawel in Krakau. Der Krakauer Hochaltar von Veit Stoß ist das größte Schnitzwerk<br />
<strong>de</strong>r Gotik. In Krakau selbst entwickelte sich in <strong>de</strong>r Malerei und Schnitzerei um 1400 eine eigene Schule, die von einheimischen Künstlern vertreten wur<strong>de</strong>, wie z. B. <strong>de</strong>m Meister <strong>de</strong>r<br />
Dominikanerpassion. Zu<strong>de</strong>m kamen orthodoxe Künstler aus Ostpolen und brachten ihre Freskenmalerei mit, die noch heute in <strong>de</strong>r Wawelkathedrale und in <strong>de</strong>r Kapelle im Lubliner<br />
Schloss bewun<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
In <strong>de</strong>r Renaissance kamen viele Künstler aus Florenz, Padua und Mailand (mit Bona Sforza) nach Polen. Sie grün<strong>de</strong>ten ihre eigenen Schulen in Krakau. Auch polnische<br />
Renaissancekünstler wie Stanisław Samostrzelnik waren in Krakau aktiv. Hervor<strong>zu</strong>heben gilt es die Sigismund-Kapelle an <strong>de</strong>r Wawelkathedrale mit <strong>de</strong>n Grabmälern <strong>de</strong>r letzten<br />
Jagiellonen, die als formtreustes Beispiel <strong>de</strong>r italienischen Renaissance außerhalb Italiens gilt. In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Manierismus waren ebenfalls die italienischen Künstler in Polen führend,<br />
allen voran Paolo Romano, <strong>de</strong>r in Lemberg tätig war. Aber auch Danzig war ein Zentrum <strong>de</strong>s wie<strong>de</strong>rum nie<strong>de</strong>rländisch geprägten Manierismus. Auch <strong>de</strong>r Barock kam aus Italien nach<br />
Polen. Hier ist insbeson<strong>de</strong>re Giovanni Trevano hervor<strong>zu</strong>heben, <strong>de</strong>r am Wawel und <strong>de</strong>m Königsschloss in Warschau wirkte. Als be<strong>de</strong>utendster Maler <strong>de</strong>s Barock in Polen gilt Karol<br />
Dankwart. In <strong>de</strong>r sächsischen Zeit kamen viele Künstler aus Sachsen nach Polen, wie z. B. <strong>de</strong>r Italiener Bernardo Bellotto. In Ostpolen entwickelte sich <strong>zu</strong> dieser Zeit eine eigene Form<br />
<strong>de</strong>s ukrainischen Barock und <strong>de</strong>r Ikonenmalerei. Der wichtigste Vertreter <strong>de</strong>s Klassizismus in Polen war Däne Bertel Thorvaldsen, <strong>de</strong>r viele Denkmäler in Warschau und Krakau schuf.<br />
Die romantische Malerei entwickelte sich in Polen nach <strong>de</strong>n Teilungen und behan<strong>de</strong>lte meist politische o<strong>de</strong>r mystische Themen. Im Zeitalter <strong>de</strong>s Positivismus dominierte die<br />
Historienmalerei, <strong>de</strong>ren bekannteste Vertreter Juliusz Kossak, die Brü<strong>de</strong>r Maksymilian und Aleksan<strong>de</strong>r Gierymski und Jan Matejko sein dürften. Seine Schüler Józef Mehoffer und<br />
Stanisław Wyspiański entwickelten die sezessionistische Richtung Junges Polen. In <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit entwickelten sich verschie<strong>de</strong>ne Kunstrichtungen. Bekannte Vertreter dieser<br />
Epoche sind Bruno Schulz und Wojciech Weiss. Während <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong>n von Hitler<strong>de</strong>utschland und <strong>de</strong>r Sowjetunion sehr viele Kunstschätze aus <strong>de</strong>n polnischen<br />
Museen geraubt. Viele von ihnen wie z. B. <strong>de</strong>r Jüngling von Raffael sind bis heute nicht wie<strong>de</strong>r aufgetaucht. In <strong>de</strong>r Volksrepublik war <strong>de</strong>r Sozrealismus vorherrschend. Gleichwohl<br />
entwickelten Künstler wie Ta<strong>de</strong>usz Kantor, Peter Potworowski, Władysław Hasior o<strong>de</strong>r Nikifor Krynicki eigene Kunstrichtungen. Mittlerweile ist die Kunst wie<strong>de</strong>r entpolitisiert.<br />
Architektur<br />
Die ersten erhaltenen Architektur<strong>de</strong>nkmäler Polens sind Hügelgräber (poln. kopiec) und kultische Steinzirkel. Die christliche Architektur kam als Vorromanik im 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt nach<br />
Polen. In diesem Stil wur<strong>de</strong>n die Burgen und Kirchen <strong>de</strong>r Polanen gebaut. In <strong>de</strong>r Romanik wur<strong>de</strong>n die ersten Kathedralen in Gnesen, Krakau, Breslau, Kolberg und Posen, Rotunda (z. B.<br />
Cieszyn, Krakau), Wehrkirchen (z. B. Strzelno) und Zisterzienser-Klöster errichtet (z. B. Tyniec).<br />
Im Zeitalter <strong>de</strong>r Gotik dominierte in Polen die Backsteingotik im Nor<strong>de</strong>n und eine gemischte Backstein-Kalksteingotik im Sü<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re in Krakau. Der größte gotische<br />
Backsteinbau <strong>de</strong>r Welt ist die Marienburg am Nogat und die größte Backsteinkirche <strong>de</strong>r Welt ist die Marienkirche in Danzig.<br />
Das gol<strong>de</strong>ne Zeitalter Polens begann in <strong>de</strong>r Spätgotik und reichte über die Renaissance und <strong>de</strong>n Manierismus bis in <strong>de</strong>n Frühbarock. Aus dieser Zeit (1350–1650) stammen die<br />
be<strong>de</strong>utendsten Bauwerke Polens, allen voran das königliche Wawelschloss in Krakau. Dieses wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>ligen in ganz Polen hun<strong>de</strong>rtfach mehr o<strong>de</strong>r weniger originalgetreu
nachgebaut. Zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Renaissance-Schlössern zählen Baranów Sandomierski, Krasiczyn, Łańcut, Janowiec, Krzyszopór, Pieskowa Skała, Sucha Beskidzka, Brzeg, Nowy<br />
Wiśnicz, Ogrodzieniec. Das Zentrum <strong>de</strong>r Renaissance war Südpolen, insbeson<strong>de</strong>re die Region um Kleinpolen und die Gegen<strong>de</strong>n um Lemberg. Gleichzeitig entwickelte sich am Übergang<br />
zwischen Spätgotik und Renaissance auch die bürgerliche Architektur in <strong>de</strong>n Städten, die viele schöne Kirchen und Rathäuser sowie Gebäu<strong>de</strong> an<strong>de</strong>rer öffentlichen Einrichtungen, wie z.<br />
B. das Collegium Maius <strong>de</strong>r Krakauer Universität, hervorbrachte. Vor allem in Krakau kann man die typisch polnische Renaissancearchitektur an <strong>de</strong>r polnischen Attika erkennen. In dieser<br />
Zeit kamen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> italienische Architekten und Künstler aus Italien (insbeson<strong>de</strong>re Florenz) nach Polen, z. B. Bartolomeo Berrecci, Santi Gucci, Francesco Florentino, Bernardo<br />
Monti, Giovanni Quadro, Mateo Gucci, die die italienische Renaissance <strong>de</strong>n klimatischen Bedingungen Mitteleuropas anpassten und so einen eigenen polnischen Renaissancestil schufen,<br />
<strong>de</strong>r jedoch mit seinen beliebten Arka<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r florentinischen Renaissance am nächsten kam. Viele dieser Bauwerke haben die Zeit <strong>de</strong>r schwedischen Kriege im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt nur als<br />
Ruinen überdauert.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s reifen Barocks trat die neue Hauptstadt Warschau als Mittelpunkt hervor. Der be<strong>de</strong>utendste Architekt dieser Zeit war <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n stammen<strong>de</strong> Tylman van<br />
Gameren, <strong>de</strong>r Hun<strong>de</strong>rte von Schlössern in ganz Polen projektierte. Große Paläste im Versailler Stil entstan<strong>de</strong>n in Warschau (z. B. das Königsschloss, Wilanów-Palast, das Radziwiłł-<br />
Palais, das Krasicki-Palais) sowie in und um Masowien (z. B. Białystok, Puławy, Rogalin, Kozłówka, Nieborów) sowie in Ostpolen.<br />
Der Spätbarock und das Rokoko sind von <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Sachsenkönige und <strong>de</strong>s letzten polnischen Königs Stanisław Poniatowski geprägt. Damals entstan<strong>de</strong>n in Warschau zahlreiche<br />
Kirchen (Visitantinnen-Kirche, St.-Anna-Kirche, Heilig-Kreuz-Kirche), Gärten (Łazienki-Park, Sächsischer Garten, Krasiński-Park, Ujazdowski-Park) und Paläste.<br />
In <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>de</strong>r Regentschaft <strong>de</strong>s letzten polnischen Königs Stanisław Poniatowski begann die Epoche <strong>de</strong>s Klassizismus. In diesem Stil wur<strong>de</strong> das damals größte Theatergebäu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Welt von Antonio Carozzi in Warschau errichtet. Da<strong>zu</strong> kamen die Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Warschauer Wertpapierbörse und <strong>de</strong>r Polnischen Nationalbank. Im Łazienki-Park entstan<strong>de</strong>n viele<br />
Schlösser und Villen in diesem Stil.<br />
Die Zentren <strong>de</strong>r polnischen Architektur <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt waren Warschau und Łódź, wo viele Bürgerhäuser und Schlösser im Stil <strong>de</strong>s Historismus und später <strong>de</strong>r Sezession errichtet<br />
wur<strong>de</strong>n. Auch in Südpolen gibt es viele Bau<strong>de</strong>nkmäler aus dieser Zeit, wie z. B. das neogotische Collegium Novum <strong>de</strong>r Jagiellonen-Universität in Krakau. Eine eigene Spielart <strong>de</strong>r<br />
Sezession Junges Polen entwickelte sich ebenfalls dort. Der Erste Weltkrieg brachte viele Zerstörungen in Südpolen. Viele öffentliche Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n im Art Deco Stil wie<strong>de</strong>raufgebaut<br />
o<strong>de</strong>r neu gebaut. Hier<strong>zu</strong> zählt z. B. das neue Sejmgebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r die Nationalmuseen in Warschau und Krakau.<br />
Die bisher größte Zerstörung <strong>de</strong>r polnischen Bausubstanz brachte <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg. Warschau wur<strong>de</strong> systematisch zerstört, die Bau<strong>de</strong>nkmäler in Ostpolen kamen an die Sowjetunion<br />
und alle größeren Städte Polens bis auf Krakau wur<strong>de</strong>n durch Kriegshandlungen erheblich beschädigt. Der Wie<strong>de</strong>raufbau in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit wur<strong>de</strong> mustergültig aufgenommen – die<br />
polnischen Restauratoren genießen Weltruhm – und ist aber auf absehbare Zeit nicht ab<strong>zu</strong>schließen. Die Altstadt und die Neustadt von Warschau sowie das Weichselviertel Mariensztat<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1970er-Jahren und das Königsschloss in <strong>de</strong>n 1980er Jahren wie<strong>de</strong>raufgebaut. Einige Paläste sind in <strong>de</strong>n 1990er Jahren wie<strong>de</strong>r erstan<strong>de</strong>n. Demnächst soll mit <strong>de</strong>m<br />
Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r Sächsischen und Brühlschen Paläste und <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rerrichtung <strong>de</strong>r Gärten <strong>de</strong>s Königsschlosses begonnen wer<strong>de</strong>n. Die Bausubstanz <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Zentrum um<br />
die Marszałkowska-Straße, die Aleje Jerozolimskie und die Świętokrzyska-Straße scheinen aber für immer verloren. An ihrer Stelle entstan<strong>de</strong>n monumentale Gebäu<strong>de</strong> im Stil <strong>de</strong>s<br />
Sozrealismus, allen voran <strong>de</strong>r Kulturpalast, <strong>de</strong>r Platz <strong>de</strong>r Verfassung und das Vorzeigeviertel MDM. In <strong>de</strong>n 1990er Jahren begann ein Bauboom von Wolkenkratzern, die von namhaften<br />
Architekten wie z. B. Norman Foster, Daniel Libeskind projektiert wur<strong>de</strong>n. Insbeson<strong>de</strong>re die Johannes-Paul-II.-Allee ist von mo<strong>de</strong>rner Architektur umgeben.<br />
Medien<br />
Fernsehen<br />
Neben <strong>de</strong>n zwei öffentlich-rechtlichen Fernsehsen<strong>de</strong>rn von Telewizja Polska (TVP; dt. Polnisches Fernsehen) gibt es zwei weitere ebenfalls lan<strong>de</strong>sweit und flächen<strong>de</strong>ckend empfangbare<br />
be<strong>de</strong>utsame private Fernsehkanäle wie TVN und Polsat.<br />
Bis 1992 besaß nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Sen<strong>de</strong>erlaubnis. 1992 kam Polsat hin<strong>zu</strong>, <strong>zu</strong>nächst illegal, ab 1993 mit Lizenz, 1997 folgte TVN.[54]<br />
Der polnische Fernsehmarkt hat sich seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren bis heute kontinuierlich weiterentwickelt, sodass die früheren wichtigsten Anbieter TVP, TVN und Polsat von einzelnen<br />
Kanälen <strong>zu</strong> Paketen aus mehreren Kanälen ausgebaut wur<strong>de</strong>n. So fin<strong>de</strong>t man jeweils in je<strong>de</strong>m Paket je<strong>de</strong>s Anbieters <strong>zu</strong>sätzlich auch einen Nachrichten-, Kultur-, Dokumentation-,
Spielfilm- und Sportsen<strong>de</strong>r. Die Empfangbarkeit dieser Pakete ist jedoch meistens nur in <strong>de</strong>n Großstädten per Fernsehkabel möglich. Zusätzlich sind die Pakete selten miteinan<strong>de</strong>r<br />
kombinierbar, so dass erst eine Satellitenschüssel bzw. ein PayTV-Anschluss notwendig ist, um eine Auswahl von über 20 Sen<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong> erreichen. Dies hängt vor allem mit <strong>de</strong>r historisch<br />
begrün<strong>de</strong>ten und finanziell bedingten Machtstellung <strong>de</strong>r staatlichen Fernsehanstalt. Die Landschaft an öffentlich-rechtlichen regionalen Kanälen ist <strong>de</strong>r in Deutschland sehr ähnlich: Es<br />
gibt 16 selbstständige staatliche Kanäle mit regionaler Ausrichtung (Die Dritten). Fernsehsen<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m größten Marktanteil war 2004 TVP1 mit 24,89 Prozent. Es folgten TVP2 (20,52<br />
%), Polsat (16,22 %) und TVN (14,71 %).[55]<br />
Rundfunk<br />
Die öffentlich-rechtliche polnische Hörfunkanstalt Polskie Radio betreibt die drei wichtigsten lan<strong>de</strong>sweit empfangbaren staatlichen Radioprogramme. Diese sind Jedynka (Das Erste) mit<br />
Schwerpunkt auf Politik, Kultur, Reportagen, Dwójka (Das Zweite) als Kultursen<strong>de</strong>r sowie Trójka (Das Dritte) vor allem für jüngere Menschen. Es wird auch ein dichtes Netz aus 17<br />
staatlichen regionalen Radiosen<strong>de</strong>rn betrieben. Die staatliche Rundfunkanstalt hat in <strong>de</strong>n 1990er Jahren ernst<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Konkurrenz durch die privaten Radiosen<strong>de</strong>r Radio Zet (ein<br />
lan<strong>de</strong>sweiter Sen<strong>de</strong>r) und RMF FM (Netz aus ca. 20 regionalen Sen<strong>de</strong>rn) bekommen, die sich bei 15- bis 35-Jährigen größter Beliebtheit erfreuen.<br />
Eine Beson<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r polnischen Medienlandschaft ist die Existenz stark religiös ausgerichteter Sen<strong>de</strong>r wie TV Trwam und Radio Maryja, welche unter katholisch-konservativen<br />
Rentnern gehört wer<strong>de</strong>n. Diese religiösen Sen<strong>de</strong>r tragen durch konfrontative politische Agitation sowie intolerante Berichterstattung über abweichen<strong>de</strong> Weltanschauung sowie soziale und<br />
sexuelle Min<strong>de</strong>rheiten erheblich <strong>zu</strong>r Spaltung zwischen <strong>de</strong>r jüngeren und älteren Generation im Lan<strong>de</strong> bei.<br />
Den größten Marktanteil konnte 2004 RMF FM mit 23,95 Prozent verbuchen. Es folgten Radio Zet (21,41 %), Polskie Radio 1 (15,51 %), Polskie Radio 3 (5,32 %) und Radio Maryja<br />
(2,39 %).[56]<br />
Print- und Internetmedien<br />
Überregionale meinungsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Tageszeitungen sind Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita und die Boulevardzeitung Fakt. Wöchentliche Magazine sind Wprost, Polityka und Newsweek<br />
Polska. Eine wichtige polnische Presseagentur ist die PAP. Für englischsprachige Auslän<strong>de</strong>r erscheinen die Warsaw Voice und das Warsaw Business Journal. Dagegen ist die<br />
<strong>de</strong>utschsprachige polen-rundschau nicht sehr weit verbreitet.<br />
1990 gab es 3.007 Zeitschriften, die Zahl wuchs bis 1999 auf 5.444. Die Zahl <strong>de</strong>r Tageszeitungen sank von 1990 bis 2000 von 130 auf 66. Auflagenstärkste war 2004 Fakt.[57]<br />
Die bekanntesten Internetportale sind Onet.pl, Wirtualna Polska und Interia.pl.<br />
Bräuche<br />
Nationale und regionale Bräuche wer<strong>de</strong>n vor allem auf <strong>de</strong>m Land aufrecht erhalten. Sie sind mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Religionen, beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r römisch-katholischen, verbun<strong>de</strong>n.<br />
Wichtig sind die Feste <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen religiösen Gemeinschaften: weihnachtliche Sternsinger, Friedhofsfeiern an Allerheiligen, das Fronleichnamsfest in Łowicz, <strong>de</strong>r Palmsonntag, die<br />
Mysterienspiele in Kalwaria Zebrzydowska, das kaschubische Bootsfest, <strong>de</strong>r Dominikaner Jahrmarkt in Danzig, aber auch das orthodoxe Jordanfest in Drohiczyn und das muslimischtatarische<br />
Kurban Bajram in Bohoniki. Pilgerfahrten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, etwa die katholischen Wallfahrten nach Tschenstochau, Heiligelin<strong>de</strong>, Licheń Stary,<br />
Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki und <strong>zu</strong>m St. Annaberg, aber auch die jüdischen Grabbesuche <strong>de</strong>r chassidischen Mystiker Elimelech aus Leżajsk und Moses Remuh aus Krakau und<br />
die orthodoxe Wallfahrt nach Grabarka. Viele <strong>de</strong>r lokalen Bräuche und Riten stehen in Zusammenhang mit <strong>de</strong>n Jahreszeiten (z. B. die Zuwasserlassung <strong>de</strong>r Wianki, die Versenkung <strong>de</strong>r<br />
Marzanna und <strong>de</strong>r Krakauer Lajkonik).<br />
Kunstwerke, die mit <strong>de</strong>n Bräuchen verbun<strong>de</strong>n sind, umfassen die Ikonenmalerei vor allem in Podlachien, Lublin und <strong>de</strong>m Karpatenvorland, Schnitzereien mit religiösen (Je<strong>zu</strong>s<br />
Frasobliwy) und weltlichen Motiven sowie die Stickereien – Koronki. Bekannt sind auch Trachten, insbeson<strong>de</strong>re die aus Krakau und die <strong>de</strong>r Goralen. Daneben gibt es viele traditionelle<br />
Bräuche <strong>de</strong>r Lebensmittelherstellung, wie z. B. <strong>de</strong>r Schafskäse Oscypek, die Krakauer Brezel Obwarzanek und Krakauer Würste. Von <strong>de</strong>n traditionellen Bräuchen in <strong>de</strong>r Architektur sind<br />
die Wegkapellen <strong>zu</strong> nennen, vor allem in <strong>de</strong>n Beski<strong>de</strong>n und Masowien.
Verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m polnischen Brauchtum sind auch die traditionelle Musik (jüdische Klezmer, Kammermusik, Ma<strong>zu</strong>rkas, Polonaisen, Krakowiaks und Polkas) sowie <strong>de</strong>r Tanz (u. a. die<br />
Tanzensembles Mazowsze, Tanz- und Gesangsensemble Śląsk, Słowianki), das traditionelle Theater sowie die Mundartdichtung <strong>de</strong>r Goralen, Kaschuben und Schlesier.<br />
Freizeit und Sport<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r vielen Seen und <strong>de</strong>r langen sandigen Meeresküste sind Wassersportarten wie Segeln (u. a. Große Masurische Seen), Surfen (u. a. Hel), Tauchen (u. a. Danziger Bucht),<br />
Kajak (u. a. auf <strong>de</strong>n Flüssen Krutynia, Czarna Hańcza, Drawa), Schwimmen und Angeln in Polen sehr beliebt. Die Polen nutzen die vielen Wäl<strong>de</strong>r auch gerne <strong>zu</strong>m Pilze sammeln. In <strong>de</strong>n<br />
Bergen wird viel gewan<strong>de</strong>rt und Alpin Ski und Snowboard gefahren (u. a. Hohe Tatra, Beski<strong>de</strong>n, Riesengebirge). Rafting ist auf <strong>de</strong>m Gebirgsflüssen, vor allem <strong>de</strong>m Dunajec im Pieniny-<br />
Durchbruch, sehr beliebt. Auch Segel- und Ballonfliegen ist in <strong>de</strong>n Beski<strong>de</strong>n populär. Skispringen (u. a. Zakopane, Wisła) erfreut sich in Polen großer Beliebtheit. Langlauf,<br />
Hun<strong>de</strong>schlittenfahren und Eissegeln wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Waldkarpaten und Masuren praktiziert. Gleichwohl stehen beim polnischen Sportfan Fußball, Volleyball und Schwimmen am höchsten<br />
im Kurs. An <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen international be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Straßenläufe nehmen <strong>zu</strong>nehmend auch Volksläufer teil.[58][59][60] Das Schachspiel hat in Polen eine lange Tradition.<br />
Am 18. April 2007 wur<strong>de</strong> Polen <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Ukraine von <strong>de</strong>r UEFA <strong>zu</strong>m Ausrichter <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft 2012 bestimmt.<br />
Feiertage<br />
• 1. Januar Neujahr (Nowy Rok)<br />
• März, April Ostersonntag (Niedziela Wielkanocna)<br />
• März, April Ostermontag (Poniedziałek Wielkanocny)<br />
• 1. Mai Maifeiertag (Święto Państwowe 1 Maja)<br />
• 3. Mai Tag <strong>de</strong>r Verfassung vom 3. Mai 1791 (Święto Konstytucji Trzeciego Maja)<br />
• 7. Sonntag nach Ostern Pfingsten (Zielone Świątki)<br />
• 9. Donnerstag nach Ostern Fronleichnam (Boże Ciało)<br />
• 15. August Mariä Aufnahme in <strong>de</strong>n Himmel (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), gleichzeitig Tag <strong>de</strong>r Polnischen Armee<br />
• 1. November Allerheiligen (Wszystkich Świętych)<br />
• 11. November Unabhängigkeitstag (Dzień Niepodległości)<br />
• 25. Dezember 1. Weihnachtsfeiertag (pierwszy dzień Bożego Narodzenia)<br />
• Dezember 2. Weihnachtsfeiertag (drugi dzień Bożego Narodzenia)<br />
Verweise<br />
Literatur<br />
• Norman Davies: Im Herzen Europas. Geschichte Polens. Warschau 2002. ISBN 3-406-46709-1<br />
• Bun<strong>de</strong>szentrale für politische Bildung (bpb): Polen, Bonn 2001, Nr. 273/2001 ISSN 0046-9408 [61]<br />
• Brigitte Jäger-Dabek: Polen<br />
• Ursula A. J. Becher, Wlodzimierz Borodziej, Robert Maier: Deutschland und Polen im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
• Jahrbuch für Polen – 1929/30. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warschau; 703 Seiten<br />
• Peter Hengstenberg, Sylvia A. Niewiem, Clemens Ro<strong>de</strong>: Län<strong>de</strong>ranalyse Polen: Nach <strong>de</strong>m Spiel ist vor <strong>de</strong>m Spiel – Polen auf <strong>de</strong>m Weg in seine europäische Zukunft.<br />
Internationale Politikanalyse, Friedrich-Ebert-Stiftung, Juli 2008.
• Roland Walter: Geologie von Mitteleuropa. 7. Auflage. Schweizerbart, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-510-65225-9, S. 124–138.<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Auswärtiges Amt<br />
2. ↑ LUDNOŚĆ – STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU TERYTORIALNYM. Główny Urząd Statystyczny, Stand vom 31. Dez. 2009 (WebCite)<br />
3. ↑ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008<br />
4. ↑ Human Development In<strong>de</strong>x<br />
5. ↑ Krystyna Długosz-Kurczabowa: Polska – Jaka jest etymologia słowa Polska (nazwa kraju)? Wydawnictwo Naukowe PWN, 21. Februar 2003<br />
6. ↑ Przemysław Urbańczyk: Początki Polski do poprawki. 29. August 2008 auf focus.pl<br />
7. ↑ a b c d e f Główny Urząd Statystyczny Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, Juni 2010, abgerufen am 23. Juli 2010<br />
8. ↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 8–9<br />
9. ↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 8<br />
10.↑ inklusive <strong>de</strong>r je 22 Kilometer Seegrenze <strong>zu</strong> Russland und Deutschland<br />
11.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 82<br />
12.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 83<br />
13.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 87–89<br />
14.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 90<br />
15.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 93–94<br />
16.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 53<br />
17.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 57, Tabelle 3<br />
18.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 57<br />
19.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 59<br />
20.↑ Friedhelm Pelzer, Polen : eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>, Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 94–95<br />
21.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 59–96<br />
22.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 96<br />
23.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 96–97<br />
24.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 97<br />
25.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 61<br />
26.↑ a b Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 62–63<br />
27.↑ Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Län<strong>de</strong>rbericht Polen. Bun<strong>de</strong>szentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 322<br />
28.↑ a b c d e Portal <strong>de</strong>r Republik Polen, Klima, abgerufen am 11. Juli 2010<br />
29.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 47–49<br />
30.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 43<br />
31.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 44<br />
32.↑ Friedhelm Pelzer: Polen: eine geographische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong>. Darmstadt 1991, ISBN 3-534-09160-4, S. 44<br />
33.↑ Wie<strong>de</strong>r mehr (kleine) Polen. Polskie Radio, 29. Jan. 2009 (WebCite)
34.↑ a b Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Län<strong>de</strong>rbericht Polen. Bun<strong>de</strong>szentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 362<br />
35.↑ a b Dieter Bringen, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.): Län<strong>de</strong>rbericht Polen. Bun<strong>de</strong>szentrale für politische Bildung, Bonn 2009, ISBN 978-3-593-38991-2, S. 363<br />
36.↑ Verfassung <strong>de</strong>r Republik Polen vom 2. April 1997, Artikel 35<br />
37.↑ Die Polen im Ausland – Polonia. Botschaft <strong>de</strong>r Republik Polen in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland<br />
38.↑ Polnisch: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.<br />
39.↑ Kaczynskis Präsi<strong>de</strong>ntenmaschine stürzt ab. In: Spiegel Online, April 2010<br />
40.↑ BIP 2009 nach Län<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r World Economic Outlook Database, April 2010 <strong>de</strong>s Internationalen Währungsfonds<br />
41.↑ BIP (PPP) 2009 nach Län<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r World Economic Outlook Database, April 2010 <strong>de</strong>s Internationalen Währungsfonds<br />
42.↑ Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 28. Januar 2010 (polnisch)<br />
43.↑ Regiony Polski – Regions of Poland. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009<br />
44.↑ Stopa bezrobocia w latach 1990-2008. Główny Urząd Statystyczny, abgerufen am 9. Juli 2008<br />
45.↑ Aktualności – Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2008 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, vom 4. Juli 2008<br />
46.↑ a b c d e CIA World Factbook.<br />
47.↑ Der Fischer Weltalmanach 2010: Zahlen Daten Fakten, Fischer, Frankfurt, 8. September 2009, ISBN 978-3-596-72910-4<br />
48.↑ Podział dróg publicznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad<br />
49.↑ Reinhold Vetter: Autobahnbau ist Sisyphusarbeit. – Polen vor <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft 2012. laen<strong>de</strong>r-analysen.<strong>de</strong>, 7. Okt. 2008<br />
50.↑ Märkische O<strong>de</strong>rzeitung/Frankfurter Stadtbote, 19. August 2005, S. 20<br />
51.↑ Czarne punkty. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego<br />
52.↑ Polskie Radio, Sechsjährige in die Schule. 20. März 2009<br />
53.↑ Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte <strong>de</strong>r Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesba<strong>de</strong>n 2010, S. 119<br />
54.↑ Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte <strong>de</strong>r Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesba<strong>de</strong>n 2010, S. 121<br />
55.↑ Rzeczpospolita 2005, hier nach Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte <strong>de</strong>r Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesba<strong>de</strong>n 2010, S. 122<br />
56.↑ Rzeczpospolita 2005, hier nach Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte <strong>de</strong>r Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesba<strong>de</strong>n 2010, S. 123<br />
57.↑ Andrzej Chwalba: Kurze Geschichte <strong>de</strong>r Dritten Republik Polen 1989 bis 2005. Wiesba<strong>de</strong>n 2010, S. 123–124<br />
58.↑ Matthias Thiel: Die Laufszene in Polen – Lauf doch mal beim Nachbarn! In: Laufzeit. Juni 2005<br />
59.↑ Polnische Laufveranstalter tagten in Jaroslawiec an <strong>de</strong>r Ostsee – Horst Mil<strong>de</strong> und John Kunkeler als Hauptredner. German Road Races, 24. November 2009<br />
60.↑ Marathon in Polen. Marathon.<strong>de</strong><br />
61.↑ Informationen <strong>zu</strong>r politischen Bildung, Heft 273<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Geschichte Polens<br />
Die Geschichte Polens beginnt mit <strong>de</strong>r slawischen Besie<strong>de</strong>lung nach <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung, <strong>de</strong>r die Staatsgründung und Christianisierung im Jahre 966 folgte. Die frühmittelalterliche<br />
Blütezeit unter <strong>de</strong>m Herrscherhaus <strong>de</strong>r Piasten en<strong>de</strong>te 1138 mit <strong>de</strong>r Zersplitterung in einzelne Herzogtümer und <strong>de</strong>m Mongolensturm von 1241, <strong>de</strong>r weite Landstriche Südpolens<br />
verwüstete.<br />
Nach <strong>de</strong>r Einigung eines Teils polnischer Herzogtümer <strong>zu</strong>m Königreich Polen <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts, bestand seit <strong>de</strong>m Spätmittelalter bis in die Neuzeit eine enge Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
mit Litauen. Ab 1385 brachte die Union mit <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen unter <strong>de</strong>n von dort stammen<strong>de</strong>n Jagiellonen <strong>de</strong>n Aufstieg <strong>zu</strong> einer europäischen Großmacht. Ab 1569 wur<strong>de</strong> die<br />
Union Polens mit Litauen in einem gemeinsamen Staat gefestigt, <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik, die eine Wahlmonarchie war. Im 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt entstand dort eine hohe parlamentarische<br />
Kultur mit umfangreichen A<strong>de</strong>lsrechten, was <strong>zu</strong> einer starken I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>lstan<strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>m Land führte.<br />
Zahlreiche Kriege mit auswärtigen Mächten, Bürgerkriege, Aufstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ukrainischen Kosaken, <strong>de</strong>r Unwille <strong>zu</strong>r Reform bei <strong>de</strong>n Verantwortungsträgern, führten <strong>zu</strong>r beträchtlichen<br />
Schwächung <strong>de</strong>s Staates, <strong>de</strong>r Einmischung von außen ins politische System und schließlich <strong>zu</strong>m Zusammenbruch <strong>de</strong>s Staates und <strong>de</strong>ssen Fall in die Be<strong>de</strong>utungslosigkeit nach <strong>de</strong>n<br />
Teilungen im späten 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Polen-Litauen verschwand von <strong>de</strong>n Landkarten Europas als souveräner Staat, <strong>de</strong>r übriggebliebene Rumpfstaat wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Wiener Kongress<br />
1815 vom Russischen Zarenreich absorbiert. Die staatliche „Wie<strong>de</strong>rgeburt“ als Zweite Republik nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges 1918 war in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r staatlichen<br />
Reorganisation von zahlreichen militärischen Konflikten mit <strong>de</strong>n Nachbarn begleitet und en<strong>de</strong>te 1939 mit <strong>de</strong>r Vereinnahmung durch das Groß<strong>de</strong>utsche Reich und die Sowjetunion nach<br />
<strong>de</strong>m Ausbruch <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges, <strong>de</strong>r dann ab 1945 bis <strong>zu</strong>r Dritten Republik fast 45 Jahre sowjetischer Bevormundung folgten.<br />
Vor- und Frühgeschichte<br />
Erste Besiedlung<br />
Die erste Besiedlung <strong>de</strong>s heutigen Polen ist bereits im Paläolithikum nachgewiesen. Die ersten Ackerbauern gehörten seit etwa 5500 v. Chr. <strong>de</strong>r Bandkeramischen Kultur an, in <strong>de</strong>r<br />
Jungsteinzeit entstand im nördlichen Mitteleuropa die Trichterbecherkultur.<br />
In <strong>de</strong>r frühen Bronzezeit entwickelten sich die Kugelamphoren-Kultur und die Kultur <strong>de</strong>r Schnurkeramiker. In <strong>de</strong>n 1920ern wur<strong>de</strong>n Überreste einer befestigten Siedlung Biskupin aus <strong>de</strong>r<br />
Zeit <strong>de</strong>r Lausitzer Kultur ausgegraben, die, sorgfältig rekonstruiert, heute einen Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher darstellt.<br />
Germanische Besiedlung<br />
Ab etwa 750 v. Chr. wan<strong>de</strong>rten in <strong>de</strong>n Nordwesten <strong>de</strong>s heutigen Polen germanische Stämme ein, die sich innerhalb von 500 Jahren bis <strong>zu</strong>m Riesengebirge südwärts ausbreiteten. Als<br />
Ostgrenze <strong>de</strong>s germanischen Siedlungsgebietes um das Jahr 75 bezeichnete <strong>de</strong>r römische Historiker Publius Cornelius Tacitus die Weichsel. Er lokalisierte die Rugier und Gepi<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r<br />
Ostsee, Burgun<strong>de</strong>n und Goten im Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und Vandalen und Bastarnen im Sü<strong>de</strong>n, sowie östlich <strong>de</strong>r Weichsel schon die nichtgermanischen Venedae. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 2. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
begann die Abwan<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r ostgermanischen Stämme Richtung Sü<strong>de</strong>n und Osten. Die germanische Besiedlung en<strong>de</strong>te im Verlauf <strong>de</strong>s 4. und 5. Jahrhun<strong>de</strong>rts während <strong>de</strong>r<br />
Völkerwan<strong>de</strong>rung<br />
Slawische Besiedlung<br />
Im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt, unter <strong>de</strong>m Ansturm <strong>de</strong>r aus Zentralasien kommen<strong>de</strong>n Awaren, begannen sich slawische Stämme in diesen Gebieten an<strong>zu</strong>sie<strong>de</strong>ln. Die aus ihrer Heimat zwischen<br />
Karpaten und Don verdrängten Slawen bewegten sich nach Westen und Sü<strong>de</strong>n. Um 600 überschritten sie die Elbe-Saale-Linie. In <strong>de</strong>n spätantiken/frühmittelalterlichen Quellen sind<br />
Namen verschie<strong>de</strong>ner westslawischer Stämme überliefert, wie <strong>de</strong>r Abodriten, Wilzen, Liutizen, Sorben, sowie <strong>de</strong>s Stammes <strong>de</strong>r Polanen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m heutigen Staat Polen seinen Namen gab.
Erste Staatsgründung<br />
Die ersten Versuche einer Staatsgründung unter <strong>de</strong>n Westslawen fan<strong>de</strong>n südlich <strong>de</strong>s heutigen Polen auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r ehemaligen Tschechoslowakei statt. Um 626 wur<strong>de</strong> im Kampf<br />
gegen das Awaren- und Frankenreich das Reich <strong>de</strong>s Samo gegrün<strong>de</strong>t (<strong>de</strong>ssen Existenz nur durch die Fre<strong>de</strong>garchronik bezeugt ist). Der erste historisch belegte Herrscher <strong>de</strong>r Westslawen<br />
hieß Derwan, <strong>de</strong>r 632 eine Allianz mit Samo einging. Nach <strong>de</strong>m Zusammenbruch <strong>de</strong>s Samo-Reiches um 660 fehlen jegliche schriftlichen Überlieferungen über Westslawen. Erst in <strong>de</strong>r<br />
Zeit Karls <strong>de</strong>s Großen erwähnen die Quellen diese Völker wie<strong>de</strong>r. Nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Frankenherrscher in <strong>de</strong>n Sachsenkriegen im Bündnis mit östlich benachbarten Slawen die Sachsen seiner<br />
Herrschaft unterwarf, wur<strong>de</strong> auch ein Unterstamm <strong>de</strong>r Elbslawen, die Drewjanen, die ab <strong>de</strong>m 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt im heutigen Wendland, das heißt „Slawenland“, sie<strong>de</strong>lten, <strong>de</strong>m Frankenreich<br />
811 einverleibt. Der Stammesname überdauerte in <strong>de</strong>r Bezeichnung Drawehn bis in die heutige Zeit.<br />
Zum Schutz <strong>de</strong>s Frankenreiches vor <strong>de</strong>n heidnischen Slawen wur<strong>de</strong>n entsprechend <strong>de</strong>r karolingischen Praxis Grenzmarken errichtet. Es entstand <strong>de</strong>r Limes Sorabicus, die sorbische<br />
Grenzmark. Nach <strong>de</strong>r Unterwerfung <strong>de</strong>r Awarenkonfö<strong>de</strong>ration durch fränkische Heere um 800, entstand an <strong>de</strong>r Ostflanke <strong>de</strong>s fränkischen Reiches die Pannonische Mark, in <strong>de</strong>r slawische<br />
Stammesbün<strong>de</strong> sie<strong>de</strong>lten. Die größte Be<strong>de</strong>utung unter ihnen kam <strong>de</strong>m Mährischen- und <strong>de</strong>m Nitraer Fürstentum <strong>zu</strong>, aus <strong>de</strong>nen sich um 830 das spätere Reich <strong>de</strong>r Großmährer<br />
herausbil<strong>de</strong>te. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts erreichte dieses christliche Reich unter Großfürst Sventopluk seine größte territoriale Aus<strong>de</strong>hnung und weitete seine Einflusssphäre auf die<br />
Gebiete <strong>de</strong>r benachbarten Stämme aus. Diese Nachbarschaft begünstigte eine Vereinigung lechischer Stämme unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>r Polanen.<br />
Im 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt berichtete ein namentlich nicht näher bekannter „bayerischer Geograph“ über Stammesstrukturen auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Polen. Der Slawenapostel Methodius<br />
schrieb über einen mächtigen Staat <strong>de</strong>r Wislanen mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Krakau, <strong>de</strong>r bereits nach slawisch-griechischem Ritus christianisiert gewesen sei. Eine Konsolidierung <strong>de</strong>s<br />
polanischen Staates unter <strong>de</strong>m Herrscherhaus <strong>de</strong>r Piasten konnten auch die ungarischen Raubzüge, beson<strong>de</strong>rs nach <strong>de</strong>r Schlacht auf <strong>de</strong>m Lechfeld 955, nicht mehr bedrohen.<br />
960–1138: Staatsgründung und erste Piasten<br />
Staatsgründung und Christianisierung Polens<br />
Polen, <strong>de</strong>ssen Name sich vom westslawischen Stamm <strong>de</strong>r Polanen ableitet, wur<strong>de</strong> als Herzogtum im späten 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>r Region um die Städte Posen und Gnesen gegrün<strong>de</strong>t. Mit<br />
<strong>de</strong>r Machtübernahme durch Herzog Mieszko I. aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Piasten 960 trat Polen als gefestigter, organisierter Staat offen in Erscheinung. Im Jahr 963 wur<strong>de</strong> Mieszko das erste<br />
Mal schriftlich erwähnt. Dieses Datum wird oft als Beginn <strong>de</strong>r polnischen Geschichtsschreibung gesehen. Anlass waren die Einfälle <strong>de</strong>r sächsischen Markgrafen Gero aus <strong>de</strong>r Ostmark<br />
und Wichmanns <strong>de</strong>s Jüngeren aus <strong>de</strong>r Mark <strong>de</strong>r Billunger, eines abgefallenen sächsischen Vasalls <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Königs Otto I. Im Zuge dieser Kämpfe wur<strong>de</strong> Mieszko von bei<strong>de</strong>n<br />
Markgrafen besiegt und für einen Teil seines Herrschaftsgebiets in <strong>de</strong>r Region um Lebus <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich gegenüber tributpflichtig gemacht. Im Jahre 965 verbün<strong>de</strong>te sich<br />
Herzog Mieszko mit <strong>de</strong>n christlichen Böhmen, ließ sich 966 nach römisch-katholischem Ritus taufen und heiratete im Anschluss die böhmische Herzogstochter Dobrawa aus <strong>de</strong>m<br />
Geschlecht <strong>de</strong>r Przemysli<strong>de</strong>n. Damit musste auch das polnische Volk <strong>de</strong>m Beispiel seines Knjas folgen. Die Annahme <strong>de</strong>s Christentums war eine machtpolitische Entscheidung, bedingt<br />
durch die Einfälle <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Markgrafen unter <strong>de</strong>m Vorwand <strong>de</strong>r Hei<strong>de</strong>nbekämpfung und -mission einerseits, sowie <strong>de</strong>r kulturellen und dynastischen Stärkung (Gründung von<br />
Kirchen und Klostern, Supremat über konkurrieren<strong>de</strong> A<strong>de</strong>lsgeschlechter) und <strong>de</strong>r Aufnahme in die christliche Gemeinschaft europäischer Fürsten an<strong>de</strong>rerseits. Für die polnische<br />
Kirchenprovinz wur<strong>de</strong> 968 ein <strong>de</strong>m Papst direkt[1] unterstehen<strong>de</strong>s Missionsbistum in Posen gegrün<strong>de</strong>t mit Bischof Jordanes (auch: Jordan) an <strong>de</strong>r Spitze.<br />
Die offizielle Annahme <strong>de</strong>s christlichen Glaubens durch <strong>de</strong>n polnischen Fürsten vermin<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>nnoch kaum die Einfälle <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Markgrafen. Bereits ein Jahr nach <strong>de</strong>r<br />
Christianisierung Polens, 967, begann Graf Wichmann einen Krieg gegen Mieszko. Das böhmisch-polnische Bündnis trug nun die ersten Früchte, als <strong>de</strong>r polnische Fürst mit Hilfe<br />
przemyslidischer Reitertruppen Wichmann, <strong>de</strong>r sich <strong>zu</strong>m militärischen Führer <strong>de</strong>s slawischen Wolinerbun<strong>de</strong>s erhob, besiegten. Das Schwert <strong>de</strong>s Markgrafen wur<strong>de</strong> von Mieszko an Kaiser<br />
Otto ausgeliefert. Mieszkos Vorstoß nach Pommern stand nun nichts mehr im Weg. Auf <strong>de</strong>r Grundlage eines im Innern gefestigten Staatswesens unterwarf Mieszko in <strong>de</strong>n Jahren 967–979<br />
ganz Hinterpommern mit Stettin und Pommerellen mit Danzig. Der Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee be<strong>de</strong>utete unmittelbaren Kontakt mit Skandinavien. Mieszkos Tochter Świętosława aus <strong>de</strong>r Ehe mit<br />
Dobrawa heiratete König Sven von Dänemark und wur<strong>de</strong> die Mutter <strong>de</strong>r dänischen Könige Harald und Knut.<br />
An <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong>r sächsischen Ostmark, die nach 965 aus machtpolitischem Kalkül in fünf einzelne Markgrafschaften geteilt wur<strong>de</strong>, kam es 972 erneut <strong>zu</strong> Spannungen. Markgraf Hodo I.<br />
aus <strong>de</strong>r Mark Lausitz, for<strong>de</strong>rte Mieszko heraus und drang mit seinen Truppen auf polnisches Gebiet. In <strong>de</strong>r Nähe von Zeh<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r unteren O<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> das Heer <strong>de</strong>s Markgrafen
eingekreist und in die Flucht geschlagen. Dabei fand <strong>de</strong>r einzige namentlich bekannte Bru<strong>de</strong>r Mieszkos, Czcibor, <strong>de</strong>n Tod. Durch <strong>de</strong>n Sieg über Hodo und <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Großen<br />
Slawenaufstand 983 kam die <strong>de</strong>utsch-sächsische Ostexpansion für fast zwei Jahrhun<strong>de</strong>rte <strong>zu</strong>m Erliegen. Kaiser Otto – besorgt über die Zustän<strong>de</strong> an seiner Ostgrenze – rief die<br />
Kontrahenten während <strong>de</strong>s Quedlinburger Hoftages von 973 <strong>zu</strong>r Ruhe und Ordnung auf. Mieszko schloss mit Graf Hodo Frie<strong>de</strong>n und leistete <strong>de</strong>m Kaiser <strong>de</strong>n Treueid. Inwieweit Polen<br />
damit in ein Lehnsverhältnis <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich eintrat, ist historisch umstritten, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Kaiser verstarb bereits wenige Wochen nach <strong>de</strong>m Urteilsspruch.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod von Mieszkos erster christlichen Frau Dobrawa und seiner Heirat 978 mit <strong>de</strong>r Sächsin Oda von Hal<strong>de</strong>nsleben erfolgte ein Bruch zwischen Polen und Böhmen. Es kam <strong>zu</strong>r<br />
Entfremdung zwischen bei<strong>de</strong>n Staaten, was schließlich 986–990 in Krieg mün<strong>de</strong>te. In diesem Konflikt wur<strong>de</strong>n Schlesien, Kleinpolen und wahrscheinlich auch Mähren <strong>de</strong>m polnischen<br />
Reich einverleibt, während die Tscherwenischen Burgen an <strong>de</strong>n ruthenischen Großfürsten Wladimir von Kiew 981 verloren gingen. Damit verloren die Piasten die Kontrolle über eine<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lspassage mit Osteuropa, <strong>de</strong>ren Erwerb quellenmäßig nicht fassbar ist.<br />
Mieszko huldigte 986 <strong>de</strong>m min<strong>de</strong>rjährigen Kaiser <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches, Otto III., in Quedlinburg und führte in seinem Namen als „Markgraf <strong>de</strong>s Reiches“ einen<br />
Hei<strong>de</strong>nfeld<strong>zu</strong>g gegen die Elbslawen an. Im Gegen<strong>zu</strong>g unterstützte ihn Kaiserin Theophanu, die als Regentin für ihren Sohn die Macht im Reich übernahm, militärisch im Kampf gegen<br />
Böhmen.<br />
Im Jahr 991, kurz vor seinem Tod, stellte <strong>de</strong>r erste historisch belegte Herrscher Polens sein gesamtes Land unter <strong>de</strong>n Schutz <strong>de</strong>s Papstes, <strong>de</strong>r im Mittelalter ein politischer Gegenspieler<br />
<strong>de</strong>s Kaisers war. Polen wur<strong>de</strong> päpstliches Lehen. Er verstarb im Jahr 992 und wur<strong>de</strong> im Posener Dom begraben. Sein Nachfolger wur<strong>de</strong> sein ältester Sohn aus <strong>de</strong>r Ehe mit Dobrawa,<br />
Bolesław, genannt Chrobry, <strong>de</strong>r Tapfere.<br />
Der erste zeitgenössische Bericht über das Königreich Polen stammt vom spanischen Reisen<strong>de</strong>n Ibrahim ibn Jaqub gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Königreich Polen<br />
Mieszko I. teilte sein Reich nach altslawischer Tradition unter seinen Söhnen Bolesław I., aus <strong>de</strong>r Ehe mit Dobrawa sowie Świętopełk, Lambert und Mieszko aus <strong>de</strong>r Ehe mit Oda auf.<br />
Bolesław entmachtete mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng einflussreicher Magnaten seine Stiefmutter und vertrieb sie samt ihrer Söhne aus Polen, wo sie bei Verwandten in Sachsen Aufnahme und Schutz<br />
fan<strong>de</strong>n. Die Reichseinheit war somit wie<strong>de</strong>rhergestellt. Bolesław setzte die Bündnispolitik seines Vaters fort, in<strong>de</strong>m er 995 <strong>de</strong>n für volljährig erklärten Kaiser Otto III., bei <strong>de</strong>r<br />
Verteidigung <strong>de</strong>s christlichen Glaubens unterstützte. Er beteiligte sich gemäß <strong>de</strong>r Quedlinburger Absprache von 991 an <strong>de</strong>ssen Kampf gegen die heidnischen Elbslawen. Dieser Kampf<br />
verlief allerdings weitgehend erfolglos. Der östliche Teil <strong>de</strong>r Nordmark mit <strong>de</strong>m Zentrum Lebus hingegen blieb bis ins 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt unter polnischem Einfluss.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Christianisierung <strong>de</strong>r baltischen Stämme an <strong>de</strong>r Ostsee kam Bischof Adalbert von Prag nach Polen, von wo er mit polnischer Unterstüt<strong>zu</strong>ng 997 in das Pruzzenland<br />
gelangte und dort seinen Märtyrertod fand. Bolesław löste <strong>de</strong>n Leichnam Adalberts aus und setzte diesen in <strong>de</strong>r Kathedrale <strong>zu</strong> Gnesen bei. Die sterblichen Überreste wur<strong>de</strong>n im Anschluss<br />
an <strong>de</strong>n böhmisch-polnischen Krieg von 1038 nach Prag überführt. Adalbert wur<strong>de</strong> aufgrund seiner Missionsarbeit und seines Märtyrertums 999 von <strong>de</strong>r Kurie heilig gesprochen.<br />
Daraufhin erteilten <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Monarch und Papst Silvester II. die Zustimmung <strong>zu</strong>r Errichtung einer unabhängigen polnischen Kirchenprovinz.<br />
Im Jahre 1000 pilgerte <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche Kaiser Otto III., mit <strong>de</strong>m Bolesław ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt, <strong>zu</strong>m Grab <strong>de</strong>s Märtyrers Adalbert in Gnesen. In einem<br />
Staatsakt verkün<strong>de</strong>te er sein Reichskonzept von <strong>de</strong>r Renovatio Imperii Romanorum, welches Polen neben Gallia und Germania als gleichrangige Stütze <strong>de</strong>s Imperiums vorsah. Für die<br />
slawischen Provinzen wur<strong>de</strong> das Erzbistum Gnesen mit Adalberts Bru<strong>de</strong>r Gau<strong>de</strong>ntius als erstem Erzbischof errichtet, <strong>de</strong>m die gegrün<strong>de</strong>ten Bistümer Kolberg, Krakau und Breslau<br />
unterstan<strong>de</strong>n. Die Errichtung einer unabhängigen Kirchenprovinz spielte in <strong>de</strong>r Folge bei <strong>de</strong>r Emanzipation Polens vom Heiligen Römischen Reich eine wichtige Rolle. Während dieses<br />
Besuches erkannte Otto III. offiziell die Souveränität <strong>de</strong>s piastisch-polnischen Herrschers an. Die seit 963 bestehen<strong>de</strong> Tributpflicht entfiel. Der Kaiser versuchte durch die Einbindung <strong>de</strong>r<br />
mittlerweile christianisierten Völker <strong>de</strong>s Ostens ein neues christliches Weltreich unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Kaisers als weltliches Oberhaupt <strong>de</strong>r Christenheit <strong>zu</strong> verfestigen. Bei diesen<br />
Überlegungen kam Polen eine Schlüsselposition innerhalb <strong>de</strong>r „Sclavinia“ <strong>zu</strong>. Otto begünstigte die Konsolidierung und Machtausweitung <strong>de</strong>r Piasten gegenüber <strong>de</strong>n tschechischen<br />
Przemysli<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Interessen nicht mit <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches in Einklang stan<strong>de</strong>n und die sich <strong>zu</strong><strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>n Slavniki<strong>de</strong>n im Krieg befan<strong>de</strong>n, einem böhmischen<br />
A<strong>de</strong>lsgeschlecht, <strong>de</strong>ssen be<strong>de</strong>utendster Vertreter, <strong>de</strong>r Heilige Adalbert von Prag war. Bolesław soll von Otto in Gnesen <strong>zu</strong>m König erhoben wor<strong>de</strong>n sein. Dies ist aufgrund mangeln<strong>de</strong>r<br />
Beweise historisch umstritten; es gibt aber <strong>de</strong>utliche Indizien, die die Königsthese stützen. Als gesichert gilt, dass die Krönungszeremonie <strong>de</strong> jure nicht vollzogen wur<strong>de</strong>, da die Erlaubnis<br />
<strong>de</strong>s Papstes fehlte. Aufgrund <strong>de</strong>s frühen To<strong>de</strong>s Ottos III. und <strong>de</strong>s vehementen politischen Wi<strong>de</strong>rstands <strong>de</strong>s neuen <strong>de</strong>utschen Königs und späteren römisch-<strong>de</strong>utschen Kaisers Heinrichs II.
fand die offizielle Krönung als Wie<strong>de</strong>rholungsakt erst 1025 statt.<br />
Der frühe Tod Ottos III. im Jahre 1002 und die darauf folgen<strong>de</strong> Thronbesteigung Heinrichs II., <strong>de</strong>r in Bolesław bloß einen seiner vielen slawischen Vasallen sah, verän<strong>de</strong>rte die<br />
Beziehungen Polens <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich grundlegend. Bolesław trat in Opposition <strong>zu</strong>m Reich, wobei er, durch Otto beeinflusst, anscheinend eine eigene I<strong>de</strong>e eines<br />
christlichen „Universalreiches“ entwickelte und nunmehr persönliche Ziele <strong>de</strong>r Expansion verfolgte und jedwe<strong>de</strong> Huldigung gegenüber <strong>de</strong>m neuen König verweigerte. Dies führte <strong>zu</strong><br />
einem mehrjährigen Krieg Polens mit <strong>de</strong>m Reich, an <strong>de</strong>ssen En<strong>de</strong> sich Polen dank seiner bereits gefestigten Staatlichkeit behaupten konnte und im Frie<strong>de</strong>n von Bautzen einen<br />
Ausgleichsfrie<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Kaiser schloss. Dies verdankte Bolesław seiner dynastischen Politik, <strong>de</strong>n sächsischen Verbün<strong>de</strong>ten im Reich sowie seinem Schwager König Sven von<br />
Dänemark, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Kaiser vom Nor<strong>de</strong>n drohte<br />
Die im Jahr 1000 in Gnesen getroffene Absprache zwischen Polen und <strong>de</strong>m Reich wur<strong>de</strong> wi<strong>de</strong>rwillig von Heinrich bestätigt. Bolesław for<strong>de</strong>rte als Bündnispartner <strong>de</strong>s „Westreichs“ vom<br />
römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser militärische Unterstüt<strong>zu</strong>ng für seinen lange geplanten Zug nach Kiew gegen Jaroslaw, die er letztlich auch bekam. Er konnte <strong>de</strong>m Kaiser zwar die gesamte<br />
Mark Meißen nicht abringen, behielt im Gegen<strong>zu</strong>g aber seine Erwerbungen im Westen, das Milzener Land und die Mark Lausitz, die dann bis 1031 bei Polen verblieben. Insgesamt führte<br />
<strong>de</strong>r Krieg mit <strong>de</strong>m Reich <strong>zu</strong> einem Substanzverlust im Inneren. Bolesław griff <strong>de</strong>nnoch in die Streitigkeiten <strong>de</strong>r slawischen Stämme in <strong>de</strong>r Nordmark ein und legte in Berlin-Köpenick<br />
eine Burg auf <strong>de</strong>r heutigen Schlossinsel an. Für die nächsten 120 Jahre, bis Mitte <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts, war Köpenick <strong>de</strong>r Sitz eines piastischen Vasalls.<br />
Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss mit <strong>de</strong>m Kaiser wandte er sich nach Kiew, <strong>de</strong>r reichen Hauptstadt <strong>de</strong>r Kiewer Rus, um seinen Schwiegersohn, Großfürst Swjatopolk, gegen <strong>de</strong>ssen Bru<strong>de</strong>r<br />
Jaroslaw <strong>zu</strong> unterstützen. Nach erfolgreicher Wie<strong>de</strong>reinset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s vertriebenen Fürsten erwarb er 1018 die Tscherwenischen Burgen für Polen <strong>zu</strong>rück. Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Bautzen<br />
und seinem Zug nach Kiew war Bolesław bis <strong>zu</strong>m Erstarken Jaroslaws <strong>de</strong>s Weisen <strong>de</strong>r Kiewer Rus und <strong>de</strong>s Reiches unter Kaiser Konrad II. <strong>de</strong>r einflussreichste Herrscher in Mittel- und<br />
Osteuropa. Im Jahr 1024 verstarb Kaiser Heinrich. Das daraus resultieren<strong>de</strong> <strong>de</strong>utsche Interregnum nutzte Bolesław Chrobry, in<strong>de</strong>m er sich 1025 ein zweites Mal (Wie<strong>de</strong>rholungsakt <strong>de</strong>r<br />
Krönungszeremonie aus <strong>de</strong>m Jahr 1000) <strong>zu</strong>m König krönen ließ. Trotz <strong>de</strong>s Prestigegewinns konnte sich das Königtum <strong>zu</strong>nächst nicht dauerhaft etablieren.<br />
Bolesław för<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>n christlichen Glauben in Polen, wissend, dass <strong>de</strong>r Papst im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten machtpolitischen Konkurrenten <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Kaisers war.<br />
Durch die erfolgreiche Gründung einer unabhängigen polnischen Kirchenprovinz und <strong>de</strong>s Erzbistums Gnesen sowie durch seine Krönung <strong>zu</strong>m ersten polnischen König trieb er die<br />
polnische Emanzipation vom Heiligen Römischen Reich voran. Er war auch <strong>de</strong>r Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r polnischen Kastellanverfassungsordnung. Unter seiner Regentschaft wur<strong>de</strong> das politisch<br />
relativ unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Herzogtum seines Vaters <strong>zu</strong> einem Machtfaktor in <strong>de</strong>r Region mit Einflusssphären von <strong>de</strong>r Elbe bis <strong>zu</strong>m Dnepr und von <strong>de</strong>r Ostsee bis an die Donau. In Polen gilt<br />
Bolesław bis heute als eine wichtige historische Persönlichkeit und liegt neben seinem Vater Mieszko I. in <strong>de</strong>r Kathedrale von Posen begraben.<br />
Machtverfall<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Bolesławs übernahm sein Sohn Mieszko II. Lambert die Herrschaft. Dieser galt als sehr gebil<strong>de</strong>t. Er erhob sich und seine <strong>de</strong>utsche Frau Richeza sofort nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s<br />
Vaters in <strong>de</strong>n Stand <strong>de</strong>r Könige, um seine Souveränität vor <strong>de</strong>r Lehnsherrschaft <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser <strong>zu</strong> sichern. Dennoch gelang es ihm nicht, die von seinem Vater eroberten<br />
Gebiete <strong>zu</strong> halten. Nach nur fünf Jahren <strong>de</strong>r Herrschaft begann sein Reich aufgrund einer Vielzahl von Faktoren <strong>zu</strong> zerfallen. Die <strong>de</strong>m Volk auferlegten Kosten, welche durch Kriege, <strong>de</strong>n<br />
Aufbau <strong>de</strong>r Monarchie und die wachsen<strong>de</strong>n kirchlichen Strukturen entstan<strong>de</strong>n, führten <strong>zu</strong> innerer Instabilität. Die ins Ausland geflüchteten Brü<strong>de</strong>r Mieszkos, Otto und Bezprym,<br />
<strong>de</strong>savouierten Mieszkos Herrschaft ebenfalls.<br />
König Mieszko II. unternahm in <strong>de</strong>n Jahren 1028 und 1030 Kriegszüge gegen östliche Teile <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches, vor allem gegen Thüringen und <strong>de</strong>m Stammesherzogtum<br />
Sachsen, weil <strong>de</strong>r neue Kaiser im Reich, Konrad II., ihm die Anerkennung als König verweigerte. Mieszko hatte im Reich <strong>de</strong>r Salier und in <strong>de</strong>r Kiewer Rus mächtige Fein<strong>de</strong>. Mehrere<br />
gleichzeitig vorgetragene militärische Aktionen Konrads und <strong>de</strong>s ruthenischen Großfürsten Jaroslaw, <strong>de</strong>r bereits <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Fein<strong>de</strong>n seines Vaters gehörte, führten <strong>zu</strong>m Verlust <strong>de</strong>r Mark<br />
Lausitz und <strong>de</strong>r Tscherwenischen Burgen. Diese Allianz stärkte die innere Opposition, da sich die Verwandtschaft Mieszkos jetzt mit <strong>de</strong>n Gegnern <strong>de</strong>s Herrschers verbün<strong>de</strong>te. Schließlich<br />
wur<strong>de</strong> Mieszko 1031 gestürzt und war gezwungen das Land seinem Halbbru<strong>de</strong>r Bezprym und <strong>de</strong>m jüngeren Bru<strong>de</strong>r Otto <strong>zu</strong> überlassen, selbst floh er nach Böhmen.<br />
Bezpryms Herrschaft dauerte nicht lange. Es kam <strong>zu</strong>m Aufstand gegen <strong>de</strong>n neuen Herrscher, <strong>de</strong>r schließlich 1032 ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Sein Tod eröffnete für Mieszko die Möglichkeit einer<br />
Rückkehr in die Heimat. Er verständigte sich mit Otto und kehrte nach Polen <strong>zu</strong>rück. Nach<strong>de</strong>m Kaiser Konrad mit einer weiteren militärischen Intervention in Polen drohte, wur<strong>de</strong> eine<br />
Einigung während <strong>de</strong>s Hoftags von Merseburg 1033 erreicht. Mieszko verzichtete auf die Königswür<strong>de</strong> und teilte sein Reich <strong>zu</strong>nächst mit seinem Bru<strong>de</strong>r Otto und Dietrich, einem Enkel
Mieszkos I. Noch im selben Jahr verstarb Herzog Otto, und Dietrich verlor aus nicht bekannten Grün<strong>de</strong>n seinen ihm <strong>zu</strong>gewiesenen polnischen Machtbereich, so dass Mieszko die<br />
Reichseinheit noch kurz vor seinem Tod, am 10. Mai 1034, wie<strong>de</strong>r errang.<br />
Mieszko II. hinterließ nach seinem Ableben ein geschwächtes Reich, das mangels starker königlicher Autorität durch Volksaufstän<strong>de</strong> und heidnischer Reaktion <strong>zu</strong> erodieren begann.<br />
Durch <strong>de</strong>n Verzicht auf königliche Ehren stand Polen ab 1033 erneut für Jahrzehnte in Abhängigkeit <strong>zu</strong>m römisch-<strong>de</strong>utschen Kaisertum.<br />
Staatskrise, Erneuerung und neue Machtentfaltung<br />
Mieszkos Sohn Kasimir I. übernahm nach <strong>de</strong>ssen Tod die Herrschaft. Er hielt sich jedoch nicht lange an <strong>de</strong>r Macht und musste auf Druck <strong>de</strong>r Opposition 1037 von Polen nach Ungarn<br />
flüchten. Nach an<strong>de</strong>ren Quellen kam er erst 1039 das erste Mal nach Polen. In <strong>de</strong>n Jahren 1037 bis 1039 fand ein Auflösungsprozess <strong>de</strong>s polnischen Staates statt. In <strong>de</strong>r Region Großpolen<br />
kam es <strong>zu</strong> Aufstän<strong>de</strong>n gegen die Kirche und das Magnatentum. Diese hatten von sozio-politischen Verän<strong>de</strong>rungen wie <strong>de</strong>r Einführung eines <strong>de</strong>m Zehnten ähnlichen Systems profitiert,<br />
während man die bis dato freien Bauern in ein Abhängigkeitsverhältnis zwang; ein Rückfall ins Hei<strong>de</strong>ntum folgte. Einzelne Regionen verselbstständigten sich, unter an<strong>de</strong>rem Masowien<br />
und Pommern.<br />
Die Schwäche <strong>de</strong>r piastischen Zentralgewalt nutzte <strong>de</strong>r böhmische Herzog, in<strong>de</strong>m er einen Kriegs<strong>zu</strong>g nach Polen unternahm und die Gebeine <strong>de</strong>s Heiligen Adalbert erbeutete. Großpolen<br />
wur<strong>de</strong> verwüstet und Schlesien erobert. Hin<strong>zu</strong> kamen noch Plün<strong>de</strong>rungszüge <strong>de</strong>r heidnischen Pruzzen und Pomoranen. Der neue Kaiser im Reich, Heinrich III., versuchte ein politisches<br />
Erstarken Böhmens unter Břetislav I. <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn und unterstütze Kasimir I. 1039 militärisch. Mit dieser Hilfe gelangte Herzog Kasimir I. wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Besitz Großpolens und 1040<br />
Kleinpolens. Krakau wur<strong>de</strong> neue Hauptstadt Polens, da Großpolen nach vielen Aufstän<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m böhmisch-polnischen Krieg <strong>zu</strong> verwüstet war. Der Kaiser zwang <strong>de</strong>n böhmischen<br />
Herrscher 1041 <strong>zu</strong>m Verzicht auf Ansprüche gegenüber Polen, gab jedoch Schlesien nicht an Polen <strong>zu</strong>rück. Um die Grenze im Osten ab<strong>zu</strong>sichern, schloss Kasimir I. im selben Jahr ein<br />
Bündnis mit Jaroslaw von Kiew und heiratete wenig später <strong>de</strong>ssen Schwester, Fürstin Dobroniega Maria. Jaroslaw gewährte ihm daraufhin 1047 militärische Hilfe bei <strong>de</strong>r Rückeroberung<br />
Masowiens und Pommerellens. Gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s Kaisers erlangte Kasimir I. um 1046 Schlesien von Böhmen <strong>zu</strong>rück. Erst nach<strong>de</strong>m Břetislav I. um 1053 die „bayrische Rebellion“<br />
gegen <strong>de</strong>n Kaiser unterstützte und bei ihm dadurch in Ungna<strong>de</strong> fiel, musste er auf Drängen <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Herrschers 1054 in Quedlinburg gegen jährliche Tributzahlungen auf Polen<br />
endgültig verzichten, was <strong>zu</strong>m Anlass für weitere böhmisch-polnische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>. Die bei<strong>de</strong>n gleichstarken slawischen Staaten wur<strong>de</strong>n so für Jahrzehnte politischmilitärisch<br />
geschwächt.<br />
Kasimir gilt als <strong>de</strong>rjenige polnische Herrscher, <strong>de</strong>r mit Hilfe seines Onkels, <strong>de</strong>s Erzbischofs <strong>zu</strong> Köln, Hermann II., <strong>de</strong>n christlichen Staat <strong>de</strong>r Piasten nach <strong>de</strong>r letzten heidnischen Reaktion<br />
wie<strong>de</strong>raufbaute und <strong>zu</strong><strong>de</strong>m durch seine Landvergabe an Krieger <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ren Versorgung das Rittertum in Polen begrün<strong>de</strong>te. Unter seinen zahlreichen Benediktinergründungen in Polen<br />
befin<strong>de</strong>t sich das Kloster auf <strong>de</strong>m Berge Tyniec bei Krakau, in das er Mönche aus Köln berief.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Kasimirs 1058 folgte ihm sein Sohn Bolesław II., genannt <strong>de</strong>r Kühne, nach. Dieser betrieb eine sehr erfolgreiche Außenpolitik. So entledigte er sich <strong>de</strong>r Tributpflicht für<br />
Schlesien an Böhmen. Auch gelang es ihm 1076 mit Erlaubnis <strong>de</strong>s Papstes Gregor VII., die Königswür<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen. Er setzte vor allem im Bereich <strong>de</strong>r kirchlichen Strukturen die<br />
Wie<strong>de</strong>raufbauarbeit seines Vaters fort. Einen Schatten auf seine Herrschaft wirft die Verurteilung und Tötung <strong>de</strong>s Bischofs Stanislaus von Krakau unter unklaren Umstän<strong>de</strong>n, welche einen<br />
Aufstand gegen Bolesław auslösten, <strong>de</strong>r schließlich <strong>zu</strong> seiner Flucht nach Ungarn führte, wo er 1082 verstarb.<br />
Auf Bolesław II. folgte sein jüngerer Bru<strong>de</strong>r Władysław I. Herman. Bereits wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung versöhnte er sich mit <strong>de</strong>m Sohn seines vertriebenen Bru<strong>de</strong>rs,<br />
gestattete ihm <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>kehren und stattete ihn mit einer eigenen Provinz aus. Für einige Jahre zahlte er wie<strong>de</strong>r Tribut an Böhmen für <strong>de</strong>n Besitz Schlesiens. Zum En<strong>de</strong> seiner Herrschaft<br />
geriet er in Konflikt mit seinen Söhnen, Bolesław (III.) und Zbigniew. Er musste ihnen auf Druck <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsopposition 1098 eigene Provinzen <strong>zu</strong>teilen, behielt aber noch die<br />
Oberherrschaft mit Hauptsitz in Płock. Während seiner Herrschaft kamen 1096 die ersten Ju<strong>de</strong>n in großer Zahl nach Polen, die dort Schutz gegen die Pogrome, die während <strong>de</strong>s Ersten<br />
Kreuz<strong>zu</strong>gs in vielen Städten Westeuropas ausbrachen, suchten. Władysław Herman starb 1102 und hinterließ ein zwischen seinen Söhnen zweigeteiltes Polen.<br />
Erbteilung<br />
Bolesław III. Schiefmund unterwarf 1108 seinen Halbbru<strong>de</strong>r Zbigniew und wehrte 1109 einen Kriegs<strong>zu</strong>g Kaiser Heinrichs V., <strong>de</strong>r damit nicht einverstan<strong>de</strong>n war, erfolgreich ab.<br />
Unter seiner Herrschaft <strong>de</strong>hnte Polen seinen Machtbereich durch die endgültige Unterwerfung <strong>de</strong>r heidnischen Pomoranen und damit <strong>de</strong>r letzten freien heidnischen Slawengebiete, die er
von Otto von Bamberg christianisieren ließ, auf Pommern aus. In Ottos Geleit kamen unter an<strong>de</strong>rem die ersten <strong>de</strong>utschen Siedler als Mönche nach Pommern. Bolesławs Einflussbereich<br />
erstreckte sich bis ins heutige Bran<strong>de</strong>nburg hinein. Durch die Gründung <strong>de</strong>s Bistums Lebus blieb Bran<strong>de</strong>nburg bis ins 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt kirchlich mit <strong>de</strong>m Erzbistum Gnesen verbun<strong>de</strong>n.<br />
Gegen En<strong>de</strong> seiner Regierungszeit verwickelte er Polen in Konflikte mit Ungarn und Böhmen. Seine Töchter ließ er in die skandinavischen, sächsischen und ruthenischen<br />
Herrscherhäuser einheiraten.<br />
Da Bolesław III. Bru<strong>de</strong>rkämpfe unter seinen vier Söhnen vermei<strong>de</strong>n wollte, teilte er sein Reich nach slawischem Brauch auf, wobei <strong>de</strong>r Älteste <strong>de</strong>s Piastengeschlechts im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Senioratsprinzips die Einheit <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s nach außen verkörpern sollte.[2]<br />
1138–1295: Partikularismus<br />
Deutsche Ostsiedlung<br />
Lan<strong>de</strong>sordnung in Kraft und <strong>de</strong>r Älteste <strong>de</strong>s Piastengeschlechts, Władysław II., wur<strong>de</strong> Seniorherzog von Polen mit Sitz in Krakau. Die jüngeren Brü<strong>de</strong>r herrschten als Juniorherzöge in<br />
<strong>de</strong>n ihnen <strong>zu</strong>geteilten Regionen. Bereits 1146 kam es <strong>zu</strong>m Bruch und Bolesławs ältester Sohn, Władysław, wur<strong>de</strong> mit Hilfe <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls von seinen Brü<strong>de</strong>rn aus Polen vertrieben. Es<br />
entbrannten dauerhafte Kämpfe um die Kontrolle Krakaus und das Supremat über das gesamte Land in <strong>de</strong>n nächsten 150 Jahren. Das Königreich zerbrach in mehrere piastische<br />
Herzogtümer, die sich um Macht, Territorien und Einfluss gegenseitig befeh<strong>de</strong>ten. Dadurch wur<strong>de</strong> die politisch-militärische Stellung Polens im Europa <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts geschwächt.<br />
Die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r polnischen Einheitstaates lebte weiter in <strong>de</strong>r einheitlichen Kirchenorganisation und <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r großen A<strong>de</strong>lsgeschlechter, sowie in <strong>de</strong>r dynastischen Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
(Verwandtschaft) aller Herrscher<br />
Bei <strong>de</strong>r Vertreibung Mieszko III. durch lokale Magnatengeschlechter setzten sich 1177 die jüngeren Vertreter <strong>de</strong>r Dynastie in Krakau durch. Zwar blieb eine gewisse Oberhoheit <strong>de</strong>s<br />
Herzogs von Krakau erhalten, aber die Versammlung <strong>de</strong>r polnischen Herzöge und Bischöfe <strong>zu</strong> Łęczyca hob 1180 das Senioratsprinzip, als Herrschaft <strong>de</strong>s Ältesten und verbriefte<br />
Vorrechte <strong>de</strong>r Geistlichkeit formell auf. Die Einheit Polens wur<strong>de</strong> nicht erreicht; die Herzogtümer <strong>de</strong>r Piasten bestan<strong>de</strong>n weiterhin als <strong>de</strong> facto souveräne Regionen nebeneinan<strong>de</strong>r. Die<br />
Senioratsprovinz Kleinpolen mit Krakau fiel 1194 an Leszek I. In seiner Titulatur dux totius Poloniae erhob Leszek I. als letzter Herzog Ansprüche auf die Oberhoheit in ganz Polen, und<br />
versuchte diese ab 1217 auch in Pommerellen durch<strong>zu</strong>setzen. Die polnischen Fürsten trafen sich 1227 in Gąsawa, Kujawien, <strong>zu</strong> einem Wiec, um sich gegen Herzog Swantopolk von<br />
Pommerellen und ihren Vetter, <strong>de</strong>n Piasten Władysław Odon, Herzog von Großpolen und Enkel Mieszkos III., <strong>zu</strong> beraten. Die Versammlung flog auf, während Leszek auf <strong>de</strong>r Flucht vor<br />
pommerellischen und großpolnischen Häschern <strong>de</strong>n Tod fand. Sein Ableben bewirkte letztlich das völlige Verschwin<strong>de</strong>n einer Zentralgewalt in Polen. Es gab, bis auf die kirchlichen<br />
Strukturen <strong>de</strong>s Erzbistums Gnesen, we<strong>de</strong>r ein überregionales polnisches Lan<strong>de</strong>srecht noch überregionale Lan<strong>de</strong>sinstitutionen. Es setzte eine verstärkte Zersplitterung polnischer Län<strong>de</strong>r<br />
ein, die <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen und böhmischen Fürsten ab Mitte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts ihre Expansion in Polen erleichterte.<br />
In diese Zeit fiel eine verstärkte Kolonisation polnischer Gebiete durch Auswan<strong>de</strong>rer aus <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich. Bis 1250 waren große Teile Pommerns und Schlesiens mit<br />
Deutschen und Flamen besie<strong>de</strong>lt, die durch einheimische Herren, wie die Greifen in Pommern und die schlesischen Piasten ins Land geholt wur<strong>de</strong>n. Die pommerschen Adligen, ebenso<br />
die schlesischen Fürsten versprachen sich durch die neuen Siedler in erster Linie eine höhere wirtschaftliche Prosperität, ein besseres Steueraufkommen, vor allem aber einen schnelleren<br />
Anschluss an die (land)wirtschaftlich-städtischen Standards Westeuropas. Aufgrund <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Neusiedler und durch <strong>de</strong>n persönlichen Einsatz und För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Ostsiedlung durch<br />
die polnischen Lan<strong>de</strong>sfürsten, wur<strong>de</strong>n weite Teile <strong>de</strong>s mittelalterlichen Polens im Laufe <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte ein Teil <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Sprachraums und verloren dauerhaft ihren slawischpolnischen<br />
Charakter. Auch öffneten sich einige Regenten, wie <strong>zu</strong>m Beispiel die schlesischen Piasten, freiwillig <strong>de</strong>m Deutschtum durch Beset<strong>zu</strong>ng hoher Ämter im Staat und in<br />
kirchlichen Strukturen mit Deutschen, Heirat auch mit Prinzessinnen aus <strong>de</strong>utschen A<strong>de</strong>lshäusern, damit Verwandtschaft <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>utschen Hocha<strong>de</strong>l. Was die Ostkolonisation und das<br />
Deutschtum in Schlesien und über die Grenzen Schlesiens hinaus <strong>zu</strong>sätzlich begünstigte, waren die Greifen und die schlesischen Piasten in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
polnische Seniorherzöge und die mächtigsten Lan<strong>de</strong>sfürsten. Die Entslawisierung und die entsprechen<strong>de</strong> Germanisierung vollzog sich friedlich und war keine brutale <strong>de</strong>utsche<br />
Landnahme polnischer Gebiete – jedoch sind Konflikte infolge mangeln<strong>de</strong>r Berücksichtigung von Interessen <strong>de</strong>r lokalen Urbevölkerung durch <strong>de</strong>n „Prozess <strong>de</strong>r Ostsiedlung“ zwischen<br />
<strong>de</strong>n autochthonen Polen und <strong>de</strong>n mehrheitlich nicht <strong>de</strong>s Slawischen mächtigen Zuwan<strong>de</strong>rern nicht aus<strong>zu</strong>schließen. Erst En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts, beson<strong>de</strong>rs seit Beginn <strong>de</strong>s 14.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts, begann eine gegenläufige Bewegung, die kulturell-wirtschaftliche Dominanz und <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>s Deutschtums in <strong>de</strong>n Kernprovinzen Polens (Klein- und Großpolen)<br />
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>drängen und führte <strong>zu</strong>r Repolinisierung weiter Landstriche und <strong>zu</strong>r Polonisierung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Bürgertums in <strong>de</strong>n Städten, <strong>zu</strong>m Beispiel in Krakau.
Äußere Eingriffe und territoriale Verluste<br />
Mongolensturm von 1241<br />
Der in das Reich geflohene Władysław <strong>de</strong>r Vertriebene gewann die Gunst <strong>de</strong>s Kaisers, welcher für ihn in Polen 1157 militärisch intervenierte. Friedrich Barbarossa zwang <strong>de</strong>n polnischen<br />
Seniorherzog Bolesław IV. <strong>zu</strong>r Herausgabe Schlesiens an die Söhne <strong>de</strong>s geschassten Souveräns und machte ihn für einen Teil seines Reiches lehnspflichtig. Jedoch zögerte Bolesław<br />
einige Jahre, <strong>de</strong>r staufischen For<strong>de</strong>rung nach<strong>zu</strong>kommen und erst im Jahre 1163, unter <strong>de</strong>r Drohung einer neuen kaiserlichen Intervention, händigte er Schlesien an die Söhne Władysławs,<br />
Bolesław <strong>de</strong>n Langen und Mieszko Kreuzbein aus. Mit <strong>de</strong>r Aushändigung dieser Provinz an die Nachkommen Władysławs entstand die langlebige Linie <strong>de</strong>r Schlesischen Piasten.<br />
Die einsetzen<strong>de</strong> Einigung Polens durch die schlesische Linie <strong>de</strong>r Piasten nahm mit <strong>de</strong>m Tod Heinrichs <strong>de</strong>s Frommen ein jähes En<strong>de</strong>. Der Herzog verlor im Kampf gegen die mongolischen<br />
Hor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Liegnitz sein Leben, und das Herzogtum Schlesien zerfiel nach 1241 in eine Vielzahl feudalistischer Fürstentümer, die nach <strong>de</strong>m Mongolensturm in <strong>de</strong>n<br />
Einflussbereich Böhmens gelangten. Die Mongoleninvasion verlieh <strong>de</strong>r Deutschen Ostkolonisation in Polen und in an<strong>de</strong>ren von ihr betroffenen Regionen Mitteleuropas, wo ein<br />
beträchtlicher Teil <strong>de</strong>r Bevölkerung <strong>de</strong>n Tod fand o<strong>de</strong>r in die mongolische Knechtschaft getrieben wur<strong>de</strong>, <strong>zu</strong>sätzlich an Be<strong>de</strong>utung. Die Mongolen, die man auch Tataren nannte, zogen<br />
sich in die von ihnen eroberten ruthenischen Fürstentümer <strong>zu</strong>rück. Bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts blieben sie <strong>de</strong>nnoch eine ständige Bedrohung und unternahmen weitere Raubzüge<br />
Richtung Westen, die das politisch zersplitterte Polen wirtschaftlich und militärisch schwächten, sodass die Lan<strong>de</strong>sfürsten <strong>de</strong>r Nachbarvölker, wie <strong>de</strong>r Litauer, vor allem aber <strong>de</strong>r Böhmen<br />
und <strong>de</strong>r Deutschen begannen, ihre eigenen Territorien auf polnischen Territorium <strong>zu</strong> erweitern.<br />
Pommern unter <strong>de</strong>n Greifen<br />
Das Land, das sich mit Zentrum Stettin über die bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r ausbreitet, wur<strong>de</strong> Anfang <strong>de</strong>s 6. Jahrhun<strong>de</strong>rts von <strong>de</strong>n slawischen Pomoranen besie<strong>de</strong>lt. Seit <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
gerieten die Pomoranen in <strong>de</strong>n Einflussbereich ihrer christlichen Nachbarn. Aus <strong>de</strong>m Westen drohten ihnen die <strong>de</strong>utsch-ostfränkischen Feudalherren. Es waren die sächsischen<br />
Markgrafen aus <strong>de</strong>r Mark <strong>de</strong>r Billunger, später aus <strong>de</strong>r Nordmark, aus <strong>de</strong>r sich wie<strong>de</strong>rum die Mark Bran<strong>de</strong>nburg konstituierte, bei<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches. Aus <strong>de</strong>m<br />
Südosten kamen die Fürsten <strong>de</strong>r Polanen, die Piasten, die die Pomoranen politisch enger an ihre Exekutive bin<strong>de</strong>n konnten.<br />
Die Pomoranen leisteten vehement Wi<strong>de</strong>rstand gegen Unterwerfungs- und Christianisierungsbestrebungen ihrer Nachbarn. Nach mehreren erfolgreichen Volksaufstän<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen sie<br />
sich ihre Freiheit kurzzeitig erkämpft hatten, wur<strong>de</strong>n sie schließlich von Bolesław Schiefmund in drei Feldzügen (zwischen 1116 und 1121) endgültig unterworfen. Dieser ließ die<br />
Pomoranen durch <strong>de</strong>n Deutschen Otto von Bamberg christianisieren. Der polnische Souverän setzte <strong>de</strong>n Pommernfürsten Wartislaw I. als seinen Vasallen in Stettin ein. Wartislaw gilt als<br />
Stammvater <strong>de</strong>r Greifen-Dynastie, die sich bis 1637 in männlicher Linie in Pommern behaupten konnte. Durch die Erfolge <strong>de</strong>s polnischen Fürsten in Mecklenburg und Vorpommern<br />
beunruhigt und um seinen Einfluss bei <strong>de</strong>n Elbslawen fürchtend, zwang Kaiser Lothar III. Bolesław, seine kaiserliche Lehnsherrschaft 1135 über Pommern an<strong>zu</strong>erkennen und gab ihm<br />
dieses mit <strong>de</strong>r Insel Rügen <strong>zu</strong> Lehen.<br />
Während <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>nkreuzzüge unterwarf Heinrich <strong>de</strong>r Löwe, Herzog <strong>de</strong>r Stammesherzogtümer Sachsen und Bayern, die Fürsten von Stettin und zwang sie ab 1164 in ein<br />
Abhängigkeitsverhältnis. Er musste sich schließlich 1181 nach einem verlorenen Reichskrieg Kaiser Friedrich Barbarossa, seinem Vetter, unterwerfen. Damit verlor er seine Macht im<br />
Reich und alle seine slawischen Lehnsherrschaften an ihn. Der pommersche Herzog Bogislaw I. war jahrelang vom Dänen Wal<strong>de</strong>mar I. bedrängt wor<strong>de</strong>n. Vom polnischen Seniorherzog<br />
konnte er keine Hilfe erwarten, da dieser mit seinen Brü<strong>de</strong>rn selbst im Krieg lag (Treffen mit Seniorherzog Mieszko von Polen 1177 in Gnesen). Bogislaw I. stellte sich 1181 unter <strong>de</strong>n<br />
Schutz <strong>de</strong>s Kaisers, <strong>de</strong>r die Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg mit Pommern einschließlich Pommerellens belehnte. Pommern wur<strong>de</strong> so kaiserliches Lehen, die pommerschen Herzöge wur<strong>de</strong>n<br />
in <strong>de</strong>n Rang <strong>de</strong>utscher Reichsfürsten erhoben.<br />
Um das pommersche Herzogtum nicht ganz <strong>de</strong>n sächsischen und polnischen Feudalherren <strong>zu</strong> überlassen, versuchten in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts auch die Dänen, unter<br />
ihrem König Knuth VI., Pommern unter ihre Lehnsherrschaft <strong>zu</strong> bringen, was ihnen erst 1185 erfolgreich gelang. Pommern war von 1185 bis <strong>zu</strong>r Schlacht bei Bornhöved 1227 unter<br />
dänischer Vorherrschaft.[3]<br />
Pommerellen unter <strong>de</strong>n Sambori<strong>de</strong>n
Das sich im Osten an Hinterpommern anschließen<strong>de</strong> Gebiet an <strong>de</strong>r Weichsel, <strong>de</strong>utsch Pommerellen genannt, stand seit 1138 nominell unter <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>s polnischen Senior-Herzogs<br />
und bis 1227 auch unter dänischem Einfluss. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts entstand die slawische Sambori<strong>de</strong>n-Dynastie, die bis 1294 über Pommerellen herrschte. Durch <strong>de</strong>n Tod von<br />
Herzog Leszek I., Seniorherzog von Polen, wur<strong>de</strong>n die pommerellischen Herzöge 1227 <strong>de</strong> facto von Krakau, <strong>de</strong>m Hauptsitz <strong>de</strong>r Senioratsprovinz, unabhängig. Der letzte souveräne<br />
Herrscher Pommerellens, Herzog Mestwin II., hatte sich <strong>zu</strong>nächst mit <strong>de</strong>m von ihm beherrschten Gesamtterritorium unter die Lehenshoheit <strong>de</strong>r Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg begeben<br />
und dieses Gebiet gleichzeitig von ihnen als Lehen <strong>zu</strong>rückerhalten. Später bereute er diesen Schritt, und 1282 schloss er mit <strong>de</strong>m Herzog von Großpolen, <strong>de</strong>n späteren König von Polen,<br />
Przemysław II., einen Vertrag in Kempen, auf <strong>de</strong>ssen Grundlage dieser nach seinem Tod sein Erbe in Pommerellen antreten sollte. Für das hinterpommersche Gebiet zwischen <strong>de</strong>m<br />
Gollenberg (bei Köslin) und <strong>de</strong>m Fluss Leba hatte Mestwin II. <strong>zu</strong>vor die Lehenshoheit <strong>de</strong>r Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg ein zweites Mal vertraglich anerkannt, die dieses Gebiet 1277<br />
Wizlaw II. von Rügen abgekauft hatten. Nach <strong>de</strong>m Tod Mestwins II. versuchte Przemysław, auch das hinterpommersche Gebiet westlich <strong>de</strong>s Leba-Flusses in Besitz <strong>zu</strong> nehmen, und es<br />
kam <strong>zu</strong> kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen. In einem Vertrag <strong>de</strong>s 8. August 1305 wur<strong>de</strong> dieser östliche Teil Hinterpommerns vom König Wenzel III. als Besitz <strong>de</strong>r Markgrafen von<br />
Bran<strong>de</strong>nburg anerkannt.[4] Schließlich wur<strong>de</strong> Pommerellen 1308 vom Deutschen Or<strong>de</strong>n erobert, und Polen konnte dort erst wie<strong>de</strong>r 1454/66 Fuß fassen. Die Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg<br />
machten gegenüber <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n geltend, dass ihnen <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche Kaiser Friedrich II. auf einem im Dezember 1231 in Ravenna abgehaltenen Reichstag Pommerellen<br />
<strong>zu</strong> Lehen gegeben hatte und legten auch eine entsprechen<strong>de</strong> Urkun<strong>de</strong> vor.[5] Im Vertrag von Soldin kaufte <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n 1309 <strong>de</strong>n bran<strong>de</strong>nburgischen Askaniern ihre aus dieser Urkun<strong>de</strong> und<br />
<strong>de</strong>m Vertrag von Arnswal<strong>de</strong> herrühren<strong>de</strong>n Ansprüche an Pommerellen ab. Obwohl <strong>de</strong>r Vertrag von Soldin 1311 von Heinrich VII. bestätigt wur<strong>de</strong>, bestritt Władysław Ellenlang diese<br />
Ansprüche <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns auf Pommerellen. Es kam <strong>zu</strong> juristischen und militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen. Erst nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Hochmeister Dietrich von Altenburg 1339 einer päpstlichen<br />
Untersuchungskommission die im Jahr 1231 von Friedrich II. ausgestellte Belehnungsurkun<strong>de</strong> vorgelegt hatte,[6] verzichtete <strong>de</strong>r polnische Monarch Kasimir III., 1343 im vom Papst<br />
Clemens VI. vermittelten Frie<strong>de</strong>n von Kalisch offiziell auf Pommerellen einschließlich Danzigs. Trotz<strong>de</strong>m blieb Pommerellen für fast zwei weitere Jahrhun<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>r Zankapfel im<br />
<strong>de</strong>utsch-polnischen Verhältnis, was kriegerische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>n Deutschor<strong>de</strong>nsrittern nach sich zog.<br />
Lebus und Entstehung <strong>de</strong>r Neumark<br />
Die Expansion <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg nach Osten auf polnisch-piastische Gebiete führte 1250 <strong>zu</strong>m Verlust von Lebus und <strong>zu</strong>r Entstehung <strong>de</strong>r Neumark als Gegenstück <strong>zu</strong>r Altmark.<br />
Polen wur<strong>de</strong> um 1250 für Jahrhun<strong>de</strong>rte von <strong>de</strong>r heutigen O<strong>de</strong>rgrenze abgedrängt, trotz Rückeroberungsversuchen unter König Władysław I. Ellenlang Anfang <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Herzog Konrad von Masowien und <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n<br />
Der polnische Herzog Konrad von Masowien begann seinen Machtbereich auf eigene Hand <strong>zu</strong> erweitern. Das pruzzische Gebiet um Kulm war sein Kriegsziel. Die Expansion auf Kosten<br />
seiner heidnischen Nachbarn wur<strong>de</strong> jedoch <strong>zu</strong> einem Fiasko. Er verlor seine Eroberungen wie<strong>de</strong>r und wur<strong>de</strong> nun seinerseits vom erwachten Nachbarn bedroht. Da er <strong>zu</strong><strong>de</strong>m in Konflikte<br />
mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Piastenherrschaften verwickelt war, richtete er <strong>de</strong>n Blick auf <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r 1225 aus Ungarn vertrieben wur<strong>de</strong>, weil dieser in Siebenbürgen im Kampf gegen<br />
heidnische Steppenvölker, die Kumanen, einen eigenen Staat grün<strong>de</strong>n wollte. Im Jahre 1226 bat Konrad von Masowien <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n um Hilfe und versprach ihm das Kulmer<br />
Land als herzögliches Lehen, als Gegenleistung und Ausgangsbasis für ihren Kampf gegen die Hei<strong>de</strong>n. Ob und inwieweit die <strong>zu</strong> erobern<strong>de</strong>n Gebiete gemäß <strong>de</strong>r Vereinbarung <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>n, ist bis heute unklar und hat in <strong>de</strong>r Vergangenheit <strong>zu</strong> Streitigkeiten zwischen <strong>de</strong>utschen und polnischen Historikern geführt. Um sich gegen eine ähnliche Entwicklung wie in<br />
Ungarn ab<strong>zu</strong>sichern, ließ sich <strong>de</strong>r Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns, Hermann von Salza, von Kaiser Friedrich II. im März 1226 <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>s Kulmer Lan<strong>de</strong>s und aller <strong>zu</strong> erobern<strong>de</strong>n<br />
Gebiete mit <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Bulle von Rimini bestätigen. Zusätzlich schloss <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Herzog am 16. Juni 1230 <strong>de</strong>n Vertrag von Kruschwitz, <strong>de</strong>r ihm das Land <strong>zu</strong>r freien<br />
Verfügung stellte. Zwischen <strong>de</strong>m Deutschen Ritteror<strong>de</strong>n im Pruzzenland und Polen, später auch Litauen, entwickelte sich eine jahrhun<strong>de</strong>rtelange Feindschaft.<br />
1295–1386: Wie<strong>de</strong>rvereinigung, letzte Piasten und das Haus Anjou<br />
Vereinigungsversuch unter König Przemysław und die böhmischen Přemysli<strong>de</strong>n<br />
Erneuerte Wie<strong>de</strong>rvereinigungsversuche wur<strong>de</strong>n aus Posen und Gnesen unternommen. Herzog Przemysław II. von Großpolen übernahm En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>de</strong>n Führungsanspruch<br />
bei <strong>de</strong>r Vereinigung piastisch-polnischer Herzogtümer. Er gelangte zwar nie in <strong>de</strong>n dauerhaften Besitz <strong>de</strong>s Herzogtums Kleinpolen-Krakau, regierte dort nur etwa ein Jahr und musste es<br />
auf Druck <strong>de</strong>s böhmischen Königs 1291 Richtung Posen verlassen. Im Besitz <strong>de</strong>r Krakauer Königsinsignien und als Regent <strong>de</strong>r Herzogtümer Großpolen und Pommerellen (ab 1294),<br />
wur<strong>de</strong> er 1295 vom polnischen Erzbischof Jakub Świnka in Gnesen <strong>zu</strong>m vierten polnischen König seit Bolesław <strong>de</strong>m Kühnen gekrönt. Mit diesem symbolischen Akt been<strong>de</strong>te er <strong>de</strong>n
polnischen Partikularismus und fokussierte mit seiner Krönung die Kräfte <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls und <strong>de</strong>r Kirche <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rerlangung <strong>de</strong>r staatlichen Einheit im Kampf <strong>de</strong>s bedrängten<br />
Polen gegen die <strong>de</strong>utschen und böhmischen Lan<strong>de</strong>sfürsten.<br />
Während einer Reise nach Posen Anfang Februar 1296 wur<strong>de</strong> er jedoch in Rogózno bei Posen von einer Gruppe adliger Oppositioneller gefangengenommen und bald darauf erschlagen.<br />
Polnische Chronisten vermuteten hinter <strong>de</strong>m Attentat die Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg (Otto V. <strong>de</strong>r Lange und Johann IV.).[7] Nach einer an<strong>de</strong>ren Version erfolgte seine Ermordung im<br />
Auftrag un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>ner polnischer Adliger aus <strong>de</strong>n in Großpolen einflussreichen A<strong>de</strong>lssippen <strong>de</strong>rer von Nałęcz und Zaremba.[8] Mit ihm starb die großpolnische Linie <strong>de</strong>r Piasten, die<br />
durch Mieszko <strong>de</strong>n Alten begrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n war, im Mannesstamm aus. Im Rahmen <strong>de</strong>s Bündnisvertrages von 1293, gegen Wenzel II., vermachte Przemysław Großpolen und<br />
Pommerellen seinem Vetter, Władysław Ellenlang, Herzog von Kujawien, <strong>de</strong>r diese bei<strong>de</strong>n Provinzen bis 1300 gegen Böhmen behaupten konnte. Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Königs eigneten sich<br />
die Bran<strong>de</strong>nburger im Verbund mit <strong>de</strong>n Herzögen von Glogau, Heinrich III., einige Warthe- und Netzedistrikte Großpolens an.<br />
Nach Przemysławs gewaltsamem Tod, gelangte <strong>de</strong>r böhmische König Wenzel II. mit Hilfe <strong>de</strong>r polnischen Kirche (Jakub Swinka) und <strong>de</strong>s in Polen ansässigen <strong>de</strong>utschen Bürgertums in<br />
<strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Er war bereits ab 1291 Herr von Kleinpolen einschließlich Krakau, neun Jahre später, 1300, folgte die Erhebung in <strong>de</strong>n Stand eines polnischen Königs. Um seiner<br />
Herrschaft in Polen legalen Eindruck <strong>zu</strong> verleihen, heiratete Wenzel 1303 Przemysławs Tochter Elisabeth Richza. Nach seiner Krönung drängte <strong>de</strong>r Böhme seinen politischen<br />
Gegenspieler Władysław ganz aus Polen, <strong>de</strong>r gezwungen war Schutz und Hilfe im ungarischen Exil <strong>zu</strong> suchen.<br />
Der böhmische Besitz Polens, wie auch <strong>de</strong>r polnischen Krone, wur<strong>de</strong> jedoch durch Papst Bonifatius VIII. für illegal erklärt. Durch <strong>de</strong>n Tod Wenzels III., eines polnischen Titularkönigs,<br />
im Jahr 1306 – er wur<strong>de</strong> ermor<strong>de</strong>t –, erlosch das alte tschechische Geschlecht <strong>de</strong>r Přemysli<strong>de</strong>n im erbberechtigten Mannesstamm und die erste <strong>de</strong>utsche Dynastie, nämlich die <strong>de</strong>r<br />
Luxemburger, kam in Böhmen an die Macht. Erst nach <strong>de</strong>r Ermordung <strong>de</strong>s böhmischen Herrschers war die Herrschaft <strong>de</strong>r Piasten vorerst gesichert und Władysław Ellenlang wur<strong>de</strong> als<br />
Herrscher allgemein anerkannt. Unter seiner Ägi<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> Polen in einer etwas verkleinerten Form wie<strong>de</strong>rvereinigt.<br />
Kampf um die Einheit<br />
Władysław I. Ellenlang kehrte mit ungarischer Hilfe aus <strong>de</strong>m Exil <strong>zu</strong>rück und übernahm in <strong>de</strong>n Jahren 1305–1306 die Herrschaft über weite Teile Polens (Kleinpolen, Mittelpolen mit <strong>de</strong>n<br />
Hauptburgen Sieradz und Łęczyca, Kujawien und Dobrin). In Pommerellen und Danzig konnte er sich nicht gegen die Bran<strong>de</strong>nburger durchsetzen und rief <strong>de</strong>n Deutschen Ritteror<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><br />
Hilfe. Weil <strong>de</strong>r König die vereinbarten Kriegsschul<strong>de</strong>n nicht bezahlte, behielten die Deutschritter Danzig, ein damals durchaus übliches Vorgehen (siehe Übernahme von Danzig durch<br />
<strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n, sowie Reinhold Curickes Der Stadt Danzig historische Beschreibung, Amsterdam und Danzig 1687). Der Or<strong>de</strong>n erwarb auch Pommerellen, und verlegte angesichts<br />
<strong>de</strong>r gescheiterten Kreuzzüge und <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>s Templeror<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>n Hochmeistersitz von Venedig in die Marienburg in das Weichsel<strong>de</strong>lta. Damit begann ein Konflikt mit <strong>de</strong>m<br />
christlichen Staat Polen, <strong>de</strong>r zwischen Pommern und Preußen einen Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee entlang <strong>de</strong>r Weichsel anstrebte, <strong>de</strong>n er nach <strong>de</strong>r Rebellion <strong>de</strong>r preußischen Städte mit <strong>de</strong>m Zweiten<br />
Thorner Frie<strong>de</strong>n von 1466 erlangte. Damit entstand ein erster Polnischer Korridor.<br />
Im Krakauer Aufstand <strong>de</strong>s Vogtes Albert strebte die Stadt unter Führung <strong>de</strong>utscher Bürger, im Bündnis mit an<strong>de</strong>ren Städten und Teilen <strong>de</strong>r Kirche, mehr Rechte an. Władysław schlug<br />
diesen Aufstand nie<strong>de</strong>r, die folgen<strong>de</strong>n Repressionen haben die politischen Aspirationen <strong>de</strong>r Städte, insbeson<strong>de</strong>re von Krakau, dauerhaft gebrochen.[9] Während einer Rebellion <strong>de</strong>s<br />
großpolnischen A<strong>de</strong>ls 1314, gegen die Herrschaft <strong>de</strong>r Herzöge von Glogau, wur<strong>de</strong> das Herzogtum Großpolen an das Reich Władysławs angeschlossen. Sechs Jahre später, im Jahr 1320,<br />
erfolgte seine Krönung <strong>zu</strong>m König von Polen. Fünf Jahre danach, versuchte Władysław die unklare Situation in <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg, die nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r bran<strong>de</strong>nburgischen<br />
Linie <strong>de</strong>r Askanier 1320 entstand, im Bündnis mit Litauen, <strong>de</strong>ssen Staatspitze noch „heidnisch“ war, aus<strong>zu</strong>nutzen und in <strong>de</strong>n Jahren 1325 bis 1329 <strong>de</strong>n Herrschaftsbereich <strong>de</strong>r märkischen<br />
Grafen auf das Gebiet westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> begrenzen, was wenige Jahre später seine außenpolitische Situation, <strong>zu</strong>m Beispiel beim Papst, infolge <strong>de</strong>r Allianz schädigte und <strong>de</strong>m<br />
Deutschen Or<strong>de</strong>n nur <strong>de</strong>n Vorwand gab gegen ihn vor<strong>zu</strong>gehen. Unterstützt wur<strong>de</strong> er dabei offen vom Lebuser Bischof Stephan, <strong>de</strong>r sich auf die Seite <strong>de</strong>s polnischen Königs schlug, <strong>zu</strong>m<br />
Verdruss seines neuen Lan<strong>de</strong>sherrn, <strong>de</strong>s Markgrafen Ludwig aus <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Wittelsbacher. Die kriegerische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng brachte jedoch kaum Landgewinne für Polen und<br />
hinterließ in <strong>de</strong>r Neumark ein Gebiet <strong>de</strong>r verbrannten Er<strong>de</strong>. Es wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>n Bran<strong>de</strong>nburgern Frie<strong>de</strong>n 1329 geschlossen, da sich die Luxemburger mit <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>nsrittern gegen ihn<br />
verbün<strong>de</strong>t hatten. Bereits im Winter 1327 zog König Johann von Luxemburg gegen Krakau, musste aber auf ungarischen Druck <strong>zu</strong>rückweichen, <strong>de</strong>nnoch huldigten ihm viele Herzöge von<br />
Schlesien. Nach <strong>de</strong>m Jahr 1331 erkannten (fast) alle Piasten-Fürsten Schlesiens die böhmische Lehnshoheit an, nur einige wenige wi<strong>de</strong>rsetzten sich erfolgreich.<br />
Eine gegen Polen gerichtete Expansionspolitik <strong>de</strong>s Deutschen Ritteror<strong>de</strong>ns im Bündnis mit König Johann, führte <strong>zu</strong>m Verlust <strong>de</strong>s Dobriner Ländchens 1329 und von Kujawien 1332, die<br />
Region Großpolen mit <strong>de</strong>m Erzbistum Gnesen wur<strong>de</strong> verwüstet. Nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Płowce, 1331, gegen die vereinigten Heere <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsritter und <strong>de</strong>r Böhmen, konnte <strong>de</strong>r polnische
Souverän die gewaltsame Annexion bei<strong>de</strong>r Gebiete nicht verhin<strong>de</strong>rn. In Anbetracht <strong>de</strong>r Lage leistete <strong>de</strong>r Herzog von Masowien in Płock, Wacław (ein Verwandter <strong>de</strong>s polnischen Königs),<br />
<strong>de</strong>m böhmischen König <strong>de</strong>n Lehnseid. Während eines Waffenstillstands, <strong>de</strong>r im Sommer 1332 auf Vermittlung <strong>de</strong>s päpstlichen Legaten Peter von Alvernia für ein Jahr <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong> kam, starb<br />
<strong>de</strong>r König. Die Macht ging an seinen Sohn Kasimir über, <strong>de</strong>r sich sofort nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Vaters <strong>zu</strong>m polnischen König krönen ließ und ein schwieriges Erbe übernahm.<br />
Władysław ging in die polnische Geschichtsschreibung als Reichseiniger Polens ein. Der Umklammerung durch die <strong>de</strong>utschen Territorialstaaten (Deutscher Or<strong>de</strong>n, Mark Bran<strong>de</strong>nburg),<br />
stellte er Bündnisse mit <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen und <strong>de</strong>m Königreich Ungarn entgegen. Er fand im Kampf gegen die <strong>de</strong>utschen Feudalherren und das selbstbewußte <strong>de</strong>utsche<br />
Patriziat in polnischen Städten ebenso starke Unterstüt<strong>zu</strong>ng in <strong>de</strong>r polnischen Kirche und beim Papst. Auch kann man das mehrheitlich slawische Königreich Böhmen <strong>zu</strong> dieser<br />
Umklammerung und Gefahr für das erneuerte polnische Königtum zählen, wur<strong>de</strong> es nach <strong>de</strong>m Ableben <strong>de</strong>r Přemysli<strong>de</strong>n seit 1310 das erste Mal von einer <strong>de</strong>utschen Dynastie regiert, <strong>de</strong>m<br />
Haus Luxemburg. Als Erben <strong>de</strong>r vorherigen Dynastie, leiteten sie Ansprüche auf die Krone Polens und die schlesischen Fürstentümer ab und selbst die in ihrem Mannesstamm slawischen<br />
Přemysli<strong>de</strong>n in persona, waren in ihrem Endstadium mit Wenzel II. und Wenzel III. <strong>de</strong>m Deutschtum viel näher, als <strong>de</strong>m Tschechentum ihres Urvaters Přemysl. Die Amtssprache<br />
Böhmens wur<strong>de</strong> Deutsch und beson<strong>de</strong>rs unter <strong>de</strong>n Luxemburgern verstärkte sich die kulturelle Dominanz <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kirche und <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls, die <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts in einer<br />
ersten anti<strong>de</strong>utschen Reaktion <strong>de</strong>r slawischen Tschechen gegen die weltlich-geistliche Obrigkeit <strong>de</strong>r Deutschen gipfelte, <strong>de</strong>n Hussitenkriegen (siehe auch Jan Hus, Jan Žižka und<br />
Su<strong>de</strong>ten<strong>de</strong>utsche). Trotz dieser und an<strong>de</strong>rer widriger Umstän<strong>de</strong>, konnte er sein Werk mit einer Krönung <strong>zu</strong>m polnischen König festigen. Władysław verfehlte jedoch sein Ziel, die alten<br />
piastischen Grenzen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen. Er vermachte seinem Sohn nur zwei alte Herrschaftsbereiche <strong>de</strong>r Piasten, Großpolen mit <strong>de</strong>m Zentrum Posen und Kleinpolen mit Krakau.<br />
König Kasimir <strong>de</strong>r Große<br />
Vom politischen Erbe seines Vaters übernahm Kasimir II. das Bündnis mit <strong>de</strong>m Königreich Ungarn, verstärkt durch die Heirat seiner Schwester Elisabeth mit Karl von Anjou und die<br />
Konflikte mit <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n um das Herzogtum Pommerellen und mit <strong>de</strong>n Luxemburgern Johann und Karl IV. um die Oberherrschaft in Schlesien, sowie mit Johann, <strong>de</strong>r als<br />
König von Böhmen auch auf die polnische Königskrone Anspruch erhob. Die Län<strong>de</strong>r die Kasimir erbte, waren relativ klein im Vergleich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Grenzen <strong>de</strong>s Staates von 1138. Die<br />
westliche Grenze <strong>de</strong>s Reiches war weit nach Osten, fast in die Kerngebiete <strong>de</strong>r alten Polanen, <strong>zu</strong>rückgedrängt wor<strong>de</strong>n. Das Herzogtum Pommern verselbständigte sich unter <strong>de</strong>r Greifen-<br />
Dynastie im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt und geriet nach 1227 unmittelbar in ein Abhängigkeitsverhältnis <strong>zu</strong>r askanischen Mark Bran<strong>de</strong>nburg. Westliche Gebiete <strong>de</strong>s Herzogtums Großpolen, im<br />
O<strong>de</strong>r-Warthe-Land, wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts durch die Markgrafen aus Bran<strong>de</strong>nburg teilweise erobert, teilweise käuflich erworben.[10] Ebenso verhielt es sich<br />
im Nor<strong>de</strong>n, wo sich zwischen 1309 und 1332 die Ritter <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns Pommerellen, Kujawien und das Dobriner Ländchen aneigneten. Bereits 1327–1331, unter <strong>de</strong>r<br />
Regierungszeit seines Vaters, unterwarfen sich die meisten Schlesischen Piasten <strong>de</strong>m Haus Luxemburg aus Böhmen. Das aus Großpolen, Kleinpolen und einigen mittelpolnischen<br />
Län<strong>de</strong>rn bestehen<strong>de</strong> Königreich, erhielt <strong>de</strong>n Namen Corona Regni Poloniae, als transpersonalen Staatsbegriff, <strong>de</strong>r die Zusammengehörigkeit <strong>de</strong>r polnischen Län<strong>de</strong>r[11] und <strong>de</strong>r<br />
lehnsabhängigen Fürsten dokumentierte. Aufgrund seiner militärisch-politischen Unterlegenheit gegenüber <strong>de</strong>n böhmischen und <strong>de</strong>utschen Lan<strong>de</strong>sfürsten, befand sich Polen weiterhin in<br />
einer äußerst kritischen Lage. An<strong>de</strong>rs als sein Vater, <strong>de</strong>r durch militärische Entscheidungen Lösungen erzwingen wollte, strebte Kasimir eher nach friedlichen und diplomatischen<br />
Auswegen.<br />
König Kasimir bemühte sich um eine Beilegung <strong>de</strong>s Konflikts mit Johann. Im Vertrag von Trentschin und <strong>de</strong>m Ausgleich von Visegrád 1335,[12] sowie nach einem böhmisch-polnischen<br />
Grenzkrieg 1345 und <strong>de</strong>m Tod seines Verbün<strong>de</strong>ten im Reich gegen Böhmen, Kaiser Ludwig IV., 1347, hatte <strong>de</strong>r polnische Souverän im Vertrag von Namslau endgültig die böhmische<br />
Lehnsherrschaft über Schlesien anerkannt. Mit ihm gab Kasimir seine dynastischen Ansprüche auf Schlesien auf und erkannte die böhmische Oberhoheit über diese Provinz an. Die<br />
schlesisch-piastischen Vettern <strong>de</strong>s Königs wie<strong>de</strong>r unter die Botmäßigkeit <strong>de</strong>s polnischen Souveräns <strong>zu</strong> bringen,[13] scheiterte damit. Dies war eine große außenpolitische Nie<strong>de</strong>rlage für<br />
Kasimir. Das erneuerte Königreich warnicht in <strong>de</strong>r Lage, die alten piastischen Gebiete <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen, was ein Hauptziel <strong>de</strong>r Außenpolitik <strong>de</strong>r letzten Piasten war. Schließlich<br />
inkorporierte <strong>de</strong>r böhmische König Karl IV., seit 1346 auch römisch-<strong>de</strong>utscher (Gegen-)König, Schlesien 1348 in die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r böhmischen Krone. Die einzige Verbindung, die<br />
zwischen <strong>de</strong>r schlesischen Provinz und Polen über die Jahrhun<strong>de</strong>rte bestand, war ihre bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt dauern<strong>de</strong> kirchliche Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m Erzbistum Gnesen.<br />
Da die westlichen Gebiete <strong>de</strong>s früh- und hochmittelalterlichen Polens <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein Teil <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches wur<strong>de</strong>n, auch ethnisch im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>utschen Ostkolonisation, orientierten sich die polnischen Herrscher, mangels Alternativen und <strong>de</strong>s starken Wi<strong>de</strong>rstands <strong>de</strong>utscher Feudalherren im Westen, ostwärts. Durch die<br />
Abdrängung Polens in <strong>de</strong>n osteuropäischen Teil <strong>de</strong>s Kontinents, unterwarf er in <strong>de</strong>n Jahren 1340 bis 1366, das von <strong>de</strong>n Ruthenen bewohnte Fürstentum Halytsch-Wolodymyr, auch<br />
Rotrussland genannt, mit Podolien seiner Herrschaft.[14] Unter Verzicht auf Pommerellen und <strong>de</strong>s Kulmer Lan<strong>de</strong>s, schloss Kasimir 1343 in Kalisch Frie<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n.<br />
Hierfür bekam er Kujawien und das Dobriner Ländchen <strong>zu</strong>rück. Auch suchte König Kasimir im selben Jahr seinen Einfluss in Pommern durch ein Bündnis mit <strong>de</strong>n Greifen <strong>de</strong>r Stettiner–
und <strong>de</strong>r Wolgaster–Linie <strong>zu</strong> festigen, was <strong>zu</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng einiger Netze- und Neumarkdistrikte führte. Im Jahr 1347 wur<strong>de</strong> das polnische Recht kodifiziert. Ein Jahr später, 1348, breitete<br />
sich rasant die Pest in Europa aus und wütete auf <strong>de</strong>m Kontinent einige Jahre. Kasimir begegnete dieser Katastrophe durch die Verhängung einer Quarantäne über sein Reich, sodass die<br />
Seuche weitgehend abgewehrt wer<strong>de</strong>n konnte. Im Nor<strong>de</strong>n seines Reiches wur<strong>de</strong> das Herzogtum Masowien 1351 unterworfen. Die piastisch-masowschen Herzogtümer, mit <strong>de</strong>n<br />
Hauptburgen Płock und Warschau, wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r jeweiligen Herrscher, teils direkt, teils als königliches Lehen <strong>de</strong>m Königreich einverleibt. Auf Kasimirs Veranlassung,<br />
wur<strong>de</strong> 1364 eine Aka<strong>de</strong>mie in Krakau gegrün<strong>de</strong>t, die zweite in Mitteleuropa nach Prag, später Jagiellonen-Universität genannt. König Kasimir verstarb 1370 und hinterließ keinen<br />
erbberechtigten männlichen Erben.<br />
Kasimir för<strong>de</strong>rte die Städte durch zahlreiche Baumaßnahmen, darunter die Sicherung <strong>de</strong>r Grenzen seines Reiches mit 50 befestigten Burgen, sowie die Aufnahme von Deutschen und<br />
Gewährung <strong>de</strong>utschen Stadtrechts. Er lud nach <strong>de</strong>m Pogromen in Westeuropa im Zuge <strong>de</strong>r Pest die Ju<strong>de</strong>n nach Polen ein (Erlass von Ju<strong>de</strong>nprivilegien 1334). Er reformierte das<br />
Militärwesen, bekämpfte das Raubrittertum, ließ das polnische Rechts- und Münzwesen vereinheitlichen, sicherte neue Han<strong>de</strong>lswege und begünstigte die Eröffnung von Salinen. Die<br />
wirtschaftlichen Reformen erfor<strong>de</strong>rten die verfassungsrechtliche Kodifikation <strong>de</strong>s Landrechtes, die Statuten Kasimirs <strong>de</strong>s Großen und die Einführung <strong>de</strong>r Generalstarosteien mit<br />
administrativen und gerichtlichen Befugnissen, Staatsrat und Kanzleiführung. Er schuf eigene Appellationsgerichtshöfe für das Mag<strong>de</strong>burger Stadtrecht und verbot die Appellation nach<br />
Mag<strong>de</strong>burg. Kasimir war <strong>de</strong>r Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r ersten polnischen Universität und <strong>de</strong>r einzige polnische König mit <strong>de</strong>m Beinamen „<strong>de</strong>r Große“. Mit ihm starben die Piasten in königlicher<br />
Linie aus.[15] Als seinen Nachfolger bestimmte er seinen Neffen, <strong>de</strong>n ungarische König Ludwig von Anjou, <strong>de</strong>r Polen mit Ungarn bis 1382 in einer Personalunion verband.<br />
König Ludwig von Anjous Nachfolgeproblem<br />
Nach Kasimirs Tod wur<strong>de</strong> Polen 1370 mit <strong>de</strong>m ungarischen Königshaus verbun<strong>de</strong>n. Der ungarische König, Ludwig von Anjou, entstammte in männlicher Linie <strong>de</strong>m Haus Capet-Anjou.<br />
Aufgrund seiner personellen Abwesenheit war er in Polen unbeliebt. Er überließ die Geschäfte Polens seiner polnischen Mutter Elisabeth als Regentin. Auch begann er das polnisch<br />
gewor<strong>de</strong>ne Galizien für Ungarn <strong>zu</strong> beanspruchen, was bei <strong>de</strong>r polnischen Aristokratie auf Wi<strong>de</strong>rstand stieß. Da er, wie Kasimir, keine „legalen“ Söhne hatte, wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m polnischen A<strong>de</strong>l<br />
1374 im Kaschauer Privileg politische Vorrechte gewährt, <strong>de</strong>r dafür die weibliche Thronfolge bestätigte und durchsetzte. Das Kaschauer Privileg wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r späteren<br />
„A<strong>de</strong>ls<strong>de</strong>mokratie“ in Polen.<br />
Ludwig starb 1382 und die Regierungsgeschäfte in Polen gingen an seine Tochter, Hedwig von Anjou, über. Sie wur<strong>de</strong> 1384 Kraft polnischen Rechts <strong>zu</strong>m regieren<strong>de</strong>n polnischen „König“<br />
gekrönt. Sie musste jedoch ihre Verlobung mit <strong>de</strong>m Prinzen Wilhelm von Habsburg lösen, da <strong>de</strong>r mehrheitlich anti<strong>de</strong>utsch eingestellte polnische A<strong>de</strong>l keine <strong>de</strong>utschen Aristokraten <strong>zu</strong><br />
seinen Königen haben wollte, auch aufgrund <strong>de</strong>s vergifteten Verhältnisses <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Deutschor<strong>de</strong>nsrittern und aus Staatsräson musste sie im Rahmen <strong>de</strong>r Union von Krewo <strong>de</strong>n viel älteren<br />
Großfürsten von Litauen, Jogaila, heiraten. Bei<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n 1386, Hedwig ein zweites Mal, <strong>zu</strong> Regenten Polens gekrönt.<br />
Jogaila ließ sich nach römisch-katholischem Ritus taufen und als Władysław II. Jagiełło wur<strong>de</strong> er <strong>de</strong>r Begrün<strong>de</strong>r einer <strong>de</strong>r mächtigsten Dynastien Europas.<br />
1386–1569: Polnisch-Litauische Personalunion<br />
König Władysław II. Jagiełło und Kampf gegen <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n<br />
Durch die Heirat <strong>de</strong>r polnischen Herrscherin Hedwig von Anjou mit <strong>de</strong>m Großfürsten von Litauen wur<strong>de</strong> die Personalunion <strong>de</strong>s Königreichs Polen mit <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen<br />
begrün<strong>de</strong>t. Polen und Litauen waren <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Zusammenschlusses unter <strong>de</strong>n Jagiellonen <strong>de</strong>r größte Flächenstaat in Europa. Der Einflussbereich <strong>de</strong>r neuen Monarchie wur<strong>de</strong> von<br />
Władysław II. Jagiełło, wie Großfürst Jogaila seit seiner Krönung hieß, sukzessiv nach Nor<strong>de</strong>n, Osten und Sü<strong>de</strong>n ausgeweitet: 1387 erkannten das Fürstentum Moldau, 1389 das<br />
Fürstentum Walachei und die Republik Nowgorod die jagiellonische Oberhoheit an.<br />
Diese Großmacht besiegte 1410 <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Tannenberg, wodurch <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Nimbus <strong>de</strong>r Unbesiegbarkeit verlor. Das neue polnisch-litauische<br />
Königtum vermochte sich schnell <strong>zu</strong> entwickeln. Die kampflose Übergabe <strong>de</strong>r Burgen und die Haltung <strong>de</strong>r Bevölkerung schien das Aufgehen <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns in Polen und Litauen<br />
an<strong>zu</strong>kündigen. Ritterschaft, Bischöfe und Städte huldigten <strong>de</strong>m König und ließen sich von ihm ihre Rechte bestätigen. Im Ersten Frie<strong>de</strong>n von Thorn 1411 konnte <strong>de</strong>r Hochmeister seinen<br />
Besitzstand gegen „Reparationszahlungen“ wahren. Im Frie<strong>de</strong>n am Melnosee 1422 fielen das Dobriner Land und Nie<strong>de</strong>rlitauen vom Deutschor<strong>de</strong>nsland ab.
Die Entsendung <strong>de</strong>s Diplomaten Paulus Vladimiri <strong>zu</strong>m Konzil von Konstanz, brachte Jagiełło die Anerkennung seines Anspruchs einer <strong>de</strong>r einflussreichsten christlichen Herrscher <strong>zu</strong><br />
sein. Das Konzil entzog <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n überdies das Recht Litauen <strong>zu</strong> missionieren, das mit Jagiełłos Amtsantritt als König von Polen offiziell <strong>zu</strong>m Christentum bekehrt wor<strong>de</strong>n<br />
war. Damit war die Existenzberechtigung dieses Ritteror<strong>de</strong>ns aus polnischer Sicht nicht mehr gegeben. Der König erfuhr aus <strong>de</strong>m Reich politische Unterstüt<strong>zu</strong>ng, so versprach Kurfürst<br />
Friedrich I. von Bran<strong>de</strong>nburg 1421 seinen Beistand gegen die Or<strong>de</strong>nsritter. Sein Sohn, <strong>de</strong>r spätere Kurfürst Friedrich II. von Bran<strong>de</strong>nburg, war mit <strong>de</strong>r Erbprinzessin Hedwig Jagiellonica<br />
(1408–1431) verlobt. Er galt bis 1424 als Thronfolger bis <strong>de</strong>r plötzliche Tod seiner Braut das Verhältnis löste.[16] Das Hussitentum gewann als eine anti<strong>de</strong>utsche Bewegung auch in Polen<br />
viele Anhänger, aber dank päpstlicher Vermittlung versöhnte sich Jagiełło 1423 mit König Sigismund von Luxemburg, mit Blick auf die Verteidigung <strong>de</strong>s katholischen Glaubens gegen<br />
das Osmanische Reich.<br />
Aufstieg <strong>zu</strong>r europäischen Großmacht<br />
König Władysław II. Jagiełło verstarb 1434. Der Kardinal Zbigniew Oleśnicki übernahm die Regentschaft für Jagiełłos unmündigen Sohn Władysław [von Warna]. Im Frie<strong>de</strong>n von Brest<br />
1435 schloss Oleśnicki einen Frie<strong>de</strong>nsvertrag mit <strong>de</strong>m Deutschor<strong>de</strong>nsstaat. In Litauen konnte er jedwe<strong>de</strong> Opposition gegen die polnisch-litauische Union ausschalten. Damit nahmen auch<br />
die Bestrebungen Sigismunds von Luxemburg, einen Keil zwischen Polen und Litauen <strong>zu</strong> treiben, ein En<strong>de</strong>. Der im Krieg und Frie<strong>de</strong>n erfolgreiche Kardinal versuchte <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>r<br />
Hussiten <strong>zu</strong> begrenzen und Schlesien auf diplomatischem Wege für Polen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen. Seine politische Zielset<strong>zu</strong>ng bestand darin, Polen <strong>zu</strong>m Bollwerk <strong>de</strong>r katholischen Kirche<br />
und <strong>zu</strong> einer europäischen Großmacht <strong>zu</strong> machen. Dem sollten die Bündnisse mit Litauen und Ungarn dienen.<br />
Für die Ungarn war Polen als Helfer gegen die osmanischen Türken außeror<strong>de</strong>ntlich wichtig. König Władysław III. erwarb die ungarische Krone 1440. Er fiel bei Warna bei <strong>de</strong>r Rettung<br />
von Konstantinopel gegen Sultan Murad II.. Dies kennzeichnete <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>r polnischen Türkenkriege in Europa. Nach drei Jahren Interregnum kam 1447 sein jüngerer Bru<strong>de</strong>r<br />
Kasimir an die Macht, <strong>de</strong>r 1471 für seinen Sohn Władysław die böhmische und 1490, nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Matthias Corvinus, die ungarische Krone sicherte. Dadurch <strong>de</strong>hnten die<br />
Jagiellonen ihren Einfluss über weite Teile Mittel-, Ost- und Südosteuropas aus.<br />
Zwecks einer Annäherung an das Königreich Deutschland wur<strong>de</strong> Kasimir mit Elisabeth von Habsburg, Tochter Königs Albrecht II., verheiratet. Diese ging als „Mutter von Königen“ in<br />
die Historie ein. Im Jahr <strong>de</strong>r Hochzeit, 1454, bat <strong>de</strong>r Preußische Bund <strong>de</strong>n polnischen König um Hilfe gegen <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n. Kasimir versprach Hilfe und nahm am<br />
Dreizehnjährigen Krieg 1454–1466 aktiv teil, <strong>de</strong>r im Zweiten Thorner Frie<strong>de</strong>n 1466 en<strong>de</strong>te. Der Deutsche Or<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> entschei<strong>de</strong>nd geschwächt und hatte Gebietsverluste <strong>zu</strong><br />
verzeichnen. Es entstand das Königliche Preußen, das mit Autonomie versehen <strong>de</strong>r direkten polnischen Herrschaft unterlag. Das Restgebiet <strong>de</strong>s Deutschor<strong>de</strong>nsstaates mit <strong>de</strong>m Zentrum in<br />
Königsberg, ohne das Erm- und Kulmerland, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m königlichen Lehen. Der Hochmeister wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m polnischen König <strong>zu</strong>r Heeresfolge und <strong>zu</strong>m Treueid verpflichtet.<br />
Dem Macht<strong>zu</strong>wachs nach außen stand die Schwächung <strong>de</strong>r Krongewalt im Inneren gegenüber. Die Jagiellonen mussten <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>lsstand Privilegien einräumen. Der polnische Reichstag,<br />
<strong>de</strong>r Sejm, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l und Klerus <strong>zu</strong>sammensetzte, gewann <strong>zu</strong>nehmend Macht über <strong>de</strong>n König. Die Verfassung Nihil Novi <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Herrschaft Königs Alexan<strong>de</strong>r legte 1505<br />
weitgehen<strong>de</strong> Mitbestimmungsrechte <strong>de</strong>s Sejms fest. Die <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Privilegierung <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls und die Übernahme zahlreicher Regierungsfunktionen durch diesen, hatte die sukzessive<br />
Entrechtung <strong>de</strong>s Bauern- und Bürgerstan<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>r Folge.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts erhöhte sich <strong>de</strong>r Druck gegen die Herrschaft <strong>de</strong>r Jagiellonen in Europa durch das Osmanische Reich, das Großfürstentum Moskau und das Haus Habsburg.<br />
Der Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s polnischen Lehnsfürstentum Moldau mit <strong>de</strong>n Häfen Kilija und Białogród, die wichtig für <strong>de</strong>n polnischen Überseehan<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n im Mittelmeer ansässigen Seerepubliken<br />
Genua und Venedig waren, wur<strong>de</strong> 1484 vom Sultan Bayezid II. erobert. König Johann I. Albrecht unternahm 1497, ohne Teilnahme <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen und Königreichs<br />
Ungarn, einen militärischen Vorstoß mit einem Heer aus 50.000 Mann und 200 Kanonen gegen die osmanische Herrschaft im Budschak. Der moldauische Fürst, Ştefan cel Mare, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />
polnischen König die Treue geschworen hatte, brach mit diesem und wechselte die Front. Die königliche Militärexpedition wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m militärischen Fiasko. Durch Nie<strong>de</strong>rlagen, Hunger<br />
und Seuchen geplagt, zog sich <strong>de</strong>r König nach Polen <strong>zu</strong>rück. Die Hohe Pforte stellte ihre Vasallen, die Krimtataren, gegen Polen und Litauen auf. In <strong>de</strong>n nächsten zwei Jahrhun<strong>de</strong>rten<br />
überfielen diese regelmäßig die südlichen Provinzen <strong>de</strong>s Reiches. Als Reaktion darauf wur<strong>de</strong> das südliche Grenzland mit freien Wehrbauern besie<strong>de</strong>lt, was <strong>zu</strong>r Entstehung <strong>de</strong>s späteren<br />
ukrainischen Kosakentums führte. Die „Wil<strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>r“, so hießen die Gebiete nördlich <strong>de</strong>r Halbinsel Krim, entwickelten sich in <strong>de</strong>r Folge <strong>zu</strong> einer „permanenten Kriegszone“ im<br />
Spannungsfeld ihrer Anlieger. Letztlich verlor Polen die direkte politische Einflussnahme über die Moldau 1512 an <strong>de</strong>n osmanischen Sultan.<br />
Der Aufstieg <strong>de</strong>s ruthenischen Großfürstentums Moskau an <strong>de</strong>r östlichen Grenze entwickelte sich für Litauen <strong>zu</strong>r Existenzbedrohung. Dieser wur<strong>de</strong> durch die 1472 vom Papst Paul II.
vermittelte Heirat Iwans III. mit <strong>de</strong>r byzantinischen Prinzessin Sophie begünstigt (Übernahme <strong>de</strong>s byzantinischen Hofzeremoniells und Supremattitels über die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r ehemaligen<br />
Kiewer Rus). Mit Großfürst Iwan und seinem Sohn begann eine großräumige Expansion <strong>de</strong>s Großfürstentums Moskau, die alle Kräfte Polens und Litauens im Osten für Jahrhun<strong>de</strong>rte<br />
band. Bei<strong>de</strong> Staaten befan<strong>de</strong>n sich ab 1492 (Kriege <strong>de</strong>r Jahre 1492–1494, 1500–1503, 1507–1508, 1512–1522 etc.) bis <strong>zu</strong>m ersten „dauerhaften“ Frie<strong>de</strong>nstraktat von 1634 mit Russland<br />
faktisch im Kriegs<strong>zu</strong>stand. Die vorherigen Waffengänge waren nur durch Waffenstillstandsverträge unterbrochen. Nach wechselvollen Kämpfen (Wedroscha 1500 und Orscha 1514) an<br />
<strong>de</strong>r Schwelle <strong>de</strong>s 15./16. Jahrhun<strong>de</strong>rts gingen mit <strong>de</strong>m Vertrag von 1522 für Litauen beträchtliche Gebietsverluste einher. Moskau errang in Osteuropa ein machtpolitisches Übergewicht<br />
gegen Vilnius.<br />
Die militärisch-politischen Rückschläge <strong>de</strong>r Jagiellonen bewogen Kaiser Maximilian I. da<strong>zu</strong>, eine gegen Polen gerichtete Koalition mit <strong>de</strong>n Kurfürstentümern Bran<strong>de</strong>nburg und Sachsen,<br />
<strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n in Preußen und Livland, <strong>de</strong>m Königreich Dänemark und <strong>de</strong>m Großfürstentum Moskau <strong>zu</strong> schließen. Mit <strong>de</strong>r Rücken<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>s Kaisers verweigerte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m <strong>de</strong>r<br />
neue Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns, Friedrich von Sachsen, König Johann Albrecht <strong>de</strong>n Huldigungseid, woraufhin <strong>de</strong>r König im Frühling 1501 sein Heer in <strong>de</strong>r Nähe von Thorn<br />
<strong>zu</strong>sammenziehen ließ. Kurz vor <strong>de</strong>m Einmarsch in das Or<strong>de</strong>nsland verstarb <strong>de</strong>r polnische König. Als Nachfolger auf <strong>de</strong>m polnischen Thron wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r jüngere Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Königs,<br />
Alexan<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Jagiellone, <strong>de</strong>r Großfürst von Litauen, bestimmt. Der Sieg bei Orscha über die russischen Truppen verhin<strong>de</strong>rte eine dauerhafte Einkreisung Polens, da <strong>de</strong>r Kaiser nun<br />
überzeugt war, dass Polen-Litauen immer noch eine potente Macht war. Er gab seine feindliche Haltung auf und begann die jagiellonisch dominierten Königreiche Böhmen und Ungarn<br />
auf diplomatischem Weg für das Haus Habsburg <strong>zu</strong> erwerben. Um die Situation mit <strong>de</strong>m Kaiserhaus <strong>zu</strong> entspannen, fand im Jahre 1515 <strong>de</strong>r Erste Wiener Kongress statt, <strong>de</strong>r Wiener<br />
Fürstentag. Sigismund <strong>de</strong>r Alte, ab 1506 König von Polen, ging ein Heirats- und damit ein Regierungsbündnis mit Maximilian von Habsburg ein. Der Kaiser erkannte die Thorner<br />
Frie<strong>de</strong>nsbestimmung von 1466 an und ließ endgültig von seinen antijagiellonischen Plänen ab. Der seit 1511 im Or<strong>de</strong>nsland Preußen herrschen<strong>de</strong> Hochmeister, Albrecht von<br />
Hohenzollern, weigerte sich jedoch weiterhin, sich Polen <strong>zu</strong> unterwerfen und setzte von 1519–1521, auf Unterstüt<strong>zu</strong>ng aus <strong>de</strong>m Reich hoffend, einen gegen seinen polnischen<br />
Lehnsherren, <strong>de</strong>r gleichzeitig sein Onkel war, geführten so genannten „Reiterkrieg“ fort. Bedingt durch das Bündnis und <strong>de</strong>n Druck <strong>de</strong>r aus Kleinpolen stammen<strong>de</strong>n Magnaten, die ein<br />
gutes Verhältnis <strong>zu</strong>m Kaiserhaus favorisierten, vergab <strong>de</strong>r polnische König die Gelegenheit, <strong>de</strong>n polnischen Machtbereich über fast das gesamte südliche Baltikum von Preußisch-<br />
Königsberg bis nach Rügen aus<strong>zu</strong><strong>de</strong>hnen. Der pommersche Herzog Bogislaw X., <strong>de</strong>ssen Herzogtum Pommern seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt durch die bran<strong>de</strong>nburgischen Markgrafen und<br />
Kurfürsten bedrängt wur<strong>de</strong>, suchte die Nähe Polens. Er akzeptierte 1503 die polnische Suzeränität über sein Herzogtum, 1513 schlug er eine vollständige Union mit Polen vor und<br />
schließlich, 1518, eine „Ewige Allianz“. König Sigismund I. und sein Vorgänger lehnten alle Vorschläge, die Polen ohne „Krieg ums Land“ bereichert hätten, ab. Der Herzog wandte sich<br />
nun an <strong>de</strong>n Kaiser, <strong>de</strong>ssen Lehnsmann er wur<strong>de</strong>. Auch beim Wie<strong>de</strong>rerwerb Schlesiens war <strong>de</strong>r König nicht erfolgreich. Er ließ seine Rechte am Herzogtum Glogau, <strong>de</strong>ssen Herrscher er<br />
als „Herzog von Schlesien“ einmal war, verwirken.<br />
König Sigismund heiratete 1518 die italienische Prinzessin Bona Sforza, die Nichte <strong>de</strong>r verstorbenen Kaiserin Bianca Maria Sforza. Als ambitionierte und machtbewusste Frau, dachte<br />
diese an Stärkung <strong>de</strong>r königlichen Macht. Ihre Reformpläne stießen beim A<strong>de</strong>l auf Wi<strong>de</strong>rstand und forcierten eine A<strong>de</strong>lsrebellion, <strong>de</strong>n so genannten „Hühnerkrieg“. Mit Königin Bona<br />
fand die italienische Renaissance in Polen und Litauen breiten Ein<strong>zu</strong>g.<br />
Sultan Süleyman I. erklärte <strong>de</strong>m Königreich Ungarn <strong>de</strong>n Krieg. Nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Mohács 1526 überrannte das Osmanische Heer die Pannonische Tiefebene. König Ludwig von<br />
Böhmen und Ungarn fiel auf <strong>de</strong>m Schlachtenfeld. Das folgen<strong>de</strong> machtpolitische „Erdbeben“ in <strong>de</strong>r Region und eine durch „Moskau“ bedrohte Ostgrenze för<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>n Abschluss eines<br />
polnisch-litauischen Frie<strong>de</strong>ns- und Han<strong>de</strong>lsvertrags 1533 mit <strong>de</strong>r Hohen Pforte. Die Kronen Böhmens und Ungarns gingen gemäß <strong>de</strong>r Wiener Akte von 1515 <strong>de</strong> jure an die österreichische<br />
Linie <strong>de</strong>r Habsburger. Damit stiegen diese <strong>zu</strong>m dominieren<strong>de</strong>n Herrschergechlecht in Europa auf. Nach <strong>de</strong>m Tod von König Johann Zápolya 1540, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n habsburgischen<br />
Herrschaftsanspruch in Ungarn bekämpft hatte, glie<strong>de</strong>rten die Osmanen Zentralungarn mit Buda als „Eyâlet Budin“ ihrem Reiche 1541 direkt an. Im Osten entstand ein autonomes <strong>de</strong>r<br />
Hohen Pforte tributpflichtiges Fürstentum Siebenbürgen unter König Johanns Sohn. Die Habsburger behaupteten sich nach <strong>de</strong>r „Aufspaltung“ <strong>de</strong>s Königreichs Ungarn dauerhaft im<br />
Westen. Albrecht von Hohenzollern, Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns, unterwarf sich 1525 <strong>de</strong>m polnischen König und nahm das neue Herzogtum Preußen aus <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
polnischen Suzeräns <strong>zu</strong> Lehen. Das Land wur<strong>de</strong> säkularisiert und <strong>de</strong>r neue evangelische Glaube garantiert. Eine Ausnahme stellte das Ermland dar, das weiterhin katholisch blieb. Bereits<br />
im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt begann sich ein Wan<strong>de</strong>l in <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Verhältnissen ab<strong>zu</strong>zeichnen. Auf <strong>de</strong>m Land setzte sich die Leibeigenschaft und Fronwirtschaft durch, während die<br />
Städte, vor allem Krakau, Danzig, Thorn, Lublin, später auch Warschau, <strong>zu</strong> blühen<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsstädten von internationalem Rang heranwuchsen.<br />
1569–1795: Republik Polen-Litauen (Rzeczpospolita)
Zeitalter <strong>de</strong>r Glaubensspaltung, Erster Nordischer Krieg und Union von Lublin<br />
König Zygmunt II. August<br />
Der im Kampf gegen <strong>de</strong>n Hocha<strong>de</strong>l geschwächte Kleina<strong>de</strong>l erwirkte unter Sigismund II. August eine Wirtschafts-, Heeres- und Rechtsreform. Unter <strong>de</strong>m Eindruck <strong>de</strong>r russischen<br />
Offensive im Livländischen Krieg gegen das Baltikum, wur<strong>de</strong> die Personalunion zwischen Polen und Litauen 1569 in Lublin <strong>zu</strong> einer Realunion umgewan<strong>de</strong>lt. Litauen stimmte <strong>de</strong>r Union<br />
mit Polen mehrheitlich <strong>zu</strong> – gegen Autonomiegewährleistung in <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Wehrhoheit, Staatsfinanzen, Jurisdiktion und Amtssprache. Der Krieg führte <strong>zu</strong>m Ausbruch <strong>de</strong>s Ersten<br />
Nordischen Krieges um das „Dominium maris Baltici“.[17] Die Realunion bil<strong>de</strong>te für die Geschichte <strong>de</strong>r Ukraine eine Zäsur. Der ukrainisch-ruthenische A<strong>de</strong>l unterstellte seine<br />
Län<strong>de</strong>reien direkt <strong>de</strong>m Königreich Polen und die kulturelle und religiöse Integration <strong>de</strong>s ukrainischen in <strong>de</strong>n polnischen A<strong>de</strong>l wur<strong>de</strong> beschleunigt. Es bil<strong>de</strong>te sich eine Kluft zwischen <strong>de</strong>m<br />
privilegierten, katholischen A<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>n orthodox gebliebenen ukrainischen Unterschichten. Dem Kronland Polen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Lubliner Union das litauische Podlachien, Wolhynien,<br />
Bracławer- und Kiewer-Land <strong>zu</strong>gesprochen. Die Union von Wilna stellte 1561 <strong>de</strong>n Machtbereich <strong>de</strong>s in Kurland, Livland und Estland souverän agieren<strong>de</strong>n Zweigs <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns<br />
unter das polnische Supremat. Der König garantierte <strong>de</strong>m Landmeister Gotthard von Kettler Kraft seines Privilegs: <strong>de</strong>utsche Sprache, <strong>de</strong>utsches Recht, <strong>de</strong>utsche Selbstverwaltung sowie<br />
Freiheit <strong>de</strong>s Glaubens, das später auch unter schwedischer und russischer Herrschaft bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt bestand hatte. Die Livländische Konfö<strong>de</strong>ration sicherte sich so gegen die<br />
russische Eroberungspolitik ab.<br />
Reformation<br />
Die Reformation verbreitete sich im konfessionell gemischten Polen und Litauen <strong>zu</strong>nächst relativ rasch. Der Calvinismus wur<strong>de</strong> 1540 durch Jan Łaski nach Polen gebracht. Unter <strong>de</strong>m<br />
Einfluss <strong>de</strong>s Unitariers, Faustus Sozzini, wur<strong>de</strong> 1579 die Kirche <strong>de</strong>r Sozinianer gegrün<strong>de</strong>t. Das Luthertum hatte <strong>zu</strong>nächst bei <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung in <strong>de</strong>n preußischen Städten und<br />
in Krakau Ein<strong>zu</strong>g gefun<strong>de</strong>n, auch im Herzogtum Preußen begannen sich die Lehren Luthers und Calvins durch<strong>zu</strong>setzen. König Sigismund I. bekämpfte sie mit einer Reihe von Edikten<br />
und Rechteeinschränkungen politisch, in Danzig auch militärisch. Sein Sohn und Nachfolger Sigismund August, auf <strong>de</strong>n die Protestanten große Hoffnungen setzten, wechselte zwar nicht<br />
die Konfession, ging aber auch nicht energisch gegen die Reformation vor. In <strong>de</strong>n Jahren nach 1548 bil<strong>de</strong>ten sich in einer Reihe von Orten reformatorische Gemein<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ner<br />
Couleur: im Westen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s die vertriebenen Böhmischen Brü<strong>de</strong>r in Leszno und Ostroróg, im Osten Arianer und Wie<strong>de</strong>rtäufer in Raków und an<strong>de</strong>ren Mediatstädten adliger<br />
Magnatengeschlechter. Diese Orte waren vorübergehend führen<strong>de</strong> Zentren <strong>de</strong>r Kultur, vor allem <strong>de</strong>r Literatur und <strong>de</strong>s Buchdrucks. Die protestantischen Richtungen <strong>de</strong>r Rzeczpospolita<br />
schlossen 1570 die Union von Sandomir, auch Consensus Sandomiriensis genannt. Mit <strong>de</strong>r „Pax Dissi<strong>de</strong>ndum“ <strong>de</strong>r Warschauer Konfö<strong>de</strong>ration 1573, wur<strong>de</strong> die uneingeschränkte<br />
Religionsfreiheit <strong>de</strong>r Protestanten, einschließlich ihrer politischen Gleichstellung und Zivilrechte, staatsrechtlich sanktioniert.<br />
Gegenreformation<br />
Die Zersplitterung <strong>de</strong>r Bewegung in verschie<strong>de</strong>ne Richtungen war <strong>zu</strong>gleich ihre große Schwäche, an <strong>de</strong>r die Gegenreformation ansetzte, die in Polen mit Stanislaus Hosius, <strong>de</strong>m Bischof<br />
von Ermland, begann. Diese wur<strong>de</strong> mit Hilfe <strong>de</strong>r Jesuiten auch intellektuell forciert. Die außenpolitische Anlehnung <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n drei Wasa-Könige an das katholische Habsburg und <strong>de</strong>r<br />
innenpolitische Kampf gegen <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>l drängten die Protestanten immer weiter <strong>zu</strong>rück, vor allem die Sozinianer. Allerdings gab es keine Einrichtung wie die Inquisition in Polen und es<br />
wur<strong>de</strong> auch niemand auf <strong>de</strong>m Scheiterhaufen verbrannt. Die polnische Toleranz jener Zeit war damit <strong>zu</strong> erklären, dass sich die Vertreter <strong>de</strong>s dominieren<strong>de</strong>n A<strong>de</strong>ls einen Glaubenskrieg wie<br />
im benachbarten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m hugenottischen Frankreich ersparen wollten. Vereinzelt wur<strong>de</strong>n allerdings von fanatisierten Volkshaufen<br />
evangelische Kirchen angezün<strong>de</strong>t, so etwa 1591 in Krakau, 1611 in Wilna und zwischen 1603 und 1616 mehrfach in Posen. Mit einem Teil <strong>de</strong>r ruthenisch-orthodoxen Kirche wur<strong>de</strong>, auf<br />
Betreiben <strong>de</strong>s Kanzelredners Piotr Skarga, ein Ausgleich in <strong>de</strong>r 1596 geschlossenen Kirchenunion von Brest gefun<strong>de</strong>n. Diese sollte die Ostgrenze sichern, erfüllte aber die Erwartungen<br />
<strong>de</strong>r Staatsspitze und <strong>de</strong>r beteiligten lokalen Wür<strong>de</strong>nträger nicht. Freilich setzte seit <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine immer stärkere Rekatholisierung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ein, die religiöse und<br />
nationale Min<strong>de</strong>rheiten <strong>zu</strong>sehends an <strong>de</strong>n Rand drängte. Die katholische Konfessionalisierung verringerte das Verteidigungspotential <strong>de</strong>s multikonfessionellen Staates entschei<strong>de</strong>nd, durch<br />
<strong>de</strong>n späteren Abfall <strong>de</strong>r orthodoxen Ukraine unter <strong>de</strong>n Saporoger Kosaken an Russland im Vertrag von Perejaslaw 1654. Sie „för<strong>de</strong>rte“ die Abwan<strong>de</strong>rung großer Teile <strong>de</strong>r protestantischen<br />
Bevölkerung, wodurch wirtschaftlich-intellektuelles Potential <strong>de</strong>m Land <strong>zu</strong>sätzlich auf Dauer verloren ging.<br />
Renaissance
Kunst, Literatur und Wissenschaft erreichten im „gol<strong>de</strong>nen Jahrhun<strong>de</strong>rt“ <strong>de</strong>r Renaissance und <strong>de</strong>s Humanismus einen Höhepunkt, insbeson<strong>de</strong>re während <strong>de</strong>r Regierungszeit <strong>de</strong>s<br />
Renaissancekönigs Sigismunds <strong>de</strong>s Alten, einen Aufschwung von Literatur und Kunst, wobei das bis dahin im Schrifttum dominieren<strong>de</strong> Latein <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>s Polnischen <strong>zu</strong>rücktrat, das<br />
sich ab etwa 1500 voll entfaltete. Es kam <strong>zu</strong>r Blüte <strong>de</strong>r „Weichselgotik“, <strong>zu</strong>m Eindringen <strong>de</strong>r italienischen Renaissance in die „Krakauer Malerschule“ und es stieg <strong>de</strong>r Einfluss <strong>de</strong>utscher<br />
und flämischer Künstler, unter an<strong>de</strong>ren Veit Stoß. An <strong>de</strong>r Krakauer Aka<strong>de</strong>mie, einem Zentrum <strong>de</strong>s Humanismus, wirkten Conrad Celtis und die Juristen Paweł Włodkowic und Jan<br />
Ostroróg. Durch Einwan<strong>de</strong>rung auch <strong>de</strong>utscher Drucker, Holzschnitzer und Verleger, stieg Krakau <strong>zu</strong>m führen<strong>de</strong>n Zentrum <strong>de</strong>s Buchdrucks in Ostmitteleuropa auf. Die Dichter Mikołaj<br />
Rej, Jan Kochanowski und Łukasz Górnicki begrün<strong>de</strong>ten die polnische Literatur, <strong>de</strong>r Philosoph Andrzej Frycz Modrzewski die polnische Staatstheorie und Nikolaus Kopernikus das<br />
heliozentrische Weltbild. In Architektur und Kunst spiegelten sich italienische und französische Einflüsse. Zahlreiche A<strong>de</strong>lspaläste, Bürgerhäuser und Kirchen entstan<strong>de</strong>n, das<br />
Königsschloss auf <strong>de</strong>m Wawelhügel wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r prunkvollen Resi<strong>de</strong>nz ausgebaut, neue Städte gegrün<strong>de</strong>t. Der Reichskanzler Jan Zamoyski ließ eine Renaissance-Mo<strong>de</strong>llstadt, Zamość,<br />
anlegen, die Städte Lemberg, Vilnius und Posen stiegen <strong>zu</strong> wichtigen Kulturzentren auf, die preußischen Hansestädte Elbing, vor allem Danzig, <strong>zu</strong> wichtigsten Han<strong>de</strong>lshäfen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Konstitutionalisierung <strong>de</strong>r Rzeczpospolita<br />
König Sigismund II. August verstarb 1572 ohne einen männlichen Nachkommen. Der A<strong>de</strong>lsstand hatte 1569 seine Vormachtstellung im Staat in <strong>de</strong>r Lubliner Union zementiert. Polen und<br />
Litauen wur<strong>de</strong>n nach 1569 <strong>zu</strong>r Rzeczpospolita, einer Republik auf Basis einer Fö<strong>de</strong>ration unter <strong>de</strong>r „Präsi<strong>de</strong>ntschaft“ eines auf Lebenszeit gewählten Königs von Polen und Großfürsts<br />
von Litauen in Realunion (amtlich Republik <strong>de</strong>r Polnischen Krone [Königreichs Polen] und <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen). Für Litauen, Weißrussland und Ukraine be<strong>de</strong>utete dies<br />
langfristig die weitgehen<strong>de</strong> Polonisierung ihrer Führungsschichten. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts umfasste die Rzeczpospolita das Gebiet Zentral-, Nord- und Ostpolens, Oblasts<br />
Kaliningrad, Litauens, Lettlands, Weißrusslands, Ukraine's, Slowakei's, Estlands und Moldaus.<br />
Bei <strong>de</strong>r Königswahl sollten alle adligen Reichsbürger sich auf <strong>de</strong>m Wahlfeld in Wola bei Warschau versammeln, um <strong>de</strong>n Herrscher in Freier Wahl <strong>zu</strong> bestimmen. Je<strong>de</strong>r Adlige hatte eine<br />
Stimme, <strong>de</strong>r verarmte Landadlige genauso wie <strong>de</strong>r mächtigste Magnat. Stimmenkauf war üblich. Der gewählte König war gezwungen, <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>r Pacta conventa Zugeständnisse<br />
<strong>zu</strong> machen. Er hatte auch die Articuli Henriciani <strong>zu</strong> beschwören. Der König galt als primus inter pares, die reale Macht lag in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Hocha<strong>de</strong>ls, <strong>de</strong>r sie durch <strong>de</strong>n alleinigen<br />
Besitz aller Staatsämter und die Grundherrschaft über die Untertanen ausübte. Seit <strong>de</strong>r Verfassung, <strong>de</strong>r Nihil Novi von 1505, konnte das Staatsoberhaupt ohne Zustimmung <strong>de</strong>s<br />
Reichstages mit seinen bei<strong>de</strong>n Kammern kein neues Gesetz mehr erlassen. Die Stellung <strong>de</strong>s Königs [in <strong>de</strong>r Rzeczpospolita] war schwächer als die eines Monarchen in einer<br />
Konstitutionellen Monarchie <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts.[18]<br />
Das Einstimmigkeitsprinzip aller Reichstagsbeschlüsse galt seit <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt, wur<strong>de</strong> aber erst seit 1652 so angewandt, dass ein einzelner Abgeordneter mit <strong>de</strong>m Ruf <strong>de</strong>s Liberum<br />
Veto das Parlament blockieren und alle bisher gefassten Beschlüsse ungültig machen konnte. Die Problematik dieser Regelungen wur<strong>de</strong> von vielen erkannt, doch Macht- und<br />
gesellschaftliches Desinteresse <strong>de</strong>r Großgrundbesitzer verhin<strong>de</strong>rten Reformen. Die meisten Städte blieben ohne politischen Einfluss und wur<strong>de</strong>n wie die Verteidigung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
vernachlässigt, weil <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l sich weigerte, entsprechen<strong>de</strong> finanzielle Leistungen <strong>zu</strong>r Aufstellung eines schlagkräftigen Heeres auf<strong>zu</strong>bringen. Als Folge <strong>de</strong>r Verweigerung Steuern <strong>zu</strong><br />
zahlen, blieb die Staatskasse seit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s gemeinsamen Staatswesens bis <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>ssen Untergang, notorisch klamm. Dadurch musste die polnisch-litauische Republik, obwohl <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n bevölkerungsreichsten und größten Staaten Europas gehörend, mit kleinen Armeen an mehreren Fronten verteidigt wer<strong>de</strong>n. Diese Politik war in Frie<strong>de</strong>nszeiten erfolgreich, doch im<br />
18. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> sie für das Land <strong>zu</strong>m Verhängnis.<br />
Die Lage <strong>de</strong>s unterdrückten Bauernstan<strong>de</strong>s war aufgrund <strong>de</strong>r Frondienste und persönlicher Unfreiheit katastrophal. Sie verschlechterte sich, da die Erlöse für seine Erzeugnisse im Lauf<br />
<strong>de</strong>r nächsten Jahrhun<strong>de</strong>rte immer mehr abnahmen. Die Grundlage für eine günstige Entwicklung <strong>de</strong>r polnischen Wirtschaft war <strong>de</strong>r Großhan<strong>de</strong>l. In Zeiten, in <strong>de</strong>nen sich im Westen <strong>de</strong>r<br />
Merkantilismus durchsetzte, spielte protektionistische Wirtschaftspolitik eine wichtige Rolle. In Polen <strong>de</strong>r Neuzeit wur<strong>de</strong> die Funktion <strong>de</strong>s Staates hingegen auf ein Minimum reduziert.<br />
Kennzeichnend für die politische Entwicklung dieser Zeit ist die Ausbildung einer „A<strong>de</strong>lsnation“ mit polonisiertem litauischen, ruthenischen und <strong>de</strong>utsch-preußisch-baltischen A<strong>de</strong>l,<br />
während die Landbevölkerung im Nor<strong>de</strong>n und Osten <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s weiterhin überwiegend <strong>de</strong>utsch-, litauisch-, weißrussisch- und ukrainisch-sprachig blieb. Der polnische Reichstag <strong>de</strong>r<br />
Magnaten engte nach 1572 die Macht <strong>de</strong>s Königtums <strong>zu</strong>nehmend ein und sicherte sich auf Dauer das Privileg <strong>de</strong>r Königswahl.<br />
König Stephan Báthory<br />
Zweiter Souverän <strong>de</strong>r „Rzeczpospolita“ wur<strong>de</strong> 1573 <strong>de</strong>r französische Prinz Heinrich von Valois. Der König verließ jedoch seinen Thron nach wenigen Monaten <strong>de</strong>r Herrschaft fluchtartig,
ohne formal abgedankt <strong>zu</strong> haben. Er erfuhr vom Tod seines Bru<strong>de</strong>rs Karl IX., König von Frankreich, um sich die französische Krone <strong>zu</strong> sichern, die mit mehr Macht verbun<strong>de</strong>n war.<br />
Heinrich hinterließ die Pacta conventa und die Articuli Henriciani, die konstitutionellen Charakter hatten und die königlichen Rechte auf ein Minimum reduzierten. Die von ihm<br />
gewährten Rechte und Privilegien, trotz seiner kurzen „Herrschaft <strong>de</strong>r 146 Tage“,[19] wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Freiheit und begrün<strong>de</strong>ten die herausgehobene Stellung <strong>de</strong>r<br />
a<strong>de</strong>lsrepublikanischen Aristokratie. Heinrich ließ <strong>de</strong>n ihm gesetzten Rückkehrtermin verstreichen. Er wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Krone verlustig erklärt und mit Stephan Báthory, <strong>de</strong>r starke Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
beim Jan Zamoyski hatte, konnte sich 1576 ein ungarischer Aristokrat aus <strong>de</strong>m Fürstentum Siebenbürgen in Polen erfolgreich durchsetzen.<br />
Báthory war ein geschickter Taktiker im Machtgefüge <strong>de</strong>r Republik und führte sein Heer siegreich gegen <strong>de</strong>n Moskauer Staat im Livländischen Krieg an. In drei kraftvollen Kampagnen<br />
(Polozk 1579, Welikije Luki 1580 und Pleskau 1581) rang er <strong>de</strong>n Zaren militärisch nie<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r, trotz <strong>de</strong>r erfolgreichen Verteidigung von Pleskau, Papst Gregor XIII. um Vermittlung bat.<br />
Der Papst sandte daraufhin <strong>de</strong>n Jesuiten Antonio Possevino, unter <strong>de</strong>ssen Leitung Zar Iwan <strong>de</strong>r Schreckliche im Vertrag von Jam Zapolski Waffenstillstand mit <strong>de</strong>m polnischen König<br />
schloss. Der Zar trat das 1563 eroberte Gebiet um die Stadt Polozk und das seit 1558 in Teilen annektierte Livland mit Dorpat an die polnische Krone ab. Stephan Báthory grün<strong>de</strong>te 1579<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>r Jesuiten, die er nach Polen holte und för<strong>de</strong>rte, die Universität Vilnius. Den Plan, mit Hilfe Polens seine ungarische Heimat von <strong>de</strong>r Türkenherrschaft <strong>zu</strong> befreien, konnte<br />
wegen seines plötzlichen To<strong>de</strong>s 1586 nicht verwirklicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Verwerfungen <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
Haus Wasa<br />
Das folgen<strong>de</strong> 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt war nach <strong>de</strong>m Abfall <strong>de</strong>r Saporoger-Kosaken eine Perio<strong>de</strong> <strong>de</strong>r militärischen Nie<strong>de</strong>rlagen und <strong>de</strong>s langsamen Verfalls <strong>de</strong>r polnischen Vormachtstellung in<br />
Ostmitteleuropa. 1587 wur<strong>de</strong> Sigismund III. Wasa, <strong>de</strong>r das Geschlecht <strong>de</strong>r Jagiellonen und <strong>de</strong>r Wasa in seiner Person vereinte, <strong>zu</strong>m König gewählt. Das Land blieb zwar vom<br />
Dreißigjährigen Krieg verschont, doch die Wahl eines schwedischen Prinzen begünstigte <strong>de</strong>n Ausbruch folgenschwerer Schwedisch-Polnischer Kriege und an<strong>de</strong>rer mannigfaltiger<br />
Konflikte, die mit <strong>de</strong>n katholischen Wasa wie Ägyptische Plagen ins Land kamen und bis ins 21. Jahrhun<strong>de</strong>rt blieben.<br />
Neben <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n im Nor<strong>de</strong>n, hatte Polen nach 1632 auch an <strong>de</strong>ssen gesamter Ostflanke im erstarkten Russischen Reich <strong>de</strong>r Romanow <strong>zu</strong> kämpfen. Die an <strong>de</strong>n Habsburgern<br />
ausgerichtete Außenpolitik <strong>de</strong>r polnischen Wasa und die Überfälle <strong>de</strong>r Kosaken auf türkisches Territorium, zerrütteten das relativ gute Verhältnis <strong>zu</strong>m Osmanischen Reich nachhaltig, auch<br />
aufgrund <strong>de</strong>r vielen Razzien <strong>de</strong>r Tatarenvölker, osmanischer Vasallen, gegen die Provinzen <strong>de</strong>s Königreichs. König Sigismund war auch <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r 1596 die Hauptstadt Polens von<br />
Krakau nach Warschau verlegte, wegen seiner zentralen Lage in Polen und <strong>de</strong>r größeren Nähe <strong>zu</strong> seinem Erbkönigreich Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts versuchte Sigismund Wasa <strong>de</strong>n Thron seiner schwedischen Heimat <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erlangen, <strong>de</strong>n er als Folge <strong>de</strong>r Schlacht bei Stångebro 1598 und seiner Abset<strong>zu</strong>ng<br />
durch <strong>de</strong>n schwedischen Reichstag als König von Schwe<strong>de</strong>n 1599 verloren hatte. Dies hatte das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ab 1592 bestehen<strong>de</strong>n Personalunion Schwe<strong>de</strong>ns mit Polen <strong>zu</strong>r Folge und<br />
provozierte <strong>de</strong>n Ausbruch <strong>de</strong>r Schwedisch-Polnischen Kriege 1600–1629.<br />
Der König griff auch massiv in die russischen Thronwirren ein, die Smuta, die nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Zaren Boris Godunow um 1605 im Zarenreich ausbrachen. Während <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>n Jahren<br />
1609 bis 1618 dauern<strong>de</strong>n Konfliktes, besetzten 1610 polnisch-litauische Unionstruppen unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Kronfeldhetmans Stanisław Żółkiewski für zwei Jahre Moskau. Eine<br />
angestrebte Personalunion scheiterte aber letztlich am russischen Wi<strong>de</strong>rstand gegen die königlichen Pläne und <strong>de</strong>r Inneren Verfassung Polens.[20] Ein Volksaufgebot aus Nischni<br />
Nowgorod hatte unter <strong>de</strong>r Führung von Kusma Minin und Knjas Dmitri Poscharski die im Moskauer Kreml verschanzten Polen belagert und sie 1612 <strong>zu</strong>r Kapitulation gezwungen.[21]<br />
Nach wechselvollen Kämpfen kam <strong>de</strong>r Krieg mit <strong>de</strong>m Vertrag von Deulino 1618 <strong>zu</strong> einem En<strong>de</strong>. König Sigismund schloss einen Waffenstillstand, in <strong>de</strong>m seine Herrschaft über Smolensk<br />
und Sewerien anerkannt wur<strong>de</strong>. Dementsprechend erreichte die A<strong>de</strong>lsrepublik mit einer Staatsfläche von knapp 1.000.000 Quadratkilometern ihre größte territoriale Aus<strong>de</strong>hnung. Nach<br />
Sigismunds Ableben und unter Bruch <strong>de</strong>s 1618 geschlossenen Vertrages, versuchte Zar Michael seine territorialen Ansprüche auf das verlorene Gebiet im „Smolensker Krieg“ ab 1632<br />
militärisch durch<strong>zu</strong>setzen, was aufgrund <strong>de</strong>s rechtzeitigen Entsatzes durch <strong>de</strong>n neuen polnischen König, Władysław IV. Wasa, in einer Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>s russischen Staates mün<strong>de</strong>te.<br />
Der dritte Gegenspieler im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt war das Osmanische Reich an <strong>de</strong>r Südgrenze. Nach diversen gegenseitigen kosakisch-tatarischen Grenzscharmützel, Einmischung lokaler<br />
Magnaten aus <strong>de</strong>r Ukraine in die inneren Angelegenheiten <strong>de</strong>r osmanischen Vasallen, <strong>de</strong>r Donaufürstentümer, kam es <strong>zu</strong> militärischen Handlungen, die schließlich in einem Krieg<br />
mün<strong>de</strong>ten, <strong>de</strong>m Osmanisch-Polnischen Krieg 1620–1621. Der türkische Sultan, Osman II., zog aus seinem sich auf drei Kontinenten erstrecken<strong>de</strong>n Imperium eine Streitmacht mit bis <strong>zu</strong><br />
300.000 Mann[22] gegen die Republik <strong>zu</strong>sammen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r polnische König bei Chocim ein gemischtes polnisch-ukrainisches Heer (bis <strong>zu</strong> 75.000 Mann an Kampftruppen, darunter 6450
Deutsche[22]) entgegenstellte. Als <strong>de</strong>n Osmanen, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit, nach über einem Monat kein Durchbruch <strong>de</strong>r polnisch-ukrainischen Front gelang, willigten bei<strong>de</strong><br />
Seiten in einen „ehrenvollen“ Waffenstillstand ein.<br />
Der Krieg for<strong>de</strong>rte über die Lan<strong>de</strong>sgrenzen bekannte Opfer. In Konstantinopel, <strong>de</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches, wies <strong>de</strong>r türkische Padischah <strong>de</strong>m Elitekorps <strong>de</strong>r Janitscharen<br />
die alleinige Schuld für das Scheitern <strong>de</strong>r militärischen Kampagne <strong>zu</strong>. Der gegen die Janitscharen gerichtete Vorwurf <strong>de</strong>r Feigheit, kostete ihn <strong>zu</strong>erst Amt und Wür<strong>de</strong>n und schließlich<br />
auch <strong>de</strong>n Kopf. Ebenso kamen Stanisław Żółkiewski bei Cecora 1620, Jan Karol Chodkiewicz bei Chocim 1621 und <strong>de</strong>r für die ukrainische Geschichte be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Kosaken-Ataman<br />
Petro Sahajdatschny ums Leben.<br />
Zeitalter <strong>de</strong>r „Blutigen Sintflut“<br />
1648 wur<strong>de</strong> Johann II. Kasimir <strong>zu</strong>m neuen polnischen König. Kaum an <strong>de</strong>r Macht, verschärften sich im Südosten die Spannungen. Auslöser waren die am Dnepr leben<strong>de</strong>n Saporoger<br />
Kosaken, eine Gruppe freier Grenzlandbewohner, die ursprünglich in polnischem Sold stehend gegen die Tatarenvölker eingesetzt wor<strong>de</strong>n war. Sie unternahmen immer wie<strong>de</strong>r Raubzüge,<br />
die <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Region gefähr<strong>de</strong>ten. Als sich abzeichnete, dass <strong>de</strong>r erwartete Kriegs<strong>zu</strong>g gegen das Osmanische Reich nicht <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong> kam, entschlossen sie sich unter Führung <strong>de</strong>s<br />
Bogdan Chmielnicki, Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kosakenstaats, <strong>zu</strong> einem Bündnis mit <strong>de</strong>n Krimtataren gegen „Warschau“.<br />
Der nun ausbrechen<strong>de</strong> Aufstand <strong>de</strong>r Kosaken, <strong>de</strong>r bürgerkriegsähnlichen Charakter hatte, war <strong>zu</strong>nächst erfolgreich und führte diese plün<strong>de</strong>rnd bis nach Kiew, Lemberg und sogar nach<br />
Zamość. Chmielnicki ließ gegen die in <strong>de</strong>r polnischen Ukraine leben<strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n Pogrome verüben, die fast 1/4 Millionen Menschen das Leben kosteten. Viele Ju<strong>de</strong>n verließen daraufhin<br />
das Land. Nach wechselvollen Kriegsereignissen, <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlacht bei Batoh, kam <strong>de</strong>r Konflikt 1654 <strong>zu</strong> einem En<strong>de</strong>; die Kosaken wechselten auf Basis <strong>de</strong>s Vertrags von<br />
Perejaslaw fast komplett unter die Oberhoheit <strong>de</strong>s russischen Zaren über und waren für Polen als Verbün<strong>de</strong>te verloren. Der Seitenwechsel war innerhalb <strong>de</strong>r Kosakennation nicht<br />
unumstritten, da ein Teil ein erneutes Zusammengehen mit Polen auf Grundlage <strong>de</strong>s Vertrags von Hadjatsch bevor<strong>zu</strong>gte. Es kam <strong>zu</strong> tiefen Spaltungen, die das Gebiet <strong>de</strong>r Ukraine für<br />
Jahrzehnte in kriegsähnliche Zustän<strong>de</strong> und Chaos fallen ließ, in <strong>de</strong>r ukrainischen Historiographie als „die Zeit <strong>de</strong>s Ruins“ bekannt. Im historischen Gedächtnis <strong>de</strong>r Polen ist dieser<br />
Konflikt bis heute präsent, die Ukrainer betrachten ihn als <strong>de</strong>n Beginn ihrer nationalen Geschichte: Seine Folgen waren auch in <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen vom En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten<br />
Weltkrieges bis in die 1950er Jahre <strong>de</strong>utlich spürbar und sind bis heute nicht überwun<strong>de</strong>n. Der Anschluss <strong>de</strong>r östlichen Ukraine an Russland begünstigte <strong>de</strong>n Ausbruch erneuter<br />
kriegerischer Handlungen mit Moskau. 1654 erklärte Russland, unter Bruch <strong>de</strong>s „Ewigen Frie<strong>de</strong>ns von 1634“, Polen <strong>de</strong>n Krieg. Im Frühjahr 1655 führte dieser <strong>zu</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng eines<br />
Großteils <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen und <strong>de</strong>r Ukraine durch russisch-saporogkosakische Truppen und <strong>zu</strong>r Erklärung <strong>de</strong>s russischen Zaren Alexei I. <strong>zu</strong>m „Großfürsten von Litauen,<br />
Wolynien und Podolien“.<br />
1655 wur<strong>de</strong> Polen, unter Bruch <strong>de</strong>s Vertrages von Stuhmsdorf, vom Königreich Schwe<strong>de</strong>n im Westen überfallen. Für das Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n gab es mehrere Grün<strong>de</strong>: Eroberung <strong>de</strong>r<br />
polnischen Festung Dünaburg durch russische Truppen an <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong> Schwedisch-Livland, Unterstüt<strong>zu</strong>ng Polens für Schwe<strong>de</strong>ns Erzfeind Dänemark und die Erbansprüche <strong>de</strong>r<br />
katholischen Wasa auf die schwedische Krone, die mit <strong>de</strong>r Abdankung <strong>de</strong>r Königin Christina I. 1654 geltend gemacht wur<strong>de</strong>n. Der Dreißigjährige Krieg hatte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die schwedische<br />
Staatskasse geleert, gleichzeitig musste ein kostspieliges Heer in <strong>de</strong>n eroberten Län<strong>de</strong>rn unterhalten wer<strong>de</strong>n, außer<strong>de</strong>m fühlte sich <strong>de</strong>r protestantische Schwe<strong>de</strong>nkönig durch die<br />
militärischen Erfolge <strong>de</strong>r kosakisch-russischen Truppen in <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik <strong>zu</strong>m Eingreifen ermutigt, um seinen Einfluss an <strong>de</strong>r Ostsee <strong>zu</strong> vergrößern. Sein Plan sah vor, die in ihrer<br />
Ostflanke geschwächte Republik vom Westen, durch das seit <strong>de</strong>m Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 bran<strong>de</strong>nburgische Hinterpommern und vom Nor<strong>de</strong>n her, über das seit 1625 schwedisch<br />
besetzte Livland, <strong>zu</strong> überfallen.<br />
Mit <strong>de</strong>r Durchmarschgenehmigung durch Hinterpommern konnte König Karl X. Gustav Polen an zwei Flanken gleichzeitig angreifen. Sein Vorstoss wur<strong>de</strong> durch die unterschiedliche<br />
Interessenlage <strong>de</strong>r Magnatenhäuser und die militärische Lage <strong>de</strong>r Republik im Osten gegen Russland und die ukrainischen Kosaken begünstigt. Das großpolnische A<strong>de</strong>lsaufgebot<br />
kapitulierte bei Ujście kampflos vor <strong>de</strong>r Streitmacht <strong>de</strong>s Feldmarschalls Arvid Wittenberg und huldigte im Anschluss <strong>de</strong>m Schwe<strong>de</strong>nkönig. Einen Zweifrontenkrieg führend, fielen<br />
nacheinan<strong>de</strong>r die wichtigsten Städte in schwedische Hän<strong>de</strong>, im September Warschau, im Oktober Krakau. Die Russen im Bündnis mit <strong>de</strong>n Kosaken hielten sich auch schadlos, als sie bis<br />
nach Lublin, Puławy und <strong>zu</strong>r Weichsel vordrangen und von <strong>de</strong>r unterworfenen Bevölkerung <strong>de</strong>n Untertaneneid auf Zar Alexei einfor<strong>de</strong>rten.<br />
König Johann Kasimir, vom größten Teil <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls im Stich gelassen, floh nach Schlesien, wo er sich die Hilfe <strong>de</strong>r katholischen Habsburger erhoffte. Diese blieb vorerst aus. Polen<br />
befand sich <strong>zu</strong>m Ausgang <strong>de</strong>s Jahres 1655 <strong>zu</strong>m größten Teil unter schwedisch-russischer Kontrolle. In Litauen stimmten die Adligen, Fürst Janusz Radziwiłł und sein Vetter Bogusław<br />
Radziwiłł, die im Angesicht russischer Erfolge im Großfürstentum Litauen (Beset<strong>zu</strong>ng von Vilnius, Grodno, Mohylew, Minsk, Smolensk … durch russisch-kosakische Truppen) eine
separatistische Politik gegenüber <strong>de</strong>r Polnischen Krone vertraten, einer Union <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen mit Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>, was faktisch <strong>de</strong>n Bruch <strong>de</strong>r Realunion mit Polen be<strong>de</strong>utete.<br />
Die Schwe<strong>de</strong>n waren min<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Zahl, um die eroberten Gebiete über längere Zeit <strong>zu</strong> halten. Zum Signal für die Befreiung wur<strong>de</strong> die Verteidigung <strong>de</strong>s Klosters von Tschenstochau, die<br />
als ein göttliches Wun<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Jungfrau Maria interpretiert wur<strong>de</strong>. Die Vertreter <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls, erschüttert durch das herrenlose Verhalten <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n, wechselten die Fronten und<br />
organisierten sich in <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung von Tyszowce. Überdies überwarf sich <strong>de</strong>r russische Zar Alexei mit <strong>de</strong>m Schwe<strong>de</strong>nkönig Karl Gustav über die Aufteilung <strong>de</strong>r „polnischen<br />
Beute“ und erklärte ihm En<strong>de</strong> Mai 1656 <strong>de</strong>n Krieg, während er mit <strong>de</strong>m polnischen König einen auf zwei Jahre begrenzten Waffenstillstand schloss. Der Schwedisch-Polnische und <strong>de</strong>r<br />
Russisch-Polnische Krieg weiteten sich somit in einen schwedisch-russisch-polnischen Konflikt aus, <strong>de</strong>n „Zweiten Nordischen Krieg“.<br />
Johann Kasimir kehrte Anfang 1656 nach Polen <strong>zu</strong>rück und erhob in Lemberg Maria, die Mutter Jesu, in einem feierlichen Akt <strong>zu</strong>r „Königin Polens“. Das sich wen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kriegsglück<br />
ausnutzend, verwüstete das königliche Heer zahlreiche protestantische Orte, darunter das kulturelle Zentrum Lissa in Großpolen. Die meisten <strong>de</strong>r dort ansässigen Böhmischen Brü<strong>de</strong>r<br />
mussten fliehen, darunter <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Theologe Johann Amos Comenius. Die Vertreibung und Verfolgung <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r aus Polen, während <strong>de</strong>r „Schwedischen Flut“, been<strong>de</strong>te damit die<br />
Epoche <strong>de</strong>r polnischen Toleranz gegenüber <strong>de</strong>n An<strong>de</strong>rsgläubigen, waren doch die Aggressoren allesamt Nicht-Katholiken, die Schwe<strong>de</strong>n/Bran<strong>de</strong>nburger waren Protestanten und die<br />
Russen Orthodoxe.<br />
Durch die Verträge von Königsberg und Marienburg 1656 gewann <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nkönig die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg, <strong>de</strong>r bis dahin Lehnsmann<br />
<strong>de</strong>s polnischen Königs war. Mit <strong>de</strong>m begangenen Lehnsbruch und <strong>de</strong>n Sieg <strong>de</strong>r schwedisch-bran<strong>de</strong>nburgischen Streitmacht über die Truppen <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik in <strong>de</strong>r dreitägigen Schlacht<br />
bei Warschau, erkannte Karl Gustav die Souveränität <strong>de</strong>s von ihm eroberten Herzogtums Preußen im Vertrag von Labiau 1656 an. Den Seitenwechsel <strong>de</strong>s Kurfürsten beantwortete <strong>de</strong>r<br />
polnische König, in<strong>de</strong>m er die Mark Bran<strong>de</strong>nburg <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung durch polnische Truppen und das Gebiet <strong>de</strong>s Herzogtums durch die Krimtataren preisgab (das Khanat <strong>de</strong>r Krim unter<br />
Khan İslâm III. Giray war seit <strong>de</strong>r Allianz <strong>zu</strong> Perejaslaw <strong>de</strong>r Chmielnicki-Kosaken mit Russland 1654 und <strong>de</strong>r im selben Jahr folgen<strong>de</strong>n Invasion <strong>de</strong>r Russen in Polen, ein Verbün<strong>de</strong>ter <strong>de</strong>r<br />
Rzeczpospolita).<br />
Karl Gustav, <strong>de</strong>r im Feldhetman <strong>de</strong>r Krone Stefan Czarniecki einen ebenbürtigen Gegner hatte, sah seine einzige Hoffnung auf einen Sieg über Polen in einer Teilung <strong>de</strong>r Republik und<br />
versuchte durch Einbindung Siebenbürgens, Bran<strong>de</strong>nburgs und Chmielnicki' Fakten <strong>zu</strong> schaffen. Anfang 1657 trat das unter <strong>de</strong>m osmanischen Schutz stehen<strong>de</strong> Fürstentum Siebenbürgen<br />
unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Protestanten Georg II. Rákóczi auf die Seite <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n und verwüstete mit seinem siebenbürgisch-kosakischen Heer (etwa 40.000 Mann) weite Gebiete Polens<br />
im Sü<strong>de</strong>n und Osten. Um ein Übergewicht Schwe<strong>de</strong>ns in Nor<strong>de</strong>uropa <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, verbün<strong>de</strong>ten sich das Königreich Dänemark, das Haus Österreich unter Kaiser Ferdinand von<br />
Habsburg und die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> mit Polen. Das sich ab Mitte <strong>de</strong>s Jahres 1657 diametral wen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kriegsglück Karl Gustavs und Rákóczi's, nahm Kurfürst Friedrich-Wilhelm <strong>zu</strong>m Anlass<br />
Erzherzog Leopold um Vermittlung beim polnischen König <strong>zu</strong> bitten (im Reich stand 1658 eine neue Kaiserwahl an und Leopold brauchte die bran<strong>de</strong>nburgische Kurstimme). Polens<br />
Staatsspitze ging gegen einen bran<strong>de</strong>nburgischen Seitenwechsel und <strong>de</strong>n offenen Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r preußischen Stän<strong>de</strong> auf einen „Han<strong>de</strong>l“ ein. Sie trat in <strong>de</strong>n Verträgen von Wehlau und<br />
Bromberg 1657 die eingeschränkte Souveränität über das Herzogtum Preußen an die Person <strong>de</strong>s Herzogs von Preußen ab.<br />
Reformbewegung, Abdankung <strong>de</strong>s Königs und Aufstieg von Jan Sobieski<br />
Die militärischen Handlungen dauerten bis <strong>zu</strong>m Vertrag von Oliva 1660. Mit ihm wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r langjährige schwedisch-polnische Disput durch ein Frie<strong>de</strong>nstraktat beigelegt. Im Vertrag mit<br />
Schwe<strong>de</strong>n verzichtete Johann Kasimir auf seine Ansprüche auf <strong>de</strong>n schwedischen Thron, Schwedisch-Livland und -Estland im Tausch gegen <strong>de</strong>n territorialen Status quo ante bellum. Der<br />
Herzog von Preußen, in Personalunion auch Kurfürst von Bran<strong>de</strong>nburg, erlangte die „Souveränität“[23] über das Herzogtum Preußen und erwies sich während <strong>de</strong>s Krieges als<br />
militärischer und politischer Machtfaktor. Frankreich übernahm die Garantie <strong>de</strong>r Einhaltung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns. Was blieb war <strong>de</strong>r Mythos von Tschenstochau als einer Arche inmitten <strong>de</strong>r<br />
„Schwedischen Sintflut“, <strong>de</strong>r einen wesentlichen Beitrag <strong>zu</strong>m Machtgewinn <strong>de</strong>s polnischen Katholizismus leistete. Für die späteren Geschicke <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, sollte sich beson<strong>de</strong>rs die<br />
Entscheidung, das Herzogtum Preußen, das spätere Königreich Preußen, aus <strong>de</strong>m polnischen Vasallentum <strong>zu</strong> entlassen, als verhängnisvoll erweisen.<br />
Im Russisch-Polnischen Krieg 1654–1667 wur<strong>de</strong>n die Truppen <strong>de</strong>s Zaren nach 1660 bis <strong>zu</strong>m Dnjepr verdrängt und Reformen <strong>de</strong>s Staatsapparats eingeleitet (u. a. Vivente Rege). Gegend<br />
diese wandte sich Lubomirski. Seine militärischen Siege und <strong>de</strong>r Machtwechsel im Krimkhanat, <strong>de</strong>r die Südgrenze mit Kosakenhetman Doroschenko bedrohte, setzten <strong>de</strong>n Abschluss<br />
eines ungünstigen Waffenstillstands 1667 mit Moskau durch. Damit verlor das Land über ein Viertel (insgesamt 261.500 km²) seines Territoriums und betrug ab 1667 noch 733.500 km².<br />
1668, durch innere und äußere Nie<strong>de</strong>rlagen geplagt, dankte <strong>de</strong>r letzte Wasakönig Johann Kasimir während <strong>de</strong>s Abdikations-Sejms entnervt ab. Er entzog sich dadurch auch seiner
Verantwortung für die ruinöse ökonomische, militärische und sozial-kulturelle Hinterlassenschaft im Lan<strong>de</strong>, durch die Flucht in ein französisches Kloster. Ein Viertel <strong>de</strong>r damaligen<br />
Bevölkerung (bis <strong>zu</strong> vier Millionen Menschen) ging durch Seuchen, Hungersnöte, Plün<strong>de</strong>rungen und Gewalttaten verloren, <strong>zu</strong>sätzliche Bevölkerungsverluste auch durch die<br />
Territorialverluste an Russland und Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen; die Wirtschaft war inoperabel zerrüttet.[24] Polen verlor im Zeitalter <strong>de</strong>r „Blutigen Sintflut“ in Relation <strong>zu</strong>r<br />
Gesamtbevölkerung mehr Menschen als im Zweiten Weltkrieg.<br />
Der Sejm wählte 1669 <strong>de</strong>n Ukrainer Wiśniowiecki <strong>zu</strong>m polnischen König. Vier an<strong>de</strong>re Kandidaten wur<strong>de</strong>n abgelehnt, da die Vertreter <strong>de</strong>s Kleina<strong>de</strong>ls nach schlechten Erfahrungen mit<br />
Auslän<strong>de</strong>rn ihre Stimme einem „Piasten“, das heißt einem einheimischen Kandidaten geben wollten und zwar im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Absichten <strong>de</strong>r a<strong>de</strong>lsrepublikanischen Oligarchen.<br />
Der in <strong>de</strong>r „Rechtsufrigen Ukraine“ bestehen<strong>de</strong> Kriegs<strong>zu</strong>stand gegen Khan Selim I. Giray und Hetman Doroschenko, mün<strong>de</strong>te im Osmanisch-Polnischen Krieg 1672–1676. Im Juni 1672<br />
wur<strong>de</strong> die Festung Kamieniec Podolski von einer bis <strong>zu</strong> 100.000 Mann (mit Tross bis <strong>zu</strong> 200.000 Mann[25]) starken Invasionsstreitmacht türkisch-tatarischer Kriegsveteranen unter <strong>de</strong>m<br />
direkten Kommando Sultan Mehmeds IV. angegriffen und belagert. Nach anfänglichen Siegen für die Polen wur<strong>de</strong> sie im August aufgrund <strong>de</strong>r aussichtslosen Situation und fehlen<strong>de</strong>n<br />
Hoffnung auf Entsatz vom Artilleriekommandanten Hekling, einem Deutschbalten aus Kurland im Dienste <strong>de</strong>r polnischen Krone und einer 800 Mann starken Garnison (vor <strong>de</strong>r Schlacht<br />
waren es fast 1700 Soldaten) in die Luft gesprengt. Durch die Explosion kam auch Jerzy Wołodyjowski ums Leben, <strong>de</strong>r bis heute eine in Polen bekannte historische Persönlichkeit ist. Der<br />
Weg ins Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong> frei. Einer bevorstehen<strong>de</strong>n militärischen Nie<strong>de</strong>rlage, gar einer türkischen Okkupation <strong>de</strong>r Rzeczpospolita <strong>zu</strong>vorkommend, schloss das durch<br />
vorangegangene Kriege ruinierte Staatswesen mit <strong>de</strong>r Regierung <strong>de</strong>s Sultans <strong>de</strong>n Präliminarfrie<strong>de</strong>n von Buczacz. Die osmanische Türkei <strong>de</strong>hnte ihre Herrschaft über weite Teile <strong>de</strong>r<br />
südlichen Ukraine aus, vor allem Podolien (bis 1699 „Eyâlet Podolya“). Der polnische Reichstag weigerte sich <strong>de</strong>n „schändlichen Vertrag“ <strong>zu</strong> ratifizieren, sodass unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s<br />
Großkronhetmans Jan Sobieski die Kriegshandlungen erneuert wur<strong>de</strong>n. Sobieski schlug 1673 die Türken bei Chocim vernichtend in die Flucht. Der Sieg brachte Polen keine<br />
unmittelbaren Vorteile, das Ansehen <strong>de</strong>s Heerführers wuchs in Europa im Beson<strong>de</strong>ren, auch bei <strong>de</strong>n Türken, die Sobieski <strong>de</strong>n Beinamen eines „Löwen aus Lehistan“ gaben. Nach<br />
wechselvollen Kämpfen en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Krieg im Vertrag von Żurawno 1676.<br />
König Wiśniowiecki entschlief 1673. Sobieski wur<strong>de</strong> während <strong>de</strong>s Krieges, dank seiner Popularität und militärischen Verdienste für das Vaterland, als sein Nachfolger per Wahl 1674<br />
bestimmt.<br />
König Jan III. Sobieski<br />
Die sich in einer tiefen politisch-ökonomisch-militärischen Krise befin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> „A<strong>de</strong>lsrepublik“ erlebte am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts noch einmal eine kurze Renaissance <strong>de</strong>r politischen<br />
Macht. Nach <strong>de</strong>m Scheitern Johann Kasimirs und seinem schmählichen Rücktritt, waren die Wasas auf breiter Front diskreditiert. Der <strong>zu</strong>m König bestimmte Michał Korybut<br />
Wiśniowiecki, verstarb nach nur fünf Herrschaftsjahren. Mit <strong>de</strong>m militärisch erfolgreichen Großkronhetman Jan Sobieski, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Unterstüt<strong>zu</strong>ng Frankreichs besaß, wur<strong>de</strong> erneut<br />
ein Pole <strong>zu</strong>m Herrscher gewählt.<br />
Dem neuen König traute man <strong>zu</strong>, <strong>de</strong>n Staat vor <strong>de</strong>r fortwähren<strong>de</strong>n Türkengefahr im Südosten <strong>de</strong>s Reiches endgültig <strong>zu</strong> befreien. Sobieski wandte sich von seinem Bündnispartner<br />
Frankreich ab und schloss im April 1683 einen gegenseitigen Beistandspakt mit <strong>de</strong>n Habsburgern. Dieser sollte sich rasch bewähren, tauchten doch die Türken schon im Sommer<br />
<strong>de</strong>sselben Jahres vor Wien auf. Der von <strong>de</strong>n Österreichern bestochene polnische Reichstag stimmte <strong>de</strong>r Entsendung eines Entsatzheeres <strong>zu</strong>, das wesentlich <strong>zu</strong>m Sieg <strong>de</strong>r alliierten Truppen<br />
in <strong>de</strong>r Schlacht am Kahlenberg beitrug. Weitere Vorstöße im Südosten gegen das osmanisch besetzte Podolien, die Moldau und die Walachei blieben allerdings ohne Erfolg.<br />
Während im polnisch-nationalen Gedächtnis die „Rettung <strong>de</strong>s Abendlan<strong>de</strong>s“ tief verankert ist, blieb im Westen eher die Erinnerung an die späteren Erfolge <strong>de</strong>s Prinzen Eugen von<br />
Savoyen. Die beson<strong>de</strong>re polnische Rolle bei <strong>de</strong>r Schlacht um Wien geriet weitgehend in Vergessenheit, vielleicht auch <strong>de</strong>swegen, weil <strong>de</strong>r Befehlshaber <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-österreichischen<br />
Kontingente, Karl von Lothringen, Jahre <strong>zu</strong>vor bei <strong>de</strong>r polnischen Königswahl an Sobieski gescheitert war.<br />
Polen trat 1684 <strong>de</strong>r durch die Vermittlung von Papst Innozenz XI. gegrün<strong>de</strong>ten Heiligen Liga bei. Zwei Jahre später wur<strong>de</strong> mit Russland, <strong>de</strong>ssen Regentin Sofia Alexejewna war, ein<br />
„Ewiger Frie<strong>de</strong>“ in Moskau geschlossen. Dieser bestätigte die im Vertrag von Andrussowo getroffenen Vereinbarungen, ferner schloss sich Russland <strong>de</strong>r gegen das Osmanische Reich<br />
gerichteten Heiligen Liga an.<br />
Innenpolitisch hingegen erreichte <strong>de</strong>r König seine Ziele nicht. Obwohl er <strong>de</strong>r letzte polnische König von Format war, konnte er we<strong>de</strong>r die Herrschaftsansprüche seiner Familie<br />
durchsetzen – seine Söhne blieben bei <strong>de</strong>r Wahl nach seinem Ableben chancenlos – noch gelang ihm, mangels königlicher Macht im Innern, die „Disziplinierung“ <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>lsstan<strong>de</strong>s.
Dieser opponierte offen gegen ihn, weil er in einem starken Königtum eine Bedrohung seiner En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts von Sobieski' Vorgängern gewährten fast „königlichen Rechte“<br />
sah. Sich <strong>de</strong>r Gefahr bewusst, die von <strong>de</strong>r bran<strong>de</strong>nburgischen Linie <strong>de</strong>s Hauses Hohenzollern für Polen ausging, musste er seine Pläne, Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen, das spätere Königreich<br />
Preußen mit <strong>de</strong>m Zentrum in Berlin, im Bündnis mit <strong>de</strong>m Königreich Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> zerschlagen, aufgrund <strong>de</strong>r dauerhaften Türkenabwehr und litauischer Opposition durch die<br />
Magnatenfamilie Pac, ganz aufgeben.[26] Die einst starke Fö<strong>de</strong>ration aus Polen und Litauen verfiel nach seinem Tod, 1696, <strong>zu</strong>sehends in eine <strong>de</strong> facto <strong>de</strong>zentralisierte Magnaten-<br />
Konfö<strong>de</strong>ration unter <strong>de</strong>r „Präsi<strong>de</strong>ntschaft“ willfähriger, ausländischer Könige, die weniger das Wohl <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s im Auge hatten, als vielmehr die eigene dynastische Machtpolitik.<br />
Von <strong>de</strong>n Katastrophen <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts, <strong>de</strong>m Abbruch <strong>de</strong>r Reformen von Johann Kasimir, <strong>de</strong>n Kämpfen mit <strong>de</strong>n Russen, Schwe<strong>de</strong>n, Bran<strong>de</strong>nburgern, Kosaken, Ungarn, Türken und<br />
Tataren, dann erneut mit Schwe<strong>de</strong>n ab 1700 konnte sich das Land nicht mehr erholen. Es sank <strong>zu</strong>m „Spielball“ neuer europäischer Mächte herab, vor allem Russlands und verfiel langsam<br />
<strong>de</strong>r Deka<strong>de</strong>nz und Agonie. Der polnische Führungsanspruch in <strong>de</strong>r Region ging im Verlauf <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts an die durch <strong>de</strong>n Absolutismus geprägte Monarchien über. Die aus<br />
Kriegen und Okkupationen frem<strong>de</strong>r Soldateska resultieren<strong>de</strong> Kontributionen, Plün<strong>de</strong>rungen und Zerstörungen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s führten <strong>zu</strong>r Verarmung und Verschuldung weiter<br />
Gesellschaftsschichten, auch <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls, was eine Verringerung seines politischen Bewusstseins und Verantwortung <strong>zu</strong>r Folge hatte. Der sukzessive Missbrauch <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Freiheit<br />
durch die nachfolgen<strong>de</strong> A<strong>de</strong>lsgeneration <strong>de</strong>generierte langfristig die „A<strong>de</strong>ls<strong>de</strong>mokratie“, die schließlich im Umfeld eines weitgehend entmachteten Königtums in politischer Anarchie<br />
ausuferte. Die Zeichen <strong>de</strong>s allgemeinen Verfalls äußerten sich durch die dauerhafte Blocka<strong>de</strong> <strong>de</strong>s polnischen Parlaments mittels <strong>de</strong>s Liberum Veto, <strong>de</strong>r Bildung legaler<br />
Wi<strong>de</strong>rstandsbewegungen gegen die Gesamtinteressen <strong>de</strong>s Staates, wenn <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l seine herausgehobene Stellung in Gefahr sah. Im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt stan<strong>de</strong>n die Konfö<strong>de</strong>rationen jedoch<br />
vielfach unter frem<strong>de</strong>n Einfluss ausländischer Botschafter, die so das Land häufig an <strong>de</strong>n Rand eines Bürgerkrieges stürzten. Der Magnatenstand zeigte ein allgemeines Desinteresse an<br />
einem „Starken Staat“ und war vor<strong>de</strong>rgründig mit <strong>de</strong>r Sicherung von privaten Pfrün<strong>de</strong>n, sowie <strong>de</strong>r Pflege eines übertriebenen Stan<strong>de</strong>sdünkels gepaart mit Vetternwirtschaft und<br />
Korruption beschäftigt. Er schwächte <strong>de</strong>n Staatskörper <strong>de</strong>rart, dass er gegen <strong>de</strong>n gleichzeitigen Zugriff dreier absolutistischer Nachbarstaaten, trotz tiefgreifen<strong>de</strong>r Reformen, effektiv kaum<br />
Wi<strong>de</strong>rstand <strong>zu</strong> leisten vermochte und somit am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> existieren aufhörte.<br />
Untergang <strong>de</strong>r Republik und Zeitalter <strong>de</strong>r Teilungen<br />
Haus Wettin<br />
Unter <strong>de</strong>r Sachsenzeit versteht man in Polen die Herrschaftszeit <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Könige aus <strong>de</strong>m Hause Wettin. Es waren August <strong>de</strong>r Starke 1697–1733 und in <strong>de</strong>r Nachfolge sein Sohn August<br />
III. 1733–1763, die Polen in Personalunion mit ihrem heimischen Kurfürstentum Sachsen regierten.<br />
Die Wahlen waren mit finanziellen Mitteln erkauft wor<strong>de</strong>n und nicht unangefochten. Um sich die polnische Krone <strong>zu</strong> sichern, musste <strong>de</strong>r protestantische Kurfürst <strong>zu</strong>m Katholizismus<br />
konvertieren. Polen wur<strong>de</strong> durch die Wettiner in Konflikte und Kriege hineingezogen, an <strong>de</strong>nen es eigentlich gar kein Interesse hatte und die es sich <strong>de</strong> facto auch nicht mehr leisten<br />
konnte, wie <strong>de</strong>n Dritten Nordischen Krieg o<strong>de</strong>r später <strong>de</strong>n Siebenjährigen Krieg. Die innere Schwäche <strong>de</strong>r Republik äußerte sich im religiösen Unfrie<strong>de</strong>n, Intoleranz gegenüber Nicht-<br />
Katholiken (beson<strong>de</strong>rs Protestanten), einem Verfall <strong>de</strong>r Wirtschaft und militärischer Ohnmacht. Den Neutralitätsstatus <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mißachtend, durchquerten fremdländische Armeen<br />
straflos sein Territorium und behan<strong>de</strong>lten es wie etwas, was am Wegesrand lag. Die Triumphe <strong>de</strong>r polnischen Heere gehörten ab da <strong>de</strong>r Vergangenheit an. Die Eroberung Schlesiens durch<br />
König Friedrich von Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen för<strong>de</strong>rte die Entwicklung <strong>de</strong>r Hohenzollernmonarchie <strong>zu</strong> einer europäischen Großmacht. Letzteres erschien unvereinbar mit Polens<br />
potentiellem Wie<strong>de</strong>raufleben. Das „wettinische Polen“ war eines <strong>de</strong>r ersten europäischen Län<strong>de</strong>r, das durch die Person <strong>de</strong>s Königs August das hohenzollernsche „Königreich in Preußen“<br />
staatsrechtlich anerkannte (die Anerkennung <strong>de</strong>s seit 1701 bestehen<strong>de</strong>n preußischen Königstitels und <strong>de</strong>r Stan<strong>de</strong>serhebung <strong>de</strong>s protestantischen Herzogtums Preußen <strong>zu</strong>m Königreich<br />
Preußen durch <strong>de</strong>n polnischen Sejm folgte, unter russischem Druck, allerdings erst 1764.[27][28] die <strong>de</strong>s Kirchenstaates 1787.[29][28][30] da <strong>de</strong>r Papst <strong>de</strong>m „herätischen“ preußischen<br />
König bis dato nur <strong>de</strong>n Titel eines „Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg“ <strong>zu</strong>gestand).<br />
Der Frie<strong>de</strong>nsvertrag <strong>zu</strong> Karlowitz 1699 mit <strong>de</strong>r Hohen Pforte ermöglichte eine Rückkehr Podoliens in <strong>de</strong>n polnischen Reichsverband. Dieser been<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n antiosmanischen Krieg <strong>de</strong>r<br />
Heiligen Liga und im Beson<strong>de</strong>ren die seit 1444 geführten Konflikte Polens mit <strong>de</strong>r Türkei bis auf <strong>de</strong>n heutigen Tag. Er führte gleichzeitig <strong>zu</strong>r politischen Annäherung bei<strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r, im<br />
Angesicht <strong>de</strong>s politisch-militärischen Aufstiegs Russlands, Österreichs und Preußens <strong>zu</strong> kontinentalen Hegemonialmächten.<br />
Die Geschicke <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>n immer stärker von <strong>de</strong>n Hocha<strong>de</strong>lsfraktionen bestimmt, namentlich die Potockis, Czartoryskis und Sapiehas, die nicht nur (teilweise) untereinan<strong>de</strong>r<br />
verfein<strong>de</strong>t waren, son<strong>de</strong>rn sich gegenseitig bekriegt hatten und immer stärker auch finanziell von frem<strong>de</strong>n Mächten abhängig wur<strong>de</strong>n. Die Versuche <strong>de</strong>s Königs, eine absolutistische
Herrschaft <strong>zu</strong> etablieren, mussten vor diesem Hintergrund und <strong>de</strong>m Fehlen einer Hausmacht in Polen scheitern.<br />
Durch die Unterstüt<strong>zu</strong>ng Russlands konnte sich sein Sohn, August III., während <strong>de</strong>s Polnischen Thronfolgekrieges gegen seinen Gegenspieler Stanislaus I. Leszczyński durchsetzen, um<br />
<strong>de</strong>n Preis <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>r politischer Einflussnahme Russlands in Polen. Das Land wur<strong>de</strong> weitgehend durch seinen Günstling Heinrich Graf von Brühl regiert. Gleichzeitig entwickelte sich<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>r Wohlstand beim Gutsa<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>r da<strong>zu</strong> führte, dass man sich auch Fragen einer inneren Reform <strong>de</strong>s Staates stellte. Der Geist <strong>de</strong>r Aufklärung drang nach Polen vor, Ansätze <strong>zu</strong><br />
einer Verbesserung <strong>de</strong>s Bildungssystems wur<strong>de</strong>n gemacht. Beson<strong>de</strong>rs positiv waren die Folgen in <strong>de</strong>r Architektur. Das Bild <strong>de</strong>r Hauptstadt Warschau verän<strong>de</strong>rte sich entschei<strong>de</strong>nd: das<br />
Königsschloss wur<strong>de</strong> großzügig umgebaut, es entstand die Sächsische Achse nach <strong>de</strong>m Vorbild von Versailles mit <strong>de</strong>m Sächsischen Palais und <strong>de</strong>m Sächsischen Garten.<br />
In Erinnerung blieb aber in erster Linie die <strong>de</strong>ka<strong>de</strong>nte Stimmung jener Zeit. Diese schlug sich in zahlreichen Sprichwörtern nie<strong>de</strong>r: Gdy August pił, cała Polska była pijana – „Wenn<br />
August getrunken hatte, war ganz Polen besoffen“ – o<strong>de</strong>r das noch bekanntere Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa – „Unter <strong>de</strong>m Sachsenkönig iss, trink und löse <strong>de</strong>n Gürtel“ –, ein<br />
Symbol für die späte sarmatische A<strong>de</strong>lskultur mit ihren üppigen Festen und <strong>de</strong>m Fehlen je<strong>de</strong>r Art von Verantwortungsbewusstsein. Ein Symbol, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r späteren Konfö<strong>de</strong>ration von<br />
Targowica, einem Paradigma für Lan<strong>de</strong>sverrat, eine Bestätigung fand. Die Sarmaten waren ein iranisches Reitervolk, das während <strong>de</strong>r Antike im südrussischen und ukrainischen<br />
Steppengebiet lebte und von <strong>de</strong>m sich die polnischen Adligen irrtümlich ableiteten. Unter Sarmatismus versteht man das Gefühl völliger persönlicher Freiheit, beim politischen<br />
Konservatismus und Intoleranz, ständischem Dünkel und Abgren<strong>zu</strong>ng gegenüber Nichtadligen.<br />
Die Chancen für grundlegen<strong>de</strong> Reformen, die sich nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Polnischen Thronfolgekrieges 1738 ergaben, wur<strong>de</strong>n vertan. Das Land und mit ihm das „System <strong>de</strong>r<br />
A<strong>de</strong>ls<strong>de</strong>mokratie“ trieben damit nach fast zwei Jahrhun<strong>de</strong>rten endloser Kriege an <strong>de</strong>n Rand <strong>de</strong>s Ruins. Mehrere Anläufe <strong>zu</strong>r Reform und Stärkung <strong>de</strong>r Staatsstrukturen, vor allem seiner<br />
Finanzen, die unabdingbar <strong>zu</strong>m Aufbau und Unterhalt eines <strong>de</strong>r Staatsgröße und <strong>de</strong>r Zeit gerechten Heeres waren, verliefen während <strong>de</strong>r Reichstage <strong>de</strong>r Jahre 1738, 1744, 1746 und 1748<br />
allesamt „im San<strong>de</strong>“. Der Hocha<strong>de</strong>l weigerte sich, neben <strong>de</strong>r natürlichen Angst vor absolutistischen Umtrieben (Verlust <strong>de</strong>r eigenen Macht und Einflusses), sich selbst <strong>zu</strong> besteuern. Die<br />
Institution <strong>de</strong>s Königtums in Polen war <strong>zu</strong> schwach, die Reformen gegen die Partikularinteressen <strong>de</strong>r Magnatengeschlechter (auch) mit Gewalt durch<strong>zu</strong>setzen. Faktisch be<strong>de</strong>utete die im<br />
Stummen Sejm von 1717 fixierte Heeresstärke von 24.000 Mann (effektiv kaum mehr als 10.000 Mann) <strong>de</strong>n militärischen Zusammenbruch Polens. Das viel kleinere Bran<strong>de</strong>nburg-<br />
Preußen unterhielt im gleichen Zeitraum eine Stehen<strong>de</strong> Armee mit bis <strong>zu</strong> 60.000 Mann unter Waffen, <strong>de</strong>r fast 85% <strong>de</strong>r Staatseinnahmen <strong>zu</strong>geführt wur<strong>de</strong>n. Die Republik sank, durch<br />
innere und äußere Faktoren <strong>zu</strong>sätzlich bedingt, nach 1738 für mehr als zwei Jahrhun<strong>de</strong>rte von einem „Subjekt“ <strong>de</strong>r europäischen Gestaltungspolitik auf das Niveau eines „Objekts“ mit<br />
beschränkter Souveränität herab, in absoluter politischer Abhängigkeit <strong>zu</strong> seinen Nachbarn stehend. Vor diesem Hintergrund und durch die militärischen Nie<strong>de</strong>rlagen <strong>de</strong>r<br />
A<strong>de</strong>lskonfö<strong>de</strong>rationen gegen professionelle Heere ausländischer Berufssoldaten eingeschüchtert, blieb <strong>de</strong>m Wahlvolk <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik kaum etwas übrig, als einem realitätsfernem<br />
Pazifismus an<strong>zu</strong>hängen, während die absolutistischen Monarchien bar jedwe<strong>de</strong>r moralischer Be<strong>de</strong>nken und Integrität danach trachteten, ihre Grenzen auf Kosten ihrer Nachbarn <strong>zu</strong><br />
erweitern.<br />
König Stanisław August Poniatowski, Reformbewegung und Teilungen Polens<br />
Der <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> innere Verfall <strong>de</strong>r polnischen A<strong>de</strong>lsrepublik setzte sich auch nach <strong>de</strong>r Wahl Stanislaus August Poniatowskis, eines ehemaligen Liebhabers <strong>de</strong>r Zarin Katharina II., im<br />
Jahre 1764 unvermin<strong>de</strong>rt fort und weckte immer mehr die Begehrlichkeiten <strong>de</strong>r Nachbarn. Der König unternahm vorsichtige Reformbemühungen, zahlreiche Bildungseinrichtungen und<br />
Manufakturen wur<strong>de</strong>n gegrün<strong>de</strong>t. Weitergehen<strong>de</strong> Schritte, wie die komplette Abschaffung <strong>de</strong>s Liberum Veto, scheiterten vor allem am Wi<strong>de</strong>rstand Russlands.<br />
Im Bereich von Kunst und Kultur be<strong>de</strong>utete die Regierungszeit <strong>de</strong>s letzten Königs eine Blütezeit. Beson<strong>de</strong>rs galt dies für die Hauptstadt Warschau. Hier entstan<strong>de</strong>n prunkvolle Bauten und<br />
Parks. Verewigt ist die Atmosphäre jener Jahrzehnte in <strong>de</strong>n Stadtveduten <strong>de</strong>s Venezianers Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, Hofmaler bei Stanislaus August Poniatowski. Auf<br />
Initiative <strong>de</strong>s Königs wur<strong>de</strong> die Zeitschrift Monitor gegrün<strong>de</strong>t. Die Logen <strong>de</strong>r Freimaurer hatten mit Cagliostro und Casanova regen Zulauf. Die Dichter Ignacy Krasicki, Adam<br />
Naruszewicz, Stanisław Trembecki konkurrierten mit Dramatikern Franciszek Zabłocki, Wojciech Bogusławski, Julian Ursyn Niemcewicz. Graf Jan Potocki, Völkerkundler und<br />
Schriftsteller, erhob sich per Heißluftballon über die Stadt, <strong>de</strong>r Pflanzersohn Lewis Littlepage aus Virginia bereiste als königlicher Sekretär und Diplomat die Höfe Europas.<br />
Pläne <strong>zu</strong>r Teilung Polens gab es auch in <strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>zu</strong>vor und immer hatten das Haus Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen und Russland das größte Interesse daran gehabt. Noch lieber hätte es<br />
Russland freilich gesehen, das gesamte Land unter weitgehen<strong>de</strong>r politischer Kontrolle <strong>zu</strong> behalten, wie es seit Jahrzehnten unter <strong>de</strong>m Vorwand <strong>de</strong>s Schutzes <strong>de</strong>r Orthodoxen und <strong>de</strong>r<br />
Protestanten <strong>de</strong>r Fall war. Die Reformansätze <strong>de</strong>s neuen Königs konnten nieman<strong>de</strong>m gefallen, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Schwäche Polens interessiert war. Unter massivem russischen Druck mussten<br />
König Poniatowski und <strong>de</strong>r Sejm 1768 einen „ewigen polnisch-russischen Vertrag“ unterzeichnen, <strong>de</strong>r alles beim Alten beließ und die Königliche Republik faktisch auf die Höhe eines
ussischen Protektorats stellte. Zahlreiche konservative Adlige waren gegen <strong>de</strong>n Vertrag und schlossen sich in einer Wi<strong>de</strong>rstandsorganisation, <strong>de</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration von Bar, <strong>zu</strong>sammen.<br />
Diese richtete sich gegen <strong>de</strong>n prorussischen König Poniatowski, die Reformen im Lan<strong>de</strong> (u. a. politische Gleichstellung <strong>de</strong>r Dissi<strong>de</strong>nten mit <strong>de</strong>n Katholiken), die Beschneidung <strong>de</strong>r<br />
Gol<strong>de</strong>nen Freiheit (u. a. Abschaffung <strong>de</strong>s Liberum Veto), sowie <strong>de</strong>n starken russischen Einfluss in Polen.<br />
Es begann ein vierjähriger Bürgerkrieg, <strong>de</strong>r das Chaos im Lan<strong>de</strong> erneut vertiefte und immer mehr europäische Dimensionen annahm. Der französische König Ludwig XV.[31] und <strong>de</strong>r<br />
türkische Sultan Mustafa III. gingen mit <strong>de</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration eine Allianz ein. Ihr Ziel war die Sicherung <strong>de</strong>r „Republik“ als „barriere <strong>de</strong> l'est“ gegen die russische Expansion. Der Krieg<br />
verlief trotz französischer Militärberater unglücklich. Die Konfö<strong>de</strong>ration hatte hohe Opferzahlen unter <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l <strong>zu</strong> beklagen,[32] das Osmanische Reich nicht min<strong>de</strong>r wenige, mit<br />
Gebietsverlusten an Russland 1774. Um sich ihren Anteil an <strong>de</strong>r „polnischen Beute“ <strong>zu</strong> sichern, waren österreichische und bran<strong>de</strong>nburgisch-preußische Truppen schon seit 1769[33] in<br />
Teilen Polens einmarschiert und hielten sie besetzt. Die Initiative <strong>zu</strong> einer wirklichen Aufteilung ging dabei vom preußischen König Friedrich II. aus. In <strong>de</strong>n Verträgen <strong>de</strong>s Jahres 1772<br />
erhielt Russland die Woiwodschaften Połock, Witebsk, Mścisław und Livland. Weite Teile Kleinpolens und Ruthenien fielen an Österreich. Das mit <strong>de</strong>m Kurfürstentum Bran<strong>de</strong>nburg in<br />
Personalunion regierte Königreich Preußen vereinnahmte das Königliche Preußen mit <strong>de</strong>m Fürstbistum Ermland und Teile <strong>de</strong>r Woiwodschaften Inowrocław und Gnesen. Insgesamt verlor<br />
Polen bei <strong>de</strong>r ersten Teilung knapp 200.000 km² mit 4,5 Millionen Einwohnern. Es blieben ihm 527.000 km² mit 7 Millionen Menschen.<br />
Diese Ereignisse brachten führen<strong>de</strong> Köpfe <strong>de</strong>s Staates da<strong>zu</strong>, noch intensiver über innere Reformen nach<strong>zu</strong><strong>de</strong>nken. Man vereinbarte eine grundlegen<strong>de</strong> Reform <strong>de</strong>r Staatsfinanzen, eine<br />
Mo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r Armee (Aufbau und Finanzierung eines 100.000 Mann starken Stehen<strong>de</strong>n Heeres) und <strong>de</strong>s Bildungswesens durch die Gründung <strong>de</strong>r „Kommission für das nationale<br />
Erziehungswesen“. Noch weitergehen<strong>de</strong> Schritte nahm man am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1780er Jahre in Angriff, als <strong>de</strong>r Vierjährige Sejm mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>zu</strong>sammentrat, eine neue Verfassung <strong>zu</strong><br />
verabschie<strong>de</strong>n. Diese Konstitution, die eine Erbmonarchie unter <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Wettiner vorsah, ging als die Verfassung vom 3. Mai 1791 in die Geschichte ein, und war die erste mo<strong>de</strong>rne<br />
Verfassung Europas, die zweite überhaupt nach <strong>de</strong>n USA, und sah neben einer Teilung und Verschränkung <strong>de</strong>r Gewalten auch das Prinzip <strong>de</strong>r Volkssouveränität vor, wenn auch <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r wichtigste Stand bleiben sollte.<br />
Der Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r alten Teilungsmächte gegen diese Verän<strong>de</strong>rungen wuchs allerdings. Das Königreich Preußen suchte, obwohl seit 1790 in einer gegen das Russische Reich gerichteten<br />
Defensivallianz sogar mit Polen verbün<strong>de</strong>t war, erneut die Nähe Russlands. Dieses hatte konservative Adlige ermutigt, sich in <strong>de</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration von Targowica <strong>zu</strong>sammen<strong>zu</strong>schließen,<br />
die vom russischen Militär unterstützt wur<strong>de</strong>. Der Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r antireformatorischen Kräfte und die russische Intervention <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng ihrer Vasallen in Polen, erzwangen 1792<br />
abermals einen Russisch-Polnischen Krieg. Die überstürzte Kapitulation <strong>de</strong>s Königs und <strong>de</strong>ssen Beitritt <strong>zu</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration von Targowica, trug nun <strong>zu</strong> einer weiteren Teilung <strong>de</strong>s<br />
revolutionären Polen' zwischen Russland und Preußen 1793 bei, in <strong>de</strong>r alle Gebiete östlich <strong>de</strong>r Linie Dünaburg – Chocim an Russland; Großpolen, Westmasowien sowie die Städte Danzig<br />
und Thorn an Preußen fielen. Der Annexionen bei<strong>de</strong>r Aggressoren hatte sich das Land im letzten a<strong>de</strong>lsrepublikanischen Sejm, <strong>de</strong>m Sejm von Grodno, durch militärischen Nachdruck <strong>zu</strong><br />
fügen. Es verblieb ein polnischer Rumpfstaat mit 240 000 km² und 3,5 Millionen Einwohnern.<br />
In ihm brach ein Jahr später ein nationaler Aufstand aus, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>m Offizier Ta<strong>de</strong>usz Kościuszko angeführt wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r Jahrzehnte <strong>zu</strong>vor erfolgreich im Amerikanischen<br />
Unabhängigkeitskrieg und im Russisch-Polnischen Krieg 1792 gekämpft hatte. Zum ersten Mal han<strong>de</strong>lte es sich um einen echten Volksaufstand. Kościuszko proklamierte sich selbst <strong>zu</strong>m<br />
„Diktator“ und hoffte auf auswärtige Hilfe. Die Kämpfe, die von wenigen kampferprobten Soldaten und einem Heer mit umgeschmie<strong>de</strong>ten Kriegssensen bewaffneter Bauern geführt<br />
wur<strong>de</strong>n, waren <strong>zu</strong>nächst unerwartet erfolgreich, etwa in <strong>de</strong>r Schlacht bei Racławice nördlich von Krakau. Die militärische Übermacht von Preußen und Russen setzte sich aber doch<br />
durch. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Maciejowice südlich von Warschau unterlag im Oktober 1794 das Hauptaufgebot mit Kościuszko an <strong>de</strong>r Spitze, <strong>de</strong>r schwer verwun<strong>de</strong>t in die Gefangenschaft<br />
geriet. Dass er im Augenblick seiner Verwundung Finis Poloniae! gerufen habe, ist eine spätere Legen<strong>de</strong>, sie trifft jedoch <strong>de</strong>n Kern, da in jenem Augenblick das Schicksal Polens besiegelt<br />
war. Der Schlacht bei Maciejowice folgen<strong>de</strong> Kampf um die polnische Hauptstadt, in <strong>de</strong>m es <strong>zu</strong> Pogromen gegen die Zivilbevölkerung durch das russische Militär kam, war <strong>de</strong>r<br />
Kościuszko-Aufstand endgültig gescheitert.<br />
Mit <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n dritten Teilung, in <strong>de</strong>r Russland alle litauischen und ruthenischen Gebiete östlich von Bug und Memel, Österreich das restliche Kleinpolen mit Krakau und<br />
Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen das restliche Masowien mit Warschau und Teile Litauens erhielt, waren Polen und Litauen, unter Bruch aller bestehen<strong>de</strong>r völkerrechtlichen Staatsverträge zwischen<br />
<strong>de</strong>r Republik und <strong>de</strong>n Teilungsmächten, für über 100 Jahre von <strong>de</strong>r politischen Landkarte Europas verschwun<strong>de</strong>n. Die endgültige Teilungskonvention, geschlossen in Sankt Petersburg<br />
1797, wur<strong>de</strong> um ein geheimes Zusatzabkommen ergänzt:<br />
„Im Angesicht <strong>de</strong>r Notwendigkeit alles ab<strong>zu</strong>schaffen, das die Erinnerung an das Bestehen <strong>de</strong>s Königreichs Polen wie<strong>de</strong>rbeleben könnte…, stimmen die <strong>de</strong>n Vertrag abschließen<strong>de</strong>n
Parteien überein…, niemals ihre Titel um <strong>de</strong>n Namen o<strong>de</strong>r Wür<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Königreichs Polen <strong>zu</strong> ergänzen, welches von heute und für alle Zeit unterdrückt bleiben soll!“<br />
Der letzte Souverän <strong>de</strong>r Rzeczpospolita, König Stanislaus August Poniatowski, starb, nach erzwungener Abdankung durch die Okkupanten, unerwartet 1798 in Sankt Petersburg. Vom<br />
katastrophalen Ausgang <strong>de</strong>r polnischen Staatlichkeit profitierte hingegen auch eine vierte Partei, die Erste Französische Republik, die das innere Staatsgefüge in <strong>de</strong>n Wirren <strong>de</strong>r<br />
Französischen Revolution konsolidieren konnte, während Polen zwischen 1792 und 1795 beträchtliche Kräfte und Aufmerksamkeit <strong>de</strong>r absolutistischen Großmächte Mittel- und<br />
Osteuropas auf sich zog.<br />
1795–1914: Fremdherrschaft<br />
Polen in <strong>de</strong>n Koalitionskriegen 1795–1815<br />
Die nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r polnischen Staatlichkeit verbliebenen Aufständischen und Oppositionellen setzten ihre Hoffnungen auf das revolutionäre Frankreich. Auf <strong>de</strong>ssen Anregung<br />
entstand bis 1797 in Oberitalien eine 6000 Mann starke Polnische Legion unter General Jan Henryk Dąbrowski, die auf Seiten Napoleons bis <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Lunéville 1801 kämpfte,<br />
ohne ihrem eigentlichen Ziel näher <strong>zu</strong> kommen. Statt <strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong>n die polnischen Soldaten wegen <strong>de</strong>r Jakobinernähe ihrer polnischen Offiziere vom nach absoluter Macht streben<strong>de</strong>n<br />
Napoleon im Kampf gegen Aufständische auf Haiti eingesetzt, wo sie mehrheitlich durch Tropenkrankheiten <strong>de</strong>zimiert wur<strong>de</strong>n. Was blieb, war <strong>de</strong>r Siegeswille <strong>de</strong>r Legionäre, <strong>de</strong>r sich im<br />
Text <strong>de</strong>s Lie<strong>de</strong>s Józef Wybickis von 1797 manifestierte: „Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben“, und weiter „Marsch, marsch, Dąbrowski, von Italien nach Polen“ (seit 1918<br />
die Nationalhymne Polens).<br />
Gleichzeitig versuchten polnische Adlige am Petersburger Hof, wie <strong>de</strong>r beim Zaren <strong>zu</strong> Einfluss gelangte Fürst Adam Jerzy Czartoryski, die Lage im russischen Teilungsgebiet <strong>zu</strong> mil<strong>de</strong>rn,<br />
was durch eine größere Freiheit beson<strong>de</strong>rs im Bildungswesen zeitweise auch gelang, außenpolitisch jedoch keine Erfolge zeigte, da Russland nicht <strong>zu</strong> einem Krieg gegen Preußen bereit<br />
war. Die französischen Kriegserfolge <strong>de</strong>s Jahres 1806 bewogen einige Polen erneut auf die Karte Napoleon <strong>zu</strong> setzen und einen bewaffneten Aufstand im polnischen Südpreußen <strong>zu</strong><br />
wagen. Durch die Schwäche Preußens und <strong>de</strong>n Vormarsch <strong>de</strong>r Gran<strong>de</strong> Armée hatte die Erhebung Erfolg.<br />
Napoleon, <strong>de</strong>r bei seinem Einmarsch in Warschau am 19. Dezember 1806 nach <strong>de</strong>m Sieg über Preußen wie ein Befreier gefeiert wur<strong>de</strong>,[34][35][36][37] dachte allerdings an Stärkung und<br />
Auffüllung seines Heeres für <strong>de</strong>n <strong>zu</strong>künftigen Kampf gegen Russland. Er erklärte sich jedoch da<strong>zu</strong> bereit, im Rahmen <strong>de</strong>s Tilsiter Frie<strong>de</strong>ns, aus <strong>de</strong>m das Königreich Preußen geschwächt<br />
herausging, ein relativ kleines Herzogtum Warschau <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>ssen Spitze <strong>de</strong>r sächsische Kurfürst Friedrich August gestellt wur<strong>de</strong>. Statt <strong>de</strong>r erwarteten Bestätigung <strong>de</strong>r Mai-<br />
Verfassung, wur<strong>de</strong> lediglich, <strong>de</strong>m französischen Vorbild folgend, das „Statut conventionnel“ erlassen, sodass die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> politische Rolle <strong>de</strong>m französischen Resi<strong>de</strong>nten in<br />
Warschau <strong>zu</strong>fiel.<br />
Trotz politischer Schwierigkeiten wuchs das Engagement <strong>de</strong>r polnischen Bevölkerung für <strong>de</strong>n neuen Staat. Dies galt beson<strong>de</strong>rs für das auf französischer Seite kämpfen<strong>de</strong> Militär, <strong>de</strong>m es<br />
1809 gelang Teile Kleinpolens von Österreich <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern, das im Österreichisch-Polnischen Krieg unter Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich-Este als erster <strong>de</strong>r drei alten<br />
Teilungsmächte versuchte das neuentstan<strong>de</strong>ne polnische Staatswesen <strong>zu</strong> ersticken. Aus diesen Grün<strong>de</strong>n war auch die polnische Bereitschaft hoch, sich massiv am Russlandfeld<strong>zu</strong>g 1812<br />
Napoleons <strong>zu</strong> beteiligen. Mit über 100.000 Mann, bei ungefähr 4 Millionen Einwohnern, stellten die Polen aus <strong>de</strong>m Herzogtum das größte Kontingent nach <strong>de</strong>n Franzosen und kämpften<br />
im Winter 1812–1813 an <strong>de</strong>r Seite Frankreichs in Russland. Nur wenige Tausend kehrten anschließend in ihre Heimat <strong>zu</strong>rück. Aufgrund <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage Napoleons und seiner Gran<strong>de</strong><br />
Armée, besetzte Russland rasch große Teile <strong>de</strong>s schutzlosen Herzogtums inklusive <strong>de</strong>r Hauptstadt Warschau und legte <strong>de</strong>m okkupierten Land Kontributionen auf.<br />
Die endgültige Entscheidung über die Zukunft Polens fiel auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress von 1815, als die Grenzen <strong>de</strong>r Teilungen bestätigt und lediglich die Position Preußens <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r<br />
Russlands geschwächt wur<strong>de</strong>. Preußen musste die in <strong>de</strong>r dritten Teilung erworbenen Gebiete weitgehend aufgeben. Das bis 1809 österreichische Krakau wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Freien Stadt erklärt.<br />
Das Herzogtum Warschau wur<strong>de</strong> um die Provinz Posen verkleinert, die an Preußen <strong>zu</strong>rückfiel. Der Rest wur<strong>de</strong> als „Königreich Polen“ mit eigener Verfassung und Autonomie ausgestattet<br />
und in Personalunion mit <strong>de</strong>m Russischen Reich vereinigt. Die Existenz einer polnischen Nation wur<strong>de</strong> von allen europäischen Großmächten anerkannt. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren gelang<br />
es, die soziale Umstrukturierung <strong>de</strong>r Gesellschaft voran<strong>zu</strong>bringen, die die Grundlagen für die Entstehung einer <strong>de</strong>mokratischen polnischen Nation aller Stän<strong>de</strong> schuf.<br />
Die französische Zeit hinterließ ein ausgezerrtes „Rumpf-Polen“. Zu lange setzte die polnische Führung (beson<strong>de</strong>rs Fürst Poniatowski) auf Napoleon. Während sich 1813 fast ganz<br />
Europa gegen Napoleon gestellt hatte, waren die Polen das einzige europäische Volk, das <strong>de</strong>m Despoten noch in <strong>de</strong>r Völkerschlacht bei Leipzig die Treue hielt, während die restlichen
französischen Verbün<strong>de</strong>ten vor allem aus <strong>de</strong>m Rheinbund und die sächsischen Regimenter überliefen. Weil <strong>de</strong>r russische Zar in <strong>de</strong>r Frage eines souveränen Polens <strong>zu</strong> keinen<br />
Konzessionen bereit war, befand sich Fürst Poniatowski und sein Volk in einer schwierigen Situation. Mit <strong>de</strong>m Sturz Napoleons durch die Teilungsmächte und das Vereinigte Königreich,<br />
brach für die Polen etwas mehr als ein Jahrhun<strong>de</strong>rt Fremdherrschaft an. Der polnische Nationalstaat war von <strong>de</strong>r europäischen Landkarte verschwun<strong>de</strong>n (endgültig nach <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>r<br />
Verfassung „Kongreßpolens“ 1831) und die polnische Kultur und Sprache wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Teil unterdrückt.<br />
Zeit <strong>de</strong>r Aufstän<strong>de</strong> 1815–1864<br />
Auf lange Sicht gesehen war die polnische Nation nach <strong>de</strong>n Wiener Beschlüssen von 1815 nicht bereit, <strong>de</strong>n Status quo <strong>zu</strong> akzeptieren. Die katholische Kirche wuchs aufgrund ihrer<br />
beibehaltenen Strukturen immer stärker in die Rolle einer Bewahrerin <strong>de</strong>r Traditionen hinein.<br />
Die politische Entwicklung seit 1815 war durch eine eher gemäßigte Unterdrückung durch <strong>de</strong>n Zaren und seinen Warschauer Statthalter Novosilcov geprägt. Damit waren aber viele<br />
Jüngere, geprägt vom Geist <strong>de</strong>r polnischen Romantik und ihrer Hel<strong>de</strong>n wie Adam Mickiewicz und Juliusz Słowacki, nicht <strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>n. Die Nachricht von Revolutionen in Paris und in<br />
Belgien im Jahre 1830 ließ auch eine kleine Gruppe von Warschauer Verschwörern <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Waffen greifen. Am 28. November <strong>de</strong>sselben Jahres brach <strong>de</strong>r Aufstand gegen die russische<br />
Bevormundung aus, <strong>de</strong>r jedoch keine konkreten politischen Zielvorstellungen hatte. Aufgrund <strong>de</strong>r zögerlichen russischen Reaktion gelangen <strong>zu</strong>nächst einige Erfolge, die <strong>de</strong>n im<br />
Dezember <strong>zu</strong>sammengetretenen Sejm da<strong>zu</strong> bewogen, die Dynastie <strong>de</strong>r Romanows für abgesetzt <strong>zu</strong> erklären. Im Laufe <strong>de</strong>s Jahres 1831 behielt Russland in <strong>de</strong>r massiven militärischen<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng aber die Oberhand, auch <strong>de</strong>swegen, weil die Aufständischen <strong>zu</strong> keinen weitergehen<strong>de</strong>n Schritten in <strong>de</strong>r Bauernfrage bereit waren.<br />
Der Novemberaufstand war in ganz Europa äußerst populär, beson<strong>de</strong>rs in Deutschland, wo die entstehen<strong>de</strong> Polenbegeisterung auch nach <strong>de</strong>m Scheitern <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>m Einsetzen<br />
<strong>de</strong>r „Großen Emigration“ <strong>zu</strong>nächst weiter bestand und <strong>zu</strong>r Entstehung von Solidaritätskomitees und „Polenlie<strong>de</strong>rn“ führte, <strong>de</strong>ren Höhepunkt das sog. „Hambacher Fest“ im Jahre 1832<br />
war, wo <strong>de</strong>utsche und polnische nationale Bestrebungen auf eindrucksvolle Weise miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Im russischen Teilungsgebiet selbst wur<strong>de</strong> die Son<strong>de</strong>rstellung <strong>de</strong>r Polen<br />
nun massiv eingeschränkt. Jetzt wur<strong>de</strong> in Teilen <strong>de</strong>r Verwaltung mit <strong>de</strong>r Russifizierung begonnen und das polnischsprachige Bildungssystem geschwächt. Zu einem neuen Zentrum <strong>de</strong>r<br />
polnischen Politik wur<strong>de</strong> das Hôtel Lambert in Paris, wohin viele be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Politiker geflohen waren und wo mit <strong>de</strong>n „Konservativen“ und <strong>de</strong>n „Demokraten“ die bei<strong>de</strong>n Hauptlager<br />
entstan<strong>de</strong>n.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r Unterdrückung im russischen Teilungsgebiet wandte sich das Hauptaugenmerk für einen erneuten Aufstand <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n Regionen <strong>zu</strong>. Für Anfang 1846 wur<strong>de</strong> eine<br />
gesamtpolnische Erhebung geplant, die ihren Schwerpunkt aber im preußischen Posen und <strong>de</strong>r Freien Stadt Krakau haben sollte. Der Posener Plan wur<strong>de</strong> jedoch verraten und die<br />
Verschwörer mit ihrem Kopf Ludwik Mierosławski verhaftet. Die Bestrebungen im österreichischen Teilungsgebiet wur<strong>de</strong>n nur halbherzig durchgeführt. Parallel da<strong>zu</strong> brach aber dort ein<br />
Bauernaufstand aus, <strong>de</strong>r sich vor allem gegen die polnischen Landadligen richtete und von <strong>de</strong>n Behör<strong>de</strong>n teilweise unterstützt wur<strong>de</strong>. Dieser extrem grausame Bürgerkrieg führte in nur<br />
zwei Monaten <strong>zu</strong> über 1000 Toten. Krakau, das vorübergehend in polnischer Hand war, wur<strong>de</strong> schließlich von österreichischen Truppen besetzt und 1846 in die Donaumonarchie<br />
inkorporiert. Aufgrund dieses völligen Scheiterns war es um so überraschen<strong>de</strong>r, dass die polnische Frage zwei Jahre später in Preußen wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einem beherrschen<strong>de</strong>n Thema wur<strong>de</strong>.<br />
Im preußischen Teilungsgebiet waren die Jahre seit 1815 vor allem geprägt durch die 1823 durchgeführte endgültige Bauernbefreiung. Die <strong>zu</strong>nächst relativ gemäßigte Politik gegenüber<br />
<strong>de</strong>n Polen wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Amtsantritt <strong>de</strong>s neuen Oberpräsi<strong>de</strong>nten Eduard Heinrich von Flottwell En<strong>de</strong> 1830 <strong>zu</strong>nehmend antipolnisch, vor allem in <strong>de</strong>r Bildungs- und <strong>de</strong>r Kirchenpolitik.<br />
Seit Beginn <strong>de</strong>r 1840er Jahre schien sich unter <strong>de</strong>m neuen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. eine liberalere Polenpolitik an<strong>zu</strong><strong>de</strong>uten, bis die Aufstandspläne von 1846 und <strong>de</strong>r<br />
große Berliner Polenprozess eine erneute Wen<strong>de</strong> einleiteten. Die Märzrevolution <strong>de</strong>s Jahres 1848 führte auch <strong>zu</strong>m Wie<strong>de</strong>rentstehen polnischer Organisationen in <strong>de</strong>r preußischen Provinz<br />
Posen. Man erwartete das Ausbrechen eines Krieges gegen das reaktionäre Russland. Mitunter arbeiteten <strong>de</strong>utsche und polnische Demokraten eng <strong>zu</strong>sammen. Der Krieg kam jedoch<br />
nicht, <strong>de</strong>r preußische König überwand seine zeitweilige Schwäche und die nationalen Spannungen im Lan<strong>de</strong> nahmen <strong>zu</strong>. Den Aufständischen gelang es nicht, die preußische militärische<br />
Übermacht <strong>zu</strong> besiegen. Dass die Stimmung <strong>de</strong>s Jahres 1848 nicht mehr <strong>de</strong>r von 1832 entsprach, zeigte schließlich die dreitägige Polen<strong>de</strong>batte <strong>de</strong>r Frankfurter Nationalversammlung im<br />
Juli 1848 sehr <strong>de</strong>utlich. Nur noch wenige traten für die Rechte <strong>de</strong>r Polen ein, die national-konservativen Kräfte setzten sich endgültig durch. Letztes Aufflackern war die <strong>de</strong>mokratische<br />
Revolution in Ba<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>ren militärischer Spitze 1849 Mierosławski stand. An <strong>de</strong>n europäischen Revolutionen <strong>de</strong>r Jahre 1848/1849 hatten auch an an<strong>de</strong>ren Stellen Polen mitgekämpft,<br />
etwa General Josef Bem in Österreich und Ungarn. Keinen Aufstandsversuch gab es aber im russischen Teilungsgebiet, wo <strong>de</strong>r Statthalter Ivan Paskevič die Zügel fest in <strong>de</strong>r Hand hielt.<br />
Erst die russische Nie<strong>de</strong>rlage im Krimkrieg 1855 und <strong>de</strong>r Amtsantritt <strong>de</strong>s neuen Zaren Alexan<strong>de</strong>rs II. weckte neue Hoffnungen. Es entwickelten sich nun ernst<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Pläne einer<br />
engen polnisch-russischen Zusammenarbeit unter <strong>de</strong>m gemäßigten Adligen Aleksan<strong>de</strong>r Wielopolski, <strong>de</strong>r 1862 <strong>zu</strong>m Chef einer nur aus Polen bestehen<strong>de</strong>n Zivilregierung ernannt wur<strong>de</strong>.
Die Demokraten dagegen sahen sich durch die Einigungsbestrebungen Italiens wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> revolutionären Taten veranlasst und begannen im Januar 1863 einen bewaffneten Aufstand, <strong>de</strong>n<br />
Januaraufstand, in <strong>de</strong>m es allerdings nicht gelang, Unterstüt<strong>zu</strong>ng aus an<strong>de</strong>ren europäischen Staaten <strong>zu</strong> erhalten. Die verschie<strong>de</strong>nen gesellschaftlichen Absichten <strong>de</strong>r polnischen<br />
Emigration, das Fehlen einer schlagkräftigen militärischen Führung im Lan<strong>de</strong> und die vergeblichen Versuche, auch die Bauern <strong>zu</strong> mobilisieren, brachten auch diesen Aufstand <strong>zu</strong>m<br />
Scheitern. Die massiven Vergeltungsmaßnahmen <strong>de</strong>r Russen, Enteignungen und Deportationen nach Sibirien, führten da<strong>zu</strong>, dass <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l nun seine beherrschen<strong>de</strong> Kraft innerhalb <strong>de</strong>r<br />
polnischen Gesellschaft verlor, die I<strong>de</strong>en <strong>de</strong>r Romantik waren endgültig gescheitert.<br />
„Organische Arbeit“ und polnische Nationalbewegung 1864–1914<br />
Das Scheitern <strong>de</strong>r Aufstän<strong>de</strong> führte in allen drei Teilungsgebieten <strong>zu</strong> neuen Überlegungen bei <strong>de</strong>n Eliten, die immer mehr vom Bürgertum gestellt wur<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>m passiven Wi<strong>de</strong>rstand<br />
vor allem im russischen Teil erwuchs <strong>de</strong>r Wille, <strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>n Russifizierung und Germanisierung aus eigener Kraft Herr <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n, ohne immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Aufstän<strong>de</strong>n greifen <strong>zu</strong><br />
müssen. Man favorisierte das Konzept einer langsamen, evolutionären Entwicklung <strong>de</strong>r eigenen Fähigkeiten in <strong>de</strong>n Bereichen Wirtschaft, Bildung o<strong>de</strong>r Kultur, das mit <strong>de</strong>m Schlagwort<br />
„organische Arbeit“ bezeichnet wur<strong>de</strong>. Ausgedacht wur<strong>de</strong>n diese Überlegungen von einer neuen Generation von Publizisten und Schriftstellern, die sich vor allem in Warschau<br />
versammelten. Sie grün<strong>de</strong>ten unter an<strong>de</strong>rem die „Fliegen<strong>de</strong>n Universitäten“, bei <strong>de</strong>ren heimlichen Treffen die sozialen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Probleme ihrer Zeit<br />
diskutiert wur<strong>de</strong>. In Anlehnung an das Hauptwerk „Positive Philosophie“ <strong>de</strong>s französischen Philosophen Auguste Comte nannten sich diejenigen, die <strong>de</strong>r Bewegung angehörten,<br />
Positivisten. Zu ihr gehörte auch die Wissenschaftlerin Marie Curie, geb. Skłodowska.<br />
Im Rahmen dieses kulturellen Nationalkampfes spielte die Rückbesinnung auf die Vergangenheit eine große Rolle, als Polen die drei Teilungsmächte zeitweise dominiert o<strong>de</strong>r – wie vor<br />
Wien 1683 – gerettet hatte. Der Krakauer Historienmaler Jan Matejko schuf zahlreiche patriotisch-motivierte Gemäl<strong>de</strong>,[38] die bei <strong>de</strong>r Bewahrung einer kulturellen I<strong>de</strong>ntität Polens in <strong>de</strong>n<br />
123 Jahren <strong>de</strong>r Teilung eine wichtige Rolle spielten.[39] Darunter sein berühmtestes Bild, die 1878 entstan<strong>de</strong>ne Schlacht bei Grunwald, das <strong>de</strong>n Triumph <strong>de</strong>r Polen über das Ritterheer <strong>de</strong>s<br />
Deutschen Or<strong>de</strong>ns im Jahr 1410 feiert.<br />
Auch die patriotische Literatur jener Zeit orientierte sich an <strong>de</strong>r Geschichte. Wichtig waren hier unter an<strong>de</strong>rem die Historienromane von Henryk Sienkiewicz, <strong>de</strong>r in seinem 1900<br />
erschienenen Buch Krzyżacy (dt.: Die Kreuzritter) in Anlehnung an Matejkos Werk von <strong>de</strong>r Schlacht bei Grunwald erzählt. Auch populäre Mythen und Geschichten wie die Erlebnisse<br />
<strong>de</strong>s Michał Drzymała o<strong>de</strong>r die Hymne „Rota“ <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Schriftstellerin Maria Konopnicka mit ihren anti<strong>de</strong>utschen bzw. antipreussischen Zeilen spielten im Nationalkampf eine<br />
wichtige Rolle.<br />
Wie inspirierend und mobilisierend <strong>de</strong>r politische Mythos von Grunwald auf die unterdrückte polnische Bevölkerung wirkt, zeigte sich im Juli 1910, als <strong>zu</strong>r Fünfhun<strong>de</strong>rtjahrfeier <strong>de</strong>r<br />
Schlacht 150.000 Menschen <strong>zu</strong>sammenkamen – die größte nationale Kundgebung während <strong>de</strong>r gesamten Teilungszeit. Da das Schlachtfeld selbst <strong>zu</strong>m Deutschen Reich gehörte, fand die<br />
Veranstaltung im galizischen Krakau statt, wo die österreichisch-ungarische Regierung eine wesentlich liberalere Kulturpolitik betrieb.[40]<br />
„Kulturkampf“ und Folgen: preußisches Teilungsgebiet<br />
In Preußen wur<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Amtsantritt <strong>de</strong>s neuen Ministerpräsi<strong>de</strong>nten Otto von Bismarck die Bestrebungen einer vollständigen Integration auch <strong>de</strong>r mehrheitlich polnisch bewohnten<br />
Lan<strong>de</strong>steile (Teile Westpreußens, <strong>de</strong>r Provinz Posen und Oberschlesiens) verstärkt. Seine Politik begann sich in <strong>de</strong>n 1860er Jahren beson<strong>de</strong>rs gegen <strong>de</strong>n dortigen A<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>n<br />
katholischen Klerus in allen Teilen Preußens <strong>zu</strong> richten. Nach <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s Deutschen Reiches 1871 wur<strong>de</strong>n die Germanisierungsbestrebungen noch verstärkt. Da<strong>zu</strong> zählte die<br />
stufenweise Abschaffung <strong>de</strong>s Polnischen als Unterrichtssprache an Oberschulen. Darüber hinaus fan<strong>de</strong>n massive Schritte gegen <strong>de</strong>n katholischen Klerus im Zuge <strong>de</strong>s Kulturkampfs ihren<br />
Nie<strong>de</strong>rschlag, die <strong>zu</strong>gleich auch im katholischen Westfalen, im Rheinland und in Bayern erfolgten (unter an<strong>de</strong>rem Aufhebung <strong>de</strong>r geistlichen Schulaufsicht). Gera<strong>de</strong> die letztgenannten<br />
Aktionen bewirkten aber genau das Gegenteil <strong>de</strong>s Gewünschten, weil die bisher national eher passiven polnischen Bauern – <strong>zu</strong>m Teil in Kooperation mit Katholiken aus <strong>de</strong>m Sü<strong>de</strong>n und<br />
Westen <strong>de</strong>s Kaiserreichs – für ihren katholischen Glauben <strong>zu</strong> kämpfen begannen.<br />
In Westpreußen und in <strong>de</strong>r Provinz Posen scheiterte <strong>de</strong>r Versuch einer weiteren „Germanisierung <strong>de</strong>s Bo<strong>de</strong>ns“ durch Aufkauf polnischen Lan<strong>de</strong>s ebenso wie die Bemühungen, neue<br />
<strong>de</strong>utsche Siedler ins Land <strong>zu</strong> locken. Hauptgrund war die landwirtschaftliche Prägung, die im Zeitalter <strong>de</strong>r Industriellen Revolution nur geringe Aussichten auf Wohlstand versprach.<br />
Deutsche und Polen wan<strong>de</strong>rten gleichermaßen aus West-/Ostpreußen und Posen in das Ruhrgebiet und das oberschlesische Industrierevier ab. Organisationen wie <strong>de</strong>r „Ostmarkenverein“
verschärften die Antagonismen noch mehr und führten <strong>zu</strong> Gegengründungen polnischer Vereine.<br />
Die Ausweisungen mehrerer zehntausend Polen russischer Staatsangehörigkeit in <strong>de</strong>n Jahren 1885–1886 brachten auch die internationale öffentliche Meinung gegen das Deutsche Reich<br />
auf. Gegen die <strong>de</strong>utsche Unterrichtssprache gab es gut organisierte und effektive Schulstreiks, <strong>de</strong>ssen bekanntester in Wreschen im Jahre 1901 auch internationales Aufsehen erregte.<br />
Auch eine zwischenzeitlich betriebene liberalere Politik unter Reichskanzler Caprivi konnte an diesen längerfristigen Aktionen nichts än<strong>de</strong>rn. Im Ergebnis ging <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Deutschen<br />
bzw. Deutschsprachigen in <strong>de</strong>r Provinz Posen von 1871 bis 1910 von 44 auf 38 Prozent <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Polen stieg vice versa von 56 auf 62 Prozent.<br />
Am wirtschaftlichen Aufschwung <strong>de</strong>s Kaiserreichs partizipierten freilich auch die Polen. Der sich anbahnen<strong>de</strong> beschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Wohlstand hatte auch Initiativen <strong>zu</strong>r Volksbildung <strong>zu</strong>r Folge,<br />
die wie<strong>de</strong>rum gut als Teil <strong>de</strong>r „organischen Arbeit“ genutzt wer<strong>de</strong>n konnten. Durch eine gewisse Rechtssicherheit für <strong>de</strong>n Einzelnen und die Möglichkeit parlamentarischer Mitwirkung,<br />
<strong>zu</strong>m Beispiel über die Partei <strong>de</strong>r Polen im Reichstag, wur<strong>de</strong>n Strukturen geschaffen, die nach 1918 im polnischen Staat von Nutzen waren. Das war ein wesentlicher Unterschied <strong>zu</strong>m<br />
zaristischen Russland, in <strong>de</strong>m es diese Rechtssicherheit nicht gab und teilweise nicht einmal Religionsfreiheit herrschte. Eine beson<strong>de</strong>re Rolle innerhalb <strong>de</strong>s preußischen Staates spielte<br />
die oberschlesische Industrieregion, die in jenen Jahren ähnlich <strong>de</strong>m Ruhrgebiet <strong>zu</strong> einem riesigen Wachstumsgebiet wur<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>m sich jedoch gleichzeitig die <strong>de</strong>utsch-polnischen<br />
nationalen Spannungen immer heftiger <strong>zu</strong> entla<strong>de</strong>n begannen. Die bei<strong>de</strong>n Industriezentren zogen auch Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> von Arbeitskräften an, was <strong>zu</strong>m hohen Anteil von Polen an <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung <strong>de</strong>s Ruhrgebiets führte. Im Ruhrgebiet integrierten sich die polnischen Zuwan<strong>de</strong>rer (Ruhrpolen) rasch in die ortsansässige Bevölkerung.<br />
Situation in Galizien<br />
Die Bedingungen für eine Weiterentwicklung polnischer Strukturen waren im österreichischen Teilungsgebiet am günstigsten. Nach<strong>de</strong>m Österreich in Oberitalien, im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
italienischen Einigungskriege, Risorgimento, En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1850er Jahre schwere Rückschläge hinnehmen musste und anschließend <strong>de</strong>n Kampf im Deutschen Krieg gegen Preußen um die<br />
Vorherrschaft im Deutschen Bund 1866 verloren hatte und <strong>zu</strong><strong>de</strong>m im Rahmen <strong>de</strong>r Österreichisch-Ungarischen Verständigung <strong>de</strong>n internen Ausgleich mit <strong>de</strong>m Königreich Ungarn<br />
durchführte, sah man sich auch in Galizien veranlasst, die Zügel <strong>zu</strong> lockern.<br />
Der Kaiser von Österreich, Franz Joseph I., erlaubte die Polonisierung <strong>de</strong>s Schulwesens und <strong>de</strong>r Verwaltung, in an<strong>de</strong>ren Bereichen gewährte man ebenfalls wachsen<strong>de</strong>n polnischen<br />
Einfluss, so dass ab 1867 eine <strong>de</strong> facto Autonomie Galiziens bestand, was jedoch die Missbilligung <strong>de</strong>r Preußen und Russen heraufbeschwor. Die polnisch dominierte Autonomie<br />
berücksichtigte allerdings nicht die Sprache und Kultur <strong>de</strong>r in Ostgalizien beheimateten Ukrainer.<br />
Einen wichtigen Einfluss auf das geistige Leben übten die Universitäten von Krakau und Lemberg aus, an <strong>de</strong>nen eine ganze Reihe polnischer Wissenschaftler ausgebil<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n. Im<br />
Gegen<strong>zu</strong>g sicherte das polnische konservative Lager <strong>de</strong>m Haus Habsburg-Lothringen seine volle Loyalität <strong>zu</strong> und vertrat diese auch personell und i<strong>de</strong>ell am Wiener Hof. Problematisch<br />
blieb in <strong>de</strong>r strukturschwachen Region die Lage <strong>de</strong>r ländlichen Bevölkerung und <strong>de</strong>r größtenteils nicht assimilierten Ju<strong>de</strong>n. Auch <strong>de</strong>shalb entstan<strong>de</strong>n bald populistische Bewegungen <strong>de</strong>r<br />
Bauern, die die Grundlagen für die in <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit mächtigen Bauernparteien legten. Das liberale geistige Klima am Vorabend <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges ermöglichte auch die<br />
Aufstellung paramilitärischer Verbän<strong>de</strong>, die für die Wie<strong>de</strong>rerlangung <strong>de</strong>r Unabhängigkeit kämpfen sollten. Es fehlte <strong>zu</strong>nächst aber ein klares und allgemein unterstütztes politisches<br />
Konzept für die weitere Entwicklung.<br />
Lage im russischen Kongresspolen („Weichselland“)<br />
Im russischen Teilungsgebiet waren nach <strong>de</strong>m gescheiterten Januaraufstand die Verwaltungsstrukturen völlig russifiziert wor<strong>de</strong>n, als Привислинский Край, Privislinsky Krai bzw.<br />
Weichselland. Die Verwendung <strong>de</strong>r polnischen Sprache in Zeitungen, Büchern und Kirchen war untersagt. Seit 1885 durfte in <strong>de</strong>n Schulen außer in <strong>de</strong>n Fächern Polnisch und Religion nur<br />
russisch unterrichtet wer<strong>de</strong>n. Die Bezeichnung „Polen“ verschwand aus <strong>de</strong>r zaristischen Verwaltung.<br />
Nach<strong>de</strong>m die alten Wege gescheitert waren und die Entwicklung <strong>de</strong>r „organischen Arbeit“ eine gewisse Zeit brauchte, führten die umfangreichen <strong>de</strong>mographischen und ökonomischen<br />
Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r zweiten Jahrhun<strong>de</strong>rthälfte auch <strong>zu</strong>m Entstehen sozialistischer Bewegungen. Die 1892 in Paris gegrün<strong>de</strong>te „Polnische Sozialistische Partei“, die im Jahre darauf auch<br />
im Weichselland tätig wur<strong>de</strong>, geriet unter ihrem faktischen Anführer Józef Piłsudski in gemäßigteres Fahrwasser und vertrat etwa seit <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> die Parole „Durch<br />
Unabhängigkeit <strong>zu</strong>m Sozialismus“.<br />
Parallel da<strong>zu</strong> gab es terroristische Anschläge, die die russische Polizei nicht <strong>zu</strong>r Ruhe kommen ließen. Demgegenüber schlossen sich die internationalistischeren, klassenkämpferischen
Kräfte unter <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Anführern Julian Balthasar Marchlewski und Rosa Luxemburg <strong>zu</strong>r „Sozial<strong>de</strong>mokratie <strong>de</strong>s Königreichs Polen und Litauen“ <strong>zu</strong>sammen und suchten die<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>n russischen Sozialisten. Auf <strong>de</strong>r rechten Seite <strong>de</strong>s Parteienspektrums etablierte sich die „Liga Narodowa“ (Nationale Liga), die mit ihrer nationalistischen,<br />
antisemitischen und prorussischen Orientierung einen an<strong>de</strong>ren Weg <strong>zu</strong>r nationalen Selbständigkeit suchte und polnische Autonomie „unter <strong>de</strong>m Zepter <strong>de</strong>s Zaren“ anstrebte. Ihr <strong>de</strong>m<br />
Panslawismus nahestehen<strong>de</strong>r Anführer Roman Dmowski war bis in die 1930er Jahre <strong>de</strong>r Hauptwi<strong>de</strong>rsacher Piłsudskis. Während Dmowski schon um 1908 in einer Buchpublikation[41]<br />
für eine Aus<strong>de</strong>hnung Polens nach Westen plädiert hatte und sich bereits 1914 mit <strong>de</strong>r russischen Regierung darauf verständigt hatte, die <strong>zu</strong>künftige Ostgrenze Polens gegenüber Russland<br />
durch Anwendung <strong>de</strong>s ethnographischen Prinzips fest<strong>zu</strong>legen,[42] wollte Piłsudski die polnischen Staatsgrenzen unter Berufung auf die Staatsgrenzen <strong>de</strong>s 1772 untergegangenen<br />
litauisch-polnischen Staatenbunds weit über das ethnographische Polen hinaus nach Osten vorschieben. Zunehmen<strong>de</strong> politische Be<strong>de</strong>utung gewann in <strong>de</strong>n ländlichen Gebieten die<br />
Bauernbewegung unter Wincenty Witos.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts spitzte sich die politische Lage in Teilen <strong>de</strong>s russischen Weichsellan<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>. Der Beginn <strong>de</strong>s Russisch-Japanischen Krieges durch <strong>de</strong>n Überfall <strong>de</strong>r Japaner<br />
auf die russische Pazifikflotte bei Port Arthur am 8. Februar 1904 verstärkte die Hoffnungen auf einen Zusammenbruch <strong>de</strong>s Russischen Reiches. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres fan<strong>de</strong>n in<br />
Warschau und an<strong>de</strong>ren Städten Demonstrationen gegen die Rekrutierung von Polen für die russische Armee statt, an <strong>de</strong>r sich erstmals kleinere polnische Kampfverbän<strong>de</strong> Piłsudskis<br />
beteiligten. Diese Trupps verübten in dieser Zeit auch verschie<strong>de</strong>ne politische Attentate, Raubüberfälle etc. Im Februar 1905 wur<strong>de</strong>n Schulstreiks organisiert, die <strong>zu</strong> Erfolgen wie <strong>de</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>lassung <strong>de</strong>r polnischen Sprache im Unterricht führten. Auch im religiösen und wirtschaftlichen Bereich musste die russische Regierung infolge <strong>de</strong>s Krieges Konzessionen<br />
machen. Die gewalttätigen Arbeiterproteste in Russland mit ihrem Höhepunkt im Petersburger Blutsonntag vom 9. Januarjul./ 22. Januar 1905greg. griffen allmählich auch auf die<br />
Ostseeprovinzen und Kongresspolen über. Im Juni kam es in Łódź, <strong>de</strong>m industriellen Zentrum <strong>de</strong>s Weichsellan<strong>de</strong>s, <strong>zu</strong> Barrika<strong>de</strong>nkämpfen, die viele Opfer for<strong>de</strong>rten.<br />
Die sich abzeichnen<strong>de</strong> russische Nie<strong>de</strong>rlage und die inneren Unruhen, während <strong>de</strong>r Russischen Revolution von 1905, verschärften die Krise <strong>zu</strong>nächst weiter, auch wenn Zar Nikolaus II.<br />
am 30. Oktober in seinem Oktobermanifest politische Reformen ankündigte. Weitergehen<strong>de</strong> Versuche <strong>zu</strong>r Machterlangung in Warschau gingen jedoch nur noch von <strong>de</strong>r PPS aus, da die<br />
National<strong>de</strong>mokraten nun <strong>zu</strong>nächst die neue russische Regierung von Pjotr Stolypin unterstützten und konservativ-klerikale Kreise von Papst Pius X. <strong>zu</strong>r Zurückhaltung aufgefor<strong>de</strong>rt<br />
wur<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren ging die russische Führung jedoch erneut auf Konfrontationskurs in allen Nationalitätenfragen, so dass sich auch für die Polen praktisch keine politischen<br />
und gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten boten.<br />
1914–1918: Polen im Ersten Weltkrieg<br />
Der 1914 ausgebrochene Erste Weltkrieg brachte die Frage <strong>de</strong>r Revision <strong>de</strong>r polnischen Teilungen wie<strong>de</strong>r auf die europäische Tagesordnung. Allerdings erschien es <strong>zu</strong>nächst als äußerst<br />
unwahrscheinlich, dass die Teilungsmächte aus <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt – das Königreich Preußen (1871 aufgegangen im Deutschen Kaiserreich), das Haus Österreich (1867 aufgegangen in<br />
Österreich-Ungarn) und das Russische Reich – geschlossen als Verlierer aus <strong>de</strong>m Krieg hervorgehen wür<strong>de</strong>n.<br />
Die Einziehung von Millionen von Polen in die Armeen <strong>de</strong>r kriegführen<strong>de</strong>n Parteien stellt neben <strong>de</strong>m Teilungstrauma eine weitere, historisch wenig beachtete Nationaltragödie <strong>de</strong>s<br />
polnischen Volkes dar, kämpften nun die „<strong>de</strong>utsch-österreichischen“ Polen gegen ihre Landsleute aus <strong>de</strong>m von Russland besetzten Teil Polens. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> das polnische Territorium<br />
bald <strong>zu</strong>m Hauptkriegsschauplatz im Osten. Die Beset<strong>zu</strong>ng weiter Teile Galiziens durch die russische Armee führte <strong>zu</strong> einer großen Fluchtwelle <strong>de</strong>r Bevölkerung nach Westen. Darunter<br />
befan<strong>de</strong>n sich beson<strong>de</strong>rs viele Ju<strong>de</strong>n, die Angst vor erneuten Pogromen unter russischer Herrschaft hatten. Die Gegenoffensive <strong>de</strong>r Mittelmächte im Sommer 1915 verän<strong>de</strong>rte die Lage<br />
jedoch erneut, da sie bis <strong>zu</strong>m Winter <strong>zu</strong>m Rück<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Russen aus ganz Kongresspolen führte. Das eroberte Territorium wur<strong>de</strong> in ein <strong>de</strong>utsches Generalgouvernement Warschau und ein<br />
österreichisches mit Sitz in Lublin eingeteilt.<br />
Regentschaftskönigreich Polen<br />
Die Politik in Berlin war sich in Be<strong>zu</strong>g auf die Zukunft Polens nicht einig. Während die einen, unterstützt von Generalgouverneur Hans von Beseler ein autonomes polnisches Königreich<br />
Polen befürworteten, plädierten die an<strong>de</strong>ren wie etwa Erich Lu<strong>de</strong>ndorff für einen Verständigungsfrie<strong>de</strong>n mit Russland und eine Rückkehr <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Vorkriegsgrenzen. Während<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong><br />
in Posen <strong>de</strong>r polnische Oberste Volksrat gegrün<strong>de</strong>t. Erst danach und nach <strong>de</strong>m endgültigen Scheitern <strong>de</strong>r Blitzkriegstrategie entschloss man sich <strong>zu</strong> einem Angebot an Polen, auch um<br />
mehr polnische Soldaten für die eigenen Reihen <strong>zu</strong> gewinnen. Mit <strong>de</strong>m Akt vom 5. November 1916 proklamierten <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Kaiser Wilhelm II. und <strong>de</strong>r österreichische Kaiser Franz<br />
Joseph die Errichtung eines Königreichs Polen in <strong>de</strong>n bisher <strong>zu</strong> Russland gehören<strong>de</strong>n Gebieten, das sich politisch und militärisch eng an die Mittelmächte anlehnen sollte. In Berlin plante
man jedoch weiterhin Gebietsannexionen auf Kosten dieses Staates, <strong>de</strong>ssen Grenzen nie genau festgelegt wur<strong>de</strong>n. Kurz danach sprachen sich auch <strong>de</strong>r russische Zar Nikolaus II. (am 25.<br />
Dezember 1916), und <strong>de</strong>r US-Präsi<strong>de</strong>nt Woodrow Wilson (am 22. Januar 1917) für die Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>s unabhängigen polnischen Staates aus, wobei nur die Vorstellungen <strong>de</strong>s<br />
letzteren sich <strong>de</strong>n polnischen Interessen und Wünschen bezüglich <strong>de</strong>s Territoriums <strong>de</strong>s künftigen polnischen Staates näherten.<br />
Im österreichischen Teilungsgebiet waren unmittelbar nach Kriegsbeginn polnische Legionen unter k.u.k.-Oberbefehl aufgestellt wor<strong>de</strong>n, die aus <strong>de</strong>n paramilitärischen<br />
Schützenverbän<strong>de</strong>n Józef Piłsudskis hervorgingen. Diese Einheiten umfassten im Sommer 1916 etwa 25.000 Mann und kämpften vor allem gegen Russland. Nach <strong>de</strong>m Akt vom 5.<br />
November wur<strong>de</strong>n die Legionen <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Oberbefehl unterstellt, aus ihnen sollte 1917 die Polnische Wehrmacht hervorgehen. Ein Teil <strong>de</strong>r Briga<strong>de</strong>n weigerte sich jedoch im Juli<br />
1917, <strong>de</strong>n Eid auf einen imaginären polnischen König sowie <strong>zu</strong>r Treue gegenüber <strong>de</strong>n Kaisern von Deutschland und Österreich <strong>zu</strong> leisten, und wur<strong>de</strong> infolge <strong>de</strong>ssen entwe<strong>de</strong>r entwaffnet<br />
und inhaftiert o<strong>de</strong>r direkt in <strong>de</strong>utsche Truppenteile einbezogen. Piłsudski selber wur<strong>de</strong> ebenfalls verhaftet und in die Festung Mag<strong>de</strong>burg gebracht. Am 18. September 1917 wur<strong>de</strong> die<br />
oberste Staatsgewalt formell auf einen neu eingerichteten dreiköpfigen Regentschaftsrat übertragen, <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m Warschauer Erzbischof Aleksan<strong>de</strong>r Kakowski, <strong>de</strong>m Magnaten Fürst<br />
Zdzisław Lubomirski und <strong>de</strong>m ebenfalls adligen früheren Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Polenklubs <strong>de</strong>r russischen Duma Józef Ostrowski bestand.<br />
Die weiteren Planungen wur<strong>de</strong>n in erster Linie durch <strong>de</strong>n Zusammenbruch <strong>de</strong>s Russischen Reiches nach <strong>de</strong>r Februarrevolution und <strong>de</strong>r Oktoberrevolution 1917 bestimmt. Die<br />
Reichsführung mit <strong>de</strong>r OHL an <strong>de</strong>r Spitze glaubte nun an einen raschen Sieg und weitere territoriale Gewinne im Osten. Im „Brotfrie<strong>de</strong>n“ mit <strong>de</strong>r neu entstan<strong>de</strong>nen Volksrepublik Ukraine<br />
vom 9. Februar 1918 in Brest Litowsk – nicht <strong>zu</strong> verwechseln mit <strong>de</strong>m späteren Frie<strong>de</strong>n von Brest-Litowsk mit Sowjetrussland – wur<strong>de</strong> dieser ein Teil polnischen Staatsgebietes, die<br />
Region um Chełm <strong>zu</strong>gesichert. Schon die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Militärbehör<strong>de</strong>n für einen unabhängigen Staat Litauen mit Vilnius als Hauptstadt hatte im Dezember 1917<br />
Empörung in Polen ausgelöst. Erschwerend hin<strong>zu</strong> kam die Requirierung von Rohstoffen und Lebensmitteln sowie die Verschleppung polnischer Zwangsarbeiter ins Reich wegen <strong>de</strong>ssen<br />
immer schwierigeren ökonomischen Lage.<br />
Als sich <strong>de</strong>r Zusammenbruch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Westfront ab<strong>zu</strong>zeichnen begann, waren sich alle politischen Lager Polens darin einig, mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng von US-Präsi<strong>de</strong>nt Wilson so schnell<br />
wie möglich die eigene Unabhängigkeit <strong>zu</strong> erreichen. Da<strong>zu</strong> trugen auch polnische Soldaten bei, die auf Seiten Frankreichs kämpften. Die im Juni 1917 ins Leben gerufene Blaue Armee<br />
unter General Józef Haller, etwa 70.000 Mann (Freiwillige, ehemalige Kriegsgefangene etc.), wur<strong>de</strong> u. a. in <strong>de</strong>r Champagne eingesetzt.<br />
1918–1939: Zweite Republik<br />
Konsolidierung <strong>de</strong>s neuen Staates<br />
Anfang <strong>de</strong>s Jahres 1918 verlangten die Mittelmächte in Brest-Litowsk von Russland die „Unabhängigkeit“ für Polen, dabei wur<strong>de</strong>n Polens Grenzen von Deutschland und Österreich enger<br />
als 1772 gezogen. Nach<strong>de</strong>m das Deutsche- und das Österreichische Kaiserreich <strong>de</strong>n Krieg verloren hatten, und das Russische Reich im Chaos <strong>de</strong>s Russischen Bürgerkriegs versank,<br />
erlangten die Polen, auch durch die politische Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Westmächte, ihre volle staatliche Souveränität <strong>zu</strong>rück. Am 7. Oktober 1918 proklamierte <strong>de</strong>r Regentschaftsrat in<br />
Warschau einen unabhängigen polnischen Staat und übernahm fünf Tage später die Befehlsgewalt über die Armee. Nach <strong>de</strong>n Bestimmungen <strong>de</strong>s Versailler Vertrags wur<strong>de</strong> Polen 1919 eine<br />
international anerkannte und unabhängige Republik.<br />
Bereits im November 1918 hatte <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Mag<strong>de</strong>burger Haft entlassene Józef Piłsudski in Warschau als „Vorläufiges Staatsoberhaupt“ die Macht übernommen. Er berief einen<br />
verfassunggeben<strong>de</strong>n Sejm ein, <strong>de</strong>r eine <strong>de</strong>mokratische Verfassung ausarbeiten und verabschie<strong>de</strong>n sollte. Die ersten Jahre <strong>de</strong>r Unabhängigkeit vergingen mit <strong>de</strong>m inneren Aufbau <strong>de</strong>s<br />
Staates. Die bestehen<strong>de</strong>n staatlichen Strukturen, welche die drei verschie<strong>de</strong>nen Teilungsmächte hinterlassen hatten, mussten vereinheitlicht, teilweise aber auch völlig neu geschaffen<br />
wer<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m war das Land weitgehend vom Krieg verwüstet, wie auch seine Grenzen in weiten Teilen nicht festgelegt waren.<br />
Als 1921 die neue Verfassung verabschie<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r nur ein schwacher Präsi<strong>de</strong>nt vorgesehen war, verzichtete Piłsudski auf die Ausübung dieses Amtes und zog sich ins Privatleben<br />
<strong>zu</strong>rück. Die Jahre bis 1926 waren innenpolitisch somit von mehreren aufeinan<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>n parlamentarischen Regierungen dominiert. Zum ersten offiziellen Präsi<strong>de</strong>nten Polens wur<strong>de</strong><br />
1922 Gabriel Narutowicz, ein Vertreter <strong>de</strong>r gemäßigten Linken, gewählt. Narutowicz wur<strong>de</strong> jedoch wenige Tage nach seiner Amtseinführung von einem nationalistischen Fanatiker<br />
ermor<strong>de</strong>t. Zu seinem Nachfolger wählte das Parlament <strong>de</strong>n gemäßigten Sozialisten Stanisław Wojciechowski. Da die Mehrheitsverhältnisse im polnischen Parlament, <strong>de</strong>m Sejm, sehr<br />
instabil waren, wechselten sich die Regierungen häufig ab und waren teilweise sehr schwach.
Polen entwickelte ab 1921 gute Beziehungen <strong>zu</strong> Großbritannien und Frankreich, die an Polen als strategischem Bündnispartner interessiert waren und <strong>de</strong>n Bau eines neuen Hafens in<br />
Gdingen finanzierten. Aus <strong>de</strong>m Fischerdorf mit 1000 Einwohnern wur<strong>de</strong> in wenigen Jahren ein Groß- und Militärhafen mit über 100.000 Einwohnern. Weil Gdingen mit <strong>de</strong>m Danziger<br />
Hafen konkurrierte und Polen gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>r Danziger Regierung ein polnisches Munitionslager auf <strong>de</strong>r Westerplatte durchsetzte, kam es <strong>zu</strong> Spannungen mit <strong>de</strong>r Freien Stadt<br />
Danzig. Der Zugang <strong>zu</strong> Ostpreußen vom restlichen Deutschen Reich war per verplombtem Korridor<strong>zu</strong>g von Konitz bis Dirschau durch das polnische Gebiet auf <strong>de</strong>r Ostbahn o<strong>de</strong>r per<br />
Schiff, durch <strong>de</strong>n Seedienst Ostpreußen möglich.<br />
Konflikte mit <strong>de</strong>n Nachbarn<br />
Aufgrund von unklaren Grenzverläufen <strong>de</strong>s neuen polnischen Staates kam es <strong>zu</strong> Konflikten mit <strong>de</strong>n Nachbarn.<br />
Deutschland<br />
Mit Deutschland gab es zwischen 1919 und 1921 Kämpfe vor allem um <strong>de</strong>n Besitz Oberschlesiens. Die Abstimmung am 20. März 1921 ergab eine Mehrheit von fast 60 % für <strong>de</strong>n<br />
Verbleib bei Deutschland. Allerdings zeigte sich, dass es dabei erhebliche regionale Unterschie<strong>de</strong> gegeben hatte, so dass in einigen Gebieten das pro-polnische Votum überwog. Polnische<br />
Freischärler begannen daraufhin am 3. Mai 1921, unterstützt von französischen Besat<strong>zu</strong>ngstruppen – Italiener und Briten stellten sich auf die <strong>de</strong>utsche Seite –, einen bewaffneten<br />
Aufstand, um <strong>de</strong>n Anschluss <strong>de</strong>s östlichen Teils Oberschlesiens an Polen gewaltsam durch<strong>zu</strong>setzen. Die Alliierten wollten vorher nur <strong>de</strong>n Landkreis Pleß an Polen anschließen. Das<br />
Deutsche Reich konnte aufgrund <strong>de</strong>r Beschränkungen durch <strong>de</strong>n Versailler Vertrag und aufgrund <strong>de</strong>r Intervention <strong>de</strong>r anglo-französischen Sieger nicht gegen die Freischärler vorgehen,<br />
trotz<strong>de</strong>m kam es <strong>zu</strong> einigen blutigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen Deutschen und Polen. Mit Billigung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Regierung versuchten Freikorps gewaltsam <strong>de</strong>n Anschluss an<br />
Polen <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn. Am 23. Mai 1921 gelang <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Freikorps <strong>de</strong>s „Selbstschutzes Oberschlesien“ die Erstürmung <strong>de</strong>s St. Annabergs, <strong>de</strong>r stärksten Befestigung <strong>de</strong>r Polen,<br />
wodurch eine Stabilisierung <strong>de</strong>r Lage eintrat. Am 20. Oktober 1921 beschloss <strong>de</strong>r Oberste Rat <strong>de</strong>r Alliierten, nach einer Empfehlung <strong>de</strong>s Völkerbun<strong>de</strong>s, das ostoberschlesische<br />
Industrierevier an Polen <strong>zu</strong> übertragen, <strong>de</strong>m es als Autonome Woiwodschaft Schlesien angeschlossen wur<strong>de</strong>. Beim Deutschen Reich verblieb <strong>de</strong>r zwar flächen- und bevölkerungsmäßig<br />
größere, jedoch eher agrarisch strukturierte Teil <strong>de</strong>s Abstimmungsgebiets – Industriestädte wie Beuthen OS, Gleiwitz o<strong>de</strong>r Hin<strong>de</strong>nburg OS blieben weiter <strong>de</strong>utsch.<br />
Die Provinzen <strong>de</strong>s Königreichs Preußen, Westpreußen und Posen, die durch die Teilungen Polens an Preußen kamen, wur<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Weimarer Republik herausgelöst und ohne Plebiszite<br />
<strong>de</strong>r neuen Republik einverleibt. Polen bekam dadurch einen Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee bei Gdingen. Einen Teil <strong>de</strong>r Gebiete hatte polnisches Militär im Großpolnischen Aufstand bereits <strong>zu</strong>vor<br />
militärisch besetzt. Die alte Hansestadt Danzig wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Freien Stadt Danzig erklärt und verblieb mit Nut<strong>zu</strong>ngsrechten Polens am Danziger Hafen außerhalb <strong>de</strong>r Grenzen <strong>de</strong>s neuen<br />
polnischen Staates unter <strong>de</strong>r Aufsicht <strong>de</strong>s Völkerbun<strong>de</strong>s. Für weitere Gebiete sah <strong>de</strong>r Versailler Vertrag Volksabstimmungen über die Staats<strong>zu</strong>gehörigkeit vor. In Masuren<br />
(Regierungsbezirk Allenstein) und im Regierungsbezirk Marienwer<strong>de</strong>r (ehemals Westpreußen) fan<strong>de</strong>n unter alliierter Aufsicht Volksabstimmungen statt, in <strong>de</strong>nen sich die große Mehrheit<br />
<strong>de</strong>r Bevölkerung (98 % bzw. 92 %) für <strong>de</strong>n Verbleib bei Ostpreußen und Deutschland entschied.<br />
Im Osten<br />
Die polnischen territorialen Bestrebungen stießen auch im Osten auf erheblichen Wi<strong>de</strong>rstand. Wegen <strong>de</strong>r nicht ein<strong>de</strong>utig abgrenzbaren Siedlungsgebiete verschie<strong>de</strong>ner Völker gab es hier<br />
sich überschnei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Gebietsansprüche, vor allem mit <strong>de</strong>n Ukrainern und <strong>de</strong>n Litauern. Eine Woche nach <strong>de</strong>r polnischen Unabhängigkeitserklärung, riefen auch die Ukrainer in Lemberg<br />
ihre Unabhängigkeit aus, was <strong>de</strong>n Polnisch-Ukrainischen Krieg um das ehemalige habsburgische Königreich Galizien und Lodomerien auslöste. Beson<strong>de</strong>rs heftige Kämpfe wur<strong>de</strong>n um<br />
Lemberg geführt, das polnische Freiwilligenverbän<strong>de</strong> und reguläre Armeeteile am 21. November einnahmen. Der Krieg dauerte militärisch jedoch bis in <strong>de</strong>n März 1919 an und wur<strong>de</strong> erst<br />
durch ein Abkommen zwischen Polen und <strong>de</strong>r Volksrepublik Ukraine unter Symon Petljura am 21. April 1920 offiziell been<strong>de</strong>t.<br />
Der mit <strong>de</strong>m Versailler Vertrag ins Leben gerufene Völkerbund sah die Ziehung einer Grenzlinie aufgrund <strong>de</strong>r im Dezember 1919 vorgelegten Empfehlungen einer Kommission unter<br />
Leitung <strong>de</strong>s britischen Außenministers Curzon vor, durch die mehrheitlich polnischsprachige Gebiete um Vilnius in Litauen und Lemberg in Galizien <strong>de</strong>m polnischen Staat verloren gehen<br />
wür<strong>de</strong>n. Die weitergehen<strong>de</strong>n Pläne Piłsudskis zielten <strong>zu</strong><strong>de</strong>m auf die Wie<strong>de</strong>rerrichtung einer Republik unter polnischer Führung in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r 1795 untergegangen A<strong>de</strong>lsrepublik, <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>r auch mehrheitlich von Ukrainern und Weißrussen bewohnte Gebiete gehören sollten. Polnische Truppen besetzten daher 1919 <strong>de</strong>n östlichen Teil Litauens um Vilnius, das seine<br />
Unabhängigkeit gera<strong>de</strong> gegen Russland durchgesetzt hatte, ebenso vorübergehend Kiew in <strong>de</strong>r Ukraine, was aufgrund <strong>de</strong>r Überschneidung mit <strong>de</strong>n territorialen Ansprüchen
Sowjetrusslands <strong>zu</strong>m Polnisch-Sowjetischen Krieg führte.<br />
Polnisch-Sowjetischer Krieg<br />
Zunächst drangen die polnischen Truppen unter General Rydz-Śmigły mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch nationalukrainische Kräfte bis nach Kiew vor. Der schnelle Erfolg war durch das<br />
Ausweichen <strong>de</strong>r sowjetischen Truppen begünstigt, die nach <strong>de</strong>r Eroberung Kiews durch die Polen eine Gegenoffensive starteten. Die sowjetischen Einheiten unter General<br />
Tuchatschewski drangen bis Warschau vor, während General Budjonny Lemberg belagerte. Durch ein waghalsiges Zangenmanöver gelang <strong>de</strong>r polnischen Armee unter Piłsudskis<br />
Kommando <strong>de</strong>r Durchbruch und eine nahe<strong>zu</strong> vollständige Vernichtung <strong>de</strong>r sowjetischen Einheiten: Während die polnischen Einheiten versuchten, die Armee von General Tuchatschewski<br />
bei Radzymin nordöstlich von Warschau auf<strong>zu</strong>halten, startete Piłsudski vom Fluss Wieprz in <strong>de</strong>r Woiwodschaft Lublin eine Großoffensive in Richtung Nor<strong>de</strong>n. Der Überraschungseffekt<br />
war so groß, dass die letzten sich <strong>zu</strong>rückziehen<strong>de</strong>n Einheiten <strong>de</strong>r Roten Armee über <strong>de</strong>utsches Gebiet – Ostpreußen – flüchten mussten.<br />
1921 wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r lettischen Hauptstadt Riga ein Frie<strong>de</strong>nsvertrag zwischen <strong>de</strong>n Kriegsparteien geschlossen und <strong>de</strong>r Aufbau <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s im Inneren in Angriff genommen. Piłsudski<br />
verfehlte zwar sein Ziel, die Staatsgrenze von 1772 wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen, es gelang ihm jedoch, die polnische Staatsgrenze etwa 200 km östlich <strong>de</strong>r geschlossenen polnischen Sprachgrenze<br />
mit relativer Bevölkerungsmehrheit, <strong>de</strong>r Curzon-Linie, <strong>zu</strong> ziehen. Im östlichen Teil Polens betrug <strong>de</strong>r polnische Bevölkerungsanteil 1919 etwa 25 %, 1938 nach <strong>de</strong>r Amtszeit Piłsudskis<br />
bezeichneten sich 38 % als polnisch. Den übrigen Anteil bil<strong>de</strong>ten jeweils verschie<strong>de</strong>ne Nationalitäten. Die Bevölkerungsmehrheit bezeichnete sich als ukrainisch, weißrussisch o<strong>de</strong>r<br />
jüdisch. Mehrheitlich polnisch – mit einem hohen Anteil Ju<strong>de</strong>n – waren <strong>zu</strong>m Beispiel Vilnius und Lemberg.<br />
Mai-Umsturz und Sanacja-Regime<br />
Józef Piłsudski war nach einigen Jahren un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r entstan<strong>de</strong>nen innenpolitischen Situation. Im Mai 1926 führte er, obwohl er in Armee und Staat keine offizielle Position<br />
beklei<strong>de</strong>te, mit <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng seiner zahlreichen Anhänger in <strong>de</strong>r Armee, einen Staatsstreich durch und riss die Macht an sich, die er bis <strong>zu</strong> seinem Tod 1935 behielt. Allerdings<br />
beklei<strong>de</strong>te Piłsudski hierbei nur selten und nur für kurze Zeit offiziell be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Ämter. Er war z. B. nie Staatspräsi<strong>de</strong>nt son<strong>de</strong>rn überließ dieses Amt seinem loyalen Gefolgsmann Ignacy<br />
Mościcki. Piłsudski war meist nur Verteidigungsminister. Allerdings war er die allgemein anerkannte oberste Autorität im Staat. Auch gab es <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1920er Jahre<br />
eine mehr o<strong>de</strong>r weniger funktionieren<strong>de</strong>, sogar im Parlament vertretene Opposition, die allerdings konsequent an <strong>de</strong>r Übernahme <strong>de</strong>r Macht gehin<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>r Ermordung von<br />
Innenminister Bronisław Pieracki im Jahre 1934 ließ die Regierung in <strong>de</strong>r Kleinstadt Bereza Kartuska im heutigen Weißrussland ein Internierungslager für ukrainische Nationalisten,<br />
Kommunisten und an<strong>de</strong>re prominente Regimegegner anlegen.<br />
Das Regime, das in <strong>de</strong>r Historiographie manchmal als „Vernunftdiktatur“ bezeichnet wird, nannte sich selbst Sanacja (etwa „Gesundung“). Eine auf die Person Piłsudski <strong>zu</strong>geschnittene<br />
neue Verfassung konnte erst nach <strong>de</strong>ssen Tod 1935 in Kraft treten. Nach Piłsudskis Tod entstan<strong>de</strong>n zwei Machtzentren in Polen – die Gruppe „Schloss“ um Mościcki, benannt nach <strong>de</strong>r<br />
Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten, <strong>de</strong>m Königsschloss in Warschau und die Gruppe <strong>de</strong>r „Obristen“ um <strong>de</strong>n neuen Marschall Edward Rydz-Śmigły. Der Trend hin <strong>zu</strong> einem autoritären Staat<br />
verstärkte sich nun weiter, die Rechte vor allem <strong>de</strong>r slawischen Min<strong>de</strong>rheiten (Ukrainer, Weißrussen) wur<strong>de</strong>n massiv eingeschränkt, die Ju<strong>de</strong>n diskriminiert. Auch die insgeheim finanziell<br />
vom Deutschen Reich unterstützte <strong>de</strong>utsche Min<strong>de</strong>rheit wur<strong>de</strong> trotz <strong>de</strong>r seit <strong>de</strong>m Nichtangriffsvertrag zwischen Hitler und Piłsudski offiziell guten <strong>de</strong>utsch-polnischen Beziehungen<br />
immer stärker in ihren Rechten eingeschränkt, wo<strong>zu</strong> auch die wachsen<strong>de</strong> Begeisterung vieler <strong>de</strong>r Volks<strong>de</strong>utschen für <strong>de</strong>n Nationalsozialismus beitrug.<br />
Die außenpolitischen Bemühungen Polens, die vor allem mit <strong>de</strong>r Person von Außenminister Józef Beck verbun<strong>de</strong>n sind, waren im Einklang mit <strong>de</strong>r französischen Politik darauf<br />
ausgerichtet, einen Block kleiner und mittlerer Staaten <strong>zu</strong>r Eindämmung sowohl Deutschlands als auch <strong>de</strong>r Sowjetunion <strong>zu</strong> schaffen. Dem stan<strong>de</strong>n jedoch vor allem die durch die<br />
Grenzziehung nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg entstan<strong>de</strong>nen gegenseitigen Gebietsansprüche im Wege. So war Polen, kurz bevor es selbst von Deutschland und <strong>de</strong>r Sowjetunion überfallen<br />
wur<strong>de</strong>, aktiv an <strong>de</strong>r Zerschlagung <strong>de</strong>r Tschechoslowakei beteiligt und annektierte nach <strong>de</strong>m Münchener Abkommen im Oktober 1938 die mehrheitlich von Polen und Deutschen<br />
besie<strong>de</strong>lten Industriegebiete in Mährisch-Schlesien und kleinere Gebiete im Grenzgebiet <strong>zu</strong>r Slowakei.<br />
1939–1945: Zweiter Weltkrieg<br />
Septemberkrieg
Nach Kündigung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utsch-polnischen Nichtangriffspaktes folgte <strong>de</strong>r Überfall auf Polen am 1. September 1939, an <strong>de</strong>m sich auch die Slowakei beteiligte. Folge <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen<br />
Angriffes auf Polen war <strong>de</strong>r Kriegseintritt Großbritanniens und Frankreichs und damit <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg.<br />
Die <strong>de</strong>utschen Truppen kamen rasch voran. Gegen die militärische Überlegenheit <strong>de</strong>r Deutschen hatten die Polen nur ihren verzweifelten Kampfeswillen entgegen<strong>zu</strong>setzen.<br />
Einzelaktionen polnischer Verbän<strong>de</strong>, etwa in <strong>de</strong>r Schlacht bei Wizna (6. bis 10. September) o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Schlacht an <strong>de</strong>r B<strong>zu</strong>ra (9. September bis 15. September), vermochten <strong>de</strong>n mit<br />
weiträumigen Umfassungsmanövern einhergehen<strong>de</strong>n Vormarsch nicht auf<strong>zu</strong>halten. Nach zwei Wochen wur<strong>de</strong> die polnische Hauptstadt eingeschlossen. Am 17. September wur<strong>de</strong> Polen –<br />
wie in <strong>de</strong>m geheimen Zusatzprotokoll <strong>de</strong>s Hitler-Stalin-Pakts vorgesehen – auch von <strong>de</strong>r Sowjetunion überfallen. Am 28. September kapitulierte Warschau. Eine offizielle<br />
Gesamtkapitulation Polens, wie <strong>zu</strong>m Beispiel die von Frankreich im Wald von Compiègne am 22. Juni 1940, fand jedoch nicht statt.<br />
Das Land wur<strong>de</strong> zwischen Deutschland und <strong>de</strong>r Sowjetunion aufgeteilt. Die polnische Regierung samt hoher polnischer Militärs floh <strong>zu</strong>erst über die Grenze nach Rumänien und wur<strong>de</strong><br />
dort auf ausdrückliche For<strong>de</strong>rungen Hitlers interniert. Die Exil-Regierung ging dann nach Paris, später nach London und organisierte von dort aus die Streitkräfte und <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand neu.<br />
Der Krieg gegen Polen sollte nach <strong>de</strong>m Willen <strong>de</strong>r NS-Führung Züge eines rassistischen Verdrängungs- und Vernichtungsfeld<strong>zu</strong>gs annehmen. Der polnische Staat sollte zerschlagen und<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche „Lebensraum“ erweitert wer<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rs als im Westen machte Hitler schon vorher klar, dass er an<strong>de</strong>re Maßstäbe anlegen wolle. Es gehe nicht um bestimmte geographische<br />
Linien, die erreicht wer<strong>de</strong>n sollten, son<strong>de</strong>rn darum, dass 80 Millionen Deutsche ihr Recht bekämen. Die „Liquidierung <strong>de</strong>s führen<strong>de</strong>n Polentums“ (Reinhard Heydrich) wur<strong>de</strong> als eine<br />
vorrangige Aufgabe angesehen. Als Vorwand für die Ermordung von zehntausen<strong>de</strong>n Angehörigen <strong>de</strong>r Intelligentsia dienten Verbrechen an Volks<strong>de</strong>utschen in <strong>de</strong>n ersten Kriegstagen, etwa<br />
im Rahmen <strong>de</strong>s „Bromberger Blutsonntags“.<br />
Unmittelbar hinter <strong>de</strong>r Front rückten Angehörige <strong>de</strong>r Einsatzgruppen in Polen ein. Ihnen gehörten insgesamt etwa 3000 Mann an, die sich aus Angehörigen von SS, Sicherheitsdienst und<br />
Polizei <strong>zu</strong>sammensetzten, und in erster Linie die Erschießungen durchführten. Als <strong>zu</strong>sätzliches Terrorinstrument fungierte <strong>de</strong>r „Volks<strong>de</strong>utsche Selbstschutz“, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r SS unterstellt war.<br />
Allein in <strong>de</strong>n ersten vier Monaten <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Besat<strong>zu</strong>ngsherrschaft wur<strong>de</strong>n mehrere 10.000 Personen erschossen. An <strong>de</strong>n Hinrichtungen, <strong>de</strong>ren geographischer Schwerpunkt die<br />
Region Westpreußen war, beteiligten sich neben <strong>de</strong>n genannten Gruppen auch Angehörige <strong>de</strong>r Gestapo und <strong>de</strong>r Wehrmacht. Hierbei han<strong>de</strong>lte es sich nicht um einzelne Exzesse, die aus<br />
<strong>de</strong>m Klima <strong>de</strong>s Hasses und <strong>de</strong>n Zufälligkeiten <strong>de</strong>s Krieges heraus entstan<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn um organisierten Massenmord.<br />
Deutsche und sowjetische Besat<strong>zu</strong>ng: Terror und Genozid<br />
Die Besat<strong>zu</strong>ngszeit hatte für große Teile <strong>de</strong>r polnischen Zivilbevölkerung schwerwiegen<strong>de</strong> Folgen. Die industriell und landwirtschaftlich entwickelten Teile wur<strong>de</strong>n direkt annektiert.<br />
Restpolen mit etwa zehn Millionen Menschen wur<strong>de</strong> als „Generalgouvernement“ <strong>de</strong>m Reichsminister Hans Frank unterstellt. Zu <strong>de</strong>n übergreifen<strong>de</strong>n Zielen <strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ngspolitik im<br />
gesamten Gebiet gehörten:<br />
• die Ausschaltung und Vernichtung <strong>de</strong>r polnischen Intelligenz,<br />
• die Vorverlegung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Ostgrenze und die Erweiterung <strong>de</strong>s „Lebensraums im Osten“,<br />
• die Stärkung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kriegswirtschaft durch rücksichtslose Ausbeutung <strong>de</strong>s Arbeitskräftepotenzials und <strong>de</strong>r materiellen Ressourcen Polens.<br />
Die annektierten Gebiete sollten schnellstmöglich „entpolonisiert“ wer<strong>de</strong>n, teils durch direkte physische Vernichtung, teils durch Vertreibung <strong>de</strong>r dort wohnen<strong>de</strong>n etwa 8 Millionen Polen<br />
und Ju<strong>de</strong>n, o<strong>de</strong>r durch „Germanisierung brauchbarer Volksbestän<strong>de</strong>“ und Neuansiedlung <strong>de</strong>utscher Min<strong>de</strong>rheiten aus an<strong>de</strong>ren Teilen Osteuropas, etwa <strong>de</strong>r Deutschbalten, die nun ihre<br />
Heimat verlassen mussten. Das Generalgouvernement verstand Hitler als Reservoir billiger halbfreier Wan<strong>de</strong>rarbeiter und als „Abla<strong>de</strong>platz“ im Reichsgebiet nicht erwünschter Polen und<br />
Ju<strong>de</strong>n. Als die Deportationen infolge <strong>de</strong>s Krieges mit <strong>de</strong>r Sowjetunion im Juni 1941 been<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, waren etwa 500.000 Polen vertrieben und durch etwa 350.000 volks<strong>de</strong>utsche<br />
Umsiedler ersetzt wor<strong>de</strong>n. Die Deportationen von Polen als Fremdarbeiter ins Reich, wovon während <strong>de</strong>s Krieges allein aus <strong>de</strong>m Generalgouvernement etwa 1,2 Millionen Menschen<br />
betroffen waren, wur<strong>de</strong>n aber aufrechterhalten. In einer Reihe von Anweisungen wur<strong>de</strong> das Ziel <strong>de</strong>r NS-Führung <strong>de</strong>utlich, die Polen auf die Stufe eines schlecht ausgebil<strong>de</strong>ten Hilfsvolkes<br />
ohne politisches Eigenbewusstsein <strong>zu</strong> beschränken.<br />
Auch die Polen, die unter sowjetische Herrschaft geraten waren, waren von Gewaltmaßnahmen betroffen. Man schätzt, dass ungefähr 1,5 Millionen ehemalige polnische Bürger <strong>de</strong>portiert<br />
wur<strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>nen 50 bis 60 Prozent Polen, 15 Prozent Ukrainer, 5 Prozent Weißrussen und ungefähr 20 Prozent Ju<strong>de</strong>n waren. 300.000 polnische Soldaten gerieten in sowjetische<br />
Kriegsgefangenschaft, nur 82.000 von ihnen überlebten. Ein Großteil <strong>de</strong>r Offiziere wur<strong>de</strong> durch sowjetische Truppen 1940 bei Katyn und in <strong>de</strong>n Lagern von Starobielsk, Kozielsk und
Ostaszków erschossen.<br />
Holocaust<br />
Ein schweres Schicksal traf die polnischen Ju<strong>de</strong>n, von <strong>de</strong>nen 89 Prozent (o<strong>de</strong>r 2,5 bis 3 Millionen) <strong>de</strong>n Völkermord nicht überlebten. Dem Terror, <strong>de</strong>n Schikanen, Plün<strong>de</strong>rungen und<br />
Pogromen <strong>de</strong>r ersten Kriegswochen folgte die Übernahme <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Verwaltungsbestimmungen: Kennzeichnungspflicht, Anmeldung <strong>de</strong>s Vermögens, Zwangsarbeit,<br />
Reiseeinschränkungen, Sperrung <strong>de</strong>r Konten, Arisierung <strong>de</strong>s Besitzes.<br />
Im Herbst 1940 begann die „Umsiedlung“ in die Ghettos. Die größten wur<strong>de</strong>n Litzmannstadt mit 160.000 Menschen und Warschau mit 450.000 Menschen. Da die Ghettos nicht in <strong>de</strong>r<br />
Lage waren, sich selbst <strong>zu</strong> erhalten und auch eine wirtschaftliche Ausbeutung von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Stellen nicht gewünscht wur<strong>de</strong>, war die Quote an Toten, oft aus Hunger und Krankheit,<br />
von Anfang an hoch.<br />
Nach<strong>de</strong>m die ursprünglichen NS-Pläne <strong>de</strong>r Umsiedlung <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n nach Madagaskar o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n „Osten“ sich als undurchführbar erwiesen hatten, entwickelte sich seit Mitte 1941, nach<br />
<strong>de</strong>m Beginn <strong>de</strong>s Krieges gegen die Sowjetunion, das Planspiel einer systematischen Ausrottung <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n, die „Endlösung <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>nfrage“. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine einzelne<br />
Entscheidung in Berlin <strong>zu</strong> dieser Frage gab, vielmehr radikalisierten sich die Maßnahmen gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r lokalen Stellen im Laufe weniger Monate immer mehr (Erschießungen von<br />
„Kommissaren“, dann jüdischer Männer, später auch Frauen und Kin<strong>de</strong>r). Der Anfang im Reich war mit <strong>de</strong>r planmäßigen Ermordung geistig und körperlich Behin<strong>de</strong>rter in <strong>de</strong>r so<br />
genannten Aktion T4 gemacht wor<strong>de</strong>n, die dabei angewandten Maßnahmen und Mittel konnten später im Osten teilweise übernommen wer<strong>de</strong>n<br />
Bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s Jahres 1942 wur<strong>de</strong>n die Massenmor<strong>de</strong> <strong>zu</strong> einem Gesamtprogramm <strong>zu</strong>r systematischen Ermordung <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>utscher Herrschaft, <strong>de</strong>m Holocaust, ausgeweitet.<br />
Die Einzelheiten <strong>de</strong>r praktischen Durchführung waren auf <strong>de</strong>r Berliner Wannsee-Konferenz im Januar 1942 festgelegt wor<strong>de</strong>n. Nun begann auch die SS mit <strong>de</strong>n Deportationen in die<br />
Vernichtungslager. Diese entstan<strong>de</strong>n überwiegend auf polnischem Bo<strong>de</strong>n: Kulmhof, Bełżec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Es gab Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n gegen die Deutschen,<br />
<strong>de</strong>r mitunter von <strong>de</strong>r polnischen Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung unterstützt, aber auch von ihr im Stich gelassen wur<strong>de</strong>. Bekanntestes Beispiel <strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rstands war <strong>de</strong>r Aufstand im Warschauer<br />
Ghetto Anfang 1943.<br />
Im Westen: Sikorski, Exil und die An<strong>de</strong>rs-Armee<br />
In Großbritannien kämpfte seit 1940 das Erste Polnische Korps unter britischem Befehl. In <strong>de</strong>r Sowjetunion entstan<strong>de</strong>n nach 1941 zwei separate polnische Armeen.<br />
Die eine, entstan<strong>de</strong>n hauptsächlich aus Deportierten, verließ mit General Władysław An<strong>de</strong>rs an <strong>de</strong>r Spitze das Land, gelangte von Sibirien über <strong>de</strong>n Nahen Osten und Nordafrika<br />
schließlich nach Italien als 2. Polnisches Korps <strong>de</strong>r 8. Britischen Armee. Es umfasste anfangs etwa 200.000, später 400.000 Mann. Sie bewährten sich beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n Schlachten um<br />
Monte Cassino im Mai 1944 und um Arnheim im September <strong>de</strong>sselben Jahres.<br />
Die an<strong>de</strong>re Armee, 1943 als Erste Infanteriedivision Ta<strong>de</strong>usz Kościuszko gegrün<strong>de</strong>t, stand unter Befehl <strong>de</strong>r sowjetischen Führung. Sie tauchte im März 1944 als Erste Polnische Armee<br />
unter General Zygmunt Berling an <strong>de</strong>r Ostfront auf.<br />
Je länger <strong>de</strong>r Krieg andauerte, <strong>de</strong>sto schwerer fiel es <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nächst in Paris, nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Eroberung <strong>de</strong>r Stadt in London ansässigen polnischen Exilregierung auf die Weltpolitik<br />
Einfluss <strong>zu</strong> nehmen. Nach<strong>de</strong>m Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Władysław Sikorski unter bis heute ungeklärten Umstän<strong>de</strong>n am 4. Juli 1943 bei einem Flugzeugabsturz vor Gibraltar ums Leben<br />
gekommen war, traten <strong>zu</strong>nehmend auch innere Meinungsverschie<strong>de</strong>nheiten auf. Zu<strong>de</strong>m verfolgte Stalin bezüglich Polens immer mehr eigene Interessen, die mit <strong>de</strong>m Vorrücken <strong>de</strong>r Front<br />
immer konkretere Formen annahmen. Er nutzte die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Exilregierung nach <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>r Massengräber bei Katyn, das Verbrechen auf<strong>zu</strong>klären, <strong>zu</strong>m Abbruch aller<br />
Kontakte und setzte von da an fast ausschließlich auf die sich in <strong>de</strong>r Sowjetunion befin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n polnischen Kommunisten.<br />
Wi<strong>de</strong>rstand<br />
Durch Bildung von Partisanengruppen versuchten Polen auch nach <strong>de</strong>r militärischen Nie<strong>de</strong>rlage Wi<strong>de</strong>rstand <strong>zu</strong> leisten. Die meisten von ihnen schlossen sich im Februar 1942 <strong>zu</strong>r<br />
„Heimatarmee“ <strong>zu</strong>sammen, die <strong>de</strong>r bürgerlichen Exilregierung in London unterstand, <strong>de</strong>r lediglich die rechtsgerichtete Gruppen (NSZ) und die Kommunisten (AL) fern blieben. Es
entstand auch eine Reihe jüdischer Wi<strong>de</strong>rstandsorganisationen, die schließlich 1943 <strong>de</strong>n Aufstand im Warschauer Ghetto organisierten. Nach<strong>de</strong>m die Rote Armee im Januar 1944 die<br />
polnische Grenze von 1939 überschritten hatte, wur<strong>de</strong>n die Truppen <strong>de</strong>r Heimatarmee vom NKWD entwaffnet, ihre Offiziere erschossen o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Gulag geschickt. Der Kampf<br />
einzelner Untergrun<strong>de</strong>inheiten dauerte jedoch bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1940er Jahre an.<br />
Im Jahr 1944 folgte <strong>de</strong>r Warschauer Aufstand, <strong>de</strong>r in Deutschland oft mit <strong>de</strong>m Ghettoaufstand von 1943 verwechselt wird. Die Sowjetunion, <strong>de</strong>ren Truppen bereits am Ostufer <strong>de</strong>r<br />
Weichsel stan<strong>de</strong>n, hatte kein Interesse, die Einheiten <strong>de</strong>r Heimatarmee <strong>zu</strong> unterstützen. So konnten <strong>de</strong>utsche Truppen <strong>de</strong>n Aufstand brutal nie<strong>de</strong>rschlagen, die Zahl <strong>de</strong>r Toten wird auf<br />
180.000 geschätzt, früher wur<strong>de</strong> sogar die Zahl 250.000 genannt. Dabei wur<strong>de</strong> die Innenstadt Warschaus unter großem Einsatz an Sprengmaterial akribisch Haus für Haus <strong>de</strong>m Erdbo<strong>de</strong>n<br />
gleichgemacht.<br />
Zum Wi<strong>de</strong>rstand gehörte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m ein beinahe flächen<strong>de</strong>cken<strong>de</strong>s Netz von Untergrun<strong>de</strong>inrichtungen wie Schulen, Universitäten, Zeitungen und vieles mehr, die da<strong>zu</strong> beitrugen, das Leid <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>utschen Besat<strong>zu</strong>ng für die Bevölkerung etwas erträglicher <strong>zu</strong> machen. Das Ausmaß an Kollaboration war vor diesem Hintergrund im europäischen Kontext vergleichsweise gering und<br />
war, angesichts <strong>de</strong>r enormen Lei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r polnischen Bevölkerung während <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Besat<strong>zu</strong>ng, auch lange Zeit tabuisiert. Eine breite gesellschaftliche Debatte über polnische Täter<br />
wur<strong>de</strong> erst <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 21. Jahrhun<strong>de</strong>rts anlässlich <strong>de</strong>r durch das Buch „Nachbarn. Der Mord an <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n von Jedwabne“ <strong>de</strong>s polnisch-amerikanischen Soziologen Jan Tomasz Gross<br />
angestoßenen Aufarbeitung <strong>de</strong>s Pogroms von Jedwabne geführt.<br />
1945–1989: Volksrepublik Polen<br />
Lubliner Komitee, Grenzfrage und polnischer Bürgerkrieg<br />
Im Juli 1944 war in Moskau das kommunistische „Polnische Komitee <strong>de</strong>r nationalen Befreiung“ ins Leben gerufen wor<strong>de</strong>n, das die Macht ergreifen sollte, sobald die Rote Armee die<br />
Curzon-Linie überschreiten wür<strong>de</strong>. Dies geschah in Lublin am 22. Juli 1944 (daher auch <strong>de</strong>r Name Lubliner Komitee). An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r neuen Führungsmannschaft stand <strong>de</strong>r<br />
Altkommunist Bolesław Bierut.<br />
Die auf alliierten Druck stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Verhandlungen zwischen „Londoner“ und „Lubliner“ Regierung führten <strong>zu</strong> keinem Ergebnis. International waren <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt bereits<br />
Vorentscheidungen über Polens <strong>zu</strong>künftige Grenzen gefallen (Konferenz von Teheran 1943). Sie führten <strong>zu</strong>r Westverschiebung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Gleichzeitig vereinbarte Stalin mit Churchill<br />
und Roosevelt die weitgehen<strong>de</strong> Vertreibung <strong>de</strong>r Deutschen aus <strong>de</strong>m bisherigen Ost<strong>de</strong>utschland.<br />
Am 1. Januar 1945 proklamierte sich das Lubliner Komitee <strong>zu</strong>r provisorischen Regierung und zog im selben Monat in die Ruinen <strong>de</strong>s befreiten Warschau um. Nach<strong>de</strong>m im Frühjahr 1945<br />
die Rote Armee ganz Polen besetzt hielt und die 14 wichtigsten Anführer <strong>de</strong>r Heimatarmee nach Moskau verschleppte, dort <strong>zu</strong> langjährigen Haftstrafen verurteilte und teilweise<br />
ermor<strong>de</strong>te, war <strong>de</strong>r Hauptwi<strong>de</strong>rstand gegen die neue Besat<strong>zu</strong>ng und die „Sowjetisierung“ <strong>de</strong>r polnischen Gesellschaft gebrochen.<br />
Bereits En<strong>de</strong> 1944 bil<strong>de</strong>te sich eine bewaffnete Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung aus Teilen <strong>de</strong>r Heimatarmee. In <strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>rn Ostpolens stellte die Wi<strong>de</strong>rstandsbewegung anfangs eine<br />
ernst<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Streitmacht dar. In <strong>de</strong>n Jahren nach Kriegsen<strong>de</strong> umfassten die Partisanen schät<strong>zu</strong>ngsweise bis <strong>zu</strong> 100.000 Mitglie<strong>de</strong>r. Ihre Aktionen blieben aber ergebnislos und<br />
nahmen ab <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1940er Jahre ab, da die Rote Armee, <strong>de</strong>r NKWD und die sich bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Organe <strong>de</strong>s kommunistisch-polnischen Staates massiv gegen sie vorgingen.<br />
Konsolidierung <strong>de</strong>s sowjetischen Einflusses und Bevölkerungsverschiebungen 1945–1948<br />
Bereits im Juli 1942 for<strong>de</strong>rte das britische Kriegskabinett Zwangsumsiedlungen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung aus Ostmittel- und Südosteuropa. Im Potsdamer Abkommen von 1945 wur<strong>de</strong><br />
von Alliierten „die Überführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung o<strong>de</strong>r Bestandteile <strong>de</strong>rselben, die in Polen, Tschechoslowakei und Ungarn <strong>zu</strong>rückgeblieben sind, nach Deutschland“<br />
beschlossen, wobei „je<strong>de</strong> <strong>de</strong>rartige Überführung […] in ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen soll“.[43] Alle genannten Län<strong>de</strong>r vollzogen die Zwangsumsiedlung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />
Bevölkerung. Insbeson<strong>de</strong>re waren in Polen etwa sieben Millionen Flüchtlinge und 1,2 Millionen zwangsausgesie<strong>de</strong>lte Menschen davon betroffen (→ Heimatvertriebener).[44][45] Die<br />
<strong>de</strong>utschen Ostgebiete selbst sollten bis <strong>zu</strong>r endgültigen Entscheidung durch eine Frie<strong>de</strong>nskonferenz unter polnische Verwaltung gestellt wer<strong>de</strong>n. Die Grenzfrage wur<strong>de</strong> zwar durch<br />
bilaterale Grenzabkommen und Verträge zwischen Polen und <strong>de</strong>r DDR (1950) sowie <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland (1970) geregelt, aber die endgültige und völkerrechtlich<br />
unumstrittene Frie<strong>de</strong>nsregelung fand erst mit <strong>de</strong>m Zwei-plus-Vier-Vertrag im Jahre 1990 statt.[46]
Aus <strong>de</strong>n östlichen Teilen <strong>de</strong>s heutigen Polens wur<strong>de</strong>n 1944 bis 1946 etwa 500.000 Ukrainer in die Ukraine zwangsumgesie<strong>de</strong>lt, weitere etwa 400.000 wur<strong>de</strong>n nach Nie<strong>de</strong>rschlesien und<br />
Pommern, also in die „wie<strong>de</strong>rgewonnenen West- und Nordgebiete“ Polens, <strong>de</strong>portiert. Parallel da<strong>zu</strong> mussten etwa 1,5 Millionen Polen ihre Heimat im Osten verlassen. Zwischen 1945<br />
und 1947 wur<strong>de</strong>n so etwa 1 Million Polen aus <strong>de</strong>r Ukraine, 300.000 aus Weißrussland und 200.000 aus Litauen nach Polen „repatriiert“. Ein großer Teil von ihnen wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n ehemals<br />
<strong>de</strong>utschen Gebieten angesie<strong>de</strong>lt. Dorthin strömten darüber hinaus etwa 3 Millionen Neusiedler aus Zentralpolen und aus <strong>de</strong>m Westen <strong>zu</strong>rückkehren<strong>de</strong> Polen.<br />
Der im Juni 1945 gebil<strong>de</strong>ten „Regierung <strong>de</strong>r nationalen Einheit“ gehörten außer Stanisław Mikołajczyk fast nur Vertreter <strong>de</strong>r Linken an.<br />
Aus <strong>de</strong>n im Januar 1947 abgehaltenen Wahlen gingen Sozialisten und Kommunisten als Sieger hervor. Mit ihren Stimmen wur<strong>de</strong> im selben Jahr eine erste Übergangsverfassung<br />
verabschie<strong>de</strong>t. Als letzte verbliebene <strong>de</strong>mokratische Partei wur<strong>de</strong> die Polnischen Bauernpartei unter an<strong>de</strong>ren durch Polizeimaßnahmen immer mehr an <strong>de</strong>n Rand gedrängt und<br />
Mikołajczyk selbst floh 1947 ins Exil. En<strong>de</strong> 1948 schlossen sich die bei<strong>de</strong>n linken Parteien <strong>zu</strong>r Vereinigten Arbeiterpartei <strong>zu</strong>sammen, während alle an<strong>de</strong>ren Parteien <strong>zu</strong>m Status von<br />
Blockparteien heruntergestuft wur<strong>de</strong>n.<br />
Stalinistischer Terror und Ära Bierut 1948–1956<br />
Während unter <strong>de</strong>n polnischen Kommunisten <strong>zu</strong>nächst die Überzeugung vorherrschte, auf die völlige Übernahme <strong>de</strong>s sowjetischen Systems verzichten <strong>zu</strong> können, wuchs nach 1947<br />
Stalins Druck. Er verlangte vor allem einen forcierten Aufbau einer Schwerindustrie, die Übernahme <strong>de</strong>s zentralen Planungssystems und eine rasche Kollektivierung <strong>de</strong>r Landwirtschaft.<br />
Damit befand er sich im Wi<strong>de</strong>rspruch mit <strong>de</strong>n eher nationalen Kräften in <strong>de</strong>r polnischen Parteiführung unter ihrem Generalsekretär Władysław Gomułka, <strong>de</strong>r eher Sympathien für das<br />
jugoslawische Mo<strong>de</strong>ll Titos erkennen ließ.<br />
Im Rahmen von Partei und Gesellschaft wur<strong>de</strong>n weitgehen<strong>de</strong> Säuberungen und Umstrukturierungen durchgeführt. Im kulturellen Bereich begann die vorübergehen<strong>de</strong> Herrschaft <strong>de</strong>s<br />
Sozialistischen Realismus. Diese Phase en<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Stalins 1953, ohne dass wie in an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn unter sowjetischer Herrschaft Schauprozesse gegen in Ungna<strong>de</strong> gefallene<br />
kommunistische Politiker durchgeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
Im außenpolitischen Bereich wur<strong>de</strong>n die nationalistischen Angriffe auf Deutschland durch die Theorien <strong>de</strong>s dialektischen Materialismus ersetzt, so dass nunmehr die USA und<br />
Großbritannien sowie die Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland und <strong>de</strong>r Vatikan <strong>zu</strong> Hauptgegnern wur<strong>de</strong>n, während man eine Annäherung <strong>zu</strong>r DDR suchte, die 1950 im Görlitzer Vertrag die<br />
O<strong>de</strong>r-Neiße-Grenze anerkannte.<br />
Polnischer Oktober 1956 und Ära Gomułka 1956–1970<br />
Die Abrechnung <strong>de</strong>s KPdSU-Chefs Nikita Chruschtschow mit <strong>de</strong>n Verbrechen Stalins während <strong>de</strong>s XX. Parteitages im Februar 1956 fiel <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m überraschen<strong>de</strong>n Tod <strong>de</strong>s<br />
polnischen Parteichefs Bolesław Bierut in Moskau wenige Tage später. Gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s neuen Kremlchefs einigte sich die in sich zerstrittene Parteiführung <strong>de</strong>r Polnischen<br />
Vereinigten Arbeiterpartei auf <strong>de</strong>n Kompromisskandidaten Edward Ochab als Nachfolger Bieruts.<br />
Wie wenig gefestigt das politische System war, erwies sich schon im Juni 1956 als Tausen<strong>de</strong> von Arbeitern im westpolnischen Posen streikten und es schließlich <strong>zu</strong>m Posener Aufstand<br />
kam.<br />
Der Streit über das weitere Vorgehen vertiefte <strong>de</strong>n Konflikt im Politbüro. Verschärft wur<strong>de</strong> die Lage durch die politische Entwicklung in Ungarn, wo sich tiefgreifen<strong>de</strong><br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen innerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft abzeichneten. Der Wirtschaftschef Hilary Minc wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Rücktritt gezwungen, <strong>de</strong>r rehabilitierte ehemalige Generalsekretär<br />
Władysław Gomułka kehrte an die Macht <strong>zu</strong>rück, obwohl Moskau <strong>de</strong>m <strong>zu</strong>nächst nicht <strong>zu</strong>stimmen wollte, seine Truppen mobilisierte und die komplette Parteiführung <strong>zu</strong> einem<br />
unangemel<strong>de</strong>ten Blitzbesuch in Warschau eingetroffen war. Schließlich gab man nach und <strong>de</strong>r bisherige polnische Verteidigungsminister Marschall Konstanty Rokossowski – ein<br />
sowjetischer Staatsbürger, über seinen Vater polnischer Herkunft – wur<strong>de</strong> in seine Heimat <strong>zu</strong>rückgerufen.<br />
Schon in seiner ersten Re<strong>de</strong> kündigte Gomułka tiefgreifen<strong>de</strong> Reformen an. Im kirchlichen und kulturellen Bereich wur<strong>de</strong> ein größerer Freiraum <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n, die Zwangskollektivierung<br />
<strong>de</strong>r Landwirtschaft wur<strong>de</strong> been<strong>de</strong>t, eine Reorganisation <strong>de</strong>s gesamten Wirtschaftssystems <strong>zu</strong>gesagt. Bald zeigte sich jedoch, dass diesen Worten nur wenige Taten folgten: liberale<br />
Zeitschriften wur<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>r verboten, <strong>de</strong>r staatliche Religionsunterricht abgeschafft. Gegen Abtrünnige in <strong>de</strong>n eigenen Reihen begann die Parteiführung massiv vor<strong>zu</strong>gehen.
Angesichts <strong>de</strong>r Feiern <strong>zu</strong>m Millennium <strong>de</strong>s christlichen Polens im Jahre 1966 steuerte die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen Staat und <strong>de</strong>r katholisch-polnischen Kirche auf einen neuen<br />
Höhepunkt <strong>zu</strong>, die auch das Deutungsmonopol über die polnische Geschichte <strong>zu</strong>m Thema hatte. Hin<strong>zu</strong> kamen außenpolitische Verwerfungen, vor allem vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r nach<br />
1956 wie<strong>de</strong>r verstärkten antiwest<strong>de</strong>utschen Agitation.<br />
Im kulturellen Bereich waren die ersten Jahre <strong>de</strong>r Gomułka-Herrschaft durchaus von positiven Entwicklungen geprägt. In <strong>de</strong>n Jahren <strong>de</strong>r „kleinen Stabilisierung“ (benannt nach einem<br />
Theaterstück von Ta<strong>de</strong>usz Różewicz) entstand eine Reihe wichtiger Werke in Literatur, Kunst und im Kinobereich, etwa die ersten Filme von Andrzej Wajda, Andrzej Munk und Roman<br />
Polański.<br />
In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>r 1960er Jahre spitzten sich die innerparteilichen Konflikte in <strong>de</strong>r PVAP <strong>zu</strong>. Eine Gruppe von kommunistischen Ka<strong>de</strong>rn, die sich durch ihren Kampf gegen die<br />
<strong>de</strong>utschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg beson<strong>de</strong>rs verbun<strong>de</strong>n fühlte, die „Partisanen“, drängte unter ihrem Anführer, Innenminister General Mieczysław Moczar, an die Macht. Moczar<br />
baute Geheimdienst und Bürgermiliz aus und schuf sich eine breite Anhängerschaft innerhalb <strong>de</strong>r Bevölkerung, die mit <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Entwicklung äußerst un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>n war. Die<br />
offizielle Propaganda gegen Israel wegen <strong>de</strong>s Sechstagekriegs im Jahre 1967 und die Ereignisse im März 1968 nahm Moczar <strong>zu</strong>m Anlass, die erste staatlich tolerierte und geför<strong>de</strong>rte<br />
antisemitische Kampagne gegen Ju<strong>de</strong>n, die in einem europäischen Land nach 1945 ohne Beispiel war, <strong>zu</strong> starten, um die kritischen und liberalen Intellektuellen, sowie wirkliche und<br />
potenzielle Oppositionelle mundtot <strong>zu</strong> machen und sich die Macht im polnischen Staat <strong>zu</strong><strong>zu</strong>schanzen. Als Folge davon wur<strong>de</strong>n etwa 20.000 polnische Ju<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Jahren 1968/1969 <strong>zu</strong>m<br />
Verlassen Polens, unter Verlust <strong>de</strong>r polnischen Staatsbürgerschaft, getrieben. Zusätzlich griffen Proteste im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m „Prager Frühling“ auf das Land über. Die auf die<br />
Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Aufführung <strong>de</strong>s Theaterstücks Totenfeier von Adam Mickiewicz in Warschau folgen<strong>de</strong>n Stu<strong>de</strong>ntenproteste wur<strong>de</strong>n gewaltsam nie<strong>de</strong>rgeschlagen. In <strong>de</strong>r PVAP setzte eine<br />
Säuberungswelle ein, <strong>de</strong>r u. a. Außenminister Adam Rapacki <strong>zu</strong>m Opfer fielen.<br />
Parteichef Gomułka war <strong>zu</strong>nächst we<strong>de</strong>r Willens noch in <strong>de</strong>r Lage, dieser Entwicklung Einhalt <strong>zu</strong> gebieten. Erst allmählich distanzierte er sich vorsichtig von seinem Innenminister.<br />
Gleichzeitig versuchte er, durch außenpolitische Anstrengungen <strong>de</strong>r Krise seiner Herrschaft entgegen <strong>zu</strong> treten. Zu Beginn <strong>de</strong>r 1960er Jahre begann <strong>de</strong>r gesellschaftliche Dialog mit <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland und Polen. Gomułka erklärte sich dabei <strong>zu</strong> offiziellen Verhandlungen bereit, die in erster Linie <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r polnischen Westgrenze <strong>zu</strong>m Thema haben<br />
sollten. Nach<strong>de</strong>m Bonn mit Moskau <strong>zu</strong> einer Vertragsvereinbarung bezüglich <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utsch-sowjetischen Verhältnisses gelangt war, kamen En<strong>de</strong> 1970 auch die Verhandlungen mit Polen <strong>zu</strong><br />
einem Abschluss.<br />
Der Unterzeichnung <strong>de</strong>s Vertrages in Warschau, <strong>de</strong>r die O<strong>de</strong>r-Neiße-Grenze aus west<strong>de</strong>utscher Rechtsposition bestätigte, wie es die DDR schon im Görlitzer Vertrag von 1950 getan hatte,<br />
einen gegenseitigen Gewaltverzicht und die Bereitschaft <strong>zu</strong> weiterer politischer Zusammenarbeit beinhaltete, folgte als symbolischer Höhepunkt <strong>de</strong>r legendäre Kniefall Willy Brandts vor<br />
<strong>de</strong>m Warschauer Ghetto-Ehrenmal am 7. Dezember 1970, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik teilweise heftig kritisiert wur<strong>de</strong>, für die Polen aber – obwohl offiziell kaum darüber berichtet wur<strong>de</strong> –<br />
einen entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Einschnitt in <strong>de</strong>n Nachkriegsbeziehungen darstellte.<br />
Die Herrschaft Gomułkas konnte dieser außenpolitische Erfolg freilich nicht mehr retten. Knapp zwei Wochen nach <strong>de</strong>r Unterzeichnung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utsch-polnischen Vertrages führten<br />
plötzlich verkün<strong>de</strong>te radikale Preiserhöhungen für Lebensmittel <strong>zu</strong> Arbeiterprotesten. Ausgehend von <strong>de</strong>n großen Werften in Danzig und Stettin brachen in <strong>de</strong>n Industriezentren Unruhen<br />
aus. Erst <strong>de</strong>r Einsatz von Militär konnte <strong>de</strong>n Aufruhr stoppen, <strong>de</strong>m 45 Menschen <strong>zu</strong>m Opfer fielen, über 1000 wur<strong>de</strong>n verletzt. Das Politbüro zwang daraufhin Parteichef Gomułka <strong>zu</strong>m<br />
Rücktritt.<br />
Ära Gierek 1970–1980<br />
Gomułkas Nachfolger, <strong>de</strong>r oberschlesische Parteifunktionär Edward Gierek, genoss in weiten Teilen <strong>de</strong>r Bevölkerung große Sympathien. Ihm gelang es, viele <strong>de</strong>r alten Ka<strong>de</strong>r rasch<br />
aus<strong>zu</strong>wechseln. Seine neue Wirtschaftspolitik zielte auf die bessere Befriedigung <strong>de</strong>r Konsumbedürfnisse <strong>de</strong>r Bevölkerung. Mit Lohn- und Rentenerhöhungen sollte <strong>de</strong>r allgemeine<br />
Lebensstandard angehoben wer<strong>de</strong>n. Die eingeleiteten Reformen (größere Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Regierung von <strong>de</strong>r kommunistischen Partei, Erweiterung <strong>de</strong>r Arbeitermitbestimmung,<br />
Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Verwaltungsstrukturen etc.) bewirkten in <strong>de</strong>r Praxis aber eher einen Macht<strong>zu</strong>wachs <strong>de</strong>r PVAP auf allen Ebenen.<br />
Die Ansätze einer umfassen<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r Wirtschaft lagen vor allem im Bereich <strong>de</strong>r Schaffung neuer Strukturen, <strong>de</strong>ren Verfahren und Produktionsstätten im Westen auf Kredit<br />
eingekauft wur<strong>de</strong>n. Die Rückzahlung sollte durch <strong>de</strong>n Verkauf <strong>de</strong>r erzeugten neuen Produkte ins Ausland erfolgen. Diese Bemühungen bewirkten gera<strong>de</strong> im psychologischen Bereich<br />
positive Verän<strong>de</strong>rungen. Die größere Produktpalette und die steigen<strong>de</strong> Kaufkraft erweckten <strong>de</strong>n Anschein einer Annäherung an die Konsumgesellschaften <strong>de</strong>s Westens, weswegen auch im
Rückblick viele Polen die Gierek-Zeit positiv in Erinnerung haben. In Wirklichkeit war aber die Zentrale Wirtschaftsplanungskommission nicht in <strong>de</strong>r Lage, die unterschiedliche<br />
Entwicklung in verschie<strong>de</strong>nen Wirtschaftszweigen aufeinan<strong>de</strong>r ab<strong>zu</strong>stimmen.<br />
In <strong>de</strong>r Außenpolitik verbesserte sich das Verhältnis <strong>zu</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik weiter, auch wegen <strong>de</strong>r „Männerfreundschaft“ zwischen Gierek und <strong>de</strong>m neuen Bun<strong>de</strong>skanzler Helmut Schmidt.<br />
Die Öffnung <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong>r DDR schuf jedoch aufgrund <strong>de</strong>r ökonomischen Unterschie<strong>de</strong> zwischen bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn eine Reihe von Spannungen.<br />
Die innenpolitischen Repressionen wur<strong>de</strong>n Mitte <strong>de</strong>r 1970er Jahre allmählich wie<strong>de</strong>r erhöht, was die Unterdrückung von Gegenstimmen <strong>zu</strong>r neuen, sozialistischen Verfassung zeigte. Als<br />
im Juni 1976 die Preise für Grundnahrungsmittel drastisch erhöht wur<strong>de</strong>n, kam es in <strong>de</strong>n industriellen Zentren Radom und Ursus bei Warschau <strong>zu</strong> Unruhen. Die Preiserhöhungen wur<strong>de</strong>n<br />
daraufhin zwar <strong>zu</strong>rückgenommen, gleichzeitig aber eine große Anzahl von Arbeitern entlassen, verhaftet und <strong>zu</strong> langen Gefängnisstrafen verurteilt.<br />
Während es bis dahin keine klare Trennungslinien innerhalb <strong>de</strong>r polnischen Gesellschaft gab und die Reformdiskussionen bis weit in die PVAP hinein geführt wur<strong>de</strong>n, entwickelten sich<br />
nun erstmals <strong>de</strong>utlich oppositionelle Gruppierungen in Polen selbst. Führen<strong>de</strong> Intellektuelle grün<strong>de</strong>ten am 23. September 1976 das „Komitee <strong>zu</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>r Arbeiter“. Der<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Druck <strong>de</strong>r öffentlichen Meinung verhin<strong>de</strong>rte in <strong>de</strong>r Folgezeit repressive Maßnahmen <strong>de</strong>r Parteiführung. In <strong>de</strong>n nächsten Jahren grün<strong>de</strong>ten sich weitere<br />
Bürgerrechtsorganisationen. Gleichzeitig engagierte sich die katholische Kirche unter Stefan Kardinal Wyszyński <strong>zu</strong>nehmend stärker. Ihre beson<strong>de</strong>re Stellung wur<strong>de</strong> gefestigt durch die<br />
mit Begeisterung aufgenommene Wahl <strong>de</strong>s Krakauer Erzbischofs Karol Wojtyła <strong>zu</strong>m Papst am 16. Oktober 1978 und <strong>de</strong>ssen mit Begeisterung aufgenommene erste Polenreise ein halbes<br />
Jahr danach.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s neuen Jahrzehnts zeichnete sich angesichts <strong>de</strong>r immer größeren wirtschaftlichen Probleme ab, dass auch die Zeit <strong>de</strong>s einstmals bejubelten Edward Gierek abgelaufen war.<br />
Opposition, Streikbewegung und Solidarność<br />
Bereits 1977 und 1978 waren in Radom bzw. Kattowitz Zellen unabhängiger Gewerkschaften gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n. Am 29. April 1978 entstand in Danzig das „Gründungskomitee freier<br />
Gewerkschaften für das Küstengebiet“, <strong>de</strong>ssen Teilnehmer <strong>zu</strong>meist schon 1970 mitgestreikt hatten. Zu ihnen stieß bald <strong>de</strong>r junge Elektriker <strong>de</strong>r „Lenin-Werft“ Lech Wałęsa. In <strong>de</strong>r<br />
Untergrundzeitschrift „Robotnik“ (Der Arbeiter) wur<strong>de</strong> im September 1979 die „Charta <strong>de</strong>r Arbeiterrechte“ veröffentlicht. In ihr wur<strong>de</strong>n die bisherigen Erfahrungen mit Streiks<br />
berücksichtigt, For<strong>de</strong>rungen für die Zukunft aufgestellt und allgemeine Positionen festgelegt.<br />
Anfang 1980 hatte sich die gesamtwirtschaftliche Lage dramatisch verschlechtert: die Subventionen für Grundnahrungsmittel verschlangen etwa 40% <strong>de</strong>r Staatseinnahmen, <strong>de</strong>r<br />
Kaufkraftüberhang nahm ständig <strong>zu</strong>, die im Westen aufgenommenen Schul<strong>de</strong>n konnten nicht mehr bedient wer<strong>de</strong>n. Die Regierung wählte wie<strong>de</strong>rum <strong>de</strong>n Weg <strong>de</strong>r Preiserhöhungen und<br />
begann mit ihnen ohne öffentliche Bekanntmachung am 1. Juli, <strong>de</strong>m lan<strong>de</strong>sweiten Beginn <strong>de</strong>r Sommerferien. Dennoch brachen in vielen Betrieben umgehend Streiks aus, <strong>zu</strong>nächst im<br />
Traktorenwerk Ursus in Warschau, dann in Ostpolen und Mitte August auch in Danzig. Obwohl die Parteiführung nun wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Nachgeben bereit war und die Lohnfor<strong>de</strong>rungen<br />
bewilligte, konnte sie die Bewegung nicht mehr eindämmen. Als die Belegschaft <strong>de</strong>r Danziger „Lenin-Werft“ am 14. August wie schon 1970 komplett in <strong>de</strong>n Ausstand trat und das<br />
Werksgelän<strong>de</strong> besetzt hatte, stellte das neue Streikkomitee erstmals auch politische For<strong>de</strong>rungen, etwa die Wie<strong>de</strong>reinstellung <strong>de</strong>r entlassenen Streikführer und die Errichtung eines<br />
Denkmals für die Opfer von 1970<br />
Die Warschauer Regierung erkannte bald die Gefahr, die von <strong>de</strong>r sich ausbreiten<strong>de</strong>n Streikwelle ausging, und kappte alle Verbindungen nach Danzig und Umgebung. Ein Teil <strong>de</strong>r<br />
streiken<strong>de</strong>n Werftarbeiter akzeptierte das Kompromissangebot <strong>de</strong>r Werksleitung, an<strong>de</strong>re plädierten für eine Aus<strong>de</strong>hnung <strong>de</strong>s Arbeitskampfes, die mit <strong>de</strong>r Gründung eines<br />
Überbetrieblichen Streikkomitees (MKS) am 16. August auch erfolgte. Der von seinem Vorsitzen<strong>de</strong>n Lech Wałęsa präsentierte For<strong>de</strong>rungskatalog enthielt unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>n Wunsch<br />
nach Zulassung freier Gewerkschaften, Meinungsfreiheit und das Streikrecht.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r PVAP setzten sich nun die Reformkräfte durch und Regierungsvertreter akzeptierten in Verhandlungen in Stettin und Danzig am 30. und 31. August die meisten <strong>de</strong>r<br />
For<strong>de</strong>rungen. Am Nachmittag <strong>de</strong>s 31. Augusts wur<strong>de</strong> das Danziger Abkommen unterzeichnet, das die Verhandlungsergebnisse politisch festschrieb. Die Gewerkschaftskräfte waren<br />
jedoch nicht mehr bereit, ihre Tätigkeit auf <strong>de</strong>n Danziger Raum <strong>zu</strong> beschränken und beschlossen die Aus<strong>de</strong>hnung auf das ganze Land. Mit einem Warnstreik erzwang die neue<br />
Organisation, die sich <strong>de</strong>n Namen „Solidarność“ (Solidarität) gab, am 3. Oktober ihre gerichtliche Registrierung. In <strong>de</strong>n Wochen darauf setzte ein gewaltiger Ansturm auf sie ein, so dass<br />
ihr schon im November etwa 10 Millionen Arbeitnehmer angehörten (von insgesamt 16 Millionen), darunter über 1 Million Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r PVAP.
Die innenpolitische Lage schien sich nun allmählich <strong>zu</strong> entspannen, nach<strong>de</strong>m Parteichef Gierek schon im September durch <strong>de</strong>n gemäßigten Stanisław Kania ersetzt und die meisten<br />
Hardliner aus <strong>de</strong>m Politbüro entfernt wor<strong>de</strong>n waren. Der Vorschlag mehrerer Parteichefs, darunter Erich Honecker, mit <strong>de</strong>n Warschauer-Pakt-Truppen ein<strong>zu</strong>marschieren, scheiterte am<br />
Veto Moskaus, das nach <strong>de</strong>n Erfahrungen <strong>de</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng Afghanistans eine weitere Verschlechterung <strong>de</strong>s weltpolitischen Klimas fürchtete.<br />
Der Kreml steigerte jedoch <strong>de</strong>n Druck auf die PVAP, die „Konterrevolution“ <strong>zu</strong> bekämpfen und veranstaltete wie<strong>de</strong>rholt Manöver in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Grenzen Polens. Im Frühjahr 1981 kam<br />
es wie<strong>de</strong>rholt <strong>zu</strong> gewalttätigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen Staatsorganen und Gewerkschaftsaktivisten. Aufgrund <strong>de</strong>r sich weiter verschlechterten wirtschaftlichen Lage häuften sich<br />
wil<strong>de</strong> Streiks, <strong>de</strong>r Eindruck von Chaos verbreitete sich angesichts <strong>de</strong>r „Doppelherrschaft“. In dieser entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Phase waren <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die bewährten Vermittlungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Kirche eingeschränkt, weil im Mai sowohl das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt wor<strong>de</strong>n, als auch Primas Stefan Wyszyński gestorben war.<br />
Nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r erste Lan<strong>de</strong>skongress <strong>de</strong>r Solidarność im September 1981 ein noch stärkeres politisches Engagement beschlossen und eine Botschaft an alle Arbeiter <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
sozialistischen Staaten gerichtet hatte, entschloss sich die PVAP-Führung endgültig <strong>zu</strong>m Konfrontationskurs.<br />
Jaruzelski und Kriegs<strong>zu</strong>stand<br />
Auf <strong>de</strong>m 4. ZK-Plenum vom 16. bis 18. Oktober wur<strong>de</strong> Parteichef Stanisław Kania durch <strong>de</strong>n als Hardliner gelten<strong>de</strong>n Verteidigungsminister General Wojciech Jaruzelski ersetzt. Die<br />
Vorbereitungen für einen entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlag gegen die Opposition waren <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.<br />
Trotz <strong>de</strong>r Bereitschaft <strong>de</strong>r „Solidarność“ <strong>zu</strong> Kompromissen übernahmen in <strong>de</strong>r Nacht vom 12. auf <strong>de</strong>n 13. Dezember 1981 Militär und Sicherheitsorgane die Macht in Polen. General<br />
Jaruzelski verkün<strong>de</strong>te in einer Fernsehansprache die Verhängung <strong>de</strong>s Kriegs<strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>r bis 1983 in Kraft blieb. Die Führungsspitze <strong>de</strong>r Gewerkschaft wur<strong>de</strong> in Danzig verhaftet.<br />
Regionalführer, Leiter <strong>de</strong>r Betriebskommissionen und oppositionelle Intellektuelle, insgesamt einige Tausend Personen, wur<strong>de</strong>n in Internierungslager gebracht. Jaruzelski rechtfertigt bis<br />
<strong>zu</strong>m heutigen Tage diesen Schritt mit einer angeblichen unmittelbaren Gefahr <strong>de</strong>s Einmarsches <strong>de</strong>r Roten Armee, doch gibt es für diese keinerlei Beweise, vielmehr sprach alles gegen<br />
eine solche Option <strong>de</strong>s Kreml <strong>zu</strong>m damaligen Zeitpunkt.<br />
Die kommunistische Partei, <strong>de</strong>ren Tätigkeit interessanterweise ebenfalls kurzfristig suspendiert wor<strong>de</strong>n war, besaß kein Konzept <strong>zu</strong>r inneren Erneuerung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Man suchte vielmehr<br />
nun Wege <strong>de</strong>r Verständigung mit <strong>de</strong>n gesellschaftlichen Kräften, die nicht <strong>zu</strong>r „Solidarność“ gehörten, vor allem mit <strong>de</strong>r katholischen Kirche. Im wirtschaftlichen Sektor begann man mit<br />
zaghaften Reformen, <strong>de</strong>ren Erfolge aber <strong>zu</strong> wünschen übrig ließen. Sie waren begleitet von internen Machtkämpfen zwischen „Falken“ und „Tauben“ in <strong>de</strong>r PVAP, <strong>de</strong>ren Höhepunkt die<br />
Ermordung <strong>de</strong>s oppositionellen Priesters Jerzy Popiełuszko durch Angehörige <strong>de</strong>s Sicherheitsapparates im Oktober 1984 war.<br />
Parallel <strong>zu</strong>r Entwicklung in <strong>de</strong>r Sowjetunion nach <strong>de</strong>m Machtantritt von Michail Gorbatschow setzten sich seit Mitte <strong>de</strong>r 1980er Jahre auch in Polen die Reformkräfte durch. Im Rahmen<br />
einer Amnestie wur<strong>de</strong>n im Juli 1986 alle politischen Gefangenen freigelassen. Um angesichts <strong>de</strong>r sich weiter verschlechtern<strong>de</strong>n Versorgungssituation die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
für weitere Wirtschaftsreformen <strong>zu</strong> gewinnen, führte man im November 1987 die erste Volksabstimmung nach über 40 Jahren durch, die mit einer klaren Nie<strong>de</strong>rlage für die Regierung<br />
en<strong>de</strong>te. Zwei Streikwellen im April, Mai und im August 1988 brachten die Reformer <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Erkenntnis, dass ohne weitere Zugeständnisse die Dauerkrise nicht wür<strong>de</strong> überwun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />
können.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Volksrepublik<br />
Die „Solidarność“ hatte die ganze Zeit über im Untergrund weiter gewirkt. Es erschienen zahlreiche Zeitschriften und Bücher in Anknüpfung an die sowjetische Samizdat-Tradition im<br />
„Zweiten Umlauf“. Die systemkonformen Gewerkschaften wur<strong>de</strong>n weitgehend boykottiert.<br />
Die anwachsen<strong>de</strong> Streikbewegung wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r PVAP mit Sorge betrachtet, <strong>zu</strong>mal sich herausstellte, dass an ihr vor allem jüngere Arbeiter <strong>de</strong>r Nach-„Solidarność“-Generation beteiligt<br />
waren. Die Politik Jaruzelskis, die auf <strong>de</strong>n Prinzipien <strong>de</strong>r Konsultation und Kooptation beruhte, war gescheitert. Unter Vermittlung von führen<strong>de</strong>n Intellektuellen und <strong>de</strong>r katholischen<br />
Kirche kam es am 31. August 1988 <strong>zu</strong> einem ersten Gespräch zwischen Innenminister Czesław Kiszczak und Lech Wałęsa „unter Gleichen“. Die Verhandlungen traten <strong>zu</strong>nächst auf <strong>de</strong>r<br />
Stelle, beson<strong>de</strong>rs als sich <strong>de</strong>r neue Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Mieczysław Rakowski auf reine Wirtschaftsreformen konzentrieren wollte. Erst nach einer Fernsehdiskussion zwischen Wałęsa und<br />
<strong>de</strong>m Chef <strong>de</strong>r offiziellen Gewerkschaft, Alfred Miodowicz, die nach mehrheitlicher Auffassung <strong>de</strong>r Zuschauer ersterer klar für sich entschied, war <strong>de</strong>r Parteiführung klar, dass ohne eine
Beteiligung <strong>de</strong>r „Solidarność“ neue Reformen in <strong>de</strong>r Bevölkerung nicht durch<strong>zu</strong>setzen sein wür<strong>de</strong>n.<br />
Vom 6. Februar bis 5. April 1989 versammelten sich in Warschau Repräsentanten <strong>de</strong>r Partei und <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Opposition <strong>zu</strong> Gesprächen am Run<strong>de</strong>n Tisch. Die eigentliche Arbeit<br />
in verschie<strong>de</strong>nen Verhandlungsgruppen führte <strong>zu</strong> tiefgreifen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rungen in allen Bereichen <strong>de</strong>s öffentlichen Lebens. Im politischen Sektor vereinbarte man die schrittweise<br />
Einführung <strong>de</strong>r vollen Volkssouveränität mit <strong>de</strong>m da<strong>zu</strong> gehören<strong>de</strong>n Pluralismus. Als Sofortmaßnahme wur<strong>de</strong> am 17. April die „Solidarność“ wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gelassen. Die Anerkennung eines<br />
Mehrparteiensystems, <strong>de</strong>s Prinzips freier Wahlen und unabhängiger Gerichte waren weitere wichtige Etappen dieses Prozesses, <strong>de</strong>r eine Mischung aus Revolution und Reform war.[47]<br />
Die ersten halbwegs freien Wahlen seit über 40 Jahren beschleunigten <strong>de</strong>n Systemwan<strong>de</strong>l. Die Sitze im Sejm wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Schlüssel 65 Prozent für die PVAP und ihre Verbün<strong>de</strong>ten,<br />
35 Prozent für die Opposition vergeben, während die Wahlen <strong>zu</strong>m Senat unbeschränkt waren. Von <strong>de</strong>n 262 vorher festgelegten Kandidaten <strong>de</strong>r „Solidarność“ wur<strong>de</strong> nur ein einziger nicht<br />
gewählt, während die PVAP ihre Kandidaten nur mit Hilfe einer kurzfristigen Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Wahlgesetzes durchbrachte. Die Wahl General Jaruzelskis <strong>zu</strong>m Staatspräsi<strong>de</strong>nten am 19. Juli<br />
erfolgte nur noch mit einer Stimme Mehrheit, ein von <strong>de</strong>r PVAP geführtes Kabinett unter General Kiszczak kam gar nicht mehr <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>. Statt <strong>de</strong>ssen gelang es <strong>de</strong>r „Solidarność“ in<br />
Zusammenarbeit mit zwei bisherigen Blockparteien am 13. September eine Regierung unter <strong>de</strong>m katholischen Publizisten Ta<strong>de</strong>usz Mazowiecki <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n. Diese Ereignisse in Polen, die<br />
vom Kreml unterstützt wur<strong>de</strong>n, trugen <strong>zu</strong>m Fall <strong>de</strong>r Berliner Mauer in Deutschland und <strong>zu</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Kommunismus im östlichen Europa bei.<br />
seit 1989: Dritte Republik<br />
Deutsch-Polnische Nachbarschaftspolitik<br />
1990 wur<strong>de</strong> die Westgrenze Polens durch das wie<strong>de</strong>rvereinigte Deutschland unter Bun<strong>de</strong>skanzler Helmut Kohl anerkannt. Kohl vollen<strong>de</strong>te damit, was Willy Brandt <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>r 1970er<br />
Jahre begonnen hatte. Die Kontakte Polens mit seinem westlichen Nachbarn entwickeln sich seit<strong>de</strong>m vertrauensvoll und eng. Auch zwischen ehemaligen <strong>de</strong>utschen Bewohnern <strong>de</strong>r<br />
damaligen Ostgebiete und <strong>de</strong>n heutigen polnischen Einwohnern sind inzwischen viele Freundschaften entstan<strong>de</strong>n: Beson<strong>de</strong>re Katalysatoren in dieser Verständigung sind die Kirchen<br />
sowie Teile <strong>de</strong>r Vertriebenenverbän<strong>de</strong>. Ein weiterer Höhepunkt <strong>de</strong>r besseren Beziehungen zwischen Polen und Deutschland war 2004 die Einladung an <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>skanzler<br />
Gerhard Schrö<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Feierlichkeiten <strong>zu</strong>m 60. Jahrestag <strong>de</strong>s Warschauer Aufstan<strong>de</strong>s. Schrö<strong>de</strong>r war damit <strong>de</strong>r erste <strong>de</strong>utsche Kanzler, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n alljährlichen Feiern teilnehmen durfte.<br />
Jedoch folgten diesem Besuch Schrö<strong>de</strong>rs Diskussionen um Wie<strong>de</strong>rgutmachungsleistungen an die <strong>de</strong>utschen Vertriebenen, die da<strong>zu</strong> führten, dass in Polen neue Ängste gegenüber <strong>de</strong>n<br />
Deutschen aufkamen.<br />
Euroatlantische Integration<br />
Am 25. Mai 1997 wur<strong>de</strong> per Volksabstimmung eine neue Polnische Verfassung angenommen. Polen gilt heute als wirtschaftlich aufstreben<strong>de</strong>r, stabiler und <strong>de</strong>mokratischer Staat, was in<br />
seiner Aufnahme in die NATO am 12. März 1999 und in die Europäische Union am 1. Mai 2004, nach<strong>de</strong>m sich eine Mehrheit <strong>de</strong>r polnischen Bürger (73 % Ja-Stimmen bei einer<br />
Beteiligung von etwa 59 %) in einer Volksabstimmung im Juni 2003 für <strong>de</strong>n EU-Beitritt ausgesprochen hatte, Ausdruck fin<strong>de</strong>t.<br />
Polen entwickelte sich während <strong>de</strong>s Dritten Golfkrieges und in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit neben Großbritannien, Italien und Spanien <strong>zu</strong> einem wichtigen Verbün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>r USA in Europa.<br />
Während <strong>de</strong>r Kriegshandlungen entsandte Polen Truppen in <strong>de</strong>n Irak. Auch im Nachkriegs-Irak nahm Polen eine wichtige Rolle ein, durch die Übernahme <strong>de</strong>r Verwaltung einer von drei<br />
Besat<strong>zu</strong>ngszonen im Irak nach <strong>de</strong>m Dritten Golfkrieg 2003.<br />
Während <strong>de</strong>s Konfliktes um die Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen im Nachbarstaat Ukraine im November/Dezember 2004 engagierte sich <strong>de</strong>r polnische Präsi<strong>de</strong>nt Aleksan<strong>de</strong>r Kwaśniewski als<br />
Vermittler zwischen <strong>de</strong>n Konfliktparteien, während die polnische Öffentlichkeit und die Medien Solidarität mit Wiktor Juschtschenko übten.<br />
Die Parlamentswahlen 2005 führten <strong>zu</strong> einem Richtungswechsel: Das bis dahin regieren<strong>de</strong> Bündnis <strong>de</strong>r „Demokratischen Linken“ wur<strong>de</strong> durch ein konservatives Bündnis abgewählt.<br />
Gewinner war Jarosław Kaczyński, Führer <strong>de</strong>r national-konservativen Partei PiS (<strong>de</strong>utsch: Recht und Gerechtigkeit). Die PiS verlor bei <strong>de</strong>n vorgezogenen Parlamentswahlen am 21.<br />
Oktober 2007 ihre Position als stärkste Partei.<br />
Seit November 2007 bil<strong>de</strong>n die PO und ihr Koalitionspartner, die gemäßigte Bauernpartei PSL, die Regierung. Neuer Ministerpräsi<strong>de</strong>nt ist Donald Tusk.
Nach einem tödlichen Flugzeugabsturz Kaczyńskis am 10. April 2010 übernahm Bronisław Komorowski geschäftsführend die Aufgaben <strong>de</strong>s polnischen Präsi<strong>de</strong>nten, im Juli 2010 wur<strong>de</strong><br />
Komorowski schließlich <strong>zu</strong>m Nachfolger Kaczyńskis gewählt.<br />
Literatur<br />
• 6-bändiges Werk Geschichte Polens<br />
• Erster Teil von Richard Roepell, Hamburg 1840. (online).<br />
• Zweiter Teil (1300–1386) von Jacob Caro, Gotha 1863. (unverän<strong>de</strong>rter Nachdruck: Elibron Classics, USA, ISBN 9-780-54382-277-2.) (online).<br />
• Dritter Teil (1386–1430) von Jacob Caro, Gotha 1869.<br />
• Vierter Teil (1430–1455) von Jacob Caro, Gotha 1875. (unverän<strong>de</strong>rter Nachdruck: Elibron Classics, USA, ISBN 9-780-54382-269-7.)<br />
• Fünfter Teil (1455–1486) von Jacob Caro, Gotha 1886.<br />
• Sechster Teil – Die zwei letzten Jagellonen (1506–1572) von Ezechiel Zivier, Gotha 1915.<br />
• Manfred Alexan<strong>de</strong>r: Kleine Geschichte Polens. Reclam, Stuttgart, aktual. u. erw. Aufl. 2008, ISBN 978-3-15-017060-1.<br />
• Norman Davies: Im Herzen Europas – Geschichte Polens. München 2000, ISBN 3-406-46709-1. (Aktualisiert um die Geschichte nach 1989)<br />
• Peter Gatter: Der weiß-rote Traum. Polens Weg zwischen Freiheit und Fremdherrschaft. Düsseldorf, Wien 1983, ISBN 3-426-03724-6.<br />
• Jürgen Hey<strong>de</strong>: Geschichte Polens. Beck, München 2006, ISBN 3-406-50885-5.<br />
• Jörg K. Hoensch: Geschichte Polens. Stuttgart 1983, ISBN 3-825-21251-3.<br />
• Rudolf Jaworski, Christian Lübke, Michael G. Müller: Eine kleine Geschichte Polens. Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-518-12179-0.<br />
• Enno Meyer: Grundzüge <strong>de</strong>r Geschichte Polens. 3. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1990, ISBN 3-534-04371-5.<br />
• Manfred Raether: Polens <strong>de</strong>utsche Vergangenheit. Schöneck 2004, ISBN 3-00-012451-9. (Neuausgabe 2008 als e-Buch).<br />
• Gotthold Rho<strong>de</strong>: Geschichte Polens – Ein Überblick. Darmstadt 1980, ISBN 3-534-00763-8.<br />
• Hans Roos: Geschichte <strong>de</strong>r polnischen Nation 1918–1985. Stuttgart [u. a.] 1986, ISBN 3-170-07587-X.<br />
• Jarosław Suchoples (Hrsg.): Skandinavien, Polen und die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r östlichen Ostsee: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,<br />
Wrocław 2005, ISBN 83-229-2637-5.<br />
• Stefan Muthesius: Kunst in Polen – Polnische Kunst 966–1990. Eine Einführung. Königstein i. Ts. 1994, ISBN 3-7845-7610-9.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Manfred Alexan<strong>de</strong>r, Kleine Geschichte Polens, Reclam, Stuttgart 2008, S. 25.<br />
2. ↑ Alexan<strong>de</strong>r, S. 35.<br />
3. ↑ Rudolf Usinger: online Deutsch-Dänische Geschichte 1189–1227. Mittler und Sohn, Berlin 1863.<br />
4. ↑ T. Hirsch, M. Töppen und E. Strehlke (Hrsg.): Scriptores Rerum Prussicarum – Die Geschichtsquellen <strong>de</strong>r preußischen Vorzeit bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsherrschaft, Band<br />
I, Leipzig 1861, S. 705.<br />
5. ↑ Jacob Caro: Geschichte Polens. Zweiter Theil. Perthes, Gotha 1863, S. 27<br />
6. ↑ Scriptores Rerum Prussicarum – Die Geschichtsquellen <strong>de</strong>r preußischen Vorzeit bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsherrschaft. (T. Hirsch, M. Töppen und E. Strehlke, Hrsg.). Band<br />
I, Leipzig 1861, S. 708, Anmerkung 91<br />
7. ↑ Scriptores Rerum Prussicarum – Die Geschichtsquellen <strong>de</strong>r preußischen Vorzeit bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsherrschaft. (T. Hirsch, M. Töppen und E. Strehlke, Hrsg.). I.<br />
Band, Leipzig 1861, Seite 695, S. 695, Anmerkung 62<br />
8. ↑ Richard Roepell: Geschichte Polens. Perthes, Hamburg 1840, S. 558.
9. ↑ Slawomir Gawlas: Die Probleme <strong>de</strong>s Lehnswesens und <strong>de</strong>s Feudalismus aus polnischer Sicht, S. 120, in: Michael Borgolte, Ralf Lusiardi: Das europäische Mittelalter im<br />
Spannungsbogen <strong>de</strong>s Vergleichs, Aka<strong>de</strong>mie Verlag, 2001.<br />
10.↑ (Verkauf <strong>de</strong>s Lebuser Lan<strong>de</strong>s an die Askanier um 1250 durch <strong>de</strong>n Piasten Bolesław von Schlesien, Grundlegung <strong>de</strong>r bran<strong>de</strong>nburgischen Neumark)<br />
11.↑ (darunter fielen auch die verlustig gegangenen Provinzen, vor allem Pommern und Schlesien)<br />
12.↑ (in Krakau 1339 bestätigt, darauf gab Johann gegen eine Geldzahlung seine Ansprüche auf die polnische Krone auf und schränkte seine Unterstüt<strong>zu</strong>ng für <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n<br />
ein)<br />
13.↑ (im Kampf gegen Böhmen fand Kasimir beträchtliche Unterstüt<strong>zu</strong>ng bei seinem schlesischen Neffen Bolko von Schweidnitz)<br />
14.↑ (das Gebiet ging später unter <strong>de</strong>m Haus Habsburg-Lothringen, nach <strong>de</strong>r Annexion von 1772, „verballhornt“ als Königreich „Galizien und Lodomerien“ in die Geschichte ein)<br />
15.↑ (in Masowien im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt und in Schlesien im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Mannesstamm)<br />
16.↑ Brockhaus’ Konversationslexikon, Band 7, S. 322.<br />
17.↑ Herrschaft über das Baltische Meer, eine Losung, die laut Wissen Media Verlag auf wissen.spiegel.<strong>de</strong> 1563 durch König Sigismund II. August geprägt wur<strong>de</strong>.<br />
18.↑ Peter Claus Hartmann: Französische Könige und Kaiser <strong>de</strong>r Neuzeit. C.H.Beck, 2006, S. 129<br />
19.↑ Pierre Chevallier: Henri III, S. 209–231.<br />
20.↑ Schwedisch-Polnische Kriege <strong>de</strong>r Jahre 1600−1611 und 1617−18, Zebrzydowski-Konfö<strong>de</strong>ration 1606−1609, unzählige Tatarenrazzien etc.<br />
21.↑ Poland in the Seventeenth Century<br />
22.↑ a b Józef S<strong>zu</strong>jski: Dzieje Polski podług ostatnich badań. Bd. 3, Lwów 1866, S. 218. (Inklusive Tross)<br />
23.↑ Zur Frage <strong>de</strong>r Übergabe <strong>de</strong>r Souveränität über das Herzogtum Preußen an die bran<strong>de</strong>nburgische Linie <strong>de</strong>r Hohenzollern siehe: Dietmar Willoweit, Hans Lemberg: Reiche und<br />
Territorien in Ostmitteleuropa, Ol<strong>de</strong>nbourg Wissenschaftsverlag, 2006, S. 78-79<br />
24.↑ Norman Davies: Im Herzen Europas – Geschichte Polens. Fünftes Kapitel – Das En<strong>de</strong> einer alten Kultur, Eine historische Nation, 4 Die A<strong>de</strong>lsrepublik, 1569–1795, S. 276<br />
25.↑ Wiem, Portalwiedzy: unter Buczacki traktat<br />
26.↑ Dietmar Willoweit, Hans Lemberg: Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Ol<strong>de</strong>nbourg Wissenschaftsverlag, 2006, S. 116<br />
27.↑ Matthias Weber: Preussen in Ostmitteleuropa. Ol<strong>de</strong>nbourg Wissenschaftsverlag, 2006, S. 14–15<br />
28.↑ a b Karl Heinrich Ludwig Pölitz: Die Staatswissenschaften im Lichte unsrer Zeit. S. 148<br />
29.↑ Ernst Daniel Martin Kirchner, Arnim-Boytzenburg, David Schwartz: Das Schloss Boytzenburg und seine Besitzer. S. 335<br />
30.↑ Bernd Sösemann: Kommunikation und Medien in Preussen vom 16. Bis <strong>zu</strong>m 19. Franz Steiner Verlag, 2002, S. 119<br />
31.↑ Brigitte Esser: Daten <strong>de</strong>r Weltgeschichte<br />
32.↑ laut Wacław Szczygielski: Konfe<strong>de</strong>racja Barska w… Warszawa, 1970, S. 6, bis <strong>zu</strong> 60.000 Tote, bis <strong>zu</strong> 6.000 Mann verbannt nach Sibirien laut Zygmunt Gloger: Geografia<br />
historyczna ziem dawnej Polski.<br />
33.↑ Hans-Jürgen Bömelburg: Zwischen polnischer Stän<strong>de</strong>gesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat. S. 215<br />
34.↑ Meyers Konversationslexikon, Vierte Auflage, S. 179<br />
35.↑ Małgorzata Danecka, Thorsten Hoppe: Warschau ent<strong>de</strong>cken – Rundgänge durch die polnische Hauptstadt, Trescher-Verlag, 2008, S. 26<br />
36.↑ Dieter Schulze: Polen – <strong>de</strong>r Sü<strong>de</strong>n mit Warschau und Posen. Dumontreise-Verlag, 2008, S. 331<br />
37.↑ Carl Neyfeld: Polens Revolution und Kampf im Jahre 1831. S. 48<br />
38.↑ Richard Brettell: Mo<strong>de</strong>rn Art 1851–1929. Capitalism and Representation, Oxford University Press, 1999, S. 198.<br />
39.↑ Feliks Szyszko: The Impact of History on Polish Art in the Twentieth Century<br />
40.↑ Christoph Mick: „Den Vorvätern <strong>zu</strong>m Ruhm – <strong>de</strong>n Brü<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong>r Ermutigung“, Variationen <strong>zu</strong>m Thema Grunwald/Tannenberg. in: zeitenblicke 3 (2004), Nr. 1
41.↑ Roman Dmowski. La question polonaise, Armand Colin, Paris 1909.<br />
42.↑ Paul Roth: Die Entstehung <strong>de</strong>s polnischen Staates – Eine völkerrechtlich-politische Untersuchung. Liebmann, Berlin 1926, S. 4, Fußnote 3).<br />
43.↑ o.T. Potsdamer Abkommen<br />
44.↑ Jochen Oltmer: Migration. Zwangswan<strong>de</strong>rungen nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg.<br />
45.↑ Berna<strong>de</strong>tte Nitschke: Vertreibung und Aussiedlung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung aus Polen 1945 bis 1949. 2. Auflage 2004.<br />
46.↑ Andreas Zimmermann, Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht (Hrsg.): Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag<br />
<strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation. (= State succession with Regard to treaties: A Stocktaking), Springer, 2000, S. 173 f.<br />
47.↑ Timothy Garton Ash: We the people. The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. London 1999, S. 14<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Vorgeschichte Polens<br />
Die Vorgeschichte Polens beginnt mit <strong>de</strong>n paläolithischen Artefakten im Südteil.<br />
Paläolithikum<br />
Das Paläolithikum (die Altsteinzeit), <strong>de</strong>r längste Abschnitt in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Menschheitsgeschichte, hatte aufgrund <strong>de</strong>r dreifachen Vergletscherung auf <strong>de</strong>m Gebiete Polens einen an<strong>de</strong>ren Verlauf<br />
als südlich <strong>de</strong>r Karpaten. Die ältesten Menschenspuren einzelne altpaläolithische Steinwerkzeuge – fin<strong>de</strong>t man nur in Südpolen. Sie stammen aus <strong>de</strong>m Min<strong>de</strong>l-Riss-Interglazial und <strong>de</strong>m<br />
Riss-Glazial, das heißt aus <strong>de</strong>r Zeit zwischen 230.000 und 110.000 v. Chr. Aus <strong>de</strong>m folgen<strong>de</strong>n Riss-Würm-Interglazial und einem Teil <strong>de</strong>s Würm-Glazials (110.000 bis 40.000 v. Chr.)<br />
fin<strong>de</strong>n sich bereits mehr Spuren <strong>de</strong>r menschlichen Tätigkeit. Sie stammen gleichfalls aus Südpolen, u. a. aus Höhlen. So wur<strong>de</strong> z. B. <strong>de</strong>r Wawelhügel mitsamt Grotte in Krakau schon vor<br />
20.000 Jahren bewohnt. Die Feuersteinwerkzeuge dieser Zeit, die typologisch <strong>zu</strong>m MitteIpaläolithikum gehören, sind schon differenzierter, was sowohl <strong>de</strong>n technischen Fortschritt wie<br />
auch die Entstehung einer neuen Tradition wi<strong>de</strong>rspiegelt. Charakteristisch für das Mittelpaläolithikum sind die Feuersteinmesser <strong>de</strong>r Micoquien-Prądnik-Kultur. Am Anfang <strong>de</strong>s<br />
Jungpaläolithikums (gegen 40.000 v. Chr.) erscheint <strong>de</strong>r Homo Sapiens. Die ältesten Spuren seines Auftretens wur<strong>de</strong>n am Wawelhügel und seiner Höhle unweit von Krakau gefun<strong>de</strong>n. Die<br />
Grenze <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Menschen besie<strong>de</strong>lten Gebiete verschob sich nach Nor<strong>de</strong>n und verlief jetzt durch Mittelpolen. Die Menschen bauten schon Hütten aus Mammutknochen. Neben<br />
<strong>de</strong>m Feuerstein begann man, Knochen als Rohstoff für die Herstellung von Werkzeugen, Speerspitzen und Schmuck <strong>zu</strong> gebrauchen. Aus Zähnen wur<strong>de</strong>n Halsketten gearbeitet.<br />
Im Spätpaläolithikum (13. bis 9. Jahrtausend v. Chr.) war durch eine wesentliche Erwärmung <strong>de</strong>s Klimas ganz Polens besie<strong>de</strong>lt. Hauptbeschäftigung <strong>de</strong>r Menschen war noch immer die<br />
Jagd auf Rentiere, die die Tundra bewohnten. Aus diesem Zeitalter stammen auch die ältesten in Polen gefun<strong>de</strong>nen Menschenreste mit Indizien für Kannibalismus.<br />
Mesolithikum<br />
Mit einer weiteren Verbesserung <strong>de</strong>s Klimas begann das Mesolithikum (die Mittelsteinzeit), das bis <strong>zu</strong>m 5. Jahrtausend v. Chr. dauerte. Damals be<strong>de</strong>ckten Wäl<strong>de</strong>r Polen. In <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />
Waldmilieu angepaßten Wirtschaft spielte <strong>de</strong>r Fischfang eine große Rolle. Aus Feuerstein – noch immer <strong>de</strong>r wichtigste Rohstoff <strong>zu</strong>r Herstellung von Werkzeugen – wur<strong>de</strong>n sehr kleine
Gegenstän<strong>de</strong> gefertigt (in <strong>de</strong>r Archäologie als Mikrolithen bezeichnet), vor allem jene <strong>de</strong>n neuen Jagdmetho<strong>de</strong>n angepassten Pfeilspitzen; aus Geweihstücken waren Harpunen in<br />
Gebrauch, aus Knochen, Horn und Bernstein wur<strong>de</strong>n realistische Tierfigürchen gearbeitet. Wir kennen aus diesem Zeitalter schon Bestattungen, in <strong>de</strong>nen die Leichen mit Hämatitpulver<br />
bestreut wur<strong>de</strong>n, was zweifellos symbolische Be<strong>de</strong>utung hatte. Das Grab aus Janislawice, ist das am reichsten ausgestattete mesolithische Grab in Europa: in <strong>de</strong>r mit Hämatitpulver<br />
bestreuten Grabhöhle hat man die Leiche mit Beigaben von Pfeilspitzen, einer Zahnhalskette und Knochenmessern gefun<strong>de</strong>n.<br />
Neolithikum<br />
Das Neolithikum (die Jungsteinzeit) war eine Wen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Menschheit. Gegen 4500 v. Chr. kamen Menschen mit <strong>de</strong>r Kenntnis von Ackerbau und Haustier<strong>zu</strong>cht auch<br />
nach Polen. Die sehr wichtigen Handwerke <strong>de</strong>r Töpferei und <strong>de</strong>r Weberei haben damals ihren Anfang genommen und man begann auch neue Techniken bei <strong>de</strong>r Herstellung von<br />
Werkzeugen an<strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>n südlich <strong>de</strong>r Karpaten liegen<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn kamen Menschen, die die neue Kultur verbreiteten. Zahlreiche Fun<strong>de</strong> in Polen zeugen davon. Die ersten<br />
Ackerbauern kamen aus Mähren und gehörten <strong>de</strong>r Kultur <strong>de</strong>r Bandkeramik an. Sie ist Teil <strong>de</strong>r sehr einheitlichen Gruppe donauländischer Kulturen, die ein sehr großes Gebiet in Europa<br />
besie<strong>de</strong>lte und überall eine i<strong>de</strong>ntische Wirtschafts- und Gesellschaftsform und Religion bewahrte. Die ersten Träger <strong>de</strong>r Kultur <strong>de</strong>r Bandkeramik kamen <strong>zu</strong>erst nach Kleinpolen und<br />
Schlesien, um an Weichsel und O<strong>de</strong>r vor<strong>zu</strong>dringen. Sie besie<strong>de</strong>lten die fruchtbaren Löß- und Schwarzer<strong>de</strong>bö<strong>de</strong>n.<br />
Im 4. und 3. Jahrtausend breiteten sich neolithische Kulturen und die mit ihnen verbun<strong>de</strong>ne Lebensweise immer schneller aus. Damals erschienen die Trichterbecher- und die<br />
Kugelamphorenkultur. Die Träger dieser Kulturen, die nicht mehr <strong>zu</strong>m Donauländischen Kreis gehören, besie<strong>de</strong>lten auch die weniger fruchtbaren Bö<strong>de</strong>n. Sie sind von <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n<br />
bis <strong>zu</strong>r Ukraine, und von Skandinavien bis Bayern, Böhmen, Mähren verbreitet. Die damalige Urbanisierung wur<strong>de</strong> dank 'eines sehr großen technischen Fortschrittes möglich: man<br />
entwickelte neue Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Ackerbaues (Pflug) und <strong>de</strong>r Haustier<strong>zu</strong>cht sowie auch Transportmittel. Einzelne. Bestattungen <strong>de</strong>r Trichterbecherkultur sind insofern von Interesse, als sie<br />
für die über Europa verbreitete Megalithkultur gehören. Typisch sind monumentale, aus großen Findlingen und Felsen errichtete Gräber. In Polen fasste man damit Grabhügel ein, die eine<br />
Länge bis <strong>zu</strong> 130 Meter, eine Breite bis <strong>zu</strong> 15 Meter und eine Höhe bis <strong>zu</strong> 3 Meter erreichen. In <strong>de</strong>n Steinkammern <strong>de</strong>r Grabhügel wur<strong>de</strong>n Bestattungen einer o<strong>de</strong>r mehrerer Personen<br />
gefun<strong>de</strong>n.<br />
Die Träger <strong>de</strong>r letztgenannten Kulturen gewannen Feuerstein in großem Ausmaß, u. a. mit Bergbau-Metho<strong>de</strong>n. Ein interessanter Komplex neolithischer Feuersteingruben befin<strong>de</strong>t sich in<br />
Krzemionki Opatowskie (Südpolen). Hier hat man auf einem 4 Kilometer langen und 15 bis 120 Meter breiten Feld mehr als 3000 Schächte ent<strong>de</strong>ckt. Von <strong>de</strong>n Schächten, die ein paar<br />
Meter breit und bis 9 Meter tief sind, zweigen horizontale Gänge ab. Die Höhe <strong>de</strong>r Gewinnungskammern beträgt 0,55 bis 1,10 Meter. Stehen gelassene Felspfeiler schützten das System<br />
vor <strong>de</strong>m Einsturz, und eine sinnreiche Lüftungsanlage ermöglichte die schwere Arbeit unter Tag.<br />
Bronze- und Eisenzeit<br />
Gegen 1800 v. Chr. verän<strong>de</strong>rten Einflüsse frem<strong>de</strong>r Kulturen auf entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Weise die kulturelle Gestalt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. In <strong>de</strong>r Frühbronzezeit beherrschte weiterhin die Kultur <strong>de</strong>r<br />
Schnurkeramik. Ostpolen, In <strong>de</strong>n westlichen Gebieten entwickelte sich eine Gruppe <strong>de</strong>r mitteleuropäischen Aunjetitzer Kultur. Die Träger bei<strong>de</strong>r Kulturen gebrauchten schon Bronze, die<br />
Träger <strong>de</strong>r Aunjetitzer Kultur befassten sich mit Metallurgie. Neben <strong>de</strong>m Handwerk entwickelte sich <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l: Gold, Mittelmeermuscheln, einige Fayenceperlen zeugen von weit<br />
reichen<strong>de</strong>n Verbindungen. Spezialisiertes Handwerk und beginnen<strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l waren Faktoren, die die Entstehung von Privilegierten verursachten. Ein reiches Körpergrab wur<strong>de</strong> in Łęlki<br />
Małe ent<strong>de</strong>ckt. Unter einem vier Meter hohen und 45 Meter breiten Grabhügel war eine Steinkammer errichtet wor<strong>de</strong>n. Neben <strong>de</strong>n Skeletten eines Mannes und einer Frau und üblichen<br />
Tongefäßen fand man zahlreiche Bronzegegenstän<strong>de</strong> und Goldschmuck.<br />
Etwa ab <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. erstand aus <strong>de</strong>r Trzciniec- und <strong>de</strong>r Vorlausitzer Kultur, die Lausitzer Kultur, die in <strong>de</strong>r Vorgeschichte Polens eine wichtige Rolle gespielt hat.<br />
Interessant sind die Massengräber auf <strong>de</strong>n Gräberfel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Trzciniec-Kultur. In Wolica Nowa hat man in einem Grab 23 Skelette, in Kosin 28 Skelette (11 Frauen, 10 Männer und 7<br />
Kin<strong>de</strong>r) gefun<strong>de</strong>n. Es besteht Grund <strong>zu</strong>r Annahme, dass es sich um Familiengräber, Kriegergräber o<strong>de</strong>r Begräbnisse eines "Fürsten" mit seiner Gefolgschaft han<strong>de</strong>lt. Das Vorhan<strong>de</strong>nsein<br />
fragmentarischer Menschenreste kann auf Kannibalismus weisen. Die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Religion, die die Verbreitung <strong>de</strong>r Brandbestattung wi<strong>de</strong>rspiegelt, hat <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Entstehung<br />
<strong>de</strong>r Lausitzer Kultur gegen 1200 v. Chr. stattgefun<strong>de</strong>n. Diese Kultur war eng mit <strong>de</strong>r mitteleuropäischen Urnenfel<strong>de</strong>rkultur verbun<strong>de</strong>n. Die Lausitzer Kultur dauerte bis in die<br />
Früheisenzeit, bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hallstattzeit. In <strong>de</strong>r Bronzezeit umfasste sie fast das ganze Gebiet Polens und einen großen Teil Mitteleuropas. Die Bevölkerung beschäftigte sich mit<br />
Ackerbau und Haustierhaltung. Außer Getrei<strong>de</strong> kultivierte man Hülsen- und Ölfrüchte sowie Gemüse und Obst. Die Jagd spielte eine kleinere Rolle.
Die Träger <strong>de</strong>r Lausitzer Kultur wohnten in offenen und in befestigten Siedlungen. Die ersteren wur<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>r gesamten Dauer dieser Kultur bewohnt. Die umwallten<br />
Burgsiedlungen erschienen am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bronzezeit und spielten in <strong>de</strong>r Früheisenzeit eine wichtige Rolle. Als bekanntestes Beispiel gilt die Pfahlbausiedlung in Biskupin, nördlich von<br />
Gnesen, die um 700 v. Chr. gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> und um 400 v. Chr. von Skythen zerstört wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>n 1930 Jahren <strong>zu</strong>fällig ent<strong>de</strong>ckt, bestand die auf einer Insel angelegte Siedlung aus 106<br />
fast gleichartigen Häusern und war von einer Wehrmauer aus kistenartig aufgerichteten Holzstämmen, die mit Er<strong>de</strong> und Steinen ausgefüllt war, umgeben. Die Siedlung dürfte insgesamt<br />
gegen 1250 Einwohner gezählt haben. Während <strong>de</strong>r Antike unterhielt die Bevölkerung im Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Polen über die Bernsteinstraßen Han<strong>de</strong>lsbeziehungen mit Rom und<br />
Griechenland.<br />
Literatur<br />
• Jan Daniel Artymowaki: Altertümer aus Polen. ISBN 3-920557-36-0<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Christianisierung Polens<br />
Der Beginn <strong>de</strong>r Christianisierung Polens (polnisch Chrzest Polski) kann mit <strong>de</strong>m 14. April 966, <strong>de</strong>r Taufe von Herzog Mieszko I. von Polen, in Verbindung gebracht wer<strong>de</strong>n.[1] Über die<br />
Grün<strong>de</strong> Mieszkos <strong>zu</strong>m Christentum über<strong>zu</strong>treten ist keine schriftliche Quelle überliefert. Zum einen war es für Mieszko I. sicherlich ein wichtiges System um <strong>de</strong>n polnischen Staat <strong>zu</strong><br />
stabilisieren. Die hierarchische Struktur <strong>de</strong>r christlichen Kirche ermöglichte ihm seinen Einfluss in <strong>de</strong>r Gesellschaft <strong>zu</strong> stärken. Die bisherigen heidnischen Religionen konnten dies nicht<br />
leisten.[2] Aber die Abkehr von <strong>de</strong>n alten Göttern konnte auch Legitimationsprobleme mit sich bringen, da eine Verbindung <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Ahnen damit abgeschnitten wur<strong>de</strong>[3]. Der Übertritt<br />
<strong>zu</strong>m Christentum brachte <strong>de</strong>m polnischen Herrscher auch die Gleichstellung mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren westlichen Herrschern und ermöglichte damit bessere staatliche Beziehungen.[3] Der<br />
Geschichtsschreiber Thietmar von Merseburg hält <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>r Frau Mieszkos Dubrawa, welche selbst Christin war, für maßgeblich für Mieszkos Entschluss, <strong>zu</strong>m Christentum<br />
über<strong>zu</strong>treten.[3]<br />
Der genaue Ort <strong>de</strong>r Taufe von Mieszko I. wird diskutiert, die Historiker haben abwechselnd argumentiert, dass Gniezno, Poznań, Regensburg[4][1][2], Köln o<strong>de</strong>r sogar Rom <strong>de</strong>r Taufort<br />
von Mieszko I. gewesen sein könnte. Die Tätigkeit von Mieszko I. war erfolgreich verlaufen, <strong>de</strong>nn bis <strong>zu</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt war <strong>de</strong>r römische Katholizismus überall in Polen verbreitet<br />
und wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r dominieren<strong>de</strong>n Religion Polens.<br />
Missionsbischof von Polen wur<strong>de</strong> Jordan <strong>de</strong>r vermutlich schon <strong>zu</strong>vor am Hof Mieszkos weilte[3] und <strong>de</strong>m später auch das Bistum Posen übertragen wur<strong>de</strong>.[2] Die Herkunft Jordans ist<br />
nicht gesichert. Vermutungen, er wäre Deutscher[5], treffen vermutlich nicht. Dass er tschechischer Herkunft war ist ebenfalls umstritten.[3] Die älteste Schicht <strong>de</strong>r polnischen<br />
christlichen Kirche war böhmischer Herkunft, die Kirche war aber eigenständig, <strong>de</strong>m Papst direkt unterstellt und nicht von <strong>de</strong>r Reichskirche abhängig.[3]<br />
Der darauffolgen<strong>de</strong> Schritt in <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>s Christentums war die Errichtung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen kirchlichen Organe in Polen während <strong>de</strong>s 10. und 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Es wur<strong>de</strong>n<br />
wichtige Gebäu<strong>de</strong> wie Kathedralen und Kloster erbaut, außer<strong>de</strong>m entstand <strong>de</strong>r Klerus.<br />
Die polnische Kirche feiert 1966 „Sacrum Poloniae Millenium“ (1000 Jahre Christentum).[4] Die Volksrepublik Polen feierten dagegen „Tysiąclecie Państwa Polskiego“ (1000 Jahre <strong>de</strong>s
Polnischen Staates).[4]<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ a b Jerzy Łojek, Kalendarz Historyczny, Warschau 1994, S. 12. ISBN 83-7001-856-4<br />
2. ↑ a b c Maria Bugucka, Dawan Polska, Warschau 1998, S. 30–32. ISBN 83-85660-60-7<br />
3. ↑ a b c d e f Manfred Alexan<strong>de</strong>r, Kleine Geschichte Polens, Stuttgart 2008, S. 19–25. ISBN 978-3-15-017060-1<br />
4. ↑ a b c Andrea Schmidt-Rösler, Polen, München/Regensburg 1996, S. 15. ISBN 3-7917-1512-6<br />
5. ↑ Karl Völker, Kirchengeschichte Polens, Berlin/Leipzig 1930, S. 8<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Konfessionen in Polen<br />
Unter <strong>de</strong>n religiösen Gruppen in Polen überragt die Römisch-Katholische Kirche mit 94,5 % <strong>de</strong>r Bevölkerung alle an<strong>de</strong>ren Gruppen mit hohem Abstand.<br />
Wohl waren auch in <strong>de</strong>r Vergangenheit die polnischen Staatsbürger häufig katholisch, aber bis <strong>zu</strong>m Ausgang <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges konnte Polen als Vielvölkerstaat angesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die überwiegend östlich <strong>de</strong>r sog. Curzon-Linie ansässigen Weißrussen und Ukrainer gehörten meist <strong>de</strong>r orthodoxen, <strong>de</strong>r Ruthenisch-Katholischen Kirche bzw. <strong>de</strong>r Unierten Kirche an.<br />
Etwa 10 % <strong>de</strong>r Bewohner <strong>de</strong>s polnischen Staatsgebietes waren jüdischen Glaubens. Die in <strong>de</strong>n Großräumen Posen, Pommerellen, Lodz und Wolhynien ansässigen Deutschen waren,<br />
an<strong>de</strong>rs als die meist katholischen <strong>de</strong>utschsprachigen Ostoberschlesier, meist evangelisch. Auch die im südöstlichen „Vorkriegspolen“ ansässigen Armenier und muslimischen Tataren<br />
gehörten in <strong>de</strong>r Regel nicht <strong>de</strong>r römisch-katholischen Kirche an.<br />
Die jetzige Situation eines „ethnisch und konfessionell homogenen“ Staates ist als Ergebnis von Völkermord, Krieg, Vertreibung und vor allem <strong>de</strong>r Westverschiebung Polens 1945<br />
an<strong>zu</strong>sehen, in <strong>de</strong>ren Rahmen das Siedlungsgebiet <strong>de</strong>r meisten orthodoxen bzw. ruthenisch-katholischen Ukrainer und Weißrussen <strong>de</strong>r UdSSR angeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>.<br />
Nach <strong>de</strong>r katholischen Kirche ist die Polnisch-Orthodoxe Kirche mit 600.000 Glie<strong>de</strong>rn und Sitz <strong>de</strong>s Metropoliten in Warschau als nächstgrößte Glaubensgemeinschaft <strong>zu</strong> nennen.<br />
Die unierte Griechisch-Katholische Kirche mit 110.380 Glie<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong> nach einer Zeit <strong>de</strong>r Repression seit 1946 im Jahr 1992 faktisch wie<strong>de</strong>r anerkannt.<br />
Die „Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen“, die seit <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt als lutherische Kirche auf eine polnische Tradition <strong>zu</strong>rückblickt, umfasste vor <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg<br />
etwa 400.000 Mitglie<strong>de</strong>r, die <strong>zu</strong> etwa 75 % <strong>de</strong>utsch- und <strong>zu</strong> etwa 25 % polnischsprachig waren. Im Zuge <strong>de</strong>r Zwangsaussiedlung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschsprachigen Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m<br />
Zweiten Weltkrieg ging die Zahl <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r auf etwa 100.000 <strong>zu</strong>rück. In <strong>de</strong>r Nachkriegszeit stand die Evangelisch-Augsburgische Kirche aufgrund <strong>de</strong>r – un<strong>zu</strong>treffen<strong>de</strong>n –<br />
Gleichset<strong>zu</strong>ng von Protestantismus und <strong>de</strong>utscher Nationalität vielfach in Misskredit. Heute umfasst die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen 80.000 Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r.<br />
Evangelisch sind u.a. <strong>de</strong>r ehemalige polnische Premier Jerzy Buzek und Adam Małysz.
Die be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Min<strong>de</strong>rheitskirchen in Polen gehören <strong>de</strong>m Polnischen Ökumenischen Rat an:<br />
• Polnisch-Orthodoxe Kirche (600.000 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen (Lutheraner) (80.000 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Altkatholische Kirche <strong>de</strong>r Mariaviten (23.670 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Polnisch-Katholische Kirche (19.035 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Baptisten in Polen (4.700 Mitglie<strong>de</strong>r) - Siebenten-Tags-Baptisten, freie Baptisten (1.300) Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Evangelisch-methodistische Kirche (5.000 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Evangelisch-reformierte Kirche von Polen (Calvinisten)(4.000 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
Nichtmitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Polnischen Ökumenischen Rates sind u.a.:<br />
• Katholische Kirche <strong>de</strong>r Mariaviten (2.195 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Altkatholische Kirche in Polen (475 Mitglie<strong>de</strong>r)<br />
• Zeugen Jehovas (126.518 aktive Mitglie<strong>de</strong>r in 2009)<br />
Die Zahl <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n, 1939 3,3 Millionen, beträgt heute 5.000.<br />
Die Zahl <strong>de</strong>r Muslime beträgt etwa 25.000 – 31.000 Gläubige, davon rund 5.000 polnische Tataren, siehe Islam in Polen.<br />
Die katholische Kirche besitzt in Polen heute noch einen großen Einfluss im Alltag und auf die Politik, <strong>de</strong>r auf die Geschichte Polens nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen ist.<br />
Während <strong>de</strong>r sozialistischen Zeit empfan<strong>de</strong>n die Polen die katholische Kirche als auf ihrer Seite befindlich und fan<strong>de</strong>n dabei auch Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch <strong>de</strong>n damaligen Papst, <strong>de</strong>n Polen<br />
Johannes Paul II. Die Geschichte Polens, die vor allem in <strong>de</strong>r neueren Geschichte, seit <strong>de</strong>n Teilungen Polens am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts, durch Fremdherrschaft und nationale<br />
Unterdrückung geprägt war, machte die Polen gegen Frem<strong>de</strong>inflüsse sensibel. Deshalb kam es <strong>zu</strong>m Teil auch <strong>zu</strong> Ablehnung gegen <strong>de</strong>n Beitritt <strong>zu</strong>r EU 2004. Um so höher wird auch von<br />
jungen Polen die als neutral empfun<strong>de</strong>ne Stellung <strong>de</strong>r katholischen Kirche während dieser Entwicklung anerkannt. Demgegenüber gilt die Evangelische Kirche in Deutschland als<br />
früherer Unterstützer <strong>de</strong>s Nationalsozialismus und hat daher ein geringes Ansehen.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Königreich Polen<br />
Das Königreich Polen (polnisch Królestwo Polskie, lateinisch Regnum Poloniae) war die Bezeichnung <strong>de</strong>s polnischen Staates in <strong>de</strong>n Jahren 1000 bis 1795. Es begann entwe<strong>de</strong>r im Jahre<br />
1000 mit <strong>de</strong>r Stan<strong>de</strong>serhebung <strong>de</strong>s polnischen Herzogs Bolesław I. <strong>zu</strong>m "Bru<strong>de</strong>r und Helfer <strong>de</strong>s Römischen Reichs" durch Kaiser Otto III. o<strong>de</strong>r durch die Selbstkrönung Bolesławs I. 1025<br />
<strong>zu</strong>m König von Polen kurz vor seinem To<strong>de</strong>. Das später erweiterte Polnisch-Litauische Reich en<strong>de</strong>te 1795 mit <strong>de</strong>r Abdankung <strong>de</strong>s letzten Königs Stanisław August Poniatowski und <strong>de</strong>r<br />
Dritten Teilung Polens.
Erbmonarchie<br />
Nach <strong>de</strong>r Zersplitterung <strong>de</strong>s Königsreichs in einzelne Herzogtümer seit <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt kam es erst 1295 mit Przemysław II. wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Krönung eines Königs. Allerdings<br />
entwickelte sich auf <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s Konzepts einer Corona Regni Poloniae bald schon ein Dualismus von König und Stän<strong>de</strong> insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls.<br />
Wichtig ist die 1386 eingegangene Allianz mit <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen, in <strong>de</strong>ren Folge <strong>de</strong>r litauische Großfürst Jogaila als Władysław II. Jagiełło <strong>de</strong>n polnischen Thron bestieg und<br />
damit die Dynastie <strong>de</strong>r Jagiellonen in Polen begrün<strong>de</strong>te.<br />
Das Königreich wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Jahren 1000–1572 durch folgen<strong>de</strong> Dynastien regiert:<br />
• 1000–1370 die Piasten<br />
• 1370–1399 die Capet-Anjou<br />
• 1386–1572 die Jagiellonen<br />
Wahlmonarchie<br />
Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Jagiellonen im Mannesstamm und <strong>de</strong>r Lubliner Union wur<strong>de</strong> die Personalunion zwischen <strong>de</strong>m Königreich Polen und <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen in eine<br />
Realunion umgewan<strong>de</strong>lt. Der polnisch-litauische A<strong>de</strong>l, die Szlachta, setzte das Recht <strong>de</strong>r Freien Wahl <strong>de</strong>s Königs und Großfürsts durch. Seither stand an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s Staates, <strong>de</strong>r so<br />
genannten Rzeczpospolita, ein Wahlkönig bzw. Wahlgroßfürst in Realunion vor. Dieser Doppelstaat, auch genannt Polen-Litauen, existierte bis 1791, <strong>de</strong>m Jahr <strong>de</strong>r Mai-Verfassung.<br />
Die Rzeczpospolita Polen ging 1795 mit <strong>de</strong>r Dritten Teilung Polens unter.<br />
Die be<strong>de</strong>utendsten Dynastien von Polen-Litauen waren:<br />
• 1587–1668 die Wasa<br />
• 1697–1763 die Wettiner<br />
Kongresspolen<br />
Nach <strong>de</strong>m Untergang <strong>de</strong>r Rzeczpospolita fielen die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r polnisch-litauischen Krone an das Kaiserreich Russland, Kaiserhaus Österreich sowie das Königreich Preußen. Nach <strong>de</strong>m<br />
Wiener Kongress 1815 wur<strong>de</strong> das sogenannte Kongresspolen eingerichtet: ein formell unabhängiges „Königreich Polen“ auf Basis einer Konstitutionellen Monarchie, das nur durch eine<br />
Personalunion mit <strong>de</strong>m Russischen Kaiserreich verbun<strong>de</strong>n sein sollte. Die Vereinbarungen wur<strong>de</strong>n durch das autokratische Regime in Sankt Petersburg in <strong>de</strong>n Jahren nach <strong>de</strong>m Kongress<br />
konsequent missachtet und schleichend beschnitten. Die vereinbarten Souveränitätsrechte wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Polen nicht vollständig gewährt. Nach <strong>de</strong>m gescheiterten Novemberaufstand 1830–<br />
1831 wur<strong>de</strong> die bestehen<strong>de</strong> polnische Verwaltung unter Bruch <strong>de</strong>r Wiener Kongressakte nach 1832 durch das „Organische Statut“ liquidiert und das Gebiet faktisch als Provinz<br />
Weichselland <strong>de</strong>m Russischen Reich administrativ direkt einverleibt.<br />
Regentschaftskönigreich Polen<br />
m Verlauf <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges wur<strong>de</strong> 1916 durch die Mittelmächte ein Regentschaftskönigreich Polen proklamiert. Dies war aber eher eine gegen Russland gerichtete Maßnahme als<br />
eine Anerkennung <strong>de</strong>s Rechts <strong>de</strong>r Polen auf Eigenstaatlichkeit. Dieses Königreich existierte formell bis 1918.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Polen-Litauen<br />
Der Staat Polen-Litauen bestand von 1569 bis 1795 in Mittel- und Osteuropa. Die bei<strong>de</strong>n namensgeben<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>r, die schon seit 1386 in einer Personalunion <strong>zu</strong>sammen geführt wur<strong>de</strong>n,<br />
waren das Königreich Polen (polnisch meist einfach Korona, „die Krone“, genannt) und das Großfürstentum Litauen. Das Gebiet umfasste in seiner größten territorialen Aus<strong>de</strong>hnung um<br />
1600 die heutigen Staatsgebiete von Polen, Litauen, Lettland, Weißrussland sowie Teile Russlands, Estlands, Rumäniens und <strong>de</strong>r Ukraine.<br />
Da nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Jagiellonen-Dynastie eine Wahlmonarchie eingeführt wur<strong>de</strong> und das Stän<strong>de</strong>parlament Sejm, das im Wesentlichen <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>l vertrat, umfangreiche<br />
Kompetenzen hatte, wird oft auch von einer A<strong>de</strong>lsrepublik gesprochen, polnisch (Erste) Rzeczpospolita genannt.<br />
Das Staatswesen war ein Vielvölkerstaat, <strong>de</strong>ssen heterogene Bevölkerungsethnien <strong>de</strong>n unterschiedlichsten Glaubensbekenntnissen folgten: katholische, protestantische und orthodoxe<br />
Christen, Ju<strong>de</strong>n und Moslems lebten hier mit- und nebeneinan<strong>de</strong>r.<br />
Mit <strong>de</strong>r Realunion verschmolzen das Großfürstentum Litauen, das Königreich Polen, das Königliche Preußen und das Herzogtum Livland <strong>zu</strong> einem Gemeinwesen. Auch die ländlichen<br />
Gebiete <strong>de</strong>s Königlichen Preußen wur<strong>de</strong>n von polnischen Starosten verwaltet, jedoch erhielten sich einige Städte (Danzig, Thorn und Elbing) aber auch das Fürstbistum Ermland ein<br />
großes Maß an Autonomie. An<strong>de</strong>re Gebiete unterstan<strong>de</strong>n Polen-Litauen nur als Lehen, so das Herzogtum Preußen, das Herzogtum Kurland und Semgallen, und zeitweilig das Fürstentum<br />
Moldau. Polen-Litauen verfügte außer<strong>de</strong>m bis 1772 über die Zipser Städte, die 1421 vom Königreich Ungarn an das Königreich Polen verpfän<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n waren.<br />
Name<br />
Die offizielle Eigenbezeichnung <strong>de</strong>s Staates war (polnisch) Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego bzw. (litauisch) Žečpospolita.<br />
Da auf Polnisch auch die polnischen Republiken seit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r polnischen Souveränität als Rzeczpospolita bezeichnet wer<strong>de</strong>n, lässt <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>s Gemeinwesens sich mit<br />
„Republik <strong>de</strong>r polnischen Krone und <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen“ wie<strong>de</strong>rgeben, trotz <strong>de</strong>s geringen etymologischen Unterschieds von rzeczpospolita und rēs pūblica.[3][4][5][6] Der<br />
scheinbare Wi<strong>de</strong>rspruch von Monarchie und Republik wird durch das Wahlkönigtum aufgehoben, durch das die Könige bzw. Großfürsten nicht mehr Besitzer son<strong>de</strong>rn nur noch<br />
Amtsträger <strong>de</strong>r vereinigten Län<strong>de</strong>r waren.<br />
In historischen Quellen lateinischer Sprache fin<strong>de</strong>t sich Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. („Republik o<strong>de</strong>r Staat <strong>de</strong>s Königreiches…“, 1627)<br />
[7]und Reges et Respublica Poloniae („Könige und Republik Polens“, 1677),[8] aber auch Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae („Königreich Polen und Großfürstentum<br />
Litauen“, 1729)[9].<br />
Im Teilungstraktat <strong>zu</strong>r zweiten polnischen Teilung von 1793 steht (Franz. S(erenissime). République <strong>de</strong> Pologne.[10]<br />
Im Englischen wird Rzeczpospolita gerne mit „Commonwealth“ übersetzt, was mit Blick auf die Staatsbezeichnung Commonwealth of Australia verständlich wird.<br />
Eine möglicherweise erst im nachhinein geprägte kürzere Bezeichnung ist Republik bei<strong>de</strong>r Nationen o<strong>de</strong>r Völker (polnisch: Rzeczpospolita Obojga Narodów und Republik Polen-<br />
Litauen[11][12] litauisch: Abiejų Tautų Respublika; ruthenisch: Рѣчъ посполитая ѡбоига<br />
народовъ; ).<br />
Realunion von Lublin<br />
Durch die Lubliner Union vom 12. August 1569 wur<strong>de</strong> die in <strong>de</strong>r Union von Krewo 1385 entstan<strong>de</strong>ne Personalunion mangels Thronfolger von Polen und Litauen in eine Realunion<br />
umgewan<strong>de</strong>lt. Der neue Staat wur<strong>de</strong> „Gemeinwesen bei<strong>de</strong>r Nationen“ genannt, es war eine Wahlmonarchie mit gemeinsamer Währung, gemeinsamem Parlament (<strong>de</strong>m Sejm) und<br />
Monarchen. Beteiligt an <strong>de</strong>r Wahl war allerdings lediglich <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>r aber ungefähr 10 % <strong>de</strong>r Bevölkerung ausmachte, <strong>de</strong>utlich mehr als in <strong>de</strong>n meisten übrigen europäischen Staaten.<br />
Der nie<strong>de</strong>re polnische A<strong>de</strong>l wur<strong>de</strong> Szlachta genannt, <strong>de</strong>r hohe die Magnaten. Aufgrund seiner aristokratischen Elemente (Wahlkönigtum mit starker Stellung <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>lsparlaments Sejm)<br />
wird dieser Staat auch als A<strong>de</strong>lsrepublik bezeichnet. Er existierte bis 1795. Der Sejm hatte schon vor <strong>de</strong>r Reform von 1781 <strong>de</strong>utlich größere Befugnisse, beispielsweise in Sachen
Außenpolitik o<strong>de</strong>r auch A<strong>de</strong>lsprädikaten, als <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit das englische Parlament.<br />
Gewählte Könige<br />
Die Könige nach Knüpfung <strong>de</strong>r polnisch-litauischen Personalunion bis <strong>zu</strong>r Union von Lublin waren außer Jagiello alle in Polen geboren, bis auf einen sogar alle in <strong>de</strong>r Königsstadt<br />
Krakau.<br />
Bei <strong>de</strong>r ersten Möglichkeit, frei einen König <strong>zu</strong> wählen, entschied sich <strong>de</strong>r Sejm im Mai 1573 für einen Auslän<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>n Kapetinger Heinrich von Valois aus Frankreich. Nur ein Jahr<br />
danach verließ dieser jedoch heimlich Polen, um nach <strong>de</strong>m nahen<strong>de</strong>n Tod seines schwer kranken älteren Bru<strong>de</strong>rs Karl IX. König von Frankreich <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n. Daraufhin wur<strong>de</strong> die mit 52<br />
Jahren noch unverheiratete Anna Jagiellonica, Tochter <strong>de</strong>s vorletzten Jagiellonen Sigismunds I. <strong>de</strong>s Alten <strong>zu</strong>m König (nicht Königin) gewählt und ein männlicher Königskandidat mit <strong>de</strong>r<br />
Bedingung gesucht, sie <strong>zu</strong> ehelichen. Der Siebenbürger Ungar Stephan Báthory hatte für <strong>de</strong>n Sejm <strong>de</strong>n Vorteil, keiner <strong>de</strong>r großen europäischen Dynastien verbun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> sein. Zehn Jahre<br />
jünger als seine Frau Anna starb er doch zehn Jahre vor ihr.<br />
Anna unterstütze erfolgreich die Wahl ihres schwedischen Neffen Sigismund III. Wasa <strong>zu</strong>m König und Großfürsten im Jahre 1587. Nach <strong>de</strong>ssen Tod wählte <strong>de</strong>r Sejm nacheinan<strong>de</strong>r zwei<br />
seiner in Krakau geborenen Söhne <strong>zu</strong>m Staatsoberhaupt.<br />
Die nächsten bei<strong>de</strong>n Könige entstammten einheimischen A<strong>de</strong>lsgeschlechtern, wenn auch aus Orten, die heute nicht mehr <strong>zu</strong> Polen gehören, 1669 Michael Korybut Wiśniowiecki und 1674<br />
Johann III. Sobieski, <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>nd in die Geschichte Europas eingriff, in<strong>de</strong>m er 1683 das osmanische Heer vor Wien schlug.<br />
Mit <strong>de</strong>m sächsischen Kurfürsten August II. <strong>de</strong>m Starken wur<strong>de</strong> dann wie<strong>de</strong>r ein Auslän<strong>de</strong>r gewählt. Allerdings war das Kurfürstentum Sachsen schwächer als Polens fünf potente<br />
Nachbarn, Schwe<strong>de</strong>n, Russland, die Osmanen, das Habsburgerreich und das Königreich Preußen. Trotz<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> die polnische Politik nun stark von <strong>de</strong>n Nachbarn und Frankreich<br />
beeinflusst, was in <strong>de</strong>r mehrfachen Wahl von Gegenkönigen <strong>zu</strong>m Ausdruck kam: Stanislaus I. Leszczyński gegen August <strong>de</strong>n Starken, dann August II. gegen ihn, dann Stanislaus' zweite<br />
Wahl, dann August III., Sohn <strong>de</strong>s ersten Sachsen auf <strong>de</strong>m polnischen Thron.<br />
Mit Stanislaus II. August Poniatowski wur<strong>de</strong> 1764 ein einheimischer A<strong>de</strong>liger mit guten Beziehungen <strong>zu</strong>m russischen Zarenhof <strong>zu</strong>m, wie sich herausstellte, letzten König und Großfürsten<br />
<strong>de</strong>r polnisch-litauischen Rzeczpospolita gewählt.<br />
Politiker<br />
Die schwache Stellung <strong>de</strong>r Könige gegenüber <strong>de</strong>m Sejm ermöglichte es einigen Politikern aus <strong>de</strong>n Reihen <strong>de</strong>r Sejmabgeordneten, jeweils über Jahre entschei<strong>de</strong>nd auf die Geschicke <strong>de</strong>s<br />
Lan<strong>de</strong>s ein<strong>zu</strong>wirken. Da<strong>zu</strong> zählen Jan Zamoyski und mehrere Angehörige <strong>de</strong>r Familie Ossoliński.<br />
Blütezeit<br />
Im frühen 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt hielt sich Polen-Litauen aus <strong>de</strong>m Dreißigjährigen Krieg heraus, und expandierte nach Osten, wobei im Polnisch-Russischen Krieg 1609–1618 <strong>de</strong>r Kreml in<br />
Moskau besetzt wur<strong>de</strong> (1610), o<strong>de</strong>r die Küste am Schwarzen Meer. In <strong>de</strong>r Zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts schränkten dann die Folgen <strong>de</strong>s Zweiten Nordischen Krieges, innere<br />
Querelen, sowie die erstarken<strong>de</strong>n Nachbarn Russland und Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen die Macht von Polen-Litauen <strong>zu</strong>nehmend ein. Seit 1697 fand sich die A<strong>de</strong>lsrepublik als Teil <strong>de</strong>r<br />
Personalunion Sachsen-Polen wie<strong>de</strong>r, die mit Unterbrechungen bis 1763 währte. Im Jahre 1772 umfasste Polen-Litauen 729.900 km² und hatte rund 12 Millionen Einwohner.[13]<br />
Einheitsstaat<br />
Im Laufe <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> die Rzeczpospolita durch das Liberum Veto <strong>zu</strong>nehmend handlungsunfähig, was <strong>de</strong>n Nachbarn die Erste Teilung Polens ermöglichte. Als Konsequenz<br />
daraus und unter <strong>de</strong>m Eindruck <strong>de</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r USA und <strong>de</strong>r Französischen Revolution entstand die liberale Verfassung vom 3. Mai 1791. Sie hob die Dualität zwischen Polen<br />
und Litauen auf. Die verbliebenen Teile <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik wur<strong>de</strong>n in einem Einheitsstaat vereint. Die absolutistisch regierten Nachbarmonarchien nahmen zwei Jahre später die Zweite<br />
Teilung Polens vor, und weitere zwei Jahre später die dritte und vollständige Aufteilung – nicht <strong>zu</strong>letzt wegen Ähnlichkeiten <strong>de</strong>r reformierten polnischen Verfassung mit <strong>de</strong>rjenigen <strong>de</strong>s<br />
revolutionären Frankreich. Polen-Litauen verschwand, wie schon an<strong>de</strong>re einst souveräne Staaten, bis 1918 von <strong>de</strong>n politischen Landkarten Europas. An <strong>de</strong>n Teilungen nahmen teil: das
Königreich Preußen, das Haus Österreich und das Russische Reich.<br />
Administrative Einteilung<br />
Abgesehen von <strong>de</strong>n königlichen Freistädten (Danzig, Thorn, Elbing und Riga bis 1621) war Polen-Litauen in Woiwodschaften eingeteilt (siehe Karte). Die Einteilung <strong>de</strong>s Gebietes <strong>de</strong>r<br />
Krone Polen in die Provinzen Großpolen und Kleinpolen hatte rein traditionelle Be<strong>de</strong>utung. Einige Herrschaften waren einer Woiwodschaft gleichgestellt. Die genaue Einteilung siehe<br />
Verwaltungsglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Polnischen A<strong>de</strong>lsrepublik<br />
Rezeption<br />
Die A<strong>de</strong>lsrepublik Polen-Litauen gemeinhin als Erste Polnische Republik betrachtet,[14] wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit <strong>zu</strong>r populärsten Epoche <strong>de</strong>r Geschichtsbetrachtung in <strong>de</strong>r<br />
polnischen Gesellschaft, obgleich die Erste Polnische Republik doch alles an<strong>de</strong>re als liberal o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>mokratisch gewesen ist. Wichtig an <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong>, die sich in <strong>de</strong>r Bevölkerung von<br />
dieser Zeit gebil<strong>de</strong>t hat, ist die Tatsache, daß Polen in dieser Zeit wirklich unabhängig war.[15]<br />
Literatur<br />
• Maria Rho<strong>de</strong>: Ein Königreich ohne König. Der kleinpolnische A<strong>de</strong>l in sieben Interregna (= Quellen und Studien; 5). Harrassowitz, Wiesba<strong>de</strong>n 1997, ISBN 3-447-03912-4<br />
(Volltext).<br />
• Daniel Stone: The Polish-Lithunian State, 1386–1795 (= A History of East Central Europe; 4). University of Washington Press, Seattle 2001, ISBN 0-295-98093-1,<br />
(eingeschränkte Vorschau).<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Lat.: "Wenn Gott mit uns, wer dann gegen uns?"; seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt Pro Fi<strong>de</strong>, Lege et Rege („Für <strong>de</strong>n Glauben, das Recht und <strong>de</strong>n König“).<br />
2. ↑ a b Hans Roos: Polen von 1668 bis 1795. In: Theodor Schie<strong>de</strong>r, Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch <strong>de</strong>r Europäischen Geschichte. Band 4: Europa im Zeitalter <strong>de</strong>s Absolutismus<br />
und <strong>de</strong>r Aufklärung. Stuttgart 1968, S. 690–752, hier S. 746ff.<br />
3. ↑ lat.: rēs pūblica be<strong>de</strong>utet „öffentliche Sache“; poln.: rzecz pospolita be<strong>de</strong>utet „gemeinsame Sache“, pospolity „gemeinsam“ sowie „gemein“ in <strong>de</strong>ssen Be<strong>de</strong>utung von<br />
„gewöhnlich“, nicht von „nie<strong>de</strong>rträchtig“.<br />
4. ↑ Daute Stefan, Fiedler Adrian: Slavische nationale Min<strong>de</strong>rheiten im Ostseeraum: Beiträge <strong>zu</strong> einer Exkursion..., S.47, Universitätsverlag Potsdam, 2008 - Zitat auf Polnisch:<br />
Rzeczpospolita Korony Polskiej [Królestwa Polskiego] i Wielkiego Księstwa Litewskiego, auf Deutsch: Republik <strong>de</strong>r Polnischen Krone [<strong>de</strong>s Königreichs Polen] und<br />
Großfürstentums Litauen.<br />
5. ↑ Förster Friedrich Christoph: Die Höfe und Cabinette Europa's im achtzehnten Jahrhun<strong>de</strong>rt, S. 137, 1839 - Zitat auf Deutsch: Republik <strong>de</strong>s Königreichs Polen und<br />
„Großherzogtums“ Litauen.<br />
6. ↑ Burszta Wojciech J., Serwański Jacek: Migracja, Europa, Polska, S. 175, 2003 - Zitat auf Polnisch: Rzeczpospolita Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, auf<br />
Deutsch: Republik <strong>de</strong>s Königreichs Polen und Großfürstentums Litauen.<br />
7. ↑ http://www.xxx<br />
8. ↑ 1677 V 17 Erneuerungsvertrag von Warschau betr. Wehlau, Bromberg, siehe Google Buchsuche [1])<br />
9. ↑ http://www.xxx<br />
10.↑ Digitalisat<br />
11.↑ Davies Norman: Im Herzen Europas: Geschichte Polens, C. H. Beck Verlag, 2002.<br />
12.↑ Auf Polnisch: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Im Deutschen auch als Republik <strong>de</strong>r Bei<strong>de</strong>n Völker o<strong>de</strong>r Republik Zweier Völker bezeichnet, wobei sich das Prädikat „Völker“
viel mehr auf die Summe seiner Hauptglie<strong>de</strong>r bezieht, namentlich das Königreich Polen und das Großfürstentum Litauen, und weniger auf Völker im Sinne von „Nationen“.<br />
13.↑ Hans Roos: Polen von 1668 bis 1795. In: Theodor Schie<strong>de</strong>r, Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch <strong>de</strong>r Europäischen Geschichte. Band 4: Europa im Zeitalter <strong>de</strong>s Absolutismus und<br />
<strong>de</strong>r Aufklärung. Stuttgart 1968, S. 690–752, hier S. 746ff.<br />
14.↑ Rusanna Gaber: Politische Gemeinschaft in Deutschland und Polen. Zum Einfluss <strong>de</strong>r Geschichte auf die politische Kultur. Politische Kultur in <strong>de</strong>n neuen Demokratien<br />
Europas. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesba<strong>de</strong>n 2007, ISBN 3-531-15565-2, S. 131.<br />
15.↑ Jürgen Hartmann: Politik und Gesellschaft in Osteuropa. Eine Einführung. Campus, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-593-32555-1, S. 242.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Greifen<br />
Greifen war die Bezeichnung <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Herzöge von Pommern. Sie leitet sich von <strong>de</strong>m Wappentier, einem aufrecht schreiten<strong>de</strong>n Greifen, ab, <strong>de</strong>r erstmals in <strong>de</strong>n 1190er Jahren auf<br />
einem Siegel Herzog Kasimirs I. nachweisbar ist. Zunächst nur als Fremdbezeichnung gebraucht, verwen<strong>de</strong>te die Dynastie <strong>de</strong>n Namen Greifen seit <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt auch selbst.<br />
Der erste sicher nachweisbare Vertreter <strong>de</strong>r Dynastie ist Wartislaw I. Er musste sich 1121 als Herzog in Stettin <strong>de</strong>m polnischen Herzog Bolesław III. Schiefmund unterwerfen, <strong>de</strong>hnte<br />
jedoch in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren sein Herrschaftsgebiet über die O<strong>de</strong>r hinweg westwärts bis <strong>zu</strong>r Peene (siehe auch Demmin) aus, wahrscheinlich sogar mit polnischer Hilfe. Während<br />
seiner Herrschaft unternahm Bischof Otto von Bamberg zwei Missionsreisen nach Pommern. Die erste, von Boleslaw Schiefmund initiierte Reise führte <strong>de</strong>n Missionar in das<br />
ursprüngliche Herrschaftsgebiet Wartislaws I. östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r. Die zweite Reise unternahm er 1128 mit <strong>de</strong>utscher Unterstüt<strong>zu</strong>ng und missionierte dieses Mal in <strong>de</strong>n von Wartislaw I.<br />
unterworfenen Gebieten westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r. Wartislaw I. selbst wur<strong>de</strong> später von einem heidnischen Wen<strong>de</strong>n ermor<strong>de</strong>t.<br />
Sein Bru<strong>de</strong>r Ratibor I., Stammvater <strong>de</strong>r Ratibori<strong>de</strong>n, einer Nebenlinie <strong>de</strong>r Greifen, <strong>de</strong>r für die noch unmündigen Söhne Wartislaws die Regentschaft führte, stiftete in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r<br />
Mordstätte das erste Kloster Pommerns, Stolpe an <strong>de</strong>r Peene, westlich von Anklam. Die Wartislaws I. Nachfolger stan<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>m Druck Heinrichs <strong>de</strong>s Löwen und Dänemarks.<br />
1164,nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r Schlacht bei Verchen, wur<strong>de</strong>n die westlichen Greifen Lehnsleute Heinrichs <strong>de</strong>s Löwen. 1181 belehnte Kaiser Friedrich I. <strong>zu</strong> Lübeck Bogislaw I. als dux<br />
slavorum mit Pommern. Bogislaw I. musste sich jedoch wenige Jahre später, da er keine Hilfe von seinem Lehnsherrn, <strong>de</strong>m Kaiser, erhielt, 1185 als Vasall <strong>de</strong>n Dänen unterwerfen;<br />
Lehnseid an König Knuth VI., "König <strong>de</strong>r Dänen und Slawen". Seit 1227, <strong>de</strong>m Jahr <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved, unterstan<strong>de</strong>n die Greifen wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n römisch-<strong>de</strong>utschen Kaisern.<br />
Ratibors eigene Nachkommen hingegen regierten als Fürsten in einem kleineren Gebiet in Hinterpommern, das als Land Schlawe o<strong>de</strong>r als Herrschaft Schlawe-Stolp bezeichnet wird. Mit<br />
Ratibor II. († vor 1227) starb die Nebenlinie <strong>de</strong>r Ratibori<strong>de</strong>n aus. Es kam <strong>zu</strong> Erbstreitigkeiten um die Herrschaft Schlawe-Stolp zwischen <strong>de</strong>r westlich daran angrenzend regieren<strong>de</strong>n<br />
Hauptlinie <strong>de</strong>s Greifenhauses einerseits und <strong>de</strong>m östlich davon in Pommerellen regieren<strong>de</strong>n Herrschergeschlecht <strong>de</strong>r Sambori<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rerseits.<br />
Seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts, mit kurzer Unterbrechung 1185–1227, war das Territorium <strong>de</strong>r Greifen mit <strong>de</strong>m Reich verbun<strong>de</strong>n. Die von Bran<strong>de</strong>nburg beanspruchte Lehnshoheit (1231
durch Friedrich II. bestätigt) blieb strittig. Dennoch gingen in dieser Zeit große Gebiete im Westen und Sü<strong>de</strong>n verloren, unter an<strong>de</strong>rem Zirzipanien, das Land Stargard und <strong>de</strong>r größte Teil<br />
<strong>de</strong>r Uckermark sowie Teile <strong>de</strong>r Neumark. Das ursprünglich wohl mit <strong>de</strong>m Herrschaftsgebiet <strong>de</strong>r Greifen <strong>de</strong>ckungsgleiche Bistum Cammin ragte nun weit nach Bran<strong>de</strong>nburg und<br />
Mecklenburg hinein. Der <strong>de</strong>utschrechtliche Lan<strong>de</strong>sausbau wur<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rs durch Herzog Barnim I. geför<strong>de</strong>rt. Seit ca. 1220/1230 strömten <strong>zu</strong>nehmend <strong>de</strong>utsche Siedler in das durch die<br />
vorangegangenen Kriege, insbeson<strong>de</strong>re die Däneneinfälle im letzten Drittel <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts verwüstete Land. Zwischen 1250 und 1350 wer<strong>de</strong>n die meisten Städte nach <strong>de</strong>utschem<br />
Recht, meist entwe<strong>de</strong>r nach lübischen o<strong>de</strong>r mag<strong>de</strong>burgischem Vorbild, gegrün<strong>de</strong>t. 1295 erfolgte eine Teilung <strong>de</strong>s Greifen-Hauses in die Linien Stettin und Wolgast. Der Wolgaster Linie<br />
gelang Zugewinn <strong>de</strong>r Herrschaft Schlawe-Stolp 1317 und <strong>de</strong>s Fürstentums Rügen 1325.<br />
Unter <strong>de</strong>n Greifen <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts ragt Barnim III. von Pommern-Stettin hervor. Er stand seit 1348 in engen Beziehungen <strong>zu</strong> Karl IV., <strong>de</strong>r die Greifenherzöge aller Linien <strong>zu</strong><br />
gesamter Hand mit Pommern und Rügen als reichsunmittelbares Herzogtum belehnte und 1363 in vierter Ehe Elisabeth von Pommern, eine Tochter Bogislaws V. von Pommern-Wolgast-<br />
Stolp, heiratete. Aus dieser Ehe ging <strong>de</strong>r spätere Kaiser Sigismund hervor. Sein Enkel Barnim V. nahm auf Seiten <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns an <strong>de</strong>r Schlacht von Tannenberg 1410 teil und<br />
geriet in polnische Gefangenschaft. Aufgrund einer engeren dynastischen Anlehnung <strong>de</strong>r Stettiner Herzöge an Bran<strong>de</strong>nburg kamen bei ihnen im 14. und 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt häufiger <strong>de</strong>utsche<br />
Vornamen vor als bei <strong>de</strong>n Wolgaster Vettern, z. B. Otto II., Joachim d. Ä., Joachim d. J. und Otto III.<br />
Ab 1372 spaltete sich das Wolgaster Herzogtum in eine vor- und hinterpommersche Linie. Die hinterpommerschen Herzöge (mit Sitz in Stolp und Rügenwal<strong>de</strong>) waren ganz beson<strong>de</strong>rs in<br />
<strong>de</strong>n Kampf zwischen Polen und <strong>de</strong>m Deutscher Or<strong>de</strong>n verstrickt (so unter Bogislaw VIII. und Erich II.). Sie kamen 1455/1466 in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong> Lauenburg und Bütow (siehe auch<br />
Landkreis Bütow und Landkreis Lauenburg). Bemerkenswertester unter <strong>de</strong>n hinterpommerschen Greifen war Erich von Pommern, <strong>de</strong>r als Erich VII. von 1397 bis 1439 nordischer<br />
Unionskönig war (siehe auch Kalmarer Union). Nach seiner Abset<strong>zu</strong>ng in <strong>de</strong>n nordischen Reichen und <strong>de</strong>r Vertreibung von <strong>de</strong>r Insel Gotland kehrte Erich nach Rügenwal<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rück, wo er<br />
auch 1459 starb und begraben wur<strong>de</strong>. Um sein Erbe entbrannte ein Streit zwischen <strong>de</strong>n vorpommerschen Herzögen <strong>de</strong>r Wolgaster Linie und <strong>de</strong>m letzten Herzog von Pommern-Stettin,<br />
Otto III.<br />
Die vorpommerschen Herzöge teilten ihr Gebiet im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch weiter auf (Barth-Rügen, Wolgast). Von ihnen ist Wartislaw IX., † 1457, als lan<strong>de</strong>sherrlicher För<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>r<br />
Gründung <strong>de</strong>r Universität Greifswald 1456 <strong>zu</strong> erwähnen. Heraldisch ist das drohen<strong>de</strong> Auseinan<strong>de</strong>rdriften <strong>de</strong>r Dynastie im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt auch daran <strong>zu</strong> erkennen, dass die Wolgaster<br />
Herzöge in dieser Zeit mit <strong>de</strong>m schwarzen Greifen ein vom roten Stettiner Greifen abweichen<strong>de</strong>s Wappensymbol verwen<strong>de</strong>ten.<br />
Der bran<strong>de</strong>nburgische Versuch, sich nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Stettiner Linie (Otto III., † 1464) in <strong>de</strong>n Besitz dieses Lan<strong>de</strong>steils <strong>zu</strong> setzen, scheiterte. 1529 erkannte Bran<strong>de</strong>nburg im<br />
Vertrag <strong>zu</strong> Grimnitz die Reichsunmittelbarkeit Pommerns an, allerdings unter <strong>de</strong>m Vorbehalt <strong>de</strong>r Eventualsukzession im Falle <strong>de</strong>s Aussterbens <strong>de</strong>r Greifen in männlicher Linie. Herzog<br />
Bogislaw X. (1454-1523), <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendste <strong>de</strong>r Greifen, vereinigte 1478 alle seit 1295 getrennten Lan<strong>de</strong>steile Pommerns, das er <strong>zu</strong> einem frühneuzeitlichen Territorialstaat umgestaltete.<br />
Seine Söhne Georg I. und Barnim IX. regierten noch gemeinsam, bereiteten jedoch schon einen erneute Lan<strong>de</strong>steilung vor. Diese kam erst 1532 nach <strong>de</strong>m Tod Georgs I. zwischen <strong>de</strong>ssen<br />
damals sechszehnjährigen Sohn Philipp I. und Barnim IX. <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>. Sie teilte das Herzogtum in die Teilherrschaften Wolgast – im Wesentlichen Gebiete westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r – und Stettin –<br />
im Wesentlichen Gebiete östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r – und galt <strong>zu</strong>nächst nur für 9 Jahre. 1541 wur<strong>de</strong> sie endgültig vollzogen und bei einer erneuten Erbauseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r<br />
regierungsberechtigten Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Herzogshauses 1569 mit leichten Modifikationen bestätigt.<br />
1534 führten die Herzöge auf <strong>de</strong>m Landtag <strong>zu</strong> Treptow an <strong>de</strong>r Rega die Reformation ein. Sie schlossen sich <strong>de</strong>m Schmalkaldischen Bund an, und die 1536 geschlossene Ehe Philipps I.<br />
mit Maria von Sachsen, einer Tochter <strong>de</strong>s Kurfürsten Johann <strong>de</strong>s Beständigen von Sachsen, festigte die Beziehungen Pommerns <strong>zu</strong>r protestantischen Führungsmacht im Reich. 1556<br />
übernahmen die Greifen auch die Herrschaft im Stift Cammin, das quasi <strong>zu</strong>r Sekundogenitur <strong>de</strong>s Herzogshauses wur<strong>de</strong>.<br />
Da Barnim IX. ohne männliche Erben blieb, übernahmen die Söhne Philipps I. ab 1569 die Herrschaft in allen drei Territorien. Der älteste Sohn Johann Friedrich regierte in Stettin, <strong>de</strong>r<br />
dritte Sohn Ernst Ludwig nach <strong>de</strong>m Verzicht seines älteren Bru<strong>de</strong>rs Bogislaw XIII. in Wolgast. Die Herrschaft im Stift übernahm nach Erreichen <strong>de</strong>r Volljährigkeit ab 1574 <strong>de</strong>r jüngste<br />
Sohn Kasimir VI.. Die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Brü<strong>de</strong>r Bogislaw XIII. und Barnim X. erhielten ebenso wie <strong>de</strong>r freiwillig auf die Herrschaft verzichten<strong>de</strong> Großonkel Barnim IX. eine Apanage in<br />
Form mehrerer lan<strong>de</strong>sherrlicher Ämter.<br />
Von <strong>de</strong>n Brü<strong>de</strong>rn hatten nur Bogislaw XIII. und Ernst Ludwig Nachkommen. Während Ernst Ludwigs einziger Sohn Philipp Julius nach Erreichen <strong>de</strong>r Volljährigkeit 1601 seinem 1592<br />
verstorbenen Vater in <strong>de</strong>r Wolgaster Herrschaft folgte, übernahmen Bogislaw XIII. 1603 und nach ihm 1606 sein ältester Sohn Philipp II. die Herrschaft in Stettin. Im Stift Cammin war<br />
bereits 1602 <strong>de</strong>r zweitälteste Sohn Bogislaws XIII., Franz, seinem Onkel Kasimir VI., <strong>de</strong>r freiwillig verzichtet hatte, gefolgt. Franz übernahm 1618 die Herrschaft in Stettin und übergab
das Stift seinem jüngsten Bru<strong>de</strong>r Ulrich. Nach<strong>de</strong>m Franz bereits 1620 und Ulrich 1622 starben, übernahm <strong>de</strong>r einzig verbliebene Bru<strong>de</strong>r Bogislaw XIV. die Herrschaft in bei<strong>de</strong>n<br />
Territorien. 1625 folgte er auch noch seinem Neffen Philipp Julius in Wolgast, so dass er wie<strong>de</strong>r ganz Pommern in seiner Hand vereinigt hatte.<br />
Da Bogislaw XIV. keine eigenen Nachkommen hatte und hinsichtlich an<strong>de</strong>rer Linien und Abkömmlinge aus <strong>de</strong>m Greifengeschlechts keine Erbfolgeregelung von <strong>de</strong>n Bündnispartnern<br />
und Stän<strong>de</strong>n akzeptiert wor<strong>de</strong>n war, en<strong>de</strong>te mit seinem To<strong>de</strong> 1637 die Herrschaft <strong>de</strong>r Greifen. Damit en<strong>de</strong>te auch die staatliche Selbständigkeit Pommerns, das im Westfälischer Frie<strong>de</strong>n<br />
1648 zwischen Bran<strong>de</strong>nburg und Schwe<strong>de</strong>n geteilt wur<strong>de</strong>.<br />
Literatur<br />
• Ulrich von Behr-Negendank, Julius von Bohlen-Bohlendorf (Hrsg.): Die Personalien und Leichen-Processionen <strong>de</strong>r Herzoge von Pommern und ihrer Angehörigen aus <strong>de</strong>n Jahren<br />
1560-1663. Halle 1869.<br />
• Helmuth Bethe: Die Bildnisse <strong>de</strong>s pommerschen Herzogshauses. In: Baltische Studien, NF 39 (1937), S. 71-99.<br />
• Helmuth Bethe: Die Kunst am Hofe <strong>de</strong>r pommerschen Herzöge. Berlin 1937.<br />
• Helmuth Bethe: Die Greifen. Pommersche Herzöge 12. bis 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Katalog <strong>zu</strong>r Ausstellung 3. März bis 5. Mai 1996. Kiel 1996.<br />
• Helmuth Bethe: Kunstpflege in Pommern. Son<strong>de</strong>rausstellung alter Kunstwerke, Urkun<strong>de</strong>n und Drucke <strong>zu</strong>m Gedächtnis an das 1637 erloschene Greifengeschlecht<br />
(Ausstellungskatalog). Stettin 1937.<br />
• Edward Rymar: Rodowód książąt pomorskich [= Genealogie <strong>de</strong>r Herzöge von Pommern], 2 Bd.e, Szczecin 1995. (2. Auflage in einem Bd. Szczecin 2005).<br />
• Ro<strong>de</strong>rich Schmidt: Greifen. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 7. Duncker & Humblot, Berlin 1966, S. 29–33. Neu abgedruckt in: Ro<strong>de</strong>rich Schmidt: Das historische<br />
Pommern. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2007, ISBN 978-3-412-27805-2, S. 117-123.<br />
• Martin Wehrmann (Bearb.): Genealogie <strong>de</strong>s pommerschen Herzogshauses. Veröffentlichungen <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern, Reihe 1, Bd. 5. Stettin<br />
1937.<br />
• Martin Wehrmann: Die Begräbnisstätten <strong>de</strong>r Angehörigen <strong>de</strong>s pommerschen Herzogshauses. In: Baltische Studien, NF 39 (1937), S. 100-118.<br />
• Martin Wehrmann: Vom pommerschen Herzogshause. Zur Erinnerung an seinen Ausgang vor 300 Jahren. In: Unser Pommerland 22 (1937), Heft 1/2, S. 1-6.<br />
• Ralf-Gunnar Werlich: Greifen. In: Höfe und Resi<strong>de</strong>nzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. Resi<strong>de</strong>nzenforschung Bd. 15/1. Ostfil<strong>de</strong>rn<br />
2003, S. 74-84.<br />
• Ralf-Gunnar Werlich: Dynastie und Genealogie – Stammbäume <strong>de</strong>r Greifen. In: Melanie Ehler, Matthias Müller (Hrsg.): Unter fürstlichem Regiment. Barth als Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r<br />
pommerschen Herzöge. Berlin 2005, S. 149-185.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Pommern<br />
Pommern ist eine Region im Nordosten Deutschlands und im Nordwesten Polens, die von <strong>de</strong>r Ostseeküste und <strong>de</strong>ren vorgelagerten Inseln von knapp 50 km bis <strong>zu</strong> fast 200 km weit ins
Binnenland reicht. Der Name Pommern ist slawischer Herkunft (po more = „am Meer“). Westliche Begren<strong>zu</strong>ng ist die Recknitz. Über die Aus<strong>de</strong>hnung nach Osten gibt es Unterschie<strong>de</strong><br />
zwischen <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen und <strong>de</strong>m polnischen Sprachgebrauch.<br />
Im <strong>de</strong>utschen Sprachgebrauch wird unter Pommern im allgemeinen das Gebiet <strong>de</strong>r historischen preußischen Provinz Pommern verstan<strong>de</strong>n[1][2]. Die Provinz Pommern lag insgesamt<br />
innerhalb <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Staatsgrenzen von 1937[3] und existierte als solche von 1815 bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs. Das Gebiet setzt sich aus <strong>de</strong>m westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegenen<br />
Vorpommern und <strong>de</strong>m östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegenen Hinterpommern <strong>zu</strong>sammen. Die östlich an Hinterpommern anschließen<strong>de</strong> Landschaft bis <strong>zu</strong>r Weichsel wird Pommerellen genannt, was<br />
so viel wie „Kleinpommern“ be<strong>de</strong>utet.<br />
Im Polnischen hingegen gibt es <strong>de</strong>n Namen Pommerellen nicht. Im polnischen Verständnis bil<strong>de</strong>t Pommerellen, auch Danziger Pommern genannt, <strong>de</strong>n Kern Pommerns. Auch das Ostufer<br />
<strong>de</strong>r unteren Weichsel wird mit da<strong>zu</strong> gerechnet. Hinterpommern (teilweise mit Vorpommern) wird im Polnischen Westpommern o<strong>de</strong>r auch Stettiner Pommern genannt.<br />
Geografie<br />
Politisch verteilt sich Pommern heute auf die <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r Mecklenburg-Vorpommern und Bran<strong>de</strong>nburg sowie die polnischen Woiwodschaften Westpommern mit <strong>de</strong>r<br />
Hauptstadt Stettin (Szczecin), Pommern mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Danzig (Gdańsk), sowie Kujawien-Pommern mit <strong>de</strong>n Hauptstädten Bromberg (Bydgoszcz) und Thorn (Toruń).<br />
In <strong>de</strong>r Region liegen die Pommersche Bucht und das dahinterliegen<strong>de</strong> Stettiner Haff, auch O<strong>de</strong>rhaff genannt. Die größten Inseln vor <strong>de</strong>r Pommerschen Küste sind Usedom, Wollin<br />
(Wolin) und Rügen. Die Inseln Rügen und Usedom und die vorpommersche Bod<strong>de</strong>nküste weisen durch ein Gemisch aus Landkernen eine enge Verzahnung von Land und Meer auf und<br />
sie verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Nehrungen (hier nicht so genannt). Das vorpommersche Binnenland ist durch ein Netz von Urstromtälern geprägt, <strong>de</strong>ren Talbo<strong>de</strong>n hier nur wenig über <strong>de</strong>m<br />
Meeresspiegel liegt. Da das Stettiner Haff (O<strong>de</strong>rhaff) eine Meeresbucht ist, sind die drei Mündungsarme <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r, also Peenestrom, Swine (Świna) und Dievenow (Dziwna) keine Flüsse,<br />
son<strong>de</strong>rn Meeresarme. Zwischen Dievenow und Danziger Bucht (Zatoka Gdańska) erstreckt sich die Pommersche Ausgleichsküste. Dort wur<strong>de</strong>n die Buchten durch Strömungseinwirkung<br />
geschlossen und bil<strong>de</strong>n jetzt Strandseen, wie <strong>de</strong>n Lebasee. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ausgleichsküste ragt die Halbinsel Hela (poln. Hel) in die Danziger Bucht. Im Binnenland Hinterpommerns und<br />
Pommerellens erstreckt sich die während <strong>de</strong>s Eiszeit geformte Pommersche Seenplatte, <strong>de</strong>ren östlicher Teil auch Kaschubische Seenplatte genannt wird. Der Streifen zwischen Küste und<br />
Seenplatte heißt Slowinzisches Küstenland (Pobrzeże Slowińskie).<br />
Vorpommern liegt größtenteils im Bun<strong>de</strong>sland Mecklenburg-Vorpommern mit <strong>de</strong>n Oberzentren Stralsund und Greifswald. Der südlichste Teil Vorpommerns liegt im Bun<strong>de</strong>sland<br />
Bran<strong>de</strong>nburg und geht in seiner Aus<strong>de</strong>hnung im Sü<strong>de</strong>n bis an die Randow und die Welse. Die meisten vorpommerschen Gemein<strong>de</strong>n sind im Amt Gartz (O<strong>de</strong>r) <strong>zu</strong>sammengefasst. Die<br />
vorpommerschen Orte Schönow und Jamikow gehören <strong>zu</strong>r Gemein<strong>de</strong> Passow im Amt O<strong>de</strong>r-Welse. Die vorpommerschen Orte Kunow und Kummerow sind Teil <strong>de</strong>r Stadt Schwedt/O<strong>de</strong>r.<br />
Ein Teil Vorpommerns, <strong>de</strong>r sogenannte Stettiner Zipfel mit <strong>de</strong>r Stadt Stettin selbst, sowie <strong>de</strong>r östlichste Abschnitt <strong>de</strong>r Insel Usedom (Uznam) mit <strong>de</strong>r ehemaligen Kreisstadt Swinemün<strong>de</strong><br />
(Świnoujście) und die Insel Wollin (Wolin), gehört <strong>zu</strong>r polnischen Woiwodschaft Westpommern.<br />
Ursprung und Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Namens<br />
Der Name leitet sich vom slawischen po more ab und be<strong>de</strong>utet „am Meer“.<br />
Als lateinische Überset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Namens Pommern kann schon die Formulierung 'longum mare' (entlang <strong>de</strong>s Meeres) im Dagome-Iu<strong>de</strong>x-Dokument aufgefasst wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m Regest <strong>de</strong>r<br />
Kurie eines um 990 von Herzog Mieszko I. an <strong>de</strong>n Papst gerichteten Schreibens, das die Grenzen <strong>de</strong>s frühen polnischen Piastenstaates beschreibt. Der spanisch-arabisch-jüdische<br />
Reisen<strong>de</strong> Ibrahim ibn Jaqub besuchte – ebenfalls in <strong>de</strong>r 2. Hälfte <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts – die bis heute nicht sicher lokalisierte Han<strong>de</strong>lsstadt Vineta in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>rmündung und<br />
erwähnte auch Demmin und <strong>de</strong>n vorpommerschen Volksstamm <strong>de</strong>r Ranen. Die nächste Erwähnung Pommerns fin<strong>de</strong>t sich für das Jahr 1046 über einen Zemuzil, Herzog <strong>de</strong>r Pommern<br />
(„Zemuzil [dux] Bomeraniorum“). In <strong>de</strong>n Chroniken <strong>de</strong>s Adam von Bremen um 1070 und <strong>de</strong>s Gallus Anonymus um 1113 wird Pommern häufig erwähnt.<br />
Vorpommern und Hinterpommern in an<strong>de</strong>ren Sprachen<br />
Die polnische Bezeichnung für Vorpommern ist Pomorze Przednie o<strong>de</strong>r Przedpomorze, also die wörtliche Überset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Namens, obwohl es von Polen aus betrachtet jenseits<br />
<strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r liegt. Ins Englische kann Vorpommern sowohl mit Hither Pomerania als auch mit Western Pomerania übersetzt wer<strong>de</strong>n, so dass letzteres nicht ein<strong>de</strong>utig ist. Hinterpommern heißt
Farther Pomerania o<strong>de</strong>r Further Pomerania. Im Französischen tragen Vorpommern und Westpommern <strong>de</strong>n gleichen Namen Poméranie occi<strong>de</strong>ntale. Im Spanischen steht Pomerania<br />
Occi<strong>de</strong>ntal, Pomerania Anterior o<strong>de</strong>r Antepomerania für Vorpommern, während Hinterpommern Pomerania Central, also „Mittelpommern“, heißt.<br />
Sprache<br />
In Vorpommern wird Deutsch und als lokaler Dialekt Pommersch (Ostnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche Sprache, Platt<strong>de</strong>utsch) gesprochen.<br />
In Hinterpommern wird aufgrund <strong>de</strong>r nahe<strong>zu</strong> vollständigen Vertreibung <strong>de</strong>r Deutschen im Rahmen <strong>de</strong>r Westverschiebung Polens nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg heute fast ausschließlich<br />
polnisch gesprochen. In Pomerellen und <strong>de</strong>n östlichen Gebieten Hinterpommerns, bei Bytów (Bütow) wird von etwa 160.000 Menschen die kaschubische Sprache gesprochen. Das in<br />
früheren Zeiten in großen Teilen Hinterpommerns verbreitete Slowinzische wur<strong>de</strong> schon vor <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg nur noch von wenigen Menschen gesprochen. Seit 1945 wur<strong>de</strong> kein<br />
Gebrauch dieser Sprache mehr erwähnt.<br />
Geschichte<br />
Vor <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung war das spätere Pommern von <strong>de</strong>n ostgermanischen Stämmen <strong>de</strong>r Rugier (seit <strong>de</strong>m 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt vor Chr.) im Westen und <strong>de</strong>r Goten (seit etwa 100 vor Chr.)<br />
im Osten besie<strong>de</strong>lt. Als große Teile <strong>de</strong>rselben im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung neue Sitze im Sü<strong>de</strong>n aufsuchten, ließen sich dort ab <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 5. Jahrhun<strong>de</strong>rts slawische Stämme nie<strong>de</strong>r.<br />
Ab <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt gerieten die Stämme <strong>de</strong>s späteren Pommern in <strong>de</strong>n Einflussbereich ihrer christlichen Nachbarn. Aus <strong>de</strong>m Westen drohten ihnen die <strong>de</strong>utschen Lan<strong>de</strong>sfürsten<br />
(Sachsen ab ca. 918) und die ostmärkischen Markgrafen (Bran<strong>de</strong>nburg ab etwa 1150), bei<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reichs, vom Nor<strong>de</strong>n her die Dänen (10.–13. Jahrhun<strong>de</strong>rt) und ab<br />
970 aus <strong>de</strong>m Südosten die polnischen Piasten. Im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt gewann Polen immer wie<strong>de</strong>r aber nicht dauerhaft die Oberhoheit über Pommern. So wur<strong>de</strong> die leicht <strong>zu</strong> kontrollieren<strong>de</strong><br />
Brahe-Netze-Warthe-Linie am Nordrand <strong>de</strong>s polnischen Kernlan<strong>de</strong>s durch eine Kette von Burgen gesichert, Wyszegrod bei Fordon an <strong>de</strong>r Weichsel, Bydgoszcz (Bromberg) an <strong>de</strong>r Brahe<br />
(Brda), sowie entlang <strong>de</strong>r Netze: Nakło (Nakel) und Ujście (Usch), Czarnków (Czarnikau), Wieleń (Filehne) in <strong>de</strong>ssen Nähe und Drez<strong>de</strong>nko (Driesen). En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab es<br />
in Santok (Zantoch) an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Netze in die Warthe zwei Grenzburgen, eine polnische und ein pommersche. Bolesław III. Schiefmund unterwarf 1113 bis 1122 große Teile<br />
Pommerns und glie<strong>de</strong>rte diese <strong>de</strong>m polnischen Piastenstaat an. 1135 musste er aber seinerseits für einen Großteil dieser Gebiete die Lehnshoheit <strong>de</strong>s Reiches anerkennen. Die<br />
(west-)pommerschen Herzöge mit Sitz in Cammin unterstellten sich 1164 <strong>de</strong>r Lehnshoheit Heinrichs <strong>de</strong>s Löwen und 1181 direkt <strong>de</strong>r Lehnshoheit <strong>de</strong>s Kaisers. Jedoch eroberte Dänemark<br />
zwischen 1168 und 1186 Vor- und Hinterpommern und hielt sie bis 1227. Danach wur<strong>de</strong> Pommern, mit Ausnahme <strong>de</strong>s Fürstentums Rügen und <strong>de</strong>s ostpommerschen Herzogtums <strong>de</strong>r<br />
Sambori<strong>de</strong>n, Teil <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Auflösung.<br />
Im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt erfuhr das Reichslehen Pommern im Zuge <strong>de</strong>r Einglie<strong>de</strong>rung in die kirchlichen und weltlichen Strukturen <strong>de</strong>s Reiches und die massive Ansiedlung von<br />
Deutschen und Flamen im Zuge <strong>de</strong>r Ostsiedlung eine sowohl <strong>de</strong>mographische als auch eine wirtschaftliche und kulturelle Zäsur. Es wur<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>s nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utschen Sprachraums.<br />
För<strong>de</strong>rer dieser Entwicklung waren die Herzöge aus <strong>de</strong>m slawischen Haus <strong>de</strong>r Greifen, die Einwohnerzahl und Steuerkraft ihres Lehens steigern wollten. Zahlreiche Klöster, Städte und<br />
Dörfer wur<strong>de</strong>n neu gegrün<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r erweitert und damit in etwa die heutige Besiedlungsstruktur geschaffen.<br />
Das erste pommersche Kloster war das 1153 gegrün<strong>de</strong>te Kloster Stolpe an <strong>de</strong>r Peene. Zwei Jahre später folgte das Kloster Grobe bei Usedom. 1180 grün<strong>de</strong>ten nie<strong>de</strong>rsächsische<br />
Prämonstratenser das Kloster Belbuck. Dänische Zisterzienser grün<strong>de</strong>ten 1173 das Kloster Kolbatz, 1199 das Kloster Hilda (heute El<strong>de</strong>na) und 1186 Mönche aus Kolbatz das<br />
Zisterzienserkloster Oliva bei Danzig. Im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt grün<strong>de</strong>ten Siedler aus <strong>de</strong>n Gebieten <strong>de</strong>s heutigen Mecklenburg, Nie<strong>de</strong>rsachsen und Westfalen neue Städte nach Lübischem<br />
Recht (1234 Stralsund, 1250 Greifswald, 1255 Kolberg (Kołobrzeg), 1259 Wolgast, 1262 Greifenberg (Gryfice) und nach Mag<strong>de</strong>burger Recht (1243 Stettin (Szczecin), 1243/53 Stargard<br />
(Stargard Szczeciński), 1260 Pölitz (Police)).<br />
1295 erfolgte eine Teilung <strong>de</strong>s Herrschaftsgebietes <strong>de</strong>r Greifen in die Fürstentümer Stettin (binnenländischer Teil bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r und südlich <strong>de</strong>s Stettiner Haffs) und Wolgast<br />
(Küstengebiete, in Vorpommern nördlich <strong>de</strong>r Peene einschließlich Demmin und Anklam). Letzteres wur<strong>de</strong> bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts noch mehrfach weiter geteilt, übernahm aber<br />
nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Rügenfürsten 1325 und <strong>de</strong>n Rügischen Erbfolgekriegen das Fürstentum Rügen (Insel Rügen und gegenüber liegen<strong>de</strong>s Festland mit <strong>de</strong>n Städten Stralsund, Barth,<br />
Damgarten, Tribsees, Grimmen und Loitz). Anfang <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts erlosch mit <strong>de</strong>m polabischen Dialekt <strong>de</strong>r Rügenslawen <strong>de</strong>r letzte slawische Dialekt Vorpommerns.<br />
Ab 1534 hielt in Pommern die Reformation Ein<strong>zu</strong>g. Durch die Einziehung <strong>de</strong>r umfangreichen kirchlichen Län<strong>de</strong>reien erweiterten die Herzöge ihre Machtposition. 1536 wur<strong>de</strong> Herzog
Philipp I. von Pommern-Wolgast bei seiner Hochzeit mit Maria von Sachsen, einer Halbschwester Johann Friedrich I. von Sachsen in Torgau von Martin Luther getraut. Der pommersche<br />
Pfarrer Johannes Bugenhagen aus Treptow an <strong>de</strong>r Rega wur<strong>de</strong> als „Doctor Pomeranus“ neben Luther und Melanchthon einer <strong>de</strong>r bekanntesten Reformatoren.<br />
Unter Bogislaw XIV. wur<strong>de</strong> Pommern 1625 nochmals vereint. Die Neutralität Pommerns im Dreißigjährigen Krieg nützte <strong>de</strong>m Land nicht viel. Pommern wur<strong>de</strong> wechselseitig von <strong>de</strong>n<br />
kaiserlichen Truppen unter Wallenstein und <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n unter Gustav II. Adolf geplün<strong>de</strong>rt. Nach<strong>de</strong>m Wallenstein trotz Zusage <strong>de</strong>s Kaisers Ferdinand II. Pommern besetzte, schloss sich<br />
1628 Stralsund und 1630 (nicht ganz freiwillig) ganz Pommern <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n an.<br />
Schwedische und bran<strong>de</strong>nburg-preußische Herrschaft<br />
Durch <strong>de</strong>n Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 kam Hinterpommern an Bran<strong>de</strong>nburg, und Vorpommern wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Schwedisch-Pommern. Pommern verlor im Dreißigjährigen Krieg fast zwei<br />
Drittel <strong>de</strong>r Bevölkerung. Das Land war geteilt und lag wirtschaftlich darnie<strong>de</strong>r. Während <strong>de</strong>s Schwedisch-Polnischen Krieges (1655–1660) und auch im Schwedisch-Bran<strong>de</strong>nburgischen<br />
Krieg (1674–1679) wur<strong>de</strong> das Gebiet von schwedischen Truppen besetzt, und es wur<strong>de</strong>n die <strong>zu</strong> Festungen ausgebauten größeren Städte Stettin, Stralsund und Greifswald belagert. Dabei<br />
gelang <strong>de</strong>m bran<strong>de</strong>nburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. 1678 die Eroberung ganz Schwedisch-Pommerns. Obwohl ihm die Landstän<strong>de</strong> bereits gehuldigt hatten, musste er auf<br />
Druck Frankreichs im Frie<strong>de</strong>n von Saint-Germain (1679) auf die eroberten Gebiete mit Ausnahme <strong>de</strong>s schmalen Landstreifens östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r verzichten.<br />
Bran<strong>de</strong>nburg und später das Königreich Preußen verzichteten nie auf die Ansprüche auf das gesamte Pommern. Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Großen Nordischen Krieges (1700–1721) kam<br />
Vorpommern südlich <strong>de</strong>r Peene mit <strong>de</strong>n Inseln Usedom und Wollin <strong>zu</strong>m Königreich Preußen, welches dieses Gebiet bereits seit 1713 unter Sequester verwaltete. Auf <strong>de</strong>m flachen Land<br />
setzte sich im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Gutswirtschaft im vollen Umfang durch. Begleiterscheinung waren leibeigenschaftsähnliche Rechts<strong>zu</strong>stän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r abhängigen Landbevölkerung<br />
und das sogenannte Bauernlegen, das heißt die Einziehung von Bauernstellen <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Gutsbetriebe.<br />
Dagegen schritten die preußischen Könige aus militärischen Erwägungen seit <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein und verboten das weitere Einziehen <strong>de</strong>r Bauernstellen, um die<br />
Rekrutierung <strong>de</strong>r Soldaten auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s Kantonswesens nicht <strong>zu</strong> gefähr<strong>de</strong>n. In Schwedisch-Pommern unterblieb ähnliches, und so erreichte am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts hier<br />
die Gutswirtschaft einen ähnlichen Höhepunkt wie im benachbarten Mecklenburg. Ernst Moritz Arndt, selbst Sohn eines freigelassenen Leibeigenen, geißelte die damit im<br />
Zusammenhang stehen<strong>de</strong>n Praktiken in mehreren Schriften <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit von 1816 bis 1945 hat sich die territoriale Verwaltungsglie<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r überwiegend landwirtschaftlich strukturierten Provinz Pommern nur allmählich verän<strong>de</strong>rt.<br />
Nach 1945<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong> Pommern im Frühjahr 1945 durch die Rote Armee erobert und in <strong>de</strong>r Folgezeit durch Festlegung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-polnischen Grenze entlang <strong>de</strong>r<br />
O<strong>de</strong>r-Neiße-Linie geteilt.<br />
Bereits kurz nach <strong>de</strong>r Eroberung wur<strong>de</strong>n die Gebiete östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r und <strong>de</strong>r Swine unter polnische Verwaltung gestellt. Erst am 3. Juli 1945 wur<strong>de</strong> auch die westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegene<br />
Provinzhauptstadt Stettin von <strong>de</strong>r Sowjetunion an Polen übergeben, nach<strong>de</strong>m dort <strong>zu</strong>nächst eine polnische und eine <strong>de</strong>utsche Stadtverwaltung neben- und gegeneinan<strong>de</strong>r gearbeitet hatten.<br />
Selbst die <strong>de</strong>utschen Kommunisten waren von diesem Schritt überrascht.<br />
Den genauen Verlauf <strong>de</strong>r Grenze legte eine sowjetisch-polnische Kommission am 21. September 1945 in Schwerin fest. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Wochen verschob jedoch das polnische Militär<br />
die Grenze im Umland von Stettin eigenmächtig noch weiter nach Westen. Die <strong>de</strong>utsche Bevölkerung in <strong>de</strong>n an Polen gefallenen Gebieten wur<strong>de</strong> aus ihrer Heimat vertrieben<br />
beziehungsweise später ausgesie<strong>de</strong>lt. Diese Maßnahmen waren <strong>zu</strong>vor durch die Beschlüsse <strong>de</strong>r Konferenz von Potsdam im August 1945 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Ostgebieten <strong>de</strong>s Deutschen Reiches<br />
beschlossen wor<strong>de</strong>n.<br />
Gegenwart<br />
Mit <strong>de</strong>m Beitritt <strong>de</strong>r DDR <strong>zu</strong>m Geltungsbereich <strong>de</strong>s Grundgesetzes <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland wur<strong>de</strong> 1990 das Land Mecklenburg-Vorpommern neu konstituiert, jedoch mit<br />
verän<strong>de</strong>rtem Gebiets<strong>zu</strong>schnitt. Mit <strong>de</strong>m Zwei-plus-Vier-Vertrag erfolgte durch die Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland die endgültige vertragliche Anerkennung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-polnischen O<strong>de</strong>r-
Neiße-Grenze und somit auch <strong>de</strong>r Zugehörigkeit Hinterpommerns <strong>zu</strong> Polen. Durch die Kreisgebietsreform von 1994 wur<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem die Landkreise Nordvorpommern,<br />
Ostvorpommern und Uecker-Randow gebil<strong>de</strong>t. Nordvorpommern, Uecker-Randow sowie seit seiner Vergrößerung <strong>de</strong>r Landkreis Demmin vereinigen altes pommersches und altes<br />
mecklenburgisches Gebiet.<br />
Um die getrennten Gebiete wie<strong>de</strong>r näher <strong>zu</strong>einan<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> bringen, wur<strong>de</strong> im Rahmen <strong>de</strong>r europäischen Zusammenarbeit die Euroregion Pomerania gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Quellennachweis<br />
1. ↑ Bertelsmann – Das Neue Universallexikon, Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2007, S. 757, ISBN 978-3-577-09099-5.<br />
2. ↑ Der Brockhaus in einem Band, Brockhaus Verlag, 12. Auflage, Leipzig/Mannheim 2006, S. 698, ISBN 3-7653-1682-2.<br />
3. ↑ d.h., <strong>de</strong>r Staatsgrenzen, die vor Unterzeichnung <strong>de</strong>s Münchner Abkommens von 1938 völkerrechtlich in Kraft waren.<br />
Literatur<br />
• Thomas Heinrich Ga<strong>de</strong>busch: Schwedisch-Pommersche Staatskun<strong>de</strong>. 2 Bän<strong>de</strong>. Greifswald und Dessau 1783–1786.<br />
• Thomas Kantzow: Pomerania. O<strong>de</strong>r Ursprunck, Altheit und Geschichte <strong>de</strong>r Völcker und Lan<strong>de</strong> Pomern, Caßuben, Wen<strong>de</strong>n, Stettin, Rhügen. In vierzehn Büchern. Hrsg. von<br />
Johann Gottfried Ludwig Kosegarten, 2 Bän<strong>de</strong>. Mauritius, Greifswald 1816–1817. (Digitalisat)<br />
• [Friedrich Thie<strong>de</strong>?:] Pomerania. Geschichte und Beschreibung <strong>de</strong>s Pommernlan<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>r För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r pommerschen Vaterlandskun<strong>de</strong>. 2 Bän<strong>de</strong>. Stettin 1844ff. Mit 109<br />
Städtansichten das ikonographische Werk.<br />
• Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern. 2 Bän<strong>de</strong>. Gotha 1919–1921.<br />
• Martin Spahn: Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte <strong>de</strong>s Herzogtums Pommern von 1476 bis 1625, Leipzig 1896.<br />
• Bruno Schumacher: Geschichte Ost- und Westpreussens. Würzburg 1959<br />
• Hans Branig: Geschichte Pommerns. Von 1648 bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Köln u. a. 1999, ISBN 3-412-09796-9.<br />
• Norbert Buske: Pommern. Territorialstaat und Lan<strong>de</strong>steil von Preußen. Schwerin 1997<br />
• Werner Buchholz (Hrsg.): Pommern. (= Deutsche Geschichte im Osten Europas; Bd. 9). Berlin 1999.<br />
• Ro<strong>de</strong>rich Schmidt: Das historische Pommern', Böhlau Verlag, Köln/Weimar 2006, ISBN 978-3-412-27805-2.<br />
• Gerhard Kobler: Historisches Lexikon <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Län<strong>de</strong>r – Die <strong>de</strong>utschen Territorien vom Mittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, C. H. Beck, München 2007, 7. Auflage, ISBN 978-3-<br />
406-54986-1.<br />
• Monika und Stephan Wolting: Dies ist Pommern. Ein literarisch-künstlerischer Reisebegleiter, Neisse Verlag, Dres<strong>de</strong>n 2009, ISBN 978-3-934038-81-3.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Herzogtum Pommern
Herzogtum Pommern ist die heute übliche Bezeichnung für das Herrschaftsgebiet <strong>de</strong>r aus slawischer Wurzel stammen<strong>de</strong>n Fürstendynastie <strong>de</strong>r Greifen, das in wechseln<strong>de</strong>r räumlicher und<br />
politischer Aufteilung vom 12. bis <strong>zu</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r historischen Landschaft Pommern bestand. Auf <strong>de</strong>m Gebiet Pommerns, gelegen an <strong>de</strong>r Südküste <strong>de</strong>r Ostsee auf<br />
bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>s Flusses O<strong>de</strong>r, bestehen heute <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>steil Vorpommern <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern sowie die Woiwodschaft Westpommern und <strong>zu</strong> einem<br />
kleineren Teil die Woiwodschaft Pommern in <strong>de</strong>r Republik Polen.<br />
Überblick<br />
In Pommern gab es im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte mehrere Herzogtümer, <strong>de</strong>ren geographischer und politischer Bestand sich durch Vereinigungen und Aufteilungen mehrfach än<strong>de</strong>rte. Die in<br />
diesen Territorien herrschen<strong>de</strong>n Herzöge wer<strong>de</strong>n dabei, entsprechend <strong>de</strong>m Greifen als gemeinsamen pommerschen Wappentier, <strong>zu</strong>sammenfassend als Greifenherzöge bezeichnend. Zu <strong>de</strong>n<br />
Teilherzogtümern in Pommern, <strong>de</strong>ren Namens<strong>zu</strong>satz in <strong>de</strong>r Regel <strong>de</strong>m jeweiligen Herrschaftssitz entspricht, zählen<br />
• das Herzogtum Barth (1372–1451)<br />
• das Herzogtum Pommern-Demmin (etwa 1170–1264)<br />
• das Herzogtum Pommern-Stettin (etwa 1170/1295–1464, 1532/41–1625/37)<br />
• das Herzogtum Pommern-Wolgast (1295–1474/8, 1532/41–1625/37)<br />
• das Herzogtum Pommern-Stolp (1368/72–1459)<br />
Während dieser Zeit bestand in diesem Gebiet seit 1140 das Bistum Cammin. Der Bischofssitz befand sich von 1140 bis etwa 1150/55 <strong>zu</strong>nächst in Wollin, dann vorübergehend in Usedom<br />
und schließlich ab 1178 in Cammin. Im Zuge <strong>de</strong>r Reformation verlor es seine kirchenleiten<strong>de</strong>n Funktionen und das weltliche Herrschaftsgebiet <strong>de</strong>r Camminer Bischöfe, das Stift Cammin,<br />
kam 1556 durch die Wahl <strong>de</strong>s Prinzen Johann Friedrich ebenfalls in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>s Greifenhauses, bei <strong>de</strong>m es bis <strong>zu</strong>m Tod <strong>de</strong>s letzten Herzogs verblieb. Allerdings gehörte das Gebiet <strong>de</strong>s<br />
1325 von <strong>de</strong>n Greifen erworbenen Fürstentums Rügen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Bistümern Schwerin (festländischer Teil) und Roskil<strong>de</strong> (Insel Rügen).<br />
Entwicklung<br />
Entstehung <strong>de</strong>s Herzogtums<br />
Um 995 unterwarf <strong>de</strong>r polnische Herzog Boleslaw I. (<strong>de</strong>r Tapfere) das Land östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r. Im Zuge <strong>de</strong>r Polenkriege zwischen 1005 und 1013 erlangte Pommern seine Unabhängigkeit<br />
wie<strong>de</strong>r. Frühe Versuche <strong>de</strong>r Christianisierung dieses Gebietes scheiterten. Der seit 1042 andauern<strong>de</strong> Konflikt <strong>de</strong>s Pommernfürsten Siemomysl mit <strong>de</strong>m polnischen Herzog Kasimir I.<br />
wur<strong>de</strong> 1046 vor Kaiser Heinrich III. verhan<strong>de</strong>lt. Um 1100 wer<strong>de</strong>n mehrere pommersche Herzöge genannt, die aber aufgrund <strong>de</strong>r spärlichen Überlieferung in keinen genealogischen<br />
Zusammenhang <strong>zu</strong> bringen sind. Die historischen Stammbäume <strong>de</strong>r Greifen aus <strong>de</strong>m 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt nennen zwar als Ahnherrn einen Swantibor, aber seine tatsächlichen<br />
verwandtschaftlichen Beziehungen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Generationen sind nicht ein<strong>de</strong>utig belegbar. Dasselbe gilt für die an<strong>de</strong>ren <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>n Quellen -<br />
vornehmlich polnischen Chroniken - genannten Herzöge von Pommern. Deshalb wer<strong>de</strong>n die Brü<strong>de</strong>r Wartislaw I. und Ratibor I. heute übereinstimmend als die ersten Fürsten aus <strong>de</strong>m<br />
Greifengeschlecht angesehen.<br />
1121 hatte sich Wartislaw I. <strong>de</strong>m polnischen Herzog Bolesław III. Schiefmund unterworfen. Boleslaw versuchte seine Herrschaft über die Pommern durch die Einführung <strong>de</strong>s<br />
Christentums weiter ab<strong>zu</strong>sichern. Der erste Missionsversuch eines spanischen Priesters in Wollin misslang jedoch. Im Mai 1124 brach Otto von Bamberg von Gnesen <strong>zu</strong> seiner ersten<br />
Missionsreise auf, die ihn über Pyritz nach Cammin und Stettin führte. Bereits im Februar 1125 kehrte er nach Gnesen <strong>zu</strong>rück. Auf seiner zweiten Missionsreise erreichte Otto von<br />
Bamberg im Jahre 1128 Demmin und Usedom. Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Pommernfürsten Wartislaw I. entstan<strong>de</strong>n unter seinen Söhnen Kasimir I. und Bogislaw I. gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts die bei<strong>de</strong>n Teilherzogtümer Pommern-Demmin und Pommern-Stettin. Bogislaw I. wur<strong>de</strong> 1181 in Lübeck als „Herzog von Slavien“ in <strong>de</strong>n Reichsfürstenstand erhoben, aber<br />
bereits 1185 musste er die dänische Oberhoheit anerkennen, die Pommern erst nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved (1227) wie<strong>de</strong>r abschütteln konnte. Der erneuten Aufnahme in <strong>de</strong>n<br />
Reichsfürstenstand stellten sich nun die askanischen Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg entgegen, die von Kaiser Friedrich II. 1231 mit <strong>de</strong>m Herzogtum Pommern belehnt wor<strong>de</strong>n waren. Sie<br />
beanspruchten die Lehnshoheit über Pommern und setzten sie in <strong>de</strong>n Verträgen von Kremmen 1236 und Landin 1250 auch weitestgehend durch, wobei ihnen noch <strong>de</strong>r Erwerb<br />
umfangreicher Län<strong>de</strong>reien, u.a. das Land Stargard und die Uckermark, gelang.
Herzogtum Pommern-Demmin<br />
Kasimir I. von Demmin war <strong>de</strong>r erste Herzog ab 1170. Bereits am 17. Mai 1264 erlosch diese Linie mit <strong>de</strong>m Tod von Wartislaw III., eines Enkels von Bogislaw I., wie<strong>de</strong>r. Wartislaw III.<br />
verlor 1236 das Land Zirzipanien westlich von Demmin an die Herren von Mecklenburg und im selben Jahr auch das Land Stargard, das spätere Mecklenburg-Strelitz, an Bran<strong>de</strong>nburg.<br />
Zugleich stellt diese Zeit <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschrechtlichen Besiedlung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s (siehe <strong>de</strong>utsche Ostsiedlung) dar.<br />
Herzogtum Pommern-Stettin<br />
Bogislaw I. herrschte über Pommern-Stettin und heiratete Anastasia von Polen, die Tochter Mieszko III. Unter seinem Enkel Barnim I. wur<strong>de</strong> seit 1230 verstärkt die <strong>de</strong>utsche Besie<strong>de</strong>lung<br />
<strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s betrieben und zahlreiche Städte nach lübischem Recht gegrün<strong>de</strong>t. Mit <strong>de</strong>m Vertrag von Landin von 1250 ging die bislang pommersche Uckermark an Bran<strong>de</strong>nburg. Nach <strong>de</strong>m<br />
Tod Wartislaws III. kam <strong>de</strong>ssen Herrschaftsgebiet 1264 an Barnim. Seine Söhne Bogislaw IV., aus erster Ehe, und Otto I., aus zweiter Ehe, teilten nach <strong>de</strong>m frühen Tod ihres Halbbru<strong>de</strong>rs<br />
bzw. Bru<strong>de</strong>rs Barnim II. 1295 das Herzogtum in die Teilherrschaften Pommern-Wolgast unter Bogislaw IV. und Pommern-Stettin unter Otto I., wobei die dynastische Verbindung durch<br />
das Rechtsinstitut <strong>de</strong>r gesamten Hand aufrechterhalten wur<strong>de</strong>.<br />
Herzogtum Pommern-Wolgast<br />
Das Herzogtum Pommern-Wolgast wur<strong>de</strong> 1295 durch Bogislaw IV. begrün<strong>de</strong>t. Seinem Sohn Wartislaw IV. gelang 1317 <strong>de</strong>r Erwerb <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r Schlawe-Stolp aus <strong>de</strong>r Erbmasse <strong>de</strong>s 1295<br />
erloschenen Herzogshauses <strong>de</strong>r Sambori<strong>de</strong>n. Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Fürsten von Rügen Wizlaw III. fiel 1325 das Fürstentum Rügen an Pommern-Wolgast. In <strong>de</strong>n Jahren 1368 und 1372<br />
wur<strong>de</strong> die Teilung von Pommern-Wolgast in Hinterpommern, das an Bogislaw V. fiel, und Vorpommern, das an die Söhne Barnims IV., Bru<strong>de</strong>r Bogislaws V., ging, beschlossen. Der dritte<br />
Bru<strong>de</strong>r Wartislaw V. erhielt <strong>zu</strong>nächst eine Abfindung, 1372 dann Neustettin, das nach seinem kin<strong>de</strong>rlosen Tod wie<strong>de</strong>r an Pommern-Wolgast <strong>zu</strong>rück fiel.<br />
Im Jahr 1456 wur<strong>de</strong> die Universität Greifswald gegrün<strong>de</strong>t. Von 1478 bis 1523 kam es nochmals <strong>zu</strong> einer Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n pommerschen Herzogtümer unter Bogislaw X. Bereits<br />
1523 wur<strong>de</strong> Pommern jedoch wie<strong>de</strong>rum in zwei Herzogtümer geteilt. Unter Johannes Bugenhagen kam es 1534 <strong>zu</strong>r Reformation im Herzogtum.<br />
Herzogtum Pommern-Stolp<br />
Nach <strong>de</strong>m, am 15. Mai 1368 in Anklam geschlossenen, Vergleich, <strong>de</strong>r am 8. Juni 1372 im Stargar<strong>de</strong>r Vertrag bestätigt wur<strong>de</strong>, entstand östlich <strong>de</strong>r Swine das Herzogtum Pommern-Stolp<br />
unter Bogislaw V. Nach seinem Tod im Jahr 1374 folgten ihm seine Söhne Kasimir IV., <strong>de</strong>r 1377 starb, Barnim V. sowie Bogislaw VIII.. Nach <strong>de</strong>ssen Ableben im Jahr 1418 führte sein<br />
Witwe Sophia von Holstein bis <strong>zu</strong>r Volljährigkeit ihres Sohnes Bogislaw IX. die Regentschaft bis 1425. Nach <strong>de</strong>m Tod von Bogislaws IX. im Jahr 1446 kehrte Erich I. 1449 nach<br />
Rügenwal<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rück und residierte dort als Herzog von Pommern-Stolp. Nach <strong>de</strong>ssen Tod 1459 übernahm Erich II., Herzog von Pommern-Wolgast, auch die Herrschaft in Rügenwal<strong>de</strong>-<br />
Stolp. Nach Erich II. († 1474) vereinigte sein Sohn Bogislaw X. ganz Pommern unter seiner Hand und das Herzogtum Pommern-Stolp hörte <strong>de</strong>m Namen nach auf <strong>zu</strong> existieren.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Herzogtums in Pommern<br />
Im Zuge <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges geriet Pommern 1630 <strong>zu</strong>nächst unter schwedische Herrschaft. Im Jahr 1637 starb Bogislaw XIV. als letzter Herzog Pommerns kin<strong>de</strong>rlos. Bis <strong>zu</strong>m<br />
Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 wur<strong>de</strong> das gesamte Gebiet Pommerns von Schwe<strong>de</strong>n verwaltet, anschließend wur<strong>de</strong> es in das <strong>zu</strong>m Kurfürstentum Bran<strong>de</strong>nburg gehören<strong>de</strong> Hinterpommern<br />
und das weiterhin als Schwedisch-Pommern bei Schwe<strong>de</strong>n verbleiben<strong>de</strong> Vorpommern geteilt. Nach <strong>de</strong>m Großen Nordischen Krieg von 1700 bis 1721 kam <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>r südlich <strong>de</strong>r Peene<br />
gelegene Teil Vorpommerns an das Königreich Preußen, nach <strong>de</strong>m Wiener Kongress im Jahr 1815 dann auch <strong>de</strong>r nördliche Teil. Pommern bestand anschließend bis 1945 als Provinz unter<br />
bran<strong>de</strong>nburg-preußischer Herrschaft.<br />
Literatur<br />
• Johann Jakob Sell: Geschichte <strong>de</strong>s Herzogtums Pommern. 1. Teil, Berlin 1819 (Volltext); 2. Teil, Berlin 1819 (Volltext); 3. Teil, Berlin 1820 (Volltext).<br />
• Wilhelm v. Sommerfeld: Geschichte <strong>de</strong>r Germanisierung <strong>de</strong>s Herzogtums Pommern o<strong>de</strong>r Slavien bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Duncker & Humblot, Leipzig 1896.
(Nachdruck: Elibron Classics 2005, ISBN 1-4212-3832-2 und ISBN 1-4212-3831-4, eingeschränkte Vorschau)<br />
• Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern. Band 1. 2. Auflage. Verlag Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1919. (Nachdruck: Augsburg 1992, ISBN 3-89350-112-6)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Pommerellen<br />
Pommerellen, früher auch Pomerellen, ist eine sich über große Teile <strong>de</strong>r Ostseeküste erstrecken<strong>de</strong> Landschaft an <strong>de</strong>r Weichselmündung, die bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges im<br />
Westen an die preußische Provinz Pommern grenzte und im Osten bis an die Weichsel reichte. Wie die Stadt Danzig wechselte auch Pommerellen in <strong>de</strong>n letzten 1.000 Jahren mehrfach<br />
zwischen slawischen und <strong>de</strong>utschen Herrschern. Zwischen <strong>de</strong>n Weltkriegen wur<strong>de</strong> das Gebiet <strong>zu</strong>m Zankapfel <strong>de</strong>r Weltpolitik, nach<strong>de</strong>m es im Versailler Vertrag aus Westpreußen<br />
herausgelöst und in Polnischen Korridor und Freie Stadt Danzig aufgeteilt wor<strong>de</strong>n war.<br />
Name<br />
Der <strong>de</strong>utsche Name „Pommerellen“ ist eine Verkleinerungsform (Suffix „-elle“) von „Pommern“.<br />
Im nie<strong>de</strong>rländischen Atlas Theatrum Orbis Terrarum von Abraham Ortelius aus <strong>de</strong>m späten 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird „Pomerella“ als ehemalige Provinz <strong>de</strong>s Fürsten von Pommern<br />
(„Pomoraniae principis“) bezeichnet und <strong>de</strong>r Name auch auf das östliche Weichselufer bezogen.<br />
Der Atlas Blaeu von 1645 trennte „Pomerellia“ vom rechts <strong>de</strong>r Weichsel gelegenen „Pomesania“.<br />
Das Polnische kennt die Bezeichnung „Pommerellen“ nicht und fasst die gesamte Danziger Gegend am linken wie am rechten Ufer <strong>de</strong>r unteren Weichsel unter <strong>de</strong>m Namen „Pomorze<br />
Gdańskie“ („Danziger Pommern“) – auch „Pomorze Wschodnie“ („Ostpommern“) o<strong>de</strong>r „Pomorze Nadwiślańskie“ („Weichselpommern“) genannt – <strong>zu</strong>sammen. So spricht beispielsweise<br />
<strong>de</strong>r polnische Politiker Julian Ursyn Niemcewicz mit Be<strong>zu</strong>g auf das „Danziger Pommern“ im frühen 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt von „unserem Pommern“ in Abgren<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong>m weiter westlich<br />
gelegenen „Hinterpommern“[1]. Für <strong>de</strong>n nördlichen Teil Pommerellens verwen<strong>de</strong>t das Polnische <strong>de</strong>n Namen Kas<strong>zu</strong>by (Kaschubei). Der kaschubische Name lautet Kaszëbë (Kaschubei) -<br />
(„Pòrénkòwô Pòmòrskô“).<br />
Land<br />
Die westliche Abgren<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> Hinterpommern hat sich im Laufe <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte mangels natürlicher Hin<strong>de</strong>rnisse immer wie<strong>de</strong>r verschoben. Der westlichste Grenzverlauf lag an <strong>de</strong>r<br />
Persante, <strong>de</strong>r östlichste an <strong>de</strong>r Grenze <strong>de</strong>r preußischen Provinzen Pommern und Westpreußen nach 1772. Im Sü<strong>de</strong>n grenzt Pommerellen an Großpolen und Kujawien. In <strong>de</strong>r Frühzeit lag<br />
die Südgrenze Pommerns in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Netze, seit <strong>de</strong>r Eroberung Pommerellens durch <strong>de</strong>n Deutschor<strong>de</strong>nsstaat lag <strong>de</strong>ssen Südgrenze weiter nördlich. Als östliche Begren<strong>zu</strong>ng<br />
Pommerellens gilt die Weichsel und ihr Delta.<br />
Geologisch besteht Pommerellen aus <strong>de</strong>r Grund- und Endmoränenlandschaft <strong>de</strong>s Baltischen Landrückens zwischen Persante und <strong>de</strong>r unteren Weichsel. Hier befin<strong>de</strong>t sich auch <strong>de</strong>r östliche<br />
Teil <strong>de</strong>r Pommerschen Seenplatte mit <strong>de</strong>m Weitsee, die südlich in die Tucheler Hei<strong>de</strong> übergeht.
Die Bevölkerung wur<strong>de</strong> seit etwa <strong>de</strong>m Jahre 1000 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Pomoranen gerechnet, ein Teil davon seit etwa 1200 Kaschuben genannt. Ihre Sprache gehört wie die polnische <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
lechischen Sprachen.<br />
Geschichte<br />
Frühgeschichte<br />
Etwa um 100 nannte <strong>de</strong>r römische Historiker Publius Cornelius Tacitus[2] neben an<strong>de</strong>ren germanischen Völkern auch die Goten als Bewohner <strong>de</strong>s Weichsel<strong>de</strong>ltas. Die archäologische<br />
Hinterlassenschaft <strong>de</strong>r Goten, Wielbark-Kultur genannt, war eine Mischkultur aus skandinavischen und an<strong>de</strong>ren Elementen. Etwa um 200 begannen Goten, das Weichselgebiet <strong>zu</strong><br />
verlassen und nach Südosten <strong>zu</strong> wan<strong>de</strong>rn. Baltische Aesten gingen wie<strong>de</strong>r weiter westlich, wo sie vor <strong>de</strong>n Goten schon lebten. Westslawische Stämme verbreiteten sich seit 600 und<br />
kamen auch nördlich bis an die Ostsee auf das Gebiet <strong>de</strong>s späteren Pommern. Seit Mitte <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts fin<strong>de</strong>t man westliche Polanen. Vom 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt bis <strong>zu</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
haben auch Wikinger und ihnen folgend Dänen Spuren an <strong>de</strong>r Küste Pommerellens hinterlassen. Namen wie Oxhöft, Rixhöft, Heisternest und Hela (englisch „heel“) bezeugen dauerhafte<br />
wikingische Han<strong>de</strong>lssiedlungen. Trotz skandinavischer Stützpunkte an <strong>de</strong>r südlichen Ostseeküste und einer unscharfen Siedlungsgrenze zwischen slawischen Pomoranen und baltischen<br />
Prußen war das Gebiet westlich <strong>de</strong>r unteren Weichsel im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>m großen Teil slawisch besie<strong>de</strong>lt.<br />
Die Lage an <strong>de</strong>r Weichselmündung brachte <strong>de</strong>r Gegend schon <strong>zu</strong> allen Zeiten intensive Kontakte nach Sü<strong>de</strong>n. Die Bernsteinstraße führte seit <strong>de</strong>r Jungsteinzeit vom Samland über das<br />
Weichsel<strong>de</strong>lta südwärts bis an die Adria. Zahlreiche arabische Silbermünzen <strong>de</strong>s 8. bis 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts, vielfach <strong>zu</strong> „Hacksilber“ zerkleinert, wur<strong>de</strong>n in Pommerellen gefun<strong>de</strong>n. Sie<br />
können durch Han<strong>de</strong>ls- o<strong>de</strong>r Beutefahrten <strong>de</strong>r Wikinger wie auch durch slawische und sogar arabische Händler aus <strong>de</strong>m Mittelmeerraum dorthin gelangt sein.<br />
Pommerellen als Teil <strong>de</strong>s frühpiastisch-polnischen Staates<br />
Die Verfasser <strong>de</strong>r ältesten polnischen Chroniken unterschie<strong>de</strong>n nicht zwischen West- und Ostpommern. Der Gallus Anonymus in Gnesen, Wincenty Kadłubek, Bischof von Krakau und<br />
Bogufał II., Bischof von Posen, berichten von <strong>de</strong>n Versuchen <strong>de</strong>r polnischen Herrscher, die sprachlich verwandten Pommern <strong>zu</strong> unterwerfen o<strong>de</strong>r sich gegen pommersche Angriffe <strong>zu</strong><br />
verteidigen. Gallus Anonymus nennt die Pommern, die erst Anfang <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter Druck die christliche Lehre annahmen, ein „heidnisches Volk“, vergleichbar <strong>de</strong>n baltischen<br />
Prußen. Bogufal kennt auch schon <strong>de</strong>n slawischen Stamm <strong>de</strong>r „Cas<strong>zu</strong>bitae“, also die Kaschuben.<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Pommerellens wur<strong>de</strong> durch Herzog Mieszko I. o<strong>de</strong>r seinen Sohn Bolesław I. zeitweilig erobert. Im Dokument Dagome Iu<strong>de</strong>x, einem durch die Kurie in <strong>de</strong>n<br />
Jahren 1086–1087 in Rom erstellten Regest, welches <strong>de</strong>n Inhalt einer aus <strong>de</strong>n Jahren 990–992 stammen<strong>de</strong>n Urkun<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rgibt, wer<strong>de</strong>n die bis <strong>zu</strong>m Meer reichen<strong>de</strong>n Gebiete eines<br />
Dagome (auch „Dagone“), seiner Ehefrau Ote und seiner Söhne, <strong>de</strong>r Herrscher <strong>de</strong>s Staates (civitas) Schinesghe (auch „Schignesne“), hinsichtlich ihrer Aus<strong>de</strong>hnung beschrieben, und es<br />
wird eine (formale) Schenkung <strong>de</strong>s Staates mitsamt seiner Gebiete durch die Herrscher an <strong>de</strong>n Apostolischen Stuhl erwähnt (für Details siehe: Dagome Iu<strong>de</strong>x). Anhand etlicher<br />
Anhaltspunkte geht man davon aus, dass es sich um eine Schenkung <strong>de</strong>s frühpiastisch-polnischen Staates han<strong>de</strong>lt; die Namen „Polonia“ und „Regnum Poloniae“ wur<strong>de</strong>n erst am Ausgang<br />
<strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts gebräuchlich.<br />
Durch die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s polnischen Piasten-Herzogs und Königs Bolesławs <strong>de</strong>s Tapferen gelangte <strong>de</strong>r Heilige Adalbert von Prag 997 von Prag über Danzig in das Land <strong>de</strong>r Prußen,<br />
wo er am 23. April 997 bei Fischhausen an <strong>de</strong>r Ostseeküste <strong>de</strong>n Märtyrertod fand. Johannes Canaparius, ein Benediktinermönch, bezeichnete in seiner Lebensbeschreibung Adalberts<br />
Danzig als "urbs", das heißt Stadt, wo St. Adalbert viele Pruzzen bekehrt hat.<br />
Als im Jahre 1000, während <strong>de</strong>s Staatsakts von Gnesen, das Erzbistum Gnesen gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> für das kurz davor vom polnischen Herzog eroberte Küstenland an <strong>de</strong>r Ostsee (seit<br />
1046 in kaiserlichen Akten als „Pommern“ benannt), ein Bistum in Kolberg gestiftet, das bei dieser Gelegenheit <strong>zu</strong>m ersten Mal erwähnt wur<strong>de</strong>. Es liegt an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Persante in<br />
die Ostsee. Erster Bischof war <strong>de</strong>r Sachse Reinbern, aber das Bistum Kolberg ging sehr bald unter und wur<strong>de</strong> erst 1972 als Bistum Koszalin-Kołobrzeg erneuert.<br />
Gallus Anonymus spricht von langen und harten Kämpfen <strong>de</strong>r Polen gegen die Pommern. Da die Oberhoheit Polens über Pommern nur nominell war, wur<strong>de</strong> die Nordgrenze <strong>de</strong>s<br />
polnischen Kernlan<strong>de</strong>s von <strong>de</strong>r Weichsel entlang <strong>de</strong>r Netze durch eine Kette von Grenzburgen gesichert. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab es in Santok an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Netze in die<br />
Warthe zwei Grenzburgen, eine polnische und ein pommersche.
Im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt etablierten im westlichen Pommern um Cammin und Stettin die Greifen ihre Herrschaft, im östlichen Pommern um Danzig die wohl ab 1118 von <strong>de</strong>m polnischen<br />
Piasten Bolesław III. Schiefmund eingesetzten Sambori<strong>de</strong>n. Damit zerfiel Pommern in einen westlichen Teil, <strong>de</strong>r sich schrittweise <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich einglie<strong>de</strong>rte und ab<br />
1181 direkt unter <strong>de</strong>m Kaiser stand und einen östlichen Teil, <strong>de</strong>r unabhängig und mit Unterbrechungen Polen unterstand.<br />
Pommerellen <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s polnischen Partikularismus und das Herzogtum Pommerellen<br />
Die pommerellischen Fürsten verwalteten ihr Land grundsätzlich von einem festen Sitz aus. Mehrere Persönlichkeiten aus <strong>de</strong>m heimischen Landa<strong>de</strong>l stan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Herzog <strong>zu</strong>r Seite.<br />
Überliefert sind die Namen Grimislaus, Gnezota und sein Bru<strong>de</strong>r Martin, Zulis und Stropha. Der Kämmerer und Kanzler Heinrich war wahrscheinlich ein <strong>de</strong>utscher Priester. Die<br />
Untertanen waren <strong>zu</strong> Dienstleistungen und <strong>zu</strong>r Heeresfolge verpflichtet. Sie hatten von ihrem Fischfang und Vieh <strong>de</strong>n Zehnten <strong>zu</strong> entrichten. Sambor begünstigte, wie sein Vater, die<br />
Sesshaftmachung <strong>de</strong>utscher Siedler und Kaufleute. Für diese stiftete er 1190 die Sankt-Nicolai-Kapelle „vor Danzig im Fel<strong>de</strong>“.<br />
Der heilige Nikolaus war <strong>de</strong>r Patron <strong>de</strong>r Seehan<strong>de</strong>l treiben<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Kaufleute. Daher fin<strong>de</strong>n sich auch große Nikolaikirchen in Lübeck, Wismar, Stralsund, Berlin, Elbing, Reval und<br />
an an<strong>de</strong>ren Orten. Der Seehan<strong>de</strong>l war bereits entwickelt. Es wur<strong>de</strong>n in erster Linie Tuche (sie waren damals <strong>zu</strong>gleich Zahlungsmittel) und das lebensnotwendige Salz eingeführt,<br />
hauptsächlich von <strong>de</strong>m 1143 gegrün<strong>de</strong>ten Lübeck. Ausgeführt wur<strong>de</strong>n Felle, Wachs, Honig und Bernstein. An <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>s späteren Langen Marktes waren Bu<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Verkauf <strong>de</strong>r von<br />
<strong>de</strong>n Schiffen eingeführten Waren erbaut. Am Koggentor war eine Lan<strong>de</strong>brücke errichtet, <strong>de</strong>ren Unterhalt <strong>de</strong>m Kloster Oliva oblag. Dafür erhielt das Kloster einen Anteil an <strong>de</strong>n<br />
Zolleinnahmen. Ins Lan<strong>de</strong>sinnere führten Kaufmannsstraßen, eine davon nach Stargard und weiter südlich, die uralte „Bernsteinstraße“ führte bis <strong>zu</strong>r Adria. Nach Westen führte die<br />
Straße über Stolp und Schlawe nach Kolberg. Zu solchen Fahrten taten sich jeweils mehrere Wagenführer <strong>zu</strong>sammen, oft wohl auch mit bewaffneter Begleitung. Bei <strong>de</strong>r Ausfahrt hatte<br />
je<strong>de</strong>r Wagenführer an <strong>de</strong>n Unterkämmerer in Danzig fünf Ellen Tuch und eine halbe Mark Silber <strong>zu</strong> zahlen. Auf <strong>de</strong>r Weiterfahrt wur<strong>de</strong> an je<strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sherrlichen Burg ein weiterer Zoll in<br />
Naturalien erhoben. Erst seit etwa 1240 waren alle Abgaben in Geld <strong>zu</strong> entrichten. Die Quellen sagen nichts von pommerellischen Münzstätten. Es sind auch keine pommerellischen<br />
Münzen gefun<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Im Zuge <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Durchdringung <strong>de</strong>s Ostseeraumes durch Dänemark kam dänisches Geld aus Haithabu (He<strong>de</strong>by) in die Küstengebiete, und die<br />
sächsischen Münzen aus <strong>de</strong>m Silber <strong>de</strong>s Rammelsberges bei Goslar strömten in großer Zahl nach Polen und Pommerellen. Auch die polnischen Fürsten prägten Münzen.<br />
Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Hauses Sambor und <strong>de</strong>r Kampf um <strong>de</strong>ssen Nachfolge<br />
Die Mark Bran<strong>de</strong>nburg und das Königreich Polen<br />
Während Polen nach <strong>de</strong>m Lehensbrief Kaiser Friedrich Barbarossas von 1181 für das westpommersche Herzogtum <strong>de</strong>r Greifen keinerlei Vorherrschaft mehr über dieses hatte, unterstand<br />
das ostpommersche Herzogtum (Pomerellen) bis ins späte 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt weiterhin polnischer Oberhoheit. Diese stand nach <strong>de</strong>r Regel <strong>de</strong>s polnischen Seniorats ausdrücklich <strong>de</strong>m<br />
Seniorherzog <strong>zu</strong>. Durch <strong>de</strong>n Tod seiner Onkel wur<strong>de</strong> Herzog Mestwin II. Herrscher über ganz Pommerellen. Im Kampf gegen seine Verwandten verbün<strong>de</strong>te sich Herzog Mestwin<br />
kurzzeitig mit <strong>de</strong>n askanischen Markgrafen aus <strong>de</strong>r Markgrafschaft Bran<strong>de</strong>nburg, dabei entband ihn <strong>de</strong>r Lehensvertrag ausdrücklich von <strong>de</strong>r Heeresfolge gegen Polen, mit <strong>de</strong>m er sich<br />
wenig später gegen die Bran<strong>de</strong>nburger, die in <strong>de</strong>r Zwischenzeit Danzig eroberten, <strong>zu</strong>r Wehr setzte. Mit Herzog Przemysław II. von Großpolen schloss Mestwin am 15. Februar 1282 im<br />
Vertrag von Kempen eine „donatio inter vivos“ (Geschenk unter Leben<strong>de</strong>n) und vermachte ihm sein Herzogtum. Derartige Erbverträge waren <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit nicht selten. Bran<strong>de</strong>nburg<br />
erkannte diesen Vertrag aber nicht an, da es am vorherigen Lehnsvertrag festhielt. Dem Deutschen Or<strong>de</strong>n musste Mestwin II., aufgrund <strong>de</strong>s Schiedsspruchs eines päpstlichen Legaten, am<br />
18. Mai 1282 das Land Gniew, das Große Wer<strong>de</strong>r und einen Teil <strong>de</strong>r Frischen Nehrung abtreten. Dieses Land hatte Mestwins Onkel Sambor II. <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n bereits 1276 geschenkt. Der<br />
Or<strong>de</strong>n erbaute noch im selben Jahr das Komturschloss in Mewe und fasste damit Fuß auf <strong>de</strong>m linken Weichselufer.<br />
Am 25. Dezember 1294 verstarb Mestwin und Przemysł II. glie<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>n größten Teil Pommerellens seinem Machtbereich ein. Am 26. Juni 1295 wur<strong>de</strong> Herzog Przemysł II. in Gnesen<br />
durch Erzbischof Jakub Świnka <strong>zu</strong>m polnischen König gekrönt. Er herrschte über Großpolen und über große Teile Pommerellens. Im Februar 1296 wur<strong>de</strong> Przemysł II. von<br />
oppositionellen Adligen, <strong>de</strong>n Zaremba und <strong>de</strong>n Nałęcz, entführt und in Rogoźno (Rogasen) ermor<strong>de</strong>t, dahinter sollen die Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg o<strong>de</strong>r Wenzel II. von Böhmen<br />
gesteckt haben.<br />
Die böhmischen Přemysli<strong>de</strong>n und Władysław I. Ellenlang<br />
Da König Przemysł II. nur die Tochter Rixa Elisabeth hinterließ, begann um seine Nachfolge als König von Polen ein Kampf zwischen Herzog Władysław I. Ellenlang von Kujawien und
<strong>de</strong>n böhmischen Přemysli<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r starke Auswirkungen auf die Geschichte Pommerellens hatte. Zunächst setzte sich König Wenzel II. von Böhmen durch. Er nahm 1300 Großpolen und<br />
Pommerellen in Besitz, verlobte sich mit Rixa Elisabeth und ließ sich von Jakub Świnka in Gnesen <strong>zu</strong>m polnischen König krönen. Zur weiteren Sicherheit nahm er noch 1300 seine<br />
polnischen Gebiete von König Albrecht I. als Lehen an, während sein polnischer Wi<strong>de</strong>rsacher Schutz und Aufnahme im Ausland suchen musste. Wenzel kehrte nach Prag <strong>zu</strong>rück und ließ<br />
sich in <strong>de</strong>n polnischen und pommerellischen Gebieten durch „Capitanei“, Starosten, vertreten. Die Verwaltung Pommerellens hatte er <strong>de</strong>m einheimischen Palatin von Danzig, Swenzo,<br />
übertragen. Dieses einheimische Geschlecht <strong>de</strong>r Swenzonen hatte, gestützt auf Neuenburg und umfangreiche Län<strong>de</strong>reien im Flussgebiet <strong>de</strong>r Brahe mit Tuchel, Größe und Macht eines<br />
selbständigen Fürstentums erlangt.<br />
Als Wenzel II. im Juni 1305 plötzlich starb, folgte ihm sein 16-jähriger Sohn Wenzel III. nach. Dieser ernannte einen Sohn <strong>de</strong>s alten Swenzo, Peter von Neuenburg, <strong>zu</strong>m Hauptmann von<br />
Pommerellen. Herzog Władysław kehrte um 1305 nach Polen <strong>zu</strong>rück und begann Großpolen von Südosten her ein<strong>zu</strong>nehmen und so Oberhand im Kampf über die Nachfolge in Polen <strong>zu</strong><br />
gewinnen. Daraufhin bemühte sich Wenzel um die Hilfe <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns. Er selbst rüstete sich <strong>zu</strong> einem Zug gegen Władysław, wur<strong>de</strong> aber im August 1306 in Olmütz ermor<strong>de</strong>t.<br />
Władysław konnte <strong>de</strong>n größten Teil Polens einnehmen und im Winter 1306/1307 Pommerellen besetzen.<br />
Die Swenzonen rufen die Bran<strong>de</strong>nburger, Władysław I. Ellenlang ruft <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n<br />
Dort entmachtete er das mächtige Geschlecht <strong>de</strong>r Swenzonen (Święca). Diese schlossen im Juli 1307 einen Übergabevertrag mit Markgraf Wal<strong>de</strong>mar von Bran<strong>de</strong>nburg. Peter trieb<br />
Bran<strong>de</strong>nburg an, seine Lehnsansprüche auf Pommerellen erneut geltend <strong>zu</strong> machen.<br />
Bran<strong>de</strong>nburgische Truppen unter <strong>de</strong>n Markgrafen Otto und Wal<strong>de</strong>mar besetzten im Sommer 1308 die strategisch wichtigsten Punkte. Die damals noch überwiegend slawische Stadt<br />
Danzig öffnete ihnen die Tore; die polnisch-kaschubische Besat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r etwa 300 Meter entfernt gelegenen Burg mit <strong>de</strong>m Landrichter Bogussa und an<strong>de</strong>ren kaschubischen Amtsträgern<br />
konnte wi<strong>de</strong>rstehen. Władysław I. war durch interne Probleme daran gehin<strong>de</strong>rt, seinen Statthaltern in Pommerellen Entsatz <strong>zu</strong> leisten.<br />
Auf <strong>de</strong>n Rat <strong>de</strong>s <strong>de</strong>m polnischen Herzog treu ergebenen Dominikanerpriors Wilhelm bat Landrichter Bogussa mit Zustimmung Władysławs <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n gegen Ersatz <strong>de</strong>r<br />
Kosten um Hilfe. Im August 1308 kam Gunther von Schwarzburg (o<strong>de</strong>r Heinrich von Plötzke), <strong>de</strong>r Komtur von Kulm, mit Truppen nach Danzig, verstärkte die Besat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Burg und<br />
nötigte die Bran<strong>de</strong>nburger im September <strong>zu</strong>m Ab<strong>zu</strong>g. Die Or<strong>de</strong>nsritter bekamen jedoch wegen <strong>de</strong>r Kostenerstattung mit <strong>de</strong>r polnisch-kaschubischen Besat<strong>zu</strong>ng Streit, <strong>de</strong>r in Gewalttaten<br />
en<strong>de</strong>te.<br />
Eroberung durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n und das „Danziger Blutbad“<br />
Inzwischen war unter <strong>de</strong>m Landmeister Heinrich von Plötzke eine starke Streitmacht aufgestellt wor<strong>de</strong>n. Sie belagerte Danzig. Am 13. November 1308 wur<strong>de</strong> die Stadt vom Or<strong>de</strong>n<br />
eingenommen. Dabei wur<strong>de</strong>n 16 kaschubische Ritter und eine unbekannte Zahl von in <strong>de</strong>r Stadt weilen<strong>de</strong>n Polen und <strong>de</strong>utschen Bürgern getötet. Die Bürger mussten ihre Häuser<br />
zerstören und die Stadt verlassen, die Ritter legten die Stadtbefestigung nie<strong>de</strong>r. Erst nach zwei Jahren durften die Bürger <strong>zu</strong>rückkehren und ihre Stadt auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rechtstadt<br />
wie<strong>de</strong>r aufbauen.<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Einnahme Danzigs vom Or<strong>de</strong>n getöteten Menschen („Danziger Blutbad“) ist jahrhun<strong>de</strong>rtelang ein Streitpunkt zwischen <strong>de</strong>utschen und polnischen Historikern<br />
gewesen. Schon 1310 verklagte <strong>de</strong>r polnische König <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n beim Papst. Der erste Prozess fand bereits 1310–1312 in Riga statt. In <strong>de</strong>r Bulle Papst Clemens' V. vom 19. Juni 1310 wird<br />
von <strong>de</strong>r Beauftragung <strong>de</strong>s Erzbischofs Johann von Bremen und <strong>de</strong>s Domherrn von Ravenna, Magister Albert von Mailand <strong>zu</strong> einer Untersuchung wegen schwerer Vorwürfe gegen <strong>de</strong>n<br />
Deutschen Or<strong>de</strong>n gesprochen. Diese schweren Vorwürfe behinhalten die Anschuldigung <strong>de</strong>s Mor<strong>de</strong>s an über 10.000 Menschen in <strong>de</strong>r Stadt Danzig.[3]<br />
Der Or<strong>de</strong>n besetzte 1309 Pommerellen, ohne auf nennenswerten Wi<strong>de</strong>rstand <strong>zu</strong> stoßen. Im selben Jahr verlegte <strong>de</strong>r Deutsche Ritteror<strong>de</strong>n seinen Hochmeistersitz von Venedig in die<br />
Marienburg. Władysław I. konnte die sehr hohe vom Or<strong>de</strong>n gefor<strong>de</strong>rte Kriegsentschädigung nicht zahlen. Die bran<strong>de</strong>nburgischen Ansprüche kaufte <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Markgrafen Wal<strong>de</strong>mar<br />
im Vertrag von Soldin (1309) für die hohe Summe von 10.000 Mark ab.<br />
Pommerellen als Teil <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>nsstaates<br />
Sicherung
Władysław I. Ellenlang hatte einen Teil <strong>de</strong>r polnischen Teilfürstentümer (Großpolen und Kleinpolen) wie<strong>de</strong>r vereinigt und wur<strong>de</strong> 1320 <strong>zu</strong>m polnischen König gekrönt. Sein erklärtes Ziel<br />
war es, Pommerellen für Polen <strong>zu</strong> gewinnen. Vorstöße bei <strong>de</strong>r Kurie in Avignon blieben ohne Wirkung. Er verbün<strong>de</strong>te sich mit <strong>de</strong>m größten Feind <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns, mit Litauen, und<br />
verheiratete seinen Sohn Kasimir 1325 mit Aldona-Anna, <strong>de</strong>r Tochter <strong>de</strong>s Litauerfürsten Gedimin. Der Or<strong>de</strong>n hatte sich dagegen mit <strong>de</strong>m inzwischen |luxemburgischen Königreich<br />
Böhmen, mit <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg und mit drei masowischen Fürsten verbün<strong>de</strong>t.<br />
1327 begann König Władysław I. einen Krieg gegen <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n. Der Krieg bestand aus gegenseitigen Verwüstungsfeldzügen. Als ein Or<strong>de</strong>nsheer aus <strong>de</strong>m östlichen Großpolen<br />
<strong>zu</strong>rückkehrte, griff Ellenlang es am 27. September 1331 bei Płowce an und vernichtete eine <strong>de</strong>r drei Abteilungen. Die Schlacht blieb im Ergebnis unentschie<strong>de</strong>n, wenn auch die<br />
psychologische Wirkung dieses ersten Teilerfolgs in offener Feldschlacht gegen <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n erheblich war. Schließlich konnte <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n die polnisch-litauischen Angriffe abschlagen und<br />
in einer kraftvollen Offensive Kujawien und das Dobriner Land <strong>de</strong>m polnischen König entreißen.<br />
Władysław starb 1333. Sein Sohn, König Kasimir III. <strong>de</strong>r Große, musste in <strong>de</strong>m Streit nachgeben. Im Vertrag von Kalisch (1343) erkannte er die Herrschaft <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns über Pommerellen<br />
und das Kulmerland „endgültig“ an. Dafür gab <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n das von ihm besetzte Kujawien und das Dobriner Land an Polen <strong>zu</strong>rück. Der Verzicht wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n polnischen Großen<br />
ausdrücklich bestätigt. Kasimir nannte sich aber weiterhin „heres Pomeraniae“ (Erbe Pommerns). Der meerferne, an <strong>de</strong>r Netze gelegene Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s war immerhin polnisch<br />
geblieben. Damit herrschte für einige Jahrzehnte äußerlich Frie<strong>de</strong>n zwischen <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n und Polen.<br />
Erschließung<br />
Der Or<strong>de</strong>n hatte sich 1309 sofort intensiv <strong>de</strong>m Ausbau <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s gewidmet. Im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Komtureien Schlochau und Konitz wur<strong>de</strong> die Grenze <strong>zu</strong> Polen durch die planmäßige Anlage<br />
von <strong>de</strong>utschen Dienstgütern und Zinsdörfern gesichert und die Stadt Friedland am Übergang über die Dobrinka an <strong>de</strong>ren Nordufer gegrün<strong>de</strong>t. Die pommersche Grenze wur<strong>de</strong> durch die<br />
Städte Bal<strong>de</strong>nburg und Hammerstein und durch <strong>de</strong>utsche Dienstgüter gesichert.<br />
Im Inneren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s gab es zahlreichen geistlichen Streubesitz <strong>de</strong>r Klöster Oliva, Pelplin, Zarnowitz (Żarnowiec), Zuckau (Żukowo), heute <strong>zu</strong> Czersk, <strong>de</strong>s Bistums Kujawien usw. In<br />
<strong>de</strong>n Jahren 1315–1340 wur<strong>de</strong>n die Wer<strong>de</strong>r im Weichsel<strong>de</strong>lta einge<strong>de</strong>icht und ausschließlich mit <strong>de</strong>utschen Bauern besetzt. Die kaschubischen Dörfer im Nor<strong>de</strong>n Pommerellens wur<strong>de</strong>n<br />
durch die Einführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Hufenverfassung und durch die Verleihung <strong>de</strong>s kulmischen Rechts wirtschaftlich leistungsfähiger gemacht. Die Dreifel<strong>de</strong>rwirtschaft und die<br />
Schulzenverfassung wur<strong>de</strong>n eingeführt. Neu gegrün<strong>de</strong>te Städte wur<strong>de</strong>n Mittelpunkte für <strong>de</strong>n Binnenverkehr <strong>de</strong>r umliegen<strong>de</strong>n Dörfer.<br />
Danzig<br />
Einen großen wirtschaftlichen Aufschwung nahmen die großen Städte wie Danzig, das wegen seiner günstigeren Lage das <strong>zu</strong>nächst vom Or<strong>de</strong>n bevor<strong>zu</strong>gte Elbing bald überflügelte.<br />
König Przemysław II. von Polen hatte <strong>de</strong>r Stadt Danzig bereits das mag<strong>de</strong>burgische anstelle <strong>de</strong>s ursprünglichen lübischen Rechts verliehen. Hochmeister Ludolf König erteilte <strong>de</strong>r Stadt<br />
1342 o<strong>de</strong>r 1343 das kulmische Recht, freilich nur <strong>de</strong>r inneren Stadt, <strong>de</strong>r „richtigen“ Stadt, die davon <strong>de</strong>n Namen <strong>de</strong>r „Rechtstadt“ erhielt. Schon um 1380 war die massive Ummauerung<br />
dieser Stadt been<strong>de</strong>t. Der heute noch erhaltene Stockturm ist ein Überbleibsel dieser mittelalterlichen Befestigung. Der Grundstein für <strong>de</strong>n Neubau <strong>de</strong>r Marienkirche, <strong>de</strong>s größten<br />
Kirchenbaus im Ostseeraum, soll 1343 gelegt wor<strong>de</strong>n sein. Die Stadt ist damals bereits dicht besie<strong>de</strong>lt gewesen. Der Artushof wird 1350 <strong>zu</strong>m ersten Mal erwähnt. Das rechtstädtische<br />
Rathaus wur<strong>de</strong> als reines Verwaltungsgebäu<strong>de</strong> um 1380 von Hinrich Ungeradin erbaut.<br />
Danzig war Mitglied <strong>de</strong>r Hanse und wur<strong>de</strong> gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts Führerin <strong>de</strong>r preußischen Städte. Der Fernhan<strong>de</strong>l war trotz aller damit verbun<strong>de</strong>nen Risiken die Grundlage für<br />
das Aufblühen <strong>de</strong>r Stadt. Ausgeführt wur<strong>de</strong>n hauptsächlich Getrei<strong>de</strong>, Holz, Asche und Teer, eingeführt wur<strong>de</strong>n flandrische Tuche, englische Wolle und Salz, vorwiegend aus Lübeck. Im<br />
14. Jahrhun<strong>de</strong>rt ließen sich englische Kaufleute in Danzig nie<strong>de</strong>r, erwarben Hausgrundstücke und schlossen sich <strong>zu</strong> einer Genossenschaft unter Leitung eines „governor“ <strong>zu</strong>sammen.<br />
Allianz <strong>de</strong>s Preußischen Bun<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Königreichs Polen gegen die Herrschaft <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns<br />
Seine eigenen umfangreichen Staatsgüter, die Domänen, bewirtschaftete <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n selbst von eigenen Höfen aus. Die Erträge <strong>de</strong>r Eigenwirtschaften, <strong>de</strong>s Mühlenmonopols und <strong>de</strong>s vom<br />
Or<strong>de</strong>n selbst betriebenen Han<strong>de</strong>ls ermöglichten es, auf Steuern und Abgaben weitgehend <strong>zu</strong> verzichten.<br />
Der Eigenhan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r Jahre von <strong>de</strong>n immer selbstbewusster wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Städten jedoch <strong>zu</strong>nehmend als bedrohliche Konkurrenz empfun<strong>de</strong>n. Die
Regionaltagungen <strong>de</strong>r preußischen Hansestädte dienten zwar <strong>de</strong>r Vorbereitung gemeinsamen Vorgehens auf <strong>de</strong>n Tagfahrten <strong>de</strong>r Hanse, es kamen natürlich aber auch Beschwer<strong>de</strong>n gegen<br />
<strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Sprache.<br />
Die landfrem<strong>de</strong>n Ritter ohne familiäre Kontinuität konnten kein Vertrauensverhältnis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n inzwischen seit Generationen eingesessenen Familien <strong>de</strong>r städtischen Patrizier, aber auch<br />
nicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m landständischen A<strong>de</strong>l, herstellen. Sie wur<strong>de</strong>n als arrogant empfun<strong>de</strong>n. Die eingeborenen Familien hatten keine Möglichkeit, in höhere Verwaltungsstellen <strong>de</strong>s Staates<br />
auf<strong>zu</strong>steigen. Institutionelle Gremien, in <strong>de</strong>nen die Angelegenheiten <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren besprochen wer<strong>de</strong>n konnten, gab es nicht. So kam <strong>zu</strong>nehmend Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit im<br />
Lan<strong>de</strong> auf.<br />
Auch die außenpolitische Lage hatte sich gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts verän<strong>de</strong>rt. Das Kaisertum war durch die Zugeständnisse geschwächt, die Karl IV. <strong>de</strong>n Kurfürsten 1376 machen<br />
musste, um die Wahl seines Sohnes Wenzel <strong>zu</strong>m römisch-<strong>de</strong>utschen König durch<strong>zu</strong>setzen. Das Papsttum war durch das Schisma (1378–1415) handlungsunfähig gewor<strong>de</strong>n. Der litauische<br />
Großfürst Jogaila ließ sich taufen und heiratete die polnische Prinzessin Hedwig von Anjou, die 1384 <strong>zu</strong>m „König von Polen“ gekrönt wor<strong>de</strong>n war. Nach<strong>de</strong>m er versprochen hatte, seine<br />
gesamten litauischen und russischen Lan<strong>de</strong> für ewige Zeiten mit <strong>de</strong>r Krone Polens <strong>zu</strong> verbin<strong>de</strong>n und die „<strong>de</strong>m polnischen Reiche verlorenen Län<strong>de</strong>r“ – hierbei war in erster Linie an<br />
Pommerellen und an das Kulmerland gedacht – wie<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>gewinnen, wählte ihn <strong>de</strong>r polnische A<strong>de</strong>l 1386 <strong>zu</strong>m König von Polen. Jogaila nahm <strong>de</strong>n Namen Władysław II. Jagiełło an.<br />
Der Or<strong>de</strong>n war dadurch von einem übermächtigen Feind umgeben, ohne auf die Hilfe von Kaiser o<strong>de</strong>r Papst rechnen <strong>zu</strong> können. Durch die Christianisierung Litauens war <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong><strong>de</strong>m in seiner Existenzberechtigung gefähr<strong>de</strong>t. Mit <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Kreuzfahrer aus ganz Europa war nicht mehr <strong>zu</strong> rechnen. Auch die Kriegstechnik hatte sich verän<strong>de</strong>rt. Erste<br />
Feuerwaffen kamen auf. Ritterheere waren auf die Unterstüt<strong>zu</strong>ng von Söldnern angewiesen und die kosteten Geld.<br />
Krieg und Erster Frie<strong>de</strong> von Thorn<br />
1409 begann <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n einen Präventivkrieg gegen Polen und Litauen, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nächst ohne größere Kämpfe erfolgreich für <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n verlief. Während eines Waffenstillstan<strong>de</strong>s gab <strong>de</strong>r als<br />
Schiedsrichter angerufene König Wenzel von Böhmen am 15. Februar 1410 einen <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n günstigen Schiedsspruch ab, <strong>de</strong>n Polen aber ablehnte. Nach Ablauf <strong>de</strong>s Waffenstillstan<strong>de</strong>s<br />
begann <strong>de</strong>r Krieg wie<strong>de</strong>r am 24. Juni. Er führte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n vernichten<strong>de</strong>n Schlacht am 15. Juli 1410, die in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Geschichtsschreibung als Schlacht bei Tannenberg, bei<br />
<strong>de</strong>n Polen als Schlacht bei Grunwald bekannt gewor<strong>de</strong>n ist. Das siegreiche polnisch-litauische Heer rückte auch in Pommerellen ein. Viele <strong>de</strong>r kleinen Städte und <strong>de</strong>r Landa<strong>de</strong>l huldigten<br />
<strong>de</strong>m polnischen König. Nur Rhe<strong>de</strong>n, Schwetz, Konitz und Schlochau hielten <strong>zu</strong>m Or<strong>de</strong>n.<br />
Die siegreichen Polen, Litauer und Tataren hatten die Marienburg belagert. Der König musste die Belagerung aber abbrechen, weil <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n von Deutschland her Hilfe nahte, im<br />
Belagerungsheer Seuchen ausgebrochen waren und <strong>de</strong>r Litauerfürst Witold abgezogen war, um sein Land gegen eine Bedrohung von Livland her <strong>zu</strong> schützen. Schnell ging die Initiative<br />
wie<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n über. Innerhalb von 14 Tagen nach Aufhebung <strong>de</strong>r Belagerung war fast das ganze Land wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns.<br />
Am 9. November 1410 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erfolgreiche Verteidiger <strong>de</strong>r Marienburg, Heinrich von Plauen vom Generalkapitel <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns einstimmig <strong>zu</strong>m Hochmeister gewählt. Er konnte am 1.<br />
Februar 1411 auf einer Weichsel-Insel bei Thorn Frie<strong>de</strong>n schließen, <strong>de</strong>n Ersten Frie<strong>de</strong>n von Thorn. Der Or<strong>de</strong>n behielt sein ganzes altes Gebiet einschließlich <strong>de</strong>r Neumark und verzichtete<br />
nur auf das Dobriner Land „für immer“. Der Or<strong>de</strong>n musste aber <strong>zu</strong>r Auslösung <strong>de</strong>r zahlreichen vornehmen Gefangenen die be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Summe von 100.000 Schock böhmische Groschen<br />
<strong>zu</strong> bestimmten Terminen an <strong>de</strong>n König von Polen zahlen.<br />
Der neue Hochmeister griff mit brutaler Härte durch, um die Untertanen <strong>zu</strong> bestrafen, die <strong>de</strong>m polnischen König nach <strong>de</strong>r Schlacht von Tannenberg so schnell gehuldigt o<strong>de</strong>r<br />
Verhandlungen aufgenommen hatten. Am schlimmsten war es in Danzig, <strong>de</strong>ssen Komtur ein gleichnamiger Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Hochmeisters war. Er lud die bei<strong>de</strong>n Bürgermeister Conrad<br />
Letzkau und Arnold Hecht sowie <strong>de</strong>n Ratsmann Bartel Groß, einen Schwiegersohn Letzkaus, auf das Schloss und ließ sie dort in <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Nacht ohne Recht und Urteil ermor<strong>de</strong>n.<br />
Die Leichen wur<strong>de</strong>n nach Intervention beim Hochmeister erst acht Tage danach vor das Burgtor geworfen. Die Bürgerschaft war ungeheuer erregt. Der Vorfall stand noch in <strong>de</strong>n dreißiger<br />
Jahren <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts in Danziger Volksschul-Lesebüchern.<br />
Dreizehnjähriger Krieg und Zweiter Frie<strong>de</strong> von Thorn<br />
Heinrich von Plauen wollte sich nicht mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n abfin<strong>de</strong>n. Er begann auf<strong>zu</strong>rüsten. Dafür und für die Zahlungsverpflichtungen aus <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsvertrag benötigte er Geld. Das<br />
sollten die Städte und die Landstän<strong>de</strong> zahlen. Die Situation wur<strong>de</strong> für das Land nicht besser, als Heinrich von Plauen 1413 abgesetzt wur<strong>de</strong>. Die Spannungen nahmen sogar wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>.
Am 4. Februar 1454 kündigte <strong>de</strong>r Bund <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Gehorsam auf und begann <strong>de</strong>n wohlvorbereiteten Krieg. In wenigen Tagen war <strong>de</strong>r größere Teil <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Aufständischen. Alle Burgen <strong>de</strong>s westlichen Preußen mit Ausnahme von Marienburg und Marienwer<strong>de</strong>r waren von Bun<strong>de</strong>struppen besetzt.<br />
Schließlich waren auch die Finanzkräfte <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns, Polens und <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s erschöpft. Vermittlungsversuche Bürgermeister Castorps aus Lübeck in <strong>de</strong>n Jahren 1463/64 scheiterten.<br />
Jedoch führten intensive Verhandlungen <strong>de</strong>s päpstlichen Legaten Rudolf von Rü<strong>de</strong>sheim, Bischof von Lavant, im Jahre 1466 <strong>zu</strong>m Erfolg. Der Zweite Frie<strong>de</strong>n von Thorn wur<strong>de</strong> am 19.<br />
Oktober 1466 geschlossen. Der Or<strong>de</strong>n musste das En<strong>de</strong> seiner Herrschaft über <strong>de</strong>n westlichen Teil seines Staatsgebietes einschließlich <strong>de</strong>r Marienburg anerkennen. Das Landgebiet und<br />
Städte <strong>de</strong>s Preußischen Bun<strong>de</strong>s und mit Son<strong>de</strong>rstellung das Fürstbistum Ermland wur<strong>de</strong>n als „Preußen königlichen Anteils“ ein Stän<strong>de</strong>staat unter <strong>de</strong>r Hoheit <strong>de</strong>s polnischen Königs.<br />
Unter <strong>de</strong>r polnischen Krone<br />
Dieses seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt sogenannte „Preußen königlichen Anteils“ war <strong>zu</strong>nächst nur in Personalunion mit <strong>de</strong>r polnischen Krone verbun<strong>de</strong>n. Die autonome Son<strong>de</strong>rstellung <strong>de</strong>s<br />
„Königlichen Preußen“ unter <strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r polnischen Krone beinhaltete eigene Landtage mit Deutsch als Verhandlungssprache, eine eigene Lan<strong>de</strong>sregierung (Lan<strong>de</strong>srat), eigene<br />
Münze, eigene Wehrhoheit <strong>de</strong>r großen Städte, das Recht <strong>de</strong>r großen Städte, eigene diplomatische Verbindungen mit <strong>de</strong>m Ausland <strong>zu</strong> unterhalten, eine Jus Indigenatus. Eingeteilt war es,<br />
abgesehen vom nur lose eingebun<strong>de</strong>nen Ermland, in drei Woiwodschaften, von <strong>de</strong>nen die Woiwodschaft Pommern die größte war.<br />
Mangels eines Thronfolgers wur<strong>de</strong> 1569 mit <strong>de</strong>r Union von Lublin eine Wahlmonarchie eingeführte, und Polen annektierte mehr o<strong>de</strong>r weniger das Großfürstentum Litauen und<br />
Königlich-Preußen <strong>zu</strong>r Realunion Rzeczpospolita. Dabei wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand auch mit Gewalt gebrochen, etwa durch Inhaftierung <strong>de</strong>r Danziger Gesandtschaft, u. a. mit Albrecht<br />
Giese. Vor und nach <strong>de</strong>r Union von Lublin war das Ausmaß <strong>de</strong>r Eigenständigkeit Gegenstand ständiger Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen, wie etwa <strong>de</strong>m Thorner Blutgericht von 1724.<br />
Bestandteil <strong>de</strong>s Königreichs Preußen und <strong>de</strong>r zweiten polnischen Republik<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>r Teilungen Polens am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam Pommerellen als Teil von Westpreußen an das Königreich Preußen, als neue Provinz Westpreußen. Nach 1919 wur<strong>de</strong><br />
es durch <strong>de</strong>n Vertrag von Versailles ohne Volksabstimmung aus <strong>de</strong>m Deutsches Reich herausgelöst und aufgeteilt in <strong>de</strong>n Polnischen Korridor bzw. die Freie Stadt Danzig. In <strong>de</strong>r zweiten<br />
polnischen Republik wur<strong>de</strong> erneut eine Woiwodschaft Pommern o<strong>de</strong>r Pommerellen mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Thorn eingerichtet. Neben historischen, wirtschaftlichen, und nicht <strong>zu</strong>letzt<br />
machtpolitischen Erwägungen wur<strong>de</strong> dies begrün<strong>de</strong>t mit <strong>de</strong>m hohen Anteil polnischer bzw. kaschubischer Einwohner in Pomerellen bzw. <strong>de</strong>m neuen Korridor. 1919 lebten in<br />
Pommerellen 412.000 Deutsch-, 433.000 Polnisch- und 120.000 Kaschubischsprachige. Die Polnische Regierung, <strong>de</strong>ren Kurs bis 1926 von <strong>de</strong>n National- und Christlichen Demokraten<br />
bestimmt wur<strong>de</strong>, verfolgte nach <strong>de</strong>r Anglie<strong>de</strong>rung Pommerellens das erklärte Ziel, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Bevölkerungsanteil <strong>zu</strong> reduzieren.[4] Maßnahmen waren die Nichtanerkennung <strong>de</strong>r<br />
Staatsbürgerschaft, die Ausweisung nach erfolgter Option gemäß Artikel 297b <strong>de</strong>s Versailler Vertrags sowie die Liquidation von Haus- und Grundbesitz. Die Abwan<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Deutschen<br />
vollzog sich aus <strong>de</strong>n Städten rascher als aus <strong>de</strong>n ländlichen Gebieten. Infolge<strong>de</strong>ssen war ab 1921 ihr Anteil umgekehrt <strong>zu</strong>r Situation bis 1918 in <strong>de</strong>n Landkreisen höher als in <strong>de</strong>n<br />
Stadtkreisen. Ihre Zahl ging bis 1931 auf 105.000 Personen <strong>zu</strong>rück.[5]<br />
Pommerellen zwischen Deutschland und Polen<br />
Nach preußisch-<strong>de</strong>utscher Lesart wird Pomerellen und Danzig als Teil <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m Deutschor<strong>de</strong>nsland basieren<strong>de</strong>n 700 Jahre alten Einheit Preußen betrachtet, die nach <strong>de</strong>r 300-jährigen<br />
Episo<strong>de</strong> als autonomes Königlich Preußen ab 1772 mit <strong>de</strong>m übrigen Preußen politisch wie<strong>de</strong>rvereinigt wur<strong>de</strong>, während man immer durch die gemeinsame <strong>de</strong>utsche Sprache kulturell<br />
verbun<strong>de</strong>n war, und die fremdsprachigen Min<strong>de</strong>rheiten in Preußen nur eine unwichtige bzw. im Arbeitsleben untergeordnete Rolle spielten; durch die Germanisierung zahlreicher<br />
Ortsnamen wur<strong>de</strong> das historische polnische Erbe teils auch symbolisch zerstört. Vom polnischen Standpunkt aus wird Pomerellen als <strong>de</strong>r traditionell polnische Teil Pommerns betrachtet,<br />
<strong>de</strong>r 1466, 1918 und 1945 politisch mit Polen wie<strong>de</strong>rvereinigt wur<strong>de</strong>, wobei <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschsprachige Aspekt gegenüber <strong>de</strong>m 1454 geäußerten pro-polnischen politischen Willen als min<strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utend dargestellt wird, o<strong>de</strong>r durch Polonisierung zahlreicher Ortsnamen verschleiert wur<strong>de</strong>.<br />
Literatur<br />
• Hartmut Boockmann: Deutsche Geschichte im Osten Europas, Ostpreußen und Westpreußen. Siedler Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-88680-212-4.<br />
• Wilhelm Brauer: Prußische Siedlungen westlich <strong>de</strong>r Weichsel. J. G. Her<strong>de</strong>r-Bibliothek Siegerland, Siegen 1983.
• Philippe Dollinger: Die Hanse. 3. Auflage. Kröner, Stuttgart 1976, ISBN 3-520-37103-0.<br />
• Wal<strong>de</strong>mar Epp: Danzig, Schicksal einer Stadt. Esslingen 1983, ISBN 3-7628-0428-1.<br />
• Ernst Gall: Danzig und das Land an <strong>de</strong>r Weichsel, Deutscher Kunstverlag, 1953.<br />
• Erich Keyser: Danzigs Geschichte, Danzig 1928. Neudruck Hamburg.<br />
• Gerard Labuda (Hg.): Historia Pomorza. 3 B<strong>de</strong>. Poznań 1972-2003.<br />
• Heinz Lingenberg: Die Anfänge <strong>de</strong>s Klosters Oliva und die Entstehung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt Danzig. Klett-Cotta, Stuttgart 1982, ISBN 3-12-914900-7.<br />
• Gotthilf Löschin: Geschichte Danzigs. 2. Auflage, Danzig 1822. Neudruck: Danziger Verlagsgesellschaft Paul Rosenberg, Klausdorf/Schwentine.<br />
• Gotthold Rho<strong>de</strong>: Geschichte Polens. 3. Auflage. Darmstadt 1980, ISBN 3-534-00763-8.<br />
• Stanisław Salmonowicz (Hg.): Historia Pomorza. Bd. 4 [1850-1918]. Toruń 2000-2003.<br />
• Bruno Schumacher: Geschichte Ost- und Westpreußens. 7. Auflage. Verlag Weidlich, Würzburg 1987. Neudruck <strong>de</strong>r 7. Auflage: Weltbild Verlag, Augsburg 1993, ISBN 978-3-<br />
89350-111-3.<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ siehe: Julian Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paris 1828, S. 247-258. Vgl. auch hier<br />
2. ↑ in Kap. 45 seiner Germania<br />
3. ↑ Hein, Max und Maschke, Erich: Preußisches Urkun<strong>de</strong>nbuch, 2. Bd., S. 9 (Urkun<strong>de</strong> Nr. 13).<br />
4. ↑ Ernst Opgenoorth, Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Ost- und Westpreußens, Teil III: Von <strong>de</strong>r Reformationszeit bis <strong>zu</strong>m Vertrag von Versailles 1807-1918, Lüneburg 1998, 132.<br />
5. ↑ Ernst Opgenoorth, Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Ost- und Westpreußens, Teil III: Von <strong>de</strong>r Reformationszeit bis <strong>zu</strong>m Vertrag von Versailles 1807-1918, Lüneburg 1998, 133.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Hinterpommern<br />
Hinterpommern ist <strong>de</strong>r zwischen <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r und Pomerellen gelegene östliche Teil Pommerns. Die Region mit <strong>de</strong>r Stadt Stettin war bis 1945 überwiegend von Deutschen besie<strong>de</strong>lt und<br />
gehörte als Teil <strong>de</strong>r preußischen Provinz Pommern <strong>zu</strong>m Deutschen Reich. Heute ist die Region überwiegend von Polen besie<strong>de</strong>lt und gehört größtenteils als Woiwodschaft Westpommern<br />
mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Stettin (poln.: Sczecin) <strong>zu</strong> Polen; die östlichen Teile gehören <strong>zu</strong>r Woiwodschaft Pommern.<br />
Geographie<br />
Die dünn besie<strong>de</strong>lte Landschaft ist geprägt von eiszeitlich geformten Moränen, Seen, Flüssen, sanften Hügeln und dichten Na<strong>de</strong>lwäl<strong>de</strong>rn.[1] Der südwestliche Teil beinhaltet mit <strong>de</strong>m<br />
Pyritzer Weizacker ein ausgesprochen fruchtbares Landwirtschaftsgebiet.
Im Hinterland <strong>de</strong>r Ostseeküste verlaufen die Verkehrsströme von Stettin nach Danzig.<br />
Geschichte<br />
Hinterpommern war Teil <strong>de</strong>s Siedlungsgebietes <strong>de</strong>r Pomoranen (Pomerani). Letzterer Name tauchte erstmals <strong>zu</strong>r Zeit Karls <strong>de</strong>s Großen auf. Nach Kriegszügen <strong>zu</strong>r Unterwerfung und<br />
Christianisierung war ganz Pommern seit 995 unter die Herrschaft <strong>de</strong>s polnischen Herzogs Bolesław III. Schiefmund geraten. Die polnische Oberhoheit entglitt seinen Nachfolgern<br />
jedoch wie<strong>de</strong>r und en<strong>de</strong>te um etwa 1135. Die ursprünglich slawischen Greifen (seit Wartislaw I.) waren Herzöge von Pommern bis 1637. Sie warben <strong>zu</strong>r Kolonisierung ihrer Län<strong>de</strong>reien<br />
<strong>de</strong>utsche Siedler an, so dass im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>nächst die westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegenen Lan<strong>de</strong>steile, später aber auch die östlichen <strong>zu</strong> einem Teil <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Siedlungsgebietes<br />
wur<strong>de</strong>n. Die verbliebene slawische Bevölkerung wur<strong>de</strong> dabei im Laufe <strong>de</strong>r Zeit größtenteils einge<strong>de</strong>utscht.<br />
Die Bewohner Ostpommerns waren <strong>de</strong>shalb ethnisch gesehen ein Mischvolk. Viele hinterpommersche A<strong>de</strong>lsfamilien, die dort bis <strong>zu</strong> ihrer Vertreibung nach 1945 ansässig waren, haben<br />
slawische Wurzeln, z. B. die von Zitzewitz o<strong>de</strong>r die von Borcke. Lediglich im östlichen Hinterpommern hielt sich mit <strong>de</strong>n Kaschuben bis in die Neuzeit eine slawische<br />
Bevölkerungsgruppe. Ihre Assimilation seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt führte je nach <strong>de</strong>r Glaubensrichtung <strong>de</strong>r Kirche, <strong>de</strong>r sie sich angeschlossen hatten, entwe<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Germanisierung<br />
(evangelische Kirche) o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Polonisierung (katholische Kirche).<br />
Von 1295 bis 1464 gehörte das südwestliche Hinterpommern (die gesamte Region südwestlich <strong>de</strong>s Flusses Ihna) <strong>zu</strong>m Herzogtum Pommern-Stettin. Die an<strong>de</strong>ren Gebiete gehörten in<br />
dieser Zeit <strong>zu</strong>m Herzogtum Pommern-Wolgast, von <strong>de</strong>m sich seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein geson<strong>de</strong>rtes Herzogtum Pommern-Wolgast-Stolp abteilte. Die Gebiete bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>s<br />
Unterlaufes <strong>de</strong>r Persante mit <strong>de</strong>n Städten Kolberg und Köslin bil<strong>de</strong>ten seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts im Wesentlichen das Stift Cammin, also das weltliche Herrschaftsgebiet <strong>de</strong>s<br />
Bischofs von Cammin.<br />
Nach einer zeitweiligen Vereinigung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Lan<strong>de</strong>steile unter Herzog Bogislaw X., reg. 1474–1523, teilten bereits seine Nachfolger das Land 1532 vorläufig und 1541<br />
endgültig in ein Herzogtum Wolgast und ein Herzogtum Stettin, die erst unter <strong>de</strong>m letzten Herzog, Bogislaw XIV., ab 1625 wie<strong>de</strong>r vereint wer<strong>de</strong>n konnten. Dabei umfasste das Stettiner<br />
Teilherzogtum diesmal in erster Linie die östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegenen Gebiete, die seit 1466 noch um die Lan<strong>de</strong> Lauenburg und Bütow im Osten erweitert wor<strong>de</strong>n waren. Letztere lagen<br />
aber außerhalb <strong>de</strong>r Grenzen <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und waren <strong>zu</strong>nächst Pfandbesitz, seit Anfang <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein Lehen <strong>de</strong>r polnischen Krone. Das<br />
Stift Cammin wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Reformation ab 1556 eine Sekundogenitur <strong>de</strong>r pommerschen Herzöge. 1648 kam Hinterpommern an die Mark Bran<strong>de</strong>nburg, das spätere Königreich<br />
Preußen und verblieb dort bis 1945 als Teil <strong>de</strong>r Provinz Pommern. Aufgrund <strong>de</strong>r Beschlüsse <strong>de</strong>r Alliierten im Potsdamer Abkommen wur<strong>de</strong> Hinterpommern 1945 unter polnische<br />
Verwaltung gestellt und die <strong>de</strong>utsche Bevölkerung vertrieben bzw. später zwangsausgesie<strong>de</strong>lt. Im Rahmen <strong>de</strong>r Aktion Weichsel wur<strong>de</strong>n in Hinterpommern nach 1945 hauptsächlich Polen<br />
aus Zentralpolen und Gebieten östlich <strong>de</strong>r Curzon-Linie angesie<strong>de</strong>lt, aber auch Ukrainer aus Galizien.<br />
Die Zugehörigkeit Hinterpommerns <strong>zu</strong> Polen wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r DDR im Görlitzer Abkommen vom 6. Juli 1950, von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland unter Vorbehalt im Warschauer Vertrag<br />
vom 7. Dezember 1970 und vom vereinten Deutschland 1990 im Zwei-plus-Vier-Vertrag sowie im <strong>de</strong>utsch-polnischen Grenzvertrag endgültig anerkannt.<br />
Sprache<br />
Bis 1945 wur<strong>de</strong> in Hinterpommern überwiegend Deutsch gesprochen, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n ländlichen Gebieten auch pommersches Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch. Östlich von Stolp war auch die<br />
Kaschubische Sprache vertreten und seit <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt infolge <strong>de</strong>r Rekatholisierung in <strong>de</strong>r Gegend um Leba und Lauenburg die Polnische Sprache.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r Vertreibung <strong>de</strong>r Deutschen nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg ist die Bevölkerung Hinterpommerns nunmehr ganz überwiegend polnischsprachig.<br />
Begrifflichkeit<br />
Der Begriff Hinterpommern in seiner heutigen Be<strong>de</strong>utung ist erst in <strong>de</strong>r Neuzeit entstan<strong>de</strong>n. Im Mittelalter verstand unter Pommern im engeren Sinne das Gebiet <strong>de</strong>s Herzogtums<br />
Pommern-Wolgast zwischen O<strong>de</strong>r und Gollenberg (bei Köslin). Nur die östlich davon gelegenen Gebiete bezeichnete man manchmal als Hinterpommern, weil sie eben hinter Pommern<br />
lagen. Erst im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt bürgerte sich im Sprachgebrauch die Bezeichnung Hinterpommern auch für Gebiete östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r ein. Dies übertrug sich dann nach 1648 auf die von<br />
Kurbran<strong>de</strong>nburg übernommenen Gebiete, ohne dass je eine scharfe Abgren<strong>zu</strong>ng nach Westen vorgenommen wur<strong>de</strong>. Deshalb ist es Auslegungssache, ob die eigentlich (historischer
Stadtkern) westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegene Stadt Stettin nun <strong>zu</strong> Vor- o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Hinterpommern <strong>zu</strong> rechnen ist.<br />
Größere Städte<br />
• Stargard i. Pom./Stargard Szczeciński<br />
• Pölitz/Police<br />
• Belgard/Białogard<br />
• Cammin/Kamień Pomorski<br />
• Kolberg/Kołobrzeg<br />
• Köslin/Koszalin<br />
• Stolp/Słupsk<br />
Bis 1945 gehörten <strong>zu</strong> Vorpommern<br />
• Stettin/Szczecin<br />
• Swinemün<strong>de</strong>/Świnoujście<br />
• Misdroy/Miedzyzdroje<br />
Literatur<br />
• Erdbeschreibung <strong>de</strong>r Preußischen Monarchie (F. Leonardi, Hrsg.), Band 3, Halle 1784, S.706-23.<br />
• Vollstämdige und neueste Erdbeschreibung <strong>de</strong>r Preußischen Monarchie und <strong>de</strong>s Freistaates Krakau, bearbeitet von G. Hussel, Geographisches Institut, Weimar 1819, S. 174-210.<br />
• Gerhard Renn: Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Namens „Pommern“ und die Bezeichnungen für das heutige Pommern in <strong>de</strong>r Geschichte. In: Greifswal<strong>de</strong>r Abhandlungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Mittelalters 8, Universitätsverlag, Greifswald 1937.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Vgl. <strong>zu</strong>m Beispiel C. Wolff: Charakteristik <strong>de</strong>r Oberfächengestalt von Hinterpommern, vom Gollenberg östlich. In: Annalen <strong>de</strong>r Erd-, Völker- und Staatenkun<strong>de</strong> (Heinrich<br />
Berghaus, Hrsg.), 3. Reihe, 8. Band, 1. April - 30. September 1839, Berlin 1839, S. 213-220.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Sambori<strong>de</strong>n<br />
Die Sambori<strong>de</strong>n (auch Sobiesławi<strong>de</strong>n) waren im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt ein Herrschergeschlecht, das die pommerellischen Herzöge stellte.
Die Sambori<strong>de</strong>n<br />
Für die ersten pommerellischen Fürsten ist die Quellenlage sehr dürftig. Ihre Namen sind fast nur aus Schenkungsurkun<strong>de</strong>n bekannt, die sie angeblich ausgestellt haben. Viele <strong>de</strong>r auf uns<br />
gekommenen Dokumente sind aus unterschiedlichen Grün<strong>de</strong>n gefälscht, sowohl was <strong>de</strong>n Inhalt, als auch was das Ausstellungsdatum angeht. Und fast nichts ist über das Wirken nach<br />
außen bekannt. So herrscht viel Spekulation, die <strong>zu</strong> unterschiedlichen Auslegungen geführt hat und noch führt. In diesen Zusammenhängen übersetzen einige Forscher das lateinische<br />
Wort „Princeps“ als „Statthalter“, an<strong>de</strong>re übersetzen es als „Fürst“. Auch die Herkunft <strong>de</strong>s pommerellischen Herrschergeschlechts wird diskutiert. Während die Herrscher aller polnischen<br />
Teilfürstentümer <strong>zu</strong>r Großfamilie <strong>de</strong>r Piasten gehörten, waren die Sambori<strong>de</strong>n im Mannesstamm unstreitig keine Piasten. Einige Forscher nehmen an, dass <strong>de</strong>r polnische König Bolesław<br />
III. Schiefmund, als er 1116 Pommern unterworfen hatte, eine Familie aus <strong>de</strong>m polnischen Hinterland als Statthalter in Pommerellen eingesetzt hat. Dabei wird darauf verwiesen, dass bei<br />
einer Familie aus <strong>de</strong>m Gebiet von Sieradz dieselben Namen vorkommen, wie bei <strong>de</strong>n Sambori<strong>de</strong>n: Świętopełk, Warcisław, Mściwój. Deren Nachkommen hätten sich dann zeitweise <strong>de</strong>r<br />
piastisch-polnischen Oberherrschaft entzogen. An<strong>de</strong>re meinen, dass es sich um ein einheimisches A<strong>de</strong>lsgeschlecht gehan<strong>de</strong>lt hat. Sie stützen sich darauf, dass Sambor I. und Mestwin I. in<br />
ihren Urkun<strong>de</strong>n unumschränkt über ihre „von ihren Vätern und Vorvätern ererbten Besit<strong>zu</strong>ngen“ verfügen, ohne eine Abhängigkeit <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n piastischen Herzögen erkennen <strong>zu</strong> lassen.<br />
Stammliste<br />
1. Sobiesław I., Herzog von Pommerellen (regierte 1155–1187);<br />
1. Sambor I., Herzog von Pommerellen (regierte 1187–1207);<br />
1. Sobiesław II. (ca. 1207–1217/1223), Sambors Sohn unter <strong>de</strong>r Vormundschaft seines Onkels Mestwin I., starb bereits in jungen Jahren;<br />
2. Swantopolk I. (ca. 1207–1227), Sambors Sohn unter <strong>de</strong>r Vormundschaft seines Onkels Mestwin I., starb bereits in jungen Jahren;<br />
2. Mestwin I., Bru<strong>de</strong>r von Sambor I. und Herzog von Pommerellen (regierte 1207–1220);<br />
1. Swantopolk II., Herzog von Pommerellen (regierte 1220–1266);<br />
1. Mestwin II., Herzog von Pommerellen (regierte 1266–1294);<br />
1. Katharina (ca. 1250–1312), heiratete Herzog Pribisław von Mecklenburg-Parchim durch Heirat Titularherzogin von Mecklenburg-Parchim und<br />
Herzogin von Pommern in Belgard;<br />
2. Eufemia (ca. 1260–1317), als Gattin von Graf Adolf V. († 1308) durch Heirat Gräfin von Holstein in Segeberg;<br />
2. Wartisław II., Herzog von Pommerellen in Danzig (regierte 1266–1271);<br />
3. Eufemia (ca. 1225–1270), als Gattin von Fürst Jaromar II. durch Heirat Fürstin von Rügen;<br />
4. Jan (ca. 1230–1248), starb in jungen Jahren;<br />
2. Wartisław I., Herzog von Pommerellen in Schwetz und Mewe (regierte 1220–1233);<br />
3. Sambor II., Herzog von Pommerellen in Liebschau und Dirschau (regierte 1220–1270);<br />
1. Sobiesław (ca. 1235–1254), überlebte seinen Vater nicht;<br />
2. Margarete Sambiria, heiratete Christoph I. von Dänemark durch Heirat Königin von Dänemark;<br />
3. Zwinisława (ca. 1240–1280), Gattin von Dobiesław Sądowic aus <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>lsgeschlecht <strong>de</strong>r Odrowąż;<br />
4. Gertruda (ca. 1250–1314), blieb unvermählt;<br />
5. Eufemia (ca. 1254–1296/1309), als Gattin von Herzog Bolesław II. durch Heirat Herzogin von Schlesien in Liegnitz;<br />
6. Salomea (Salome, ca. 1254/1257–1312/1314), als Gattin von Herzog Siemomysław durch Heirat Herzogin von Kujawien in Inowrocław;<br />
4. Ratibor, Herzog von Pommerellen in Belgard (regierte 1233–1262);<br />
5. Witosława (ca. 1205–1290), Priorin im Kloster Zuckau;<br />
6. Mirosława (ca. 1190–1233/1240), heiratete Herzog Bogislaw II. von Pommern durch Heirat Herzogin von Pommern;<br />
7. Hedwig (Jadwiga, ca. 1200–1249), heiratete Herzog Władysław Odon von Großpolen durch Heirat Herzogin von Großpolen;<br />
Aussterben
Durch das Ableben von Herzog Mestwin II. im Jahre 1294 starb das pommerellische Herrscherhaus <strong>de</strong>r Sambori<strong>de</strong>n im Mannesstamm aus. Nachfolger in <strong>de</strong>r Herrschaft in Pommerellen<br />
wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst Przemysław II., Herzog von Großpolen, <strong>de</strong>r am 16. Juni 1295 vom Erzbischof von Gnesen <strong>zu</strong>m König von Polen gekrönt, aber schon im Februar 1296 ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.<br />
Anschließend kam es <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m langen pommerellischen Erbfolgestreit, als <strong>de</strong>ssen Ergebnis 1308 <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>s Herzogtums in Besitz nahm.<br />
Literatur<br />
• Ernst Bahr: Aus <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Kreises Karthaus, S. 23 ff., in Der Kreis Karthaus, ein westpreußisches Heimatbuch, hg. Wilhelm Brauer u. a., ohne Ort, 1978<br />
• Peter von Dusburg: Chronik <strong>de</strong>s Preußenlan<strong>de</strong>s. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Darmstadt 1984<br />
• Erich Keyser: Danzigs Geschichte. Danzig 1928, Nd. Hamburg o. J.<br />
• Erich Keyser: Die Baugeschichte <strong>de</strong>r Stadt Danzig. Köln 1972, ISBN 3-412-95972-3<br />
• Otto Korthals: Herzog Sambor II. von Pommerellen in Westpreußen Jahrbuch Bd. 18, 1968, S. 8 ff.<br />
• Heinz Lingenberg: Die Anfänge <strong>de</strong>s Klosters Oliva und die Gründung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt Danzig. Klett, Stuttgart 1982<br />
• F. Lorentz: Geschichte <strong>de</strong>r Kaschuben. Berlin 1926<br />
• Ostrowska, R. u. Trojanowska, I., Be<strong>de</strong>ker kas<strong>zu</strong>bski, Gdansk 1978<br />
• Max Perlbach (Hrsg.): Pommerellisches Urkun<strong>de</strong>nbuch. Bertling, Danzig 1881–1916. Neudruck: Scientia, Aalen 1969.<br />
• Gotthold Rho<strong>de</strong>: Geschichte Polens. Darmstadt 1980, ISBN 3-534-00763-8.<br />
• Bruno Schumacher: Geschichte Ost- und Westpreußens. 7. Auflage. Verlag Weidlich, Würzburg 1987. Neudruck <strong>de</strong>r 7. Auflage: Weltbild Verlag, Augsburg 1993, ISBN 3-89350-<br />
111-8.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Wendischer Städtebund<br />
Der Wendische Städtebund entstand 1259 zwischen Lübeck, Kiel, Wismar, Rostock und Stralsund. Er diente <strong>de</strong>r Sicherung <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lswege auf <strong>de</strong>m Land und <strong>zu</strong>r See und gilt als<br />
Keimzelle sowohl <strong>de</strong>s späteren wendischen Quartiers als auch <strong>de</strong>r Deutschen Hanse insgesamt. Seine Wurzeln lagen im Bündnis zwischen Hamburg und Lübeck von 1230, vertraglich<br />
festgelegt 1241. Verstärkt wur<strong>de</strong> er durch das traditionell mit Hamburg verbün<strong>de</strong>te Lüneburg sowie später durch die pommerschen Städte Greifswald, Stettin und Anklam. Zum Teil waren<br />
diese Städte auch im Wendischen Münzverein <strong>zu</strong>sammen geschlossen.<br />
Literatur<br />
• Philippe Dollinger: Die Hanse. 5. Auflage, Stuttgart 1998, ISBN 3520371057.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Hansisch-nie<strong>de</strong>rländischer Krieg - 1438 bis 1441<br />
Der Hansisch-nie<strong>de</strong>rländische Krieg von 1438 bis 1441 war ein Krieg zwischen <strong>de</strong>m Städtebund Hanse und <strong>de</strong>r Grafschaft Holland.<br />
Vorgeschichte<br />
Die holländischen Kaufleute umgingen im Ostseeraum nach Möglichkeit die Stapelgebote <strong>de</strong>r Hanse und suchten als Umlandfahrer <strong>de</strong>n unmittelbaren Weg <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Konsumenten und<br />
Produzenten. Dieses Vorgehen untergrub das hansische Zwischenhan<strong>de</strong>lsmonopol und bewirkte entsprechen<strong>de</strong> finanzielle Einbußen.<br />
Einen ersten Zwischenfall gab es 1422, als ein Geschwa<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r wendischen Städte in <strong>de</strong>n Sund eindrang und dort holländische Heringsfänger manövrierunfähig machte. Als Begründung<br />
wur<strong>de</strong> angegeben, <strong>de</strong>r dänische König könnte die Fahrzeuge für <strong>de</strong>n Kampf gegen die Hanse chartern.<br />
In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren konnten die Hollän<strong>de</strong>r ihre Stellung im Ostseeraum ausbauen. Die Hanse reagierte mit restriktiven Maßnahmen. 1436 untersagten die wendischen Städte ihren<br />
Schiffen die Fahrt nach Holland und Flan<strong>de</strong>rn. Es kam <strong>zu</strong> diplomatischen Aktivitäten mit einem lebhaften Schriftverkehr, jedoch ohne Ergebnis.<br />
Am 7. April 1438 gestattete Herzog Philipp <strong>de</strong>r Gute <strong>de</strong>n Hollän<strong>de</strong>rn die Kaperei gegen die sechs wendischen Städte (Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Greifswald, Stettin und Anklam)<br />
sowie <strong>de</strong>n Herzog von Holstein.<br />
Am 23. April 1438 informierte die Hanse ihre Städte über einen bevorstehen<strong>de</strong>n Krieg mit Holland und for<strong>de</strong>rte <strong>zu</strong>r Einstellung <strong>de</strong>r Schifffahrt nach Flan<strong>de</strong>rn, Holland und Seeland auf.<br />
Kriegsverlauf<br />
Holland war <strong>zu</strong>r See noch nicht stark genug, um sich einen offenen Kampf mit Hanseverbän<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> liefern und musste sich auf die Kaperei beschränken. Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite blieben die<br />
wendischen Städte auf sich gestellt, <strong>de</strong>nn trotz wie<strong>de</strong>rholter Auffor<strong>de</strong>rung Lübecks beteiligten sich die übrigen Hansestädte nicht an <strong>de</strong>n Kampfhandlungen.<br />
Die Anstrengungen von Herzog, Rat und Ritterschaft von Holland und Seeland ermöglichten es, dass schon am 22. Juni 1438 eine aus 54 großen und 50 kleinen Schiffen bestehen<strong>de</strong><br />
Kaperflotte unter Hendrik van Borsselen aus Rotterdam auslaufen konnte. Obwohl er auf <strong>de</strong>r Hinfahrt <strong>de</strong>n neutral gebliebenen Hansestädten freies Geleit <strong>zu</strong>gesagt hatte, überfiel er<br />
überraschend bei Brest eine preußische Baiensalzflotte und brachte 23 preußische und livländische Schiffe auf. Die dort befindlichen elf Schiffe <strong>de</strong>r wendischen Städte hatten sich beim<br />
Erscheinen <strong>de</strong>r Kaperflotte rechtzeitig in <strong>de</strong>n Hafen <strong>zu</strong>rückgezogen.<br />
Die neutralen Hansestädte erhoben Scha<strong>de</strong>nersatzansprüche, doch trotz ihrer Empörung schlossen sie sich auch jetzt nicht <strong>de</strong>m Krieg <strong>de</strong>r von Lübeck angeführten wendischen Städte an.<br />
Vielmehr arretierten sie aus Unmut über die Sperrmaßnahmen <strong>de</strong>r wendischen Städte im Sund <strong>de</strong>ren Güter in Preußen.<br />
Nach <strong>de</strong>r Eisperio<strong>de</strong> nahmen im Frühjahr 1439 bei<strong>de</strong> Seiten <strong>de</strong>n Kaperkrieg auf. Im Mittelpunkt stand die Sundpassage, wo sowohl das Geleit <strong>de</strong>r eigenen Han<strong>de</strong>lsschiffe gewährleistet<br />
als auch das Aufbringen gegnerischer Schiffe angestrebt wur<strong>de</strong>.<br />
Zu dieser Zeit traf Christoph, <strong>de</strong>r künftige Herrscher <strong>de</strong>r drei nordischen Reiche, in Lübeck ein. Er erlangte die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r wendischen Städte, in<strong>de</strong>m er sich unter an<strong>de</strong>rem
verpflichtete, gegen Holland vor<strong>zu</strong>gehen, <strong>de</strong>n Sundzoll auf<strong>zu</strong>heben und <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n ihre Privilegien <strong>zu</strong> bestätigen. Im Gegen<strong>zu</strong>g bot Christophs Rivale Erich von Pommern <strong>de</strong>n<br />
Hollän<strong>de</strong>rn und Philipp <strong>de</strong>m Guten ein Bündnis an, um auf <strong>de</strong>n dänischen Thron <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>kehren.<br />
Als im Frühjahr 1440 die Kampfhandlungen wie<strong>de</strong>r aufgenommen wur<strong>de</strong>n, erschien eine holländische Flotte, doch es gelang Christoph <strong>zu</strong>vor mit Hilfe einer hansischen Flotte, seinen<br />
Gegner <strong>zu</strong> besiegen. Die holländische Flotte lag bei Marstrand vor Anker, wur<strong>de</strong> aber rechtzeitig gewarnt und konnte sich durch Rück<strong>zu</strong>g retten.<br />
Nach<strong>de</strong>m Christoph seinen Thron gesichert hatte, rückte er mehr und mehr von <strong>de</strong>r Hanse ab und begünstigte <strong>zu</strong>nehmend die Hollän<strong>de</strong>r. Der Kaperkrieg wur<strong>de</strong> bis Kriegsen<strong>de</strong> von bei<strong>de</strong>n<br />
Seiten fortgesetzt.<br />
Frie<strong>de</strong>nsschluss<br />
Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Kopenhagen en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Hansisch-nie<strong>de</strong>rländische Krieg. Der auf zehn Jahre befristete Vertrag wur<strong>de</strong> im Jahr 1441 in Kopenhagen von <strong>de</strong>n Städten <strong>de</strong>r Hanse unter<br />
Führung von Lübecks Bürgermeister Johann Lüneburg und <strong>de</strong>n Hollän<strong>de</strong>rn unterzeichnet.<br />
Im Vertrag verpflichteten sich die nie<strong>de</strong>rländischen Städte <strong>zu</strong>m Ersatz beziehungsweise <strong>zu</strong>r Rückgabe von 22 Schiffen <strong>de</strong>r preußischen und livländischen Hansestädte. Die Hollän<strong>de</strong>r<br />
zahlten weiterhin 5.000 Gul<strong>de</strong>n an König Christoph III. von Dänemark und verpflichteten sich gegenüber <strong>de</strong>n wendischen Städten <strong>de</strong>r Hanse, allen diesen entstan<strong>de</strong>nen Scha<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><br />
ersetzen. An<strong>de</strong>rerseits mussten die wendischen Städte <strong>de</strong>n Hollän<strong>de</strong>rn gegenseitige Verkehrsfreiheit <strong>zu</strong>gestehen und alle einschränken<strong>de</strong>n Maßnahmen aufheben. Damit war die hansische<br />
Monopolstellung im Ostseeraum untergraben.<br />
Literatur<br />
• Konrad Fritze/Günter Krause: Seekriege <strong>de</strong>r Hanse. Militärverlag <strong>de</strong>r DDR, Berlin 1989, ISBN 3-926642-02-5<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kampen (Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>)<br />
Kampen ist eine Gemein<strong>de</strong> und ehemalige Hansestadt in <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländischen Provinz Overijssel mit einer Fläche von 161,84 km² und 49.345 Einwohnern.<br />
Orte<br />
In Klammern die Einwohnerzahl (Januar 2007):<br />
• Kampen; Sitz <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>verwaltung (33.750)<br />
• IJsselmui<strong>de</strong>n, am rechten IJsselufer gegenüber von Kampen (11.500)<br />
• Grafhorst (1.000)
• 's-Heerenbroek (600)<br />
• Kamperveen (etwas über 800)<br />
• Wilsum (etwas über 800)<br />
• Zalk (etwas über 800)<br />
Lage und Wirtschaft<br />
Die Stadt liegt an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r IJssel in das IJsselmeer. Sie hat drei Verkehrsbrücken über diesen Fluss. Kampen ist <strong>de</strong>r Endpunkt einer Kleinbahn nach Zwolle; <strong>de</strong>r Bahnhof liegt<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Stadt, jenseits <strong>de</strong>r IJssel.<br />
Kampen hat zwei theologische Fakultäten verschie<strong>de</strong>ner protestantischer Kirchen und eine Kunstaka<strong>de</strong>mie. Die Landwirtschaft, vor allem Molkereien (in <strong>de</strong>r Umgebung Pol<strong>de</strong>r mit<br />
nährstoffreichen Wiesen), und verschie<strong>de</strong>ne kleinere Industriebetriebe und Werften, sowie <strong>de</strong>r Tourismus (Wassersport; historische Altstadt) sind die Haupterwerbsquellen. En<strong>de</strong> 2007<br />
wur<strong>de</strong> eine erhebliche Ausbreitung <strong>de</strong>s Flusshafens und <strong>de</strong>r dortigen Schiffswerften untersucht, um <strong>zu</strong>sätzliche Arbeitsplätze <strong>zu</strong> schaffen.<br />
Geschichte<br />
Die Stadt Kampen entstand um das Jahr 1000 aus einem Dorf entlang einem Deich. 1236 erhielt Kampen Stadtrecht. Schon früh war Kampen o<strong>de</strong>r Campen eine wichtige Hafen- und<br />
Han<strong>de</strong>lsstadt wegen seiner Lage an <strong>de</strong>r Flussmündung. Die Stadt trat 1441 <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Hanse bei. Kampen war einige Zeit die wichtigste nie<strong>de</strong>rländische Stadt in diesem<br />
Städteverbund. Seit <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt verlor es an Be<strong>de</strong>utung, da sich Probleme mit <strong>de</strong>m Wasserstand ergeben hatten, aber auch als Folge von Kriegen und <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskonkurrenz<br />
Hollands. Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatte die Stadt eine gemeinschaftliche Münze mit Zwolle und Deventer, die in <strong>de</strong>r Hansezeit mehr o<strong>de</strong>r weniger Partnerstädte waren. Vom 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
bis etwa 1970 war Kampen ein Zentrum <strong>de</strong>r Zigarrenherstellung.<br />
Die Orte Grafhorst und Wilsum erhielten ebenfalls im Mittelalter Stadtrechte, wuchsen aber nie <strong>zu</strong> richtigen Städten aus. Grafhorst wur<strong>de</strong> 1849 durch eine Brandkatastrophe nahe<strong>zu</strong> völlig<br />
zerstört.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Gebäu<strong>de</strong><br />
Aus <strong>de</strong>r Blütezeit <strong>de</strong>r Stadt sind mehrere historische Gebäu<strong>de</strong> erhalten geblieben:<br />
• das Rathaus, mit einer schönen Innenausstattung, <strong>zu</strong>m Teil aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
• drei Stadttore, u. a. die Cellebroe<strong>de</strong>rspoort und die weiße Koornmarktspoort, die von <strong>de</strong>r IJssel sichtbar ist<br />
• <strong>de</strong>r Neue Turm (Nieuwe Toren), erbaut im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt, mit vier Glocken aus <strong>de</strong>n 1480er Jahren, die aus einem an<strong>de</strong>ren Gebäu<strong>de</strong> kamen, und einem Glockenspiel vom<br />
berühmten Glockengießer Hemony.<br />
• drei alte Kirchen, von <strong>de</strong>nen vor allem die Nikolaus- o<strong>de</strong>r Obere Kirche (Bovenkerk) sehenswert ist. Internationale Bekanntheit hat die Hinsz-Orgel erlangt.<br />
Von <strong>de</strong>n alten Häusern sind nur wenige erhalten:<br />
• Das bekannteste ist das „Gotische Haus“, das bis 2006 das Stadtmuseum beherbergte. Es wur<strong>de</strong> im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt durch Pierre Cuypers stark restauriert.<br />
• Die „IJsselfront“, die Häuserzeile entlang <strong>de</strong>s Flusses, datiert, wie jene in Zutphen, aus <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Museen<br />
• Das Tabakmuseum mit einer 2,5 Meter langen Zigarre behan<strong>de</strong>lt die Geschichte <strong>de</strong>r Tabakherstellung <strong>de</strong>r Stadt.
• Das Städtische Museum hat <strong>de</strong>n Charakter eines größeren Heimatmuseums. Es wird im Dezember 2008 im alten Rathaus eine neue Unterkunft haben.<br />
• In <strong>de</strong>r Koornmarktspoort wer<strong>de</strong>n Wechselausstellungen gegeben.<br />
• Im Nieuwe Toren wer<strong>de</strong>n wechseln<strong>de</strong> Ausstellungen gezeigt.<br />
Sehenswürdigkeiten außerhalb <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Die Dorfkirche von Wilsum aus <strong>de</strong>m 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
• Die Windmühle von Zalk (1860)<br />
• Die Dorfkirche von IJsselmui<strong>de</strong>n (Anfang <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts)<br />
• Die Fluss- und Wiesenlandschaft ist reich an Vögeln.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Die Stadt Kampen pflegt Städtepartnerschaften mit folgen<strong>de</strong>n Städten:<br />
• Eilat (Israel)<br />
• Meinerzhagen (Deutschland)<br />
• Pápa (Ungarn)<br />
• Soest (Deutschland)<br />
• Strzelce Opolskie (Polen)<br />
Persönlichkeiten<br />
Ehrenbürger<br />
• Willem Kolff (1911–2009), Mediziner und Arzt; 1945 Stadtkrankenhaus Kampen Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r künstlichen Niere.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Hinrik van Kampen, Glockengießer <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
• Jan Willem <strong>de</strong> Winter (1761-1812), Admiral, Marschall, Oberbefehlshaber <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländischen Streitkräfte während <strong>de</strong>r Koalitionskriege.<br />
• Jaap Stam (* 1972), Fußballspieler. Er begann seine Karriere beim DOS Kampen und spielte dort bis 1992. Jaap Stam absolvierte für die nie<strong>de</strong>rländische Fußball-<br />
Nationalmannschaft 67 Län<strong>de</strong>rspiele (1996–2004).<br />
Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben<br />
• Hendrick Avercamp (1585–1634), Maler, <strong>de</strong>r Stumme von Kampen (<strong>de</strong> Stomme van Kampen); nach ihm sind die Avercampstraat und ein Café benannt.<br />
• Gerhard van Wou (1440–1527), Glockengießer. Er schuf die Gloriosa für <strong>de</strong>n Erfurter Dom, die im Allgemeinen als sein Meisterwerk betrachtet wird.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Bevölkerungsstatistik, 1. März 2010 – Centraal Bureau voor <strong>de</strong> Statistiek, Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Land Lebus<br />
Das Land Lebus (auch Lebuser Land) ist sowohl eine eiszeitliche Hochfläche als auch eine historische Kulturlandschaft bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r. Der westlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegene Teil gehört<br />
heute <strong>zu</strong> Bran<strong>de</strong>nburg und <strong>de</strong>r östlich davon gelegene Teil <strong>zu</strong>r polnischen Woiwodschaft Lebus.<br />
Geschichte<br />
Bolesław Chrobry (<strong>de</strong>r Tapfere) beteiligte sich, gemäß <strong>de</strong>r Quedlinburger Absprache von 991, am Kampf Kaiser Otto III. gegen die heidnischen Elbslawen. Dieser Kampf verlief<br />
allerdings weitgehend erfolglos. Der östliche Teil <strong>de</strong>r Nordmark mit <strong>de</strong>m Zentrum Lebus hingegen, blieb bis ins 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt unter polnischem Einfluss. (vgl. Geschichte Polens)<br />
Der Name kommt von <strong>de</strong>r Stadt Lebus und taucht im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>m ersten Mal auf. Das Land Lebus war im Besitz <strong>de</strong>s gleichnamigen Bistums mit Sitz in Lebus und war <strong>zu</strong>nächst<br />
vor allem von westslawischen Stämmen bewohnt. Später kamen <strong>de</strong>utschstämmige Kolonisten hin<strong>zu</strong>. Um 1600 war die Region dann fast ausschließlich <strong>de</strong>utschsprachig.<br />
Heute<br />
Die heutige polnische Woiwodschaft Lebus (Wojwództwo Lubuskie) sieht sich - ausgedrückt in <strong>de</strong>r Namensgebung - in einer historischen Tradition mit <strong>de</strong>m mittelalterlichen Land Lebus.<br />
Für die Umgebung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt Lebus bzw. das Amt Lebus im Landkreis Märkisch-O<strong>de</strong>rland in Bran<strong>de</strong>nburg hat sich <strong>de</strong>r Begriff Land Lebus bzw. Lebuser Land bis heute<br />
erhalten.<br />
Das Land Lebus wur<strong>de</strong> für 2003/2004 <strong>zu</strong>r grenzüberschreiten<strong>de</strong>n Landschaft <strong>de</strong>s Jahres gewählt.<br />
Literatur<br />
• Matthias Antkowiak & Michaela Aufleger: Frankfurt (O<strong>de</strong>r) und das Land Lebus. In: Führer <strong>zu</strong> archäologischen Denkmälern in Deutschland. Bd. 45. Stuttgart 2005, ISBN 3-<br />
8062-1952-4<br />
• Cornelia Willich: Die Ortsnamen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Lebus. Mit einem siedlungsgeschichtlichen Beitrag von Rolf Barthel. (= Bran<strong>de</strong>nburgisches Namenbuch. Bd. 8 gleichzeitig Berliner<br />
Beiträge <strong>zu</strong>r Namenforschung Bd. 9) Weimar 1994. ISBN 3-7400-0918-7<br />
• Otto Breitenbach: Das Land Lebus unter <strong>de</strong>n Piasten. Fürstenwal<strong>de</strong>/Spree 1890<br />
• Lutz Partenheimer: Die Entstehung <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg. Mit einem lateinisch-<strong>de</strong>utschen Quellenanhang. 1. und 2. Auflage Köln/Weimar/Wien 2007.<br />
• Siegismund Wilhelm Wohlbrück: Geschichte <strong>de</strong>s ehemaligen Bistums Lebus und <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s dieses Namens. Berlin 1829, 648 Seiten (Volltext).
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Neumark (Landschaft)<br />
Die Neumark (poln. Nowa Marchia) ist eine östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r in Polen gelegene historische Landschaft. Sie gehörte bis 1945 <strong>zu</strong>r preußischen Provinz Bran<strong>de</strong>nburg.<br />
Geografische Lage<br />
Die Neumark war im Westen und Sü<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r begrenzt, im Nor<strong>de</strong>n grenzte sie an die Provinz Pommern und im Osten an Polen bzw. von 1815 bis 1920 an die preußische Provinz<br />
Posen. Neben <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r beherrschten die Flüsse Warthe und Netze mit ihren weiten Sumpfgebieten die Landschaft. Zur Zeit ihrer größten Aus<strong>de</strong>hnung (En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts)<br />
umfasste die Neumark die Kreise Königsberg/Nm., Soldin, Landsberg/W., Frie<strong>de</strong>berg, Arnswal<strong>de</strong>, Dramburg, Schivelbein, Sternberg, das vormals schlesische Crossen und das historischgeographisch<br />
<strong>zu</strong>r Nie<strong>de</strong>rlausitz gehören<strong>de</strong> Cottbus.<br />
Geschichte bis 1320<br />
Bis <strong>zu</strong>m Anfang <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts war das Gebiet <strong>de</strong>r späteren Neumark dünn von slawischen Stämmen besie<strong>de</strong>lt und stand seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter <strong>de</strong>r Herrschaft Polens.<br />
Vom dritten Jahrzehnt <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts an begann die Einwan<strong>de</strong>rung nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Siedler nördlich und südlich von Warthe und Netze <strong>zu</strong>nächst auf Initiative <strong>de</strong>r pommerschen und<br />
polnischen Herrscher. Sie bedienten sich dabei <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Templer, Johanniter und Zisterzienser, die <strong>zu</strong>nächst Klöster grün<strong>de</strong>ten und dann in <strong>de</strong>ren Bereich Siedlungen errichteten. Im<br />
Nor<strong>de</strong>n bauten Pommern und Polen <strong>zu</strong>m Schutz <strong>de</strong>r Grenze Burgen, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ren Füßen ebenfalls neue Siedlungen entstan<strong>de</strong>n.<br />
Auch die Bran<strong>de</strong>nburger Markgrafen aus <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Askanier, waren bestrebt, östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r Fuß <strong>zu</strong> fassen. Zu einem wichtigen Stützpunkt wur<strong>de</strong> die Kastellanei Zantoch mit <strong>de</strong>m<br />
einzigen Wartheübergang. Sie war in polnischer Hand, wegen ihrer strategischen Be<strong>de</strong>utung aber über lange Zeiten ein Streitobjekt mit <strong>de</strong>n Pommern gewesen. Des Streites mü<strong>de</strong><br />
überließ Großpolenherzog Przemysl I. 1254 die Kastellanei <strong>de</strong>m bran<strong>de</strong>nburgischen Markgrafen Konrad als Mitgift für seine Tochter Konstanza. Zur Sicherung <strong>de</strong>s Gebietes grün<strong>de</strong>te<br />
Markgraf Johannes I. 1257 die Stadt Landsberg. Durch weiteren Lan<strong>de</strong>rwerb konnten die Askanier ihren Herrschaftsbereich weiter nach Osten bis <strong>zu</strong>m Fluss Drage und nach Nor<strong>de</strong>n bis<br />
<strong>zu</strong>m Fluss Persante aus<strong>de</strong>hnen. Bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts war die Besie<strong>de</strong>lung <strong>de</strong>r „Terra trans O<strong>de</strong>ram“ im Wesentlichen abgeschlossen (<strong>de</strong>r Name "Neumark" wird erstmals<br />
1383 gebraucht:"die nuwe Mareke uff dissit o<strong>de</strong>r obir <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r"). Die neuen Siedler waren in <strong>de</strong>r Hauptsache aus <strong>de</strong>n Mag<strong>de</strong>burger und altmärkischen Lan<strong>de</strong>n gekommen. Zum<br />
Machtzentrum <strong>de</strong>r Neumark, wie das Gebiet etwa vom 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt an genannt wur<strong>de</strong>, entwickelte sich die Stadt Soldin, die 1261 in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Askanier gekommen war.<br />
Vom Aussterben <strong>de</strong>r Askanier bis <strong>zu</strong>r Reformation<br />
Mit <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Askanier 1320 ließ das Interesse Bran<strong>de</strong>nburgs an <strong>de</strong>r Neumark spürbar nach. We<strong>de</strong>r die Wittelsbacher (1323–1373) noch die Luxemburger Herrschaftshäuser<br />
kümmerten sich um die Weiterentwicklung ihrer östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r gelegenen Gebiete. Das politische Vakuum nutzten die Polen mit mehrfachen zerstörerischen Einfällen, und Raubritter<br />
terrorisierten die Bevölkerung. 1402 wur<strong>de</strong> die Neumark an <strong>de</strong>n Deutschen Ritteror<strong>de</strong>n verpfän<strong>de</strong>t, 1429 ging sie in <strong>de</strong>ssen Besitz über, doch ließ auch <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n das Land weiter<br />
verfallen. Im Jahre 1433 wur<strong>de</strong>n Teile <strong>de</strong>r Neumark von Hussiten schwer zerstört. Anfang Juni begann <strong>de</strong>r Einmarsch von Hussiten und Polen, am 4. Juni wur<strong>de</strong> Zantoch erobert, vom 9.<br />
bis 15. Juni Landsberg belagert. Während<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong> in weitem Umkreis alles verwüstet, zahlreiche Dörfer wur<strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rgebrannt. Am 15. Dezember 1433 schlossen <strong>de</strong>r Deutsche<br />
Or<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r König von Polen einen Frie<strong>de</strong>n auf zwölf Jahre, er sah unter an<strong>de</strong>rem vor, dass <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Bischöfen von Polen alle Güter, Dörfer und Besit<strong>zu</strong>ngen, die ihnen von alters<br />
her gehört hatten, wie<strong>de</strong>r einräumen sollte.
Die eigene Misswirtschaft zwang <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n, die Neumark bereits 1454 wie<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n bran<strong>de</strong>nburgischen Kurfürsten Friedrich II. aus <strong>de</strong>m Hause Hohenzollern <strong>zu</strong> verpfän<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m<br />
Friedrich II. die Neumark 1463 für 40.000 Gul<strong>de</strong>n endgültig erworben hatte, gehörte die Neumark mit Ausnahme <strong>de</strong>r Zeit zwischen 1535 und 1571 auf Dauer <strong>zu</strong> Bran<strong>de</strong>nburg. 1535<br />
machte Markgraf Hans von Küstrin die Neumark zeitweise <strong>zu</strong> einem selbständigen Staatsgebil<strong>de</strong> und leitete die Konsolidierung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ein. Dabei wirkten sich die Folgen <strong>de</strong>r 1537<br />
eingeführten Reformation günstig aus, <strong>de</strong>nn aller Stifts- und Klosterbesitz mit seinen reichen Einnahmen wur<strong>de</strong> in lan<strong>de</strong>sherrliches Eigentum überführt.<br />
Die Neumark von <strong>de</strong>r Reformation bis <strong>zu</strong>m Wiener Kongress 1815<br />
1548 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Regierungssitz von Soldin nach Küstrin verlegt. Der Dreißigjährige Krieg machte <strong>de</strong>r Neumark schwer <strong>zu</strong> schaffen. Schwedische wie kaiserliche Truppen zogen<br />
plün<strong>de</strong>rnd und brandschatzend durch das Land, die Pestepi<strong>de</strong>mien <strong>de</strong>r Jahre 1626 und 1631 rafften die Bevölkerung dahin. Während <strong>de</strong>r schwedischen Beset<strong>zu</strong>ng musste die Neumark<br />
60.000 Taler und 10.000 Wispel Roggen an Stationierungskosten aufbringen.<br />
Mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s preußischen Staates 1701 begann sich die Situation <strong>de</strong>r Neumark wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> verbessern. Bereits unter König Friedrich I. setzte eine neue Kolonisationswelle ein,<br />
und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n neuen Einwan<strong>de</strong>rern zählten auch zahlreiche reformierte Franzosen, die ihres Glaubens wegen ihre Heimat verlassen mussten. Zielgerichtet wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Neumark das<br />
Tuchmacherhandwerk angesie<strong>de</strong>lt. Einen erneuten Rückschlag für das wirtschaftliche Leben brachte <strong>de</strong>r Siebenjährige Krieg mit sich, als erneut hohe Kontributionen aufgebracht wer<strong>de</strong>n<br />
mussten. Erheblicher Landgewinn und wirtschaftliche Konsolidierung kam durch das Trockenlegungsprogramm von Friedrich <strong>de</strong>m Großen für das Warthe- und Netzebruch ab 1770 für<br />
die Neumark <strong>zu</strong>m Tragen.<br />
Die Neumark von 1815 bis 1945<br />
Die Neuglie<strong>de</strong>rung Preußens auf Grund <strong>de</strong>r territorialen Verän<strong>de</strong>rungen durch <strong>de</strong>n Wiener Kongress 1815 verän<strong>de</strong>rte auch die politische Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Neumark. Die Kreise Dramburg<br />
und Schivelbein sowie die nördlichen Teile <strong>de</strong>s Kreises Arnswal<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Stadt Nörenberg wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Provinz Pommern <strong>zu</strong>geschlagen. Das verbliebene Gebiet <strong>de</strong>r Neumark mit <strong>de</strong>n<br />
Kreisen Königsberg/Nm., Soldin, Arnswal<strong>de</strong>, Frie<strong>de</strong>berg, Landsberg/W., Sternberg (1873 geteilt in Weststernberg (Reppen) und Oststernberg (Zielenzig)), Züllichau-Schwiebus und<br />
Crossen wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n neu geschaffenen Regierungsbezirk Frankfurt <strong>de</strong>r Provinz Bran<strong>de</strong>nburg eingeglie<strong>de</strong>rt. Zum 1. Januar 1836 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kreis Küstrin aufgelöst und auf die Kreise<br />
Königsberg/Nm., Landsberg/W. und Lebus aufgeteilt. Als 1938 die Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen aufgelöst wur<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> die Neumark um die Kreise Schwerin/W. sowie Teile<br />
<strong>de</strong>r Kreise Meseritz und Bomst erweitert, im Gegen<strong>zu</strong>g gingen aber die Kreise Arnswal<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong>berg an die Provinz Pommern.<br />
Die Rote Armee erreichte die Neumark En<strong>de</strong> Januar 1945. Von <strong>de</strong>n 645.000 Einwohnern (Volkszählung 1939) waren noch rund 400.000 im Lan<strong>de</strong> [1]. Von ihnen kamen in <strong>de</strong>n<br />
darauffolgen<strong>de</strong>n Wochen bis Kriegsen<strong>de</strong> viele ums Leben. Das ostbran<strong>de</strong>nburgische Gebiet war damit die Region Deutschlands mit <strong>de</strong>n höchsten Verlusten unter <strong>de</strong>r Zivilbevölkerung.<br />
Die Neumark in Polen<br />
Im Frühjahr 1945 unterstellte die UdSSR das Gebiet <strong>de</strong>r polnischen Zivilverwaltung. Durch die Beschlüsse <strong>de</strong>r Potsdamer Konferenz (Potsdamer Abkommen) vom Juli/August 1945 kam<br />
das Gebiet vorbehaltlich einer frie<strong>de</strong>nsvertraglichen Regelung <strong>zu</strong>r Volksrepublik Polen. Die noch ansässige <strong>de</strong>utsche Bevölkerung wur<strong>de</strong> bis 1947 fast vollständig vertrieben und per<br />
Dekret vom 6. März 1946 enteignet. Nur ein kleiner Teil <strong>de</strong>r Bevölkerung, <strong>zu</strong>meist Spezialisten wie Techniker für Wasserwerke, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rückgehalten und musste Zwangsarbeit leisten.<br />
Diese Personengruppe durfte Ostbran<strong>de</strong>nburg Anfang <strong>de</strong>r 1950er-Jahre verlassen. An Stelle <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung traten <strong>zu</strong> etwa zwei Dritteln Zuwan<strong>de</strong>rer aus Zentralpolen sowie<br />
<strong>zu</strong> ca. einem Drittel ebenfalls aus ihrer Heimat vertriebene Ostpolen und Ukrainer. 1975–1998 gehörte die Neumark <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Woiwodschaften Gorzów Wielkopolski (Landsberg/Warthe)<br />
und Zielona Góra (Grünberg); nur ein kleiner Teil um Chojna (Königsberg Nm.) gehörte <strong>zu</strong>r Woiwodschaft Szczecin (Stettin). Die völkerrechtliche Zugehörigkeit <strong>zu</strong> Polen wur<strong>de</strong> 1990<br />
mit Abschluss <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utsch-polnischen Grenzvertrags erneut bestätigt.<br />
Mit <strong>de</strong>r Neuglie<strong>de</strong>rung Polens nach <strong>de</strong>r Demokratisierung kam <strong>de</strong>r größte Teil <strong>de</strong>r Neumark <strong>zu</strong>r Woiwodschaft Lebus, <strong>de</strong>ren Kernland sie nun bil<strong>de</strong>t. Ein kleiner Teil gehört <strong>zu</strong>r<br />
Woiwodschaft Westpommern. Seit <strong>de</strong>m 1. Januar 1999 gehört fast die ganze Neumark <strong>de</strong>r Woiwodschaft Lebus an.<br />
Infrastruktur <strong>de</strong>r Neumark<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>r Neumark war von jeher von <strong>de</strong>r Land- und Forstwirtschaft geprägt. Auch die mittelgroßen Siedlungen waren <strong>zu</strong>meist Ackerbürgerstädte. Vom 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt an gewann
das Tuchmachergewerbe an Be<strong>de</strong>utung. Mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Verkehrswege, die Reichsstraße 1 Berlin–Königsberg und die Ostbahn durchquerten die Neumark, wur<strong>de</strong> auch die<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ng für industrielle Ansie<strong>de</strong>lungen geschaffen. Sie waren hauptsächlich auf die Bedürfnisse <strong>de</strong>r Landwirtschaft ausgerichtet und konzentrierten sich auf die bei<strong>de</strong>n großen<br />
Städte Landsberg und Küstrin.<br />
Literatur<br />
• Erich Blunck (Hg.): Die Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>s Kreises Königsberg (Neumark). Geographisch geologische Übersicht / Die Stadt Königsberg / Die nördlichen Orte / Die Stadt<br />
Cüstrin / Sie südlichen Orte (Die Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Provinz Bran<strong>de</strong>nburg, 7 T. 1). Vossische Buchhandlung, Berlin 1927–1929.<br />
• Gerd Heinrich: Berlin und Bran<strong>de</strong>nburg. Mit Neumark und Grenzmark Posen-Westpreußen (Kröners Taschenausgabe, 311). Alfred Kröner Verlag, Stuttgart ³1995, ISBN 3-520-<br />
31103-8. – Mit einigen Beiträgen von Johannes Schultze <strong>zu</strong> Orten <strong>de</strong>r Neumark.<br />
• Jörg Lü<strong>de</strong>ritz: Die Neumark ent<strong>de</strong>cken. 3. Auflage. Berlin 2003, ISBN 3-89794-019-1.<br />
• Jörg Lü<strong>de</strong>ritz (Hrsg): Neumärkisches Lesebuch. Landschaften und Menschen im östlichen Bran<strong>de</strong>nburg. Berlin 2004, ISBN 3-89794-043-4.<br />
• Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Ziemia Lubuska: Almanach Terra Transo<strong>de</strong>rana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska. Berlin 2008, ISBN 978-3-937233-50-5.<br />
• Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Vereins für Geschichte <strong>de</strong>r Neumark.<br />
Nachweise<br />
1. ↑ Jörg Lü<strong>de</strong>ritz:Die Neumark: Durch die alte Kulturlandschaft östlich <strong>de</strong>r O<strong>de</strong>r, Berlin 2008, ISBN 978-3-89794-122-9<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Böhmischen Krone<br />
Als Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Böhmischen Krone (auch: Krone Böhmen; Böhmische Krone, Böhmische Kronlän<strong>de</strong>r, tschech. Česká koruna, země Koruny české, lat. Corona Bohemiae, Corona Regni<br />
Bohemiae) bezeichnet man die Gesamtheit <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r, die mit <strong>de</strong>m Königreich Böhmen durch <strong>de</strong>n gemeinsamen Herrscher sowie über Lehensbeziehungen miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n waren.<br />
Der Begriff bezeichnet also nicht die materielle Krone, die <strong>de</strong>m König aufs Haupt gesetzt wur<strong>de</strong> (siehe da<strong>zu</strong> Wenzelskrone), vielmehr wird damit das entpersonalisierte, aus mehreren<br />
Glie<strong>de</strong>rn entstan<strong>de</strong>ne böhmische Staatswesen benannt.<br />
Übersicht<br />
Im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt waren nur Böhmen, die Markgrafschaft Mähren und die Grafschaft Glatz auf Dauer miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n. Unter <strong>de</strong>n Luxemburger Königen Johann und Karl<br />
IV. kamen Schlesien, die Ober- und die Nie<strong>de</strong>rlausitz sowie eine Vielzahl von kleineren Reichslehen hin<strong>zu</strong>. Karl IV. verfügte, dass die Län<strong>de</strong>rverbindung unabhängig von <strong>de</strong>n<br />
dynastischen Entwicklungen Bestand haben sollte, auch dann, wenn die Luxemburger einmal aussterben sollten. Die förmliche Verbindung einzelner Territorien mit <strong>de</strong>r Krone Böhmen<br />
bezeichnete man als Inkorporationen Das wur<strong>de</strong> auch unter <strong>de</strong>n Habsburgern ab Ferdinand I. beibehalten, seit<strong>de</strong>m sie eine <strong>de</strong>r drei Hauptgruppen <strong>de</strong>r Habsburgermonarchie bil<strong>de</strong>ten.
Die Böhmische Krone war we<strong>de</strong>r eine bloße Personalunion noch eine Fö<strong>de</strong>ration gleichberechtigter Mitglie<strong>de</strong>r. Statt<strong>de</strong>ssen galten das Königreich Böhmen und seine Stän<strong>de</strong> als Haupt, die<br />
an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>r als die Glie<strong>de</strong>r. Während die Böhmen <strong>de</strong>n Unterschied zwischen Hauptland und Nebenlän<strong>de</strong>rn hervorhoben und neben <strong>de</strong>r Führungsrolle im Inneren nach außen die<br />
Alleinvertretung <strong>de</strong>s Staates beanspruchten, betonten Mährer, Schlesier und Lausitzer die politische Autonomie ihrer Län<strong>de</strong>r, die sich schließlich freiwillig mit Böhmen vereinigt hätten.<br />
Die Führungsrolle Böhmens wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Nebenlän<strong>de</strong>r nicht grundsätzlich in Frage gestellt, wenngleich sie seit <strong>de</strong>m Beginn <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts beharrlich mehr Rechte,<br />
<strong>zu</strong>m Beispiel die Beteiligung an <strong>de</strong>r Königswahl, for<strong>de</strong>rten.<br />
Außer <strong>de</strong>m König verfügte die Böhmische Krone über keine gemeinsamen Staatsorgane, was in Krisenzeiten ein großer Nachteil war. Nur selten trafen sich die Stän<strong>de</strong> aller Län<strong>de</strong>r <strong>zu</strong><br />
Generallandtagen. Lediglich die böhmische Hofkanzlei unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Oberstkanzlers war für alle Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Krone <strong>zu</strong>ständig. Obwohl kaum Institutionen vorhan<strong>de</strong>nen waren,<br />
kam es vor allem im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong> immer engeren politischen Verbindungen zwischen <strong>de</strong>n Kronlän<strong>de</strong>rn und <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges schien es, als könnte mit <strong>de</strong>r<br />
Confoe<strong>de</strong>ratio Bohemica das politische System <strong>de</strong>r Böhmischen Krone entschei<strong>de</strong>nd mo<strong>de</strong>rnisiert wer<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r Schlacht am Weißen Berg war dieses Verfassungsexperiment allerdings<br />
schnell been<strong>de</strong>t. In <strong>de</strong>r Folgezeit verlor die Krone Böhmen als Staatskonstrukt innerhalb <strong>de</strong>r frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie immer stärker an Be<strong>de</strong>utung. Schon 1635 waren im<br />
Prager Frie<strong>de</strong>n die Lausitzen herausgelöst und an Sachsen gegeben wor<strong>de</strong>n. Im Frie<strong>de</strong>n von Berlin (1742) musste Österreich <strong>de</strong>n größten Teil Schlesiens und die Grafschaft Glatz an<br />
Preußen abtreten.<br />
Literatur<br />
• Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová u.a. (Hrsg.): Velké dějiny zemí koruny české. Prag 1999 ff.<br />
• Bd. 1: Do roku 1197 (M. Bláhová)<br />
• Bd. 2: 1197-1250 (V. Vaníček)<br />
• Bd. 3: 1250-1310 (V. Vaníček)<br />
• B<strong>de</strong>. 4A u. 4B: 1310-1402 (L. Bobková & M. Bartlová)<br />
• Bd. 5: 1402-1437 (P. Cornej)<br />
• Bd. 7: 1526-1618 (P. Vorel)<br />
• Bd. 10: 1740-1792 (P. Belina)<br />
• Fehlen<strong>de</strong> Bän<strong>de</strong> noch nicht erschienen<br />
• Joachim Bahlcke: Regionalismus und Staatsintegration im Wi<strong>de</strong>rstreit. Die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r böhmischen Krone im ersten Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Habsburgerherrschaft (1526-1619). (=<br />
Schriften <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>sinstituts für Ost<strong>de</strong>utsche Kultur und Geschichte 3), München 1994.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Livländischer Krieg<br />
Der Livländische Krieg von 1558 bis 1583, auch als Erster Nordischer Krieg bezeichnet, war <strong>de</strong>r erste einer Reihe kriegerischer Konflikte zwischen Schwe<strong>de</strong>n, Polen, Dänemark und
Russland um die Vorherrschaft im Ostseeraum.<br />
Kriegsverlauf<br />
Der Livländische Krieg begann 1558 mit <strong>de</strong>m Einmarsch russischer Truppen Iwans IV. in Livland. Russland kämpfte gegen Polen-Litauen, Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n um die Herrschaft<br />
über das Baltikum. Die livländischen Städte an <strong>de</strong>r Ostseeküste waren für Russland wegen <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls mit Westeuropa von strategischer Be<strong>de</strong>utung.<br />
Der Krieg en<strong>de</strong>te trotz anfänglicher russischer Siege gegen <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n für Russland erfolglos. Gotthard Kettler, <strong>de</strong>r letzte Landmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns in Livland,<br />
schloss 1561 mit Sigismund II. Augustus ein Abkommen, durch das aus <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>nsland das Herzogtum Kurland und Semgallen unter polnischer Lehnshoheit entstand.<br />
1576/77 stieß Iwan IV. erneut ins Ostbaltikum vor und eroberte das von Schwe<strong>de</strong>n besetzte Estland und das von Polen besetzte Livland. Die Allianz zwischen Polen-Litauen und<br />
Schwe<strong>de</strong>n konnte die russischen Truppen jedoch <strong>zu</strong>rückdrängen. Im Waffenstillstand von Jam Zapolski mit Polen-Litauen von 1582 verzichtete Iwan IV. auf Livland und Polozk, erhielt<br />
aber die von König Stephan Báthory zwischen 1579 und 1581 eroberten russischen Gebiete <strong>zu</strong>rück, nach<strong>de</strong>m dieser die mehrmonatige erfolglose Belagerung von Pskow aufgegeben<br />
hatte. Estland wur<strong>de</strong> 1583 im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Pljussa <strong>de</strong>r schwedischen Krone <strong>zu</strong>geschlagen.<br />
Literatur<br />
• Norbert Angermann, Studien <strong>zu</strong>r Livlandpolitik Ivan Groznyjs, Wiesba<strong>de</strong>n 1972.<br />
• Erich Donnert, Der livländische Or<strong>de</strong>nsstaat und Rußland, Berlin 1963.<br />
• Werner Näf: Die Epochen <strong>de</strong>r Deutschen Geschichte I. Staat und Staatsgemeinschaft vom Ausgang <strong>de</strong>s Mittelalters bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, München 1970.<br />
• Knud Rasmussen, Die livländische Krise 1554-1561, Kopenhagen 1973.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Union von Lublin<br />
Die Lubliner Union begrün<strong>de</strong>te 1569 die polnisch-litauische A<strong>de</strong>lsrepublik (auch Polen-Litauen o<strong>de</strong>r Rzeczpospolita genannt), um durch Einführung <strong>de</strong>r Wahlmonarchie die Nachfolge<br />
für <strong>de</strong>n kin<strong>de</strong>rlosen polnischen König Sigismund II. August, <strong>de</strong>n letzten <strong>de</strong>r Jagiellonen, <strong>zu</strong> regeln.<br />
Vom 10. Januar bis <strong>zu</strong>m 12. August 1569 tagte <strong>de</strong>r von ihm einberufene Sejm in Lublin. Nach zahlreichen recht stürmischen Sit<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong> vom polnischen und litauischen A<strong>de</strong>l, in<br />
Anbetracht <strong>de</strong>s absehbaren Erlöschens <strong>de</strong>r Herrscherdynastie <strong>de</strong>r Jagiellonen und <strong>de</strong>r außenpolitischen Lage, die Umwandlung <strong>de</strong>r bis dahin in Personalunion miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>nen<br />
Staaten, Königreich Polen, Großfürstentum Litauen und Königliches Preußen (nicht <strong>zu</strong> verwechseln mit <strong>de</strong>m Herzogtum Preußen, ab 1701 Königreich Preußen), in einen einheitlichen<br />
Staat (Realunion) beschlossen: in die A<strong>de</strong>lsrepublik – mit einheitlicher Gesetzgebung, Amtssprache (Polnisch und Latein) und Währung sowie einem Parlament (Sejm) und Monarchen.<br />
Gewisse Privilegien sicherten sich jedoch sowohl Litauen als auch das königliche Preußen.<br />
Eingeführt wur<strong>de</strong> die Wahlmonarchie, fortan lag die Macht im Staat <strong>zu</strong>m überwiegen<strong>de</strong>n Teil in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls und Hocha<strong>de</strong>ls sowie einiger litauischer Magnaten, die
sich jedoch mit <strong>de</strong>r Zeit polonisierten. Zu <strong>de</strong>n im Sejm vertretenen freien Städten gehörten auch Danzig, das seine Machtposition als mit Abstand wichtigster Hafen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
auskostete, sowie Thorn und Elbing.<br />
In <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r größere polnische Lan<strong>de</strong>steil im Allgemeinen die Krone (Korona) genannt, während <strong>de</strong>r kleinere, litauische Teil Litauen (Litwa) hieß. Die bis dahin in<br />
Litauen gelten<strong>de</strong> Amtssprache, das Ruthenische, wur<strong>de</strong> in manchen Domänen immer mehr vom Polnischen verdrängt.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Union von Wilna<br />
Die Union von Wilna war ein Vertrag vom 28. November 1561 zwischen <strong>de</strong>m Landmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns in Livland, Gotthard Kettler und Sigismund II. August, <strong>de</strong>m König von<br />
Polen, Großfürst von Litauen, <strong>de</strong>r die Liquidation <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns in Livland und <strong>de</strong>ssen Aufgehen im polnisch-litauischen Staat <strong>zu</strong>r Folge hatte.<br />
Vorgeschichte<br />
1558 hatte das Zarentum Russland unter Iwan <strong>de</strong>m Schrecklichen <strong>de</strong>n Livländischen Krieg begonnen. Die Livländische Konfö<strong>de</strong>ration konnte <strong>de</strong>m Ansturm <strong>de</strong>r Russen wenig<br />
entgegensetzen, Teile Livlands wur<strong>de</strong>n erobert und langfristig besetzt gehalten. Zum Schutz vor weiteren Angriffen unterstellte sich in <strong>de</strong>r Folge die Konfö<strong>de</strong>ration <strong>de</strong>r Lehenshoheit<br />
verschie<strong>de</strong>ner Mächte im Ostseeraum. Deren Ambitionen hingegen bezogen sich auf Verbesserungen ihrer strategischen Positionen gegenüber Russland sowie einen Ausbau ihrer<br />
Stützpunkte im Ostseeraum. Auch die materiellen Ressourcen Livlands stellten einen Anreiz dar.<br />
Das Königreich Dänemark kaufte 1560 das Gebiet <strong>de</strong>r Bistümer Kurland in Pilten und Ösel-Wiek in Arensburg vom Bischof Johann von Münchhausen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Lehre Luthers anhing. Das<br />
Königreich Schwe<strong>de</strong>n übernahm 1561 das heutige nördliche Estland mit Reval. Der größte Teil aber fiel mit <strong>de</strong>m livländischen Kernland und <strong>de</strong>m südlichen Wiek an Polen-Litauen.<br />
Ebenso schlossen sich die Or<strong>de</strong>nsgebiete westlich und südlich <strong>de</strong>r Düna als Herzogtum Kurland und Semgallen <strong>de</strong>r Krone Polen-Litauens als Vasallenstaat an.<br />
Die Union<br />
Der Vertrag setzte sich aus <strong>de</strong>m Privilegium Sigismundi Augusti und <strong>de</strong>r Pacta Subiectionis <strong>zu</strong>sammen. Das „Privilegium Sigismundi Augusti“ bezog sich auf die Stän<strong>de</strong>, vor allem <strong>de</strong>n<br />
A<strong>de</strong>l, in Livland. Für das Herzogtum Kurland und Semgallen gab es die „Pacta Subiectionis“, die diese Privilegien garantierte und <strong>zu</strong><strong>de</strong>m das Verhältnis <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls <strong>zu</strong>m Herzog und bei<strong>de</strong>r<br />
Verhältnis <strong>zu</strong>m König von Polen und <strong>zu</strong>m polnisch-litauischen Reichstag regelte.<br />
Kraft dieses Vertrages wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n und mit ihm die gesamte Livländische Konfö<strong>de</strong>ration aufgelöst und säkularisiert, während Kurland mit Semgallen <strong>zu</strong>m „Herzogtum<br />
Kurland und Semgallen“ verschmolzen, das Kettler als protestantischer Erbherzog vom polnischen König <strong>zu</strong> Lehen nahm. Die Hansestadt Riga mit <strong>de</strong>m Rest Livlands wur<strong>de</strong>n als<br />
„Herzogtum jenseits <strong>de</strong>r Düna“ (lat. Ducatus Ultradunensis) <strong>de</strong>m Staat Polen-Litauen direkt einverleibt und alsbald in From von drei Wojewodschaften mit Hauptsitzen in Pernau,<br />
Wen<strong>de</strong>n und Dorpat administrativ verwaltet.<br />
Die Union von Wilna begünstigte <strong>de</strong>n Ausbruch <strong>de</strong>s Dreikronenkrieges 1563.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Polnisch - Schwedischer Krieg (1600 – 1629)<br />
(Weitergeleitet von Schwedisch-Polnische Kriege 1600–1629)<br />
Die Schwedisch-Polnischen Kriege von 1600 bis 1629[1] waren ein militärischer Konflikt zwischen <strong>de</strong>m Königreich Schwe<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Königreich Polen, bei <strong>de</strong>m es um<br />
Erbfolgeansprüche und die Vorherrschaft im Ostseeraum ging. Sie gehören <strong>zu</strong> einer ganzen Reihe Nordischer Kriege. Mit mehreren Unterbrechungen zog sich <strong>de</strong>r Krieg über fast 30 Jahre<br />
hin. Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen fan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Teil parallel, jedoch weitgehend unabhängig vom Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) statt.<br />
Ursprünge <strong>de</strong>s Konflikts: die Thronansprüche Sigismund Wasas<br />
Im Jahr 1587 wur<strong>de</strong> Sigismund Wasa nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s bisherigen polnischen Königs Stephan Báthory durch die polnisch-litauische A<strong>de</strong>lsversammlung <strong>zu</strong>m König von Polen gewählt.<br />
Er bestieg unter <strong>de</strong>m Namen Sigismund III. Wasa (poln. Zygmunt III Waza, litauisch Zigmantas Vaza) <strong>de</strong>n polnischen Thron. Gegenkandidat bei <strong>de</strong>r Wahl war <strong>de</strong>r Habsburger Erzherzog<br />
Maximilian, <strong>de</strong>r allerdings militärisch mit seinen Anhängern in <strong>de</strong>r Schlacht von Byczyna 1588 <strong>de</strong>n von Jan Zamoyski geführten Truppen unterlag, in Gefangenschaft geriet und daraufhin<br />
auf seine Thronansprüche verzichtete. Sigismund war <strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>s schwedischen Königs Johann III. und <strong>de</strong>ssen Frau Katharina Jagiellonica, die eine polnisch-litauische Prinzessin aus<br />
<strong>de</strong>m A<strong>de</strong>lsgeschlecht <strong>de</strong>r Jagiellonen und die Tochter König Sigismund I. von Polen (* 1467; † 1548) war. Vor allem unter <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>r Mutter wur<strong>de</strong> Sigismund katholisch erzogen.<br />
Schon bei seiner Thronbesteigung in Polen war klar, dass er nach <strong>de</strong>m Tod seines Vaters auch <strong>de</strong>n schwedischen Thron besteigen wür<strong>de</strong>. Die Perspektive eines katholischen Königs im<br />
mittlerweile rein evangelisch-lutherischen Schwe<strong>de</strong>n löste in führen<strong>de</strong>n politischen Kreisen Schwe<strong>de</strong>ns Unruhe aus. Sigismund unterzeichnete daher nach seiner Thronbesteigung in<br />
Polen die Artikel von Kalmar, die das <strong>zu</strong>künftige Verhältnis zwischen Polen und Schwe<strong>de</strong>n regeln sollten.<br />
Darin wur<strong>de</strong> die Unabhängigkeit bei<strong>de</strong>r Königreiche voneinan<strong>de</strong>r festgeschrieben. Dem protestantischen Schwe<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> Religionsfreiheit garantiert. Nach <strong>de</strong>m Tod seines Vaters wur<strong>de</strong><br />
Sigismund Wasa 1594 auch <strong>zu</strong>m König von Schwe<strong>de</strong>n gekrönt, so dass bei<strong>de</strong> Königreiche in Personalunion vereinigt wur<strong>de</strong>n. Sigismund residierte jedoch weiter in <strong>de</strong>r polnischen<br />
Hauptstadt Krakau und versuchte Schwe<strong>de</strong>n von dort aus <strong>zu</strong> regieren. Vier Jahre später kam es <strong>zu</strong> einer Rebellion seiner Gegner in Schwe<strong>de</strong>n unter Führung seines protestantischen<br />
Onkels Karl, <strong>de</strong>s Herzogs von Sö<strong>de</strong>rmanland. Sigismund wur<strong>de</strong> vorgeworfen, sich nicht an seine früheren Versprechen <strong>zu</strong> halten, insgeheim die Gegenreformation in Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><br />
för<strong>de</strong>rn und die Selbständigkeit Schwe<strong>de</strong>ns ein<strong>zu</strong>schränken. Sigismund lan<strong>de</strong>te daraufhin mit einer mehrere 1000 Mann starken Söldnertruppe an <strong>de</strong>r schwedischen Küste in Kalmar, um<br />
seine Thronrechte <strong>zu</strong> verteidigen.<br />
Nach anfänglichen Erfolgen erlitt er jedoch in <strong>de</strong>r Schlacht von Stångebro am 25. September 1598 eine Nie<strong>de</strong>rlage und sah sich gezwungen, Schwe<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> verlassen. Er wur<strong>de</strong><br />
danach durch <strong>de</strong>n schwedischen Reichstag seiner Thronrechte verlustig erklärt. Sein protestantischer Onkel Karl, <strong>de</strong>r Anführer <strong>de</strong>r Rebellion, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst Reichsverweser und bestieg<br />
als Karl IX. im Jahr 1604 <strong>de</strong>n schwedischen Thron. Offiziell gab Sigismund Wasa <strong>de</strong>n Anspruch auf die schwedische Krone jedoch nie auf und nannte sich weiterhin „König von Polen<br />
und Schwe<strong>de</strong>n“.<br />
Kriegsausbruch und Kriegsverlauf 1600–1609
Während Sigismund seine schwedischen Thronansprüche im wesentlichen auf angeworbene ausländische Söldnerheere stützen musste und so gut wie keine polnischen Truppen in die<br />
schwedischen Thronstreitigkeiten involviert waren, kam es in <strong>de</strong>r Folge <strong>zu</strong>m offenen Kriegsausbruch zwischen bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn. Anlass war <strong>de</strong>r Anspruch König Sigismunds auf das unter<br />
schwedischer Herrschaft stehen<strong>de</strong> Estland. Schon in <strong>de</strong>n Verhandlungen vor <strong>de</strong>r Thronbesteigung Sigismunds in Polen war im Gespräch gewesen, ob das schwedische Estland<br />
gewissermaßen als Preis für die Erlangung <strong>de</strong>r polnischen Königskrone an Polen-Litauen übergeben wer<strong>de</strong>n sollte. Dies wur<strong>de</strong> jedoch von allen politischen Kreisen Schwe<strong>de</strong>ns,<br />
insbeson<strong>de</strong>re von König Johann III. entschie<strong>de</strong>n abgelehnt, so dass dies auch nicht vertraglich fixiert wur<strong>de</strong>.<br />
Nach <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>r schwedischen Krone gelang es König Sigismund, die führen<strong>de</strong>n A<strong>de</strong>lskreise Polen-Litauens für einen Feld<strong>zu</strong>g nach Estland <strong>zu</strong> gewinnen. Die Schwe<strong>de</strong>n kamen<br />
jedoch <strong>de</strong>m polnisch-litauischen Angriff <strong>zu</strong>vor und gingen selbst in die Offensive. Im Verlauf <strong>de</strong>s Jahres 1600 drangen von Estland aus schwedische Truppen unter <strong>de</strong>r Führung Herzog<br />
Karls nach Livland ein und besetzten die Städte Dorpat und Pernau. Die Schwe<strong>de</strong>n drangen bis <strong>zu</strong>r Düna vor und begannen mit <strong>de</strong>r Belagerung <strong>de</strong>r Burg Kokenhusen etwa 100 km östlich<br />
von Riga. Den direkten Angriff auf das stark befestigte Riga wagte Herzog Karl jedoch nicht. Angesichts <strong>de</strong>r schwedischen Erfolge bewilligte <strong>de</strong>r Sejm die Geldmittel für die Aufstellung<br />
einer Armee von etwa 20.000 Mann. Unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Großhetmans von Litauen Krzysztof Radziwiłł rückte diese Streitmacht nach Livland vor.<br />
Am 23. Juni 1601 kam es <strong>zu</strong>r Schlacht bei Kokenhusen, die für die polnisch-litauische Armee siegreich verlief. Die Schwe<strong>de</strong>n mussten sich wie<strong>de</strong>r weitgehend aus Livland <strong>zu</strong>rückziehen<br />
und <strong>de</strong>n größten Teil ihrer Eroberungen aufgeben. Auch in <strong>de</strong>r Schlacht bei Weissenstein am 15. September 1604 blieb das polnisch-litauische Heer unter Hetman Jan Karol Chodkiewicz<br />
siegreich. Der schwedische Reichstag bewilligte daraufhin Gel<strong>de</strong>r für militärische Verstärkungen. Im Jahr 1605 lan<strong>de</strong>te eine etwa 5000 Mann starke schwedische Armee unter An<strong>de</strong>rs<br />
Lennartsson in Estland und marschierte auf Riga mit <strong>de</strong>m Ziel, diesen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Ostseehafen ein<strong>zu</strong>nehmen. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Kirchholm am 27. September 1605 wur<strong>de</strong> die vereinigte<br />
schwedische Streitmacht unter <strong>de</strong>m Oberkommando König Karls IX. jedoch von <strong>de</strong>r zahlenmäßig unterlegenen polnisch-litauischen Armee unter <strong>de</strong>m Kommando von Chodkiewicz<br />
geschlagen. In <strong>de</strong>r Folgezeit gelang es jedoch <strong>de</strong>n Polen nicht, ihre militärischen Erfolge dauerhaft <strong>zu</strong> nutzen. Aufgrund ausstehen<strong>de</strong>r Soldzahlungen löste sich das Heer Chodkiewiczs<br />
wie<strong>de</strong>r weitgehend auf und Polen wur<strong>de</strong> durch innere Unruhen geschwächt (u.a. durch <strong>de</strong>n Zebrzydowski-Aufstand 1605–09 gegen König Sigismund). Außer<strong>de</strong>m brach 1609 <strong>de</strong>r Krieg<br />
zwischen Polen und Russland aus. Im Jahr 1611 wur<strong>de</strong> schließlich ein Waffenstillstand zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Polen abgeschlossen, <strong>de</strong>r im wesentlichen <strong>de</strong>n Besitzstand vor <strong>de</strong>m Krieg<br />
festschrieb.<br />
Erneute Kriegshandlungen 1617–1618<br />
Im Jahr 1611 bestieg Gustav II. Adolf nach <strong>de</strong>m Tod seines Vaters König Karls IX. <strong>de</strong>n schwedischen Thron. Schon unter seinem Vater hatte Schwe<strong>de</strong>n militärisch in die russischen<br />
Wirren im Ingermanländischen Krieg eingegriffen und unter an<strong>de</strong>rem vorübergehend die Städte Nowgorod und Pskow (Pleskau) besetzt. Im Frie<strong>de</strong>n von Stolbowo 1617 trat Russland die<br />
Stadt Schlüsselburg sowie <strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>r historischen Provinz Ingermanland an Schwe<strong>de</strong>n ab.<br />
In <strong>de</strong>n Jahren 1617 und 1618 kam es erneut <strong>zu</strong>m Ausbruch <strong>de</strong>r Kampfhandlungen zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Polen-Litauen in Livland, die mit geringen Landgewinnen <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n in<br />
Livland en<strong>de</strong>ten.<br />
Der Konflikt 1621–1625<br />
Der vorangegangene Waffenstillstand zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Polen lief im November 1620 aus, woraufhin die Schwe<strong>de</strong>n unter Gustav II. Adolf erneut in die Offensive gingen. Im Jahr<br />
1621 gelang es <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n, Riga ein<strong>zu</strong>nehmen. Polen konnte nicht seine ganzen Kräfte <strong>zu</strong>m Einsatz bringen, da es sich im Krieg mit <strong>de</strong>m Osmanischen Reich befand. Im Vertrag von<br />
Mitau vom 1. März 1625 wur<strong>de</strong> erneut ein Waffenstillstand für drei Jahre abgeschlossen.<br />
Der Krieg von 1626–1629<br />
Nach <strong>de</strong>m Auslaufen <strong>de</strong>s Waffenstillstan<strong>de</strong>s ergriffen die Schwe<strong>de</strong>n unter Gustav II. Adolf erneut die militärische Initiative und eine schwedische Invasionsflotte lan<strong>de</strong>te an <strong>de</strong>r Küste <strong>de</strong>s<br />
unter polnischer Lehnshoheit stehen<strong>de</strong>n Herzogtums Preußen, wo sie auf wenig wesentlichen Wi<strong>de</strong>rstand traf, da Kurfürst Georg Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg, <strong>de</strong>r seit 1620 auch Herzog in<br />
Preußen war, <strong>de</strong>r Schwager Gustav II. Adolfs war. Die Einnahme <strong>de</strong>r unter polnischer Oberhoheit stehen<strong>de</strong>n, aber weitgehend autonomen großen Hanse- und Hafenstadt Danzig gelang<br />
allerdings nicht. Im Dezember 1626 erlitten die polnisch-litauischen Truppen in Livland bei Kokenhusen eine empfindliche Nie<strong>de</strong>rlage. Im Seegefecht bei Oliva vor Danzig am 28.<br />
November 1627 konnte eine Danziger Flottille einen Sieg über die schwedische Flotte erringen. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Górzno am 2. Februar 1629 erlitten die polnischen Truppen jedoch
eine Nie<strong>de</strong>rlage.<br />
Am 26. Oktober 1629 wur<strong>de</strong> schließlich <strong>de</strong>r Waffenstillstand von Altmark für sechs Jahre abgeschlossen. Der Vertrag garantierte Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>s größten Teils von Livland<br />
einschließlich <strong>de</strong>r Stadt Riga. Außer<strong>de</strong>m erhielt Schwe<strong>de</strong>n die Kontrolle über die preußischen Städte Elbing, Memel, Fischhausen, Braunsberg und Frauenburg <strong>zu</strong>gesprochen. Die<br />
Waffenruhe mit Polen und die erheblichen Einkünfte aus <strong>de</strong>n Seezöllen <strong>de</strong>r Städte Riga, Memel, Elbing und Fischhausen erlaubten es König Gustav II. Adolf im folgen<strong>de</strong>n Jahr mit einem<br />
schwedischen Heer an <strong>de</strong>r Küste Pommerns <strong>zu</strong> lan<strong>de</strong>n und auf Seiten <strong>de</strong>r bedrängten Protestanten in <strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg in Deutschland ein<strong>zu</strong>greifen.<br />
Literatur<br />
• Robert I. Frost: The Northern Wars − War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721, Longman Publishings, London/ New York 2000, ISBN 0-582-06429-5<br />
• Gert von Pistohlkors: Deutsche Geschichte im Osten Europas: Baltische Län<strong>de</strong>r, Siedler Verlag, 2002. ISBN 3-88680-774-6<br />
• Klaus Zernack: Das Zeitalter <strong>de</strong>r Nordischen Kriege als frühneuzeitliche Geschichtsepoche, in: Zeitschrift für historische Forschung, Nr. 1 (1974), S. 54–79.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Ralph Tuchtenhagen: Geschichte <strong>de</strong>r baltischen Län<strong>de</strong>r, München 2005, ISBN 3-406-50855-3, S. 36.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Osmanisch-Polnischer Krieg 1620-1621<br />
Der Osmanisch-Polnische Krieg 1620–1621 wur<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>m Osmanischen Reich und Polen-Litauen um die Herrschaft über die Donaufürstentümer, vor allem das Fürstentum<br />
Moldau geführt. Bei<strong>de</strong> Seiten erhoben <strong>de</strong>n Anspruch <strong>de</strong>r „Schutzherrschaft“ über die Donaufürstentümer. Der Krieg begann 1620[3] und en<strong>de</strong>te 1621 im Vertrag von Chocim, in <strong>de</strong>m die<br />
Polen und Litauer ihre Ansprüche auf die Donaufürstentümer aufgaben. Er war die einzige direkte bewaffnete Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Osmanischen Reich<br />
zwischen 1498 und 1672.[4]<br />
Hintergrund<br />
Zwischen Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Osmanischen Reich, die das 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt hindurch in <strong>zu</strong>meist friedlichem, wenn nicht sogar recht freundlichem Verkehr gestan<strong>de</strong>n hatten, kam es ab<br />
etwa 1600 aus drei Grün<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Zerwürfnissen:<br />
Zum einen hatten sich polnische Magnaten mit Billigung <strong>de</strong>s polnischen Königs vermehrt in die inneren Angelegenheiten <strong>de</strong>r osmanischen Vasallenstaaten und namentlich <strong>de</strong>s<br />
Fürstentums Moldau eingemischt, um <strong>de</strong>m ihnen genehmen Bojarengeschlecht Mohyła (rum. Movilă) <strong>de</strong>n dortigen Gospodarenthron <strong>zu</strong> sichern. So hatte <strong>de</strong>r Großhetman <strong>de</strong>r polnischen<br />
Krone Stanisław Żółkiewski seit 1615 einen regelrechten Privatkrieg auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Fürstentums geführt, <strong>de</strong>r am 22. November 1617 mit <strong>de</strong>m Vertrag von Busza am Dnister been<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>.
Hin<strong>zu</strong> kamen wechselseitige Überfälle <strong>de</strong>r Krimtataren und <strong>de</strong>r Nogaier-Hor<strong>de</strong>, die <strong>de</strong>n osmanischen Sultan als ihren Suzerän anerkannten, auf <strong>de</strong>r einen Seite und <strong>de</strong>r formell <strong>de</strong>r<br />
polnischen Krone unterstehen<strong>de</strong>n Saporoscher Kosaken auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren. Diese waren bei ihren Raubzügen wie<strong>de</strong>rholt bis weit in die Gebiete <strong>de</strong>s Osmanenreiches vorgedrungen und<br />
hatten unter an<strong>de</strong>rem 1614 Sinop und 1615 das Ufer <strong>de</strong>s Bosporus gebrandschatzt.<br />
Drittens ging es um die Feldzüge, die <strong>de</strong>r protestantische Fürst Gábor Bethlen von Siebenbürgen mit einer Streitmacht aus 30.000 Mann[5] seit 1619 gegen die Herrschaft <strong>de</strong>r Habsburger<br />
im Königlichen Ungarn und ihre dortige Rekatholisierungspolitik führte. Dabei hatte er geschickt die Schwierigkeiten genutzt, die <strong>de</strong>r Kaiser Ferdinand II. mit <strong>de</strong>m beginnen<strong>de</strong>n<br />
Dreißigjähriger Krieg hatte, und drang bis nach Wien vor. Sein Schwager König Sigismund III. Wasa, <strong>de</strong>r ebenfalls katholisch war, hatte <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r katholischen Sache<br />
8.000[5] bis 10.000[6] Söldner gegen die Protestanten geschickt. Diese so genannten „Lisowczycy“ (ihren Rufnamen erhielten sie nach <strong>de</strong>m Familiennamen ihres ersten Komman<strong>de</strong>urs,<br />
<strong>de</strong>r Lisowski hieß) wur<strong>de</strong>n von Walenty Rogowski[5] bzw. Hieronim Kleczkowski[6] kommandiert und besiegten das siebenbürgische Aufgebot unter Rákóczi György am 21. November<br />
1619 in <strong>de</strong>r Schlacht von Humenné[7] (bei Humenné, einer slowakischen Stadt, damals Oberungarn) und zwang Bethlen so, seine Belagerung Wiens ab<strong>zu</strong>brechen. Am 16. Januar 1620<br />
schloss dieser in Bratislava einen Waffenstillstand mit <strong>de</strong>n Habsburgern, <strong>de</strong>r in<strong>de</strong>s nur von kurzer Dauer war. Das Eingreifen <strong>de</strong>r polnischen Söldner veranlasste Bethlen bei seinem<br />
Suzerän, <strong>de</strong>m osmanischen Sultan, um militärischen Beistand gegen <strong>de</strong>n polnischen König <strong>zu</strong> bitten.<br />
Während<strong>de</strong>ssen wechselte <strong>de</strong>r Gospodar <strong>de</strong>r Moldau, Gaspar Gratiani, die Seiten, verbün<strong>de</strong>te sich mit Polen und stellte sich offen gegen seinen ehemaligen Lehnsherren. Der erst<br />
siebzehnjährige Sultan Osman II. sandte daraufhin eine Armee aus bis <strong>zu</strong> 22.000 türkischen und tatarischen Soldaten unter <strong>de</strong>m Kommando von Iskan<strong>de</strong>r Paşa und Khan Temir in die<br />
Donaufürstentümer. Der polnische Hof machte sich nun große Sorgen über die sich abzeichnen<strong>de</strong> protestantisch-türkische Zusammenarbeit. Dennoch konnte <strong>de</strong>r Sejm nicht da<strong>zu</strong><br />
bewogen wer<strong>de</strong>n, eine vergleichbar große Streitmacht auf<strong>zu</strong>stellen, da die Szlachta ihm in dieser Frage die Unterstüt<strong>zu</strong>ng verweigerten, auch weil ein Großteil <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>n<br />
Protestantismus unterstützte. Daher wur<strong>de</strong> unter Führung <strong>de</strong>s über siebzigjährigen Żółkiewski ein eher kleines Heer von bis <strong>zu</strong> 8.000 Mann [8] aufgestellt, das <strong>zu</strong>m Teil von <strong>de</strong>n<br />
interessierten Magnaten privat finanziert wor<strong>de</strong>n war.<br />
Der Feld<strong>zu</strong>g von 1620<br />
Am 10. September stieß die polnische Armee bei Cecora (heute Ţuţora im Kreis Iaşi in Rumänien) in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Flusses Pruth auf osmanische und tartarische Streitkräfte, die Gábor<br />
Bethlen im Kampf gegen die Habsburger unterstützen sollten. Angesichts ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit wagten die Polen keinen Angriff und begaben sich in Verteidigungsstellung.<br />
Mit einem überraschen<strong>de</strong>n Angriff <strong>de</strong>r Tartaren am 17. September, bei <strong>de</strong>m zahlreiche Gefangene gemacht wur<strong>de</strong>n, begann eine mehrtägige Schlacht, die sich bis <strong>zu</strong>m 7. Oktober<br />
hinziehen sollte. Angesichts <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlichen zahlenmäßigen Überlegenheit <strong>de</strong>s osmanischen Heeres wechselten die meisten moldauischen Soldaten (ohnehin waren statt <strong>de</strong>r von Gratiani<br />
versprochenen 25.000 Mann nicht einmal 1000 im Lager <strong>de</strong>r Polen erschienen[8][9]) die Seite und attackierten nun die polnische Streitmacht. Obwohl sich bereits <strong>zu</strong>m 19. September<br />
eine Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Polen abzeichnete, war Koniecpolski bemüht, die Schlachtordnung aufrecht <strong>zu</strong> erhalten und so <strong>de</strong>n Zusammenbruch seines Heeres <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn.<br />
Nach<strong>de</strong>m Żółkiewski <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g befohlen hatte, gelang am 29. September <strong>de</strong>r Durchbruch durch die türkischen Reihen. Zahlreiche Attacken <strong>de</strong>r Nogaier-Tataren unter ihrem Khan<br />
Temir und <strong>de</strong>r Janitscharen, <strong>de</strong>nen das polnische Heer in <strong>de</strong>n Tagen danach ausgesetzt war, konnten zwar abgewehrt wer<strong>de</strong>n, doch es zeigten sich <strong>zu</strong>nehmend Auflösungserscheinungen.<br />
Ein gewaltiger türkischer Angriff am 6. Oktober hatte schließlich <strong>zu</strong>r Folge, dass die meisten Magnaten und Adligen gemeinsam mit <strong>de</strong>r Kavallerie flohen und Infanterie und Tross im<br />
Stich ließen. Ihre Desertion führte da<strong>zu</strong>, dass das polnische Heer fast vollständig aufgerieben wur<strong>de</strong>. Die Mehrheit <strong>de</strong>r polnischen Soldaten wur<strong>de</strong> getötet o<strong>de</strong>r geriet in Gefangenschaft.<br />
Zu <strong>de</strong>n Gefangenen zählten auch Stanisław Koniecpolski, <strong>de</strong>r Schwiegersohn <strong>de</strong>s kommandieren<strong>de</strong>n Großhetmans, und Bohdan Chmelnyzkyj, <strong>de</strong>r spätere Anführer <strong>de</strong>s Großen<br />
Kosakenaufstands 1648–1654. Żółkiewski selbst fiel, seinen Kopf sandten die Türken im Triumph nach Istanbul. Nur wenigen gelang die Flucht über <strong>de</strong>n Dnister, darunter auch Gratiani,<br />
<strong>de</strong>r aber kurz darauf von moldauischen Bojaren aus Furcht vor Repressalien <strong>de</strong>r Türken ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Der Wintereinbruch verhin<strong>de</strong>rte eine unmittelbare Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s erfolgreichen<br />
osmanischen Feld<strong>zu</strong>gs.<br />
Der Feld<strong>zu</strong>g von 1621<br />
Die Katastrophe von Cecora motivierte <strong>de</strong>n Sejm, seinen Wi<strong>de</strong>rstand gegen die Militärpläne <strong>de</strong>s Königs und <strong>de</strong>r Magnaten auf<strong>zu</strong>geben. Im Dezember 1620 bewilligte das A<strong>de</strong>lsparlament<br />
die Mittel für eine Armee von bis <strong>zu</strong> 40.000 Mann[8] für <strong>de</strong>n nötigen Abwehrkampf, ohne <strong>de</strong>n die Ukraine einem militärischen Zugriff <strong>de</strong>r Türken schutzlos offengestan<strong>de</strong>n hätte. Es<br />
kamen je nach Quelle zwischen 32.510[1] und 35.105 Mann [10] <strong>zu</strong>sammen, die <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s Kronprinzen Władysław Wasa und <strong>de</strong>s litauischen Großhetmans Jan Karol
Chodkiewicz unterstan<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rs als im Jahr <strong>zu</strong>vor beteiligten sich auch die Saporoger Kosaken unter ihrem Ataman Petro Konaschewitsch-Sahajdatschny mit bis <strong>zu</strong> 40.000<br />
Kämpfern[11][9][1] am Krieg. Der britische Historiker Norman Davies schätzt, dass auf polnisch-litauischer Seite insgesamt 65.000 Mann stan<strong>de</strong>n.[4] Am 20. August 1621 überquerte<br />
diese Streitmacht <strong>de</strong>n Dnister und errichtete bei Chocim (heute Khotyn im Oblast Tscherniwzi in <strong>de</strong>r Ukraine) ein befestigtes Lager. Die Stadt und die Festung selbst waren erst 1620 von<br />
<strong>de</strong>n Türken <strong>zu</strong>rückerobert wor<strong>de</strong>n. Kurz darauf traf dort eine osmanische Streitmacht ein, die aus bis <strong>zu</strong> 150.000 Janitscharen, Tataren, Moldauern und Walachen bestand und die Sultan<br />
Osman II. persönlich kommandierte, gefolgt von einem Tross von bis <strong>zu</strong> 100.000 Mann. Die Armee <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches überstieg das polnisch-kosakische Heer zahlenmäßig um<br />
<strong>de</strong>n Faktor Drei.[9] Die Türken unternahmen mehrere Sturmangriffe auf das Lager, <strong>de</strong>ssen Befestigungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Da diese abgeschlagen wur<strong>de</strong>n,<br />
belagerten sie das Lager fünf Wochen lang und drangen über eine rasch gebaute Brücke nach Podolien vor, um <strong>de</strong>n polnisch-litauischen Nachschub aus <strong>de</strong>r Festung Kamieniec Podolski<br />
ab<strong>zu</strong>schnei<strong>de</strong>n. Der Legen<strong>de</strong> nach soll es am En<strong>de</strong> im Lager von Chocim nur noch ein einziges Fass Schießpulver gegeben haben. Zwei <strong>de</strong>r polnisch-litauischen Komman<strong>de</strong>ure fielen:<br />
Ataman Konaschewitsch-Sahajdatschny wur<strong>de</strong> so schwer verletzt, dass er ein halbes Jahr später seinen Wun<strong>de</strong>n erlag, Hetman Chodkiewicz starb am 24. September im Lager von<br />
Chocim. Ihm folgte Stanisław Lubomirski als Regimentarz nach, <strong>de</strong>m es gelang, die Moral <strong>de</strong>r Eingeschlossenen gegen die Übermacht <strong>de</strong>r türkischen Belagerer aufrecht<strong>zu</strong>erhalten. Weil<br />
die Janitscharen schließlich bei einem weiteren Sturm auf das Lager <strong>de</strong>n Gehorsam verweigerten, brach Sultan Osman II. am 28. September die Belagerung ab.<br />
Waffenstillstand und Frie<strong>de</strong>n<br />
Am 9. Oktober 1621 schlossen Sultan Osman II. und Kronprinz Władysław in Chocim einen Frie<strong>de</strong>nsvertrag,[12] <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Status quo ante bellum wie<strong>de</strong>rherstellte, und im Wesentlichen<br />
die Bestimmungen 1617 geschlossenen Vertrags von Busza wie<strong>de</strong>rholte: Der Dnister wur<strong>de</strong> als Grenze zwischen bei<strong>de</strong>n Reichen bekräftigt, Polen-Litauen verzichtete auf weitere<br />
Einmischungen in die inneren Angelegenheiten <strong>de</strong>r Donaufürstentümer und verpflichtete sich, Khan Temir jährlich ein „Geschenk“ <strong>zu</strong> zahlen. Dafür versprachen die Tataren, auf ihre<br />
regelmäßigen Überfälle <strong>zu</strong> verzichten, und Polen-Litauen erhielt das Recht, einen ständigen Gesandten bei <strong>de</strong>r Hohen Pforte <strong>zu</strong> unterhalten.<br />
Folgen<br />
Der Vertrag brachte keinen Frie<strong>de</strong>n. Zwar war Polen-Litauen versprochen wor<strong>de</strong>n, dass die Tatarenüberfälle aufhören wür<strong>de</strong>n, doch wur<strong>de</strong>n allein in <strong>de</strong>n Jahren 1622 bis 1629 neunzehn<br />
weitere Raubzüge <strong>de</strong>r Nogaier-Hor<strong>de</strong> gezählt. Die kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen Polens mit <strong>de</strong>n türkischen Sultanen setzten sich auch in <strong>de</strong>n nächsten Jahrzehnten fort, so im<br />
Osmanisch-Polnischen Krieg 1672–1676 und im Osmanisch-Polnischen Krieg 1683–1699. Erst mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz 1699 been<strong>de</strong>te Polen endgültig seine<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>m südlichen Nachbarn.<br />
Für Osman II. leitete <strong>de</strong>r Feld<strong>zu</strong>g das En<strong>de</strong> seiner Herrschaft ein. Als er nach <strong>de</strong>r Meuterei <strong>de</strong>r Janitscharen vor Chocim darüber nachdachte, gegen diese notorisch eigensinnige<br />
Eliteeinheit eine Truppe aus ihm loyalen Arabern auf<strong>zu</strong>stellen, kam dies <strong>de</strong>n Janitscharen <strong>zu</strong> Ohren, die ihn daraufhin ermor<strong>de</strong>ten und seinen geistig behin<strong>de</strong>rten Onkel Mustafa I. <strong>zu</strong>m<br />
zweiten Mal als zwar offenkundig unfähigen, aber lenkbaren Sultan installierten.<br />
Rezeption<br />
Der Sieg von Chocim wur<strong>de</strong> in ganz Europa bejubelt: Seit <strong>de</strong>r Seeschlacht von Lepanto 1571 war erstmals auch <strong>zu</strong> Lan<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Osmanischen Reich Einhalt geboten wor<strong>de</strong>n. Papst Gregor<br />
XV. beschloss ein mehrtägiges Dankfest, und in Hel<strong>de</strong>nlie<strong>de</strong>rn und Gemäl<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r polnisch-litauische Sieg noch lange verherrlicht.<br />
Jakub Sobieski (1590–1646), <strong>de</strong>r Vater <strong>de</strong>s späteren polnischen Königs Johann III. Sobieski, verfasste einen ausführlichen Bericht über seine Erlebnisse während <strong>de</strong>r Schlacht bei Chocim<br />
auf Latein. Diese „Commentariorum chotinensis belli libri tres“ wur<strong>de</strong>n 1646 in Danzig veröffentlicht und fan<strong>de</strong>n weite Verbreitung auch über Polen hinaus. Der Barockdichter Wacław<br />
Potocki (1621–1696) verwen<strong>de</strong>te sie als eine Hauptquelle für sein zehnteiliges Hel<strong>de</strong>ngedicht Wojna chocimska (Der Krieg von Chocim), das um 1670 entstand. Darin bietet Potocki eine<br />
historisch einigermaßen <strong>zu</strong>verlässige, gereimte Chronik <strong>de</strong>r Belagerung, vermischt diese aber mit einer Idolisierung <strong>de</strong>s Großhetmans Chodkiewicz, in <strong>de</strong>m er „ein letztes Mal das I<strong>de</strong>al<br />
<strong>de</strong>s christlichen Ritters aufleuchten“ sah. Diese wird unterbrochen durch zahlreiche Sottisen, Pasquills und Satiren auf die Magnaten-Oligarchie seiner Gegenwart, die nach Potockis<br />
Meinung am Verfall <strong>de</strong>r Rzeczpospolita Schuld hatte, was die Komposition <strong>de</strong>s Werks chaotisch-amorph erscheinen lässt.[13] Dennoch gilt die Wojna chocimska als „das wohl gefeiertste<br />
epische Gedicht in <strong>de</strong>r polnischen Literatur“.[4]<br />
Auch in <strong>de</strong>r Malerei wur<strong>de</strong> die Schlacht von Chocim wie<strong>de</strong>rholt dargestellt. Der nie<strong>de</strong>rländische Maler Jan van Huchtenburgh († 1733), <strong>de</strong>r im frühen 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Balkanfeldzüge
<strong>de</strong>s Prinzen Eugen begleitet und in großformatigen Tableaus verherrlicht hatte, malte auch eine Schlacht bei Chocim, die er in <strong>de</strong>rselben Tradition einer Verteidigung <strong>de</strong>s christlichen<br />
Abendlan<strong>de</strong>s gegen die Türkengefahr sah. In ganz an<strong>de</strong>rer Absicht setzte sich <strong>de</strong>r polnische Historienmaler Józef Brandt († 1915) mit <strong>de</strong>m ersten Osmanisch-Polnischen Krieg<br />
auseinan<strong>de</strong>r: Für ihn war dieser Krieg ein Beweis dafür, dass sein Vaterland, auch wenn es in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Teilung 1795-1918 keinen souveränen Staat bil<strong>de</strong>n durfte, <strong>de</strong>n Teilungsmächten<br />
seiner Zeit Preußen, Österreich und Russland min<strong>de</strong>stens gleichwertig, wenn nicht überlegen war, da es sie vor <strong>de</strong>m weiteren Vordringen <strong>de</strong>r Türken gerettet hatte.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b c Józef S<strong>zu</strong>jski: Dzieje Polski podług ostatnich badań, Bd. 3, Lwów 1866, S. 218<br />
2. ↑ Léonard Chodźko: Histoire populaire <strong>de</strong> la Pologne, Collection Georges Barba, Paris 1864, S. 152<br />
3. ↑ Serhii Plokhy: The Cossacks and Religion in Early Mo<strong>de</strong>rn Ukraine, Oxford University Press, 2002, S. 34<br />
4. ↑ a b c Norman Davies: God's Playground. A History of Poland in Two Volumes, Bd. 1: The Origins to 1795, Oxford University Press, 2005, S. 347<br />
5. ↑ a b c Tomasz Święcki, Kazimierz Józef Turowski: Opis starożytnej Polski, Bd. 1, Krakau 1861, S. 193<br />
6. ↑ a b Paweł Jasienica: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Srebrny wiek, Bd. 1, S. 331<br />
7. ↑ Henryk Wisner: Die A<strong>de</strong>lsrepublik und <strong>de</strong>r Dreißigjährige Krieg, in: Heinz Duchhardt und Eva Ortlieb (Hrsg.), Der Westfälische Frie<strong>de</strong>. Diplomatie, politische Zäsur,<br />
kulturelles Umfeld, I<strong>de</strong>engeschichte, Ol<strong>de</strong>nbourg Verlag, München 1998, S. 410<br />
8. ↑ a b c Simon Millar und Peter Dennis: Vienna 1683. Christian Europe Repels the Ottomans, Osprey Publishing, Oxford 2008, S. 8<br />
9. ↑ a b c Stephen R. Turnbull: The Ottoman Empire 1326-1699, Osprey Publishing, Oxford 2003, S. 84<br />
10.↑ Leszek Podhoro<strong>de</strong>cki: Chocim 1621, 1988, S. 16<br />
11.↑ Serhii Plokhy: The Cossacks and religion in early mo<strong>de</strong>rn Ukraine, S. 35<br />
12.↑ Léonard Chodźko: Histoire populaire <strong>de</strong> la Pologne, S. 152<br />
13.↑ Ernst J. Krywon: Wojna chocimska, in: „Kindlers Literatur Lexikon“, Kindler Verlag, Zürich 1964, Bd. 12, S. 10263<br />
Literatur<br />
• Carl Brockelmann: Geschichte <strong>de</strong>r islamischen Völker und Staaten, Georg Olms Verlag, Hil<strong>de</strong>sheim, Zürich, New York 1977 (=Reprint <strong>de</strong>r ersten Ausgabe von 1939)<br />
• Norman Davies, God's Playground. A History of Poland, Bd. 1: The Origins to 1795, Oxford University Press, Oxford 1981<br />
• Josef Engel (Hrsg.): Die Entstehung <strong>de</strong>s neuzeitlichen Europa (=Handbuch <strong>de</strong>r europäischen Geschichte, hrsg. v. Theodor Schie<strong>de</strong>r, Bd. 3),Union Verlag, Stuttgart 1971<br />
• Simon Millar und Peter Dennis: Vienna 1683. Christian Europe Repels the Ottomans, Osprey Publishing, Oxford 2008<br />
• Stanford Jay Shaw und Ezel Kural Shaw: History of the Ottoman Empire and Mo<strong>de</strong>rn Turkey. The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808, Cambridge University<br />
Press 1976<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Osmanisch-Polnischer Krieg 1633-1634<br />
Der Osmanisch-Polnische Krieg 1633–1634 war ein kleinerer militärischer Konflikt zwischen Truppen <strong>de</strong>s türkischen Pascha von Widin, Abaza Mehmed Paşa, auf <strong>de</strong>r einen Seite und<br />
polnisch-litauischen Einheiten, die unter <strong>de</strong>m persönlichen Kommando von Hetman Stanisław Koniecpolski stan<strong>de</strong>n. Eine förmliche Verlet<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns<strong>zu</strong>stands zwischen <strong>de</strong>r<br />
polnisch-litauischen A<strong>de</strong>lsrepublik und <strong>de</strong>m Osmanischen Reich war damit nicht verbun<strong>de</strong>n.[1]<br />
Der Hintergrund<br />
Der türkische Pascha von Widin, Abaza Mehmed Paşa, ein ehemaliger ruthenischer Sklave, war Beylerbey <strong>de</strong>r osmanischen Provinz Silistrien im heutigen Bulgarien. Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s<br />
polnischen Königs Sigismund III. Wasa, brach <strong>de</strong>r russische Zar Michael I. <strong>de</strong>n Waffenstillstand von Deulino und begann einen Krieg gegen Polen-Litauen, <strong>de</strong>n Russisch–Polnischen<br />
Krieg 1632–1634. Abaza mobilisierte auf Bitten <strong>de</strong>s Zaren[2] hin türkische Truppen aus Silistrien, die er durch weitere Vasallen <strong>de</strong>r Hohen Pforte, die Moldauer, Walachen und die Hor<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Nogaier-Tataren aus <strong>de</strong>m Jedisan und Budschak verstärkte.<br />
Der Feld<strong>zu</strong>g von 1633<br />
Um <strong>de</strong>n 29. Juni 1633 verheerte ein ungefähr 1000 Mann starker Kampfverband <strong>de</strong>r Nogaier-Tataren aus <strong>de</strong>m Budschak die Gegend um Kamieniec Podolski, einer wichtigen Stadt und<br />
starken Festung in <strong>de</strong>r Region Podolien. Ob sie dies aus eigener Initiative taten o<strong>de</strong>r ob sie auf Anweisung von Abaza als Späher geschickt wur<strong>de</strong>n, ist unbekannt. Nach zwei Tagen<br />
kehrten die Tataren auf das Gebiet <strong>de</strong>s Fürstentums Moldau, eines Vasallenfürstentums <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches, mit ihrer Beute und <strong>de</strong>n Gefangenen (Jasyr) <strong>zu</strong>rück.<br />
Koniecpolski, <strong>de</strong>r sich gera<strong>de</strong> in Bar aufhielt, nahm sofort mit 2.000 Mann Kavallerie die Verfolgung auf, als die Nachrichten über <strong>de</strong>n Tatarenangriff ihn erreichten. Koniecpolski<br />
überquerte <strong>de</strong>n polnisch-osmanischen Grenzfluss Dnister, und gelangte, ohne Aufmerksamkeit <strong>zu</strong> erregen, in das moldauische Gebiet <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches, das wenige Jahrzehnte<br />
<strong>zu</strong>vor das Aufmarschgebiet eines vorhergehen<strong>de</strong>n Krieges zwischen <strong>de</strong>m Osmanischen Reich und Polen-Litauen gewesen war. In<strong>de</strong>m die Tataren sich auf <strong>de</strong>m Gebiet Moldaus in<br />
Sicherheit wähnten und ihr Tempo verlangsamten, konnten sie Koniecpolski und seine Reitern am 4. Juli 1633 nahe Sasowy Róg am Fluss Prut stellen. Die Polen töteten viele Gegner,<br />
an<strong>de</strong>re nahmen sie gefangen, <strong>de</strong>r Rest zerstreute sich. Unter <strong>de</strong>n Gefangenen waren einige hohe Vertreter <strong>de</strong>r nogaischen Obrigkeit, so <strong>de</strong>r Schwiegersohn von Khan Temir (Kantymir),<br />
<strong>de</strong>r ein Anführer <strong>de</strong>r Nogaier-Hor<strong>de</strong> im Budschak war. Die meiste Beute <strong>de</strong>r Tataren gewann <strong>de</strong>r polnische Feldherr <strong>zu</strong>rück.<br />
Koniecpolski, <strong>de</strong>r ein umfangreiches Spionagenetz in <strong>de</strong>r Region hatte und im Sü<strong>de</strong>n Polens für die Außenpolitik die Verantwortung trug, kannte vermutlich die gegen Polen zielen<strong>de</strong><br />
Kriegspläne von Abaza Paşa. Er kehrte auf das linke Ufer <strong>de</strong>s Dnister <strong>zu</strong>rück und baute ein Kriegslager nahe Kamieniec Podolski. Anschließend rief er nach Verstärkung seiner Truppe,<br />
die bis <strong>zu</strong> 3.000 Mann stark war. Es kamen ungefähr 8.000 Mann <strong>zu</strong>sammen, bestehend aus Kosaken und privaten Verbän<strong>de</strong>n regionaler Magnaten. Abaza begann seinen Marsch in <strong>de</strong>r<br />
zweiten Hälfte <strong>de</strong>s September mit 30.000 Mann türkisch-osmanischer Truppen und 10.000 Mann aus <strong>de</strong>r Walachei und <strong>de</strong>r Moldau. Zu ihm stieß ein 15.000 Mann starker Kampfverband<br />
<strong>de</strong>r Nogaier-Tataren aus <strong>de</strong>m Jedisan und Budschak, <strong>de</strong>r durch Kantymir angeführt wur<strong>de</strong>. Mitte Oktober war er nahe Chotyn und kannte die Vorbereitungen Koniecpolskis. Abaza spielte<br />
die diplomatische Karte, um Koniecpolski aus<strong>zu</strong>manöverieren. Er entschied sich seine Pläne <strong>zu</strong> beschleunigen, in<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n Dnister überquerte. Kantymir begann seine Angriffe am 20.<br />
Oktober auf das Kriegslager Koniecpolskis. Am 22. Oktober griff dann Abaza mit all seiner Streitmacht persönlich in das Kriegsgeschehen ein. Seiner Armee gelang, trotz starker<br />
Verluste, kein Durchbruch. Daraufhin beor<strong>de</strong>rte Abaza Paşa <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g.<br />
Die Folgen<br />
Im Jahr 1634 stan<strong>de</strong>n das Osmanische Reich und Polen-Litauen am Rand eines Krieges. Gerüchten <strong>zu</strong>folge hatte Sultan Murad IV. <strong>de</strong>n polnischen Gesandten bei einem öffentlich<br />
Empfang beleidigt und bereits eine gewaltige Streitmacht gegen die Rzeczpospolita in Marsch gesetzt.[3] Doch statt die Kriegsvorbereitungen <strong>de</strong>s ?? <strong>zu</strong> unterstützen, entschied sich sein<br />
Vasall, <strong>de</strong>r Khan <strong>de</strong>r Krim Canibek Giray, in <strong>de</strong>n polnisch-russischen Krieg ein<strong>zu</strong>greifen. Gegen polnische Subsidienzahlungen verheerten die Krimtataren wie<strong>de</strong>rholt Moskowiter<br />
Gebiete, was Zar Michael I. veranlasste, bei König Władysław IV. um Frie<strong>de</strong>n nach<strong>zu</strong>suchen. Bei<strong>de</strong> schlossen daraufhin im Juni 1634 <strong>de</strong>n Vertrag von Polanów.
Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss rückte <strong>de</strong>r polnische König Władysław IV. Wasa mit bis <strong>zu</strong> 30.000 Soldaten nach Sü<strong>de</strong>n bis an die Grenze <strong>zu</strong>m Osmanischen Reich vor. Murad IV. schickte<br />
nun seinen Emissär Çavuş Şahin Ağa nach Warschau. In <strong>de</strong>n offiziellen Gesprächen ta<strong>de</strong>lte er Abaza Mehmed Paşa wegen seines eigenmächtigen Vorgehens gegen Polen und versprach,<br />
ihn <strong>zu</strong> bestrafen. Der silistrische Pascha versuchte daraufhin seinen Souverän mit reichen Geschenken <strong>zu</strong> umgarnen, jedoch berief man ihn nach Istanbul und übergab ihm einen<br />
Sei<strong>de</strong>nstrick, was als Auffor<strong>de</strong>rung <strong>zu</strong>m Selbstmord <strong>zu</strong> verstehen war, <strong>zu</strong>sätzlich wur<strong>de</strong> er seines Kommandos entbun<strong>de</strong>n. Am 19. September 1634 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vertrag von Chocim aus<br />
<strong>de</strong>m Jahr 1621 erneuert, verlängert und von bei<strong>de</strong>n Seiten bestätigt. Eine Umsiedlung <strong>de</strong>r Nogaier-Hor<strong>de</strong> im Budschak, die <strong>de</strong>r Sultan bei dieser Gelegenheit <strong>zu</strong>gesagt hatte, erfolgte nicht.<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Josef Engel (Hrsg.), Die Entstehung <strong>de</strong>s neuzeitlichen Europa (=Handbuch <strong>de</strong>r europäischen Geschichte, hrsg. v. Theodor Schie<strong>de</strong>r, Bd. 3),Union Verlag, Stuttgart 1971, S.<br />
1047<br />
2. ↑ Stanford Jay Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Mo<strong>de</strong>rn Turkey. The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808, Cambridge University<br />
Press, 1976, S. 199<br />
3. ↑ R. Nisbet Bain, Slavonic Europe. A Political History of Poland from 1447 to 1796, Read Books, 2006, S. 198<br />
Literatur<br />
• R. Nisbet Bain: Slavonic Europe - a Political History of Poland from 1447 to 1796 (Englisch);<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Polnisch-Russischer Krieg 1609-1618<br />
Der Polnisch-Russische Krieg 1609–1618 war ein Krieg zwischen <strong>de</strong>m Königreich Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Zarentum Russland. Der Krieg begann mit einer Offensive Polens unter <strong>de</strong>r<br />
Führung <strong>de</strong>s polnischen Königs Sigismund III. Wasa mit <strong>de</strong>m Ziel, die Krone Russlands für sich <strong>zu</strong> sichern und en<strong>de</strong>te 1618 mit <strong>de</strong>m Vertrag von Deulino, in <strong>de</strong>m Polen-Litauen<br />
territoriale Zugeständnisse gemacht wur<strong>de</strong>n, das damit seine größte territoriale Ausbreitung erreichte. Das Russische Zarenreich konnte hingegen seine Unabhängigkeit sichern.<br />
Vorgeschichte<br />
Russland befand sich <strong>zu</strong> dieser Zeit in <strong>de</strong>r so genannten Zeit <strong>de</strong>r Wirren, die von 1598 bis 1613 andauerte. Ursache dafür war das Aussterben <strong>de</strong>r Moskauer Rjuriki<strong>de</strong>n, wodurch die<br />
Zarenherrschaft in die Schwebe geriet. Diese Perio<strong>de</strong> war durch eine allgemeine Anarchie, zerrüttete Herrschaftsverhältnisse und eine zeitweilige Interregnums-Phase gekennzeichnet. Vor<br />
1610 gelang es <strong>de</strong>n russischen Schwindlern Pseudodimitri I. und Pseudodimitri II., mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng polnischer Magnaten die Macht in Russland an sich <strong>zu</strong> reißen, ohne <strong>de</strong>n Thron<br />
jedoch dauerhaft halten <strong>zu</strong> können, da sie keine Koalition mit <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l eingingen und frem<strong>de</strong>, vor allem nach polnischen Vorbild entlehnte Vorstellungen verwirklichen suchten. Als<br />
sich <strong>de</strong>r falsche Dmitrij mit <strong>de</strong>r Katholikin Marina wi<strong>de</strong>r Tradition und Glauben trauen ließ, fegte ihn ein Moskauer Aufstand hinweg. Zu offenkundig waren die guten Beziehungen <strong>zu</strong>m<br />
aus ihrer Sicht ungläubigen polnischen Erzfeind, <strong>zu</strong> abrupt die Vorboten <strong>de</strong>r Europäisierung gewesen.[1]
Von 1610 bis 1617 befand sich das <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit in Europa als „Moskowiter Reich“ bezeichnete Russische Zarentum <strong>zu</strong><strong>de</strong>m in einem Parallelkrieg mit <strong>de</strong>m Königreich Schwe<strong>de</strong>n<br />
(Ingermanländischer Krieg), das versuchte, <strong>de</strong>n Moskauer Thron für sich <strong>zu</strong> sichern.<br />
Der polnische König Sigismund III. Wasa, <strong>de</strong>r bis 1599 auch König von Schwe<strong>de</strong>n gewesen war, wollte seinen schwedischen Fein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Moskauer Thron nicht überlassen (Polen befand<br />
sich 1600–1611, 1617–1618, 1621–1626 und 1626–1629 ebenfalls im Krieg gegen Schwe<strong>de</strong>n) und beschloss eine Intervention. Grundlage für diese Einmischung bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Vertrag von<br />
Tuschino vom 4. Februar 1610 zwischen <strong>de</strong>m polnischen König und <strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n russischen Zaren Wassili IV. Schuiski eingestellten Bojaren. In diesem Vertrag wur<strong>de</strong> zwischen bei<strong>de</strong>n<br />
Parteien vereinbart, <strong>de</strong>n Sohn <strong>de</strong>s polnischen Königs Władysław <strong>zu</strong>m Zaren <strong>zu</strong> krönen und die Macht <strong>de</strong>s Zaren <strong>zu</strong> beschränken, allerdings wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vertrag nie umgesetzt.<br />
Kriegsverlauf<br />
Polnische Beset<strong>zu</strong>ng Moskaus und russisches Interregnum<br />
Die kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen begannen im Herbst 1609, als ein polnisches Heer unter Führung <strong>de</strong>s polnischen Königs eine langandauern<strong>de</strong> Belagerung <strong>de</strong>r russischen Stadt<br />
Smolensk begann. Nach<strong>de</strong>m ein zweites polnisches Heer eine zahlenmäßig überlegene russische Armee in <strong>de</strong>r Schlacht von Kluschino am 24. Junijul./ 4. Juli 1610greg.[2] besiegen<br />
konnte, wur<strong>de</strong> Zar Wassili IV. am 17. Juli 1610 durch innenpolitische Gegner gestürzt und <strong>zu</strong> einem einfachen Mönch geschoren. Neben <strong>de</strong>r allgemeinen Anarchie im Moskauer Reich<br />
kam somit noch eine Interregnumsphase hin<strong>zu</strong>, die <strong>de</strong>n Höhepunkt <strong>de</strong>r russischen Smuta bil<strong>de</strong>te.<br />
Dem polnischen Heer unter Führung von Stanisław Żółkiewski hatte Moskau nach dieser Nie<strong>de</strong>rlage nichts mehr entgegen<strong>zu</strong>setzen, woraufhin dieses Moschaisk, Volokolamsk und<br />
Dmitrow einnahm. En<strong>de</strong> Juli 1610 erreichte das polnische Heer Moskau.<br />
In <strong>de</strong>r Zwischenzeit nach <strong>de</strong>m Sturz <strong>de</strong>s Zaren wur<strong>de</strong> ein Sieben-Bojaren-Rat (als Duma) in Moskau eingerichtet, die die neue Moskauer Führung darstellte. Der Rat wählte alsbald wie<br />
vertraglich vereinbart <strong>de</strong>n Prinzen Władysław, <strong>de</strong>n polnischen Königssohn, <strong>zu</strong>m neuen Moskauer Zaren. Als dieser Rat sich daraufhin ins polnische Lager bei Smolensk begab, um die<br />
Krönung <strong>de</strong>s neuen Zaren <strong>zu</strong> vollziehen, ließ <strong>de</strong>r anwesen<strong>de</strong> polnische König <strong>de</strong>n Rat nach langen Verhandlungen schließlich im April 1611 verhaften und nach Polen <strong>de</strong>portieren – was<br />
als Repressionsmaßnahme <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m inzwischen ausgebrochenen Moskauer Aufstand gedacht war.<br />
Der polnische König wollte selber über das Moskauer Reich herrschen, um eine gute Ausgangssituation für eine von ihm angestrebte erneute polnisch-schwedische Personalunion<br />
erhalten <strong>zu</strong> können. Ein, angesichts <strong>de</strong>r russischen Notlage, möglicher historischer Kompromiss zwischen Russen und Polen scheiterte damit. Die Pläne zielten auf die Abhängigkeit<br />
Russlands von Polen. Die Krönung eines katholischen Königs von Polen <strong>zu</strong>m russischen Zaren war <strong>zu</strong><strong>de</strong>m ebenso ausgeschlossen wie <strong>de</strong>r Übertritt eines Polenkönigs <strong>zu</strong>m russischorthodoxen<br />
Glauben. Die vom König gefor<strong>de</strong>rte Zarenkrone war etwas ganz an<strong>de</strong>res als die Wahl seines Sohne <strong>zu</strong>m Zaren, in <strong>de</strong>r Erwartung, dass dieser als orthodoxer Zar später<br />
ohnehin nicht als Nachfolger seines Vaters, <strong>zu</strong>m polnischen König gewählt wer<strong>de</strong>n könne.[3]<br />
Russische Volksaufstän<strong>de</strong><br />
Die pro-polnische russische Fraktion unter <strong>de</strong>n Bojaren fiel angesichts <strong>de</strong>ssen nun von <strong>de</strong>m polnischen König ab. So bil<strong>de</strong>ten sich zeitlich nacheinan<strong>de</strong>r mehrere provisorische russische<br />
Gegenbewegungen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r isolierten polnischen Regierung in Moskau. Unterstützt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Volksaufstand durch <strong>de</strong>n Patriarch Hermogenes, <strong>de</strong>r als Reichsverweser und Interrex die<br />
antikatholischen Emotionen schürte und <strong>de</strong>n Hass gegen die Besatzer offen <strong>zu</strong> Tage kommen ließ.[4] Von Januar 1611 an stellten be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Städte (u.a. Nischni Nowgorod, Wologda)<br />
<strong>de</strong>s Moskauer Reiches Verbän<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Rückeroberung Moskaus auf. Der am 13. Februar 1611 in Moskau ausbrechen<strong>de</strong> Aufstand [5] <strong>de</strong>r Moskauer Bürger markierte <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>s<br />
Untergangs <strong>de</strong>r polnischen Herrschaft im Moskauer Reich, die mit religiöser Unterdrückung einherging.<br />
Um ihre Kräfte nicht über ein all<strong>zu</strong>großes Gebiet <strong>zu</strong> verzetteln, entschloss sich die Polnische Garnison, nur <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> behaupten, nämlich <strong>de</strong>n Kreml und das anschließen<strong>de</strong><br />
Viertel Kitai-Gorod.[6] Der polnische König konnte <strong>de</strong>r isolierten Moskauer Garnison nicht <strong>zu</strong> Hilfe kommen, da er bis Anfang 1611 bei <strong>de</strong>r Belagerung von Smolensk mit seinem Heer<br />
gebun<strong>de</strong>n war<br />
Die erste Aufstandswelle wur<strong>de</strong> erfolgreich von <strong>de</strong>r 3000 Mann starken polnischen Garnison [5] nie<strong>de</strong>rgeschlagen. Bei <strong>de</strong>m ersten Aufstand wur<strong>de</strong> ein Teil Moskaus durch Brän<strong>de</strong>
zerstört.<br />
Am 19. März brach <strong>de</strong>r Aufstand erneut aus, <strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rum in Straßenkämpfen von <strong>de</strong>r polnischen Garnison unterdrückt wer<strong>de</strong>n konnte. Das seit Januar 1611 aufgestellte Aufgebot <strong>de</strong>r<br />
Städte griff nun am 24. März 1611 das besetzte Moskau an, wur<strong>de</strong> aber wie<strong>de</strong>rum durch einen polnischen Gegenangriff <strong>zu</strong>rückgeworfen.[7] Nach<strong>de</strong>m die Erstürmung aufgrund <strong>de</strong>s<br />
Fehlens an Belagerungsartillerie scheiterte, belagerte nun diese Landwehr (opolčenie) <strong>de</strong>n Moskauer Kreml. Das Aufgebot dieses Haufens war heterogen durchmischt. Es bestand aus<br />
Stadtbewohnern, Kosaken und diversen an<strong>de</strong>ren Gruppen. Diese Durchmischung stellte ein Problem für die Disziplin im Belagerungslager dar. So brach das 1. Aufgebot am 27. Juni 1611<br />
wie<strong>de</strong>r auseinan<strong>de</strong>r, da sich die anwesen<strong>de</strong>n Kosaken weigerten, eine einheitliche Befehlsgewalt an<strong>zu</strong>erkennen. Am 13. Juni 1611 fiel <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die seit 20 Monaten belagerte russische Stadt<br />
Smolensk in polnische Hän<strong>de</strong>.<br />
Der russische Staat schien in diesem Moment vor <strong>de</strong>m endgültigen Zerfall <strong>zu</strong> stehen. Jedoch setzte im Spätsommer 1611 eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> patriotische Gegenbewegung in <strong>de</strong>n nicht<br />
besetzten Gebieten ein, die <strong>zu</strong>r Bildung eines zweiten Landwehraufgebotes in Nischni Nowgorod führte. Diese Bewegung brachte <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>s gesamten russischen Volkes <strong>zu</strong>m<br />
Ausdruck, die öffentliche Ordnung und eine legitimierte Zentralgewalt wie<strong>de</strong>rherstellen <strong>zu</strong> wollen, um das andauern<strong>de</strong> Chaos im Moskauer Staat <strong>zu</strong> überwin<strong>de</strong>n. Im Kern bestand dieses<br />
Aufgebot aus bewaffneten Stadtbewohnern, jedoch wur<strong>de</strong> diesmal von Anfang an Wert auf Disziplin in <strong>de</strong>r Truppe gelegt. Die polnische Besat<strong>zu</strong>ng konnte bis <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt durch<br />
einen einmaligen Entsatz auf 4000 Mann verstärkt wer<strong>de</strong>n.<br />
Russische Belagerung Moskaus<br />
Landwehraufgebot umfasste zwischen 25–30.000 Mann mit unterschiedlichster Bewaffnung und etwa 1.000 Schützen.[8] Zwischen <strong>de</strong>m 22. August und <strong>de</strong>m 24. August 1612 kämpfte<br />
das russische Landwehraufgebot gegen ein eingetroffenes polnisches Entsatzheer. Nach anfänglichen Erfolgen <strong>de</strong>r Polen gelang es <strong>de</strong>n Russen die polnischen Angriffe ab<strong>zu</strong>wehren und<br />
einen polnischen Entsatz <strong>de</strong>r Festung <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn.<br />
Die polnische Garnison wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r russischen Belagerung insgesamt 19 Monate lang, musste jedoch aufgrund von Hunger und <strong>de</strong>s gescheiterten polnischen Entsatzes am 25. Oktober<br />
1612 vor <strong>de</strong>m von Kusma Minin und Dmitri Poscharski angeführten Landwehraufgebot kapitulieren und abziehen. Dennoch hielten polnische Truppen 1612 weite Gebiete im Westen <strong>de</strong>s<br />
Moskauer Reiches besetzt.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s russischen Interregnums<br />
Trotz <strong>de</strong>s Sieges in Moskau stan<strong>de</strong>n noch immer die Schwe<strong>de</strong>n im Nordwesten Russlands mit Nowgorod als ihrer Hauptgarnison. Der Schwe<strong>de</strong>nkönig verlangte wie<strong>de</strong>rum die<br />
Zarenkrone für <strong>de</strong>n Prinzen Karl Phillip als Austausch für Novgorod. Allerdings stand eine ausländische Thronfolge nicht mehr <strong>zu</strong>r Debatte. Russland suchte einen nationalen, orthodoxen<br />
Zaren. So beschlossen die neu formierten russischen Landstän<strong>de</strong> 1613 in Moskau, <strong>de</strong>n 16 jährigen Michael Romanow, ein Kandidat <strong>de</strong>s Diensta<strong>de</strong>ls, <strong>zu</strong>m russischen Zaren <strong>zu</strong> wählen, <strong>de</strong>r<br />
sich <strong>zu</strong> dieser Zeit in einem Kloster in <strong>de</strong>r Nähe von Kostroma aufhielt. Der junge Mann schien als hinreichend schwacher Zar, von <strong>de</strong>m man keine tyrannische Autokratie befürchten<br />
musste.[9] Die durchführen<strong>de</strong> Wahlversammlung, die sich als ganzes Land konstituierte, wur<strong>de</strong> durch fast alle sozialen Schichten und Gruppen mit Ausnahme <strong>de</strong>r Unfreien und <strong>de</strong>r<br />
herrschaftlichen Bauern vertreten.[10] Zwar hatten gera<strong>de</strong> diese Gruppen[11] in <strong>de</strong>n zweieinhalb Jahren <strong>de</strong>s Interregnums von 1610 bis 1613 <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand gegen die ausländische<br />
Intervention getragen und eine Verwaltung mühsam aufrechterhalten, aber Bedingungen wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m <strong>de</strong>signierten Zaren Michail vor <strong>de</strong>r Wahl nicht gestellt. Damit en<strong>de</strong>te die<br />
Interregnumsphase im Russischen Zarenreich und die verbliebenen polnischen Truppen zogen sich an die polnische Grenze <strong>zu</strong>rück.<br />
Ausgang <strong>de</strong>s Krieges<br />
Bis 1617 unterblieben, mit Ausnahme eines 1615 unternommenen erfolglosen russischen Versuches Smolensk <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern, größere Kampfhandlungen, da die beidseitigen<br />
beschränkten Mittel größere Kriegshandlungen nicht <strong>zu</strong>ließen und somit ein militärisches Patt entstand. Neben Moskaus allgemeiner Erschöpfung lag das auch daran, dass <strong>de</strong>r<br />
finanzschwache polnische König kostspielige Söldner unterhalten musste, weil das or<strong>de</strong>ntliche Aufgebot <strong>de</strong>r Republik nicht einmal für die Erfüllung <strong>de</strong>r Pacta conventa <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
stand.<br />
In <strong>de</strong>r polnischen Republik selbst drohten nach <strong>de</strong>m Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Moskauer Garnison 1613 ebenfalls chaotische Verhältnisse im Innern ein<strong>zu</strong>kehren. Ebenso waren die Grenzen im Nor<strong>de</strong>n,
Osten und Sü<strong>de</strong>n ungesichert. Ein Wan<strong>de</strong>l trat plötzlich ein, als im Frühjahr 1616 die Szlachta in seltener Einmütigkeit beschloss, <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n auch mit militärischen Druck erzwingen <strong>zu</strong><br />
wollen.<br />
Somit scheiterte auch <strong>de</strong>r seit 1612 vorbereitete großangelegte habsburgische Vermittlungsversuch. Die Habsburgermonarchie fürchtete vor allem das im Falle eines polnischen Sieges,<br />
mit <strong>de</strong>r Übernahme <strong>de</strong>s Moskauer Zarenthrons das polnische Vasahaus ein Übergewicht bekommen hätte, mit <strong>de</strong>r es auch die ehemals schwedische Krone <strong>zu</strong>rückgewinnen konnte und im<br />
Ergebnis eine Nor-Osteuropäische Supermonarchie entstan<strong>de</strong>n wäre.[12]<br />
Nach langen Vorbereitungen stieß <strong>de</strong>r polnische Kronprinz Władysław, <strong>de</strong>r seine Ansprüche auf <strong>de</strong>n russischen Thron nicht aufgeben wollte, im Herbst 1617 in einem erneuten Feld<strong>zu</strong>g<br />
nach Moskau vor. Die polnischen Truppen stießen über Wjasma und die kleineren russischen Grenzfestungen Richtung Moskau vor. Das polnische Heer vereinigte sich dann mit einem<br />
ukrainischen Kosakenheer unter Führung von Ataman Sahajdatschny, welches einen erfolglosen Sturm auf Moskau unternahm. Danach marschierte das vereinigte Heer <strong>zu</strong>m<br />
Dreifaltigkeitskloster in Sergijew Possad, um dieses wichtige religiöse Zentrum ein<strong>zu</strong>nehmen. Die Belagerung <strong>de</strong>s befestigten Klosters scheiterte jedoch am Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Mönche und<br />
<strong>de</strong>n stationierten Strelitzen-Truppen. Jedoch war das Moskauer Reich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Zeitpunkt <strong>zu</strong> schwach um das polnische Heer in einer offenen Feldschlacht stellen und besiegen <strong>zu</strong> können.<br />
Auch für die polnische Republik war ein Abschluss <strong>de</strong>r Kämpfe dringend gewor<strong>de</strong>n, da die Republik wegen <strong>de</strong>r Kosaken- und Moldau-Politik in Schwierigkeiten mit <strong>de</strong>n Osmanen<br />
geraten waren und erneute Einfälle <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n befürchten musste.[13]<br />
Waffenstillstand und die Folgen<br />
Während <strong>de</strong>s polnischen Feld<strong>zu</strong>ges wur<strong>de</strong> im Jahre 1618 <strong>de</strong>r Vertrag von Deulino (Deulino ist eine Ortschaft in <strong>de</strong>r Nähe Moskaus) unterzeichnet, in <strong>de</strong>m Polen-Litauen das Gebiet um<br />
Smolensk und Sewerien <strong>zu</strong>gesprochen bekam, die das Großfürstentum Litauen im Vertrag von 1522 an Russland verloren hatte, außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> ein 14 1/2-jähriger Waffenstillstand<br />
beschlossen. Polen-Litauen nahm nach <strong>de</strong>m Vertrag wie<strong>de</strong>r eine machtvolle Stellung in <strong>de</strong>n ruthenischen Län<strong>de</strong>rn ein.[13] Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> im Vertrag ein gegenseitiger<br />
Kriegsgefangenenaustausch beschlossen. Der polnische Königssohn musste auch nicht <strong>de</strong> jure auf <strong>de</strong>n russischen Thron verzichten.<br />
Moskau erlangte durch diesen Vertrag die dringend benötigte Waffenruhe, die es benötigte, um sich im Innern regenerieren <strong>zu</strong> können. Bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts benötigte das<br />
Russische Zarentum um die Depression von 1560 bis 1620 <strong>zu</strong> überwin<strong>de</strong>n. Die machtpolitische Zurückhaltung, die das erschöpfte Moskau sich Polen-Litauen gegenüber auferlegte,[14]<br />
wur<strong>de</strong> nur 1632 bis 1634 unterbrochen als man infolge eines polnischen Interregnums nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s polnischen Königs Sigismund III. Wasa im Bund mit <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n Gustav<br />
Adolf die 1618 verlorenen Gebiete erfolglos <strong>zu</strong>rückerobern wollte.<br />
Das während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Smuta entwickelte Ständische Bewusstsein ging sang- und klanglos 1622 nach <strong>de</strong>m Abflauen <strong>de</strong>r Notstandssituation <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Anknüpfung an <strong>de</strong>r alten<br />
Autokratie unter. Unterstützt wur<strong>de</strong> dieser Prozess durch die Kirche, für die die zaristische Macht traditionell eine notwendige Ergän<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r eigenen geistlichen Autorität war. Der kleine<br />
und mittlere Diensta<strong>de</strong>l benötigte <strong>de</strong>n Zaren wie<strong>de</strong>rum als Schutz vor <strong>de</strong>r mächtigen Hocharistokratie. Das russische Volk, das stark im Bewusstsein <strong>de</strong>r Autokratie verwurzelt war,<br />
konzentrierte sich nach <strong>de</strong>r chaotischen Zeit <strong>de</strong>r Smuta auf Sicherheit und Wohlstand und hieß einen starken Hel<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>s Zaren, willkommen.<br />
Sonstiges<br />
Tod <strong>de</strong>s Patriarchen Hermogenes<br />
Der Führer <strong>de</strong>r russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Hermogenes, wur<strong>de</strong> während <strong>de</strong>r Belagerung Moskaus 1611 von <strong>de</strong>r polnischen Seite inhaftiert, nach<strong>de</strong>m er Aufrufe gegen die<br />
Polen und gegen die Kosaken erließ. Obwohl er im Kreml von <strong>de</strong>r polnischen Garnison scharf bewacht wur<strong>de</strong>, führte er diese weiter. Da er seine geheimen Aktivitäten nicht einstellen<br />
wollte, warfen ihn die Polen in einen Kerker und ließen ihn dort im Februar 1612 <strong>de</strong>s Hungers sterben[15] 1913 wur<strong>de</strong> er dafür von <strong>de</strong>r russisch-orthodoxen Kirche als Märtyrer<br />
heiliggesprochen.<br />
Die Legen<strong>de</strong> von Iwan Sussanin<br />
Der Legen<strong>de</strong> nach reiste Michail Romanow nach <strong>de</strong>r Befreiung Moskaus nach Kostroma um sich dort <strong>zu</strong>m Zaren krönen <strong>zu</strong> lassen. So wird erzählt, dass plün<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Kosaken beabsichtigt
hatten, sich seiner dort <strong>zu</strong> bemächtigen. Ein Bauer namens Iwan Sussanin habe sie absichtlich, um seinen Herren <strong>zu</strong> retten, einen falschen Weg in tiefe Wäl<strong>de</strong>r geführt, wofür er ermor<strong>de</strong>t<br />
wor<strong>de</strong>n sei.[16] Dieser Legen<strong>de</strong> widmete <strong>de</strong>r Komponist Michail Glinka die Oper „Ein Leben für <strong>de</strong>n Zaren“.<br />
Russischer Feiertag<br />
Zum Ge<strong>de</strong>nken an die Befreiung Moskaus wur<strong>de</strong> im Russischen Reich <strong>de</strong>r 4. November je<strong>de</strong>s Jahr als ein Nationaler Feiertag begangen. Der Tag galt als Tag <strong>de</strong>r vom Volk initiierten<br />
Neugründung <strong>de</strong>s russischen Staates, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>vor aufgehört hatte, <strong>zu</strong> existieren. Nach <strong>de</strong>r Machtergreifung <strong>de</strong>r Bolschewiki wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Feiertag abgeschafft, weil er <strong>zu</strong> nah an <strong>de</strong>n<br />
Feierlichkeiten <strong>zu</strong>m Jahrestag <strong>de</strong>r Oktoberrevolution lag und an die Herrschaft <strong>de</strong>r Romanows erinnerte. 2005 führte <strong>de</strong>r russische Präsi<strong>de</strong>nt Wladimir Putin <strong>de</strong>n alten Feiertag unter <strong>de</strong>m<br />
Namen "Tag <strong>de</strong>r nationalen Einheit" wie<strong>de</strong>r ein.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Goehrke/Hellmann/Lorenz/Scheibert: Weltgeschichte - Russland, Band 31, Weltbild Verlag, Frankfurt am Main 1998, S. 143<br />
2. ↑ http://www.xxx<br />
3. ↑ Lothar Rühl:Aufstieg und Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Russischen Reiches, Stuttgart 1992, ISBN 3-421-06534-9, S. 136<br />
4. ↑ Goehrke/Hellmann/Lorenz/Scheibert: Weltgeschichte - Russland, Band 31, Weltbild Verlag, Frankfurt am Main 1998, S. 144<br />
5. ↑ a b Manfred Hellmann: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band I Bis 1613, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1986, S.1055<br />
6. ↑ Valentin Gitermann: Geschichte Russlands 1. Band, Frankfurt am Main 1987, Athenäum Verlag, S.250<br />
7. ↑ Manfred Hellmann: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band I Bis 1613, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1986, S.1056<br />
8. ↑ Manfred Hellmann: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band I Bis 1613, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1986, S.1063<br />
9. ↑ Lothar Rühl:Aufstieg und Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Russischen Reiches, S. 138<br />
10.↑ Goehrke/Hellmann/Lorenz/Scheibert: Weltgeschichte - Russland, Band 31, Weltbild Verlag, Frankfurt am Main 1998, S. 146<br />
11.↑ Vertreter von 50 Städten, <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls, von hohen Beamten, <strong>de</strong>r Kirche und <strong>zu</strong>m ersten Mal <strong>de</strong>r russischen Kosaken: Lothar Rühl:Aufstieg und Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Russischen<br />
Reiches, S. 137<br />
12.↑ Klaus Zernack: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band 2: 1613-1856, vom Randtstaat <strong>zu</strong>r Hegemonialmacht,Stuttgart 1986, ISBN 3-7772-8618-4, S.45<br />
13.↑ a b Klaus Zernack: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band 2: 1613-1856, vom Randtstaat <strong>zu</strong>r Hegemonialmacht,Stuttgart 1986, ISBN 3-7772-8618-4, S.46<br />
14.↑ Goehrke/Hellmann/Lorenz/Scheibert: Weltgeschichte - Russland, Band 31, Weltbild Verlag, Frankfurt am Main 1998, S. 160<br />
15.↑ Valentin Gitermann: Geschichte Russlands 1. Band, Frankfurt am Main 1987, Athenäum Verlag, S.250<br />
16.↑ Valentin Gitermann: Geschichte Russlands 1. Band, Frankfurt am Main 1987, Athenäum Verlag, S.257<br />
Literatur<br />
• Hans-Joachim Torke:Lexikon <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Verlag C.H. Beck, München 1985, ISBN 3-406-30-447-8<br />
• Günther Stökl: Russische Geschichte - Von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1990, ISBN 3-520-24405-5<br />
• Klaus Zernack: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band II 1613–1856 – Vom Randstaat <strong>zu</strong>r Hegemonialmacht, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1986, ISBN 3-7772-8618-4<br />
• Manfred Hellmann: Handbuch <strong>de</strong>r Geschichte Russlands, Band I Bis 1613, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1986, ISBN 3-7772-8618-4<br />
• Valentin Gitermann: Geschichte Russlands 1. Band, Frankfurt am Main 1987, Athenäum Verlag, ISBN 3-610-08461-8,<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Russisch-Polnischer Krieg 1632-1634<br />
Der Russisch-Polnische Krieg 1632–1634, auch Smolensker Krieg genannt, war ein Konflikt zwischen Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Zarentum Russland. Nach <strong>de</strong>m sich Russland <strong>zu</strong> einem<br />
gewissen Grad von <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Wirren erholt hatte, nutzte <strong>de</strong>r russische Zar Michael I. das in Polen durch <strong>de</strong>n Tod von König Sigismund III. Wasa entstan<strong>de</strong>ne Machtvakuum <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m<br />
Versuch, unter Bruch <strong>de</strong>s Waffenstillstands von Deulino die an Polen-Litauen gefallenen Gebiete, vorrangig die Festung Smolensk, <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern. Smolensk war nach <strong>de</strong>m Polnisch–<br />
Russischen Krieg 1609–1618 an <strong>de</strong>n Nachbarstaat gefallen und blieb im Verlauf <strong>de</strong>s 15. bis 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts stets ein Zankapfel zwischen Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Russischen Reich<br />
Der Verlauf<br />
Eine gut vorbereitete russische Armee von bis <strong>zu</strong> 35.000 Mann, mit <strong>de</strong>m Wojewo<strong>de</strong>n Michael Schein an <strong>de</strong>r Spitze, erreichte Smolensk im Oktober 1632 und begann sofort mit <strong>de</strong>r<br />
Belagerung <strong>de</strong>r Grenzfestung. Die Stadt hielt sich, unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Wojewo<strong>de</strong>n Aleksan<strong>de</strong>r Korwin Gosiewski und <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng von Fürst Krzysztof Radziwiłł, <strong>de</strong>s<br />
Feldhetmans von Litauen, <strong>de</strong>m es sogar gelang <strong>de</strong>n russischen Belagerungsring zweimal <strong>zu</strong> überwin<strong>de</strong>n und die polnische Garnison, bis <strong>zu</strong>m Eintreffen <strong>de</strong>s Entsatzeheeres unter König<br />
Władysław IV. Wasa, mit dringend benötigten Mitteln <strong>zu</strong> versorgen, bis ins nächste Jahr hinein. Die polnische Streitmacht, angeführt persönlich durch <strong>de</strong>n König, kam in <strong>de</strong>r Nähe von<br />
Smolensk am 4. September 1633 an und unternahm unmittelbar darauf Schritte gegen die Belagerer.<br />
In einer Serie von heftigen Kämpfen zwangen die Polen die Russen <strong>zu</strong>erst ihre Belagerung von Smolensk bis <strong>zu</strong>m 3. Oktober vollständig auf<strong>zu</strong>geben, um sie dann schließlich bis <strong>zu</strong>m<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Monats ein<strong>zu</strong>kreisen und selbst <strong>zu</strong> belagern. Die belagerten Russen warteten nun ihrerseits auf ein Entsatzheer, das aber nie ankam. Hin<strong>zu</strong> kamen die Plün<strong>de</strong>rungszüge <strong>de</strong>r<br />
Krimtataren unter ihrem Khan Canibek Giray, die die südlichen Teile Moskowiens in <strong>de</strong>n Jahren 1632–1634 verwüsteten und sie sogar bis fast in die Vororte Moskaus brachten. Das Jahr<br />
1633 war für die russische Landbevölkerung beson<strong>de</strong>rs verheerend. Dies führte <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong>r militärischen Schwächung <strong>de</strong>r russischen Seite, da Scheins Soldaten, die aus <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n<br />
Tataren verwüsteten Gebieten kamen, aus Sorge um ihre Vermögen und Familien, Fahnenflucht begingen. Die russischen Komman<strong>de</strong>ure stritten sich um die richtige Strategie und fan<strong>de</strong>n<br />
keinen gemeinsamen Nenner gegen die Polen. Schließlich streckten die Russen am 25. Februar 1634 ihre Waffen.<br />
Die Folgen<br />
Der Krieg en<strong>de</strong>te im Vertrag von Polanów („Ewiger Frie<strong>de</strong>“). Der Frie<strong>de</strong>nsvertrag bestätigte <strong>de</strong>n Vorkriegsstatus, außer kleinen Grenzkorrekturen im Osten <strong>zu</strong> Gunsten <strong>de</strong>r russischen<br />
Seite, unter an<strong>de</strong>rem fielen die Städte Serpejsk und Trubtschewsk an <strong>de</strong>n Zaren (Trubtschewsk allerdings erst 10 Jahre später. Der polnische König plante 1644 einen Krieg gegen das<br />
Osmanische Reich, und wollte im Osten <strong>de</strong>n Zaren mit einem Geschenk „ruhigstellen“, auch dann als die lokalen Wür<strong>de</strong>nträger Wi<strong>de</strong>rstand gegen dieses königliche Vorhaben leisteten,<br />
allerdings zwecklos). Daneben verpflichtete sich Russland eine Kriegsentschädigung in Höhe von 20.000 Rubeln in Gold an Polen <strong>zu</strong> zahlen, während König Władysław IV. formell<br />
seinen Anspruch auf <strong>de</strong>n russischen Thron fallen ließ.
Literatur<br />
• Mirosław Nagielski: Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633–1634, DiG, 2006, ISBN 83-7181-410-0.<br />
• Dariusz Kupisz: Smoleńsk 1632–1634, Bellona, 2001, ISBN 83-11-09282-6.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ «Перечневая роспись ратных людей под Смоленском 141-го года» Меньшиков Д.Н. Затишье перед бурей. Боевые действия под Смоленском в июле-августе 1633<br />
года // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Научно-практическая конференция 12-14 мая 2010 г. СПб., 2010. Ч. II. С. 107<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Russisch-Polnischer Krieg 1654-1667<br />
Der Russisch-Polnische Krieg 1654–1667 begann, nach<strong>de</strong>m das Zarentum Russland infolge <strong>de</strong>s Bündnisschlusses von Perejaslaw <strong>de</strong>n ukrainischen Kosaken <strong>zu</strong> Hilfe kam, die im Zuge<br />
<strong>de</strong>s Chmelnyzkyj-Aufstands seit sechs Jahren gegen die polnische Oberherrschaft kämpften. Er war ein weiterer Ausbruch <strong>de</strong>r jahrhun<strong>de</strong>rtealten Rivalität um die ruthenischen Gebiete,<br />
die Russland aufgrund geschichtlicher, religiöser und kultureller Verbindungen als sein Teil betrachtete.<br />
Kriegsverlauf<br />
Der Krieg verlief äußerst wechselhaft, wenngleich er fast völlig auf <strong>de</strong>m <strong>zu</strong> Polen-Litauen gehören<strong>de</strong>n Gebiet stattfand. Zunächst konnte Russland im Jahr 1654 endgültig Smolensk von<br />
<strong>de</strong>n Polen erobern, das seit <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Wirren in polnischen Hän<strong>de</strong>n war und im Krieg von 1632 bis 1634 erfolglos belagert wor<strong>de</strong>n war. Danach konnte die russisch-ukrainische Armee<br />
mehrere weitere Schlachten gewinnen und bis nach Lublin im eigentlichen Polen vorstoßen. Als jedoch Schwe<strong>de</strong>n gleichzeitig in Polen einfiel, schlossen bei<strong>de</strong> Seiten im Vertrag von<br />
Niemież einen Waffenstillstand ab, um gegen die drohen<strong>de</strong> schwedische Vorherrschaft an<strong>zu</strong>kämpfen. Nach <strong>de</strong>r Vertreibung <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n aus Polen begannen 1659 neue Feindseligkeiten,<br />
die für die vom Sieg über Schwe<strong>de</strong>n motivierten Polen nun erfolgreicher verliefen. Nach <strong>de</strong>m Seitenwechsel eines Teils <strong>de</strong>r Kosaken unter Hetman Iwan Wyhowski wur<strong>de</strong> das russische<br />
Heer von Polen, Kosaken und <strong>de</strong>n Krimtataren am 8. Juli 1659 bei Konotop geschlagen.[1], was jedoch die Spannungen innerhalb <strong>de</strong>r Kosakenreihen verschärfte und <strong>zu</strong>m baldigen Sturz<br />
von Wyhowski führte. Polen konnte Russland aus Weißrussland und Litauen <strong>zu</strong>rückdrängen, letztlich aber wegen inneren Konflikten und <strong>de</strong>r schweren Nie<strong>de</strong>rlage bei Hluchiw nicht mehr<br />
weiter vordringen.[2]<br />
Ergebnis<br />
Die Pattsituation mün<strong>de</strong>te im Vertrag von Andrussowo und letztlich im „Ewigen Frie<strong>de</strong>n“ von 1686. Die „linksufrige“ Ukraine, östlich <strong>de</strong>s Dnjepr sowie Kiew gingen in russischen Besitz<br />
über. Dies war <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rgangs <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Staates, <strong>de</strong>r im Verlauf <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts immer mehr Gebiete verlor, bis er zwischen <strong>de</strong>n Großmächten aufgeteilt<br />
wur<strong>de</strong>. Für Russland markierte die Anglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Ostukraine dagegen <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>s Aufstieges <strong>zu</strong>r europäischen Großmacht.
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Paul R. Magocsi: A history of Ukraine. University of Washington Press 1997, ISBN 0-295-97580-6, S. 225.<br />
2. ↑ Christoph Schmidt: Russische Geschichte 1547–1917. Verlag Ol<strong>de</strong>nbourg, München 2003, ISBN 3-486-56705-5, S. 26f.<br />
Literatur<br />
• Малов А. В. Русско-польская война 1654–1667 гг. М.: Цейхгауз, 2006 г. ISBN 5-94038-111-1.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Chmelnyzkyj-Aufstand<br />
Chmelnyzkyj–Aufstand war ein großer Aufstand <strong>de</strong>r ukrainischen Saporoger Kosaken und Bevölkerung unter <strong>de</strong>r Führung von Bohdan Chmelnyzkyj in <strong>de</strong>r Ukraine in <strong>de</strong>n Jahren<br />
1648−1657, <strong>de</strong>r gegen die A<strong>de</strong>lsrepublik Polen-Litauen gerichtet war, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r die damalige Ukraine gehörte. Der Grund war eine <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Willkür polnischer Landbesitzer gegenüber<br />
<strong>de</strong>r ukrainischen Landbevölkerung, wirtschaftliche Ausbeutung und <strong>de</strong>r religiöse Druck auf die orthodoxe Bevölkerung im Rahmen <strong>de</strong>r Union von Brest.<br />
Bohdan Chmelnyzkyj, ein enteigneter ruthenischer Adliger, begab sich <strong>zu</strong>r Saporoger Sitsch, <strong>de</strong>m Hort <strong>de</strong>r Kosaken, und wur<strong>de</strong> dort <strong>zu</strong>m Hetman gewählt. Eine Kosakenarmee begann<br />
einen erfolgreichen Feld<strong>zu</strong>g gegen die Armee <strong>de</strong>r polnischen Krone und schlug sie mehrmals empfindlich. Bereits 1648, <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s, schickte Bohdan Chemlnyzkyj eine<br />
Gesandtschaft nach Moskau mit <strong>de</strong>r Bitte um Beistand. Da Moskau jedoch zögerte, einen neuen Krieg gegen Polen-Litauen <strong>zu</strong> beginnen, mussten sich die Kosaken mit <strong>de</strong>n Krimtataren<br />
verbün<strong>de</strong>n. Als Bezahlung durften die Krimtataren einen Löwenanteil <strong>de</strong>r erbeuteten polnischen Güter behalten. Die Kosaken begannen einen unaufhaltsamen Vormarsch Richtung<br />
Westen, wobei viele Polen, Jesuiten und Ju<strong>de</strong>n gna<strong>de</strong>nlos erschlagen wur<strong>de</strong>n.<br />
Das Kriegsglück verließ Chmelnyzkyj, als <strong>de</strong>r Krimkhan in <strong>de</strong>n Schlachten bei Sboriw, Berestetschko und Schwanez die Kosaken verriet, damit Polen nicht all<strong>zu</strong> sehr geschwächt wür<strong>de</strong>.<br />
Daraufhin wandte sich Chmelnyzkyj erneut an Zar Alexei Michailowitsch. Bei <strong>de</strong>r Rada von Perejaslaw im Januar 1654 schwor ein Großteil <strong>de</strong>r Kosakenelite einen Treueeid auf <strong>de</strong>n<br />
Zaren. Das Zarentum Russland erklärte Polen-Litauen <strong>de</strong>n Krieg. Der sehr wechselhafte Russisch-Polnische Krieg 1654–1667 war eine Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Chmelnyzkyj-Aufstands. Am<br />
En<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> die Ukraine zwischen Russland und Polen entlang <strong>de</strong>s Dnepr aufgeteilt.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Dreizehnjähriger Krieg<br />
Der Dreizehnjährige Krieg 1454 bis 1466 (polnisch: Wojna trzynastoletnia), auch Preußischer Städtekrieg genannt, begann als Konflikt zwischen <strong>de</strong>m von mehreren preußischen<br />
Hansestädten gegrün<strong>de</strong>ten Preußischen Bund und <strong>de</strong>m Deutschor<strong>de</strong>nsland <strong>de</strong>s Deutschen Ritteror<strong>de</strong>n. Er führte <strong>zu</strong>r Teilung Preußens und hatte dadurch noch Folgen bis ins 20.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Vorgeschichte<br />
Nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Tannenberg (1410) und <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Thorn musste <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n Reparationen an Polen-Litauen zahlen, worauf Hochmeister Heinrich <strong>de</strong>r Ältere<br />
massive Steuererhöhungen in Deutschor<strong>de</strong>nsland durchsetzte. Mit dieser Wirtschaftspolitik waren viele Bürger in <strong>de</strong>n Hansestädten nicht einverstan<strong>de</strong>n und versuchten, mehr<br />
Unabhängigkeit und Autonomie <strong>zu</strong> erreichen, vergleichbar mit <strong>de</strong>m Status <strong>de</strong>r reichsunmittelbaren Städte im Heiligen Römischen Reich. Zu diesem Zweck wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Preußische Bund<br />
unter Führung <strong>de</strong>s Deutschritters Johann von Baysen gegrün<strong>de</strong>t und bei Kasimir IV. Jagiello um Hilfe ersucht.<br />
Heinrich von Plauen wollte sich nicht mit <strong>de</strong>m Ersten Thorner Frie<strong>de</strong>n abfin<strong>de</strong>n. Er begann auf<strong>zu</strong>rüsten. Dafür und für die Zahlungsverpflichtungen aus <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsvertrag benötigte er<br />
Geld. Das sollten die Städte und die Landstän<strong>de</strong> zahlen. Die Situation wur<strong>de</strong> für das Land nicht besser, als Heinrich von Plauen 1413 abgesetzt wur<strong>de</strong>.<br />
Die Ritterdienste <strong>de</strong>r Inhaber von Dienstgütern waren für <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n wegen <strong>de</strong>s Aufkommens <strong>de</strong>r Söldnerheere uninteressant gewor<strong>de</strong>n. Deshalb versuchte er, die Rechte <strong>de</strong>r Besitzer von<br />
Dienstgütern mit allen – auch wi<strong>de</strong>rrechtlichen – Mitteln <strong>zu</strong> verschlechtern. Er war am möglichst schnellen Heimfall <strong>de</strong>r Güter interessiert, die er mit Bauerndörfern aufsie<strong>de</strong>ln wollte. Die<br />
Zinszahlungen <strong>de</strong>r Bauern waren ihm mehr wert als die Ritterdienste <strong>de</strong>r Gutsbesitzer.<br />
Desgleichen begann <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n massiv in die Verfassungen <strong>de</strong>r Städte ein<strong>zu</strong>greifen, um die führen<strong>de</strong>n Positionen <strong>de</strong>r Stadtherrschaft mit ihm genehmen Leuten <strong>zu</strong> besetzen.<br />
Politisch gestärkt wur<strong>de</strong> die preußischen Stän<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n polnischen König: Er machte sie <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Garanten <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>nsverträge von 1422 und 1435. De jure wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>n<br />
Städten die Macht gegeben, Einfluss auf die Außenpolitik <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns aus<strong>zu</strong>üben. De facto ignorierte <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n je<strong>de</strong> Einmischung in seine Belange.<br />
Das alles, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Arroganz <strong>de</strong>r landfrem<strong>de</strong>n Ritter baute sich <strong>zu</strong> einer bedrohlichen Stimmung gegen <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n auf. Am 14. März 1440 schlossen sich die preußischen Stän<strong>de</strong>,<br />
also die Ritterschaft, <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l und die Städte, in Marienwer<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einem "Bund vor Gewalt" <strong>zu</strong>sammen. Man wollte sich <strong>zu</strong>nächst nicht vom Or<strong>de</strong>n lösen, son<strong>de</strong>rn sich gegen die<br />
Unterdrückung wehren und mit einer Stimme sprechen. Die Meuchelmor<strong>de</strong> von Danzig waren nicht vergessen, auch in an<strong>de</strong>ren Städten waren ähnliche, wenn auch nicht so schlimme<br />
Dinge passiert.<br />
Es wur<strong>de</strong> ein aus 20 Mitglie<strong>de</strong>rn bestehen<strong>de</strong>r „Enger Rat“ gegrün<strong>de</strong>t. Als Sitz dieses Rates wur<strong>de</strong> Thorn bestimmt, weil es an <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong> Polen lag. Der Hochmeister Ludwig von<br />
Erlichshausen verlangte die Auflösung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s. Der Bund lehnte ab. Schließlich wur<strong>de</strong> die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s <strong>de</strong>m Kaiser anvertraut. Der Kaiser<br />
setzte <strong>de</strong>n Gerichtstag auf <strong>de</strong>n 24. Juni 1453 in Wien fest. Am 1. Dezember 1453 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bund für rechtswidrig erklärt und seine Auflösung befohlen.<br />
Kriegsverlauf<br />
Die Anhänger <strong>de</strong>s Preußischen Bun<strong>de</strong>s ersuchten mehrere europäische Herrscher ohne Erfolg um Unterstüt<strong>zu</strong>ng, nur <strong>de</strong>r König von Polen war gewillt, die Schutzherrschaft <strong>zu</strong><br />
übernehmen. Somit kündigte <strong>de</strong>r Bund am 4. Februar 1454 <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Gehorsam auf und begann <strong>de</strong>n wohlvorbereiteten Krieg. In wenigen Tagen war <strong>de</strong>r größere Teil <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s in<br />
<strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Aufständischen. Alle Burgen <strong>de</strong>s westlichen Preußen, mit Ausnahme von Marienburg und Marienwer<strong>de</strong>r, waren von Bun<strong>de</strong>struppen besetzt.<br />
Der Bruch mit <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n war vollzogen wor<strong>de</strong>n, ohne dass eine feste Vereinbarung mit <strong>de</strong>m König von Polen getroffen wor<strong>de</strong>n war. Aber seit Herbst 1452 gab es zwischen <strong>de</strong>r Kulmer<br />
Ritterschaft sowie <strong>de</strong>n Städten Kulm und Thorn lose Verhandlungen mit <strong>de</strong>m König von Polen. Der „Enge Rat“ erhielt eine Einladung, nach <strong>de</strong>m 2. Februar 1454 Bevollmächtigte <strong>zu</strong>m
Sejm nach Krakau <strong>zu</strong> schicken. Dort hielt König Kasimir IV. gera<strong>de</strong> seine Hochzeit mit Elisabeth von Habsburg, als eine Bun<strong>de</strong>sgesandtschaft unter Hans von Baysen ihm die<br />
Oberherrschaft über Preußen antrug. In einem auf <strong>de</strong>n 6. März (wahrscheinlich <strong>zu</strong>rück-) datierten Dokument erklärte Kasimir die Inkorporation <strong>de</strong>s gesamten Or<strong>de</strong>nsgebiets in <strong>de</strong>n<br />
polnischen Staat, erteilte <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l Rechte, die <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls entsprachen, und bestätigte die <strong>de</strong>r Städte.<br />
Am 22. Februar erklärte auch <strong>de</strong>r polnische König <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Krieg und schon am 6. März nahm er die Ergebung <strong>de</strong>r preußischen Stän<strong>de</strong> an und inkorporierte <strong>de</strong>n gesamten<br />
Or<strong>de</strong>nsstaat <strong>de</strong>m polnischen Reich. Am 23. Mai nahm er die Huldigung <strong>de</strong>r Stän<strong>de</strong> in Thorn entgegen. Das Land wur<strong>de</strong> pro forma in vier Wojewodschaften (Kulm, Pommerellen, Elbing,<br />
Königsberg) geteilt, und Hans von Baysen <strong>zu</strong>m Statthalter ernannte.<br />
Die meisten Or<strong>de</strong>nsburgen waren nur mit sehr wenigen Or<strong>de</strong>nsrittern besetzt und wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Aufständischen ohne Schwierigkeiten genommen. Der Or<strong>de</strong>n hielt sich im Westen nur<br />
in wenigen Burgen: Marienburg, Stuhm und Konitz.<br />
Während <strong>de</strong>r Herbstarbeit auf <strong>de</strong>n Gütern hatte <strong>de</strong>r König Schwierigkeiten, Truppen <strong>de</strong>s großpolnischen und kujawischen A<strong>de</strong>ls auf<strong>zu</strong>bieten. Der König sah sich gezwungen, <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l<br />
große Zugeständnisse <strong>zu</strong> machen. Erst danach konnte er mit <strong>de</strong>m Aufgebot von Großpolen und Kujawien nach Konitz ziehen, um die aus <strong>de</strong>m Reich heranziehen<strong>de</strong> Verstärkung <strong>de</strong>s<br />
Or<strong>de</strong>ns ab<strong>zu</strong>fangen.<br />
Es kam am 18. September 1454 <strong>zu</strong>r Schlacht bei Konitz, <strong>de</strong>r einzigen großen Feldschlacht <strong>de</strong>s Krieges. Sie en<strong>de</strong>te trotz zahlenmäßig doppelter Überlegenheit <strong>de</strong>r Polen mit ihrer<br />
vernichten<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlage gegen die Or<strong>de</strong>nstruppen aus <strong>de</strong>m Reich unter Herzog Rudolf von Sagan. Daraufhin kehrten zahlreiche Städte, insbeson<strong>de</strong>re auch Königsberg, <strong>zu</strong>m Or<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>rück.<br />
Im weiteren Verlauf gab es keine großen offenen Schlachten mehr, <strong>de</strong>r weitere Krieg wur<strong>de</strong> größtenteils ohne Truppen <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls geführt. Es war nur noch ein<br />
Verwüstungskrieg mit Söldnern um feste Plätze. Es waren beson<strong>de</strong>rs die Städte <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s, voran Danzig, die das Geld für die Söldner aufbrachten.<br />
Zur See führte Danzig einen erfolgreichen Kaperkrieg gegen Lübeck und die an<strong>de</strong>ren Städte <strong>de</strong>s Wendischen Quartiers um <strong>de</strong>ren Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n Häfen <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns, Königsberg und<br />
Memel, <strong>zu</strong> unterbin<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n dadurch <strong>zu</strong> schwächen.<br />
Durch <strong>de</strong>n Verlust weiter Lan<strong>de</strong>steile verlor <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n wichtige Einnahmequellen. Aus Geldmangel musste er schon 1454 die Neumark an Bran<strong>de</strong>nburg verkaufen. Unterstüt<strong>zu</strong>ng aus<br />
Livland o<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Balleien erhielt er nicht. Mit Vertrag vom 9. Oktober 1454 musste er eine Reihe von Burgen an seine Söldner verpfän<strong>de</strong>n.<br />
Als er die vereinbarten Zahlungstermine nicht einhalten konnte, verkauften Söldnerhauptleute nach langen Verhandlungen am 16. August 1456 die Marienburg und fünf an<strong>de</strong>re Burgen an<br />
<strong>de</strong>n König und <strong>de</strong>n Bund. Der Bund zahlte <strong>de</strong>n böhmischen Söldnern 304.000 Mark, wovon Danzig allein 144.400 übernahm. Der Verkauf <strong>de</strong>r Burgen an <strong>de</strong>n Feind wur<strong>de</strong> von einigen<br />
Söldnerführern als ehrenrührig angesehen.<br />
Der Hochmeister räumte die Marienburg 1457 kampflos und zog nach Königsberg. Am 7. Juni 1457 zog König Kasimir in die Burg ein. Die Stadt Marienburg hingegen verteidigte sich<br />
unter ihrem Bürgermeister Bartholomäus Blume weitere drei Jahre. Erst 1460 ergab sich die Stadt Marienburg an Danzig; Bürgermeister Blume wur<strong>de</strong> anschließend hingerichtet.[1]<br />
Entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> militärische Erfolge verbuchten die Gegner <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns in <strong>de</strong>n 1460er Jahren: Am 15. September 1463 kam es <strong>zu</strong> einem Seegefecht auf <strong>de</strong>m Frischen Haff, als <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n<br />
versuchte, über die Weichsel die Stadt Mewe <strong>zu</strong> entsetzen. Es war <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Sieg <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s und seines Verbün<strong>de</strong>ten Polen. Mewe und an<strong>de</strong>re Städte an <strong>de</strong>r Weichsel, die sich<br />
noch in <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns befan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n erobert. Nun kontrollierte <strong>de</strong>r Bund und Polen die Weichsel.<br />
Vermittlungsversuche von Bürgermeister Hinrich Castorp aus Lübeck in <strong>de</strong>n Jahren 1463/64 scheiterten. Schließlich waren auch die Finanzkräfte <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns erschöpft,<br />
Kampfhandlungen erlahmten. 1466 verlor <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n auch noch Pommerellen.<br />
Zweiter Frie<strong>de</strong>n von Thorn<br />
Intensive Verhandlungen <strong>de</strong>s päpstlichen Legaten Rudolf von Rü<strong>de</strong>sheim, Bischof von Lavant, führten im Jahre 1466 <strong>zu</strong>m Erfolg: Der Zweite Frie<strong>de</strong>n von Thorn wur<strong>de</strong> am 19. Oktober<br />
1466 geschlossen.
Der östliche Rest <strong>de</strong>s Deutschor<strong>de</strong>nslan<strong>de</strong>s blieb unter Kontrolle <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns, jedoch sollten die Hochmeister <strong>de</strong>r Krone Polens persönliche Treuei<strong>de</strong> abgeben[2]. Im Jahre 1525 verlor <strong>de</strong>r<br />
Or<strong>de</strong>n auch dort <strong>de</strong>n Einfluss, das Gebiet wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Herzogtum Preußen säkularisiert, bis es im Vertrag von Wehlau 1657 die Unabhängigkeit <strong>zu</strong>rückerlangte.<br />
Der Westteil Preußens, Pommerellen, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Kulmer und Michelauer Land und <strong>de</strong>m ostpreußischen Ermland, wur<strong>de</strong> als weitgehend autonomes „Preußen königlichen<br />
Anteils“ in einer rechtlich nicht klar <strong>de</strong>finierten Union mit <strong>de</strong>r „Krone“ Polen verbun<strong>de</strong>n, d. h. <strong>de</strong>m König direkt unterstellt. Die Son<strong>de</strong>rstellung <strong>de</strong>s „Königlichen Preußen“ gegenüber <strong>de</strong>r<br />
Krone, eigene Landtage mit Deutsch als Verhandlungssprache, eigene Lan<strong>de</strong>sregierung (Lan<strong>de</strong>srat), eigener Münze, eigene Wehrhoheit <strong>de</strong>r großen Städte, das Recht <strong>de</strong>r großen Städte,<br />
eigene diplomatische Verbindungen mit <strong>de</strong>m Ausland <strong>zu</strong> unterhalten usw. wur<strong>de</strong>n für drei Jahrhun<strong>de</strong>rte Gegenstand ständiger Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen.<br />
Schon 1467 kam es wegen Konflikten um die Investitur von Bischöfen mit <strong>de</strong>m Fürstbistum Ermland, welches eine Halbenklave im östlichen Or<strong>de</strong>nsstaat war, <strong>zu</strong>m sogenannten<br />
Pfaffenkrieg (Wojna popia) (1467–1479).<br />
Literatur<br />
• Biskup, Marian: Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyzackim 1454-1466, Warszawa 1969 (mit <strong>de</strong>utscher Zusammenfassung). (Der Dreizehnjährige Krieg mit <strong>de</strong>m Deutschen<br />
Or<strong>de</strong>n)<br />
• Biskup Marian: Der preußische Bund 1440-1454 - Geschichte, Struktur, Tätigkeit und Be<strong>de</strong>utung in <strong>de</strong>r Geschichte Preußens und Polens, in: Konrad Fritze, Eckhard Müller-<br />
Mertens, Johannes Schildhauer (Hgg.): Hansische Studien III, Bürgertum-Han<strong>de</strong>lskapital-Städtebün<strong>de</strong> (Abhandlungen <strong>zu</strong>r Han<strong>de</strong>ls- und Sozialgeschichte XV), Weimar 1975,<br />
S.210-229.<br />
• Biskup, Marian, Wojna trzynastoletnia i powrót Polski na Baltyk w XV wieku (Dzieje narodu i panstwa polskiego tom I i II), Kraków 1990. (Der Dreizehnjährige Krieg und die<br />
Rückkehr Polens an die Ostsee im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt)<br />
• Karin Friedrich: The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772, [1]<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Bruno Schumacher: Geschichte Ost- und Westpreußens. 7. Auflage. Verlag Weidlich, Würzburg 1987, S. 137.<br />
2. ↑ Seite 43, 44 Keine Lehnshoheit, Treuei<strong>de</strong> in Person<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Zweiter Nordischer Krieg<br />
Der Zweite Nordische Krieg, auch Kleiner Nordischer Krieg o<strong>de</strong>r Zweiter Schwedisch-Polnischer Krieg genannt, war eine von 1655 bis 1660/61 dauern<strong>de</strong> kriegerische<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen Polen-Litauen und Schwe<strong>de</strong>n sowie <strong>de</strong>ren Verbün<strong>de</strong>ten um die Vorherrschaft im Baltikum. In <strong>de</strong>n Krieg wur<strong>de</strong>n nahe<strong>zu</strong> alle Anrainerstaaten Polen-Litauens<br />
verstrickt, darunter auch Russland, das seine Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Polen-Litauen, die in enger Verbindung <strong>zu</strong>m Zweiten Nordischen Krieg stan<strong>de</strong>n, im Rahmen <strong>de</strong>s Russisch-<br />
Polnischen Krieges von 1654–1667 austrug. In Polen wird die Zeit <strong>de</strong>s Krieges mit Schwe<strong>de</strong>n, häufig aber auch die Gesamtheit <strong>de</strong>r militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r 1650er und
1660er Jahre auch als die „(Blutige) Sintflut“ bzw. als „Schwedische Sintflut“ (pln. Potop Szwedzki) bezeichnet, weil das Königreich damals gera<strong>de</strong><strong>zu</strong> eine Sintflut von Invasionen<br />
frem<strong>de</strong>r Heere erlebte.<br />
Vorgeschichte<br />
Schwe<strong>de</strong>n und Polen waren schon seit <strong>de</strong>r Abset<strong>zu</strong>ng Sigismund III. als schwedischer König im Jahr 1599 in schwere kriegerische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen verwickelt. Es ging um <strong>de</strong>n<br />
Besitz <strong>de</strong>r baltischen Küstenregionen Estland und Livland. Riga, Dorpat, große Teile von Kurland, Königsberg und wichtige preußische Küstengebiete fielen in schwedische Hand.<br />
Zum an<strong>de</strong>ren hatte Polen die Zeit <strong>de</strong>r Wirren in Russland genutzt, um große Gebiete im Westen <strong>de</strong>s Russischen Reiches <strong>zu</strong> annektieren. 1648 begann in <strong>de</strong>r von Polen besetzten Ukraine<br />
ein Kosakenaufstand unter <strong>de</strong>r Führung ihres Atamans Bohdan Chmelnyzkyj, durch <strong>de</strong>n Polen einen Großteil seiner Gebiete verlor. Als die schwedische Königin Christina I. am 16. Juni<br />
1654 abdankte, machte <strong>de</strong>r polnische König Johann II. Kasimir, ein Urenkel <strong>de</strong>s Königs Gustav I. und letzter leben<strong>de</strong>r Wasa, Ansprüche auf <strong>de</strong>n schwedischen Thron geltend. Zeitgleich<br />
begann durch Chmelnyzkyjs Bündnisschluss mit Russland <strong>de</strong>r für Polen-Litauen anfangs verheeren<strong>de</strong> Russisch-Polnische Krieg. Die Russen und die Kosaken eroberten ganz Litauen und<br />
drangen bis nach Lublin vor.<br />
Kriegsbeginn<br />
Im Juni 1655 fiel Karl X. Gustav daraufhin von Pommern und Litauen aus in das politisch völlig zerrüttete Polen ein und besetzte Warschau und Krakau. Ohne weiteren Wi<strong>de</strong>rstand<br />
kapitulierten die polnischen Festungen. Auch gingen viele adlige Reiter <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n über. Am 25. Juli kapitulierte Polen, am 18. August stimmte Janusz Radziwill einer Union <strong>de</strong>s<br />
Großfürstentums Litauen mit Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>. König Johann II. Kasimir floh nach Schlesien.<br />
Kurfürst Friedrich Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg war in <strong>de</strong>n Krieg einbezogen, da seine östliche Besit<strong>zu</strong>ng, das zwischen Pommern und Litauen gelegene Herzogtum Preußen, seit <strong>de</strong>m<br />
Zweiten Frie<strong>de</strong>n von Thorn ein polnisches Lehen war und jetzt ohne Schutzherr war. Er hatte das geplante Bündnis mit Schwe<strong>de</strong>n aufgegeben, weil ihm <strong>de</strong>ssen For<strong>de</strong>rungen auf <strong>de</strong>n<br />
Stettiner Verhandlungen <strong>zu</strong> hoch erschienen. Dort ließ er Milizen, die so genannten „Wybranzen“, aufbieten und schloss im November mit <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s nunmehr unbeschützten<br />
westlichen Preußens einen gegenseitigen Verteidigungspakt[1], <strong>de</strong>n Vertrag von Rinsk, ab. Der Schwe<strong>de</strong>nkönig wollte jedoch Preußen und Ermland für sich gewinnen und Friedrich<br />
Wilhelm sah sich gezwungen <strong>zu</strong>r Selbstverteidigung, beteuerte auch dieses stets. Die bran<strong>de</strong>nburgischen Truppen aus Cleve und Bran<strong>de</strong>nburg wur<strong>de</strong>n ins Herzogtum Preußen verlegt. In<br />
seinem Vorhaben bedroht wandte sich Karl X. Gustav nach Preußen, drängte die Bran<strong>de</strong>nburger bis unter die Mauern von Königsberg und erzwang am 17. Januar 1656 <strong>de</strong>n Vertrag von<br />
Königsberg.<br />
In diesem Vertrag nahm <strong>de</strong>r Kurfürst das Herzogtum Preußen nun als schwedisches Lehen an und kappte die Verbindung mit <strong>de</strong>n westpreußischen Stän<strong>de</strong>n. Er musste sein Land <strong>de</strong>n<br />
durchziehen<strong>de</strong>n schwedischen Truppen und die Häfen <strong>de</strong>n schwedischen Schiffen öffnen. Auch trat Bran<strong>de</strong>nburg <strong>de</strong>m König die Hälfte <strong>de</strong>r einträglichen Seezölle ab. Dafür erhielt<br />
Bran<strong>de</strong>nburg das Bistum Ermland als schwedisches Lehen.<br />
Der erbitterte Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r polnischen Adligen, die ihre Ei<strong>de</strong> gegen die Schwe<strong>de</strong>n brachen, die Rückkehr <strong>de</strong>s Königs Johann II. Kasimir sowie <strong>de</strong>r nationale Fanatismus <strong>de</strong>r Polen<br />
führte <strong>zu</strong> einer prekären Lage für <strong>de</strong>n schwedischen König, <strong>de</strong>r daraufhin die Hilfe <strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburger benötigte. Nach<strong>de</strong>m sich Friedrich Wilhelm in Königsberg zwar <strong>zu</strong>r Neutralität,<br />
nicht aber <strong>zu</strong>r Mitwirkung am Krieg gegen Polen verpflichtet hatte, wur<strong>de</strong> am 23. Juni 1656 in Marienburg ein neuer Vertrag geschlossen. In diesem Vertrag verpflichtete sich <strong>de</strong>r<br />
Kurfürst für die Überlassung <strong>de</strong>s Bistums Ermland und vier großer polnischer Wojwodschaften mit seiner ganzen Macht als freier Bun<strong>de</strong>sgenosse <strong>de</strong>m König <strong>zu</strong> Hilfe <strong>zu</strong> ziehen.<br />
Trotz <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Überzahl <strong>de</strong>r Polen und <strong>de</strong>n verbün<strong>de</strong>ten Tataren erreichten die Schwe<strong>de</strong>n und Bran<strong>de</strong>nburger zwischen <strong>de</strong>m 28. und 30. Juli einen großen Sieg in <strong>de</strong>r Schlacht von<br />
Warschau. Im Anschluss daran zeigte sich die schwedische Schwäche: <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong> Nachschub an Truppen und Material. Den Polen zogen bald neue große Scharen <strong>zu</strong>. Russland schloss<br />
mit Polen einen Waffenstillstand ab, erklärte Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Krieg und eroberte Gebiete im Baltikum. Der bran<strong>de</strong>nburgische General Graf Wal<strong>de</strong>ck erlitt im Oktober am Lyck eine<br />
Nie<strong>de</strong>rlage, König Johann II. Kasimir eroberte Danzig. In dieser Not entschloss sich Karl X. Gustav sogar da<strong>zu</strong>, <strong>de</strong>m Kurfürsten im Vertrag von Labiau (20. November 1656) die<br />
Souveränität über ganz Preußen <strong>zu</strong><strong>zu</strong>gestehen. Im Vertrag von Wehlau (19. September 1657) erlangte <strong>de</strong>r Kurfürst auch die Unabhängigkeit Preußens von Polen.<br />
Noch einmal unternahm <strong>de</strong>r schwedische König einen Zug durch ganz Polen, um mit seinem neuen Bun<strong>de</strong>sgenossen, <strong>de</strong>m Fürsten von Siebenbürgen Georg II. Rákóczi
<strong>zu</strong>sammen<strong>zu</strong>treffen. Vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt Tschenstochau wur<strong>de</strong> er aber gestoppt.<br />
Bündnispartner<br />
Königstreue Truppen leisteten <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n erbitterten Wi<strong>de</strong>rstand. Während<strong>de</strong>ssen versuchte Johann II. Kasimir, Bündnispartner <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Um ein Übergewicht Schwe<strong>de</strong>ns in<br />
Nor<strong>de</strong>uropa <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, traten Dänemark, Österreich (Haus Habsburg) und die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> auf die Seite Polens. Der türkische Sultan erlaubt ein Bündnis seines Vasallen, <strong>de</strong>s Krim-<br />
Khans mit <strong>de</strong>m König. Auch Bran<strong>de</strong>nburg wechselte nach einem Einfall <strong>de</strong>r Krimtataren schließlich die Fronten, nach<strong>de</strong>m Polen im Vertrag von Wehlau am 19. September 1657 <strong>de</strong>m<br />
Kurfürsten die Souveränität im Herzogtum Preußen <strong>zu</strong>erkannte. Gegen Dänemark erzielte Karl X. Gustav <strong>zu</strong>nächst militärische Erfolge.<br />
Nach einer erfolgreichen Offensive <strong>de</strong>r antischwedischen Koalition schlugen England und Frankreich Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen vor.<br />
Kriegsen<strong>de</strong><br />
Der Krieg wur<strong>de</strong> dann am 3. Mai 1660 durch <strong>de</strong>n Vertrag von Oliva been<strong>de</strong>t. Der polnische König verzichtete darin auf alle Ansprüche auf <strong>de</strong>n schwedischen Thron. Schwe<strong>de</strong>n behielt<br />
Livland und Estland gemäß <strong>de</strong>n Bestimmungen <strong>de</strong>s Westfälischen Frie<strong>de</strong>nsvertrages vom 24. Oktober 1648.<br />
Bran<strong>de</strong>nburg musste sich aus <strong>de</strong>n besetzten schwedischen Gebieten in Pommern, Holstein und Schleswig <strong>zu</strong>rückziehen, erlangte aber gleichzeitig die endgültige Souveränität über das<br />
Herzogtum Preußen und erwies sich während <strong>de</strong>s Krieges als militärischer und politischer Machtfaktor. Frankreich übernahm die Garantie <strong>de</strong>r Einhaltung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns.<br />
Literatur<br />
• Robert I. Frost: After the Deluge. Poland-Lithuania and the Second Northern War, 1655-1660 (= Cambridge Studies in Early Mo<strong>de</strong>rn History). Cambridge University Press, 2004,<br />
ISBN 0521544025.<br />
• Robert I. Frost: The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe 1558-1721. Longman, London 2000, ISBN 978-0-582-06429-4.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Defensiv-Vertrag von Rinsk zwischen <strong>de</strong>m westlichen Preußen und <strong>de</strong>m Herzog von Preußen<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Großfürstentum Litauen<br />
Das Großfürstentum Litauen (teilweise auch <strong>de</strong>s lateinischen Titels Magnus Dux Lithuaniae wegen als Großherzogtum Litauen bezeichnet) war ein Großherzogtum, das sich über das<br />
heutige Territorium <strong>de</strong>r Staaten Litauen und Weißrussland, und teilweise Ukraine, Russische Fö<strong>de</strong>ration und Polen erstreckte. Am Höhepunkt seiner Macht kurz vor 1400 reichte es bis <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n Steppengebieten am Schwarzen Meer. 1386 ging es eine Union mit Polen ein und vor allem nach <strong>de</strong>r Lubliner Union 1569, wo ein gemeinsamer Staat Polen-Litauen gegrün<strong>de</strong>t
wur<strong>de</strong>, verschmolz es mehr und mehr in <strong>de</strong>n polnisch dominierten Gesamtstaat. Als politische Einheit verschwand es jedoch erst im Zuge <strong>de</strong>r Polnischen Teilungen.<br />
Geschichte<br />
Erste Impulse <strong>zu</strong>r Staatsbildung gab es im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt unter <strong>de</strong>m Eindruck <strong>de</strong>r Bedrohung durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n, das Königreich Litauen unter Mindaugas blieb jedoch eine<br />
Episo<strong>de</strong>. Eine staatliche Konsolidierung erfolgte um 1300. Gediminas grün<strong>de</strong>te 1323 die Hauptstadt Wilna (lit. Vilnius), das die Burg Trakai als Fürstensitz ablöste.<br />
Der Einfall <strong>de</strong>r Mongolen in Osteuropa und die schon vorher erfolgte Zersplitterung <strong>de</strong>r Kiewer Rus hinterließen ein politisches Vakuum, <strong>zu</strong>mal Litauen aufgrund seiner nordwestlichen<br />
Lage von <strong>de</strong>n Kriegszügen <strong>de</strong>r Mongolen unberührt blieb. So erfolgte im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt, insbeson<strong>de</strong>re unter Großfürst Gediminas und seinen Söhnen Algirdas und Kęstutis, <strong>de</strong>r Aufstieg<br />
Litauens <strong>zu</strong> einer osteuropäischen Großmacht.<br />
Einige Teilfürstentümer <strong>de</strong>r Rus wur<strong>de</strong>n unterworfen, vor allem nach <strong>de</strong>r Schlacht am Irpen, einige schlossen sich in einer Schwächephase <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Hor<strong>de</strong> auch freiwillig an. 1362<br />
wur<strong>de</strong> diese in <strong>de</strong>r Schlacht am Blauen Wasser besiegt, <strong>de</strong>r litauische Großfürst zog in Kiew ein und Weißrussland, die Ukraine und Westrussland stan<strong>de</strong>n damit unter <strong>de</strong>m Supremat<br />
litauischer Großfürsten. Die politischen Strukturen <strong>de</strong>r ostslawischen Fürstentümer wur<strong>de</strong>n beibehalten, beson<strong>de</strong>rs im Sü<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n auch Vasallenfürstentümer für die Söhne Algirdas'<br />
eingerichtet. Die Großfürsten von Litauen sahen sich von nun an als rechtmäßige Erben <strong>de</strong>s untergegangenen Reiches <strong>de</strong>r Kiewer Rus. Von Algirdas ist die Absichtserklärung überliefert:<br />
„Omnis Russia ad Litwinos <strong>de</strong>beret simpliciter pertinere“ (<strong>de</strong>utsch: „Die ganze Rus soll einfach <strong>de</strong>n Litauern gehören[1]“). Die späteren polnisch-litauischen Herrscher trugen <strong>de</strong>n Titel:<br />
magnus dux Littwanie, Samathie et Rusie.<br />
Der Mehrheit <strong>de</strong>r Bevölkerung und <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls entsprechend, wur<strong>de</strong>n im Laufe <strong>de</strong>r Zeit die ostslawische Kultur im Großfürstentum dominant. Zur Kanzleisprache (also etwa Amtssprache)<br />
bil<strong>de</strong>te sich das Ruthenische aus, das bis ca. 1700 in Litauen üblich blieb.<br />
Die nach wie vor heidnischen Großfürsten betrieben in dieser Phase eine Politik religiöser Toleranz, was Litauen auch für die europäischen Ju<strong>de</strong>n sowie für zahlreiche kleinere Gruppen<br />
wie die Karäer attraktiv machte.<br />
Im Westen sahen sich die litauischen Herrscher einer ständigen Bedrohung durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n gegenüber, diese Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng konnte erst nach <strong>de</strong>m Bündnis mit Polen und<br />
<strong>de</strong>r Schlacht von Tannenberg 1410 entschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Nach<strong>de</strong>m das Großfürstentum Moskau die mongolische Fremdherrschaft um 1480 abstreifte, wur<strong>de</strong> es, da es sich gleichfalls als legitimer Nachfolger <strong>de</strong>r Kiewer Rus ansah, seit <strong>de</strong>m<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15., beson<strong>de</strong>rs aber seit Beginn <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts, <strong>zu</strong>m größten Konkurrenten Polen-Litauens bei <strong>de</strong>r „Sammlung <strong>de</strong>r russischen Er<strong>de</strong>“.<br />
Union mit Polen<br />
1386 bestieg <strong>de</strong>r litauische Großfürst Jogaila nach seiner Taufe als Władysław II. Jagiełło <strong>de</strong>n polnischen Thron, was <strong>zu</strong>r Union von Krewo führte, in <strong>de</strong>r ein Bündnis und eine<br />
Personalunion installiert wur<strong>de</strong>. Regent von Litauen wur<strong>de</strong> Jogailas Vetter Vytautas, <strong>de</strong>r aber weiterhin eine eigenständige Großmachtpolitik betrieb und unter <strong>de</strong>m Litauen seine größte<br />
Aus<strong>de</strong>hnung erreichte. Es folgten weitere Reformulierungen <strong>de</strong>r Union in <strong>de</strong>r Union von Horodło und <strong>de</strong>r Union von Vilnius und Radom. Ab ungefähr 1450 begann <strong>de</strong>r Druck Moskaus<br />
sowie <strong>de</strong>s Osmanischen Reichs <strong>zu</strong><strong>zu</strong>nehmen, welches das aus <strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Hor<strong>de</strong> entstan<strong>de</strong>ne Krimkhanat unter seine Oberhoheit bringen konnte. Das erfor<strong>de</strong>rte ein immer<br />
engeres Zusammengehen <strong>de</strong>r Bündnispartner. Die in <strong>de</strong>n vorigen Verträgen formulierte Personalunion wur<strong>de</strong> 1569 in <strong>de</strong>r Lubliner Union <strong>zu</strong> einer Realunion erweitert, <strong>de</strong>ren Ergebnis <strong>de</strong>r<br />
Polnisch-Litauische Doppelstaat (mo<strong>de</strong>rn lit. Žečpospolita („Gemeinwesen“) o<strong>de</strong>r Abiejų tautų respublika, („Republik bei<strong>de</strong>r Völker“)) war. Dabei trat Litauen allerdings seine Territorien<br />
in <strong>de</strong>r heutigen Ukraine an die polnische Krone ab. Die Verteidigung <strong>de</strong>r südlichen Peripherie gegen das Osmanische Reich und ihre Vasallen, die Krimtataren, betraf nun <strong>de</strong>n polnischen<br />
Reichsteil.<br />
Mit <strong>de</strong>r im Zug <strong>de</strong>r Union erfolgten Vereinigung <strong>de</strong>s polnischen und litauischen A<strong>de</strong>ls in einem gemeinsamen Sejm, <strong>de</strong>r im Lauf <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts immer mehr <strong>zu</strong>m Schwerpunkt <strong>de</strong>r<br />
Politik wur<strong>de</strong>, begann die Eigenständigkeit <strong>de</strong>s Großfürstentums Litauen <strong>zu</strong>r bloßen Formalität <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n. Es gab jedoch bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts eigene Institutionen.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re war das polnische Krontribunal für Litauen nicht <strong>zu</strong>ständig, es gab in Hrodna ein eigenes Litauisches Tribunal. Erst mit <strong>de</strong>r Verfassung vom 3. Mai 1791 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Dualismus zwischen Polen und Litauen und damit indirekt das Großfürstentum abgeschafft; sie konnte in <strong>de</strong>r kurzen Zeit bis <strong>zu</strong>m Untergang <strong>de</strong>s Gesamtstaates insgesamt aber keine
Wirkung mehr entfalten.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ A. Kappeler: Kleine Geschichte <strong>de</strong>r Ukraine, München, C. H. Beck 1994, S. 43<br />
Literatur<br />
• Mathias Niendorf: Das Großfürstentum Litauen. Studien <strong>zu</strong>r Nationsbildung in <strong>de</strong>r Frühen Neuzeit (1569-1795). Harrassowitz Verlag, Wiesba<strong>de</strong>n 2006, ISBN 3-447-05369-0,<br />
(Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Nordost-Instituts 3), (Zugleich: Kiel, Univ., Habil.-Schr., 2003).<br />
• Grigorijus Potašenko (Hrsg.): The Peoples of the Grand Duchy of Lithuania. Aidai, Vilnius 2002, ISBN 9955-445-52-1.<br />
• S. C. Rowell: Lithuania Ascending. A Pagan Empire within East-Central Europe 1295-1345. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1994, ISBN 0-521-45011-X,<br />
(Cambridge studies in medieval life and thought 4th Series, 25).<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Schlacht bei Orscha (1514)<br />
Die Schlacht bei Orscha ereignete sich am 8. September 1514 nahe <strong>de</strong>r Stadt Orscha im heutigen Weißrussland im Zuge <strong>de</strong>s Russisch-Litauischen Krieges 1512–1522. Die Streitkräfte <strong>de</strong>s<br />
Großfürstentums Litauen, durch die Polnisch-Litauische Union mit <strong>de</strong>m Königreich Polen verbün<strong>de</strong>t, besiegten unter <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s Großhetmans von Litauen, Fürst Konstanty<br />
Ostrogski das Heer <strong>de</strong>s Großfürstentums Moskau unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Stallmeisters Iwan Tscheljadnin.<br />
Den Litauern[7] und Polen[8] gelang die Einnahme <strong>de</strong>s russischen Lagers sowie die Gefangennahme vieler russischen Wür<strong>de</strong>nträger und Kommandanten. Trotz <strong>de</strong>s taktischen Sieges<br />
blieb die strategische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Schlacht äußerst gering, da das Ziel <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Feld<strong>zu</strong>gs, die Rückeroberung von einen Monat <strong>zu</strong>vor an Moskau verlorengegangenem<br />
Smolensk, nicht erreicht wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Hintergrund<br />
Zwischen <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen und <strong>de</strong>m Großfürstentum Moskau gab es bereits seit langer Zeit eine ausgeprägte Rivalität, die in zahlreichen Konflikten mün<strong>de</strong>te, die als<br />
Russisch-Litauische Kriege bekannt sind. Bei<strong>de</strong> Staaten beanspruchten für sich das Erbe <strong>de</strong>r Kiewer Rus und waren mit <strong>de</strong>m „Sammeln <strong>de</strong>r russischen Er<strong>de</strong>“ beschäftigt[9]. Litauen hatte<br />
<strong>zu</strong>vor aus <strong>de</strong>r Verwüstung <strong>de</strong>r Rus durch die Mongolen einen Vorteil gezogen und nach und nach <strong>de</strong>n Westen <strong>de</strong>r ehemaligen Rus unter seine Herrschaft gebracht (siehe Schlacht am<br />
Irpen). In <strong>de</strong>r Folge bestand <strong>de</strong>r Großteil seiner Einwohner aus orthodoxen Slawen, die jedoch von einer <strong>zu</strong>nächst heidnischen baltischen Elite beherrscht wur<strong>de</strong>n, welche bald <strong>zu</strong>m<br />
polnischen Katholizismus übertrat. Im freien Teil <strong>de</strong>r Rus erfolgte hingegen eine Konsolidierung rund um das Großfürstentum Moskau, <strong>de</strong>ssen rurikidischen Herrscher bald auch<br />
russische (ostslawische) Gebiete im Großfürstentum Litauen <strong>zu</strong>rück beanspruchten.[10]
In <strong>de</strong>n vorausgegangenen drei Kriegen zeichnete sich ein Übergewicht Moskaus ab, das sich von <strong>de</strong>r Oberherrschaft <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Hor<strong>de</strong> befreit hatte. Durch die Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r<br />
Schlacht von Wedroscha verlor Litauen auch <strong>de</strong> jure ein Drittel seines Staatsgebiets an <strong>de</strong>n Moskauer Großfürsten Iwan III.. Die orthodoxen Feudalherren begannen bereits <strong>zu</strong>vor wegen<br />
ihrer Benachteiligung gegenüber <strong>de</strong>n Katholiken massenhaft <strong>de</strong>m Moskauer Großfürst Treueeid <strong>zu</strong> leisten und mit ihren Län<strong>de</strong>reien über<strong>zu</strong>laufen.[11]<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen im Vorfeld <strong>de</strong>r Schlacht<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres 1512 begann ein neuer Krieg zwischen Moskau und Litauen. Unmittelbarer Anlaß war die Verhaftung <strong>de</strong>r russischstämmigen litaischen Großfürstin Helena von<br />
Moskau in Wilno, die als Schutzherrin <strong>de</strong>r Orthodoxen in Litauen auftrat und eine Schwester von Wassili III. war. Ein zweiter Grund war <strong>de</strong>r neue Vertrag zwischen Litauen und <strong>de</strong>m<br />
Krimkhanat, nach <strong>de</strong>m Litauen die Krimtataren für Überfälle auf <strong>de</strong>n Moskauer Staat bezahlte.[12]<br />
Die Festung Smolensk bil<strong>de</strong>te nach ihrer Eroberung vor rund 100 Jahren <strong>de</strong>n wichtigsten östlichen Vorposten <strong>de</strong>r Jagiellonen. Sie wehrte erste russische Belagerungen <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>r<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen 1512[13] und 1513[14] erfolgreich ab. 1514 ließ Großfürst Wassili III. ein 42.000 Mann starkes Invasionsheer[15] mit bis <strong>zu</strong> 300 Kanonen[16] unter <strong>de</strong>r Führung<br />
<strong>de</strong>r Fürsten Glinski und Schtschenja gegen Smolensk in Marsch setzen. Die Russen begannen am 17. März[17]mit <strong>de</strong>r Belagerung <strong>de</strong>r Stadt, während das Smolensker Umland durch<br />
Streifzüge <strong>de</strong>r Nowgoro<strong>de</strong>r Statthalter Schujski und Morosow gebrandschatzt wur<strong>de</strong>. Großfürst Wassili erschien persönlich im Juli vor Smolensk und ließ die Festung am 29. Juli[18]<br />
durch seine Artillerie beschießen.<br />
Am 30. Juli 1514 fiel Smolensk schließlich durch <strong>de</strong>n Verrat[19] <strong>de</strong>s Garnisonskomman<strong>de</strong>urs Juri Solohub[20][21]. Knjas Glinski, ein abgefallener Vasall <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Königs<br />
mit guten Kontakten nach Litauen, überzeugte Solohub von <strong>de</strong>r Notwendigkeit <strong>de</strong>r Kapitulation. Für <strong>de</strong>n Fall eines militärischen o<strong>de</strong>r diplomatischen Erfolgs bei Smolensk aufgrund<br />
Glinskis Initiative versprach ihm <strong>de</strong>r Moskauer Großfürst, sein Han<strong>de</strong>ln mit <strong>de</strong>r Herrschaft über Stadt und Umland in Form eines russischen Erblehens <strong>zu</strong> entgelten[22][23]. Einen Tag<br />
später hielt <strong>de</strong>r russische Großfürst feierlich Ein<strong>zu</strong>g in die eingenommene Stadt[24] und ließ umgehend <strong>de</strong>n einheimischen A<strong>de</strong>l ins Innere <strong>de</strong>s Moskauer Staates umsie<strong>de</strong>ln, während auf<br />
ihren Län<strong>de</strong>reien Moskauer E<strong>de</strong>lleute angesie<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n.[25]<br />
Das Großfürstentum Moskau errang durch die Einnahme <strong>de</strong>r Stadt eine Schlüsselposition am Oberlauf <strong>de</strong>s Dnepr[26]. Die Nachricht über die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Polen und Litauer verbreitete<br />
sich über ganz Europa[27]. Durch diesen Sieg ermutigt, sandte Großfürst Wassili III. Anfang August mehrere getrennt voneinan<strong>de</strong>r operieren<strong>de</strong>n Truppenverbän<strong>de</strong> ins Grenzgebiet <strong>de</strong>s<br />
Großfürstentums Litauen und <strong>zu</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Städte Krytschau, Mstsislaw und Dubrouna. Ihre Gesamtstärke wird von mo<strong>de</strong>rnen Forschern auf maximal 12.000 geschätzt.[28][29][30]<br />
Ältere Quellen, die sich auf glorifizieren<strong>de</strong> Siegesschriften <strong>de</strong>s polnischen Königs an <strong>de</strong>n Papst berufen, sprechen von einem Invasionsheer von 80.000 Mann.[31]<br />
Während<strong>de</strong>ssen sammelte <strong>de</strong>r polnische König und litauische Großfürst Sigismund seine Truppen für die Rückeroberung von Smolensk unter <strong>de</strong>m Kommando von Fürst Konstanty<br />
Ostrogski. Die litauische Armee wird von <strong>de</strong>n Historikern auf 7.000 geschätzt.[32] Auf <strong>de</strong>r polnischen Seite ignorierte ein Großteil <strong>de</strong>r Szlachta <strong>zu</strong>nächst die Mobilmachung, nur mit<br />
Mühe und Not konnten bis August 9.000 Mann[33][5] in Minsk <strong>zu</strong>sammengestellt wer<strong>de</strong>n. Die bei<strong>de</strong>n Armeen beinhaltete auch Söln<strong>de</strong>r aus Westeuropa. Sigismund besaß eine gut<br />
ausgebil<strong>de</strong>te und schwer gerüstete Kavallerie nebst einer Militäringenieureinheit[34] und Artillerie.[35] König Sigismund stieß mit seinem Heer bis Baryssau vor. Er blieb in <strong>de</strong>r Stadt<br />
und ergänzte die Garnison mit bis <strong>zu</strong> 4.000 Mann[36]. Das restliche Heer zog unter <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s Fürsten Ostrogski Richtung Orscha, wo am 27. August[37] bereits erste<br />
Scharmützel an <strong>de</strong>n Übergängen <strong>de</strong>r Flüsse Bjaresina und Drut stattfan<strong>de</strong>n. Die Gesamtstärke <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Heeres bei Orscha kam somit ebenfalls auf etwa 12.000 Mann.[5]<br />
Die Truppen <strong>de</strong>s Moskauer Großfürsten rückten nach <strong>de</strong>r vorherigen Sicherung <strong>de</strong>r eroberten Städte (Smolensk, Mstsislaw, Krytschau, Dubrouna etc.) unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Konjuschis<br />
Iwan Tscheljadnin mit bis <strong>zu</strong> 12.000 Mann in die Gegend um Wizebsk zwischen Orscha und Dubrouna am Fluss Kropiwna vor[38], wo sie ihr Lager aufschlugen. Laut Weisung <strong>de</strong>s<br />
Großfürsten sollten sie vorerst nur die Bewegungen <strong>de</strong>r feindlichen Truppen observieren, was allerdings aufgrund von Meinungsverschie<strong>de</strong>nheiten zwischen <strong>de</strong>n Komman<strong>de</strong>uren<br />
Tscheljadnin und Knjas Bulgakow-Goliza völlig missachtet wur<strong>de</strong>. Tscheljadnin vertrat die Ansicht, die polnisch-litauischen Truppen müssten <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st eine <strong>de</strong>r zwei Brücken über <strong>de</strong>n<br />
Dnepr überqueren, um ihn <strong>zu</strong> stellen. Folglich teilte er seine Streitkräfte, um jene Übergänge <strong>zu</strong> sichern. Jedoch setzte die Armee <strong>de</strong>s Großhetmans einige Kilometer nördlich <strong>de</strong>r<br />
erwähnten Brücken in <strong>de</strong>r Nacht vom 7. <strong>zu</strong>m 8. September, ca. fünf Kilometer östlich von Orscha, mit zwei Pontonbrücken sowie einer Furt gegenüber <strong>de</strong>m Dorf Paschino auf das<br />
südliche Ufer über, was von sporadischen Verhandlungen mit <strong>de</strong>r russischen Seite getarnt wur<strong>de</strong>.<br />
Der polnische Teil <strong>de</strong>r verbün<strong>de</strong>ten Streitmacht sich aus Infanterie, leichter und schwerer Kavallerie sowie Artillerie <strong>zu</strong>sammen und wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Hetmanen Świerczowski und<br />
Sampoliński befehligt. Das Kommando über die 12.000 Mann <strong>de</strong>r litauisch-ruthenischen Reiter unterstan<strong>de</strong>n teils <strong>de</strong>m Kiewer Wojewo<strong>de</strong>n Radziwiłł, teils direkt <strong>de</strong>m Oberkomman<strong>de</strong>ur
Ostrogski.<br />
Aufstellung <strong>zu</strong>r Schlacht<br />
Um neun Uhr morgens stand das gesamte Heer in einer Flussschlinge und war somit von drei Seiten vom Wasser umgeben. Seine Aufstellung folgte <strong>de</strong>r sogenannten altpolnischen<br />
Tradition, die <strong>zu</strong>m Ziel hatte, die gegnerische Hauptstreitmacht im Zentrum ihrer Linien <strong>zu</strong> bin<strong>de</strong>n, um sie anschließend mit Hilfe <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n Flanken stationierten schweren polnischen<br />
Kavallerie <strong>zu</strong> zerschlagen.<br />
Das Zentrum <strong>de</strong>r polnisch-litauischen Formation bil<strong>de</strong>te in vor<strong>de</strong>rster Linie das Fußvolk inklusive eines Teils <strong>de</strong>r Artillerie[39]. Die Infanterieformation mit <strong>de</strong>r Artillerie stand mittig<br />
zwischen Reiterkontingenten polnischer Kavallerie unter Sampoliński an ihrer linken Flanke, während an ihrer rechten in gleicher Mannstärke die Litauer und Ruthenen unter Ostrogski<br />
stan<strong>de</strong>n. Am linken Flügel, etwas hinter Sampoliński, stand Świerczowski mit seiner schweren polnischen Kavallerie, während sich hinter Ostrogski das Heer <strong>de</strong>s Radziwiłł befand. Bei<strong>de</strong><br />
Flügel wur<strong>de</strong>n jeweils durch eine Kavalleriereserve aus leichter polnischer und litauischer Kavallerie <strong>zu</strong>sätzlich gestärkt. Die übrige Infanterie verbarg sich mit <strong>de</strong>m größten Teil <strong>de</strong>r<br />
Artillerie im Bereich eines Hohlwegs in waldiger Gegend. Es hat <strong>de</strong>n Anschein, dass Ostrogski mit einem massiven Vorstoß <strong>de</strong>r russischen Truppen in diesen Bereich rechnete und<br />
frühzeitig Gegenmaßnahmen traf.<br />
Die Moskowitische Armee, bestehend aus fünf Regimentern (Polks)[40], wur<strong>de</strong> in einer traditionellen Schlachtformation aufgestellt. In <strong>de</strong>r Mitte das Große Polk unter <strong>de</strong>r Führung<br />
Tscheljadnins. Vor ihm stellte sich in einer breiten Formation das Regiment <strong>de</strong>s Wojewo<strong>de</strong>n Rostowski auf. Auf <strong>de</strong>r rechten Seite stand ein Polk <strong>de</strong>s Knjas Bulgakow-Galitzin, auf <strong>de</strong>r<br />
linken das Regiment unter Knjas Obolenski. Die Reserve stand in <strong>de</strong>n hinteren Reihen unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Wojewo<strong>de</strong>n Tscheljadin-Dawydow.<br />
Die Schlacht<br />
Am 8. September 1514, um die Mittagszeit, erteilte Tscheljadnin <strong>de</strong>n Befehl <strong>zu</strong>m Angriff[41]. Bulgakow-Goliza griff mit seinem Regiment vom rechten Flügel als erster an und versuchte<br />
<strong>de</strong>n Feind an seiner polnischen linken Flanke <strong>zu</strong> umfassen[42]. Ihm stellte sich, ohne Ostrogskis Angriffsbefehl ab<strong>zu</strong>warten, Sampoliński mit seinen Reitern entgegen. Er wur<strong>de</strong> durch die<br />
überlegene Angriffswucht <strong>de</strong>s Gegners überrascht, sodass er sich auf seine Ausgangsposition <strong>zu</strong>rückzog. Unter <strong>de</strong>n Verluste <strong>de</strong>r Polen befan<strong>de</strong>n sich Vertreter alter A<strong>de</strong>lsgeschlechter wie<br />
Zborowski und Slupecki. Unterstützt von <strong>de</strong>r leichten Kavallerie von Jan Tarnowski versuchte Sampoliński zwei Mal erfolglos einen Gegenangriff. Erst die schwere Kavallerie von<br />
Świerczowski zerstreute das gegnerische Regiment völlig. Die Kernstreitmacht <strong>de</strong>s Polks warf sie <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>n Rest drängte sie Richtung <strong>de</strong>s Dnepr ab[42]. Derart in die Zange<br />
genommen, erhielt Bulgakow-Goliza keinerlei Entlastung durch die an<strong>de</strong>ren russischen Truppenteile. Laut <strong>de</strong>m Chronisten Herberstein lag die Ursache für das Ausbleiben von<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ng in einer persönlichen Feh<strong>de</strong> zwischen Bulgakow-Goliza und <strong>de</strong>m Oberbefehlshaber Tscheljadnin.[43] Derartige Feh<strong>de</strong>n, die sich um die Rangordnung und Ehre <strong>de</strong>s<br />
Geschlechter han<strong>de</strong>lten, behin<strong>de</strong>rten die russische Kriegsführung lange Zeit bis ins 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein.<br />
Gleichzeitig griff das das „Regiment <strong>zu</strong>r linken Hand“ <strong>de</strong>s Fürsten Pronski die rechte litauisch-ruthenische Flanke unter Ostrogski an. Tscheljadnin entschied, seine Offensive durch einen<br />
Teil seines Polks und das „vor<strong>de</strong>ren Regiment“ von Temka-Rostowski <strong>zu</strong> verstärken. Ostrogski befahl seinen Truppen <strong>de</strong>n Geordneten Rück<strong>zu</strong>g in Richtung <strong>de</strong>s Hohlwegs, wo ein Teil<br />
<strong>de</strong>r polnisch-litauischen Infanterie und fast die gesamte Artillerie aufgestellt waren[44]. Die Kriegslist gelang <strong>de</strong>m ruthenischen Fürsten. Die russische Kavallerie verkannte die Lage und<br />
folgte Ostrogskis Truppen in <strong>de</strong>n engen Hohlweg in Richtung <strong>de</strong>s Dnepr. Die nachstoßen<strong>de</strong>n Russen gerieten hier unter schweren Beschuss aus Handbüchsen und Falkonetten. Eine<br />
Artilleriekugel tötete <strong>de</strong>n Wojewo<strong>de</strong>n Temka-Rostowski, ebenso kam Knjas Obolenski ums Leben und das russische Heer, bestehend aus zwei Polks mitsamt <strong>de</strong>r Reserven, wur<strong>de</strong> im<br />
dichten Schlachtengedränge stark <strong>de</strong>zimiert[42].<br />
Die Vernichtung <strong>de</strong>r Regimenter Rostowski und Obolenski leitete <strong>de</strong>n Untergang <strong>de</strong>r russischen Armee ein. Ostrogski ging <strong>zu</strong>m Generalangriff über und stellte seine Truppen mit <strong>de</strong>r<br />
Reserve <strong>de</strong>m Großen Polk Tscheljadnins entgegen. Im Zentrum erlitten die Russen in <strong>de</strong>r Folge schwere Verluste. Tscheljadnin konnte nur mit Mühe die hintere Reserve Dawydows<br />
erreichen, wohin alsbald auch die schwere polnische Kavallerie Świerczowskis und die Einheiten Radziwiłłs vordrangen und die russischen Streitkräfte zerschlugen[42].<br />
Polnische und litauische Kavallerie verfolgte die sich ungeordnet <strong>zu</strong>rückziehen<strong>de</strong>n Russen bis <strong>zu</strong>m Fluss Krapiuna (Kropiwna), vier Kilometer vom Schlachtort entfernt, wo viele <strong>de</strong>r<br />
Flüchten<strong>de</strong>n ertranken[45]. Gegen Abend (ca. 18 Uhr) waren die Kampfhandlungen weitgehend been<strong>de</strong>t, allerdings dauerte die Verfolgung zersprengter russischer Einheiten noch bis in<br />
die Mitternacht[42][46].
Falsifizierte Daten<br />
Der polnisch-litauische Monarch Sigismund suchte politischen Nutzen mit Mitteln einer europaweiten Propaganda aus <strong>de</strong>m Sieg seines Heerführers Ostrogski <strong>zu</strong> ziehen. In seinen Briefen<br />
an <strong>de</strong>n Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns schrieb er, dass sich die Verluste <strong>de</strong>r Russen auf ca. 30.000 Mann beliefen, während ihre Gesamtstärke ca. 80.000 Mann betragen haben soll.<br />
[47] In seiner Siegesschrift an <strong>de</strong>n römischen Papst behauptete er, dass unter <strong>de</strong>r russischen Verlusten 16.000 Mann tot waren und 14.000 in Gefangenschaft.[48] Sigismund legte nach,<br />
in<strong>de</strong>m er die Russen als Nicht-Christen und Asiaten bezeichnete, die im Bund mit Türken und Tataren danach trachteten, das Christentum <strong>zu</strong> zerstören.[49]<br />
Auf diese Schriften berufen sich unkritisch auch zahlreiche polnische Quellen <strong>de</strong>s 19. und teilweise 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Mo<strong>de</strong>rne Quellen, die sich mit <strong>de</strong>r Mobilisationsfähigkeit <strong>de</strong>s<br />
Moskauer Staates <strong>zu</strong> dieser Zeit beschäftigen, reduzieren die mögliche Armeestärke <strong>de</strong>r Russen und <strong>de</strong>mentsprechend auch die möglichen Verluste <strong>de</strong>utlich. Auch <strong>de</strong>r polnische Historiker<br />
Tomasz Bohun bezeichnet die Zahlen von König Sigismund als nicht vertrauenswürdig.[50] Laut polnisch-litauischen Dokumenten wer<strong>de</strong>n nur 611 Gefangene <strong>de</strong>r russischen Aristokratie<br />
namentlich erwähnt.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz war diese Nie<strong>de</strong>rlage für die Russen sehr empfindlich. Zahlreiche oberste Heerführer gerieten in Gefangenschaft, darunter Iwan Tscheljadnin, Michail Bulgakow-Goliza,<br />
Iwan Pronski. Die Woiwo<strong>de</strong>n Temka-Rostowski und Andrei Obolenski wur<strong>de</strong>n getötet.<br />
Folgen<br />
Die Armee <strong>de</strong>s Ostrogskis setzte die Verfolgung <strong>de</strong>r Russen fort und nahm die meisten durch die Russen eroberten Festungen (Krytschau, Dubrouna, Mstsislaw) ein, jedoch waren die<br />
polnisch-litauischen Kräfte <strong>zu</strong> erschöpft, um Smolensk noch vor <strong>de</strong>m Winter <strong>zu</strong> belagern. Ostrogski erreichte die Tore von Smolensk erst gegen En<strong>de</strong> September mit etwa 6.000 Mann.<br />
Das späte Eintreffen <strong>de</strong>r Alliierten verhin<strong>de</strong>rte eine Rückeroberung von Smolensk, da Großfürst Wassili die Verteidigung <strong>de</strong>r Festung direkt nach <strong>de</strong>r Schlacht vorbereiten ließ. Eine noch<br />
1514 erfolgte, allerdings erfolglose, Erhebung mit <strong>de</strong>m Ziel eines Abfalls <strong>de</strong>r Smolensker Bevölkerung vom Moskauer Staat Richtung Polen-Litauen, wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n russischen<br />
Statthalter, Fürst Wassili Schuiski, bereits im Keimstadium erstickt. Die Konspiranten hängte man an <strong>de</strong>r Stadtmauer auf, <strong>de</strong>n Anführer <strong>de</strong>s Aufstands, <strong>de</strong>n orthodoxen Bischof<br />
Varsonophius[51], inhaftierte man in Moskau. Eine erfolgte Stürmung <strong>de</strong>r Festung durch die Truppen <strong>de</strong>s Ostrogskis wehrte Schuiski siegreich ab. Da die Schar <strong>de</strong>r Belagerer <strong>zu</strong> einer<br />
dauerhaften Belagerung <strong>zu</strong> schwach war, musste sie sich nach Litauen in die Winterquartiere <strong>zu</strong>rückziehen[52]. Somit wur<strong>de</strong> das ursprüngliche Ziel <strong>de</strong>s litauisch-polnischen Feld<strong>zu</strong>gs, die<br />
Wie<strong>de</strong>reinnahme Smolensk, verfehlt. Die strategische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Schlacht bei Orscha erwies sich als gering.<br />
Dennoch marschierte Ostrogski, <strong>de</strong>n man nach <strong>de</strong>r Schlacht auch „Scipio Ruthenus“[53]rief, im Dezember 1514 triumphierend in Wilno ein und wur<strong>de</strong> von Polen und Litauern als Held<br />
gefeiert[54]. Um <strong>de</strong>s Sieges <strong>zu</strong> ge<strong>de</strong>nken, wur<strong>de</strong> ihm das Privileg erteilt in Wilno, <strong>de</strong>r katholischen Hauptstadt <strong>de</strong>s Großfürstentums, zwei orthodoxe Kirchen <strong>zu</strong> bauen[55]: die Kirche <strong>de</strong>r<br />
Heiligen Dreifaltigkeit und die Kirche von Heiligem Nicholas, die <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n eindrucksvollsten Beispielen <strong>de</strong>r orthodoxen Kirchenarchitektur in Litauen gehören.<br />
Die Schlacht hatte für <strong>de</strong>n Verlierer keine territorialen Konsequenzen[56], sie min<strong>de</strong>rte allerdings das Ansehen <strong>de</strong>s Moskauer Großfürsten als potenziellen Verbün<strong>de</strong>ten und steigerte das<br />
Prestige <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Königtums [57]. Im Anschluss an die Schlacht verließ <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche Kaiser Maximilian I. einseitig das <strong>de</strong>utsch-russische Bündnis, allerdings<br />
griff er bereits vor <strong>de</strong>r Schlacht nicht wie abgesprochen das polnische Königreich an. Er hatte Angst, <strong>de</strong>r polnische König wür<strong>de</strong> mit seinem Schwager, <strong>de</strong>m ungarischen Magnaten Johann<br />
Zápolya, <strong>de</strong>r im gleichen Jahr über <strong>de</strong>n Bauernaufstand <strong>de</strong>s György Dózsa obsiegte, ihre bei<strong>de</strong>n siegreichen Heere gegen ihn, als Anstifter dieser Kriege, vereinen. Er bat <strong>de</strong>n böhmischungarischen<br />
König Vladislav II., <strong>de</strong>n älteren Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s polnischen Königs Sigismund, eine Aussöhnung und Allianz mit Krakau <strong>zu</strong> vermitteln[58]. Die militärische Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r<br />
russischen Seite wird von Historikern Iwan Tscheljadnin und Fürst Bulgakow-Goliza <strong>zu</strong>geschrieben, da sie in ihrer Uneinigkeit nicht in <strong>de</strong>r Lage waren, ihre Streitmacht gemeinsam<br />
erfolgreich <strong>zu</strong> koordinieren[54]. Sie kam für <strong>de</strong>n Moskauer Staat einer „Elitenkatastrophe“ gleich[59], <strong>zu</strong><strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> durch Schwächung <strong>de</strong>r Offensivkraft <strong>de</strong>r russischen Westexpanison<br />
gegen Litauen bis etwa 1563[60] Grenzen gesetzt. Die Schlacht bei Orscha konnte allerdings die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n strategisch-territorialen Resultate <strong>de</strong>r vorhergehen<strong>de</strong>n Schlacht an <strong>de</strong>r<br />
Wedroscha <strong>de</strong>s Jahres 1500 (Moskowitisch-Litauischer Krieg 1500–1503) nicht revidieren.<br />
Der Krieg zwischen <strong>de</strong>m Großfürstentum Litauen und <strong>de</strong>m Großfürstentum Moskau setzte sich in einem Grenzkrieg aus gegenseitigen Raubzügen ohne eine Entscheidungsschlacht bis<br />
1522 fort. Er en<strong>de</strong>te im Vertrag von Moskau, <strong>de</strong>r einen <strong>zu</strong>nächst auf fünf Jahre begrenzten Waffenstillstand[61]bei<strong>de</strong>n Seiten auferlegte, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m hatte Litauen auf Basis Uti possi<strong>de</strong>tis auf<br />
bis <strong>zu</strong> ein Drittel seiner ruthenischen Gebiete einschließlich Smolensk <strong>zu</strong> verzichten.
Literatur<br />
Quellen<br />
• Die Schlacht wur<strong>de</strong> von Siegmund von Herberstein in seinem Rerum Moscoviticarum Commentarii beschrieben („Kommentare über die Russen Angelegenheiten“, 1549).<br />
• Piso, Jacob: Epistola Pisonis ad Ioannem Coritium, <strong>de</strong> conflictu Polonorum et Lituanorum cum Moscovites. In Ianus Damianus, Iani Damiani Senensis ad Leonem X. Pont. Max.<br />
<strong>de</strong> expeditione in Turcas Egegia (Basel, bei Ioannes Frobenius, 1515).<br />
• Piso, Jacob: Die Schlacht von <strong>de</strong>m Kunig von Poln und mit <strong>de</strong>m Moscowiter, S.l., 1514.<br />
• Bielski, Marcin: Kronika polska (Polnische Chronik <strong>de</strong>s Marcin Bielski).<br />
Sekundärliteratur<br />
• Schlözer, August Ludwig: Allgemeine Welthistorie, Ausg. 50, Johann Jacob Gebauer Verlag, Halle 1785, S. 232−237.<br />
• Schulz, A.: Über ein Gemäl<strong>de</strong> wahrscheinlich von Georg Preu (polnische Schlacht aus <strong>de</strong>m Anfänge <strong>de</strong>s 16. Jh.) in Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Bd. 3, 1877, S.180.<br />
• Caro, Jakob: Die Schlacht bei Orsza 1514 (nach <strong>de</strong>m grossen Bil<strong>de</strong> im Museum Schlesischer Altertümer), in Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Bd. 3, 1879, S. 345−353.<br />
• Müller, Heinrich, Kunter, Fritz: Europäische Helme aus <strong>de</strong>r Sammlung <strong>de</strong>s Museums für Deutsche Geschichte, Militärverlag <strong>de</strong>r DDR, Berlin 1971, S. 92−93.<br />
• Sach, Maike: Hochmeister und Großfürst - Die Beziehungen zwischen <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n in Preußen und <strong>de</strong>m Moskauer Staat um die Wen<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Neuzeit, Quellen und<br />
Studien <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Östlichen Europa (SGO),Franz Steiner Verlag Wiesba<strong>de</strong>n GmbH, Band 62, 1. Auflage 2002, ISBN 3515080473.<br />
• Stryjkowski, Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, Bd. 2, Stanisław Strąbski Verlag, Warszawa 1846, S. 381−388.<br />
• Dróżdż, Piotr: Orsza 1514, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, ISBN 9788311091344.<br />
Einzelnachweise und Anmerkungen<br />
1. ↑ In Westeuropa durch polnische Vermittlung Moskowiter genannt<br />
2. ↑ Лобин А.Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 111-112><br />
3. ↑ Brian Davies: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.120-121.<br />
4. ↑ Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.104-119<br />
5. ↑ a b c d Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.45-78<br />
6. ↑ Icon Group International, Inc.: Attackers, San Diego/USA 2008, S. 204; Ta<strong>de</strong>usz Korzon, Bronisław Gembarzewski: Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Ausg. 2, Krakau-<br />
Lemberg-Warschau 1923; Laut Alexan<strong>de</strong>r von Bronikowski: Die Geschichte Polens, Bd. 2, Dres<strong>de</strong>n 1827, S. 50: bis <strong>zu</strong> 500 Kanonen, die er als „Stücke“ beschreibt<br />
7. ↑ Den litauischen Truppen, die sich aus ethnischen Litauern und Ruthenen [Weißrussen, Ukrainer etc.] <strong>zu</strong>sammensetzten<br />
8. ↑ Unter <strong>de</strong>n Polen waren auch tschechische und <strong>de</strong>utsche Kontingente<br />
9. ↑ Peter Nitsche, Eckhard Hübner: Zwischen Christianisierung und Europäisierung, Stuttgart 1998, S. 91<br />
10.↑ Hermann Wiesflecker: Kaiser Maximilian I., Bd. 1, Köln 1971, S. 311-312<br />
11.↑ В.В. Каргалов: Конец ордынского ига. М.: Наука, 1980<br />
12.↑ Nikolai Karamsin: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates. Band 7, Kapitel 11<br />
13.↑ Laut Philipp Strahl und Ernst Herrmann in Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, S.18 …war <strong>de</strong>r Casus belli unter an<strong>de</strong>rem eine geheime Allianz zwischen König Sigismund und<br />
Meñli I. Giray, <strong>de</strong>m Khan <strong>de</strong>r Krim. Laut [Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów, 6 Auflage, Warschau 1992, S. 315-316] ließ <strong>de</strong>r Khan nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Wiśniowiec 1512, in<br />
<strong>de</strong>r eine große Tatarenrazzia durch Ostrogski und Kamieniecki vernichtet wur<strong>de</strong> [laut Chambers's encyclopaedia, unter Sigismund, S. 715, fan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bis <strong>zu</strong> 27.000
Krimtataren und ihre Verbün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n Tod], gegen polnische Tribute mit <strong>de</strong>m Titel eines „Upominek“ (wörtlich An<strong>de</strong>nken, hier als „Geschenk“ gemeint) in Höhe von 15.000<br />
Złoty, das Moskauer Gebiet [Rjasan mit Umland] mit Razzien verheeren [die polnisch-krimtatarische Allianz hielt bis etwa 1519, dann wechselte <strong>de</strong>r Khan erneut die Seiten]. Die<br />
erste Belagerung begann etwa im November 1512 [die Autoren erwähnen nicht das genaue Datum, nur dass <strong>de</strong>r Großfürst im Dezember erschien]. Der Großfürst erschien am 19.<br />
Dezember persönlich vor Smolensk, sah sich jedoch aufgrund von Überschwemmungen <strong>de</strong>s Dneprs, <strong>de</strong>r die Kommunikation und Zufuhr erschwerte, <strong>zu</strong>m Ab<strong>zu</strong>g im März 1513<br />
genötigt<br />
14.↑ Philipp Carl Strahl, Ernst Herrmann: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, Ausg. 3, 1832, S. 18, begann die zweite Belagerung im September <strong>de</strong>s Jahres 1513 und wur<strong>de</strong> aufgrund<br />
<strong>de</strong>s schlechten Herbstwetters bereits nach sechs Wochen abgebrochen<br />
15.↑ Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVIв. // Российское государство в XIV – XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня<br />
рождения Ю.Г. Алексеева. — СПб.: 2002. — С. 77.<br />
16.↑ Laut Stryjkowski, Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, Bd. 2, S. 377; Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje narodu polskiego, S. 91<br />
17.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 232: 17. März 1514<br />
18.↑ Philipp Strahl, Ernst Herrmann: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, S.19<br />
19.↑ Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje narodu polskiego, S. 91; Meyers Konversationslexikon: Glinski, Michael, S. 435; Norman Davies: God's Playground: The origins to 1795,<br />
Oxford 2005, S. 114<br />
20.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 233: Solohub<br />
21.↑ Jerzy Hrycyk, Józef Buszko, Walter Leitsch, Stanisław Dzida: Österreich Polen, S. 35, 1996; Sigmund von Herberstein, Wolfram von <strong>de</strong>n Steinen, Paul König, Walter Leitsch:<br />
Das alte Russland, S. 185, 1984; Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów, 6 Auflage, Warschau 1992, S. 317: nur Juli<br />
22.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 233; Nach <strong>de</strong>m Fall von Smolensk, sah sich <strong>de</strong>r Großfürst Wassili hingegen nicht mehr an sein<br />
Versprechen gebun<strong>de</strong>n; Maciej Stryjkowski fasst das Verhalten <strong>de</strong>s russischen Oberhaupts indirekt als verräterische Versprechen <strong>zu</strong>sammen<br />
23.↑ Solohub, <strong>de</strong>r anfangs Wi<strong>de</strong>rstand gegen die voreilige Übergabe leistete und <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung Entsatz durch <strong>de</strong>n polnischen König versprach [Allgemeine Welthistorie von<br />
August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 233], aber nach Morddrohungen durch die lokalen Wür<strong>de</strong>nträger gegen seine Person <strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r prorussischen Konspiranten<br />
nachgegeben hatte, wur<strong>de</strong> laut [Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów, 6 Auflage, Warschau 1992, S. 317] für seine Entscheidung später angeklagt und hingerichtet<br />
24.↑ Hermann Aubin: Geschichtliche Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> und Universalgeschichte, S. 170, 1950<br />
25.↑ Laut Stryjkowski, Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, Bd. 2, S. 387…gab Großfürst Wassili <strong>de</strong>n (verschleppten) Smolenskern russische Namen, <strong>de</strong>n<br />
angesie<strong>de</strong>lten Russen smolenskische<br />
26.↑ Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów, 6 Auflage, Warschau 1992, S. 317<br />
27.↑ In Rom vermutete man, das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Königreichs Polen wäre angekommen, <strong>de</strong>s Weiteren erwartete man einen Angriff seitens <strong>de</strong>utscher Staaten (Kaiser Maximilian von<br />
Habsburg im Bund mit Hochmeister Albrecht von Hohenzollern) [Paweł Jasienica: Polska Jagiellonów, 6 Auflage, Warschau 1992, S. 317] <strong>zu</strong>r Stüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r moskowitischen<br />
Offensive. Am 4. August 1514 ratifizierte Kaiser Maximilian die im Januar 1514 bei Großfürst Wassili von Russland vorgelegte Allian<strong>zu</strong>rkun<strong>de</strong>, die sich gegen König Sigismund<br />
von Polen-Litauen richtete [Maike Sach: Hochmeister und Grossfürst, S. 210, 1. Auflage 2002].<br />
28.↑ Лобин А.Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 111-112><br />
29.↑ Форум//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.120-121.<br />
30.↑ Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.104-119<br />
31.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 233 und Jerzy Samuel Bandtkie, Dzieje narodu polskiego, S. 91 unter an<strong>de</strong>rem: 80.000 Mann gegen<br />
Wilno<br />
32.↑ Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.45-78<br />
33.↑ Лобин А.Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 112.<br />
34.↑ Unter <strong>de</strong>r Leitung von Jan Baszta aus Żywiec
35.↑ Unter <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>r Nürnberger Hans Weiß und Jan Behem<br />
36.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 235; Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje narodu polskiego, S. 91<br />
37.↑ Stryjkowski, Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, Bd. 2, S. 382<br />
38.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 235<br />
39.↑ Rzeczpospolita vom 25. März 2006, Nr. 72, ORSZA ROK 1514, Bitwa pod Orszą<br />
40.↑ auf russisch Polk, Polk=Regiment; Regimenter, die in <strong>de</strong>n „Vor<strong>de</strong>ren Polk“ und Polks „<strong>zu</strong>r linker“ und „rechter Hand“ eingeteilt wur<strong>de</strong>n u. a.; fast ausschließlich leichte<br />
Kavallerie<br />
41.↑ Laut Allgemeine Encyclopädie <strong>de</strong>r Wissenschaften und Künste, S. 241, …Angriff <strong>de</strong>r Russen gegen die feindlichen Linien; Gazeta Wyborcza vom 9. September 2008,<br />
Włodzimierz Kalicki: 8 września 1514 r. Ja to wam namaluję!<br />
42.↑ a b c d e Rzeczpospolita vom 25. März 2006, Nr. 72, ORSZA ROK 1514, Przez Orszę do Europy; Gazeta Wyborcza vom 9. September 2008, Włodzimierz Kalicki: 8 września<br />
1514 r. Ja to wam namaluję!<br />
43.↑ Лобин А.Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 113-114<br />
44.↑ Laut Allgemeine Encyclopädie <strong>de</strong>r Wissenschaften und Künste, S. 241, …verstellter Rück<strong>zu</strong>g in <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Kanonen<br />
45.↑ Allgemeine Encyclopädie <strong>de</strong>r Wissenschaften und Künste, S. 241; Stryjkowski, Maciej: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi, Bd. 2, S. 386<br />
46.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 236<br />
47.↑ Acta Tomiciana III, № 232, 288, 289, 293, 295, 298, 301<br />
48.↑ Acta Tomiciana III, № 234.<br />
49.↑ Poe, Marshall T. (2001). A People Born to Slavery: Russia in Early Mo<strong>de</strong>rn European Ethnography, 1478-1748. Cornell University Press. p. 21. ISBN 0-8014-3798-9.<br />
50.↑ Bohun T. Bitwa pod Orsza 08.09.1514 // Rzeczpospolita. 2006. ¹ 4/20. S. 13.<br />
51.↑ auf Russisch Warsonofi genannt<br />
52.↑ Philipp Strahl, Ernst Herrmann: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, S. 22; Allgemeine Encyclopädie <strong>de</strong>r Wissenschaften und Künste, S. 241; Allgemeine Welthistorie von<br />
August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 237<br />
53.↑ Richard Roepell, Jakob Caro: Geschichte Polens, S. 793, 1886; Zeitschrift für osteuropäische Geschichte, S. 308, 1966; ruthenischer [weißrussisch-ukrainischer] Scipio<br />
54.↑ a b Philipp Strahl, Ernst Herrmann: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, S. 22<br />
55.↑ Philipp Strahl, Ernst Herrmann: Geschichte <strong>de</strong>s russischen Staates, S. 22; Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 237<br />
56.↑ Smolensk mit Umland blieb ab 1514 bis 1611 unter russisch-moskowitischer Herrschaft<br />
57.↑ Maike Sach: Hochmeister und Grossfürst, S. 212, 1. Auflage 2002<br />
58.↑ Allgemeine Welthistorie von August Ludwig Schlözer, Bd. 50, 1785, S. 237; Die sich unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Hauses Habsburg herausbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> antijagiellonische Liga aus<br />
<strong>de</strong>utschen Staaten im Heiligen Römischen Reich, Dänemark, Russland, <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n in Preußen und Livland, brach als Ergebnis <strong>de</strong>r Schlacht wie ein Kartenhaus in sich<br />
<strong>zu</strong>sammen<br />
59.↑ Laut Rzeczpospolita vom 25. März 2006, Nr. 72, ORSZA ROK 1514, Przez Orszę do Europy; in die Gefangenschaft geriet fast die gesamte militärische Führung <strong>de</strong>r Russen,<br />
namentlich Tscheljadnin und Bulgakow-Goliza, Vertreter etlicher Fürsten- und Bojarenhäuser, so die Ruriki<strong>de</strong>n-Fürsten <strong>de</strong>r Linien Rjasan, Jaroslawl, Smolensk und Starodub<br />
60.↑ Verlust von Polazk mit Umland nördlich <strong>de</strong>r Düna 1563 an das Zarentum Russland im Russisch-Litauischen Krieg 1562–1570<br />
61.↑ Laut Feliks Koneczny, Dzieje Rosji: gab sich Polen-Litauen mit <strong>de</strong>m Verlust von Smolensk nicht ab, folglich wur<strong>de</strong> nur ein Waffenstillstand geschlossen, <strong>de</strong>r 1527 um weitere<br />
sechs Jahre verlängert wur<strong>de</strong>; Carol Belkin Stevens: Russia's wars of emergence, 1460-1730, S. 59, 2007; Eduard Pelz: Geschichte Peters <strong>de</strong>s Grossen, S. 47
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Reiterkrieg<br />
Der Reiterkrieg von 1519 bis 1521 war <strong>de</strong>r letzte militärische Versuch <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns unter seinem letzten Hochmeister Albrecht von Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen, <strong>de</strong>n<br />
Deutschor<strong>de</strong>nsstaat in Ostpreußen von <strong>de</strong>r Vormundschaft Polens <strong>zu</strong> befreien. Im Waffenstillstand nach ergebnislosen Kämpfen wur<strong>de</strong> Albrecht Protestant, säkularisierte 1525 das Land<br />
und nahm es als erster Herzog von Preußen als Lehen von König Sigismund I. von Polen.<br />
Vorgeschichte<br />
Der Zweite Thorner Frie<strong>de</strong>n von 1466, <strong>de</strong>r die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns im Dreizehnjährigen Krieg gegen die Allianz aus Preußischer Bund und Polen besiegelte, hatte <strong>de</strong>m<br />
Or<strong>de</strong>n nicht nur empfindliche Gebietsverluste eingebracht, son<strong>de</strong>rn ihn durch die Verpflichtung <strong>zu</strong>r Heeresfolge und <strong>zu</strong>r Ableistung eines Treueei<strong>de</strong>s gegenüber <strong>de</strong>m polnischen König in<br />
ein unerträgliches Abhängigkeitsverhältnis <strong>zu</strong> Polen gebracht. Nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n 1497 von Polen gezwungen wur<strong>de</strong>, am Türkenfeld<strong>zu</strong>g teil<strong>zu</strong>nehmen, <strong>de</strong>r sich jedoch weniger gegen die<br />
Türken richtete, son<strong>de</strong>rn eher <strong>de</strong>r Erweiterung <strong>de</strong>s polnischen Herrschaftsgebietes diente, suchten die Hochmeister <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns sich aus <strong>de</strong>r Abhängigkeit von Polen <strong>zu</strong> befreien.<br />
Zunächst wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Plan <strong>de</strong>s Hochmeisters Hans von Tiefen in die Tat umgesetzt, als seine Nachfolger <strong>de</strong>utsche Reichsfürsten <strong>zu</strong> wählen, die sich <strong>de</strong>r Pflicht <strong>zu</strong>m Treueei<strong>de</strong>s leichter<br />
wi<strong>de</strong>rsetzen konnten. Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> von Tiefens wur<strong>de</strong> 1498 Herzog Friedrich von Sachsen <strong>zu</strong>m Hochmeister gewählt. Er leistete <strong>de</strong>n Treueeid nicht mehr, ebenso sein Nachfolger<br />
Markgraf Albrecht von Bran<strong>de</strong>nburg-Ansbach. Dieser versuchte dann, mit militärischen Mitteln die Regelungen <strong>de</strong>s Zweiten Thorner Frie<strong>de</strong>ns rückgängig <strong>zu</strong> machen.<br />
Der Krieg<br />
Den Kampf gegen seinen Onkel, <strong>de</strong>n polnischen König Sigismund I., begann Albrecht mit <strong>de</strong>m Überfall auf die ermländische Stadt Braunsberg am 31. Dezember 1519. Sigismund fiel<br />
daraufhin in das <strong>zu</strong>m Or<strong>de</strong>n gehören<strong>de</strong> Pomesanien ein. Während <strong>de</strong>r vierzehnmonatigen Kampfhandlungen kam es nie <strong>zu</strong> einer offenen Feldschlacht bei<strong>de</strong>r Heere, vielmehr zogen die<br />
hauptsächlich aus Söldnern <strong>zu</strong>sammengestellten Truppen zerstörend einerseits durch das Ermland und an<strong>de</strong>rerseits durch <strong>de</strong>n Südwesten <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>nlan<strong>de</strong>s. Zunächst hatte es <strong>de</strong>n<br />
Anschein, als wür<strong>de</strong>n die polnischen Truppen die Überhand gewinnen, <strong>de</strong>nn es gelang ihnen, weit in <strong>de</strong>n Nordosten fast bis nach Königsberg vor<strong>zu</strong>stoßen. Die preußischen Stän<strong>de</strong> setzten<br />
sich für einen Waffenstillstand ein. Der Hochmeister reiste im Juni 1520 <strong>zu</strong> Verhandlungen mit Sigismund nach Thorn, brach die Gespräche nach kurzer Zeit aber wie<strong>de</strong>r ab, als er erfuhr,<br />
dass eine dänische Hilfstruppe <strong>zu</strong> seiner Unterstüt<strong>zu</strong>ng aufgebrochen war. So flammten die Kämpfe wie<strong>de</strong>r auf, immer wie<strong>de</strong>r durch neue Verhandlungen unterbrochen.<br />
1520 gelang es Albrecht, mit Hilfe <strong>de</strong>utscher Fürsten ein neues 10.000 Mann starkes Söldnerheer an<strong>zu</strong>werben. Mit diesem drängte er die polnischen Streitmacht bis an die Weichsel<br />
<strong>zu</strong>rück, die sie wegen Hochwassers nicht überschreiten konnte. Er konzentrierte die ihm <strong>zu</strong>r Verfügung stehen<strong>de</strong>n Kräfte nun jedoch nicht <strong>zu</strong> einer Entscheidungsschlacht, son<strong>de</strong>rn führte<br />
Kämpfe im Ermland, wo er vergeblich versuchte, die Stadt Heilsberg ein<strong>zu</strong>nehmen.<br />
Ebenso erfolglos versuchte das Söldnerheer, Danzig <strong>zu</strong> erobern. Dann löste es sich angesichts ausbleiben<strong>de</strong>r Erfolge auf.<br />
Kriegsen<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong>nsschluss<br />
Als damit <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>r ernsthaft in Gefahr geriet und <strong>zu</strong><strong>de</strong>m eine erneute Türkeninvasion befürchtet wur<strong>de</strong>, griffen <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche Kaiser Karl V. (seit 1519 im Amt) und <strong>de</strong>r
öhmisch-ungarische König Ludwig II. <strong>zu</strong>r Befriedung <strong>de</strong>r Region in das Geschehen ein und vermittelten einen vierjährigen Waffenstillstand, <strong>de</strong>r am 21. März 1521 in Kraft trat. Den<br />
Waffenstillstand nutzte Albrecht <strong>zu</strong> einer Reise nach Deutschland, die ihn <strong>zu</strong> einer grundlegen<strong>de</strong>n Än<strong>de</strong>rung seiner Politik bewog. Auf Anraten Luthers führte er 1525 in seinem Land die<br />
Reformation ein und ließ sich im Frie<strong>de</strong>n von Krakau am 8. April 1525 von König Sigismund die weltliche Herzogswür<strong>de</strong> in Preußen verleihen. Die Schritte Albrechts schmälerten Macht<br />
und Einkünfte <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns empfindlich und wur<strong>de</strong>n we<strong>de</strong>r durch das Papsttum noch das Heilige Römische Reich anerkannt.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Wiener Fürstentag<br />
Der Wiener Fürstentag war ein politisch richtungsweisen<strong>de</strong>s Treffen europäischer Herrscher im Jahre 1515.<br />
Wichtige Teilnehmer waren Maximilian I. (Kaiser <strong>de</strong>s Heiligen römischen Reiches) aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Habsburger, sowie die Brü<strong>de</strong>r Wladislaw II. (König von Böhmen und Ungarn)<br />
und Sigismund I. (König von Polen-Litauen) aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Jagiellonen.<br />
Die politische Situation Europas war von folgen<strong>de</strong>n Ereignissen geprägt:<br />
Das Osmanische Reich (die "Türken") bedrohte durch erfolgreiche Feldzüge im Balkan und in Sü<strong>de</strong>uropa Ungarn und Österreich.<br />
Spanien, Italien, Frankreich, England und Deutschland (in Form <strong>de</strong>s HRR) stritten in wechseln<strong>de</strong>n Bündnissen um die Vorherrschaft in Europa; die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng betraf neben<br />
weltlichen Mächten auch die katholische Kirche.<br />
Durch Verhandlungen sollte eine einheitliche Politik <strong>de</strong>r osteuropäischen Mächte gegen die Bedrohung durch das Osmanische Reich erreicht wer<strong>de</strong>n. Die Verhandlungen wur<strong>de</strong>n am 22.<br />
Juli 1515 abgeschlossen, und die Frie<strong>de</strong>nsvereinbarungen wur<strong>de</strong>n durch Heiratsverträge besiegelt.<br />
Folgen für Ungarn<br />
Wichtige Vereinbarungen Ungarn betreffend waren<br />
• ein Heiratsvertrag zwischen Ludwig II. von Ungarn, <strong>de</strong>m Sohn Wladislaws, und Maria von Habsburg, einer Enkelin Maximilian I.; und<br />
• ein Heiratsvertrag zwischen Ferdinand I., <strong>de</strong>m Enkel Maximilian I., und Anna von Ungarn.<br />
Ungarn wur<strong>de</strong> 1526 vom Osmanischen Reich erobert, wobei Ludwig II. sein Leben verlor. In Österreich konnte Ferdinand, <strong>de</strong>r Anna geheiratet hatte, <strong>de</strong>r Belagerung standhalten; nach<br />
<strong>de</strong>m Tod Ludwigs II. war er formal auch Herrscher über das osmanisch eroberte Ungarn, wo von <strong>de</strong>n Osmanen jedoch Ludwigs Onkel Johann Zápolya <strong>zu</strong>m König ausgerufen wur<strong>de</strong>.<br />
Insofern wur<strong>de</strong> durch diese Hochzeiten <strong>de</strong>r Grundstein <strong>de</strong>r "Donaumonarchie" gelegt, die sich später als Österreich-Ungarn <strong>zu</strong>r europäischen Großmacht entwickelte.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Preußische Huldigung<br />
Preußische Huldigung (poln. Hołd pruski) ist <strong>de</strong>r Titel eines Historiengemäl<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s polnischen Malers Jan Matejko aus <strong>de</strong>m Jahre 1882.<br />
Gemäl<strong>de</strong><br />
Das Bild zeigt Matejkos Vorstellung davon, wie Albrecht I. von Bran<strong>de</strong>nburg-Ansbach am 10. April 1525 in Krakau gegenüber <strong>de</strong>m polnischen König Sigismund I. <strong>de</strong>n Lehnseid leistet,<br />
um damit als Abschluss <strong>de</strong>s Reiterkrieges erster Herzog in Preußen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n. Zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Entstehung <strong>de</strong>s Gemäl<strong>de</strong>s war Polen zwischen Russland, Österreich und Preußen-<br />
Deutschland aufgeteilt, insbeson<strong>de</strong>re letzteres betrieb eine <strong>de</strong>utliche Germanisierungspolitik. Der nationalistische Maler Matejko, <strong>de</strong>r seine Kunst als „eine Art Waffe“ betrachtete,[1]<br />
imaginiert in diesem Gemäl<strong>de</strong>, dass die Machtverhältnisse einmal umgekehrt waren: Der Vorfahr <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Kaisers Wilhelm I. (Deutsches Reich), <strong>de</strong>r Hohenzollernfürst Albrecht,<br />
kniet vor <strong>de</strong>m polnischen König und gelobt ihm die Treue. Dass sich das Verhältnis zwischen bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn bald umkehren sollte, <strong>de</strong>utete Matejko in <strong>de</strong>r Gestalt <strong>de</strong>s Hofnarren<br />
Stańczyk an, <strong>de</strong>r vor König Sigismund sitzt und mit sorgenvoller Miene, <strong>de</strong>n Kopf in die Hand gestützt, aus <strong>de</strong>m Bild herausblickt. Das Bild hängt heute in <strong>de</strong>r Galerie polnischer Kunst<br />
<strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts in Krakau.<br />
Historischer Hintergrund<br />
Albrecht von Bran<strong>de</strong>nburg-Ansbach war ein Neffe <strong>de</strong>r polnischen Jagiellonen-Könige und auch <strong>de</strong>swegen 1511 <strong>zu</strong>m Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns ernannt wor<strong>de</strong>n. Die<br />
Spannungen zwischen <strong>de</strong>m Or<strong>de</strong>nsstaat und Polen im seit <strong>de</strong>m Zweiten Frie<strong>de</strong>n von Thorn 1466 zweigeteilten Preußen mün<strong>de</strong>ten 1519 in <strong>de</strong>n Reiterkrieg, <strong>de</strong>r 1521 mit einem<br />
Waffenstillstand unterbrochen wur<strong>de</strong>. Zur Lösung <strong>de</strong>s Konfliktes been<strong>de</strong>te er mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r preußischen Stän<strong>de</strong> die Herrschaft <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsritter auch im östlichen Teil Preußens,<br />
säkularisierte <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>nsbesitz, und führte die Reformation ein.<br />
Die herzoglich-preußische Lehnsabhängigkeit von Polen en<strong>de</strong>te 1657 mit <strong>de</strong>m Vertrag von Wehlau. In <strong>de</strong>n Teilungen Polens wur<strong>de</strong> das Königreich Polen von 1772 bis 1795 auch mit<br />
Hilfe Preußens von <strong>de</strong>n Landkarten getilgt. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt erinnerten sich Polen an frühere Glanzzeiten, <strong>de</strong>r Historienmaler Matejko verfasste entsprechen<strong>de</strong> Gemäl<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r<br />
patriotischen Erbauung.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Feliks Szyszko: The Impact of History on Polish Art in the Twentieth Century<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Hühnerkrieg<br />
Der Hühnerkrieg (polnisch Wojna kokosza) ist <strong>de</strong>r Name für eine anti-royalistische und anti-absolutistische Rebellion (polnisch rokosz) <strong>de</strong>r polnischen Szlachta, <strong>de</strong>s mittleren und<br />
nie<strong>de</strong>ren A<strong>de</strong>ls mit Zentrum im heutigen Galizien. Die abwerten<strong>de</strong> Bezeichnung für <strong>de</strong>n Krieg wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Magnaten <strong>zu</strong>geschrieben, <strong>de</strong>m höheren A<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>r größtenteils <strong>de</strong>n König<br />
unterstützte und behauptete, die einzige Wirkung <strong>de</strong>s „Krieges“ sei die Beinahe-Ausrottung <strong>de</strong>r örtlich durch die Adligen requirierten Hühner während <strong>de</strong>s „rokosz“ in Lemberg gewesen.<br />
Die Bezeichnung <strong>de</strong>r Rebellion durch die Magnaten mit „kokosz“ – es be<strong>de</strong>utet Legehenne – mag von einem Wortspiel inspiriert sein zwischen „rokosz“ und <strong>de</strong>m ähnlich klingen<strong>de</strong>n<br />
„kokosz“.<br />
Zu Beginn seiner Herrschaft erbte König Sigismund I., <strong>de</strong>r Ältere ein Königreich Polen mit einer jahrhun<strong>de</strong>rtelangen Tradition von Freiheiten <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls, in zahllosen Privilegien bestätigt.<br />
Sigismund sah sich <strong>de</strong>r Herausfor<strong>de</strong>rung gegenüber, die innere Macht <strong>zu</strong> konsolidieren gegenüber äußeren Bedrohungen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Während <strong>de</strong>r Herrschaft seines Vorgängers,<br />
Alexan<strong>de</strong>r I., war das Statut <strong>de</strong>s „Nihil Novi“ (Nichts Neues) eingerichtet wor<strong>de</strong>n, das <strong>de</strong>n Königen Polens verbot, Gesetze ohne Zustimmung <strong>de</strong>s Sejms <strong>zu</strong> erlassen. Dies erwies sich als<br />
lähmend in Sigismunds Verhandlungen mit <strong>de</strong>r Szlachta und <strong>de</strong>n Magnaten wie auch als ernste Bedrohung <strong>de</strong>r Stabilität <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. In <strong>de</strong>r Absicht seine Macht <strong>zu</strong> stärken, erließ<br />
Sigismund eine Reihe von Reformen, richtete 1527 eine Wehrpflichtarmee ein und <strong>de</strong>hnte <strong>de</strong>n bürokratischen Apparat aus, <strong>de</strong>r nötig war, um <strong>de</strong>n Staat <strong>zu</strong> regieren und die Armee <strong>zu</strong><br />
finanzieren. Unterstützt von seiner italienischen Gemahlin, <strong>de</strong>r Königin Bona Sforza, begann er Land <strong>zu</strong>r Ausweitung <strong>de</strong>s königlichen Besitzes <strong>zu</strong> kaufen. Er begann auch einen Prozess<br />
<strong>de</strong>r Restitution königlicher Güter, die <strong>zu</strong>vor verpfän<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r Angehörigen <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls als Lehen gegeben wor<strong>de</strong>n waren.<br />
Im Jahre 1537 führte die Politik <strong>de</strong>s Königs <strong>zu</strong> einem größeren Konflikt. Die Szlachta versammelte sich nahe Lemberg <strong>zu</strong> einer levée en masse und verlangte ein militärisches<br />
Einschreiten gegen Moldawien. Der kleine und mittlere A<strong>de</strong>l je<strong>de</strong>nfalls rief einen rokosz aus, eine halblegale Rebellion, in <strong>de</strong>r Absicht, <strong>de</strong>n König <strong>zu</strong>r Aufgabe seiner Reformen <strong>zu</strong><br />
veranlassen. Die Adligen präsentierten ihm 36 For<strong>de</strong>rungen, darunter die be<strong>de</strong>utendsten:<br />
1. Ein En<strong>de</strong> weiteren Lan<strong>de</strong>rwerbs durch Bona Sforza<br />
2. Befreiung <strong>de</strong>r Szlachta vom Zehnten<br />
3. Eher Bereinigung als Ausweitung <strong>de</strong>s Staatsschatzes<br />
4. Bestätigung und Ausweitung <strong>de</strong>r Privilegien <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls<br />
5. Aufhebung <strong>de</strong>s Zolls o<strong>de</strong>r Befreiung <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls davon<br />
6. Annahme eines Gesetzes <strong>zu</strong>r incompabilitas – <strong>de</strong>r Unvereinbarkeit bestimmter Ämter in einer Hand (z. B. <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Starost mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s Woiwo<strong>de</strong>n)<br />
7. Die Verabschiedung eines Gesetzes, das nur die Angehörigen <strong>de</strong>r örtlichen Szlachta für die Übernahme lokaler Ämter vorsah<br />
8. Die Schaffung eines permanenten Beratergremiums für <strong>de</strong>n König.<br />
Die Protestierer kritisierten schließlich die Rolle <strong>de</strong>r Königin Bona Sforza, die sie einer „schlechten Erziehung“ <strong>de</strong>s jungen Prinzen Sigismund August beschuldigten (<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>künftigen<br />
Königs Sigismund II. August) wie auch <strong>de</strong>s Versuchs, ihre Macht und ihren Einfluss im Staat aus<strong>zu</strong>weiten.<br />
Es sickerte jedoch bald durch, dass die Führer <strong>de</strong>r Szlachta unter sich zerstritten waren und dass es beinahe unmöglich war, eine Übereinkunft <strong>zu</strong> erreichen. Zu schwach einen Bürgerkrieg<br />
gegen <strong>de</strong>n König <strong>zu</strong> beginnen, willigte man schließlich in etwas Ähnliches wie einen Kompromiss ein. Der König wies die meisten For<strong>de</strong>rungen <strong>zu</strong>rück, akzeptierte allerdings das Prinzip<br />
<strong>de</strong>r incompabilitas im folgen<strong>de</strong>n Jahr und stimmte <strong>zu</strong>, die Wahl <strong>de</strong>s <strong>zu</strong>künftigen Königs nicht Vivente Rege, also <strong>zu</strong> Lebzeiten <strong>de</strong>s regieren<strong>de</strong>n Königs, <strong>zu</strong><strong>zu</strong>lassen.<br />
Daraufhin kehrte die Szlachta heim und hatte wenig erreicht.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Lubomirski-Konfö<strong>de</strong>ration<br />
Die Lubomirski-Konfö<strong>de</strong>ration war eine von 1665 bis 1666 dauern<strong>de</strong> Rebellion <strong>de</strong>s polnischen Magnaten und Feldherrn, Jerzy Sebastian Lubomirski, gegen <strong>de</strong>n polnischen König Johann<br />
II. Kasimir und seine Reformpläne.<br />
Von seinem Verbannungsort Schlesien suchte Fürst Lubomirski um Unterstüt<strong>zu</strong>ng für seine Sache beim Kaiser Leopold I., Kurfürst Friedrich Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg und König Karl<br />
von Schwe<strong>de</strong>n nach, während die Beschlüsse <strong>de</strong>s polnischen Parlaments durch seine Gefolgsleute in Polen mittels <strong>de</strong>s Liberum Vetos lahmgelegt wur<strong>de</strong>n. Lubomirski höchstpersönlich<br />
schlug, dank <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch einen Teil <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>lsaufgebots und rebellieren<strong>de</strong>r Königstruppen, das königliche Heer mehrmals beinahe vernichtend in die Flucht, so<br />
1665 bei Tschenstochau und 1666 bei Mątwy, während sich Polen im Osten mit Russland ab 1654 formell noch im Kriegs<strong>zu</strong>stand befand.<br />
Die Konfö<strong>de</strong>ration en<strong>de</strong>te schließlich im Vertrag von Łęgonice, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n polnischen König da<strong>zu</strong> verpflichtete seine Reformpläne auf<strong>zu</strong>geben und mit Russland 1667, unter Aufgabe weiter<br />
Gebiete im Osten, <strong>de</strong>n ungünstigen Waffenstillstand von Andrussowo ab<strong>zu</strong>schließen.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Osmanisch-Polnischer Krieg 1672-1676<br />
Der Osmanisch-Polnische Krieg 1672–1676 war ein Krieg zwischen <strong>de</strong>m Osmanischen Reich im Bund mit <strong>de</strong>m Khanat <strong>de</strong>r Krim und Doroschenko-Kosaken auf <strong>de</strong>r einen Seite und <strong>de</strong>r<br />
Republik Polen-Litauen im Bund mit <strong>de</strong>r Walachei und Chanenko-Kosaken auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren. Der Krieg begann im Januar 1672 mit einer Kriegserklärung <strong>de</strong>s türkischen Sultans und<br />
en<strong>de</strong>te 1676 mit <strong>de</strong>m Vertrag von Żurawno, in <strong>de</strong>m Polen gezwungen wur<strong>de</strong>, seine Souveränität über Podolien mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Kamieniec Podolski an das Osmanische Reich<br />
ab<strong>zu</strong>treten.<br />
Hintergrund<br />
Der Osmanisch-Polnische Krieg 1672–1676 hatte seinen Ursprung im Jahr 1666, als Petro Doroschenko, Kosaken-Hetman in <strong>de</strong>r „rechtsufrigen Ukraine“, sich mit <strong>de</strong>n Krimtataren gegen<br />
Polen verbün<strong>de</strong>t hatte. Im Vertrag von Andrussowo, 1667, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r aus Teilen <strong>de</strong>r polnischen Ukraine 1649 entstan<strong>de</strong>ne Staat <strong>de</strong>r Saporoger Kosaken, das Hetmanat, in eine polnisch<br />
dominierte Ukraine westlich <strong>de</strong>s Dnjepr (rechtsufrige Ukraine) und eine russisch dominierte Ukraine östlich <strong>de</strong>s Dnjepr (linksufrige Ukraine) geteilt. Die Ukraine versank daraufhin für
Jahrzehnte im Chaos eines Bürgerkriegs verschie<strong>de</strong>ner kosakischer Parteiungen, die entwe<strong>de</strong>r propolnisch, prorussisch o<strong>de</strong>r prokrimtatarisch-osmanisch waren. Es war eine Zeit, die in<br />
<strong>de</strong>r ukrainischen Historiographie als „die Zeit <strong>de</strong>s Ruins“ bekannt ist. Im Kampf gegen Polen versuchte Petro Doroschenko die Kontrolle über die gesamte rechtsufrige Ukraine <strong>zu</strong><br />
erlangen. Er scheiterte bei <strong>de</strong>m Versuch und sah sich im Angesicht <strong>de</strong>r militärisch-politischen Nie<strong>de</strong>rlagen gezwungen, mit <strong>de</strong>m osmanischen Kaiser ab 1667 in Verhandlungen <strong>zu</strong> treten.<br />
Er schloss mit ihm einen Vertrag, <strong>de</strong>r das rechtsufrige kosakisch-ukrainische Hetmanat mit <strong>de</strong>r Hauptstadt Tschyhyryn formell <strong>zu</strong> einem Vasallenstaat (Protektorat) <strong>de</strong>s Osmanischen<br />
Reiches machte.<br />
Die polnisch-litauische Republik war durch <strong>de</strong>n Chmielnicki-Aufstand 1648–1654, <strong>de</strong>n Russisch-Polnischen Krieg 1654–1667, <strong>de</strong>n Schwedisch-Polnischen Krieg 1655–1660 und eine<br />
gegen <strong>de</strong>n polnischen König gerichtete interne Rebellion <strong>de</strong>s Fürsten Lubomirski 1665–1666 <strong>zu</strong> geschwächt, um etwaige Kosakenaufstän<strong>de</strong> <strong>zu</strong> bekämpfen o<strong>de</strong>r nur die volle Kontrolle<br />
über das ukrainische Gebiet <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen, das ab 1648 ein ständiger Unruheherd blieb.<br />
Um aus <strong>de</strong>r Schwäche Polens Kapital <strong>zu</strong> schlagen, wechselte 1666 das ab 1654 mit Polen gegen das Zarentum Russland und Ataman Chmielnicki <strong>zu</strong>vor verbün<strong>de</strong>te Khanat <strong>de</strong>r Krim<br />
unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s neuen Khans, Adil Giray, erneut die Seiten („krimtatarisches Wechselfieber“) und ging mit Hetman Doroschenko eine gegen Polen gerichtete Allianz ein. Bei<strong>de</strong><br />
Bündnispartner waren <strong>zu</strong>nächst erfolgreich und schlugen durch einen Überraschungsangriff ein 6000 Mann starkes polnisches Heer unter Sebastian Machowski in <strong>de</strong>r Schlacht bei Ściana<br />
bzw. Brajłów in Podolien am 19. Dezember 1666, die kosakisch-krimtatarische Offensive wur<strong>de</strong>n jedoch im folgen<strong>de</strong>n Jahr durch die Streitkräfte <strong>de</strong>s Feldhetmans <strong>de</strong>r polnischen Krone,<br />
Jan Sobieski, gestoppt und die Doroschenko-Kosaken im Bund mit <strong>de</strong>n Krimtataren selbst mehrmals in die Flucht geschlagen. Nach <strong>de</strong>r für die Polen siegreichen Schlacht bei Podhajce,<br />
1667, schloss Polen mit <strong>de</strong>m Khanat <strong>de</strong>r Krim am 16. Oktober 1667 und mit Doroschenko am 19. Oktober <strong>de</strong>sselben Jahres Waffenstillstandsverträge.<br />
Als 1669 Doroschenko für die Ukraine weitgehen<strong>de</strong> Autonomie verlangte, wur<strong>de</strong> er auf Befehl <strong>de</strong>s polnischen Königs seines Amtes enthoben und durch Hetman Michael Chanenko<br />
ersetzt. Als <strong>de</strong>r seit 1667 <strong>de</strong>n Polen freundlich gesinnte Khan <strong>de</strong>r Krim, Adil Giray, ein Bündnis mit <strong>de</strong>n neuen Hetman <strong>de</strong>r rechtsufrigen Ukraine schloss, ohne vorher dafür bei seinem<br />
Suzerän um die Erlaubnis nach<strong>zu</strong>fragen, wur<strong>de</strong> dieser im Mai 1671 durch <strong>de</strong>n osmanischen Sultan gestürzt und durch einen loyaleren Vasallen, Selim I. Giray, ersetzt. Doroschenko<br />
erneuerte daraufhin mit <strong>de</strong>m neuen Krimkhan die Allianz von 1666–67. Im August 1671 brach <strong>de</strong>r Krieg erneut aus, doch auch diesmal wur<strong>de</strong>n die ungleichen Allianzpartner durch die<br />
Truppen von Jan Sobieski militärisch bezwungen. Daraufhin bat Selim seinen Suzerän, <strong>de</strong>n türkischen Kaiser, um militärischen Beistand, <strong>de</strong>r die „Bitte“ seines Vasalls als Vorwand<br />
nutzte, Polen-Litauen <strong>de</strong>n Krieg <strong>zu</strong> erklären, um die zwischen Polen, Russland und <strong>de</strong>m Krimkhanat strittige Ukraine für das Osmanische Reich <strong>zu</strong> erobern.<br />
So entwickelte sich aus einem Grenzkonflikt, ein Krieg zwischen <strong>de</strong>m republikanischen Königreich Polen-Litauen und <strong>de</strong>m Osmanischen Reich um die Herrschaft über die Ukraine.<br />
Die Kampagne von 1672<br />
Die osmanischen Streitmacht (bis <strong>zu</strong> 100.000 Mann) unter <strong>de</strong>r Führung von Sultan Mehmed IV. und Großwesirs Köprülü Fazil Ahmed betrat das Gebiet <strong>de</strong>r polnischen Ukraine im<br />
August 1672, nahmen die Festung Kamieniec Podolski am 26. August <strong>de</strong>sselben Jahres ein, <strong>de</strong>m schließlich am 20. September die Belagerung von Lemberg folgte. Die Krimtataren, die<br />
an <strong>de</strong>r Belagerung nicht teilnahmen, begannen mit ihren Razzien zwischen <strong>de</strong>n Flüssen Wieprz, San, Bug und Wislok. Die Razzien umfassten ein Gebiet, das die Städte Zamość,<br />
Lemberg, Biecz und Drohobytsch umschloss. Sobieski stellte ihnen mit einer bis <strong>zu</strong> 4.000 Mann starken Kavallerie (Sobieskis Kriegs<strong>zu</strong>g gegen die Tataren-Razzien, poln. Wyprawa<br />
Sobieskiego na czambuly tatarskie) vom 5. Oktober bis <strong>zu</strong>m 14. Oktober nach. Auf das En<strong>de</strong>rgebnis <strong>de</strong>r 1672er Kampagne hatte Sobieskis Kriegs<strong>zu</strong>g jedoch kaum Einfluss, es konnten<br />
allerdings bis <strong>zu</strong> 44.000 Menschen aus <strong>de</strong>r Gefangenschaft (Jasyr) <strong>de</strong>r Krimtataren befreit wer<strong>de</strong>n, die man in die Sklaverei auf <strong>de</strong>r Halbinsel Krim trieb. Die polnischen Truppen waren<br />
<strong>zu</strong> schwach und <strong>de</strong>m osmanischen Heer im freien Feld nicht gewachsen. Auf <strong>de</strong>n Krieg völlig unvorbereitet und durch innere Zerwürfnisse zwischen <strong>de</strong>m König Michael Wisniowiecki,<br />
<strong>de</strong>r durch die Masse <strong>de</strong>s Kleina<strong>de</strong>ls an die Macht kam und <strong>de</strong>n Magnaten (die <strong>de</strong>n untätigen König <strong>zu</strong>r Abdankung zwingen wollten) geschwächte Polen, konnte <strong>de</strong>r durch das Liberum<br />
Veto in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s Jahres 1672 zweimal blockierte polnische Reichstag (durch die Anhänger <strong>de</strong>s Königs) keine höheren Steuern anordnen, um das Truppenkontingent im<br />
Angesicht <strong>de</strong>r osmanischen Kriegserklärung <strong>zu</strong> erhöhen. Nach mehreren Nie<strong>de</strong>rlagen waren die Vertreter <strong>de</strong>s Königs gezwungen, mit <strong>de</strong>n Vertreter <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches, Kaplan,<br />
Paşa, Wesir und Beylerbey von Aleppo (Eyalet Aleppo, arab. aleb, türk. Halep), <strong>de</strong>n Vorfrie<strong>de</strong>nsvertrag von Buczacz am 18. Oktober 1672 <strong>zu</strong> unterzeichnen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Osmanischen Reich<br />
Podolien mit <strong>de</strong>r Festung Kamieniec Podolski und fast die gesamte rechtsufrige Ukraine <strong>de</strong>n Doroschenko-Kosaken als Vasallen <strong>de</strong>r Hohen Pforte <strong>zu</strong>sprach, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m verpflichtete sich die<br />
polnische Krone <strong>de</strong>m türkischen Sultan einen Tribut von 22.000 in „Czerwony Złoty“ jährlich <strong>zu</strong> leisten.<br />
Ein Bericht über diesen Feld<strong>zu</strong>g ist in <strong>de</strong>r Chronik von Hacı Ali festgehalten.
Die Kampagne von 1673<br />
Da <strong>de</strong>r Vertrag von Buczacz aufgrund seines „schändlichen Charakters“ (beträchtliche Gebietsverluste, Tributleistungen, die Polen faktisch auf die gleiche Höhe stellten, wie die Krim<br />
o<strong>de</strong>r die Moldau) durch <strong>de</strong>n polnischen Reichstag nicht ratifiziert wur<strong>de</strong>, setzte er sich im nächsten Jahr fort. Das polnische Parlament ordnete die Erhöhung von Steuern an, um eine<br />
Streitmacht von 43.000 Mann (die Krone Polens 31.000 Mann, <strong>de</strong>r litauische Reichsteil 12.000 Mann) aus<strong>zu</strong>heben. Großhetman Sobieski übernahm die Führung <strong>de</strong>r neuen Armee, <strong>de</strong>r es<br />
gelang die Osmanen im Fel<strong>de</strong> mehrmals <strong>zu</strong> schlagen, große Teile Moldawiens und <strong>de</strong>r strittigen ukrainischen Gebiete (bis auf das von polnischen Truppen belagerte türkische Kamieniec<br />
Podolski) konnten von osmanischen Truppen geräumt wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Chocim, am 11. November 1673, nahm Sobieski das osmanische Kriegslager und die Festung Chocim<br />
ein, während die dort stationierte bis <strong>zu</strong> 35.000 Mann starke Garnison unter <strong>de</strong>r Führung von Hüseyin (Hussein), Paşa von Silistrien, im Sturmangriff <strong>de</strong>r Husaren fast völlig aufgerieben<br />
wur<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>r Einnahme von Chocim verlagerte <strong>de</strong>r polnische König das Kriegsgeschehen auf das Gebiet Moldawiens und nahm sogar <strong>de</strong>ssen Hauptstadt Jassy kurzfristig ein, jedoch<br />
aufgrund von Fahnenflucht und <strong>de</strong>s eigenmächtigen Rück<strong>zu</strong>gs von Großhetman Michael Kasimir Pac, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n litauischen Truppenteil kommandierte und ihn <strong>zu</strong>rück nach Litauen nahm,<br />
musste er sich von dort rasch <strong>zu</strong>rückziehen. Als König Michael Korybut Wisniowiecki am 10. November 1674 verstarb, wur<strong>de</strong> Großhetman Sobieski für seine militärischen Erfolge und<br />
Verdienste für das Vaterland <strong>zu</strong>m König von Polen-Litauen erwählt. Die Sieg bei Chocim än<strong>de</strong>rte we<strong>de</strong>r etwas am weiteren Kriegsverlauf, noch konnte er politisch gegenüber <strong>de</strong>r Hohen<br />
Pforte „ausgeschlachtet“ wer<strong>de</strong>n. Der Krieg setzte sich auch in <strong>de</strong>n nächsten Jahren mit unvermin<strong>de</strong>rter Härte fort.<br />
Die Kampagnen von 1674 bis 1675<br />
In <strong>de</strong>n Jahren nach 1674 schmolz das polnische Heer zahlenmäßig ab, da <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Magnaten beherrschte polnische Reichstag sich im Angesicht osmanischer Nie<strong>de</strong>rlagen weigerte,<br />
erneut Steuern <strong>zu</strong> erheben, um die Armee <strong>zu</strong> bezahlen, was <strong>zu</strong> hoher Desertion innerhalb <strong>de</strong>r unbesol<strong>de</strong>ten polnisch-litauischen Armee führte. Zusätzlich setzte <strong>de</strong>r Großhetman Litauens,<br />
Michael Kasimir Pac, seinem Intimfeind Sobieski <strong>zu</strong>, was Intrigen innerhalb <strong>de</strong>s polnisch-litauischen Heeres begünstigte, während die Osmanen ihre Streitkräfte reorganisierten und<br />
verstärkten. Trotz<strong>de</strong>m blieben die Polen ab 1674 in <strong>de</strong>r Offensive, auch durch ein sich ab 1674 abzeichnen<strong>de</strong>s russisch-kosakisch-osmanisches Zerwürfnis (Krieg <strong>de</strong>r Kosaken aus <strong>de</strong>r<br />
linksufrigen Ukraine im Bund mit Russland gegen <strong>de</strong>n osmanischen Vasallen Doroschenko und <strong>de</strong>ssen Kosaken in Tschyhyryn) begünstigt. Die Polen gewannen die gesamte rechtsufrige<br />
Ukraine <strong>zu</strong>rück (bis auf Kamieniec Podolski) und beherrschten sie vom Herbst 1674 bis <strong>zu</strong>m Frühling 1675; jedoch stellten die Osmanen erneut ein Heer gegen Polen in Marsch und<br />
antworteten im Juni 1675 mit einer Gegenoffensive. Die bis <strong>zu</strong> 30.000 Mann starke osmanische Armee unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Serdar Şişman Ibrahim, Paşa von Buda und ein<br />
Schwiegersohn <strong>de</strong>s Sultans, setzte über <strong>de</strong>n Dnister bei Tighina über, wo bei Manaczyn eine krimtatarische Streitmacht in fast gleicher Mannstärke <strong>zu</strong> ihr stieß. Şişman nahm Bar ein, <strong>de</strong>m<br />
am 27. Juni Zbaraż und am 11. September Podhajce folgten, und begann am 20. September mit <strong>de</strong>r Belagerung von Trembowla. Nach <strong>de</strong>r für die Polen siegreichen Schlacht bei Lesienice<br />
vom 24. August in <strong>de</strong>r Nähe von Lemberg gegen die Krimtataren (bis <strong>zu</strong> 20.000 Mann) <strong>de</strong>s Nuradin Safa Giray, organisierte Sobieski ein Entsatzheer für die belagerte Stadt. Berichte über<br />
das kommen<strong>de</strong> Entsatzheer hörend, unterbrach Şişman die Belagerung <strong>de</strong>r Stadt am 11. Oktober und zog sich hinter <strong>de</strong>n Dnister <strong>zu</strong>rück.<br />
Die Kampagne von 1676<br />
Im August 1676 begannen die Osmanen erneut im Bun<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>n Krimtataren (bis <strong>zu</strong> 60.000 Mann unter <strong>de</strong>r Führung von Şajtan Ibrahim, Paşa von Damaskus und Selim I. Giray) mit<br />
einer neuen Offensive gegen Polen. Sie betraten das Gebiet Polens über Pokutien und marschierten Richtung <strong>de</strong>s heutigen Iwano-Frankiwsk. Nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Wojniłów vom 24.<br />
September zog sich Sobieski etwas ins Lan<strong>de</strong>sinnere <strong>zu</strong>rück, wo er mit ca. 20.000 Mann im Kriegslager von Żurawno, südlich von Lemberg bei Halytsch, einer osmanisch-tatarischen<br />
Belagerung drei Wochen lang standhielt (vom 25. September bis 14. Oktober 1676), bis bei<strong>de</strong> Parteien entkräftet schließlich in einen Waffenstillstand einwilligten.<br />
Abschluss<br />
Nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Żurawno schlossen bei<strong>de</strong> Kriegsparteien am 17. Oktober 1676 <strong>de</strong>n Waffenstillstandsvertrag von Żurawno. In ihm behielt das Osmanische Reich die direkte<br />
Kontrolle über Podolien mit Kamieniec Podolski (osmanisches Eyalet Podolya 1672/76–1699). Polen erhielt einen Teil <strong>de</strong>r verlorenen Gebiete (Biała Cerkiew) in <strong>de</strong>r „Rechtsufrigen<br />
Ukraine“ <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>r Rest ging an Hetman Doroschenko als Vasall <strong>de</strong>r Hohen Pforte (nach <strong>de</strong>ssen Entmachtung 1676 durch <strong>de</strong>n russischen Zaren an Juri Chmelnyzkyj, <strong>de</strong>r ein Sohn von<br />
Bohdan Chmelnyzkyj war), als Hetman 1677–81, außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n Kriegsgefangene ausgetauscht. Der Inhalt <strong>de</strong>s Vertrages von Żurawno fand seine völkerrechtliche Anerkennung im<br />
Vertrag von Konstantinopel 1678, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r türkische Sultan auf „Bitten“ <strong>de</strong>s Krimkhans <strong>zu</strong>sätzlich auf <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Polen <strong>zu</strong> entrichten<strong>de</strong>n, jedoch nie gezahlten Tribut verzichtete.
Literatur<br />
• Viorel Panaite: Ottoman-Polish Diplomatic Relations, Asian Studies. International Journal for Asian Studies (II/2001) (Englisch)<br />
• Geoffrey Treasure: The Making of Mo<strong>de</strong>rn Europe, 1648-1780, S. 536, S. 612, ISBN 978-0-415-30155-8 (Englisch)<br />
• Stanford Jay Shaw: History of the Ottoman Empire and Mo<strong>de</strong>rn Turkey, Cambridge University Press, 1977, S. 213, ISBN 0-521-29163-1 (Englisch)<br />
• John Stoye: The Siege of Vienna: The Last Great Trial Between Cross & Crescent, S. 18, ISBN 978-1-933648-63-7 (Englisch)<br />
• Paul Robert Magocsi: A History of Ukraine, S.227, ISBN 0-8020-7820-6 (Englisch)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Großer Türkenkrieg<br />
Der Große Türkenkrieg, auch als Großer Türkenkrieg Leopolds I. o<strong>de</strong>r 5. Österreichischer Türkenkrieg bezeichnet, dauerte von 1683 bis 1699. Unter seinem neuen Großwesir und<br />
Oberbefehlshaber Kara Mustafa versuchte das Osmanische Reich 1683 <strong>zu</strong>m zweiten Mal (nach <strong>de</strong>r Ersten Wiener Türkenbelagerung 1529), Wien <strong>zu</strong> erobern und das Tor nach Zentral-<br />
bzw. Westeuropa auf<strong>zu</strong>stoßen. Das Scheitern <strong>de</strong>r Belagerung führte <strong>zu</strong>r kaiserlichen Gegenoffensive, in <strong>de</strong>ren Verlauf die Osmanen aus <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Königreichs Ungarn vertrieben<br />
wur<strong>de</strong>n und die Dreiteilung Ungarns <strong>zu</strong> Gunsten <strong>de</strong>r Habsburger ein En<strong>de</strong> fand.<br />
Vorgeschichte<br />
1529 mussten die Osmanen vor Wien ihren ersten Versuch <strong>zu</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Stadt wegen schlechten Wetters und <strong>de</strong>s daraus resultieren<strong>de</strong>n fehlen<strong>de</strong>n Nachschubs abbrechen. Im<br />
Türkenkrieg von 1663/1664 stießen die Osmanen erneut auf Wien vor, konnten aber am 1. August 1664 vom kaiserlichen Oberbefehlshaber Raimondo di Montecuccoli in <strong>de</strong>r Schlacht bei<br />
Mogersdorf/St. Gotthard an <strong>de</strong>r Raab aufgehalten wer<strong>de</strong>n. Neun Tage nach diesem Sieg wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> von Eisenburg (Vasvár) mit einer Gültigkeitsdauer von 20 Jahren unterzeichnet.<br />
Ein Jahr vor Ablauf setzte sich Großwesir Kara Mustafa mit einem 150.000 Mann[1] starken Heer Richtung Wien in Marsch. Die Gelegenheit schien günstig, da die unter osmanischer<br />
Herrschaft operieren<strong>de</strong>n Kuruzen unter Emmerich Thököly weite Gebiete <strong>de</strong>s Königreichs Ungarn unter ihre Herrschaft gebracht hatten.<br />
Kriegsverlauf<br />
Der Entsatz von Wien 1683<br />
Als am 7. September 1683 sich ein vom Papst Innozenz XI. mitfinanziertes Entsatzheer <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches unter Karl von Lothringen mit Truppen <strong>de</strong>s Polenkönigs Jan<br />
Sobieski III. in Tulln an <strong>de</strong>r Donau ungefähr 30 Kilometer vor Wien vereinigte, dauerte die Belagerung schon seit <strong>de</strong>m 15. Juli an. Unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s polnischen Königs überraschte<br />
man die osmanische Streitmacht und schlug sie fünf Tage später am 12. September 1683 in <strong>de</strong>r Schlacht am Kahlenberg vernichtend. In dieser Schlacht erhielt jener junge Leutnant seine<br />
Feuertaufe, <strong>de</strong>r diesen Türkenkrieg schließlich been<strong>de</strong>n sollte: Prinz Eugen von Savoyen. Der türkische Chronist Mehmed, <strong>de</strong>r Silâhdar, berichtete über <strong>de</strong>n Anblick <strong>de</strong>r Entsatzarmee:
„Die Giauren [Ungläubige, christliche Truppen] tauchten mit ihren Abteilungen auf <strong>de</strong>n Hängen auf wie Gewitterwolken, starrend vor dunkelblauem Erz. Mit <strong>de</strong>m einen Flügel gegenüber<br />
<strong>de</strong>n Walachen und Moldauern an das Donauufer angelehnt und mit <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren Flügel bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n äußersten Abteilungen <strong>de</strong>r Tataren hinüberreichend, be<strong>de</strong>ckten sie Berg und Feld und<br />
formierten sich in sichelförmiger Schlachtordnung. Es war als wälze sich eine Flut von schwarzem Pech bergab, die alles, was sich ihr entgegenstellt, erdrückt und verbrennt.“[2]<br />
Die Eroberung von Ofen<br />
Durch die türkische Nie<strong>de</strong>rlage von 1683 sah Leopold I. nun endlich die Chance <strong>zu</strong>m Gegenschlag. Unter Mithilfe von Papst Innozenz XI. wur<strong>de</strong> am 5. März 1684 die Allianz <strong>de</strong>r<br />
Heiligen Liga gegen die Osmanen geschlossen. König Sobieski <strong>de</strong>r Polen, Kaiser Leopold I. und die Republik Venedig schlossen ein Bündnis, das sich ausschließlich gegen die Osmanen<br />
richten sollte.[3] Das erste Ziel war die Befreiung von Ofen. Im Oktober 1684 musste die Belagerung aufgegeben wer<strong>de</strong>n, da die Moral schlecht war und das türkische Entsatzheer die<br />
kaiserlichen Belagerungstruppen bedrängte.<br />
Zwei Jahre nach <strong>de</strong>r erfolglosen Belagerung von Ofen wur<strong>de</strong> 1686 ein erneuter Feld<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r ungarischen Hauptstadt gestartet. Mitte Juni 1686 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Belagerung<br />
begonnen. Ein türkisches Entsatzheer traf Mitte August vor Ofen ein, <strong>de</strong>r Kommandant scheute aber an<strong>zu</strong>greifen. Am 2. September 1686 eroberten die kaiserlichen Truppen die Festung.<br />
[4]<br />
Zweite Schlacht von Mohács<br />
161 Jahre nach<strong>de</strong>m das unabhängige Ungarn in <strong>de</strong>r ersten Schlacht bei Mohács (1526) aufgehört hatte <strong>zu</strong> existieren, kam es am 12. August 1687 auf <strong>de</strong>r gleichen Ebene erneut <strong>zu</strong>r<br />
Schlacht um Ungarn. Die 50.000 Mann starke kaiserliche Streitmacht unter Karl von Lothringen traf auf ein ca. 60.000 Mann starkes osmanisches Heer. Einem türkischen Großangriff<br />
wur<strong>de</strong> standgehalten, und <strong>de</strong>r von Prinz Eugen geführte Gegenangriff brach durch sämtliche türkischen Linien bis <strong>zu</strong>m Zelt <strong>de</strong>s geflohenen Großwesirs durch. Während auf kaiserlicher<br />
Seite nicht mehr als 600 Mann an Verlusten <strong>zu</strong> beklagen waren, mussten die Türken bis <strong>zu</strong> 10.000 Tote hinnehmen.[5] Die Folgen dieses, wenn man <strong>de</strong>n Zahlen glauben schenkt,<br />
überwältigen<strong>de</strong>n Sieges waren umfassend: In <strong>de</strong>r Folge konnte Karl von Lothringen Esseg und Slawonien befreien, während Siebenbürgen wie<strong>de</strong>r an Ungarn angeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Unter<br />
<strong>de</strong>m Eindruck dieser Ereignisse sprach <strong>de</strong>r ungarische Reichstag <strong>de</strong>n Habsburgern das Erbrecht auf die Stephanskrone <strong>zu</strong>, und <strong>de</strong>r erst neunjährige Sohn Kaiser Leopolds, Joseph, wur<strong>de</strong><br />
König von Ungarn. Prinz Eugen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Gegenstoß bei Mohács persönlich geführt hatte, wur<strong>de</strong> reichlich dafür entlohnt: Im Januar 1688 erfolgte die Ernennung <strong>zu</strong>m<br />
Feldmarschalleutnant und er wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s gol<strong>de</strong>nen Vlies aufgenommen.<br />
Belgrads Eroberung und <strong>de</strong>ren Folgen<br />
Nach <strong>de</strong>r erfolgreichen Zweiten Schlacht bei Mohács 1687 hieß das Ziel im darauf folgen<strong>de</strong>n Jahr Belgrad – die Stadt zwischen Donau und Save, welche seit 1521 in osmanischen Besitz<br />
war. Unter <strong>de</strong>m Kommando von Max Emanuel, <strong>de</strong>s Kurfürsten von Bayern, begann die Belagerung Anfang August 1688. Nur einen Monat später, am 6. September 1688, wur<strong>de</strong> die Stadt<br />
unter enormen Verlusten auf bei<strong>de</strong>n Seiten eingenommen. Die kaiserlichen Truppen eroberten Niš am 24. September 1688, Widin am 16. Oktober 1689 und rückten bis Bankja (jetzt eine<br />
Vorstadt Sofias) und Pernik im Osten und Skopie und Priština (befreit im Oktober 1689) im Sü<strong>de</strong>n vor[6]. Die Bevölkerung „stieg aus <strong>de</strong>n Gebirgen ein und hieß die Deutschen als<br />
Befreier von ihrer sklavischen Lage willkommen.“[7]<br />
Bereits 20 Tage nach <strong>de</strong>r Einnahme Belgrads marschierten Truppen König Ludwigs XIV. in das Rheinland ein und eröffneten <strong>de</strong>n Pfälzischen Erbfolgekrieg. Trotz dieser ungünstigen<br />
strategischen Entwicklung entschloss man sich am Kaiserhof im Juni 1689 die Waffenstillstandsverhandlungen mit <strong>de</strong>r Hohen Pforte ein<strong>zu</strong>stellen und gleichzeitig <strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>s<br />
kaiserlichen Heeres nach Westen <strong>zu</strong> verlagern. Durch diese Ereignisse wen<strong>de</strong>te sich das Kriegsglück im Osten wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Osmanen, die im Jahre 1690 Belgrad <strong>zu</strong>rückerobern<br />
konnten.<br />
Die Schlacht bei Zenta<br />
Nach<strong>de</strong>m 1697 <strong>de</strong>r Pfälzische Erbfolgekrieg been<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n war, kehrte Prinz Eugen, in <strong>de</strong>r Zwischenzeit <strong>zu</strong>m Feldmarschall beför<strong>de</strong>rt (1693), auf <strong>de</strong>n osmanischen Kriegsschauplatz als<br />
Oberbefehlshaber <strong>de</strong>r Armee in Ungarn <strong>zu</strong>rück. Er sammelte die Truppen aus Oberungarn und Siebenbürgen bei Peterwar<strong>de</strong>in, um <strong>de</strong>n osmanischen Vorstoß auf<strong>zu</strong>halten. Nach <strong>de</strong>r<br />
Vereinigung mit <strong>de</strong>n Truppen umfasste die kaiserliche Armee zwischen 50.000 und 55.000 Mann.[8] Den ganzen August hindurch spielten sich jedoch nur taktische Manöver zwischen
<strong>de</strong>n Streitmächten im Großraum Peterwar<strong>de</strong>in ab. Anfang September brachen die Osmanen die taktischen Geplänkel ab und zogen <strong>de</strong>r Theiß entlang nach Nor<strong>de</strong>n um sich <strong>de</strong>r Festung<br />
Szegedin <strong>zu</strong> bemächtigen. Der kaiserliche Feldmarschall folgte nun, fast auf gleicher Höhe, <strong>de</strong>r osmanischen Streitmacht. Der Sultan gab <strong>de</strong>n Plan <strong>zu</strong>r Erstürmung Szegedins <strong>de</strong>swegen<br />
auf; er beabsichtigte nun die Theiß bei Zenta <strong>zu</strong> überqueren und sich nach Temesvár ins Winterlager <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>ziehen. Als Prinz Eugen die Absicht <strong>de</strong>s Fein<strong>de</strong>s erkannte, entschloss er sich<br />
sofort <strong>zu</strong>m Angriff, überraschte die Osmanen am 11. September 1697 während <strong>de</strong>r Flussüberquerung und fügte ihnen eine vernichten<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rlage <strong>zu</strong>.<br />
Es war ein vollständiger und umfassen<strong>de</strong>r Sieg, und von nun an war <strong>de</strong>r Name Prinz Eugen in ganz Europa <strong>zu</strong> einem Begriff gewor<strong>de</strong>n. Der nach Temesvár fliehen<strong>de</strong> Sultan verlor an die<br />
25.000 Mann, wohingegen die Verluste <strong>de</strong>r Truppen <strong>de</strong>s Kaisers 28 Offiziere und 401 Mann an Toten betrugen.[9] Eine vernichten<strong>de</strong>re Nie<strong>de</strong>rlage hatte das Osmanische Reich auf <strong>de</strong>m<br />
europäischen Kontinent noch nicht erlebt.<br />
Der Überfall auf Sarajevo<br />
Der Sieg bei Zenta wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Kaiserlichen jedoch nicht entschei<strong>de</strong>nd strategisch genutzt, <strong>de</strong>nn für eine Belagerung <strong>de</strong>r Festung Temesvár war das Jahr schon <strong>zu</strong> weit fortgeschritten.<br />
Bevor man jedoch ins Winterlager zog, sollte <strong>de</strong>n bereits angeschlagenen Türken noch ein weiterer Schlag versetzt wer<strong>de</strong>n. Prinz Eugen beschloss mit einem Teil seiner Armee einen<br />
Überfall auf Bosnien durch<strong>zu</strong>führen. Sein Ziel: Sarajevo. Der Einfall begann am 13. Oktober 1697 von Esseg (heute: Osijek, Kroatien) aus. Bereits zehn Tage später wur<strong>de</strong>, trotz <strong>de</strong>r<br />
unwegsamen Route mitten durch bosnisches Bergland, das 250 km entfernte Sarajevo erreicht. Kaiserliche Parlamentäre, die die Übergabeauffor<strong>de</strong>rung Eugens überbringen sollten,<br />
wur<strong>de</strong>n beschossen, noch ehe sie die Stadt erreichten, und so wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Befehl <strong>zu</strong>m Angriff auf die unbefestigte Stadt erteilt. Am nächsten Tag notierte Eugen in sein Kriegstagebuch:<br />
„Man hat die Stadt völlig nie<strong>de</strong>rgebrannt und auch die ganze Umgebung. Unsere Trupps, die <strong>de</strong>n Feind verfolgten, haben Beute eingebracht, und auch Frauen und Kin<strong>de</strong>r [...]“[10]<br />
Frie<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Karlowitz<br />
Das Kriegsjahr 1698 verlief ohne größere Gefechte, da es in <strong>de</strong>r kaiserlichen Kriegskasse wie<strong>de</strong>r einmal an Geld mangelte: Im Sommer 1698 blieb <strong>de</strong>r Sold für die Armee aus, wodurch<br />
zwei Dragonerregimenter meuterten und ihre Offiziere als Geiseln nahmen. Prinz Eugen zeigte kein Pardon für die Meuterer: 12 wur<strong>de</strong>n erschossen, 20 gehängt und die Übrigen mussten<br />
Spießruten laufen.[11] (Über die genauen Opferzahlen bei <strong>de</strong>n „Spießrutenläufern“ ist nichts bekannt). Aufgrund <strong>de</strong>r Meuterei, <strong>de</strong>r schlechten Finanzlage und <strong>de</strong>r Tatsache, dass sowohl<br />
<strong>de</strong>r Kaiser als auch die Hohe Pforte <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n suchten, kam es unter <strong>de</strong>r Vermittlung Englands <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsgesprächen bei Karlowitz. Karlowitz lag zwischen <strong>de</strong>r von kaiserlichen<br />
Truppen gehaltenen Festung Peterwar<strong>de</strong>in und <strong>de</strong>r osmanischen Festung Belgrad. Auf einer Anhöhe bei Karlowitz wur<strong>de</strong> ein hölzerner Rundbau mit vier verschie<strong>de</strong>nen Eingängen<br />
errichtet. Damit sollte sichergestellt sein, dass alle vier Delegationen gleichzeitig an <strong>de</strong>n Verhandlungstisch treten konnten. Am 26. Jänner 1699[12] kam es schließlich zwischen <strong>de</strong>m<br />
Kaiser, Polen und Venedig einerseits sowie <strong>de</strong>m osmanischen Reich an<strong>de</strong>rerseits <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss: Siebenbürgen wur<strong>de</strong> mit Ungarn wie<strong>de</strong>rvereint, Ungarn wur<strong>de</strong> Österreich bzw. <strong>de</strong>n<br />
Habsburgern <strong>zu</strong>erkannt. Venedig erhielt <strong>de</strong>n Peloponnes. Bis auf das Banat waren nun alle osmanischen Eroberungen <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts wie<strong>de</strong>r verloren und das Haus Österreich wur<strong>de</strong><br />
eine europäische Großmacht.[13]<br />
Folgen<br />
Im Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz musste sich das Osmanische Reich erstmals von einer christlichen Macht Frie<strong>de</strong>nsbedingungen diktieren lassen, die weitreichen<strong>de</strong> Folgen für die ganze Region<br />
hatten: Die Dreiteilung Ungarns, eine direkte Folge <strong>de</strong>r 1. Schlacht von Mohács 1526, war nun <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Habsburger been<strong>de</strong>t. Lediglich das Banat von Temesvár blieb als letztes<br />
Stück <strong>de</strong>s alten Königreichs Ungarn noch osmanisches Gebiet, musste aber nach einem weiteren Türkenkrieg (1.Türkenkrieg Karl VI. 1716 - 1718) ebenfalls an das Habsburgerreich<br />
abgetreten wer<strong>de</strong>n.<br />
Museale Rezeption<br />
In <strong>de</strong>r Dauerausstellung <strong>de</strong>s Wiener Heeresgeschichtlichen Museums nimmt <strong>de</strong>r Große Türkenkrieg einen breiten Raum ein. Zahlreiche Objekte sind <strong>de</strong>r Öffentlichkeit <strong>zu</strong>gänglich,<br />
darunter mehrere Rossschweife und die Reflexbögen <strong>de</strong>r berüchtigten Sipahi. Beson<strong>de</strong>re Stücke sind auch ein türkisches Kettenhemd aus <strong>de</strong>m Besitz <strong>de</strong>s bei Mogersdorf siegreichen<br />
kaiserlichen Feldherren Raimondo Montecuccoli, eine silberne türkische Kalen<strong>de</strong>ruhr, eine 1683 vor Wien erbeutete türkische Standarte (Sancak-i Şerif) sowie das Siegel <strong>de</strong>s türkischen
Sultans Mustafa II., welches durch Prinz Eugen von Savoyen in <strong>de</strong>r Schlacht bei Zenta 1697 erbeutet wur<strong>de</strong>.[14]<br />
Belege<br />
1. ↑ Thomas Winkelbauer, Stän<strong>de</strong>freiheit und Fürstenmacht. Län<strong>de</strong>r und Untertanen <strong>de</strong>s Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. In: Herwig Wolfram(Hg.),<br />
Österreichische Geschichte 1522 - 1699.(Wien 2003) S. 164<br />
2. ↑ Richard F. Kreutel, Karamustapha vor Wien. Das türkische Tagebuch <strong>de</strong>r Belagerung. (Graz 1955)<br />
3. ↑ Ernst Trost, Prinz Eugen von Savoyen. (Wien - München ²1985) S. 47<br />
4. ↑ Trost (²1985), S. 56<br />
5. ↑ Trost (²1985), S. 60<br />
6. ↑ История на България, С., 1983, т. 4, S. 234, изд. на БАН<br />
7. ↑ ibi<strong>de</strong>m, S. 234, zitiert nach La Sacra Lega contro la potenza ottomana. Raconti veridici brievemente <strong>de</strong>scritti da Don Simpliciano Bizozeri, Milano, 1690, S. 401<br />
8. ↑ Trost (²1985), S. 10<br />
9. ↑ Walter Hummelberger, Die Türkenkriege und Prinz Eugen. In: Herbert St. Fürlinger(Hg.), Unser Heer. 300 Jahre Österreichisches Soldatentum in Krieg und Frie<strong>de</strong>n. (Wien-<br />
München-Zürich 1963)S. 88<br />
10.↑ Trost (²1985), S.84<br />
11.↑ Richard Schmitt, Peter Strasser, Rot-weiß-rote Schicksalstage. Entscheidungsschlachten um Österreich. (St. Pölten-Wien-Linz 2004). S. 68<br />
12.↑ Trost (²1985), S. 86<br />
13.↑ „War die Habsburger Monarchie eine Großmacht?“, Siehe da<strong>zu</strong>: Karl Vocelka, Glanz und Untergang <strong>de</strong>r höfischen Welt. Representation, Reform und Reaktion im<br />
Habsburgischen Vielvölkerstaat. In: Herwig Wolfram(Hg.), Österreichische Geschichte 1699-1815. (Wien 2004) S. 79 - 84<br />
14.↑ Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher (Hg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz, Wien 2000 S. 10-15.<br />
Literatur<br />
• Walter Hummelberger, Die Türkenkriege und Prinz Eugen.In: Herbert St. Fürlinger (Hg.), Unser Heer. 300 Jahre Österreichisches Soldatentum in Krieg und Frie<strong>de</strong>n. (Wien-<br />
München-Zürich 1963).<br />
• Ernst Trost, Prinz Eugen von Savoyen. (Wien – München ²1985).<br />
• Richard Schmitt, Peter Strasser, Rot-weiß-rote Schicksalstage. Entscheidungsschlachten um Österreich. (St.Pölten-Wien-Linz 2004).<br />
• Viscount Montgomery of Alamein, Kriegsgeschichte. Weltgeschichte <strong>de</strong>r Schlachten und Kriegszüge. (London 1968).<br />
• Renate Barsch-Ritter, Österreich auf allen Meeren. Geschichte <strong>de</strong>r K.(u.)K. Marine 1382 bis 1918. (Graz-Wien-Köln 2000).<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Zweite Wiener Türkenbelagerung<br />
Die Zweite Wiener Türkenbelagerung war eine Belagerung <strong>de</strong>r Stadt Wien vom 14. Juli bis 12. September 1683 durch Truppen <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches. Verteidigt wur<strong>de</strong> Wien durch<br />
Truppen <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches, Polen-Litauens, <strong>de</strong>r Republik Venedig und <strong>de</strong>s Kirchenstaates. Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Eroberungsversuchen, <strong>de</strong>m Eintreffen eines<br />
Entsatzheeres und <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n Schlacht am Kahlenberg zogen sich die Truppen <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches <strong>zu</strong>rück.<br />
Der Begriff ,Zweite Wiener Türkenbelagerung‘ schließt an einen Eroberungsversuch Wiens durch Truppen <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches im Jahr 1529, genannt Erste Wiener<br />
Türkenbelagerung, an.<br />
Ausgangssituation<br />
Die Expansionspolitik <strong>de</strong>r Osmanen hatte ihren Höhepunkt erreicht. Der größte Teil <strong>de</strong>s Königreichs Ungarn unterstand ab 1541 <strong>de</strong>r osmanischen Kontrolle, teils direkt (Zentralungarn),<br />
teils als Vasall (Fürstentum Siebenbürgen); die unterworfenen ungarischen Gebiete lieferten – da vertraglich da<strong>zu</strong> verpflichtet – Geld und teilweise auch Truppen. Der Gol<strong>de</strong>ne Apfel, wie<br />
die Osmanen <strong>zu</strong> dieser Zeit Wien nannten, war <strong>zu</strong>m Greifen nahe.<br />
1672 überfielen die Osmanen die damals polnisch-beherrschte Ukraine und das Königreich Polen-Litauen, eroberten die Festung Kamieniec Podolski und stießen bis Lemberg in Galizien<br />
vor. Das durch innere Konflikte zerrissene, beson<strong>de</strong>rs durch die Kriege <strong>de</strong>r „Blutigen Sintflut“ zerrüttete und militärisch beträchtlich geschwächte Königreich schloss im Vertrag von<br />
Buczacz einen Vorfrie<strong>de</strong>nsvertrag. In diesem Abkommen verpflichteten sich die Polen Podolien mit Kamieniec Podolski, sowie die rechtsufrige Ukraine (Gebiet westlich <strong>de</strong>s Dnepr) an<br />
die Kosaken unter Hetman Doroschenko als osmanische Vasallen ab<strong>zu</strong>treten. Zusätzlich verpflichtete sich das Land, einen jährlichen Tribut an die Hohe Pforte <strong>zu</strong> leisten. Die<br />
Verweigerung <strong>de</strong>r Ratifikation <strong>de</strong>s Buczaczer Vertrages durch <strong>de</strong>n polnischen Reichstag, <strong>de</strong>n Sejm, führte <strong>zu</strong> erneuten Kriegshandlungen. Ein Jahr später, 1673, führten die Polen unter<br />
ihrem Feldmarschall Johann (Jan) III. Sobieski wie<strong>de</strong>r ein Heer gegen die Osmanen und schlugen sie bei Chotyn vernichtend. Doch wenige Wochen später stan<strong>de</strong>n tatarische und<br />
osmanische Truppen unter Großwesir Kara Mustafa erneut im Land. Nach wechselvollen Kämpfen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Osmanisch-Polnische Krieg schließlich 1676 im Vertrag von Żurawno<br />
been<strong>de</strong>t. Die Osmanen blieben <strong>de</strong>nnoch weiter eine Bedrohung für Polen.[4]<br />
Das Heilige Römische Reich, durch seine Religionskriege und <strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg zerrüttet sowie durch die Pestepi<strong>de</strong>mie von 1679 geschwächt[5], stand gegen Frankreich unter<br />
Ludwig XIV. und die Osmanen unter Sultan Mehmet IV. in einem Zweifrontenkrieg.<br />
In Ungarn und <strong>de</strong>r Slowakei unterdrückten die Habsburger <strong>de</strong>n protestantischen A<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>r sich im Kuruzen-Aufstand unter <strong>de</strong>r Führung von Emmerich Thököly gegen Kaiser Leopold I.<br />
1678–1682 erhob.[6]<br />
Strategische Be<strong>de</strong>utung Wiens<br />
Wiens wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung lag in seiner Lage am Schnittpunkt zweier wichtiger Han<strong>de</strong>lswege, <strong>de</strong>r Donau und <strong>de</strong>r Bernsteinstraße, begrün<strong>de</strong>t. Aus militärischer Sicht war Wien <strong>zu</strong>m<br />
angrenzen<strong>de</strong>n, durch ausge<strong>de</strong>hnte Ebenen geprägten Ungarn hin nur schwer <strong>zu</strong> verteidigen und vom Heiligen Römischen Reich im Nor<strong>de</strong>n, bedingt durch die schwer passierbare Donau,<br />
militärisch nur schwer <strong>zu</strong> unterstützen. Wien verfügte aber über eine eigene große Donauflotte, die <strong>de</strong>n eigenen Nachschub und <strong>de</strong>n Transport <strong>de</strong>r schweren Artillerie ermöglichte.<br />
Strategisch gesehen galt die Stadt als christlicher Vorposten durch seine Lage zwischen <strong>de</strong>n Alpen und <strong>de</strong>n Karpaten. Damit hatte Wien eine große Be<strong>de</strong>utung für die Osmanen, die Wien<br />
als ein ‚Tor nach Westeuropa‘ ansahen.<br />
Festung Wien<br />
Nach <strong>de</strong>r ersten Wiener Türkenbelagerung wur<strong>de</strong>n im Jahre 1548 die Stadtmauern, die 1194 aus <strong>de</strong>n Lösegel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Richard Löwenherz gebaut wor<strong>de</strong>n waren, <strong>de</strong>m aktuellen<br />
militärtechnischen Stand angepasst. Italienische Festungsbauer errichteten eine Festung, die damals <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnsten Standards entsprach. Nach <strong>de</strong>m Dreißigjährigen Krieg wur<strong>de</strong> die<br />
Festung aus <strong>de</strong>r altitalienischen Manier in die neuitalienische Manier erweitert. An <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>rs kritischen Stelle zwischen Schottenbastei und Augustinerbastei, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Graben nicht
mit Wasser gefüllt war, errichtete man vier Ravelins, die bis 1672 fertig gebaut waren. Die Kontereskarpe als vor<strong>de</strong>rer Rand <strong>de</strong>s Grabens wur<strong>de</strong> mit einem Ge<strong>de</strong>ckten Weg ausgebaut.<br />
Die Burgbastei (<strong>de</strong>r linke Flügel <strong>de</strong>r Verteidiger, <strong>de</strong>r rechte Flügel <strong>de</strong>r Angreifer) war ein regelmäßiges Viereck mit je neun Kanonen, aber sie verfügte über keine Minenanlage. Hinter <strong>de</strong>r<br />
Burgbastei befand sich <strong>de</strong>r Kavalier, die Spanierbastei, eine überhöhte Artilleriefestung. Die Löwelbastei (<strong>de</strong>r rechte Flügel <strong>de</strong>r Verteidiger, <strong>de</strong>r linke Flügel <strong>de</strong>r Angreifer) war kleiner als<br />
die Burgbastei, und dahinter <strong>de</strong>r Kavalier, genannt die „Katze“, nahm nochmals Platz weg.[7]<br />
Die über 200 Meter lange Stadtmauer zwischen <strong>de</strong>n Basteien war <strong>zu</strong> lang für einen wirksamen Kartätscheneinsatz. Da<strong>zu</strong> kam, dass <strong>de</strong>r Ravelin etwas <strong>zu</strong> weit in <strong>de</strong>n Graben vorgeschoben<br />
und etwas <strong>zu</strong> hoch gebaut war, so dass <strong>de</strong>r Artilleriebeschuss im Graben hinter <strong>de</strong>m Ravelin von <strong>de</strong>n Basteien nur eingeschränkt möglich war. Die ersten Häuser <strong>de</strong>r Vorstadt waren nur<br />
200 Meter von <strong>de</strong>r Stadtmauer entfernt, außer<strong>de</strong>m konnte das Glacis in <strong>de</strong>n letzten Tagen vor <strong>de</strong>r Belagerung nicht mehr eingeebnet wer<strong>de</strong>n.[7]<br />
Im Minenkrieg um Wien waren die Osmanen mit 5.000 Mineuren ein<strong>de</strong>utig im Vorteil. Sie hatten nicht nur mehr Material und Personal, son<strong>de</strong>rn auch mehr Erfahrung im Minenkrieg.<br />
1682, nach Scheitern <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen zwischen Kaiser Leopold I. und <strong>de</strong>n Osmanen, warb <strong>de</strong>r Kaiser <strong>de</strong>n Festungsbaumeister Georg Rimpler an und stellte ihn als Ingenieur<br />
und Oberstleutnant in <strong>de</strong>n Dienst.[8] Georg Rimpler verstärkte die Kontereskarpe, baute zwischen <strong>de</strong>m Ravelin und <strong>de</strong>n Basteien Kaponniere, und hinter ihnen an <strong>de</strong>r Kehle zwischen<br />
Kurtine und Bastei wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rwall angelegt. Er ließ Palisa<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Ge<strong>de</strong>ckten Weg aufstellen und empfahl das Ausheben einer Künette im Graben. Er erkannte richtig, dass<br />
zwischen Burg- und Löwelbastei <strong>de</strong>r Hauptangriff <strong>de</strong>r Osmanen stattfin<strong>de</strong>n sollte.[9] Er stellte Bergleute aus Tirol, Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r und Lothringer <strong>zu</strong> diesem schwierigen Dienst ein, und<br />
auch Frauen wur<strong>de</strong>n anfangs eingesetzt.[10]<br />
Vorgeschichte<br />
Politische und Militärische Bündnisse<br />
Am 10. August 1664 hatten Kaiser Leopold I. und <strong>de</strong>r Großwesir Ahmed Köprülü in Eisenburg/Vasvár einen 20 Jahre währen<strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsvertrag abgeschlossen. Eine Verlängerung<br />
dieses Frie<strong>de</strong>nsvertrages kam 1682 nicht <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>. Am 26. Jänner 1683 schloss Leopold I. ein Defensivbündnis mit Bayern gegen Frankreich und das Osmanische Reich.[11] Am 31.<br />
März sammelte sich die Osmanische Armee bei Adrianopel (heute Edirne) mit 168.000 Mann und 300 Geschützen. An diesem Tag gelang es Papst Innozenz XI., <strong>de</strong>n polnischen König<br />
Jan Sobieski und Kaiser Leopold I. <strong>zu</strong> einem Defensivbündnis <strong>zu</strong> überre<strong>de</strong>n. Innozenz XI. unterstützte das Bündnis und <strong>de</strong>n Kampf gegen die Osmanen mit 1,5 Millionen Gul<strong>de</strong>n. Es<br />
wur<strong>de</strong> folgen<strong>de</strong>r Vertrag unterzeichnet:[12]<br />
1. Der Heilige Römische Kaiser soll jährlich während <strong>de</strong>s Türkenkrieges 60.000 Mann und die Krone Polens 40.000 Mann stellen.<br />
2. Wenn <strong>de</strong>r König von Polen selbst am Krieg teilnimmt, übernimmt er die Führung <strong>de</strong>r Truppen.<br />
3. Gegenseitiger Beistand bei <strong>de</strong>r Belagerung von Krakau o<strong>de</strong>r Wien.<br />
4. Bei<strong>de</strong> Seiten sollen christliche Verbün<strong>de</strong>te suchen und diese in die Allianz einla<strong>de</strong>n.<br />
5. Der Kaiser zahlt an die polnische Krone 200.000 Reichstaler.<br />
6. Alle Steuern (300.000 Reichstaler) <strong>de</strong>r venetianischen Kirchen in <strong>de</strong>r Lombar<strong>de</strong>i wer<strong>de</strong>n für ein Jahr als Sold <strong>de</strong>r polnischen Soldaten für <strong>de</strong>n Türkenkrieg verwen<strong>de</strong>t.<br />
7. Der Kaiser übernimmt alle Schul<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Polen gegenüber Schwe<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m letzten schwedischen Krieg und verzichtet auf alle Schul<strong>de</strong>n gegenüber Österreich.<br />
8. Kein Allianzpartner macht ohne Einverständnis <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren Waffenstillstand o<strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>n Türken.<br />
9. Seine kaiserliche Majestät, die Krone Polens und die Kardinäle Pio und Barberini schwören einen heiligen Eid auf diesen Vertrag.<br />
10.Von bei<strong>de</strong>n Seiten sollen kriegskundige Ratgeber abgestellt wer<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite die Notwendigkeit <strong>zu</strong>r Aufstellung eines Heeres übermittelt.<br />
11. Eroberte Gebiete in Ungarn gehören seiner kaiserlichen Majestät, eroberte Gebiete in <strong>de</strong>r Walachei und <strong>de</strong>r Ukraine gehören Polen.<br />
12.Diese Allianz geht auch an die Erben und Nachfolger <strong>de</strong>s Römischen Kaisers über.<br />
Osmanischer Vormarsch<br />
Am 3. Mai erreichte die osmanische Armee Belgrad. Sultan Mehmed IV. übertrug <strong>de</strong>n Oberbefehl seinem Großwesir Kara Mustafa Pascha. Später wur<strong>de</strong> in Stuhlweißenburg als Ziel <strong>de</strong>s<br />
Feld<strong>zu</strong>ges Wien, die Reichshauptstadt <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches, bekanntgegeben. Herzog Karl V. von Lothringen versuchte durch die Belagerung bei Neuhäusel die osmanischen
Truppen ab<strong>zu</strong>lenken, gab aber die Belagerung am 9. Juni auf und zog die österreichischen Truppen nach Raab <strong>zu</strong>rück. Die Osmanen überschritten die strategisch wichtige Brücke bei<br />
Esseg am 13. Juni, aber die Brücke war für das schwere Belagerungsgerät <strong>zu</strong> schwach. Die osmanischen Pioniere bauten eine neue Brücke auf.<br />
Gefecht bei Petronell<br />
Am 1. Juli trafen die Osmanen bei Raab ein. Tata, Neutra, Veszprém und Pápa ergaben sich <strong>de</strong>n Osmanen. In Wien ergriff Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg die ersten Maßnahmen für<br />
die Verteidigung und ließ die Stadtmauern instand setzen. Raab sollte die osmanischen Truppen aufhalten und zermürben, aber Herzog Karl V. ließ nur eine verstärkte Besat<strong>zu</strong>ng in Raab<br />
und setzte sich mit seinen Truppen Richtung Wien ab. Die Osmanen folgten ihm. Schon am 4. Juli stan<strong>de</strong>n die Osmanen an <strong>de</strong>r österreichischen Grenze. Drei Tage darauf ritten 40.000<br />
Krimtataren, sämtlichen Verteidigern im Land um Wien zahlenmäßig um das Doppelte überlegen, in das 40 Kilometer östlich gelegene Petronell. Bei Regelsbrunn stießen sie auf<br />
<strong>zu</strong>rückgehen<strong>de</strong> österreichische Savoyendragoner. Nach anfänglicher Verwirrung konnte Karl V. von Lothringen die Truppen <strong>zu</strong>m Kampf aufstellen. An <strong>de</strong>r Spitze seiner Truppen griff er<br />
die Tataren an. Unterstützt wur<strong>de</strong> er von <strong>de</strong>n Generalen Sachsen-Lauenburg Taaffe und Rabatta auf <strong>de</strong>m rechten Flügel und von <strong>de</strong>m Markgrafen Ludwig von Ba<strong>de</strong>n, dann Mercy und<br />
Palffy auf <strong>de</strong>m linken Flügel. Die Tataren wur<strong>de</strong> mit einem Verlust von 200 Mann in die Flucht getrieben. Die Kaiserlichen verloren etwa sechzig Mann, darunter einen jungen Prinzen<br />
von Aremberg und einen Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Prinzen Eugen von Savoyen, <strong>de</strong>n Oberst Prinz Ludwig Julius von Savoyen, <strong>de</strong>r eine tödliche Quetschung durch sein verwun<strong>de</strong>tes Pferd erlitt und<br />
einige Tage später in Wien starb.[13] Nach diesen Gefechten verließen Kaiser Leopold I. und die Kaiserfamilie Wien über Korneuburg, Melk und Linz nach Passau. Politisch war die<br />
Flucht notwendig, um das Entsatzheer <strong>zu</strong> organisieren. Mit <strong>de</strong>m Kaiser verließen auch etwa 80.000 Einwohner die Stadt.<br />
Vorbereitung auf die Belagerung<br />
Der Feldzeugmeister Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg übernahm die militärische Führung in <strong>de</strong>r Hauptstadt. Alle Truppen von Kaiser Leopold I. wur<strong>de</strong>n alarmiert und nach Wien <strong>zu</strong><br />
Herzog Karl V. an das linke Donauufer bei Wien beor<strong>de</strong>rt. Feldzeugmeister Graf Leslie wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Infanterie von <strong>de</strong>r Insel Schütt auf <strong>de</strong>m linken Donauufer in Eilmärschen nach Wien<br />
beor<strong>de</strong>rt, um die Besat<strong>zu</strong>ng von Wien <strong>zu</strong> verstärken. Tags darauf zog Herzog Karl V. mit seinen Truppen von Schwechat kommend über die Donaubrücken in die Leopoldstadt und Tabor.<br />
Dort lagerte er mit seinen Truppen. Die Bewohner <strong>de</strong>r Vorstädte wur<strong>de</strong>n aufgefor<strong>de</strong>rt, alles in die Stadt <strong>zu</strong> schaffen (vor allem Lebensmittel). Am 12. Juli wur<strong>de</strong>n die Vorstädte Wiens<br />
(heute 3. bis 9. Wiener Gemein<strong>de</strong>bezirk) auf Befehl von Graf Starhemberg in Brand gesetzt. Die übrig gebliebenen Ruinen boten <strong>de</strong>n Osmanen aber immer noch genug Schutz. Die<br />
Bürger und Stu<strong>de</strong>nten Wiens wur<strong>de</strong>n für die Verteidigung eingezogen. Munition (1.000 24-pfündige Kugeln) aus Steyr traf über <strong>de</strong>n Wasserweg in Wien ein.<br />
Verwüstungen in Burgenland und Nie<strong>de</strong>rösterreich<br />
Die Verbindung von Wien nach Wiener Neustadt war bereits durch die Tataren unterbrochen. Am 11. Juli eroberten die Osmanen nach drei Tagen Belagerung Hainburg und brannten es<br />
nie<strong>de</strong>r. 90 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung wur<strong>de</strong>n ermor<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r verschleppt. Nicht viel an<strong>de</strong>rs erging es <strong>de</strong>n Orten Ba<strong>de</strong>n, Schwechat, Inzersdorf und <strong>de</strong>r Favorita bei Wien. Sie wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n Tagen eingenommen und zerstört. Die Bevölkerung von Perchtoldsdorf wur<strong>de</strong> ebenso getötet und <strong>de</strong>r Ort nie<strong>de</strong>rgebrannt, wie in Mödling, wo die Bewohner, die in die<br />
St.Othmarkirche flüchteten, in <strong>de</strong>r Kirche umgebracht wur<strong>de</strong>n. In Bruck wur<strong>de</strong> die Vorstadt von <strong>de</strong>n Bewohnern selbst in Brand gesteckt. Nach vorheriger Weigerung einer Übergabe <strong>de</strong>r<br />
Stadt, kapitulierten sie ebenso, wie bereits vorher Eisenstadt und Ö<strong>de</strong>nburg. Die Stadt musste Kontributionen leisten, unter an<strong>de</strong>rem 50 Wagen Gerste und Mehl für das Lager vor Wien.<br />
Am 14. Juli plün<strong>de</strong>rten und verbrannten die Osmanen das Stift Heiligenkreuz.[11]<br />
Verlauf <strong>de</strong>r Belagerung<br />
Geschütze <strong>de</strong>r Wiener Festung, <strong>de</strong>r Entsatzarmee und <strong>de</strong>r Osmanen<br />
Die Wiener Festung verfügte über 130 Kartaunen und Doppelkartaunen mit einem Kaliber <strong>zu</strong> 40 Kilogramm. Weiterhin gehörten 11 Kolumbrinegeschütze mit einem Kaliber <strong>zu</strong> 5<br />
Kilogramm <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Arsenal <strong>de</strong>r Festung.<br />
Die am 7. und 8. September 1683 anrücken<strong>de</strong> Entsatzarmee <strong>de</strong>r Kaiserlichen, <strong>de</strong>r Polen, Bayern und Sachsen sowie <strong>de</strong>r südwest<strong>de</strong>utschen Fürstentümer führte insgesamt 152 Kartaunen<br />
mit sich.
Das osmanische Heer verfügte über 50 Balyemezgeschütze mit einem Kaliber von 13 bis 40 Kilogramm (10 bis 30 Okka), 15 bis 20 Kolumbrinegeschütze (türk. Kolomborna) mit einem<br />
Kaliber von 4 bis 11 Kilogramm, 5 Mörser und 120 Sahigeschütze. Größere Geschütze wur<strong>de</strong>n von Großwesir Kara Mustafa nicht mitgenommen, obwohl genügend Geschütze in<br />
ungarischen Festungen für die Osmanen vorhan<strong>de</strong>n waren[14][15].<br />
Einteilung <strong>de</strong>r osmanischen Truppen<br />
Juli<br />
• Abschnitt: Links Mitte Rechts<br />
• Festungsbauwerk darin: Löwelbastei (eigentlich „Löblbastei“) Ravelin Burgbastei<br />
• Truppen/Befehlshaber Janitscharenkorps rumelinische Truppen Kara Mehmed Pascha,<br />
• Ahmed Pascha Wesirs Abaza Sari Hüseyin Pascha<br />
Belagerungsbeginn<br />
Am 14. Juli erreichten die Osmanen Wien und schlossen es von Sü<strong>de</strong>n, Westen und Nor<strong>de</strong>n ein. Der Großwesir Kara Mustafa errichtete seine Zeltburg auf <strong>de</strong>r Schmelz. Französische<br />
Ingenieure im osmanischen Heere traten für <strong>de</strong>n Angriff auf die Kärntner Bastei ein, nahe am Wienfluss, an <strong>de</strong>ren Abschnitt die Osmanen schon 1529 scheiterten. Achmed Bey war<br />
osmanischer Ingenieur und entlaufener Kapuziner im Heer von Kara Mustafa. Er hatte bereits 1682 als Mitglied einer Gesandtschaft <strong>de</strong>s ungarischen Rebellen Tökölys die Festung Wien<br />
ausgekundschaftet. Er riet Kara Mustafa <strong>zu</strong> einem Angriff gegen die von Georg Rimpler inzwischen vorbereiteten Befestigungen im Südwesten zwischen Burgbastei und Löwelbastei.[10]<br />
Der Großwesir bestimmte die Position <strong>de</strong>r Geschützstellungen und <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>r Schanzgräben. Er setzte ein Schreiben <strong>zu</strong>r Kapitulation und Übergabe <strong>de</strong>r Stadt auf und ließ es nach<br />
Wien bringen. Graf Starhemberg lehnte die Kapitulation ab. Er hoffte mit etwa 11.000 Soldaten und 5.000 Bürgern und Freiwilligen bis <strong>zu</strong>m Entsatz durch<strong>zu</strong>halten.<br />
Die Umschließung <strong>de</strong>r Stadt war beim Donaukanal noch nicht vollständig, so dass die Stadt über Inseln in <strong>de</strong>r Donau (heute 2., 20. und Teile <strong>de</strong>s 21. und 22. Bezirks) weiter mit Truppen,<br />
Material und Nachrichten hätte versorgt wer<strong>de</strong>n können. Daher entsandte am 15. Juli Großwesir Kara Mustafa Truppen unter Hüseyin Pascha, <strong>de</strong>m Beylerbeyi von Damaskus, mit <strong>de</strong>m<br />
Auftrag, die Stadtbewohner von dieser Insel <strong>zu</strong> vertreiben. Da <strong>de</strong>r Donauarm an mehreren Stellen passierbar war und die Insel niedriger lag als die Stadt (Problem für die Artillerie) zog<br />
sich Herzog Karl V. am 16. Juli mit <strong>de</strong>r Kavallerie über die Donau nach Jedlesee <strong>zu</strong>rück, räumte alle Inseln auf <strong>de</strong>r Donau und bezog am linken Donauufer Stellung.[16] Nun umschlossen<br />
die Osmanen die Stadt vollständig. Die Leopoldstadt wur<strong>de</strong> in Brand gesteckt, die Brücken abgerissen. Nach <strong>de</strong>r Eroberung <strong>de</strong>r Leopoldstadt bestimmte Großwesir Kara Mustafa <strong>de</strong>n<br />
Beylerbeyi von Bosnien, Hizir Pascha, mit seinen Truppen die Leopoldstadt <strong>zu</strong> sichern und von dort die Beschießung <strong>de</strong>r Stadt auf<strong>zu</strong>nehmen. Am nächsten Tag brachen die Osmanen die<br />
letzte Brücke und damit die letzte Verbindung Wiens über die Donau ab.<br />
Schon am Tag <strong>de</strong>s Eintreffens <strong>de</strong>r Osmanen schlugen in Wien die ersten Geschützkugeln ein. Erste ausgebrochene Brän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadt konnten bald wie<strong>de</strong>r gelöscht wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Bevölkerung lynchte daraufhin zwei mutmaßliche Brandstifter. Graf Starhemberg gab <strong>de</strong>n Befehl, <strong>zu</strong>sätzliche Brandschutzmaßnahmen vor<strong>zu</strong>nehmen und setzte eine Kompanie <strong>zu</strong>r<br />
Brandbekämpfung ein. Das Komödienhaus zwischen Burg und Augustinerkloster wur<strong>de</strong> aufgrund seiner vielen Holzaufbauten sofort vollständig abgetragen. Wenige Tage später, am 19.<br />
Juli, verursachte eine Bombe ein großes Feuer und drohte sich aus<strong>zu</strong>breiten. Die dafür aufgestellte Kompanie löschte <strong>de</strong>n Brand sehr schnell.<br />
Ein erster Angriff auf Klosterneuburg wur<strong>de</strong> am 17. Juli abgewehrt. Klosterneuburg hatte eine Schlüsselstellung für die Sicherung <strong>de</strong>s osmanischen Belagerungsheeres vor Wien. Die<br />
untere Stadt wur<strong>de</strong> geplün<strong>de</strong>rt und angezün<strong>de</strong>t, doch konnte Klosterneuburg <strong>de</strong>n Angriffen standhalten. Zwei Tage später wur<strong>de</strong> ein weiterer Angriff <strong>de</strong>r Osmanen auf Klosterneuburg<br />
<strong>zu</strong>rückgeschlagen.[11]<br />
Am 19. Juli kam <strong>de</strong>r Hofschatzmeister <strong>de</strong>s Sultans Mehmed IV., Ali Aga, ins osmanische Lager nach Wien. Er berichtete, dass Sultan Mehmed IV. bestürzt war über die Entscheidung,<br />
Wien an<strong>zu</strong>greifen. Sein Befehl war, die ungarischen Rebellen und die Feste Neuhäusl <strong>zu</strong> unterstützen und weitere Festungen in Ungarn <strong>zu</strong> nehmen und nicht auf Wien <strong>zu</strong> marschieren.<br />
Der Großwesir versuchte, durch militärische Erfolge <strong>de</strong>n Hofschatzmeister <strong>zu</strong> beschwichtigen, und machte verstärkt Druck auf seine Truppen. Doch bis <strong>zu</strong>r Abreise <strong>de</strong>s Hofschatzmeisters<br />
Ali Aga nach Edirne am 30. Juli <strong>zu</strong>r Berichterstattung beim Sultan konnte er diese nicht vorlegen.
Am 27. Juli wur<strong>de</strong> die völlige Mobilisierung aller wehrhaften Männer angeordnet. Auch erste Maßnahmen gegen Krankheiten wur<strong>de</strong>n getroffen.<br />
Nachrichtenkrieg<br />
Einen Boten, <strong>de</strong>r sich am 18. Juli aus Wien <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n kaiserlichen Truppen in Jedlesee durchschlagen wollte, griffen die Osmanen auf. Im Verhör nannte er die Truppenstärke Wiens. In <strong>de</strong>r<br />
Nacht <strong>zu</strong>m 20. Juli erreichte ein Kürassier die Festung und brachte Graf Starhemberg einen Brief von Herzog Karl V. Noch in <strong>de</strong>rselben Nacht machte sich <strong>de</strong>r Soldat auf <strong>de</strong>n Rückweg,<br />
wur<strong>de</strong> aber mit <strong>de</strong>n verschlüsselten Briefen von <strong>de</strong>n Osmanen abgefangen.<br />
Minenkrieg (Laufgräben durchs Glacis und erste Minen)<br />
Mit <strong>de</strong>m Eintreffen osmanischer Truppen begann ein Wettlauf bei <strong>de</strong>n Schützengräben auf <strong>de</strong>n Glacis. Bei<strong>de</strong> Parteien gruben Laufgräben aufeinan<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>. Schon am nächsten Tag führten<br />
die Wiener erste Ausfälle durch, um die Grabungsarbeiten <strong>zu</strong> stören. Innerhalb von drei Tagen kamen die Osmanen bis auf Angriffsweite an die Wiener Schanzen heran.<br />
Inzwischen wur<strong>de</strong>n im Graben die letzten Vorbereitungen getroffen. Eine Künette wur<strong>de</strong> ausgehoben, die bis <strong>zu</strong>m Grundwasser heranreichte, und drei Kaponniere, ein Nie<strong>de</strong>rwall wur<strong>de</strong>n<br />
vor <strong>de</strong>r Kurtine errichtet und eine dritte Verteidigungslinie rechts und links von <strong>de</strong>r Löwelbastei gebaut. Zusätzlich wur<strong>de</strong>n Querwälle und Palisa<strong>de</strong>n gezogen, die verhin<strong>de</strong>rten, dass die<br />
Osmanen bei <strong>de</strong>r Eroberung eines Teils <strong>de</strong>r Verteidigungsanlage einer Linie sofort die ganze Linie erobern konnten. Als am 18. Juli <strong>de</strong>r Großwesir Kara Mustafa die Schanzarbeiten<br />
besichtigte, ent<strong>de</strong>ckten die Osmanen eine Wasserleitung aus <strong>de</strong>n Vorstädten, gruben <strong>de</strong>n Wienern die Leitung ab und verwen<strong>de</strong>ten sie nun selbst. Die Stimmung im osmanischen Lager<br />
war sehr gut. Die Osmanen waren nun mit ihren Schanzen nur noch zwanzig Meter von <strong>de</strong>r Kontereskarpe entfernt. Vor <strong>de</strong>n Spitzen <strong>de</strong>r Burg- und Löwelbastei, wo auch die<br />
Kontereskarpe in das Glacis vorsprang, waren die Osmanen nur noch sechs Meter entfernt. Hier wur<strong>de</strong> bereits mit Flinten und Handgranaten gekämpft. Ein Bombenwurf brannte Teile <strong>de</strong>r<br />
vor<strong>de</strong>rsten Palisa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Belagerten nie<strong>de</strong>r.<br />
Ab <strong>de</strong>m 20. Juli begannen sich die Osmanen tiefer in die Er<strong>de</strong> ein<strong>zu</strong>graben. In je<strong>de</strong>m Abschnitt wur<strong>de</strong> eine Mine gegen die Palisa<strong>de</strong>n gegraben. Am 23. Juli kam es <strong>zu</strong>r ersten<br />
Minensprengung <strong>de</strong>r Osmanen vor <strong>de</strong>m Abschnitt <strong>de</strong>s Ravelin und <strong>de</strong>r Burgbastei. Ein Angriff <strong>de</strong>r Osmanen auf die Palisa<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> unter großen Verlusten bei<strong>de</strong>rseits großteils<br />
abgewehrt. In <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> je<strong>de</strong>r Hausbesitzer da<strong>zu</strong> verpflichtet, einen Mann ab<strong>zu</strong>stellen, <strong>de</strong>r im Keller horchte, ob gegraben o<strong>de</strong>r geklopft wird. Das Schlechtwetter tags darauf gab<br />
<strong>de</strong>n Belagerten einen Tag Pause. Aber am folgen<strong>de</strong>n 25. Juli ging <strong>de</strong>r Minenkampf weiter. Die Osmanen ließen eine Mine vor <strong>de</strong>r Löwelbastei hochgehen und sprengten einen Teil <strong>de</strong>r<br />
Palisa<strong>de</strong>n weg. Am folgen<strong>de</strong>n Tag sprengten mit geringer Wirkung die Belagerten Wiener die erste Mine unter <strong>de</strong>n Schanzen <strong>de</strong>r Osmanen.<br />
Am 28. Juli wur<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Ravelin die nächsten Minen <strong>de</strong>r Osmanen gesprengt. Die Palisa<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r ge<strong>de</strong>ckte Weg und die Kontereskarpe wur<strong>de</strong>n in einer Breite von sieben Metern<br />
gesprengt und in <strong>de</strong>n Graben geworfen. Ein Ausfall <strong>de</strong>r Wiener ermöglichte die Befestigung <strong>de</strong>s eingestürzten Teiles <strong>de</strong>r Kontereskarpe. Es gab hohe Verluste für die Wiener.<br />
Vor <strong>de</strong>r Burgbastei sprengten die Osmanen und die Wiener am 30. Juli je eine Mine, die die Laufgräben und <strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>ckten Weg auf <strong>de</strong>r Kontereskarpe beschädigten. Nach einem Angriff<br />
<strong>de</strong>r Osmanen und Gegenangriff <strong>de</strong>r Wiener zogen sich letztere von <strong>de</strong>n eigenen Laufgräben auf <strong>de</strong>n instandgesetzten ge<strong>de</strong>ckten Weg <strong>zu</strong>rück. Vor <strong>de</strong>m Ravelin stürmen die Osmanen bis<br />
vor die Palisa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Wiener. Vor <strong>de</strong>r Löwelbastei wur<strong>de</strong>n 30 Geschütze durch die Laufgräben in Stellung gebracht. Diese zerschossen am 31. Juli <strong>de</strong>n Kavalier <strong>de</strong>r Löwelbastei, die<br />
„Katze“. Die Geschütze darin wur<strong>de</strong>n zerstört o<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Katze herausgeholt. In <strong>de</strong>n Resten <strong>de</strong>r Katze wur<strong>de</strong>n Schießscharten gebrochen. Die Brustwehr <strong>de</strong>r Bastei wur<strong>de</strong> etwas<br />
abgetragen, um ein besseres Schussfeld gegen die eingegrabenen Osmanen <strong>zu</strong> haben. Die Laufgräben waren an manchen Stellen so nah, dass es <strong>zu</strong> Nahkämpfen kam.<br />
Ablauf <strong>de</strong>r osmanischen Belagerung in <strong>de</strong>r Umgebung von Wien<br />
Ein erster Angriff auf Klosterneuburg wur<strong>de</strong> am 17. Juli abgewehrt. Klosterneuburg hatte eine Schlüsselstellung für die Sicherung <strong>de</strong>s osmanischen Belagerungsheeres vor Wien. Die<br />
Verteidigung leitete <strong>de</strong>r 50-jährige Kammerschreiber Marcelinus Ortner, ein Laienbru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Stifts, <strong>de</strong>r von Beruf Tischler war. Die untere Stadt wur<strong>de</strong> geplün<strong>de</strong>rt und angezün<strong>de</strong>t, doch<br />
konnte Klosterneuburg dank <strong>de</strong>r Maßnahmen Ortners <strong>de</strong>n Angriffen standhalten. Zwei Tage später schlug er einen weiteren Angriff <strong>de</strong>r Osmanen auf Klosterneuburg <strong>zu</strong>rück.[11]<br />
Chronik in Europa<br />
Graf Philipp von Thurn traf am 14. Juli in Warschau ein und überbrachte die Nachricht von <strong>de</strong>r Belagerung Wiens. König Jan Sobieski gab Anweisungen, das Heer <strong>zu</strong> sammeln, und
wollte noch vor Monatsen<strong>de</strong> aufbrechen.<br />
Kaiser Leopold I. reiste weiter und erreichte am 17. Juli Passau. Dort trafen am 23. Juli die ersten bayerischen Hilfstruppen (10.000 Mann) ein. Am 27. Juli überbrachte Graf Philipp von<br />
Thurn in Passau die Botschaft, dass König Jan Sobieski und sein älterer Sohn Prinz Jakob Ludwig Heinrich mit 50.000 Mann bis En<strong>de</strong> August nach Wien komme. Der Jesuit Pater Wolff<br />
mel<strong>de</strong>te Kaiser Leopold I., dass 10.000 Mann aus Sachsen noch diesen Monat aufbrechen wer<strong>de</strong>n. Wenige Tage später kam die Nachricht aus Polen, dass Sobieski bis <strong>zu</strong>m 20. August vor<br />
Wien sein wer<strong>de</strong>. Er marschiere über Schlesien und Mähren.<br />
August<br />
Versorgungslage<br />
Am 1. August wur<strong>de</strong>n in Wien die Lebensmittelpreise fixiert. Erfolgreich war man mit dieser Verordnung nicht, sie musste in <strong>de</strong>n nächsten 7 Wochen fast täglich wie<strong>de</strong>rholt und auf<br />
Medikamente und an<strong>de</strong>re Gegenstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s täglichen Bedarfs ausge<strong>de</strong>hnt wer<strong>de</strong>n. Zusätzlich wur<strong>de</strong> die Unterbringung <strong>de</strong>r vielen Leichen geregelt. Auch diese Regelungen mussten alle<br />
paar Tage unter Androhung schwerer Strafen wie<strong>de</strong>rholt wer<strong>de</strong>n. Je länger die Belagerung dauerte, <strong>de</strong>sto härter musste die Stadtregierung gegen Preiswucherer durchgreifen, da <strong>de</strong>r<br />
Schwarzhan<strong>de</strong>l blühte.<br />
Das osmanische Belagerungsheer hatte ebenfalls mit Versorgungsproblemen <strong>zu</strong> kämpfen. Nachschub musste aus Ofen bezogen wer<strong>de</strong>n, weil in <strong>de</strong>r näheren Umgebung von <strong>de</strong>n Tataren<br />
sehr viel zerstört wor<strong>de</strong>n war. Hin<strong>zu</strong> kam, das die Belagerung sich länger zog als geplant. So gingen die Vorräte aus. Bis En<strong>de</strong> August waren alle Lebensmittel im osmanischen Lager<br />
verbraucht.<br />
Wiener Chronik<br />
Am 1. August beschossen die Osmanen während <strong>de</strong>r Heiligen Messe <strong>de</strong>n Stephansdom und begingen damit, ohne es <strong>zu</strong> merken, einen Wortbruch (siehe Eintrag am 15. September). Tags<br />
darauf wur<strong>de</strong> die Kapuzinerkirche bombardiert, sodass das Dach einstürzte.<br />
Am 8. August wur<strong>de</strong> ein 15-jähriger Junge als Spion aufgegriffen. Die Stadtbevölkerung war aber extrem nervös, und obwohl er alles abstritt, wur<strong>de</strong> er am 27. August geköpft. Die „Rote<br />
Ruhr“ brach aus und <strong>de</strong>zimierte die Stadtbevölkerung stark. Am 11. August erkrankte Graf Starhemberg daran und konnte sich erst am 20. August wie<strong>de</strong>r erholen.<br />
Ein Einberufungsbefehl erging am 26. August an alle Männer von Wien, die sich bisher von <strong>de</strong>r Stadtverteidigung drücken konnten, weil sie nicht tauglich waren o<strong>de</strong>r nicht wollten, und<br />
zwei Tage später musste Graf Starhemberg die To<strong>de</strong>sstrafe für jene, die sich noch immer vor <strong>de</strong>r Einberufung drückten, erlassen.<br />
Am 27. August wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Nacht 30 Raketen vom Stephansdom abgeschossen. In <strong>de</strong>r nächsten Nacht waren es bereits 100 Raketen.<br />
Die Wiener erkannten am 31. August erste Vorbereitungen <strong>de</strong>r Osmanen gegen <strong>de</strong>n bevorstehen<strong>de</strong>n Entsatz und begannen Hoffnung <strong>zu</strong> schöpfen. Graf Starhemberg setzte alle Mittel für<br />
die Kämpfe ein, ließ die Straßen und Häuser rund um <strong>de</strong>n Bereich Burgbastei und Löwelbastei in Verteidigungs<strong>zu</strong>stand setzen und richtete dort eine weitere Verteidigungslinie ein.<br />
Chronik <strong>de</strong>r Osmanen<br />
Großwesir Kara Mustafa ließ am 3. August <strong>de</strong>n Alaybeyi vom rechten Flügel (Burgbastei) wegen mangeln<strong>de</strong>r Erfolge absetzen. Auch <strong>de</strong>r Posten <strong>de</strong>s Arsenaloberst wur<strong>de</strong> nach Kritik<br />
neubesetzt.<br />
Am 22. August traf <strong>de</strong>r osmanische verbün<strong>de</strong>te Fürst von Siebenbürgen mit seinen Truppen im osmanischen Lager vor Wien ein. Er kritisierte die Pläne <strong>zu</strong>r Eroberung Wiens stark,<br />
weshalb <strong>de</strong>r verärgerte Großwesir Kara Mustafa ihn <strong>zu</strong>r Überwachung <strong>de</strong>r Brücken bei Raab in Ungarn <strong>zu</strong>rücksandte.<br />
Nachrichtenkrieg<br />
Ein berittener Bote Herzog Karls V. drang am 4. August bis <strong>zu</strong>r Stadt durch und brachte Nachrichten. Die Belohnungen und Bezahlungen für Kuriere wur<strong>de</strong>n immer teurer. Als Leutnant
Michael Gregorowitz am 8. August von Wien <strong>zu</strong> Herzog Karl V. nach Jedlesee drei Briefe überbrachte, wur<strong>de</strong> er <strong>zu</strong>m Kompaniechef beför<strong>de</strong>rt. Er schaffte es durch das osmanische Lager<br />
und <strong>de</strong>n Wienerwald bis <strong>zu</strong>m 16. August Herzog Karl V. <strong>zu</strong> erreichen. Der Orientwarenhändler Georg Franz Kolschitzky wur<strong>de</strong> am 13. August als Kurier aus <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> Herzog Karl V.<br />
entsandt und kam am 15. August dort an. Am 17. August kehrte Kolschitzky als Held <strong>zu</strong>rück. Er war durch die osmanischen Truppen nach Wien mit Nachrichten von Herzog Karl V.<br />
gelangt. Er brachte die Nachricht, dass ein Entsatzheer mit insgesamt 70.000 Mann sich bei Wien sammle und die ungarischen Rebellen geschlagen habe. Kolschitzky erhielt die<br />
versprochene Belohnung von 200 Dukaten. Der Kurier Seradly, <strong>de</strong>r Diener von Kolschitzky, wur<strong>de</strong> am 19. August aus Wien ins kaiserliche Feldlager nach Jedlesee entsandt. Die Hälfte<br />
<strong>de</strong>s Lohnes von 200 Dukaten erhielt er vor seinem Abmarsch. Am 21. August kehrte er mit einigen Briefen von Herzog Karl V. von Lothringen aus Jedlesee <strong>zu</strong>rück. Der Kurier Georg<br />
Michaelowitz (wird von manchen Zeitzeugen mit Kolschitzky o<strong>de</strong>r Leutnant Gregorowitz verwechselt) brach am 27. August mit einigen Briefen <strong>zu</strong> Herzog Karl V. auf. Er erhielt dafür<br />
die Belohnung von 100 Dukaten. Bei seiner Rückkehr am 1. September erhielt er weitere 100 Dukaten.<br />
Minenkrieg (durch die Palisa<strong>de</strong>n und die Kontereskarpe in <strong>de</strong>n Graben)<br />
Weitere Minen <strong>de</strong>r Osmanen beschädigten am 1. August die Kontereskarpe. Tags darauf nahmen die Osmanen die Palisa<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>r Löwelbastei ein. Am Abend ließen die Wiener unter<br />
<strong>de</strong>n osmanischen Laufgräben vor <strong>de</strong>r Löwelbastei eine Mine hochgehen. Eine weitere Mine <strong>de</strong>r Wiener explodierte vor <strong>de</strong>m Ravelin am 3. August. Aber die Wirkung <strong>de</strong>r Wiener Minen<br />
war um einiges schlechter als die <strong>de</strong>r osmanischen. Am Abend erfolgte beim Ravelin ein Angriff <strong>de</strong>r Osmanen und warf die Wiener aus <strong>de</strong>n Palisa<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m ge<strong>de</strong>ckten Weg die<br />
Kontereskarpe hinunter in <strong>de</strong>n Graben. Die Wiener räumten am folgen<strong>de</strong>n Tag die Stellungen an <strong>de</strong>r Palisa<strong>de</strong> vollständig. Eine Mine <strong>de</strong>r Wiener am 5. August bei <strong>de</strong>r Burgbastei schlug<br />
nach hinten aus und zerstörte einen großen Teil <strong>de</strong>s ge<strong>de</strong>ckten Weges. Der folgen<strong>de</strong> Angriff <strong>de</strong>r Janitscharen wur<strong>de</strong> abgewehrt. Die Stimmung <strong>de</strong>r Osmanen war noch gut.[17]<br />
Grabenkämpfe<br />
Die Osmanen legten vor <strong>de</strong>r Löwelbastei und <strong>de</strong>m Ravelin einen Tunnel an, <strong>de</strong>r bis in <strong>de</strong>n Graben führte. Gegen Abend <strong>de</strong>s 6. August drangen die ersten Osmanen vor <strong>de</strong>m Ravelin in <strong>de</strong>n<br />
Graben ein. Graf Starhemberg kam mit <strong>de</strong>n besten hun<strong>de</strong>rt Mann und vertrieb die Osmanen wie<strong>de</strong>r. Alle Wollsäcke, die die Osmanen <strong>zu</strong>m Schanzen mitgebracht hatten, wur<strong>de</strong>n in die<br />
Stadt gebracht. Es gab viele Tote auf bei<strong>de</strong>n Seiten. Doch schon am nächsten Morgen drangen die Osmanen über die Tunnel in <strong>de</strong>n Graben vor <strong>de</strong>n Bastionen ein, setzten sich fest und<br />
begannen sich in Richtung Ravelin vor<strong>zu</strong>arbeiten. Es wur<strong>de</strong> eine erste Mine im Graben zwischen Löwelbastei und Ravelin gesprengt, <strong>de</strong>ren Erdaufwurf für weitere Schanzen verwen<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>. Durch heftigen Beschuss stürzte <strong>de</strong>r Tunnel vor <strong>de</strong>r Burgbastei ein und begrub dreißig Osmanen unter sich. Am 8. August erreichte bei einem Sturmangriff erstmals ein Soldat <strong>de</strong>r<br />
Osmanen die Stadtmauer. Tags darauf sprengten die Osmanen eine Mine vor <strong>de</strong>r Löwelbastei, wodurch sie <strong>de</strong>n Weg für <strong>de</strong>n Tunnel in <strong>de</strong>n Stadtgraben öffneten und sich endgültig<br />
festsetzen konnten.<br />
Minenkrieg (Angriff auf die zweite Verteidigungslinie)<br />
Die Osmanen sprengten am 9. August die erste Mine unter <strong>de</strong>m Ravelin und rissen sieben Meter Mauer mit. Die Bresche in <strong>de</strong>r Mauer wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Wienern sofort abgeriegelt. In <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n Tagen wur<strong>de</strong>n auch die Löwelbastei und die Burgbastei angegriffen. Die Kaponniere wur<strong>de</strong>n vollständig verschüttet und mit <strong>de</strong>r nächsten Mine zerstört. Ausfälle <strong>de</strong>r Wiener,<br />
um die Tunnel in <strong>de</strong>n Graben <strong>zu</strong> zerstören und damit <strong>de</strong>n Zugang in <strong>de</strong>n Graben <strong>zu</strong> blockieren, scheiterten mit hohen Verlusten. Der Druck <strong>de</strong>r Osmanen ließ nicht nach.<br />
Am 12. August gab es weiter heftige Gefechte um das Ravelin, und zwei Minen unter <strong>de</strong>r Burgbastei wur<strong>de</strong>n gesprengt. Die Wirkung war schwach und schlug teilweise nach hinten aus,<br />
<strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong> Sturmangriff scheiterte unter hohen Verlusten <strong>de</strong>r Osmanen. Eine weitere Mine unter <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s Ravelins zeigte gute Wirkung. Das Ravelin wur<strong>de</strong> in zwei Teile<br />
geteilt. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Ravelin und auf <strong>de</strong>n Basteien Vorkehrungen getroffen, damit, wenn Teile in osmanische Hand fallen, <strong>de</strong>r Festungsabschnitt trotz<strong>de</strong>m verteidigungsfähig<br />
bleibt. Die Stimmung <strong>de</strong>r Osmanen schwankte.<br />
Mitte August wur<strong>de</strong> eine Mine <strong>de</strong>r Osmanen durch Palisa<strong>de</strong>n unbrauchbar gemacht, eine zweite Mine durch Kanonen zerstört und eine dritte Mine durch Gegensprengung vernichtet. Am<br />
15. August setzten sich die Osmanen im Festungsgraben vor <strong>de</strong>r Löwelbastei fest und gruben sich bis <strong>zu</strong>r Künette in <strong>de</strong>r Grabenmitte vor. Bei einem Ausfall <strong>de</strong>r Wiener wur<strong>de</strong>n alle dort<br />
verschanzten Osmanen getötet, ihre Rampen, Stützbalken und alles Holz angezün<strong>de</strong>t, und ihre Minen zerstört, danach kehrten die Wiener auf die Löwelbastei <strong>zu</strong>rück. Es dauerte zwölf<br />
Tage, bis die Osmanen diese Stellung wie<strong>de</strong>r voll unter ihrer Kontrolle hatten. Die Stimmung <strong>de</strong>r Osmanen verschlechterte sich weiter.<br />
In <strong>de</strong>n nächsten Tagen kam es im gesamten Graben <strong>zu</strong> schweren Gefechten ohne merklichen Fortschritt einer Seite. Die Wiener unternahmen am 18. August einen erfolglosen Ausfall bei
<strong>de</strong>r Burgbastei. Es han<strong>de</strong>lte sich dabei um eine aus <strong>de</strong>n Stadtbürgern gebil<strong>de</strong>te Freiwilligenkompanie, die auf eigene Faust han<strong>de</strong>lte. In Wien erging drei Tage später die Verordnung, dass<br />
niemand mehr ohne Befehl Ausfälle wagen darf. Die Osmanen sprengten unter <strong>de</strong>r Burgbastei am 20. August zwei Minen und unter <strong>de</strong>m Ravelin eine Mine. Den gesamten Tag wur<strong>de</strong>n<br />
die Basteien erfolglos von <strong>de</strong>n Osmanen gestürmt. Ein Angriff <strong>de</strong>r Wiener gegen die Tunnel vor <strong>de</strong>r Burgbastei am 22. August zeigt wenig Wirkung. Die Osmanen flüchteten aus <strong>de</strong>m<br />
Graben, besetzen ihn aber einige Stun<strong>de</strong>n später wie<strong>de</strong>r. In <strong>de</strong>n nächsten Tagen gab es je<strong>de</strong> Menge kleinerer Minen, Stürme, Ausfälle und vor allem Tote auf bei<strong>de</strong>n Seiten.<br />
Trotz starken Regens <strong>de</strong>r die Gräben volllaufen ließ, wur<strong>de</strong> weiter gekämpft. Nach einer gesprengten Mine unter <strong>de</strong>m Ravelin griffen die Osmanen wie<strong>de</strong>r erfolglos an und hatten hohe<br />
Verluste. Am osmanischen Feiertag <strong>de</strong>r Köpfung von Johannes <strong>de</strong>m Täufer (29. August) zün<strong>de</strong>ten sie eine beson<strong>de</strong>rs große Mine unter <strong>de</strong>m Ravelin und sprengten das meiste in die Luft.<br />
Der letzte Rest <strong>de</strong>s Ravelins wur<strong>de</strong> auf Befehl <strong>de</strong>r Wiener Offiziere geräumt. Von <strong>de</strong>r Stadtregierung ging die Auffor<strong>de</strong>rung, Wasserbottiche in <strong>de</strong>r Stadt verteilt auf<strong>zu</strong>stellen, um<br />
Grabungstätigkeiten schneller <strong>zu</strong> erkennen. Auf <strong>de</strong>m Wasserspiegel <strong>de</strong>r Bottiche sah man bei <strong>de</strong>r kleinsten Erschütterung durch das unterirdische Graben ein verzerrtes Spiegelbild.<br />
Bei einem Zufallstreffer <strong>de</strong>r Osmanen am 31. August hinter <strong>de</strong>r Löwelbastei wur<strong>de</strong> ein Munitionslager getroffen, das auch die nebenliegen<strong>de</strong>n Schwarzpulverlager entzün<strong>de</strong>te. Die<br />
Schwarzpulvervorräte wur<strong>de</strong>n dadurch empfindlich reduziert.<br />
Ablauf <strong>de</strong>r osmanischen Belagerung in <strong>de</strong>r Umgebung von Wien<br />
Die Osmanen eroberten am 3. August Pottendorf, Ebreichsdorf und Götzendorf unter Tötung und Verschleppung <strong>de</strong>r ansässigen Bevölkerung. Am 24. August griffen die Janitscharen<br />
erneut Klosterneuburg an, das sie als Stützpunkt gegen das Entsatzheer verwen<strong>de</strong>n wollten. Der Angriff dauerte bis <strong>zu</strong>m 26. August und konnte erfolgreich abgewehrt wer<strong>de</strong>n.[11]<br />
Chronik in Europa<br />
Um <strong>de</strong>n 3. August gab es viele kleinere und größere Scharmützel zwischen polnischen Hilfstruppen und kaiserlichen Truppen gegen Tataren, ungarischen Rebellen und Osmanen. Der<br />
August war durch langes Warten <strong>de</strong>s Kaisers Leopold I. in Passau auf Truppen für das Entsatzheer gekennzeichnet. Vom 9. bis 11. August erkrankte Kaiser Leopold I. und lag mit Fieber,<br />
Durchfall und Erbrechen im Bett.<br />
Am 8. August traf Prinz Eugen von Savoyen in Passau ein. Er berichtete, dass alle an<strong>de</strong>ren französischen Offiziere, die sich <strong>de</strong>n Österreichern anschließen wollten, eingesperrt wur<strong>de</strong>n.<br />
Am 12. August stießen 1.000 Mann von <strong>de</strong>m Regiment <strong>de</strong>s Prinzen Ludwig von Neuburg <strong>zu</strong>m Heer und am 21. August 8.000 Franken.<br />
Erst am 14. August und nicht wie versprochen En<strong>de</strong> Juli marschierte König Jan Sobieski mit seiner Armee von Krakau aus Richtung Wien. Er war am 22. August bei Gleiwitz und<br />
erreichte am folgen<strong>de</strong>n Tag Troppau.<br />
Am 24. August brach Herzog Karl V. mit seinen Truppen donauaufwärts auf, um <strong>zu</strong>m Treffpunkt in Tulln <strong>zu</strong> kommen. Bei Bisamberg traf er auf Osmanen und ungarische Hilfstruppen<br />
und besiegte sie mit seiner Kavallerie.<br />
Am 25. August zog das Entsatzheer unter Kaiser Leopold I. Richtung Wien. Leopold I. fuhr mit <strong>de</strong>m Schiff von Passau nach Linz, erreichte es 3 Tage später und setzte seinen Marsch auf<br />
Wien unverzüglich fort. Am 31. August traf Sobieski mit Herzog Karl V. in Hollabrunn <strong>zu</strong>sammen.<br />
September<br />
Anfang September ging in <strong>de</strong>r Stadt wie auch im osmanischen Lager die Nahrung aus. Die Nahrungsmittelknappheit in <strong>de</strong>r Stadt konnte etwas gemil<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, als am 3. September bei<br />
zwei weiteren Ausfällen beim Schottentor 22 Ochsen, zwei Pfer<strong>de</strong> und ein Wagen eingebracht wur<strong>de</strong>n.<br />
Wiener Chronik<br />
Am 3. September wur<strong>de</strong>n vom Stephansdom in <strong>de</strong>r Nacht 30 Raketen abgeschossen, am 6., 7. und 8. September waren es bereits so viele, dass sie nicht gezählt wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
Drakonische Maßnahmen gegen Deserteure und Wehrdienstverweigerer wur<strong>de</strong>n am 6. September in Wien beschlossen. Wer krank o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> alt für die Arbeit war, musste ein ärztliches<br />
Attest vorweisen. Am 9. September starb <strong>de</strong>r Wiener Bürgermeister Johann Andreas von Liebenberg nach einer mehrwöchigen Krankheit. In <strong>de</strong>n Straßen hinter <strong>de</strong>r Burg- und
Löwelbastei wur<strong>de</strong> am 10. September heftig gegraben, Palisa<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n gebaut und Laufgänge für eine weitere Verteidigungslinie angelegt.<br />
Chronik <strong>de</strong>r Osmanen<br />
Am 7. September hielt Großwesir Kara Mustafa eine Musterung ab. Er wollte die Stadt noch vor Eintreffen <strong>de</strong>s Entsatzheeres erobern. In einer großen Umgruppierung stellten sich die<br />
Osmanen in <strong>de</strong>n nächsten Tagen für die Entsatzschlacht neu auf. Kara Mustafa hielt Kriegsrat über die bevorstehen<strong>de</strong> Schlacht gegen das Entsatzheer. Er nahm seine Anführer <strong>zu</strong> einem<br />
Erkundungsritt nah <strong>de</strong>n Aufmarschwegen mit, auf <strong>de</strong>nen das Entsatzheer anrücken könnte.<br />
Nachrichtenkrieg<br />
Am 1. September brachte Georg Michaelowitz unter Lebensgefahr Nachrichten von Herzog Karl V. in die Stadt: <strong>de</strong>r Entsatz sei unterwegs und wer<strong>de</strong> in einigen Tagen eintreffen. Bereits<br />
am nächsten Tag brach er wie<strong>de</strong>r mit neuen Botschaften aus <strong>de</strong>r Stadt auf. Er erhielt dafür gegen <strong>de</strong>n ausdrücklichen Willen <strong>de</strong>s Rechnungsbeamten, 200 Dukaten im voraus. In <strong>de</strong>r<br />
Botschaft an <strong>de</strong>n Kaiser wur<strong>de</strong> darauf gedrängt, <strong>de</strong>n Entsatz <strong>zu</strong> beschleunigen. Die Verteidiger wären nahe am En<strong>de</strong> ihrer Kräfte angelangt.<br />
Stefan Seradly erhielt am 4. September 120 Dukaten für die Überbringung von Briefen an das Entsatzheer. Er verriet aber die Wiener und lief <strong>zu</strong> Großwesir Kara Mustafa über. Dieser<br />
erfuhr dadurch von <strong>de</strong>r geplanten Entset<strong>zu</strong>ng Wiens und zog Verstärkung heran.<br />
Am 8. September wur<strong>de</strong>n zwei <strong>de</strong>utsche Kuriere auf <strong>de</strong>m Weg nach Wien abgefangen.<br />
Minenkrieg (Angriff auf die Stadtmauer)<br />
Am 1. September hatten die Osmanen mehrere Minen bei <strong>de</strong>r Löwelbastei unter die Kurtine getrieben. Die Wiener machten einen Ausfall, um die Minen <strong>zu</strong><strong>zu</strong>schütten, scheitern aber am<br />
starken Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Osmanen. Am nächsten Tag ließen die Osmanen bei <strong>de</strong>r Burgbastei eine Mine hochgehen. Die Wirkung war minimal. Durch die Mine war es aber <strong>de</strong>n Osmanen<br />
jetzt leichter, in die Burgbastei <strong>zu</strong> kommen. An <strong>de</strong>r Löwelbastei unterwühlten die Osmanen die Stadtmauer. Bei einem Ausfall <strong>de</strong>r Wiener gegen die Minen <strong>de</strong>r Osmanen wur<strong>de</strong>n alle<br />
Angreifer getötet. Am 3. September ging die nächste Mine an <strong>de</strong>r Burgbasteispitze hoch. Es fielen etliche Qua<strong>de</strong>rstücke heraus. Die Wiener machten wie<strong>de</strong>r einen Ausfall, um weitere<br />
Minen <strong>zu</strong> zerstören, ohne greifbare Ergebnisse. An diesem Tag war die Anzahl <strong>de</strong>r Toten auf bei<strong>de</strong>n Seiten sehr hoch. Graf Starhemberg gab die letzten Reste vom Ravelin, Kontereskarpe<br />
und Kaponniere auf. Die Minen <strong>de</strong>r Osmanen kamen jetzt zwei bis drei Meter unter die Stadtmauer. Beim Minieren und Kontraminieren gerieten die Osmanen und Wiener aufeinan<strong>de</strong>r,<br />
wodurch sich ein Gemetzel entwickelte.<br />
Am 4. September kam es <strong>zu</strong>r ersten Minensprengung unter <strong>de</strong>r Kurtine. Die Wirkung war sehr stark, die Mauerteile fielen aber nach außen, wodurch <strong>de</strong>r Angriff erschwert und verzögert<br />
wur<strong>de</strong> und scheiterte am Verteidigungswillen <strong>de</strong>r Bevölkerung, die in kürzester Zeit durch Einschlagen von Palisa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Durchgang sperrten. Bei einer weiteren Minensprengung und<br />
Sturm <strong>de</strong>r Osmanen an <strong>de</strong>r Burgbastei wur<strong>de</strong> eine acht Meter breite Bresche in die Burgbastei geschlagen. Von allen Seiten kamen Osmanen für <strong>de</strong>n Angriff. Erste Janitscharen wur<strong>de</strong>n<br />
auf <strong>de</strong>r Bastei gesichtet. Aber die Steigung im Geröll auf die Burgbastei war <strong>zu</strong> stark. Durch gestaffelten Beschuss konnte <strong>de</strong>r Angriff nach zwei Stun<strong>de</strong>n abgewehrt wer<strong>de</strong>n. Mit<br />
spanischen Reitern und Sandsäcken schlossen die Wiener die Bresche. Allein dieser Sturm kostete die Wiener 200 Mann, darunter mehrere Offiziere. In <strong>de</strong>r Nacht wur<strong>de</strong> die Bresche<br />
vollständig geschlossen. Holz von Dächern und an<strong>de</strong>ren Bauteilen in Wien wur<strong>de</strong> abgerissen, um es als Palisa<strong>de</strong>n bei Burg- und Löwelbastei <strong>zu</strong> verwen<strong>de</strong>n. Die Stimmung <strong>de</strong>r Osmanen<br />
erreichte nach diesem Tag einen Tiefpunkt. Am nächsten Tag versuchten es die Osmanen erneut. Sie wollten die Stadt über die Löwelbastei nehmen. Die Stadtverteidiger hatten sich neu<br />
in 64 Kampfgruppen gruppiert. Nach <strong>de</strong>r Sprengung von zwei weiteren Minen an <strong>de</strong>r äußersten Spitze <strong>de</strong>r Löwelbastei gelang es, unter hohen Verlusten für bei<strong>de</strong> Seiten, <strong>de</strong>n Sturm auf<br />
die Löwelbastei ab<strong>zu</strong>wehren. Als die Sperren immer dichter wur<strong>de</strong>n, nahmen die Osmanen wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Minenkampf auf. In Wien stan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt nur noch zirka 5000<br />
verteidigungsfähige Männer <strong>zu</strong>r Verfügung.[18]<br />
Die Osmanen eroberten am 8. September <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rwall. Die Wiener versuchten ihn in einem Gegenangriff wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern, die Osmanen schlugen dies aber <strong>zu</strong>rück.<br />
Gleichzeitig bereiteten sie an dieser Stelle weitere Minen an <strong>de</strong>r Kurtine vor und sprengten nachmittags zwei Minen unter <strong>de</strong>r Löwelbastei. Je<strong>de</strong> Menge Mauerwerk lan<strong>de</strong>te im Graben.<br />
Trotz<strong>de</strong>m war die Mauer nachher eher steiler als flacher und so konnte <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong> Angriff leicht <strong>zu</strong>rückgeschlagen wer<strong>de</strong>n. Es kam <strong>zu</strong> ersten Meutereien im osmanischen Lager.<br />
Am 12. September stellten sich die Osmanen für die Entsatzschlacht beim Kahlengebirge bis Hütteldorf auf und trieben gleichzeitig fünf Minen bis unter die Stadtmauern. Sie waren bis
<strong>zu</strong> zwei Meter tief unter <strong>de</strong>r Kurtine eingedrungen und stan<strong>de</strong>n kurz davor, die Ladungen <strong>zu</strong> setzen und <strong>zu</strong> sprengen.<br />
Chronik in Europa<br />
Am 4. September war Kriegsrat <strong>zu</strong> Stetteldorf am Wagram auf Schloss Juliusburg bei Tulln unter <strong>de</strong>m Vorsitz von König Jan Sobieski. Zusammen mit Herzog Karl V. wur<strong>de</strong> die weitere<br />
Marschroute und Taktik <strong>zu</strong>m Entsatz von Wien festgelegt. Hierbei kam es <strong>zu</strong> einem diplomatischen Disput zwischen Karl V. und Sobieski um die Frage <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Entsatzheeres.<br />
Kaiser Leopold I. hatte das Kommando im Vorfeld vertraglich an Sobieski abgetreten, um diesen <strong>zu</strong> einer Teilnahme am gemeinsamen Krieg gegen die Osmanen <strong>zu</strong> bewegen. Die<br />
Differenzen zwischen Herzog Karl V. und König Sobieski wur<strong>de</strong>n schließlich durch diplomatische Intervention von Marco d'Aviano, päpstlicher Legat und Beichtvater von Leopold I.,<br />
beseitigt.<br />
Am 6. September kam <strong>de</strong>r Kurfürst von Bayern nach Linz. Fränkische, sächsische, bayrische und schwäbische Kontingente überquerten die Donau bei Krems und rückten weiter<br />
Richtung Tulln vor. Am Tag darauf überquerte die Polnische Armee die Donau bei Tulln und vereinigte sich mit <strong>de</strong>n Truppen Sachsens, <strong>de</strong>n Kaiserlichen, <strong>de</strong>n Bayern und <strong>de</strong>n fränkischschwäbischen<br />
Reichstruppen in dieser Stadt, 30 Kilometer stromaufwärts von Wien. Die Tataren, die für die Bewachung <strong>de</strong>r Brücke abgestellt waren, verhin<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>n Brückenkopf nicht.<br />
Kaiser Leopold I. fuhr von Linz Richtung Wien mit <strong>de</strong>m Schiff ab. In Dürnstein machte er am 9. September Station. Da er König Sobieski die Leitung <strong>de</strong>r Schlacht abgetreten hatte,<br />
konnte er nicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Truppen weiterreisen. Er setzte Herzog Karl V. an seine Stelle <strong>zu</strong>r Leitung <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen ein.<br />
Beim letzten großen Kriegsrat <strong>de</strong>r christlichen Allianz wur<strong>de</strong> auf Anraten Herzog Karls V. beschlossen, durch <strong>de</strong>n Wienerwald unter Zurücklassung <strong>de</strong>s Trosses in 3 Kolonnen auf Wien<br />
vor<strong>zu</strong>rücken. Der Weg für das Entsatzheer durch <strong>de</strong>n Wienerwald war beschwerlich, da es nur wenige schlecht befestigte Wege gab und die Artillerie nicht o<strong>de</strong>r nur begrenzt<br />
mitgenommen wer<strong>de</strong>n konnte. Es mangelte während <strong>de</strong>s Anmarsches auch an Verpflegung. Da <strong>de</strong>r Tross <strong>zu</strong>rückgelassen wur<strong>de</strong>, gab es keinen Lebensmittelnachschub. Die Truppen<br />
mussten ohne Verpflegung zwei Tage marschieren. Dafür gab es aber keine weiteren Schwierigkeiten beim Vormarsch. Großwesir Kara Mustafa hatte es versäumt, die Donaubrücken <strong>zu</strong><br />
sichern und Klosterneuburg <strong>zu</strong> erobern, das nun <strong>zu</strong> einem wichtigen Brückenkopf <strong>de</strong>r Alliierten wur<strong>de</strong>. Weiterhin gab es keine Befestigung <strong>de</strong>s Kahlengebirges. Am Morgen <strong>de</strong>s 12.<br />
September stiegen die Alliierten vom Kahlengebirge herunter für die Schlacht am Kahlenberg.<br />
Schlacht am Kahlenberg<br />
Am 11. September besetzten die alliierten christlichen Truppen das Kahlengebirge. In <strong>de</strong>n Morgenstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s 12. Septembers griff das Entsatzheer mit Truppen aus Venedig, Bayern,<br />
Sachsen, Franken, Schwaben, Ba<strong>de</strong>n, Oberhessen und Polen an, zirka 54.000 bis 60.000 Mann. Die osmanischen Kommandanten konnten sich über die Taktik für <strong>de</strong>n Zweifrontenkrieg<br />
nicht einigen. Nach zwölfstündigen Kampf griff die Kavallerie unter <strong>de</strong>m Oberkommando von König Sobieski von <strong>de</strong>n Höhen <strong>de</strong>s Wienerwal<strong>de</strong>s her ein. Die gesamte christliche<br />
Streitmacht ging <strong>zu</strong>m Generalangriff über, <strong>de</strong>nn auch die Wiener begannen mit einem Ausfall, als sie sahen, dass die Schlacht am Kahlenberg <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Christen ausging, und<br />
stürmten die Laufgräben <strong>de</strong>r Osmanen. Das osmanische Heer flüchtete überstürzt und sammelte sich bei Győr/Raab.<br />
Folgen <strong>de</strong>r Belagerung<br />
Am 13. September betrat König Sobieski die Stadt. Die kaiserlichen Truppen drängten auf eine sofortige Verfolgung <strong>de</strong>r Truppen, aber Sobieski wollte sein Pferd nicht weiter belasten. So<br />
begann die allgemeine Plün<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Osmanen <strong>zu</strong>rückgelassenen Tiere, Lebensmittel, Güter, Materialien, Waffen, Geschütze und Munition. Das meiste, insbeson<strong>de</strong>re die<br />
Zeltburg von Großwesir Kara Mustafa, wur<strong>de</strong> von Sobieski einbehalten, während die kaiserlichen Truppen fast leer ausgingen.[19]<br />
Die Wiener Bevölkerung verschoss im Freu<strong>de</strong>ntaumel wahllos Munition. Nach <strong>de</strong>r Belagerung wur<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Stadtmauer hinter <strong>de</strong>m zerschossenen und aufgegebenen Ravelin mehrere mit<br />
Schwarzpulver gefüllte Minen gefun<strong>de</strong>n. Diese sechs Meter tief unter <strong>de</strong>r Kurtine gelegenen Minen waren fertig <strong>zu</strong>r Sprengung, wur<strong>de</strong>n aber infolge <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage nicht mehr gezün<strong>de</strong>t.<br />
Als Kaiser Leopold I. vom Sieg <strong>de</strong>r Entsatztruppen erfuhr, begab er sich mit <strong>de</strong>m Schiff von Dürnstein nach Klosterneuburg. Am nächsten Tag fuhr er weiter nach Wien und zog in die<br />
befreite Stadt ein.<br />
Großwesir Kara Mustafa suchte nach <strong>de</strong>r Schlacht einen Schuldigen. Er ließ Ibrahim Pascha, <strong>de</strong>n Beylerbeyi von Ofen, hinrichten, weil er angeblich <strong>de</strong>r Erste war, <strong>de</strong>r sich vom<br />
Schlachtfeld <strong>zu</strong>rückgezogen hatte. Wahrscheinlich wollte er sich aber nur eines Zeugens entledigen, <strong>de</strong>r hätte aussagen können, dass Ibrahim Pascha die Zweifronten-Taktik gegen Wien
und das Entsatzheer für falsch hielt.<br />
1683 wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stern und <strong>de</strong>r Halbmond am Stephansdom, <strong>de</strong>r seit 1519 dort die Spitze zierte (damals allerdings nicht als osmanisches Symbol angebracht), heruntergenommen und<br />
durch ein Kreuz ersetzt.[20] Kaiser Leopold I. und König Jan Sobieski trafen sich <strong>zu</strong> Pfer<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Nähe von Schwechat. Das Verhältnis bei<strong>de</strong>r Herrscher <strong>zu</strong>einan<strong>de</strong>r war etwas gestört.<br />
Der Ruhm <strong>de</strong>r gewonnenen Entsatzschlacht ging an König Sobieski, da <strong>de</strong>r Kaiser die Führung vertraglich hatte abtreten müssen, um die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Polen <strong>zu</strong> erhalten. An <strong>de</strong>r<br />
Stelle, an <strong>de</strong>r sich die bei<strong>de</strong>n Herrscher trafen, wur<strong>de</strong> später das sogenannte Kugelkreuz aufgestellt. Es ist ein auf vier Türkenkugeln ruhen<strong>de</strong>r Obelisk.[11][21] In Schwechat wur<strong>de</strong> von<br />
<strong>de</strong>n alliierten Truppen eine Para<strong>de</strong> abgehalten. Die Kurfürsten von Bayern und Sachsen zogen anschließend mit ihren Truppen wie<strong>de</strong>r ab. Erst am 18. September begannen König<br />
Sobieski und Herzog Karl V. mit <strong>de</strong>r Verfolgung <strong>de</strong>r geschlagenen osmanischen Streitkräfte. Da aber die Fliehen<strong>de</strong>n nicht sofort verfolgt wor<strong>de</strong>n waren, konnten sie sich bei Párkány<br />
wie<strong>de</strong>r sammeln. Entgegen <strong>de</strong>n Empfehlungen von Herzog Karl V. und ohne auf weitere kaiserliche Truppen <strong>zu</strong> warten, die einen Tagesmarsch hinter <strong>de</strong>n polnisch-österreichischen<br />
Truppen <strong>zu</strong>rücklagen, zog König Sobieski am 7. Oktober Richtung Párkány. Der König, alle Warnungen ignorierend, vertraute <strong>de</strong>n Berichten osmanischer Gefangenen, dass die Garnison<br />
in Párkány nur sehr klein sei. Er wusste aber nicht, dass sich dort bereits ein 40.000 Mann starkes osmanisches Kontingent versammelt hatte, das <strong>zu</strong> großen Teilen aus Truppen bestand,<br />
die nicht an <strong>de</strong>r Schlacht um Wien teilgenommen hatten.<br />
Die Vorhut, unter <strong>de</strong>m Kommando von Stefan Bidzieński, wur<strong>de</strong> sofort in ein Gefecht verwickelt und fast vollständig aufgerieben (circa 2.000 Mann). Die fliehen<strong>de</strong>n Reste <strong>de</strong>r Vorhut<br />
sehend, ließ <strong>de</strong>r König seine Infanterie und Artillerie hinter sich und stellte sich mit nur 4.000 Mann Hussaria <strong>de</strong>m zahlenmäßig überlegenen Feind entgegen. Trotz kleinerer Erfolge war<br />
die polnische Front, aufgrund <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>n Infanterie und Artillerie, nicht <strong>zu</strong> halten und brach schließlich <strong>zu</strong>sammen. König Sobieski wollte <strong>de</strong>nnoch weiterkämpfen, woraufhin ihn die<br />
Offiziere, beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r österreichische Feldmarschall von Dünewald, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m polnischen König während <strong>de</strong>r Schlacht <strong>zu</strong>r Seite stand, baten, an sein Leben <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nken. Als er von einer<br />
Welle in Panik verfallener Soldateska ergriffen wur<strong>de</strong>, zog er sich <strong>zu</strong>rück. Aus einem Bericht <strong>de</strong>s polnischen Adligen und Schriftstellers, Jan Chryzostom Pasek, ist <strong>zu</strong> entnehmen:<br />
„Der König kam also mit <strong>de</strong>m Heer auf gleiche Höhe mit jenen Leichen <strong>de</strong>r Vorhut, gleich verließ die unseren <strong>de</strong>n Mut, und da sprangen uns die Türken wie die Rasen<strong>de</strong>n an.<br />
Man begann <strong>zu</strong>erst, ihnen schwachen Wi<strong>de</strong>rstand <strong>zu</strong> leisten. Als sie aber <strong>de</strong>r Eskadron <strong>de</strong>r ruthenischen Wojewo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Kronhetmanns in <strong>de</strong>n Rücken gekommen waren, da<br />
begann die Husareneskradon davon<strong>zu</strong>laufen, eine zweite nach, eine dritte, schließlich gab das ganze Heer Fersengeld, mit <strong>de</strong>m König und allen Hetmannen, alle <strong>zu</strong> ihrer großen<br />
Schan<strong>de</strong> und <strong>zu</strong>m Gelächter für die Deutschen. Schimpflich flohen sie eine gute Meile, bis sie sich auf die Kaiserlichen stützen konnten.[22]“<br />
Nach Auflösung <strong>de</strong>r polnischen Kavallerie zogen sich die Polen fluchtartig <strong>zu</strong>rück. König Sobieski entkam nur mit großer Mühe dank <strong>de</strong>r Hilfe seiner tatarischen Hilfstruppen unter<br />
Kommando <strong>de</strong>s Lipka-Tataren, Oberst Samuel Mirza Krzeczowski.[23] Zwei Tage später, am 9. Oktober, nach erfolgter Verstärkung <strong>de</strong>r polnischen Kavallerie durch Infanterie, Artillerie<br />
und kaiserliche Truppen, wur<strong>de</strong>n die Osmanen in <strong>de</strong>r zweiten Schlacht von Párkány geschlagen.<br />
Am 21. Oktober eroberten die kaiserlichen Truppen und die Polen Gran. Am 25. Dezember wur<strong>de</strong> Großwesir Kara Mustafa, auf <strong>de</strong>m Rück<strong>zu</strong>g in Belgrad angekommen, auf Befehl <strong>de</strong>s<br />
Sultans erdrosselt. Er hatte die Schlacht um Wien trotz dreifacher Übermacht verloren. Als Dank für die Befreiung Wiens wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Katholischen Kirche am 12. September das Fest<br />
Mariä Namen eingeführt.<br />
Durch die sich anschließen<strong>de</strong>n Eroberungen im Zuge <strong>de</strong>s Großen Türkenkrieges in Süd-Osteuropa stieg das Haus Österreich auf Kosten <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches <strong>zu</strong>r europäischen<br />
Großmacht auf.<br />
Spuren <strong>de</strong>r osmanischen Belagerung<br />
Wien<br />
• Im Türkenschanzpark im 18. Bezirk haben sich osmanische Einheiten (unter an<strong>de</strong>rem Janitscharen) beson<strong>de</strong>rs heftig gegen die Angriffe <strong>de</strong>s Entsatzheeres <strong>zu</strong>r Wehr gesetzt. Der<br />
Türkenschanzpark erinnert mit seinem Namen noch heute an dieses Gefecht, ebenso die Türkenschanzstraße in <strong>de</strong>r Nähe.<br />
• Nahe <strong>de</strong>m Türkenschanzplatz erinnert die Rimplergasse an <strong>de</strong>n obersten Festungsbauer und Mineur Oberstleutnant Georg Rimpler[10].<br />
• Der Türkenritthof an <strong>de</strong>r Hernalser Hauptstraße im 17. Bezirk erinnert an einen alten Brauch aus <strong>de</strong>r Belagerungszeit, bei <strong>de</strong>m ein verklei<strong>de</strong>ter ‚Türke‘ auf einem Esel durch die<br />
Straßen paradierte.[24] Der Gemein<strong>de</strong>bau aus <strong>de</strong>n 1920er-Jahren ist mit einer entsprechen<strong>de</strong>n Statue über <strong>de</strong>m Eingang geschmückt.[25]
• Im 9. Bezirk befin<strong>de</strong>t sich die Türkenstraße.<br />
• Die Hei<strong>de</strong>nschussgasse im 1. Bezirk beherbergt die Statue eines osmanischen Janitscharen am Palais Montenuovo. Sie erinnert an eine Legen<strong>de</strong>, nach <strong>de</strong>r die Osmanen<br />
versuchten, an dieser Stelle die Stadtmauern unterirdisch <strong>zu</strong> sprengen und fast Erfolg hatten. Der Legen<strong>de</strong> nach wur<strong>de</strong>n sie von einem Bäckergesellen aus Münster ent<strong>de</strong>ckt, <strong>de</strong>r<br />
die Wache alarmierte<br />
• Aus <strong>de</strong>r Bronze <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rückgelassenen Kanonen <strong>de</strong>r Osmanen wur<strong>de</strong> die Pummerin, die größte Glocke <strong>de</strong>s Stephansdoms, gegossen.[26]<br />
• Weitere Gassen, Straßen, Plätze und Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n nach markanten Personen <strong>de</strong>r Belagerung benannt, wie die Graf-Starhemberg-Gasse im 4. Bezirk, die Starhemberg-Kaserne<br />
im 10. Bezirk, die Sobieskigasse und <strong>de</strong>r Sobieskiplatz im 9. Bezirk. Denkmäler sind das Liebenberg-Denkmal gegenüber <strong>de</strong>r Universität an <strong>de</strong>r Ringstraße, das Denkmal im<br />
Stephansdom, die Ge<strong>de</strong>nktafel an <strong>de</strong>r Kirche am Kahlenberg usw.<br />
an<strong>de</strong>re Orte<br />
• Das Türkenkreuz in Perchtoldsdorf.<br />
• Die Blutgasse <strong>zu</strong>m Fischertor in Hainburg erinnert an die Verschleppung und Ermordung von 90 % <strong>de</strong>r Hainburger Bevölkerung nach <strong>de</strong>r Eroberung <strong>de</strong>r Stadt am 12. Juli 1683.<br />
Museale Rezeption<br />
Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ist die Zweite Wiener Türkenbelagerung sowie die Entsatzschlacht vom 12. September 1683 ausführlich dokumentiert. Unter <strong>de</strong>n<br />
Ausstellungsobjekten befin<strong>de</strong>n sich u. a. mehrere zeitgenössische Ölgemäl<strong>de</strong> von monumentalter Größe, welche die Geschehnisse nachvollziehbar machen. Eine Planskizze ermöglicht es,<br />
sich sowohl die Belagerungssituation als auch <strong>de</strong>n Schlachtenverlauf <strong>zu</strong> vergegenwärtigen.[27] Beson<strong>de</strong>re Stücke sind <strong>de</strong>r Degen <strong>de</strong>s Verteidigers von Wien, Graf Ernst Rüdiger von<br />
Starhemberg, nebst einem ihm <strong>zu</strong>geschriebenen Kürass. Ausgestellt ist auch eine große Anzahl an Beutestücken <strong>de</strong>s türkischen Heeres, wie mehrere Rossschweife, Reflexbögen <strong>de</strong>r<br />
berüchtigten Sipahi sowie eine türkische Standarte (Sancak-i Şerif). Eine beson<strong>de</strong>rs kuriose Waffe ist eine Sturmsense, eine aus drei Sensenblättern <strong>zu</strong>sammengeschmie<strong>de</strong>te<br />
Verteidigungswaffe <strong>de</strong>r Belagerten.[28]<br />
Literatur<br />
• Isabella Ackerl: Von Türken belagert – von Christen entsetzt. Das belagerte Wien 1683. Österreichischer Bun<strong>de</strong>sverlag, Wien 1983, ISBN 3-215-04445-5.<br />
• Thomas M. Barker: Doppeladler und Halbmond. Entscheidungsjahr 1683. Styria, Wien 1982, ISBN 3-222-11407-2.<br />
• Peter Broucek: Der Sieg bei Wien 1683. Österreichischer Bun<strong>de</strong>sverlag, Wien 1983, ISBN 3-215-04573-7.<br />
• Gertrud Gerhartl: Belagerung und Entsatz von Wien 1683. In: Militärhistorische Schriftenreihe. Band 46, Österreichischer Bun<strong>de</strong>sverlag, Wien 1983, ISBN 3-215-04967-8.<br />
• Balthasar Kleinschroth: Flucht und Zuflucht. Das Tagebuch <strong>de</strong>s Priesters Balthasar Kleinschroth aus <strong>de</strong>m Türkenjahr 1683. In: Hermann Watzl (Hrsg.): Forschungen <strong>zu</strong>r<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> von Nie<strong>de</strong>rösterreich. Band 8, Böhlau, Graz / Köln 1983, ISBN 3-205-07205-7.<br />
• Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch <strong>de</strong>r Belagerung Wiens 1683, verfasst vom Zeremonienmeister <strong>de</strong>r Hohen Pforte. In: Osmanische Geschichtsschreiber. Erste<br />
Auflage. Band 1, Styria, Graz / Wien / Köln 1955 (übersetzt von Richard Franz Kreutel, sowie eingeleitet und erklärt) (als 2. Auflage bei dtv, München 1976, ISBN 3-423-00450-<br />
9).<br />
• Karl Teply (Redaktion): Kara Mustafa vor Wien. 1683 aus <strong>de</strong>r Sicht türkischer Quellen. Styria, Wien 1982 (übersetzt von Richard Franz Kreutel), ISBN 3-222-11435-8.<br />
• Klaus-Peter Matschke: Das Kreuz und <strong>de</strong>r Halbmond. Die Geschichte <strong>de</strong>r Türkenkriege. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2004, ISBN 3-538-07178-0.<br />
• Johannes Sachslehner: Wien anno 1683. Pichler, Wien 2004, ISBN 3-85431-344-6.<br />
• Walter Sturminger (Hrsg.): Die Türken vor Wien in Augenzeugenberichten. Rauch, Düsseldorf 1968 (als Taschenbuch bei dtv, München 1983, in <strong>de</strong>r Reihe dtv-<br />
Augenzeugenberichte, ISBN 3-423-02717-7).<br />
Einzelnachweise
1. ↑ a b c Bernd Rill, Ferenc Majoros: Das Osmanische Reich 1300–1922. Marix, Wiesba<strong>de</strong>n 2004, ISBN 3-937715-25-8, S. 280–285.<br />
2. ↑ Georg Graffe, Daniel Gerlach: Sturm über <strong>de</strong>m Bosporus. Komplett-Media, 2007, ISBN 978-3-8312-9362-9, S. 173–175. (Imperium, 2. Staffel, 3. Teil)<br />
3. ↑ Thomas Winkelbauer: Stän<strong>de</strong>freiheit und Fürstenmacht. Län<strong>de</strong>r und Untertanen <strong>de</strong>s Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Teil 1. In: Herwig Wolfram (Hrsg.):<br />
Österreichische Geschichte 1522–1699. Wien 2004, ISBN 3-8000-3528-6, S. 164.<br />
4. ↑ Klaus-Peter Matschke: Das Kreuz und <strong>de</strong>r Halbmond. Die Geschichte <strong>de</strong>r Türkenkriege. Artemis und Winkler, Düsseldorf 2004, S. 360 f. (Sekundärliteratur)<br />
5. ↑ wien-vienna.at: Türkenbelagerung – Die Heere<br />
6. ↑ Slowakei in <strong>de</strong>r frühen Neuzeit<br />
7. ↑ a b Oberstleutnant Johann Georg von Hoffmann aus <strong>de</strong>m Jahresbericht <strong>de</strong>s Realgymnasiums <strong>de</strong>r Theresianischen Aka<strong>de</strong>mie in Wien 1937, S. 3–17, zitiert nach: Walter<br />
Sturminger: Die Türken vor Wien. Karl Rauch, Düsseldorf 1968, S. 32.<br />
8. ↑ Klaus-Peter Matschke, Das Kreuz und <strong>de</strong>r Halbmond. Die Geschichte <strong>de</strong>r Türkenkriege, S358f. (Sekundärliteratur)<br />
9. ↑ Klaus-Jürgen Bremm: Im Schatten <strong>de</strong>s Desasters. Zwölf Entscheidungsschlachten in <strong>de</strong>r Geschichte Europas. Books on Demand, Nor<strong>de</strong>rstedt 2003, ISBN 3-833-40458-2, S.<br />
160<br />
10.↑ a b c Lebensgeschichte Georg Rimpler S. 178ff.<br />
11.↑ a b c d e f http://xxx<br />
12.↑ Matthaeus Merian: Theatri Europaei continuati Zwölffter Theil. Merian, Frankfurt am Main 1691, S. 524f. (Sekundärquelle)<br />
13.↑ Wien's Belagerungen durch die Türken und ihre Einfälle in Ungarn und Österreich. Von Karl August Schimmer, 1812<br />
14.↑ Richard Franz Kreutel (Übersetzer): Die Geschichte <strong>de</strong>s Silihdar. aus: Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch <strong>de</strong>r Belagerung Wiens 1683, verfasst vom<br />
Zeremonienmeister <strong>de</strong>r Hohen Pforte. Band 1 <strong>de</strong>r Reihe: Osmanische Geschichtsschreiber. Verlag Styria, Graz/Wien/Köln 1955, Erste Auflage, S. 141-143.<br />
15.↑ Topçu<br />
16.↑ Sturminger 1968, zitiert Oberstleutnant Johann Georg von Hoffmann, S. 116<br />
17.↑ Sturminger 1968, zitiert Oberstleutnant Johann Georg von Hoffmann, S. 185<br />
18.↑ Sturminger 1968, zitiert Oberstleutnant Johann Georg von Hoffmann, S. 300<br />
19.↑ Klaus-Jürgen Bremm: Im Schatten <strong>de</strong>s Desasters. Zwölf Entscheidungsschlachten in <strong>de</strong>r Geschichte Europas. Books on Demand, Nor<strong>de</strong>rstedt 2003, ISBN 3-833-40458-2, S.<br />
166.<br />
20.↑ Toni Faber in: Der Dom. Mitteilungsblatt <strong>de</strong>s Wiener Domerhaltungsvereines2/2006, S. 11 ([1])<br />
21.↑ Foto <strong>de</strong>s Kugelkreuzes<br />
22.↑ Maximilian Lorenz von Starhemberg S8<br />
23.↑ Izabella Gawin, Dieter Schulze: KulturSchock Polen. Reise-Know-How-Verlag, Bielefeld 2004, ISBN 3-831-71295-6, S. 126<br />
24.↑ %BCrken_1683 Der Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Türken 1683 Stich aus einem Flugblatt von 1684<br />
25.↑ Magistrat <strong>de</strong>r Stadt Wien: Türkenritthof<br />
26.↑ www.xxx<br />
27.↑ Johann Christoph Allmayer-Beck: Das Heeresgeschichtliche Museum Wien. Saal I - Von <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s stehen<strong>de</strong>n Heeres bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts, Salzburg<br />
1982 S. 30.<br />
28.↑ Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher (Hg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz, Wien 2000 S. 16.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Belagerung von Ofen (1684/1686)<br />
Nach <strong>de</strong>r erfolglosen Zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 durch die Osmanen, welche <strong>de</strong>n Großen Türkenkrieg auslöste, startete eine kaiserliche Gegenoffensive <strong>zu</strong>r Rückeroberung<br />
Ungarn, in <strong>de</strong>ren Folge die ungarische Hauptstadt Ofen von <strong>de</strong>n Osmanen befreit wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Ausgangssituation<br />
Schon 1541 wur<strong>de</strong> Buda (<strong>de</strong>utsch: Ofen) von <strong>de</strong>n Türken erobert und sollte 145 Jahre unter osmanischer Herrschaft liegen. Durch die türkische Nie<strong>de</strong>rlage von 1683 sah Leopold I. nun<br />
endlich die Chance gekommen <strong>zu</strong>m Gegenschlag aus<strong>zu</strong>holen. Unter Mithilfe von Papst Innozenz XI. wur<strong>de</strong> am 5. März 1684 die Allianz <strong>de</strong>r Heiligen Liga gegen die Osmanen<br />
geschlossen. König Sobieski von Polen, Kaiser Leopold I. und die Republik Venedig schlossen ein Bündnis, welches sich ausschließlich gegen die Osmanen richten sollte.[1]<br />
Erste Belagerung 1684<br />
Ein etwa 38.000 Mann starkes Heer[2] machte sich im Frühjahr 1684 unter Karl V. von Lothringen auf, um Ofen von <strong>de</strong>n Osmanen <strong>zu</strong> befreien.<br />
Nach<strong>de</strong>m die Hauptarmee am 13. Juni bei Gran/Esztergom die Donau übersetzte, erschien die Vorhut <strong>de</strong>s kaiserlichen Heeres unter <strong>de</strong>m Befehl von Maximilian Lorenz von Starhemberg<br />
und <strong>de</strong>s Generals <strong>de</strong>r Kavallerie Markgraf Ludwig Wilhelm von Ba<strong>de</strong>n am 15. Juni vor Vicegrad/Visegrád. Am 16. Juni wur<strong>de</strong> die Stadt Gran von <strong>de</strong>n kaiserlichen Truppen ungeachtet<br />
ihrer starken Mauern im Sturm erobert, nach<strong>de</strong>m ein Tor mit <strong>de</strong>m Geschütz zerstört wur<strong>de</strong>. Der größte Teil <strong>de</strong>r osmanischen Besat<strong>zu</strong>ngstruppen wur<strong>de</strong> getötet und die Stadt geplün<strong>de</strong>rt.<br />
Nur wenige Osmanen konnten sich in das Schloss auf <strong>de</strong>m Felsen oberhalb <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>rückziehen. Nach nur eineinhalbtägiger Belagerung kapitulierte am 18. Juni die restliche<br />
osmanische Besat<strong>zu</strong>ng.<br />
Am 27. Juni traf das kaiserliche Heer bei Waitzen/Vác auf ein 17.000 Mann starkes osmanisches Heer. Obwohl sich die Osmanen an einer günstigen Position verschanzt hatten, ließ Karl<br />
V. mit Artilleriefeuer <strong>de</strong>n Kampf eröffnen. Das Zentrum <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen wur<strong>de</strong> dabei von Maximilian Lorenz von Starhemberg angeführt und nach einem kurzen Kampf konnten<br />
die osmanischen Truppen geschlagen wer<strong>de</strong>n. Sogar Waitzen fiel noch am selben Tag in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kaiserlichen. Am 30. Juni rückte die kaiserliche Hauptarmee in die Stadt Pest,<br />
welche kurz <strong>zu</strong>vor von <strong>de</strong>n Osmanen in Brand gesteckt wur<strong>de</strong>, ein. Nach<strong>de</strong>m die Armee bei Waitzen wie<strong>de</strong>r das Donauufer wechselte, begann am 14. Juli 1684, <strong>de</strong>m Jahrestag <strong>de</strong>s<br />
Beginns <strong>de</strong>r Wienbelagerung, mit 34.000 Mann die Belagerung Budas, welche von etwa 10.000 Osmanen mit über 200 Geschützen verteidigt wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r Beschuss <strong>de</strong>r Festung.<br />
Feldmarschall Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>r Belagerung beauftragt. Am 19. Juli schafften es die kaiserlichen Truppen die Unterstadt Budas<br />
ein<strong>zu</strong>nehmen. Da aber <strong>zu</strong> wenig Truppen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Beset<strong>zu</strong>ng vorhan<strong>de</strong>n waren, ließ Ernst Rüdiger die Häuser in Brand setzen. Die im Juli und August durchgeführten Angriffe unter<br />
<strong>de</strong>m Kommando von Ernst Rüdiger und Maximilian wur<strong>de</strong>n alle von <strong>de</strong>n Verteidigern <strong>zu</strong>rückgeschlagen. Am 10.August fiel <strong>de</strong>r osmanische Kommandant Kara Mehmed Pascha bei <strong>de</strong>r<br />
Abwehr eines Angriffes. Anfang September, so berichtet ein General, sei die Zahl <strong>de</strong>r diensttauglichen kaiserlichen Soldaten von 34.000 auf 12.500 gesunken. Zu<strong>de</strong>m war die Moral <strong>de</strong>r<br />
Belagerer niedrig. Erst als am 11. September ein kaiserliches Hilfskorps Buda erreichte, wur<strong>de</strong>n die Belagerungsaktivitäten verstärkt.
Doch am 22. September traf ein Entsatzheer <strong>de</strong>r Osmanen ein, die sogleich in <strong>de</strong>n Angriff übergingen. Dieser Angriff konnte zwar von <strong>de</strong>n Kaiserlichen abgewehrt wer<strong>de</strong>n, doch das<br />
osmanische Entsatzheer konnte nicht entschei<strong>de</strong>nd geschlagen wer<strong>de</strong>n. Die ständigen Störangriffe <strong>de</strong>s Entsatzheeres und Ausfälle <strong>de</strong>r türkischen Stadtbesat<strong>zu</strong>ng zermürbten die Belagerer<br />
endgültig, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m musste noch Ernst Rüdiger, <strong>de</strong>r unter starken Gichtbeschwer<strong>de</strong>n litt, in <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>r Belagerung abgelöst wer<strong>de</strong>n. Da die Witterung im Oktober ungünstig ausfiel,<br />
wur<strong>de</strong> entschie<strong>de</strong>n, die Belagerung ab<strong>zu</strong>brechen. Am 30. Oktober zog sich die kaiserliche Armee nach 109 Tagen Belagerung <strong>zu</strong>rück. Durch osmanische Ausfälle, Ruhr und<br />
Fieberepi<strong>de</strong>mien, schlecht angelegte Laufgräben sowie durch taktische Fehler bei <strong>de</strong>r Belagerung selbst schrumpfte die alliierte Streitmacht um mehr als die Hälfte. Bei <strong>de</strong>n christlichen<br />
Alliierten waren nach diesem gescheiterten Unternehmen 23.000 Mann an Verlusten <strong>zu</strong> beklagen darunter auch Hauptmann Paul Joseph Jakob von Starhemberg.[3] Ernst Rüdiger von<br />
Starhemberg wur<strong>de</strong> die Schuld am Misslingen <strong>de</strong>r Belagerung Budas aufgebür<strong>de</strong>t, obwohl er am Anfang als Einziger gegen diese Belagerung war.<br />
Zweite Belagerung 1686<br />
Zwei Jahre nach <strong>de</strong>r erfolglosen Belagerung von Ofen wur<strong>de</strong> 1686 ein erneuter Feld<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r ungarischen Hauptstadt gestartet, an <strong>de</strong>r diesmal mit 74.000 Mann eine fast<br />
doppelt so starke christliche Streitmacht teilnahm. Mitte Juni 1686 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Belagerung begonnen. Ein türkisches Entsatzheer traf Mitte August vor Ofen ein, doch Abdurrahman<br />
Abdi Pascha scheute einen Großangriff gegen die Belagerungsarmee und so kam es am 2. September 1686 <strong>zu</strong>m erfolgreichen Generalsturm auf die Festung. Prinz Eugen und seine<br />
Dragoner waren nicht direkt an <strong>de</strong>r Einnahme beteiligt, son<strong>de</strong>rn sicherten <strong>de</strong>n Rücken ihres Heeres vor <strong>de</strong>r türkischen Entsatzarmee, welche die Einnahme <strong>de</strong>r Stadt, seit 143 Jahren in<br />
osmanischem Besitz, nicht verhin<strong>de</strong>rn konnte. Nach <strong>de</strong>r Erstürmung entlud sich nun <strong>de</strong>r ganze Zorn <strong>de</strong>r siegreichen Soldaten gegen die „Hei<strong>de</strong>n“. Die osmanische Bedrohung, welche im<br />
Bewusstsein <strong>de</strong>s damaligen Europas über Jahrhun<strong>de</strong>rte fest verankert war, die in ganz Europa verbreitete Wut über die Gräueltaten <strong>de</strong>r Osmanen gegen die Zivilbevölkerung und <strong>de</strong>r von<br />
Kirche und Glauben angefachte religiöse Hass entlu<strong>de</strong>n sich nun an Besat<strong>zu</strong>ng und Bevölkerung von Ofen:<br />
„Ofen wur<strong>de</strong> eingenommen und <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung preisgegeben. Die Soldaten begingen dabei tausen<strong>de</strong>rlei Exzesse. Gegen die Türken, wegen ihres langen und hartnäckigen Wi<strong>de</strong>rstan<strong>de</strong>s,<br />
<strong>de</strong>r eine erstaunliche Menge ihrer Kamera<strong>de</strong>n das Leben gekostet hatte, aufgebracht, sehen sie we<strong>de</strong>r auf Alter noch Geschlecht. Der Kurfürst von Bayern und <strong>de</strong>r Herzog von Lothringen,<br />
durch das Seufzen <strong>de</strong>r Männer die man umbrachte, und <strong>de</strong>r Weiber, die vergewaltigt wur<strong>de</strong>n, gerührt, erteilten so gute Ordres, daß <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rmetzeln Einhalt geschah und noch über<br />
2000 Türken das Leben gerettet wur<strong>de</strong>...“[4]<br />
Bei <strong>de</strong>m Massaker <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen wur<strong>de</strong>n 3000 Türken getötet. Die Gewalt richtete sich nicht nur gegen die Muslime, son<strong>de</strong>rn ebenfalls gegen die jüdische Bevölkerung von<br />
Ofen. In <strong>de</strong>n ersten drei Tagen nach Eroberung <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> die jüdische Gemein<strong>de</strong> Ofens nahe<strong>zu</strong> vernichtet.[5]<br />
Folgen<br />
Als Folge <strong>de</strong>r Einnahme Ofens sowie <strong>de</strong>r gewonnenen Schlacht bei Mohács (1687), erkannte <strong>de</strong>r ungarische Reichstag im November 1687 in Pressburg die Erblichkeit <strong>de</strong>r ungarischen<br />
Krone im Haus Habsburg an und verzichtete gleichzeitig auf das Wi<strong>de</strong>rstands- sowie Wi<strong>de</strong>rspruchsrecht.[6] Außer<strong>de</strong>m verpflichtete sich <strong>de</strong>r ungarische Reichstag <strong>de</strong>n habsburgischen<br />
Thronfolger noch <strong>zu</strong> Lebzeiten seines Vaters <strong>zu</strong>m König von Ungarn <strong>zu</strong> krönen. So wur<strong>de</strong> am 9. Dezember 1687 Joseph, <strong>de</strong>r neunjährige Sohn Kaiser Leopolds, als erster erblicher König<br />
mit <strong>de</strong>r Stephanskrone gekrönt. Ungarn war nun endgültig Erbland <strong>de</strong>r Habsburger und bereits im Juni 1688 wur<strong>de</strong> die "Kommission <strong>zu</strong>r Einrichtung <strong>de</strong>s Königreichs Ungarn"<br />
geschaffen, um im Land <strong>de</strong>r Stephanskrone eine starke monarchistische Regierung, unter Berücksichtigung <strong>de</strong>s Wiener Absolutismus und <strong>de</strong>s Merkantilismus, <strong>zu</strong> schaffen. [7]<br />
Quellen<br />
1. ↑ Ernst Trost, Prinz Eugen von Savoyen. (Wien - München ²1985) S. 47<br />
2. ↑ Trost (²1985)<br />
3. ↑ Trost (²1985), S. 48<br />
4. ↑ Trost (²1985), S. 56<br />
5. ↑ Thomas Winkelbauer, Stän<strong>de</strong>freiheit und Fürstenmacht. Län<strong>de</strong>r und Untertanen <strong>de</strong>s Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter Teil 1. In: Herwig Wolfram(Hg.),<br />
Österreichische Geschichte 1522 - 1699. (Wien 2004), S. 166
6. ↑ Winkelbauer (2004), S. 168<br />
7. ↑ Winkelbauer (2004), S. 166<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Schlacht bei Mohács (1687)<br />
Die Schlacht bei Mohács (auch bekannt als Schlacht am Berg Harsány) im Jahre 1687 war eine Schlacht, zwischen <strong>de</strong>m kaiserlichen österreichischen Heer einerseits und <strong>de</strong>m Heer <strong>de</strong>s<br />
Osmanischen Reiches an<strong>de</strong>rerseits, während <strong>de</strong>s Großen Türkenkrieges (1683-1699). Sie en<strong>de</strong>te mit einem kaiserlichen Sieg, unter <strong>de</strong>ssen Eindruck die ungarischen Stän<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m<br />
Pressburger Reichstag die Erblichkeit <strong>de</strong>r ungarischen Krone im Haus Habsburg anerkannten.<br />
Vorgeschichte<br />
Der Große Türkenkrieg begann mit <strong>de</strong>r Belagerung Wiens im Jahr 1683 durch das osmanische Heer. Nach <strong>de</strong>m Entsatz <strong>de</strong>r Stadt in <strong>de</strong>r Schlacht am Kahlenberg am 12. September 1683<br />
ging die Initiative an die kaiserlichen Truppen über. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren drängten sie unter Herzog Karl V. von Lothringen die Osmanen <strong>zu</strong>rück und eroberten zahlreiche Festungen.<br />
Im Jahre 1686 gelang ihnen mit <strong>de</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r ehemaligen ungarischen Hauptstadt Buda (→ siehe: Belagerung von Ofen (1684/1686)) <strong>de</strong>r bis dahin größte Erfolg. Frie<strong>de</strong>nsangebote<br />
<strong>de</strong>s Osmanischen Reiches wur<strong>de</strong>n am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres noch <strong>zu</strong>rückgewiesen, da nunmehr die Abtretung ganz Ungarns greifbar schien.[1]<br />
Im April 1687 wur<strong>de</strong> in Wien die Entscheidung <strong>zu</strong>m weiteren Vorgehen getroffen. Die Hauptarmee (ca. 40.000 Mann) unter Herzog Karl von Lothringen sollte entlang <strong>de</strong>r Donau auf<br />
Esseg vorgehen, während eine zweite Armee (ca. 20.000 Mann) unter Kurfürst Max Emanuel von Bayern gleichzeitig von Szolnok an <strong>de</strong>r Theiß gegen Peterwar<strong>de</strong>in ziehen sollte. Mitte<br />
Juli vereinigten sich die bei<strong>de</strong>n Heere an <strong>de</strong>r Donau. Die osmanischen Truppen (ca. 60.000 Mann) unter <strong>de</strong>m Großwesir Süleyman Paşa bezogen dagegen ein befestigtes Lager vor Esseg<br />
<strong>zu</strong>m Schutz dieser Stadt. Zwischen <strong>de</strong>n Heeren lag nur <strong>de</strong>r Fluss Drau. En<strong>de</strong> Juli eroberten die Kaiserlichen einen Brückenkopf am jenseitigen Ufer <strong>de</strong>s Flusses und stellten sich in<br />
Schlachtordnung auf, um die Osmanen heraus<strong>zu</strong>for<strong>de</strong>rn. Diese blieben jedoch passiv und beschränkten sich auf die Beschießung <strong>de</strong>r Drau-Brücken und Uferdämme. Da sich Herzog Karl<br />
von Lothringen nicht in <strong>de</strong>r Lage sah, das befestigte osmanische Lager <strong>zu</strong> stürmen, entschied er sich nach einigen Tagen <strong>zu</strong>r Räumung <strong>de</strong>s Brückenkopfes, obwohl er dafür sowohl von<br />
seinen Unterführern als auch von Kaiser Leopold I. kritisiert wur<strong>de</strong>. Der Großwesir vermutete, dass die Moral <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen nun angeschlagen sei und folgte ihnen. Durch<br />
geschickte Manöver drängte er die Kaiserlichen bis in <strong>de</strong>n Raum Mohács <strong>zu</strong>rück, wo diese Anfang August eine befestigte Stellung bezogen. Die Osmanen errichteten bei Dárda ebenfalls<br />
eine befestigte Stellung, die jedoch von dichtem Gebüsch verborgen für die Kaiserlichen nicht sichtbar war. Herzog Karl von Lothringen ahnte <strong>de</strong>mentsprechend noch nichts von <strong>de</strong>r<br />
Nähe <strong>de</strong>s osmanischen Heeres.<br />
Verlauf<br />
Am Morgen <strong>de</strong>s 12. August plante <strong>de</strong>r Herzog von Lothringen nach Siklos <strong>zu</strong> ziehen, weil ihm das Gelän<strong>de</strong> dort für eine Schlacht geeignet schien. Der rechte Flügel setzte sich in<br />
Bewegung und marschierte nach Westen in ein dichtes Waldgebiet. Süleyman Paşa sah daraufhin seine Chance für gekommen und griff mit seinem gesamten Heer <strong>de</strong>n linken Flügel <strong>de</strong>s<br />
kaiserlichen Heeres unter <strong>de</strong>m Kurfürsten von Bayern an, <strong>de</strong>r noch immer in <strong>de</strong>n befestigen Stellungen stand und ebenfalls im Begriff war nach Westen <strong>zu</strong> marschieren. Allein 8.000
Sipahis versuchten dabei, die linke Flanke <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen <strong>zu</strong> umfassen. Der Kurfürst von Bayern ließ umgehend <strong>de</strong>n Herzog von Lothringen, <strong>de</strong>r sich bei <strong>de</strong>m abmarschierten<br />
rechten Flügel befand, benachrichtigen und traf Anstalten, um <strong>de</strong>n Angriff <strong>de</strong>r doppelt überlegenen Osmanen ab<strong>zu</strong>weisen. Die Infanterie behauptete ihre Stellung und General Piccolomini<br />
gelang es mit einigen Kavallerieregimentern, <strong>de</strong>n Umfassungsangriff <strong>de</strong>r Sipahis <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>werfen.<br />
Der Großwesir war von <strong>de</strong>m unerwartet heftigen Wi<strong>de</strong>rstand überrascht und befahl die Einstellung <strong>de</strong>r Angriffe. Zwar beschoss die osmanische Artillerie die kaiserlichen Stellungen<br />
weiter, doch <strong>de</strong>n Truppen selbst wur<strong>de</strong> befohlen, Stellungen auf<strong>zu</strong>werfen und sich dahinter <strong>zu</strong> verschanzen. Dadurch gewann <strong>de</strong>r alarmierte rechte Flügel <strong>de</strong>s kaiserlichen Heeres die<br />
notwendige Zeit, um in seine ursprüngliche Stellung <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>kehren. Auch <strong>de</strong>r Herzog von Lothringen gedachte <strong>zu</strong>nächst die eingenommene Stellung lediglich <strong>zu</strong> verteidigen, doch<br />
schließlich ließ er sich vom Kurfürst von Bayern sowie vom Markgrafen Ludwig von Ba<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> einem großangelegten Gegenangriff überre<strong>de</strong>n. Der Aufmarsch <strong>de</strong>s kaiserlichen Heeres<br />
war um 15:00 Uhr been<strong>de</strong>t. Zur gleichen Zeit nahm auch Süleyman Paşa <strong>de</strong>n Angriff wie<strong>de</strong>r auf. Wie<strong>de</strong>r versuchten Sipahis unterstützt durch Janitscharen die linke Flanke <strong>de</strong>r<br />
kaiserlichen Stellung <strong>zu</strong> umgehen. Markgraf Ludwig von Ba<strong>de</strong>n wehrte diesen Angriff mit 23 Eskadronen ab und ging anschließend selbst <strong>zu</strong>m Sturm auf die noch unvollen<strong>de</strong>te<br />
osmanische Stellung über. An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s Angriffs drangen die Truppen <strong>de</strong>r Generäle Rabutin und Eugen von Savoyen in die osmanischen Verschan<strong>zu</strong>ngen ein, wobei die Reiter<br />
aufgrund <strong>de</strong>s schwierigen Gelän<strong>de</strong>s von ihren Pfer<strong>de</strong>n hatten absteigen müssen.[2] Der osmanische Wi<strong>de</strong>rstand brach <strong>zu</strong>sammen und schon bald verwan<strong>de</strong>lte sich <strong>de</strong>r eingeleitete<br />
Rück<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>s osmanischen Heeres in eine wil<strong>de</strong> Flucht.<br />
Während <strong>de</strong>r ganzen Schlacht war lediglich <strong>de</strong>r linke Flügel <strong>de</strong>s kaiserlichen Heeres im Kampf gewesen. Vor <strong>de</strong>r Front <strong>de</strong>s rechten Flügels lag ein dichter Wald, <strong>de</strong>r einen Angriff dieser<br />
Truppen nicht <strong>zu</strong>ließ. Man hatte allerdings versucht, ein Umgehungsmanöver über <strong>de</strong>n rechten Flügel <strong>zu</strong> unternehmen, um <strong>de</strong>n Osmanen <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> verlegen, doch in <strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>rn<br />
hatte sich die Kolonne verirrt. Die Verluste <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen hielten sich mit etwa 600 Mann sehr in Grenzen. Die Osmanen verloren hingegen ihren gesamten Tross, <strong>de</strong>n größten<br />
Teil <strong>de</strong>r Artillerie (66 Geschütze) und nach einigen Schät<strong>zu</strong>ng bis <strong>zu</strong> 10.000 Tote.[3] Allein die Beute <strong>de</strong>s Kurfürsten von Bayern soll zwei Millionen Dukaten umfasst haben. Das<br />
Prachtzelt <strong>de</strong>s Großwesirs und 160 Fahnen fielen in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sieger.[4]<br />
Folgen<br />
Die Nie<strong>de</strong>rlage stürzte das Osmanische Reich in eine innenpolitische Krise. Bereits vor <strong>de</strong>r Schlacht bei Mohács war die Moral <strong>de</strong>r osmanischen Truppen durch die Rückschläge<br />
signifikant gesunken. Nach <strong>de</strong>r Schlacht kam es <strong>zu</strong> einem Aufstand <strong>de</strong>r Janitscharen und Sipahis im Lager <strong>de</strong>s Großwesirs. Dieser flüchtete nach Istanbul, doch eine Gesandtschaft <strong>de</strong>r<br />
Aufrührer folgte ihm und erreichte bei Sultan Mehmed IV. <strong>de</strong>ssen Hinrichtung. Kurze Zeit später setzten die meutern<strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>n Sultan selbst ab und setzten <strong>de</strong>ssen Bru<strong>de</strong>r<br />
Süleyman II. auf <strong>de</strong>n Thron. Nach weiteren Ausschreitungen gegen Wür<strong>de</strong>nträger und hohe Beamte setzte ein Volksaufstand <strong>de</strong>m Chaos ein En<strong>de</strong>.[5]<br />
Den kaiserlichen Truppen ermöglichte diese Schwäche <strong>de</strong>r Osmanen die Eroberung großer Gebiete. Sie nahmen Esseg, Klausenburg, Valpó, Peterwar<strong>de</strong>in, Karlowitz, Jllok, Pozega,<br />
Palota und Erlau ein. Damit gerieten Slawonien und Siebenbürgen unter kaiserliche Kontrolle. Das Prestige, welches die Habsburger damit erlangten, veranlasste die ungarischen Stän<strong>de</strong><br />
auf <strong>de</strong>m Reichstag <strong>zu</strong> Pressburg <strong>de</strong>n erst neunjährigen Erzherzog Joseph, am 9. Dezember 1687, <strong>zu</strong>m ersten erblichen König von Ungarn <strong>zu</strong> krönen. Überdies verpflichteten sich die<br />
Ungarn, von nun an <strong>de</strong>n Thronfolger noch <strong>zu</strong> Lebzeiten seines Vaters <strong>zu</strong> krönen und verzichteten gleichzeitig auf ihr Wi<strong>de</strong>rstands- und Wi<strong>de</strong>rspruchsrecht (jus resistendi/jus<br />
contradicendi) gegenüber <strong>de</strong>m König.[6] Die seit <strong>de</strong>m Tod König Ludwigs II. 1526 anhalten<strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>n Habsburgern, <strong>de</strong>n Osmanen, <strong>de</strong>m ungarischen A<strong>de</strong>l<br />
und <strong>de</strong>n Fürsten von Siebenbürgen um die Stephanskrone, waren nun <strong>zu</strong> Gunsten Habsburgs been<strong>de</strong>t. Nach <strong>de</strong>r formalen Bestätigung am 25. Januar 1688 war das Königreich Ungarn<br />
Erbreich <strong>de</strong>r Habsburger. Die muslimische Bevölkerung floh aus Ungarn, Slawonien und Siebenbürgen, teils wegen <strong>de</strong>r Grausamkeiten, die sie von <strong>de</strong>n christlichen Eroberern erlitten,<br />
teils, weil das muslimische Religionsgesetz eine Emigration im Falle <strong>de</strong>r Einnahme durch Nicht-Muslime vorsah.[7]<br />
Um die Erinnerung an die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r böhmischen und ungarischen Christen gegen die Osmanen im Jahre 1526 <strong>zu</strong> verwischen, entschied man sich, das Treffen offiziell ebenfalls als<br />
Schlacht bei Mohács <strong>zu</strong> bezeichnen, obwohl <strong>de</strong>r Ort <strong>de</strong>r früheren Schlacht mehrere Kilometer entfernt lag.[8]<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Paul Wentzcke: Feldherr <strong>de</strong>s Kaisers - Leben und Taten Herzog Karl V. von Lothringen, Leipzig 1943, S.278<br />
2. ↑ Franz Herre: Prinz Eugen - Europas heimlicher Herrscher, Stuttgart 1997, S.39f
3. ↑ Ernst Trost: Prinz Eugen von Savoyen, Wien/ München 1985, S. 60<br />
4. ↑ Wentzcke (1943), S.286<br />
5. ↑ Ernst Werner/ Walter Markow: Geschichte <strong>de</strong>r Türken - Von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, Berlin (Ost) 1979, S.156f<br />
6. ↑ Thomas Winkelbauer: Stän<strong>de</strong>freiheit und Fürstenmacht - Län<strong>de</strong>r und Untertanen <strong>de</strong>s Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Bd.1, Wien 2004 (= Herwig Wolfram<br />
(Hrsg.): Österreichische Geschichte 1522 - 1699)<br />
7. ↑ Josef Matuz, Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, 5. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008, S. 186<br />
8. ↑ Max von Turek: s.v. Mohács, in: Bernhard von Poten: Handbuch <strong>de</strong>r gesamten Militärwissenschaften, Leipzig 1879, S.37<br />
Literatur<br />
• Bernhard von Poten (Hrsg.): Handwörterbuch <strong>de</strong>r gesamten Militärwissenschaften. Band 7, Velhagen & Klasing, Bielefeld, Leipzig 1879.<br />
• Karl Staudinger: Geschichte <strong>de</strong>s kurbayerischen Heeres unter Kurfürst Max II Emanuel 1680-1726. Band 2, Lindauer, München 1904.<br />
• Paul Wentzcke: Feldherr <strong>de</strong>s Kaisers. Leben und Taten Herzog Karl V. von Lothringen. Koehler & Amelang, Leipzig 1943.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Schlacht bei Zenta<br />
In <strong>de</strong>r Schlacht bei Zenta errangen die kaiserlichen Truppen unter <strong>de</strong>m Oberbefehl von Prinz Eugen von Savoyen bei Zenta an <strong>de</strong>r Theiß am 11. September 1697 einen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Sieg<br />
über die Osmanen. Dieser Sieg führte schließlich <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Großen Türkenkrieg (1683–1699) been<strong>de</strong>te.<br />
Ausgangslage<br />
Kaiser Leopold I. ging nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Osmanen bei <strong>de</strong>r Zweiten Wiener Türkenbelagerung in die Offensive. Seine Truppen eroberten Ofen (Stadt) (heutiges Budapest)<br />
1684/1686, besiegten die Osmanen in <strong>de</strong>r Schlacht bei Mohács (1687) und eroberten 1688 Belgrad, welches 1690 infolge <strong>de</strong>s Pfälzischen Erbfolgekrieges aber wie<strong>de</strong>r an die Osmanen<br />
<strong>zu</strong>rückfiel.<br />
Vorgeschichte<br />
1697, als <strong>de</strong>r Pfälzische Erbfolgekrieg been<strong>de</strong>t war, kehrte Prinz Eugen (seit 1693 Feldmarschall) auf <strong>de</strong>n osmanischen Kriegsschauplatz <strong>zu</strong>rück. Der bisherige Oberbefehlshaber,<br />
Kurfürst Friedrich August von Sachsen, legte sein Kommando nie<strong>de</strong>r, da er nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Johanns III. Sobieski <strong>zu</strong>m König <strong>de</strong>r Polen gewählt wor<strong>de</strong>n war. Rüdiger Graf Starhemberg,<br />
<strong>de</strong>r berühmte Verteidiger Wiens während <strong>de</strong>r Zweiten Wiener Türkenbelagerung und damalige Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Hofkriegsrates, empfahl in einem Gutachten vom 15. März 1697:<br />
„Ich weiß Keinen, <strong>de</strong>r mehr Verstand, Experienz, Application [Hinwendung, Fleiß] und Eifer <strong>zu</strong> Euer Kaiserlichen Majestät Dienst hätte, ein generoses und uninteressiertes Gemüt, auch
die Liebe und Respect bei <strong>de</strong>r Miliz, als <strong>de</strong>r Prinz von Savoyen [...] Er hat in Italien commandiert [...] die Armata je<strong>de</strong>rzeit in großer Einigkeit, Respect und Gehorsam erhalten, welcher<br />
dagegen bei <strong>de</strong>r Armata in Ungarn ganz zerfallen, weswegen wohl nötig, <strong>de</strong>rselben einen solchen vor<strong>zu</strong>stellen, <strong>de</strong>r ihn wie<strong>de</strong>r Ein<strong>zu</strong>führen weiß, von allen Offizieren beliebt und hier<strong>zu</strong><br />
secundiert wird, die alle und son<strong>de</strong>rlich die Vornehmeren <strong>de</strong>m Prinzen von Savoyen so viel geneigt, als sie <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren [Kurfürst von Sachsen] abgeneigt sind [...][2]“<br />
Vorbereitung <strong>zu</strong>r Schlacht<br />
Aufgrund dieser Empfehlung wur<strong>de</strong> Prinz Eugen am 5. Juli 1697 <strong>zu</strong>m Oberbefehlshaber <strong>de</strong>r Armee in Ungarn ernannt. Wie aus <strong>de</strong>rselben Empfehlung <strong>zu</strong> entnehmen ist, befand sich die<br />
Armee in einem <strong>de</strong>nkbar schlechten Zustand: Von <strong>de</strong>r Sollstärke von 70.000 Mann waren nur 35.000 kampffähig, die Kriegskasse war leer und die Verpflegung miserabel. Eugen musste<br />
sich Geld leihen, um wenigstens Verpflegung und Sold für seine Armee im ausreichen<strong>de</strong>n Maße <strong>zu</strong>r Verfügung <strong>zu</strong> haben.<br />
Eugens erste taktische Maßnahme war das rasche Zusammenziehen <strong>de</strong>r in Oberungarn und Siebenbürgen operieren<strong>de</strong>n Truppen, um eine möglichst große Streitmacht gegen die Türken<br />
aufbieten <strong>zu</strong> können. Da aus Peterwar<strong>de</strong>in die Meldung kam, dass sich <strong>de</strong>r Sultan mit seiner Armee und <strong>de</strong>r gesamten Donauflottille bereits in Belgrad befin<strong>de</strong>, blieb ihm nicht viel Zeit.<br />
Nur fünf Tage nach seiner Kommandoübernahme (17. Juli) begann er einen Gewaltmarsch Richtung Peterwar<strong>de</strong>in. Nach <strong>de</strong>r Vereinigung mit <strong>de</strong>n Truppen aus Oberungarn und<br />
Siebenbürgen an diesem Orte umfasste die kaiserliche Armee zwischen 50.000 und 55.000 Mann.[3]<br />
Als man vor <strong>de</strong>r Festung eintraf, war die türkische Streitmacht ebenfalls schon vor Ort. Den ganzen August hindurch spielten sich jedoch nur taktische Manöver zwischen <strong>de</strong>n<br />
Streitmächten im Großraum Peterwar<strong>de</strong>in ab. Die Osmanen versuchten we<strong>de</strong>r die Erstürmung <strong>de</strong>r Burg noch eine offene Feldschlacht, da Eugen die Schlacht immer nur in Reichweite <strong>de</strong>r<br />
Festungsgeschütze anbot. Anfang September brachen die Osmanen die taktischen Geplänkel ab und zogen <strong>de</strong>r Theiß entlang nach Nor<strong>de</strong>n, um sich <strong>de</strong>r Festung Szegedin <strong>zu</strong> bemächtigen.<br />
Der kaiserliche Feldmarschall folgte nun, fast auf gleicher Höhe, <strong>de</strong>r osmanischen Streitmacht.<br />
Da gelang <strong>de</strong>r kaiserlichen Kavallerie, die ständig Feindberührung hielt, die Gefangennahme eines türkischen Offiziers. Seiner Aussage <strong>zu</strong>folge wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Plan <strong>zu</strong>r Erstürmung Szegedins<br />
wegen <strong>de</strong>s verfolgen<strong>de</strong>n christlichen Heeres aufgegeben und <strong>de</strong>r Sultan beabsichtige, die Theiß bei Zenta <strong>zu</strong> überqueren und sich nach Temesvár ins Winterlager <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>ziehen. Als<br />
Eugen von dieser Nachricht erfuhr, entschloss er sich, sofort die Schlacht <strong>zu</strong> eröffnen.<br />
Auf osmanischer Seite hatte <strong>de</strong>r erfahrene Hau<strong>de</strong>gen Ca'fer Pascha vergeblich gegen die Überquerung <strong>de</strong>r Theiß gestimmt und zeigte sich, nach <strong>de</strong>r Chronik seines Siegelbewahrers Alî<br />
aus Temeschwar, unglücklich über diese Entscheidung:<br />
“Als er unserem Herrn Pascha Bericht erstattete, raufte sich dieser verzweifelt <strong>de</strong>n Bart und sagte: ‘O weh, o weh, jetzt ist es soweit, dass <strong>de</strong>r Ehre <strong>de</strong>s Erhabenen Reiches Abbruch<br />
geschehen muss!’ Er lud die Paschas und Ağas <strong>zu</strong> sich und als er ihnen mitteilte, dass man auf das jenseitige Ufer übersetze, wur<strong>de</strong>n alle nie<strong>de</strong>rgeschlagen und bekümmert, weil sie diese<br />
Maßnahme als völlig verfehlt erachteten; sie wun<strong>de</strong>rten sich, auf wessen Betreiben es wohl da<strong>zu</strong> gekommen war, und waren ganz verstört.” [4]<br />
Ca'fer Pascha fiel noch im Verlaufe <strong>de</strong>r Schlacht bei <strong>de</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>s Brückenkopfes, um <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> <strong>de</strong>cken.<br />
Schlachtverlauf<br />
Am Nachmittag <strong>de</strong>s 11. September 1697 bot sich an <strong>de</strong>r Theiß bei Zenta folgen<strong>de</strong>s Bild: Am diesseitigen, westlichen Ufer befand sich ein aus Schanzen und Erdwällen errichteter<br />
türkischer Brückenkopf, <strong>de</strong>r die Flussüberquerung sicherte. Auf <strong>de</strong>r Pontonbrücke, die über die Theiß führte, wur<strong>de</strong>n gera<strong>de</strong> die Artillerie und <strong>de</strong>r Tross auf die an<strong>de</strong>re Seite transportiert,<br />
auf <strong>de</strong>r sich bereits <strong>de</strong>r Sultan und die osmanische Kavallerie befan<strong>de</strong>n. Die Türken wiegten sich in falscher Sicherheit und dachten nicht, dass die kaiserliche Armee so schnell vor Ort<br />
sein wür<strong>de</strong>, wie aus einem türkischen Bericht <strong>zu</strong> entnehmen ist:<br />
„Daß <strong>de</strong>r Feind kommen wer<strong>de</strong>, hatte ja niemand bezweifelt, jedoch war nicht an<strong>zu</strong>nehmen gewesen, daß er nach nur einem Tag da sein wür<strong>de</strong>; aber die Giaurenreiter [kaiserliche<br />
Kavallerie] hatten die Infanteristen hinter sich aufs Pferd genommen, und so waren sie in höchster Schnelligkeit herangerückt.[5]“<br />
Eugens Truppen eröffneten direkt aus <strong>de</strong>r Bewegung heraus <strong>de</strong>n Angriff und gingen halbmondförmig gegen die Verteidigungsstellung <strong>de</strong>r Osmanen vor. Als etwas nördlicher <strong>de</strong>r<br />
Pontonbrücke Sandbänke im Fluss erkennbar wur<strong>de</strong>n, nutzte Eugen diese Gelegenheit sofort aus und ließ diese besetzen, um die türkische Abwehrstellung auch in ihrem Rücken unter<br />
Beschuss <strong>zu</strong> nehmen. Nach intensivem Artilleriefeuer folgte <strong>de</strong>r Sturmangriff, an <strong>de</strong>m sich nicht nur die Infanterie, son<strong>de</strong>rn auch die abgesessenen Kavalleristen sowie an <strong>de</strong>r Spitze eines
Dragonerregiments Prinz Eugen selbst beteiligten. Die Schanzen wur<strong>de</strong>n schließlich überwun<strong>de</strong>n, die Türken in <strong>de</strong>n Fluss getrieben und die Brücke unter Feuer genommen:<br />
„Der Soldat ist so ergrimmt gewesen, daß er fast keinem Quartier (Pardon, Gna<strong>de</strong>) gegeben, obschon Paschas und Offiziere sich gefun<strong>de</strong>n, welche viel Geld versprochen haben, und<br />
befin<strong>de</strong>n sich daher gar wenig Gefangene in unserer hand[sic!].[6]“<br />
Beute<br />
Nach <strong>de</strong>m Sieg bei Zenta überreichte Prinz Eugen <strong>de</strong>m Kaiser persönlich die Stücke, die in <strong>de</strong>r Schlacht bei Zenta erbeutet wur<strong>de</strong>n. Es waren dies: 6.000 Wagen und Unmengen von<br />
Proviant (3000 Wagen versanken in <strong>de</strong>r Theiß), 80 große und 58 kleine Geschütze, 423 Fahnen, 7 Rossschweife <strong>de</strong>r Regimentsinhaber, Kamele, Ochsen, Pfer<strong>de</strong>, Zelte, die Kriegskasse<br />
(angeblich mit drei Millionen Gul<strong>de</strong>n und weiteren 40.000 aus <strong>de</strong>m Besitz <strong>de</strong>s Sultans), das Archiv, eine große Zahl türkischer Pauken, einen Prunksäbel sowie die Kutsche <strong>de</strong>s Sultans<br />
mit acht Pfer<strong>de</strong>n und zehn „Kebs-Weibern“.<br />
Das wichtigste Beutestück war aber das Siegel <strong>de</strong>s Sultans Mustafa II., welches heute im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien aufbewahrt wird. Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um eine<br />
Messingpetschaft mit spitzovaler Siegelfläche (19×26 mm) mit <strong>de</strong>m Wortlaut „Mustafa, Sohn <strong>de</strong>s Mehmed Han, immer siegreich“, darunter das Jahr <strong>de</strong>r Thronbesteigung „1106 <strong>de</strong>r<br />
Hedschra“ (nach <strong>de</strong>r christlichen Zeitrechnung das Jahr 1695). Das Siegel <strong>de</strong>s Sultans ist <strong>zu</strong>sammen mit einem zweiten Siegel eines gewissen Ismail und einem rotsei<strong>de</strong>nen,<br />
goldbestickten Säckchen <strong>zu</strong> sehen.[7] Das Siegel war im Feld<strong>zu</strong>g von 1697 (Großer Türkenkrieg) - wie in <strong>de</strong>r türkischen Armee üblich - <strong>de</strong>m Oberbefehlshaber Großwesir Elmas<br />
Mehmed Pasa übergeben wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r es ständig bei sich <strong>zu</strong> tragen hatte. Der Großwesir wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Schlacht getötet, das Siegel von Prinz Eugen erbeutet, dieser übergab es als Trophäe<br />
<strong>de</strong>m Kaiser, in weiterer Folge wur<strong>de</strong> es von <strong>de</strong>r kaiserlich-königlichen Schatzkammer <strong>de</strong>m Heeresmuseum übergeben.[8] Über das Siegel schrieb Prinz Eugen in seinem Bericht an <strong>de</strong>n<br />
Kaiser: „Ich habe auch [...] <strong>de</strong>s Gross-Sultan Petschaft erhalten, welches das Allerrarste, und diesen ganzen Krieg über bei allen Victorien noch niemals bekommen wor<strong>de</strong>n ist [...] und ich<br />
wer<strong>de</strong> mir auch die Ehre geben, wenn ich wie<strong>de</strong>rum das Glück habe, vor Eurer Kaiserlichen Majestät Thron <strong>zu</strong> erscheinen, in aller Untertänigkeit es persönlich <strong>zu</strong> überreichen.“[9]<br />
Ergebnis<br />
Es war ein vollständiger und umfassen<strong>de</strong>r Sieg und von nun an war <strong>de</strong>r Name Prinz Eugens in ganz Europa <strong>zu</strong> einem Begriff gewor<strong>de</strong>n. Der nach Temeschburg fliehen<strong>de</strong> Sultan verlor an<br />
die 25.000 Mann, seine gesamte Artillerie und <strong>de</strong>n ganzen Verpflegungsvorrat, wohingegen die Verluste <strong>de</strong>r Truppen <strong>de</strong>s Kaisers 28 Offiziere und 401 Mann an Toten betrugen.[10] Die<br />
Schlacht bei Zenta war die Grundlage für <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz (1699), mit <strong>de</strong>m sich das Kräfteverhältnis in Südosteuropa <strong>zu</strong> Ungunsten <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches verän<strong>de</strong>rte.<br />
Trotz<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sieg bei Zenta militärisch nicht vollständig genutzt, weil auf eine Verfolgung <strong>de</strong>r Türken angesichts <strong>de</strong>r Witterungsbedingungen verzichtet wur<strong>de</strong>.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ K. K. Kriegsarchiv (Hrsg.): Feldzüge <strong>de</strong>s Prinzen Eugen von Savoyen. Verlag <strong>de</strong>s K. K. Generalstabes, Wien 1876, Band 2, S. 156.<br />
2. ↑ Walter Hummelberger: Die Türkenkriege und Prinz Eugen. In: Herbert St. Fürlinger(Hrsg.): Unser Heer. 300 Jahre österreichisches Soldatentum in Krieg und Frie<strong>de</strong>n. Wien<br />
1963, S. 86f.<br />
3. ↑ Ernst Trost: Prinz Eugen von Savoyen. Wien ²1985, S. 10.<br />
4. ↑ Stefan Schreiner (Herausgeber): Die Osmanen in Europa. Erinnerungen und Berichte türkischer Geschichtsschreiber. Verlag Styria, Graz/Wien/Köln 1985, ISBN 3-222-11589-<br />
3, S. 337.<br />
5. ↑ Trost ²1985, S. 11<br />
6. ↑ Trost ²1985, S. 12<br />
7. ↑ Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher (Hg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz, Wien 2000 S. 17.<br />
8. ↑ Johann Christoph Allmayer-Beck: Das Heeresgeschichtliche Museum Wien. Saal I - Von <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s stehen<strong>de</strong>n Heeres bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts, Salzburg 1982<br />
S. 64.<br />
9. ↑ zitiert bei Agnes Husslein-Arco, Marie-Louise von Plessen (Hrsg.): Prinz Eugen. Feldherr, Philosoph und Kunstfreund, Wien 2010, S. 61.
10.↑ Hummelberger 1963, S. 88<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Frie<strong>de</strong> von Karlowitz<br />
Der Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz wur<strong>de</strong> am 26. Januar 1699 geschlossen. Mit ihm en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Große Türkenkrieg zwischen <strong>de</strong>m Osmanischen Reich auf <strong>de</strong>r einen und Österreich, Polen, <strong>de</strong>r<br />
Republik Venedig sowie Russland auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite.<br />
Vorgeschichte<br />
Der Große Türkenkrieg begann mit <strong>de</strong>r zweiten Türkenbelagerung Wiens 1683. Nach <strong>de</strong>m Sieg über das Osmanenheer <strong>de</strong>s Großwesirs Kara Mustafa durch Herzog Karl V. von<br />
Lothringen und <strong>de</strong>n polnischen König Johann III.Sobieski am 12. September 1683 in <strong>de</strong>r Schlacht am Kahlenberg, beteiligten sich auch Venedig (ab 1684) und Russland (ab 1686) am<br />
Kampf gegen die Osmanen. Das Kriegsziel war, die Expansion <strong>de</strong>r Osmanen, die seit etwa drei Jahrhun<strong>de</strong>rten vom Südosten her immer weiter in europäische Kerngebiete vorgedrungen<br />
waren, nachhaltig <strong>zu</strong> stoppen und sie möglichst weit in Richtung auf ihr eigenes Kernland <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>drängen. Hauptkriegsschauplatz war Ungarn, das die Osmanen schließlich verloren.<br />
Nach <strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>s Prinzen Eugen von Savoyen am 11. September 1697 in <strong>de</strong>r Schlacht bei Zenta über Sultan Mustafa II. war <strong>de</strong>r osmanische Wille <strong>zu</strong>r erneuten West-Expansion<br />
gebrochen. Es zeigten sich nun alle Seiten frie<strong>de</strong>nsbereit.<br />
Frie<strong>de</strong>nsschluss<br />
Als Verhandlungsort wur<strong>de</strong> Karlowitz, das heutige Sremski Karlovci in <strong>de</strong>r Vojvodina gewählt, da es zwischen <strong>de</strong>m habsburgischen Peterwar<strong>de</strong>in und <strong>de</strong>m osmanischen Belgrad auf<br />
neutralem Terrain lag. Die Verhandlungen gingen von Mitte November 1698 bis Januar 1699. Das Osmanische Reich wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Reis Effendi („Außenminister“) Rami Mohammed<br />
und <strong>de</strong>n Dragoman (Pfortendolmetscher) Alexan<strong>de</strong>r Maurokordatos, Kaiser und Reich durch die Grafen Kinsky, Öttingen und Schlick sowie Marsigli (nur als Berater) vertreten. Für<br />
Venedig verhan<strong>de</strong>lte Carlo Ruzzi, für Polen Malachowski und Prokopij Wosnitzin vertrat Russland.<br />
Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Karlowitz musste das Osmanische Reich ganz Ungarn einschließlich Siebenbürgens (aber ohne <strong>de</strong>m Banat von Temesvar), sowie <strong>de</strong>n Großteil Kroatiens (in etwa<br />
das heutige Slawonien) an Österreich abtreten. Der Republik Venedig wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r seit 1686 bestehen<strong>de</strong> Besitz <strong>de</strong>r Halbinsel Morea bestätigt, während Polen das seit 1672 durch die Hohe<br />
Pforte okkupierte Podolien mit Kamieniec Podolski und weitere Teile <strong>de</strong>r Ukraine <strong>zu</strong>rückerhielt.<br />
Folgen und Be<strong>de</strong>utung<br />
Der Frie<strong>de</strong>nsschluss markiert einen Wen<strong>de</strong>punkt in <strong>de</strong>r europäischen Geschichte: Nie <strong>zu</strong>vor hatte ein Sultan von Konstantinopel vor einer nichtmuslimischen Macht die Waffen gestreckt.<br />
Der Frie<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Karlowitz legte <strong>de</strong>n Grundstein für die neue Großmacht Österreich und war <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>r Epoche <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rgangs <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches.[1]<br />
Russland schloss auf zwei Jahre einen Waffenstillstand, <strong>de</strong>r aber direkt in <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Konstantinopel (1700) mün<strong>de</strong>te, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r russische Besitz von Azow bestätigt wur<strong>de</strong>.
Die kartographische Erfassung <strong>de</strong>r ausgehan<strong>de</strong>lten Grenzfestlegungen oblag Johann Christoph von Naumann, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r kaiserlichen Gesandtschaft gehörte. Naumann war anschließend<br />
einige Jahre als kaiserlicher Grenzingenieur mit <strong>de</strong>m Auftrag tätig, die von <strong>de</strong>n Türken befestigten Plätze entlang <strong>de</strong>s Flusses Maros <strong>zu</strong> schleifen und auf österreichischer Seite neue<br />
Festungswerke an<strong>zu</strong>legen.<br />
Literatur<br />
• Michajlo R. Popović: Der Frie<strong>de</strong> von Karlowitz: 1699. Schmidt, Leipzig 1893, (Leipzig, Univ., Diss., 1893).<br />
• Oswald Redlich: Weltmacht <strong>de</strong>s Barock. Österreich in <strong>de</strong>r Zeit Kaiser Leopolds I. 4. durchgesehene Auflage. Rohrer, Wien 1961.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mathias Bernath (Hrsg.): Biographisches Lexikon <strong>zu</strong>r Geschichte Südosteuropas. Verlag Ol<strong>de</strong>nbourg, München 1979, Band 3, ISBN 3-486-48991-7, S. 349.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Sachsen-Polen<br />
Der Begriff Sachsen-Polen bezeichnet die von 1697 bis 1706 und von 1709 bis 1763 bestehen<strong>de</strong> Personalunion zwischen <strong>de</strong>m Kurfürstentum Sachsen und <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik Polen-<br />
Litauen in Person Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen, beziehungsweise August II., König von Polen und seines Thronfolgers, König August III. von Polen. Die Personalunion<br />
erlosch nach <strong>de</strong>m Tod Augusts III. 1763. Eine weitere wettinische Thronfolge kam aufgrund <strong>de</strong>r geän<strong>de</strong>rten Interessenlage <strong>de</strong>s Russischen Reiches nicht mehr <strong>zu</strong> Stan<strong>de</strong>.<br />
Herrschaftsgebiete<br />
Polen-Litauen<br />
Bedingt durch <strong>de</strong>n auszehren<strong>de</strong>n zweiten Nordischen Krieg, war die A<strong>de</strong>lsrepublik ein Land ohne staatliche Verwaltungsorgane, mit einer unterentwickelten Wirtschaft, un<strong>zu</strong>reichen<strong>de</strong>n<br />
Steuereinnahmen und einer Armee, die <strong>de</strong>n Erfor<strong>de</strong>rnissen <strong>de</strong>r Zeit we<strong>de</strong>r qualitativ noch zahlenmäßig gewachsen war.[1] Dafür verfügte die A<strong>de</strong>lsrepublik über Rohstoffreichtum und<br />
war daher für das gewerblich geprägte Sachsen interessant. Die polnischen Beamten, die Kronarmee und die Staatskasse unterstan<strong>de</strong>n in Polen <strong>de</strong>m Sejm, <strong>de</strong>ssen Politik von <strong>de</strong>n<br />
mächtigen Magnatenfamilien und <strong>de</strong>r Szlachta bestimmt wur<strong>de</strong>. Ihre Neigung <strong>zu</strong>r Bildung von Konfö<strong>de</strong>rationen verwan<strong>de</strong>lte das Königreich in ein Pulverfass. Der Reichstag Polens war<br />
durch diese Privatinteressen relativ handlungsunfähig (Liberum Veto); die Krone selbst hatte nur beschränkte Einkünfte, die <strong>de</strong>m Kronschatzmeister Przebendowski unterstan<strong>de</strong>n. Dies<br />
be<strong>de</strong>utete, dass Polen ein extremes Übergewicht <strong>de</strong>r ständischen gegenüber <strong>de</strong>r monarchischen Komponente besaß.<br />
Kurfürstentum Sachsen<br />
Das Kurfürstentum Sachsen verfügte über ein hoch entwickeltes Manufaktur- und Handwerkswesen. Durch sein geschlossenes Herrschaftsgebiet galt es auch im europäischen Maßstab<br />
als ein mächtigeres Staatsgebil<strong>de</strong>, das noch En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts von <strong>de</strong>r inneren Entwicklung her Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen überlegen war, jedoch in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnten die<br />
protestantische Führungsrolle im Heiligen Römischen Reich an Bran<strong>de</strong>nburg abtreteten musste.
Königskrönung von Kurfürst Friedrich-August<br />
Ein Antrieb für die Erlangung <strong>de</strong>r polnischen Königswür<strong>de</strong> war <strong>de</strong>r Wunsch nach politischer Souveränität, die Kurfürst Friedrich-August außenpolitisch weiteres Gewicht <strong>zu</strong> geben<br />
versprach. Die langanhalten<strong>de</strong> und gefestigte Dominanz <strong>de</strong>r Habsburger Dynastie im Reich bestärkte <strong>de</strong>n Kurfürsten, sich einem drohen<strong>de</strong>n Rang- und Machtverlust durch eine<br />
Rangerhöhung auf einem nicht <strong>zu</strong>m Reich gehören<strong>de</strong>n Gebiet <strong>zu</strong> entziehen. Ein weiteres wichtiges Motiv bil<strong>de</strong>ten die Rang- und Zeremonialfragen, die <strong>zu</strong> jener Zeit die Machtstellung<br />
anzeigten und daher unmittelbare politische Be<strong>de</strong>utung hatten. Alle Fürsten dieser Zeit folgten <strong>de</strong>m französischem Vorbild Ludwigs XIV. in <strong>de</strong>r Prachtentfaltung, wie ausgefeiltes<br />
höfisches Zeremoniell, aufwändig inszenierte Einzüge und fantasievolle Feuerwerke, üppige Bankette mit Opernaufführungen und Balletten. Der Erwerb <strong>de</strong>r polnischen Königskrone<br />
stellte daher eine Prestigefrage Ersten Ranges für Kurfürst Friedrich-August dar. Denn nur mit einer Königskrone konnte ein <strong>de</strong>utscher Fürst seine quasi souveräne Stellung ausdrücken<br />
und damit von <strong>de</strong>n europäischen Mächten als gleichrangig akzeptiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Dem sächsischen Gesandten in Warschau, Graf Flemming, war es <strong>zu</strong>vor gelungen, die Konkurrenz durch das Aufstellen immer neuer Bewerber völlig <strong>zu</strong> zersplittern. Die Bemühungen<br />
<strong>de</strong>s Neffen von Papst Innozenz XI., <strong>de</strong>s Fürsten Livio O<strong>de</strong>scalchi, Herzogs von Bracciano und Ceri, <strong>de</strong>s Sohnes <strong>de</strong>s vormaligen Königs Johann III. Sobieski, Prinz Jakob Ludwig<br />
Heinrich, <strong>de</strong>s Kurfürsten Johann Wilhelm von <strong>de</strong>r Pfalz, <strong>de</strong>s Herzogs Leopold von Lothringen, <strong>de</strong>s Markgrafen Ludwig Wilhelm von Ba<strong>de</strong>n-Ba<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>s Kurfürsten Max II. von Bayern<br />
und zwölf weiterer Kandidaten waren daher hoffnungslos. Der aus Frankreich <strong>zu</strong>r Königswahl angereiste Fürst Franz Ludwig von Bourbon-Conti konnte sogar eine größere Stimmenzahl<br />
als August auf sich vereinigen, musste jedoch, von sächsischen Truppen genötigt, ohne Erfolg in seine Heimat <strong>zu</strong>rückkehren.<br />
Nach <strong>de</strong>n üblichen Bestechungsgel<strong>de</strong>rn, konnte Kurfürst Auguste <strong>de</strong>r Starke am 26./27. Juni auf <strong>de</strong>m Wahlfeld entgegen aller Anfangserwartungen in Warschau-Wola gewählt wer<strong>de</strong>n.<br />
Am 15. September 1697 folgte in Krakau die Krönung als August II. Mocny.<br />
Ausgangsbedingungen<br />
Nach <strong>de</strong>r Königskrönung ergaben sich für bei<strong>de</strong> Seiten vorteilhafte Möglichkeiten. Bei<strong>de</strong> Partner fühlten sich von Preußen und <strong>de</strong>ssen territorialen Ambitionen bedroht. Durch das<br />
Zusammengehen bei<strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r konnte diese Gefahr vorerst gebannt wer<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong> Mächte benötigten gegenseitige Unterstüt<strong>zu</strong>ng im unsicheren Nor<strong>de</strong>uropa, wo die preußische,<br />
schwedische und russische Armee <strong>de</strong>n sächsischen und polnischen Heeren weit überlegen waren. Da Polen-Litauen <strong>de</strong>r größere <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Partner war, hatte <strong>de</strong>r heimische A<strong>de</strong>l Grund<br />
genug <strong>zu</strong>r Annahme, dass es ihnen gelingen wür<strong>de</strong>, ihre separatistischen Interessen <strong>zu</strong> wahren. Als Konstitutionalisten konnte es ihnen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m eher gelingen, einen ausländischen<br />
Herrscher <strong>zu</strong> kontrollieren als einen Einheimischen.[2]<br />
Trotz <strong>de</strong>r Vorteile, wie <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>zu</strong>sätzliche dynastische Erbansprüche und ein höheres Gewicht in Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen, gab sich <strong>de</strong>r sächsische Hof nicht mit <strong>de</strong>m Gewinn <strong>de</strong>r<br />
polnischen Königskrone <strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>n. Statt<strong>de</strong>ssen sollte das Potenzial Polens für <strong>de</strong>n Dres<strong>de</strong>ner Hof finanziell und militärisch nutzbar gemacht wer<strong>de</strong>n.[3] Dem stand die Beschränktheit <strong>de</strong>r<br />
Befugnisse entgegen, die ein polnischer Wahlkönig besaß. Das Kurfürstentum Sachsen konnte nur dann hoffen aus <strong>de</strong>r Verbindung mit Polen <strong>zu</strong> profitieren, wenn es gelang, eine<br />
Landbrücke zwischen bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong> erwerben. Diese Hoffnung zerschlug sich mit <strong>de</strong>r preußischen Annexion Schlesiens nach 1740. Solange Kommunikation, Warenverkehr und<br />
Truppenbewegungen vom guten Willen Habsburgs o<strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburg-Preußens abhingen, konnte nicht an eine Großmacht Sachsen-Polen gedacht wer<strong>de</strong>n.[4] Die I<strong>de</strong>e einer Realunion<br />
zwischen diesen gegensätzlichen Territorien als solche war sicher utopisch, <strong>de</strong>nnoch erschien <strong>de</strong>n Akteuren ein gewisser Zusammenschluss bei<strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Bereichen Verwaltung,<br />
Militär, Wirtschaft und Finanzen, ähnlich wie in <strong>de</strong>n Kernlän<strong>de</strong>rn im Habsburgerreich möglich. Anknüpfungspunkte stellten <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r Rohstoffreichtum Polens und die<br />
entwickelte Manufakturwirtschaft Sachsens dar.<br />
Zeitlicher Verlauf<br />
Nach <strong>de</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng Sachsens durch die Schwe<strong>de</strong>n im Großen Nordischen Krieg musste König August II. im (Frie<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Altranstädt 1706 <strong>de</strong>n polnischen Königstitel abgeben, und <strong>de</strong>n von<br />
Schwe<strong>de</strong>n gestützten Stanislaus I. Leszczyński auf <strong>de</strong>m Thron anerkennen. Nach <strong>de</strong>r schwedischen Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r Schlacht bei Poltawa 1709 konnte <strong>de</strong>r sächsische Kurfürste <strong>de</strong>n<br />
Thron aber wie<strong>de</strong>rgewinnen. Nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rerlangung <strong>de</strong>r Königskrone strebte König August II. die Entmachtung <strong>de</strong>s Sejm in einem Staatsstreich an. Seine Vertreter for<strong>de</strong>rten dort die<br />
Verschmel<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r sächsischen Armee mit <strong>de</strong>r polnischen Kronarmee, nach<strong>de</strong>m man schon 1713 sämtliche polnische Festungen besetzt, Lager anlegen und Verhaftungen hatte<br />
vornehmen lassen. Da dies ein erster Schritt <strong>zu</strong>r Errichtung einer absolutistisch orientierten Erbmonarchie in Polen be<strong>de</strong>utet hätte, provozierte es 1715/16 <strong>de</strong>n Aufstand <strong>de</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration
von Tarnogrod, angeführt von Marschall Ledóchowski und Graf Branicki, wodurch August seinen Thron riskierte. Es war hauptsächlich ein Aufstand <strong>de</strong>s Kleina<strong>de</strong>ls gegen <strong>de</strong>n König;<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Magnaten wie <strong>zu</strong>m Beispiel Litauens Hetman Ludwik Pociej (ein Freund Peters <strong>de</strong>s Großen) versuchten eher <strong>zu</strong> vermitteln. Die sächsischen Truppen blieben zwar in allen<br />
größeren Gefechten siegreich, konnten <strong>de</strong>n Aufstand aber nicht been<strong>de</strong>n, so dass die Kassen knapp wur<strong>de</strong>n. König August II. akzeptierte die von <strong>de</strong>n Konfö<strong>de</strong>rierten ins Spiel gebrachte<br />
Vermittlung <strong>de</strong>s Zaren und erreichte im Frie<strong>de</strong>n von Warschau 1716 beziehungsweise im Stummen Sejm 1717 nur Teilerfolge. Die sächsische Armee musste im Gegen<strong>zu</strong>g das Land<br />
verlassen.<br />
Nach 1716 zeichnete sich jedoch eine gewisse Stabilisierung <strong>de</strong>r Regierung August II. in Polen ab, wodurch zwar einige Reformen möglich wur<strong>de</strong>n – aber für solche im Sinne <strong>de</strong>s<br />
Absolutismus bestand keine Aussicht. Mehrere Reichstage platzten, und König August II. bemühte sich ergebnislos, <strong>de</strong>m Kurprinzen die Nachfolge <strong>zu</strong> sichern. Wenigstens erholte sich<br />
Polen in <strong>de</strong>n 20er Jahren wirtschaftlich von <strong>de</strong>n Auswirkungen <strong>de</strong>s großen Nordischen Krieges. Der Gutsa<strong>de</strong>l produzierte intensiv, <strong>de</strong>r Warenaustausch zwischen Polen und Sachsen,<br />
durch die Leipziger Messe geför<strong>de</strong>rt und durch Zollabkommen erleichtert, stieg. Vor<strong>zu</strong>gsweise kamen dabei die Rohstoffe aus Polen und Fertigprodukte aus Sachsen. Paläste, Parks und<br />
zahlreiche neue Kirchen zeugten davon, dass Polen nach wie vor über Ressourcen verfügte. Nur fehlte es in <strong>de</strong>r, sich ständig in innerer Blocka<strong>de</strong> und Ohnmacht befindlichen,<br />
A<strong>de</strong>lsrepublik am Willen, etwas daraus <strong>zu</strong> machen. Eine zentrale Wirtschafts- und Finanzpolitik war in Polen nicht durchsetzbar, ein großer Teil <strong>de</strong>r Steuern (bis <strong>zu</strong> 20%) blieben auf <strong>de</strong>m<br />
Ein<strong>zu</strong>gswege hängen und merkantilistisches Denken beschränkte sich auf das Eigeninteresse <strong>de</strong>r Magnatenfamilien.<br />
Neben <strong>de</strong>r langwierigen und frustrieren<strong>de</strong>n Reformarbeit in Polen spielte die dauerhafte Sicherung <strong>de</strong>r wettinischen Herrschaft in Polen eine wichtige Rolle in <strong>de</strong>r Politik August II. Ein<br />
erster Schritt in diese Richtung gelang 1733 als Kurfürst Friedrich August II., <strong>de</strong>r Sohn August <strong>de</strong>s Starken, mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng Österreichs und Russlands und <strong>de</strong>n üblichen Bestechungen<br />
gegen <strong>de</strong>n Kandidaten Schwe<strong>de</strong>ns und Frankreichs, Stanisław Leszczyński, <strong>zu</strong>m König von Polen gewählt wur<strong>de</strong>. Dies löste <strong>de</strong>n Polnischen Thronfolgekrieg aus. August III. wur<strong>de</strong> am<br />
17. Januar 1734 <strong>zu</strong>m polnischen König gekrönt und behauptete die Krone im Frie<strong>de</strong>n von Wien (1738). Angesichts dieser Sachlage hofften sich <strong>de</strong>r König und sein Premierminister<br />
Heinrich von Brühl in Polen mit <strong>de</strong>m „Ministerialsystem” sachsentreuer Magnaten (die in Schlüsselpositionen gesetzt wur<strong>de</strong>n) über Wasser <strong>zu</strong> halten und bei<strong>de</strong> Län<strong>de</strong>r politisch<br />
verbin<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> können. Sie erlangten im Siebenjährigen Krieg sogar die Zustimmung ihrer drei Verbün<strong>de</strong>ten für eine erneute Thronkandidatur Sachsens, aber die Erfolge waren nur<br />
scheinbar und nicht von Dauer.<br />
In Sachsen führte Heinrich von Brühl nach <strong>de</strong>m Sturz Graf Sulkowskis von 1738 bis 1756 die alleinige Regierung, 1746 wur<strong>de</strong> er formell Premierminister. Er war ein erfolgreicher<br />
Diplomat und festigte die Verwaltung, wur<strong>de</strong> aber wegen falscher Finanzpolitik im Landtag 1749 scharf angegriffen. Trotz rücksichtsloser finanzieller Maßnahmen Brühls steuerte das<br />
Kurfürstentum Sachsen in eine Staatskrise. Der Zwangsumtausch von Vermögenswerten in staatliche Schuldverschreibungen erschütterte die Wirtschaft, die ohnehin <strong>zu</strong> kleine sächsische<br />
Armee musste abgerüstet und ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Steuern verpfän<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Da<strong>zu</strong> kam <strong>de</strong>r Druck von außen, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r sächsische Export wur<strong>de</strong> durch die preußische<br />
(Zoll-)Politik jener Zeit stark behin<strong>de</strong>rt.<br />
Aber erst <strong>de</strong>r Siebenjährige Krieg brachte für Sachsen 1756 <strong>de</strong>n Absturz. Die <strong>zu</strong> kleine sächsische Armee kapitulierte unter Graf Rutowski kampflos am Lilienstein, König August III. und<br />
sein Hof zogen nach Warschau um, wo sie bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Krieges in relativer politischer Ohnmacht verblieben. Das Kurfürstentum Sachsen, nun behelfsweise vom Königreich<br />
Preußen und von einigen Kabinettsministern verwaltet, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Kriegsschauplatz und litt unter <strong>de</strong>n hohen Kontributionen bei<strong>de</strong>r Seiten. Als <strong>de</strong>r Siebenjährige Krieg im<br />
Hubertusburger Frie<strong>de</strong>n 1763 <strong>zu</strong> En<strong>de</strong> ging, war das bis dahin recht wohlhaben<strong>de</strong> Kurfürstentum Sachsen ruiniert, was <strong>de</strong>r Hof nur ungern <strong>zu</strong>r Kenntnis nahm. Auf die Vergabe <strong>de</strong>r<br />
polnischen Krone hatte Sachsen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m keinerlei Einfluss: Polen-Litauen war mehr <strong>de</strong>nn je unter die Vorherrschaft Russlands geraten; <strong>de</strong>n Nachfolger August III., Stanisław August<br />
Poniatowski, bestimmte die Zarin Katharina II. Damit en<strong>de</strong>te die Personalunion zwischen Sachsen und Polen.<br />
Ergebnis<br />
Die sächsische Herrschaft über Polen blieb eine lose, so dass die Trennung Polens von Sachsen 1706 und 1763 keine <strong>zu</strong>sammengewachsenen Strukturen zerriss. Es gab zwar Versuche die<br />
Personalunion Sachsen-Polen in eine echte Staatsunion hin aus<strong>zu</strong>bauen. So existierten Pläne in Polen eine sächsische Erbfolge <strong>zu</strong> errichten. Jedoch führten diese Bestrebungen nicht <strong>zu</strong><br />
konkreten Entwicklungen. Allerdings hatte sich das Kurfürstentum Sachsen trotz <strong>de</strong>s <strong>zu</strong>sätzlichen Reputation die die polnische Krone brachte in seinen Möglichkeiten <strong>de</strong>utlich<br />
übernommen. Wirtschaft, Verwaltung und Armee stagnierten aufgrund <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>sätzlichen Belastungen durch die enormen Zusatzausgaben für Kunst und Repräsentation. Es fehlte in<br />
Sachsen an einer konsequenten Wirtschaftspolitik gegenüber Manufakturen. Peuplierung und Verbesserung <strong>de</strong>r Landwirtschaft wur<strong>de</strong>n in Sachsen ebenso vernachlässigt. Sachsen blieb<br />
auch in <strong>de</strong>r Fortentwicklung seines Heeerwesens gegenüber <strong>de</strong>n Nachbarmächten <strong>zu</strong>rück.
Mit <strong>de</strong>m Übertritt Augusts <strong>zu</strong>m Katholizismus verlor Sachsen die Führungsrolle unter <strong>de</strong>n evangelischen Reichsstän<strong>de</strong>n an Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen. August verzichtete jedoch auf die<br />
Anwendung <strong>de</strong>s Instrumentariums cuius regio, eius religio, das ihm eine Rekatholisierung Sachsens o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st eine Emanzipation <strong>de</strong>r römischen Religion ermöglicht hätte und<br />
versicherte statt<strong>de</strong>ssen seinen sächsischen Untertanen im Religionsversicherungs<strong>de</strong>kret von 1697 (1734 von seinem Sohn erneuert), dass sein Übertritt <strong>zu</strong>m Katholizismus keine Folgen<br />
für sie habe. Dennoch entfrem<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Glaubenswechsel, <strong>de</strong>r nur aus machtpolitischem Kalkül heraus geschehen war, <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren von seinen protestantischen Untertanen.<br />
Das „polnische Abenteuer“ ihres Lan<strong>de</strong>sherren kam die Sachsen teuer <strong>zu</strong> stehen. Aus <strong>de</strong>r sächsischen Staatskasse flossen Unsummen an Bestechungsgel<strong>de</strong>rn an <strong>de</strong>n polnischen A<strong>de</strong>l und<br />
an kirchliche Wür<strong>de</strong>nträger Polens (in <strong>de</strong>r Regierungszeit Augusts etwa 39 Mio. Reichstaler), um sich diese geneigt <strong>zu</strong> machen. König August II. veräußerte hierfür sogar einige nicht<br />
unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> sächsische Län<strong>de</strong>reien und Rechte.<br />
In Polen wird diese Perio<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r für die Dauer von 66 Jahre das wettinische Herrschergeschlecht herrschte, auch als die Sachsenzeit bezeichnet. Mehrheitlich wir diese Zeit in Polen für<br />
Polen als negativ eingeschätzt. In Erinnerung blieb die <strong>de</strong>ka<strong>de</strong>nte Stimmung jener Zeit, die sich in Sprichwörtern nie<strong>de</strong>rgeschlagen hat, etwa: Gdy August pił, cała Polska była pijana –<br />
Wenn August getrunken hatte, war ganz Polen besoffen – o<strong>de</strong>r: Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa – Unter <strong>de</strong>m Sachsenkönig iss, trink und löse <strong>de</strong>n Gürtel –, das ein Symbol für die<br />
späte sarmatische A<strong>de</strong>lskultur mit ihren üppigen Festen und <strong>de</strong>m Fehlen von Verantwortungsbewusstsein bei <strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>r Magnaten gegenüber <strong>de</strong>m eigenen Staat gewor<strong>de</strong>n ist und<br />
mit <strong>de</strong>r späteren Konfö<strong>de</strong>ration von Targowica seinen Höhepunkt fand. Durch die Schwächung <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>lsrepublik ereigneten sich wenige Jahre später die Teilungen Polens.<br />
Literatur<br />
• Norman Davies: God's Playground: The Origins to 1795 - A History of Poland, Oxford University Press, New York 2005, ISBN 0-19-925339-0<br />
• René Hanke: Brühl und das Renversement <strong>de</strong>s alliances: Die antipreussische Aussenpolitik <strong>de</strong>s Dres<strong>de</strong>ner Hofes 1744–1756, 2006<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ René Hanke: Brühl und das Renversement <strong>de</strong>s alliances: Die antipreussische Aussenpolitik <strong>de</strong>s Dres<strong>de</strong>ner Hofes 1744–1756, 2006, S. 18<br />
2. ↑ Norman Davies: God's Playground: The Origins to 1795 - A History of Poland, Oxford University Press, New York 2005, ISBN 0-19-925339-0, S.372<br />
3. ↑ René Hanke: Brühl und das Renversement <strong>de</strong>s alliances: Die antipreussische Aussenpolitik <strong>de</strong>s Dres<strong>de</strong>ner Hofes 1744–1756, 2006, S. 15<br />
4. ↑ René Hanke: Brühl und das Renversement <strong>de</strong>s alliances: Die antipreussische Aussenpolitik <strong>de</strong>s Dres<strong>de</strong>ner Hofes 1744–1756, 2006, S. 20<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Großer Nordischer Krieg<br />
Der Große Nordische Krieg war ein in Nord-, Mittel- und Osteuropa geführter Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum in <strong>de</strong>n Jahren 1700 bis 1721.<br />
Eine Dreier-Allianz, bestehend aus <strong>de</strong>m Russischen Zarenreich, <strong>de</strong>n Personalunionen Sachsen-Polen und Dänemark-Norwegen, griff im März 1700 das Schwedische Reich an, das von<br />
<strong>de</strong>m 18-jährigen, als jung und unerfahren gelten<strong>de</strong>n König Karl XII. regiert wur<strong>de</strong>. Trotz <strong>de</strong>r ungünstigen Ausgangslage blieb <strong>de</strong>r schwedische König <strong>zu</strong>nächst siegreich und bewirkte,
dass Dänemark-Norwegen (1700) und Sachsen-Polen (1706) aus <strong>de</strong>m Krieg ausschie<strong>de</strong>n. Als er sich 1708 anschickte, Russland in einem letzten Feld<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> besiegen, erlitten die<br />
Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Poltawa im Juli 1709 eine verheeren<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rlage, die die Kriegswen<strong>de</strong> be<strong>de</strong>utete.<br />
Von dieser Nie<strong>de</strong>rlage ermutigt, traten die ehemaligen schwedischen Gegner Dänemark und Sachsen wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Krieg gegen Schwe<strong>de</strong>n ein. Von nun an bis <strong>zu</strong>m Kriegsen<strong>de</strong> hatten die<br />
Alliierten die Initiative in <strong>de</strong>r Hand und drängten die Schwe<strong>de</strong>n in die Defensive. Erst nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r als uneinsichtig und stur gelten<strong>de</strong> schwedische König im Herbst 1718 während einer<br />
Belagerung von Fre<strong>de</strong>rikshald unter ungeklärten Umstän<strong>de</strong>n fiel, konnte <strong>de</strong>r für Schwe<strong>de</strong>n aussichtslos gewor<strong>de</strong>ne Krieg been<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Die Frie<strong>de</strong>nsbedingungen im Frie<strong>de</strong>n von<br />
Nystad, <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Fre<strong>de</strong>riksborg und <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stockholm be<strong>de</strong>uteten das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s schwedischen Status als europäische Großmacht und <strong>de</strong>n gleichzeitigen Aufstieg<br />
Russlands als neue Großmacht.<br />
Vorgeschichte<br />
Die Ursache <strong>de</strong>s Großen Nordischen Krieges war von verschie<strong>de</strong>nen Faktoren bestimmt und hatte ihre Ursprünge <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts. In zahlreichen Kriegen gegen das<br />
Königreich Dänemark, das Königreich Polen-Litauen und das Russische Zarenreich hatte Schwe<strong>de</strong>n bis 1660 die Vormachtstellung im Ostseeraum errungen. Dabei hatte es das<br />
Zarenreich im Frie<strong>de</strong>n von Stolbowo (1617) vom Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee abgedrängt und Dänemark mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Oliva (1660) die uneingeschränkte Herrschaft über <strong>de</strong>n Sund<br />
entrissen. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren war Schwe<strong>de</strong>n außenpolitisch von Frankreich unterstützt wor<strong>de</strong>n und konnte seinen Besitzstand wahren.<br />
Als Folge dieser Entwicklungen zeichneten sich am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts folgen<strong>de</strong> Konfliktlinien in Nordosteuropa ab[1]:<br />
Einen Streitpunkt zwischen Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n stellte die Frage um die gottorfschen Anteile in <strong>de</strong>n Herzogtümern Holstein und vor allem Schleswig dar. Die Herzogtümer waren<br />
seit 1544 in königliche, gottorfsche und gemeinsam regierte Anteile aufgeteilt [2]. Trotz<strong>de</strong>m verblieb Holstein formell als <strong>de</strong>utsches und Schleswig als dänisches Lehen. Nach <strong>de</strong>m<br />
Torstenssonkrieg 1658 wur<strong>de</strong>n die Anteile <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n alliierten Gottorfer im Herzogtum Schleswig vom dänischen Lehen entbun<strong>de</strong>n. Die dänische Außenpolitik, die sich<br />
durch die Allianz <strong>de</strong>r Gottorfer mit <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n von zwei Seiten bedroht sah, versuchte die Gottorfer Anteile wie<strong>de</strong>r ein<strong>zu</strong>verleiben. Die Unabhängigkeit <strong>de</strong>s Teil-Herzogtums<br />
Schleswig-Holstein-Gottorf garantierte lediglich die schwedische Regierung, welche davon ausging, dass sie mit <strong>de</strong>m verbün<strong>de</strong>ten Territorium im Falle eines Krieges gegen Dänemark<br />
über eine strategische Basis für Truppenaufmärsche und Angriffe auf das dänische Festland verfügte.<br />
Ein weiterer Streitpunkt zwischen Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n bil<strong>de</strong>ten die früher dänischen und seit 1658 <strong>zu</strong> Schwe<strong>de</strong>n gehören<strong>de</strong>n Provinzen Schonen (Skåne), Blekinge und Halland. Die<br />
Frage nach <strong>de</strong>r staatlichen Zugehörigkeit Schonens führte bereits 1675 <strong>zu</strong>m Kriegseintritt Dänemarks in <strong>de</strong>n Nordischen Krieg von 1674 bis 1679.<br />
Unter König Karl XI. von Schwe<strong>de</strong>n (1655–1697) war es <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n so genannten Reduktionen gekommen, durch welche <strong>de</strong>r Landbesitz <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls größtenteils an die Krone überging. Diese<br />
Praxis stieß unter an<strong>de</strong>rem in Livland auf <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>s betroffenen A<strong>de</strong>ls, <strong>de</strong>r sich nun um ausländische Hilfe bemühte.<br />
In Russland hatte Zar Peter I. (1672–1725) erkannt, dass das Fehlen eines Zugangs <strong>zu</strong>r Ostsee <strong>de</strong>n russischen Han<strong>de</strong>l beeinträchtigte. Seine Anstrengungen richteten sich vor allem<br />
<strong>de</strong>shalb gegen Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Kurfürst August I. von Sachsen (1670–1733) war im Jahre 1697 als August II. <strong>zu</strong>m König von Polen gewählt wor<strong>de</strong>n. Er strebte danach, sich in Polen Anerkennung <strong>zu</strong> verschaffen und<br />
das Königtum dadurch in eine Erbmonarchie umwan<strong>de</strong>ln <strong>zu</strong> können. Dabei beriet ihn <strong>de</strong>r aus Livland geflohene Johann Reinhold von Patkul (1660–1707). Dieser meinte, dass die<br />
Rückeroberung <strong>de</strong>s einst polnischen Livlands August <strong>zu</strong> einigem Prestige verhelfen wür<strong>de</strong>. Der lokale A<strong>de</strong>l wür<strong>de</strong> diesen Schritt willkommen heißen und sich gegen die schwedische<br />
Herrschaft erheben.<br />
Zwischen <strong>de</strong>n drei potentiellen Gegnern Schwe<strong>de</strong>ns zeichnete sich bald nach <strong>de</strong>r Thronbesteigung <strong>de</strong>s erst 15-jährigen Karls XII. von Schwe<strong>de</strong>n (1682–1718) <strong>de</strong>r Zusammenschluss <strong>zu</strong><br />
einer Allianz ab. Bereits im ersten Regierungsjahr hatte <strong>de</strong>r junge König seinen Schwager Friedrich IV. (1671–1702), <strong>de</strong>n Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf <strong>zu</strong>m „Oberbefehlshaber<br />
aller schwedischen Truppen in Deutschland“ gemacht und ihn beauftragt, die Lan<strong>de</strong>sverteidigung <strong>de</strong>s Gottorfer Teil-Herzogtums <strong>zu</strong> verbessern. Diese offensichtlich militärischen<br />
Vorbereitungen gaben im Juni 1698 <strong>de</strong>n Anstoß <strong>zu</strong> ersten Bündnisverhandlungen zwischen Dänemark und Russland.[3] Im August 1698 trafen sich Zar Peter I. und König August<br />
II.schließlich in Rawa, wo sie erste Absprachen für ein gemeinsamen Angriff auf Schwe<strong>de</strong>n trafen.[4] Den formalen Abschluss <strong>de</strong>r Allianz stellte <strong>de</strong>r am 11. Novemberjul./ 21. November<br />
1699greg. abgeschlossene Vertrag von Preobraženskoe dar. Erst am 23. Novemberjul./ 3. Dezembergreg. erfolgte <strong>de</strong>r Abschluss einer Allianz zwischen Zar Peter I. und König Friedrich
IV. von Dänemark (1671–1730). Dänemark war seit März 1698 auch mit Sachsen in einer Defensivallianz verbün<strong>de</strong>t. In bei<strong>de</strong>n Verträgen wur<strong>de</strong> Schwe<strong>de</strong>n nicht erwähnt. Sie<br />
verpflichteten die Vertragspartner lediglich da<strong>zu</strong>, sich im Falle eines Angriffs, o<strong>de</strong>r wenn <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l eines <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r durch an<strong>de</strong>re Staaten beeinträchtigt wür<strong>de</strong>, Beistand <strong>zu</strong> leisten.<br />
Weiterhin ließ Zar Peter I. Klauseln einfügen, laut <strong>de</strong>nen er erst nach einem Frie<strong>de</strong>nsschluss zwischen Russland und <strong>de</strong>m Osmanischen Reich an die Bestimmungen <strong>de</strong>r Verträge gebun<strong>de</strong>n<br />
war.[5]<br />
Kriegsverlauf<br />
Kriegseröffnung: Einfall <strong>de</strong>r Sachsen in Livland<br />
Am 12. Februar 1700 fiel die sächsische Armee ohne Kriegserklärung in Livland ein. Doch <strong>de</strong>r livländische A<strong>de</strong>l stellte sich nicht auf die Seite <strong>de</strong>r Sachsen. Die Einnahme <strong>de</strong>r Festung<br />
Riga scheiterte. Die militärischen Erfolge waren beschei<strong>de</strong>n. Die polnische A<strong>de</strong>lsrepublik, die Rzeczpospolita fühlte sich von August betrogen und erklärte, dass Polen sich nicht im Krieg<br />
mit Schwe<strong>de</strong>n befän<strong>de</strong>. Nur einige polnische Magnaten wie Fürst Hieronim Augustyn Lubomirski schlugen sich anfangs auf seine Seite. Am 11. März erklärte Dänemark Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n<br />
Krieg und marschierte in das schleswig-holsteinische Teilherzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf ein.<br />
Feld<strong>zu</strong>g Karls XII. gegen Dänemark<br />
Der erst 18 Jahre alte schwedische König Karl XII. ordnete die Mobilmachung an. Die schwedische Armee war kein Söldnerheer wie in an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn üblich. Zu Beginn <strong>de</strong>s 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts betrug die Truppenstärke <strong>de</strong>r Karoliner, wie die schwedischen Soldaten seit ihrem Grün<strong>de</strong>r Karl XI. hießen, 76.000 Soldaten[6]. Die Soldaten <strong>de</strong>r einzelnen Einheiten lebten<br />
in Frie<strong>de</strong>nszeiten als Bauern in ihren Dörfern (so genannte In<strong>de</strong>lningsverket). Da sie einan<strong>de</strong>r kannten, hielten sie im Kampf eng <strong>zu</strong>sammen. Fahnenflucht war in <strong>de</strong>r schwedischen Armee<br />
so gut wie unbekannt. Frankreich unter Ludwig XIV. unterstützte Schwe<strong>de</strong>n finanziell, welches damals mit Schwedisch-Pommern, Holstein-Gottorp, Finnland, Karelien, Ingermanland<br />
und Livland nur circa 3 Millionen Einwohner hatte. Je<strong>de</strong>s Jahr zahlte <strong>de</strong>r Sonnenkönig über 1.000.000 Livres.<br />
Wilhelm III., damals <strong>zu</strong>gleich König von England, Schottland und Irland sowie Statthalter <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, wünschte die Erhaltung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns in Nor<strong>de</strong>uropa und garantierte <strong>de</strong>n Status<br />
Quo. Da Dänemark <strong>de</strong>r Angreifer war und Großbritannien sowie die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Garantiemächte <strong>de</strong>s Altonaer Vertrages waren, stellte er sich auf die Seite Schwe<strong>de</strong>ns und schickte unter<br />
Admiral George Rooke ein englisch-holländisches Geschwa<strong>de</strong>r mit 25 Linienschiffen <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng Schwe<strong>de</strong>ns nach Göteborg. Schwe<strong>de</strong>n verfügte über eine Flotte von 38<br />
Linienschiffen und 12 Fregatten, Dänemark hatte 33 Linienschiffe und 7 Fregatten. In einem kühnen Manöver gelang <strong>de</strong>r schwedischen Flotte die Durchfahrt durch die kleinere <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n Fahrrinnen im Öresund, außerhalb <strong>de</strong>r Reichweite <strong>de</strong>r Kanonen <strong>de</strong>r dänischen Sundfestungen. Die schwedische Flotte vereinigte sich mit <strong>de</strong>m englisch-holländischen Geschwa<strong>de</strong>r,<br />
und <strong>de</strong>r dänischen Flotte von 33 Schiffen stand jetzt ein mächtiges Geschwa<strong>de</strong>r von mehr als 60 Schiffen gegenüber, so dass <strong>de</strong>r dänische Admiral keine Seeschlacht wagte. Unter <strong>de</strong>m<br />
Schutz dieser Flotte konnte Karl XII. am 23. Juli 1700 auf <strong>de</strong>r dänischen Hauptinsel Seeland lan<strong>de</strong>n, Kopenhagen einschließen und im August mit <strong>de</strong>r Belagerung <strong>de</strong>r dänischen<br />
Hauptstadt beginnen.<br />
Der dänische König Friedrich IV. sah sich jetzt in einer katastrophalen Lage: Seine Flotte stand einer viel stärkeren feindlichen gegenüber, seine Hauptstadt stand unter Belagerung,<br />
während sein Heer gegen Herzog Friedrich IV. von Holstein-Gottorf weit weg im Herzogtum Holstein operierte. Friedrich IV. musste seine Nie<strong>de</strong>rlage eingestehen und schloss am 18.<br />
August 1700 mit Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Traventhal. Der erste Feld<strong>zu</strong>g im Großen Nordischen Krieg en<strong>de</strong>te somit schnell und fast unblutig. Der Status Quo Ante wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r<br />
hergestellt, und Dänemark schied aus <strong>de</strong>r Koalition gegen Schwe<strong>de</strong>n aus.<br />
Feld<strong>zu</strong>g Karls XII. gegen Russland<br />
In <strong>de</strong>n letzten Monaten vor <strong>de</strong>r Kriegserklärung hatte <strong>de</strong>r Zar in <strong>de</strong>r Gegend um Nowgorod und Pleskau ein Heer von 60.000 Mann <strong>zu</strong>sammengezogen. Um <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, dass die<br />
Schwe<strong>de</strong>n davon Nachricht bekämen, ließ er fast alle Postverbindungen mit Schwe<strong>de</strong>n abbrechen. Gleich nach erfolgter Kriegserklärung am 19. August rückten das versammelte Heer<br />
und an<strong>de</strong>re Truppenabteilungen in Estland und Ingermanland ein. Am 19. September erschien das Heer vor Narva und die Belagerungsarbeiten wur<strong>de</strong>n am 1. und 2. Oktober eröffnet.<br />
Narva stand unter Kommando von Rudolph Henning Horn mit 1000 Mann besetzt. Zusätzlich beteiligten sich weitere 1000 bewaffnete Bürger an <strong>de</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>r Festung. Das<br />
russische Belagerungsheer, <strong>de</strong>r Größe um eine vielfaches überlegen, bestand <strong>zu</strong> einem erheblichen Teil aus frisch eingezogenen und ungeübten Mannschaften. Ein Sturmangriff folgte<br />
<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren, ohne dass die russischen Belagerer Fortschritte erzielen konnten.[7] Karl XII. entschloss sich, das russische Heer an<strong>zu</strong>greifen, und so die Festung Narva <strong>zu</strong> entsetzen. Am 1.
Oktober ging die aus 200 Schiffen und mit 8000 Mann besetzte Flotte in Segel. Karl XII. ging mit <strong>de</strong>m Entschluss <strong>zu</strong>r Überfahrt <strong>zu</strong> dieser fortgeschrittenen Jahreszeit ein hohes Risiko<br />
ein. Nach<strong>de</strong>m die Flotte vor Kurland in einen schweren Seesturm geriet, erreichten die Schiffe, <strong>zu</strong>m Teil in verschie<strong>de</strong>nen Häfen, mit unterschiedlichen Verlusten die Ziel-Küste in<br />
Livland und Estland. Die gesamte Flotte kehrte nach Karlshamn <strong>zu</strong>rück um weitere 4000 Mann und <strong>de</strong>n Rest <strong>de</strong>r Artillerieparks über<strong>zu</strong>setzen. Auch diese Fahrt verlief im Großen und<br />
Ganzen glücklich. Der ursprüngliche Plan gegen Riga <strong>zu</strong> marschieren wur<strong>de</strong> fallengelassen, da König August bereits <strong>de</strong>n Rückmarsch angetreten hatte. Aus diesem Grund marschierte das<br />
schwedische Heer gegen Narva, um die bedrängte Stadt <strong>zu</strong> entsetzen. Zum Schutz Livlands hinterließ Karl XII. 5000 Mann, sodass für <strong>de</strong>n Marsch gegen Narva nur 8000 Mann<br />
verblieben. Am 20. November erreichte das schwedische Heer Narva und griff das viel größere russische Heer, das sich in seinen Verschan<strong>zu</strong>ngen hielt, an. In <strong>de</strong>r Schlacht von Narva<br />
besiegte er die zahlenmäßig <strong>de</strong>utlich überlegene Armee <strong>de</strong>r Russen. Bei einem Angriff auf die russischen Linien im Schutz eines Schneesturms wur<strong>de</strong>n diese von <strong>de</strong>r routinierten<br />
schwedischen Armee durchbrochen und das feindliche Heer in zwei Teile gespalten. Viele von Peters Truppen, <strong>zu</strong>meist Rekruten, flohen vom Schlachtfeld und ertranken in <strong>de</strong>r Narva.<br />
Der Rest <strong>de</strong>r geschlagen Truppen zog sich undiszipliniert und führungslos nach Nowgorod <strong>zu</strong>rück, wo allerdings nur ein kleiner Teil ankam; die meisten <strong>de</strong>sertierten, erfroren o<strong>de</strong>r<br />
verhungerten auf <strong>de</strong>m Weg dorthin.<br />
Die Schlacht von Narwa ist einer <strong>de</strong>r größten Siege <strong>de</strong>r schwedischen Militärgeschichte. En<strong>de</strong> 1700 hatte Karl XII. Schwe<strong>de</strong>n erfolgreich verteidigt und alle feindlichen Truppen von<br />
schwedischem Territorium vertrieben. Anstatt das geschlagene russische Heer <strong>zu</strong> verfolgen, um es vollständig <strong>zu</strong> vernichten und seinen Gegner Zar Peter auch <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> zwingen,<br />
wandte sich <strong>de</strong>r König nun seinem dritten Gegner, <strong>de</strong>m sächsischen Kurfürsten und König von Polen, <strong>zu</strong>.<br />
Kriegsverlauf nach Narva bis <strong>zu</strong>m Altranstädter Frie<strong>de</strong>n (1701–1706)<br />
Feldzüge in Polen und Sachsen<br />
Der polnische König August hatte mit ansehen müssen, wie seine Verbün<strong>de</strong>ten Dänemark und Russland von Karl XII. geschlagen wor<strong>de</strong>n waren. Im Februar 1701 trafen sich August und<br />
Peter erneut, um ihr Bündnis <strong>zu</strong> erneuern. Peter brauchte Zeit um die russische Zarenarmee <strong>zu</strong> reorganisieren und auf<strong>zu</strong>rüsten, August selbst brauchte einen starken Verbün<strong>de</strong>ten im<br />
Rücken <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n. Als nachteilig erwies sich für August die Weigerung seiner polnischen Untertanen, sich an <strong>de</strong>m Krieg militärisch <strong>zu</strong> beteiligen. Ungeachtet <strong>de</strong>r Zusammenkünfte<br />
bei<strong>de</strong>r Partner, die mit großen bei<strong>de</strong>seitigen Versprechungen gepaart waren, versuchten bei<strong>de</strong> Partner, von <strong>de</strong>n schweren Nie<strong>de</strong>rlagen gegen die Schwe<strong>de</strong>n nachhaltig beeindruckt,<br />
ihrerseits aus <strong>de</strong>m Krieg aus<strong>zu</strong>kehren. Ohne Mitwissen ihres Bündnispartners boten sie <strong>de</strong>m Schwe<strong>de</strong>nkönig Karl XII. Seperatfrie<strong>de</strong>n an. Dieser wollte davon nichts wissen und rüstete<br />
verstärkt für einen neuen Feld<strong>zu</strong>g gegen Sachsen. Da<strong>zu</strong> ließ er für 1701 insgesamt 80.492 Mann aufstellen. 17.000 Mann wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Deckung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sinneren abgestellt, 18.000 Mann<br />
schützten Schwedisch-Pommern, 45.000 Mann waren auf Livland, Estland und Ingermanland verteilt. [8] Der größte Teil <strong>de</strong>r schwedischen Truppen in Livalnd wur<strong>de</strong> um Dorpat<br />
konzentriert. Nach <strong>de</strong>n üblichen Heerschauen begann am 17. Juni 1701 <strong>de</strong>r schwedische Vormarsch über Wolmar und Wen<strong>de</strong>n nach Riga. Die Schwe<strong>de</strong>n planten die Düna zwischen<br />
Kokenhusen und Riga <strong>zu</strong> passieren. Die Sachsen hatten dieses Vorgehen ihrerseits vermutet und an mehreren Übergangsstellungen entlang <strong>de</strong>r Düna Feldbefestigungen errichtet. Am 19.<br />
Juli 1701 stan<strong>de</strong>n sich 25.000 Mann starke sächsisch-russische Truppen und 20.000 schwedische Soldaten[9] bei Riga an <strong>de</strong>r Düna gegenüber. Der sächsische Oberbefehlshaber Adam<br />
Heinrich von Steinau ließ sich durch schwedische Ablenkungsmanöver täuschen und zersplitterte seine Einheiten entlang <strong>de</strong>r Düna. So gelang es <strong>de</strong>r schwedischen Infanterie, <strong>de</strong>n<br />
reißen<strong>de</strong>n Fluss <strong>zu</strong> überqueren und einen Brückenkopf <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n. Die sächsische Armee erlitt eine Nie<strong>de</strong>rlage, konnte sich aber sammeln und ohne Rast bis auf preußisches Territorium<br />
geordnet <strong>zu</strong>rückziehen. Die russischen Truppen zogen sich ebenso, von <strong>de</strong>r erneuten Nie<strong>de</strong>rlage geschockt, nach Russland <strong>zu</strong>rück. Ganz Kurland stand <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n damit offen. Karl<br />
besetzte mit seinen Truppen Mitau, die Hauptstadt <strong>de</strong>s Herzogtums Kurland, das unter polnischer Lehnshoheit stand.<br />
Die Rzeczpospolita, die polnisch-litauische Republik, protestierte gegen die Verlet<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s polnischen Hoheitsgebietes, <strong>de</strong>nn nicht diese (vertreten durch <strong>de</strong>n polnischen Reichstag)<br />
befand sich im Krieg mit Schwe<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nur <strong>de</strong>r König von Polen. August <strong>de</strong>r Starke bot Karl XII. erneut Verhandlungen an. Karls Ratgeber rieten ihm, mit <strong>de</strong>m König von Polen<br />
Frie<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> schließen. Doch Karl blieb starrsinnig und verlangte vom Sejm die Wahl eines neuen Königs. Dies lehnte die Mehrheit <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls ab.[10] Im Januar 1702 verlegte<br />
Karl das schwedische Heer von Kurland nach Litauen. Am 23. März 1702 verließ Karl XII. das Winterquartier in Litauen und marschierte in Polen ein. Am 14. Mai 1702 ergab Warschau<br />
sich kampflos. Es wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Zahlung einer hohen Kontribution gezwungen, bevor Karl seinen Marsch nach Krakau fortsetzte. Auf <strong>de</strong>m Weg dorthin stellte sich das 24.000 Mann starke<br />
polnisch-sächsische Heer <strong>de</strong>n nur 12.000 Mann zählen<strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n entgegen, und am 19. Juli 1702 kam es <strong>zu</strong>r Schlacht bei Klissow südlich von Kielce. Die Polen und Sachsen<br />
unterlagen erneut gegen die Schwe<strong>de</strong>n. 2.000 Sachsen wur<strong>de</strong>n getötet o<strong>de</strong>r verletzt, und mehr als 1.000 gerieten in schwedische Gefangenschaft. Auf schwedischer Seite wur<strong>de</strong>n nur 900<br />
Soldaten getötet o<strong>de</strong>r verletzt. Die Schwe<strong>de</strong>n erbeuteten die gesamte sächsische Artillerie und <strong>de</strong>n gesamten Tross mit Augusts Feldkasse mit 150.000 Reichstalern und seinem
Silbergeschirr. August sammelte die verbliebenen Einheiten seines Heeres und zog sich in die östlichen Lan<strong>de</strong>steile von Polen <strong>zu</strong>rück. Karl XII. besetzte Krakau drei Wochen später.<br />
August bot <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n nach dieser Nie<strong>de</strong>rlage abermals Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen an. Er wollte <strong>de</strong>n schwedischen For<strong>de</strong>rungen so weit als irgend möglich entgegenkommen, nur König<br />
von Polen wünsche er <strong>zu</strong> bleiben. Auch <strong>de</strong>r Kardinal-Primas unterbreitete im Namen <strong>de</strong>r Republik Polen Vorschläge für einen Frie<strong>de</strong>n. Er bot Schwe<strong>de</strong>n Polnisch Livland, Kurland und<br />
eine hohe Kriegsentschädigung. Karl XII. müsse lediglich auf die Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Königs verzichten. Ein weiteres Mal zeigte Karl sich starrsinnig (König Eisenkopf) und beharrte auf <strong>de</strong>r<br />
Abset<strong>zu</strong>ng Augusts. Am 21. April 1703 schlugen die Schwe<strong>de</strong>n die Sachsen in <strong>de</strong>r Schlacht bei Pultusk und nahm nach einer monatelangen Belagerung von Thorn die Stadt im September<br />
1703 ein. In vielen dieser Begegnungen waren die schwedischen Kräfte <strong>de</strong>m Gegner um das zwei- bis dreifache unterlegen.<br />
August zog sich mit seinem Hof nach Sandomierz <strong>zu</strong>rück. Dort bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r polnische A<strong>de</strong>l eine Konfö<strong>de</strong>ration <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng von August II. Sie kämpften gegen die schwedische<br />
Beset<strong>zu</strong>ng Polens und gegen <strong>de</strong>n von Schwe<strong>de</strong>n gefor<strong>de</strong>rten neuen König. Mit Partisanenaktionen verwickelten sie die schwedischen Truppen in Gefechte und schwächten ihre<br />
Kampfkraft. Am 12. Juli 1704 wur<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n Willen <strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>s polnischen A<strong>de</strong>ls unter <strong>de</strong>m Schutz <strong>de</strong>r schwedischen Armee Stanislaus I. Leszczyński <strong>zu</strong>m König gewählt.<br />
Aber auch in Sachsen gab es Wi<strong>de</strong>rstand gegen die Polenpolitik <strong>de</strong>s Kurfürsten. August führte eine Akzisesteuer ein, um seine Kriegskasse <strong>zu</strong> füllen und die Armee aufrüsten <strong>zu</strong> können.<br />
Das brachte die sächsischen Stän<strong>de</strong> gegen ihn auf. Außer<strong>de</strong>m erregte er <strong>de</strong>n Unmut <strong>de</strong>r Bevölkerung durch aggressive Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Rekrutenwerbung.<br />
Die erste Hälfte <strong>de</strong>s Jahres 1705 verlief in Polen ohne militärische Ereignisse. Die Stadt Rawitsch bil<strong>de</strong>te das Hauptquartier für die schwedische Armee unter Oberkommando <strong>de</strong>s Königs<br />
Karl XII. Zu <strong>de</strong>r Zeit wur<strong>de</strong> entschie<strong>de</strong>n, dass <strong>de</strong>r Kandidat Karls XII., Stanislaus Leszczyński, <strong>zu</strong>m neuen polnischen König gekrönt wer<strong>de</strong>n solle. Diese Krönung sollte im Juli 1705<br />
vonstatten gehen. Seine Gegner sammelten daraufhin eine Streitmacht von 10.000 Mann in Warschau, um diese Krönung <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn. Um die Sicherheit <strong>de</strong>s Thronfolgers <strong>zu</strong><br />
gewährleisten, sen<strong>de</strong>te Karl XII. seinen Generalleutnant Carl Nieroth mit einer 2000 Mann starken Streitmacht nach Warschau.<br />
Für die Schwe<strong>de</strong>n war die Sicherung <strong>de</strong>r Thronfolge <strong>de</strong>shalb so wichtig, da nur mit ihrem Wunschkandidaten die <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Zeitpunkt angelaufenen Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen mit Polen<br />
abgeschlossen wer<strong>de</strong>n konnten. Der eigentliche polnische König, <strong>de</strong>r Wettiner August II., war <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit zwar <strong>zu</strong> Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen mit Schwe<strong>de</strong>n bereit, <strong>de</strong>nnoch wollten die<br />
Schwe<strong>de</strong>n ihrerseits einen für ihre Zwecke fügsameren Kandidaten auf <strong>de</strong>m polnischen Thron sehen. Somit sahen die Schwe<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Entthronung Augusts II. die einzige Möglichkeit,<br />
Frie<strong>de</strong>n in ihrem Sinne <strong>zu</strong> schaffen. Am 31. Juli 1705 kam es bei Warschau <strong>zu</strong>r Schlacht von Rakowitz, in <strong>de</strong>r eine aus Sachsen und Polen bestehen<strong>de</strong> Armee von einer fünfmal kleineren<br />
schwedischen Armee besiegt wur<strong>de</strong>. Als Folge wur<strong>de</strong> am 24. September 1705 Stanislaus Leszczyński <strong>zu</strong>m neuen polnischen König gekrönt. Am 18. November 1705 schließt Polen<br />
Frie<strong>de</strong>n mit Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Im Dezember 1705 überschritten 20.000 Mann russischer Truppen unter Feldmarschall Georg Benedikt von Ogilvy die polnische Grenze, um sich mit <strong>de</strong>n sächsischen Truppen <strong>zu</strong><br />
vereinen. Karl zog ihnen mit <strong>de</strong>m Hauptteil seiner Armee von fast 30.000 Mann entgegen. Ein Heer von 10.000 Mann unter Carl Gustaf Rehnskiöld wandte sich gegen die Sachsen, die<br />
inzwischen wie<strong>de</strong>r eine Stärke von 19.000 Soldaten hatten. Die russische Armee verschanzte sich in <strong>de</strong>r Festung Grodno und wartete auf Entsatz. Unter<strong>de</strong>ssen kam es am 13. Februar<br />
1706 zwischen <strong>de</strong>r sächsischen und <strong>de</strong>r schwedischen Armee <strong>zu</strong>r Schlacht bei Fraustadt, in <strong>de</strong>r die Schwe<strong>de</strong>n unter Rhenskiöld <strong>de</strong>n Sachsen unter General von <strong>de</strong>r Schulenburg eine<br />
vernichten<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rlage <strong>zu</strong>fügten. Da die russische Armee in Grodno nicht mehr auf Hilfe hoffen konnte, wagte sie einen Ausbruch. Sie entkamen <strong>de</strong>n Verfolgern und konnten sich über<br />
die Grenze retten. Karl erkannte, dass er eine Entscheidung in Russland herbeiführen musste. Dafür brauchte er aber Rückenfreiheit.<br />
Am 27. August 1706 rückte die schwedische Armee in Sachsen ein. Sie eroberte Zug um Zug das Kurfürstentum und erstickte je<strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand im Keim. Karl XII. sicherte <strong>de</strong>r<br />
sächsischen Bevölkerung <strong>zu</strong>, dass keine Übergriffe und Repressalien stattfän<strong>de</strong>n, wenn sie <strong>de</strong>n Anordnungen <strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ngsmacht Folge leisteten. August, <strong>de</strong>r seit <strong>de</strong>r Schlacht bei<br />
Fraustadt keine nennenswerten Truppen mehr in Polen hatte, bot Karl Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen an. Seine Unterhändler Carl Piper und Olof Hermelin unterzeichneten am 24. September<br />
1706 in Altranstädt einen Frie<strong>de</strong>nsvertrag. Mit <strong>de</strong>r Drohung, auf Seiten Ludwigs <strong>de</strong>s XIV. von Frankreich in <strong>de</strong>n Spanischen Erbfolgekrieg ein<strong>zu</strong>greifen, erreichte Karl außer<strong>de</strong>m, dass<br />
<strong>de</strong>n Lutheranern in <strong>de</strong>r damals noch habsburgischen Provinz Schlesien eine begrenzte Religionsfreiheit <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>. Diese erhielten das Recht, sogenannte Gna<strong>de</strong>nkirchen <strong>zu</strong><br />
errichten.<br />
In <strong>de</strong>r Schlacht bei Kalisch schlugen nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsvertrag zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Sachsen die verbün<strong>de</strong>ten russischen, sächsischen und polnischen Truppen die schwedischen<br />
Truppen unter General Mar<strong>de</strong>felt. Die schwedischen Truppen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht völlig vernichtet. Über 100 Offiziere (unter ihnen auch polnische Magnaten) und General Mar<strong>de</strong>felt<br />
gerieten in Gefangenschaft. August lehnte trotz<strong>de</strong>m eine Annullierung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>nsvertrages ab und kehrte nach Sachsen <strong>zu</strong>rück. Am 19. Dezember ratifizierte er <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsvertrag.
Russische Eroberung Ingermanlands, Estlands und Livlands 1701–1706<br />
Nach<strong>de</strong>m klar war, dass die schwedische Hauptarmee auf <strong>de</strong>m polnischen Kriegsschauplatz gebun<strong>de</strong>n war, nutzte Zar Peter I. die Situation und ließ die verbliebenen russische Kräfte nach<br />
<strong>de</strong>m Desaster von Narva ihre Aktivitäten in <strong>de</strong>n schwedischen Baltikumprovinzen wie<strong>de</strong>r aufnehmen.<br />
Den Zeitgewinn nutze Zar Peter I., um unter enormen Anstrengungen seine Armee wie<strong>de</strong>r aufrüsten und reorganisieren <strong>zu</strong> lassen. Durch Rekrutierungen konnte die Armee wie<strong>de</strong>r<br />
verstärkt wer<strong>de</strong>n und umfasste 1705 bereits wie<strong>de</strong>r 200.000 Soldaten, nach <strong>de</strong>n 34.000 verbliebenen im Jahr 1700.[11] Er ernannte ausländische Experten, die die Truppen – ausgestattet<br />
mit mo<strong>de</strong>rnen Waffen – in <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r westeuropäischen Kriegsführung schulen sollten. Um die bei Narva verlorengegangene Artilleriewaffe schnell wie<strong>de</strong>r auf<strong>zu</strong>bauen, ließ Peter<br />
I. Kirchenglocken konfiszieren, um aus ihnen Kanonen her<strong>zu</strong>stellen. So verfügte die russische Armee im Frühjahr 1701 wie<strong>de</strong>r über 243 Kanonen, 13 Haubitzen und 12 Mörser.[11] Die<br />
schwedischen Kräfte im Baltikum unter Kommando von Wolmar Anton von Schlippenbach waren nur sehr schwach [12] und wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><strong>de</strong>m in drei autonome Korps getrennt. Je<strong>de</strong>s<br />
dieser Korps für sich war <strong>zu</strong> schwach, um <strong>de</strong>n russischen Kräften mit Erfolg entgegentreten <strong>zu</strong> können. Auch wur<strong>de</strong>n die separierten Korps nicht koordiniert geführt.[13] Schwedische<br />
Verstärkungen wur<strong>de</strong>n primär <strong>de</strong>m polnischen Kriegsschauplatz <strong>zu</strong>geführt, so dass ein strategisch wichtiger Punkt nach <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren von <strong>de</strong>r russischen Armee erobert wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Von ihrem Hauptquartieren bei Pskow und Nowgorod aus begann En<strong>de</strong> 1701 die erste russische Invasion nach Livland mit einer etwa 26.000 Mann zählen<strong>de</strong>n Streitmacht. Bei <strong>de</strong>m sich<br />
anschließen<strong>de</strong>n Feld<strong>zu</strong>g gelang es Schlippenbach, mit einer etwa 2000 Mann starken schwedischen Abteilung im September das etwa 7000 Mann zählen<strong>de</strong> russische Hauptheer unter<br />
Boris Scheremetjew in zwei Begegnungen bei Rauge und Kasaritz <strong>zu</strong> schlagen, wobei die Russen 2000 Verluste erlitten. Dessen ungeachtet unternahmen die Russen weiterhin sich stetig<br />
intensivieren<strong>de</strong> begrenzte Angriffe auf livländisches Gebiet, <strong>de</strong>m die zahlenmäßig schwachen Schwe<strong>de</strong>n immer schwieriger nachkommen konnten.<br />
Während <strong>de</strong>r zweiten großen Invasion nach Livland unter <strong>de</strong>r Führung von General Boris Scheremetjew gewannen die Russen gegen die etwa 2200 Mann zählen<strong>de</strong>[14] schwedische<br />
livländische Armee unter Kommando von Schlippenbach in <strong>de</strong>r Schlacht bei Erestfer am 30. Dezember 1701. Die schwedischen Verluste wer<strong>de</strong>n auf etwa 1000 Mann geschätzt.<br />
Nach<strong>de</strong>m sie die Gegend geplün<strong>de</strong>rt und zerstört hatten, zogen sie sich allerdings wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rück. Im Sommer 1702 fand die dritte große, etwa 40.000 Mann zählen<strong>de</strong>, russische Invasion<br />
statt. Am 19. Juli erlangten die Russen entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Siege gegen die etwa 6000 Mann zählen<strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n[15] in <strong>de</strong>n Gefechten bei Hummelshof (o<strong>de</strong>r Hummelsdorf), nahe Dorpat<br />
und Marienburg in Livland, bei <strong>de</strong>r nach schwedischen Angaben 840 Tote und 1000 Gefangene in <strong>de</strong>r Schlacht selbst und weitere 1000 Schwe<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>r sich anschließen<strong>de</strong>n<br />
Verfolgung <strong>zu</strong> beklagen waren.[16] Die Schlacht be<strong>de</strong>utete das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r livländischen Armee und <strong>de</strong>n Grundstock für die russische Eroberung Livlands. Wolmar und Marienburg (im<br />
August) und die ländlichen Gebiete Livlands fielen nach <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Schlachten in russische Hän<strong>de</strong>.<br />
Feldmarschall Boris Scheremetjew führte die russische Armee dann nordwärts Richtung Ingria. Am 11. Oktober 1702 ging die mit 450 Schwe<strong>de</strong>n besetzte Festung Nöteborg in russischen<br />
Besitz über. Diese am Zufluss <strong>de</strong>r Newa aus <strong>de</strong>m Ladogasee gelegene Festung kontrollierte die Mündung und wur<strong>de</strong> aufgrund dieser strategisch wichtigen Be<strong>de</strong>utung von Peter I. in<br />
Schlüsselburg umgetauft.<br />
Nach<strong>de</strong>m im Mai 1703 die schwedische Festung Nyenschantz an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Neva in <strong>de</strong>n Golf von Finnland durch Boris Scheremetjew mit Hilfe <strong>de</strong>r neuerrichteten Russischen<br />
Marine erobert wer<strong>de</strong>n konnte, begann Zar Peter I. im sumpfigen Delta <strong>de</strong>r Newa 1703 mit <strong>de</strong>m Aufbau einer Festung und später mit einer Stadt, die mit <strong>de</strong>m Namen Sankt Petersburg<br />
neue russische Hauptstadt wer<strong>de</strong>n sollte. Der Rest von Ingria, inklusive Jaama und Koporje, fiel danach schnell <strong>de</strong>n Russen <strong>zu</strong>.<br />
Im Sommer <strong>de</strong>s Jahres 1704 wur<strong>de</strong> eine russische Armee, unter <strong>de</strong>m Kommando von Feldmarschall Georg Benedikt von Ogilvys (1651–1710), von Ingermanland aus <strong>zu</strong>r Eroberung von<br />
Narva angesetzt. Gleichzeitig stieß eine weitere russische Armee gegen Dorpat vor. Ziel dieser Operationen war die Einnahme dieser wichtigen Grenzfestungen, um dadurch das im<br />
Vorjahr eroberte Ingermanland mit <strong>de</strong>m neuen St. Petersburg <strong>zu</strong> schützen und die Möglichkeit <strong>zu</strong>r Eroberung Livlands <strong>zu</strong> gewinnen. Am 14. Juli 1704 fiel Dorpat in russische Hän<strong>de</strong> und<br />
am 9. August Narva. 1706 waren nur noch wenige Hauptorte und Festungen, namentlich Riga, Pernau, Arensburg und Reval, in schwedischen Hän<strong>de</strong>n.<br />
Die russischen Siege wur<strong>de</strong>n durch eine <strong>de</strong>utliche numerische Überlegenheit sichergestellt. Die russische Taktik konzentrierte sich auf Angriffe auf isolierte und nur mit kleinen<br />
Garnisonen versehene schwedische Festungen. Beson<strong>de</strong>rs am Anfang vermied es die russische Armee noch, größere Festungen an<strong>zu</strong>greifen. Ein beson<strong>de</strong>res Kennzeichen dieses<br />
Kriegsschauplatzes war auch die planmäßige Anwendung <strong>de</strong>r Taktik <strong>de</strong>r verbrannten Er<strong>de</strong> seitens <strong>de</strong>r Russen. Das Ziel, das die Russen damit verfolgten, war es, das Baltikum als<br />
mögliche schwedische Basis für weitere Operationen untauglich <strong>zu</strong> machen. Eine große Zahl an Einwohnern wur<strong>de</strong> im Zuge dieser Taktik durch die russische Armee verschleppt. Viele<br />
dieser Verschleppten en<strong>de</strong>ten als Leibeigene auf <strong>de</strong>n Gütern hoher russischer Offiziere o<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong>n als Sklaven an die Tataren o<strong>de</strong>r die Osmanen veräußert.[17] Durch die Einsätze und
die militärischen Erfolge auf diesem Kriegsschauplatz in diesen Jahren hatte die russische Armee wertvolle Erfahrung und Selbstvertrauen gewonnen. Die Siege zeigten, wie effektiv sich<br />
die Zarenarmee in nur wenigen Jahren entwickelt hatte.<br />
Feld<strong>zu</strong>g gegen Russland 1707–1709<br />
Die russische Taktik bestand darin, <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n in kleinen Gefechten <strong>zu</strong> begegnen und eine große Entscheidungsschlacht <strong>zu</strong> vermei<strong>de</strong>n. Die Kosakenverbän<strong>de</strong> spielten in diesem<br />
Konzept für die Russen eine wichtige Rolle. Mehrere Frie<strong>de</strong>nsangebote Zar Peters I. im Februar, Juni und August 1707 lehnte <strong>de</strong>r in Sachsen verweilen<strong>de</strong> Karl XII. ab, da er diese für eine<br />
List hielt. Karl XII. erkannte, dass nur ein Vorstoß in das Herz <strong>de</strong>s Russischen Zarentums <strong>de</strong>n Krieg been<strong>de</strong>n könnte und wandte sich im September 1707 gegen seinen alleinigen Gegner<br />
Russland. Als er Sachsen verließ und durch Polen nach Russland zog, hatte er seine Armee auf 44.000 Mann vergrößert (seine Hauptarmee bestand aus 36.000 Soldaten), neu eingeklei<strong>de</strong>t<br />
und mit neuen Waffen ausgerüstet. Seine Kriegskasse war um mehrere Millionen Taler größer. In Polen stießen 8.000 schwedische Rekruten sowie 16.000 Soldaten von Seiten<br />
Leszczyńskis und Józef Potockis <strong>zu</strong> ihm.[18]Somit zog <strong>de</strong>r König mit fast 70.000 Soldaten gegen Moskau. Der Fel<strong>zu</strong>g verlief <strong>zu</strong>nächst erfolgreich. Nach einer viermonatigen Ruhepause<br />
überschritt Karl XII. in einem Winterfeld<strong>zu</strong>g am 1. Januar 1708 die Weichsel und nahm Grodno ein. Das schwedische Heer setzte, nach<strong>de</strong>m am 1. Juni <strong>de</strong>r Sommerfeld<strong>zu</strong>g begonnen<br />
wur<strong>de</strong>, am 18. Juni über die Beresina und schlug am 4. Juli 1708 eine 20.000 Mann starke russische Armee in <strong>de</strong>r Schlacht von Golowtschin. Im September schlug es eine russische<br />
Armee von 16.000 Mann bei Smolensk. Zu diesem Zeitpunkt war es nur noch 10 Tagesmärsche von Moskau entfernt. Da die Schwe<strong>de</strong>n aber durch die russische Taktik <strong>de</strong>r verbrannten<br />
Er<strong>de</strong> an Versorgungsmängeln litten, befahl Karl XII. General Adam Ludwig Lewenhaupt, von Riga aus mit 11.000 Mann Verstärkung und Versorgungszügen <strong>zu</strong> ihm <strong>zu</strong> stoßen. Karl XII.<br />
ließ <strong>de</strong>n Vormarsch daher bei Mogilev stoppen.<br />
Eine schwedische Streitkraft von 12.000 Mann, die Ingermanland von Finnland aus erobern und die neue russische Stadt Sankt Petersburg nie<strong>de</strong>rbrennen sollte, musste aufgrund <strong>de</strong>r<br />
starken Verteidigung <strong>de</strong>r Stadt diesen Plan aufgeben und unter einen Verlust von 3000 Mann <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g nach Vyborg antreten.<br />
1708 erschienen erneut russische Truppen in Polen. Ihnen gelang es während <strong>de</strong>s außergewöhnlich harten Winters 1708/1709, in <strong>de</strong>r Schlacht bei Lesnaja am 9. Oktober 1708 <strong>de</strong>n Tross<br />
<strong>de</strong>r schwedischen Armee <strong>zu</strong> erbeuten, die damit von ihrer Versorgung abgeschnitten war. Der schwedische General Lewenhaupt und über 6000 Soldaten schafften es im Anschluss an die<br />
Schlacht, ohne Versorgungstross <strong>zu</strong>m schwedischen Hauptheer <strong>zu</strong> stoßen. Während <strong>de</strong>r König wartete, erhielt er in Mogilev Nachricht vom Ataman <strong>de</strong>r ukrainischen Kosaken, Iwan<br />
Masepa. Masepa, einst ein Verbün<strong>de</strong>ter Zar Peters, war in Ungna<strong>de</strong> gefallen und suchte einen Weg, die Ukraine aus <strong>de</strong>r russischen Umklammerung <strong>zu</strong> lösen. Er versprach, dass er einen<br />
Großaufstand anführen und ihn mit einer 100.000 Mann starken Armee unterstützen wür<strong>de</strong>, wenn die Schwe<strong>de</strong>n in die Ukraine vorrückten. Karl XII. marschierte daraufhin entgegen <strong>de</strong>m<br />
Rat seiner Generäle in die Ukraine. Doch die erwartete Verstärkung durch die mit Schwe<strong>de</strong>n verbün<strong>de</strong>ten Kosaken unter Ataman Iwan Masepa blieb aus. Die Russen hatten eine Armee<br />
unter Prinz Alexan<strong>de</strong>r Danilowitsch Menschikow entsandt, <strong>de</strong>r Baturyn, Masepas Hauptstadt, besetzte und viele seiner Unterstützer tötete. So konnte Masepa nur einen kleinen Teil <strong>de</strong>r<br />
versprochenen Männer aufstellen. Nichts<strong>de</strong>stoweniger verbrachte Karl XII. <strong>de</strong>n Winter in <strong>de</strong>r Ukraine, immer noch selbstbewusst seine Ziele <strong>zu</strong> erreichen. Doch <strong>de</strong>r Winter von 1708/09,<br />
<strong>de</strong>r schwerste in <strong>de</strong>m Jahrhun<strong>de</strong>rt, wirkte sich verheerend für die Schwe<strong>de</strong>n aus.<br />
So war <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Frühjahrs 1709 nur noch ein Drittel <strong>de</strong>r schwedischen Armee in Russland, etwa 20.000 Mann mit wenigen Kanonen einsatzbereit. Beson<strong>de</strong>rs die in Deutschland<br />
angeworbenen Soldaten hatten die Kälte nicht verkraftet. Weitere Unterstüt<strong>zu</strong>ng boten die Verbän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Saporoger Kosaken, die von Masepa aufgestachelt wur<strong>de</strong>n und Zar Peter zwangen<br />
seine Anstrengungen <strong>zu</strong> teilen. Trotz <strong>de</strong>r angespannten Versorgungslage entschied sich König Karl XII., die Stadt Poltava <strong>zu</strong> belagern, einen Nachschubstützpunkt mit großen Vorräten an<br />
Schießpulver und an<strong>de</strong>ren Versorgungsgütern. Er blockierte die Stadt ab Mai, eine schnelle Kapitulation erwartend; jedoch hielten die Russen, die die Garnison im Vorfeld verstärkt<br />
hatten, aus. Nach<strong>de</strong>m Zar Peter die Saporoger Kosaken geschlagen hatte, wandte er sich mit seiner 60.000 Mann starken Armee <strong>de</strong>r belagerten Stadt Poltawa <strong>zu</strong>, um diese <strong>zu</strong> entsetzen.<br />
Die russische Armee überquerte <strong>de</strong>n Fluss Worskla und errichtete ein befestigtes Lager ein paar Kilometer nördlich <strong>de</strong>r Stadt. Als Zar Peter die Lage <strong>de</strong>r schwedischen Armee mitgeteilt<br />
bekam, gab er seine bisherige Politik <strong>de</strong>r Schlachtausweichung auf. Karl XII. entschied sich <strong>zu</strong>r Attacke auf das befestigte Lager am Morgen <strong>de</strong>s 8. Juli 1709. Lewenhaupt for<strong>de</strong>rte die<br />
Aufgabe <strong>de</strong>r Belagerung, aber König Karl XII. lehnte ab und ließ die Belagerung von Poltawa aufrechterhalten. Lediglich 12.500 Mann wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r eigentlichen Schlacht eingesetzt.<br />
Da es einen Mangel an Schießpulver gab, mussten die Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten und leeren Musketen in die Schlacht gehen. Lediglich vier Kanonen wur<strong>de</strong>n für die Attacke<br />
auf schwedischer Seite eingesetzt. So kam es in <strong>de</strong>r Ukraine <strong>zu</strong>r entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlacht bei Poltawa. Entsprechend <strong>de</strong>m Charakter Karls XII. sollte eine Überraschungsattacke die<br />
Russen in Verwirrung und Auflösung stürzen. Doch die Schwe<strong>de</strong>n erlitten eine vernichten<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rlage.<br />
Nach <strong>de</strong>r Schlacht sammelten sich die <strong>zu</strong>rückfluten<strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n im Lager bei Puschkariwka. Insgesamt bestand die gesamte schwedische Armee noch aus etwa 15.000 Mann und 6.000
Kosaken[19]. Als Rück<strong>zu</strong>gslinie stand <strong>de</strong>r Weg nach Sü<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verfügung. Nach einer Reorganisierung und Auffrischung sollte die Armee durch osmanisches Gebiet nach Polen<br />
<strong>zu</strong>rückgeführt wer<strong>de</strong>n. Noch am Schlachttag marschierte die Armee entlang <strong>de</strong>r Worskla nach Sü<strong>de</strong>n ab. Am 10. Juli traf das Heer bei Perewolotschna am Zusammenfluss von Worskla<br />
und Dnepr ein und musste feststellen, dass die wenigen Boote nicht ausreichten, um die gesamte schwedische Armee <strong>zu</strong> evakuieren.[20]<br />
Man beschloss daher im schwedischen Hauptquartier, dass Karl XII., die Verwun<strong>de</strong>ten, sowie eine Eskorte aus Schwe<strong>de</strong>n und Kosaken <strong>de</strong>n Dnepr überqueren und auf osmanisches Gebiet<br />
ziehen sollten. Das Heer hingegen sollte die Worskla wie<strong>de</strong>r hinauf marschieren und nach Sü<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Krim einschwenken. Von dort sollte es wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m König stoßen. In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m<br />
30. Junijul./ 11. Juli 1709greg. setzte <strong>de</strong>r König mit Iwan Masepa, <strong>de</strong>ssen Gefährten Kost Hordijenko, sowie 900 Schwe<strong>de</strong>n und 2000 Kosaken über <strong>de</strong>n Fluss. Die Armee, die nun unter<br />
<strong>de</strong>m Befehl <strong>de</strong>s Generals Lewenhaupt stand, bereitete <strong>de</strong>n Abmarsch für <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Morgen vor. Um 8 Uhr traf jedoch eine russische Kolonne von 6.000 Dragonern und 3.000<br />
Kalmücken unter General Menschikow ein. Lewenhaupt leitete sofort Verhandlungen ein und man einigte sich schließlich, <strong>zu</strong> kapitulieren, obwohl man <strong>de</strong>n gegenüberstehen<strong>de</strong>n<br />
russischen Truppen zahlenmäßig fast doppelt überlegen war. Am Morgen <strong>de</strong>s 30. Junijul./ 11. Juligreg. um 11 Uhr kapitulierte das schwedische Heer mit rund 14.000 Soldaten, 34<br />
Geschützen und 264 Fahnen. Die verbliebenen Kosaken flüchteten größtenteils auf ihren Pfer<strong>de</strong>n, um <strong>de</strong>r Bestrafung als Verräter <strong>zu</strong> entgehen.[21] Die Kolonne König Karls XII. erreichte<br />
wenige Tage später am 17. Juli <strong>de</strong>n Bug, wo <strong>de</strong>r Pascha von Otschakow seine Erlaubnis erteilte, das Osmanische Reich <strong>zu</strong> betreten. Eine Nachhut von 600 Mann schaffte das Übersetzen<br />
über <strong>de</strong>n Bug nicht mehr und wur<strong>de</strong> von 6.000 russischen Reitern unter General Wolkonski eingeholt und nie<strong>de</strong>rgemacht.[22] Damit en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r russische Feld<strong>zu</strong>g Karls XII. in einer<br />
<strong>de</strong>saströsen Nie<strong>de</strong>rlage, die die Wen<strong>de</strong> in diesem Krieg be<strong>de</strong>utete.<br />
Weiterer Kriegsverlauf 1710–1721<br />
Russisch-Osmanischer Krieg<br />
Peter schickte seinen Botschafter nach Istanbul und for<strong>de</strong>rte die Auslieferung Karls. Ahmed III. ließ <strong>de</strong>n Botschafter ins Gefängnis werfen. Daraufhin fiel Peter mit seiner Armee ins<br />
Osmanische Reich ein. Die osmanischen Truppen kesselten ihn bei Huşi, einem kleinen Ort am Pruth, ein. Sie nutzten jedoch ihre überlegene Position nicht aus und ließen ihn ehrenvoll<br />
abziehen. Im Frie<strong>de</strong>n vom Pruth verpflichtete Peter sich, die Festung Asow ab<strong>zu</strong>treten und sich aus <strong>de</strong>n Gebieten <strong>de</strong>r Kosaken <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>ziehen.<br />
Operationen im Ostseeraum<br />
In Polen allerdings weigerte sich die Konfö<strong>de</strong>ration von Sandomir unter <strong>de</strong>m Hetman Adam Mikołaj Sieniawski, <strong>de</strong>m reichsten Mann Polens und Schwiegersohn Fürst Lubomirskis, die<br />
Abdankung Augusts II. und die Thronbesteigung Stanislaus Leszczynskis an<strong>zu</strong>erkennen. Der russische Zar schlug <strong>de</strong>n Polen neue Thronkandidaten vor und auch Leszczynski versuchte<br />
seine Gegner für sich <strong>zu</strong> gewinnen. Dies scheiterte aber an <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Verteilung von Pfrün<strong>de</strong>n und Posten. Die Konfö<strong>de</strong>ration hatte allerdings nur geringen militärischen Wert; ihre<br />
Truppen konnten allenfalls <strong>de</strong>n Nachschub <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n stören.<br />
Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n bei Poltawa kündigte August <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Altranstädt. Am 20. August 1709 marschierten erneut sächsische Truppen in Polen ein. Die<br />
schwedischen Truppen mit 9.000 Mann zogen sich nach Stettin und Stralsund <strong>zu</strong>rück. Stanislaus Leszczynski floh ins Ausland. Am 28. Juni 1709 erneuerten Dänemark und Sachsen ihren<br />
Bündnisvertrag. Auch an<strong>de</strong>re Staaten griffen in <strong>de</strong>n Krieg ein. Das Kurfürstentum Hannover erhob Anspruch auf Bremen und Ver<strong>de</strong>n (Aller). Preußen wollte sich <strong>de</strong>r schwedischen<br />
Gebiete in Pommern bemächtigen – Stettin, Usedom, Wollin. En<strong>de</strong> 1709 besetzte die dänische Armee mit 14.000 Soldaten die südschwedische Provinz Schonen, wur<strong>de</strong> jedoch drei<br />
Monate später in <strong>de</strong>r Schlacht von Helsingborg von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>m Kommando von Magnus Stenbock wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rückgeschlagen. Am 4. Juli 1710 ergab sich die Stadt Riga nach<br />
längerer Belagerung <strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>s russischen Generals Boris Petrowitsch Scheremetew. [23] 1712 besetzte Dänemark das schwedische Herzogtum Ver<strong>de</strong>n und verpfän<strong>de</strong>te es 1715 an<br />
Hannover.<br />
Peter I. sicherte seine Gebietsgewinne im Ostseeraum. Im Sommer 1713 hatte er Südfinnland erobert. Zu Wasser waren die Schwe<strong>de</strong>n mit ihren großen Schiffen, die viele Geschütze<br />
tragen konnten, <strong>de</strong>r russischen Flotte aber weit überlegen. Peters einzige Chance war eine Schlacht in Küstennähe. Unter Aufbietung aller Mittel verdoppelte er seine Ostseeflotte und<br />
stellte sie unter das Kommando erfahrener Venezianer und Griechen. Im August 1714 lagen sich die bei<strong>de</strong>n Flotten bei Hangö gegenüber. Während einer anhalten<strong>de</strong>n Flaute kämpften sich<br />
die kleineren, aber wendigen russischen Schiffe durch <strong>de</strong>n schwedischen Geschützhagel und enterten die unbeweglichen schwedischen Schiffe eins nach <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren. Damit herrschte<br />
die russische Flotte über die nördliche Ostsee.
Kampf um Schwedisch-Pommern 1711–1715<br />
Am 29. August 1711 drangen erstmals dänische Truppen unter <strong>de</strong>m Kommando König Friedrichs IV. von Mecklenburg aus bei Damgarten in Schwedisch-Pommern ein. Die Schwe<strong>de</strong>n<br />
hatten hier nur 8.000 Mann unter Oberst Karl Gustav Düker stehen.[24] Zu <strong>de</strong>n Dänen stießen Anfang September 1711 russische und sächsische Truppen. Sie waren durch die Neumark<br />
und die Uckermark gekommen und vereinigten sich bald darauf mit <strong>de</strong>m dänischen Heer. Die zahlenmäßig unterlegenen Schwe<strong>de</strong>n beschränkten sich <strong>de</strong>shalb auf die Verteidigung <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n Festungen Stettin und Stralsund sowie <strong>de</strong>r Insel Rügen.<br />
Ab <strong>de</strong>m 7. September 1711 kam es <strong>zu</strong> einer ersten Belagerung von Stralsund durch die verbün<strong>de</strong>ten Heere. Jedoch fehlten <strong>de</strong>r Belagerungsarmee schwere Artillerie und genügend<br />
Nahrungsmittel für die rund 30.000 Mann starke Truppe.[25] Als am 8. Dezember 1711 6.000 Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng Stralsunds auf Rügen lan<strong>de</strong>ten, zogen sich die Verbün<strong>de</strong>ten am<br />
7. Januar 1712 nach über 17 Wochen Belagerung <strong>zu</strong>rück und bezogen Winterlager in Mecklenburg.<br />
Im Mai 1712 rückten erneut russische Soldaten in Pommern ein und es kam <strong>zu</strong>r zweiten Belagerung von Stralsund, bei <strong>de</strong>r die Verbün<strong>de</strong>ten 7.000 Sachsen und 38.000 Russen aufboten.<br />
Die Belagerung scheiterte wie<strong>de</strong>r, da am 26. September 1712 10.000 Mann unter Kommando <strong>de</strong>s schwedischen Generals Magnus Stenbock auf Rügen lan<strong>de</strong>ten und die Eroberung<br />
Stralsunds unmöglich machten. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres 1712 gelang es <strong>de</strong>m schwedischen General, die Verbün<strong>de</strong>ten aus Pommern <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>drängen und <strong>de</strong>n Krieg nach Mecklenburg und<br />
Holstein <strong>zu</strong> verlagern. Ihm gelang am 20. Dezember 1712 in <strong>de</strong>r Schlacht bei Ga<strong>de</strong>busch ein Sieg über die verbün<strong>de</strong>ten sächsischen und dänischen Truppen. Die verloren 6.000 Soldaten<br />
und mussten sich fluchtartig <strong>zu</strong>rückziehen. Im Januar 1713 ließ Stenbock die Stadt Altona nie<strong>de</strong>rbrennen[26]. Kriegsentschei<strong>de</strong>nd war die Schlacht von Ga<strong>de</strong>busch nicht, schon im<br />
nächsten Jahr sollte sich das Schicksal dieser schwedischen Armee bei Tönning im heutigen Schleswig-Holstein besiegeln.<br />
Nach<strong>de</strong>m die siegreichen Verbün<strong>de</strong>ten aus Holstein wie<strong>de</strong>r nach Pommern einmarschiert waren, erfolgte im Juni 1713 die dritte Belagerung von Stralsund. Diese wur<strong>de</strong> im Oktober<br />
erneut aufgehoben. Im August 1713 begannen russische und sächsische Einheiten unter Führung <strong>de</strong>s Fürsten Menschikow einen Angriff auf Stettin, welches über eine Garnison von 4300<br />
Mann verfügte. Die Stadt ergab sich am 19. September 1713, nach<strong>de</strong>m ein achtstündiges Bombar<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>r sächsischen Belagerungsartillerie große Teile <strong>de</strong>r Stadt zerstört hatte. Am 6.<br />
Oktober 1713 marschierten, nach Verhandlungen und Zahlung von 400.000 Reichstalern an die Alliierten,[27] preußische Truppen in Stettin ein. Schwedisch-Pommern war inzwischen<br />
bis auf Stralsund komplett von <strong>de</strong>n verbün<strong>de</strong>ten Dänen, Russen und Sachsen erobert und von Preußen als neutraler Macht besetzt wor<strong>de</strong>n.<br />
Auch in dieser für Schwe<strong>de</strong>n äußerst kritischen Lage lehnte Karl XII. mehrere Frie<strong>de</strong>nsangebote ab. Er war im November 1714 aus Ben<strong>de</strong>r in die Festung Stralsund <strong>zu</strong>rückgekehrt. Als er<br />
erste Erfolge gegen die preußische Armee erzielte, wur<strong>de</strong> er von <strong>de</strong>n vereinigten russischen, sächsischen, preußischen und dänischen Truppen in <strong>de</strong>r Festung eingeschlossen. Nach einer<br />
monatelangen Belagerung von Wismar (1715/16) und <strong>de</strong>r Belagerung von Stralsund während <strong>de</strong>s Pommernfeld<strong>zu</strong>ges ergaben sich die eingeschlossenen Schwe<strong>de</strong>n am 23. Dezember<br />
1715. König Karl XII. konnte in einem Fischerboot über die Ostsee entkommen.<br />
Ausklang <strong>de</strong>s Krieges: Tod Karls XII.<br />
Am 30. Novemberjul./ 11. Dezember 1718greg. fand Karl XII. bei <strong>de</strong>r Belagerung <strong>de</strong>r norwegischen Festung Fre<strong>de</strong>rikshald unter bis heute ungeklärten Umstän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Tod durch eine<br />
Kugel in die Schläfe.<br />
Gleich nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Königs hob Prinz Friedrich von Hessen-Kassel, <strong>de</strong>r Ehemann von Karls Schwester Ulrike Eleonore, die Belagerung auf und führte das Heer nach Schwe<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>rück. Auf <strong>de</strong>m Rückweg ereignete sich <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>smarsch <strong>de</strong>r Karoliner. Friedrich von Hessen-Kassel übernahm die Krone durch Verzicht seiner Frau, blieb aber in <strong>de</strong>r Folge vom<br />
schwedischen Reichsrat abhängig. Die Unterhandlungen mit Russland wur<strong>de</strong>n abgebrochen. Mit Großbritannien-Hannover, Preußen, Dänemark und Sachsen-Polen wur<strong>de</strong> dagegen unter<br />
Vermittlung Frankreichs <strong>de</strong>r Reihe nach Frie<strong>de</strong>n geschlossen.<br />
Frie<strong>de</strong>nsschlüsse<br />
Am 7. November 1719 (jul.) wur<strong>de</strong> mit Polen ein geheimer Vertrag unterzeichnet, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Oliva bestätigte. August <strong>de</strong>r Starke löste die Allianz mit Peter I. auf. Im Januar<br />
1719 hatte sich August <strong>de</strong>r Starke mit Österreich und Großbritannien verbün<strong>de</strong>t, die ihm Hilfe gegen einen Angriff Russlands auf Polen-Litauen <strong>zu</strong>sicherten. Ulrike Eleonore erkannte ihn<br />
als König von Polen an.
Am 19. November 1719 (jul.) wur<strong>de</strong> in einem Präliminarfrie<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Stockholm <strong>de</strong>r Krieg mit Großbritannien been<strong>de</strong>t. Hannover erhielt in diesem die Herzogtümer Bremen-Ver<strong>de</strong>n gegen<br />
eine Zahlung von einer Million Reichstalern.<br />
Am 21. Januarjul./ 1. Februar 1720greg. kam es nach langwierigen Verhandlungen <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stockholm zwischen Preußen und Schwe<strong>de</strong>n. Preußen behielt Stettin, die Inseln<br />
Usedom und Wollin sowie Vorpommern bis <strong>zu</strong>r Peene für eine finanzielle Gegenleistung von 2 Millionen Reichstalern.<br />
Am 3. Julijul./ 14. Juli 1720greg. been<strong>de</strong>ten Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Krieg im Frie<strong>de</strong>n von Fre<strong>de</strong>riksborg. Dänemark gab Schwe<strong>de</strong>n Rügen und Vorpommern nördlich <strong>de</strong>r Peene<br />
sowie die Herrschaft Wismar <strong>zu</strong>rück, das dafür 600.000 Taler bezahlte und auf die Zollfreiheit im Sund verzichetete.<br />
Das Russische Reich führte <strong>de</strong>rweil <strong>de</strong>n Krieg gegen Schwe<strong>de</strong>n unvermin<strong>de</strong>rt fort. Um die Unterzeichnung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>nsvertrags voran<strong>zu</strong>bringen, entschied sich Peter I., eine<br />
Lan<strong>de</strong>operation im schwedischen Kernland durch<strong>zu</strong>führen. Im August 1719 erfolgte eine gleichzeitige Landung südlich und nördlich von Stockholm. An <strong>de</strong>r Operation waren 20<br />
Linienschiffe, einige hun<strong>de</strong>rt Ru<strong>de</strong>rschiffe sowie 26.000 Mann Landungstruppen beteiligt. Im Verlauf <strong>de</strong>r Operationen wur<strong>de</strong>n acht größere Städte (u.a. die damals zweitgrößte Stadt<br />
Norrköping) zerstört. Durch <strong>de</strong>n General Fjodor Matwejewitsch Apraxin ließ Zar Peter I. die Küste von Westbothnien nie<strong>de</strong>rbrennen. 13 Städte, 361 Dörfer und 441 adlige Güter wur<strong>de</strong>n<br />
zerstört. Am 17. August 1720 wur<strong>de</strong> ein schwedisches Geschwa<strong>de</strong>r von einem russischen geschlagen, und 1721 wur<strong>de</strong> Stockholm selbst nur durch die Ankunft einer britischen Flotte vor<br />
einem russischen Angriff gerettet. Als Großbritannien erkannte, dass es nicht möglich war, eine Koalition gegen Russland <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n, drängte nun auch das Vereinigte Königreich darauf,<br />
die Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen mit Russland so schnell wie möglich auf<strong>zu</strong>nehmen. Infolge eines Finanzcrashs war es für <strong>de</strong>n britischen König Georg I. nicht mehr möglich, die Schwe<strong>de</strong>n<br />
finanziell <strong>zu</strong> unterstützen. Die nor<strong>de</strong>uropäischen Herrscher (mit Ausnahme Augusts II. von Sachsen/Polen) verweigerten, weitere Kriegshandlungen gegen Peter I. auch nur in Betracht <strong>zu</strong><br />
ziehen. Somit blieb Schwe<strong>de</strong>n nichts an<strong>de</strong>res übrig, als mit Russland am 28. April, in Nystadt, in direkte Frie<strong>de</strong>nsunterhandlungen <strong>zu</strong> treten.<br />
Am 10. September 1721 trat Schwe<strong>de</strong>n im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Nystad die Gebiete Ingermanland, Livland, Estland, die Inseln Ösel und Dagö sowie Südkarelien an Russland ab. Dafür<br />
erhielt es Finnland <strong>zu</strong>rück, das Peter I. 1714 erobert hatte.<br />
Im Hamburger Vergleich (1729) erkannte Schwe<strong>de</strong>n die Abtretung <strong>de</strong>s Herzogtums Ver<strong>de</strong>n an Hannover an.<br />
Folgen und Auswirkungen <strong>de</strong>s Krieges<br />
Der Krieg hatte soziologisch gravieren<strong>de</strong> Auswirkungen auf das Schwedische Reich. Das Verhältnis Frauen <strong>zu</strong> Männer betrug 5:3. Finnland hatte die höchsten Verluste erlitten. 16%<br />
seiner Bevölkerung fiel in <strong>de</strong>m Krieg. In Schwe<strong>de</strong>n betrug <strong>de</strong>r Blutzoll 10% <strong>de</strong>r Bevölkerung. Finnland war so schwer getroffen, dass <strong>de</strong>r schwedische Gouverneur für sechs Jahre darauf<br />
verzichtete, Steuern <strong>zu</strong> erheben. Der Mangel an Männern im Schwedischen Reich führte da<strong>zu</strong>, dass vorwiegend Frauen die landwirtschaftliche Arbeit übernehmen mussten.[28]<br />
Schwe<strong>de</strong>n verlor seine Besit<strong>zu</strong>ngen in Deutschland (bis auf Wismar und Vorpommern nördlich <strong>de</strong>r Peene) und im Baltikum und somit seine Stellung als nordische Großmacht an<br />
Russland, welches als neue Militärmacht am Baltikum im Blickfeld Europas aufgetaucht[29] und für die europäische Neuordnung verantwortlich war. Russlands neue Hauptstadt entstand<br />
an <strong>de</strong>r Ostsee, geschützt durch breite Küstengebiete. Eine Entwicklung, die die um ihre Han<strong>de</strong>lsbeziehungen in die Ostsee besorgte See- und Han<strong>de</strong>lsmacht Großbritannien nicht gerne<br />
sah, aber auch nicht verhin<strong>de</strong>rn konnte.[30] Mit Russlands Aufstieg war gleichzeitig <strong>de</strong>r Abstieg Polens verbun<strong>de</strong>n, das in die Einflusssphäre Russlands geriet und ab 1768, aufgrund <strong>de</strong>s<br />
Zusammenbruchs seiner Wehrorganisation, <strong>de</strong> facto <strong>zu</strong> einem russischen Protektorat herabsank und in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielte.[31] Der Nie<strong>de</strong>rgang Schwe<strong>de</strong>ns<br />
und Polens wie<strong>de</strong>rum befreite Preußen von zwei potentiell starken Gegnern in <strong>de</strong>r Region und fiel mit seinem Aufstieg <strong>zu</strong>r Großmacht <strong>zu</strong>sammen.[32] Zusammen mit Frankreich,<br />
Österreich und Großbritannien sollten Russland und Preußen künftig eine Pentarchie <strong>de</strong>r Großmächte bil<strong>de</strong>n. Der Große Nordische Krieg hatte eine grundlegen<strong>de</strong> Verschiebung im<br />
europäischen Mächteverhältnis <strong>zu</strong>r Folge. Bran<strong>de</strong>nburg und Russland waren aus <strong>de</strong>r zweiten in die erste Reihe <strong>de</strong>r europäischen Staaten aufgerückt.[33]<br />
Literatur<br />
• Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York 1987.<br />
• Norman Davies: Im Herzen Europas. Geschichte Polens. München 2000.<br />
• Robert I. Frost: The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721. Harlow (Essex) 2000.<br />
• Eckardt Opitz: Vielerlei Ursachen, ein<strong>de</strong>utige Ergebnisse. Das Ringen um die Vormacht im Ostseeraum im Großen Nordischen Krieg 1700–1721. In: Bernd Wegner (Hrsg.): Wie
Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten. Verlag Ferdinand Schöningh, Pa<strong>de</strong>rborn, 2000, S. 89–107.<br />
• Geoffrey Parker: The Cambridge illustrated history of warfare. Cambridge 2005.<br />
• Georg Piltz: August <strong>de</strong>r Starke. Träume und Taten eines <strong>de</strong>utschen Fürsten. Verlag Neues Leben, Berlin (Ost) 1986. ISBN 3-355-00012-4<br />
• Klaus Zernack: Das Zeitalter <strong>de</strong>r Nordischen Kriege von 1558 bis 1809 als frühneuzeitliche Geschichtsepoche. In: Zeitschrift für historische Forschung 1 (1974) S. 55–79.<br />
• Hans Branig: Geschichte Pommerns Teil II. Von 1648 bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Böhlau Verlag, Köln 2000. ISBN 3-412-09796-9<br />
• Curt Jany: Geschichte <strong>de</strong>r Preußischen Armee. Vom 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt bis 1914. Bd. 1, Biblio Verlag, Osnabrück 1967, Seite 632–641.<br />
• Dietmar Lucht: Pommern. Geschichte, Kultur und Wissenschaft bis <strong>zu</strong>m Beginn <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1996. ISBN 3-8046-8817-9<br />
• Benjamin Richter: Verbrannte Er<strong>de</strong>. Peter <strong>de</strong>r Große und Karl XII. Die Tragödie <strong>de</strong>s ersten Russlandfeld<strong>zu</strong>ges, MatrixMedia Verlag, Göttingen 2010 ISBN 978-3-932313-37-0<br />
• Werner Scheck: Geschichte Russlands. Wilhelm Heyne Verlag, München 1977. ISBN 3-453-48035-X<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Darstellung nach: Eckardt Opitz: Vielerlei Ursachen, ein<strong>de</strong>utige Ergebnisse - Das Ringen um die Vormacht im Ostseeraum im Großen Nordischen Krieg 1700–1721, S.90–94<br />
2. ↑ Karte <strong>de</strong>r gottorfschen und königlichen Anteile in <strong>de</strong>n Herzogtümern Schleswig und Holstein<br />
3. ↑ Eckardt Opitz: Vielerlei Ursachen, ein<strong>de</strong>utige Ergebnisse - Das Ringen um die Vormacht im Ostseeraum im Großen Nordischen Krieg 1700–1721, S.94f<br />
4. ↑ Georg Piltz: August <strong>de</strong>r Starke - Träume und Taten eines <strong>de</strong>utschen Fürsten, Verlag Neues Leben, Berlin (Ost) 1986, S.80<br />
5. ↑ Werner Scheck: Geschichte Russlands, München 1977, S.188<br />
6. ↑ In a total of 57 regiments, whereof 34 allotted and 23 enlisted. Navy units were not inclu<strong>de</strong>d in the 57 regiments. Mobilization statistics at Militaria.<br />
7. ↑ Fryxell, S.80<br />
8. ↑ An<strong>de</strong>rs Fryxell: Lebensgeschichte Karl's <strong>de</strong>s Zwölften, Königs von Schwe<strong>de</strong>n, Band 1, S. 117<br />
9. ↑ Fryxell, S. 118<br />
10.↑ Fryxell, S. 121<br />
11.↑ a b Duffy:Russia's Military Way to the West, S. 17<br />
12.↑ Die Stärke <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n im Jahr 1701 betrug etwa: 3100 Mann Feldtruppen, 2000 Mann Garnison in Dorpat, 150 Mann in Marienburg, sechs kleinere Kriegsschiffe mit 300<br />
Mann sowie Landmiliz (Zahlen nach Angaben von W. A. v. Schlippenbach)<br />
13.↑ Peter Englund: The Battle that Shook Europe, Pearson Education Verlag, S. 39<br />
14.↑ nach an<strong>de</strong>ren Angaben 3800 Schwe<strong>de</strong>n,<br />
15.↑ Seite 15<br />
16.↑ nach <strong>de</strong>m offiziellen russischen Bericht von <strong>de</strong>r Schlacht sollen 5000 Schwe<strong>de</strong>n getötet wor<strong>de</strong>n sein, bei einem eigenen Verlust von 400 Mann, Rossiter Johnson: The Great<br />
Events by Famous Historians, S. 324<br />
17.↑ Peter Englund:The Battle that Shook Europe, Pearson Education Verlag, S. 40<br />
18.↑ Bengt Liljegren|Liljegren, Bengt - Karl XII: En biografi, Historiska media, 2000, Sidan 151.<br />
19.↑ A. D. von Drygalski: Poltawa, in: Bernhard von Poten: Handwörterbuch <strong>de</strong>r gesamten Militärwissenschaften, Bd.8, Leipzig 1879, S.7<br />
20.↑ Robert K. Massie: Peter <strong>de</strong>r Große - Sein Leben und seine Zeit, Frankfurt/ Main 1987, S.456<br />
21.↑ Robert K. Massie: Peter <strong>de</strong>r Große - Sein Leben und seine Zeit, Frankfurt/ Main 1987, S.458f<br />
22.↑ Robert K. Massie: Peter <strong>de</strong>r Große - Sein Leben und seine Zeit, Frankfurt/ Main 1987, S.460<br />
23.↑ [1], abgefragt am 9. Januar 2010
24.↑ Branig 2000, Seite 53.<br />
25.↑ Ewe 1984, Seite 194.<br />
26.↑ Ein zeitgenössischer Bericht über <strong>de</strong>n Brand befin<strong>de</strong>t sich auf Wikisource: Nachricht_über_<strong>de</strong>n_Brand_von_Altona_1713<br />
27.↑ Lucht 1996, Seite 99.<br />
28.↑ Franklin Daniel Scott: Swe<strong>de</strong>n, the nation's history, S.259<br />
29.↑ Geoffrey Parker, S. 155<br />
30.↑ Klaus Zernack, S. 71<br />
31.↑ Norman Davis, S. 277<br />
32.↑ Paul Kennedy, S. 97<br />
33.↑ Klaus Zernack, S. 57<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Polnischer Thronfolgekrieg<br />
Der Polnische Thronfolgekrieg (1733–1738), auch Polnischer Erbfolgekrieg genannt, war ein Krieg um die Thronfolge Polens nach <strong>de</strong>m Tod Augusts II. (<strong>de</strong>s Starken) († 1. Februar<br />
1733).<br />
Vorgeschichte<br />
Während Österreich und Russland nach einigem Zögern die Bestrebungen <strong>de</strong>s neuen sächsischen Kurfürsten, August <strong>de</strong>s Starken Sohn Friedrich August II. unterstützen, dass <strong>de</strong>n<br />
Fortbestand <strong>de</strong>r Personalunion Sachsen-Polen be<strong>de</strong>utete, wollte Frankreich <strong>de</strong>n früheren polnischen König Stanislaus I. Leszczyński (<strong>de</strong>n Schwiegervater Ludwigs XV.) als Nachfolger<br />
einsetzen.<br />
August <strong>de</strong>r Starke benötigte für seine Pläne sowohl die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Auslan<strong>de</strong>s wie <strong>de</strong>r polnischen Magnaten. Im Inneren stan<strong>de</strong>n sich zwei A<strong>de</strong>lsfraktionen gegenüber. Die eine<br />
gruppierte sich um die Familie Potocki, welche die traditionellen Kräfte, die die A<strong>de</strong>lprivilegien verteidigten und <strong>de</strong>n Wettinern ablehnten repräsentierten. In <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren dominierte die<br />
Familie Czartoryski. Diese strebte eine Mo<strong>de</strong>rnisierung in Anlehnung an <strong>de</strong>n englischen Parlamentarismus an. Es <strong>de</strong>utete sich ein Sieg <strong>de</strong>r Reformer an. Durch <strong>de</strong>n Tod <strong>de</strong>s Königs kam<br />
diese Entwicklung nicht mehr <strong>zu</strong>m tragen.[1]<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen in Polen<br />
Russische Truppen erschienen vor Warschau, woraufhin <strong>de</strong>r sächsischen Partei die Wahl Friedrich Augusts gelang. Insbeson<strong>de</strong>re zahlreiche litauische A<strong>de</strong>lige stimmten unter russischem<br />
Druck für <strong>de</strong>n Sachsen. Der einige Tage <strong>zu</strong>vor von einer Konfö<strong>de</strong>ration polnischer A<strong>de</strong>liger ebenfalls gewählte Stanislaus Leszczynski floh nach Danzig, das daraufhin 1734 von
ussischen und sächsischen Truppen eingenommen wur<strong>de</strong>.[2]<br />
Aber erst die Aufgabe <strong>de</strong>r Konfö<strong>de</strong>ration von Dzików been<strong>de</strong>te 1735 die Kampfhandlungen gegen die sächsischen Truppen in Kleinpolen. Im übrigen wur<strong>de</strong>n im Rahmen <strong>de</strong>s Bündnisses<br />
wie<strong>de</strong>r einmal russische Truppen in Ostpolen stationiert, da Sachsen aufgrund <strong>de</strong>r unsicheren Haltung Preußens seine Truppen in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Grenze haben wollte.<br />
Internationaler Konflikt<br />
1733 erklärte Frankreich Österreich (Habsburger Karl VI.) und Russland <strong>de</strong>n Krieg. Die Kriegshandlungen fan<strong>de</strong>n hauptsächlich an <strong>de</strong>r Rhein-Grenze statt, <strong>zu</strong>nächst noch unter <strong>de</strong>m<br />
Befehl <strong>de</strong>s greisen Prinzen Eugen von Savoyen (<strong>de</strong>r hier <strong>de</strong>n preußischen Kronprinzen Friedrich mit <strong>de</strong>r Kriegskunst näher vertraut gemacht haben soll). Den Franzosen gelang unter<br />
an<strong>de</strong>rem die Eroberung <strong>de</strong>r Festungen Kehl und Philippsburg. Ein weiterer Kriegsschauplatz war Italien, wo Frankreich und das verbün<strong>de</strong>te Sardinien bei Parma und Guastalla siegreich<br />
blieben. Die Österreicher wur<strong>de</strong>n hier <strong>zu</strong><strong>de</strong>m von spanischen Truppen bedrängt, die die Ansprüche <strong>de</strong>s Herzogs von Parma und spanischen Infanten Karl auf Neapel und Sizilien stützten<br />
und 1734 bei Bitonto siegten. Frankreich (Kardinal Fleury) hatte in diesem Krieg das ökonomische und militärische Übergewicht, wollte aber seine Mittel für <strong>de</strong>n sich seit <strong>de</strong>r<br />
Pragmatischen Sanktion 1713 abzeichnen<strong>de</strong>n Österreichischen Erbfolgekrieg aufsparen.<br />
Frie<strong>de</strong> und Folgen<br />
Im Wiener Präliminarfrie<strong>de</strong>n 1735 wur<strong>de</strong> daher <strong>de</strong>r Sachse als August III. als König von Polen bestätigt. Stanislaus Leszczynski wur<strong>de</strong> von Ludwig XV. mit <strong>de</strong>n Herzogtümern Bar und<br />
Lothringen entschädigt, wo er als Lan<strong>de</strong>svater sehr beliebt wur<strong>de</strong>. Franz Stephan von Lothringen, <strong>de</strong>r sich bereits als Schwiegersohn <strong>de</strong>s Kaisers abzeichnete und nun endgültig auf sein<br />
angestammtes Herzogtum verzichten musste, wur<strong>de</strong> dafür mit <strong>de</strong>m Herzogtum Toskana abgefun<strong>de</strong>n, da das Aussterben <strong>de</strong>r Medici <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt bereits ab<strong>zu</strong>sehen war. Neapel und<br />
Sizilien fielen an Karl von Spanien, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gunsten Österreichs auf das Herzogtum Parma und Piacenza und seinen Anspruch auf die Toskana verzichtete. Der Frie<strong>de</strong>n konnte aufgrund <strong>de</strong>r<br />
Nachfolgeregelungen erst nach <strong>de</strong>m Ableben <strong>de</strong>s Herzogs Gian Gastone <strong>de</strong>’ Medici († 1737) in Kraft treten. Der Krieg en<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>r Verkündigung <strong>de</strong>s Wiener Frie<strong>de</strong>ns am 18.<br />
November 1738.<br />
Der Krieg zeigte einige Neuerungen an, die in <strong>de</strong>r Folgezeit stärker das politische Machtgefüge Europas beeinflussten. Zum einen bot das junge Preußen <strong>de</strong>m römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser<br />
erstmals sein ganzes für die damalige Zeit hochmo<strong>de</strong>rnes Heer <strong>zu</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>s Reiches an.[3] Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite akzeptierte <strong>de</strong>r Kaiser erstmals russische Truppen am Rhein<br />
(1735).[4]<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Manfred Alexan<strong>de</strong>r: Kleine Geschichte Polens. Bonn, 2006 S.151f.<br />
2. ↑ Manfred Alexan<strong>de</strong>r: Kleine Geschichte Polens. Bonn, 2006 S.152<br />
3. ↑ Der Kaiser lehnte wohl aus Furcht vor Ansprüchen Preußens an Jülich und Berg die nicht uneigennützige preußische Hilfe im Wesentlichen ab.<br />
4. ↑ vgl. Bleckwenn 1979: 12.<br />
Literatur<br />
• Bleckwenn, Hans: Reiter, Husaren und Grenadiere. d. Uniformen d. kaiserl. Armee am Rhein 1734. Harenberg, Dortmund 1985. ISBN 3-88379-125-3<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Siebenjähriger Krieg<br />
Im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), auch Dritter Schlesischer Krieg genannt, kämpften mit Preußen und Großbritannien/Kurhannover einerseits sowie Österreich, Frankreich und<br />
Russland an<strong>de</strong>rerseits alle europäischen Großmächte ihrer Zeit. An <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen waren weitere (mittlere und kleine) Staaten beteiligt. Der Krieg wur<strong>de</strong> in Mitteleuropa,<br />
Portugal, Nordamerika, Indien, <strong>de</strong>r Karibik sowie auf <strong>de</strong>n Weltmeeren ausgefochten. Für Großbritannien und Frankreich ging es hierbei auch um die Herrschaft in Nordamerika und<br />
Indien.<br />
Vorgeschichte<br />
Am 18. Oktober 1748 hatte <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n von Aachen <strong>de</strong>n Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748) been<strong>de</strong>t, ohne dabei das Konfliktpotential zwischen <strong>de</strong>n Großmächten <strong>zu</strong> beseitigen.<br />
Daraufhin bestimmten folgen<strong>de</strong> Ziele die außenpolitischen Handlungen <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Staaten:<br />
• Preußen hatte unter Friedrich II. die österreichische Provinz Schlesien erobert und versuchte nun, diese mittels eines Bündnissystems gegen eine mögliche Rückeroberung <strong>zu</strong><br />
behaupten.<br />
• Österreich unter Maria Theresia verfolgte tatsächlich das Ziel <strong>de</strong>r Rückeroberung Schlesiens. Um <strong>de</strong>n Erfolg <strong>zu</strong> gewährleisten, versuchte <strong>de</strong>r Kanzler Wenzel Anton Graf Kaunitz<br />
(1711–1794) <strong>zu</strong>nächst, <strong>de</strong>n preußischen König Friedrich II. (1712–1786) außenpolitisch <strong>zu</strong> isolieren.<br />
• Russland war unter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Zarin Elisabeth (1709–1761) an einer Expansion nach Westen interessiert, wobei ihr Augenmerk auf Semgallen und das Herzogtum<br />
Kurland gerichtet war. Diese stan<strong>de</strong>n allerdings unter polnischer Oberhoheit. Elisabeth wollte Polen dafür mit Ostpreußen entschädigen. So kam ihr <strong>de</strong>r Krieg gegen Preußen, für<br />
<strong>de</strong>n Österreich Verbün<strong>de</strong>te suchte, gera<strong>de</strong> recht.<br />
• Großbritannien sah in Frankreich seinen Hauptkonkurrenten und versuchte, diesen vor allem in <strong>de</strong>n Kolonien <strong>zu</strong> schwächen. Da Georg II. in Personalunion auch Kurfürst von<br />
Hannover war, musste er <strong>zu</strong>gleich versuchen, diese Herrschaft gegen einen möglichen französischen Angriff <strong>zu</strong> sichern.<br />
• Frankreich unter Ludwig XV. sah seinerseits in Großbritannien seinen Hauptgegner, wünschte jedoch einen Krieg noch hinaus<strong>zu</strong>zögern, um sich besser vorbereiten <strong>zu</strong> können.<br />
Im Jahre 1754 spitzte sich <strong>de</strong>r britisch-französische Konflikt in Nordamerika <strong>zu</strong>, als es im Ohiotal <strong>zu</strong> ernsten Gefechten kam (→ siehe: Franzosen- und Indianerkrieg). Die britische<br />
Regierung entsandte im Januar 1755 ein größeres Truppenkontingent unter General Edward Braddock (1695–1755) in die amerikanischen Kolonien, woraufhin im März auch eine<br />
französische Flotte auslief. Im Sommer <strong>de</strong>s Jahres kam es <strong>zu</strong> einigen Schlachten in Nordamerika (→ Siehe: Schlacht am Monongahela) und auf See; im August begann man in<br />
Großbritannien mit <strong>de</strong>r Beschlagnahmung französischer Han<strong>de</strong>lsschiffe.<br />
Da <strong>de</strong>r Krieg nunmehr unausweichlich schien, suchten sowohl die französische als auch die britische Regierung Verbün<strong>de</strong>te in Europa. Frankreich wünschte einen gesamteuropäischen<br />
Krieg <strong>zu</strong> vermei<strong>de</strong>n, um sich vollkommen auf Großbritannien konzentrieren <strong>zu</strong> können. Es bestand bereits ein Defensivbündnis mit Preußen, aber im August 1755 begann man auch<br />
Verhandlungen mit Österreich, um es aus <strong>de</strong>m beginnen<strong>de</strong>n Krieg heraus<strong>zu</strong>halten. Dies kam <strong>de</strong>n diplomatischen Bemühungen <strong>de</strong>s Grafen Kaunitz sehr entgegen, <strong>de</strong>ssen Ziel es war,<br />
Frankreich aus <strong>de</strong>ssen Bündnis mit Preußen <strong>zu</strong> lösen. Großbritannien schloss seinerseits am 30. September einen Subsidienvertrag mit Russland, um im Bedarfsfall russische Truppen<br />
<strong>zu</strong>m Schutze Hannovers <strong>zu</strong> benutzen. Gleichzeitig verhan<strong>de</strong>lte es jedoch auch mit Preußen. Am 16. Januar 1756 schlossen Preußen und Großbritannien die Konvention von Westminster,<br />
in welcher bei<strong>de</strong> garantierten, Nord<strong>de</strong>utschland vor frem<strong>de</strong>n Truppen <strong>zu</strong> schützen. Aus <strong>de</strong>r Sicht Friedrichs II. stellte dieses Abkommen keinen Affront gegen Frankreich dar, weil er noch<br />
immer glaubte, dass Frankreichs Hauptgegner Österreich sei. Gleichzeitig meinte er, so dafür gesorgt <strong>zu</strong> haben, dass die russischen Truppen nicht gegen ihn han<strong>de</strong>ln könnten, ohne ihre<br />
Verträge mit Großbritannien <strong>zu</strong> verletzen. Für Georg II. be<strong>de</strong>utete <strong>de</strong>r Vertrag mit Preußen <strong>de</strong>n Schutz seiner Stammlan<strong>de</strong>.<br />
Am Hofe Ludwigs XV. von Frankreich sah man in <strong>de</strong>m britisch-preußischen Zusammengehen ein Problem, <strong>de</strong>nn damit war <strong>de</strong>n französischen Truppen die Beset<strong>zu</strong>ng Hannovers<br />
versperrt. Das Kurfürstentum brauchte man jedoch als Faustpfand in einem Krieg gegen Großbritannien. Unter diesem Eindruck kam es am 1. Mai 1756 <strong>zu</strong>m Abschluss <strong>de</strong>s Vertrages von<br />
Versailles, einem Defensiv-Bündnis zwischen Österreich und Frankreich, welches auch als „Umkehrung <strong>de</strong>r Allianzen“ bezeichnet wird. Frankreich wür<strong>de</strong> nun Preußen in einem Krieg<br />
gegen Österreich nicht mehr beistehen. Gleichzeitig hatten österreichische Diplomaten bereits im März/April <strong>de</strong>s Jahres Verbindungen <strong>zu</strong>m russischen Hof geknüpft und dort die
Bereitschaft für ein gemeinsames österreichisch-russisches Vorgehen gegen Preußen festgestellt. Somit war es <strong>de</strong>r österreichischen Diplomatie gelungen, Friedrich II. von Preußen<br />
weitgehend <strong>zu</strong> isolieren. In einem für das Jahr 1757 geplanten Krieg <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rgewinnung Schlesiens brauchte sich Österreich auf keinem an<strong>de</strong>ren Kriegsschauplatz <strong>zu</strong> engagieren,<br />
konnte aber auf <strong>de</strong>n Beistand Russlands und vielleicht auch Sachsens rechnen.<br />
In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Wochen eskalierte <strong>de</strong>r Konflikt. Schon im April 1756 hatte ein französischer Verband die britische Insel Menorca eingenommen und Truppen auf Korsika stationiert.<br />
Daraufhin erfolgte am 17. Mai 1756 die offizielle Kriegserklärung Großbritanniens an Frankreich, welche <strong>de</strong>r französische Hof am 9. Juni mit einer eigenen Kriegserklärung<br />
beantwortete.<br />
Übersicht <strong>de</strong>r Bündnisse<br />
Vertrag von Versailles und Erweiterungen<br />
• Territorium von bis<br />
• „Kaiserliche“ bzw. Habsburgermonarchie: Vertrag von Versailles (1756) 1756 1763<br />
• Königreich Frankreich: Vertrag von Versailles (1756) 1756 1763<br />
• Kurfürstentum Sachsen 1756 1763<br />
• Russisches Reich 1757 1761<br />
• Heiliges Römisches Reich: Reichsexekution durch „Reichsarmee“ 1757 1763<br />
• Königreich Schwe<strong>de</strong>n 1757 1763<br />
• Königreich Spanien („Bourbonischer Hausvertrag“ mit Frankreich) 1761 1763<br />
• Herzogtum Parma („Bourbonischer Hausvertrag“ mit Frankreich) 1761 1763<br />
• Königreich Neapel & Königreich Sizilien („Bourbonischer Hausvertrag“ mit Frankreich) 1761 1763<br />
Konvention von Westminster und Erweiterungen<br />
• Territorium von bis<br />
• Königreich Preußen (Konvention von Westminster) 1756 1763<br />
• Königreich Großbritannien & Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg („Kurhannover“) (Konvention von Westminster) 1756 1763<br />
• Königreich Portugal 1756 1763<br />
• Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel 1756 1763<br />
• Landgrafschaft Hessen-Kassel 1756 1763<br />
• Herzogtum Sachsen-Gotha und Altenburg 1756 1763<br />
• Grafschaft Schaumburg-Lippe (Bückeburg) 1756 1763<br />
• Russisches Reich 1761 1761<br />
Verlauf<br />
Im Juni 1756 erhielt Friedrich II. durch seine Spione an <strong>de</strong>n europäischen Höfen Kenntnis von <strong>de</strong>r Annäherung zwischen Frankreich und Russland sowie von russischen<br />
Truppenbewegungen. Außer<strong>de</strong>m bekam er Abschriften <strong>de</strong>r Pariser und Petersburger Verträge, die die Allianz zwischen Österreich, Russland, Frankreich und Sachsen dokumentierten.<br />
Daraufhin befahl Friedrich die Mobilisierung seiner Regimenter in Ostpreußen und Schlesien, um <strong>de</strong>m drohen<strong>de</strong>n Angriff von mehreren Seiten durch einen Einmarsch in Sachsen<br />
<strong>zu</strong>vor<strong>zu</strong>kommen. Die Beset<strong>zu</strong>ng Sachsens hatte für Preußen einen militärischen und einen wirtschaftlichen Hintergrund (siehe Ephraimiten). Militärisch gesehen versuchte Friedrich mit
<strong>de</strong>m Erzgebirge und <strong>de</strong>r Sächsischen Schweiz einen natürlichen Grenzwall <strong>zu</strong>r österreichischen Provinz Böhmen <strong>zu</strong> gewinnen. Außer<strong>de</strong>m konnte Friedrich durch die Beset<strong>zu</strong>ng die<br />
benötigten Kriegsmaterialien, wie Kanonen, Munition usw. die Elbe von Mag<strong>de</strong>burg hinauf transportieren. Wirtschaftlich sollte das wohlhaben<strong>de</strong> Sachsen die Kriegskassen <strong>de</strong>s<br />
preußischen Königs füllen. Nach <strong>de</strong>r zügigen Beset<strong>zu</strong>ng Sachsens wollte Friedrich in Böhmen einrücken. Dort sollte die Einnahme Prags die dauerhafte Unterbringung <strong>de</strong>r preußischen<br />
Streitkräfte auf gegnerischem Territorium ermöglichen und Maria Theresia <strong>zu</strong> Frie<strong>de</strong>nsverhandlungen zwingen. Bei einem solchen Erfolg wäre dann nicht mehr <strong>zu</strong> erwarten, dass<br />
Russland im folgen<strong>de</strong>n Jahr Preußen allein angreifen wür<strong>de</strong>.<br />
1756<br />
Sachsen / Böhmen<br />
Am 29. August 1756 überschritt die preußische Armee ohne vorherige Kriegserklärung die Grenze Sachsens. Die sächsische Armee unter <strong>de</strong>r Führung von Graf Rutowski wur<strong>de</strong><br />
überrascht und sammelte sich in einem Lager bei Pirna, wo die preußische Armee sie am 10. September einschloss. Am 9. September besetzte die preußische Armee bereits kampflos<br />
Dres<strong>de</strong>n. Rutowski weigerte sich jedoch <strong>zu</strong> kapitulieren, weil er damit rechnete, dass ihn die österreichische Armee bald entsetzen wür<strong>de</strong>. Als diese unter <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s<br />
Feldmarschall Browne tatsächlich En<strong>de</strong> September nahte, zog Friedrich II. ihr mit <strong>de</strong>r Hälfte seiner Armee entgegen (die an<strong>de</strong>re belagerte weiterhin das sächsische Heerlager). Am 1.<br />
Oktober 1756 kam es <strong>zu</strong>r Schlacht bei Lobositz in Böhmen. Die Schlacht en<strong>de</strong>te mit einem preußischen Sieg, wodurch die Österreicher die eingeschlossenen Sachsen nicht mehr<br />
erreichen konnten. Daraufhin mussten die sächsischen Truppen am 16. Oktober 1756 kapitulieren. Sie wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nächst in preußische Dienste gepresst, <strong>de</strong>sertierten jedoch größtenteils im<br />
folgen<strong>de</strong>n Frühjahr. Somit war nur die Beset<strong>zu</strong>ng Sachsens erreicht wor<strong>de</strong>n, während das Konzept eines entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlages gegen Österreich gescheitert war.<br />
Nordamerika<br />
Der britisch-französische Gegensatz in <strong>de</strong>n nordamerikanischen Kolonien hatte bereits im Vorjahr <strong>zu</strong> größeren Kampfhandlungen geführt. Im Jahre 1756 ergriffen die Franzosen unter<br />
Marquis <strong>de</strong> Montcalm die Offensive. Am 15. August 1756 eroberten sie das wichtige britische Fort Oswego und brachten somit das ganze Gebiet um <strong>de</strong>n Ontariosee unter Kontrolle. Die<br />
regulären Verbän<strong>de</strong> stellten die Besat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r französischen Forts, so dass für weitere offensive Operationen nur die Milizen und Indianer <strong>zu</strong>r Verfügung stan<strong>de</strong>n. Deshalb beschränkte<br />
sich das weitere französische Vorgehen auf <strong>de</strong>n Kleinkrieg, während die Briten ihre Truppen sammelten, ohne jedoch selbst offensiv <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n.<br />
1757<br />
Die Situation stellte sich für Friedrich II. <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Jahres 1757 ungünstig dar. Am 17. Januar wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reichskrieg gegen Preußen erklärt, da dieses durch <strong>de</strong>n Angriff auf Sachsen<br />
Landfrie<strong>de</strong>nsbruch begangen habe. Die Reichstruppen wür<strong>de</strong>n also als weiterer Gegner Preußens auf <strong>de</strong>n Plan treten. Nur Tage später, am 22. Januar, unterzeichneten Russland und<br />
Österreich einen Allianzvertrag, <strong>de</strong>m am 1. Mai ein französisch-österreichisches Offensivbündnis folgte. Zusätzlich <strong>zu</strong>m schon lang erwarteten Angriff <strong>de</strong>r Russen und <strong>de</strong>m Krieg gegen<br />
Österreich wür<strong>de</strong>n also auch Truppen Frankreichs, als Garantiemacht <strong>de</strong>s Westfälischen Frie<strong>de</strong>ns, in Deutschland einrücken, um gegen Preußen vor<strong>zu</strong>gehen und gleichzeitig Hannover als<br />
Faustpfand im Krieg gegen Großbritannien <strong>zu</strong> gewinnen. Die Briten befan<strong>de</strong>n sich in Nordamerika und Indien unter Druck und konnten kaum wirksam für <strong>de</strong>n Schutz Hannovers sorgen.<br />
Aus diesem Grund stellten die mit Preußen und Großbritannien verbün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>utschen Fürstentümer eine Armee auf, die sogenannte Observationsarmee, die gegen die französischen<br />
Streitkräfte operieren sollte.<br />
Böhmen / Schlesien<br />
Friedrich II. nahm sein strategisches Konzept <strong>de</strong>s Vorjahres noch einmal auf, <strong>zu</strong>nächst Prag ein<strong>zu</strong>nehmen und so einen entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlag gegen Österreich <strong>zu</strong> führen. Im April<br />
rückten die preußischen Truppen von mehreren Seiten in Böhmen ein, wo es am 6. Mai <strong>zu</strong>r Schlacht bei Prag kam. Zwar siegten die Preußen, doch ein Großteil <strong>de</strong>r österreichischen<br />
Armee rettete sich in die Festung. Während Friedrich nun mit <strong>de</strong>r Belagerung <strong>de</strong>rselben begann, zog von Sü<strong>de</strong>n her ein österreichisches Entsatzheer unter Feldmarschall Graf Daun heran.<br />
Friedrich II. stellte sich diesem mit <strong>de</strong>r Hälfte seiner Truppen (die an<strong>de</strong>re belagerte Prag) in <strong>de</strong>r Schlacht von Kolin am 18. Juni entgegen, wur<strong>de</strong> dabei jedoch schwer geschlagen. Als<br />
Folge dieser Nie<strong>de</strong>rlage mussten die Preußen ganz Böhmen räumen und nach Sachsen <strong>zu</strong>rückweichen. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Monaten manövrierten die gegnerischen Heere ergebnislos um<br />
einan<strong>de</strong>r, bis Friedrich II. durch <strong>de</strong>n Anmarsch <strong>de</strong>r Reichsexekutionsarmee in Thüringen gezwungen war, mit einem großen Teil seiner Truppen dorthin <strong>zu</strong> eilen. Die nunmehr überlegenen
Österreicher griffen die preußischen Truppen unter <strong>de</strong>m Herzog von Braunschweig-Bevern am 7. September in <strong>de</strong>r Schlacht von Moys an und zwangen diese <strong>zu</strong>m Rück<strong>zu</strong>g. Nach einer<br />
weiteren Schlacht von Breslau am 22. November sowie <strong>de</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Festungen Schweidnitz und Breslau befand sich En<strong>de</strong> November <strong>de</strong>r größte Teil Schlesiens wie<strong>de</strong>r unter<br />
österreichischer Kontrolle. In diesem Zeitraum gelang es <strong>de</strong>m österreichischen General Andreas Hadik von Futak auch mit einer Abteilung Husaren, für einen Tag (16. Oktober) Berlin <strong>zu</strong><br />
besetzen, bevor er sich wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rückzog. Anfang Dezember traf jedoch die preußische Hauptarmee unter Friedrich II. wie<strong>de</strong>r in Schlesien ein. Er griff die österreichische Armee in <strong>de</strong>r<br />
Schlacht von Leuthen am 5. Dezember an und schlug sie entschei<strong>de</strong>nd. Diese zog sich nach Böhmen <strong>zu</strong>rück, während die Preußen bis <strong>zu</strong>m April 1758 die schlesischen Festungen<br />
<strong>zu</strong>rückeroberten. Damit war die Ausgangssituation vom Beginn <strong>de</strong>s Jahres weitgehend wie<strong>de</strong>r hergestellt.<br />
Mittel<strong>de</strong>utschland<br />
Im Juni griffen auch die Franzosen an. Sie entsandten eine Armee nach Nord<strong>de</strong>utschland, welche die preußischen Län<strong>de</strong>r am Rhein besetzte und anschließend gegen Hannover vorging.<br />
Am 26. Juli 1757 schlugen die französischen Truppen unter Führung <strong>de</strong>s Marschalls d'Estrées die aus Kontingenten <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kleinstaaten bestehen<strong>de</strong> Observationsarmee unter <strong>de</strong>m<br />
Herzog von Cumberland in <strong>de</strong>r Schlacht bei Hastenbeck. Die Observationsarmee zog sich an die Nordsee <strong>zu</strong>rück, wo sie sich in <strong>de</strong>r Konvention von Kloster Zeven für neutral erklärte.<br />
Somit stand im Spätsommer für die Franzosen <strong>de</strong>r Weg nach Berlin offen. Da sie aber kein Interesse daran hatten, Preußen gegenüber Österreich <strong>zu</strong> sehr <strong>zu</strong> schwächen, begnügten sie sich<br />
mit <strong>de</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r mit Preußen verbün<strong>de</strong>ten Fürstentümer. Marschall d'Estrées wur<strong>de</strong> nach einigen Intrigen in Versailles durch <strong>de</strong>n Herzog von Richelieu ersetzt.<br />
Gleichzeitig begann im August auch die Reichsexekutionsarmee mit ihren Operationen in Thüringen gegen das sächsische Gebiet. Die Armee bestand aus einem französischen Korps<br />
unter <strong>de</strong>m Prinzen von Soubise und <strong>de</strong>n Reichstruppen unter <strong>de</strong>m Herzog von Sachsen-Hildburghausen, <strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>n Oberbefehl führte. Gegen diese Armee rückte Friedrich II. von<br />
Schlesien her an und schlug sie am 5. November 1757 vernichtend in <strong>de</strong>r Schlacht bei Roßbach. Die Reichsarmee trat in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren nicht mehr als eigenständiger Verband in<br />
Erscheinung. Friedrich II. setzte sich mit <strong>de</strong>r preußischen Hauptarmee wie<strong>de</strong>r nach Schlesien in Bewegung, um dort <strong>de</strong>m österreichischen Vordringen <strong>zu</strong> begegnen.<br />
Ostpreußen<br />
Zur Verteidigung Ostpreußens hatte Friedrich II. <strong>de</strong>n erfahrenen Generalfeldmarschall Johann von Lehwaldt mit 30.000 Mann vorgesehen. Am 1. Juli griff eine ca. 100.000 Mann starke<br />
russische Armee unter General Stepan Fjodorowitsch Apraxin an. Sie nahm nach kurzer Belagerung die Festung Memel am 5. Juli ein. Das nächste Etappenziel war Königsberg. Dabei<br />
stellte sich das preußische Korps <strong>de</strong>s Generalfeldmarschalls Lehwaldt <strong>de</strong>m russischen Vormarsch entgegen. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Groß-Jägersdorf wur<strong>de</strong> es am 30. August geschlagen.<br />
Trotz<strong>de</strong>m war die russische Versorgungslage ohne <strong>de</strong>n Hafen von Königsberg so schlecht, dass Apraxin sich wie<strong>de</strong>r aus Ostpreußen <strong>zu</strong>rückzog. Nur in Memel verblieb eine Besat<strong>zu</strong>ng.<br />
Ostseeküste<br />
Am 12. September griffen auch die Schwe<strong>de</strong>n von Stralsund aus Preußen an. Sie eroberten die schwach verteidigten Orte Pasewalk, Ueckermün<strong>de</strong> und Swinemün<strong>de</strong>. Daraufhin beor<strong>de</strong>rte<br />
Friedrich II. das Korps <strong>de</strong>s Generalfeldmarschalls Lehwaldt aus Ostpreußen heran (die Russen hatten sich bereits <strong>zu</strong>rückgezogen), um gegen die Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> operieren. Lehwaldt<br />
eroberte bis <strong>zu</strong>m Jahresen<strong>de</strong> Wollin, Anklam und Demmin, während sich die Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>rückzogen und nur Stralsund besetzt hielten.<br />
Nordamerika<br />
Marquis <strong>de</strong> Montcalm setzte seine Strategie fort, die wichtigsten britischen Forts <strong>zu</strong> zerstören, um so einer britischen Offensive von diesen Forts aus vor<strong>zu</strong>beugen. Ziel <strong>de</strong>s Angriffs war<br />
Fort William Henry am Lake George. Die Briten kapitulierten nach einigen Tagen Belagerung am 9. August gegen freien Ab<strong>zu</strong>g. Die indianischen Verbün<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>r Franzosen hielten sich<br />
nicht an die Vereinbarungen und überfielen die britischen Truppen, was als Fort William Henry-Massaker bekannt wur<strong>de</strong>. Die Briten sammelten unter<strong>de</strong>ssen Truppen auf <strong>de</strong>r Kap-Breton-<br />
Insel für einen Angriff auf die Festung Louisbourg, <strong>de</strong>r jedoch verschoben wur<strong>de</strong>.<br />
1758<br />
Anfang <strong>de</strong>s Jahres waren russische Truppen unter Graf von Fermor erneut in Ostpreußen und Pommern eingedrungen und versuchten anschließend, sich mit <strong>de</strong>n Österreichern <strong>zu</strong><br />
vereinigen. Dies konnte Friedrich in <strong>de</strong>r Schlacht bei Zorndorf verhin<strong>de</strong>rn. Die Russen zogen sich bis Jahresen<strong>de</strong> hinter die Weichsel <strong>zu</strong>rück, hielten aber Ostpreußen. Unter Ausnut<strong>zu</strong>ng
<strong>de</strong>r Abwesenheit <strong>de</strong>s preußischen Hauptkontingents gelang es österreichischen Truppen, fast ganz Schlesien <strong>zu</strong> besetzen.<br />
Außer<strong>de</strong>m drangen im Spätsommer österreichische Truppen unter Graf Daun in Südsachsen ein, schlugen die Preußen in <strong>de</strong>r Schlacht von Hochkirch und versuchten Dres<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> nehmen,<br />
was aber nicht gelang. En<strong>de</strong> November zogen sie sich nach Böhmen <strong>zu</strong>rück. Im Gegen<strong>zu</strong>g drang eine preußische Armee in Mähren bis Olmütz vor und belagerte die Stadt. Durch die seit<br />
<strong>de</strong>m Österreichischen Erbfolgekrieg verstärkten Mauern konnte dieses Mal die Festung Olmütz, an<strong>de</strong>rs als im Jahr 1741, von <strong>de</strong>n österreichischen Truppen erfolgreich verteidigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Großbritannien sagte Preußen in einer Vereinbarung vom 11. April 1758 finanzielle Mittel von 4,5 Millionen Talern sowie die Aufstellung eines neuen Heeres in Kurhannover <strong>zu</strong>.[1]<br />
Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel konnte die Franzosen in <strong>de</strong>r Schlacht von Rheinberg und in <strong>de</strong>r Schlacht bei Krefeld schlagen und kontrollierte <strong>zu</strong>m Jahresen<strong>de</strong> das<br />
gesamte rechtsrheinische Gebiet.<br />
In Nordamerika besiegten die Franzosen am 18. Juli ein zahlenmäßig weit überlegenes Heer <strong>de</strong>r Briten in <strong>de</strong>r Schlacht von Ticon<strong>de</strong>roga 1758.<br />
„Affaire <strong>de</strong> Meer“: In <strong>de</strong>r Schlacht bei Rees Mehr (heute Hamminkeln-Mehrhoog) am 5. August 1758 schlugen die Preußen unter General v. Imhoff die Franzosen. Das Bataillon<br />
Stolzenberg traf die Franzosen in <strong>de</strong>r Flanke. Heute noch erinnert an <strong>de</strong>r Stelle ein Obelisk an diese Schlacht mit <strong>de</strong>r Inschrift: „Deutschlands tapferen Kriegern, welche hier unter General<br />
v. Imhoff am 5. August 1758 die Franzosen schlugen. Errichtet am 5. August 1858 durch die Bewohner von Haffen und Mehr“. Hierdurch kam es <strong>zu</strong>m siegreichen Ausgang <strong>de</strong>r Schlacht<br />
bei Mehr, bei <strong>de</strong>r 3.000 Preußen fast 10.000 Franzosen schlugen. Das französische Heer floh <strong>zu</strong>rück in die von ihm besetzte Stadt Wesel.<br />
1759<br />
Durch <strong>de</strong>n hohen Blutzoll <strong>de</strong>r vorherigen Kriegsjahre war Preußen <strong>zu</strong> offensiven Aktionen nicht mehr in <strong>de</strong>r Lage, vielmehr hatte es nun mit Angriffen auf das preußische Kernland <strong>zu</strong><br />
kämpfen. Erneut versuchten die Russen unter Saltykow und Österreicher unter Leopold Joseph Graf Daun eine Vereinigung ihrer Truppen <strong>zu</strong> erreichen, um Friedrich gemeinsam <strong>zu</strong><br />
schlagen. Diese Vereinigung gelang diesmal bei <strong>de</strong>m Ort Kunersdorf (östlich von Frankfurt (O<strong>de</strong>r)), nach<strong>de</strong>m die Russen aus Ostpreußen – ein preußischer Verband, <strong>de</strong>r sich ihnen<br />
entgegengeworfen hatte, war am 23. Juli bei Kay geschlagen wor<strong>de</strong>n – und die Österreicher über Schlesien angerückt waren. Friedrich erlitt bei einem Angriff auf das Lager <strong>de</strong>r nunmehr<br />
Verbün<strong>de</strong>ten in <strong>de</strong>r Schlacht von Kunersdorf (12. August) eine katastrophale Nie<strong>de</strong>rlage, das preußische Heer löste sich zwischenzeitlich auf.<br />
Die Russen, Österreicher und Franzosen nutzten jedoch wegen wachsen<strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rsprüche innerhalb <strong>de</strong>s Bündnisses nicht die Gunst <strong>de</strong>r Stun<strong>de</strong>, um nach Berlin vor<strong>zu</strong>rücken. Friedrich<br />
bezeichnete diesen Umstand, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m preußischen Staat die Existenz rettete, in einem Brief an seinen Bru<strong>de</strong>r Heinrich als das „Mirakel <strong>de</strong>s Hauses Bran<strong>de</strong>nburg“. Die Russen zogen sich<br />
im Herbst in ihre Ausgangsstellung <strong>zu</strong>rück und die Österreicher rückten auf <strong>de</strong>n sächsischen Kriegsschauplatz ab. Dort hatte im Sommer die Reichsarmee unter Ausnut<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r<br />
Abwesenheit preußischer Truppen fast ganz Sachsen inklusive Dres<strong>de</strong>n besetzt. Nach Vereinigung <strong>de</strong>r Reichsarmee mit <strong>de</strong>n Österreichern kam es hier am 20. November <strong>zu</strong> einem<br />
Zusammentreffen mit einem preußischen Kontingent im Gefecht von Maxen, das <strong>zu</strong>m Einschluss <strong>de</strong>r preußischen Truppen führte. Der preußische General von Finck kapitulierte<br />
daraufhin einen Tag später und wur<strong>de</strong> mit rund 14.000 Mann gefangen genommen.<br />
Auf <strong>de</strong>m west<strong>de</strong>utschen Kriegsschauplatz blieb bis <strong>zu</strong>m Jahresen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Status quo weitgehend erhalten, einen Vorstoß <strong>de</strong>s Herzogs von Braunschweig <strong>zu</strong>m Rhein wehrten die Franzosen<br />
bei Bergen ab (13. April). Der darauf folgen<strong>de</strong> Vorstoß <strong>de</strong>s französischen Hauptkontingents nach Hannover wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n preußischen Verbün<strong>de</strong>ten in <strong>de</strong>r Schlacht bei Min<strong>de</strong>n (1.<br />
August) abgewiesen.<br />
Am 12. Oktober 1759 wur<strong>de</strong> in Bütow in Hinterpommern ein vorläufiges Abkommen über <strong>de</strong>n Austausch russischer und preußischer Kriegsgefangener unterzeichnet.[2]<br />
1760<br />
Auch 1760 war Preußen angesichts <strong>de</strong>r eigenen Schwäche vorrangig darauf bedacht, seine eigenen sowie die eroberten Gebiete <strong>zu</strong> halten. Die 1759 sehr erfolgreichen alliierten Truppen<br />
im Westen mussten die Preußen bis Anfang Februar mit 10.000 Mann gegen die Reichsarmee unterstützen, dies schwächte Herzog Ferdinand gegen Frankreich.<br />
Österreich wollte <strong>zu</strong>nächst Schlesien wie<strong>de</strong>rgewinnen, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Russen die preußischen Kräfte vernichten. Dementsprechend fielen österreichische Truppen unter von Laudon<br />
in Schlesien ein, eroberten wichtige Festungen und schlugen ein preußisches Korps bei Lan<strong>de</strong>shut vernichtend. Gleichzeitig versuchte Friedrich vergeblich, mit starken Kräften Dres<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen, was <strong>zu</strong> erheblichen Zerstörungen in <strong>de</strong>r Innenstadt führte.
Der französische Sieg am 28. April gegen die Briten in Quebec in <strong>de</strong>r Schlacht bei Sainte-Foy än<strong>de</strong>rt nichts mehr an <strong>de</strong>r absehbaren französischen Gesamtnie<strong>de</strong>rlage in Kanada.<br />
In West<strong>de</strong>utschland stan<strong>de</strong>n die Alliierten nur noch im östlichen Westfalen mit sehr reduzierten Kräften in Winterquartieren. Die Franzosen lagen am Nie<strong>de</strong>rrhein und im südlichen<br />
Hessen. Erst im Juni vereinigten sich die französischen Korps in Hessen-Kassel. Dem alliierten Erfolg bei Korbach stand ein französischer Verlust bei Emsdorf gegenüber. Trotz <strong>de</strong>s<br />
Sieges <strong>de</strong>r alliierten Truppen im pa<strong>de</strong>rbornischen Warburg konnten sich die Franzosen in Hessen-Kassel behaupten.<br />
Als österreichische Entsatztruppen unter Daun Dres<strong>de</strong>n entgegenstrebten und Friedrich von <strong>de</strong>n Entwicklungen in Schlesien alarmiert wur<strong>de</strong>, zog er dorthin ab und Daun folgte ihm.<br />
Bei<strong>de</strong>n österreichischen Armeen, die am 15. August von Friedrich angegriffen wur<strong>de</strong>n, gelang eine Vereinigung bei Liegnitz. Den preußischen Truppen gelang ein Sieg und damit die<br />
Verbindung <strong>zu</strong> Truppen unter Prinz Heinrich, <strong>de</strong>r dadurch die russischen Kräfte auf Distanz halten konnte.<br />
Diese Erfolge wur<strong>de</strong>n schnell relativiert, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>n Gegnern Preußens gelang gleichzeitig die Beset<strong>zu</strong>ng Sachsens durch die Reichsarmee und die kurzzeitige Beset<strong>zu</strong>ng und starke<br />
Plün<strong>de</strong>rung Berlins durch die Russen unter Tottleben und Tschernyschew und Österreicher unter Lacy. Friedrich gelang am 3. November in <strong>de</strong>r Schlacht bei Torgau noch einmal ein<br />
Befreiungsschlag, in<strong>de</strong>m er die ihm folgen<strong>de</strong>n österreichischen Kräfte unter Daun besiegte und nach Sachsen <strong>zu</strong>rückdrängte. Trotz<strong>de</strong>m war die Lage Preußens katastrophal, unter an<strong>de</strong>rem<br />
waren Ostpreußen, Sachsen und Schlesien in <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>s Gegners.<br />
Schwedische Truppen setzten sich gleichzeitig im preußischen Teil Pommerns (ein Teil Vorpommerns war seit <strong>de</strong>m Dreißigjährigen Krieg schwedisch) fest. Im Herbst wur<strong>de</strong>n alliierte<br />
Truppen bei <strong>de</strong>r Schlacht bei Kloster Kampen von <strong>de</strong>n Franzosen am Rhein geschlagen.<br />
1761<br />
Erneut war Schlesien Kriegsschauplatz. Gegen die anrücken<strong>de</strong>n und sich vereinigen<strong>de</strong>n Österreicher (unter Laudon) und Russen bezog das preußische Heer das Lager von Bunzelwitz,<br />
das <strong>de</strong>n ganzen Sommer gegen die mit Versorgungsschwierigkeiten kämpfen<strong>de</strong>n Verbün<strong>de</strong>ten gehalten wer<strong>de</strong>n konnte. Die Russen zogen im September zermürbt ab, aber auch die<br />
Preußen, so dass die wichtige Festung Schweidnitz <strong>zu</strong>sammen mit Oberschlesien in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Österreicher fiel.<br />
In Hinterpommern eroberten die Russen Kolberg, aber in Vorpommern gelang es <strong>de</strong>n Preußen, sich gegen die Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> behaupten. Auf <strong>de</strong>m west<strong>de</strong>utschen Kriegsschauplatz passierte<br />
wenig, was insbeson<strong>de</strong>re an <strong>de</strong>r schwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kraft <strong>de</strong>s französischen Staates lag.<br />
So hatte Preußen auch in diesem Jahr Glück, dass die Alliierten <strong>zu</strong> keinem entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schlag in <strong>de</strong>r Lage waren. Dennoch war die Lage Preußens weiterhin kritisch. Hin<strong>zu</strong> kam noch,<br />
dass die britische Regierung nach <strong>de</strong>m Sturz Pitts im Dezember die Subsidienzahlungen einstellte.<br />
Entlastung erlangte Friedrich schließlich durch ein Ereignis, das oft fälschlicherweise mit seinem damals schon zwei Jahre alten Wort vom „Mirakel <strong>de</strong>s Hauses Bran<strong>de</strong>nburg“ in<br />
Zusammenhang gebracht wird: Die Zarin Elisabeth starb am 25. Dezember, und ihr Neffe Peter III. trat daraufhin die Nachfolge an.<br />
1762<br />
Nach<strong>de</strong>m er <strong>de</strong>n preußischen Hohen Or<strong>de</strong>n vom Schwarzen Adler verliehen bekam, schloss Peter III., ein Bewun<strong>de</strong>rer Friedrichs, am 5. Mai in St. Petersburg einen Frie<strong>de</strong>ns- und<br />
Bündnisvertrag mit Preußen (und stellte diesem ein Kontingent <strong>zu</strong>r Verfügung) (Frie<strong>de</strong>n von Sankt Petersburg), <strong>de</strong>m sich Schwe<strong>de</strong>n am 22. Mai (Frie<strong>de</strong>n von Hamburg) anschloss. Nach<br />
Peters Ermordung löste Katharina die Große das Bündnis auf, beließ es aber beim Frie<strong>de</strong>n. Durch die frei wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kräfte erstarkt, versuchte Friedrich die Österreicher aus Schlesien<br />
und Sachsen <strong>zu</strong> verdrängen. Es gelang ihm, Daun bei Burkersdorf <strong>zu</strong> schlagen und Schweidnitz <strong>zu</strong> besetzen. Bei Freiberg kam es schließlich <strong>zu</strong>r letzten Schlacht zwischen Österreich und<br />
Preußen. Die Preußen unter Prinz Heinrich siegten, womit ihnen auch die Rückgewinnung Sachsens gelang.<br />
Im Sommer stießen französische Truppen letztmals nach Nordhessen vor, die jedoch am 24. Juni in <strong>de</strong>r „Schlacht bei Wilhelmsthal“ (heute <strong>zu</strong>r Gemein<strong>de</strong> Cal<strong>de</strong>n gehörend) und am 23.<br />
Juli in <strong>de</strong>r „Schlacht bei Lutterberg“ mit Kriegschauplätzen dies- und jenseits <strong>de</strong>r Fulda bei Lutterberg (heute <strong>zu</strong> Staufenberg in Nie<strong>de</strong>rsachsen zählen<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>teil) und nahe<br />
Knickhagen (heutiger Gemein<strong>de</strong>teil <strong>de</strong>s hessischen Fuldatal) am Fulda-Zufluss Osterbach verlustreich besiegt wur<strong>de</strong>n.<br />
Der Krieg in <strong>de</strong>n Kolonien
Unter Robert Clive eroberten die Briten die französischen Besit<strong>zu</strong>ngen in Indien. In Nordamerika begannen die Feindseligkeiten bereits 1754 (→ Franzosen- und Indianerkrieg). Nach<br />
anfänglichen Rückschlägen (französischer Sieg in <strong>de</strong>r Schlacht am Monongahela 1755) eroberten die Briten erst das Ohiogebiet, stießen dann <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Großen Seen vor und begannen<br />
schließlich die Invasion Kanadas. Durch die Vernichtung <strong>de</strong>r französischen Flotte in zwei Seeschlachten wur<strong>de</strong> Québec von Europa abgeschnitten. Die Briten eroberten daraufhin 1759<br />
Québec und 1760 Montreal.<br />
Die Frie<strong>de</strong>nsverträge von 1763<br />
Großbritannien und Portugal schlossen am 10. Februar <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Paris mit Frankreich und Spanien.<br />
Am 15. Februar 1763 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n von Hubertusburg zwischen Preußen und seinen Gegnern geschlossen. Der Status quo ante bellum wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rhergestellt.<br />
Auswirkungen<br />
Politische Folgen<br />
Preußen hatte sich durch <strong>de</strong>n Krieg als fünfte Großmacht im europäischen Mächtekonzert etabliert. Der mit <strong>de</strong>n Schlesischen Kriegen begonnene Gegensatz <strong>zu</strong> Österreich blieb, von <strong>de</strong>r<br />
Phase <strong>de</strong>r gemeinsamen Gegnerschaft <strong>zu</strong> Napoléon abgesehen, bis <strong>zu</strong>m Krieg von 1866 für die <strong>de</strong>utsche Politik grundlegend (Deutscher Dualismus) und mün<strong>de</strong>te bald darauf in <strong>de</strong>n<br />
Bayerischen Erbfolgekrieg.<br />
Frankreich, das durch völlig unterschiedliche Kriegsschauplätze seine Ziele verfehlte, misslang <strong>de</strong>r Erwerb <strong>de</strong>r Österreichischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> (heute Belgien), die als Kompensation für<br />
die Hilfe bei <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgewinnung Schlesiens durch Österreich <strong>zu</strong>gesagt waren. Außer<strong>de</strong>m verlor es einen großen Teil seines Kolonialreiches (ganz Kanada, alle Teile Indiens), brannte<br />
auf Revanche an Großbritannien und geriet in immer tiefere Staatsverschuldung. Ersteres führte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r französischen Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r rebellieren<strong>de</strong>n Kolonien im Amerikanischen<br />
Unabhängigkeitskrieg, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r Staatsverschuldung <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wichtigsten Ursachen <strong>de</strong>r Französischen Revolution wur<strong>de</strong>.<br />
Großbritannien mischte sich seit <strong>de</strong>m Krieg verstärkt in die europäische Kontinentalpolitik ein. Der Sieg in Nordamerika wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Ursache <strong>de</strong>s Konflikts mit <strong>de</strong>n Siedlern in <strong>de</strong>n älteren<br />
Kolonien. Zum Schutz <strong>de</strong>r im Krieg mit Großbritannien verbün<strong>de</strong>ten Indianer wur<strong>de</strong>n die neu erworbenen Gebiete zwischen Allegheny Mountains und Ohio beziehungsweise Mississippi<br />
nicht <strong>zu</strong>r Besiedlung freigegeben, außer<strong>de</strong>m sollte die Kolonialbevölkerung durch verschie<strong>de</strong>ne Steuern an <strong>de</strong>n Kosten <strong>de</strong>s Krieges beteiligt wer<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong>s führte <strong>zu</strong> Konflikten. Die<br />
Miliztruppen <strong>de</strong>r Kolonisten konnten Kampferfahrung sammeln, die sie eineinhalb Jahrzehnte später im Unabhängigkeitskrieg gegen das Mutterland Großbritannien erfolgreich<br />
einsetzten.<br />
Wirtschaftliche Folgen<br />
Für die Bevölkerung <strong>de</strong>r beteiligten Staaten in <strong>de</strong>n Kriegsgebieten hatte <strong>de</strong>r Krieg <strong>zu</strong>m Teil katastrophale Auswirkungen. Der Verlust an Soldaten war immens – so verlor allein Preußen<br />
180.000 Mann. Auch die Zivilbevölkerung wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>zimiert, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n am stärksten betroffenen Gebieten wie Sachsen o<strong>de</strong>r Pommern. Sachsen hatte als von Preußen besetztes<br />
Gebiet auch sehr stark unter Plün<strong>de</strong>rungen, Zwangsrekrutierungen und Kontributionszahlungen <strong>zu</strong> lei<strong>de</strong>n.<br />
Rezeption<br />
Kulturell<br />
1763 begann Lessing mit <strong>de</strong>m Schreiben <strong>de</strong>s Lustspiels Minna von Barnhelm o<strong>de</strong>r das Soldatenglück, das 1767 erschien und aufgeführt wur<strong>de</strong>. Das Stück spielt in <strong>de</strong>r Zeit unmittelbar<br />
nach <strong>de</strong>m Krieg und behan<strong>de</strong>lt das Schicksal eines Soldaten. Thackeray liefert mit seinem Roman Die Memoiren <strong>de</strong>s Junkers Barry Lyndon (ab 1844) die Vorlage für Stanley Kubricks<br />
Verfilmung. Stanley Kubricks preisgekrönter Film Barry Lyndon (1975) spielt in <strong>de</strong>n Wirren <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges. Er beleuchtet die gesellschaftliche Struktur Großbritanniens<br />
während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Mobilmachung und <strong>de</strong>s Kriegs.
Der Künstler Adolph Menzel überlieferte Ansichten <strong>de</strong>r sterblichen Überreste von gefallenen Offizieren <strong>de</strong>s Krieges. Seine Leichenporträts, die 1873 anlässlich <strong>de</strong>r Öffnung <strong>de</strong>r<br />
Grabgewölbe unter <strong>de</strong>r Garnisonkirche in Berlin entstan<strong>de</strong>n, zeigen unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>n mumifizierten Leichnam von Feldmarschall James Keith.<br />
Die in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus <strong>zu</strong> Propagandazwecken gedrehten Spielfilme „Fri<strong>de</strong>ricus - Der alte Fritz“ (1937) und „Der große König“ (1942), bei<strong>de</strong> mit Otto Gebühr in <strong>de</strong>r<br />
Rolle <strong>de</strong>s Friedrich II., verherrlichen <strong>de</strong>n Preußenkönig und schil<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Siebenjährigen Krieg aus preußischer Sicht.<br />
Museal<br />
In <strong>de</strong>r Dauerausstellung <strong>de</strong>s Wiener Heeresgeschichtlichen Museums sind zahlreiche Objekte aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges <strong>de</strong>r Öffentlichkeit <strong>zu</strong>gänglich. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
hierbei hauptsächlich um Stücke <strong>de</strong>r preußischen Armee, wie Füsiliermützen, Pallasche, Degen und Fahnen (wie z. B. die Fahne <strong>de</strong>s königlich-preußischen 17. Feldregiments aus <strong>de</strong>r Zeit<br />
Friedrichs II.), die von österreichischen Truppen zwischen 1756 und 1763 erbeutet wur<strong>de</strong>n.[3] Diese 22 Fahnen gelten auf fahnenkundlichem Gebiet als beson<strong>de</strong>re Rarität. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
dabei um Trophäen, die überwiegend bei <strong>de</strong>r Kapitulation von Maxen in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Österreicher gefallen sind. Die Fahnen entsprechen alle <strong>de</strong>m bei Regierungsantritt Friedrichs II.<br />
neu geschaffenen Fahnenmusters, das einen mit Schwert und Donnerkeil bewehrten Adler und die Devise „PRO GLORIA ET PATRIA“ zeigt. Die Eckmedaillons sowie die in<br />
durchbrochener Manier gearbeiteten Fahnenspitzen enthalten die Initialen „FR“.[4]<br />
Literatur<br />
Gesamtdarstellungen und Darstellungen <strong>zu</strong> Einzelaspekten<br />
• J.W. von Archenholtz: Geschichte <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges in Deutschland von 1756 bis 1763, Frankfurt und Leipzig 1788. eBook (Faksimilie), Potsdam 2010, ISBN 978-3-<br />
941919-54-9<br />
• Christopher Duffy: Friedrich <strong>de</strong>r Große. Weltbild Verlag GmbH, Augsburg 1994<br />
• Sven Externbrink: Friedrich <strong>de</strong>r Große, Maria Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie im Siebenjährigen Krieg, Aka<strong>de</strong>mie Verlag. Berlin 2006, ISBN 978-<br />
3-05-004222-0 (Rezension)<br />
• Marian Füssel: Der Siebenjährige Krieg. Ein Weltkrieg im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt. C.H. Beck oHG, München 2010, ISBN 978-3-406-60695-3.<br />
• Olaf Groehler: Die Kriege Friedrichs II. Militärverlag <strong>de</strong>r DDR, Berlin 1986<br />
• Großer Generalstab (Hg.): Geschichte <strong>de</strong>s siebenjährigen Krieges in einer Reihe von Vorlesungen, mit Benut<strong>zu</strong>ng authentischer Quellen, bearbeitet von <strong>de</strong>n Offizieren <strong>de</strong>s<br />
Großen Generalstabs: Berlin 1824ff - online bei Google Books: Band 1 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6<br />
• Johann Heilmann: Beitrag <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Feld<strong>zu</strong>ges von 1757, Berlin 1854, eBook (Faksimilie), Potsdam 2010, ISBN 978-3-941919-51-8<br />
• Curt Jany: Geschichte <strong>de</strong>r Preußischen Armee vom 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt bis 1914, Zweiter Band, Die Armee Frie<strong>de</strong>richs <strong>de</strong>s Großen 1740-1763, Nachdruck hrsg. von Eberhard Jany,<br />
Osnabrück 1967. Zum Siebenjährigen Krieg: 342ff.<br />
• Eberhard Kessel (Autor), Thomas Lindner (Herausgeber) : Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges 1760-1763, 2 Bän<strong>de</strong>: Torgau und Bunzelwitz. Schweidnitz und Freiberg,<br />
Ferdinand Schöningh Verlag, Pa<strong>de</strong>rborn 2007, ISBN 978-3-506-75706-7<br />
• Henry Lloyd: Geschichte <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges in Deutschland zwischen <strong>de</strong>m Könige von Preußen und <strong>de</strong>r Kaiserin Königin mit ihren Alliierten; übersetzt und<br />
herausgegeben von Georg Friedrich von Tempelhof: 6 Bän<strong>de</strong>; Berlin 1783ff. Online bei Google Books: Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6<br />
• Georg Ortenburg (Hrsg.), Siegfried Fiedler: Kriegswesen und Kriegführung im Zeitalter <strong>de</strong>r Kabinettskriege. Bernhard & Graefe Verlag, Augsburg 1986, ISBN 3-7637-5478-4<br />
• Friedrich R.Paulig: Geschichte <strong>de</strong>s siebenjährigen Krieges. Ein Beitrag <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Geschichte <strong>de</strong>r Jahre 1740-1763, Frankfurt a.O., 1871, eBook (Faksimilie), Potsdam 2010,<br />
ISBN 978-3-941919-55-6<br />
• Leopold von Ranke (Autor): Der Ursprung <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges, Leipzig 1871, eBook (Faksimilie), Potsdam 2010,ISBN 978-3-941919-56-3<br />
• Philipp von Westphalen: Geschichte <strong>de</strong>r Feldzüge <strong>de</strong>s Herzogs Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg, hrsg. von Ferdinand von Westphalen, Berlin 1859-72 (Nachdruck<br />
Starnberg 1985), 6 B<strong>de</strong>. - online bei Google Books: Band 1 - Band 2
An<strong>de</strong>re<br />
• Samuel Gotthold Langen: Die besiegten Heere, eine O<strong>de</strong>, nebst <strong>de</strong>m Jubelgesange <strong>de</strong>r Preußen, Halle 1758, eBook (Faksimilie), Potsdam 2010, ISBN 978-3-941919-53-2<br />
• M.J.C.L.R.A.S.: Poetische Erzählungen von <strong>de</strong>n vornemsten Thaten Friedrichs <strong>de</strong>s Grossen und Seiner Hel<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>m jetzigen Kriege, Halle 1759, eBook (Faksimilie), Potsdam<br />
2010, ISBN 978-3-941919-52-5<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Siebenjähriger Krieg. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Bd. 14, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 945.<br />
2. ↑ Beiträge <strong>zu</strong>r neueren Staats- und Kriegsgeschichte. Danzig 1760, Nr. 91-94, S. 161-168.<br />
3. ↑ Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher (Hg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz, Wien 2000 S. 29 f.<br />
4. ↑ Johann Christoph Allmayer-Beck: Das Heeresgeschichtliche Museum Wien. Saal II - Das 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt bis 1790, Salzburg 1983 S. 83 f.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Wismar<br />
Die Hansestadt Wismar liegt an <strong>de</strong>r Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns am südlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r durch die Insel Poel geschützten Wismarbucht. Die kreisfreie Stadt ist eines <strong>de</strong>r 18<br />
Mittelzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Am 27. Juni 2002 wur<strong>de</strong> ihre Altstadt <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r von Stralsund unter <strong>de</strong>r Bezeichnung Historische Altstädte Stralsund und Wismar in die Welterbeliste <strong>de</strong>r UNESCO<br />
aufgenommen.<br />
Geografie<br />
Die Stadt liegt an <strong>de</strong>r Südspitze <strong>de</strong>r gleichnamigen Wismarbucht an <strong>de</strong>r Ostsee. Hier mün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bach Köppernitz und die im Gründungsjahrhun<strong>de</strong>rt künstliche geschaffene Stadtgrube,<br />
gespeist aus <strong>de</strong>m Mühlenteich, in die Hafenbecken <strong>zu</strong>r Ostsee. Der 1577 von Tilemann Stella, <strong>de</strong>m herzoglichem Hofbaumeister, begonnene Kanalausbau, <strong>zu</strong>nächst Viechelnsche Fahrt<br />
genannt (erst ab <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt bürgerte sich <strong>de</strong>r Name Wallensteingraben ein), fließt östlich <strong>de</strong>r Altstadt in die Ostsee. Der Kanal hatte einen Höhenunterschied von 38 Metern <strong>zu</strong><br />
überwin<strong>de</strong>n und erwies sich als unwirtschaftlich und versan<strong>de</strong>te in <strong>de</strong>r Folge. Trotz<strong>de</strong>m bestehen bis heute Kanalpläne, <strong>zu</strong>letzt 2008 durch eine Machbarkeitsstudie, die die<br />
Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg in Auftrag geben wollte. Doch die notwendigen Mittel <strong>zu</strong>m Bau und Unterhalt <strong>de</strong>r umstrittenen Wasserstraße <strong>zu</strong>r Ostsee fehlten. Im Stadtgebiet<br />
befin<strong>de</strong>n sich mehrere kleinere und zwei größere stehen<strong>de</strong> Gewässer, <strong>de</strong>r Mühlenteich und <strong>de</strong>r Viereggenhöfer Teich.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Wismar ist in acht Stadtteile geglie<strong>de</strong>rt:[2]
Klima<br />
• Altstadt<br />
• Wismar Nord<br />
• Wismar Ost<br />
• Dargetzow<br />
• Wismar Süd<br />
• Frie<strong>de</strong>nshof<br />
• Wismar West<br />
• Wendorf<br />
Der Jahresnie<strong>de</strong>rschlag liegt bei 599 mm und ist damit vergleichsweise niedrig, da er in das untere Viertel <strong>de</strong>r in Deutschland erfassten Werte fällt. An 21 % <strong>de</strong>r Messstationen <strong>de</strong>s<br />
Deutschen Wetterdienstes wer<strong>de</strong>n niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist <strong>de</strong>r Februar, <strong>de</strong>r meiste Nie<strong>de</strong>rschlag fällt im Juli und zwar doppelt so viel wie im Februar. Die<br />
Nie<strong>de</strong>rschläge variieren wenig. An nur 11 % <strong>de</strong>r Messstationen wer<strong>de</strong>n niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert.<br />
Namensherkunft<br />
Die Urkun<strong>de</strong>nlage <strong>zu</strong>m Namen <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar lässt, auch nach neuesten Forschungen, keine Ein<strong>de</strong>utigkeit <strong>zu</strong>. Genannt wird unter an<strong>de</strong>rem die Ableitung von Wismaria o<strong>de</strong>r Ort<br />
<strong>de</strong>s Vysěmêr o<strong>de</strong>r Visemêr, <strong>de</strong>m angeblichen Lokator <strong>de</strong>s Ortes. Der Ortsname än<strong>de</strong>rte sich von 1229 Wyssemaria, 1230 Wissemaria bis 1237, 1246 hin <strong>zu</strong> Wismaria.[3]. Demgegenüber<br />
wird <strong>de</strong>r Name Wismar schon 1147 durch die 20 Jahre später entstan<strong>de</strong>ne Knýtlinga-Saga erwähnt[4], als <strong>de</strong>r dänische König Sven Gra<strong>de</strong> in „Wizmar Havn“ – <strong>de</strong>r Wismarer Bucht –<br />
lan<strong>de</strong>te. Dies ist nicht glaubwürdig, da es sich höchstens um einen Ankerplatz han<strong>de</strong>lte. Auch <strong>de</strong>r dänische König Wal<strong>de</strong>mar lan<strong>de</strong>te 1164 in „Wismar Havn“. Die auf bei<strong>de</strong> Ereignisse<br />
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen<strong>de</strong> nachweisbare Fälschung <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> vom 4. Januar 1211, wonach Kaiser Otto IV „<strong>de</strong>n lieben Bürger <strong>zu</strong> Schwerin eine beliebige Anzahl von kleineren Schiffen und<br />
zwei größeren Schiffen im Hafen von Wismar <strong>zu</strong> halten gestattet“ [5].<br />
Der Name <strong>de</strong>r Stadt Wismar ist nicht ein<strong>de</strong>utig, auch wenn man die Urkun<strong>de</strong> von 1167 [6], also rund 60 Jahre vor Stadtgründung heranzieht. Hierbei han<strong>de</strong>lte es sich um eine Urkun<strong>de</strong><br />
von Heinrich <strong>de</strong>m Löwen <strong>zu</strong>r Bestätigung <strong>de</strong>r Festlegung <strong>de</strong>r Grenzen <strong>de</strong>s Bistums Ratzeburg[7], wo <strong>zu</strong>m ersten Mal <strong>de</strong>r Name Wismar als aqua que Wissemara dicitur, ad aquem<br />
Wissemaram als östliche Grenze <strong>de</strong>s Bistums erwähnt wird. Es ist ein kleiner Flusslauf östlich Wismars. Letztendlich datiert die urkundliche Erwähnung (es ist eine Kopie <strong>de</strong>s im 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt durch einen Stadtbrand verloren gegangenen Urkun<strong>de</strong>nbuchs Wismar) <strong>de</strong>r Stadt Wismar aus <strong>de</strong>m Jahr 1229[8] als Fürst Johann „seinen lieben Bürgern (man spricht nur von<br />
Bürgern, wenn eine Stadt (Civita) vorhan<strong>de</strong>n) ein Stück Land zwischen <strong>de</strong>r Köppernitz und ... überläßt“. Erwähnt wird dies auch in <strong>de</strong>r Kirchbergschen Chronik[9] von <strong>de</strong>r „un dy stad<br />
<strong>zu</strong>r Wysmar“.<br />
Der Name für die planmäßige Besiedlung <strong>de</strong>s dreikuppigen Hügels an <strong>de</strong>r südlichen Wismar-Bucht, <strong>de</strong>r heutigen Hansestadt Wismar, leitet sich nach Ansicht <strong>de</strong>s ausgewiesenen Hanse-<br />
und Wismarforscher Friedrich Techen[10], <strong>de</strong>m mecklenburgischen Altmeister <strong>de</strong>r Geschichte Friedrich Schlie[11] und Friedrich Schildt[12] vom Namen <strong>de</strong>s östlich <strong>de</strong>r Stadt gelegenen<br />
Baches <strong>de</strong>r aqua Wisemaraa ab. Das dort vermutete Dorf Alt Wismar kann eventuell nur als Ansiedlung angesehen wer<strong>de</strong>n, die später in die neue Stadt und dann auch erst das alte Wismar<br />
genannt wur<strong>de</strong>, überging. Die aqua wissemaraa gab es nachweislich und auch <strong>de</strong>n Ort Alt Wismar (siehe Urkun<strong>de</strong> von 1167). Zwei Bezeichnungen <strong>de</strong>uten auf diesen Ort hin: Das 1868<br />
abgerissene Altwismartor im Osten <strong>de</strong>r Stadt und die heutige Altwismarstraße in Richtung Osten. Schwerlich kann man da Viysemar, <strong>de</strong>n Lokator, als einzigen Nachweis für <strong>de</strong>n<br />
Stadtnamen Wismar angeben, wobei <strong>de</strong>r Name Wismar 1147 und 1167, Jahrzehnte früher auftaucht und <strong>de</strong>r erwähnte Lokator sicherlich noch nicht anwesend war.<br />
Geschichte<br />
Vor <strong>de</strong>r Stadtgründung<br />
Die Region um die heutige Hansestadt Wismar ist schon auf Grund <strong>de</strong>r günstigen Lage Jahrtausen<strong>de</strong> altes Besiedlungsgebiet, was durch Ausgrabungen und Fun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r letzten Jahre belegt
ist. Nach <strong>de</strong>m Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Germanen in <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung war bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts die Region um die Wismarbucht von <strong>de</strong>n wendischen o<strong>de</strong>r slawischen Obodriten<br />
bewohnt, die nahe Wismar beim heutigen Dorf Mecklenburg und in <strong>de</strong>r Burg Ilow östlich von Wismar ihren Hauptsitz o<strong>de</strong>r Wohnsitz hatten.<br />
Das nördlich von Wismar am Salzhaff gelegene Dorf Alt Gaarz wur<strong>de</strong> durch eine willkürliche, auf keine wissenschaftliche Basis grün<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Entscheidung mit Verleihung <strong>de</strong>s Stadtrechts<br />
am 1. April 1938 in Rerik umbenannt. Damit sollte <strong>de</strong>r alte Han<strong>de</strong>lsplatz Reric <strong>de</strong>r Wikinger dokumentiert und gleichzeitig die Weltanschauung <strong>de</strong>r Nationalsozialisten <strong>de</strong>monstriert<br />
wer<strong>de</strong>n (siehe auch Kühlungsborn). Neuerliche Fun<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Wismarer Bucht, wie etwa von Münzen aus <strong>de</strong>n Jahren um 900 n. Chr. und auch <strong>de</strong>r Fund <strong>de</strong>r Poeler Kogge, lassen<br />
vermuten, dass das 808 n. Chr. zerstörte Reric im 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r wikingischer Fernhan<strong>de</strong>lsplatz an <strong>de</strong>r Ostsee war, <strong>de</strong>ssen Rolle Haithabu übernahm, das sich eben in <strong>de</strong>r<br />
nördlichen Wismarer Bucht befand.<br />
Der Name „Wismar“ ist erstmals für das Jahr 1147 durch die 20 Jahre später entstan<strong>de</strong>ne Knytlinga-Sage erwähnt[4], als <strong>de</strong>r dänische König Sven Gra<strong>de</strong> in „Wizmar Havn“ – <strong>de</strong>r<br />
Wismarer Bucht – lan<strong>de</strong>te. Der Name „Hafen“ ist hier irreführend. Es könnte sich, wenn die Sage stimmt, nur um einen Ankerplatz han<strong>de</strong>ln, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s „aqua wissemara“<br />
befand. Der Name <strong>de</strong>r Stadt „Wismar“ ist nicht ein<strong>de</strong>utig, auch wenn man die Urkun<strong>de</strong> von 1167[13], also rund 60 Jahre vor Stadtgründung, heranzieht. Hierbei han<strong>de</strong>lte es sich um eine<br />
Urkun<strong>de</strong> [14], von Heinrich <strong>de</strong>m Löwen <strong>zu</strong>r Bestätigung <strong>de</strong>r Festlegung <strong>de</strong>r Grenzen <strong>de</strong>s Bistums Ratzeburg, wo <strong>zu</strong>m ersten Mal urkundlich belegt <strong>de</strong>r Name Wismar als aqua que<br />
Wissemara dicitur, ad aquem Wissemaram als östliche Grenze <strong>de</strong>s Bistum erwähnt wird. Es ist ein kleiner Flusslauf östlich Wismars.<br />
Die am 4. Januar 1211 in Capua ausgestellte Urkun<strong>de</strong>, wonach Kaiser Otto IV. „<strong>de</strong>n lieben Bürger <strong>zu</strong>n Schwerin eine beliebige Anzahl von kleineren Schiffen und zwei größeren Schiffen<br />
im Hafen von Wismar <strong>zu</strong> halten gestattet“[15], beruht auf einer Fälschung, die durch eine falsche Abschrift <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> von 1167 entstan<strong>de</strong>n ist. Letztendlich datiert die urkundliche<br />
Erwähnung (es ist eine Kopie <strong>de</strong>s im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt durch einen Stadtbrand verloren gegangenen Urkun<strong>de</strong>nbuchs Wismar) <strong>de</strong>r Stadt Wismar aus <strong>de</strong>m Jahr 1229[8] als Fürst Johann I.<br />
„seinen lieben Bürgern (man spricht nur von Bürgern, wenn eine Stadt (Civita) vorhan<strong>de</strong>n) ein Stück Land zwischen <strong>de</strong>r Köppernitz und ... überläßt“. Erwähnt wird dies auch in <strong>de</strong>r<br />
Kirchbergschen Chronik[9] von <strong>de</strong>r „un dy stad <strong>zu</strong>r Wysmar“.<br />
Hypothetisch wird angenommen (da keine bekannte Urkun<strong>de</strong> dies belegen kann), dass <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r durch die planmäßige Besiedlung <strong>de</strong>r späteren Hansestadt Wismar, sich von <strong>de</strong>m<br />
östlich <strong>de</strong>r Stadt gelegenen Fluss aqua wissemare o<strong>de</strong>r wie es <strong>de</strong>utlicher <strong>zu</strong>m Ausdruck kommt, <strong>de</strong>r Wissemaraa herleitet. Das Wort Aa be<strong>de</strong>utet noch heute im skandinavischen Raum<br />
Fluss o<strong>de</strong>r Bach.<br />
Stadtgründung<br />
Die Stadtgründung <strong>de</strong>r heutigen Stadt Wismar geht vermutlich auf <strong>de</strong>n Fürsten Heinrich Borwin I., Herr <strong>zu</strong> Mecklenburg, <strong>zu</strong>rück. Das Stadtgründungsjahr wird auf 1226 geschätzt.[16]<br />
Die hier angesie<strong>de</strong>lten Menschen stammten – ihren Familiennamen nach – wohl aus Holstein, Westfalen, Nie<strong>de</strong>rsachsen und <strong>de</strong>r Mark. 1229 wur<strong>de</strong> die Stadt Wismar erstmals urkundlich<br />
erwähnt. Kurz darauf wird in Wismar das Lübische Stadtrecht eingeführt, welches im Jahre 1266 durch <strong>de</strong>n Mecklenburgischen Fürsten Heinrich I. bestätigt wur<strong>de</strong>. Die ursprünglich<br />
einzeln gelegenen Siedlungen um St. Marien und St. Nikolai wuchsen bis 1238 <strong>zu</strong>sammen. Durch <strong>de</strong>n unvermin<strong>de</strong>rten Zu<strong>zu</strong>g von Siedlern kam ab 1250 die „Neustadt“ um St. Georgen<br />
hin<strong>zu</strong>. Wismar wur<strong>de</strong> Sitz zweier Bettelor<strong>de</strong>nsnie<strong>de</strong>rlassungen: So kamen 1251/52 die Franziskaner, 1292/93 die Dominikaner in die Stadt. 1276 war die erste Siedlungsphase been<strong>de</strong>t.<br />
Wismar errichtete eine alle Viertel umschließen<strong>de</strong> Stadtmauer, <strong>de</strong>ren Lage auch heute die Begren<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Altstadt darstellt.<br />
Zeit <strong>de</strong>r Hanse<br />
Schon einige Jahre nach <strong>de</strong>r Stadtgründung wur<strong>de</strong> Wismar Mitglied <strong>de</strong>r Hanse. Am 6. September 1259[17] trafen sich in Wismar die Gesandten aus Lübeck und Rostock, um einen<br />
Schutzvertrag gegen die <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Seeräuberei <strong>zu</strong> schließen. Das war <strong>de</strong>r Grundstein für das sich rasch entwickeln<strong>de</strong> wendische Quartier <strong>de</strong>r Hanse. Im Jahre 1280 bil<strong>de</strong>te Wismar, das<br />
an <strong>de</strong>r Hansischen Ostseestraße lag, <strong>zu</strong>sammen mit Stralsund, Rostock, Lübeck und Hamburg <strong>de</strong>n Wendischen Städtebund und die Stadt wur<strong>de</strong> im Mittelalter ein wichtiges Mitglied <strong>de</strong>r<br />
Hanse. Die hanseatische Tradition <strong>de</strong>r Stadt ist bis heute <strong>de</strong>utlich spürbar. In bewusster Anlehnung daran trägt Wismar seit <strong>de</strong>m 18. Januar 1990 auch wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Titel Hansestadt. Von<br />
1238 bis 1250 wur<strong>de</strong> die Wismarer Neustadt gebaut, und Wismar erreichte seine bis ins 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt gültige Aus<strong>de</strong>hnung.<br />
Fürst Johann I. von Mecklenburg verlegte 1257 seine Resi<strong>de</strong>nz von <strong>de</strong>r Burg Mecklenburg auf <strong>de</strong>n Weberkamp vor <strong>de</strong>r Stadt. Am 6. September 1259 schlossen sich die Städte Rostock,<br />
Lübeck und Wismar <strong>zu</strong>sammen, um gemeinsam gegen die Seeräuber <strong>zu</strong> kämpfen; mit <strong>de</strong>m 1283 folgen<strong>de</strong>n Rostocker Landfrie<strong>de</strong>n stabilisierte sich die Zusammenarbeit <strong>de</strong>r Städte <strong>de</strong>s
Wendischen Viertels <strong>de</strong>r Hanse weiter. Die Stadt blieb als be<strong>de</strong>utendste Stadt im Fürstentum bis <strong>zu</strong>m Jahr 1358 Resi<strong>de</strong>nzstadt <strong>de</strong>r mecklenburgischen Fürsten. Im Jahr 1267 kam es <strong>zu</strong><br />
einem ersten großen Stadtbrand. Die reiche Hansestadt wur<strong>de</strong> nun mit vielen Backsteinhäusern wie<strong>de</strong>raufgebaut. Das gestiegene Selbstbewusstsein <strong>de</strong>r Stadt spiegelte sich im Aufstand<br />
1310 gegen <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren Henrich II. von Mecklenburg wi<strong>de</strong>r. Der Auslöser war die Weigerung Wismars, die Hochzeit <strong>de</strong>ssen Tochter Mechthild mit <strong>de</strong>m Herzog Otto <strong>zu</strong><br />
Braunschweig-Lüneburg in <strong>de</strong>r Stadt durch<strong>zu</strong>führen. Aber schon 1311 musste sich Wismar <strong>de</strong>m Herzog unterwerfen.<br />
1350 erreichte <strong>de</strong>r Schwarze Tod die Stadt, und mehr als 2000 Einwohner erlagen <strong>de</strong>r Krankheit.[18] In <strong>de</strong>n kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r Hanse mit Dänemark stand Wismar<br />
mit <strong>de</strong>n Städten <strong>de</strong>s Wendischen Viertels. Kurz nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stralsund besuchte Kaiser Karl IV. 1375 von Lübeck kommend die Stadt, wo ihm ein ehrenvoller Empfang bereitet<br />
wur<strong>de</strong>. Der Verlust <strong>de</strong>r schwedischen Krone durch die Mecklenburger brachte die mecklenburgischen Hansestädte Wismar und Rostock erstmals in Konflikt mit <strong>de</strong>n übrigen<br />
Hansestädten, die eher gegen die Mecklenburger Herzöge und <strong>de</strong>n Kaiser mit Königin Margarethe von Dänemark hielten. Der Konflikt wur<strong>de</strong> als Kaperkrieg geführt, die von <strong>de</strong>n<br />
Mecklenburgern für Private ausgestellten Kaperbriefe waren die Geburtsstun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vitalienbrü<strong>de</strong>r.<br />
Anfang <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam es <strong>zu</strong> innerstädtischen Unruhen. Die Handwerksämter begehrten unter ihrem Anführer Claus Jesup auf und setzten einen Neuen Rat ein, <strong>de</strong>r sich gegen<br />
das Patriziat und die Fernhändler jedoch dauerhaft nicht halten konnte. Die Unruhen eskalierten 1427 nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r hansischen Flotte erneut, und in Wismar wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Flottenführer wie auch <strong>de</strong>r Bürgermeister Johann Bantzkow auf <strong>de</strong>m Richtblock <strong>de</strong>s Marktplatzes hingerichtet.<br />
Die Reformation ging in Wismar von <strong>de</strong>n Franziskanern aus. Der Mönch <strong>de</strong>s Grauen Klosters Heinrich Never übernahm frühzeitig die neue lutherische Lehre. Während sich das<br />
Schwarze Kloster noch einige Zeit über die Reformation hinaus halten konnte, wur<strong>de</strong> das Graue Kloster um 1540 <strong>zu</strong>r Schule, wenige Jahre später <strong>zu</strong>r Lateinschule. In dieser Zeit<br />
etablierte sich in Wismar auch eine Täufergemein<strong>de</strong>, an <strong>de</strong>ren Zusammenkünften im Winter 1553/54 auch Menno Simons teilnahm. Im Jahr 1555 verkün<strong>de</strong>ten die wendischen<br />
Hansestädte ein Mandat gegen die Täufer, doch auch nach 1555 fin<strong>de</strong>n sich noch vereinzelt Täufer in <strong>de</strong>r Hansestadt [19][20].<br />
Der Kanalbau <strong>de</strong>r Viechelner Fahrt, heute Wallensteingraben genannt, wur<strong>de</strong> 1594 als Wasserstraße <strong>zu</strong>m Schweriner See und <strong>zu</strong>r Elbe in Betrieb genommen, verfiel kurz darauf jedoch<br />
schon wie<strong>de</strong>r, da er in <strong>de</strong>r politisch unruhigen Zeit nicht genug gepflegt und unterhalten wur<strong>de</strong>.<br />
Schwe<strong>de</strong>nzeit<br />
Im Dreißigjährigen Krieg wur<strong>de</strong> Wismar 1632 von Schwe<strong>de</strong>n besetzt und fiel im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Insel Poel und <strong>de</strong>m Amt Neukloster als kaiserliches<br />
Lehen an die schwedische Krone. Ab 1653 war die Stadt Sitz <strong>de</strong>s Obertribunals, <strong>de</strong>s höchsten Gerichtshofs für die schwedischen Gebiete südlich <strong>de</strong>r Ostsee, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen bis 1712 auch das<br />
Herzogtum Ver<strong>de</strong>n und bis 1815 Schwedisch-Pommern gehörten.<br />
Im Schonischen Krieg wur<strong>de</strong> Wismar von dänischen Truppen am 13. Dezember 1675 angegriffen und bis November 1680 von <strong>de</strong>n Dänen besetzt. Am 23. November 1680 zog <strong>de</strong>r<br />
schwedische Graf Königsmarck als Vertreter <strong>de</strong>s schwedischen Königs in die Stadt ein, und Wismar wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r ein Teil Schwe<strong>de</strong>ns. Anschließend bauten die Schwe<strong>de</strong>n Wismar <strong>zu</strong><br />
einer <strong>de</strong>r stärksten Seefestungen Europas aus. So wur<strong>de</strong> die Hafeneinfahrt über die Festungsanlage auf <strong>de</strong>r Insel Walfisch gesichert. Im Dezember 1711 wur<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt das<br />
Gefecht bei Lübow geschlagen, nach<strong>de</strong>m Wismar seit August <strong>de</strong>sselben Jahres von einem dänischen Korps blockiert wur<strong>de</strong>. Die Stadtbefestigungen wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r schwedischen<br />
Nie<strong>de</strong>rlage im Nordischen Krieg wie<strong>de</strong>r geschleift, nach<strong>de</strong>m das belagerte Wismar am 19. April 1716 im Pommernfeld<strong>zu</strong>g 1715/1716 von preußisch-dänischen Truppen eingenommen<br />
wor<strong>de</strong>n war.<br />
Die schwedische Herrschaft über Wismar en<strong>de</strong>te <strong>de</strong> facto 1803, als das Königreich die Stadt mit <strong>de</strong>m Malmöer Pfandvertrag für 99 Jahre an das Herzogtum Mecklenburg-Schwerin<br />
verpfän<strong>de</strong>te. Endgültig fielen sie und die umliegen<strong>de</strong>n Gebiete aber erst 1903 an Deutschland <strong>zu</strong>rück, als Schwe<strong>de</strong>n vertraglich auf die Einlösung <strong>de</strong>s Pfan<strong>de</strong>s verzichtete.<br />
Die Wismarer feiern je<strong>de</strong>s Jahr im Spätsommer das Schwe<strong>de</strong>nfest, noch vor <strong>de</strong>m Hafenfest die größte Veranstaltung <strong>de</strong>s Jahres in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Von 1803 bis 1933<br />
1830 kam es im Gefolge <strong>de</strong>r Julirevolution auch in Wismar <strong>zu</strong> Unruhen unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>s Advokaten Christian Düberg, die durch eine Mischung aus Reform (neue Verfassung <strong>de</strong>r<br />
Stadt im Dezember) und militärischem Eingreifen aufgelöst wur<strong>de</strong>n.
1848 wur<strong>de</strong> eine Eisenbahnlinie nach Schwerin gebaut, 1883 nach Rostock und 1887 nach Karow. Im Jahr 1881 eröffnete Rudolph Karstadt in Wismar sein erstes Tuchgeschäft und legte<br />
damit <strong>de</strong>n Grundstock für die heutige Warenhauskette Karstadt.<br />
1933 bis En<strong>de</strong> Zweiter Weltkrieg<br />
Seit Beginn <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus wur<strong>de</strong>n politische Gegner und an<strong>de</strong>rs unerwünschte Menschen wie die in <strong>de</strong>r Stadt leben<strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n verfolgt, in die Emigration getrieben und<br />
ermor<strong>de</strong>t. Der beliebte jüdische Arzt Dr. Leopold Liebenthal, nach <strong>de</strong>m seit 1961 eine Straße benannt ist, starb drei Wochen nach <strong>de</strong>m Novemberpogrom von 1938. Während <strong>de</strong>s Zweiten<br />
Weltkrieges mussten Kriegsgefangene sowie ungezählte Frauen und Männer aus <strong>de</strong>n von Deutschland besetzten Län<strong>de</strong>rn rüstungswichtige Zwangsarbeit verrichten: u.a. in <strong>de</strong>r<br />
Triebwagen- und Waggonfabrik und <strong>de</strong>n Dornier-Flugzeugwerken. 36 Opfer <strong>de</strong>r Zwangsarbeit sind auf <strong>de</strong>m Friedhof an <strong>de</strong>r Schweriner Straße begraben.<br />
Während <strong>de</strong>s Krieges litt Wismar unter zwölf Bombenangriffen. Insgesamt wur<strong>de</strong>n auf die Stadt 460 Tonnen Bomben von <strong>de</strong>r britischen Royal Air Force und 400 Tonnen von <strong>de</strong>r USAAF<br />
abgeworfen. Beson<strong>de</strong>rs verheerend war <strong>de</strong>r als „Erprobungseinsatz" <strong>de</strong>klarierte Angriff von 10 britischen Mosquito-Jagdbombern in <strong>de</strong>r Nacht vom 14. <strong>zu</strong>m 15. April 1945, <strong>de</strong>r mit<br />
Luftminen ausgeführt wur<strong>de</strong>.[21] Viele historische Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n zerstört - unter an<strong>de</strong>rem wur<strong>de</strong>n die Georgenkirche, die Marienkirche und das diese umgeben<strong>de</strong> gotische Viertel<br />
schwer beschädigt.<br />
En<strong>de</strong> Zweiter Weltkrieg bis heute<br />
Nach Beset<strong>zu</strong>ng durch britische und kanadische Truppen am 2. Mai 1945, zog am 1. Juli 1945 die Rote Armee ein und übernahm vereinbarungsgemäß die Stadt mit Westmecklenburg, so<br />
dass Wismar Teil <strong>de</strong>r Sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone wur<strong>de</strong>. Seither sind insbeson<strong>de</strong>re <strong>zu</strong> Zeiten <strong>de</strong>r DDR ab 1949 bis 1990 im Stadtgebiet viele Erinnerungsstätten entstan<strong>de</strong>n, die die<br />
Erinnerung an erlittenes Unrecht und begangene Gräuel wach halten sollen:<br />
• Ge<strong>de</strong>nkstein aus <strong>de</strong>m Jahre 1947 auf <strong>de</strong>r Westseite <strong>de</strong>s Friedhofs an <strong>de</strong>r Schweriner Straße für 43 (nach an<strong>de</strong>ren Angaben 36) Frauen, Kin<strong>de</strong>r und Männer, die Opfer <strong>de</strong>r<br />
Zwangsarbeit wur<strong>de</strong>n<br />
• Ge<strong>de</strong>nkstein aus <strong>de</strong>m Jahre 1921 auf <strong>de</strong>r Ostseite <strong>de</strong>s Friedhofs für die erschossenen Arbeiter, die beim Kapp-Putsch 1920 die Republik verteidigten. Seit <strong>de</strong>n 1960er Jahren ist<br />
die Ge<strong>de</strong>nkanlage in einen "Ehrenhain <strong>de</strong>r Kämpfer für <strong>de</strong>n Sozialismus" einbezogen<br />
• Ge<strong>de</strong>nktafel für die Opfer <strong>de</strong>s Faschismus an gleicher Stelle an die Kommunisten Johann Frehse und Ernst Scheel, die bei<strong>de</strong> im KZ Dachau ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n<br />
• Ge<strong>de</strong>nkstein vor <strong>de</strong>r Anker-Schule an <strong>de</strong>r Kapitänspromena<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n antifaschistischen Wi<strong>de</strong>rstandskämpfer Johann Frehse, ermor<strong>de</strong>t im KZ Dachau 1942, nach <strong>de</strong>m bis 1990<br />
ein Platz und diese Schule benannt waren<br />
• Ge<strong>de</strong>nkanlage an <strong>de</strong>r ehemaligen Mathias-Thesen-Werft für <strong>de</strong>n kommunistischen Reichstagsabgeordneten Mathias Thesen, <strong>de</strong>r 1944 im KZ Sachsenhausen ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Das<br />
Denkmal wur<strong>de</strong> nach 1990 geschleift<br />
• Ge<strong>de</strong>nkstein von 1954 in <strong>de</strong>r Schweriner Straße für <strong>de</strong>n Arbeiterpolitiker Ernst Thälmann, <strong>de</strong>r 1944 im KZ Buchenwald ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong><br />
• Ge<strong>de</strong>nktafel von 1994 an seinem Wohnhaus in <strong>de</strong>r Altwismarstraße 21 <strong>zu</strong>r Erinnerung an <strong>de</strong>n jüdischen Arzt Dr. Leopold Liebenthal, <strong>de</strong>r ein Opfer <strong>de</strong>s Novemberpogroms von<br />
1938 wur<strong>de</strong><br />
Ab 1952 gehörte Wismar nach <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r DDR <strong>zu</strong>m Bezirk Rostock.<br />
1961 schlossen Stadt und evangelische Kirche einen Vertrag über die "Geistlichen Hebungen" ab. Danach trat die Kirche umfangreichen Grundbesitz in und außerhalb <strong>de</strong>r Stadt ab, gegen<br />
das (nicht eingehaltene) Versprechen, die Kirchen Wismars wie<strong>de</strong>r auf<strong>zu</strong>bauen.[22]<br />
Wismar stieg aufgrund staatlicher Vorgaben in <strong>de</strong>r DDR <strong>zu</strong>m zweiten Hafen <strong>de</strong>r DDR nach Rostock auf. Der Hafen spezialisierte sich auf <strong>de</strong>n Umschlag von Massengütern. Auch die<br />
starke Werftindustrie geht auf die Gründung eines Schiffsreparaturbetriebes <strong>de</strong>r Roten Armee <strong>zu</strong>rück. Bei<strong>de</strong> Richtungsvorgaben <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Entwicklung haben auch die<br />
Deutsche Wie<strong>de</strong>rvereinigung mit Modifikationen überlebt. Wismars Hafen beherbergt heute eines <strong>de</strong>r größten europäischen Holz-Cluster Europas und die Werft gehört mit <strong>de</strong>r neuen<br />
Schiffbauhalle <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnsten ihrer Art.
Die Bürger Wismars besannen sich nach <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r DDR ihrer hanseatischen Wurzeln und in <strong>de</strong>r Ratssit<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s damaligen Rates <strong>de</strong>r Stadt Wismar vom 18. Januar<br />
1990 wur<strong>de</strong> beschlossen, dass die Stadt ab sofort <strong>de</strong>n offiziellen Namen "Hansestadt Wismar" trägt.<br />
Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r DDR wur<strong>de</strong> Wismars historischer Stadtkern ab 1991 im Rahmen <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung gründlich saniert. Seit <strong>de</strong>m Jahr 2002 ist Wismars Altstadt <strong>zu</strong>sammen mit<br />
Stralsund UNESCO-Weltkulturerbe mit <strong>de</strong>m Namen Historische Altstädte Stralsund und Wismar. Wismar grün<strong>de</strong>te <strong>zu</strong>sammen mit Stralsund die Deutsche Stiftung Welterbe.<br />
Politischen Planungen <strong>zu</strong>folge sollte Wismar mit <strong>de</strong>r Kreisgebietsreform 2009 in einem künftigen Landkreis Westmecklenburg mit <strong>de</strong>r Kreisstadt Schwerin aufgehen. Das<br />
Lan<strong>de</strong>sverfassungsgericht Greifswald stellte jedoch fest, dass die Paragrafen <strong>zu</strong>r Bildung <strong>de</strong>r neuen Großkreise unvereinbar mit <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sverfassung sind.<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r Kreisreform Mecklenburg-Vorpommern 2011 soll Wismar nun doch Teil und Kreisverwaltungssitz eines neu<strong>zu</strong>bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Landkreises Nordwestmecklenburg wer<strong>de</strong>n.<br />
Schwerin wird diesem Kreis nicht angehören und seine Kreisfreiheit behalten.<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Im Jahre 1989 erreichte die Bevölkerungszahl <strong>de</strong>r Stadt Wismar mit über 58.000 ihren historischen Höchststand. Inzwischen ist die Einwohnerzahl jedoch wie<strong>de</strong>r stark gesunken. Seit <strong>de</strong>r<br />
Wen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r DDR hat die Stadt wegen <strong>de</strong>r hohen Arbeitslosigkeit und <strong>de</strong>s Geburtenrückgangs bis 2005 etwa 13.000 Einwohner verloren. En<strong>de</strong> September 2005 lebten in Wismar nach<br />
Fortschreibung <strong>de</strong>s Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern 45.502 Menschen mit Hauptwohnsitz.<br />
Die folgen<strong>de</strong> Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach <strong>de</strong>m jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 han<strong>de</strong>lt es sich meist um Schät<strong>zu</strong>ngen, danach um Volkszählungsergebnisse (1) o<strong>de</strong>r<br />
amtliche Fortschreibungen <strong>de</strong>r jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise <strong>de</strong>r Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die „Ortsanwesen<strong>de</strong> Bevölkerung“, ab<br />
1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort <strong>de</strong>r Hauptwohnung“. Vor 1843 wur<strong>de</strong> die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.<br />
• Jahr Einwohner<br />
• 1300 5.000<br />
• 1632 3.000<br />
• 1799 6.000<br />
• 1818 6.700<br />
• 27. November 1830 1 10.560<br />
• 29. November 1840 1 11.427<br />
• 30. November 1850 1 12.975<br />
• 1. Dezember 1860 1 13.253<br />
• 1. Dezember 1871 1 14.068<br />
• 1. Dezember 1875 1 14.462<br />
• 1. Dezember 1880 1 15.518<br />
• 1. Dezember 1885 1 15.797<br />
• 1. Dezember 1890 1 16.787<br />
• 2. Dezember 1895 1 17.809<br />
• 1. Dezember 1900 1 20.222<br />
• 1. Dezember 1905 1 21.902<br />
• 1. Dezember 1910 1 24.378<br />
• 1. Dezember 1916 1 21.513<br />
• 5. Dezember 1917 1 21.819
• 8. Oktober 1919 1 25.201<br />
• 16. Juni 1925 1 26.016<br />
• 16. Juni 1933 1 27.493<br />
• 17. Mai 1939 1 36.054<br />
• 1. Dezember 1945 1 37.832<br />
• 29. Oktober 1946 1 42.018<br />
• 31. August 1950 1 47.786<br />
• 31. Dezember 1955 54.834<br />
• 31. Dezember 1960 55.400<br />
• 31. Dezember 1964 1 55.067<br />
• 1. Januar 1971 1 56.287<br />
• 31. Dezember 1975 56.811<br />
• 31. Dezember 1981 1 57.718<br />
• 31. Dezember 1985 57.465<br />
• 31. Dezember 1988 58.058<br />
• 31. Dezember 1990 55.509<br />
• 31. Dezember 1995 50.368<br />
• 31. Dezember 2000 47.031<br />
• 31. Dezember 2001 46.544<br />
• 31. Dezember 2002 46.170<br />
• 31. Dezember 2003 45.714<br />
• 31. Dezember 2004 45.442<br />
• 31. Dezember 2005 45.391<br />
• 31. Dezember 2006 45.182<br />
• 31. Dezember 2007 45.012<br />
• Dezember 2008 44.730<br />
Wappen<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> am 30. Juni 1994 durch das Innenministerium anerkannt und unter <strong>de</strong>r Nr. 27 <strong>de</strong>r Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert.<br />
Die Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar blasoniert das Wappen folgen<strong>de</strong>rmaßen: „Das Wappen zeigt in Silber über blauem Wellschildfuß, darin drei (2:1) silberne Fische, die oberen<br />
<strong>zu</strong>gewen<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r untere nach links gekehrt, eine nach links schwimmen<strong>de</strong> rote Kogge mit zwei silbernen Streifen längs <strong>de</strong>r Deckslinie, goldbeschlagenem Ru<strong>de</strong>r und gol<strong>de</strong>nem Bugspriet;<br />
am Mast eine gol<strong>de</strong>ne Tatzenkreuzspitze, darunter eine nach links wehen<strong>de</strong>, zweimal von Silber und Rot längsgestreifte Flagge, ein gol<strong>de</strong>ner Mastkorb und ein gol<strong>de</strong>ner Schild, dieser<br />
belegt mit einem herschauen<strong>de</strong>n schwarzen Stierkopf mit silbernen Hörnern, gol<strong>de</strong>ner Krone, geöffnetem Maul, ausgeschlagener roter Zunge und abgerissenem Halsfell, das bogenförmig<br />
ausgeschnitten ist und sieben Spitzen zeigt; auf <strong>de</strong>m Bug <strong>de</strong>r Kogge eine nach links gekehrte wi<strong>de</strong>rsehen<strong>de</strong> natürliche Möwe.“<br />
Weiterhin heißt es dort über das Signet: „Das frühere, ehemalige Wappen <strong>de</strong>r Stadt Wismar – gespalten, rechts in Gold ein halber herschauen<strong>de</strong>r schwarzer Stierkopf mit silbernen<br />
Hörnern, gol<strong>de</strong>ner Krone, geöffnetem Maul, ausgeschlagener roter Zunge und abgerissenem Halsfell am Spalt; links vier Querbän<strong>de</strong>r gleicher Breite von Silber und Rot – darf als<br />
Wappenzeichen (Signet) weiterverwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n“.[26]
Flagge<br />
Die Farben <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar sind laut gültiger Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bürgerschaft Silber (Weiß)-Rot. Die Flagge <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar zeigt die Stadtfarben abwechselnd in sechs<br />
Längsstreifen gleicher Breite.<br />
Ursprünglich war dies im Mittelalter die Seeflagge <strong>de</strong>r Wismarer Schiffe und die Stadtflagge hatte mit <strong>de</strong>n gleichen Farben jedoch nur vier Streifen, was sich auch im offiziellem Wappen<br />
<strong>de</strong>r Stadt wi<strong>de</strong>rspiegelt.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Wismar unterhält Städtepartnerschaften mit Kemi in Finnland seit 1959, Lübeck in Schleswig-Holstein seit 1987, Calais in Frankreich seit 1966, Aalborg in Dänemark seit 1961 und<br />
Kalmar in Schwe<strong>de</strong>n seit 2002. Außer<strong>de</strong>m besteht eine Städtefreundschaft mit Hal<strong>de</strong>n in Norwegen seit 1991.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich in <strong>de</strong>r Altstadt. Zu nennen sind <strong>de</strong>r Marktplatz (einer <strong>de</strong>r größten Nord<strong>de</strong>utschlands und exakt 100 mal 100 Meter groß) mit <strong>de</strong>m<br />
klassizistischen Rathaus aus <strong>de</strong>n Jahren 1817 bis 1819, die im Renaissancestil gehaltene Wismarer Wasserkunst und das bekannte Bürgerhaus Alter Schwe<strong>de</strong> sowie das<br />
Stadtgeschichtliche Museum <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar im Schabbellhaus.<br />
Eine Kuriosität ist die vom Markt abgehen<strong>de</strong>, „Tittentasterstraße“ [27] genannte Gasse, von <strong>de</strong>r gerüchtweise gemunkelt wird, sie habe ihre Bezeichnung daher, dass ihre Enge die<br />
namensgeben<strong>de</strong> Tätigkeit provoziere.<br />
In <strong>de</strong>r Umgebung <strong>de</strong>s Marktes verdienen die zahlreichen hervorragend sanierten Straßenzüge mit mittelalterlichen bis klassizistischen Giebelhäusern Beachtung. Hinter <strong>de</strong>m Rathaus am<br />
Rudolph-Karstadt-Platz in <strong>de</strong>r Fußgängerzone befin<strong>de</strong>t sich das Stammhaus <strong>de</strong>s Warenhauskonzerns Karstadt. Das Gebäu<strong>de</strong> in seiner heutigen Erscheinung stammt aus <strong>de</strong>m Jahr 1908,<br />
Umbau 1931. Sehenswert ist das historische Treppenhaus und das kleine Museum im Erdgeschoss.<br />
Bemerkenswert ist auch <strong>de</strong>r Fürstenhof aus <strong>de</strong>r Backsteinrenaissance, reich verziert mit Terrakotten aus <strong>de</strong>r Werkstatt <strong>de</strong>s Lübecker Künstlers Statius von Düren. Im Fürstenhof befin<strong>de</strong>t<br />
sich heute das örtliche Amtsgericht.<br />
Blickpunkte sind auch <strong>de</strong>r historische Alte Hafen mit <strong>de</strong>m Wassertor, <strong>de</strong>m letzten erhaltenen Stadttor Wismars und <strong>de</strong>r südlichen Ostseeküste, <strong>de</strong>m so genannten Gewölbe und <strong>de</strong>m<br />
Nachbau <strong>de</strong>r Poeler Kogge im Wismarer Hafen. Dort befin<strong>de</strong>t sich auch das Baumhaus mit zwei Repliken <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nköpfe, Wismars Wahrzeichen, vor <strong>de</strong>m Hauseingang. Ebenfalls <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n mittelalterlichen Zeugen <strong>de</strong>r Hansestadt gehört <strong>de</strong>r Alte Wasserturm, <strong>de</strong>r letzte erhaltene Wehrturm <strong>de</strong>r Stadtbefestigung, <strong>de</strong>r 1685 <strong>zu</strong>m Wasserturm ausgebaut wur<strong>de</strong>. Aus <strong>de</strong>m Jahr<br />
1897 stammt <strong>de</strong>r Wasserturm am Turnplatz, ein 28 Meter hoher, im neogotischen Stil errichteter Backsteinturm. Außerhalb <strong>de</strong>r Altstadt ist das Ensemble <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sgartenschau von 2002<br />
mit Aussichtsturm sehenswert, sowie <strong>de</strong>r Tierpark und das Technische Lan<strong>de</strong>smuseum.<br />
Als Weltkulturerbe steht die Hansestadt seit Mai 2002 <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Altstadt <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund unter <strong>de</strong>m beson<strong>de</strong>ren Schutz <strong>de</strong>r UNESCO.[28]<br />
Kirchen<br />
Weitere wichtige Sehenswürdigkeiten sind die Innenstadtkirchen als Zeugnisse <strong>de</strong>r Backsteingotik:<br />
Von <strong>de</strong>n drei Hauptkirchen (Nikolaikirche, Georgenkirche und Marienkirche) war am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs nur noch die Nikolaikirche weitgehend erhalten. Die an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n<br />
großen Stadtkirchen waren durch Fliegerbomben schwer beschädigt. Von St. Marien verblieb nach <strong>de</strong>r Sprengung <strong>de</strong>s Kirchenschiffs im Jahr 1960 nur <strong>de</strong>r markante Turm, in <strong>de</strong>m heute<br />
Filmvorführungen stattfin<strong>de</strong>n. St. Georgen wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung unter größter Anstrengung wie<strong>de</strong>r aufgebaut, im Mai 2010 wur<strong>de</strong> ein vorläufiger Abschluss <strong>de</strong>r<br />
Rekonstruktionsarbeiten mit einem Festakt gefeiert. Ein weiteres spätmittelalterliches sakrales Bauwerk ist die Heiligen-Geist-Kirche aus <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt.
Musik<br />
• Marienkirche bzw. Marienkirchturm. Das durch Luftminen am 14./15. April 1945 schwer beschädigte, aber durchaus <strong>zu</strong> retten<strong>de</strong> Kirchenschiff wur<strong>de</strong> 1960 auf Beschluss <strong>de</strong>r<br />
Stadtverordnetenversammlung wegen angeblich mangeln<strong>de</strong>r Standsicherheit gesprengt. Die Ziegel wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verwertung für Baumaterial zermalen. Der hohe Kirchturm konnte<br />
wegen seiner Be<strong>de</strong>utung als Seezeichen nicht beseitigt wer<strong>de</strong>n.<br />
• In <strong>de</strong>r Marienkirche gibt die Ausstellung Wege <strong>zu</strong>r Backsteingotik in Form eines knapp 15-minütigen Animationsfilms Auskunft darüber, wie <strong>zu</strong> früheren Zeiten Kirchen gebaut<br />
bzw. erweitert wur<strong>de</strong>n.<br />
• Nikolaikirche: Charakteristisches Merkmal ist das Kirchenschiff, das <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n höchsten Deutschlands gehört.<br />
• Georgenkirche: Sie war seit <strong>de</strong>m Luftangriff vom April 1945 eine Ruine und wird seit 1990 wie<strong>de</strong>r aufgebaut.<br />
• Heiligen-Geist-Kirche: Die gut erhaltene Kirche ist Hauptbau <strong>de</strong>s Heiligen-Geist-Hospitales in <strong>de</strong>r Lübschen Straße.<br />
• Laurentiuskirche: Die katholische Kirche wur<strong>de</strong> 1901/02 im neuromanischen Stil errichtet.<br />
• Neue Kirche: Sie wur<strong>de</strong> als evangelische Notkirche 1951 neben <strong>de</strong>r schwer bombenbeschädigten Marienkirche errichtet.<br />
Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind in Wismar an mehreren Spielstätten <strong>zu</strong> Gast. Neben <strong>de</strong>r Georgenkirche sind dies die Heiligen-Geist-Kirche und <strong>de</strong>r alte Hafen. Hier fan<strong>de</strong>n<br />
bisher Open-Air-Konzerte neben <strong>de</strong>n historischen Speichern statt.[29]<br />
In <strong>de</strong>n Kirchen Wismars ist die Wismarer Kantorei aktiv. Sie wur<strong>de</strong> 1975 gegrün<strong>de</strong>t und leistet Chorarbeit mit einem Erwachsenenchor, mehreren Gemein<strong>de</strong>chören, einem Jugendchor<br />
und <strong>de</strong>m Kin<strong>de</strong>rchor. Im evangelischen Kin<strong>de</strong>rgarten wird musikalischer. Ergänzend <strong>zu</strong>m Chor ist das Instrumentalensemble Collegium musicum in die Aufführungen einbezogen.[30]<br />
An <strong>de</strong>r Musikschule wur<strong>de</strong> 1996 die Bigband Wismar gegrün<strong>de</strong>t. Die Bandmitglie<strong>de</strong>r sind <strong>zu</strong>m Großteil Musikschüler, die jedoch oft von ehemaligen Mitglie<strong>de</strong>rn unterstützt wer<strong>de</strong>n. Zu<br />
<strong>de</strong>n jährlichen Höhepunkten zählen neben diversen Konzerten und Probenlagern unter an<strong>de</strong>rem auch <strong>de</strong>r internationale Neubran<strong>de</strong>nburger Jugendbigbandworkshop. Die Bigband hat an<br />
diversen Wettbewerben, wie <strong>de</strong>m Deutschen Orchesterwettbewerb, <strong>de</strong>m Skoda-Jazz-Cup Berlin und <strong>de</strong>m Jugend jazzt teilgenommen.<br />
Das CampusOpenAir Wismar fin<strong>de</strong>t seit <strong>de</strong>m Jahr 2000 in <strong>de</strong>r Hansestadt statt. Bands wie 2raumwohnung (2005), Blumentopf und Clueso (2006), Culcha Can<strong>de</strong>la und Dog Eat Dog<br />
(2007), Donots, Das Bo und Mia. (2008) sowie Fotos, Den<strong>de</strong>mann, Virginia Jetzt! und Thomas D. (2009) füllten bereits <strong>de</strong>n Wismarer Campus mit bis <strong>zu</strong> 8000 Gästen (2008). Am 25.<br />
September 2010, <strong>zu</strong>m 10. CampusOpenAir Wismar, traten The Boss Hoss, Samy Deluxe, Tele, The Sonic Boom Foundation und I'm Not A Band auf. Das Festival fin<strong>de</strong>t traditionell nach<br />
<strong>de</strong>r ersten Woche <strong>de</strong>s Wintersemesters (En<strong>de</strong> September) statt, wird komplett ehrenamtlich vom Allgemeiner Studieren<strong>de</strong>nausschuss <strong>de</strong>r Hochschule Wismar organisiert und gilt als eine<br />
<strong>de</strong>r größten regelmäßigen Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern. [31]<br />
Wirtschaft und Verkehr<br />
Wirtschaft<br />
Die Nordic Yards ist die mit Abstand größte Arbeitgeberin Wismars. Die Schiffsbauwerft beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter, einen Teil davon in einem <strong>de</strong>r größten überdachten<br />
Trockendocks Deutschlands, das mit 72 m Höhe und 395 m Länge erheblich das Stadtbild prägt.<br />
Im Stadtgebiet Haffeld (Wismar-Nord) besitzt die Hansestadt eines <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnsten Holzverarbeitungszentren Europas. Dort sind Klausner Nordic Timber / Holz Werke Nord, EGGER<br />
Holzwerkstoffe Wismar sowie <strong>de</strong>r Brettschichtholzhersteller Hüttemann Wismar angesie<strong>de</strong>lt. Auf <strong>de</strong>m Areal sind rund 1000 Arbeitsplätze entstan<strong>de</strong>n.<br />
Schon seit 2001 forscht, entwickelt und produziert die <strong>zu</strong>r Centrosolar-Gruppe gehören<strong>de</strong> SOLARA Sonnenstromfabrik Wismar im Bereich <strong>de</strong>r Photovoltaik. Zum Programm gehören<br />
sowohl PV-Netzverbundanlagen als auch PV-Inselsysteme.<br />
Im März 2008 wur<strong>de</strong> ein neues Fertigungswerk errichtet. Hier wer<strong>de</strong>n jährlich von rund 360 Mitarbeitern Solarmodule im Wert von 400 Millionen Euro hergestellt.<br />
In <strong>de</strong>r Stadt befin<strong>de</strong>t sich das Stammhaus von Karstadt. Im Jahr 1881 eröffnete Rudolph Karstadt hier sein erstes Tuchgeschäft.
Hafen<br />
Wismar besitzt einen Seehafen, <strong>de</strong>r bei bestimmten Nord-Windwetterlagen für die Region verhältnismäßig starke Wasserstandsschwankungen hat. Der Hafen wur<strong>de</strong> bereits 1211<br />
urkundlich erwähnt und hat Be<strong>de</strong>utung vor allem für Massengüter und massenhafte Stückgüter. Hauptgutarten sind Rund- und Schnittholz, Stahl und Schrott, Torf, Baustoffe und über die<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1990er Jahre komplett neu gebaute Massengutanlage Kali und Salz. Im Jahr 2008 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hafen von 1.300 Seeschiffen angelaufen, mit <strong>de</strong>nen ein Umschlag von 3,46<br />
Millionen Tonnen erfolgte.[32]<br />
Der historische Alte Hafen ist wirtschaftlich nicht von Be<strong>de</strong>utung; statt<strong>de</strong>ssen stellt er einen <strong>de</strong>r attraktivsten Orte Wismars dar. Er ist Heimathafen <strong>de</strong>r Rekonstruktion <strong>de</strong>r Poeler Kogge<br />
und Spielort <strong>de</strong>r Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Für Segler und Sportbootfahrer bietet Wismar eine gute Infrastruktur. Nah <strong>de</strong>m Stadtzentrum <strong>de</strong>r bereits genannte Alte Hafen mit für größere Yachten geeigneten Kaianlagen, <strong>de</strong>r<br />
Westhafen mit vielen Liegenplätzen für Boote aller Größenordnungen und <strong>de</strong>r südlich <strong>de</strong>s Überseehafens gelegene Wasserwan<strong>de</strong>rrastplatz. Nördlich <strong>de</strong>r MTW-Werft liegt <strong>de</strong>r wegen <strong>de</strong>s<br />
engen Fahrwassers und <strong>de</strong>s beschränkten Tiefgangs für kleinere Boote geeignete Segelhafen. Etwas außerhalb <strong>de</strong>s Stadtzentrums befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Yachthafen Wendorf im gleichnamigen<br />
Stadtteil.<br />
Verkehr<br />
Öffentlicher Nahverkehr<br />
Der Bahnhof Wismar liegt nordöstlich <strong>de</strong>r Altstadt. Er wird von zwei stündlich verkehren<strong>de</strong>n Regional-Express-Linien <strong>de</strong>r Deutschen Bahn AG angefahren.<br />
• RE 4: Wismar–Schwerin–Ludwigslust(–Wittenberge–Berlin–Luckenwal<strong>de</strong> -Jüterbog)<br />
• RE 8: Wismar–Bad Doberan–Rostock–Tessin<br />
In unmittelbarer Nähe <strong>zu</strong>m Bahnhof befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). Hier treffen sich alle Stadt- und Regionalbuslinien.<br />
Der Stadtbusverkehr wird vom stadteigenen Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb Wismar (EVB) – Linien A bis G – sowie vom privaten Regionalbusunternehmen Bus-Betriebe Wismar<br />
GmbH (BBW) – Linie 242 – erbracht. Zur Anwendung kommt <strong>de</strong>r Tarif für <strong>de</strong>n Stadtverkehr Wismar.<br />
An Werktagen (Montag bis Freitag) verkehren tagsüber folgen<strong>de</strong> Stadtbuslinien:<br />
• Linie A: Seebad Wendorf ↔ ZOB ↔ Bahnhof ↔ Lin<strong>de</strong>ngarten ↔ Fischkaten (alle 30 Minuten)<br />
• Linie B-D: Seebad Wendorf ↔ {Am Markt → Lin<strong>de</strong>ngarten → Bahnhof → ZOB} ↔ Frie<strong>de</strong>nshof ↔ Dammhusen (alle 30 Minuten)<br />
• Linie C: Frie<strong>de</strong>nshof ↔ ZOB ↔ Bahnhof ↔ Lin<strong>de</strong>ngarten ↔ Dargetzow (alle 60 Minuten)<br />
• Linie E: Frie<strong>de</strong>nshof ↔ ZOB ↔ Bahnhof ↔ Lin<strong>de</strong>ngarten ↔ Rothentor (alle 60 Minuten)<br />
• Linie F: Wei<strong>de</strong>ndammplatz → Hege<strong>de</strong> → Am Markt → Dahlberg → Wei<strong>de</strong>ndammplatz (alle 30 Minuten)<br />
• Linie G: Ostseeblick ↔ Wendorf ↔ Dammhusen ↔ Frie<strong>de</strong>nshof ↔ Lin<strong>de</strong>ngarten ↔ Bahnhof ↔ ZOB (alle 60 Minuten)<br />
• Linie 242: (Proseken ↔ Gägelow ↔) Ostseeblick ↔ Lin<strong>de</strong>ngarten ↔ Bahnhof ↔ Dargetzow ↔ Kritzow (alle 30 Minuten)<br />
Der Regionalbusverkehr wird von <strong>de</strong>n Unternehmen Bus-Betriebe Wismar GmbH (BBW), Mecklenburger Verkehrsbetriebe GmbH (mvb), sowie Grevesmühlener Busbetriebe GmbH<br />
(GBB) erbracht. Tariflich integriert sind diese in die Verkehrsgemeinschaft Westmecklenburg (VWM).<br />
Autobahn und Güterverkehr<br />
Wismar ist über die A 20 nach Rostock und nach Lübeck sowie über die A 14 nach Schwerin, die sich im Autobahnkreuz Wismar kreuzen, in das <strong>de</strong>utsche Autobahnnetz eingebun<strong>de</strong>n.
Der Hafen ist an das bun<strong>de</strong>sweite Eisenbahnnetz angeschlossen. Etwa 60 Prozent aller Güter wer<strong>de</strong>n per Eisenbahn an- o<strong>de</strong>r abtransportiert.<br />
Infrastruktur<br />
Allgemein<br />
• Die Stadtbibliothek <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar wird von einem För<strong>de</strong>rverein unterstützt. Sie führt eine Kin<strong>de</strong>rbibliothek und hat Angebote für Schulklassen sowie Projekte <strong>zu</strong>r<br />
Leseför<strong>de</strong>rung.<br />
• Das Stadtarchiv <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar kann als Gedächtnis <strong>de</strong>r Stadtverwaltung bis ins Mittelalter <strong>zu</strong>rückblicken. Wismarer Beiträge nennt sich die Schriftenreihe <strong>de</strong>s Archivs.<br />
Bildung<br />
Schulen<br />
• Vier Grundschulen<br />
• Regionale Schulen<br />
• Ostsee-Schule (Wendorf) mit einer Klasse <strong>de</strong>s Produktiven Lernens<br />
• Bertolt-Brecht-Schule (Frie<strong>de</strong>nshof)<br />
• Integrierte Gesamtschule (IGS) Johann Wolfgang von Goethe (ehemals Dominikanerkloster)(Altstadt)<br />
• Zwei För<strong>de</strong>rschulen<br />
• Zwei Privatschulen<br />
• Verbund <strong>de</strong>r fünf bestehen<strong>de</strong>n Berufsschulzentren mit integrierten Fachgymnasien für Wirtschaft und Metalltechnik<br />
• Die Musikschule<br />
Gymnasien<br />
Nach <strong>de</strong>r endgültigen Einglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Außenstelle (ehem. Helene-Weigel-Gymnasium) <strong>de</strong>s Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums <strong>zu</strong>m Haupthaus in <strong>de</strong>r Dahlmannstraße wird dies neben<br />
<strong>de</strong>m Geschwister-Scholl-Gymnasium (Große Stadtschule) weiter bestehen. Nach einigen Jahren rückläufiger Schülerzahlen in <strong>de</strong>n Einstiegsklassen war dieser Schritt notwendig<br />
gewor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r nun endgültig vollzogen wur<strong>de</strong>. Durch Schüler- und Lehrertransfers innerhalb <strong>de</strong>r Schulwochen kann eine größere Bandbreite an Kursen in <strong>de</strong>r Oberstufe geboten wer<strong>de</strong>n.<br />
Hochschule<br />
Eine <strong>de</strong>r wichtigsten Bildungseinrichtungen Wismars ist die Hochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design.<br />
Soziales<br />
• Altengerechtes Wohnen wird an vielen Standorten angeboten.<br />
• Das Städtisches Alten- und Pflegeheim mit 375 Plätze befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Störtebekerstraße 2.<br />
• Das Städtisches Alten- und Pflegeheim Wendorf ist in <strong>de</strong>r Rudolf-Breitscheid-Straße.<br />
• Soziale Einrichtungen bestehen durch<br />
• <strong>de</strong>n Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit <strong>de</strong>r Kontakt- und Informationsstelle,<br />
• die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit sozialen Diensten,
Sport<br />
• die Caritas Mecklenburg,<br />
• das Christliches Jugenddorfwerk Deutschland ,<br />
• das Deutsche Rote Kreuz (DRK) - Kreisverband Wismar,<br />
• <strong>de</strong>n Malteser Hilfsdienst,<br />
• <strong>de</strong>n Ökumenischer Kirchenla<strong>de</strong>n als Begegnungszentrum,<br />
• die Beratungsstelle <strong>de</strong>r katholischen Kirche,<br />
• die Volkssolidarität Stadtverband Wismar und<br />
• <strong>de</strong>n Weißen Ring als Hilfe für Kriminalitätsopfer.<br />
In Wismar gibt es zahlreiche Sportvereine. Der bekannteste Fußballverein ist <strong>de</strong>r FC Anker Wismar, <strong>de</strong>r aktuell in <strong>de</strong>r Oberliga Nord spielt. Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele im<br />
Kurt-Bürger-Stadion aus.<br />
Literatur<br />
Ältere Literatur<br />
• Dietrich Schrö<strong>de</strong>r (1670-1753): Kurze Beschreibung <strong>de</strong>r Stadt und Herrschaft Wismar - Was betrifft die weltliche Historie <strong>de</strong>rselben, mehrentheils aus allerhand schriftlichen<br />
Urkun<strong>de</strong>n, <strong>zu</strong>r Erläuterung <strong>de</strong>r Mecklenburg weltlichen Historie, <strong>de</strong>n Liebhabern mitgetheilt. 1858 (Onlineversion in <strong>de</strong>r Volltextbibliothek Lexikus)<br />
• Friedrich Crull: Die Rathslinien <strong>de</strong>r Stadt Wismar. Halle 1875, Nachdruck 2005, ISBN 3-487-12082-8 (Original in Digitale Bibliothek)<br />
• Wismar. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Bd. 16, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 695.<br />
• Friedrich Schlie: Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler <strong>de</strong>s Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin. II. Band: Die Amtsgerichtsbezirke Wismar, Grevesmühlen, Rehna,<br />
Ga<strong>de</strong>busch und Schwerin. Schwerin 1898, Neudruck Schwerin 1992, S. 1–221. ISBN 3-910179-06-1<br />
• Gustav Willgeroth: Bil<strong>de</strong>r aus Wismars Vergangenheit. Wismar 1903, Reprint Schwerin 1997, ISBN 3-932370-41-4<br />
• Friedrich Techen: Geschichte <strong>de</strong>r Seestadt Wismar. Wismar 1929<br />
• Rudolf Kleiminger: Das graue Mönchenkloster in Wismar. Ein Beitrag <strong>zu</strong>r Erschließung <strong>de</strong>r Bauweise <strong>de</strong>r Franziskaner in Mecklenburg, Eberhardtsche Hof- und<br />
Ratsbuchdruckerei, Wismar 1934<br />
• Rudolf Kleiminger: Das Schwarze Kloster in Seestadt Wismar. Ein Beitrag <strong>zu</strong>r Kultur- u. Baugeschichte d. norddt. Dominikanerklöster im Mittelalter, Neuer Filser-Verlag,<br />
München 1938<br />
Neuere Literatur<br />
• Rudolf Kleiminger: Das Heiligengeisthospital von Wismar in sieben Jahrhun<strong>de</strong>rten. Ein Beitrag <strong>zu</strong>r Wirtschaftsgeschichte <strong>de</strong>r Stadt, ihrer Höfe und Dörfer, Weimar 1962<br />
• Rudolf Kleiminger: Geschichte <strong>de</strong>r Großen Stadtschule <strong>zu</strong> Wismar von 1541-1945. Schmidt und Klaunig, Kiel 1991, ISBN 3-88312-087-1<br />
• Ingo Ulpts: Die Bettelor<strong>de</strong>n in Mecklenburg. Saxonia Franciscana 6. Werl 1995<br />
• Angela Pfotenhauer, Elmar Lixenfeld: Wismar und Stralsund – Welterbe. Monumente-Edition. Monumente-Publikation <strong>de</strong>r Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn 2004,<br />
ISBN 3-936942-55-2 (Paperback) o<strong>de</strong>r ISBN 3-936942-56-0 (Festeinband)<br />
• Carl Christian Wahrmann: Aufschwung und Nie<strong>de</strong>rgang. Die Entwicklung <strong>de</strong>s Wismarer Seehan<strong>de</strong>ls in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts (Kleine Stadtgeschichte 4). LIT<br />
Verlag. Berlin 2007. ISBN 978-3-8258-0098-7<br />
• Christine Decker: Wismar 1665. Eine Stadtgesellschaft im Spiegel <strong>de</strong>s Türkensteuerregisters. LIT Verlag für wissenschaftliche Literatur, Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London
Medien<br />
2006, ISBN 978-3-8258-9192-3<br />
Filme und Fernsehen<br />
• „Nosferatu, eine Symphonie <strong>de</strong>s Grauens“ – früher Vampirfilm gedreht von F. W. Murnau in Wismar, Rostock und Lübeck<br />
• „SOKO Wismar“ – Fernsehserie im ZDF<br />
• „Das Geheimnis meines Vaters“ – Deutschlands erste Kriminovela. Ausstrahlung in <strong>de</strong>r ARD<br />
• mehrfach „Polizeiruf 110“ <strong>de</strong>s NDR<br />
• „Die Versuchung“ - TV-Film mit Thekla Carola Wied, ARD 2004<br />
In Wismar gibt es mit wismar tv einen Stadtsen<strong>de</strong>r, in <strong>de</strong>m neben Ratgebersendungen, Berichten von Veranstaltungen in <strong>de</strong>r Stadt auch Werbesendungen produziert wer<strong>de</strong>n.<br />
Presse<br />
In Wismar erscheint die Ostsee-Zeitung mit einer Regionalausgabe. Daneben erscheinen mehrere kostenlose Anzeigenblätter. Da<strong>zu</strong> gehören <strong>de</strong>r "Markt", <strong>de</strong>r Ostsee Anzeiger (ehemals<br />
Wismarer Anzeiger), <strong>de</strong>r Blitz, die Wismar-Zeitung und <strong>de</strong>r Stadtanzeiger.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt - Bevölkerungsentwicklung <strong>de</strong>r Kreise und Gemein<strong>de</strong>n 2009 (PDF; 522 KB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ Kommunale Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar<br />
3. ↑ Paul Kühnel:Die slavischen Ortsnamen in Meklenburg in Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskun<strong>de</strong>:Jahrbücher <strong>de</strong>s Vereins für Mecklenburgische<br />
Geschichte und Altertumskun<strong>de</strong>. - Bd. 46 (1881), S. 159<br />
4. ↑ a b Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.-B. 88, Mecklenburgisches Lan<strong>de</strong>sarchiv, Schwerin, Kapitel 108<br />
5. ↑ Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch Lan<strong>de</strong>sarchiv Schwerin, Schwerin, S. 202<br />
6. ↑ MUB, Lan<strong>de</strong>sarchiv Schwerin, Schwerin, S. 88<br />
7. ↑ Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.-B., Band IV 239<br />
8. ↑ a b Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.-B. 362, Mecklenburgisches Lan<strong>de</strong>sarchiv, Schwerin<br />
9. ↑ a b Westphalen: Mon.ined IV , S. 763<br />
10.↑ Dr. Friedrich Techen: Pfingsblätter <strong>de</strong>s hansischen Geschichtsvereins, Blatt VI, S. 1-2, 1910<br />
11.↑ Friedrich Schlie:Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler <strong>de</strong>s Grossherzogthum Schwerin, Abschnitt:Die Stadt Wismar,Schwerin, 1898<br />
12.↑ Friedrich Schildt:Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Wismar von <strong>de</strong>r Gründung bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts,Wismar, 1872, S. 1-2<br />
13.↑ Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.-B. 88, Lan<strong>de</strong>sarchiv Schwerin<br />
14.↑ Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.-B., Band IV, Mecklenburgisches Lan<strong>de</strong>sarchiv, Schwerin, S. 239<br />
15.↑ Mecklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch: U.B. 202, Mecklenburgisches Lan<strong>de</strong>sarchiv, Schwerin<br />
16.↑ Nach <strong>de</strong>r Reimchronik <strong>de</strong>s Ernst von Kirchberg nach <strong>de</strong>r Gründung Rostocks und vor <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Borwins, also zwischen 1218 und Januar 1227.<br />
17.↑ Karl Pagel: Die Hanse, Georg Wester Verlag,Braunschweig, 1952, Seite 114
18.↑ Erneute Pestwellen erfassten Wismar 1376 und 1387.<br />
19.↑ Mennonitisches Lexikon, Band 4, Stichwort Wismar. 1967, S. 548-549.<br />
20.↑ J.A: Brandsma: Menno Simons von Witmarsum, Kapitel VII Aufenthalt in Wismar. J.G. Oncken Verlag Kassel, 1962.<br />
21.↑ Olaf Groehler: "Bombenkrieg gegen Deutschland". Aka<strong>de</strong>mie-Verlag, Berlin 1990. ISBN 3-05-000612-9. Seiten 433,437 und 449<br />
22.↑ Joachim Grehn: "Der Altar gehört mitten in die Georgenkirche". Frankfurter Allgemeine Zeitung (Leserbrief), 19. Februar 2009<br />
23.↑ www.xxx<br />
24.↑ Pressemitteilung , Homepage Gerd Zielenkiewitz, 13. Juni 2010.<br />
25.↑ Mandatsverteilung in <strong>de</strong>r Wismarer Bürgerschaft <strong>zu</strong>m Stichtag 8. Juni 2010<br />
26.↑ Vgl.: Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Hansestadt Wismar vom 18. Februar 1994<br />
27.↑ Straßenschild<br />
28.↑ Sammlung von Hausbiografien älterer Profanbauten <strong>de</strong>r Hochschule Wismar<br />
29.↑ www.festspiele-mv.<strong>de</strong> abgerufen am 17. Dezember 2009<br />
30.↑ Kantorei auf www.xxx<br />
31.↑ http://www.xxx<br />
32.↑ Vgl. Seehafen Wismar GmbH, Geschäftsentwicklung. Abgerufen am 3. Mai 2009.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Wismarer Wappen<br />
Die Hansestadt Wismar nutzt zwei verschie<strong>de</strong>ne Wappen. Eines, mit <strong>de</strong>m Schiff, als das offizielle Wappen, welches das einzige ist, welches <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt führt, das an<strong>de</strong>re, mit <strong>de</strong>m<br />
Stierkopf, eigentlich ein älteres Wappen, als Signet, welches nicht für <strong>de</strong>n offiziellen Gebrauch bestimmt ist, dafür aber von je<strong>de</strong>m verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n darf.<br />
Geschichte<br />
Das älteste Siegel <strong>de</strong>r Stadt, von 1250, zeigt bereits die Kogge und einen Schild mit Stierkopf am Mast. Das Schiff weist auf die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>r hanseatischen Hafenstadt, die<br />
Fische darunter auf die <strong>de</strong>s Fischfangs. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Möwe, welche nicht gleich, erst im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts auf <strong>de</strong>m Siegel erschien, ist nicht überliefert. Der Schild am Mast weist<br />
auf das Herzogtum Mecklenburg, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m die Stadt bereits früh gehörte.
Bis 1918 war das Wappen <strong>de</strong>r Stadt das Kleine Wappen mit <strong>de</strong>m Stierkopf und <strong>de</strong>n rot-weißen Streifen von <strong>de</strong>r Flagge Wismars. Ab 1918 wur<strong>de</strong> das alte Siegel als Wappen geführt, in<br />
diesem Fall mit blauem Feld, welches ab 1995 silber ist.<br />
Literatur<br />
Georg Braun (Hrsg.), Frans Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum. Köln 1572–1612.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Frankreich<br />
Frankreich (amtlich République française, <strong>de</strong>utsch Französische Republik; Kurzform<br />
franz.: France [fʀ ̃s]) ɑ ist ein <strong>de</strong>mokratischer, zentralistischer Einheitsstaat im Westen<br />
Europas. In Europa grenzt es an Belgien, Luxemburg, Deutschland, die Schweiz, Italien, Monaco, Spanien, Andorra, an die Nordsee, an <strong>de</strong>n Atlantik mit <strong>de</strong>m Ärmelkanal und an das<br />
Mittelmeer. Neben <strong>de</strong>m Territorium in Europa gehören <strong>zu</strong> Frankreich Überseegebiete in <strong>de</strong>r Karibik (u. a. Saint-Martin, das eine Landgrenze mit <strong>de</strong>m nie<strong>de</strong>rländischen Sint Maarten<br />
aufweist), Südamerika (Französisch-Guayana, das Landgrenzen <strong>zu</strong> Brasilien und Suriname hat), vor <strong>de</strong>r Küste Nordamerikas, im Indischen Ozean und in Ozeanien. Ferner beansprucht<br />
Frankreich einen Teil <strong>de</strong>r Antarktis. Frankreich ist ein Mitglied <strong>de</strong>r EU.<br />
Geographie<br />
Insgesamt hat das „französische Mutterland“ in Europa, das aufgrund seiner Form auch als l’Hexagone (Sechseck) bezeichnet wird, eine Fläche von 547.026 km². Frankreich hat<br />
abgesehen vom Mittelmeer auch Meeresküsten im Nor<strong>de</strong>n und Westen, das Landschaftsbild prägen überwiegend Ebenen o<strong>de</strong>r sanfte Hügel. In <strong>de</strong>r Südosthälfte ist das Land gebirgig,<br />
Hauptgebirge sind die Pyrenäen, das Zentralmassiv, die Alpen sowie die Vogesen im Osten. Der höchste Berg Frankreichs und <strong>de</strong>r Alpen ist <strong>de</strong>r Mont Blanc (4.810 Meter).<br />
Die mit Abstand wichtigste und größte Stadt in Frankreich ist die Hauptstadt Paris mit rund zwölf Millionen Einwohnern in <strong>de</strong>r Agglomeration (Region Île-<strong>de</strong>-France). Die Großräume<br />
um Marseille, Lille und Lyon haben ebenfalls mehr als eine Million Einwohner.<br />
Am 1. Januar 2006 waren die größten Städte <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s nach <strong>de</strong>n Erhebungen <strong>de</strong>s rollieren<strong>de</strong>n Zensus, einer Erhebung mit rotieren<strong>de</strong>n Stichproben (in <strong>de</strong>r rechten Spalte <strong>de</strong>r Großraum):<br />
• Platz Name Stadt (Ew.) Großraum (Ew.)<br />
• 1. Paris 2.181.371 10.142.977<br />
• 2. Marseille 839.043 1.418.481<br />
• 3. Lyon 472.305 1.417.463<br />
• 4. Toulouse 437.715 850.873<br />
• 5. Nizza (frz. Nice) 347.060 940.017
• 6. Nantes 282.853 568.743<br />
• 7. Straßburg (frz. Strasbourg) 272.975 638.370<br />
• 8. Montpellier 251.634<br />
• 9. Bor<strong>de</strong>aux 232.260 803.117<br />
• 10. Lille 226.014 1.016.205<br />
Bevölkerung<br />
Bevölkerungsentwicklung<br />
Die Bevölkerung Frankreichs wur<strong>de</strong> für 1750 auf etwa 25 Millionen geschätzt. Damit war es mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Westeuropas. Bis 1850 stieg die Einwohnerzahl<br />
weiter bis auf 37 Millionen, danach trat eine Stagnation <strong>de</strong>s Wachstums ein.[5] Die Ursache hierfür waren das damals verbreitete I<strong>de</strong>al einer kin<strong>de</strong>rarmen Familie und die I<strong>de</strong>en <strong>de</strong>s<br />
Malthusianismus.[6] So wuchs die Einwohnerzahl in 100 Jahren nur um drei Millionen: 1945 hatte Frankreich, trotz starker Zuwan<strong>de</strong>rung, nur etwa 40 Millionen Einwohner. Diese<br />
Bevölkerungsstagnation wird als eine <strong>de</strong>r Ursachen für die relative Rückständigkeit Frankreichs während <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Weltkriege gesehen.[6] Für das Jahr 1990 wur<strong>de</strong>n 56,6 Millionen<br />
Einwohner ermittelt, für <strong>de</strong>n 1. Januar 2010 wur<strong>de</strong> die Bevölkerung einschließlich <strong>de</strong>r Menschen in <strong>de</strong>n Überseegebieten auf 64,7 Millionen geschätzt.[2] Davon entfielen 62,8 Millionen<br />
auf die Métropole.[3]<br />
Nach Deutschland nimmt Frankreich in <strong>de</strong>r EU <strong>de</strong>n zweiten Platz bei <strong>de</strong>r Bevölkerungszahl ein; weltweit liegt es auf Platz 20. Innerhalb <strong>de</strong>r EU hat Frankreich einen Bevölkerungsanteil<br />
von 13 %.[7]<br />
Die Bevölkerung wuchs im Jahr 2009 um 346.000 Personen o<strong>de</strong>r 0,5 Prozent. Das Wachstum verlangsamte sich leicht gegenüber <strong>de</strong>n Vorjahren (2006: 0,6 %, 2007 und 2008: 0,6 %). Die<br />
Geburtenbilanz <strong>de</strong>s Jahres 2009 war positiv: es wur<strong>de</strong>n 275.000 Menschen mehr geboren als starben; die Wan<strong>de</strong>rungsbilanz ist ebenfalls positiv: es wan<strong>de</strong>rten 71.000 Menschen mehr <strong>zu</strong><br />
als aus.[7] Die französische Bevölkerung wird im Durchschnitt älter: Der Anteil <strong>de</strong>r Unter-20-Jährigen ist zwischen 2000 und 2010 von 25,8 % auf 24,7 % gesunken, gleichzeitig nahm<br />
<strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Menschen über 65 von 15,8 % auf 16,6 % <strong>zu</strong>.[7]<br />
2009 wur<strong>de</strong>n 256.000 Ehen geschlossen, nach<strong>de</strong>m es zehn Jahre <strong>zu</strong>vor noch mehr als 294.000 waren. Dafür wählten mehr Franzosen <strong>de</strong>n Zivilen Solidaritätspakt als Form <strong>de</strong>s<br />
Zusammenlebens. Diese Pacs genannte Partnerschaft wur<strong>de</strong> 1999 eingeführt; 2009 wur<strong>de</strong>n 175.000 Pacs geschlossen.[7] Das Durchschnittsalter <strong>de</strong>r ersten Ehe lag 2008 für Männer bei<br />
31,6 Jahren und für Frauen bei 29,7 Jahren. Es stieg seit 1999 um fast 2 Jahre.[7] Die Fruchtbarkeitsrate in Frankreich liegt mit 2,0 Kin<strong>de</strong>rn pro Frau (2008) europaweit an dritter Stelle<br />
nach Irland und Island;[8] sie ist jedoch von 3 Kin<strong>de</strong>rn pro Frau in <strong>de</strong>n 1960er Jahren gesunken.[9] Die Kin<strong>de</strong>rsterblichkeit 2009 betrug 3,8 ‰ nach 4,4 ‰ im Jahr 1999.[7]<br />
Die Lebenserwartung, die um 1750 bei knapp 30 Jahren gelegen war, betrug 1987 72 Jahre für Männer und 80 Jahre für Frauen[10]. Bis 2008 stieg sie auf 84 Jahre für Frauen und 78<br />
Jahre für Männer.[7]<br />
Ausländische Bevölkerung<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s langsamen Bevölkerungswachstums kannte Frankreich bereits in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts das Problem <strong>de</strong>s Arbeitskräftemangels. Für die Industrialisierung kamen<br />
<strong>de</strong>shalb Gastarbeiter aus <strong>de</strong>n Nachbarlän<strong>de</strong>rn (Italiener, Polen, Deutsche, Spanier, Belgier) nach Frankreich. Ab 1880 lebten und arbeiteten somit etwa 1 Million Auslän<strong>de</strong>r in Frankreich;<br />
sie stellten 7 bis 8 Prozent <strong>de</strong>r Erwerbstätigen.[11] Das Phänomen einer Massenauswan<strong>de</strong>rung, das gleichzeitig in Deutschland herrschte, kannte Frankreich nicht. Während <strong>de</strong>s Ersten<br />
Weltkrieges waren etwa 3 % <strong>de</strong>r Bevölkerung Frankreichs Auslän<strong>de</strong>r, es kam <strong>zu</strong> ersten auslän<strong>de</strong>rfeindlichen Ten<strong>de</strong>nzen.[11] Bis 1931 wuchs <strong>de</strong>r Auslän<strong>de</strong>ranteil auf 6,6 %; Frankreich<br />
behielt bis 1974 eine sehr liberale Einwan<strong>de</strong>rungspolitik bei. Der Anteil <strong>de</strong>r ausländischen Wohnbevölkerung 2006 betrug 5,8 %, da<strong>zu</strong> kommen 4,3 % Français par acquisition, also<br />
Menschen, die im Ausland geboren sind und die französische Staatsbürgerschaft bekommen haben.[12]<br />
Starke Verschiebungen hat es bei <strong>de</strong>n Herkunftslän<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Auslän<strong>de</strong>r in Frankreich gegeben. Europäer, vor allem Italiener und Polen, machten 1931 mehr als 90 % <strong>de</strong>r ausländischen<br />
Bevölkerung aus.[11] Dieser Anteil lag in <strong>de</strong>n 1970er Jahren nur noch bei etwa 60 %, <strong>de</strong>n stärksten Anteil stellten nun die Portugiesen.[11] Heute sind die meisten Auslän<strong>de</strong>r in
Frankreich nordafrikanischen Ursprunges (Algerier, Marokkaner, Tunesier), gefolgt von Sü<strong>de</strong>uropäern (Portugiesen, Italiener, Spanier).[13] Die höchste Konzentration von ausländischer<br />
Bevölkerung fin<strong>de</strong>t sich im Südosten Frankreich sowie im Großraum Paris.[13]<br />
Bildungswesen<br />
Die französische Verfassung <strong>de</strong>finiert, dass <strong>de</strong>r Zugang <strong>zu</strong> Bildung, Ausbildung und Kultur für alle Bürger gleich <strong>zu</strong> sein hat und dass das Unterhalten eines unentgeltlichen und<br />
laizistischen öffentlichen Schulwesens Aufgabe <strong>de</strong>s Staates ist. Demnach ist das Bildungssystem Frankreichs zentralistisch organisiert, die verschie<strong>de</strong>nen Gebietskörperschaften müssen<br />
jedoch die Infrastruktur bereitstellen. Es koexistieren private und öffentliche Einrichtungen, wobei die größtenteils katholischen Privatschulen in <strong>de</strong>r Vergangenheit mehrmals Gegenstand<br />
intensiver politischer Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng waren. Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Schulsystemen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschsprachigen Län<strong>de</strong>r liegt in Frankreich mehr Schwerpunkt auf Auslese und Bildung von<br />
Eliten, bzw. Ausbildung über Bildung. Seit 1967 herrscht Schulpflicht bis <strong>zu</strong>m 16. Lebensjahr.[14]<br />
Der Kin<strong>de</strong>rgarten heißt in Frankreich École maternelle und bietet Vorschulerziehung für Kin<strong>de</strong>r ab zwei Jahren an. Er wird von einem hohen Prozentsatz <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r besucht. Die Betreuer<br />
in <strong>de</strong>n maternelles haben eine Lehrerausbildung. Die École élémentaire ist die Grundschule und dauert fünf Jahre, nach <strong>de</strong>ren Abschluss die Kin<strong>de</strong>r das Collège besuchen, welches<br />
einheitlich ist, vier Jahre dauert und welches man mit <strong>de</strong>m Brevet <strong>de</strong>s collèges abschließt.<br />
Hiernach hat <strong>de</strong>r Jugendliche mehrere Möglichkeiten. Er kann in eine berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Schule eintreten, die er mit <strong>de</strong>m Certificat d'aptitu<strong>de</strong> professionelle abschließt; ein duales<br />
Ausbildungssystem wie in Deutschland ist aber sehr wenig verbreitet. Das Lycée entspricht in etwa <strong>de</strong>m Gymnasium. Es führt nach 12 Schuljahren <strong>zu</strong>m baccalauréat, man unterschei<strong>de</strong>t<br />
mehrere Schulzweige wie naturwissenschaftlich, wirtschaftlich o<strong>de</strong>r literarisch. Wer ein lycée professionnel o<strong>de</strong>r ein Centre <strong>de</strong> formation d'apprentis besucht, kann dies nach 13<br />
Schuljahren mit einem baccalauréat professionnel abschließen.<br />
Die aka<strong>de</strong>mische Bildung wird von <strong>de</strong>r Koexistenz <strong>de</strong>r Gran<strong>de</strong>s écoles und <strong>de</strong>r Universitäten geprägt. Die Gran<strong>de</strong>s écoles dienen <strong>de</strong>r Ausbildung von Eliten für Wirtschaft und<br />
Verwaltung, haben jedoch nur wenige Forschung. Man kann sie meist erst nach <strong>de</strong>m Besuch <strong>de</strong>r classe préparatoire besuchen, die in <strong>de</strong>r Regel von Lycées angeboten wird. Die Gran<strong>de</strong>s<br />
écoles haben gegenüber <strong>de</strong>n Universitäten Frankreichs eine höhere Reputation, haben niedrige Stu<strong>de</strong>ntenzahlen und hohe persönliche Betreuung, jedoch ist eine Promotion hier nicht<br />
möglich. Zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r Gran<strong>de</strong>s écoles gehören die École Polytechnique, die École Normale Supérieure, die École nationale d’administration und die École Centrale Paris. Im<br />
Zuge <strong>de</strong>r europaweiten Harmonisierung <strong>de</strong>r Studienabschlüsse im Rahmen <strong>de</strong>s Bologna-Prozess wird auch an französischen Hochschulen das LMD-System eingeführt. LMD be<strong>de</strong>utet,<br />
dass nacheinan<strong>de</strong>r die Licence bzw. Bachelor (nach 3 Jahren), <strong>de</strong>r Master (nach 5 Jahren) und das Doktorat (nach 8 Jahren) erworben wer<strong>de</strong>n können. Die traditionellen nationalen<br />
Diplome (DEUG, Licence, Maîtrise, DEA und DESS) sollen im Rahmen dieses Prozesses entfallen. En<strong>de</strong> 2009 studierten rund 2,25 Millionen Stu<strong>de</strong>ntinnen und Stu<strong>de</strong>nten an<br />
französischen Hochschulen.[15]<br />
Sprachen<br />
Die französische Sprache entwickelte sich aus <strong>de</strong>m francien, das im Mittelalter in <strong>de</strong>r heutigen Region Île-<strong>de</strong>-France gesprochen wur<strong>de</strong>. Es verbreitete sich in <strong>de</strong>m Maße, wie die<br />
französischen Könige ihr Herrschaftsgebiet aus<strong>de</strong>hnten. Bereits 1539 bestimmte König Franz I., dass die französische Sprache die einzige Sprache seines Königreiches sein solle.<br />
Trotz<strong>de</strong>m sprach im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt nur etwa die Hälfte <strong>de</strong>r Untertanen <strong>de</strong>r französischen Könige französisch.[16] Nach <strong>de</strong>r Revolution wur<strong>de</strong>n die Regionalsprachen aktiv bekämpft; erst<br />
im Jahre 1951 erlaubte die Loi Deixonne Unterricht in Regionalsprachen.[17] Auch heute legt Artikel 2 <strong>de</strong>r französischen Verfassung von 1958 fest, dass die französische Sprache die<br />
alleinige Amtssprache Frankreichs ist. Sie ist nicht nur die in Frankreich allgemein gesprochene Sprache, sie ist auch Trägerin <strong>de</strong>r französischen Kultur in <strong>de</strong>r Welt. Die in Frankreich<br />
gesprochenen Regionalsprachen drohen aufgrund interner Wan<strong>de</strong>rungen und <strong>de</strong>r fast ausschließlichen Verwendung <strong>de</strong>r französischen Sprache in <strong>de</strong>n elektronischen Medien aus<strong>zu</strong>sterben.<br />
Frankreich hat die Europäische Charta <strong>de</strong>r Regional- o<strong>de</strong>r Min<strong>de</strong>rheitensprachen zwar unterschrieben, jedoch nicht ratifiziert. Der Grund dafür liegt, dass Teile <strong>de</strong>r Charta mit <strong>de</strong>r<br />
französischen Verfassung nicht vereinbar sind. Seit 2008 erwähnt die Verfassung in Artikel 75 die Regionalsprachen als Kulturerbe Frankreichs.[18]<br />
Regionalsprachen, die in Frankreich gesprochen wer<strong>de</strong>n, sind:<br />
• die romanischen Oïl-Sprachen in Nordfrankreich, die teilweise als französische Dialekte angesehen wer<strong>de</strong>n, wie Picardisch, Normannisch, Gallo, Poitevin-Saintongeais,<br />
Wallonisch und Champenois.
• das Franko-Provenzalische im französischen und (west-)schweizerischen Alpen- und Juraraum<br />
• Okzitanisch in Südfrankreich<br />
• Katalanisch in Département Pyrénées-Orientales<br />
• Elsässisch und Lothringisch im Nordosten Frankreichs<br />
• Baskisch und seine Dialekte im äußersten Südwesten<br />
• Bretonisch im Nordwesten<br />
• Provenzalisch im Südosten<br />
• Korsisch auf Korsika<br />
• Flämisch im Nor<strong>de</strong>n<br />
Weiterhin wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Überseebesit<strong>zu</strong>ngen verschie<strong>de</strong>nste Sprachen gesprochen wie Kreolsprachen, Polynesische Sprachen o<strong>de</strong>r Kanak-Sprachen.<br />
Französisch ist Arbeitssprache bei <strong>de</strong>r UNO, <strong>de</strong>r OSZE, <strong>de</strong>r Europäischen Kommission und <strong>de</strong>r Afrikanischen Union. Um die französische Sprache vor <strong>de</strong>r Vereinnahmung durch<br />
Anglizismen <strong>zu</strong> schützen, wur<strong>de</strong> 1994 die Loi Toubon verabschie<strong>de</strong>t. Mit <strong>de</strong>m Durchführungs<strong>de</strong>kret von 1996 wur<strong>de</strong> ein Mechanismus <strong>zu</strong>r Einführung neuer Wörter festgelegt, <strong>de</strong>r von<br />
<strong>de</strong>r Délégation générale à la langue française et aux langues <strong>de</strong> France und <strong>de</strong>r Commission générale <strong>de</strong> terminologie et <strong>de</strong> néologie gesteuert wird. Dieses Dekret verlangt, dass die<br />
französischen Wörter, die in <strong>de</strong>r Amtszeitung und im Wörterbuch FranceTerme veröffentlicht wer<strong>de</strong>n, von öffentlichen Stellen verpflichtend <strong>zu</strong> gebrauchen sind.<br />
Die Einwan<strong>de</strong>rer verschie<strong>de</strong>nster Nationen, vor allem aus Portugal, Osteuropa, <strong>de</strong>m Maghreb und <strong>de</strong>m restlichen Afrika haben ihre Sprachen mitgebracht. Im Unterschied <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
traditionellen Sprachen konzentrieren sich diese Sprechergemein<strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n großen Städten, sind aber keinem genau abgrenzbarem geografischen Gebiet <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen.<br />
Religionen<br />
Frankreich ist offiziell ein laizistischer Staat, das heißt, Staat und Religionsgemeinschaften sind vollkommen voneinan<strong>de</strong>r getrennt. Da von staatlicher Seite keine Daten über die<br />
Religions<strong>zu</strong>gehörigkeit <strong>de</strong>r Einwohner erhoben wer<strong>de</strong>n, beruhen alle Angaben über die konfessionelle Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bevölkerung auf Schät<strong>zu</strong>ngen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Angaben <strong>de</strong>r<br />
Religionsgemeinschaften selbst und weichen <strong>de</strong>shalb oft erheblich voneinan<strong>de</strong>r ab, weshalb auch die folgen<strong>de</strong>n Zahlen mit Vorsicht <strong>zu</strong> behan<strong>de</strong>ln sind. In einer Umfrage von Le Mon<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s religions bezeichneten sich 51 % <strong>de</strong>r Franzosen als katholisch, 31 % erklärten keiner Religion an<strong>zu</strong>gehören und etwa 9 % gaben an Muslime <strong>zu</strong> sein. 3 % bezeichneten sich als<br />
Protestanten und 1 % als Ju<strong>de</strong>n. Dies entspricht auf die Bevölkerungszahl hochgerechnet 32 Millionen Katholiken, 5,7 Millionen Muslimen, 1,9 Millionen Protestanten und 600.000<br />
Ju<strong>de</strong>n sowie 20 Millionen Konfessionslosen. 6 % machten an<strong>de</strong>re o<strong>de</strong>r keine Angaben.<br />
Historisch war Frankreich lange Zeit ein katholisch dominierter Staat. Seit Ludwig XI. († 1483) trugen die französischen Könige mit Einverständnis <strong>de</strong>s Papstes <strong>de</strong>n Titel eines roi très<br />
chrétien (allerchristlichsten Königs). In <strong>de</strong>r Reformationszeit blieb Frankreich immer mehrheitlich katholisch, auch wenn es starke protestantische Min<strong>de</strong>rheiten (Hugenotten) gab. Diese<br />
mussten aber spätestens nach <strong>de</strong>r Bartholomäusnacht 1572 die Hoffnung auf ein protestantisches Frankreich aufgeben. Als <strong>de</strong>r Protestant Heinrich von Navarra Thronerbe Frankreichs<br />
wur<strong>de</strong> trat er <strong>zu</strong>m katholischen Glauben über (Paris vaut bien une messe - Paris ist eine Messe wert !), garantierte aber gleichzeitig im Edikt von Nantes 1598 <strong>de</strong>n Protestanten<br />
Son<strong>de</strong>rrechte und insbeson<strong>de</strong>re Religionsfreiheit. Das Edikt von Nantes wur<strong>de</strong> 1685 unter Ludwig XIV. wie<strong>de</strong>r aufgehoben, was trotz schwerster Strafandrohungen <strong>zu</strong> einer Massenflucht<br />
<strong>de</strong>r Hugenotten ins benachbarte protestantische Ausland führte. Erst kurz vor <strong>de</strong>r Französischen Revolution erhielten die Protestanten eine begrenzte Glaubensfreiheit <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n. Die<br />
französische Revolution hob dann alle Beschränkungen <strong>de</strong>r Glaubensfreiheit auf. Es kam in <strong>de</strong>n Jahren nach <strong>de</strong>r Revolution in <strong>de</strong>r Ersten Französischen Republik <strong>zu</strong> einer kurzen Phase<br />
einer heftigen Kirchenfeindlichkeit, da die katholische Kirche als Vertreterin <strong>de</strong>s ancien régime (alten Regimes) gesehen wur<strong>de</strong>. Nicht nur die Privilegien <strong>de</strong>r Kirche, son<strong>de</strong>rn sogar <strong>de</strong>r<br />
christliche Kalen<strong>de</strong>r und Gottesdienst wur<strong>de</strong>n abgeschafft. Unter Napoleon Bonaparte kam es mit <strong>de</strong>m Konkordat von 1801 aber wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einem Ausgleich zwischen katholischer Kirche<br />
und Staat. Unter <strong>de</strong>r bourbonischen Restauration nach 1815 gewannen die katholisch-monarchistische I<strong>de</strong>en wie<strong>de</strong>r die Oberhand: So wur<strong>de</strong>n die 1823 <strong>zu</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>r liberalen<br />
Revolution in Spanien einfallen<strong>de</strong>n bourbonischen Truppen als die „100.000 Söhne <strong>de</strong>s heiligen Ludwig“ bezeichnet, die Jesuitische Mission in Übersee wur<strong>de</strong> geför<strong>de</strong>rt. In <strong>de</strong>r Dritten<br />
Republik ergab sich erneut ein Konflikt zwischen Kirche und Staat, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>m am 9. Dezember 1905 verabschie<strong>de</strong>ten Gesetz <strong>zu</strong>r Trennung von Kirche und Staat mün<strong>de</strong>te, in <strong>de</strong>m die<br />
strikte Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben wur<strong>de</strong>.[19]
Die jüdische Gemeinschaft in Frankreich hat eine wechselhafte Geschichte. Seit <strong>de</strong>r Römerzeit lebten Ju<strong>de</strong>n in Frankreich. Sie wur<strong>de</strong>n jedoch in zwei Wellen 1306 unter Philipp IV. und<br />
1394 unter Karl VI. vollständig <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s verwiesen. Über viele Jahrhun<strong>de</strong>rte gab es danach kaum ein jüdisches Leben in Frankreich bis die Französische Revolution <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n die<br />
bürgerliche Gleichberechtigung gewährte. Trotz<strong>de</strong>m blieb Frankreich bis Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein Land mit geringer jüdischer Bevölkerung. Nach <strong>de</strong>m Ersten, aber vor allem<br />
nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg setzte eine starke Zuwan<strong>de</strong>rung aus <strong>de</strong>n ehemaligen Kolonien sowie aus Osteuropa ein, so dass Frankreich heute das Land Europas mit <strong>de</strong>r größten jüdischen<br />
Bevölkerungsgruppe darstellt.<br />
Ebenfalls seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges ist eine starke Zunahme <strong>de</strong>s Anteils an Muslimen <strong>zu</strong> verzeichnen, die auf Zuwan<strong>de</strong>rung aus <strong>de</strong>n ehemaligen Kolonien <strong>zu</strong>rückgeht.<br />
Nur noch 58 % <strong>de</strong>r Franzosen glauben an einen Gott; <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r jungen Menschen, die an ein Leben nach <strong>de</strong>m Tod glauben, ist aber seit 1981 von 31 % auf 42 % gestiegen.[20] Nach<br />
einer Studie <strong>de</strong>s PewResearch Center bezeichnet sich nur eine Min<strong>de</strong>rheit von 27 % <strong>de</strong>r Franzosen als „religiös“ und 10 % als „sehr religiös“. Bei<strong>de</strong>s sind weltweit die niedrigsten Werte.<br />
[21]<br />
Geschichte<br />
Urgeschichte bis Frühmittelalter<br />
Es wird geschätzt, dass das heutige Frankreich vor etwa 480.000 Jahren besie<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Aus <strong>de</strong>r Altsteinzeit sind in <strong>de</strong>r Höhle von Lascaux be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Felsmalereien erhalten geblieben.<br />
Ab 600 v.Chr. grün<strong>de</strong>ten phönizische und griechische Händler Stützpunkte an <strong>de</strong>r Mittelmeerküste, während Kelten vom Nordwesten her das Land besie<strong>de</strong>ln, das später von <strong>de</strong>n Römern<br />
als Gallien bezeichnet wur<strong>de</strong>. Die keltischen Gallier mit ihrer druidischen Religion wer<strong>de</strong>n heute häufig als Vorfahren <strong>de</strong>r Franzosen gesehen, und Vercingetorix häufig <strong>zu</strong>m ersten<br />
Nationalhel<strong>de</strong>n Frankreichs verklärt, wenngleich kaum gallische Elemente in <strong>de</strong>r französischen Kultur verblieben sind.<br />
Zwischen 58 und 51 v. Chr. eroberte Caesar in <strong>de</strong>n Gallischen Kriegen die Region; es wur<strong>de</strong>n die römischen Provinzen Gallia, Gallia Narbonensis, Gallia Belgica und Aquitanien<br />
eingerichtet. In einer Perio<strong>de</strong> von Prosperität und Frie<strong>de</strong>n übernahmen diese Provinzen römische Fortschritte in Technik, Landwirtschaft und Rechtssprechung; große, elegante Städte<br />
entstan<strong>de</strong>n. Ab <strong>de</strong>m 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt wan<strong>de</strong>rten vermehrt germanische Völker nach Gallien ein, diese grün<strong>de</strong>ten nach <strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>s römischen Reiches 476 eigene Reiche. Nach einer<br />
vorübergehen<strong>de</strong>n Dominanz <strong>de</strong>r Westgoten grün<strong>de</strong>ten die Franken unter Chlodwig I. das Reich <strong>de</strong>r Merowinger. Sie übernehmen zahlreiche römische Werte und Einrichtungen, u.a. <strong>de</strong>n<br />
Katholizismus (496). Im Jahre 732 gelang es ihnen, in <strong>de</strong>r Schlacht von Tours und Poitiers <strong>de</strong>r Islamischen Expansion Einhalt <strong>zu</strong> gebieten. Die Karolinger folgen <strong>de</strong>n Merowingern nach,<br />
Karl <strong>de</strong>r Große wur<strong>de</strong> 800 <strong>zu</strong>m Kaiser gekrönt, 843 wur<strong>de</strong> das Frankenreich mit <strong>de</strong>m Vertrag von Verdun unter seinen Enkeln aufgeteilt; <strong>de</strong>ssen westlicher Teil entsprach in etwa <strong>de</strong>m<br />
heutigen Frankreich.<br />
Mittelalter<br />
Das französische Mittelalter war geprägt durch <strong>de</strong>n Aufstieg <strong>de</strong>s Königtums im stetigen Kampfe gegen die Unabhängigkeit <strong>de</strong>s Hocha<strong>de</strong>ls und die weltliche Gewalt <strong>de</strong>r Klöster und<br />
Or<strong>de</strong>nsgemeinschaften. Die Kapetinger setzten, ausgehend von <strong>de</strong>r heutigen Île-<strong>de</strong>-France, die I<strong>de</strong>e von einem Einheitsstaat durch, die Teilnahme an verschie<strong>de</strong>nen Kreuzzügen<br />
untermauerten dies. Die Normannen fielen wie<strong>de</strong>rholt in <strong>de</strong>r Normandie ein, die daher ihren Namen bekam; im Jahre 1066 eroberten sie England. Unter Ludwig VII. beginnt eine lange<br />
Serie von kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit England, nach<strong>de</strong>m Ludwigs geschie<strong>de</strong>ne Frau Eleonore von Poitou und Aquitanien 1152 Heinrich Plantagenet heiratet und damit etwa<br />
die Hälfte <strong>de</strong>s französischen Staatsgebiets an England fällt. Philipp II. August kann England <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Staufern bis 1299 weitgehend aus Frankreich verdrängen; <strong>de</strong>r englische<br />
König Heinrich III. (England) muss <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Ludwig IX. als Lehnsherrn anerkennen. Ab 1226 wird Frankreich <strong>zu</strong> einer Erbmonarchie; im Jahre 1250 ist Ludwig IX. <strong>de</strong>r mächtigste<br />
Herrscher <strong>de</strong>s Abendlan<strong>de</strong>s.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s letzten Kapetingers wird 1328 Philipp von Valois <strong>zu</strong>m neuen König gewählt, er begrün<strong>de</strong>t die Valois-Dynastie. Die Bevölkerung Frankreichs wird für diese Zeit auf 15<br />
Millionen geschätzt, und das Land verfügt mit <strong>de</strong>r Scholastik, <strong>de</strong>r gotischen und romanischen Architektur über be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> kulturelle Errungenschaften. Thronansprüche, die Eduard III.<br />
Plantagenet, König von England und Herzog von Aquitanien, erhebt, führen 1339 <strong>zu</strong>m Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg. Nach großen Anfangserfolgen Englands, das <strong>de</strong>n gesamten Nordwesten<br />
Frankreichs erobert, kann Frankreich die Invasoren <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>rückdrängen. Eine Rebellion <strong>de</strong>s Burgunds und die Ermordnung <strong>de</strong>s Königs führen da<strong>zu</strong>, dass England sogar Paris und<br />
Aquitanien besetzen kann, erst <strong>de</strong>r von Jeanne d'Arc entfachte nationale Wi<strong>de</strong>rstand führte <strong>zu</strong>r Rückeroberung <strong>de</strong>r verlorenen Gebiete (mit Ausnahme von Calais) bis 1453. Zusätzlich
<strong>zu</strong>m Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg rafft die Pest von 1348 etwa ein Drittel <strong>de</strong>r Bevölkerung dahin.<br />
Mit <strong>de</strong>r Einglie<strong>de</strong>rung Burgunds und <strong>de</strong>r Bretagne in <strong>de</strong>n französischen Staat befand sich das Königtum auf einem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht, wur<strong>de</strong> jedoch während <strong>de</strong>r<br />
Renaissance in dieser Position durch Habsburg, <strong>de</strong>ssen Kaiser Karl V. ein Reich beherrschte, <strong>de</strong>ssen Staaten sich rund um Frankreich gruppierten, bedroht. Ab 1540 breitet sich durch das<br />
Wirken von Johannes Calvin <strong>de</strong>r Protestantismus nach Frankreich aus. Die französischen Calvinisten, die als Hugenotten bezeichnet wur<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n in ihrer Glaubensausübung stark<br />
unterdrückt, die Hugenottenkriege und speziell die Bartholomäusnacht im Jahre 1572 führten <strong>zu</strong>r Auswan<strong>de</strong>rung von Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong>n Hugenotten. Erst <strong>de</strong>r erste Herrscher aus <strong>de</strong>m<br />
Hause Bourbon, Heinrich von Navarra, gewährte <strong>de</strong>n Hugenotten im Edikt von Nantes 1598 Religionsfreiheit.<br />
Die Renaissance-Zeit wird auch von einer stärkeren Zentralisierung geprägt, während welcher <strong>de</strong>r König von <strong>de</strong>r Kirche und <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l unabhängig wur<strong>de</strong>. Es gelang <strong>de</strong>n leiten<strong>de</strong>n<br />
Ministern und Kardinälen Richelieu und Jules Mazarin, einen absolutistischen Staat <strong>zu</strong> errichten. Auf Betreiben Richelieus griff 1635 Frankreich aktiv in <strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg in<br />
Mitteleuropa ein; im Zusammenhang damit kam es <strong>zu</strong>m (Krieg gegen Spanien). Im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n von 1648 erhielt Frankreich Gebiete im Elsass <strong>zu</strong>gesprochen; das Heilige<br />
Römische Reich und Spanien wur<strong>de</strong>n geschwächt, es begann das Zeitalter <strong>de</strong>r französischen Dominanz in Europa, in welcher sich alle Herrscher Europas am Vorbild <strong>de</strong>r französischen<br />
Kultur orientierten und in welcher das Französische wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r dominieren<strong>de</strong>n Bildungssprache wur<strong>de</strong>. Die teuren Kriege und die A<strong>de</strong>lsopposition führten jedoch <strong>zu</strong>m Staatsbankrott und<br />
<strong>zu</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r Fron<strong>de</strong>. Mit <strong>de</strong>m Edikt von Fontainebleau 1685 wur<strong>de</strong> die Religionsfreiheit <strong>de</strong>r Hugenotten wie<strong>de</strong>r aufgehoben. Trotz schwerer Strafandrohungen flohen abermals<br />
Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> Hugenotten. Unter Ludwig XIV., <strong>de</strong>m so genannten Sonnenkönig, <strong>de</strong>r 1643 als Vierjähriger inthronisiert wur<strong>de</strong> und bis 1715 herrschte, erreichte <strong>de</strong>r Absolutismus<br />
seinen Höhepunkt, auf <strong>de</strong>m unter an<strong>de</strong>rem das Schloss Versailles errichtet wur<strong>de</strong>.<br />
Neuzeit<br />
Die Kriege, die die absolutistischen Könige führten (etwa Devolutionskrieg, Holländischer Krieg, Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg, Teilnahme<br />
am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg), ihre teure Hofhaltung und Missernten, lösten eine große Finanzkrise aus, die König Ludwig XVI. da<strong>zu</strong> zwang, die Generalstän<strong>de</strong><br />
ein<strong>zu</strong>berufen, was <strong>zu</strong>r Konstituierung <strong>de</strong>r Nationalversammlung führte, die eine Verfassung ausarbeitete und die Macht <strong>de</strong>s Königs beschränkte und so das Ancien Régime been<strong>de</strong>te. Die<br />
sich weiter verschlechtern<strong>de</strong>n Lebensbedingungen <strong>de</strong>s Volkes führten 1789 <strong>zu</strong>r Französischen Revolution, nach <strong>de</strong>r die erstmalige Erklärung <strong>de</strong>r Menschen- und Bürgerrechte stattfand,<br />
die Kirche enteignet, und sogar ein neuer Kalen<strong>de</strong>r eingeführt wur<strong>de</strong>, und nach <strong>de</strong>r 1791 eine Verfassung mit Frankreich als einer konstitutionellen Monarchie verabschie<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Nach<br />
<strong>de</strong>r versuchten Flucht <strong>de</strong>s Königs wur<strong>de</strong> dieser verhaftet und 1793 hingerichtet, die Ersten Republik wur<strong>de</strong> verkün<strong>de</strong>t. Die erste Erfahrung mit republikanischer Herrschaft, die auf <strong>de</strong>m<br />
Gleichheitsprinzip beruhte, en<strong>de</strong>te jedoch im Chaos und <strong>de</strong>r Terrorherrschaft unter Robespierre.<br />
Napoléon Bonaparte ergriff in dieser Situation 1799 mit einem Staatsstreich die Macht als Erster Konsul; 1804 ließ er sich <strong>zu</strong>m Kaiser krönen. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Koalitionskriege brachte<br />
er fast ganz Europa unter seine Kontrolle. Sein Russlandfeld<strong>zu</strong>g 1812 wur<strong>de</strong> jedoch ein Misserfolg, die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 besiegelte die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r französischen<br />
Truppen. Während <strong>de</strong>s Exils in Elba regierte mit Ludwig XVIII. wie<strong>de</strong>r ein Bourbone, Napoléon kam 1815 <strong>zu</strong>rück und regierte weitere 100 Tage. Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r Schlacht bei<br />
Waterloo wur<strong>de</strong> er endgültig verbannt. Die Restauration brachte wie<strong>de</strong>r die Bourbonen auf <strong>de</strong>n Thron, die daran gingen, das verlorene Kolonialreich wie<strong>de</strong>r auf<strong>zu</strong>bauen. In Frankreich<br />
herrschte gleichzeitig die Industrielle Revolution, und eine Arbeiterklasse bil<strong>de</strong>te sich langsam heraus. Die Julirevolution von 1830 stürzte <strong>de</strong>n <strong>de</strong>spotisch regieren<strong>de</strong>n Karl X. und wur<strong>de</strong><br />
durch <strong>de</strong>n Bürgerkönig Louis-Philippe ersetzt. Eine erneute bürgerliche Revolution brachte Frankreich jedoch 1848 die Zweite Republik.<br />
Zum Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r Zweiten Republik wur<strong>de</strong> Louis Napoléon Bonaparte gewählt, <strong>de</strong>r sich bereits 1852 <strong>zu</strong>m Kaiser krönen ließ. Unter seiner Herrschaft wur<strong>de</strong> Opposition gewaltsam<br />
unterdrückt, außenpolitisch gelangen jedoch Unternehmen wie <strong>de</strong>r Erwerb von Nizza und Savoyen, die Einglie<strong>de</strong>rung von Äquatorialafrika und Indochina ins Kolonialreich und <strong>de</strong>r Bau<br />
<strong>de</strong>s Sueskanals. Seine Herrschaft fällt <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Nationalstaatsbildung in Deutschland unter Führung <strong>de</strong>s Nord<strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s. Der Deutsch-Französische Krieg, <strong>de</strong>n Napoleon<br />
III. begann, um einen mächtigen Konkurrenten um die Hegemonie in Europa <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, en<strong>de</strong>te mit einer Nie<strong>de</strong>rlage, Wilhelm I. ließ sich im Spiegelsaal von Versailles <strong>zu</strong>m Kaiser<br />
proklamieren. Die Pariser Kommune, ein Aufstand, <strong>de</strong>r sich gegen die Kapitulation richtete, wur<strong>de</strong> mit Gewalt und zahlreichen To<strong>de</strong>sopfern nie<strong>de</strong>rgeschlagen.<br />
Erster und Zweiter Weltkrieg<br />
Die Dritte Republik währte von 1871 bis 1940. In dieser Zeit wur<strong>de</strong> das französische Kolonialreich auf eine Fläche von 7,7 Millionen km² ausge<strong>de</strong>hnt. Nach <strong>de</strong>r Dreyfus-Affäre wur<strong>de</strong><br />
Frankreich <strong>zu</strong> einem streng laizistischen Staat. Die Industrialisierung führte <strong>zu</strong> einem Wirtschaftsaufschwung, die 1889 und 1900 veranstaltete Paris zwei Weltausstellungen. 1904 schloss
Frankreich mit <strong>de</strong>m Vereinigten Königreich die Entente cordiale und trat in <strong>de</strong>n Ersten Weltkrieg mit <strong>de</strong>m Ziel ein, Elsass-Lothringen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen und Deutschland entschei<strong>de</strong>nd <strong>zu</strong><br />
schwächen. Nach <strong>de</strong>m Krieg fand sich Frankreich zwar auf <strong>de</strong>r Siegerseite wie<strong>de</strong>r, Nordfrankreich war jedoch weitgehend verwüstet und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n 1,5 Millionen gefallenen Soldaten kamen<br />
166.000 Opfer <strong>de</strong>r Spanischen Grippe 1918/19.<br />
Die Zwischenkriegszeit war in Frankreich vor allem von politischer Instabilität gekennzeichnet. Die ab 1934 regieren<strong>de</strong> Volksfront war vor allem auf Erhaltung <strong>de</strong>s Status quo aus.<br />
Dementsprechend schlecht war Frankreich auf <strong>de</strong>n Zweiten Weltkrieg vorbereitet. In seinem Westfeld<strong>zu</strong>g umgingen die <strong>de</strong>utschen Truppen die Maginot-Linie, marschierten in ein<br />
unverteidigtes Paris ein und Marschall Pétain musste am 22. Juni 1940 einen Waffenstillstand unterzeichnen. Frankreich wur<strong>de</strong> in eine zone occupée und eine zone libre geteilt, wobei in<br />
letzterer das von Deutschland abhängige konservativ-autoritáre Vichy-Regime regierte. Bereits kurz nach <strong>de</strong>r Unterzeichnung <strong>de</strong>s Waffenstillstands bil<strong>de</strong>ten sich Gruppen <strong>de</strong>r Résistance,<br />
in London grün<strong>de</strong>te Charles <strong>de</strong> Gaulle die Exilregierung Freies Frankreich. In <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Alliierten durchgeführten Operation Overlord wur<strong>de</strong> Nordfrankreich <strong>zu</strong>rückerobert, nach <strong>de</strong>r<br />
Schlacht um Paris wur<strong>de</strong> die Stadt im August 1944 befreit. Im September bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong> Gaulle eine provisorische Regierung.<br />
Nachkriegszeit und europäische Einigung<br />
Die Vierte Republik war bereits am 13. Oktober 1946 durch einen Volksentscheid beschlossen wor<strong>de</strong>n. Frankreich, das sich auf Seiten <strong>de</strong>r Siegermächte wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Gründungsmitglied<br />
<strong>de</strong>r UNO und bekam im Sicherheitsrat ein Veto-Recht. Der Wie<strong>de</strong>raufbau wur<strong>de</strong> nicht <strong>zu</strong>letzt mit Unterstüt<strong>zu</strong>ngsleistungen aus <strong>de</strong>m Marshallplan vorangetrieben. 1949 wur<strong>de</strong> Frankreich<br />
auch Gründungsmitglied <strong>de</strong>r NATO, und 1951 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl <strong>de</strong>r erste Schritt <strong>zu</strong>r Europäischen Integration gesetzt, 1957<br />
wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>n Römischen Verträge die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegrün<strong>de</strong>t, aus <strong>de</strong>r mittlerweile die Europäische Union gewor<strong>de</strong>n ist und wo Frankreich ein aktives wie<br />
dominantes Mitglied ist.<br />
Die Nachkriegszeit ist auch durch <strong>de</strong>n Zerfall <strong>de</strong>s Kolonialreiches geprägt. Der erste Indochinakrieg en<strong>de</strong>t mit <strong>de</strong>r Schlacht von Điện Biên Phủ und <strong>de</strong>m Verlust aller französischen<br />
Kolonien in Südostasien. Einen noch tieferen Schnitt be<strong>de</strong>utete <strong>de</strong>r Algerienkrieg, <strong>de</strong>r mit großer Härte geführt wur<strong>de</strong> und in <strong>de</strong>ssen Konsequenz Algerien in die Unabhängigkeit entlassen<br />
wer<strong>de</strong>n musste. Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> Pied-noirs mussten nach Frankreich rückgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
Innenpolitisch wur<strong>de</strong> die instabile Vierte Republik im Jahre 1958 durch die Fünfte Republik abgelöst, die einen starken, von <strong>de</strong>r Legislative weitgehend unabhängigen Präsi<strong>de</strong>nten<br />
vorsieht. Diese Fünfte Republik wur<strong>de</strong> im Mai 1968 stark erschüttert, was langfristig kulturelle, politische und ökonomische Reformen in Frankreich nach sich zog. Nach <strong>de</strong>r Ölkrise von<br />
1973 beschloss Frankreich, sich durch Nut<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Kernenergie vom Erdöl unabhängiger <strong>zu</strong> machen. Eine weitere Zäsur war Machtübernahme durch die Sozialistische Partei 1981 und<br />
die Präsi<strong>de</strong>ntschaft von François Mitterrand, während <strong>de</strong>rer massive Verstaatlichungen vorangetrieben wur<strong>de</strong>n, die To<strong>de</strong>sstrafe und Atomtests abgeschafft, die 39-Stun<strong>de</strong>n-Woche<br />
eingeführt und <strong>de</strong>r Vertrag von Maastricht ratifiziert wur<strong>de</strong>. Sein Nachfolger Jacques Chirac setzte die Einführung <strong>de</strong>s Euro um und brüskierte die USA, in<strong>de</strong>m er die Teilnahme am<br />
Irakkrieg verweigerte.[22][23]<br />
Politik<br />
Seit <strong>de</strong>r Annahme einer neuen Verfassung am 5. Oktober 1958 spricht man in Frankreich von <strong>de</strong>r Fünften Republik. Diese Verfassung macht Frankreich <strong>zu</strong> einer zentralistisch<br />
organisierten Demokratie mit einem exekutivlastigen semi-präsi<strong>de</strong>ntiellen Regierungssystem. Gegenüber früheren Verfassungen wur<strong>de</strong> die Rolle <strong>de</strong>r Exekutive und vor allem jene <strong>de</strong>s<br />
Präsi<strong>de</strong>nten weitgehend gestärkt. Dies war die Reaktion auf die extreme politische Instabilität in <strong>de</strong>r Vierten Republik. Sowohl Präsi<strong>de</strong>nt und Premierminister spielen eine aktive Rolle im<br />
politischen Leben, wobei <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt nur <strong>de</strong>m Volk gegenüber verantwortlich ist. Die Macht <strong>de</strong>s Parlaments wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r fünften Republik eingeschränkt, die Verfassung hat ihm jedoch<br />
entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kontrollfunktionen übertragen.<br />
Die Verfassung enthält keinen Grundrechtekatalog, son<strong>de</strong>rn verweist auf die Erklärung <strong>de</strong>r Menschen- und Bürgerrechte von 1789 und die in <strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>r Vierten Französischen<br />
Republik von 1946 festgehaltenen sozialen Grundrechte.<br />
Exekutive<br />
Verfassungsgemäß ist <strong>de</strong>r direkt durchs Volk gewählte Staatspräsi<strong>de</strong>nt das höchste Staatsorgan. Er steht über allen an<strong>de</strong>ren Institutionen. Er wacht über die Einhaltung <strong>de</strong>r Verfassung,
sichert das Funktionieren <strong>de</strong>r öffentlichen Gewalten, die Kontinuität <strong>de</strong>s Staates, die Unabhängigkeit, die Unverletzlichkeit <strong>de</strong>s Staatsgebietes und die Einhaltung von mit an<strong>de</strong>ren Staaten<br />
geschlossenen Abkommen. Er tritt als Schiedsrichter bei Streitigkeiten zwischen staatlichen Institutionen auf.[24] Er verkün<strong>de</strong>t Gesetze und hat das Recht, sie <strong>de</strong>m Verfassungsrat <strong>zu</strong>r<br />
Prüfung vor<strong>zu</strong>legen. Er darf Gesetze o<strong>de</strong>r Teile davon an das Parlament <strong>zu</strong>r Neuberatung <strong>zu</strong>rückweisen, hat aber kein Vetorecht. Dekrete und Verordnungen wer<strong>de</strong>n vom Ministerrat,<br />
<strong>de</strong>ssen Vorsitz <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt führt, beschlossen; gegenüber diesen hat <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt jedoch ein aufschieben<strong>de</strong>s Veto.[25] Hinsichtlich <strong>de</strong>r Außen- und Sicherheitspolitik verfügt <strong>de</strong>r<br />
Staatspräsi<strong>de</strong>nt sowohl über die Richtlinien- und über die Ratifikationskompetenz, sodass er sowohl die Außenpolitik gestaltet als auch völkerrechtliche Vereinbarungen für Frankreich<br />
verbindlich eingeht. Diese Praxis schälte sich in <strong>de</strong>r Regierungszeit <strong>de</strong> Gaulles heraus und ist nicht zwingend <strong>de</strong>r Verfassung <strong>zu</strong> entnehmen.[26] Auf Antrag <strong>de</strong>r Regierung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
Parlamentes darf <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt Volksabstimmungen initiieren. Er ernennt Mitglie<strong>de</strong>r wichtiger Gremien, etwa drei <strong>de</strong>r neun Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Verfassungsrates, alle Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Obersten<br />
Rates für <strong>de</strong>n Richterstand sowie die Staatsanwälte. Der Staatspräsi<strong>de</strong>nt ist keiner Kontrolle durch die Judikative unterworfen, <strong>de</strong>m Parlament gegenüber ist er nur bei Hochverrat<br />
verantwortlich. Des Weiteren befiehlt <strong>de</strong>r Staatspräsi<strong>de</strong>nt über die Streitkräfte und <strong>de</strong>n Einsatz <strong>de</strong>r Atomwaffen; im Falle <strong>de</strong>r Ausrufung <strong>de</strong>s Notstan<strong>de</strong>s hat <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt fast<br />
unbeschränkte Autorität. Dem Präsi<strong>de</strong>nten steht das Präsidialamt als Berater und Unterstützer <strong>zu</strong>r Seite.<br />
Der Präsi<strong>de</strong>nt leitet die ihm verliehene staatliche Autorität an <strong>de</strong>n Premierminister und die Regierung weiter, wobei die Regierung die vom Präsi<strong>de</strong>nten vorgegebenen Richtlinien<br />
um<strong>zu</strong>setzen hat. Dies erfor<strong>de</strong>rt eine enge Zusammenarbeit zwischen Präsi<strong>de</strong>nten und Premierminister, die in einer Cohabitation schwierig sein kann, also wenn Präsi<strong>de</strong>nt und<br />
Premierminister aus zwei entgegengesetzten politischen Lagern kommen. Der Präsi<strong>de</strong>nt ernennt formell ohne jegliche Einschränkungen einen Premierminister und, auf Vorschlag <strong>de</strong>s<br />
Premierministers, die Regierungsmitglie<strong>de</strong>r. Die Regierung hängt in <strong>de</strong>r Folge vom Vertrauen <strong>de</strong>s Parlamentes ab, <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt kann eine einmal ernannte Regierung formal nicht<br />
entlassen. Die Regierung besteht aus Ministern, Staatsministern, ministres délegués, also Ministern mit speziellen Aufgaben, und Staatssekretären. Regierungsmitglie<strong>de</strong>r dürfen in<br />
Frankreich kein an<strong>de</strong>res staatliches Amt, keine sonstige Berufstätigkeit o<strong>de</strong>r Parlamentsmandat ausüben. Sie sind in ihrer Funktion <strong>de</strong>m Parlament verantwortlich.[27]<br />
Legislative<br />
Das Parlament <strong>de</strong>r V. Republik besteht aus zwei Kammern. Die Nationalversammlung (Assemblée Nationale) hat 577 Abgeordnete, die direkt auf fünf Jahre gewählt wer<strong>de</strong>n. Der Senat<br />
hat 317 Mitglie<strong>de</strong>r (ab 2010 346 Mitglie<strong>de</strong>r). Diese wer<strong>de</strong>n indirekt für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Die Wahl <strong>de</strong>s Senats wird auf Ebene <strong>de</strong>r Départements durchgeführt,<br />
wobei das Wahlkollegium aus <strong>de</strong>n Abgeordneten <strong>de</strong>s Départements, <strong>de</strong>n Generalräten und Gemein<strong>de</strong>vertretern besteht.<br />
Die Initiative für Gesetze kann vom Premierminister o<strong>de</strong>r einer <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Parlamentskammern ausgehen. Nach <strong>de</strong>r Debatte in <strong>de</strong>n Kammern muss <strong>de</strong>r Gesetzestext von bei<strong>de</strong>n Kammern<br />
gleichlautend verabschie<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, wobei das Weiterreichen <strong>de</strong>s Textes als navette bezeichnet wird. Nach <strong>de</strong>r Annahme durch das Parlament hat <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt nur einmal das Recht,<br />
einen Gesetzestext <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>weisen. Das Parlament hat weiters die Aufgabe, die Arbeit <strong>de</strong>r Regierung durch Anfragen und Aussprachen <strong>zu</strong> kontrollieren. Die Nationalversammlung hat<br />
die Möglichkeit, die Regierung <strong>zu</strong> stürzen. Das Parlament hat nicht die Befugnis, <strong>de</strong>n Staatspräsi<strong>de</strong>nten politisch heraus<strong>zu</strong>for<strong>de</strong>rn.[28] Der Staatspräsi<strong>de</strong>nt darf jedoch die<br />
Nationalversammlung auflösen; von diesem Recht wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Vergangenheit wie<strong>de</strong>rholt Gebrauch gemacht, um schwierige Phasen <strong>de</strong>r Cohabitation <strong>zu</strong> been<strong>de</strong>n.[29]<br />
Jurisdiktion<br />
In <strong>de</strong>r Fünften Republik übernimmt <strong>de</strong>r Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) die Kontrollfunktion innerhalb <strong>de</strong>s politischen Systems. In einem nicht erneuerbaren Mandat ernennen<br />
<strong>de</strong>r Staatspräsi<strong>de</strong>nt, und die Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r Nationalversammlung und <strong>de</strong>s Senats jeweils drei Abgeordnete für eine Amtszeit von neun Jahren. Der Rat überprüft Gesetze auf Anfrage,<br />
überwacht die Gesetzesmäßigkeit von Wahlen und Referen<strong>de</strong>n. Für eine Überprüfung von Gesetzen sind jeweils 60 Abgeordnete <strong>de</strong>r Nationalversammlung (10,4 % <strong>de</strong>r Abgeordneten)<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Senats (18,1 % <strong>de</strong>r Senatoren) nötig.<br />
Die To<strong>de</strong>sstrafe wur<strong>de</strong> in Frankreich 1981 abgeschafft.<br />
Politische Parteien<br />
Die französische Parteienlandschaft zeichnet sich durch einen hohen Grad <strong>de</strong>r Zersplitterung und hohe Dynamik aus. Neue Parteien entstehen und existieren<strong>de</strong> Parteien än<strong>de</strong>rn häufig ihre<br />
Namen. Die Namen <strong>de</strong>r Parteien geben nur sehr bedingt über ihre i<strong>de</strong>ologische Ausrichtung Aufschluss, <strong>de</strong>nn es ist <strong>zu</strong> einer gewissen Begriffsentfremdung gekommen. Französische<br />
Parteien haben in <strong>de</strong>r Regel relativ wenige Mitglie<strong>de</strong>r und eine schwache Organisationsstruktur, die sich häufig auf Paris als <strong>de</strong>m Ort, wo die meisten Entscheidungen getroffen wer<strong>de</strong>n,
konzentriert.[30] Die politische Linke wird von <strong>de</strong>r kommunistischen Parti communiste français, <strong>de</strong>r sozialistischen Parti socialiste und <strong>de</strong>r Parti radical <strong>de</strong> gauche besetzt, wobei die Parti<br />
communiste français die mitglie<strong>de</strong>rstärkste Partei <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist. Die Parti socialiste stellte hingegen <strong>de</strong>n langjährigen Präsi<strong>de</strong>nten François Mitterrand und mehrere Premierminister. Die<br />
grüne Partei in Frankreich heißt Les Verts, wobei grüne Politik in Frankreich ten<strong>de</strong>nziell weniger Zulauf genießt als in <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschsprachigen Staaten. Die wichtigste Zentrumspartei ist<br />
die erst 2007 gegrün<strong>de</strong>te Mouvement démocrate. Zum konservativen Lager gehört die Union pour un mouvement populaire, die momentan <strong>de</strong>n Präsi<strong>de</strong>nten und <strong>de</strong>n Premierminister<br />
stellt. Weiterhin ist <strong>de</strong>r Mouvement pour la France eher noch <strong>zu</strong>m bürgerlichen Lager <strong>zu</strong> zählen, während <strong>de</strong>r Front National <strong>zu</strong>m Rechtsextremismus gehört.<br />
Innenpolitik<br />
Momentan stellt das konservative Lager <strong>de</strong>s amtieren<strong>de</strong>n Staatspräsi<strong>de</strong>nten Nicolas Sarkozy mit 345 Sitzen die absolute Mehrheit in <strong>de</strong>r Nationalversammlung.<br />
Am 6. Mai 2007 gewann Nicolas Sarkozy, <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>ntschaftskandidat <strong>de</strong>r UMP, mit gut 53 % <strong>de</strong>r Stimmen die Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahl. Seine Kontrahentin, die Sozialistin Ségolène<br />
Royal, erreichte knapp 47 Prozent.<br />
Am 16. Mai 2007 folgte Sarkozy Jacques Chirac im Amt <strong>de</strong>s französischen Staatspräsi<strong>de</strong>nten. In <strong>de</strong>n darauffolgen<strong>de</strong>n Tagen ernannte er <strong>de</strong>n früheren Sozial- und Bildungsminister<br />
François Fillon <strong>zu</strong>m neuen Premierminister und stellte das neue Kabinett vor, <strong>de</strong>m auch Politiker <strong>de</strong>s Zentrums und <strong>de</strong>r Sozialisten angehören.<br />
Als wichtigste innenpolitische Vorhaben nannte die Regierung die Erhöhung <strong>de</strong>r Kaufkraft <strong>de</strong>r Bürger, eine Flexibilisierung <strong>de</strong>r Arbeitszeiten, insbeson<strong>de</strong>re durch die Abschaffung <strong>de</strong>r 35-<br />
Stun<strong>de</strong>n-Woche sowie ein härteres Vorgehen gegen Kriminalität. Während seiner Zeit als Innenminister und seit <strong>de</strong>r Wahl <strong>zu</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten sah sich Sarkozy wie<strong>de</strong>rholt mit<br />
Schwierigkeiten in <strong>de</strong>r Banlieue, <strong>de</strong>n Vorstadtsiedlungen großer Städte, konfrontiert. Immer wie<strong>de</strong>r kommt es hier <strong>zu</strong> Sachbeschädigungen durch Vandalismus und <strong>zu</strong> Zusammenstößen<br />
zwischen <strong>de</strong>r Polizei und Jugendlichen. Im Oktober 2005 hatten die Konflikte einen Höhepunkt erreicht und griffen von Paris in an<strong>de</strong>re Städte über, nach<strong>de</strong>m zwei Jugendliche einen<br />
Unfalltod erlitten hatten (siehe Hauptartikel Unruhen in Frankreich 2005).<br />
Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Stand 2010<br />
Außen- und Sicherheitspolitik<br />
Leitlinie <strong>de</strong>r französischen Außenpolitik ist die <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Integration Europas mit <strong>de</strong>m Ziel einer politischen Einigung. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg gaben Deutschland und<br />
Frankreich unter <strong>de</strong>m Eindruck <strong>de</strong>r Kriegserlebnisse ihre Erbfeindschaft auf, die eine grundsätzliche Gefährdung <strong>de</strong>s europäischen Frie<strong>de</strong>ns darstellte, und verfolgten die Aussöhnung<br />
untereinan<strong>de</strong>r. Mittlerweile betreiben Frankreich und Deutschland eine oftmals kongruente Europapolitik, sodass es Pläne gibt, aus diesen bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn ein „Kerneuropa“ <strong>zu</strong> bil<strong>de</strong>n, das<br />
die europäische Einigung nötigenfalls auch gegen einige an<strong>de</strong>re EU-Mitglie<strong>de</strong>r vorantreibt.<br />
Indirekt ist dieser Prozess auch gegen ein als solches wahrgenommenes imperiales Streben <strong>de</strong>r Vereinigten Staaten von Amerika, <strong>de</strong>ren überbor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Machtfülle Frankreich mit <strong>de</strong>r<br />
Schaffung einer multipolaren Weltordnung relativieren will.<br />
Eine weitere Säule <strong>de</strong>r französischen Außenpolitik ist die internationale Kooperation auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Sicherheitspolitik und <strong>de</strong>r Entwicklungshilfe bei ständiger Wahrung <strong>de</strong>r<br />
französischen Souveränität. Da<strong>zu</strong> ist Frankreich Mitglied in zahlreichen sicherheitspolitischen Organisationen wie <strong>de</strong>r OSZE und hat am Eurocorps teil. Außer<strong>de</strong>m engagiert sich<br />
Frankreich in <strong>de</strong>r atomaren Abrüstung, hat bisher jedoch nicht verlautbaren lassen, auf das Potenzial <strong>de</strong>r Force <strong>de</strong> frappe <strong>zu</strong> verzichten.<br />
Frankreich ist <strong>zu</strong><strong>de</strong>m ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat mit Vetorecht. Über die Vereinten Nationen koordiniert es seine internationale Entwicklungs<strong>zu</strong>sammenarbeit und sein<br />
humanitäres Engagement.<br />
Ebenfalls von großer Be<strong>de</strong>utung für die französischen Außenbeziehungen ist die französische Kulturpolitik und die För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Frankophonie. International hat die französische<br />
Sprache mit ungefähr 140 Millionen Sprechern einen hohen Stellenwert. Dies möchte das französische Außenministerium mit einer Unterabteilung namens AEFE unterstützen, die in<br />
knapp 125 Län<strong>de</strong>rn knapp 279 Schulen, die von knapp 16.000 Jugendlichen besucht wer<strong>de</strong>n. Die Leistungen <strong>de</strong>r knapp 1.000 Lokalitäten <strong>de</strong>r Agence française nehmen ungefähr 200.000<br />
Stu<strong>de</strong>nten in aller Welt in Anspruch.[31]
Hin<strong>zu</strong> kommt ein Engagement auch nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kolonialherrschaft in Afrika, wo Frankreich bis heute in vielen Län<strong>de</strong>rn die bestimmen<strong>de</strong> Ordnungsmacht geblieben ist.<br />
Frankreich war 1949 Gründungsmitglied <strong>de</strong>s Nordatlantikvertrages (NATO) und erhielt militärischen Schutz durch die USA. Mit <strong>de</strong>r Machtübernahme von <strong>de</strong> Gaulle 1958 än<strong>de</strong>rten sich<br />
die Beziehungen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n USA und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n USA dominierten NATO dahingehend, dass Frankreich 1966 seine militärische Integration in die Strukturen <strong>de</strong>r NATO aufgab und<br />
ausschließlich politisch integriert blieb. Im März 2009 kündigte Präsi<strong>de</strong>nt Sarkozy die vollständige Rückkehr Frankreichs in die Kommandostruktur <strong>de</strong>r NATO an. Das französische<br />
Parlament bestätigte am 17. März 2009 diesen Schritt, in<strong>de</strong>m es Sarkozy das Vertrauen ausgesprochen hatte.[32]<br />
Unter <strong>de</strong> Gaulles Führung entwickelte sich Frankreich 1960 <strong>zu</strong> einer Atommacht und verfügte ab 1965 mit <strong>de</strong>r Force <strong>de</strong> Frappe über Atomstreitkräfte, die <strong>zu</strong>nächst 50 mit Atombomben<br />
(Kernwaffen) ausgestattete Flugzeuge in Dienst stellte. 1968 hatte Frankreich bereits 18 Abschussrampen für Mittelstreckenraketen aufgestellt, die 1970 und 1971 mit Atomsprengköpfen<br />
ausgestattet wur<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n 1970er Jahren erweiterte Frankreich seine Atommacht auch auf See. Vier Atom-U-Boote verfügen über je 16 atomar bestückte Mittelstreckenraketen.<br />
Militär<br />
Die französischen Streitkräfte (Les forces armées françaises) sind eine Berufsarmee mit 350.000 Männern und Frauen unter Waffen. 20.000 Soldaten sind inkl. Gerät in <strong>de</strong>n<br />
Übersee<strong>de</strong>partements und -territorien stationiert, weitere 8.000 in afrikanischen Staaten, mit <strong>de</strong>nen Verteidigungsabkommen vereinbart wur<strong>de</strong>n. Die Streitkräfte teilen sich dabei in die<br />
drei klassischen Sektoren Heer (Armée <strong>de</strong> Terre), Luftwaffe (Armée <strong>de</strong> l’air), Marine (Marine nationale) sowie die Nuklearstreitkräfte (Force <strong>de</strong> dissuasion nucléaire) mit ca. 348 bis 350<br />
Sprengköpfen. Des Weiteren ist die Gendarmerie Nationale, eine zentrale Polizeibehör<strong>de</strong>, <strong>de</strong>m Verteidigungsministerium unterstellt. Militärisches und populärkulturelles Aushängeschild<br />
<strong>de</strong>s französischen Militärs ist die Frem<strong>de</strong>nlegion (Légion Étrangère).<br />
Administrative Glie<strong>de</strong>rung<br />
Frankreich gilt spätestens seit Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu als Inbegriff <strong>de</strong>s zentralisierten Staates. Zwar wur<strong>de</strong>n später Maßnahmen <strong>zu</strong>r Dezentralisierung ergriffen, diese hatten<br />
jedoch eher <strong>de</strong>n Zweck, die Zentralgewalt näher <strong>zu</strong>m Bürger <strong>zu</strong> bringen. Erst seit <strong>de</strong>r Verwaltungsreform <strong>de</strong>r Jahre 1982 und 1983 wur<strong>de</strong>n Kompetenzen von <strong>de</strong>r Zentralregierung auf die<br />
Gebietskörperschaften verlagert.[33]<br />
Auf oberster Ebene ist Frankreich in 26 Régions geglie<strong>de</strong>rt. Regionen gibt es erst seit 1964, seit 1982/83 haben sie <strong>de</strong>n Status einer Gebietskörperschaft. Je<strong>de</strong> Region wählt einen<br />
Regionalrat (Conseil régional), <strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rum einen Präsi<strong>de</strong>nten wählt. Weiterhin ernennt <strong>de</strong>r französische Staatspräsi<strong>de</strong>nt einen Regionalpräfekten. Regionen sind <strong>zu</strong>ständig für die<br />
Wirtschaft, die Infrastruktur <strong>de</strong>r Berufs- und Gymnasialausbildung und finanzieren sich über Steuern, die sie einheben dürfen, und über Transferzahlungen <strong>de</strong>r Zentralregierung.[34]<br />
Korsika hat unter <strong>de</strong>n Regionen einen Son<strong>de</strong>rstatus und wird als Collectivité territoriale bezeichnet. Vier Regionen (Gua<strong>de</strong>loupe, Martinique, Französisch-Guayana und La Réunion)<br />
befin<strong>de</strong>n sich in Übersee und hatten bis <strong>zu</strong>r Verfassungsän<strong>de</strong>rung 2003 <strong>de</strong>n Status eines Überseedépartements. Die Regionen bil<strong>de</strong>n die europäische Statistikebene NUTS-2 (auf <strong>de</strong>r<br />
übergeordneten Ebene NUTS-1 bestehen 8+1 Zones d’étu<strong>de</strong>s et d’aménagement du territoire (ZEAT, Raumplanungs- und -ordnungszonen)).<br />
Eine Region ist ihrerseits in Départements unterteilt. Départements ersetzten 1790 die traditionellen Provinzen, um <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>r lokalen Machthaber <strong>zu</strong> brechen. Von <strong>de</strong>n heute 100<br />
Départements liegen 96 in Europa. Die hohe Zahl dieser relativ kleinen Verwaltungseinheiten ist immer wie<strong>de</strong>r Gegenstand von Diskussionen. Départements wählen einen Generalrat<br />
(Conseil général), <strong>de</strong>r einen Präsi<strong>de</strong>nten als Exekutivorgan wählt. Erster Mann im Département ist jedoch <strong>de</strong>r vom französischen Staatspräsi<strong>de</strong>nten ernannte Präfekt. Départements haben<br />
die Aufgabe, sich um das Sozial- und Gesundheitswesen, die Collèges, Kultur- und Sporteinrichtungen, Departementsstraßen und <strong>de</strong>n Sozialbau <strong>zu</strong> kümmern.[35][36] Sie dürfen Steuern<br />
einheben und bekommen Transferzahlungen <strong>de</strong>r Zentralregierung. Die Départements bil<strong>de</strong>n die europäische Statistikebene NUTS-3.<br />
Die 325 Arrondissements stellen keine eigene Rechtspersönlichkeit dar. Sie dienen vorrangig <strong>de</strong>r Entlastung <strong>de</strong>r Départementsverwaltung. Ebenso dienen die 4036 Kantone nur noch als<br />
Wahlbezirk für die Wahl <strong>de</strong>r Generalräte. Die Arrondissements <strong>de</strong>r Städte Paris, Lyon und Marseille haben <strong>de</strong>n Status von Kantonen.[37][38]<br />
Die kleinste und gleichzeitig älteste organisatorische Einheit <strong>de</strong>s französischen Staates sind die Gemein<strong>de</strong>n (communes). Sie folgten 1789 <strong>de</strong>n Pfarreien und Städten nach. Anfang 2009<br />
gab es 36.682 Gemein<strong>de</strong>n, davon 112 in Übersee.[37] Trotz <strong>de</strong>r hohen Zahl <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n, die größtenteils nur sehr wenige Einwohner haben, gab es in <strong>de</strong>n letzten Jahren kaum<br />
Bemühungen um eine Gemein<strong>de</strong>reform. Je<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong> wählt einen Gemein<strong>de</strong>rat (Conseil municipal), <strong>de</strong>r dann aus seiner Mitte einen Bürgermeister wählt. Seit 1982 haben die<br />
Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utlich mehr Rechte und wer<strong>de</strong>n vom Staat weniger bevormun<strong>de</strong>t. Auf Gemein<strong>de</strong>ebene wer<strong>de</strong>n Grundschulbildung, Stadtplanung, Abfallbeseitigung, Abwasserreinigung und
Kulturaktivitäten organisiert; auch sie finanzieren sich über eigene Steuern und Transferzahlungen.[39][40]<br />
Verwaltungsrechtliche Son<strong>de</strong>rstati gelten für die Départementskörperschaft (Collectivité départementale,) Mayotte, die Gebietskörperschaft (Collectivité territoriale) Saint-Pierre und<br />
Miquelon, die Überseeterritorien (Territoires d’outre-mer, T.O.M.) Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin und die Französischen<br />
Süd- und Antarktisgebiete (Terres australes et antarctiques françaises, T.A.A.F.) sowie die Îles éparses und die Clipperton-Insel.<br />
Frankreich sowie seine Überseeregionen, -départements sowie Saint-Barthélemy und Saint-Martin sind Teil <strong>de</strong>r EU. Die restlichen Überseegebiete sind nicht EU-Mitglie<strong>de</strong>r. In Frankreich<br />
erlassene Gesetze gelten in <strong>de</strong>n T.O.M. nur, wenn dies ausdrücklich erwähnt ist.<br />
Infrastruktur<br />
Straßenverkehr<br />
Ein dichtes Autobahnnetz verbin<strong>de</strong>t in erster Linie <strong>de</strong>n Großraum Paris mit <strong>de</strong>n Regionen. Dabei wur<strong>de</strong> in erster Linie das auf Paris <strong>zu</strong> laufen<strong>de</strong> Netz <strong>de</strong>r Nationalstraßen ausgebaut. Nach<br />
und nach wer<strong>de</strong>n auch Querverbindungen zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Großräumen geschaffen. Die Verkehrswege Frankreichs gehören <strong>de</strong>m Staat, die meisten Autobahnstrecken wer<strong>de</strong>n seit<br />
2006 aber privat betrieben, an Mautstellen müssen alle Benutzer Maut zahlen.[41] Nur wenige Abschnitte sind mautfrei, <strong>zu</strong>m Beispiel im Bereich <strong>de</strong>r Großstädte, die neue A75 o<strong>de</strong>r die<br />
elsässische A35. Dabei gilt wie<strong>de</strong>rum die Ausnahme, dass bestimmte, beson<strong>de</strong>rs aufwändige Autobahnabschnitte auch innerhalb <strong>de</strong>s Großstadtbereichs Maut kosten (z. B. Nordumgehung<br />
von Lyon o<strong>de</strong>r A14 bei Paris).<br />
Schienenverkehr<br />
Der öffentliche Nahverkehr ist in großen Zentren hervorragend ausgebaut. In Paris ist kein Ort weiter als 500 Meter von einer Station <strong>de</strong>r Métro entfernt. Auch in an<strong>de</strong>ren Städten wer<strong>de</strong>n<br />
die U-Bahnen mit großem Aufwand ausgebaut, <strong>zu</strong>m Beispiel in Lyon, Lille, Marseille o<strong>de</strong>r Toulouse. Außerhalb <strong>de</strong>r großen Zentren wird <strong>de</strong>r Nahverkehr hingegen nur spärlich betrieben.<br />
Lan<strong>de</strong>sweit wur<strong>de</strong> seit Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre das Netz <strong>de</strong>s Hochgeschwindigkeits<strong>zu</strong>gs TGV konsequent ausgebaut. Das Netz wird weiter ausgebaut und erreicht dabei auch <strong>zu</strong>nehmend<br />
die Nachbarlän<strong>de</strong>r. Für Deutschland ist vor allem <strong>de</strong>r Neubau <strong>de</strong>r Hochgeschwindigkeitsstrecke LGV Est européenne Richtung Straßburg und Süd<strong>de</strong>utschland beziehungsweise Richtung<br />
Saarbrücken und Mannheim relevant. Der Thalys verbin<strong>de</strong>t Paris mit Brüssel, Aachen und Köln.<br />
Seit 2003 muss die Staatsbahn SNCF sich privater Konkurrenz stellen. De facto hat sie aber lan<strong>de</strong>sweit noch ein Fast-Monopol.<br />
Luftverkehr<br />
Der Luftverkehr ist in Frankreich stark zentralisiert. Die bei<strong>de</strong>n Flughäfen <strong>de</strong>r Hauptstadt Paris (Charles <strong>de</strong> Gaulle und Orly) fertigten 2008 gemeinsam 87,1 Millionen Fluggäste ab.[42]<br />
Charles <strong>de</strong> Gaulle ist dabei <strong>de</strong>r zweitgrößte Flughafen Europas und zentrales Drehkreuz <strong>de</strong>r Air France. Er wickelt auch praktisch <strong>de</strong>n gesamten Langstreckenverkehr ab. Die größten<br />
Flughäfen außerhalb von Paris sind jene von Nizza mit 10 Millionen Passagieren, danach folgen Lyon und Marseille. Air France, die führen<strong>de</strong>s Mitglied <strong>de</strong>r Allianz SkyTeam ist,<br />
fusionierte 2004 mit KLM <strong>zu</strong> Air France-KLM und ist seit<strong>de</strong>m die größte Fluggesellschaft <strong>de</strong>r Welt.<br />
Schiffsverkehr<br />
Frankreich hat die natürlichen und künstlichen Binnenwasserstraßen (Flüsse und Kanäle) aus wirtschaftlichen und militärischen Beweggrün<strong>de</strong>n in seiner Geschichte stark entwickelt und<br />
ausgebaut. Seine Hochblüte erlebte das Wasserwegenetz im 19.Jahrhun<strong>de</strong>rt mit einer Länge von 11.000 Kilometern. Durch Konkurrenz von Schiene und Straße ist es bis heute auf rund<br />
8.500 Kilometer <strong>zu</strong>rückgegangen. Es wird <strong>zu</strong>m Großteil von <strong>de</strong>r staatlichen Wasserstraßenverwaltung Voies navigables <strong>de</strong> France (VNF) verwaltet und betrieben.<br />
2007 wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Frachtschifffahrt auf Frankreichs Wasserstraßen Güter mit einem Gesamtgewicht von 61,7 Millionen Tonnen beför<strong>de</strong>rt. Bezieht man die Distanz in die Statistik ein,<br />
ergibt sich ein Wert von 7,54 Milliar<strong>de</strong>n Tonnen-Kilometer. Über die letzten 10 Jahre be<strong>de</strong>utet dies eine Steigerung um 33 Prozent. Die Personenschifffahrt hat heute nur noch touristische<br />
Be<strong>de</strong>utung, ist aber ein aufstreben<strong>de</strong>r Wirtschaftsfaktor.
Der Canal Seine-Nord Europe (CSNE) ist das Projekt eines neuen, 106 km langen Kanals in Süd-Nord-Richtung durch Nordfrankreich zwischen <strong>de</strong>n Ein<strong>zu</strong>gsgebieten <strong>de</strong>r Flüsse Seine<br />
und Schel<strong>de</strong>. Das Projekt ist in <strong>de</strong>n Verkehrswegeplan <strong>de</strong>r Europäischen Union aufgenommen, die Planung soll 2010 been<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r Kanal 2014 o<strong>de</strong>r 2015 in Betrieb genommen wer<strong>de</strong>n<br />
Siehe auch: Liste <strong>de</strong>r schiffbaren Flüsse und Kanäle in Frankreich<br />
Wirtschaft<br />
Allgemeines<br />
Traditionell ist in Frankreich die Wirtschaftspolitik von vergleichsweise starken staatlichen Eingriffen gelenkt. Hier spielt die historische Rolle <strong>de</strong>s Merkantilismus – im Speziellen <strong>de</strong>s<br />
Colbertismus – im Land eine Rolle.<br />
Frankreich ist eine gelenkte Volkswirtschaft, die in <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>zu</strong>nehmend <strong>de</strong>reguliert und privatisiert wur<strong>de</strong>. Ein staatlicher Min<strong>de</strong>stlohn, <strong>de</strong>r SMIC, sichert <strong>de</strong>n Angestellten einen<br />
Stun<strong>de</strong>nlohn von 8,71 Euro.[43]<br />
Wein steht aufgrund <strong>de</strong>r zahlreichen Weinbaugebiete in <strong>de</strong>r französischen Ausfuhrliste an fünfter Stelle: nach Autos, Flugzeugen, pharmazeutischen Produkten und Elektronik. Auch <strong>de</strong>r<br />
Tourismus spielt eine große Rolle.<br />
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Durchschnitt <strong>de</strong>r Jahre 1995 bis 2005 um 2,1 % jährlich und erreichte 2005 <strong>de</strong>n Wert von 1.689,4 Milliar<strong>de</strong>n Euro. Im Vergleich mit <strong>de</strong>m BIP <strong>de</strong>r<br />
EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht Frankreich einen In<strong>de</strong>x von 111,4 (EU-25:100) (2003).[44]<br />
Die Erwerbstätigenstruktur hat sich gegenüber früher grundlegend gewan<strong>de</strong>lt. So arbeiteten 2003 nur noch 4 % <strong>de</strong>r Erwerbstätigen in <strong>de</strong>r Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, in <strong>de</strong>r<br />
Industrie waren es 24 %, wohingegen 72 % im Dienstleistungsbereich tätig waren.<br />
Deutschland ist <strong>de</strong>r wichtigste Han<strong>de</strong>lspartner Frankreichs (2003): Es exportiert 14,9 % seines Exportvolumens nach Deutschland, das seinerseits am Import mit 19,1 % beteiligt ist.<br />
Frankreich importierte 2009 Waren im Wert von ca. 532,2 Milliar<strong>de</strong>n US-Dollar und exportierte Waren im Wert von ca. 456,8 Milliar<strong>de</strong>n US-Dollar und hat damit ein Han<strong>de</strong>ls<strong>de</strong>fizit.[45]<br />
[46]<br />
Die größten französischen Unternehmen 2003 ohne Banken und Versicherungen<br />
1. Total – Umsatz 104,7 Mrd. € – 111.000 Beschäftigte<br />
2. Carrefour – Umsatz 70,5 Mrd. € – 419.000 Beschäftigte<br />
3. PSA Peugeot Citroën – Umsatz 54,2 Mrd. € – 200.000 Beschäftigte<br />
4. France Télécom – Umsatz 46,1 Mrd. € – 222.000 Beschäftigte<br />
5. EDF – Umsatz 44,9 Mrd. € – 167.000 Beschäftigte<br />
6. Suez – Umsatz 39,6 Mrd. € – 171.000 Beschäftigte<br />
7. Les Mousquetaires – Umsatz 38,4 Mrd. € – 112.000 Beschäftigte<br />
8. Renault – Umsatz 37,5 Mrd. € – 160.000 Beschäftigte<br />
9. Publicis Groupe – Umsatz 32,2 Mrd. € – 35.000 Beschäftigte<br />
10.Saint-Gobain – Umsatz 29,6 Mrd. € – 172.000 Beschäftigte<br />
11. Groupe Auchan – Umsatz 28,7 Mrd. € – 156.000 Beschäftigte<br />
12.Veolia Environnement – Umsatz 28,6 Mrd. € – 257.000 Beschäftigte<br />
13.Centres Leclerc – Umsatz 27,2 Mrd. € – 84.000 Beschäftigte<br />
Energie und Bo<strong>de</strong>nschätze
Die Energiewirtschaft Frankreichs beschäftigte 2008 194.000 Personen (0,8 % <strong>de</strong>r Erwerbsbevölkerung) und trug 2,1 % <strong>zu</strong>m BIP bei.[47] Ursprünglich verfügte Frankreich über reiche<br />
Kohlevorkommen, die Kohleför<strong>de</strong>rung erreichte jedoch bereits 1958 mit <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung von 60 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt. 1973 för<strong>de</strong>rte man noch 29,1 Millionen Tonnen, 2004<br />
schloss mit La Houve in Lothringen die letzte Kohlegrube Frankreichs. Kohle wird heute vor allem aus Australien, <strong>de</strong>n USA und Südafrika importiert und in <strong>de</strong>r Stahlindustrie und<br />
Wärmekraftwerken (6,9 GW installierte Leistung) verwen<strong>de</strong>t.[48]<br />
Frankreich verfügt über sehr geringe Vorkommen an Erdöl und Erdgas, die <strong>de</strong>n Gesamtverbrauch <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s für gera<strong>de</strong> zwei Monate <strong>de</strong>cken könnten. Neben <strong>de</strong>n knapp 1 Million Tonnen<br />
Öl, die jährlich in Frankreich selbst geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, wird Erdöl aus <strong>de</strong>m Nahen Osten (22 %), <strong>de</strong>n Nordsee-Anrainerstaaten (20 %), Afrika (16 %) und <strong>de</strong>r früheren Sowjetunion (29 %)<br />
importiert. Insgesamt verbrauchte Frankreich 2008 82 Millionen Öleinheiten an Erdölprodukten, davon knapp die Hälfte für <strong>de</strong>n Verkehr. Die 13 Raffinerien <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s können 98<br />
Millionen Tonnen Öl jährlich verarbeiten.[49] 22 % <strong>de</strong>s Energieverbrauches wird von Erdgas abge<strong>de</strong>ckt, vor allem im Wohnbereich und in <strong>de</strong>r Industrie. Das Erdgas im Wert von 26<br />
Milliar<strong>de</strong>n Euro, das Frankreich 2008 importierte, stammte vor allem aus Norwegen, Russland, Algerien und <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n.[50]<br />
Die Ölpreisschocks <strong>de</strong>r 1970er Jahre veranlassten die Regierung, ein Nuklearprogramm <strong>zu</strong> initiieren. Von <strong>de</strong>n 44 Millionen Öleinheiten an Energie, die Frankreich 1973 produzierte,<br />
waren noch 9 % Atomenergie. 2008 wur<strong>de</strong>n 137 Millionen Öleinheiten produziert, davon waren 84 % Atomenergie. Zu Beginn <strong>de</strong>s Jahres 2009 waren in Frankreich 21 Kernkraftwerke<br />
mit 59 Reaktoren und einer Gesamtleistung von 63,3 GW am Netz. In die Kernkraftwerke wur<strong>de</strong>n in Frankreich bisher 77 Milliar<strong>de</strong>n Euro investiert; man schätzt, dass durch die nukleare<br />
Energiegewinnung jährlich 31 Millionen Tonnen CO2 vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.[51] An<strong>de</strong>rerseits entstehen jährlich in <strong>de</strong>n Atomkraftwerken mehr als 700.000 m³ Atommüll. Von <strong>de</strong>n 442 TWh<br />
elektrischer Energie, die 2008 in Frankreich erzeugt wur<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n 65 % in <strong>de</strong>n Privathaushalten und weitere 27 % in <strong>de</strong>r Industrie verbraucht. Frankreich ist auch ein Stromexporteur,<br />
2008 wur<strong>de</strong>n 50 TWh an die Nachbarlän<strong>de</strong>r verkauft, größte Abnehmer sind Italien und Großbritannien. [52] Marktführer bei <strong>de</strong>r Erzeugung elektrischer Energie ist <strong>de</strong>r staatlich<br />
dominierte Konzern Électricité <strong>de</strong> France.<br />
Erneuerbare Energieträger spielen in Frankreich eine untergeordnete Rolle: 5,5 % <strong>de</strong>r Energie wer<strong>de</strong>n aus Wasserkraft, 8,7 % aus Holz, 2,1 % aus Biomasse, 1,2 % aus Müll und 0,49 %<br />
aus Wind gewonnen.[53]<br />
Staatshaushalt<br />
Der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von umgerechnet 1,445 Bio. US-Dollar, <strong>de</strong>m stan<strong>de</strong>n Einnahmen von umgerechnet 1,229 Bio. US-Dollar gegenüber. Daraus ergibt sich ein<br />
Haushalts<strong>de</strong>fizit in Höhe von 8,2 % <strong>de</strong>s BIP.[54]<br />
Die Staatsverschuldung betrug 2009 2,1 Bio. US-Dollar o<strong>de</strong>r 79,7 % <strong>de</strong>s BIP.[54]<br />
2006 betrug <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Staatsausgaben (in % <strong>de</strong>s BIP) folgen<strong>de</strong>r Bereiche:<br />
• Gesundheit:[55] 11,0 %<br />
• Bildung:[54] 5,7 % (2005)<br />
• Militär:[54] 2,6 % (2005)<br />
Kultur<br />
Frankreich leitet seinen Rang in Europa und <strong>de</strong>r Welt auch aus <strong>de</strong>n Eigenheiten seiner Kultur ab, die sich insbeson<strong>de</strong>re über die Sprache <strong>de</strong>finiert (Sprachschutz- und<br />
-pflegegesetzgebung). In <strong>de</strong>r Medienpolitik wird die eigene Kultur und Sprache durch Quoten für Filme und Musik geför<strong>de</strong>rt. Frankreich verfolgt in <strong>de</strong>r Europäischen Union, <strong>de</strong>r<br />
UNESCO und <strong>de</strong>r WTO mit Nachdruck seine Konzeption <strong>de</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>r kulturellen Vielfalt („diversité culturelle“): Kultur sei keine Ware, die schrankenlos frei gehan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Der Kultursektor bil<strong>de</strong>t daher eine Ausnahme vom restlichen Wirtschaftsgeschehen („exception culturelle“).<br />
Lan<strong>de</strong>sweite Pflege und Erhalt <strong>de</strong>s reichen materiellen kulturellen Erbes wird als Aufgabe von nationalem Rang angesehen. Dieses Verständnis wird durch staatlich organisierte o<strong>de</strong>r<br />
geför<strong>de</strong>rte Maßnahmen, die <strong>zu</strong>r Bildung eines nationalen kulturellen Bewusstseins beitragen, wirksam in die Öffentlichkeit transportiert. Im jährlichen Kulturkalen<strong>de</strong>r fest verankerte<br />
Tage <strong>de</strong>s nationalen Erbes, <strong>de</strong>r Musik o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kinos beispielsweise fin<strong>de</strong>n lebhaften Zuspruch in <strong>de</strong>r Bevölkerung. Großzügig <strong>zu</strong>geschnittene kulturelle Veranstaltungen entsprechen <strong>de</strong>m
Selbstverständnis Frankreichs als Kulturnation und von Paris als Kulturmetropole. Die För<strong>de</strong>rung eines kulturellen Profils <strong>de</strong>r regionalen Zentren in <strong>de</strong>r Provinz wird verstetigt.<br />
Architektur<br />
Die ältesten architektonischen Spuren in Frankreich hinterließen die Römer vor allem in Südostfrankreich, wie beispielsweise das Amphitheater von Nîmes o<strong>de</strong>r die Pont du Gard. Nach<br />
<strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>r römischen Herrschaft wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nächst keine Bauwerke errichtet, die bis heute erhalten geblieben sind. Aus <strong>de</strong>m Mittelalter sind vor allem Sakralbauten erhalten<br />
geblieben, wie das Baptisterium Saint-Jean aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Karolinger, Kirchen in gotischem Stil wie St-Sernin <strong>de</strong> Toulouse, Ste-Foy <strong>de</strong> Conques o<strong>de</strong>r Ste-Marie-Ma<strong>de</strong>leine <strong>de</strong> Vézelay<br />
sowie Kirchen in romanischem Stil wie die Kathedrale von Beauvais. Daneben wur<strong>de</strong>n Festungsstädte wie Carcassonne o<strong>de</strong>r Aigues-Mortes errichtet.<br />
Als die Renaissance auch in Frankreich aufkam, interpretierten die französischen Architekten diese Kunstform auf ihre Weise und errichteten zahlreiche Schlösser im ganzen Land. Das<br />
Schloss Ancy-le-Franc blieb das einzige vollständig von Italienern durchgeführte Bauwerk. Der Absolutismus führte da<strong>zu</strong>, dass <strong>de</strong>r klassizistische Barock in ganz Frankreich bestimmend<br />
wur<strong>de</strong>, um die Macht <strong>de</strong>s Königs <strong>zu</strong> symbolisieren. Zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Bauwerken dieser Zeit zählen <strong>de</strong>r Louvre und Schloss Versailles, diese wur<strong>de</strong>n auch <strong>zu</strong> vorbil<strong>de</strong>rn für<br />
Bauwerke im Ausland, etwa Schloss Sanssouci. Der technische Fortschritt ermöglichte es, Gebäu<strong>de</strong> wie das Panthéon <strong>zu</strong> errichten, das für damalige Verhältnisse sehr wenig Baumaterial<br />
im Verhältnis <strong>zu</strong>m umfassten Raum benötigte.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit nach <strong>de</strong>r französischen Revolution herrschte <strong>de</strong>r Klassizismus mit kühler, disziplinierter und eleganter Architektur; Beispiele hierfür sind <strong>de</strong>r Arc <strong>de</strong> Triomphe o<strong>de</strong>r die Kirche<br />
La Ma<strong>de</strong>leine in Paris. 1803 wur<strong>de</strong> die Académie <strong>de</strong>s Beaux-Arts gegrün<strong>de</strong>t, französische Architektur wur<strong>de</strong> erneut in zahlreichen Län<strong>de</strong>rn imitiert, beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n USA, gleichzeitig<br />
wur<strong>de</strong>n neue Baumaterialien eingeführt; es entstan<strong>de</strong>n Monumente wie <strong>de</strong>r Eiffelturm o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Pariser Zentralmarkt Les Halles und man begann mit <strong>de</strong>r Restaurierung von<br />
Bau<strong>de</strong>nkmälern.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>r Jugendstil auf, aus <strong>de</strong>m sich in Frankreich rasch das Art Déco entwickelte. In diesen Stilrichtungen sind zahlreiche Eingänge von<br />
Métrostationen in Paris sowie das Théâtre <strong>de</strong>s Champs-Élysées erhalten. Der Internationale Stil, <strong>de</strong>r maßgebend von Le Corbusier mitgetragen wur<strong>de</strong>, zeichnete sich durch unverzierte<br />
geometrische Formen aus, Beispiel ist die Villa Savoye. Nach <strong>de</strong>m zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong>n einige prestigeträchtige Bauten in Frankreich erstmals durch Auslän<strong>de</strong>r verwirklicht, wie das<br />
Centre Pompidou o<strong>de</strong>r die Pyrami<strong>de</strong> im Louvre. Zu <strong>de</strong>n neuesten architektonischen Errungenschaften Frankreichs gehören schließlich das Institut du mon<strong>de</strong> arabe und die Bibliothèque<br />
Nationale François Mitterrand.[56]<br />
Film und Kino<br />
Frankreich gilt als <strong>de</strong>r Geburtsort <strong>de</strong>s Filmes. Im Jahre 1895 veranstalteten die Brü<strong>de</strong>r Lumière in Paris die erste kommerzielle Filmvorführung. Industrielle wie Charles Pathé und Léon<br />
Gaumont investierten große Summen in die Technik und Herstellung, so dass französische Unternehmen <strong>de</strong>n Weltmarkt für Filme dominierten; in Paris gab es 1907 bereits mehr als 100<br />
Vorführungshallen, 1920 waren es in Frankreich schon mehr als 4500. Auf Pathé geht auch die bis heute übliche Praxis <strong>de</strong>s Filmverleihs <strong>zu</strong>rück, nach<strong>de</strong>m er 1907 entschied, Filme nicht<br />
mehr als Meterware <strong>zu</strong> verkaufen.[57] Der Ausbruch <strong>de</strong>s ersten Weltkrieges und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Flucht zahlreicher Filmschaffen<strong>de</strong>r in die USA sowie die Einführung <strong>de</strong>r Tonfilm-<br />
Technologie, die in Frankreich <strong>zu</strong>nächst nicht eingeführt wur<strong>de</strong>, führten da<strong>zu</strong>, dass <strong>de</strong>r Schwerpunkt <strong>de</strong>r Filmproduktion sich in die USA verlagerte.<br />
Die 1930er Jahre gelten als Gol<strong>de</strong>nes Zeitalter <strong>de</strong>s französischen Films. Die Weltwirtschaftskrise bedingten niedrige Budgets, junge Regisseure wie Jean Renoir und Stars wie Jean Gabin,<br />
Pierre Brasseur und Arletty brachten sehr kreative und teils auch sehr politische Werke hervor (Poetischer Realismus). Auch nach Ausbruch <strong>de</strong>s zweiten Weltkrieges florierte <strong>de</strong>r Film; die<br />
Vichy-Regierung grün<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>r Comité d’organisation <strong>de</strong> l’industrie cinématographique die Vorläuferorganisation <strong>de</strong>s heutigen CNC. Trotz Mangelwirtschaft, Zensur und Emigration<br />
entstan<strong>de</strong>n etwa 220 Filme, die sich vor allem auf die Ästhetik <strong>de</strong>s gezeigten konzentrierten.<br />
Nach 1945 setzt sich die französische Regierung das Ziel, die Filmindustrie wie<strong>de</strong>r auf<strong>zu</strong>bauen. Um die Dominanz <strong>de</strong>s amerikanischen Films <strong>zu</strong> brechen, wer<strong>de</strong>n im Blum-Byrnes-<br />
Abkommen Einfuhrquoten festgelegt. Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes wer<strong>de</strong>n gegrün<strong>de</strong>t, eine Zusammenarbeit mit Italien vereinbart und gesetzliche und finanzielle<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ngen beschlossen. In <strong>de</strong>n 1950er Jahren wur<strong>de</strong>n vor allem Literaturverfilmungen mit großem Augenmerk auf die Qualität (cinéma <strong>de</strong> papa) produziert, bis 1956 die weibliche<br />
Sexualität mit <strong>de</strong>m Auftauchen eines neuen Stars, Brigitte Bardot, filmfähig gemacht wur<strong>de</strong>.<br />
Die Nouvelle Vague, die ab <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1950er Jahre von einer Generation junger Regisseure wie Jean-Luc Godard, Clau<strong>de</strong> Chabrol und Jacques Rivette getragen wird, bringt Anti-
Hel<strong>de</strong>n auf die Leinwand, thematisiert <strong>de</strong>ren intime Gedanken, macht Filme mit hohem Tempo und offenen En<strong>de</strong>n. Neue Technik ermöglicht eine neue Ästhetik und erlaubt es Halb-<br />
Profis, mit niedrigem Budget Filme <strong>zu</strong> verwirklichen. Die Kreativität <strong>de</strong>r Nouvelle Vague war international äußerst einflussreich und wur<strong>de</strong> durch die Einrichtung <strong>de</strong>r Cinémas d'art et<br />
d'essai noch geför<strong>de</strong>rt. Das Jahr 1968 brachte auch im französischen Film eine Zäsur, die <strong>zu</strong> stark politischen Filmen und <strong>zu</strong> einer stärkeren Präsenz von Frauen im Metier führte.<br />
Gleichzeitig setzte sich das Fernsehen durch; dies brachte neue Strukturen bei <strong>de</strong>r Finanzierung und Distribution von Filmen mit sich.<br />
In <strong>de</strong>n 1980er Jahren investierte die neue sozialistische Regierung stark in die Kultur, Budgets für Filmproduktionen stiegen, während gleichzeitig die amerikanische Vorherrschaft<br />
bekämpft wur<strong>de</strong>. Es kam <strong>zu</strong> aufwändigen Verfilmungen von Literaturklassikern. Parallel kam die Strömung <strong>de</strong>s unpolitischen cinéma du look auf, in <strong>de</strong>m Farben, Formen und Stil die<br />
Handlung über<strong>de</strong>ckten.[58]<br />
Naturschutz<br />
Frankreich unterhält Naturschutzgebiete verschie<strong>de</strong>ner Kategorien im europäischen Kernland und in <strong>de</strong>n Übersee-Départements. Es sind dies <strong>de</strong>rzeit:<br />
• 9 Nationalparks mit einer Fläche von etwa 4,5 Millionen Hektar<br />
• 45 Regionale Naturparks mit einer Fläche von mehr als 7 Millionen Hektar sowie<br />
• eine Vielzahl von Schutzzonen, wie<br />
• Naturreservate (Réserve Naturelle),<br />
• Natura 2000 – Gebiete <strong>de</strong>r EU,<br />
• Biosphärenreservate <strong>de</strong>r UNESCO.<br />
Weitere Naturschutzgebiete sind in Planung und Vorbereitung.<br />
Sport<br />
An<strong>de</strong>rs als in vielen an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn ist <strong>de</strong>r Fußball in Frankreich bis heute nicht die unangefochtene Nummer 1 unter <strong>de</strong>n Sportarten. Beson<strong>de</strong>rs Rugby ist im Südwesten <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
populärer. Das Interesse am Fußball hängt sehr stark mit <strong>de</strong>r Leistung französischer Mannschaften auf internationaler Ebene <strong>zu</strong>sammen. Als i<strong>de</strong>ntitätsstiften<strong>de</strong>s Band gera<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n<br />
verschie<strong>de</strong>nen sozialen und ethnischen Gruppen Frankreichs gilt die französische Fußball-Nationalmannschaft. Die so genannte équipe tricolore trägt ihre Heimspiele meist im Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
France in Saint Denis bei Paris aus.<br />
1998 wur<strong>de</strong> in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Im Endspiel gegen Brasilien gewann <strong>de</strong>r Gastgeber das Turnier.<br />
Ähnlich populär <strong>de</strong>m Fußball ist Rugby Union. Gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n südlichen und südwestlichen Regionen ist Rugby tatsächlich <strong>de</strong>r weitaus beliebteste Sport. Die höchste Liga ist die Top 14<br />
(siehe auch Rugby Union in Frankreich). Das Meisterschaftsendspiel fin<strong>de</strong>t jährlich im Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> France statt. Die Nationalmannschaft, von <strong>de</strong>n Fans „Les Bleus“ genannt, was später auch<br />
auf die Fußballequipe übertragen wur<strong>de</strong>, gilt seit Jahrzehnten kontinuierlich als eines <strong>de</strong>r besten Teams <strong>de</strong>r Welt und war bislang bei je<strong>de</strong>r Weltmeisterschaft min<strong>de</strong>stens ins Viertelfinale<br />
vorgedrungen. Insgesamt wur<strong>de</strong> sie zweimal Vizeweltmeister und errang einmal <strong>de</strong>n dritten Platz. Nationalstadion ist das Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> France in St. Denis nahe Paris. Die besten<br />
Vereinsmannschaften <strong>de</strong>r letzten Jahre sind Sta<strong>de</strong> Toulousain, das insgesamt 16 Mal die französische Meisterschaft und dreimal <strong>de</strong>n europäischen Heineken Cup gewinnen konnte, <strong>de</strong>r<br />
aktuelle Meister Sta<strong>de</strong> Français aus Paris mit 13 Meisterschaftserfolgen und <strong>de</strong>r Meister <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Vorjahre Biarritz Olympique mit fünf nationalen Meisterschaftstiteln.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit vom 7. September bis <strong>zu</strong>m 20. Oktober 2007 fand erstmals die Rugbyweltmeisterschaft in Frankreich statt und man zählte „Les Bleus“ <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Topfavoriten auf <strong>de</strong>n Titel.<br />
Allerdings kamen sie nicht über einen 4. Platz hinaus. Weltmeister wur<strong>de</strong> Südafrika.<br />
Weitere populäre Sportarten sind <strong>de</strong>r Radsport (insbeson<strong>de</strong>re im Juli, während <strong>de</strong>r dreiwöchigen Tour <strong>de</strong> France), Leichtathletik, Formel 1 (Großer Preis von Frankreich in Magny Cours)<br />
und Pétanque (Mondial la Marseille à Pétanque)<br />
Großer Beliebtheit erfreut sich in <strong>de</strong>n vergangenen Jahren auch Tennissport. 1997 und 2003 konnten die Französischen Tennisdamen <strong>de</strong>n Fed Cup gewinnen. Außer<strong>de</strong>m siegte Mary
Pierce im Jahre 2000 bei <strong>de</strong>n French Open.<br />
In Frankreich fan<strong>de</strong>n bereits mehrmals Olympische Spiele statt: Sommerspiele 1900 und 1924 in Paris, Winterspiele in Chamonix 1924, Grenoble 1968 und Albertville 1992.<br />
Musik<br />
Die französische Musik erreichte mit <strong>de</strong>r Klassik eine erste Blüte. Komponisten wie Lully, Charpentier (16. Jahrhun<strong>de</strong>rt), Rameau (17. Jahrhun<strong>de</strong>rt), Berlioz, Gounod und Bizet. Die<br />
französische klassische Musik galt jedoch als technik- und formenlastig.[59] Den Übergang <strong>zu</strong>r Mo<strong>de</strong>rne in gesellschaftspolitischer wie musikalischer Sicht verkörpert Debussy am<br />
besten; weiters sind Maurice Ravel und <strong>de</strong>r ebenfalls sehr experimentell arbeiten<strong>de</strong> Erik Satie in dieser Epoche be<strong>de</strong>utend.[60] Der Beginn <strong>de</strong>r Avantgar<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Musik wird beson<strong>de</strong>rs<br />
durch die Groupe <strong>de</strong>s Six eingeleitet. Hauptfigur <strong>de</strong>r zeitgenössischen Musik ist Pierre Boulez.<br />
Seit <strong>de</strong>m Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts befin<strong>de</strong>t sich die populäre Musik im Aufwind. Das bekannteste einheimische Genre ist das Chanson, eine Liedgattung mit starker Konzentration auf<br />
<strong>de</strong>n Text. Die wichtigsten Künstler <strong>de</strong>s Chanson sind Édith Piaf, Boris Vian, Georges Brassens, Charles Aznavour o<strong>de</strong>r Yves Montand. Ausländische Musikstile fin<strong>de</strong>n ihren Wi<strong>de</strong>rhall in<br />
Frankreich: Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ersten Weltkrieges begann <strong>de</strong>r Jazz die französische Musik <strong>zu</strong> beeinflussen, mit Django Reinhardt o<strong>de</strong>r Stéphane Grappelli stellte Frankreich auch<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Künstler <strong>de</strong>s Jazz.<br />
In <strong>de</strong>r Rock- und Popmusik prägten etwa Daft Punk und Étienne <strong>de</strong> Crécy <strong>de</strong>n French House, Gotan Project ist Vorreiter <strong>de</strong>s so genannten Electrotango und St. Germain steht für eine<br />
Kombination von Jazz und House. Air wie<strong>de</strong>rum ist ein bekannter Vertreter von Ambient-Musik. Der Rap wur<strong>de</strong> in Frankreich adaptiert, erfolgreichster Vertreter <strong>de</strong>s Französischen Hip-<br />
Hop ist MC Solaar.[59]<br />
Lokal verbreitete Musikstile sind die Bretonische Musik, <strong>de</strong>ren be<strong>de</strong>utendster Künstler Alan Stivell ist, o<strong>de</strong>r die Korsische Musik mit Bands wie I Muvrini. Zahlreiche afrikanische und<br />
maghrebinische Künstler leben und arbeiten in Frankreich, so gibt es eine lebendige Raï-Szene und zahlreiche Veranstaltungen mit afrikanischer Musik.<br />
Die fünf Musiker, die zwischen 1955 und 2009 die meisten Platten in Frankreich verkauften, sind Clau<strong>de</strong> François, Johnny Hallyday, Sheila, Michel Sardou und Jean-Jacques Goldman.<br />
[61]<br />
Medien<br />
Die wichtigsten französischen Printmedien sind die nationalen Tageszeitungen:<br />
• Le Mon<strong>de</strong> (Linksliberal, Druckauflage 2003 ca. 500.000 Exemplare)<br />
• Libération (linksorientiert, 200.000 Exemplare)<br />
• Le Figaro (konservativ, Auflage: 450.000 Exemplare)<br />
• Les Échos, La Tribune (Wirtschaft, 180.000 bzw. 125.000 Exemplare)<br />
• L’Humanité (kommunistisch, 74.000 Exemplare)<br />
• La Croix (katholisch, 114.000 Exemplare)<br />
• L’Équipe (Sport, 485.000 Exemplare)<br />
Die wichtigsten Nachrichtenmagazine in Frankreich:<br />
• Le Nouvel Observateur (400.000 Exemplare)<br />
• L’Express (400.000 Exemplare)<br />
• Le Point (400.000 Exemplare)<br />
Marianne
Größte Regionalzeitung ist die Ouest-France mit einer Druckauflage von 900.000 Exemplaren.<br />
Be<strong>de</strong>utend ist auch das jeweils mittwochs erscheinen<strong>de</strong> Investigations- und Satireblatt Le Canard enchaîné mit einer Auflage von 550.000 Exemplaren.<br />
Fernsehen<br />
Wie in vielen an<strong>de</strong>ren europäischen Län<strong>de</strong>rn besteht auch in Frankreich eine Co-Existenz von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsen<strong>de</strong>rn. Zur 1992 gegrün<strong>de</strong>ten öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunkanstalt France Télévisions gehören die Sen<strong>de</strong>r France 2, France 3, France 4, France 5 und France Ô.<br />
Des Weiteren gibt es mit TV5 und ARTE zwei weitere Sen<strong>de</strong>r, an <strong>de</strong>nen France Télévisions beteiligt ist. TV5 ist ein französischsprachiges Gemeinschaftsprogramm <strong>de</strong>r Staaten<br />
Frankreich, Belgien, <strong>de</strong>m französischsprachigen Teil Kanadas und <strong>de</strong>r Schweiz. ARTE ist ein <strong>de</strong>utsch-französischer Sen<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r von ARTE France <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen<br />
Rundfunkanstalten ARD und ZDF betrieben wird. France Télévisions ist darüber hinaus an <strong>de</strong>m Nachrichtensen<strong>de</strong>r EuroNews beteiligt.<br />
Der größte Fernsehsen<strong>de</strong>r Frankreichs ist <strong>de</strong>r Privatsen<strong>de</strong>r TF1, <strong>de</strong>r bis 1987 noch öffentlich-rechtlich war. TF1 ist außer<strong>de</strong>m alleiniger Gesellschafter <strong>de</strong>s Sportsen<strong>de</strong>rs Eurosport. Seit<br />
Dezember 2006 sen<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r von TF1 und France Télévisions produzierte französische Nachrichtensen<strong>de</strong>r France24.<br />
Bibliotheken<br />
Die Bibliotheken sind weitgehend Mediatheken und konnten in <strong>de</strong>n vergangenen 15 Jahren ihre Benutzerzahl verdoppeln (2005: 21 Millionen; 1989: 10,5). Mehr als 40 Prozent <strong>de</strong>r<br />
Franzosen über 15 Jahren sind eingeschriebene Bibliotheksgänger und leihen <strong>zu</strong> 90 Prozent Bücher aus. Im Angebot sind meist auch CDs und DVDs und Internetnut<strong>zu</strong>ng. (Quelle: F.A.Z.<br />
6. Juni 2006)<br />
Feiertage<br />
• 1. Januar Neujahr<br />
• 1. Mai Tag <strong>de</strong>r Arbeit/Maifeiertag<br />
• 8. Mai Tag <strong>de</strong>s Sieges (fête <strong>de</strong> la victoire)<br />
• 7 Wochen nach Ostern Pfingstmontag<br />
• 10 Tage vor Pfingsten Christi Himmelfahrt (jour <strong>de</strong> l’Ascension)<br />
• 14. Juli Tag <strong>de</strong>s 14. Juli („Fête nationale“) – Jahrestag <strong>de</strong>s Sturms auf die Bastille 1789<br />
• 15. August Maria Himmelfahrt<br />
• 1. November Allerheiligen<br />
• 11. November Waffenstillstand von Rethon<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>r Beendigung <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges<br />
• Dezember Weihnachtsfeiertag<br />
Literatur<br />
• Alfred Pletsch: Län<strong>de</strong>rkun<strong>de</strong> Frankreich. WBG Darmstadt 2003, 2. Aufl. ISBN 3-534-11691-7<br />
• Wilfried Loth: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Frankfurt 1995, ISBN 3-596-10860-8.<br />
• Bernhard Schmidt, Jürgen Doll, Walther Fekl, Siegfried Loewe und Fritz Taubert: Frankreich-Lexikon. Schlüsselbegriffe <strong>zu</strong> Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Geschichte, Kultur,<br />
Presse- und Bildungswesen. 2. überarbeitete Auflage 2005 ISBN 3-503-06184-3, Studienausgabe 2007, ISBN 3-503-07991-2<br />
• Ralf Nestmeyer: Französische Dichter und ihre Häuser. Insel, Frankfurt 2005, ISBN 3-458-34793-3.<br />
• Informationen <strong>zu</strong>r politischen Bildung Heft Nr. 285 Frankreich mit Karten, (auch online einsehbar, jedoch ohne die Karten und Bil<strong>de</strong>r) BpB Bonn 2004 (mit Literatur, Internet-
Hinweisen)<br />
• Adolf Kimmel & Henrik Uterwed<strong>de</strong> (Hgg): Län<strong>de</strong>rbericht Frankreich BpB, Schriftenreihe Band 462, 2. Aufl. 2005 ISBN 3-89331-574-8<br />
• Karl Stoppel Hg.: La France. Regards sur un pays voisin. Eine Textsammlung <strong>zu</strong>r Frankreichkun<strong>de</strong> Quellen und Originaltexte, in frz. Sprache, Vokabular. Reclam, Ditzingen<br />
2000; 2. durchges. Aufl. Stuttgart 2008 (RUB 8906 Fremdsprachentexte)<br />
• Ludwig Watzal (Verantw.): Frankreich Zs. Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage <strong>zu</strong> „Das Parlament“, 38/2007 v. 17. 9., Hg. Bun<strong>de</strong>szentrale für politische Bildung BpB, Bonn<br />
2007 (Schwerpunktheft) ISSN 0479-611X<br />
• Robert Picht u.a. Hgg.: Frem<strong>de</strong> Freun<strong>de</strong>. Deutsche und Franzosen vor <strong>de</strong>m 21. Jahrhun<strong>de</strong>rt Piper, München 2002 ISBN 3-492-03956-1 (57 Essays von 52 Autoren <strong>zu</strong> Begriffen<br />
<strong>de</strong>r dt.-frz. Geschichte, Politik, Kultur und Wirtschaft, u.a. Hans Manfred Bock, Freimut Duve, Etienne François)<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Auswärtiges Amt<br />
2. ↑ a b Institut National <strong>de</strong> la Statistique et <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Économiques: Bilan démographique 2009<br />
3. ↑ a b Institut National <strong>de</strong> la Statistique et <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Économiques: Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2010, France métropolitaine<br />
4. ↑ Human Development Report 2009, abgerufen am 13. November 2009<br />
5. ↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.234<br />
6. ↑ a b Ernst Ulrich Grosse und Heinz-Helmut Lüger: Frankreich verstehen, Darmstadt 1997, S. 168ff<br />
7. ↑ a b c d e f g Insee: Bilan démographique 2009 - Deux pacs pour trois mariages, Januar 2010, besucht am 26. Januar 2010<br />
8. ↑ Eurostat: Taux <strong>de</strong> fertilité total, besucht am 26. Januar 2010<br />
9. ↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.241<br />
10.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.238<br />
11.↑ a b c d Ernst Ulrich Grosse und Heinz-Helmut Lüger: Frankreich verstehen, Darmstadt 1997, S. 173ff<br />
12.↑ Insee: Population selon la nationalité , besucht am 26. Januar 2010<br />
13.↑ a b Catherine Borrel, Insee: Enquêtes annuelles <strong>de</strong> recensement 2004 et 2005 - Près <strong>de</strong> 5 millions d’immigrés à la mi-2004 , besucht am 26. Januar 2010<br />
14.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.256ff<br />
15.↑ Auswärtiges Amt <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland: Frankreich: Kultur und Bildung, Stand Oktober 2009, besucht am 20. Januar 2010.<br />
16.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.247<br />
17.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.251<br />
18.↑ Legifrance: La Constitution du 4 Octobre 1958, besucht am 28. Dezember 2009.<br />
19.↑ Französisches Außenministerium: Der Laizismus in Frankreich, Mai 2007<br />
20.↑ Institut National <strong>de</strong> la Statistique et <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Économiques: Les valeurs en France, 2002/2003, S.4<br />
21.↑ Pew Global Attitu<strong>de</strong>s Project: Unfavourable Views of Jews and Moslems on the Increase in Europe, 17. September 2008, S. 5<br />
22.↑ Library of Congress - Fe<strong>de</strong>ral Reserve Division: Country Profile France, S. 2-5<br />
23.↑ Stephen C. Jett und Lisa Roberts: Mo<strong>de</strong>rn World Nations - France, Phila<strong>de</strong>lphia 2003, ISBN 0-7910-7607-5, S.35-64<br />
24.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.93f<br />
25.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.107f<br />
26.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.101f
27.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.119ff<br />
28.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.133ff<br />
29.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.104ff<br />
30.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.146ff<br />
31.↑ France Diplomatie: Außenpolitische Maßnahmen, besucht am 17. Januar 2010<br />
32.↑ Die Presse: Parlament segnet Frankreichs Rückkehr in die Nato ab vom 17. März 2009.<br />
33.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.206<br />
34.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.219<br />
35.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.215<br />
36.↑ Insee: Département::Définition, besucht am 20. Januar 2010<br />
37.↑ a b Insee: Circonscriptions administratives <strong>de</strong>s régions au 1er janvier, Stand 1. Januar 2009, besucht am 20. Januar 2010<br />
38.↑ Insee: Arrondissement::Définition, besucht am 20. Januar 2010<br />
39.↑ Haensch, Günther und Tümmers, Hans J.: Frankreich: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. München 1993, ISBN 3-406-37491-3, S.208<br />
40.↑ Insee: Commune::Définition, besucht am 20. Januar 2010<br />
41.↑ Süd<strong>de</strong>utsche Zeitung: Frankreich verkauft Autobahnen für 14,8 Milliar<strong>de</strong>n Euro, 14. Dezember 2005<br />
42.↑ Aéroports <strong>de</strong> Paris: Présentation <strong>de</strong>s résultats 2008, 12. März 2009<br />
43.↑ Institut National <strong>de</strong> la Statistique et <strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Économiques: Montant du salaire minimum interprofessionell <strong>de</strong> croissance (SMIC)<br />
44.↑ Eurostat News Release 63/2006: Regional GDP per inhabitant in the EU 25[1]<br />
45.↑ The World Factbook: Importe Frankreichs 2009 (englisch)<br />
46.↑ The World Factbook: Exporte Frankreichs 2009 (englisch)<br />
47.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.2<br />
48.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.2, S.12-14<br />
49.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.5, S.15-18<br />
50.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.19-21<br />
51.↑ Ministère <strong>de</strong> l'Économie, <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> l'Industrie: L'energie nucleaire - présentation générale, 31. Oktober 2006, besucht am 30. Januar 2010<br />
52.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.2, S.5, S.23<br />
53.↑ Commissariat général au développement durable: Chiffres clés <strong>de</strong> l'énergie, édition 2009, Dezember 2009, S.27<br />
54.↑ a b c d The World Factbook<br />
55.↑ Der Fischer Weltalmanach 2010: Zahlen Daten Fakten, Fischer, Frankfurt, 8. September 2009, ISBN 978-3-596-72910-4<br />
56.↑ David A. Hanser: Architecture of France, Westport 2006, ISBN 0-313-31902-2, S. xxii ff.<br />
57.↑ Jean-Pierre Jeancolas: Histoire du cinéma français, éd. Nathan 2000, ISBN 2-09-190742-1, S.19<br />
58.↑ Jill Forbes und Sue Harris: Cinema, in: Nicholas Hewit (Hrsg.): The Cambridge Companion to mo<strong>de</strong>rn French culture, Cambridge 2003, ISBN 0-521-79123-5, S. 319-336<br />
59.↑ a b Colin Nettelbeck: Music, in: Nicholas Hewit (Hrsg.): The Cambridge Companion to mo<strong>de</strong>rn French culture, Cambridge 2003, ISBN 0-521-79123-5, S. 272-289<br />
60.↑ Memo.fr: La musique française, besucht am 27. August 2010.<br />
61.↑ Musique-franco.com: La musique française: artistes connus, histoires et paroles <strong>de</strong> chansons, besucht am 27. August 2010.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Franzosen<br />
Franzosen sind eine romanisch-sprachige Nation in Westeuropa. Im Selbstverständnis <strong>de</strong>r Französischen Republik ist die Nation keine ethnische Gruppe, viele Franzosen lehnen <strong>de</strong>n<br />
Gedanken an eine über die Staatsbürgerschaft hinausgehen<strong>de</strong> ethnische Zuordnung ab.[1] Dem stehen nationalistische bzw. rassistische Auffassungen entgegen, französischen<br />
Staatsbürgern, die aus Gebieten außerhalb <strong>de</strong>s europäischen Frankreich stammen, aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion o<strong>de</strong>r ethnischen Herkunft die Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m Staatsvolk<br />
absprechen.<br />
Einige Min<strong>de</strong>rheiten in Frankreich bezeichnen sich selbst etwa als Bretonen, Okzitanier,[2] Elsässer o<strong>de</strong>r Korsen. Sie beanspruchen damit für ihre jeweilige Gruppe <strong>de</strong>n Status einer<br />
eigenen ethnischen Gruppe und grenzen sich auf diese Weise von <strong>de</strong>r Titularnation <strong>de</strong>r „Franzosen“ im ethnischen Sinne ab.<br />
Französische Ethnogenese<br />
Mo<strong>de</strong>rne Mythen über antike Vorfahren<br />
Der französische Nationalmythos beginnt bereits mit <strong>de</strong>n Kelten (Gallier), jenem indoeuropäischen Stamm, <strong>de</strong>r sich am frühesten gelöst hatte und am weitesten nach Westen<br />
vorgedrungen war, und in <strong>de</strong>n fünf Jahrhun<strong>de</strong>rten bis <strong>zu</strong>r Eroberung durch Caesar (seit 58 v. Chr.) eine eigene Kultur entwickelt hatte. Zu <strong>de</strong>n mächtigsten Stämmen gehörten die Arverner<br />
im Gebirgsland <strong>de</strong>r Auvergne und die Äduer zwischen Saône und Loire.[3][4][5] Die indoeuropäischen Kelten hatten <strong>zu</strong>vor die Urbevölkerung (z. B. Ligurer) in <strong>de</strong>n Sü<strong>de</strong>n abgedrängt,<br />
nur ein Zweig <strong>de</strong>r Iberer, die Aquitaner, hat sich bis heute in geringen Resten in <strong>de</strong>n westlichen Tälern <strong>de</strong>r Pyrenäen erhalten. Der Name Gascogne (vasconia) erinnert an die frühere<br />
weitere Ausbreitung <strong>de</strong>r Basken, die in Frankreich aber nicht – wie in Spanien – ihre nationale Son<strong>de</strong>rstellung bewahrt haben.<br />
Ein National<strong>de</strong>nkmal für <strong>de</strong>n legendären Gallierfürsten Vercingetorix wur<strong>de</strong> erst 1864 von Napoleon III. errichtet, seine trotzige Kapitulation vor Caesar wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r französischen<br />
Nie<strong>de</strong>rlage im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) <strong>zu</strong>m nationalen Mythos überhöht.<br />
Nach <strong>de</strong>r römischen Eroberung hatte sich <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>s keltischen A<strong>de</strong>ls assimiliert, große Teile <strong>de</strong>r keltischen Bevölkerung waren daraufhin mit Römern <strong>zu</strong> einer galloromanischen<br />
Bevölkerung verschmolzen o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st vermischt und romanisiert. Sie genossen römische Bürgerrechte und waren spätestens im 4. Jahrhun<strong>de</strong>rt christianisiert wor<strong>de</strong>n.<br />
Vermischungen <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rungszeit<br />
Die christianisierte galloromanische Bevölkerung wur<strong>de</strong> im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung im Südosten <strong>zu</strong>nächst von Burgun<strong>de</strong>rn, im Südwesten von Westgoten und allesamt schließlich<br />
von toxandrischen Franken unterworfen. Die Franken waren ihrerseits allerdings selbst ein buntes Gemisch „freier“ Stämme. Gegenüber einigen Millionen unterworfener Galloromanen<br />
zählte die Oberschicht <strong>de</strong>r fränkischen Eroberer nur einige Hun<strong>de</strong>rttausend, mit <strong>de</strong>r (katholischen) Taufe <strong>de</strong>s Frankenkönigs Chlodwigs (um 500) verband sie sich mit <strong>de</strong>m einheimischen<br />
A<strong>de</strong>l, allmählich bil<strong>de</strong>te sich eine neue Mischbevölkerung heraus. Zu <strong>de</strong>n germanischen Völkern <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung kamen ab <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch die Normannen in <strong>de</strong>r<br />
Normandie hin<strong>zu</strong>. Bei diesen zeigte sich die Assimilationsfähigkeit <strong>de</strong>r galloromanischen Mehrheit am <strong>de</strong>utlichsten: innerhalb weniger Generationen waren die Normannen ganz in ihr
aufgegangen und francophone Normannen eroberten England sowie Süditalien.<br />
Die ebenfalls im Rahmen <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung erst im 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt eingewan<strong>de</strong>rten, nichtromanischen (keltischen) Bretonen behielten ihre Eigenart hingegen bis heute bei.<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r Ausbildung eines christlichen Universalreiches unter Karl <strong>de</strong>m Großen hatte die galloromanische Kultur eine kosmopolitische Prägung erhalten. Nach <strong>de</strong>r Teilung <strong>de</strong>s<br />
Reiches 843 zeigte sich <strong>zu</strong>m ersten Mal die Einheit <strong>de</strong>r galloromanischen Nation im Aufkommen <strong>de</strong>r neuen Sprache.[3] Im Nor<strong>de</strong>n und Osten fiel <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>s einstigen<br />
Siedlungsgebiets <strong>de</strong>r germanischen Franken bei <strong>de</strong>r Reichsteilung an das Ostfrankenreich (das spätere Deutschland), im Westfrankenreich (das spätere Frankreich) dominierte das<br />
Galloromanische. Bis ins 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> jedoch <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st i<strong>de</strong>ell sowohl von karolingisch-westfränkischen als auch von ostfränkischen Herrschern an <strong>de</strong>r Reichseinheit<br />
festgehalten, die Entstehung <strong>de</strong>s ersten französischen Staates wird daher von <strong>de</strong>n meisten Historikern erst mit <strong>de</strong>r Königskrönung Hugo Capets (987) angesetzt.<br />
Nation und Nationalstaat im Mittelalter<br />
Die Vermischung von Franken und Galloromanen war von Nord nach Süd in unterschiedlich intensivem Maße erfolgt. Im Sü<strong>de</strong>n gab es noch eine Zeitlang burgundische und gotische, im<br />
Nor<strong>de</strong>n und Osten fränkische Siedlungsreste. Zu<strong>de</strong>m bil<strong>de</strong>te Südfrankreich noch um 1000 eine romanische Sprachbrücke eher nach Spanien (Okzitaner, Katalanen) als nach<br />
Nordfrankreich. Diese Unterschie<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n durch die zwischenzeitliche Schwäche <strong>de</strong>s Pariser Königtums gegenüber regionalen Herzögen und später gegenüber englischen Königen<br />
geför<strong>de</strong>rt.<br />
Im Ergebnis mehrerer Schlüsselereignisse <strong>de</strong>s Mittelalters bil<strong>de</strong>te sich schließlich eine französische Nation bzw. ein früher Nationalstaat heraus<br />
• während <strong>de</strong>r Kreuzzüge kämpften Nordfranzosen und Südfranzosen gemeinsam, ihr Anführer Ludwig <strong>de</strong>r Heilige († 1270) wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m französischen Nationalheiligen<br />
• mit <strong>de</strong>m Albigenserkreuz<strong>zu</strong>g bzw. <strong>de</strong>r Eroberung <strong>de</strong>r Grafschaft Toulouse wur<strong>de</strong> die religiöse, kulturelle und staatliche Einigung abgeschlossen, die Südfranzosen stan<strong>de</strong>n fortan<br />
unter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Nordfranzosen<br />
• <strong>de</strong>r Gallikanismus trug <strong>zu</strong>r Herausbildung einer von Rom unabhängigen katholischen Nationalkirche bei<br />
• im Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg behauptete Frankreich seine nationale Unabhängigkeit gegenüber einer englischen Dynastie (neben <strong>de</strong>m französischen entstand so auch ein englisches<br />
Nationalbewusstsein) und Burgund, Jeanne d’Arc († 1431) wur<strong>de</strong> (neben Ludwig) <strong>zu</strong>r Nationalheiligen<br />
• die Gefahr eines burgundischen Gegenreiches wur<strong>de</strong> durch die Aufteilung <strong>de</strong>s burgundischen Erbes abgewen<strong>de</strong>t und <strong>de</strong>r französische Nationalstaat abgerun<strong>de</strong>t<br />
Nationalbewusstsein <strong>de</strong>r Neuzeit<br />
Zur endgültigen Herausbildung eines Nationalbewusstseins kam es bei <strong>de</strong>n Franzosen in Folge <strong>de</strong>r Französischen Revolution ab 1789. Die Nation <strong>de</strong>finierte sich nicht im ethnischen Sinn<br />
als Abgren<strong>zu</strong>ng von Nachbarvölkern son<strong>de</strong>rn im <strong>de</strong>mokratischen Sinn als Vertreter <strong>de</strong>s Volkswillens und somit als souveräner Gegenspieler gegen ein absolutes Königtum. Nicht die<br />
Einwohner von Paris o<strong>de</strong>r die französischsprachigen Katholiken, son<strong>de</strong>rn die Delegierten <strong>de</strong>s Dritten Stands proklamierten sich daher <strong>zu</strong>r Nationalversammlung (Ballhausschwur). Die<br />
Nation wur<strong>de</strong> eine Staatsnation, sie bestand nicht primär aus ethnischen Franzosen, son<strong>de</strong>rn aus Citoyen bzw. <strong>de</strong>m Wahlvolk mit staatsbürgerlichen Rechten und republikanischen I<strong>de</strong>alen.<br />
Die nicht-französischsprachigen Staatsbürger wur<strong>de</strong>n allerdings durch die Wehrpflicht und später durch die Schulpflicht bzw. die damit verbun<strong>de</strong>ne obligatorische Verwendung und<br />
Verbreitung <strong>de</strong>r offiziellen Amtssprache assimiliert und franzosisiert, das Hochfranzösische verdrängte z. B. das Okzitanische fast völlig. Das mit <strong>de</strong>m Papsttum geschlossene Konkordat<br />
von 1801 bestätigte die Mehrheitsstellung <strong>de</strong>s Katholizismus und führte gleichzeitig die Trennung von Staat und Religion ein, bis 1905 mit <strong>de</strong>m Gesetz <strong>zu</strong>r Trennung von Religion und<br />
Staat <strong>de</strong>r Laizismus gesetzlich festgelegt wur<strong>de</strong>.<br />
Das neue Selbstbewusstsein <strong>de</strong>s sich auf die römische Republik (z. B. Brutus) berufen<strong>de</strong> Bürgertums, das schließlich in <strong>de</strong>r Hinrichtung <strong>de</strong>s Königs (1793) kulminierte, griff in <strong>de</strong>n<br />
Revolutionskriegen auch auf die französische Bauernschaft über (die damals 90 % <strong>de</strong>r Bevölkerung ausmachte) und entwickelte sich <strong>zu</strong> einem Sendungsbewusstsein. Die Gran<strong>de</strong> Nation<br />
sah sich fortan als Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit und die Einigung Europas unter französischer Vorherrschaft, was auch nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage Napoleons anhielt (Julirevolution<br />
von 1830, Februarrevolution 1848, Pariser Kommune 1871, Stu<strong>de</strong>ntenrevolte 1968). Marianne wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Symbol <strong>de</strong>r Freiheit und <strong>zu</strong>m i<strong>de</strong>alistischen Prototyp <strong>de</strong>r französischen Frau.<br />
Napoleon I. allerdings hatte schon 1799 das römisch-republikanische Vorbild durch das römisch-imperiale Vorbild (Caesar) ersetzt und eine französische Vorherrschaft wie schon unter
Karl <strong>de</strong>m Großen und <strong>de</strong>m Sonnenkönig Ludwig XIV. angestrebt. Als Repräsentant <strong>de</strong>r Volkssouveränität krönte sich Napoleon <strong>zu</strong>m Kaiser <strong>de</strong>r Franzosen (empereur <strong>de</strong>s Français), nicht<br />
<strong>zu</strong>m Kaiser von Frankreich. Das 50-Millionen-Einwohner-Kaiserreich schloss Millionen Deutsche, Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r, Italiener und Kroaten als französische Staatsbürger ein. Die<br />
bourbonische Restauration bemühte sich, die bürgerlich-freiheitlich-republikanischen I<strong>de</strong>ale durch religiös-monarchistische Inhalte <strong>zu</strong> ersetzen, (so wur<strong>de</strong>n die 1823 <strong>zu</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung<br />
<strong>de</strong>r liberalen Revolution in Spanien einfallen<strong>de</strong>n bourbonischen Truppen als die „100.000 Söhne <strong>de</strong>s heiligen Ludwig“ bezeichnet, die Jesuitische Mission in Übersee wur<strong>de</strong> geför<strong>de</strong>rt),<br />
doch spätestens seit <strong>de</strong>r Orientkrise bzw. <strong>de</strong>r Rheinkrise von 1840 kam wie<strong>de</strong>r eine nationalistische Note hin<strong>zu</strong>, die religiöse Komponente geriet spätestens mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Monarchie<br />
ins Hintertreffen. Ab 1852 propagierte Napoleon III. <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Panlatinismus. So entstand auch auf kolonialistischem Gebiet ein zivilisatorisches und missioniarisches Sendungsbewusstsein,<br />
welches nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage im Deutsch-Französischen Krieg auch einen revanchistischen Chauvinismus hervorbrachte und kurz nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs (1919) in einem<br />
erneuten französischen Hegemonieanspruch über Europa führte. Eine Erneuerung <strong>de</strong>s französischen Nationalbewusstseins auf <strong>de</strong>r Rechten bewirkte in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit <strong>de</strong>r Gaullismus:<br />
Anstelle <strong>de</strong>r katholisch-konservativen o<strong>de</strong>r faschistischen I<strong>de</strong>en trat ein positiver Be<strong>zu</strong>g auf die Errungenschaften <strong>de</strong>r Französischen Revolution (und in <strong>de</strong>ren Gefolge <strong>de</strong>r<br />
republikanischen Staatsform und <strong>de</strong>s Laizismus) und die Leistungen <strong>de</strong>r Résistance, <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen Gründungsmythen Frankreichs. [6]<br />
Hun<strong>de</strong>rt Millionen Franzosen<br />
Bereits 1868 hatte <strong>de</strong>r amerikanophile Publizist und Frankreichs späterer US-Botschafter Lucien-Anatole Prévost-Paradol seinen Kaiser Napoleon III. auf Frankreichs Be<strong>de</strong>utung im<br />
Mittelmeerraum hingewiesen und gemahnt, dass es bis <strong>zu</strong> 100 Millionen Franzosen auf bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>s Mittelmeeres bedürfe, um einem weltpolitischen Hegemonieanspruch gegenüber<br />
angelsächsischen, <strong>de</strong>utschen und russischen Rivalen ausreichend Geltung <strong>zu</strong> verschaffen. Die koloniale Expansion (nach Marokko und Tunesien) sollte „Lebensraum“ und „Volkskraft“<br />
für ein entsprechen<strong>de</strong>s Bevölkerungswachstum bereiten.[7][8]<br />
Zum Zeitpunkt seiner größten Aus<strong>de</strong>hnung (zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Weltkriegen) hatte das (Zweite) Französische Kolonialreich etwa 45 Millionen Einwohner, das französische Mutterland<br />
(France métropolitaine) zählte etwa 40 Millionen, während <strong>de</strong>r „Erbfeind“ Deutschland 100 Millionen Einwohner zählte. Bis 1960 war die Bevölkerung Frankreichs auf knapp 46<br />
Millionen angestiegen, doch hatte Frankreich inzwischen einige Kolonien verloren (Syrien/Libanon 1943/46, Indochina 1953/54, Französisch-Indien 1949/56, Marokko und Tunesien<br />
1956/57, Guinea 1958). Die Bevölkerung <strong>de</strong>r verbliebenen Kolonien war auf knapp 54 Millionen gewachsen.[9]<br />
Assimilationspolitik<br />
Bereits 1848 bzw. 1871 hatte Frankreich Algerien und 1916 die vier wichtigsten Städte <strong>de</strong>s Senegal (Quatre Communes) <strong>zu</strong> integralen Bestandteilen Frankreichs erklärt, ein Teil <strong>de</strong>r<br />
Einwohner erhielt französische Bürgerrechte, mit <strong>de</strong>nen vor allem auch die Wehrpflicht verbun<strong>de</strong>n war. So wur<strong>de</strong> Blaise Diagne, <strong>de</strong>r Bürgermeister von Dakar, in die französische<br />
Nationalversammlung gewählt, während Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> Algerier und Senegalesen in bei<strong>de</strong>n Weltkriegen auf französischem Bo<strong>de</strong>n für Frankreich kämpften und fielen. Insgesamt 1,5<br />
Millionen <strong>zu</strong>sätzliche Soldaten hielt Frankreich so in seinen Kolonien in Reserve.[10]<br />
Im Rahmen einer „Assimilationspolitik“ band Frankreich stärker als etwa Großbritannien, Belgien o<strong>de</strong>r Portugal einheimische Eliten in die Verwaltung seiner Kolonien ein, um das<br />
kolonialistische System <strong>zu</strong> ergänzen und <strong>zu</strong> verschleiern. So gab es auf Gua<strong>de</strong>loupe bzw. im Tschad erstmals einen schwarzafrikanischen Gouverneur, Félix Éboué, <strong>de</strong>r sich dann 1940 als<br />
erste französische Kolonie <strong>de</strong>m „Freien Frankreich“ um General Charles <strong>de</strong> Gaulle anschloss und damit die Tradition <strong>de</strong>s republikanischen Frankreich gegen die <strong>de</strong>r konservativen<br />
Restauration unterstützte. Der ehemalige Kolonialminister Jacques Stern warb für die Assimilation <strong>de</strong>r „farbigen“ Franzosen.<br />
Doch die <strong>de</strong>r einheimischen Bevölkerung gewährten Bürgerrechte blieben <strong>zu</strong>nächst eingeschränkt und wenigen vorbehalten, die laizistische Republik enthielt z. B. <strong>de</strong>r Mehrheit <strong>de</strong>r<br />
algerischen Muslime die vollen Bürgerrechte vor, was letztlich <strong>zu</strong>m Scheitern <strong>de</strong>r „Assimilationspolitik“ mit beitrug.[11] Nach 1945 versprach die Französische Vierte Republik eine<br />
gleichberechtigte Integration, neben Algeriern und Senegalesen wur<strong>de</strong>n 1945 alle Einwohner <strong>de</strong>r Kolonien formal gleichberechtigte Citoyens, doch erst 1957 ersetzte das allgemeine<br />
Wahlrecht eine die Einheimischen <strong>de</strong>r Kolonien benachteiligen<strong>de</strong> Wahlrechtsordnung.[12]<br />
Französische Union und Französische Gemeinschaft<br />
An die Stelle <strong>de</strong>s Kolonialreichs trat 1946 eine Union Française (Französische Union) zwischen <strong>de</strong>m Mutterland und <strong>de</strong>n in autonome Tochterrepubliken umgewan<strong>de</strong>lten verbliebenen<br />
Kolonien, 1958 dann die Communauté française (Französische Gemeinschaft). Bereits die Volksfrontregierung Léon Blum hatte 1937 eine solche Union angestrebt. Außenpolitik,
Verteidigung, Finanzwesen, langfristige Wirtschaftsplanung, strategische Rohstoffe, die Kontrolle <strong>de</strong>r Justiz- und <strong>de</strong>s Bildungswesen sowie <strong>de</strong>r Kommunikationssysteme sollten unter<br />
Zuständigkeit <strong>de</strong>r Union bzw. <strong>de</strong>r Gemeinschaft bleiben. Statt Staatsbürgerschaften <strong>de</strong>r einzelnen Mitgliedsrepubliken gab es nur die Staatsbürgerschaft <strong>de</strong>r Union, die allerdings nicht<br />
i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>r französischen Staatsbürgerschaft war. Amtssprache war Französisch.[13]<br />
• Das Kolonialreich ist tot. An seiner Stelle errichteten wir die Union. Frankreich bereichert, gea<strong>de</strong>lt und vergrößert, wird morgen 100 Millionen Bürger und freie Menschen<br />
besitzen. (Pierre Cot)[14]<br />
• Frankreich hat seinen Traum eines Imperiums von 100 Millionen Franzosen nicht aufgegeben. (Ralph Bunche)[15]<br />
Doch 1960 brach die angestrebte Gemeinschaft von 100 Millionen frankophonen Staatsbürgern endgültig <strong>zu</strong>sammen, die autonomen Republiken wur<strong>de</strong>n unabhängige Nationalstaaten,<br />
Algerien folgte 1962. Bis 1980 lösten sich auch noch die Komoren, Dschibuti und Vanuatu von Frankreich. Zumin<strong>de</strong>st einen i<strong>de</strong>ellen (und ansatzweise auch wirtschaftlichen)<br />
Zusammenhalt versuchen Frankreich, Kanada, Belgien und die ehemaligen Kolonien seit 1970 in <strong>de</strong>r Frankophonie weiterhin <strong>zu</strong> pflegen.[16]<br />
Geburtenrate und Immigration<br />
Dennoch wur<strong>de</strong> das Schlagwort von „Hun<strong>de</strong>rt Millionen Franzosen“ auch in <strong>de</strong>r Folgezeit immer wie<strong>de</strong>r von französischen und afrikanischen Politikern aufgegriffen und neu<br />
abgewan<strong>de</strong>lt. Eine alternative Deutung kam <strong>de</strong>m Nachkriegsplan <strong>de</strong> Gaulles und Michel Debrés <strong>zu</strong>, durch zahlreiche staatliche Vergünstigungen und Erleichterungen die Geburtenrate<br />
bzw. das Bevölkerungswachstum Frankreichs <strong>zu</strong> för<strong>de</strong>rn.[17] Dies war auch eine Erfahrung aus <strong>de</strong>r militärischen Nie<strong>de</strong>rlage gegen Nazi-Deutschland 1940. Schon das Vichy-Regime<br />
unter Marschall Pétain hatte eine Steigerung <strong>de</strong>r Geburtenrate, damals die niedrigste in Europa, <strong>zu</strong> erreichen versucht, eine Politik, die in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit - begünstigt durch<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n wirtschaftlichen Wohlstand - beibehalten wur<strong>de</strong>, ab ca. 1960 verstärkt durch Einwan<strong>de</strong>rung.<br />
• Es müssen 100 Millionen Franzosen sein. Wenn das nicht durch Geburten <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong> kommt, dann durch Einwan<strong>de</strong>rung. (Michel Debré)[18]<br />
Tatsächlich haben zwischen 14[19] und 15[20] Millionen (22–23 %) <strong>de</strong>r heute 64 Millionen Einwohner Frankreichs einen Migrationshintergrund, <strong>de</strong>ren Elternteile und Vorfahren sind<br />
aber größtenteils Einwan<strong>de</strong>rer aus an<strong>de</strong>ren europäischen Län<strong>de</strong>rn. Seit <strong>de</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Kolonien sind in mehreren Wellen Millionen nordafrikanische und westafrikanische<br />
Einwan<strong>de</strong>rer in das ehemalige Mutterland gekommen, als Kin<strong>de</strong>r von Unionsstaatsbürgern haben viele von ihnen laut Gesetz Ansprüche auf die französische Staatsbürgerschaft. Viele<br />
Immigranten wohnen in seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren entstan<strong>de</strong>nen Neubausiedlungen (banlieues) am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r französischen Großstädte. Die Integration dieser Immigranten ist bisher nur<br />
unvollständig gelungen, was Unbehagen über Einwan<strong>de</strong>rung und Überfremdungsängste unter <strong>de</strong>n einheimischen Franzosen för<strong>de</strong>rt, die u.a. <strong>zu</strong> Wahlerfolgen rechtsextremer Parteien wie<br />
<strong>de</strong>s Front national führten.<br />
Nach Ansicht <strong>de</strong>s britischen Historikers und Autors Paul Johnson wür<strong>de</strong> die französische Nation, sollte sie <strong>de</strong>nn jemals 100 Millionen erreichen, <strong>zu</strong>r Hälfte aus nordafrikanischen<br />
Muslimen bestehen. Dem müsse Westeuropa durch höhere Geburtenraten entgegenwirken, polemisierte Johnson 2006 in <strong>de</strong>r Jewish World Review.[21] Ähnlich rassistische Polemik hatte<br />
bereits Adolf Hitler in "Mein Kampf" geäußert, als er Frankreich wegen seiner Assimilationspolitik als "vernegert" geißelte.[22] Doch auch <strong>de</strong>r satirische Simplicissimus hatte schon 1904<br />
die französische Kolonialpolitik als "Rassenvermischung" karikiert.<br />
Erst 1995 wur<strong>de</strong> die inhaltslos gewor<strong>de</strong>ne Communauté auch formaljuristisch aufgelöst. Alle ehemaligen Mitgliedstaaten (Frankreich und die Tochterrepubliken, einschließlich Togo und<br />
Kamerun) <strong>zu</strong>sammen hatten <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt bereits fast 200 Millionen Einwohner, die ehemaligen Staaten <strong>de</strong>r Union sogar über 330 Millionen. Weltweit gibt es jedoch nur etwa 131<br />
Millionen frankophone Muttersprachler, etwa 60 Millionen davon in Afrika (Haarmann). In jenen 32 Staaten <strong>de</strong>r Welt, in <strong>de</strong>nen Französisch Amtssprache ist, leben 88 Mio<br />
Muttersprachler.[23]<br />
Religion<br />
Frankreich hat heute etwa 64 Millionen Einwohner, 94 % davon sind französische Staatsbürger (MSN Encarta). Für 86 %[23] bzw. 88 % (Haarmann) von ihnen ist Französisch die<br />
Muttersprache.<br />
Die Mehrheit <strong>de</strong>r Bevölkerung ist katholisch, wobei die Angaben von 51 % (Le Mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s religions) über 64 % (Auswärtiges Amt[24]) und 75 % (Fischer Weltalmanach 2010) bis 88 %
(CIA[25]) reichen. Etwa 5 Millionen (8 %) sind Muslime vor allem aus Nord- und Westafrika. Daneben gibt es 1–3 % Protestanten und Ju<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Rest sind vor allem Atheisten und<br />
Konfessionslose. Nach einer Studie <strong>de</strong>s PewResearch Center aus <strong>de</strong>m Jahr 2008 bezeichnet sich nur eine Min<strong>de</strong>rheit von 37 % <strong>de</strong>r Franzosen als „religiös“ und 9 % als „sehr religiös“.<br />
Bei<strong>de</strong>s sind weltweit die niedrigsten Werte. Die Studie offenbart <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Vorurteile gegenüber Muslimen und Ju<strong>de</strong>n.[26]<br />
Die nichtkatholischen Franzosen waren bereits durch die Hugenottenkriege (bis 1598) bzw. durch die Aufhebung <strong>de</strong>s Edikts von Nantes durch das Edikt von Fontainebleau (1685)<br />
faktisch ausgeschlossen und vertrieben wor<strong>de</strong>n. Francophone Schweizer, die mehrheitlich calvinistisch bzw. reformiert sind, bezeichnen sich daher selbst selten als Franzosen. Die<br />
katholischen Wallonen gelten jedoch als Französische Gemeinschaft Belgiens.<br />
Bis 1960 hatten (katholische) Christen etwa 45 % und Muslime über 30 % <strong>de</strong>r 100 Millionen Franzosen ausgemacht (über 30 Millionen Muslime und 10 Millionen Christen allein in <strong>de</strong>n<br />
afrikanischen Tochterrepubliken), vor 1958 (Verlust Marokkos, Tunesiens und Guineas) war <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Muslime noch höher. (Hin<strong>zu</strong> kamen die Buddhisten aus Indochina.)<br />
Sonstige Einwan<strong>de</strong>rung<br />
Im 19. und 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt kamen viele Einwan<strong>de</strong>rer aus Osteuropa, Westasien und Indochina, unter an<strong>de</strong>rem Polen, Armenier und Libanesen, die in <strong>de</strong>r Bevölkerung aufgingen.<br />
Berühmte Beispiele sind hier Marie Curie und <strong>de</strong>r armenischstämmige Chansonsänger Charles Aznavour.[3] Schon seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts kamen zahlreiche Italiener, seit<br />
<strong>de</strong>n 1960er Jahren auch Portugiesen als Gastarbeiter ins Land und blieben oft auch dauerhaft, italienische Vorfahren hat u.a. die Fußballlegen<strong>de</strong> Michel Platini. Vor allem im Sü<strong>de</strong>n<br />
Frankreichs sie<strong>de</strong>lten sich nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Linken im Spanischen Bürgerkrieg zahlreiche politisch Verfolgte Spanier und Katalanen an ("Rotspanier"), u.a. <strong>de</strong>r Vater von Raymond<br />
Domenech. Auch als Söldner in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong>nlegion haben zahlreiche Auslän<strong>de</strong>r die französische Staatsbürgerschaft erworben.<br />
Bevölkerungsgruppen französischer Abstammung<br />
Bereits im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatten französische Auswan<strong>de</strong>rer Kolonien in Übersee gegrün<strong>de</strong>t, die Siedlungen bestan<strong>de</strong>n auch nach <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>s (Ersten) Kolonialreichs (1763)<br />
fort. Nachfahren französischer Auswan<strong>de</strong>rer sind in Kanada die Québécois,[27] die Akadier[28] und die frankophonen Kanadier („Franko-Kanadier“) <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Provinzen, <strong>zu</strong>sammen<br />
über 7 Millionen francophone Muttersprachler.[23] Die Staatsbürger <strong>de</strong>r Vereinigten Staaten, die französische Vorfahren haben, nennt man Franko-Amerikaner. Ein Großteil sind<br />
Französische Kanadier, die in <strong>de</strong>r Industrialisierung nach Neuengland eingewan<strong>de</strong>rt sind. Zu<strong>de</strong>m gibt es von franko-kanadischen Auswan<strong>de</strong>rern abstammen<strong>de</strong> Cajuns und frankophone<br />
Kreolen im US-Bun<strong>de</strong>sstaat Louisiana, wo eine Mehrheit <strong>de</strong>r US-Amerikaner dieses Staates französische bzw. kreolische Vorfahren hat[29], aber nur noch 4,7 % Französisch als<br />
Muttersprache sprechen.[30]<br />
Insgesamt haben 9.616.700 US-Amerikaner (2,8 %) französische o<strong>de</strong>r kreolische und weitere 2.184.200 (0,6 %) franko-kanadische Vorfahren[31], doch nur noch 1.355.800 (0,5 %)<br />
sprechen Französisch und weitere 629.000 (0,2 %) kreolisch als Muttersprache. Von diesen Französisch-Muttersprachlern beherrschen nur 21,8 % Englisch gegenüber 43,3 % <strong>de</strong>r<br />
Kreolen[32] Zu<strong>de</strong>m leben 600.000 französische Staatsbürger als Auslän<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n USA.[33]<br />
Daneben gibt es viele Ethnien, die teilweise französischer Herkunft sind, wie die Métis in Nordamerika (indianischer Abstammung), Kreolen <strong>de</strong>r Karibik und Afrikas (französischer und<br />
afrikanischer Abstammung, in <strong>de</strong>r Karibik auch indianische Wurzeln) und die Europolynesier (französischer und polynesischer Abstammung).<br />
Ein Gefühl <strong>de</strong>r Nähe und Verbun<strong>de</strong>nheit empfin<strong>de</strong>n viele Franzosen gegenüber an<strong>de</strong>ren frankophonen Nationen und Ethnien auf <strong>de</strong>r Welt, wie <strong>de</strong>n belgischen Wallonen, <strong>de</strong>n<br />
schweizerischen Romands o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n kanadischen Québécois. Letztere wer<strong>de</strong>n oft als „Cousins“ bezeichnet, was jenseits <strong>de</strong>s Atlantiks als abwertend empfun<strong>de</strong>n wird. Zwischen Romands<br />
und Wallonen leben noch 120.000 französische Staatsbürger in Belgien und 75.000 in <strong>de</strong>r Schweiz. Weitere 300.000 Franzosen leben in Italien[33], hin<strong>zu</strong> kommen 200.000 frankophone<br />
Valdostaner im italienischen Aostatal.<br />
Auch nach Deutschland kamen französische Einwan<strong>de</strong>rer, die mit <strong>de</strong>r Zeit assimiliert wur<strong>de</strong>n. Eine wichtige solche Einwan<strong>de</strong>rergruppe waren im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Hugenotten,<br />
die außer in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und England und <strong>de</strong>ren Kolonien auch in <strong>de</strong>r Schweiz und in <strong>de</strong>n protestantischen <strong>de</strong>utschen Staaten, vor allem in Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen, Zuflucht fan<strong>de</strong>n.<br />
[34] Der Anteil <strong>de</strong>r Hugenotten in Berlin machte um 1700 etwa 20 %, um 1800 etwa 10 % und um 1900 noch gut 1 % aus.[35]
Literatur<br />
• Harald Haarmann: Kleines Lexikon <strong>de</strong>r Völker: von Aborigines bis Zapoteken, ab Seite 132,<br />
• Detlev Wahl: Lexikon <strong>de</strong>r Völker Europas und <strong>de</strong>s Kaukasus. Rostock 1999, Seite 74–83<br />
• H. Köller und B. Töpfer: Frankreich. Ein historischer Abriß. 2 Bän<strong>de</strong>, Berlin 1973<br />
• Fuchs und Henseke: Das Französische Kolonialreich. Berlin 1988<br />
• Jacques Sterns: The French Colonies. Past and Future. New York 1944, Seite 25–26<br />
• J. W. Bromlej: народы мира - историко-этнографический справочник. Moskau 1988, Seiten 483–486<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Artikel 1 <strong>de</strong>r Französischen Verfassung vom 4. Oktober 1958: „Frankreich ist eine unteilbare, laizistische, <strong>de</strong>mokratische und soziale Republik. Sie gewährleistet die Gleichheit<br />
aller Bürger vor <strong>de</strong>m Gesetz ohne Unterschied <strong>de</strong>r Herkunft, Rasse o<strong>de</strong>r Religion. Sie achtet je<strong>de</strong>n Glauben.“<br />
2. ↑ Ostal d'Occitània<br />
3. ↑ a b c Diercke Län<strong>de</strong>rlexikon, Augsburg 1989, ISBN 3-89350-211-4<br />
4. ↑ Éric Gailledrat: Les Ibères <strong>de</strong> l'Èbre à l'Hérault (VIe-IVe s. avant J.-C.), Lattes, Sociétés <strong>de</strong> la Protohistoire et <strong>de</strong> l'Antiquité en France Méditerranéenne, Monographies<br />
d'Archéologie Méditerranéenne - 1, 1997<br />
5. ↑ Dominique Garcia: Entre Ibères et Ligures. Lodévois et moyenne vallée <strong>de</strong> l'Hérault protohistoriques. CNRS éd., Paris 1993; Les Ibères dans le midi <strong>de</strong> la France.<br />
L'Archéologue, n°32, 1997, S. 38–40<br />
6. ↑ Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009, Seite 9.<br />
7. ↑ Heinz Gollwitzer: Vom Zeitalter <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckungen bis <strong>zu</strong>m Beginn <strong>de</strong>s Imperialismus. Göttingen 1972, Seite 487ff.<br />
8. ↑ Prévost-Paradol, 1868: Frankreichs Be<strong>de</strong>utung im Mittelmeerraum<br />
9. ↑ Fischer Weltalmanach 2010. Frankfurt am Main 2009, Seite 11–14 (Entwicklung <strong>de</strong>r Welt seit 1960)<br />
10.↑ Heinrich Loth (Hrsg.): Geschichte Afrikas. Band 2, Berlin 1976, Seiten 70 und 166f.<br />
11.↑ Herbert Lüthy: Das überseeische Frankreich. Ein Kolonialreich in <strong>de</strong>r Krise. In: The Month. 14/1949, Seite 175–186<br />
12.↑ Franz Ansprenger: Geschichte Afrikas. München 2007, Seite 93–97<br />
13.↑ Christian Mähr<strong>de</strong>l (Hrsg.): Geschichte Afrikas. Band 3, Berlin 1983, Seiten 130–141<br />
14.↑ 100 Millionen Franzosen - Es knistert im Kolonialreich. In: DER SPIEGEL. 17/1947 vom 26. April 1947, Seite 11<br />
15.↑ Die Entkolonisierung <strong>de</strong>r französischen Territorien<br />
16.↑ Algerien ist allerdings we<strong>de</strong>r Mitglied noch Beobachter <strong>de</strong>r Organisation<br />
17.↑ Kin<strong>de</strong>rkriegen ist keine Privatsache. In: taz.<strong>de</strong> vom 6. April 2001<br />
18.↑ Michel Debré: Au service <strong>de</strong> la nation - Essai d'un programme politique. Paris 1963<br />
19.↑ Gilbert Charles, Besma Lahouri: Les vrais chiffres. In: L'Express. 4. Dezember 2003<br />
20.↑ French people<br />
21.↑ Paul Johnson in Jewish World Review: Let´s Have More Babies!<br />
22.↑ Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular <strong>de</strong>s Nationalsozialismus, Seite 633f. <strong>de</strong> Gruyter Berlin/New York 2000<br />
23.↑ a b c The New York Times 2010 Almanac, Seite 505. New York 2009<br />
24.↑ Län<strong>de</strong>rinformationen <strong>de</strong>s Auswärtigen Amtes über Frankreich
25.↑ CIA World Factbook, France, September 2009<br />
26.↑ pewglobal.<br />
27.↑ Gérard Bouchard: Genèse <strong>de</strong>s nations et cultures du nouveau mon<strong>de</strong>. Essai d'histoire comparée. Boréal, Montréal 2001<br />
28.↑ Ingo Kolboom, Roberto Mann: Akadien. Ein französischer Traum in Amerika. Vier Jahrhun<strong>de</strong>rte Geschichte und Literatur <strong>de</strong>r Akadier. Synchron Wissenschaftsverlag <strong>de</strong>r<br />
Autoren, Hei<strong>de</strong>lberg 2005, ISBN 3-935025-54-8<br />
29.↑ Prof. Dr. Wolfgang Viereck: dtv-Atlas Englische Sprache. München 2002, Seite 160<br />
30.↑ US Census 2000<br />
31.↑ New York Times The World Almanac and book of facts 2009, Seite 601<br />
32.↑ New York Times The World Almanac and book of facts 2009, Seite 596<br />
33.↑ a b J. W. Bromlej: народы мира - историко-этнографический справочник. Moskau 1988, Seite 484<br />
34.↑ Jochen Desel: Hugenotten. Französische Glaubensflüchtlinge in aller Welt. 2. Auflage, Dt. Hugenotten-Gesellschaft, Bad Karlshafen 2005, ISBN 3-930481-18-9.<br />
35.↑ Ewaldt Harndt: Französisch im Berliner Jargon. Berlin 1998, Seite 17<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte Frankreichs<br />
Die Geschichte Frankreichs behan<strong>de</strong>lt die geschichtlichen und vorgeschichtlichen Ereignisse im Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Frankreichs.<br />
Übersicht<br />
Republiken und Monarchien<br />
Das heutige Frankreich (Französische Republik, République Francaise) wird als Fünfte Französische Republik verstan<strong>de</strong>n und versteht sich staatsgeschichtlich als Nachfolger früherer<br />
Republiken. Die erste französische Republik war 1792 ausgerufen wor<strong>de</strong>n und existierte bis 1804. Die fünf französischen Republiken sind Nachfolge- bzw. Vorgängerstaaten<br />
verschie<strong>de</strong>ner französischer Monarchien, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen die verschie<strong>de</strong>nen Erscheinungsformen <strong>de</strong>s Königreich Frankreichs (Mittelalter bis 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt) sowie die bei<strong>de</strong>n französischen<br />
Kaiserreiche (19. Jahrhun<strong>de</strong>rt) gehören.<br />
Das französische Königreich hat sich im Mittelalter stufenlos aus <strong>de</strong>m westfränkischen Königreich entwickelt. Letzteres war ein Ergebnis <strong>de</strong>r Teilung <strong>de</strong>s Fränkischen Königreiches im<br />
Jahre 843. Das Fränkische Reich bil<strong>de</strong>te eine mal mehr, mal weniger geschlossene Einheit. Es entstand, als <strong>de</strong>r im heutigen Belgien herrschen<strong>de</strong> salfränkische König Chlodwig I. (481-<br />
511) aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Merowinger die an<strong>de</strong>ren Frankenreiche (z.B. das <strong>de</strong>r Rheinfranken um Köln) eroberte.<br />
Der Ausdruck Franken steht als Sammelbegriff für verschie<strong>de</strong>ne germanische Gruppen, die im 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>n Regionen an Nie<strong>de</strong>rrhein und im Rhein<strong>de</strong>lta erstmals geschichtlich<br />
fassbar gewor<strong>de</strong>n waren.
Bezeichnung <strong>de</strong>s Staates bzw. <strong>de</strong>r Staatsoberhäupter<br />
Chlodwig I., Herrscher 481-511, aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Merowinger, konnte sich vermutlich erstmals als alleiniger König <strong>de</strong>r Franken bezeichnen. Zuvor hatten mehrere fränkische Könige<br />
und Kleinkönige existiert. Nach seinem Tod bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r merowingischen Dynastie 751 existierte das Fränkische Reich als Gesamtreich fort (Regnum Francorum), wur<strong>de</strong> aber mal<br />
mehr, mal weniger durch die fränkischen Teilreiche und <strong>de</strong>ren Könige dominiert. Zu <strong>de</strong>n Teilreichen gehörten z.B. Neustrien, Austrien, Burgund und Aquitanien. Die fränkischen Könige<br />
bezeichneten sich z.B. als König von Orléans, König von Reims, König von Paris, König von Soissons, König von Neustrien, König von Austrien, König von Burgund o<strong>de</strong>r König von<br />
Aquitanien. Franzien (im Französischen France, also <strong>de</strong>r gleiche Ausdruck wie für "Frankreich") war eine Art fränkischer Kernraum nördlich <strong>de</strong>r Loire. Das Gesamtreich beherrschen und<br />
sich als König <strong>de</strong>r Franken (Francorum Rex, seltener Rex Francorum) bezeichnen konnten sich unter an<strong>de</strong>rem Chlothar I. (558-561), Chlothar II. (613-629), Dagobert I. (632-639),<br />
Chlodwig I. (691-695) o<strong>de</strong>r Chil<strong>de</strong>rich III. (743-751).<br />
In <strong>de</strong>r karolingischen Epoche bis <strong>zu</strong>r Reichsteilung von Verdun (751-843) bestand die Titulatur König <strong>de</strong>r Franken fort. Karl I. (Karl <strong>de</strong>r Große) nahm <strong>zu</strong><strong>de</strong>m 800 <strong>de</strong>n Titel eines<br />
Römischen Kaisers an, <strong>de</strong>n auch seine Nachfolger übernahmen. Die Teilkönigreiche waren weiterhin von Be<strong>de</strong>utung. Die Reichsteilung 843 sah als Ergebnis unter an<strong>de</strong>rem das<br />
westfränkische Königreich, aus <strong>de</strong>m das Königreich Frankreich wur<strong>de</strong>. Die westfränkischen Herrscher behielten <strong>de</strong>n Titel König <strong>de</strong>r Franken jedoch bis ins 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt bei, ferner<br />
wur<strong>de</strong>n sie weiterhin gewählt. Karl II. war auch römischer Kaiser.<br />
Auch nach <strong>de</strong>m Dynastiewechsel im westfränkischen Reich von <strong>de</strong>r Karolingern <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Kapetingern im Jahre 987 – in <strong>de</strong>r Geschichtsschreibung neben 843 oft als Beginn <strong>de</strong>s<br />
französischen Königtums angesehen – bestand <strong>de</strong>r Titel König <strong>de</strong>r Franken (Roi <strong>de</strong>s Francs) noch lange fort. Mitkönige sicherten <strong>de</strong>n dynastischen Bestand. Bis ins letzte französische<br />
Königsjahr 1848 entstammten die Könige aus <strong>de</strong>r Dynastie <strong>de</strong>r Kapetinger, allerdings aus verschie<strong>de</strong>nen Häusern (direkte Kapetinger 987–1328, Valois und Nebenlinien 1328–1589,<br />
Bourbon und Nebenlinien 1589–1792, 1814/15–1848).<br />
Erst Philipp II. (1180–1223) verwen<strong>de</strong>te um 1190 erstmals <strong>de</strong>n Titel König von Frankreich (Roi <strong>de</strong> France, Franciae Rex, seltener Rex Franciae). Ludwig IX. (1214–1270) wechselte<br />
während seiner Regierungszeit in <strong>de</strong>r offiziellen Bezeichnung von König <strong>de</strong>r Franken <strong>zu</strong> König von Frankreich. Der Titel König <strong>de</strong>r Franken bleibt aber bis <strong>zu</strong> Philipp IV. (1268–1314) in<br />
Gebrauch. Auf Münzen fin<strong>de</strong>t sich Francorum Rex sogar bis ins 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Die Titulatur König von Frankreich und Navarra (Roi <strong>de</strong> France et <strong>de</strong> Navarre) galt 1285–1328, 1589–1789 und 1814/1815–1830. Zwischen 1328 und 1589 wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r lediglich König<br />
von Frankreich verwen<strong>de</strong>t. Nach Beginn <strong>de</strong>r Französischen Revolution wechselte Ludwig XVI. 1789 <strong>zu</strong>m Ausdruck König <strong>de</strong>r Franzosen (Roi <strong>de</strong>s Francais); dieser Titel wur<strong>de</strong> bis 1792<br />
und dann wie<strong>de</strong>r 1830–1848 verwen<strong>de</strong>t. Anstelle auf das Territorium wur<strong>de</strong> nun auf die Bevölkerung Be<strong>zu</strong>g genommen. Der Zusatz Allerchristlichster König war unter Karl VII.<br />
aufgekommen. Die Kaistertitel <strong>de</strong>r Jahre 1804–1814/1815 und 1852–1870 waren Empereur <strong>de</strong>s Francais (Kaiser <strong>de</strong>r Franzosen).<br />
Parallel <strong>zu</strong>r Bezeichnung <strong>de</strong>s Herrschers kam <strong>de</strong>r Ausdruck Königreich Frankreich (Royaume <strong>de</strong> France) ebenfalls erst im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt auf und in Gebrauch und ersetzte Royaume <strong>de</strong>s<br />
Francs (Königreich <strong>de</strong>r Franken) bzw. Francie occi<strong>de</strong>ntalis (westliches Franken). 1791 wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r absoluten eine konstitutionelle Monarchie, aus <strong>de</strong>m Königreich Frankreich für ein<br />
Jahr das Königreich <strong>de</strong>r Franzosen (Royaume <strong>de</strong>s Francais; Ludwig XVI. hatte, wie erwähnt, bereits 1789 <strong>zu</strong> König <strong>de</strong>r Franzosen gewechselt).<br />
Bezeichnungen <strong>de</strong>r Staatsoberhäupter<br />
Sehr kurze Übergangsperio<strong>de</strong>n, wie z.B. am Beginn <strong>de</strong>r zweiten Republik, sind nicht aufgeführt.<br />
• 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt – 12./13. Jahrhun<strong>de</strong>rt: König <strong>de</strong>r Franken<br />
• 12./13. Jahrhun<strong>de</strong>rt – 1789: König von Frankreich (und Navarra)<br />
• 1789–1792: König <strong>de</strong>r Franzosen<br />
• 1792–1804: Die Verfassung <strong>de</strong>r Ersten Republik sah kein formelles Oberhaupt <strong>de</strong>s Staates vor. Als De-facto-Oberhäupter können angesehen wer<strong>de</strong>n:<br />
• 1792–1795: Nationalkonvent: 1792–1793 Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Justizausschusses (Danton), 1793–1794 Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Wohlfahrtsausschusses (Robespierre)<br />
• 1795–1799: Direktor <strong>de</strong>s Direktoriums<br />
• 1799–1804: Konsul
• 1804–1814/15: Kaiser <strong>de</strong>r Franzosen<br />
• 1814/1815–1830: König von Frankreich und Navarra<br />
• 1830–1848: König <strong>de</strong>r Franzosen<br />
• 1848–1852: Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r französischen Republik<br />
• 1852–1870: Kaiser <strong>de</strong>r Franzosen<br />
• 1870–1871: Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Regierung <strong>de</strong>r nationalen Verteidigung (Trochu)<br />
• 1871–1940: Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r französischen Republik<br />
• 1940–1944: Staatschef (Petain)<br />
• 1944–1947: Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Provisorischen Regierung<br />
• seit 1947: Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r französischen Republik<br />
Bezeichnungen <strong>de</strong>s Staates<br />
• 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt – 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt: Königreich <strong>de</strong>r Franken (Royaume <strong>de</strong>s Francs)<br />
• 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt – 1791: Königreich Frankreich (Royaume <strong>de</strong> France)<br />
• 1791–1792: Königreich <strong>de</strong>r Franzosen (Royaume <strong>de</strong>s Francais)<br />
• 1792–1804: Französische Republik (République Francais, I. Republik)<br />
• 1804–1814/1815: Französisches Kaiserreich (Empire Francais)<br />
• 1814/1815–1848: Königreich <strong>de</strong>r Franzosen<br />
• 1848–1852: Französische Republik (II. Republik)<br />
• 1852–1870: Französisches Kaiserreich<br />
• 1870–1940: Französische Republik (III. Republik)<br />
• 1940–1944: Französischer Staat (Etat Francais, Vichy-Regime)<br />
• 1944–1947: Französische Republik (Provisorische Regierung)* 1947–1958: Französische Republik (IV. Republik)<br />
• seit 1958: Französische Republik (V. Republik)<br />
Vorgeschichte und Antike<br />
Bis 6000 v.Chr. breiteten sich von <strong>de</strong>n Kernräumen Afrikas her Jäger- und Sammlerkulturen auch im Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Frankreich aus. Zu be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>ren Fundorten dieser Zeit zählen<br />
Cro-Magnon und La Ferrassie. Aus <strong>de</strong>r mittleren Altsteinzeit sind in weiten Teilen Frankreichs Fun<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Mousterien und verwandter Kulturgruppen bekannt. Bis <strong>zu</strong>r Jungsteinzeit<br />
drangen südwesteuropäische Bauernkulturen ein (Chassey-Kultur).<br />
Bis 1500 v.Chr. haben sich wie in weiten Teilen Eurasiens und Afrikas weitere Bauernkulturen etabliert. Während <strong>de</strong>r spätbronzezeitlichen Wan<strong>de</strong>rperio<strong>de</strong> (1250-750 v.Chr.) breiteten sich<br />
von Osten her Urnenfel<strong>de</strong>rkulturen aus, im Westen verharrten westeuropäische Bronzekulturen.<br />
Die ionische Kolonisationsphase brachte die Gründung von griechischen Koloniestädten an <strong>de</strong>r französischen Mittelmeerküste: Massalia – Marseille, Olbia, Antipolis – Antibes, Nikaia –<br />
Nizza, Agathe, Rho<strong>de</strong> (Mutterstadt: Phokaia im heutigen Kleinasien).<br />
Im vierten Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. sind weite Teile Frankreichs Teil <strong>de</strong>s keltischen Kernraums (frühe Latène-Kultur). Die Kelten erreichen im darauffolgen<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rt die<br />
Mittelmeerküste. Zu <strong>de</strong>n keltischen Stämmen zählen z.B. die Aulerci, Bituriges, Arverner, Hae<strong>de</strong>r, Volcae und Allobroger.<br />
In <strong>de</strong>n Zeiten <strong>de</strong>r Punischen Kriege sind die griechischen Kolonien Südfrankreichs Verbün<strong>de</strong>te Roms. Die Kriegsexpedition <strong>de</strong>r Scipionen gelangt über Massilia und Rhodae in die
karthagischen Gebiete <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel (218-209 v.Chr.).<br />
Die Expansion <strong>de</strong>s römischen Reiches brachte auch das westliche Europa unter römische Herrschaft. Kleine Gebiete <strong>de</strong>s heutigen Frankreich im Südosten im Nizza (Nicaea) gehörten<br />
bereits <strong>zu</strong> Ligurien und damit <strong>zu</strong>m italischen Kerngebiet. Die mittelmeernahen Gebiete wur<strong>de</strong>n zwischen 154 und 121 v. Chr. römisch. Zwischen 58 und 51 v. Chr. eroberte Caesar in <strong>de</strong>n<br />
Gallischen Kriegen die bis dahin unter keltischer Herrschaft stehen<strong>de</strong>n Gebiete für Rom. Es wur<strong>de</strong>n die römischen Provinzen Gallia, Gallia Narbonensis, Gallia Belgica und Aquitanien<br />
eingerichtet.<br />
Vor allem das Rhonetal bis Lyon (Lugdunum) und die Mittelmeergebiete gehörten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Zentren <strong>de</strong>s römischen Reiches. Von Lyon strahlten einige Haupthan<strong>de</strong>lsstraßen<br />
von Sü<strong>de</strong>n nach Nordwesten und Nordosten aus. Resi<strong>de</strong>nzort war Arelate, für die nördlichen Teile später Trier. Ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r römischer Flottenhafen befand sich in Forum Iulii.<br />
Kurz vor <strong>de</strong>r Teilung <strong>de</strong>s römischen Reiches um 395 n. Chr. erstreckten sich die Diözesen XIII (Galliae) und XIV (Septem Provinciarum) über Frankreich, die <strong>zu</strong>sammen mit XII<br />
(Britanniae) und XV (Hispanie) die Präfektur Gallien bil<strong>de</strong>ten. Diese nahm im weströmischen Reich <strong>de</strong>ren westliche Gebiete ein.<br />
Im fünften Jahrhun<strong>de</strong>rt durchzogen germanische Gruppen weite Teile <strong>de</strong>r römischen Reiche. Im Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Frankreich ließen sich unter an<strong>de</strong>rem die Franken im Nor<strong>de</strong>n und die<br />
Burgun<strong>de</strong>r im Südosten nie<strong>de</strong>r. 451 besiegten die Römer in <strong>de</strong>r Schlacht auf <strong>de</strong>n Katalaunischen Fel<strong>de</strong>rn die Hunnen unter Attila. Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Weströmischen Reiches um 476<br />
etablierten sich mehrere Reiche:<br />
• Reiche <strong>de</strong>r Franken im Nor<strong>de</strong>n (z.B. das Reich <strong>de</strong>r Salfranken)<br />
• Reich <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>r im Südosten<br />
• Reich <strong>de</strong>r Westgoten im Südwesten<br />
• Teile im Osten gehörten <strong>zu</strong>m Herrschaftsgebiet <strong>de</strong>r Alemannen<br />
• Teile im Südosten waren Teil <strong>de</strong>s italischen Reiches <strong>de</strong>s Odowaker<br />
• Um Paris hatte sich als römisches Restgebiet das Reich <strong>de</strong>s Syagrius gehalten<br />
• In <strong>de</strong>r Bretagne (Aremorica) ließen sich keltische Briten nie<strong>de</strong>r<br />
In <strong>de</strong>r Folgezeit eroberten die Franken sowohl das Gebiet <strong>de</strong>s späteren Frankreich als auch weite Teile Europas.<br />
5. Jahrhun<strong>de</strong>rt – 843: Fränkisches Reich<br />
Der Merowinger Chlodwig I. schaltete die an<strong>de</strong>ren fränkischen Kleinkönige aus und errichtete das Frankenreich. Es eroberte nach und nach die umliegen<strong>de</strong>n Reiche und Gebiete (502-<br />
507 Alemannien, 507-511 Aquitanien von <strong>de</strong>n Westgoten, 531 ebenfalls von <strong>de</strong>n Westgoten das Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Gascogne und septimanische Gebiete an <strong>de</strong>r oberen Garonne, 532-534<br />
das Reich <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>r und 536 die ostgotischen Mittelmeergebiete um Marseille. Die Bretagne stand in loser Verbun<strong>de</strong>nheit <strong>zu</strong>m Frankenreich.<br />
Im 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt breiteten sich von Afrika her Mauren nach Europa aus und eroberten Spanien und Septimanien. Sie unterlagen 732 in <strong>de</strong>r Schlacht von Tours und Poitiers <strong>de</strong>m<br />
Frankenreich. 759 wur<strong>de</strong> auch Septimanien fränkisch. Das Frankenreich wur<strong>de</strong> seit 751 von <strong>de</strong>n Karolingern geführt.<br />
Unter Karl I. (Karl <strong>de</strong>r Große, Charlemagne) erreichte das Frankenreich seine größte Aus<strong>de</strong>hnung und beherrschte neben <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s späteren Frankreich auch weite Teile <strong>de</strong>s übrigen<br />
Europa. Dieses Frankenreich wur<strong>de</strong> 843 in drei Teile geteilt. Aus <strong>de</strong>m Westfränkischen Königreich entwickelte sich das Königreich <strong>de</strong>r Franken, das seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt „Königreich<br />
Frankreich“ genannt wur<strong>de</strong>.<br />
In <strong>de</strong>n westlichen Gebieten <strong>de</strong>s Fränkischen Reiches blieb das Lateinische als Volkssprache erhalten (Altfranzösisch u.a.), in <strong>de</strong>n östlichen Gebieten wer<strong>de</strong>n die germanischen Idiome<br />
weiterentwickelt (Althoch<strong>de</strong>utsch, Altnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch); bis um 1000 pen<strong>de</strong>lt sich die westliche romanisch-germanische Sprachgrenze zwischen Nordsee und Matterhorn ein.<br />
843–1328: Vom Westfränkischen Königreich <strong>zu</strong>m Königreich Frankreich<br />
Frankreich war ursprünglich ein Teil <strong>de</strong>s Frankenreichs. Mit <strong>de</strong>r Teilung im Vertrag von Verdun begann 843 von <strong>de</strong>n Zeitgenossen ungeplant seine Geschichte als eigenständiges
Gemeinwesen. Die Söhne <strong>de</strong>s Karolingerkaisers Ludwig I. <strong>de</strong>s Frommen (814-40) teilten das Reich in einen östlichen, einen mittleren und einen westlichen Teil, wie es damals üblich<br />
war, wenn <strong>de</strong>r verstorbene Herrscher mehr als einen überleben<strong>de</strong>n Sohn hatte. Vergleichbares hatte es schon oft gegeben, und die Teilreiche waren auch oft wie<strong>de</strong>r vereint wor<strong>de</strong>n, wenn<br />
ein Teilherrscher ohne eigene Nachkommen verstarb. Damals war nicht absehbar, dass diese Teilung <strong>zu</strong> einer dauerhaften Aufspaltung in unterschiedliche Staatswesen führen wür<strong>de</strong>.<br />
Erster König dieses Westfränkischen Reichs, <strong>de</strong>ssen Wurzeln schon in früheren Reichsteilungen in Neustrien und Austrasien begrün<strong>de</strong>t liegen, wur<strong>de</strong> Karl II. <strong>de</strong>r Kahle (843-77); dies<br />
kann als Ursprung <strong>de</strong>s heutigen Frankreichs betrachtet wer<strong>de</strong>n, wobei <strong>de</strong>r Vertrag von Coulaines 843 nachträglich gleichfalls als Gründungsurkun<strong>de</strong> erscheint, da er in <strong>de</strong>m Teilreich ein<br />
eigenständiges Verfassungssystem begrün<strong>de</strong>te. Französische Gelehrte greifen teilweise noch weiter in <strong>de</strong>r Geschichte aus und sehen Chlodwig I. o<strong>de</strong>r sogar <strong>de</strong>n sagenhaften Faramund<br />
(französisch Pharamond, frühes 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt) als ersten König an.<br />
Wie im Ostfrankenreich bil<strong>de</strong>n sich große Territorien: Die Herzogtümer Franzien, Aquitanien (Guyenne), Gascogne, Bretagne und Normandie, die Grafschaften Champagne, Grafschaft<br />
Toulouse, Barcelona, Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn, sowie die Markgrafschaft Gothien. Ursprünglich wur<strong>de</strong> im Frankenreich das Königreich unter allen Söhnen aufgeteilt. Dies wur<strong>de</strong> anfangs<br />
auch in <strong>de</strong>n drei fränkischen Teilreichen beibehalten. Schon bald än<strong>de</strong>rte sich dies und es bil<strong>de</strong>te sich eine Art staatliche I<strong>de</strong>ntität im Westen, Osten sowie in Italien heraus. Das Mittelreich<br />
Lotharingien wur<strong>de</strong> dabei ab 925 endgültig <strong>de</strong>m Ostreich <strong>zu</strong>geschlagen. Verbun<strong>de</strong>n war diese Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Sichtweise mit Dynastiewechseln, mit <strong>de</strong>r Einführung neuer Namen für die<br />
Reiche sowie mit <strong>de</strong>m Wechsel von <strong>de</strong>r Erb- <strong>zu</strong>r Wahlmonarchie; durch die Praxis, die Herrschersöhne schon <strong>zu</strong> Lebzeiten <strong>de</strong>r Väter <strong>zu</strong> krönen und an <strong>de</strong>r Macht <strong>zu</strong> beteiligen, wur<strong>de</strong> in<br />
West- und Ostfranken die dynastische Herkunft dominierend. An<strong>de</strong>rs als in Ostfranken/Deutschland, wo die Karolinger 911 ausstarben und während <strong>de</strong>s gesamten Mittelalters nie mehr<br />
als fünf Herrscher <strong>de</strong>rselben Dynastie ununterbrochen aufeinan<strong>de</strong>rfolgten, spielten in Westfranken/Frankreich dynastische Kontinuität und das Geblütsrecht bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine<br />
wesentliche Rolle, und die Könige erreichten Anfang <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts sogar die Errichtung einer Erbmonarchie.<br />
Anfangs hatte Westfranken eine starke Stellung unter <strong>de</strong>n Karolingerreichen. Karl II. <strong>de</strong>r Kahle konnte als letzter überleben<strong>de</strong>r Sohn Kaiser Ludwigs I. Italien erwerben und wur<strong>de</strong> 875<br />
<strong>zu</strong>m Kaiser gekrönt. Durch <strong>de</strong>n frühen Tod seines Sohnes und seiner bei<strong>de</strong>n Enkel löste sich das Reich jedoch auf: 877 wur<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rburgund (Arelat) und 888 Hochburgund<br />
selbstständige Königreiche, und auch die Herrschaft in Italien konnte nicht aufrechterhalten wer<strong>de</strong>n. 880 musste <strong>de</strong>r Anspruch auf Lothringen aufgegeben wer<strong>de</strong>n, das an Ostfranken fiel.<br />
884 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ursprünglich ostfränkische König und Kaiser Karl III. <strong>de</strong>r Dicke (881-87) Herrscher auch <strong>de</strong>s westfränkischen Reichs, aber wegen seiner Passivität angesichts <strong>de</strong>r<br />
normannischen Bedrohung wur<strong>de</strong> er <strong>zu</strong>r Abdankung gezwungen (Reichstag von Tribur). 888 wur<strong>de</strong> mit Graf Odo von Paris aus <strong>de</strong>m Geschlecht <strong>de</strong>r Robertiner ein erster Gegenkönig in<br />
Westfranken gewählt. In <strong>de</strong>n nächsten hun<strong>de</strong>rt Jahren wechselte die Königsstellung im Westfrankenreich öfter zwischen <strong>de</strong>n Karolingern und <strong>de</strong>n Robertinern, wobei die Macht während<br />
dieser Zeit sich <strong>zu</strong>nehmend in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Robertiner konzentrierte. Aber selbst nach<strong>de</strong>m diese 987 endgültig die Königsherrschaft im Westfrankenreich übernommen hatten, war das<br />
französische Königtum im Vergleich <strong>zu</strong> seinem ostfränkisch-<strong>de</strong>utschen Pendant weitgehend auf seinen Kernraum in <strong>de</strong>r Ille <strong>de</strong> France beschränkt und übte nur eine nominelle<br />
Oberherrschaft über die übrigen Herzogtümer in Frankreich aus.<br />
Zu einem Machtfaktor entwickelte sich das burgundische Kloster Cluny und die von ihm ausgehen<strong>de</strong> monastische Reformbewegung (cluniazensische Reform). Der Stifter von Cluny,<br />
Herzog Wilhelm <strong>de</strong>r Fromme von Aquitanien, gab <strong>de</strong>m 910 gegrün<strong>de</strong>ten Kloster eine von je<strong>de</strong>r weltlichen und bischöflichen Gewalt freie Verfassung; es war lediglich <strong>de</strong>m Papst<br />
unterstellt. König Heinrich I. <strong>de</strong>s Ostfrankenreiches (919-36) erteilte <strong>de</strong>m Kloster das Privileg, Tochterklöster <strong>zu</strong> grün<strong>de</strong>n und die Reform auch auf diese <strong>zu</strong> übertragen. Begünstigend für<br />
die Ausbreitung war nicht <strong>zu</strong>letzt das Machtvakuum im Grenzgebiet von Frankreich, Deutschem Reich und <strong>de</strong>m Arelat, sodass sich die cluniazensische Reform rasch ausbreiten konnte –<br />
vor allem im westfränkischen Reich. Das Kloster wuchs im Laufe <strong>de</strong>r Zeit <strong>zu</strong> einem zentralisierten Mönchsstaat heran, <strong>de</strong>m im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt über 200 Abteien und Priorate unterstellt<br />
waren. Cluny entwickelte sich neben <strong>de</strong>m römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser <strong>zu</strong>m zweiten be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n abendländischen Machtfaktor dieser Zeit und trug wesentlich <strong>zu</strong>m Mitte <strong>de</strong>s 11.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts eskalieren<strong>de</strong>n Investiturstreit bei.<br />
Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r Karolinger wur<strong>de</strong> 987 Herzog Hugo Capet von Franzien, ein Nachfahre <strong>de</strong>s Gegenkönigs Robert I. aus <strong>de</strong>m Geschlecht <strong>de</strong>r Robertiner, mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r<br />
Kaiserin Theophanu König von Frankreich und begrün<strong>de</strong>te die später so genannte Kapetinger-Dynastie.<br />
1066 konnte Herzog Wilhelm <strong>de</strong>r Eroberer England erobern. Er war gleichzeitig Vasall <strong>de</strong>s französischen Königs. Das englische Königshaus entwickelte sich <strong>zu</strong>r größten Bedrohung für<br />
die französische Krone über die nächsten vier Jahrhun<strong>de</strong>rte.<br />
Der Aufstieg <strong>de</strong>r Kapetinger setzt ein mit Ludwig VI. <strong>de</strong>m Dicken (1106-37); durch Ausbildung <strong>de</strong>s Lehnsrechts und Privilegierung <strong>de</strong>r Städte kann er die Stärkung <strong>de</strong>r Krone auf Kosten<br />
<strong>de</strong>s nie<strong>de</strong>ren A<strong>de</strong>ls einleiten. Ein französisches Nationalgefühl entstand durch <strong>de</strong>n Angriff Kaiser Heinrichs V. 1124 und durch die Kreuzzüge, in <strong>de</strong>nen sich die Franzosen als<br />
„auserwähltes Werkzeug Gottes“ verstehen. Ludwig stellt eine Verbindung <strong>zu</strong>m Papsttum her <strong>zu</strong>m „Schutz gegen Deutschland“. Sein Kanzler, <strong>de</strong>r Zisterzienserabt Suger, stellt weiterhin
eine Verbindung zwischen <strong>de</strong>r Krone und <strong>de</strong>n Zisterziensern her. Sein Kirchenbau, die Basilika Saint-Denis, ist Stein gewor<strong>de</strong>ner Herrschaftsanspruch und verkörpert als Initialbau <strong>de</strong>r<br />
Gotik, die über die nächsten 250 Jahre die europäische Baukunst dominieren wird, die gewachsene Be<strong>de</strong>utung Frankreichs.<br />
Unter Ludwig VII. (1137-80) wi<strong>de</strong>rfährt <strong>de</strong>r Krone ein ernster Schlag: Ludwigs geschie<strong>de</strong>ne Frau Eleonore von Poitou und Aquitanien heiratet 1152 Heinrich Plantagenet, Herzog <strong>de</strong>r<br />
Normandie, Graf von Anjou, Maine und Touraine, <strong>de</strong>r 1154 auch König von England wird. Das Angevinische Reich nimmt damit etwa die Hälfte <strong>de</strong>s französischen Staatsgebiets ein.<br />
Ludwigs Sohn Philipp II. August (1180–1223) kann England im Schulterschluss mit <strong>de</strong>n Staufern aus <strong>de</strong>m Gebiet nördlich <strong>de</strong>r Loire verdrängen (1214: Schlacht bei Bouvines), und<br />
Ludwig IX. <strong>de</strong>r Heilige (1226-70) kann 1259 die Angevinen auf einen kleinen Bereich im Südwesten <strong>de</strong>s Reichs (Gascogne und Aquitanien) beschränken. Der englische König Heinrich<br />
III. (England) muss <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Ludwig IX. als Lehnsherrn anerkennen.<br />
Ein weiterer nahe<strong>zu</strong> unabhängiger Vasall ist <strong>de</strong>r Graf von Toulouse, <strong>de</strong>r neben <strong>de</strong>r Grafschaft Toulouse auch über das Languedoc gebot. Zu Beginn <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts unterschei<strong>de</strong>t sich<br />
<strong>de</strong>r französische Sü<strong>de</strong>n kulturell und mit <strong>de</strong>m Okzitanischen sogar sprachlich <strong>de</strong>utlich vom Nor<strong>de</strong>n. Die Verfolgung <strong>de</strong>r „Ketzerei“ im südöstlichen Teil <strong>de</strong>s Reichs ist Auslöser <strong>de</strong>r<br />
Albigenserkriege (1209-29). Erste Ziele <strong>de</strong>r mit äußerster Brutalität vorangetriebenen „Bekehrung“ sind Béziers und Carcassonne. Ursprünglich begonnen durch <strong>de</strong>n Papst, spielen ab<br />
1216 religiöse Fragen dabei nur noch eine untergeordnete Rolle – die Kriegführung hat jetzt <strong>de</strong>r König an sich genommen. Die Krone ist auch hier siegreich, und Toulouse und das<br />
Languedoc fallen bis 1271 ebenfalls an sie. Der Papst übernimmt die Verfolgung <strong>de</strong>r „Ketzer“ (Katharer); die <strong>zu</strong> diesem Zweck gegrün<strong>de</strong>te Inquisition erhält beinahe uneingeschränkte<br />
Macht im Languedoc. In <strong>de</strong>r Region kommt es hierauf immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Aufstän<strong>de</strong>n; 1244 wird in einem letzten Kriegs<strong>zu</strong>g die Festung Montségur erobert.<br />
1226 gelingt es Ludwig VIII. (Frankreich), das Reich <strong>zu</strong>r Erbmonarchie <strong>zu</strong> machen, was in Deutschland bis in die Neuzeit allen Herrscherfamilien verwehrt bleibt . Nach <strong>de</strong>m Tod Kaiser<br />
Friedrichs II. im Jahre 1250 ist Ludwig IX. <strong>de</strong>r mächtigste Herrscher <strong>de</strong>s Abendlan<strong>de</strong>s.<br />
1246 vergibt König Ludwig IX. die 1204 von <strong>de</strong>n Plantagenets an die Krone <strong>zu</strong>rückgefallene Grafschaft Anjou an seinen jüngeren Bru<strong>de</strong>r Karl und begrün<strong>de</strong>t so das Haus Anjou. Anjou<br />
erwirbt in <strong>de</strong>r Folge exterritoriale Gebiete: 1246 die Grafschaft Provence im römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiserreich, 1266–1442 das Königreich Neapel (päpstliches Lehen aus <strong>de</strong>m staufischen<br />
Erbe), 1278-83 das Fürstentum Achaia (im von <strong>de</strong>n Kreuzfahrern gebil<strong>de</strong>ten Lateinischen Kaiserreich).<br />
König Philipp IV. <strong>de</strong>r Schöne (1285–1314) stärkt das Königtum weiterhin durch kluge Finanzpolitik, die Liquidierung <strong>de</strong>s Templeror<strong>de</strong>ns <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Krone und die Erweiterung <strong>de</strong>r<br />
Domaine royal (Krondomäne) um die Champagne. Der Konflikt mit England verschärft sich aber erneut, und es kommt 1297–1305 <strong>zu</strong> einer ersten militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng mit<br />
<strong>de</strong>n traditionell pro-englischen Städten in Flan<strong>de</strong>rn, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r König aber letztlich die Oberhand behält.<br />
Auch <strong>de</strong>r Konflikt mit <strong>de</strong>m Papst um <strong>de</strong>ssen Weltherrschaftsanspruch eskaliert. 1303 setzt Philipp <strong>de</strong>r Schöne <strong>de</strong>n Papst gefangen, und 1309 besiegelt er die Abhängigkeit <strong>de</strong>r Kurie von<br />
Frankreich durch <strong>de</strong>ren erzwungene Übersiedlung nach Avignon. Während <strong>de</strong>r nun folgen<strong>de</strong>n mehr als 100-jährigen ‚babylonischen Gefangenschaft’ erfährt die Kirche einen starken<br />
Autoritätsverlust.<br />
Die Kapetinger-Dynastie erlischt 1328 im Mannesstamm mit <strong>de</strong>m Tod König Karls IV. Ihr folgt die Valois-Dynastie, die ebenfalls im Mannesstamm auf Hugo Capet <strong>zu</strong>rückgeht, auf <strong>de</strong>n<br />
Thron (bis 1498).<br />
1328–1589: Haus Valois<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s letzten Kapetingers wird 1328 nach salischem Erbfolgerecht (männliche Thronfolge) Philipp von Valois, Graf von Anjou, <strong>de</strong>r Cousin <strong>de</strong>s verstorbenen Karl IV. <strong>zu</strong>m<br />
neuen König gewählt; er begrün<strong>de</strong>t die Valois-Dynastie (bis 1498). Thronansprüche erhebt aber ebenfalls Eduard III. Plantagenet, König von England und Herzog von Aquitanien. Eduard<br />
ist Neffe Karls IV. in weiblicher Folge. Vor diesem Hintergrund kommt es 1339 bis 1453 <strong>zu</strong>m Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg. England erzielt große Anfangserfolge und erobert bis 1360 neben<br />
Calais <strong>de</strong>n gesamten Nordwesten Frankreichs. Es kommt in Frankreich <strong>zu</strong> schweren inneren Konflikten – das Land hat <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Pestepi<strong>de</strong>mie von 1348 unter <strong>de</strong>n Kriegsfolgen<br />
und marodieren<strong>de</strong>n Söldnern (Armagnacs) <strong>zu</strong> lei<strong>de</strong>n. Ab 1369 kann Frankreich <strong>de</strong>n Gegner im Kleinkrieg abnutzen und bis 1380 auf wenige Stützpunkte (Calais, Cherbourg, Brest,<br />
Bor<strong>de</strong>aux, Bayonne) <strong>zu</strong>rückdrängen.<br />
König Johann II. <strong>de</strong>r Gute (1350-64) belehnt seine jüngeren Söhne mit <strong>de</strong>n wichtigen Territorien Anjou, Berry und Burgund. Diese Nebenlinien <strong>de</strong>r Valois haben bis 1477 erheblichen<br />
Einfluss im Königreich. Insbeson<strong>de</strong>re das Haus Burgund kann während dieser Zeit einen erheblichen Besitz anhäufen. Einen ersten Schritt da<strong>zu</strong> unternimmt Philipp <strong>de</strong>r Kühne, Herzog
von Burgund (1363–1404), als es 1378 <strong>zu</strong> einer Auflehnung <strong>de</strong>r flandrischen Städte gegen die kriegsbedingt hohe Steuerlast kommt. Philipp von Burgund kann diesen Aufstand<br />
nie<strong>de</strong>rschlagen und erhält mit <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>r flandrischen Gräfin Margarete von Mâle 1384 Flan<strong>de</strong>rn, mit <strong>de</strong>m Artois, Hennegau und <strong>de</strong>r Franche-Comté. Philipp und sein Neffe Ludwig<br />
Herzog von Orléans(1392–1407) nehmen weiterhin die Regentschaft für <strong>de</strong>n geisteskranken König Karl VI. (1380–1422) wahr, sind aber untereinan<strong>de</strong>r in Machtkämpfe verstrickt.<br />
Es kam <strong>zu</strong>r Staatskrise, als 1415 England erneut <strong>de</strong>n Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieg aufgriff. Herzog Philipp <strong>de</strong>r Gute von Burgund (1419-67) stellte sich auf die Seite Englands, als 1419<br />
Anhänger <strong>de</strong>s Dauphin seinen Vater ermor<strong>de</strong>n. England und Burgund besetzten schnell die Normandie und <strong>de</strong>n Nor<strong>de</strong>n Frankreichs einschließlich <strong>de</strong>r Krondomäne mit Paris, sowie<br />
Aquitanien. Die Rettung kam mit Jeanne d'Arc, <strong>de</strong>r so genannten Jungfrau von Orléans. Diese konnte <strong>de</strong>n nationalen Wi<strong>de</strong>rstand entfachen, zwang 1429 England <strong>zu</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
Belagerung von Orléans und führte Karl VII. (1422-61) <strong>zu</strong>r Salbung nach Reims. Schließlich wur<strong>de</strong> sie von <strong>de</strong>n Burgun<strong>de</strong>rn gefangen genommen, an die Englän<strong>de</strong>r verkauft und am 30.<br />
Mai 1431 auf <strong>de</strong>m Scheiterhaufen verbrannt. In Frankreich gilt sie seither als Nationalheldin. Von <strong>de</strong>r Römisch-katholischen Kirche wur<strong>de</strong> sie 1920 heilig gesprochen. 1435 versöhnte<br />
sich <strong>de</strong>r König mit Burgund, 1436 wur<strong>de</strong> Paris und 1449–53 schließlich die Normandie <strong>zu</strong>rückerobert – <strong>de</strong>r Krieg schlief daraufhin ein.<br />
In <strong>de</strong>r Zwischenzeit können die Burgun<strong>de</strong>r weiter ihren Herrschaftsbereich ausbauen. Der König konnte 1435 <strong>de</strong>ren Abwendung von England nur durch die Entlassung Burgunds aus <strong>de</strong>r<br />
französischen Lehnsabhängigkeit erkaufen. Burgund verdankt seinen Aufstieg <strong>de</strong>r anhalten<strong>de</strong>n Schwäche <strong>de</strong>r französischen Monarchie. Als jedoch 1461 nach Beilegung <strong>de</strong>s<br />
Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieges Ludwig XI. <strong>de</strong>n französischen Thron besteigt, än<strong>de</strong>rt sich die politische Lage: Da Burgund nach wie vor als Teil Frankreichs gilt, ist <strong>de</strong>r Zusammenprall<br />
unausweichlich. Der Konflikt wird noch durch die aggressive Politik Herzog Karls <strong>de</strong>s Kühnen (1467-77) verschärft, <strong>de</strong>r Burgund <strong>zu</strong>m unabhängigen Königreich erklären will. Er trifft<br />
eine entsprechen<strong>de</strong> Vereinbarung mit <strong>de</strong>m Habsburger Kaiser Friedrich III. (1440-93), <strong>de</strong>r aber im Gegen<strong>zu</strong>g die Hand <strong>de</strong>r burgundischen Erbin Maria für seinen Sohn Maximilian<br />
for<strong>de</strong>rt. Dem stimmt Karl letztlich auch <strong>zu</strong>, kann jedoch die Früchte seiner Politik nicht mehr ernten, da er 1477 in <strong>de</strong>r Schlacht bei Nancy fällt.<br />
Mit <strong>de</strong>m Erbfall erhebt nun Habsburg Ansprüche auch auf französisches Territorium. Es kommt <strong>zu</strong>m Krieg; erst 1493 wird mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss von Senlis entschie<strong>de</strong>n, dass Flan<strong>de</strong>rn<br />
und das Artois an Habsburg fallen und in das römisch-Deutsche Reich eingeglie<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Bei Frankreich verbleiben die übrigen französischen Territorien aus <strong>de</strong>m burgundischen Erbe<br />
(Burgund, Nevers, Picardie).<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r Italienischen Kriege seit 1495 wur<strong>de</strong>n Spanien und Frankreich <strong>zu</strong>nehmend Machtkonkurrenten. Frankreich versuchte mehrfach Mailand <strong>zu</strong> annektieren und so die<br />
Oberhoheit in Italien <strong>zu</strong> erlangen. Unter <strong>de</strong>r Regierung Franz I. kam es <strong>zu</strong> heftigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Kaiser Karl V., <strong>de</strong>r seinen Besitz in Süditalien (Neapel) <strong>zu</strong> verteidigen<br />
suchte. Franz’ Offensivkriege blieben letztlich ohne Folgen.<br />
Sein Nachfolger Heinrich II. unternahm ebenfalls Angriffskriege gegen das Haus Habsburg, die nur mäßige Erfolge brachten. Durch die Unterzeichnung <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns von Cateau-<br />
Cambrésis suchte man einen außenpolitisch stabilen Frie<strong>de</strong>n, da es <strong>zu</strong> inneren Konflikten mit <strong>de</strong>n Hugenotten kam. Durch diesen Frie<strong>de</strong>n verlor Frankreich seine Vormachtposition an<br />
Spanien.<br />
Es kam <strong>zu</strong>r inneren Schwächung Frankreichs und <strong>de</strong>r Krone. Katholisches und protestantisches Lager bekämpften sich gegenseitig, um Einfluss auf die Regierung <strong>zu</strong> erhalten. In <strong>de</strong>r<br />
Bartholomäusnacht am 23./24. August 1572 in Paris wur<strong>de</strong>n wichtige protestantische Persönlichkeiten ermor<strong>de</strong>t. Dies löste erneut Flüchtlingsströme aus.<br />
1589–1789: Haus Bourbon<br />
Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r direkten Linie <strong>de</strong>r sogenannten Valois führte <strong>zu</strong> Kämpfen, bei <strong>de</strong>nen schließlich Heinrich IV. aus <strong>de</strong>m Hause Bourbon rechtmäßig König wur<strong>de</strong>. Er war <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendste<br />
männliche Nachkomme <strong>de</strong>s frz. Königshauses und Neffe <strong>de</strong>s Königs Franz I., so dass er sich gegen das pro-spanische Haus Guise durchsetzen konnte, das <strong>de</strong>n Thron usurpieren wollte.<br />
Da er Protestant war, musste er <strong>zu</strong>m Katholizismus übertreten, um seine Herrschaft <strong>zu</strong> festigen. Sein Ausspruch "Paris ist eine Messe wert" (katholische Messe) wur<strong>de</strong> weltberühmt.<br />
Schließlich brachte 1598 das von Heinrich IV. erlassene Edikt von Nantes eine zeitweilige Beruhigung <strong>de</strong>r Lage, die jedoch nur bis <strong>zu</strong>r Eroberung von La Rochelle 1628 anhielt.<br />
Mit <strong>de</strong>r Thronbesteigung Heinrich IV. begann die be<strong>de</strong>utendste Epoche <strong>de</strong>r frz. Geschichte: Der erneute Aufstieg Frankreichs <strong>zu</strong>r Vormacht in Europa und die Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r<br />
absolutistisch-zentralistischen Staatsform. Heinrich installierte eine zentral gelenkte, vom König völlig abhängige Bürokratie und schlug eine aggressive Außenpolitik gegenüber Spanien<br />
ein. Seine Ermordung verhin<strong>de</strong>rte jedoch eine Invasion in die Spanischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>. Sein Sohn Ludwig XIII. stand <strong>zu</strong>nächst unter <strong>de</strong>r Regentschaft seiner Mutter. Es folgte eine Zeit, in<br />
<strong>de</strong>r zwei Kardinäle – Richelieu und Mazarin – die Geschicke Frankreichs an Stelle <strong>de</strong>s Königs lenkten und <strong>de</strong>n Protestantismus energisch <strong>zu</strong>rückdrängten. Mit <strong>de</strong>r Einnaheme von La<br />
Rochelle 1628 verloren die Hugenotten <strong>de</strong>n letzten <strong>de</strong>r ihnen im Edikt von Nantes gewährten befestigten Rück<strong>zu</strong>gsplätze und waren danach schutzlos <strong>de</strong>r königlichen absolutistischen
Politik ausgeliefert. Unter <strong>de</strong>r Leitung Richelieus wur<strong>de</strong> die Macht <strong>de</strong>r Krone weiter gefestigt, die innere Opposition ausgeschaltet und höchst aktive Außenpolitik betrieben. Auf<br />
Betreiben Richelieus griff 1635 Frankreich aktiv in <strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg in Mitteleuropa ein und geriet damit automatisch in Konflikt mit Spanien (Französisch-Spanischer Krieg<br />
(1635–1659)). Im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n von 1648 erhielt Frankreich Gebiete im Elsass <strong>zu</strong>gesprochen und erreichte eine dauerhafte Schwächung <strong>de</strong>r Zentralgewalt im Heiligen<br />
Römischen Reich. Mit <strong>de</strong>m Pyrenäenfrie<strong>de</strong>n ging die Zeit <strong>de</strong>r Hegemonie Spaniens in Europa auch äußerlich sichtbar <strong>zu</strong> En<strong>de</strong> und das Zeitalter <strong>de</strong>r französischen Dominanz in Europa<br />
begann. Diese Dominanz war nicht nur eine militärische, son<strong>de</strong>rn auch eine kulturelle. Fast alle Fürsten Europas orientierten sich am Vorbild <strong>de</strong>r französischen Kultur am Hof von<br />
Versailles. Das Französische wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r dominieren<strong>de</strong>n Bildungssprache.<br />
Der vierjährige König Ludwig XIV. erbte 1643 <strong>de</strong>n Thron, Mazarin führte die Regierung weiter. Die sogenannte Fron<strong>de</strong> bekämpfte die Herrschaft Mazarins und die absolutistische Macht,<br />
aber <strong>de</strong>r Bürgerkrieg scheiterte. Nach <strong>de</strong>m Tod Kardinal Mazarins übernahm Ludwig XIV. 1661 die Regierung allein. Unter ihm gelangte Frankreich auf <strong>de</strong>n Gipfel seiner Macht. Der<br />
König selbst verfügte dabei über eine enorme Machtfülle im Staat, das Zeitalter <strong>de</strong>s Absolutismus brach endgültig an. Aufgrund seiner Prunksucht wur<strong>de</strong> er <strong>de</strong>r Sonnenkönig genannt.<br />
Ludwig XIV. sah sich in <strong>de</strong>r politischen Tradition seines Großvaters und Richelieus, um Frankreichs Machtposition <strong>zu</strong> stärken. Nach <strong>de</strong>m blutigen Londoner Kutschenstreit erzwang er<br />
die Anerkennung <strong>de</strong>r französischen Krone als stärkster Macht in Europa. Er reformierte <strong>de</strong>n Staat von Grund auf, in<strong>de</strong>m er die Bürokratie effektiv ausbaute, die Wirtschaft massiv<br />
för<strong>de</strong>rte, die französische Armee <strong>zu</strong>r leistungsstärksten, fortschrittlichsten und größten <strong>de</strong>s Kontinents ausbaute, die Flotte neu schuf und das Rechtswesen vereinfachte. Dabei stand ihm<br />
<strong>de</strong>r geniale Colbert <strong>zu</strong>r Seite. Sein Schloss Versailles und die staatliche Organisation Frankreichs wur<strong>de</strong>n überall als wegweisend kopiert. Paris wuchs <strong>zu</strong>r größten Stadt Europas und <strong>zu</strong>m<br />
wissenschaftlichen und intellektuellen Zentrum Europas heran.<br />
Während seiner Herrschaft führte Frankreich vier große Kriege bzw. Raubkriege: Den Devolutionskrieg (1667–1668), <strong>de</strong>n Holländischen Krieg (1672–1678), <strong>de</strong>n Pfälzischen<br />
Erbfolgekrieg gegen die Augsburger Allianz (1688–1697) und <strong>de</strong>n Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1713). Letzterer en<strong>de</strong>te in einer Staatsverschuldung, aber auch in <strong>de</strong>r endgültigen<br />
Beseitigung <strong>de</strong>r Habsburger als politischer Bedrohung. Seine Kriege ergaben eine enorme territoriale Erweiterung und führten sowohl <strong>zu</strong> Frankreichs heutigen Grenzen als auch <strong>zu</strong>r<br />
<strong>de</strong>utsch-französische Erbfeindschaft infolge <strong>de</strong>r seit <strong>de</strong>m Dreißigjährigen Krieg wie<strong>de</strong>rholten französischen Raubzüge und Verwüstungen auch östlich <strong>de</strong>s Rheins.<br />
Durch Ludwigs Edikt von Fontainebleau 1685 wur<strong>de</strong> das tolerante Edikt von Nantes aufgehoben, um die Einheit <strong>de</strong>s Staates <strong>zu</strong> vollen<strong>de</strong>n. Kirchen <strong>de</strong>r Hugenotten wur<strong>de</strong>n zerstört,<br />
protestantische Schulen geschlossen. Wer im Lan<strong>de</strong> blieb und noch als Protestant erkennbar war, wur<strong>de</strong> verfolgt.<br />
Ludwig überlebte seinen Sohn und seinen ältesten Enkel und starb am 1. September 1715. Sein Urenkel Ludwig XV. folgte ihm auf <strong>de</strong>m Thron; damit begann eine Zeit <strong>de</strong>s erneuten<br />
wirtschaftlichen Aufschwungs und die Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r kulturellen Blüte. Legendär sind die Hofintrigen um Madame <strong>de</strong> Pompadour und Madame Dubarry. Durch seine erfolglose<br />
Teilnahme am Siebenjährigen Krieg gegen Friedrich <strong>de</strong>n Großen verlor Ludwig XV. erhebliche Teile <strong>de</strong>r französischen Kolonien in Nordamerika (Québec, Louisiana) und Teile von<br />
Indien an England.<br />
Nach ihm kam sein Enkel Ludwig XVI. auf <strong>de</strong>n Thron, <strong>de</strong>r mit Marie Antoinette, einer Tochter <strong>de</strong>r Kaiserin Maria Theresia von Österreich verheiratet war. Ludwig XVI. machte die von<br />
Ludwig XV. noch kurz vor seinem Tod begonnenen Reformen <strong>zu</strong>m großen Teil wie<strong>de</strong>r rückgängig und suchte durch eigene Reformen <strong>de</strong>n Staat <strong>zu</strong> reorganisieren. Dabei unterlief ihm <strong>de</strong>r<br />
Fehler, dass er die Obersten Gerichtshöfe mit höherer Machtkompetenz ausstattete, wodurch es Hocha<strong>de</strong>l und Klerus besser möglich war seine Reformvorhaben <strong>zu</strong> bekämpfen. Dies<br />
führte in <strong>de</strong>n 1780er Jahren <strong>zu</strong> einer großen Finanzkrise, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r auch die Teilnahme am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beitrug. Der König reagierte mit Sparmaßnahmen und<br />
versuchte das Finanzwesen neu <strong>zu</strong> regeln; auch die direkte Besteuerung <strong>de</strong>s 1. und 2. Stan<strong>de</strong>s versuchte er <strong>zu</strong> erreichen. Nach <strong>de</strong>n Missernten <strong>de</strong>r Jahre 1787/88 sah sich <strong>de</strong>r König<br />
schließlich im August 1788 genötigt, die alte ständische Versammlung, die Generalstän<strong>de</strong> (frz. les États generaux) ein<strong>zu</strong>berufen, um die nicht mehr allein <strong>zu</strong> lösen<strong>de</strong>n Probleme<br />
an<strong>zu</strong>gehen. Letztendlich spaltete sich am 17. Juni 1789 aber ein Teil <strong>de</strong>r Generalstän<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r Dritte Stand, ab und konzipierte als Nationalversammlung eine Verfassung mit<br />
eingeschränkter Macht <strong>de</strong>r Monarchie. Damit begann das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s so genannten Ancien Régime (dt. "Alte Herrschaft").<br />
1789–1814/1815: Von Französischer Revolution <strong>zu</strong> Erstem Kaiserreich<br />
1789–1793: Vom Sturm auf die Bastille <strong>zu</strong>r Ersten Republik<br />
Die Französische Revolution begann mit <strong>de</strong>m Sturm auf die Bastille in Paris am 14. Juli 1789 (heute Nationalfeiertag Frankreichs). Die Revolutionäre wollten <strong>de</strong>m Absolutismus ein En<strong>de</strong>
setzen, <strong>de</strong>r unter Ludwig XIV. seine Blütezeit erreicht hatte, unter Ludwig XVI. jedoch bereits in eine <strong>de</strong>ka<strong>de</strong>nte Phase eingetreten war. Am 3. September 1791 wur<strong>de</strong> eine neue<br />
Verfassung mit Frankreich als einer konstitutionellen Monarchie verabschie<strong>de</strong>t. Am 10. August 1792 erfolgte <strong>de</strong>r Sturm auf die Tuilerien und die Suspendierung <strong>de</strong>s Königs.<br />
1793–1804: Erste Republik<br />
Die Verschärfung <strong>de</strong>r Gegensätze und die missglückte Flucht <strong>de</strong>s Königs nach Varennes führten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Festnahme und letztlich <strong>zu</strong> seiner Enthauptung am 21. Januar 1793; in<br />
Frankreich kam es <strong>zu</strong>r Errichtung <strong>de</strong>r Ersten Republik. Nach <strong>de</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r Jakobiner erfolgte <strong>de</strong>r Ausschluss <strong>de</strong>r Girondisten aus <strong>de</strong>m Konvent. Es folgte eine Zeit <strong>de</strong>r<br />
Terrorherrschaft unter Robespierre. Am 27./28. Juli 1794 (9./10. Thermidor) erfolgte die Verhaftung und Hinrichtung Robespierres und seiner Anhänger durch die Thermidorianer. Die<br />
Jakobinerherrschaft wur<strong>de</strong> durch die Herrschaft <strong>de</strong>s Direktoriums abgelöst. Es folgte eine Phase <strong>de</strong>r inneren Konsolidierung und <strong>de</strong>r militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>n<br />
Nachbarlän<strong>de</strong>rn.<br />
Am 9. November 1799 ergriff Napoléon Bonaparte mit <strong>de</strong>m Staatsstreich <strong>de</strong>s 18. Brumaire VIII die Macht als Erster Konsul. Er ließ 1802 die Sklaverei, die im Zuge <strong>de</strong>r Revolution<br />
abgeschafft wor<strong>de</strong>n war, in <strong>de</strong>n Kolonien wie<strong>de</strong>r einführen, was in <strong>de</strong>r Kolonie Haiti im Jahre 1804 <strong>zu</strong> einem erneuten Aufstand führte, <strong>de</strong>r schließlich in <strong>de</strong>r Unabhängigkeitserklärung<br />
Haitis mün<strong>de</strong>te.<br />
1804–1814/1815: Erstes Kaiserreich<br />
Die Französische Revolution begann mit <strong>de</strong>m Sturm auf die Bastille in Paris am 14. Juli 1789 (heute Nationalfeiertag Frankreichs). Die Revolutionäre wollten <strong>de</strong>m Absolutismus ein En<strong>de</strong><br />
setzen, <strong>de</strong>r unter Ludwig XIV. seine Blütezeit erreicht hatte, unter Ludwig XVI. jedoch bereits in eine <strong>de</strong>ka<strong>de</strong>nte Phase eingetreten war. Am 3. September 1791 wur<strong>de</strong> eine neue<br />
Verfassung mit Frankreich als einer konstitutionellen Monarchie verabschie<strong>de</strong>t. Am 10. August 1792 erfolgte <strong>de</strong>r Sturm auf die Tuilerien und die Suspendierung <strong>de</strong>s Königs.<br />
1793–1804: Erste Republik<br />
Die Verschärfung <strong>de</strong>r Gegensätze und die missglückte Flucht <strong>de</strong>s Königs nach Varennes führten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Festnahme und letztlich <strong>zu</strong> seiner Enthauptung am 21. Januar 1793; in<br />
Frankreich kam es <strong>zu</strong>r Errichtung <strong>de</strong>r Ersten Republik. Nach <strong>de</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r Jakobiner erfolgte <strong>de</strong>r Ausschluss <strong>de</strong>r Girondisten aus <strong>de</strong>m Konvent. Es folgte eine Zeit <strong>de</strong>r<br />
Terrorherrschaft unter Robespierre. Am 27./28. Juli 1794 (9./10. Thermidor) erfolgte die Verhaftung und Hinrichtung Robespierres und seiner Anhänger durch die Thermidorianer. Die<br />
Jakobinerherrschaft wur<strong>de</strong> durch die Herrschaft <strong>de</strong>s Direktoriums abgelöst. Es folgte eine Phase <strong>de</strong>r inneren Konsolidierung und <strong>de</strong>r militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>n<br />
Nachbarlän<strong>de</strong>rn.<br />
Am 9. November 1799 ergriff Napoléon Bonaparte mit <strong>de</strong>m Staatsstreich <strong>de</strong>s 18. Brumaire VIII die Macht als Erster Konsul. Er ließ 1802 die Sklaverei, die im Zuge <strong>de</strong>r Revolution<br />
abgeschafft wor<strong>de</strong>n war, in <strong>de</strong>n Kolonien wie<strong>de</strong>r einführen, was in <strong>de</strong>r Kolonie Haiti im Jahre 1804 <strong>zu</strong> einem erneuten Aufstand führte, <strong>de</strong>r schließlich in <strong>de</strong>r Unabhängigkeitserklärung<br />
Haitis mün<strong>de</strong>te.<br />
1804–1814/1815: Erstes Kaiserreich<br />
Am 2. Dezember 1804 setzte sich Napoléon selbst die Kaiserkrone aufs Haupt. Bereits unter Ludwig XIV., <strong>de</strong>r das Elsass annektierte, und <strong>de</strong>r Republik hatte sich Frankreich auf Kosten<br />
seiner Nachbarn erweitert; Napoléon brachte in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>n größten Teil Europas unter seine direkte o<strong>de</strong>r indirekte Kontrolle (Koalitionskriege). Er agierte als Imperialist, wobei er <strong>de</strong>n<br />
eroberten Län<strong>de</strong>rn auch Errungenschaften <strong>de</strong>r Revolution und <strong>de</strong>s Liberalismus überbrachte: Rechtsgleichheit etwa o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong> civil ("Co<strong>de</strong> Napoléon").<br />
Am 2. Dezember 1805 siegte Napoléon gegen Russland und Österreich in <strong>de</strong>r Schlacht bei Austerlitz, auch Dreikaiserschlacht genannt. Im Oktober 1806 kam es <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Schlacht bei Jena<br />
und Auerstedt, in <strong>de</strong>r die preußischen Truppen vernichtend geschlagen wur<strong>de</strong>n. Die französischen Truppen marschierten in Berlin ein. Napoléon marschierte durch Polen und<br />
unterzeichnete ein Abkommen mit <strong>de</strong>m russischen Zar Alexan<strong>de</strong>r I., das Europa zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Mächten aufteilte. Napoléon setzte einen europaweiten Han<strong>de</strong>lsboykott (die sog.<br />
Kontinentalsperre) gegen Großbritannien durch und setzte einen neuen König in Spanien ein. Die Spanier erhoben sich, und es gelang Napoléon nicht, <strong>de</strong>n Aufstand nie<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>schlagen.<br />
1809 kam es neuerlich <strong>zu</strong>m Krieg mit Österreich, das dieses Mal jedoch auf sich alleine gestellt war. Napoléon eroberte Wien, büßte aber kurz darauf in <strong>de</strong>r Schlacht bei Aspern <strong>de</strong>n
Nimbus <strong>de</strong>r Unbesiegbarkeit ein. An<strong>de</strong>rthalb Monate später nahm er in <strong>de</strong>r Schlacht bei Wagram erfolgreich Revanche und Österreich musste sich im Frie<strong>de</strong>n von Schönbrunn geschlagen<br />
geben.<br />
In diesem Jahr ließ sich Napoléon von Joséphine schei<strong>de</strong>n, da sie ihm keine Kin<strong>de</strong>r gebären konnte, und heiratete 1810 Marie-Louise von Habsburg. Nach <strong>de</strong>r verunglückten Mission <strong>de</strong>r<br />
Gran<strong>de</strong> Armée ("Großen Armee") gegen Russland 1812 kam das Französische Kaiserreich ins Wanken. Die endgültige Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Franzosen kam 1813 in <strong>de</strong>r Völkerschlacht bei<br />
Leipzig. Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage ging Napoléon ins Exil nach Elba, einer kleinen Mittelmeerinsel. Ludwig XVIII. wur<strong>de</strong> als König eingesetzt. Schon 1815 kehrte Napoléon aber wie<strong>de</strong>r aufs<br />
Festland <strong>zu</strong>rück, wo ihn das Militär, das ihn aufhalten sollte, begeistert empfing. Er übernahm in Paris wie<strong>de</strong>r die Macht und regierte weitere 100 Tage. 1815 wur<strong>de</strong> Napoléon bei<br />
Waterloo, (auch "Belle Alliance" genannt), in <strong>de</strong>r Nähe von Brüssel endgültig besiegt. Frankreich musste die eroberten Gebiete wie<strong>de</strong>r aufgeben, konnte sein altes Territorium<br />
(einschließlich Elsass-Lothringens) aber vollständig erhalten.<br />
1814/1815–1871: Von <strong>de</strong>r Restauration <strong>zu</strong>m Zweiten Kaiserreich<br />
1814/1815–1830: Restauration<br />
Es wur<strong>de</strong>n nun wie<strong>de</strong>r Könige aus <strong>de</strong>m Hause Bourbon eingesetzt, das mit Ludwig XVIII. und Karl X. immer <strong>de</strong>spotischer regierte. Am 26. Juli 1830 löste Karl X. das Parlament auf. Auf<br />
<strong>de</strong>n "Staatsstreich" reagierte die liberale Opposition mit Aufrufen <strong>zu</strong>m Wi<strong>de</strong>rstand gegen das Regime. Es kam <strong>zu</strong>r Julirevolution von 1830.<br />
1830–1848: Julimonarchie<br />
In <strong>de</strong>r Folge dieser Revolution 1830 kam <strong>de</strong>r als liberal gelten<strong>de</strong> Louis-Philippe aus <strong>de</strong>r Nebenlinie Orléans <strong>de</strong>s Hauses Bourbon auf <strong>de</strong>n französischen Thron. Als sogenannter<br />
Bürgerkönig führte er seine vom Großbürgertum gestützte Regierung <strong>zu</strong>nächst liberal, gab dann aber seiner Politik eine <strong>zu</strong>nehmend reaktionäre Richtung, bis hin <strong>zu</strong>m Beitritt Frankreichs<br />
in die Heilige Allianz, ein ursprünglich von Preußen, Russland und Österreich gegrün<strong>de</strong>tes, <strong>de</strong>r Restauration verpflichtetes Staatenbündnis. Louis-Philippes Herrschaft wur<strong>de</strong> 1848 durch<br />
eine erneute bürgerliche Revolution, die <strong>zu</strong>r zweiten französischen Republik führte, gestürzt.<br />
1848–1852: Zweite Republik<br />
1848 kam es <strong>zu</strong>r Februarrevolution und eine zweite Republik wur<strong>de</strong> errichtet. Louis Napoléon Bonaparte, ein Neffe Napoléon Bonapartes, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten gewählt.<br />
1852–1870: Zweites Kaiserreich<br />
Am 2. Dezember 1852 krönte sich Louis Napoléon Bonaparte als Napoléon III. <strong>zu</strong>m Kaiser. Er sicherte seine Macht durch Militär und Repressionsmaßnahmen ab. Eine erfolgreiche<br />
Außenpolitik sowie materielle Zugeständnisse an die Bevölkerung sicherten seine Macht <strong>zu</strong>sätzlich ab. Sein Zweites Kaiserreich dauerte bis 1870, bis er im Deutsch-Französischen Krieg<br />
militärisch scheiterte und in preußische Gefangenschaft geriet.<br />
1870–1944: Pariser Kommune, Dritte Republik, Vichy-Regime [Bearbeiten]<br />
1870–1871: Pariser Kommune<br />
Nach einer Kapitulation <strong>de</strong>s Kaiserreichs kam es in Paris <strong>zu</strong>m Volksaufstand gegen diese Kapitulation; die sogenannte Pariser Kommune entstand. Die Abgeordneten <strong>de</strong>r Kommune<br />
for<strong>de</strong>rten die Gründung einer fö<strong>de</strong>ralistischen Republik. Die konservative Mehrheit <strong>de</strong>r französischen Nationalversammlung schickte Truppen gegen die Kommune. Nach zweimonatiger<br />
Belagerung kam es vom 21. bis 28. Mai 1871 <strong>zu</strong> erbitterten Barrika<strong>de</strong>nkämpfen um die französische Hauptstadt. Fast ein Viertel <strong>de</strong>r Arbeiterbevölkerung kam bei <strong>de</strong>n Kämpfen und <strong>de</strong>n<br />
darauffolgen<strong>de</strong>n Massenexekutionen ums Leben.<br />
1871–1940: Dritte Republik
In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong> Frankreich wie<strong>de</strong>r Republik. 1905 wur<strong>de</strong> als eine Konsequenz aus <strong>de</strong>r Affäre Dreyfus das Gesetz <strong>zu</strong>r Trennung von Religion und Staat angenommen, wodurch die<br />
vollkommene Trennung von Staat und Kirche – frz. la laïcité, dt. Laizismus – in <strong>de</strong>r Verfassung verankert wur<strong>de</strong>. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 (frz. La Gran<strong>de</strong> Guerre) kamen<br />
ca. 1,5 Mio. französische Soldaten ums Leben. Frankreich gehörte nach <strong>de</strong>m Krieg <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Siegermächten <strong>de</strong>r Entente und diktierte <strong>de</strong>n Verlierern im Versailler Vertrag harte<br />
Bedingungen. Das 1871 an Deutschland verlorene Elsass-Lothringen wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r an Frankreich abgetreten.<br />
In <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit verfolgte Frankreich <strong>zu</strong>nächst die Politik <strong>de</strong>r Sicherheit am Rhein (1923 Ruhrgebietsbeset<strong>zu</strong>ng unter Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Poincaré), <strong>de</strong>r die <strong>de</strong>utsch-französische<br />
Annäherung im Locarnovertrag 1925 folgte. Die folgen<strong>de</strong>n Jahre waren Krisenjahre mit schnell wechseln<strong>de</strong>n Regierungen. Im Februar 1934 kam es überdies <strong>zu</strong> einem Putschversuch <strong>de</strong>r<br />
faschistischen Bewegung Croix <strong>de</strong> feu. Nach <strong>de</strong>m Rücktritt von Édouard Daladier (1934) bil<strong>de</strong>te Gaston Doumergue eine Regierung <strong>de</strong>r nationalen Einheit (frz. Union Nationale), die<br />
ohne Zustimmung <strong>de</strong>r Kommunisten und Sozialisten auskommen musste. 1936 konnten die Parlamentswahlen von <strong>de</strong>r neu gebil<strong>de</strong>ten Volksfront aus Sozialisten, Kommunisten und<br />
Radikalsozialisten mit <strong>de</strong>r Parole «Brot, Frie<strong>de</strong>n, Freiheit» gewonnen wer<strong>de</strong>n. Der Sozialist Léon Blum wur<strong>de</strong> 1936/37 und 1938 Ministerpräsi<strong>de</strong>nt. Sein Nachfolger wur<strong>de</strong> zweimal <strong>de</strong>r<br />
Radikalsozialist Edouard Daladier. Die Volksfront verfolgte konsequent das Prinzip <strong>de</strong>r Nichteinmischung und war auf Frie<strong>de</strong>n und Verteidigung eingestellt. Gegenüber Deutschland<br />
verfolgte sie eine Appeasement-Politik.<br />
Erst als Hitler am 1. September 1939 <strong>de</strong>n Polenfeld<strong>zu</strong>g begann, reagierte Frankreich <strong>zu</strong>sammen mit Großbritannien mit <strong>de</strong>r Kriegserklärung. Frankreich war jedoch bei Ausbruch <strong>de</strong>s<br />
Zweiten Weltkrieges wegen <strong>de</strong>r vorangegangenen innenpolitischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen militärisch unvorbereitet. Die französische Armee blieb bis <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Beset<strong>zu</strong>ng Belgiens<br />
am 10. Mai 1940 in <strong>de</strong>r Defensive und beschränkte sich auf einen „Sitzkrieg“. Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng nach <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Angriff en<strong>de</strong>te innerhalb weniger Wochen mit <strong>de</strong>r völligen<br />
Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r französischen Armee. Am 14. Juni 1940 besetzten <strong>de</strong>utsche Truppen Paris. Staatspräsi<strong>de</strong>nt Albert Lebrun beauftragte nach <strong>de</strong>m Rücktritt <strong>de</strong>s Ministerpräsi<strong>de</strong>nten Reynaud<br />
Marschall Pétain am 16. Juni 1940 mit <strong>de</strong>r Regierungsbildung und Waffenstillstandsverhandlungen. Hitler konnte <strong>de</strong>n Besiegten die Bedingungen mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r diktieren.<br />
Am 22. Juni 1940 unterschrieb General Charles Huntziger im historischen Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne <strong>de</strong>n Waffenstillstand an <strong>de</strong>m Ort, an <strong>de</strong>m auch <strong>de</strong>r Waffenstillstand<br />
<strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges unterschrieben wor<strong>de</strong>n war.<br />
1940–1944: Vichy-Regime<br />
Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage blieb Frankreich besetzt. Der Waffenstillstandsvertrag sah eine Aufteilung Frankreichs in verschie<strong>de</strong>ne Zonen vor. Die von <strong>de</strong>n Deutschen besetzte und unter<br />
Militärverwaltung gestellte „Zone occupeé“ (besetzte Zone) umfasste <strong>de</strong>n Nordosten und Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, die Atlantik- und die Kanalküste sowie die <strong>de</strong> facto vom Deutschen Reich<br />
annektierten Gebiete Elsass und Lothringen. Der <strong>de</strong>utsche Militärbefehlshaber residierte mit seinen Behör<strong>de</strong>n in Paris. Der äußerste Nor<strong>de</strong>n unterstand <strong>de</strong>r Militärverwaltung in Belgien,<br />
<strong>de</strong>r äußerste Südosten <strong>de</strong>m Bündnispartner Italien. In <strong>de</strong>r „Zone libre“ (Freie Zone) entstand das von <strong>de</strong>n Deutschen abhängige konservativ-autoritäre Vichy-Regime (die offizielle<br />
Bezeichnung war État Français), eine bis <strong>zu</strong>m Vordringen <strong>de</strong>r Alliierten 1944 mit Deutschland kooperieren<strong>de</strong> Regierung. Die Regierung erhielt ihren Namen von ihrem Regierungssitz,<br />
<strong>de</strong>m Kurort Vichy in <strong>de</strong>r Auvergne. Chef <strong>de</strong> l'État (Staatschef) war Marschall Henri Philippe Pétain. Die Freie Zone wur<strong>de</strong> am 11. November 1942 von <strong>de</strong>n Deutschen besetzt, als <strong>de</strong>n<br />
Alliierten die Invasion nach Nordafrika gelang. Wie in <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren von Deutschland besetzten Staaten kam es auch in Frankreich <strong>zu</strong> bewaffnetem Wi<strong>de</strong>rstand durch die Résistance gegen<br />
die Besat<strong>zu</strong>ng und ihre Helfer. Der <strong>de</strong>utschen Partisanenbekämpfung fielen insgesamt rund 13.000 bis 16.000 Franzosen <strong>zu</strong>m Opfer, darunter 4.000 bis 5.000 vollkommen unbeteiligte<br />
Zivilisten.[1] Bei <strong>de</strong>r Landung in <strong>de</strong>r Normandie und <strong>de</strong>r Befreiung Frankreichs waren mit untergeordneter Be<strong>de</strong>utung auch Truppen <strong>de</strong>s Freien Frankreich, <strong>de</strong>r unter Charles <strong>de</strong> Gaulle<br />
gebil<strong>de</strong>ten Londoner Exilregierung, beteiligt<br />
Seit 1944: Provisorische Regierung, Vierte und Fünfte Republik<br />
1944–1947: Provisorische Regierung<br />
De Gaulle bil<strong>de</strong>te am 9. September 1944 eine provisorische Regierung. Nach <strong>de</strong>r Vertreibung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Besatzer kam es <strong>zu</strong>erst <strong>zu</strong> wil<strong>de</strong>n Ausschreitungen gegen <strong>de</strong>r Kollaboration<br />
verdächtigte Landsleute; später wur<strong>de</strong> die Einrichtung einer Commission d'Épuration auf regionaler Ebene bewirkt. Marschall Pétain wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Tod verurteilt (von <strong>de</strong> Gaulle wur<strong>de</strong> die<br />
Strafe schließlich in lebenslange Haft umgewan<strong>de</strong>lt) und <strong>de</strong>r Ministerpräsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Vichy-Regimes Pierre Laval hingerichtet.
Am 13. November 1945 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gaulle durch die französische Nationalversammlung <strong>zu</strong>m Ministerpräsi<strong>de</strong>nten gewählt.<br />
1947–1958: Vierte Republik<br />
Die Vierte Republik war bereits am 13. Oktober 1946 durch einen Volksentscheid beschlossen wor<strong>de</strong>n. Als erster Staatspräsi<strong>de</strong>nten trat 1947 <strong>de</strong>r Sozialist Vincent Auriol sein Amt an.<br />
1954 wur<strong>de</strong> René Coty sein Nachfolger.<br />
Frankreich war trotz <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage 1940 gegen das Deutsche Reich von <strong>de</strong>n Siegermächten (USA, Großbritannien, Sowjetunion) als gleichberechtigte Macht (Besat<strong>zu</strong>ngsmacht)<br />
anerkannt wor<strong>de</strong>n. Frankreich wur<strong>de</strong> auch eine <strong>de</strong>r Veto-Mächte im UNO-Sicherheitsrat. In die Zeit <strong>de</strong>r Vierten Republik fällt <strong>de</strong>r Indochinakrieg, mit <strong>de</strong>m durch die Nie<strong>de</strong>rlage für<br />
Frankreich 1954 das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s französischen Kolonialreichs eingeleitet wur<strong>de</strong>. Die durch <strong>de</strong>n Algerienkrieg ausgelöste Krise been<strong>de</strong>te die Vierte Republik, und brachte 1958 Charles <strong>de</strong><br />
Gaulle wie<strong>de</strong>r an die Macht. De Gaulle verlangte vor seiner Wahl als Staatspräsi<strong>de</strong>nt Son<strong>de</strong>rvollmachten <strong>zu</strong>r Lösung <strong>de</strong>r Algerienkrise sowie eine Verfassungsän<strong>de</strong>rung <strong>zu</strong>r Stärkung <strong>de</strong>r<br />
präsidialen Autorität gegenüber Regierung und Parlament. Die neue Verfassung wur<strong>de</strong> im selben Jahr per Volksentscheid angenommen und markierte das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vierten Republik.<br />
Herausragen<strong>de</strong> Politiker sind René Pleven, Robert Schuman, Pierre Mendès-France und Georges Bidault.<br />
Seit 1958: Fünfte Republik<br />
Die neue Verfassung wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r so genannten Fünften Republik, die bis heute andauert. Seit 1958 gilt Frankreich als semipräsi<strong>de</strong>ntielle Demokratie, <strong>de</strong>r Begriff ist in <strong>de</strong>r<br />
Politikwissenschaft allerdings umstritten. Von 1958 bis 1969 war Charles <strong>de</strong> Gaulle Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Fünften Republik. Im September 1958 wählten die Franzosen per Referendum mit 80%<br />
die neue Konstitution, die auf einen Vorschlag <strong>de</strong> Gaulles <strong>zu</strong>rückging. In dieser Konstitution wur<strong>de</strong> die exekutive Macht bekräftigt, und <strong>de</strong>m Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Republique weiterhin die<br />
Repräsentation <strong>de</strong>s Staates <strong>zu</strong>gesprochen. Er ist Befehlshaber <strong>de</strong>r Armee, kann Gesetze verabschie<strong>de</strong>n und die Assemblée Nationale je<strong>de</strong>rzeit auflösen. 1962 been<strong>de</strong>te <strong>de</strong> Gaulle <strong>de</strong>n Krieg<br />
in Algerien. Die meisten Franzosen mussten Algerien daraufhin verlassen. 1968 brachen in Paris die Mai-Unruhen aus, <strong>de</strong>nen sich die Arbeiter anschlossen. De Gaulle setzte Neuwahlen<br />
an und gewann noch einmal. 10 Monate später verlor er jedoch ein Referendum und trat <strong>zu</strong>rück. Seine Nachfolger Georges Pompidou (1969-74) und Valéry Giscard d'Estaing (1974-81)<br />
führten seine Politik im Wesentlichen fort. 1981 kam mit <strong>de</strong>r Wahl <strong>de</strong>s sozialistischen Staatspräsi<strong>de</strong>nten François Mitterrand (1981-95) und <strong>de</strong>m anschließen<strong>de</strong>n Wahlsieg <strong>de</strong>r<br />
Sozialistischen Partei (PS) die gemäßigte Linke an die Macht. 1986 verlor Mitterrand die absolute Mehrheit im Parlament und musste fortan mit <strong>de</strong>m gaullistischen Premierminister<br />
Jacques Chirac regieren, die Phase <strong>de</strong>r Cohabitation begann.<br />
1995 gewann Chirac die Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen gegen <strong>de</strong>n sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin. Chirac verlor 1997 die absolute Mehrheit im Parlament an die Sozialisten, Lionel<br />
Jospin wur<strong>de</strong> Premierminister. 2002 setzte sich Chirac bei <strong>de</strong>n Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahlen erneut gegen <strong>de</strong>n sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin und Jean-Marie Le Pen, <strong>de</strong>n Chef <strong>de</strong>r<br />
rechtsextremen Nationalen Front (frz. le Front National), durch. Jospin belegte nur Platz drei hinter <strong>de</strong>m Amtsinhaber Chirac und Le Pen, er trat von allen Ämtern <strong>zu</strong>rück. Von 2002 bis<br />
2007 amtierte dann wie<strong>de</strong>r eine konservative Regierung unter <strong>de</strong>n Premierministern Raffarin und <strong>de</strong> Villepin. Die Ablehnung <strong>de</strong>s EU-Referendums am 29. Mai 2005 und die Unruhen in<br />
vielen französischen Vorstädten im Herbst 2005 (siehe: Unruhen in Frankreich 2005) machten einen Reformstau <strong>de</strong>utlich sichtbar. So gewann im Mai 2007 <strong>de</strong>r ehemalige Wirtschafts-<br />
und Innenminister Nicolas Sarkozy die Stichwahl <strong>de</strong>r Französischen Präsi<strong>de</strong>ntschaftswahl gegen die Sozialistin Ségolène Royal. Mitte 2008 brachte er eine große Verfassungsreform auf<br />
<strong>de</strong>n Weg, die unter an<strong>de</strong>rem die Amtszeit <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten auf zwei Legislaturperio<strong>de</strong>n begrenzt und <strong>de</strong>m Parlament mehr Einfluss auf die Politik <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s geben soll.<br />
In <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten wur<strong>de</strong> die Annäherung und die Kooperation mit <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland (siehe auch: Élysée-Vertrag) zentral für die ökonomische Integration Europas,<br />
einschließlich <strong>de</strong>r Einführung <strong>de</strong>s Euro im Januar 2002.<br />
Literatur<br />
• H.-G. Haupt u.a.: Kleine Geschichte Frankreichs, Stuttgart, Reclam 1994.<br />
• Ernest Lavisse: Histoire <strong>de</strong> France <strong>de</strong>puis les origines jusqu`à la Révolution, 9 Bän<strong>de</strong>, Paris 1903–1911.<br />
• Nouvelle Histoire <strong>de</strong> la France contemporaine, 20 Bän<strong>de</strong>, Paris 1972–2005.<br />
• Jean Favier (Hrsg.): Geschichte Frankreichs (6 Bän<strong>de</strong>), Stuttgart 1989 ff.
• Wolfgang Schmale: Geschichte Frankreichs, Stuttgart: Ulmer (UTB), 2000, ISBN 3-8252-2145-8.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Peter Lieb: Konventioneller Krieg o<strong>de</strong>r NSWeltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München, Ol<strong>de</strong>nbourg<br />
Wissenschaftsverlag, 2007, ISBN 978-3486579925<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Fränkisches Reich<br />
Das Fränkische Reich war ein Königreich in West- und Mitteleuropa zwischen <strong>de</strong>m 5. und 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt, das sich auf <strong>de</strong>m westeuropäischen Gebiet <strong>de</strong>s Römischen Reichs bil<strong>de</strong>te. Es<br />
geht auf mehrere westgermanische Völker <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rungszeit <strong>zu</strong>rück.<br />
Das Reich <strong>de</strong>r Franken wur<strong>de</strong> innerhalb von drei Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>zu</strong>r historisch wichtigsten Reichsbildung <strong>de</strong>s abendländischen Europa seit <strong>de</strong>r Antike,[1] und nach <strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>s<br />
Römischen Reichs <strong>zu</strong>m Machtzentrum und später <strong>zu</strong>r Großmacht in West- und Mitteleuropa. Es wur<strong>de</strong> durch die Dynastien <strong>de</strong>r Merowinger und später <strong>de</strong>r Karolinger regiert, die aus <strong>de</strong>n<br />
Arnulfingern und Pippini<strong>de</strong>n hervorgingen. Eine wichtige Stütze <strong>de</strong>r späteren Dynastie <strong>de</strong>r Karolinger war Karl Martell, <strong>de</strong>r 732 in <strong>de</strong>r Schlacht bei Tours und Poitiers an <strong>de</strong>r Loire das<br />
Vordringen <strong>de</strong>r islamischen Mauren nach Mitteleuropa verhin<strong>de</strong>rte. Den Höhepunkt seiner Macht und Aus<strong>de</strong>hnung erreichte das Frankenreich unter Karl <strong>de</strong>m Großen. Nach <strong>de</strong>r späteren<br />
Teilung wur<strong>de</strong> aus seinem östlichen Teil (Ostfrankenreich) das mittelalterliche <strong>de</strong>utsche Reich (Heilige Römische Reich Deutscher Nation) und aus <strong>de</strong>m westlichen Teil Frankreich.<br />
Das merowingische Frankenreich<br />
Schon im 4. Jahrhun<strong>de</strong>rt sie<strong>de</strong>lten auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Römischen Reiches germanische Stämme als Fö<strong>de</strong>raten. Diesen wur<strong>de</strong> aufgrund <strong>de</strong>r militärischen Probleme Roms das<br />
Siedlungsrecht gegeben, in <strong>de</strong>r Erwartung, dass sie dann die Reichsgrenzen verteidigen wür<strong>de</strong>n. Am nordöstlichen En<strong>de</strong> Galliens sie<strong>de</strong>lten die germanischen Franken, die als Franci in<br />
römischen Quellen das erste Mal in <strong>de</strong>n 50er Jahren <strong>de</strong>s 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt erwähnt wer<strong>de</strong>n.[2]<br />
Die Erstnennung <strong>de</strong>s Stammes <strong>de</strong>r Salfranken fin<strong>de</strong>t sich beim römischen Historiker Ammianus Marcellinus, welcher vom Kampf <strong>de</strong>s römischen Caesar (Unterkaisers) Julian gegen die<br />
Franken im Jahr 358 berichtete:<br />
„Nach diesen Vorbereitungen wandte er sich <strong>zu</strong>nächst gegen die Franken, die man gewöhnlich als Salier bezeichnet; sie hatten sich vor längerer Zeit erfrecht, auf römischem<br />
Bo<strong>de</strong>n in Toxandrien ihre Wohnsitze ein<strong>zu</strong>richten.“[3]<br />
Nach<strong>de</strong>m Gallien seit <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s Heermeisters Aëtius <strong>de</strong>r römischen Kontrolle mehr und mehr entglitten war, nutzten die Franken <strong>de</strong>n Zusammenbruch <strong>de</strong>s Weströmischen Reiches (um<br />
476), um ihr Gebiet <strong>zu</strong> vergrößern, ähnlich wie die Westgoten im Sü<strong>de</strong>n. Im Nor<strong>de</strong>n Galliens hatte sich ein römisches Restreich unter <strong>de</strong>m römischen Statthalter Syagrius, <strong>de</strong>m Sohn <strong>de</strong>s<br />
Heermeisters Aegidius, im Gebiet um Soissons halten können, welches vom Rest <strong>de</strong>s Imperiums abgeschnitten war (seit 464, siehe auch Paulus).
486/487 besiegten die Franken unter Chlodwig I. Syagrius und eroberten <strong>de</strong>ssen Herrschaftsgebiet. Dadurch verschob sich die Grenze <strong>de</strong>s Frankenreiches bis an die Loire. Chlodwig, <strong>de</strong>r<br />
vorher nur einer von mehreren fränkischen Kleinkönigen war, nutzte danach die Chance, die übrigen Teilkönigreiche <strong>zu</strong> beseitigen und ein germanisch-romanisches Reich <strong>zu</strong> grün<strong>de</strong>n. Er<br />
beseitigte nacheinan<strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>rem Sigibert von Köln sowie Ragnachar und führte 496/506 erfolgreiche Kriege gegen die Alamannen. 507 schlug Chlodwig die Westgoten in <strong>de</strong>r<br />
Schlacht von Vouillé (o<strong>de</strong>r bei Voulon), nach <strong>de</strong>r er sie fast ganz aus Gallien verdrängte.<br />
Der Besitz <strong>de</strong>r Grundherren, die während <strong>de</strong>r fränkischen Eroberungskriege getötet o<strong>de</strong>r vertrieben wur<strong>de</strong>n, gelangte in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Krone (Königsgut). Dadurch finanzierte Chlodwig<br />
seine weiteren Feldzüge und stärkte seine Königsmacht. Der König wur<strong>de</strong> nach und nach größter Grundbesitzer. Durch Landschenkungen brachte er an<strong>de</strong>re Adlige in direkte<br />
Abhängigkeit, woraus sich das Lehnswesen entwickelte. Der König verlieh das Land auf Zeit, <strong>de</strong>nn das größer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> königliche Eigentum, das Ergebnis <strong>de</strong>r ständigen Kriege war,<br />
musste auch verwaltet wer<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rerseits spielte die Geldwirtschaft im Fränkischen Reich eine relativ geringe Rolle. Aus diesen Vorausset<strong>zu</strong>ngen bil<strong>de</strong>te sich die frühfeudale<br />
fränkische Gesellschaft heraus.<br />
Chlodwig übernahm aber auch <strong>de</strong>n funktionsfähigen spätantiken römischen Verwaltungsapparat (<strong>de</strong>ren Kern vor allem im Sü<strong>de</strong>n die civitates waren). Dabei spielte die Macht <strong>de</strong>r<br />
örtlichen Bischöfe, die oft Verwaltungsaufgaben in <strong>de</strong>n civitates übernommen hatten, eine wichtige Rolle, sodass sich die Kirche <strong>zu</strong> einer weiteren Machtstütze <strong>de</strong>s Königs entwickeln<br />
sollte. Durch <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>r Burgun<strong>de</strong>rin Chro<strong>de</strong>child trat Chlodwig I. <strong>zu</strong>m katholischen Christentum über.[4] Mit seiner Taufe (vielleicht 496/98 o<strong>de</strong>r 508; das Datum ist umstritten)[4]<br />
sicherte er sich die Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch die römischen Christen und ermöglichte so ein Miteinan<strong>de</strong>r von Franken und gallo-römischer Bevölkerung. Bald darauf ging auch die spätantike<br />
Übergangszeit in Gallien vorüber, das Frühmittelalter nahm langsam Gestalt an. Die königlichen Boten (Grafen und Bischöfe) waren bestimmt, Chlodwigs königliche Anordnungen<br />
durch<strong>zu</strong>setzen. Daneben setzte Chlodwig 511 auf <strong>de</strong>r ersten Reichsyno<strong>de</strong> einen maßgeblichen Einfluss fränkischer Könige auf die Bischofsinvestitur durch und versuchte, eine<br />
einheitliche kirchliche Gesetzgebung für das Frankenreich <strong>zu</strong> schaffen. Im frühen 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt (nach 507) entstand mit <strong>de</strong>r Lex Salica eine erste Sammlung <strong>de</strong>s Volksrechts <strong>de</strong>r Franken.<br />
Der Aufstieg <strong>de</strong>r Arnulfinger und Pippini<strong>de</strong>n<br />
Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Chlodwigs (511) wur<strong>de</strong> das Reich unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Zwar konnte die Reichseinheit durch Chlodwigs Nachfolger immer wie<strong>de</strong>r hergestellt wer<strong>de</strong>n<br />
(wobei vor allem Theu<strong>de</strong>bert I. von Be<strong>de</strong>utung ist, <strong>de</strong>r eine expansive Politik in Italien betrieb), doch brachte es die germanische Tradition mit sich, dass es immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong><br />
Reichsteilungen unter <strong>de</strong>n Söhnen beim To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Vaters kam. 639 starb Dagobert I., <strong>de</strong>r letzte be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Merowinger, und hinterließ seinem Sohn das nochmals geeinigte Reich. Die<br />
wahre Macht lag aber beim Hausmeier Aega und <strong>de</strong>r Witwe Dagoberts.<br />
Die Hausmeier strebten nun auch nach <strong>de</strong>r gesamten Macht im Reich. Ein Intermezzo brachten die Jahre 657–662, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>s Hausmeiers Grimoald, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>m Namen<br />
Chil<strong>de</strong>bertus adoptivus in die Geschichte einging, von <strong>de</strong>m Merowinger Sigibert III. adoptiert wur<strong>de</strong> und in diesen Jahren auf <strong>de</strong>m Thron saß. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Tertry (687) schließlich<br />
besiegte <strong>de</strong>r austrasische Hausmeier Pippin II. <strong>de</strong>n rechtmäßigen Herrscher <strong>de</strong>s fränkischen Gesamtreiches und schaffte so die Vorausset<strong>zu</strong>ng für <strong>de</strong>n weiteren Aufstieg <strong>de</strong>r Arnulfinger<br />
und Pippini<strong>de</strong>n und später <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Karolinger. Pippin wagte es aber nach <strong>de</strong>m im En<strong>de</strong>ffekt missglückten „Staatsstreich“ Grimoalds noch nicht, sich selbst <strong>zu</strong>m König <strong>zu</strong> erheben, weil er<br />
nicht über das ererbte Königsheil verfügte.<br />
714, nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Pippins, entbrannten Machtkämpfe, in <strong>de</strong>nen sich 719 sein unehelicher Sohn Karl Martell durchsetzte. Der für seine Härte und sein Durchset<strong>zu</strong>ngsvermögen bekannte<br />
Karl stand vor schwierigen innen- und außenpolitischen Problemen. Immer wie<strong>de</strong>r versuchten einige Führer <strong>de</strong>r alten Reichsa<strong>de</strong>lsgeschlechter im Frankenreich, sich gegen seine<br />
Herrschaft auf<strong>zu</strong>lehnen. Einen Wen<strong>de</strong>punkt stellte das Jahr 732 dar. In <strong>de</strong>r Schlacht bei Tours und Poitiers besiegte Karl, gemeinsam mit seinem ehemaligen Feind Eudo von Aquitanien<br />
und unterstützt von <strong>de</strong>n Langobar<strong>de</strong>n, die muslimischen Araber. Hierfür wur<strong>de</strong> er als Retter <strong>de</strong>s Abendlan<strong>de</strong>s gefeiert. Auch die Kämpfe gegen Friesen, Sachsen, Bajuwaren und<br />
Alamannen festigten seine Herrschaft. Daneben unterstützte er die Missionsarbeit <strong>de</strong>s Bischofs Bonifatius in diesen Gebieten. Ab 737 herrschte er nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s merowingischen<br />
Königs Theu<strong>de</strong>rich IV. allein über das Frankenreich, wie schon sein Vater ohne Königstitel. Nach fränkischer Tradition teilte Karl Martell das Reich kurz vor seinem To<strong>de</strong> unter seinen<br />
Söhnen Karlmann und Pippin III. auf.<br />
Das Frankenreich unter <strong>de</strong>n Karolingern<br />
Pippin III. wur<strong>de</strong> Alleinherrscher nach<strong>de</strong>m sein Bru<strong>de</strong>r ins Kloster gegangen war und er <strong>de</strong>n letzten merowingischen König, Chil<strong>de</strong>rich III., ebenfalls dorthin geschickt hatte. 751 ließ er<br />
sich dann nach alttestamentlichem Vorbild <strong>zu</strong>m König salben. Drei Jahre später salbte ihn Papst Stephan II. ein zweites Mal. Im Vertrag von Quierzy (754) versprach Pippin, das
ehemalige Exarchat von Ravenna <strong>de</strong>m Papst <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>geben (Pippinische Schenkung); im Gegen<strong>zu</strong>g legitimierte <strong>de</strong>r Papst die Karolinger als Könige <strong>de</strong>s Frankenreichs. Schon 755 ereilte<br />
<strong>de</strong>n fränkischen König die Bitte, <strong>de</strong>m Vertrag nach<strong>zu</strong>kommen. Bis <strong>zu</strong> seinem To<strong>de</strong> führt Pippin zwei erfolgreiche Feldzüge gegen die Langobar<strong>de</strong>n und schenkte <strong>de</strong>m Papst die eroberten<br />
Gebiete. Pippin III. gilt so als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kirchenstaates. Bei seinem To<strong>de</strong> 768 hinterließ er seinen Söhnen Karl und Karlmann ein Reich, das politisch wie wirtschaftlich im Aufbau<br />
begriffen war.<br />
Kurze Zeit später (771) starb Karlmann, und Karl <strong>de</strong>r Große wur<strong>de</strong> dadurch Alleinherrscher. Durch <strong>de</strong>n von seinem Vater geschlossenen Vertrag mit <strong>de</strong>m Papst war Karl diesem<br />
verpflichtet. Da die Langobar<strong>de</strong>n die Schenkungen Pippins nicht anerkannten, führte Karl weiter gegen sie Krieg und eroberte ihr Reich im Jahre 774. Neben <strong>de</strong>n Langobar<strong>de</strong>nfeldzügen<br />
schritt die Missionierung im Osten voran. Beson<strong>de</strong>rs die Kriege gegen die Sachsen bestimmten die Politik Karls bis 785, als sich Widukind schließlich <strong>de</strong>m fränkischen König unterwarf.<br />
Die Sachsenkriege dauerten noch bis 804 fort (letzter Feld<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Franken nach Nor<strong>de</strong>lbien).<br />
Die zahlreichen Kriege bewirkten eine fortschreiten<strong>de</strong> Feudalisierung, eine Stärkung <strong>de</strong>r Reichen und einen Anstieg <strong>de</strong>r feudalabhängigen Bauern. Im Ergebnis dieser Entwicklung<br />
wuchsen Besitz und Macht <strong>de</strong>r Lehnsherren, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>s Königs (und späteren Kaisers) und <strong>de</strong>r Herzöge. Auch die Kirche konnte ihre Macht festigen. Karl konsolidierte die<br />
Staatsmacht nach außen durch die Errichtung von Grenzmarken. Diese waren Bollwerke für die Reichsverteidigung und Aufmarschgebiete für Angriffskriege. Zur Verwaltung setzte er<br />
Markgrafen ein, die mit beson<strong>de</strong>ren Rechten ausgestattet waren, da die Marken nicht direkt Teil <strong>de</strong>s Reiches waren und somit auch außerhalb <strong>de</strong>r Reichsverfassung stan<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n<br />
Marken wur<strong>de</strong>n Burgen errichtet und eine wehrhafte Bauernbevölkerung angesie<strong>de</strong>lt. Beson<strong>de</strong>rs wichtig waren hierbei die Marken im Osten <strong>de</strong>s Reiches, die Awarenmark (siehe auch<br />
Marcha Orientalis) und die Mark Karantanien, aus <strong>de</strong>nen später Österreich hervorging (siehe auch Ostarrîchi).<br />
Zur Festigung seiner Herrschaft nach Innen zentralisierte Karl die Königsherrschaft um 793 durch eine Verwaltungsreform. Die Königsherrschaft grün<strong>de</strong>te sich auf <strong>de</strong>n königlichen Hof,<br />
das Pfalzgericht und die Kanzlei. Im Reich verwalteten Grafen die Königsgüter (Pfalzen). Pfalz- und Markgrafen wur<strong>de</strong>n durch Königsboten (missi dominici) kontrolliert und sprachen<br />
königliches Recht. Aachen wur<strong>de</strong> unter Karl <strong>zu</strong>r Kaiserpfalz und <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>s Frankenreiches.<br />
Den Höhepunkt seiner Macht erreichte Karl am 25. Dezember 800 mit <strong>de</strong>r Krönung <strong>zu</strong>m römischen Kaiser: Damit war das Frankenreich – neben <strong>de</strong>m Byzantinischen Kaiserreich und<br />
<strong>de</strong>m Kalifat <strong>de</strong>r Abbasi<strong>de</strong>n – nun endgültig eine anerkannte Großmacht.<br />
Der Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Frankenreichs<br />
Nach 46-jähriger Herrschaft starb Karl 814 in Aachen. Sein Sohn Ludwig <strong>de</strong>r Fromme wur<strong>de</strong> Kaiser. Dieser versuchte, entgegen <strong>de</strong>r fränkischen Tradition, die die Aufteilung <strong>de</strong>s Erbes<br />
vorsah und wie es auch Karl <strong>de</strong>r Große in <strong>de</strong>r Divisio Regnorum von 806 bestimmt hatte, die Reichseinheit <strong>zu</strong> wahren und erließ 817 ein Reichsteilungs- o<strong>de</strong>r besser:<br />
Reichseinheitsgesetz (Ordinatio imperii). Schließlich galt auch die Kaiserwür<strong>de</strong> als unteilbar. Deswegen bestimmte Ludwig seinen Sohn Lothar <strong>zu</strong>m Mitkaiser. Das Gesetz sah vor, dass<br />
immer <strong>de</strong>r älteste Sohn <strong>de</strong>s Kaisers <strong>de</strong>n Titel <strong>de</strong>s römischen Kaisers erben sollte. Ludwig entschied sich für <strong>de</strong>n Reichseinheitsgedanken, wenn auch unter kirchlichem Einfluss, <strong>de</strong>r die<br />
Einheit <strong>de</strong>s Reiches als Pendant <strong>zu</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Kirche sah. Daher spielten die Bischöfe auch eine beson<strong>de</strong>re politische Rolle: Sie stellten sich gegen die Söhne <strong>de</strong>s Kaisers, die für die<br />
Aufteilung <strong>de</strong>s Reiches waren. Seit 829 führten diese Spannungen <strong>zu</strong> militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m Kaiser und seinen Söhnen.<br />
Als Ludwig 840 starb, wur<strong>de</strong> Lothar I. zwar Kaiser, doch einigten sich die Söhne 843 im Vertrag von Verdun, das Frankenreich auf<strong>zu</strong>teilen. Später wur<strong>de</strong> das Reich durch die Prümer<br />
Teilung (855) und die Verträge von Mersen (870) und Ribemont (880) weiter aufgeteilt. Die Reichseinheit wur<strong>de</strong>, außer kurzzeitig unter Karl III. (885-887), nie wie<strong>de</strong>rhergestellt. Die<br />
einzelnen Teile entwickelten unterschiedliche Sitten, Bräuche, Sprachen und wur<strong>de</strong>n so <strong>zu</strong> eigenständigen Staaten. Einige Zeit darauf sprach man von einem West- und Ostfränkischen<br />
Reich, bis dieser Hinweis auf die gemeinsame Herkunft ein Jahrhun<strong>de</strong>rt später verschwand. Vom alten Frankenreich sollte nur <strong>de</strong>r westliche Teil <strong>de</strong>n Namen „Frankreich“ übernehmen.<br />
Das aus <strong>de</strong>m Ostfrankenreich entstehen<strong>de</strong> Heilige Römische Reich, aus <strong>de</strong>m später Deutschland hervorging, führte die Tradition <strong>de</strong>s römischen Kaisertums fort.<br />
Divisio Regnorum (806)<br />
Das Testament Karls <strong>de</strong>s Großen sah die Aufteilung unter seinen Söhnen Pippin, Ludwig <strong>de</strong>m Frommen und Karl <strong>de</strong>m Jüngeren vor (siehe Divisio Regnorum). Da jedoch Pippin und Karl<br />
<strong>de</strong>r Jüngere bereits 810 bzw. 811 verstarben, wur<strong>de</strong> dieser Plan aufgegeben und Ludwig wur<strong>de</strong> statt<strong>de</strong>ssen 813 <strong>zu</strong>m Mitkaiser erhoben, <strong>de</strong>r so nun nach <strong>de</strong>m Tod seines Vaters 814 im<br />
Besitz aller kaiserlichen Rechte seine Nachfolge antreten konnte.
Vertrag von Verdun (843)<br />
Die Aufteilung <strong>de</strong>s Fränkischen Reichs ging auf <strong>de</strong>n teils kriegerischen Erbfolgestreit <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>n Kaiser Ludwig I., <strong>de</strong>r Fromme, mit seinen Söhnen führte. Nach einer Palastrevolution<br />
und Gefangennahme wur<strong>de</strong> Kaiser Ludwig I. Anfang <strong>de</strong>r 830er Jahre von seinen Söhnen entmachtet. Ab 831/832 verselbständigten die Söhne <strong>zu</strong>nehmend ihre Herrschaftsbereiche im<br />
Reichsverband und beließen ihren Vater in <strong>de</strong>r Funktion eines Titularkaisers. Drei Jahre nach <strong>de</strong>m Tod ihres Vaters leiteten Kaiser Lothar I., König Karl <strong>de</strong>r Kahle und König Ludwig <strong>de</strong>r<br />
Deutsche 843 im Vertrag von Verdun die Teilung und damit das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Fränkischen Reiches ein; die Reichseinheit war nicht mehr <strong>zu</strong> gewährleisten und en<strong>de</strong>te faktisch mit <strong>de</strong>m Vertrag<br />
von Verdun.<br />
Durch die Teilung entstan<strong>de</strong>n drei neue Reiche:<br />
• das Westfrankenreich Karls <strong>de</strong>s Kahlen, Ursprung <strong>de</strong>s späteren Frankreich<br />
• das Ostfrankenreich Ludwigs <strong>de</strong>s Deutschen, Ursprung <strong>de</strong>s späteren Heiligen Römischen Reiches (Deutscher Nation)<br />
• das Lotharii Regnum („Mittelreich“) Lothars I., Ursprung <strong>de</strong>s späteren Lothringen<br />
Prümer Teilung (855)<br />
855 veranlasste Lothar I. in <strong>de</strong>r Prümer Teilung die Aufteilung <strong>de</strong>s Mittelreiches unter seinen Söhnen.<br />
Vertrag von Meersen (870)<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>r Söhne Lothars I. wur<strong>de</strong> das einstige Mittelreich unter Karl <strong>de</strong>m Kahlen und Ludwig <strong>de</strong>m Deutschen im Vertrag von Meersen aufgeteilt.<br />
Vertrag von Ribemont (880)<br />
Nach vergeblichen Versuchen Karls <strong>de</strong>s Kahlen, das ganze Mittelreich <strong>zu</strong> erobern (Schlacht bei An<strong>de</strong>rnach 876), erhielt Ludwig III. durch <strong>de</strong>n Vertrag von Ribemont die Westhälfte<br />
Lotharingiens. Damit war die Aufteilung <strong>de</strong>s Frankenreiches vorläufig abgeschlossen, die Grenze zwischen <strong>de</strong>m West- und Ostteil blieb das ganze Mittelalter über nahe<strong>zu</strong> unverän<strong>de</strong>rt.<br />
Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>r westfränkischen Könige Ludwig III. (882) und Karlmann (884), wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ostfränkische König Karl III. (<strong>de</strong>r Dicke) bis 888 noch letzter Kaiser <strong>de</strong>s Gesamtreiches<br />
(außer Nie<strong>de</strong>rburgund). Der Streit zwischen <strong>de</strong>n (späteren) Nachfolgestaaten (Deutschland, Frankreich) um Teile <strong>de</strong>s Mittelreichs reichte als sogenannte Erbfeindschaft bis ins 20.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein.<br />
Lebensart im Frankenreich<br />
Die Bevölkerung<br />
Im Frankenreich waren <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>r Bevölkerung Bauern o<strong>de</strong>r bäuerliches Gesin<strong>de</strong>. In vielen Gegen<strong>de</strong>n gab es keine Städte, lediglich in früher römischen Gebieten bestan<strong>de</strong>n<br />
verkleinerte römische Anlagen, die als Verwaltungsmittelpunkte von civitates unter Bischöfen o<strong>de</strong>r Grafen weiter existierten. Über <strong>de</strong>m nie<strong>de</strong>ren Volk befand sich eine zahlenmäßig dünne<br />
Schicht von Adligen, in <strong>de</strong>r damaligen Zeit meist „die Großen“ genannt.<br />
Die Lebensweise <strong>de</strong>r bäuerlichen Grundbevölkerung im Frankenreich lässt sich nicht mit <strong>de</strong>r heutigen vergleichen. Der Großteil <strong>de</strong>r Menschen verbrachte sein ganzes Leben in <strong>de</strong>mselben<br />
Dorf. Täglich wur<strong>de</strong> von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet, außer am Sonntag und an kirchlichen Festtagen. War man alt genug, heiratete man und bekam beinahe jährlich<br />
ein Kind; die meisten Kin<strong>de</strong>r starben jung. Allgemein war die Lebenserwartung wesentlich niedriger als heute, mit 50 Jahren galt eine Bäuerin o<strong>de</strong>r ein Bauer als Greis. Die meisten<br />
Menschen kannten nebst ihrem Dorf nur <strong>de</strong>n Weg <strong>zu</strong>r nächsten Kirche und umliegen<strong>de</strong> Ortschaften. Von <strong>de</strong>m Geschehen in größerer Entfernung hatte <strong>de</strong>r Großteil keine Ahnung. Ein<br />
<strong>zu</strong>sätzliches Hin<strong>de</strong>rnis war das Fehlen von befestigten Straßen außer <strong>de</strong>njenigen, die von <strong>de</strong>n Römern <strong>zu</strong>vor angelegt wor<strong>de</strong>n waren. Die einfache Bevölkerung konnte we<strong>de</strong>r lesen noch<br />
schreiben, es gab aber auch keine Schriften, durch die solche Leute hätten erfahren können, was in <strong>de</strong>r Welt vor sich geht. Arbeiten auf <strong>de</strong>m Land wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Bauern in <strong>de</strong>r gleichen
Weise verrichtet, wie es einst ihre Väter vor ihnen taten. Das, was schon seit grauer Vorzeit gemacht wur<strong>de</strong>, hielten sie für das Richtige, da es von Gott so gewollt sei.<br />
Genaue Zahlen über die damalige Bevölkerung sind nicht bekannt, so dass die Historiker auf Schät<strong>zu</strong>ngen angewiesen sind. Diese ergaben eine ungefähre Anzahl von 2 Millionen<br />
Einwohnern im „<strong>de</strong>utsch“-sprachigen Teil <strong>de</strong>s Frankenreichs. Für das ganze Reich nimmt man eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von etwa 8 Einwohner/Quadratkilometer an, für<br />
die <strong>de</strong>utschen Sprachgebiete hingegen nur eine durchschnittliche Anzahl von 4 bis 5 Einwohner/Quadratkilometer.<br />
Landwirtschaft<br />
Entstehung <strong>de</strong>r Grundherrschaft<br />
Die Krieger <strong>de</strong>s fränkischen Königs übernahmen nach <strong>de</strong>r Eroberung die Herrenhöfe ihrer Vorgänger. Die Knechte und Mäg<strong>de</strong>, die neben <strong>de</strong>m Herrenhof wohnten, kümmerten sich um<br />
das Land <strong>de</strong>s Herren. Sie bekamen kein Geld, aber dafür Verpflegung und Unterkunft. Die Handwerker unter ihnen stellten die Kleidung und Waffen her und pflegten diese. Die Ärmeren<br />
wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Heeresdienst gezwungen. Die an<strong>de</strong>ren, die Abgaben leisten konnten, wur<strong>de</strong>n nach Hause entlassen.<br />
Die Bauern als <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r Landbevölkerung im Mittelalter wur<strong>de</strong>n genau nach ihrem Rechtsstatus unterschie<strong>de</strong>n. Es gab Freie, Halbfreie und Unfreie, später wur<strong>de</strong> noch<br />
zwischen Leibeigenen und Hörigen unterschie<strong>de</strong>n. Auch die Adligen waren anfangs nur Großbauern mit beson<strong>de</strong>rs umfangreichem Besitz an Land, Allod genannt, und an Menschen.<br />
Über diese Angehörigen seines Hauses übte <strong>de</strong>r Adlige ein weitreichen<strong>de</strong>s Herrenrecht aus. Zum Haus zählten dabei in weiterem Sinne auch abhängige Familien. Eine ähnliche Stellung<br />
nahmen <strong>zu</strong>vor in <strong>de</strong>r spätrömischen Gesellschaft die Großgrundbesitzer ein, <strong>de</strong>nen ein umfangreicher Besitz an Latifundien gehörte, in <strong>de</strong>ssen Zentrum ein luxuriöser Herrenhof stand,<br />
<strong>de</strong>r von zahlreichen abhängigen Bauern bewirtschaftet wur<strong>de</strong>. Daneben gehörten noch Handwerker <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Besitz, so dass man nahe<strong>zu</strong> von Selbstversorgung ausgehen kann. Diese<br />
Bauern waren an ihr Stück Land gebun<strong>de</strong>n und durften nicht wegziehen, um sich an einem an<strong>de</strong>ren Ort einen an<strong>de</strong>ren Herren o<strong>de</strong>r gar einen an<strong>de</strong>ren Beruf <strong>zu</strong> suchen. Aus diesen bei<strong>de</strong>n<br />
Wurzeln entstand in einer langen Entwicklung die neue Gesellschaftsordnung <strong>de</strong>r heut<strong>zu</strong>tage so genannten Grundherrschaft im Frankenreich.<br />
Die Grundherrschaft setzte sich schnell im ganzen Reich durch. Sie breitete sich auch in <strong>de</strong>n Gebieten aus, welche erst ab 800 in fränkischen Besitz gelangten. Grundherren waren Adlige,<br />
Klöster, Bischöfe und <strong>de</strong>r König, <strong>de</strong>r damals <strong>de</strong>r größte Grun<strong>de</strong>igentümer war. Die Bauern, welche unter eine solche Herrschaft fielen, wirtschafteten <strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>r Zeit nicht<br />
selbstständig, son<strong>de</strong>rn mussten gleichzeitig auf <strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Eigentümers mithelfen. Die Grundherrschaft wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m „Grundbaustein“ <strong>de</strong>s damaligen Gesellschaftsbaus und spätestens<br />
seit 750 <strong>zu</strong>m üblichen, landwirtschaftlichen Betrieb, ähnlich wie heute <strong>de</strong>r Bauernhof <strong>de</strong>r übliche, landwirtschaftliche Betrieb ist.<br />
Grundherren<br />
Die Grundherren waren alle Adligen (Bischöfe, Äbte). Der hörige Bauer <strong>de</strong>s Mittelalters durfte ohne die Erlaubnis seines Grundherren nicht aus <strong>de</strong>r Grundherrschaft ausschei<strong>de</strong>n. Die<br />
Hörigen mussten Dienste für ihren Herrn verrichten und ihm dabei regelmäßig Abgaben zahlen, meist in Form von Anteilen an <strong>de</strong>r Ernte. Aber auch <strong>de</strong>r Eigentümer hatte Pflichten, die es<br />
<strong>zu</strong> erfüllen galt. Er musste seinem Untergebenen „Schutz und Schirm“ bieten, das heißt ihn schützen und unterstützen, beispielsweise bei Krankheiten, einem Brand o<strong>de</strong>r einer starken<br />
Missernte. Er musste ihn sowohl vor Angreifern verteidigen, als auch in seinem Namen Rache üben, falls er umgebracht wer<strong>de</strong>n sollte. Innerhalb seiner eigenen Grundherrschaft war er<br />
<strong>de</strong>r Hüter <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns, so sprang er auch bei Streitereien als Vermittler und Richter ein und konnte im Streitfall <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsbrecher bestrafen.<br />
Die Grundherrschaft glie<strong>de</strong>rte sich dabei in verschie<strong>de</strong>ne Bereiche. Es gab je nach Größe <strong>de</strong>s Hofes eine Kirche, verschie<strong>de</strong>ne Werkstätten (Le<strong>de</strong>rwerkstatt, Schmie<strong>de</strong>, Wagnerei,<br />
Schnei<strong>de</strong>rei, Tuchfärberei, Schuhmacher), eine Brauerei, eine Mühle und eine Kelterei. Da<strong>zu</strong> gab es natürlich eine Vielzahl von Fel<strong>de</strong>rn, von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>n Hörigen <strong>zu</strong>r<br />
Verfügung gestellt wur<strong>de</strong>. Ein Teil <strong>de</strong>r Fel<strong>de</strong>r war jedoch noch im Besitz <strong>de</strong>s Grundherrn. Und so gehörte es nebst <strong>de</strong>n Abgaben ebenfalls <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>r Bauern, täglich eine<br />
bestimmte Zeit auf diesen Fel<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong> arbeiten, bevor sie sich um die Bestellung ihrer eigenen Flächen kümmern konnten.<br />
Nebst <strong>de</strong>n Hörigen gab es auch das so genannte Gesin<strong>de</strong>. Mit diesem Begriff bezeichnet man die Knechte und Mäg<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Grundherrn, <strong>de</strong>ren einzige Aufgabe darin bestand, auf <strong>de</strong>n<br />
Fel<strong>de</strong>rn ihres Eigentümers Frondienst <strong>zu</strong> leisten. Sie wohnten <strong>zu</strong>meist im Fronhof o<strong>de</strong>r unmittelbar daneben.<br />
Bauern
Nebst <strong>de</strong>n zahlenmäßig größten Schichten <strong>de</strong>r Bevölkerung, <strong>de</strong>m hörigen Bauern und <strong>de</strong>m grundherrlichen Gesin<strong>de</strong> gab es im Frankenreich noch zwei weitere bäuerliche Schichten: die<br />
Zinsbauern und die Königsfreien. Bei <strong>de</strong>n Zinsbauern han<strong>de</strong>lt es sich um solche Landwirte, die keiner Arbeit auf <strong>de</strong>m Fronhof o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Herrenacker verpflichtet waren, <strong>de</strong>m<br />
Grundherren jedoch eine bestimmte Abgabe zahlten, damit dieser sie vor allfälligen Gefahren schützt. Im Laufe <strong>de</strong>r Zeit wur<strong>de</strong>n sie <strong>de</strong>n Hörigen langsam angepasst und gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Frankenreichs (etwa um 900) unterschie<strong>de</strong>n sie sich praktisch nicht mehr von ihnen.<br />
Die Königsbauern waren Bauern, die außer <strong>de</strong>m König keinen Menschen über sich hatten. Meist gehörten sie <strong>de</strong>m fränkischen Stamm an. Sie waren <strong>zu</strong>r Heerfolge verpflichtet, wenn <strong>de</strong>r<br />
König seine Armee aufbot und dienten dort als Fußkrieger. Die Frankenkönige hatten seit <strong>de</strong>m Einbrechen <strong>de</strong>r Franken in Gallien die Königsbauern <strong>zu</strong>meist auf herrenloses Land gesetzt.<br />
Karl <strong>de</strong>r Große sie<strong>de</strong>lte vor allem in Sachsen diese Bauern an, die er vermutlich aus <strong>de</strong>n Hörigen <strong>de</strong>r Königsgüter, über die er Grundherr war, hatte auswählen lassen. Sie sollten damit<br />
gleichzeitig die fränkische Herrschaft über Sachsen sichern.<br />
Es kam nicht selten vor, dass Könige ein vormals an einen Königsfreien vergebenes Land wie<strong>de</strong>r an eine neue Person verschenkten, beispielsweise als Landgeschenk an ein Kloster o<strong>de</strong>r<br />
einen Vasallen mit Grund ausstatten wollten. In diesem Fall wur<strong>de</strong> das Land mitsamt <strong>de</strong>m Königsfreien verschenkt. Dieser blieb zwar theoretisch gesehen ein freier Mann, war aber<br />
gleichzeitig seinem neuen Eigentümer untertan. Zuerst verlor er das Recht, von seinem Besitz weg<strong>zu</strong>ziehen und wur<strong>de</strong> Schritt für Schritt <strong>zu</strong>m Hörigen gemacht.<br />
Es gab aber auch Fälle, in <strong>de</strong>nen sich ein Königsfreier freiwillig einem Grundherren untertan machte. Dies konnte verschie<strong>de</strong>ne Grün<strong>de</strong> haben: Verarmung und die Unfähigkeit, selber<br />
weiter <strong>zu</strong> wirtschaften, eine große Anzahl Schul<strong>de</strong>n an einen Grundherren, die nicht mehr <strong>zu</strong>rückgezahlt wer<strong>de</strong>n konnten o<strong>de</strong>r weil er sich nicht mehr für das Heer aufbieten lassen wollte.<br />
Ohne dass es ein genaues Gesetz gab, bürgerte es sich mit <strong>de</strong>r Zeit ein, dass hörige Bauern nicht mehr da<strong>zu</strong> verpflichtet waren, in Kriegen <strong>zu</strong> kämpfen.<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Frühmittelalters wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Gegen<strong>de</strong>n Frankreichs und Deutschlands beschlossen, dass kein Landbewohner frei sein könne. Das heißt, je<strong>de</strong>r Bauer<br />
musste einen Grundherren über sich haben und gehörte damit entwe<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Gesin<strong>de</strong> eines Herrn o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen hörigen Bauern.<br />
Klöster im Frankenreich<br />
Im Laufe <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte nahm die Anzahl Klöster im Reich stark <strong>zu</strong>. Seit <strong>de</strong>m ersten Karolingerkönig und seit Bischof Bonifatius nahmen mehr und mehr solcher Einrichtungen die<br />
530 verfasste Regel <strong>de</strong>s heiligen Benedikt an. Benedikt von Nursia hatte hiermit das Zusammenleben und Verhalten <strong>de</strong>r Mönche in seinem Kloster auf <strong>de</strong>m Monte Cassino bei Neapel<br />
festgelegt. Es wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r darauf folgen<strong>de</strong>n Zeit <strong>zu</strong>r Mustereinrichtung für das gesamte europäische Klosterwesen.<br />
Mönche und Nonnen wur<strong>de</strong>n hauptsächlich jene, die sich von <strong>de</strong>r restlichen Welt mit ihren Freun<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Bindungen <strong>zu</strong>rückziehen wollten, um ihr Leben in <strong>de</strong>n Dienst Gottes <strong>zu</strong> stellen.<br />
Es gab jedoch noch weitere Beweggrün<strong>de</strong> für einen Eintritt, so wur<strong>de</strong>n Klosterbrü<strong>de</strong>r und -schwestern wirtschaftlich hinreichend versorgt. Fünfmal am Tag und Zweimal in <strong>de</strong>r Nacht<br />
versammelten sich die Mönche in ihrer Kirche <strong>zu</strong> Gebeten und <strong>zu</strong>m Psalmensingen. Bei <strong>de</strong>n Mahlzeiten las immer abwechselnd ein Mönch seinen Brü<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>n Schriften von Heiligen<br />
vor. Aufgrund <strong>de</strong>r drei Gelüb<strong>de</strong>, die Mönche bei ihrem Eintritt ablegen mussten, durften sie we<strong>de</strong>r eine Ehe führen noch Kin<strong>de</strong>r haben. Sie sollten mittellos sein und waren <strong>de</strong>m<br />
jeweiligen Abt <strong>zu</strong> Gehorsam verpflichtet. Dies alles sollte da<strong>zu</strong> dienen, dass ein Mönch sein Leben nur auf Gott ausrichten konnte.<br />
Da Untätigkeit als eine Sün<strong>de</strong> galt, schrieb das Reglement vor, dass die Mönche mehrere Stun<strong>de</strong>n pro Tag arbeiten und mehrere Stun<strong>de</strong>n lesen sollten. Alles, was man <strong>zu</strong>m Leben<br />
brauchte, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Klosteranlage hergestellt. Ein Teil <strong>de</strong>r Mönche verrichtete seine Arbeit auf <strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>rn, ein Teil seine im Klostergarten. Wie<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re verrichteten ihren Dienst als<br />
Abschreiber, in<strong>de</strong>m sie Pergamentschreiben o<strong>de</strong>r Bücher aus <strong>de</strong>n Klosterbibliotheken kopierten. Nebst vorwiegend christlichen Schriften wur<strong>de</strong>n auch Bücher „weltlicher“ Autoren<br />
übernommen, beispielsweise die Schriften von Titus, Caesar und Vergil. Ab <strong>de</strong>m 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt entstan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Mönchsklostern auch Frauenkloster für Nonnen. Nonnen<br />
verrichteten keine Feldarbeit, arbeiteten jedoch oftmals im Garten.<br />
Im Frankenreich wur<strong>de</strong>n Klöster vielfältig mit Län<strong>de</strong>reien beschenkt und konnten sich auf diese Weise <strong>zu</strong> reichen Grundherren entwickeln. Die großen Klöster beschäftigten unter<br />
an<strong>de</strong>rem auch Knechte, die als Handwerker in gewissen Werkstätten arbeiteten. Von Adligen wur<strong>de</strong>n die Klöster nicht selten auch als Versorgungsstätten für ihre Söhne und Töchter<br />
verwen<strong>de</strong>t, die sie nicht hatten verheiraten können. Hier konnten sie zwar kein a<strong>de</strong>liges Leben führen, allerdings ohne wirtschaftliche Not leben. Überdies waren die Äbte,<br />
beziehungsweise die Äbtissinnen, welche <strong>de</strong>m Kloster vorstan<strong>de</strong>n, in vielen Fällen ein A<strong>de</strong>lsgeschlecht.
Stellung <strong>de</strong>s Königs<br />
Der König stand nicht nur über <strong>de</strong>n gewöhnlichen Bauern und <strong>de</strong>n Adligen, son<strong>de</strong>rn auch über <strong>de</strong>n Äbten und Bischöfen in seinem Reich. Er war bei weitem <strong>de</strong>r größte Grundherr im<br />
Land. In einer Vielzahl von Gebieten hatte er Adlige <strong>zu</strong> Grafen gemacht; mit diesem Titel führten sie dort die Aufsicht über die in <strong>de</strong>r Nähe gelegenen Königsgüter und einzelne Fronhöfe,<br />
wirkten beim Heeresaufgebot mit und zogen die <strong>de</strong>m König <strong>zu</strong>stehen<strong>de</strong>n Abgaben aus <strong>de</strong>m Land (Grenz-, Schifffahrts- und Wegzölle, Münzenprägungs -und Marktabgaben) ein. In<br />
einigen seiner Gutshöfe ließ <strong>de</strong>r König größere, steinerne Gebäu<strong>de</strong> errichten, die so genannten Pfalzen. Alle Königsgüter hatten ihre Überschüsse an die nächstgelegene solche<br />
Einrichtung <strong>zu</strong> entrichten. Je<strong>de</strong>r Pfalz stand ein Pfalzgraf vor.<br />
Der König hatte keine feste Hauptstadt, son<strong>de</strong>rn zog mit seinem Hofgefolge von Pfalz <strong>zu</strong> Pfalz. Zum Gefolge zählten ein Kämmerer, <strong>de</strong>ssen Aufgabe darin bestand, <strong>de</strong>n Königsschatz und<br />
die Einkünfte <strong>de</strong>s Königs <strong>zu</strong> verwalten, und <strong>de</strong>r Marschall, <strong>de</strong>r die berittenen Krieger <strong>de</strong>r Königswache befehligte. Ein Geistlicher war ebenfalls anwesend und leitete die Kanzlei. Er las<br />
<strong>de</strong>m König die Briefe an<strong>de</strong>rer Herrscher o<strong>de</strong>r von Bischöfen vor, verfasste die Antwortschreiben und ließ durch die ihm unterstehen<strong>de</strong>n Hofgeistlichen die Schenkungs- und an<strong>de</strong>re<br />
königliche Urkun<strong>de</strong>n verfassen. Der Herrscher selbst konnte nur in <strong>de</strong>n wenigsten Fällen lesen und schreiben. Auch Karl <strong>de</strong>r Große hatte dieses Problem. Anstelle seiner Unterschrift<br />
zeichnete er auf eine Urkun<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r ein Schreiben einen kleinen Strich, um dieses für gültig <strong>zu</strong> erklären.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Friedrich Prinz: Grundlagen <strong>de</strong>utscher Geschichte (4.–8. Jahrhun<strong>de</strong>rt). Gebhardt: Handbuch <strong>de</strong>r Deutschen Geschichte, Band 1, 10. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 2001, S. 286.<br />
2. ↑ Vgl. Alexan<strong>de</strong>r Demandt: Die Spätantike. 2. Aufl. München 2007, S. 50 f.<br />
3. ↑ Ammianus Marcellinus: Liber XVII, 8, 3<br />
4. ↑ a b Ulrich Knefelkamp: Das Mittelalter. Geschichte im Überblick. UTB, 2002, ISBN 3-82522-105-9, S. 40.<br />
Literatur<br />
Allgemein<br />
Monographien/Sammelbän<strong>de</strong><br />
• The New Cambridge Medieval History. Verschie<strong>de</strong>ne Hrsg. Bd. 1–2. Cambridge 1995ff. (mit mehreren Beiträgen <strong>zu</strong>m Frankenreich).<br />
• Paul Fouracre (Hrsg.): Frankland. the Franks and the world of the early middle ages. Manchester University Press, Manchester 2008. ISBN 978-0-7190-7669-5.<br />
• Reinhard Schnei<strong>de</strong>r: Das Frankenreich. 4. Aufl. Ol<strong>de</strong>nbourg, München 2001.<br />
Artikel in Fachlexika<br />
• Hans Hubert Anton, Josef Fleckenstein: Franken, Frankenreich – B. Allgemeine und politische Geschichte. Verfassungs- und Institutionengeschichte. In: Lexikon <strong>de</strong>s Mittelalters.<br />
Bd. 4, 1989, Sp. 693–718.<br />
• Hans Hubert Anton: Franken – III. Historisches §§ 17–22. In: Reallexikon <strong>de</strong>r Germanischen Altertumskun<strong>de</strong>. 2. Aufl., Bd. 9, 1995, S. 414–435.<br />
• Knut Schäferdiek: Franken. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 11, 1983, S. 330–335.<br />
• Rudolf Schieffer: Fränkisches Reich. In: Handwörterbuch <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Rechtsgeschichte, 2. Aufl. Bd. 1, 2008, 1672–1685.<br />
Zu <strong>de</strong>n Merowingern<br />
Monographien/Sammelbän<strong>de</strong><br />
• Michael Borgolte: Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie. Thorbecke, Sigmaringen 1986. ISBN 3-7995-7351-8.
• Eugen Ewig: Die Merowinger und das Frankenreich. 5. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 2006. ISBN 3-17-019473-9.<br />
• Eugen Ewig: Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften. 2 B<strong>de</strong>. Artemis, München/Zürich 1976–79. ISBN 3-7608-4652-1.<br />
• Franz Irsigler: Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s frühfränkischen A<strong>de</strong>ls. Röhrscheid, Bonn 1969, 1981. ISBN 3-7928-0420-4.<br />
• Patrick J. Geary: Die Merowinger. Europa vor Karl <strong>de</strong>m Großen. Beck, München 1996, 2004 (orig. Before France and Germany, 1988). ISBN 3-406-49426-9.<br />
• Ian N. Wood: The Merovingian Kingdoms, 450–751. Longman, London 1994, 2000. ISBN 0-582-49372-2.<br />
• Dieter Geuenich (Hrsg.): Die Franken und die Alemannen bis <strong>zu</strong>r „Schlacht bei Zülpich“ (496/497). Reallexikon <strong>de</strong>r Germanischen Altertumskun<strong>de</strong>. Ergän<strong>zu</strong>ngsbd 19.<br />
Berlin/New York 1998. ISBN 3-11-015826-4.<br />
Artikel in Fachlexika<br />
• Hans Hubert Anton: Merowinger. In: Lexikon <strong>de</strong>s Mittelalters. Bd. 6, 1993, Sp. 543–544.<br />
• Ian Wood: Merowingerzeit § 2. Historisches. In: Reallexikon <strong>de</strong>r Germanischen Altertumskun<strong>de</strong>, 2. Aufl. Bd. 19, 2001, S. 587–593.<br />
Zu <strong>de</strong>n Karolingern<br />
Monographien/Sammelbän<strong>de</strong><br />
• Rudolf Schieffer: Die Karolinger. Kohlhammer, Stuttgart 1992, 2000, 2006. ISBN 3-17-019099-7.<br />
• Gunter G. Wolf (Hrsg.): Zum Kaisertum Karls d. Gr.: Beiträge und Aufsätze. Wiss. Buchges., Darmstadt 1972, ISBN 3-534-04549-1.<br />
• Pierre Riché: Die Welt <strong>de</strong>r Karolinger. Übersetzt u. hrsg. von Cornelia und Ulf Dirlmeier. Reclam, Stuttgart 1981, 1999. ISBN 3-15-010463-7.<br />
• Pierre Riché: Die Karolinger. Eine Familie formt Europa. Stuttgart 1987.<br />
• Peter Classen: Karl <strong>de</strong>r Große, das Papsttum und Byzanz. Schwann, Düsseldorf 1968, Thorbecke, Sigmaringen 1988. ISBN 3-7995-5709-1.<br />
• Dieter Hägermann: Karl <strong>de</strong>r Große, Herrscher <strong>de</strong>s Abendlan<strong>de</strong>s. Propyläen-Verlag, Berlin 2000; List, München 2003. ISBN 3-548-60275-4.<br />
Artikel in Fachlexika<br />
• Thomas Zotz, Karolinger. In: Lexikon <strong>de</strong>s Mittelalters. Bd. 5, 1991, Sp. 1008–1014.<br />
• Rudolf Schieffer: Karolinger und Karolingerzeit § 1. In: Reallexikon <strong>de</strong>r Germanischen Altertumskun<strong>de</strong>. 2. Aufl. Bd. 16, 2000, S. 587–593.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Westfrankenreich<br />
Das Westfrankenreich (lat. Francia occi<strong>de</strong>ntalis) war <strong>de</strong>r westliche Teil <strong>de</strong>s aufgeteilten Frankenreichs. Es entstand 843 durch <strong>de</strong>n Vertrag von Verdun und wur<strong>de</strong> 870 durch <strong>de</strong>n Vertrag
von Meerssen erweitert. Aus <strong>de</strong>m westfränkischen Reich entwickelte sich im Lauf <strong>de</strong>s 9. und 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts Frankreich.<br />
Der Prozess <strong>de</strong>r Entstehung Frankreichs vollzog sich langsam und schrittweise und war <strong>de</strong>n damals Leben<strong>de</strong>n kaum bewusst. Daher lässt er sich schwer zeitlich fixieren. Man geht davon<br />
aus, dass <strong>de</strong>r Vorgang spätestens mit <strong>de</strong>m Dynastiewechsel von 987 (Übergang von <strong>de</strong>n Karolingern <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Kapetingern) abgeschlossen war. Daher wer<strong>de</strong>n die ab 987 regieren<strong>de</strong>n<br />
Kapetinger stets als Könige von Frankreich bezeichnet. Die karolingischen und robertinischen Könige in <strong>de</strong>r Zeit zwischen <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>m Dynastiewechsel von<br />
987 wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen populärwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Literatur teils als westfränkische, teils als französische Könige bezeichnet, je nach<strong>de</strong>m, wo die<br />
betreffen<strong>de</strong>n Forscher <strong>de</strong>n Übergang vom Westfrankenreich <strong>zu</strong> Frankreich ansetzen. Alle diese Periodisierungsansätze sind willkürlich. Auch <strong>de</strong>r Dynastiewechsel von 987 wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n<br />
Zeitgenossen nicht als tiefer Einschnitt o<strong>de</strong>r gar als neue Reichsgründung aufgefasst. Man sah darin damals nicht einmal die endgültige Entmachtung <strong>de</strong>r Karolinger, son<strong>de</strong>rn nur eine<br />
Episo<strong>de</strong> in einem seit langem andauern<strong>de</strong>n Machtkampf zweier rivalisieren<strong>de</strong>r Geschlechter. Erst im Lauf <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnte erwies sich die neue kapetingische Herrschaft als<br />
dauerhaft.<br />
Mit <strong>de</strong>m Vertrag von Verdun wur<strong>de</strong> das Frankenreich in drei Teile aufgeteilt:<br />
• Westfrankenreich, das spätere Frankreich<br />
• Ostfrankenreich, <strong>de</strong>r Vorläufer <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches<br />
• Das Mittelreich, (auch Lotharii Regnum) wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst 855 geteilt (Prümer Teilung), aber bald darauf <strong>zu</strong> einem Teil auf die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Reiche aufgeteilt (Vertrag von<br />
Mersen 870, Vertrag von Ribemont 880), <strong>zu</strong>m an<strong>de</strong>ren Teil entstan<strong>de</strong>n auf seinem Bo<strong>de</strong>n die neuen Königreiche Nie<strong>de</strong>rburgund, Hochburgund und Italien. Diese wie<strong>de</strong>rum<br />
verschmolzen <strong>zu</strong>nächst mit <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich, um dann später doch an Frankreich <strong>zu</strong> fallen (Burgund) o<strong>de</strong>r sich in selbstständige Kleinstaaten <strong>zu</strong> verwan<strong>de</strong>ln<br />
(Italien). Das Gebiet (Benelux, Rheinland, Lothringen, Elsaß) wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m immer wie<strong>de</strong>r Zankapfel zwischen <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n Reichen (Frankreich,<br />
Heiliges Römisches Reich / Deutschland).<br />
Literatur<br />
• Carlrichard Brühl: Die Geburt zweier Völker. Deutsche und Franzosen (9.–11. Jahrhun<strong>de</strong>rt). Böhlau Verlag, Köln u. a. 2001.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Habsburgisch-Französischer Gegensatz<br />
Als Habsburgisch-französischen Gegensatz bezeichnet die Geschichtswissenschaft <strong>de</strong>n von 1516 bis 1756 dauern<strong>de</strong>n Konflikt zwischen <strong>de</strong>m Haus Habsburg und <strong>de</strong>m Königreich<br />
Frankreich um die Vorherrschaft in Europa. Sowohl offen als auch ver<strong>de</strong>ckt ausgetragen, prägte er 240 Jahre lang die gesamte europäische Macht- und Bündnispolitik und mün<strong>de</strong>te in<br />
zahlreiche Kriege, von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Dreißigjährige Krieg <strong>de</strong>r verheerendste war.<br />
Vorgeschichte
Die Ursprünge <strong>de</strong>s Konflikts waren dynastischer Natur und entsprangen <strong>de</strong>r erfolgreichen Heiratspolitik <strong>de</strong>r Habsburger, die <strong>de</strong>m Grundsatz folgte: Bella gerant alii, tu felix Austria,<br />
nube! - Kriege mögen an<strong>de</strong>re führen. Du, glückliches Österreich, heirate! . Im Jahr 1477 ehelichte <strong>de</strong>r spätere Kaiser Maximilian I. Maria, die Tochter und einzige Erbin Herzog Karls <strong>de</strong>s<br />
Kühnen von Burgund. Das französische Königshaus Valois, <strong>de</strong>m auch die Burgun<strong>de</strong>r Herzöge entstammten, machte ebenfalls Ansprüche auf das burgundische Erbe geltend, das teils auf<br />
französischem, teils auf Reichsgebiet lag. Maximilian setzte die Rechte seiner Frau im Reich durch, jedoch gelang es König Ludwig XI. von Frankreich die Picardie, das Mâconnais, das<br />
Auxerrois, das Charolais und das Herzogtum Burgund wie<strong>de</strong>r vollständig für die französische Krone <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern.<br />
Darüber hinaus verheiratete Maximilian 1496 seinen und Marias Sohn, Philipp <strong>de</strong>n Schönen, mit <strong>de</strong>r Infantin von Spanien, Johanna <strong>de</strong>r Wahnsinnigen. Als <strong>de</strong>ren Sohn, <strong>de</strong>r spätere Kaiser<br />
Karl V., 1515 die Herrschaft im burgundischen Flan<strong>de</strong>rn und im Jahr darauf im Königreich Spanien antrat, war Frankreich sowohl im Nor<strong>de</strong>n und Osten als auch im Sü<strong>de</strong>n von<br />
habsburgischen Territorien umgeben. Vermehrt wur<strong>de</strong> Karls Macht noch durch die einträglichen spanischen Besit<strong>zu</strong>ngen in Amerika, durch die <strong>zu</strong> Spanien gehören<strong>de</strong>n Königreiche<br />
Sardinien, Neapel und Sizilien sowie durch seine 1519 erfolgte Wahl <strong>zu</strong>m römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser als Nachfolger seines Großvaters Maximilian I. Jedoch gelang es Karl Zeit seines<br />
Lebens nicht, die habsburgischen Län<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> zentralisieren und so die Einkreisung Frankreichs effektiv wirksam <strong>zu</strong> machen. Seine Län<strong>de</strong>r blieben vorerst eigenständige Staaten, die zwar<br />
in Personalunion regiert wur<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Stän<strong>de</strong> aber auch außenpolitisch eigene Interessen vertraten.<br />
Entwicklung im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Bereits seit 1494 kämpften Frankreich und Spanien um die Vorherrschaft in Italien. Zu diesem bereits schwelen<strong>de</strong>n Konflikt kam seit 1516 das Bestreben <strong>de</strong>r französischen Krone, sich<br />
aus <strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>n Umklammerung durch die habsburgischen Besit<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong> lösen. Um das Haus Habsburg als Konkurrenten um die Vorherrschaft in Europa aus<strong>zu</strong>schalten, führte allein<br />
König Franz I. von Frankreich vier Kriege (Italienische Kriege). Ihnen sollten unter seinen Nachfolgern viele weitere folgen. Sie suchten und fan<strong>de</strong>n dafür immer wie<strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
bei einzelnen <strong>de</strong>utschen Reichsfürsten, aber auch beim Osmanischen Reich. Günstiger wur<strong>de</strong> die Situation für Frankreich, nach<strong>de</strong>m die Reformation Deutschland in sich feindlich<br />
gegenüberstehen<strong>de</strong> Lager gespalten hatte. Aufgrund seiner maritimen Interessen stand auch das protestantische England seit <strong>de</strong>r Thronbesteigung Königin Elisabeths I. für mehr als ein<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt meist im anti-spanischen Lager.<br />
Das Konfliktpotenzial ging nur unwesentlich <strong>zu</strong>rück, als Karl V. 1555 abdankte und seinen Machtbereich zwischen seinem Sohn Philipp II. und seinem Bru<strong>de</strong>r Ferdinand I. aufteilte.<br />
Ferdinand erhielt die österreichischen Erblan<strong>de</strong> und die Kaiserkrone, Philipp Spanien sowie die nie<strong>de</strong>rländischen und italienischen Besit<strong>zu</strong>ngen. Die österreichischen und spanischen<br />
Habsburger stimmten jedoch ihre machtpolitischen Interessen weiter miteinan<strong>de</strong>r ab, und nach wie vor sah sich Frankreich von Philipps Herrschaftsbereich eingekreist. König Philipp<br />
gelang es, seine Besit<strong>zu</strong>ngen so in seiner Hand <strong>zu</strong> zentralisieren, dass er <strong>de</strong>n Druck auf Frankreich stark erhöhen konnte. Die Hugenottenkriege vermin<strong>de</strong>rten in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 16.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts die Handlungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r französischen Krone erheblich. Durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Cateau-Cambrésis von 1559 war <strong>de</strong>r Kampf um die europäische Vorherrschaft<br />
vorerst <strong>zu</strong> Gunsten Spaniens entschie<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Erst das Wie<strong>de</strong>rerstarken <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s unter <strong>de</strong>m ersten Bourbonenkönig Heinrich IV. sollte Frankreichs außenpolitische Schwäche<br />
been<strong>de</strong>n.<br />
Entwicklung im 17. und frühen 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Wie<strong>de</strong>raufflammen <strong>de</strong>s Konflikts<br />
Heinrich IV. plante bereits 1610 militärisch in <strong>de</strong>n Jülich-Klevischen Erbfolgestreit ein<strong>zu</strong>greifen und <strong>de</strong>n Kampf gegen die habsburgischen Mächte wie<strong>de</strong>r auf<strong>zu</strong>nehmen. Die Aussichten<br />
da<strong>zu</strong> hatten sich entschei<strong>de</strong>nd verbessert, seit 1568 in <strong>de</strong>n mehrheitlich protestantischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n ein Aufstand gegen Spanien ausgebrochen war. Der darauf folgen<strong>de</strong> Achtzigjährige<br />
Krieg sollte Spanien entschei<strong>de</strong>nd schwächen und <strong>zu</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> führen. Diese sahen in Frankreich für lange Zeit einen natürlichen Verbün<strong>de</strong>ten. Der Ausbruch<br />
eines großen, allgemein-europäischen Krieges, <strong>de</strong>r durch ein französisches Engagement in Jülich-Kleve möglich gewesen wäre, wur<strong>de</strong> 1610 nur durch die Ermordung Heinrichs IV.<br />
verhin<strong>de</strong>rt.<br />
Dreißigjähriger Krieg und Vorherrschaft Frankreichs<br />
In <strong>de</strong>n 1618 ausbrechen<strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg griff Frankreich vorerst nicht direkt ein. Die Politik Kardinal Richelieus, <strong>de</strong>r für König Ludwig XIII. die Regierung führte, war es<br />
<strong>zu</strong>nächst, diejenigen Fürsten mit Subsidien <strong>zu</strong> unterstützen, die sich gegen die drohen<strong>de</strong> Ausweitung <strong>de</strong>r kaiserlichen Macht in Deutschland unter Ferdinand II. und Ferdinand III.
wandten. Dies waren insbeson<strong>de</strong>re die Fürsten <strong>de</strong>r Protestantischen Union und Schwe<strong>de</strong>n unter König Gustav II. Adolf. Erst nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei<br />
Nördlingen 1635 beteiligte sich Frankreich auch militärisch.<br />
Im 1648 geschlossenen Westfälischen Frie<strong>de</strong>n erreichte Frankreich nicht nur territoriale Zugeständnisse im Elsass, son<strong>de</strong>rn setzte auch weitere, strategisch wichtige Vorstellungen durch:<br />
Die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n formell vom Reich unabhängig, und die Reichsfürsten erhielten das Recht, Bündnisse mit frem<strong>de</strong>n Mächten – also auch mit Frankreich - <strong>zu</strong> schließen, so lange<br />
sich diese nicht gegen <strong>de</strong>n Kaiser richteten. Vor allem war es Frankreich gelungen, die österreichischen von <strong>de</strong>n spanischen Habsburgern <strong>zu</strong> trennen. Während es mit <strong>de</strong>n einen Frie<strong>de</strong>n<br />
schloss, führte es mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren weiter Krieg. Erst 1659 vereinbarte es mit Spanien <strong>de</strong>n Pyrenäenfrie<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r für Frankreich ebenso vorteilhaft war wie <strong>zu</strong>vor <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> von Münster. Er<br />
markierte das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r spanischen und <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>r französischen Vorherrschaft in Europa.<br />
Eindämmung <strong>de</strong>r französischen Hegemonie<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Kardinal Mazarins übernahm König Ludwig XIV. 1661 die alleinige Regierung Frankreichs. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren brach <strong>de</strong>r habsburgisch-französische Gegensatz<br />
erneut auf – nun jedoch unter <strong>de</strong>m umgekehrten Vorzeichen einer drohen<strong>de</strong>n französischen Hegemonie.<br />
Ludwigs aggressives Ausgreifen auf die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> im Holländischen Krieg sowie auf <strong>de</strong>n Westen Deutschlands im Zuge <strong>de</strong>r Reunionspolitik und <strong>de</strong>s Pfälzischen Erbfolgekriegs<br />
verän<strong>de</strong>rte die europäischen Bündnissysteme. Zunächst näherten sich die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> <strong>de</strong>m habsburgischen Kaiser in Wien an und schließlich auch England, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländische<br />
Generalstatthalter Wilhelm von Oranien infolge <strong>de</strong>r Glorious Revolution 1688 <strong>de</strong>n englischen Thron bestiegen hatte.<br />
Die sogenannte Große Allianz trat Frankreich 1701-1713/14 im Spanischen Erbfolgekrieg entgegen, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s letzten spanischen Habsburgers Karl II. ausgebrochen war.<br />
Trotz einer von <strong>de</strong>n europäischen Mächten im Frie<strong>de</strong>n von Rijswijk 1697 getroffenen Vereinbarung, hatten Ludwigs Diplomaten Karl II. da<strong>zu</strong> bewegt, Philipp von Bourbon, einen Enkel<br />
<strong>de</strong>s französischen Königs, als seinen Alleinerben ein<strong>zu</strong>setzen.<br />
Die Staaten <strong>de</strong>r Großen Allianz sahen in dieser Machtkonzentration <strong>de</strong>r Bourbonen eine erhebliche Störung <strong>de</strong>s europäischen Gleichgewichts. Sie traten daher für eine habsburgische<br />
Sekundogenitur in Spanien ein: Karl, <strong>de</strong>r zweitgeborene Sohn Kaiser Leopolds I. sollte <strong>de</strong>n Thron in Madrid besteigen. Der darüber ausbrechen<strong>de</strong> Krieg belastete Frankreich enorm, es<br />
konnte jedoch letztlich <strong>de</strong>n Angriffen <strong>de</strong>r Großen Allianz standhalten.<br />
Doch 1711, nach <strong>de</strong>m Tod Kaiser Josephs I., <strong>de</strong>m älteren Bru<strong>de</strong>r Karls, erbte dieser auch die übrigen habsburgischen Besit<strong>zu</strong>ngen. Damit drohte das Reich Karls V. wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> erstehen. Da<br />
dies für die bisherigen Verbün<strong>de</strong>ten Österreichs, England und die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, ebenso inakzeptabel war, wie eine französische Dominanz, drängten sie auf einen Ausgleich mit König<br />
Ludwig XIV. und <strong>de</strong>ssen Enkel Philipp.<br />
Der Frie<strong>de</strong> von Utrecht bestätigte Philipp V. zwar als König von Spanien, untersagte jedoch die Vereinigung <strong>de</strong>r französischen und <strong>de</strong>r spanischen Krone unter ein und <strong>de</strong>mselben<br />
Herrscher aus <strong>de</strong>m Hause Bourbon. Zum Ausgleich fielen die Spanischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> an Österreich. Gleichzeitig war es Frankreich gelungen die habsburgische Umklammerung für<br />
immer <strong>zu</strong> zerschlagen. Der Frie<strong>de</strong>n von Utrecht und <strong>de</strong>r Tod Ludwigs XIV. 1715 been<strong>de</strong>ten daher die aggressive Eroberungspolitik Frankreichs, es konnte seine Vorherrschaft in Europa<br />
bewahren, während das Haus Österreich <strong>zu</strong>r europäischen Großmacht aufgestiegen war.<br />
Die Umkehr <strong>de</strong>r Allianzen<br />
Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Utrecht hatte <strong>de</strong>r habsburgisch-französische Gegensatz im Grun<strong>de</strong> seine Substanz verloren. Außer <strong>de</strong>n Österreichischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n grenzte kein habsburgisches<br />
Territorium mehr an Frankreich. Die machtpolitischen Interessen bei<strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r überschnitten sich kaum noch, insbeson<strong>de</strong>re seit Österreich daran gegangen war, seine Machtbasis auf<br />
<strong>de</strong>m Balkan auf Kosten <strong>de</strong>s Osmanischen Reiches <strong>zu</strong> vergrößern.<br />
Dennoch blieben die traditionellen Bündnissysteme auch weiterhin bestehen. Sowohl im Polnischen Erbfolgekrieg als auch in <strong>de</strong>n Schlesischen Kriegen unterstützte Frankreich jeweils<br />
das anti-habsburgische Lager. Erst als Österreichs stärkster Gegenspieler im Reich, Friedrich II. von Preußen, 1756 die Konvention von Westminster, ein Bündnis mit Frankreichs Rivalen<br />
England, abschloss, kam es <strong>zu</strong>m sogenannten Renversement <strong>de</strong>s Alliances, <strong>de</strong>r Umkehr <strong>de</strong>r Allianzen. Auf Betreiben <strong>de</strong>s Staatskanzlers Kaunitz schloss Österreich ein<br />
Verteidigungsbündnis mit Frankreich, das sich während <strong>de</strong>s Siebenjährigen Krieges <strong>zu</strong> einer Offensivallianz entwickelte. Im Krieg gegen Preußen stan<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>r erstmals auf
<strong>de</strong>rselben Seite.<br />
Der habsburgisch-französische Gegensatz, <strong>de</strong>ssen erster Keim im Jahr 1477 durch eine Fürstenhochzeit gelegt wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> fast 300 Jahre später durch eine weitere Heirat<br />
symbolisch been<strong>de</strong>t, durch jene zwischen <strong>de</strong>m französischen Thronfolger und späteren König Ludwig XVI. und <strong>de</strong>r Tochter Kaiserin Maria Theresias, Marie Antoinette. Bei<strong>de</strong> sollten<br />
während <strong>de</strong>r Französischen Revolution ihr Leben verlieren, mit <strong>de</strong>r – unter gänzlich an<strong>de</strong>ren Vorzeichen - ein weiteres Kapitel <strong>de</strong>utsch-französischer Konflikte begann. In ihrem Verlauf<br />
sollten im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt nationalistische Kreise <strong>de</strong>n rein machtpolitisch und dynastisch motivierten habsburgisch-französischen Gegensatz als Ursprung <strong>de</strong>r sogenannten<br />
„Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und Frankreich <strong>de</strong>uten.<br />
Durch <strong>de</strong>n Wiener Kongress von 1815 wur<strong>de</strong> Frankreichs militärische Dominanz in Europa endgültig gebrochen, <strong>zu</strong>gunsten einer, sich seit <strong>de</strong>m Pariser Frie<strong>de</strong>n 1763 abzeichnen<strong>de</strong>n,<br />
Pentarchie.<br />
Literatur<br />
• Matthew S. An<strong>de</strong>rson: The origins of the mo<strong>de</strong>rn European state system 1494-1618, London, New York 1998<br />
• Francois Bondy u. Manfred Abelein: Deutschland und Frankreich. Geschichte einer wechselvollen Beziehung, München 1984 ISBN 3-430-11001-7<br />
• Heinz Durchhardt: Gleichgewicht <strong>de</strong>r Kräfte, Convenance, Europäisches Konzert, Frie<strong>de</strong>nskongresse und Frie<strong>de</strong>nsschlüsse vom Westfälischen Frie<strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong>m Wiener Kongress;<br />
(1976)<br />
• Eduard Fueter: Geschichte <strong>de</strong>s europäischen Staatensystems von 1492-1559, München 1919 (Neudruck 1972)<br />
• Esther-Beate Körber: Habsburgs europäische Herrschaft. Von Karl V. bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts, Darmstadt 2002<br />
• Ilja Mieck: Europäische Geschichte <strong>de</strong>r Frühen Neuzeit, Stuttgart 1998<br />
• Lothar Schilling: Kaunitz und das Renversement <strong>de</strong>s alliances. Studien <strong>zu</strong>r außenpolitischen Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz (Historische Forschungen, 50), Berlin 1994<br />
• Jörg Ulbert (Hrsg.): Formen internationaler Beziehungen in <strong>de</strong>r Frühen Neuzeit. Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem. Festschrift für Klaus Malettke<br />
<strong>zu</strong>m 65. Geburtstag (Historische Forschungen, 71), Berlin 2001<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Schleswig<br />
Schleswig, nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch: Sleswig, dänisch: Slesvig) ist eine Stadt im Nor<strong>de</strong>n Schleswig-Holsteins an <strong>de</strong>r Schlei. Sie ist Kreisstadt <strong>de</strong>s Kreises Schleswig-Flensburg. Der Stadtname<br />
kommt aus <strong>de</strong>m Altnordischen und be<strong>de</strong>utet Bucht <strong>de</strong>r Schlei o<strong>de</strong>r Hafen <strong>de</strong>r Schlei.[2]<br />
Geographie<br />
Die Stadt liegt am westlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Schlei, welche die Grenze <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Halbinseln Angeln und Schwansen bil<strong>de</strong>t, und damit am westlichen Rand <strong>de</strong>s Schleswig-Holsteinischen
Hügellan<strong>de</strong>s am Übergang <strong>zu</strong>r Geest. Das Stadtgebiet umfasst Höhenlagen von 0 bis 20 m ü. NN. In <strong>de</strong>r Stadt liegt <strong>de</strong>r Brautsee.<br />
Die nächsten größeren Städte sind Flensburg, Husum und Kiel. In unmittelbarer Nähe verläuft die Autobahn 7. In Schleswig en<strong>de</strong>n die Bun<strong>de</strong>sstraßen 76 und 77, im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt<br />
verläuft die B 201. Der Schleswiger Bahnhof ist Haltepunkt für IC- und ICE-Züge und liegt an <strong>de</strong>n Bahnstrecken Hamburg–Neumünster–Flensburg und Husum–Kiel.<br />
Momentan entsteht im Osten <strong>de</strong>r Stadt ein neuer Stadtteil an <strong>de</strong>r Stelle, wo sich die „Kaserne auf <strong>de</strong>r Freiheit“ befun<strong>de</strong>n hat. 2008 fand auf <strong>de</strong>n Königswiesen an <strong>de</strong>r Schlei die erste<br />
Lan<strong>de</strong>sgartenschau Schleswig-Holsteins statt. Das Gelän<strong>de</strong> wird als Stadtpark weitergenutzt.<br />
Klima<br />
Das Klima ist feuchtgemäßigt und ozeanisch geprägt. Die Temperatur beträgt im Jahresmittel 8° C, die Nie<strong>de</strong>rschlagsmenge 814 mm.<br />
Geschichte<br />
Mittelalter<br />
Schleswig wur<strong>de</strong> im Jahre 804 erstmals als Sliasthorp erwähnt und feierte im Jahr 2004 sein 1200-jähriges Jubiläum. Die Endung thorp verweist darauf, dass es sich um eine<br />
Nebensiedlung han<strong>de</strong>lt.<br />
Die Haithabu genannte Siedlung am Had<strong>de</strong>byer Noor wur<strong>de</strong> von König Gudfred (Göttrik) 808 <strong>zu</strong>m Han<strong>de</strong>lsplatz ausgebaut und 1066 von Slawen zerstört. Die Frage, ob die Keimzellen<br />
<strong>de</strong>r gegenüberliegen<strong>de</strong>n heutigen Stadt Schleswig erst nach <strong>de</strong>r Zerstörung von Haithabu gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r schon einige Jahre Bestand hatten, wird bislang in <strong>de</strong>r Forschung<br />
kontrovers diskutiert. Je<strong>de</strong>nfalls übernahm das mittelalterliche Schleswig das Erbe Haithabus als be<strong>de</strong>utendste Drehscheibe <strong>de</strong>s nor<strong>de</strong>uropäischen Han<strong>de</strong>ls mit <strong>de</strong>m schon seit <strong>de</strong>r<br />
Wikingerzeit bestehen<strong>de</strong>n Westhafen bei Hollingstedt.<br />
Gegen 900 erobern die schwedischen Wikinger unter ihrem König Olaf das Gebiet. 934 schlägt <strong>de</strong>r ostfränkische König Heinrich I. <strong>de</strong>r Vogler Olafs Sohn Knut I. und macht Haithabu<br />
tributpflichtig. Kaiser Otto I. grün<strong>de</strong>t 947 das Bistum Schleswig. Im Jahre 983 erobert <strong>de</strong>r dänische König Harald Blauzahn das Gebiet <strong>zu</strong>rück.<br />
Der Chronist Adam von Bremen berichtete schon im Jahr 1076 ausführlich über die Be<strong>de</strong>utung Haithabus und Schleswigs. So wur<strong>de</strong> unter Erzbischof Adalbert von Bremen in Schleswig<br />
eine Syno<strong>de</strong> abgehalten, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Vertreter aus ganz Nor<strong>de</strong>uropa eingela<strong>de</strong>n waren. Die ersten Bischöfe Schleswigs waren Harald (Haroldus), Poppo und Rodolphus.<br />
Für das Jahr 1134 wird von Saxo Grammaticus <strong>de</strong>r Dom erwähnt. Er berichtet, dass sich <strong>de</strong>r dänische König Niels vor <strong>de</strong>n Brü<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r St. Knudsgil<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Dom flüchten wollte, aber<br />
erschlagen wird, weil er 1131 <strong>de</strong>n Herzog Knud Lavard, <strong>de</strong>n Sohn seines älteren Bru<strong>de</strong>rs Erik Ejegod, töten ließ.<br />
Die Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r Bischöfe war eine Burg, die heute unter <strong>de</strong>m Schloss Gottorf liegt und <strong>zu</strong>erst im Jahre 1161 erwähnt wur<strong>de</strong>, als <strong>de</strong>r Schleswiger Bischof Occo nach <strong>de</strong>r Zerstörung<br />
seiner nordwestlich von Schleswig gelegenen Burg Alt-Gottorf seinen Sitz auf die Schlossinsel verlegte. Besitz <strong>de</strong>s Bischofs blieb die Burg bis <strong>zu</strong>m Jahre 1268, danach kam sie im Tausch<br />
für die Burg Schwabstedt an die Herzöge von Schleswig und ging 1340 an die in Holstein regieren<strong>de</strong>n Schauenburger Grafen über. Schleswig hatte inzwischen seine Rolle als<br />
überregionale Han<strong>de</strong>lsmetropole <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns an Lübeck abtreten müssen, war <strong>zu</strong> dieser Zeit aber noch immer ein Han<strong>de</strong>lsplatz von regionaler Be<strong>de</strong>utung, doch ging die regionale<br />
Vorrangstellung im Laufe <strong>de</strong>r Zeit auf Flensburg über.<br />
1486 erscheint das von <strong>de</strong>m Drucker Steffen Arn<strong>de</strong>s gesetzte Messbuch Missale Slesvicense für das Stift in Schleswig als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r nord<strong>de</strong>utscher Frühdruck.<br />
Neuzeit
alle <strong>de</strong>r zahlreichen Kirchen und Klöster <strong>de</strong>r Stadt. Teilweise wur<strong>de</strong>n sie „in überschäumen<strong>de</strong>m Glaubenseifer gewostet“, d. h. bis auf die Fundamente abgebrochen, was sich bei<br />
Ausgrabungen <strong>de</strong>r Maria-Magdalena-Kirche <strong>de</strong>s Dominikanerklosters sehr <strong>de</strong>utlich zeigte.<br />
Nach <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>steilung <strong>de</strong>r Herzogtümer Schleswig und Holstein 1544 wur<strong>de</strong> Schloss Gottorf Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r Herzöge<br />
von Schleswig-Holstein-Gottorf. Diese blieben <strong>de</strong>r dänischen Krone <strong>zu</strong>nächst eng verbun<strong>de</strong>n, im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
führten sie jedoch eine <strong>zu</strong>nehmend eigenständige Politik. Nach <strong>de</strong>m Großen Nordischen Krieg fielen die Gottorfer<br />
Anteile <strong>de</strong>s Herzogtums Schleswig wie<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n dänischen König (1721). Nach <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>r Resi<strong>de</strong>nzfunktion<br />
wur<strong>de</strong> das Schloss Sitz <strong>de</strong>s Obergerichts, <strong>de</strong>r Regierungs- und Justizbehör<strong>de</strong> für das gesamte Herzogtum. 1843<br />
wur<strong>de</strong>n Regierung und Gericht getrennt und die schleswigsche Stän<strong>de</strong>versammlung wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r eingerichtet. Als<br />
Tagungsraum diente <strong>de</strong>r Stän<strong>de</strong>saal <strong>de</strong>s Rathauses. Neben <strong>de</strong>r Funktion als Behör<strong>de</strong>nsitz war Schleswig in erster<br />
Linie eine Ackerbürgerstadt. 1711 wur<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n Vorstädte Lollfuß und Friedrichsberg eingemein<strong>de</strong>t.<br />
Ab 1840 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-dänische Konflikt das beherrschen<strong>de</strong> Thema in <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>ren Bürger sich<br />
überwiegend auf die Seite <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Schleswig-Holsteiner stellten. 1848 brach <strong>de</strong>r Bürgerkrieg aus, in <strong>de</strong>m es<br />
am 23. April 1848 <strong>zu</strong>r Schlacht bei Schleswig kam. Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kampfhandlungen 1850 wur<strong>de</strong>n die<br />
Behör<strong>de</strong>n innerhalb <strong>de</strong>r dänischen Monarchie neu geordnet. Schleswig verlor sämtliche herzoglichen Behör<strong>de</strong>n.<br />
Nach <strong>de</strong>m Deutsch-Dänischen Krieg 1864 wur<strong>de</strong>n die Herzogtümer Schleswig und Holstein <strong>zu</strong>nächst gemeinsam<br />
von Preußen und Österreich als Kondominium verwaltet. Nach <strong>de</strong>r Gasteiner Konvention 1865 gerieten Stadt und<br />
Herzogtum Schleswig unter preußische Verwaltung, bevor sie nach <strong>de</strong>m Deutschen Krieg 1866 von Preußen<br />
annektiert wur<strong>de</strong>n. Die Stadt Schleswig löste von 1879 bis 1917 Kiel als Sitz <strong>de</strong>s Oberpräsi<strong>de</strong>nten und Hauptstadt<br />
<strong>de</strong>r Provinz Schleswig-Holstein ab. Mit <strong>de</strong>r 1946 von <strong>de</strong>r britischen Militärregierung betriebenen Umwandlung Schleswig-Holsteins von einer preußischen Provinz <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>utschen<br />
Bun<strong>de</strong>sland wur<strong>de</strong> Kiel Lan<strong>de</strong>shauptstadt. Als Ausgleich für <strong>de</strong>n Verlust <strong>de</strong>r politischen und administrativen Funktionen wur<strong>de</strong> Schleswig nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg Sitz <strong>de</strong>s<br />
Oberlan<strong>de</strong>sgerichts, <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sarchivs, <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>smuseums für Kunst und Kulturgeschichte und <strong>de</strong>s Archäologischen Lan<strong>de</strong>smuseums. Schleswig ist heute kulturelles Zentrum <strong>de</strong>s<br />
Lan<strong>de</strong>steils Schleswig.<br />
Wappen<br />
Blasonierung: „In Blau über blauen und silbernen Wellen auf torloser gol<strong>de</strong>ner Zinnenmauer ein gol<strong>de</strong>ner Zinnenturm, <strong>de</strong>n eine <strong>zu</strong>gewen<strong>de</strong>te gol<strong>de</strong>ne Mondsichel und ein sechsstrahliger<br />
gol<strong>de</strong>ner Stern begleiten.“[3]<br />
Flagge<br />
Blasonierung: „Die Stadtflagge ist blau-gelb.“[4]<br />
Die Farben blau-gelb entsprechen <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>s Herzogtums Schleswig (siehe auch: Schleswigsche Löwen).<br />
Die Schleswiger Flagge ist nicht in <strong>de</strong>r Kommunalen Wappenrolle Schleswig-Holstein eingetragen.<br />
Religionen<br />
Die überwiegen<strong>de</strong> Mehrheit <strong>de</strong>r Schleswiger ist evangelisch-lutherisch. Daneben fin<strong>de</strong>n sich Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r katholischen Kirche, <strong>de</strong>r evangelisch-lutherischen dänischen Kirche, Jehovas<br />
Zeugen und freie Gemein<strong>de</strong>n.<br />
Kirchen
• Dom (ev.)<br />
• Dreifaltigkeitskirche (ev.)<br />
• Michaeliskirche (ev.)<br />
• Pauluskirche (ev.)<br />
• Auferstehungskirche (ev.)<br />
• Evangelisch freikirchliche Gemein<strong>de</strong> (Baptisten)<br />
• Ansgarkirche (kath.)<br />
• Ansgarkirke (ev. dänisch)<br />
• Neuapostolische Kirche<br />
• Immanuel-Gemein<strong>de</strong> (ev. freikirchl.)<br />
• Charismatische Gemeinschaftskirche (ev. Freikirche)<br />
• Kapelle <strong>de</strong>r Baptisten in Schleswig<br />
• Lan<strong>de</strong>skirchliche Gemeinschaft (ev.)<br />
Klöster<br />
• St. Michaelis auf <strong>de</strong>m Berge (vor 1140–1192), Benediktiner-Doppelkloster<br />
• St.-Johannis-Kloster vor Schleswig (1194), Benediktinerinnenkloster, seit 1536 Frauenstift<br />
• Graukloster (1234–1517, eigentlich Kloster St. Paul), Franziskanerkloster<br />
• St. Maria Magdalena (1235–1528/29), Dominikanerkloster<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Der Schleswiger Dom St. Petri beherrscht das Bild <strong>de</strong>r Stadt schon von weitem. Sein Turm ist jedoch erst 100 Jahre alt. Er steht in <strong>de</strong>r Altstadt, die ihr altertümliches Bild weitgehend<br />
bewahren konnte. Ihr Zentrum ist <strong>de</strong>r Rathausmarkt mit <strong>de</strong>m Rathaus und seinem alten Stän<strong>de</strong>saal. Das Rathaus entstand 1794 im klassizistischen Stil durch Umbau <strong>de</strong>s alten<br />
Grauklosters, <strong>de</strong>ssen mittelalterliche Reste noch <strong>de</strong>utlich an <strong>de</strong>r Rückseite <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s erkennbar sind. Es wur<strong>de</strong> im Mai 2005 bei einem Brand beschädigt. Vom Rathausmarkt führt die<br />
Lange Straße <strong>zu</strong>m Gallberg und darüber hinaus <strong>zu</strong>m Kornmarkt, wo die Einkaufsstraße Schleswigs beginnt. Dieser erstreckt sich am Nordufer <strong>de</strong>r Schlei und geht in <strong>de</strong>n Stadtteil Lollfuß<br />
über, wo neben vielen Kleinbürgerhäusern vor allem das heutige Amtsgericht und das so genannte Präsi<strong>de</strong>ntenkloster sehenswert sind.<br />
Im Osten <strong>de</strong>r Altstadt liegt die Fischersiedlung Holm mit einem geschlossen erhaltenen Bestand alter Fischerhäuser. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sü<strong>de</strong>rholmstraße befin<strong>de</strong>t sich das alte St.-Johannis-<br />
Kloster vor Schleswig mit einem Bibelmuseum.<br />
Etwas außerhalb liegt Schloss Gottorf, heute Sitz <strong>de</strong>r Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan<strong>de</strong>smuseen. Das Schlossgebäu<strong>de</strong> selbst kann auf eine über 800-jährige Baugeschichte<br />
<strong>zu</strong>rückblicken. Nördlich <strong>de</strong>s Schlosses schließt sich <strong>de</strong>r barocke Neuwerkgarten an, <strong>de</strong>r seit 2004 restituiert wird. Darin liegt das 2005 errichtete Globushaus mit einem Nachbau <strong>de</strong>s<br />
Gottorfer Riesenglobus. Nordöstlich <strong>de</strong>s Gartens liegt das Volkskun<strong>de</strong> Museum Schleswig.<br />
Gegenüber <strong>de</strong>m Schloss befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r zwischen 1876 und 1878 erbaute Sitz <strong>de</strong>r früheren preußischen Provinzialregierung. Im Volksmund Roter Elefant genannt, bil<strong>de</strong>t es auch optisch
ein Pendant <strong>zu</strong>m Schloss. Hier entwarf <strong>de</strong>r erste preußische Regierungspräsi<strong>de</strong>nt im Auftrag <strong>de</strong>s Reichskanzlers Otto von Bismarck die Reichsversicherungsordnung. Heute ist es Sitz <strong>de</strong>s<br />
Oberlan<strong>de</strong>sgerichtes, früher war auch das Oberversicherungsamt dort untergebracht.<br />
Ebenfalls südlich <strong>de</strong>s Schlosses beginnt <strong>de</strong>r Stadtteil Friedrichsberg mit <strong>de</strong>m 85 Meter hohen Wikingturm von 1973, von <strong>de</strong>m man eine herrliche Aussicht über die Stadt hat. Weitere<br />
Sehenswertigkeiten sind das Stadtmuseum im Gün<strong>de</strong>rothschen Hof, das Prinzenpalais (heute Sitz <strong>de</strong>s schleswig-holsteinischen Lan<strong>de</strong>sarchivs), die Friedrichsberger Dreifaltigkeitskirche<br />
und einige Seitenstraßen <strong>de</strong>s Stadtteils.<br />
Am Südufer <strong>de</strong>r Schlei sind die Wallanlagen <strong>de</strong>r alten Wikingerstadt Haithabu <strong>zu</strong> erkennen. Dort liegt auch das Wikinger-Museum.<br />
Parks<br />
Im Jahre 2008 wur<strong>de</strong>n die Königswiesen als Zentralfläche für die erste Lan<strong>de</strong>sgartenschau Schleswig-Holsteins mo<strong>de</strong>rnisiert. Die ca. 16 ha großen Königswiesen, die sich direkt am<br />
Nordufer <strong>de</strong>r Schlei befin<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Bevölkerung weiterhin als Stadtpark genutzt.<br />
Museen<br />
Die Stadt Schleswig ist Standort einer Reihe von Museen. Unter an<strong>de</strong>rem hat die Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan<strong>de</strong>smuseen Schloss Gottorf ihren Sitz in Schleswig. Im Schloss<br />
sind das Lan<strong>de</strong>smuseum für Kunst und Kulturgeschichte und das Archäologisches Lan<strong>de</strong>smuseum untergebracht. Auf <strong>de</strong>m Hesterberg liegt das Volkskun<strong>de</strong> Museum Schleswig, das<br />
Stadtmuseum befin<strong>de</strong>t im Gün<strong>de</strong>rothschen Hof, das Museum für Outsi<strong>de</strong>rkunst im Präsi<strong>de</strong>ntenkloster. In <strong>de</strong>r Fischersiedlung Holm gibt es ein Holm-Museum. Vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt<br />
befin<strong>de</strong>n sich das Wikinger-Museum Haithabu in Busdorf (Ortsteil Had<strong>de</strong>by) und das von <strong>de</strong>r dänischen Min<strong>de</strong>rheit getragene Danewerkmuseum (Danevirkegår<strong>de</strong>n) in Groß Dannewerk.<br />
Beson<strong>de</strong>rs für Familien mit Kin<strong>de</strong>rn ist das Teddy-Bär-Haus auf <strong>de</strong>m Areal <strong>de</strong>s Stadtmuseums in <strong>de</strong>r Schleswiger Friedrichstraße (OT Friedrichsberg) <strong>zu</strong> empfehlen. Im<br />
Präsi<strong>de</strong>ntenkloster am Stadtweg befin<strong>de</strong>n sich <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Ost<strong>de</strong>utschen Heimatstuben, in <strong>de</strong>nen die Vertriebenenverbän<strong>de</strong> an die ehemaligen <strong>de</strong>utschen Ostgebiete erinnern.<br />
Theater<br />
Das Schleswig-Holsteinische Lan<strong>de</strong>stheater und Sinfonieorchester ist die größte Lan<strong>de</strong>sbühne Deutschlands. Es geht regelmäßig auf Tournee durch das westliche Schleswig-Holstein.<br />
Büchereien<br />
In Schleswig existieren eine <strong>de</strong>utsche Stadtbibliothek und eine dänische Bücherei.<br />
Kunst<br />
Von Mai bis Oktober 2008 wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Bucht <strong>de</strong>r Schlei eine Kunstinstallation, Spiegel unserer Zeit in <strong>de</strong>r Galerie auf <strong>de</strong>r Schlei gezeigt. Sie wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Stadt Schleswig und <strong>de</strong>m<br />
Kunst- und Kulturteam Erfun<strong>de</strong>nes Land organisiert. Neun Künstler setzten sich hierbei mit <strong>de</strong>n Themen <strong>de</strong>s Wassers und <strong>de</strong>r Klimaverän<strong>de</strong>rung in Gedichtform und Objektkunst<br />
auseinan<strong>de</strong>r.<br />
Sprachen<br />
In Schleswig wer<strong>de</strong>n Hoch<strong>de</strong>utsch, Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch (als Schleswigsch, Angeliter Platt) und Dänisch (vorwiegend als Sydslesvigdansk) gesprochen, bis Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts auch<br />
Søn<strong>de</strong>rjysk („Plattdänisch“).<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Die Stadt Schleswig verfügt kaum über nennenswerte Industriebetriebe. Im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt befin<strong>de</strong>t sich ein größeres Gewerbegebiet. Der Frem<strong>de</strong>nverkehr hat einige Be<strong>de</strong>utung, und es
gibt etwas Küstenfischerei. Zahlreiche Rechtsanwälte haben sich an <strong>de</strong>m Gerichtssitz nie<strong>de</strong>rgelassen. Schleswig ist Sitz <strong>de</strong>r VR Bank Flensburg-Schleswig.<br />
Verkehr<br />
Schleswig liegt an <strong>de</strong>r Autobahn 7. Anschluss in die Stadt besteht über die Anschlussstellen Schleswig/Schuby Nr. 5 sowie Schleswig/Jagel Nr. 6.<br />
Der Bahnhof Schleswig liegt an <strong>de</strong>r Bahnstrecke Neumünster–Flensburg. Nach <strong>de</strong>r Annexion <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Schleswig durch Preußen 1867 wur<strong>de</strong> diese Bahnstrecke durch<br />
Umstrukturierung <strong>de</strong>s übernommenen Bahnnetzes erbaut und Schleswig erhielt seinen Bahnhof an <strong>de</strong>r neuen Staatsbahnstrecke. Die Bahnstrecke wur<strong>de</strong> jetzt umgebaut, sodass die<br />
Distanz zwischen Schleswig-Flensburg-Husum <strong>de</strong>utlich verkürzt wur<strong>de</strong>. In Zukunft ist geplant die Strecke nach Hamburg über Kiel um<strong>zu</strong>bauen, als gewöhnlich über Neumünster.<br />
Des Weiteren stellte die Schleswiger Kreisbahn bis <strong>zu</strong> ihrer Einstellung die Verbindung mit Friedrichsstadt im Südwesten sowie Kappeln und Satrup im Nordosten her. Als weitere<br />
Verbindung von <strong>de</strong>r Altstadt <strong>zu</strong>m Bahnhof Schleswig diente von 1890 bis 1936 eine Straßenbahn, die ab 1910 elektrisch angetrieben wur<strong>de</strong>.<br />
Medien<br />
Regionale Tageszeitung Schleswigs sind unter an<strong>de</strong>rem die Schleswiger Nachrichten. Die dänischsprachige Tageszeitung Flensborg Avis hat ebenfalls eine lokale Redaktion in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Beson<strong>de</strong>re Be<strong>de</strong>utung haben <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Kieler Nachrichten. Im nahen Flensburg betreibt <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utsche Rundfunk ein Fernseh- und Hörfunkstudio, in <strong>de</strong>m Beiträge aus <strong>de</strong>r Region<br />
produziert wer<strong>de</strong>n. Die in Schleswig am meisten gehörten Radioprogramme sind Radio Schleswig-Holstein (RSH) sowie die NDR 1 Welle Nord <strong>de</strong>s NDR. Die Angehörigen <strong>de</strong>r<br />
dänischen Min<strong>de</strong>rheit nutzen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die hier <strong>zu</strong> empfangenen dänischen Fernsehsen<strong>de</strong>r DR I und TV Syd.<br />
Partnerstädte<br />
• London Borough of Hillingdon (Vereinigtes Königreich), seit 1958<br />
• Mantes-la-Jolie (Frankreich), seit 1958<br />
• Vejle (Dänemark), seit 1977<br />
• Waren (Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern), seit 1990<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Gerichte<br />
In Schleswig befin<strong>de</strong>n sich außer <strong>de</strong>m Amtsgericht, mit <strong>de</strong>m für Schleswig-Holstein <strong>zu</strong>ständigen zentralen Mahngericht, auch das Oberlan<strong>de</strong>sgericht, das Lan<strong>de</strong>ssozialgericht, das<br />
Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Schleswig Holstein, sowie das Sozialgericht Schleswig. Seit 1. Mai 2008 ist die Stadt <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>s neu eingerichteten Schleswig-<br />
Holsteinischen Lan<strong>de</strong>sverfassungsgerichts.<br />
Schulen<br />
• Grundschulen<br />
• Bugenhagenschule (Friedrichstraße 103)<br />
• Schule Nord (Schützenred<strong>de</strong>r 16)<br />
• St.-Jürgen-Schule (Erlenweg 2)<br />
• Wilhelminenschule (Lutherstraße 11)<br />
• Hauptschulen
• Gallbergschule (Gallberg 47)<br />
• Bugenhagenschule (Friedrichstraße 103)<br />
• Schule Nord (Schützenred<strong>de</strong>r 16)<br />
• Gemeinschaftsschulen<br />
• Dannewerkschule (Erikstraße 50)<br />
• Realschulen<br />
• Bruno-Lorenzen-Schule (Spielkoppel 6)<br />
• Gymnasien<br />
• Domschule (Königsstraße 17a)<br />
• Berufliches Gymnasium <strong>de</strong>s Kreises Schleswig-Flensburg / [inoffiziell] Gymnasium am Fürstengarten (Flensburger Straße 19b)<br />
• Lornsenschule (Michaelisallee 1)<br />
• Dänische Schulen<br />
• Gottorp Skolen (Grund- und Hauptschule, Erdbeerenberg 32)<br />
• Hiort Lorenzen-Skolen (Grund- und Realschule, Königsberger Straße 3)<br />
• A. P. Møller-Skolen (Dänisches Gymnasium, ab 2008, Auf <strong>de</strong>r Freiheit)<br />
• För<strong>de</strong>rschulen<br />
• Pestalozzischule (Lutherstraße 9)<br />
• Peter-Härtling-Schule (Holzred<strong>de</strong>r 12)<br />
• Schule Hesterberg (Friedrich-Ebert-Straße 5)<br />
• Lan<strong>de</strong>sför<strong>de</strong>rzentrum Hören, Georg Wilhelm Pfingsten Schule (Lutherstraße 14)<br />
• Lan<strong>de</strong>sför<strong>de</strong>rzentrum Sehen, (Lutherstraße 14)<br />
• Berufsschulen<br />
• Berufsbildungszentrum Schleswig (kurz BBZ, Flensburger Straße 19b)<br />
• Schulzentrum für Gesundheitsberufe Schleswig (Am Damm 1)<br />
• Sonstige Schulen<br />
• Erzieherfachschule<br />
• Landwirtschaftsschule<br />
• Kreismusikschule Schleswig-Flensburg<br />
Die nächsten Universitäten befin<strong>de</strong>n sich in Kiel und Flensburg.<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Ansverus, Benediktinermönch und Heiliger
• Wal<strong>de</strong>mar Augustiny, Schriftsteller<br />
• Friedrich Georg Wieck, Schriftsteller und Industrieller<br />
• Bernhard Wieck (1845–1913), Ingenieur, Direktor <strong>de</strong>r Berliner Grundrentengesellschaft, erster Amts- und Gemein<strong>de</strong>vorsteher von Grunewald<br />
• Herman Wilhelm Bissen, dänischer Bildhauer <strong>de</strong>s Klassizismus, Thorvaldsen-Schüler<br />
• Karl Nikolai Jensen Börgen, <strong>de</strong>utscher Astronom<br />
• Ulrich von Brockdorff-Rantzau, erster Außenminister <strong>de</strong>r Weimarer Republik<br />
• Johann von Bruyn, dänischer Major, Oberlandinspektor (Landreformer)<br />
• Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Fußballprofi<br />
• Asmus Jakob Carstens, Maler <strong>de</strong>s Klassizismus<br />
• Johannes Christiansen (1809–1854), Rechtsgelehrter<br />
• Hans-Otto <strong>de</strong> Boor, Rechtswissenschaftler<br />
• Fritz Engelke (eigentlich Friedrich Engelke), lutherischer Theologe und 1934/35 „Vikar <strong>de</strong>r Deutschen Evangelischen Kirche“<br />
• Friedrich von Eyben, Jurist, Diplomat und Kanzler <strong>de</strong>r königlich dänisch-holsteinischen Regierung in Glückstadt<br />
• Anton Franzen, braunschweigischer Lan<strong>de</strong>sminister<br />
• Manfred Hansen (1928–1987), Staatsanwalt und Politiker (SPD)<br />
• Ludvig Harboe (1709–1783), evangelisch-lutherischer Bischof in Island, Norwegen und Dänemark<br />
• Hermann Heiberg, <strong>de</strong>utscher Schriftsteller<br />
• Victor Hensen, Meeresbiologe<br />
• Jobst Hirscht, <strong>de</strong>utscher Leichtathlet<br />
• Klaus Jepsen, <strong>de</strong>utscher Schauspieler und Synchronsprecher<br />
• Heinz Kruse, <strong>de</strong>utscher Opernsänger<br />
• Hans Kuds<strong>zu</strong>s, <strong>de</strong>utscher Aphoristiker<br />
• Claudia von Lanken, <strong>de</strong>utsche Fußballtrainerin<br />
• Volker Lemke (* 1942), Jurist und Politiker (CDU)<br />
• Carl von Lorck, Jurist und Kunsthistoriker<br />
• Heinrich Marquardsen, Rechtswissenschaftler und Politiker<br />
• Heinz Marten, <strong>de</strong>utscher Oratorien-Tenor und Lie<strong>de</strong>rsänger<br />
• Heinrich Philippsen, schleswig-holsteinischer Heimatforscher<br />
• Hermann-Bernhard Ramcke, Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg, wegen Kriegsverbrechen in Frankreich verurteilt<br />
• Christian Redl, Filmschauspieler<br />
• Friedrich Graf von Reventlou, schleswig-holsteinischer Politiker<br />
• Bernhard Rogge, <strong>de</strong>utscher Admiral<br />
• Ralf Rothmann, <strong>de</strong>utscher Schriftsteller
• Edward Selig Salomon, Briga<strong>de</strong>general im Amerikanischen Bürgerkrieg (Sezessionskrieg), Gouverneur <strong>de</strong>s Territoriums Washington (1870–1872)<br />
• Erasmus Sartorius, <strong>de</strong>utscher Komponist, Organist, Musikschriftsteller und Poet<br />
• Hans von Seeckt, Militär<br />
• Hans-Hermann Tiedje, <strong>de</strong>utscher Journalist<br />
• Sibylle Weischenberg, Journalistin und Medien-Expertin<br />
• Jannpeter Zopfs, Richter am <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>sgerichtshof<br />
In Schleswig aufgewachsen, aber in an<strong>de</strong>ren Orten geboren sind<br />
• Jürgen Drews, <strong>de</strong>utscher Schlagersänger<br />
• Kay Nehm, <strong>de</strong>utscher Jurist, ehemaliger Generalbun<strong>de</strong>sanwalt<br />
• Heinrich Schafmeister, <strong>de</strong>utscher Sänger und Schauspieler<br />
• François Smesny, <strong>de</strong>utsch-französischer Schauspieler<br />
• Lone Fischer, <strong>de</strong>utsche Handballerin<br />
• Mit Schleswig verbun<strong>de</strong>n sind<br />
• Carl Gottlieb Bellmann, Organist und Komponist <strong>de</strong>s Schleswig-Holstein-Lieds<br />
• Matthäus Friedrich Chemnitz, Jurist und Texter <strong>de</strong>s Schleswig-Holstein-Lieds<br />
• Friedrich Karl Gotsch, Maler und Grafiker, Friedrich Karl Gotsch-Stiftung, Schloss Gottorf<br />
• Adam Olearius, <strong>de</strong>utscher Schriftsteller, Diplomat und Forschungsreisen<strong>de</strong>r<br />
• Friedrich Ernst Peters (1890–1962), <strong>de</strong>utscher Schriftsteller und Direktor <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sgehörlosenschule in Schleswig (1946–1955)<br />
Sonstiges<br />
Am 8. Januar 2004 gab die Deutsche Post anlässlich <strong>de</strong>s 1200jährigen Bestehens von Schleswig eine Son<strong>de</strong>rmarke mit <strong>de</strong>m Nennwert 55 Cent heraus. Sie zeigt Motive aus <strong>de</strong>r Geschichte<br />
sowie be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Bauwerke <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Literatur<br />
• Heinrich Philippsen: Kurzgefasste Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Schleswig und <strong>de</strong>r Schleswiger Knudsgil<strong>de</strong>, Schleswig 1926<br />
• Joachim Skierka: Schleswig in <strong>de</strong>r Statthalterzeit 1711–1836<br />
• Theo Christiansen: Schleswig 1836–1945<br />
• Theo Christiansen: Schleswig und die Schleswiger 1945–1962<br />
• Theo Christiansen: Schleswig 1945–1968, Fotodokumentation<br />
• Torsten Schulze: Schleswig – wie es war, Droste-Verlag Düsseldorf, 1996<br />
• Reimer Pohl: Straßen in Schleswig<br />
• Volker Vogel: Schleswig im Mittelalter, Archäologie einer Stadt
• Oliver Bruhns: Schleswiger Stadtgeschichten. In: Reimer Witt / Oliver Bruhns: 1200 Jahre Schleswig, hrsg. vom Lions-Club Schleswig, 2006<br />
Quellen<br />
1. ↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. März 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemein<strong>de</strong>n und Städten (PDF-Datei; 500 kB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ Bzw. „Schlei-Bucht o<strong>de</strong>r Schlei-Hafen“. Vgl.: Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte: Praehistorische Zeitschrift. <strong>de</strong> Gruyter, Berlin 1930, S.<br />
259.<br />
3. ↑ Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein<br />
4. ↑ Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadt Schleswig<br />
5. Unterlagen <strong>de</strong>r Stadtverwaltung Schleswig, Hauptamt<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.